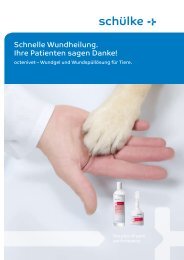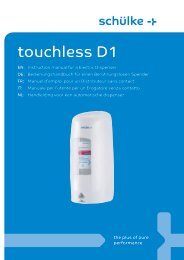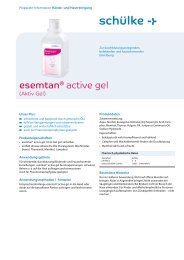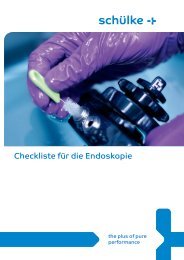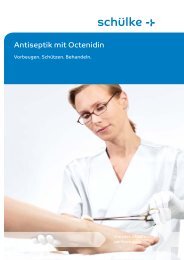octenisept® Wundkompendium - Schülke & Mayr
octenisept® Wundkompendium - Schülke & Mayr
octenisept® Wundkompendium - Schülke & Mayr
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
octenisept ® <strong>Wundkompendium</strong><br />
octenisept ® in der antiseptischen Wundbehandlung<br />
Anke Bültemann, Veronika Gerber, Kerstin Protz
p 2
Inhalt<br />
1 <strong>Wundkompendium</strong><br />
Definition und Unterteilung der einzelnen Wundzustände _____________________________ 4<br />
Indikation einer antiseptischen Wundbehandlung ___________________________________ 4<br />
Hygienisches Vorgehen beim Verbandwechsel einer chronischen Wunde im ambulanten Bereich ___ 5<br />
Hygienisches Vorgehen beim Verbandwechsel einer chronischen Wunde im stationären Bereich ___ 6<br />
Anforderungen an Wundantiseptika ____________________________________________ 8<br />
Applikation von octenisept ® __________________________________________________ 8<br />
Indikation einer antiseptischen Behandlung oberflächlicher Wunden ___________________ 9<br />
Applikation von octenisept ® bei oberflächlichen Wunden ___________________________ 10<br />
Vorgehensweise 1: <strong>octenisept®</strong>-getränkte Kompressen _ __________________________________ 10<br />
Vorgehensweise 2: <strong>octenisept®</strong> aufsprühen oder übergießen _______________________________ 11<br />
Vorgehensweise 3: Umschläge mit <strong>octenisept®</strong> _______________________________________ 12<br />
Vorgehensweise 4: Eiswürfel aus <strong>octenisept®</strong> ________________________________________ 12<br />
Fallbeispiele für octenisept ® -Anwendungen bei oberflächlichen Wunden _________________ 13<br />
1. Erysipel bei Elephanthiasis _________________________________________________ 13<br />
2. Infiziertes Ulcus cruris ____________________________________________________ 14<br />
Indikation einer antiseptischen Behandlung tiefer Wunden __________________________ 15<br />
Applikation von octenisept ® bei tiefen Wunden __________________________________ 16<br />
Antiseptische Behandlung und Einlage ____________________________________________ 16<br />
2 Ergänzende Informationen<br />
Verträglichkeit von octenisept ® mit modernen Wundauflagen ___________________________ 17<br />
FAQ’s _________________________________________________________________ 18<br />
3 Weitere klinische Erfahrungen ______________________________________________ 22<br />
4 CD zum octenisept ® <strong>Wundkompendium</strong> – Der Verbandwechsel _____________________ 28<br />
Literatur ______________________________________________________________ 34<br />
p 3
1 <strong>Wundkompendium</strong><br />
Definition und Unterteilung der einzelnen<br />
| 1 |<br />
Wundzustände<br />
Aseptische Wunden<br />
sind frei von Entzündungszeichen und entstehen durch<br />
Operationen oder Verletzungen. Die Wundränder sind glatt<br />
durchtrennt und liegen dicht beieinander. Sie werden durch<br />
Nähte, Klammern, Kleber oder sog. Steristrips (spezielle<br />
Pflasterstreifen) verschlossen und heilen primär ab.<br />
Kontaminierte Wunden<br />
weisen ebenfalls keinerlei Entzündungszeichen auf, allerdings<br />
liegt bereits eine Besiedlung von sich nicht vermehrenden<br />
Bakterien vor. Solche Wunden werden offen<br />
behandelt und heilen sekundär. Beispiele für kontaminierte<br />
Wunden können Verbrennungen, chronische Wunden<br />
wie Dekubitus, Ulcus cruris venosum, und das Diabetische<br />
Fußulcus, aber auch Drainageaustrittstellen oder bewusst<br />
offen gehaltene Wunden, etwa bei Tracheostoma oder dem<br />
Anus praeter, sein.<br />
Indikation einer antiseptischen Wundbehandlung<br />
p 4<br />
Indikation Erkennungsmerkmale<br />
Wundinfektion<br />
(siehe Beispiel auf Seite 9)<br />
Gefahr einer Wundinfektion durch<br />
(siehe Beispiel auf Seite 9)<br />
Kolonisierte und kritisch kolonisierte Wunden<br />
werden ebenfalls offen behandelt. In Erstgenannten finden<br />
sich bereits vermehrungsfähige Bakterien, die die Wundheilung<br />
jedoch nicht nachhaltig beeinflussen. Letztere sind<br />
aber schon infektionsgefährdet, da die Gefahr besteht, dass<br />
die Keimbesiedelung auf den Körper (Wirt) übergeht.<br />
Auf dieses Übergangsstadium folgt die<br />
infizierte Wunde<br />
Diese ist an den signifikanten Entzündungszeichen Rötung,<br />
Schwellung, Überwärmung, Schmerzen und Funktionseinschränkung<br />
zu erkennen. Weitere typische Symptome sind<br />
große Exsudatmengen, eine unangenehme Geruchsentwicklung,<br />
eitrige Sekrete und bei Gewebeuntersuchungen<br />
hohe Keimzahlen über 106 koloniebildender Einheiten (KBE)<br />
pro Gramm Gewebe.<br />
Die Keimbesiedelung ist auf den Körper übergegangen, der<br />
Wirt reagiert.<br />
• Kardinalsymptome der infizierten Wunde: Rötung, Schwellung, Überwärmung,<br />
Schmerz und Funktionseinschränkung<br />
• Häufig erhöhte Exsudatmengen, Eiter und unangenehme Gerüche<br />
• Vorliegender mikrobiologischer Keimnachweis<br />
• Bei Gewebeuntersuchungen sehr hohe Keimzahlen:<br />
> 106 koloniebildende Einheiten [KBE] pro Gramm Gewebe<br />
• Nekrosen und Fibrinbeläge auf der Wundoberfläche<br />
• Nicht Beachtung von hygienischen Grundsätzlichkeiten: z. B. unsteriles Arbeiten und dadurch<br />
Gefahr der Keimverschleppung, kein Tragen von Schutzkleidung (Einmalhandschuhe und -schürze)<br />
und Vernachlässigung der Händedesinfektion, mehrmalige Verwendung von Einmalmaterialien<br />
• Lokalisation der Wunde: z. B. Diabetisches Fußsyndrom, Dekubitus in der Sakralregion, Bauchwunde<br />
in direkter Nähe zu Stomaanlagen<br />
• Schwierige hygienische Verhältnisse: z. B. Manipulation am Verband durch den Patienten, Haustiere<br />
in der häuslichen Versorgung und mangelnde Körperhygiene
1 <strong>Wundkompendium</strong><br />
Nach Diagnostik und Therapie der wundauslösenden<br />
Ursachen, beschleunigen lokale Maßnahmen der symptomatischen<br />
Therapie, wie z. B. eine individuell angepasste<br />
Wundversorgung und eine ggf. notwendige lokale Antiseptik,<br />
den Heilungsprozess.<br />
Die optimale Wundversorgung wird phasengerecht auf die<br />
Abläufe und Zustände innerhalb der Wunde und am vorliegenden<br />
Befund orientiert, sowie auf den Fortschritt der<br />
Abheilung reagierend, zeitnah angepasst. Eine einleitende<br />
Wundreinigung zu Beginn der Therapie, befreit die Wunde<br />
Hygienisches Vorgehen beim Verbandwechsel einer<br />
| 2 |<br />
chronischen Wunde im ambulanten Bereich<br />
Ziele des Verbandwechsels:<br />
• Wundkontrolle<br />
• Wundbeurteilung und Therapieanpassung<br />
• Verhinderung der Einschleppung von Keimen<br />
und Bakterien<br />
• Bekämpfung einer bereits bestehenden<br />
oder beginnenden Infektion<br />
Grundsätzliches:<br />
• Jede Wunde ist aseptisch zu behandeln, da Keimbesiedelung<br />
eine Wundheilung behindert und in<br />
einigen Fällen unmöglich macht.<br />
Vorbereitung des Verbandwechsels einer<br />
chronischen Wunde:<br />
Festlegen der Reihenfolge: von rein zu unrein,<br />
Tourenplanung entsprechend festlegen<br />
1. Aseptische Wunden<br />
2. Kontaminierte Wunden<br />
3. Kolonisierte Wunden<br />
4. Infizierte Wunden<br />
5. Infizierte Wunden mit MRSA/ORSA oder VRE<br />
(Vancomycin resistente Enterokokken)<br />
von Nekrosen und Fibrinbelägen, Fremdkörpern, Abfallstoffen<br />
und überschüssigem Wundexsudat. Unter den genannten<br />
Störfaktoren lassen sich vorhandene Fistelungen und<br />
Unterminierungen nicht erkennen, da der Wundgrund und<br />
somit der tatsächliche Umfang und Zustand der Wunde<br />
nicht beurteilbar ist. Infektionen können sich unbeobachtet<br />
ausbilden. Erst nach einem umfangreichen Debridement,<br />
welches neben dem avitalem Gewebe auch gleichzeitig eine<br />
bakterielle Belastung reduziert, ist eine ergebnisorientierte<br />
lokale Wundtherapie möglich.<br />
• Patienteninformation<br />
• Analgesie bedenken und Wirkeintritt abwarten<br />
• Arbeitsfläche schaffen (Wischdesinfektion)<br />
• Abwurfbehälter (nicht aus Glas gemäß UVV Unfallverhütungsverordnung)<br />
für benutzte Instrumente,<br />
spitze Gegenstände und Verbandstoffe bereitstellen<br />
• Fenster und Türen schließen<br />
• Keine anderen Tätigkeiten während des Verbandwechsels<br />
im Zimmer wie Putzarbeiten, Betten machen<br />
• Unbeteiligte Personen und Haustiere fernhalten<br />
• Vorbereitung der benötigten Utensilien auf einer<br />
sauberen Unterlage (nichts im Patientenbett/auf dem<br />
Fußboden ablegen!)<br />
• Steriles Material patientenfern und<br />
unsteriles Material patientennah anordnen<br />
• Patienten entsprechend lagern<br />
• Schutzunterlage verwenden<br />
• Schutzkleidung/Einmalschürze anziehen<br />
(keine langärmeligen Jacken tragen)<br />
• Auf gute Beleuchtung achten<br />
• Materialien vorbereiten<br />
• Hände desinfizieren<br />
• Einmalhandschuhe anziehen<br />
p 5
1 <strong>Wundkompendium</strong><br />
Durchführung des Verbandwechsels einer<br />
chronischen Wunde:<br />
• Anwendung des „Non-touch-Prinzips“ mit unsterilen<br />
Handschuhen und sterilen Instrumenten oder<br />
Verwendung steriler Handschuhe<br />
• Bei aufwendigen Verbandwechseln eine zweite Person<br />
zum Anreichen hinzuziehen<br />
• Alten Verband mit Einmalhandschuhen, tiefer liegende<br />
Tamponaden mit steriler Pinzette/sterilen Handschuhen<br />
abnehmen<br />
• Inspektion der alten Wundauflage, danach im<br />
bereitgestellten Abwurfbehälter entsorgen<br />
• Handschuhwechsel und hygienische Händedesinfektion<br />
• Aseptische Wunden von innen nach außen reinigen<br />
• Septische Wunden von außen nach innen reinigen<br />
• Wundumgebung nicht tupfen sondern wischen;<br />
pro Wischvorgang eine Kompresse/Tupfer verwenden<br />
• Reinigen mit geeigneter Spüllösung,<br />
z. B. NaCl 0,9 % / Ringerlösung<br />
• Infizierte und infektionsgefährdete Wunden mit einem<br />
zeitgemäßen Antiseptikum behandeln<br />
• Inspektion der gereinigten Wunde<br />
• Handschuhwechsel und hygienische Händedesinfektion<br />
• Phasengerechte und individuell angepasste Versorgung<br />
der Wunde nach ärztlicher Verordnung<br />
• Verband fixieren<br />
• Handschuhe entsorgen<br />
• Hygienische Händedesinfektion<br />
Nachsorge des Verbandwechsels einer<br />
chronischen Wunde:<br />
• Patient in angenehme Sitz-/Liegeposition bringen<br />
• Wischdesinfektion der Arbeitsfläche<br />
(Flächendesinfektionsmittel)<br />
• Müllbeutel verschließen, erneuern und außerhalb des<br />
Zimmers entsorgen<br />
• Gebrauchte Instrumente in Desinfektionslösung im entsprechenden<br />
Behältnis bis zur Wiederaufbereitung lagern;<br />
ACHTUNG: “wo immer möglich, ist die Trocken-<br />
| 3 |<br />
entsorgung zu bevorzugen”<br />
• Hygienische Händedesinfektion<br />
• Dokumentation und Führung des Wundprotokolls<br />
p 6<br />
Hygienisches Vorgehen beim Verbandwechsel einer<br />
chronischen Wunde im stationären Bereich<br />
Ziele des Verbandwechsels:<br />
• Wundkontrolle<br />
• Wundbeurteilung und Therapieanpassung<br />
• Verhinderung der Einschleppung von Keimen<br />
und Bakterien<br />
• Bekämpfung einer bereits bestehenden oder<br />
beginnenden Infektion<br />
Grundsätzliches:<br />
• Jede Wunde ist aseptisch zu behandeln, da<br />
Keimbesiedelung eine Wundheilung behindert<br />
und in einigen Fällen unmöglich macht.<br />
Vorbereitung des Verbandwechsels einer<br />
chronischen Wunde:<br />
Festlegen der Reihenfolge: von rein zu unrein<br />
1. Aseptische Wunden<br />
2. Kontaminierte Wunden<br />
3. Kolonisierte Wunden<br />
4. Infizierte Wunden<br />
5. Infizierte Wunden mit MRSA/ORSA oder VRE<br />
(Vancomycin resistente Enterokokken)<br />
• Patienteninformation<br />
• Analgesie bedenken und Wirkeintritt abwarten<br />
• Der Verbandwagen wird vor der Tür des Patientenzimmers<br />
belassen, ansonsten Gefahr der<br />
Keimverschleppung<br />
• Vorbereitung der benötigten Utensilien auf dem<br />
Verbandwagen<br />
• Auf einem per Wischdesinfektion gereinigten Tablett<br />
die Materialien ins Zimmer transportieren; ggf.<br />
Entsorgungsbehälter für spitze Gegenstände<br />
mitnehmen<br />
• Arbeitsfläche im Patientenzimmer schaffen,<br />
z. B. Patientenklapptisch (Wischdesinfektion)<br />
• Steriles Material patientenfern und<br />
unsteriles Material patientennah anordnen<br />
• Nichts im Patientenbett ablegen<br />
• Abwurfbehälter bereitstellen<br />
• Fenster und Türen schließen
1 <strong>Wundkompendium</strong><br />
• Keine anderen Tätigkeiten während des Verband-<br />
wechsels im Zimmer wie Putzarbeiten, Betten machen<br />
• Unbeteiligte Personen fernhalten; ggf. Sichtschutz<br />
organisieren („Spanische Wand“)<br />
• Patienten entsprechend lagern<br />
• Schutzunterlage verwenden<br />
• Schutzkleidung/Einmalschürze anziehen<br />
(keine langärmeligen Jacken tragen)<br />
• Auf gute Beleuchtung achten<br />
• Materialien vorbereiten<br />
• Hände desinfizieren<br />
• Einmalhandschuhe anziehen<br />
Durchführung des Verbandwechsels einer<br />
chronischen Wunde:<br />
• Anwendung des „Non-touch-Prinzips“ mit unsterilen<br />
Handschuhen und sterilen Instrumentarien oder Verwendung<br />
steriler Handschuhe<br />
• Bei aufwendigen Verbandwechseln eine zweite Person<br />
zum Anreichen hinzuziehen<br />
• Alten Verband mit Einmalhandschuhen, tiefer liegende<br />
Tamponaden mit steriler Pinzette/sterilen Handschuhen<br />
abnehmen<br />
• Inspektion der alten Wundauflage, danach im bereit<br />
gestellten Abwurfbehälter entsorgen<br />
• Handschuhwechsel und hygienische Händedesinfektion<br />
• Aseptische Wunden von innen nach außen reinigen<br />
• Septische Wunden von außen nach innen reinigen<br />
• Wundumgebung nicht tupfen, sondern wischen;<br />
pro Wischvorgang eine Kompresse/Tupfer verwenden<br />
• Reinigen mit geeigneter Spüllösung,<br />
z. B. NaCl 0,9 % / Ringerlösung<br />
• Infizierte und infektionsgefährdete Wunden mit einem<br />
zeitgemäßen Antiseptikum behandeln<br />
• Inspektion der gereinigten Wunde<br />
• Handschuhwechsel und hygienische Händedesinfektion<br />
• Phasengerechte und individuell angepasste Versorgung<br />
der Wunde nach ärztlicher Verordnung<br />
• Verband fixieren<br />
• Handschuhe entsorgen<br />
• Hygienische Händedesinfektion<br />
Nachsorge des Verbandwechsels einer<br />
chronischen Wunde:<br />
• Patient in angenehme Sitz-/Liegeposition bringen<br />
• Wischdesinfektion der Arbeitsfläche<br />
(Flächendesinfektionsmittel)<br />
• Müllbeutel verschließen, erneuern und außerhalb<br />
des Zimmers entsorgen<br />
• Gebrauchte Instrumente in Desinfektionslösung<br />
im entsprechenden Behältnis bis zur<br />
Wiederaufbereitung lagern;<br />
ACHTUNG: “wo immer möglich, ist die<br />
| 3 |<br />
Trockenentsorgung zu bevorzugen”<br />
• Hygienische Händedesinfektion<br />
• Dokumentation und Führung des Wundprotokolls<br />
p 7
1 <strong>Wundkompendium</strong><br />
| 4,5 |<br />
Anforderungen an Wundantiseptika<br />
In Lehrbüchern wird empfohlen, Antiseptika nur bei vorliegender Wundinfektion einzusetzen.<br />
Diese Empfehlung beruht auf der Erfahrung und Annahme, dass Antiseptika die Wundheilung durch<br />
Verhinderung der Zellneubildung behindern. Das trifft auch auf viele Antiseptika zu.<br />
Daher sollte ein Wundantiseptikum…<br />
• nicht die Wundheilung behindern<br />
• keine Schmerzen verursachen<br />
• keine toxischen Substanzen enthalten<br />
• mit den Wundauflagen kombinierbar sein<br />
• ein umfassendes Wirkspektrum haben<br />
• in Körperhöhlen angewendet werden können<br />
• die Wundumgebung nicht schädigen<br />
• auch über einen längeren Zeitraum ohne Nebenwirkungen<br />
und Wirkverlust eingesetzt werden können<br />
• keine Resistenzen entwickeln<br />
Applikation von octenisept ®<br />
<strong>octenisept®</strong> kann bei der antiseptischen Wundbehandlung in unterschiedlicher<br />
Weise appliziert werden. Die Applikationsart hängt dabei von der Wundbeschaffenheit ab.<br />
p 8<br />
Warum octenisept ® ?<br />
Es erfüllt alle genannten Anforderungen.<br />
Zusätzlich hat <strong>octenisept®</strong> folgende Eigenschaften:<br />
• es ist farblos – behindert nicht die Sicht auf das<br />
Einsatzgebiet<br />
• es besitzt ein umfassendes Keimspektrum: eine echte<br />
Alternative zur lokalen Antibiotikatherapie<br />
• es ist schnell wirksam<br />
• es hat die größtmögliche Wirkbreite bei geringsten<br />
Nebenwirkungen<br />
• es ist verdünnt einsetzbar*<br />
• es kann ohne Wirkverlust erwärmt und gelagert werden<br />
• es ist frei von aliphatischen Alkoholen, daher kein<br />
Austrocknen der Haut<br />
• es ist wässrig, kann daher eingefroren werden**<br />
* Wirksamkeitsbeleg von verdünntem <strong>octenisept®</strong><br />
** siehe Anwendungsbeispiel auf Seite 12<br />
Oberflächliche Wunden Applikation Tiefe Wunden Applikation<br />
Wundfläche mit Nekrosen und/<br />
oder Fibrinbelägen<br />
Infizierte Wundflächen<br />
Kontaminierte Wundflächen<br />
Sprühen, Übergießen,<br />
Umschläge, UAW*<br />
Sprühen, Übergießen,<br />
Umschläge, UAW*<br />
Sprühen, Übergießen,<br />
UAW*<br />
Erysipel, Phlegmone Eiswürfel, Umschläge<br />
Wundtaschen mit Nekrosen<br />
und/oder Fibrinbelägen<br />
Abszess<br />
Infizierte Körperhöhlen<br />
*UAW = Ultraschallassistierte Wundreinigung<br />
** Beim Ausspülen ist darauf zu achten, dass das Präparat nicht unter Druck ins Gewebe eingebracht bzw. injiziert wird<br />
und ein Abfluss jederzeit gewährleistet ist (z. B. Drainage, Lasche).<br />
Ausspülen**, UAW*<br />
Ausspülen**, UAW*,<br />
getränkte Tamponaden,<br />
lokale Unterdrucktherapie mit<br />
integrierter Spülung<br />
Ausspülen**, UAW*,<br />
lokale Unterdrucktherapie mit<br />
integrierter Spülung
1 <strong>Wundkompendium</strong><br />
Indikation einer antiseptischen Behandlung<br />
oberflächlicher Wunden<br />
Infektionsgefährdete Wunde Merkmale<br />
Infizierte Wunde Merkmale<br />
• Aufgrund der Lokalisation besteht die Gefahr des<br />
Eintrages von Keimen in die Wunde<br />
• Fibrinbeläge<br />
• Der Verband ist schwierig zu fixieren<br />
• Mazeration<br />
• Rötung der Wundumgebung<br />
• Überwärmung des betroffenen Bereiches<br />
• Schwellung<br />
• Schmerz<br />
• Funktionseinschränkung<br />
• Geruch<br />
• Nekrosen und Fibrinbeläge<br />
• Keimnachweis durch Wundabstrich<br />
p 9
1 <strong>Wundkompendium</strong><br />
Applikation von octenisept ® bei<br />
oberflächlichen Wunden<br />
Vorgehensweise 1: octenisept ® -getränkte Kompressen<br />
Kurz vor Behandlungsbeginn wird die Originalverpackung (Bild 1) nur teilweise geöffnet (Bild 2) und<br />
anschließend octenisept ® in die Originalverpackung gegossen (Bild 3). Die Kompresse saugt das<br />
octenisept ® auf und kann bis zum Gebrauch verschlossen aufbewahrt werden.<br />
p 10<br />
Bei der beschriebenen Vorgehensweise ist sichergestellt,<br />
dass die Mindesteinwirkzeit von einer Minute<br />
eingehalten wird, ohne den Arbeitsablauf unterbrechen<br />
zu müssen.<br />
• Entfernung und Begutachtung des alten Verbandes<br />
• Sichtkontrolle: Infektionszeichen vorhanden?<br />
• Wenn ja, Abstrichentnahme<br />
• Sterile Kompressen mit <strong>octenisept®</strong> tränken und auf<br />
die Wundfläche legen<br />
• Einwirkzeit von 1 Minute beachten<br />
• Bei Wundbelägen: Tupfer andrücken und abheben.<br />
Auf der Wundfläche soll nicht gerieben werden, um die<br />
neu gebildeten Zellen nicht zu zerstören.<br />
Fibrinbeläge und Zelltrümmer verfärben die Tupfer<br />
gelblich. Den Vorgang so oft wiederholen, bis die Tupfer<br />
weiß bleiben. Pro Vorgang einen neu getränkten Tupfer<br />
verwenden.<br />
• Fotodokumentation und phasengerechte Wundbehandlung<br />
durchführen.
1 <strong>Wundkompendium</strong><br />
Vorgehensweise 2: octenisept ® aufsprühen oder übergießen<br />
Diese Vorgehensweise wird dann empfohlen, wenn die Wundoberfläche frei von Nekrosen ist und das<br />
Antiseptikum ungehindert alle Areale benetzt. Die Einwirkzeit ergibt sich aus der Trocknungszeit. Da<br />
nicht nachgespült oder abgetrocknet wird, ist die Mindesteinwirkzeit garantiert.<br />
Entfernung und Begutachtung des alten Verbandes<br />
• <strong>octenisept®</strong> aufsprühen oder übergießen<br />
• Fotodokumentation und phasengerechte Wundbehandlung<br />
durchführen: bei infizierten Wunden<br />
muss mindestens einmal täglich ein Verbandwechsel<br />
erfolgen<br />
p 11
1 <strong>Wundkompendium</strong><br />
Vorgehensweise 3: Umschläge mit octenisept ®<br />
Diese Methode ist dann geeignet, wenn sich die Keime überwiegend unter der Haut befinden. Durch<br />
die Dauerbefeuchtung tritt eine in diesem Fall erwünschte Mazeration ein, die ein Eindringen des<br />
Antiseptikums in die entzündeten Areale verbessert.<br />
Vorgehensweise 4: Eiswürfel aus octenisept ®<br />
Diese Vorgehensmethode ist geeignet bei Erysipel und Phlegmone. Neben der Keimreduzierung<br />
tritt auch eine kühlende, schmerzstillende und abschwellende Wirkung ein. Ergänzt werden sollte<br />
diese Methode durch die Vorgehensweise 3 – also Umschläge mit octenisept ® .<br />
p 12<br />
• Sterile Kompressen mit <strong>octenisept®</strong> tränken und<br />
auflegen<br />
• Vorgang wiederholen sobald die Kompressen nicht<br />
mehr ausreichend feucht sind<br />
• Der Gesamtzeitraum von 8 Stunden hat sich als ausschließliche<br />
lokale Therapie der Infektion klinisch<br />
bewährt. Eine systemische Antibiotikatherapie wird der<br />
behandelnde Arzt je nach Krankheitsbild anordnen.<br />
Danach phasengerechte Wundbehandlung mit antiseptischer<br />
Therapie kombinieren (siehe Vorgehensweise 1<br />
und 2)<br />
• Umgebende Haut vor Austrocknung schützen<br />
• <strong>octenisept®</strong> in einen geeigneten Behälter gießen und<br />
im Medikamentenkühlschrank einfrieren<br />
• Mit einem Eiswürfel aus gefrorenem <strong>octenisept®</strong> über<br />
die entzündeten Bereiche streichen<br />
• Angetrocknetes Exsudat auf der Haut kann mechansich,<br />
durch in eine Kompresse eingelegten Eiswürfel,<br />
entfernt werden<br />
• Die Maßnahme mehrmals täglich wiederholen.<br />
Bewährt haben sich Intervalle von 4 Stunden
1 <strong>Wundkompendium</strong><br />
Fallbeispiele für octenisept ® -Anwendungen<br />
bei oberflächlichen Wunden<br />
1. Erysipel bei Elephanthiasis<br />
Aufnahmebefund<br />
Die Entzündungszeichen im linken Bein sind deutlich<br />
sichtbar. Die Blasen sind mit infektiöser Flüssigkeit gefüllt,<br />
die Keime enthält. Das Bein ist geschwollen, stark gerötet<br />
und überwärmt. Die Patientin hat starke Schmerzen.<br />
Lokale Therapie<br />
Da <strong>octenisept®</strong> nur bei direktem Kontakt mit Keimen<br />
wirkt, musste ein lokaler Zugang geschaffen werden.<br />
Durch feuchte Umschläge entsteht eine gewollte<br />
Mazeration die diesen ermöglicht. Mit Eiswürfeln aus<br />
<strong>octenisept®</strong> wurde das Bein 3 x täglich während acht<br />
Tagen abgerieben.<br />
Mit gefrorenem <strong>octenisept®</strong> in einer Mullkompresse werden<br />
Exsudatreste und Hautschuppen vorsichtig mechanisch<br />
entfernt. So werden die freigesetzten Keime sofort durch<br />
<strong>octenisept®</strong> auf der Haut abgetötet. Die Wundflächen<br />
werden anschließend wieder mit <strong>octenisept®</strong>-Umschlägen<br />
behandelt, bis alle Infektionszeichen abgeklungen sind.<br />
Das war zwei Tage später der Fall.<br />
Die Therapie wird umgestellt:<br />
Ein nonadhäsiver Hydroaktivverband und eine Kompressionstherapie<br />
führten dazu, dass fünf Tage später<br />
die Wunden abgeheilt sind.<br />
p 13
1 <strong>Wundkompendium</strong><br />
2. Infiziertes Ulcus cruris<br />
p 14<br />
Aufnahmebefund<br />
Der 74-jährige Patient hat seit 25 Jahren „offene Beine“<br />
unklarer Genese. Er kommt wegen einer dekompensierten<br />
Herzinsuffizienz in die Klinik und muss zunächst intensivmedizinisch<br />
behandelt werden. Parallel wird eine lokale<br />
antiseptische Therapie mit <strong>octenisept®</strong>-Umschlägen<br />
begonnen, da die Infektion der Wunden sich ungünstig<br />
auf seinen Gesamtzustand auswirkte.<br />
Therapie<br />
1. Tag: Umschläge mit <strong>octenisept®</strong><br />
2. – 4. Tag: Sprühdesinfektion mit <strong>octenisept®</strong> und<br />
anschließende mechanische Reinigung mit<br />
<strong>octenisept®</strong>-getränkten Kompressen.<br />
Hydrogel auf die Beläge und Wundabdeckung<br />
mit Hydroaktivverband. Leichte Kompression.<br />
5. – 20. Tag: Sprühdesinfektion mit <strong>octenisept®</strong> und<br />
Wundabdeckung mit Hydroaktivverband.<br />
Leichte Kompression.<br />
Die Wundränder und die Hautinseln wurden durchgehend<br />
mit einem transparenten Hautschutzfilm vor Mazeration<br />
geschützt. Nach drei Wochen Behandlung ist eine deutliche<br />
Besserung erkennbar: die Infektion ist bereits nach 48<br />
Stunden rückläufig, die Fibrinbeläge sind nach vier Tagen<br />
weg und die Hautinseln vergrößern sich. Frisches Granulationsgewebe<br />
wächst bis auf Hautniveau.<br />
Eine gemeinsame Wundversorgung mit dem ambulanten<br />
Pflegedienst stellt die kontinuierliche Therapie auch nach<br />
der Entlassung sicher.<br />
Es wird weiterhin eine Sprühdesinfektion mit <strong>octenisept®</strong><br />
empfohlen, da eine Re-Infizierung durch die eingeschränkten<br />
hygienischen Verhältnisse im Umfeld des Patienten<br />
droht. Es stellte sich heraus, dass in den vergangenen 25<br />
Jahren die Ulcera mehrmals fast abgeheilt waren und sich<br />
durch Infektion immer wieder vergrößerten.
1 <strong>Wundkompendium</strong><br />
Indikation einer antiseptischen Behandlung tiefer Wunden<br />
Im Gegensatz zu den oberflächlichen Wunden ist bei tiefen infizierten Wunden immer eine Auswirkung<br />
auf den gesamten Organismus zu erwarten. Daher ist die lokale antiseptische Behandlung<br />
nur ein Bestandteil der ärztlichen Behandlung im Zusammenhang mit der systemischen Therapie.<br />
Trotzdem wird auch bei tiefen Wunden eine antiseptische Therapie bereits bei Verdacht auf eine<br />
Infektion und bei drohender Infektion empfohlen.<br />
Infektionsgefährdete Wunde Merkmale<br />
Infizierte Wunde Merkmale<br />
• Aufgrund der Lokalisation besteht die Gefahr des<br />
Eintrages von Keimen in die Wunde<br />
• Nekrose und/oder Fibrinbeläge<br />
• Der Verband ist schwierig zu fixieren<br />
• Rötung der Wundumgebung<br />
• Überwärmung des betroffenen Bereiches<br />
• Schwellung<br />
• Schmerz<br />
• Funktionseinschränkung<br />
• Geruch<br />
• Nekrose und/oder Fibrinbeläge<br />
• Keimnachweis durch Wundabstrich<br />
• Osteomyelitis<br />
p 15
1 <strong>Wundkompendium</strong><br />
Applikation von octenisept ® bei tiefen Wunden<br />
Antiseptische Behandlung und Einlage<br />
Bei Behandlungsmengen von mehr als 50 ml kann octenisept ® mit Ringerlösung 1:1 verdünnt<br />
werden. Ein Anwärmen der Spülflüssigkeit ist in diesem Fall ebenfalls empfehlenswert.<br />
p 16<br />
In die sterile Schale wird <strong>octenisept®</strong> eingefüllt.<br />
So kann auch angewärmte Ringerlösung oder 0,9 %-ige<br />
NaCl-Lösung im Verhältnis 1:1 zugemischt werden. Die<br />
Spülflüssigkeit wird in eine Blasenspritze aufgezogen.<br />
Mit einem Absaugkatheter oder Einmalkatheter wird die<br />
Spülflüssigkeit in die Wundhöhle eingebracht. Dabei ist<br />
unbedingt darauf zu achten, dass die Flüssigkeit nicht unter<br />
Aufwendung von Druck appliziert wird und wieder frei aus<br />
der Wunde abfließen kann.<br />
Die erforderliche Menge ist abhängig von der Wundgröße<br />
und den Wundverhältnissen: die Maßnahme wird dann<br />
beendet, wenn klare Flüssigkeit ausläuft.<br />
Einen schmalen Polyurethan-Streifen mit <strong>octenisept®</strong><br />
tränken und lose einlegen, bis ein Drittel der Wundtasche<br />
gefüllt ist.<br />
Achtung: Manche Materialien können stark aufquellen. Um<br />
sicherzustellen, dass kein Material beim Verbandwechsel in<br />
der Wundhöhle verbleibt, wird der Polyurethan-Streifen als<br />
Lasche so eingelegt, dass ein Ende heraushängt.
2 Ergänzende Informationen<br />
Verträglichkeit von octenisept ® mit modernen<br />
| 6 |<br />
Wundauflagen<br />
In der modernen Wundversorgung kommen die Wundauflagen<br />
in direkten Kontakt mit dem Antiseptikum oder<br />
werden satt mit dem Antiseptikum getränkt und in die<br />
Wunde eingelegt.<br />
Daraus ergibt sich die Fragestellung, ob die Wirksamkeit<br />
des Antiseptikums durch die Wundauflage negativ<br />
beeinflusst wird. Hierzu wurden in-vitro Untersuchungen<br />
| 7 |<br />
durchgeführt.<br />
Im Testmodell des Agardiffusionstests (analog den Untersuchungen,<br />
die zur Hemmhofbestimmung bei Antibioka<br />
verwendet werden) wurden verschiedene moderne<br />
Wundauflagen (Größe jeweils 2 cm) mit einer definierten<br />
Menge an antimikrobiellem Wirkstoff bzw. Präparat<br />
(<strong>octenisept®</strong>, Rivanol und Lavasept) beaufschlagt und im<br />
Brutschrank bebrütet und auf Hemmhof geprüft.<br />
Zur Bestimmung auf Hemmhof wurden die Agarplatten<br />
zuvor mit S. aureus bzw. P. aeruginosa beimpft.<br />
Folgende Wundauflagen wurden untersucht:<br />
Produkt Typ Hersteller<br />
3M Tegaderm<br />
Alginat<br />
3M Tegaderm<br />
Hydrokolloid<br />
Alginat 3M<br />
Hydrokolloid 3M<br />
SeaSorb Soft Alginat Coloplast<br />
Comfeel Plus Hydrokolloid Coloplast<br />
Urgosorb Alginat Urgo<br />
Urgotül<br />
Netz aus Polyester-<br />
Fasern<br />
Urgo<br />
Algoplaque Film Hydrokolloid Urgo<br />
Im Agardiffusionstest zeigte sich, dass hinsichtlich der<br />
Hemmhofbildung deutliche Unterschiede betreffend der<br />
Präparate und der Wundauflagen bestehen.<br />
<strong>octenisept®</strong> zeigte gegenüber S. aureus mit allen getesteten<br />
Wundauflagen sowohl bei 25 %, 50 % und unverdünnt ausreichende<br />
Hemmhofbildung. Bei P. aeruginosa war dies bei<br />
unverdünntem <strong>octenisept®</strong> ebenfalls der Fall.<br />
Für eine Anwendungsempfehlung werden quantitative<br />
Daten benötigt – der Hemmhoftest liefert nur qualitative<br />
Daten – um sicherzustellen, dass genügend antimikrobieller<br />
Wirkstoff für die Wachstumshemmung von Bakterien<br />
(= Bakteriostase) oder die Abtötung von Bakterien<br />
(= Bakterizidie) zur Verfügung steht.<br />
Daher wurde für die Kombination von <strong>octenisept®</strong> und<br />
ausgewählten modernen Wundauflagen die Verfügbarkeit<br />
des antimikrobiellen Wirkstoffes Octenidindihydrochlorid<br />
bestimmt.<br />
Das in den Agar diffundierte Octenidin wurde hierzu quantitativ<br />
bestimmt. Hierzu wurden jeweils 47 µg Octenidin auf<br />
die zu prüfende Wundauflage gegeben und die Agarplatte<br />
bebrütet. Im Agar wurden von minimal 8 % bis maximal<br />
74 % des aufgetragenen Octenidin gefunden.<br />
Berechnet man auf diesem Ergebnis die Mengen Octenidin<br />
die in der Praxis und somit in die Wunde gelangen, wird in<br />
jedem Fall genügend Octenidin frei, um die Bakterien am<br />
Wachstum zu hemmen bzw. abzutöten.<br />
<strong>octenisept®</strong> wird auf Grundlage dieser Untersuchungen von<br />
keiner modernen Wundauflage in seiner antimikrobiellen<br />
Wirksamkeit negativ beeinflusst.<br />
p 17
2 Ergänzende Informationen<br />
FAQ’s<br />
Fragen zur Wirksamkeit<br />
1. Ist octenisept ® gegen MRSA wirksam?<br />
p 18<br />
Ja.<br />
<strong>octenisept®</strong> ist gegen eine Vielzahl von MRSA auf Wirksamkeit<br />
positiv geprüft worden. Es wurden in keinem<br />
Fall grundlegende Unterschiede in der Wirksamkeit im<br />
Vergleich zu sensitiven S. aureus Stämmen ermittelt.<br />
Resistenzbildung gegenüber Octenidin ist nicht bekannt.<br />
2. Ist octenisept ® gegen Hautpilze wirksam?<br />
Ja.<br />
Bei <strong>octenisept®</strong> handelt es sich um ein fungizides<br />
Präparat, dass gegen eine Vielzahl von verschiedenen<br />
Pilzen in-vitro eine gute Wirksamkeit aufweist. Gegen<br />
Fußpilz hat sich das Präparat im klinischen Versuch als<br />
wirksam herausgestellt.<br />
3. Kann octenisept ® den Biofilm in der Wunde<br />
durchdringen?<br />
In vitro-Wirksamkeit von Octenidin und Polihexanid<br />
gegen Biofilme aus Pseudomonas<br />
aeruginosa im Labor.<br />
N. Harbs, J. Siebert<br />
GMS Krankenhaushyg. Interdiszip 2007; 2 (2): Doc45 (20071228)<br />
4. Wirkt octenisept ® auch reinigend oder<br />
ausschließlich antiseptisch?<br />
Ja, auch sehr gut reinigend.<br />
Durch die Anwesenheit von geringen Mengen eines<br />
oberflächigen Netzmittels (Tensid) wird die Oberflächenspannung<br />
des Präparates stark erniedrigt und<br />
die Benetzung der Wundoberfläche somit begünstigt.<br />
Damit wird gleichzeitig eine Reinigungswirkung erzielt.<br />
Fragen zur Verträglichkeit<br />
5. Kann es durch octenisept ® zu einer Elektrolytverschiebung<br />
im Wundmilieu kommen und<br />
damit zu einer Störung der Wundheilung?<br />
Nein.<br />
Obgleich <strong>octenisept®</strong> nicht isotonisch ist, sind Störungen<br />
des Elektrolythaushalts in der Wunde, die zu<br />
Wundheilungsstörungen bei der wiederholten, zeitlich<br />
befristeten Anwendung führen, bisher nicht bekannt.<br />
Auch eine über vier Wochen andauernde tägliche<br />
Anwendung auf chronischen Wunden im Vergleich zur<br />
Ringerlösung führte zu keinen Wundheilungsstörungen,<br />
sondern im Gegenteil zu einer Förderung der Granulation.<br />
Notwendige Verdünnungen können mit sterilem<br />
Wasser oder auch physiologischen Verdünnungsmedien<br />
durchgeführt werden.<br />
6. Ist octenisept ® in der praktischen Anwendung<br />
zytotoxisch?<br />
Nein.<br />
Alle antiseptisch bzw. antimikrobiell wirkenden Stoffe<br />
besitzen naturgemäß eine mehr oder weniger ausgeprägte<br />
zytotoxische Wirksamkeit, die sich in-vitro in Zellund<br />
Gewebekulturen nachweisen lässt (Kramer et al.<br />
1993, 1996). So aussagekräftig solche in-vitro Ergebnisse<br />
im Einzelnen sein mögen, die entscheidende Frage ist<br />
aber die nach der Relevanz und der Übertragbarkeit<br />
dieser Befunde auf die Praxis (Niedner 1996). Darüber<br />
hinaus sind die herangezogenen Methoden häufig nur<br />
unzureichend validiert, als dass sie verlässliche Ergebnisse<br />
für die Praxis liefern könnten.<br />
Eine abschließende Bewertung der Übertragbarkeit<br />
der in vitro Ergebnisse auf den Menschen muss deshalb<br />
dem klinischen Versuch am Menschen und den<br />
vielfältigen Erfahrungen mit dem Präparat in der Praxis<br />
vorbehalten bleiben.<br />
<strong>octenisept®</strong> ist seit dem Jahre 1995 für die unterstützende<br />
Wundbehandlung zugelassen. Es zeichnet sich<br />
neben seiner guten Wirksamkeit durch eine sehr gute<br />
lokale Verträglichkeit aus. Wie Polihexanid und PVP-Iod
2 Ergänzende Informationen<br />
weist auch Octenidin bzw. <strong>octenisept®</strong> (0,1 % Octenidin,<br />
2 % Phenoxyethanol) eine nachweisbare Zytotoxizität<br />
in vitro auf. Bei weiterführenden Zellkulturtests konnte<br />
allerdings gezeigt werden, dass Octenidin mit Zellen<br />
bzw. Proteinen starke Wechselwirkungen eingeht und<br />
Komplexe bildet, die unter Erhalt der antimikrobiellen<br />
Wirksamkeit eine stark reduzierte Zytotoxizität aufweisen<br />
(Kramer et al. 2006). Das ist eine ungewöhnliche,<br />
bisher nicht beschriebene Wechselwirkung eines Antiseptikums<br />
mit Zell-, Gewebe- bzw. Matrixbestandteilen.<br />
Diese Eigenschaft wirkt sich in vivo günstig auf die Verträglichkeit<br />
aus, weil nur die oberste Zellschicht mit dem<br />
Wirkstoff exponiert wird und dieser aus den gebildeten<br />
Komplexen in geringen nicht zytotoxischen Konzentration<br />
wieder in die Umgebung abgegeben wird und<br />
damit weiter bioverfügbar bleibt. Zugleich ist denkbar,<br />
dass durch die „Wundversiegelung“ die nachfolgende<br />
bakterielle Kolonisation unterbunden wird.<br />
Dieses Phänomen liefert eine plausible Erklärung für die<br />
Diskrepanz zwischen den bisherigen in-vitro-Befunden<br />
in Zell- und Gewebekulturen, die mit <strong>octenisept®</strong> erhalten<br />
wurden, und den günstigen präklinschen sowie klinischen<br />
Beobachtungen. So wird diese gute Verträglichkeit<br />
bereits in einer präklinischen Untersuchung an einem-<br />
Tiermodell zur Beeinflussung der Wundheilung deutlich<br />
(Kramer et al. 2004). Im verwendeten Tiermodell wurden<br />
künstliche, standardisierte Wunden von weiblichen<br />
Ferkeln über insgesamt 28 Tage täglich mit u. a.<br />
<strong>octenisept®</strong> und Ringerlösung behandelt. Die Wunden<br />
wurden in regelmäßigen Abständen größenmäßig (planimetrisch)<br />
vermessen und zusätzlich histopathologisch<br />
auf Veränderungen durch die Antiseptika-Gabe untersucht.<br />
Im Ergebnis kam es in der <strong>octenisept®</strong>-Gruppe in<br />
den ersten 18 Tagen zu einer geringeren Wundkontraktion<br />
als bei Ringerlösung. Ein Unterschied im Wundverschluss<br />
zwischen Ringerlösung und <strong>octenisept®</strong> (28,3<br />
Tage) war jedoch nicht zu erkennen. So war ein Unterschied<br />
in der Wundgröße im Vergleich zu Ringer-Lösung<br />
zum Ende der Beobachtungszeit nicht mehr vorhanden.<br />
Unabhängig von der Behandlung kam es über den gesamten<br />
Beobachtungszeitraum in keinem Fall zu<br />
histologischen Veränderungen. Aus den Ergebnissen<br />
lässt sich der Schluss ziehen, dass <strong>octenisept®</strong> eine vergleichbar<br />
gute lokale Gewebeverträglichkeit wie Ringerlösung<br />
aufweist. Diese Befunde werden gestützt durch<br />
Ergebnisse von Untersuchungen zur Behandlung von<br />
chronischen Wunden (Dubois et al. 1989, Vanscheidt<br />
et al. 2005). Bei Vanscheidt et al. (2005) wurden chronische<br />
Ulcera von 43 Patienten täglich über 4 Wochen<br />
im Vergleich zu Ringer-Lösung mit <strong>octenisept®</strong> behandelt.<br />
Es kam unter <strong>octenisept®</strong> zu einer Minderung der<br />
Infektionszeichen sowie zu einer signifikanten Verbesserung<br />
der Granulation. Eine negative Beeinflussung der<br />
Wundheilung wurde nicht beobachtet.<br />
Auch auf Verbrennungswunden wurde die problemlose<br />
Anwendung dokumentiert (Menke et al. 2001). In<br />
einer prospektiven Untersuchung kam <strong>octenisept®</strong> bei<br />
20 Patienten mit Verbrennungen 2. und 3. Grades von<br />
20 – 50 % der Körperoberfläche großflächig im Rahmen<br />
der offenen Wundbehandlung zur Anwendung. Dabei<br />
standen die lokale und systemische Verträglichkeit im<br />
Vordergrund. Im Median kamen 1450 ml <strong>octenisept®</strong><br />
über 8 Tage zum Einsatz. Bei keinem Patienten traten<br />
nach Anwendung mit dem Präparat lokale Unverträglichkeitsreaktionen<br />
auf. Auch relevante systemische<br />
Nebenwirkungen wurden während des Untersuchungszeitraumes<br />
nicht beobachtet.<br />
Zum Vergleich der Verträglichkeit von Wundantiseptika<br />
wurde der sogenannte Biokompatibilitätsindex (BI)<br />
eingeführt (Kramer et al. 2006). Der BI ergibt sich aus<br />
dem unter gleichen Versuchsbedingungen ermittelten<br />
Quotienten der IC50 im Zytotoxizitätstest in-vitro und<br />
der Konzentration, die im quantitativen Suspensionstest<br />
gegenüber Testbakterien mindestens eine 3 lg-Reduktion<br />
ergibt. Hierbei schneidet Octenidin am günstigsten<br />
ab, d. h. unter Zugrundelegung des BI ist Octenidin z. B.<br />
Polihexanid, an therapeutischen Breiten überlegen, weil<br />
die Wirksamkeit von Octenidin deutlich höher ist, ohne<br />
dass die Zytotoxizität in gleichem Ausmaß vorhanden ist.<br />
p 19
2 Ergänzende Informationen<br />
7. Kann eine verbleibende octenisept ® -Lösung<br />
p 20<br />
in der Wunde in Verbindung mit Silberpräparaten<br />
toxisch wirken?<br />
Nein.<br />
Lokale antiseptische Maßnahmen, z. B. mit <strong>octenisept®</strong>,<br />
stellen bei infizierten oder infektionsgefährdeten Wunden<br />
einen wichtigen Beitrag im Rahmen der wirksamen<br />
Wundbehandlung dar. Abhängig vom Wundstatus<br />
kommen dabei verschiedene Wundauflagen unterschiedlichster<br />
Hersteller zum Einsatz. Die Frage, die<br />
sich in diesem Zusammenhang stellt, ist die nach einer<br />
vorstellbaren negativen Wechselwirkung zwischen der<br />
eingesetzten Wundauflage und dem zuvor verwendeten<br />
<strong>octenisept®</strong>; einerseits könnte die Funktion der<br />
Wundauflage durch eine Wechselwirkung leiden bzw.<br />
andererseits könnte <strong>octenisept®</strong> in seiner Wirksamkeit<br />
inhibiert werden.<br />
Erste eigene Untersuchungen zur Beeinträchtigung<br />
der lokalen Wirksamkeit von Wundantiseptika durch<br />
moderne Wundauflagen (Zeitschrift für Wundheilung<br />
2002, Nr. 5 S. 177 – 181) zeigten keine grundlegenden<br />
Probleme bei der Kombination von <strong>octenisept®</strong> mit handelsüblichen<br />
Wundauflagen. Aufgrund des schnellen<br />
Wirkungseintritts von <strong>octenisept®</strong> birgt eine beschränkte<br />
Resorption der Wirkstoffe durch die Wundfaser<br />
nach Abschluss der antiseptischen Maßnahme keinen<br />
Nachteil, zumal von einer Wirkstofffreisetzung weiterhin<br />
ausgegangen werden kann. Aus den praktischen<br />
Erfahrungen der letzten Jahre mit einer Vielzahl weiterer<br />
Wundauflagen, einschl. Silberauflagen, sind uns keine<br />
Reklamationen hinsichtlich möglicher Wechselwirkungen<br />
bekannt geworden. Damit werden die anfänglichen<br />
Befunde bestätigt.<br />
Diese Aussage schließt nicht aus, dass es nicht doch in<br />
Einzelfällen und abhängig von den Einsatzbedingungen<br />
zu Beeinträchtigungen der Funktion einzelner Wundauflagen<br />
kommen kann. Wir bitten in diesem Fall um<br />
Benachrichtigung, damit wir zu einer schnellen Problemlösung<br />
beitragen können.<br />
Fragen zu Anwendungsbereichen<br />
8. Warum darf octenisept ® sowohl zur Schleimhautantiseptik<br />
als auch zur Wundantiseptik<br />
eingesetzt werden?<br />
<strong>octenisept®</strong> ist für beide Indikationen zugelassen.<br />
<strong>octenisept®</strong> wurde 1990 als Schleimhautantiseptikum in<br />
Deutschland zugelassen. Eine Indikationserweiterung<br />
auf unterstützende Wundbehandlung erfolgte 1995.<br />
9. Ist octenisept ® zur intraoperativen Spülung<br />
großflächiger Wunden geeignet?<br />
Ja.<br />
<strong>octenisept®</strong> ist zur unterstützenden Wundbehandlung<br />
zugelassen. Diese Indikation schließt auch die Behandlung<br />
großflächiger Wunden (z. B. Verbrennungswunden)<br />
mit ein, zumal Octenidin nicht in relevanten Mengen<br />
systemisch absorbiert wird und damit lediglich oberflächig<br />
zur Wirkung kommt.<br />
10. Kann octenisept ® am Knorpel angewendet<br />
werden ?<br />
Nein.<br />
Nicht an intaktem, vitalem Knorpelgewebe.<br />
11. Ist octenisept ® zur Spülung der Bauchhöhle<br />
zugelassen ?<br />
Nein.<br />
Hierbei handelt es sich um eine Kontraindikation. Die<br />
Bedingungen für eine sichere Anwendung sind z. Zt.<br />
nicht durch klinische Studien abgesichert.
2 Ergänzende Informationen<br />
Fragen zur Anwendungsdauer<br />
12. Darf octenisept ® bis zur Epithelisierung<br />
verwendet werden?<br />
Ja, sofern medizinisch notwendig.<br />
Störungsfrei granulierende und epithelisierende Wunden<br />
bedürfen i. d. R. keiner weiteren antiseptischen<br />
Maßnahmen.<br />
Sollte in diesen Phasen ein erhöhtes Infektionsrisiko<br />
bestehen, kann nach den vorliegenden Erfahrungen<br />
<strong>octenisept®</strong> auch auf diesen Wunden ohne die Gefahr<br />
von Wundheilungsstörungen eingesetzt werden.<br />
13. Wie lange kann octenisept ® angewendet<br />
werden? Bedeutet 14 Tage Anwendung<br />
innerhalb von 14 Tagen oder Anwendungen<br />
an 14 Tagen?<br />
2 bzw. 4 Wochen.<br />
Die zugelassene Anwendung von 14 Tagen bezieht sich<br />
auf die kontinuierliche Anwendung über diesen Zeitraum.<br />
Jedoch bestätigen Anwendungsbeobachtungen<br />
und Praxisberichte auch die sichere Anwendung über<br />
4 Wochen.<br />
14. Wie lange kann octenisept ® nach Anbruch<br />
verwendet werden?<br />
3 Jahre<br />
Fragen zur Anwendung mit Verbandstoffen<br />
15. Wie oft muss der Verbandwechsel bei Anwendung<br />
von octenisept ® vorgenommen werden?<br />
Alle 12 – 24 Stunden.<br />
Aufgrund der nachgewiesenen Remanenz von 24<br />
Stunden für Octenidin kann der Verbandswechsel und<br />
die wiederholte Anwendung von <strong>octenisept®</strong> abhängig<br />
vom Zustand und von der Exsudation der Wunde<br />
in Wechselintervallen von 12 – 24 Stunden erfolgen,<br />
ohne dass mit einer Beeinträchtigung der Wirksamkeit<br />
gerechnet werden muss.<br />
16. Kann man octenisept ® zum Anfeuchten von<br />
Aquacel oder anderen Verbandstoffen<br />
verwenden?<br />
Ja.<br />
<strong>octenisept®</strong> ist sehr gut geeignet, siehe Frage 7.<br />
17. Ist die Anwendung von octenisept ® mit<br />
Silberverbänden möglich?<br />
Ja, aber nicht notwendig.<br />
Als remanenter Wirkstoff verbleibt Octenidin für längere<br />
Zeit auf der Wunde und entfaltet auch über die eigentliche<br />
Anwendung hinaus seine Wirksamkeit. Eine<br />
Kombination von Ag-Verbänden mit <strong>octenisept®</strong> ist bei<br />
Sicherstellung eines regelmäßigen Verbandwechsels<br />
mit wiederholter Anwendung von <strong>octenisept®</strong> somit aus<br />
unserer Sicht nicht notwendig.<br />
p 21
3 Weitere klinische Erfahrungen<br />
octenisept ® wird in der Praxis bei aseptischen Wunden, kontaminierten Wunden, kolonisierten,<br />
kritisch kolonisierten Wunden und vor allem bei infizierten Wunden eingesetzt. Die folgenden<br />
Behandlungsbeispiele zeigen exemplarisch die klinischen Erfahrungen von octenisept ® .<br />
Indikation Wundinfektion<br />
| 8 |<br />
Beispiel Einsatz beim diabetischem Gangrän<br />
p 22<br />
16.05. Wundzustand bei Einweisung<br />
Vorausgegangen war die häusliche, unsachgemäß<br />
durchgeführte Fußpflege durch die Patientin selbst.<br />
Bei der Beseitigung einer hornigen Druckstelle<br />
(Hühnerauge) mit Verletzung der Haut und Infektion;<br />
hervorgerufen durch zu enges Schuhwerk mit Innennaht.<br />
Am 17.05. Amputation der V. linken Zehe.<br />
23.05. Wundzustand eine Woche nach OP<br />
Rötung und Schwellung.<br />
Nach Teilentfernung der Fäden zeichnen sich in der Tiefe<br />
des Wundkanals nekrotische Gewebeteile ab.<br />
Vor und nach einem vorsichtigen Teildebridement<br />
antiseptische Behandlung mit <strong>octenisept®</strong>:<br />
Aufsprühen von <strong>octenisept®</strong> bzw. Einlegen von mit<br />
<strong>octenisept®</strong>-getränktem Polyurethanschaum.<br />
26.05.<br />
Die Restfäden sind entfernt. Die Wunde ist stark belegt.<br />
Wundreinigung mit <strong>octenisept®</strong>-getränkten Tupfern.
3 Weitere klinische Erfahrungen<br />
31.05.<br />
Der entzündliche Zustand hat sich zurückgebildet,<br />
trotz aller Bemühungen nur geringe Verbesserung.<br />
Die Patientin ist weiterhin nicht kooperativ.<br />
Wundrevision unter Operationsbedingungen.<br />
Danach Wundversorgung wie vorne beschrieben.<br />
07.06.<br />
Gut durchblutete Granulationsfläche.<br />
Mazeration am Wundrand.<br />
13.07.<br />
Wundheilung schreitet voran.<br />
Die Wunde ist fast geschlossen.<br />
31.07.<br />
Die Wunde ist geschlossen.<br />
p 23
3 Weitere klinische Erfahrungen<br />
Indikation infektionsgefährdete Wunde<br />
Beispiel Perianalabszess<br />
Nach Ausräumung eines Perianalabszesses verblieb eine große Wundfläche, die direkten Kontakt<br />
mit dem Anus hatte. Die Patientin lehnte die Anlage eines passageren Anus praeter ab.<br />
p 24<br />
23.07.<br />
Spülung mit <strong>octenisept®</strong>, Hydrogel auf die Fibrinbeläge<br />
und Nekrosen, Polyurethanstreifen mit <strong>octenisept®</strong><br />
getränkt und auf der Wundfläche verteilt.<br />
27.07.<br />
Es wurde so verbunden, dass die Wundflächen<br />
aneinander lagen.<br />
31.07.<br />
Angepasste Therapie:<br />
Proteasehemmer, kein Hydrogel mehr, Folienverband<br />
zur Abdeckung. <strong>octenisept®</strong> bleibt wesentlicher<br />
Bestandteil der Therapie wegen der Darmkeime.<br />
31.07.<br />
Obwohl die Patientin direkt in die Wunde abführt,<br />
sind keinerlei Entzündungszeichen vorhanden.
3 Weitere klinische Erfahrungen<br />
09.08.<br />
Entlassungsbefund.<br />
Die Patientin wird im Pflegeheim weiter versorgt.<br />
07.01.<br />
Da die Wunde noch nicht vollständig verschlossen ist,<br />
wird nach jedem Toilettengang der Wundbereich mit<br />
<strong>octenisept®</strong> besprüht.<br />
p 25
3 Weitere klinische Erfahrungen<br />
Zusammenfassung klinisch dokumentierter<br />
Erfahrung<br />
Chirurgische Ambulanz<br />
Erfahrungsbericht <strong>octenisept®</strong><br />
Dr. med. F. Biermann, Gronau, 24.05.1993<br />
Der Erfahrungsbericht von Herrn Dr. Biermann zeigt, dass<br />
bei der Wundversorgung von Schürf-, Biss- und Schnittwunden<br />
bei mehr als 1.000 Patienten in der Ambulanz<br />
eines Krankenhauses keine lokalen Nebenwirkungen, wie<br />
z. B. Rötungen, Schwellungen oder Wundheilungsstörungen,<br />
beobachtet wurden.<br />
Zusammenfassender Bericht über eine prospektive<br />
Anwendungsstudie mit <strong>octenisept®</strong><br />
Dr. Frick, Saarbrücken, 29.08.1995<br />
Die prospektive Anwendungsstudie mit <strong>octenisept®</strong> in<br />
der chirurgischen Ambulanz von Herrn Dr. Frick hatte<br />
zum Ziel, die objektiven und subjektiven Missempfindungen<br />
unmittelbar nach der Anwendung von <strong>octenisept®</strong><br />
zu dokumentieren.<br />
In die Bewertung wurden Schnitt-, Riss-, Quetsch- und<br />
Bisswunden sowie Ulzera cruris von 48 Patienten aufgenommen.<br />
In keinem Fall wurden Hautunverträglichkeiten,<br />
wie z. B. Rötungen oder Schwellungen, beobachtet.<br />
Außerdem wurden keine allergischen Reaktionen beobachtet<br />
und es traten keine Wundinfektionen auf.<br />
p 26<br />
Verbrennungspatienten<br />
Erfahrungsbericht über Verwendung von <strong>octenisept®</strong><br />
bei schwerer Verbrennungsverletzung<br />
M. Baerecke, A. Hiemetzberger, H. Piza,<br />
Krankenhaus Lainz/Wien, Januar 1993<br />
Im Krankenhaus Lainz (Wien) wurde <strong>octenisept®</strong> zur<br />
Wundversorgung bei einem schwerstverletzten Patienten<br />
eingesetzt.<br />
Der Patient erlitt Verbrennungen 2. bis 3. Grades (80 %),<br />
und <strong>octenisept®</strong> wurde zur adjuvanten Behandlung über<br />
drei Monate eingesetzt (systematische Behandlung mit<br />
Antibiotika, lokale Behandlung mit <strong>octenisept®</strong>).<br />
Der Patient wurde dabei zweimal täglich mit <strong>octenisept®</strong><br />
gewaschen und konnte damit über den Anwendungszeitraum<br />
infektionsfrei gehalten werden.<br />
Der Patient verstarb nach der Behandlung an der Verschlechterung<br />
seines Allgemeinzustandes. Ursächlich<br />
hierfür waren wahrscheinlich die schweren cerebralen<br />
Schäden, die der Patient durch einen Suizid-Versuch<br />
erlitten hatte.<br />
Erfahrungsbericht <strong>octenisept®</strong><br />
Primarius Dr. Wolf Pachinger, Klagenfurt, 09.09.1996<br />
<strong>octenisept®</strong> wird 1:1 verdünnt mit destilliertem Wasser,<br />
vordergründig bei Verbrennungswunden, aber auch bei<br />
Gewebsdefekten anderer Genese seit ca. zwei Jahren zur<br />
Anwendung gebracht. Hervorzuheben ist, dass <strong>octenisept®</strong><br />
von den Patienten ausgezeichnet toleriert wird und<br />
entsprechende mikrobielle Wirkung aufweist. Nebenwirkungen<br />
wurden bislang bei einer großen Anzahl von<br />
Patienten keine beobachtet.
3 Weitere klinische Erfahrungen<br />
Erfahrungsbericht (Ergebnisse) zur präoperativen<br />
Verwendung von <strong>octenisept®</strong> bei Schwerstverbrannten<br />
Oberarzt Dr. Menke,<br />
Berufsgen. Unfallklinik, Ludwigshafen, 17.01.2000<br />
In die Hauptstudie wurden 20 Patienten im Alter zwischen<br />
25 und 55 Jahren eingeschlossen, deren Verbrennungsgrad<br />
zwischen 20 % und 50 % lag. 15 Patienten<br />
waren Männer. Im Median waren 27,5 % der Körperoberfläche<br />
verbrannt. Verbrennungen 2. Grades betrafen<br />
im Median 17,8 % der Körperoberfläche, 13 % waren<br />
drittgradig verbrannt. Bei der Abschätzung der verwendeten<br />
Präparatemengen ergab sich eine gute Korrelation<br />
zwischen vorgelegter Präparatemenge und Zahl der<br />
verwendeten Kompressen. Je Behandlung kamen 1.450<br />
ml (Median) zur Applikation bei einer Range zwischen<br />
500 und 2.800 ml. Im Median wurde das Präparat acht<br />
Tage angewendet, bei einer Schwankungsbreite (Range)<br />
von 2 bis 13 Tagen. Bei keinem Patienten traten nach<br />
Anwendung mit dem Präparat <strong>octenisept®</strong> lokale Unverträglichkeitsreaktionen<br />
oder erkennbare systemische Nebenwirkungen<br />
auf, und die erhobenen Befunde ergaben<br />
keine Hinweise, dass die Anwendung des Präparates bei<br />
Schwerstverbrannten zur antiseptischen Behandlung vor<br />
Operationen oder bei Verbandwechseln kritisch oder zurückhaltend<br />
zu sehen ist. Die Befunde stehen vielmehr in<br />
guter Übereinstimmung mit den positiven Erfahrungen,<br />
die wir aus klinischer Sicht mit dem nun schon mehrere<br />
Jahre dauernden Einsatz des Präparates bei unseren<br />
Patienten gewonnen haben.<br />
Chirurgie<br />
Anwendungsbeobachtung von <strong>octenisept®</strong> zur präoperativen<br />
Haut- und Schleimhautantiseptik sowie zur unterstützenden<br />
Wund- und Nahtbehandlung bei Kleinkindern<br />
und Säuglingen<br />
1. Univ.-Klinik für Chirurgie, Prim. Doz. Dr. G. Menardi,<br />
Innsbruck, 23.04.1998<br />
Ziel dieser prospektiv durchgeführten Studie war es, die<br />
Anwendung von <strong>octenisept®</strong> an überwiegend Kleinkindern<br />
und Säuglingen systematisch über einen bestimmten<br />
Zeitraum zu erfassen. Dabei lag der Schwerpunkt der<br />
Anwendung von <strong>octenisept®</strong> neben der präoperativen<br />
Hautantiseptik insbesondere auf der postoperativen<br />
Wund- und Nahtversorgung, für die ein wässrig basiertes<br />
Präparat, aus Gründen der Verträglichkeit, im Vergleich<br />
zu einem alkoholbasierten Hautantiseptikum bevorzugt<br />
werden sollte. In die Studie eingeschlossen wurden 68<br />
Kinder, wobei 58 jünger als 8 Jahre waren. Das Präparat<br />
wurde bei septischen und aseptischen Operationen zur<br />
Haut- und Wunddesinfektion sowie vor postoperativen<br />
Verbandwechseln eingesetzt.<br />
Innerhalb der Nachbeobachtungszeit von vier bis 24<br />
Stunden nach Anwendung traten keine Reaktionen wie<br />
Schwellung, Rötung, allergische Reaktion, Papeln oder<br />
Nässen auf; ebenso konnten keine subjektiven Missempfindungen,<br />
wie Schmerzen, Brennen oder Jucken – soweit<br />
bei diesem Patienten gut erhebbar – mit <strong>octenisept®</strong> in<br />
Verbindung gebracht werden. Auch konnten über die<br />
Dauer der stationären Aufnahme keine Fälle von Wundinfektionen<br />
beobachtet werden, obgleich auch infektionsanfällige<br />
Eingriffe (z. B. Ventilrevision bei Hydrocephalus,<br />
Port-A-Katheter-Anlage) in die Zeit der Anwendungsbeobachtung<br />
fielen. Die systematische Erhebung von Daten<br />
zur Anwendung von <strong>octenisept®</strong> vor operativen Maßnahmen<br />
und zur Wundbehandlung bestätigt die in der Praxis<br />
beobachtete gute lokale Verträglichkeit des Präparates<br />
auch bei Kleinkindern und Säuglingen, so dass für eine<br />
sichere Anwendung auch in dieser Altersgruppe ausreichende<br />
Erfahrungen vorliegen.<br />
p 27
4 CD zum octenisept ® <strong>Wundkompendium</strong> – Der Verbandwechsel<br />
1. Vorbereitung des Verbandwechsels<br />
Festlegen der Reihenfolge: von rein zu unrein, Tourenplanung entsprechend festlegen<br />
1. Aseptische Wunden<br />
2. Kontaminierte Wunden<br />
3. Kolonisierte Wunden<br />
4. Infizierte Wunden<br />
5. Infizierte Wunden mit MRSA/ORSA oder VRE (Vancomycin resistente Enterokokken)<br />
• Patienteninformation<br />
• Analgesie und Wirkeintritt (mindestens 45 Minuten)<br />
abwarten. Emla-Creme kann auf zwei Arten appliziert<br />
werden:<br />
º Emla-Creme auf sterile, transparente Folie auftragen<br />
und diese anschließend auf die Wunde aufbringen<br />
º Die Emla-Creme kann direkt in die Wunde appliziert<br />
werden, da hierbei jedoch eine Kontaminationsgefahr<br />
besteht, ist diese Vorgehensweise nicht empfehlenswert<br />
• Arbeitsfläche schaffen (Wischdesinfektion)<br />
• Abwurfbehälter (nicht aus Glas gemäß UVV Unfallverhütungsverordnung)<br />
für benutzte Instrumente, spitze<br />
Gegenstände und Verbandstoffe bereitstellen<br />
• Fenster und Türen schließen<br />
• Keine anderen Tätigkeiten während des Verbandwechsels<br />
im Zimmer, wie Putzarbeiten, Betten machen<br />
• Unbeteiligte Personen und Haustiere fernhalten<br />
• Vorbereitung der benötigten Utensilien auf einer<br />
sauberen Unterlage (nichts im Patientenbett/auf dem<br />
Fußboden ablegen!)<br />
• Steriles Material patientenfern und unsteriles Material<br />
patientennah anordnen<br />
• Patienten entsprechend lagern<br />
• Schutzunterlage verwenden<br />
• Schutzkleidung/Einmalschürze anziehen<br />
(keine langärmeligen Jacken tragen)<br />
• Auf gute Beleuchtung achten<br />
• Materialien vorbereiten: <strong>octenisept®</strong> in Spritze aufziehen<br />
• Hände desinfizieren<br />
• Einmalhandschuhe anziehen<br />
p 28
4 CD zum octenisept ® <strong>Wundkompendium</strong> – Der Verbandwechsel<br />
Exkurs: die 6 Schritte der hygienischen Händedesinfektion (Standard-Einreibemethode gem. EN 1500)<br />
1 | Handfläche auf<br />
Handfläche<br />
2. Durchführung des Verbandwechsels<br />
• Anwendung des „Non-touch-Prinzips“ mit unsterilen<br />
Handschuhen und sterilen Instrumenten oder Verwendung<br />
steriler Handschuhe<br />
• Bei aufwendigen Verbandwechseln eine zweite Person<br />
zum Anreichen hinzuziehen<br />
• Alten Verband mit Einmalhandschuhen, tiefer liegende<br />
Tamponaden mit steriler Pinzette/sterilen Handschuhen<br />
abnehmen<br />
• Inspektion der alten Wundauflage, danach im bereitgestellten<br />
Abwurfbehälter entsorgen<br />
• Handschuhwechsel und hygienische Händedesinfektion<br />
• Aseptische Wunden von innen nach außen reinigen<br />
• Septische Wunden von außen nach innen reinigen<br />
• Wundumgebung nicht tupfen sondern wischen; pro Wischvorgang<br />
eine neue/n Kompresse/Tupfer verwenden<br />
• Reinigen mit geeigneter Spüllösung,<br />
z. B. NaCl 0,9 % / Ringerlösung<br />
• Infizierte und infektionsgefährdete Wunden mit einem<br />
zeitgemäßen Antiseptikum reinigen, entweder mit<br />
º satt getränktem Tupfer oder<br />
º durch Ausspülen von offenen, freiliegenden Wundhöhlen<br />
| Forts. nächste Seite = S. 30 |<br />
2 | Handfläche über<br />
Handrücken<br />
3 | Handfläche auf<br />
Handfläche mit<br />
verschränkten, gespreizten<br />
Fingern<br />
4 | Außenseite der verschränkten<br />
Finger auf<br />
gegenüberliegende<br />
Handflächen<br />
5 | Kreisendes Reiben<br />
des rechten Daumens<br />
in der geschlossenen<br />
linken Handfläche<br />
6 | Kreisendes Reiben<br />
mit geschlossenen Fingerkuppen<br />
der Hand<br />
in der Handfläche<br />
p 29
4 CD zum octenisept ® <strong>Wundkompendium</strong> – Der Verbandwechsel<br />
p 30<br />
| Forts. von Seite 29 |<br />
• Inspektion der gereinigten Wunde<br />
• Handschuhwechsel und hygienische Händedesinfektion<br />
• Phasengerechte und individuell angepasste Versorgung<br />
der Wunde nach ärztlicher Verordnung<br />
• Verband fixieren<br />
• Handschuhe entsorgen<br />
• Hygienische Händedesinfektion<br />
Nachsorge des Verbandwechsels<br />
• Patient in angenehme Sitz-/Liegeposition bringen<br />
• Wischdesinfektion der Arbeitsfläche<br />
(Flächendesinfektionsmittel)<br />
• Müllbeutel verschließen, erneuern und außerhalb des<br />
Zimmers entsorgen<br />
• Zur Instrumentenaufbereitung ist “wo immer möglich,<br />
| 93 |<br />
die Trockenentsorgung zu bevorzugen”<br />
Wo dies nicht möglich ist:<br />
º Gebrauchte Instrumente in Desinfektionslösung im entsprechenden<br />
Behältnis bis zur Wiederaufbereitung lagern<br />
• Hygienische Händedesinfektion<br />
• Dokumentation und Führung des Wundprotokolls<br />
Ein paar Hinweise – 1. Wundgrößenbestimmung<br />
Es gibt verschiedene Möglichkeiten,<br />
die Wundgröße zu bestimmen:<br />
• Visuelle Einschätzung: ungenau, da subjektiv<br />
• Durchmessererfassung mit Einmalpapierlineal:<br />
Erfassung der größten Länge und Breite mit Orientierung<br />
anhand der Körperachsen; die Achsen stehen dabei im<br />
rechten Winkel zueinander<br />
• Tiefenbestimmung: mit sterilen Materialien wie z. B.<br />
Pinzette, Knopfkanüle, Spülkatheter, skalierte Messsonde<br />
und anschließender Größenangabe unter Zuhilfenahme<br />
eines Einmalpapierlineals; Achtung: bei Verwendung von<br />
sterilen Watteträgern besteht die Gefahr, dass Rückstände<br />
in der Wunde verbleiben!
4 CD zum octenisept ® <strong>Wundkompendium</strong> – Der Verbandwechsel<br />
• Unterminierung (Taschenbildung): Bestimmung nach der<br />
Uhrmethode (z. B. 12 Uhr kopfwärts und 6 Uhr fußwärts);<br />
ebenfalls unter Zuhilfenahme steriler Materialien<br />
(s. Tiefenbestimmung)<br />
• Tracing/Planimetrie: computergestützt und manuell;<br />
die Wundmaße werden durch Nachzeichnen auf einer<br />
sterilen gerasterten Wundfolie und anschließendem<br />
Kästchenzählen ermittelt; ein Kästchen entspricht einer<br />
Größeneinheit von 1 cm2 ; bei Verwendung einer doppelseitigen<br />
sterilen Folie wird die obere, nicht kontaminierte<br />
Folie in die Wunddokumentation abgeheftet; Achtung:<br />
Erstellungsdatum und Lage der Wunden kennzeichnen<br />
• EDV-gestützte Vermessung durch z. B. punktuelle<br />
Erfassung der Form des Wundrandes<br />
• Volumenbestimmung mit Flüssigkeit: Abkleben der<br />
Wunde mit einer sterilen Transparentfolie; dann angewärmte<br />
Ringerlösung oder NaCl 0,9 %-Lösung in einer<br />
Spritze aufziehen und unterhalb der Folie in die Wunde<br />
befüllen; anschließend Angabe des Wundvolumens in<br />
„ml“. Aufgrund der möglichen Verletzungsgefahr bei der<br />
letztgenannten Methode sind aus Gründen der Sicherheit<br />
die anderen beschriebenen Methoden zu bevorzugen.<br />
2. Wundreinigung und Wundrandschutz<br />
• Zum Anlösen von Fibrinbelägen ist es mitunter hilfreich, einige Zeit vor dem mechanischen Debridement mit<br />
<strong>octenisept®</strong>-getränkte Kompressen aufzulegen.<br />
• Die Kompressen können einfach im sterilen Originalbehältnis der Kompresse befeuchtet werden.<br />
• Wundrand schützen, z. B. einen transparenten Hautschutzfilm mit Cavilon. Da bekanntermaßen die Wunde vom<br />
Wundrand her zuwächst, ist dieser Bereich insbesondere vor Feuchtigkeit und Mazeration zu schützen.<br />
Dabei ist darauf zu achten, dass Cavilon dünn aufgetragen wird.<br />
p 31
4 CD zum octenisept ® <strong>Wundkompendium</strong> – Der Verbandwechsel<br />
3. Ultraschallassistierte (UAW) Wundreinigung<br />
Die UAW ist eine hocheffiziente Form der Wundreinigung. Aufgrund der starken Aerosolbildung und der damit verbundenen<br />
Keimübertragung sollte die Reinigungsflüssigkeit antimikrobiell wirksam sein. In vielen Kliniken wird hierzu in der<br />
Apotheke verdünntes <strong>octenisept®</strong> hergestellt (<strong>octenisept®</strong> mit 0,9 % NaCl-Lösung 1:1 verdünnt). Die UAW wird hierdurch<br />
nicht negativ beeinträchtigt. Dieses Vorgehen gewährleistet eine größtmögliche Sicherheit.<br />
4. Keimabstrich aus der Wunde<br />
Bei Verdacht auf Anaerobier (Wundgeruch!) ist ein schneller Transport in das Labor wichtig. Auf eine Kühlschranklagerung<br />
sollte verzichtet werden, da Anaerobier leicht absterben.<br />
Bei Entnahme aus Fistelmündungen mit einem Hautdesinfektionsmittel (octeniderm® oder kodan® tinktur forte) oder<br />
<strong>octenisept®</strong> oberflächlich desinfizieren und anschließend mit kleinem Abstrichtupfer Material aus der Tiefe gewinnen.<br />
Bei trockenen Wunden und granulomatösen Veränderungen ist statt Abstrich eine Probeexzision vorzuziehen. Vor allem<br />
bei langen Verläufen mit kleiner Ulcusbildung und passender Anamnese (Wasserkontakt, z. B. Aquarium) Untersuchung<br />
auf MOTT (Mycobacteria other than tubercle bacilli), z. B. Mycobacterium marinum, anfordern, da dies nicht zum Laborroutineprogramm<br />
bei Wundabstrichen gehört.<br />
Verschorfte und trockene Katheteraustrittsstellen mit befeuchtetem Tupfer (steriles Aqua bidest. oder sterile physiologische<br />
Kochsalzlösung) abstreichen. Weitere tiefergehende Informationen können den Empfehlungen der American<br />
Society for Microbiology entnommen werden. |9|<br />
p 32<br />
Abstrichtupfer zur Proben-Entnahmne<br />
Wunde mit der getränkten Kompresse reinigen und befeuchten<br />
Sterile Kompresse mit isotonischer Kochsalzlösung befeuchten<br />
Abstrichtupfer entnehmen
4 CD zum octenisept ® <strong>Wundkompendium</strong> – Der Verbandwechsel<br />
Probenentnahme von der gesamten Wundfläche. Achtung: Die Entnahme sollte möglichst aus den tieferen Wundschichten erfolgen,<br />
um nicht die oberflächliche, unkritische Wundbesiedelung zu erfassen.<br />
Tupfer in das Transport-Behältnis mit Nährmedium packen und beschriften.<br />
5. Hinweise zu octenisept ®<br />
• Bei Wundspüllungen ist darauf zu achten, dass das Präparat nicht unter Druck ins Gewebe eingebracht bzw. injiziert wird.<br />
• Bei Spülungen von Wundkavitäten ist darauf zu achten, dass ein Abfluss jederzeit gewährleistet ist (z. B. Drainage, Lasche).<br />
• <strong>octenisept®</strong> nach Gebrauch verschließen und das Behältnis ggf. Wisch-Desinfizieren.<br />
• <strong>octenisept®</strong> stets aus Originalgebinden verwenden und nicht mit anderen Präparaten mischen.<br />
• Die Einwirkzeit von mindestens einer Minute ist einzuhalten und darf nicht durch vorheriges Abtrocknen verkürzt werden.<br />
• Verbände, Inzisionsfolien können nach vollständigem Abtrocknen von <strong>octenisept®</strong> angelegt werden.<br />
• Spülungen der Nasenhöhle sind zu vermeiden.<br />
• <strong>octenisept®</strong> nicht mit Antiseptika auf PVP-Iod-Basis auf benachbarten Hautarealen<br />
verwenden, da es in den Grenz-bereichen zu starken braunen bis violetten<br />
Veränderungen kommen kann.<br />
• <strong>octenisept®</strong> sollte nicht zu Spülungen in der Bauchhöhle (z. B. intraoperativ) und<br />
der Harnblase und nicht am Trommelfell angewendet werden.<br />
• <strong>octenisept®</strong> nicht in größeren Mengen verschlucken oder in größeren Mengen<br />
in den Blutkreislauf, z. B. durch versehentliche Injektion, gelangen.<br />
• <strong>octenisept®</strong> kann bis auf Körpertemperatur erwärmt und gelagert werden.<br />
p 33
Literatur<br />
| 1 | Kerstin Protz, Moderne Wundversorgung (4. Aufl., 2007), Elsevier Verlag,<br />
| 2 | Standards (Leitlinien Verbandwechsel ambulant, Leitlinien Verbandwechsel stationär) Wundzentrum Hamburg<br />
p 34<br />
(www.wundzentrum-hamburg.de) und Robert-Koch-Institut (www.rki.de)<br />
| 3 | Instrumentenaufbereitung richtig gemacht, Arbeitskreis Instrumenten-Aufbereitung,<br />
Mörfelden-Walldorf 2005, 8. Auflage, Seite 20<br />
| 4 | A. Schwarzkopf, V. Gerber und J. Siebert, ZfW 3 (2003) 85-87<br />
| 5 | A. Kramer, G. Müller und O. Assadian, GMS Krankenhaushyg Interdiszip 2006; 1 (1): Doc 32<br />
|6 | <strong>octenisept®</strong> und moderne Wundauflagen, P. Goroncy-Bermes, H. Brill, B. Christiansen, H. Braunwarth.,<br />
Wird die lokale Wirksamkeit von Wundantiseptika durch moderne Wundauflagen beeinträchtigt?<br />
Zeitschrift für Wundheilung, 5 (2002): 177 – 181 (Teil 1)<br />
| 7 | G. Müller und A. Kramer, Journal of Orthopaedic Research 23 (2005) 127 – 133<br />
| 8 | C. Biehl und M. Ressel, Interner Erfahrungsbericht S&M, Dannenberg März 1996<br />
| 9 | American Society for Microbiology, Murray et al (ed.), Manual of Clinical Microbiology Specimen Collection,<br />
Transport and Storage ASM Press 1995
Pflichttexte<br />
| D |<br />
octenisept ® :<br />
• Zusammensetzung: Arzneilich wirksame Bestandteile: 100g Lösung enthalten: Octenidinhydrochlorid 0,1g, Phenoxyethanol (Ph.Eur.) 2,0g · Sonstige Bestandteile : (3-Cocosfettsäure-<br />
amidopropyl)-dimethylazaniumylacetat, Natrium-D-gluconat, Glycerol 85%, Natriumchlorid, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser. • Anwendungsgebiete: Zur wiederholten, zeitlich<br />
begrenzten antiseptischen Behandlung von Schleimhaut und angrenzender Haut vor diagnostischen und operativen Maßnahmen – im Ano-Genitalbereich von Vagina, Vulva, Glans<br />
penis, auch vor Katheterisierung der Harnblase – in der Mundhöhle. Zur zeitlich begrenzten unterstützenden Therapie bei Pilzerkrankungen der Haut zwischen den Zehen sowie zur<br />
unterstützenden antiseptischen Wundbehandlung. • Gegenanzeigen: <strong>octenisept®</strong> sollte nicht zu Spülungen in der Bauchhöhle (z. B. intraoperativ) und der Harnblase und nicht am<br />
Trommelfell angewendet werden. <strong>octenisept®</strong> sollte nicht bei Unverträglichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe angewendet werden. • Nebenwirkungen: Als subjektives Symptom<br />
kann in seltenen Fällen ein vorübergehendes Brennen auftreten. Bei Spülungen in der Mundhöhle verursacht <strong>octenisept®</strong> vorübergehend einen bitteren Geschmack. Sollten Sie andere<br />
als die hier beschriebenen Nebenwirkungen bei sich feststellen, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit. • Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:<br />
Um möglichen Gewebeschädigungen vorzubeugen ist darauf zu achten, dass das Präparat nicht unter Druck ins Gewebe eingebracht bzw. injiziert wird. Bei Wundkavitäten muss ein<br />
Abfluss jederzeit gewährleistet sein (z. B. Drainage, Lasche). <strong>octenisept®</strong> nicht in größeren Mengen verschlucken oder in größeren Mengen in den Blutkreislauf, z. B. durch versehentliche<br />
Injektion, gelangen lassen. (v01)<br />
| A |<br />
octenisept ® – Lösung zur Wund- und Schleimhautdesinfektion:<br />
Z. Nr. 1-20402 • Stoffgruppe: Antiseptikum • Zusammensetzung: 100 g enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Octenidindihydrochlorid 0,1 g, 2-Phenoxyethanol 2,0 g, in wässriger<br />
Lösung. • Eigenschaffen und Wirksamkeit: Die mikrobielle Wirksamkeit erstreckt sich auf die Bakterizidie, Fungizidie und Wirksamkeit gegenüber lipophilen und Hepatitis B-Viren. Die<br />
Wirksamkeitsspektren von 2-Phenoxyethanol und Octenidindihydrochlorid ergänzen einander diesbezüglich ausgezeichnet. Klinische Untersuchungen zur Wirksamkeit an der Vaginalund<br />
Mundschleimhaut wiesen Keimreduktionsfaktoren auf, die häufig besser als die anderer Präparate zu beurteilen sind. Diese Reduktionen ergaben sich sowohl für die Sofort- als auch<br />
für die Langzeitwirkung. Die Wirksubstanz Octenidindihydrochlorid wird durch die Haut oder die Schleimhaut nicht, der Wirkstoff 2-Phenoxyethanol nur in vernachlässigbarem Ausmaß<br />
resorbiert. Das Präparat wird als bitter empfunden. • Anwendungsgebiete: Zur antiseptischen Behandlung von Schleimhaut und Übergangsepithel, vor operativen Eingriffen. In der<br />
Mundhöhle (z. B. vor Zahnextraktionen oder Kürettagen.) Im Urogenitalbereich (z. B. vor Hysterektomien) und im Rektalbereich (z. B. vor dem Veröden von Hämorrhoiden). Zur Wund- und<br />
Nahtversorgung. Auch zur antiseptischen Behandlung infizierter Wunden der Haut. • Art der Anwendung: Auf die zu desinfizierenden Areale auftragen. Gegebenenfalls kann, insbesondere<br />
im Bereich der Mundhöhle, auch eine Spülung vorgenommen werden. • Anwendungshinweis: Es wird empfohlen, zum Verdünnen keimfreies, gereinigtes Wasser (früher: Aqua<br />
Bidestillata) zu verwenden. • Dosierung: Die zu desinfizierenden Areale vollständig benetzen und 1 Min. einwirken lassen. Bei Spülungen der Mundhöhle soll mit ca. 20 ml <strong>octenisept®</strong><br />
20 Sek. lang intensiv gespült und eine zusätzliche Einwirkzeit von 1 Min. vorgesehen werden. • Gegenanzeigen: Bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Bestandteile des Präparates.<br />
• Schwangerschaft und Stillperiode: <strong>octenisept®</strong> kann in der Schwangerschaft und Stillperiode angewendet werden. • Nebenwirkungen: Der bei Mundspülungen auftretende bittere<br />
Geschmack hält ca. eine Stunde an und hängt mit der Langzeitwirkung zusammen. • Besondere Warnhinweise zur sicheren Anwendung: <strong>octenisept®</strong> sollte nicht gleichzeitig mit<br />
PVP-Jod angewendet werden. <strong>octenisept®</strong> sollte nicht am Trommelfell angewendet werden. <strong>octenisept®</strong> ist nicht zur Daueranwendung vorgesehen. <strong>octenisept®</strong> sollte nicht in größeren<br />
Mengen verschluckt werden. Wird eine größere Menge verschluckt, so kann es zu Reizungen der Magen- und Darmschleimhaut kommen. Bei Wundspüllungen ist darauf zu achten,<br />
dass das Präparat nicht unter Druck ins Gewebe eingebracht bzw. injiziert wird. Bei Spülungen von Wundkavitäten ist darauf zu achten, dass ein Abfluss jederzeit gewährleistet ist (z. B.<br />
Drainage, Lasche). Für Kinder unerreichbar aufbewahren. • Packungsgrößen: 50 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml • Haltbarkeit: 60 Monate. • Abgabe: Rezeptfrei, apothekenpflichtig.<br />
Der vollständige Text ist dem Austria Codex Fachinformationen zu entnehmen.<br />
| CH |<br />
octenisept ®<br />
• Zus: 1 mg Octenidinhydrochlorid/ml • Ind: Haut- und Schleimhautdesinfektion vor operativen und diagnostischen Eingriffen im Urogenital- und Rektalbereich. Vor Katheterisierung der<br />
Harnröhre oder Untersuchungen der Gebärmutter. Desinfektion der Mundschleimhaut. Desinfektion bei Verletzungen, Wunden und zur Nahtversorgung. <strong>octenisept®</strong> farblos ist für die<br />
Anwendung bei Säuglingen und Frühgeborenen geeignet. • Anwendung: Mittels Tupfer die zu desinfizierenden Areale vollständig benetzen und 1 min einwirken lassen. Mundhöhlenspülung:<br />
mit 20 ml <strong>octenisept®</strong> farblos 20 Sek intensiv spülen und 1 min einwirken lassen. • KI: Nicht am Auge und Ohr anwenden! Überempfindlichkeit • UAW: Geschmacksstörungen,<br />
Brennen, leichte Parästhesien, aseptische Peritonitis nach intraperitonealer Anwendung. Abgabekategorie D<br />
Die vollständige Fachinformation ist im Arzneimittelkompendium der Schweiz publiziert.<br />
Zul.-Nr./ No. AMM: 49 853 084<br />
Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:<br />
<strong>Schülke</strong> & <strong>Mayr</strong> GmbH, 22840 Norderstedt<br />
p 35
schülke weltweit:<br />
China<br />
<strong>Schülke</strong>&<strong>Mayr</strong> GmbH<br />
Shanghai Representative Office<br />
Shanghai 200041<br />
Telefon +86-21-62 17 29 95<br />
Telefax +86-21-62 17 29 97<br />
Italien<br />
<strong>Schülke</strong>&<strong>Mayr</strong> Italia S.r.l.<br />
20148 Mailand<br />
Telefon +39-02-40 21 820<br />
Telefax +39-02-40 21 829<br />
Polen<br />
Schulke Polska Sp. z o.o.<br />
01-793 Warszawa<br />
Telefon +48-22-568 22 02-03<br />
Telefax +48-22-568 22 04<br />
... sowie unsere internationalen Distributeure<br />
<strong>Schülke</strong>&<strong>Mayr</strong> GmbH<br />
22840 Norderstedt | Deutschland<br />
Telefon | Telefax +49 40 521 00 -0 | -318<br />
www.schuelke.com<br />
Ein Unternehmen der<br />
Air Liquide-Gruppe<br />
Deutschland<br />
<strong>Schülke</strong>&<strong>Mayr</strong> GmbH<br />
22840 Norderstedt<br />
Telefon +49-40-521 00 0<br />
Telefax +49-40-521 00 318<br />
Malaysia<br />
<strong>Schülke</strong>&<strong>Mayr</strong> (Asia) Sdn Bhd<br />
46000 Petaling Jaya, Selangor<br />
Telefon +60-3-77 83 56 98<br />
Telefax +60-3-77 84 79 31<br />
Schweiz<br />
<strong>Schülke</strong>&<strong>Mayr</strong> AG<br />
8003 Zürich<br />
Telefon +41-44-466 55 44<br />
Telefax +41-44-466 55 33<br />
Frankreich<br />
<strong>Schülke</strong> France SARL<br />
94250 Gentilly<br />
Telefon +33-1- 49 69 83 78<br />
Telefax +33-1- 49 69 83 85<br />
Niederlande<br />
<strong>Schülke</strong>&<strong>Mayr</strong> Benelux B.V.<br />
2003 LM-Haarlem<br />
Telefon +31-23-535 26 34<br />
Telefax +31-23-536 79 70<br />
Singapur<br />
<strong>Schülke</strong>&<strong>Mayr</strong> (Asia) Pte. Ltd.<br />
Singapur 768767<br />
Telefon +65-62-57 23 88<br />
Telefax +65-62-57 93 88<br />
Großbritannien<br />
<strong>Schülke</strong>&<strong>Mayr</strong> UK Ltd.<br />
Sheffield S9 1AT<br />
Telefon +44-114-254 35 00<br />
Telefax +44-114-254 35 01<br />
Österreich<br />
<strong>Schülke</strong>&<strong>Mayr</strong> Ges.m.b.H.<br />
1070 Wien<br />
Telefon +43-1-523 25 01 0<br />
Telefax +43-1-523 25 01 60<br />
2033 | III | 09.09 | A | westwerk<br />
Produktinformation wird nicht vom Änderungsdienst erfasst.<br />
HI_D v_04