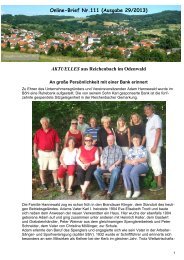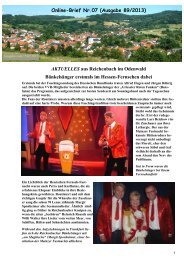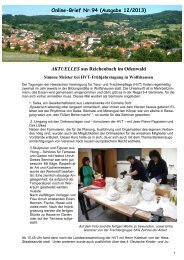Unser Wasser - Verschönerungsverein Reichenbach
Unser Wasser - Verschönerungsverein Reichenbach
Unser Wasser - Verschönerungsverein Reichenbach
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Unser</strong> <strong>Wasser</strong><br />
<strong>Unser</strong> <strong>Wasser</strong><br />
Geschichte und Geschichten<br />
über die <strong>Reichenbach</strong>er Quellen,<br />
Brunnen & <strong>Wasser</strong>werke
<strong>Unser</strong> <strong>Wasser</strong><br />
Geschichte und Geschichten<br />
über die <strong>Reichenbach</strong>er Quellen,<br />
Brunnen und <strong>Wasser</strong>werke
Inhalt<br />
4 Vorwort<br />
4 Bürgermeister Kaltwasser<br />
5 <strong>Wasser</strong> - Urquell des Lebens<br />
6 Die Entwicklungsgeschichte der <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
7 Die ersten Brunnen<br />
8 Die Entstehung des Trinkwassernetzes<br />
12 Die Dienstanweisung für den „Rohrmeister“<br />
13 Die Brunnen bleiben weiterhin wichtig<br />
13 Das <strong>Reichenbach</strong>er Schwimmbad<br />
14 Jetzt auch <strong>Wasser</strong>gebühren<br />
14 Die <strong>Wasser</strong>versorgung ist erneut unzureichend<br />
16 Die Errichtung eines Gemeindebades<br />
17 Die Gemeinde errichtet einen Hochbehälter<br />
18 Die <strong>Wasser</strong>versorgung ist schon wieder unzureichend<br />
19 Eine Steuerungsanlage hilft<br />
20 Die Brunnen gewinnen wieder an Bedeutung<br />
20 Der Brunnen in der Bangertgasse<br />
21 Der Brunnen in der Beedenkirchener Straße<br />
22 Der Brunnen in der Friedhofstraße<br />
23 Der Brunnen im Brandauer Klinger<br />
24 Der Brunnen in der Hohensteiner Straße - Vorbachbrunnen<br />
25 Der Brunnen im Rödchen<br />
26 Der Brunnen am Marktplatz<br />
29 Qualitätssicherung ist heute oberstes Gebot<br />
29 Aktuelle Kosten der Trinkwasserversorgung<br />
30 Daseinsfürsorge - früher und heute<br />
31 Quellenangaben/Bildnachweis/Impressum
4<br />
Vorwort<br />
„Alles ist aus dem <strong>Wasser</strong> geworden“,<br />
stellte der griechische<br />
Philosoph Thales vor über 2500<br />
Jahren fest.<br />
„Das <strong>Wasser</strong> kann ohne Fische<br />
auskommen, aber kein einziger<br />
Fisch ohne <strong>Wasser</strong>“, so lautet ein<br />
bekanntes chinesisches Sprichwort,<br />
das die Abhängigkeit des<br />
Lebens vom <strong>Wasser</strong> auf den<br />
Punkt bringt.<br />
Gutes, gesundes <strong>Wasser</strong> gehört<br />
zum größten Vermögen einer<br />
Gesellschaft, ist ein Schatz, den<br />
wir unbedingt erhalten müssen.<br />
Wenn wir an unsere Kinder denken,<br />
wissen wir sofort, dass sich<br />
dieser Aufwand lohnt. Wir müssen<br />
uns stets ins Bewusstsein<br />
rufen, dass <strong>Wasser</strong> der Ursprung<br />
allen Lebens ist. Das <strong>Wasser</strong> ist<br />
alles und ins <strong>Wasser</strong> kehrt alles<br />
zurück.<br />
<strong>Unser</strong> <strong>Wasser</strong><br />
Was weltweit zum Nachdenken<br />
anregen sollte, könnte in Deutschland<br />
leicht als Randerscheinung<br />
untergehen.<br />
Denn wir leben - zum Glück - in<br />
einer Region, in der <strong>Wasser</strong> im<br />
Überfluss vorhanden ist. Jederzeit<br />
sauberes <strong>Wasser</strong> zur Verfügung<br />
zu haben, ist für uns daher<br />
selbstverständlich.<br />
In vielen Teilen der Erde ist das<br />
<strong>Wasser</strong> jedoch knapp und deshalb<br />
äußerst kostbar. Der Zugang<br />
zum <strong>Wasser</strong> ist zuweilen hart umkämpft,<br />
bis hin zu kriegerischen<br />
Auseinandersetzungen.<br />
Das „<strong>Reichenbach</strong>er <strong>Wasser</strong>buch“<br />
gibt einen anschaulichen<br />
geschichtlichen Abriss der Entwicklung<br />
der <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
unter besonderer Betrachtung<br />
der Brunnen im Ort und vermittelt<br />
dem interessierten Leser eine exakte<br />
Zustandsbeschreibung.<br />
Den Initiatoren, allen voran dem<br />
<strong>Verschönerungsverein</strong> <strong>Reichenbach</strong><br />
als Herausgeber der Schrift<br />
sowie dem Redaktionsteam sei<br />
für diese gelungene Arbeit herzlich<br />
gedankt.<br />
Ihr<br />
Jürgen Kaltwasser,<br />
Bürgermeister
<strong>Wasser</strong> - Urquell des Lebens<br />
Es rieselt vom Himmel, sprudelt<br />
aus Quellen, murmelt in Bächen,<br />
dümpelt in Teichen und fließt aus<br />
der Leitung.<br />
<strong>Wasser</strong> stand am Anfang des<br />
Lebens auf unserer Erde.<br />
<strong>Wasser</strong> gibt es im Überfluss und<br />
ist dennoch so knapp.<br />
<strong>Wasser</strong> ist unser Lebensmittel<br />
Nummer eins und für uns alle<br />
lebensnotwendig.<br />
Sinnbild des <strong>Wasser</strong>s und somit<br />
des Lebens ist der Brunnen.<br />
Franz Schubert (1790 - 1828) hat<br />
ihn an den Anfang seines wohl<br />
bekanntesten Werkes gesetzt.<br />
Mit der „schaurig schönen“ Tonfolge<br />
vom „Am Brunnen vor<br />
dem Tore, da steht ein Lindenbaum;<br />
ich träumt in seinem<br />
Schatten, so manchen süßen<br />
Traum“ preist er in der „Winterreise“<br />
den Brunnen als <strong>Wasser</strong>- und<br />
Lebensspender.<br />
Wir wollen es Schubert nachtun<br />
und mit dieser Schrift die Brunnen<br />
in <strong>Reichenbach</strong> in den Mittelpunkt<br />
des Interesses rücken. Damit<br />
verbinden möchten wir die<br />
Geschichte des <strong>Reichenbach</strong>er<br />
Trink- und Brauchwassers, das<br />
für Menschen, Tiere und Pflanzen<br />
so lebensnotwendig war und ist.<br />
<strong>Unser</strong> <strong>Wasser</strong> 5
6<br />
Die Entwicklungsgeschichte der <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Als vor knapp eintausend Jahren,<br />
Anno Domini 1012, „Richinbach“<br />
zum ersten Mal urkundlich erwähnt<br />
wurde, war die Gemarkung<br />
„Wildbann“ des Abtes Bobbo<br />
von Lorsch. <strong>Reichenbach</strong> war<br />
als zentrale Stelle Sitz einer Wildhube.<br />
Zu ihr gehörten Wohnhaus,<br />
Scheuer, Stall, Backhaus und die<br />
nötigen Äcker und Wiesen [3].<br />
Weitere Ansiedlungen gab es<br />
nicht oder nur in geringer Zahl,<br />
so dass das Trinkwasser für<br />
Mensch und Tier wohl aus den<br />
zahlreichen Bächen <strong>Reichenbach</strong>s<br />
(Lauter, Graulbach, Vorbach,<br />
<strong>Reichenbach</strong> u.a.) entnommen<br />
wurde.<br />
<strong>Unser</strong> <strong>Wasser</strong><br />
Eine natürlich gefasste Quelle<br />
gab es am Fuße des Felsenmeers.<br />
Dort ermordete Hagen<br />
von Tronje nach der im 13. Jahrhundert<br />
entstandenen Nibelungensage<br />
hinterhältig Siegfried,<br />
als er sich an der Quelle erfrischen<br />
wollte.<br />
Der Nibelunge Siegfried bestand<br />
in seiner Jugend viele Abenteuer.<br />
So tötete er einen Lindwurm, in<br />
dessen Blut er badete und darauf<br />
scheinbar unverwundbar gegen<br />
Eisen und Stahl wurde. Jedoch<br />
fiel ihm ein Lindenblatt zwischen<br />
die Schulterblätter und an dieser<br />
Stelle war er verwundbar. Brunhild,<br />
die von Siegfrieds Gattin<br />
Kriemhild davon erfuhr,<br />
beauftragte Hagen<br />
von Tronje, Siegfried<br />
bei der Jagd zu<br />
ermorden. Diesen<br />
Auftrag erfüllte er an<br />
der „Siegfriedsquelle“<br />
im Felsenmeer.<br />
Da die Nibelungensage,<br />
ein Lied mit über<br />
2000 Strophen, auf<br />
die Geschehnisse der<br />
Völkerwanderungszeit<br />
zurückgeht und später<br />
vielfach ergänzt und<br />
auch geografisch verändert<br />
wurde, pochen<br />
heute auch andere<br />
Orte auf den „Original-<br />
Siegfriedsbrunnen“.<br />
Doch für die <strong>Reichenbach</strong>er<br />
steht fest,<br />
dass nur am Felsenmeer der Original-Schauplatz<br />
gewesen sein<br />
kann. Auch deshalb wurde im<br />
Jubiläumsjahr der Siegfriedsage<br />
die Inschrift an der Quelle aufgefrischt<br />
und das Areal um die<br />
geschichtsträchtige Quelle immer<br />
wieder gepflegt.<br />
Mit der Zunahme der Bürger im<br />
fünfzehnten und sechzehnten<br />
Jahrhundert reichten die ungefassten<br />
Quellen und Bäche nicht<br />
mehr aus. Wie in vielen anderen<br />
Dörfern des Odenwaldes waren<br />
zur <strong>Wasser</strong>gewinnung schon<br />
Anstauungen der Bäche erforderlich<br />
[1].<br />
Doch diese Art der <strong>Wasser</strong>gewinnung<br />
schloss Verunreinigungen<br />
nicht aus, ja förderte Krankheiten<br />
an Mensch und Tier. Deshalb<br />
wurden im Laufe der Entwicklung<br />
<strong>Reichenbach</strong>s immer mehr Quellen<br />
gefasst, ihr Einzugsgebiet<br />
geschützt und das Trink- oder<br />
Brauchwasser direkt den Menschen<br />
und Tieren zugeleitet.
Die ersten Brunnen<br />
Der erste öffentlich nutzbare<br />
Brunnen, gespeist von einer<br />
gefassten Quelle, war nachweislich<br />
der Marktplatzbrunnen. Der<br />
protestantische Pfarrer Martin<br />
Walther (1569 - 1635), der mit<br />
seinen Aufzeichnungen in den<br />
Kirchenbüchern ein weithin einmaliges<br />
Dokument der Dorfgeschichte<br />
geliefert hat, schreibt<br />
hierzu: „Den 14. Nov. 1603 ist<br />
von Sebastian Platzern, Kunststeiger<br />
des Bergwerks, der Bronn<br />
beym Rathaus anderst und von<br />
neuem gelegt worden“[5].<br />
Daraus lässt sich ableiten, dass<br />
dieser Brunnen wohl schon längere<br />
Zeit bestand. Er dürfte um das<br />
Jahr 1600 etwa 200 Einwohnern<br />
[2] als <strong>Wasser</strong>spender gedient<br />
haben. Die Erneuerungsarbeiten<br />
am Marktplatzbrunnen weckten<br />
bei den „Unterdörfern“ den<br />
Wunsch nach einem eigenen<br />
Brunnen. Dieser wurde 1614 erfüllt,<br />
wie Pfarrer Walther schreibt:<br />
Der Marktplatzbrunnen vor dem<br />
Kriegerdenkmal von 1870/71 [3]<br />
„Hat der Herr Ambtmann gutgeheißen,<br />
daß auch ein Bronn<br />
bey des Schultheißen Hauß<br />
(Scharschmidt, Friedhofstraße)<br />
auff der Gassen springen soll<br />
und dem Bronnen den Namen<br />
geben Haderbronn“.<br />
Gespeist wurden beide Brunnen<br />
von einer gefassten Quelle in der<br />
Brunnenstube, deren Ergiebigkeit<br />
wohl hoch war und zumindest<br />
beim Brunnen in der Friedhofstraße<br />
auch heute noch ist. Über<br />
Bauweise und -material ist nichts<br />
bekannt. Zumindest der Marktplatzbrunnen<br />
änderte seine Form<br />
und sein Aussehen über die Jahrhunderte<br />
vielfach.<br />
Nach Richard Matthes, dem ersten<br />
Verfasser des <strong>Reichenbach</strong>er<br />
Heimatbuches im Jahre<br />
1936, „floß das <strong>Wasser</strong> unterirdisch<br />
durch Röhren aus Kiefernholz<br />
(Deicheln), die gewöhnlich<br />
auf dem Marktplatz unter Aufsicht<br />
eines Bensheimer Bohrmeisters<br />
von den <strong>Reichenbach</strong>er Zimmerleuten<br />
gebohrt wurden. Damit<br />
diese Deicheln widerstandsfähig<br />
wurden, legte man sie noch eini-<br />
Beim Bohren der Deicheln<br />
(hölzerne <strong>Wasser</strong>leitungsrohre) [3]<br />
ge Zeit in einen Teich im<br />
Rödchen. Die dortige Wiese heißt<br />
heute noch die Teichwiese“.<br />
Nach dem dramatischen Rückgang<br />
der Bevölkerung im Glaubenskrieg<br />
von 1618 - 1648 stieg<br />
die Zahl der Einwohner bis zum<br />
Jahre 1800 auf über 500 an [2].<br />
Diese benötigten mehr und auch<br />
besseres <strong>Wasser</strong>, als es die<br />
Bäche und die beiden Brunnen<br />
liefern konnten. Deshalb fassten<br />
sich immer mehr Bürger ihre<br />
eigenen Quellen, oder förderten<br />
ihr Trinkwasser aus gemeinsam<br />
errichteten Brunnen.<br />
Dies lässt sich aus der Geschichtsschreibung<br />
und auch<br />
aus dem Archiv der Gemeinde<br />
nicht nachweisen. Es ist jedoch<br />
davon auszugehen, dass in <strong>Reichenbach</strong><br />
die Entwicklung analog<br />
der in den umliegenden Ortschaften,<br />
z.B. wie in Schannenbach<br />
verlief, wo Vereinbarungen<br />
über diese vertraglich gesicherten<br />
<strong>Wasser</strong>rechte anschaulich<br />
von Hermann Bauer [1] geschildert<br />
werden.<br />
<strong>Unser</strong> <strong>Wasser</strong> 7
8<br />
In <strong>Reichenbach</strong> gingen die Verantwortlichen<br />
der Gemeinde früh<br />
den Weg einer gemeinsamen<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung. So fasste der<br />
Gemeinderat 1892 den Beschluss<br />
über die „Anlegung eines<br />
neuen Brunnens im Oberdorf“.<br />
Dazu war eine Regelung mit dem<br />
Grundstückseigentümer „Gastwirt<br />
Andreas Lampert von <strong>Reichenbach</strong>“<br />
erforderlich, die am<br />
17. Dezember zustande kam. In<br />
ihr wurde der Kauf der Quelle im<br />
Vorbach vereinbart, um deren<br />
<strong>Wasser</strong> langfristig nutzen zu können.<br />
Als Preis wurden 50 Reichsmark<br />
„gegen bare Zahlung“ festgehalten.<br />
In dem Vertrag behielt sich die<br />
Gemeinde den ungehinderten<br />
Zugang des Rohrmeisters zur<br />
Brunnenstube vor. Diese sollte<br />
„ummauert werden und ein lichtes<br />
Maß von ein und einem halben<br />
Meter Breite und zwei Meter<br />
Die Entstehung des Trinkwassernetzes<br />
1898 gründete sich die „<strong>Wasser</strong>genossenschaft<br />
<strong>Reichenbach</strong>“,<br />
die im selben Jahr den Bau von<br />
Quellenkammer, Sammelkammer<br />
und eines Hochbehälters<br />
<strong>Unser</strong> <strong>Wasser</strong><br />
Länge haben“. „Sobald<br />
die Brunnenstube ausgemauert<br />
und ein verschließbares<br />
Thor angebracht<br />
ist, erhält<br />
Andreas Lampert einen<br />
Schlüssel von der<br />
Gemeinde unentgeltlich“.<br />
Unterschrieben<br />
ist die Regelung vom<br />
großherzoglichen Bürgermeister<br />
Johannes<br />
Eßinger, der von 1875<br />
bis 1910 dem Gemeinderat<br />
vorstand.<br />
Aus dem „Gemeinderath“unterschrieben<br />
Deichert, Lampert,<br />
Seeger, Müller,<br />
Joh. Scharschmidt<br />
II. und Bickelhaupt.
an der heutigen Beedenkirchener<br />
Straße realisierte. Über das „<strong>Wasser</strong>werk“<br />
existiert im Gemeindearchiv<br />
noch eine Abzeichnung der<br />
Planunterlagen aus dem Jahre<br />
1910, die wegen ihrer Detailgenauigkeit<br />
und Einmaligkeit nachstehend<br />
teilweise wiedergegeben<br />
wird.<br />
Lageplan Unterdorf zwischen<br />
Falltorbrücke und Einfahrt zur<br />
„Buddemarie“<br />
Aus diesem <strong>Wasser</strong>werk versorgte<br />
die Genossenschaft die einzelnen<br />
Haushalte mit Trinkwasser.<br />
Dazu war jedoch die Verlegung<br />
einer „<strong>Wasser</strong>leitung mit Seitenabstichen“<br />
notwendig.<br />
Diese wurde von der „Genossenschaft<br />
mit unbeschränkter Haftpflicht“<br />
bei der Kreisstraßenverwaltung<br />
„ersucht“. Dem Antrag<br />
beigefügt war ein Lageplan über<br />
die Kreisstraße Bensheim -<br />
Gadernheim, in dem die Straßenführung,<br />
der geplante Verlauf der<br />
<strong>Wasser</strong>leitungen und deren „Seitenabstiche“<br />
festgehalten waren.<br />
Die Verlegung der <strong>Wasser</strong>leitung<br />
wurde dem „Gesuchsteller“ unter<br />
einer Reihe von Bedingungen genehmigt.<br />
So durften beispielsweise<br />
keinerlei Veränderungen vorgenommen<br />
werden, wenn sich in<br />
dem Straßenzug ein „Staatska-<br />
bel“ befand. Sowohl bei der Neuanlage,<br />
als auch bei jeder späteren<br />
Reparatur musste der „Postverwaltung<br />
<strong>Reichenbach</strong>“ zuvor<br />
Anzeige erstattet werden, „damit<br />
letztere Behörde jedesmal die<br />
entsprechenden Vorkehrungen<br />
wegen der Schonung des Staatskabels<br />
anordnet“.<br />
<strong>Unser</strong> <strong>Wasser</strong> 9
10<br />
1907 kam es zum Verkauf des<br />
„<strong>Wasser</strong>werks mit sämtlichem<br />
Mobiliar und Immobilien“ an die<br />
Gemeinde. Zuvor jedoch wurden<br />
umfangreiche Untersuchungen<br />
über die Entwicklung der Schüttungsmengen<br />
der Quellen angestellt<br />
und nach neuen gesucht.<br />
So berichtete am 14. September<br />
<strong>Unser</strong> <strong>Wasser</strong><br />
1905 die Großherzogliche<br />
Kulturinspektion<br />
in Darmstadt an das<br />
Großherzogliche Kreisamt<br />
in Bensheim, dass<br />
sie die „derzeit gefaßten<br />
Quellen“ beobachtet<br />
hätte. Die Schwankungen<br />
der <strong>Wasser</strong>mengen<br />
wären „unwesentlich“.<br />
Zudem hätten sie die für<br />
eine Zuführung in Betracht<br />
kommenden<br />
Quellen im „Brandauer<br />
Klinger“ gemessen. Die<br />
Quellen der Schlosserei<br />
Reimund hätten 52 Tages-cbm<br />
und die des ... Hechler 20 mal 7<br />
Tages-cbm ergeben. Die weiteren<br />
in diesem Tal liegenden Quellen<br />
mit 20 Tages-cbm kämen vorläufig<br />
wegen der geringen <strong>Wasser</strong>menge<br />
nicht in Betracht. Das<br />
Amt schlug vor, die Messungen<br />
bis auf weiteres fortzusetzen.<br />
Damit erklärte sich Bürgermeister<br />
Eßinger jedoch<br />
nicht einverstanden. Da die<br />
Gemeinde für die Messungen<br />
eine Rechnung über<br />
7,70 Reichsmark erhalten<br />
habe, bitte sie „unterthänigst“<br />
darum, diese selbst<br />
vornehmen zu dürfen, um<br />
der Gemeinde Kosten zu<br />
sparen. Diesem Gesuch<br />
wurde vom Kreisamt und<br />
der Kulturinspektion stattgegeben.<br />
In den Folgemonaten<br />
meldete Bürgermeister<br />
Eßinger seine Ergebnisse<br />
nach Darmstadt und<br />
Bensheim. Diese waren<br />
der Kulturinspektion jedoch<br />
nicht ausreichend<br />
genug. Mit Schreiben<br />
vom 27. Dezember<br />
1906 teilten sie dem<br />
Kreisamt und der Bür-<br />
germeisterei in <strong>Reichenbach</strong> mit,<br />
dass sie sich aufgrund der ihnen<br />
vorgegebenen Daten „nicht endgültig“<br />
über den Zustand des<br />
<strong>Wasser</strong>werkes und möglicher<br />
Neufassung von Quellen äußern<br />
könnten.<br />
Ohne das angeforderte Gutachten<br />
ging dann wohl dennoch<br />
der Kauf des <strong>Wasser</strong>werkes <strong>Reichenbach</strong><br />
über die Bühne. Am<br />
17. April 1907 wurde der Kaufvertrag<br />
zwischen der <strong>Wasser</strong>genossenschaft<br />
und der Gemeinde abgeschlossen.<br />
Der Käufer hatte<br />
den Betrag von „46.000 Reichsmark,<br />
zahlbar den 1. Januar<br />
1908, verzinslich zu 4 % vom<br />
1. Januar 1907 ab“, zu entrichten.<br />
Die Übergabe erfolgte mit dem<br />
1. Januar 1907. Der Vertrag war<br />
unterzeichnet vom Großherzoglichen<br />
Bürgermeister Eßinger,<br />
Großherzoglichen Beigeordneten<br />
Dude sowie von den Gemeinderäten<br />
Lampert, Scharschmidt II.,<br />
Bitsch, Kindinger, Trautmann,<br />
Hochgenug und Dörner II.. Für<br />
die <strong>Wasser</strong>genossenschaft unterschrieben<br />
Jakob Lampert IV.,<br />
Philipp Kindinger V., Philipp Dörner<br />
II., Georg Beutel II., Georg<br />
Lampert V., Johann Philipp<br />
Schneider, Peter Weimar und<br />
Peter Kindinger V..[6]
Die angestrebte höhere Liefermenge<br />
für nun 1.843 Einwohner<br />
[2] konnte 1910 realisiert werden.<br />
Die Gemeinde kaufte von Johann<br />
Philipp Schneider II. und seiner<br />
Ehefrau Barbara, geborene Lang,<br />
„sämtliche entspringenden Quellen“<br />
auf ihren Grundstücken im<br />
„Hainzenwald“ zum Preis von<br />
500 Reichsmark. Der Vertrag wurde<br />
unterzeichnet vom neuen Bürgermeister<br />
Philipp Mink XIII., sowie<br />
den Gemeinderäten Bitsch,<br />
Krichbaum, Lampert, Bernhardt,<br />
Trautmann und Heil.<br />
Im Gemeindearchiv findet man<br />
auch ein „Versteigerungsprotokoll<br />
über die Unterhaltung der Brunnen<br />
für die Zeit vom 01. Juni<br />
1920 bis dahin 1925“.<br />
Es lautet:<br />
Nach vorausgegangener öffentlicher<br />
Bekanntmachung wird die<br />
Unterhaltung der Brunnen für die<br />
Zeit vom 1. Juni 1920 bis dahin<br />
1925, unter folgenden Bedingungen<br />
versteigert.<br />
1. Die Brunnen müssen jederzeit<br />
in ordentlichem Zustande gehalten,<br />
vor allem dass jeder Zeit das<br />
<strong>Wasser</strong> läuft, und keine Unterbrechungen<br />
eintreten.<br />
2. Die Quellkammern sind ebenfalls<br />
in ordnungsmäßigen Zustande<br />
zu halten.<br />
3. Genehmigung bleibt 8 Tage<br />
lang vorbehalten.<br />
<strong>Unser</strong> <strong>Wasser</strong> 11
12<br />
Die Dienstanweisung für den „Rohrmeister“<br />
Von der Kulturinspektion in Darmstadt<br />
genehmigt werden musste<br />
die 24 Paragraphen umfassende<br />
Dienstanweisung für den Rohrmeister<br />
der <strong>Wasser</strong>versorgung.<br />
Diese für den reibungslosen Betrieb<br />
der <strong>Wasser</strong>werke und für die<br />
ausreichende und qualitätsgerechte<br />
Versorgung der Bevölkerung<br />
so wichtigen Position, wurde<br />
viele Jahrzehnte an örtliche<br />
Handwerker vergeben. Auf die<br />
Anweisung aus dem Jahre 1909,<br />
sicher exemplarisch auch für<br />
spätere Jahrzehnte, soll deshalb<br />
hier kurz eingegangen werden.<br />
Dem Rohrmeister oblag die Instandhaltung<br />
und Überwachung<br />
des gesamten <strong>Wasser</strong>werkes<br />
<strong>Reichenbach</strong>. Er hatte namentlich<br />
die Spülung des Rohrnetzes<br />
und die Kontrolle über die beweglichen<br />
Teile wie Schieber und<br />
Hydranten vorzunehmen.<br />
<strong>Unser</strong> <strong>Wasser</strong><br />
Er haftete für etwa vorkommende<br />
Schäden, sofern dieselben nicht<br />
durch Naturereignisse oder<br />
durch Verschulden dritter Personen<br />
hervorgerufen wurden, „mit<br />
seinem Gehalte“.<br />
Der Rohrmeister hatte ein Tagebuch<br />
zu führen und es am Monatsletzten<br />
dem Bürgermeister<br />
vorzulegen. Darin musste er alle<br />
ausgeführten Arbeiten mit Angabe<br />
des Zeitaufwandes und der<br />
Hilfskräfte eintragen. Er hatte<br />
darüber zu wachen, dass die<br />
ortspolizeilichen Vorschriften für<br />
den Schutz und die Erhaltung der<br />
<strong>Wasser</strong>leitung beachtet werden.<br />
Ohne Urlaub durfte er die Gemarkung<br />
<strong>Reichenbach</strong> nicht verlassen.<br />
Zu seiner Vertretung im Urlaubs-<br />
oder Krankheitsfall hatte er<br />
einen geeigneten und vom Gemeinderat<br />
genehmigten Stellvertreter<br />
zu stellen. Diesen musste<br />
er in den Betrieb der Gesamt-<br />
anlage einführen und in eingehendster<br />
Weise mit allen Handlungen,<br />
Vorschriften usw. vertraut<br />
machen.<br />
Der Rohrmeister musste den<br />
Hochbehälter wöchentlich einmal<br />
besichtigen und den <strong>Wasser</strong>stand<br />
kontrollieren. Das Rohrnetz<br />
war mindestens alle 14 Tage in<br />
seiner ganzen Ausdehnung zu<br />
begehen. Er hatte sich von der<br />
Beweglichkeit der Schieber, Hydranten<br />
und Hähne durch „jedesmaliges<br />
versuchsweises Öffnen<br />
und Schließen gründlich zu überzeugen“.<br />
Im Winter waren sämtliche<br />
Straßenkappen von Schnee<br />
und Eis frei zu halten und je nach<br />
Bedarf mit Viehsalz zu bestreuen.<br />
Die Überwachung der Haus- und<br />
Anschlussleitungen war ebenfalls<br />
Sache des Rohrmeisters. Auch<br />
musste er die <strong>Wasser</strong>messungen<br />
vierteljährlich vornehmen und diese<br />
sorgfällig in das Messbuch<br />
eintragen. Sobald Feueralarm ertönte,<br />
musste er sofort die<br />
Schieber der Brandreserve<br />
im Hochbehälter öffnen<br />
und sich dem Feuerwehrkommandanten<br />
zur Verfügung<br />
stellen. Der Rohrmeister<br />
war dem Bürgermeister<br />
direkt unterstellt. Für seine<br />
Leistungen erhielt er ein<br />
jährliches Gehalt von 120<br />
Reichsmark [6].
Die Brunnen bleiben weiterhin wichtig<br />
Mit dem Bau des <strong>Wasser</strong>werkes,<br />
der <strong>Wasser</strong>leitungen und der<br />
Erhöhung der Liefermengen verloren<br />
die Brunnen am Marktplatz<br />
und in der Friedhofstraße an<br />
Bedeutung. Trotzdem kamen, wie<br />
Richard Matthes im <strong>Reichenbach</strong>er<br />
Heimatbuch schreibt, „zu<br />
späterer Zeit noch weitere Brunnen<br />
hinzu und zwar am Gasthaus<br />
„Zum Schwanen“ ... und an der<br />
Das <strong>Reichenbach</strong>er Schwimmbad<br />
An heißen Sommertagen konnten<br />
die Einwohner <strong>Reichenbach</strong>s ab<br />
dem 29. Mai 1927 nicht nur die<br />
örtlichen Bäche und Brunnen zur<br />
Abkühlung nutzen. Jetzt stand<br />
allen ein Schwimmbad im Höllacker<br />
zur Verfügung. Die Anlage<br />
wurde von der Familie Reiche<br />
privat gebaut und betrieben. Trotz<br />
ihres nach heutigen Maßstäben<br />
bescheidenen Komforts und<br />
hygienischen Mängeln bleibt sie<br />
vielen Bürgern in angenehmer, ja<br />
freudiger Erinnerung.<br />
Bis in die 60-iger Jahre hinein<br />
lernten die meisten Kinder und<br />
Jugendliche in dem kleinen<br />
Becken schwimmen. Da störte es<br />
auch nicht, dass das von der<br />
<strong>Reichenbach</strong> gespeiste Bad oftmals<br />
eiskalt war. Auch die "Anlandungen"<br />
im tieferen Teil dienten<br />
eher der Erheiterung. Und höchste<br />
Glücksgefühle erreichten die<br />
jugendlichen Halbstarken, wenn<br />
sie die gestrenge Frau Reiche<br />
ärgern konnten.<br />
„Kultstatus“ hatten die Umkleidekabinen.<br />
Als Sammelkabinen wa-<br />
Abzweigung der Wingertsbergstraße<br />
von der Hauptstraße (vor<br />
dem Kolonialwarengeschäft Klinger)“.<br />
Wann diese Brunnen errichtet<br />
wurden und wie sie aussahen,<br />
lässt sich weder aus dem<br />
Gemeindearchiv noch aus dem<br />
Heimatbuch rekonstruieren.<br />
Alle genannten Brunnen dienten<br />
und dienen auch jetzt den Bürgern<br />
zur Versorgung mit Brauch-<br />
ren sie natürlich nach Geschlecht<br />
getrennt. Doch die zweite Frauen-/Mädchenkabine<br />
und die erste<br />
Männer/Jungenkabine lagen<br />
direkt nebeneinander. Getrennt<br />
von einer einfachen Bretterwand,<br />
an der der natürliche Wuchs der<br />
Bretter nicht begradigt, Astlöcher<br />
nicht verschlossen waren. Da<br />
verwunderte es nicht, dass die<br />
einheimischen Frauen und<br />
Mädchen die zweite Kabine nicht<br />
aufsuchten. Aber nach Reichen-<br />
wasser. Doch bei Lieferknappheit,<br />
insbesondere in heißen<br />
Sommern, waren sie vielfach<br />
wichtiger Ersatz für das ausbleibende<br />
Trinkwasser.<br />
bach kamen damals ja viele<br />
Urlauber, Sommerfrischler, denen<br />
die Besonderheit der Trennwand<br />
zumindest bei ihrem ersten Besuch<br />
noch nicht auffiel. Aufmerksam<br />
wurde so manche Besucherin<br />
erst, wenn sie den Auflauf in<br />
der ersten Jungenkabine bemerkte.<br />
<strong>Unser</strong> <strong>Wasser</strong> 13
14<br />
Jetzt auch <strong>Wasser</strong>gebühren<br />
Für die Lieferung des Trinkwassers<br />
durch die <strong>Wasser</strong>genossenschaft<br />
und später durch die<br />
Gemeinde wurden Gebühren erhoben.<br />
Dies geschah, um die<br />
Entstehungs- und laufenden Kosten<br />
zu decken und um Mittel für<br />
künftige Investitionen zu erhalten.<br />
Als Beispiel für die Haushaltsrechnung<br />
der Gemeinde soll hier<br />
eine Einnahme- und Ausgaberechnung<br />
aus dem Jahre 1943<br />
vorgestellt werden.<br />
Danach gingen damals 5.739,40<br />
Reichsmark an <strong>Wasser</strong>geld laut<br />
Hebeliste ein. Berechnungsgrundlage<br />
waren Pauschalen für<br />
jeden Haushalt, die sich an der<br />
Familienzahl, eventuell auch an<br />
<strong>Unser</strong> <strong>Wasser</strong><br />
Besonderheiten im gewerblichen<br />
Bereich orientierten. 18 Mark wurden<br />
für Wiesenpacht am <strong>Wasser</strong>reservoir<br />
und 341,05 Mark für Zinsen<br />
eingenommen. Diese betrugen<br />
etwa zwei Prozent des<br />
<strong>Wasser</strong>leitungsfonds, der bei der<br />
Sparkasse Zwingenberg angelegt<br />
war.<br />
Den Einnahmen in Höhe von<br />
6.098,45 Reichsmark standen folgende<br />
Ausgaben gegenüber:<br />
1.026,59 Mark Rechnungsrest<br />
aus dem Vorjahr und 1.280,17<br />
Mark an Betriebsaufwand. Darunter<br />
erhielten Jakob Mink und andere<br />
für Erdarbeiten an der <strong>Wasser</strong>leitung<br />
213,50 Mark, Georg<br />
Kindinger für Maurerarbeiten und<br />
Materiallieferungen 40,10 Mark<br />
und Peter Weimar für verschiedene<br />
Hausanschlüsse, Reparaturarbeiten<br />
und Materiallieferungen<br />
889,92 Mark. Als Rohrmeister erhielt<br />
Weimar zudem 100 Mark an<br />
Jahresvergütung, Heinrich Eckel III.<br />
wurden für Gummistiefel bei<br />
<strong>Wasser</strong>leitungsarbeiten 15 Mark<br />
und Jakob Mink II. für desgleichen<br />
16 Mark erstattet. Schließ-<br />
Die <strong>Wasser</strong>versorgung ist erneut unzureichend<br />
Nicht mehr ausreichend war die<br />
<strong>Reichenbach</strong>er <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
nach dem zweiten Weltkrieg.<br />
Durch den Zuzug der<br />
Ausgebombten, Flüchtlinge und<br />
Heimatvertriebenen stieg die<br />
Bevölkerungszahl in <strong>Reichenbach</strong><br />
auf knapp 2.500 an. Ausgerichtet<br />
war die Anlage jedoch<br />
ursprünglich auf nur 1.800 bis<br />
1.900 „Köpfe“, wie Bergingenieur<br />
Carl Emil Spatz aus Wiesbaden<br />
am 10. September 1946 in seinem<br />
lich wurden an das <strong>Wasser</strong>wirtschaftsamt<br />
in Darmstadt noch<br />
5,75 Mark für kulturtechnische<br />
Kosten entrichtet.<br />
Der Geschäftsaufwand betrug<br />
810 Reichsmark, wovon die<br />
Gemeinde 760 Mark für die<br />
Vergütung von Verwaltung, Kassen-<br />
und Rechnungsführung, Beleuchtung,<br />
Heizung, Reinigung<br />
der Büroräume und für Bürobedürfnisse<br />
erhielt. 1.048 Mark<br />
musste die Gemeinde an die<br />
Finanzkasse in Bensheim für Körperschaftssteuer<br />
bezahlen, zu<br />
denen noch 809,40 Mark Gewerbesteuer<br />
kamen.<br />
Bei Gesamtausgaben von<br />
5.315,21 Mark wurde ein Überschuss<br />
von 783,24 Mark erzielt,<br />
der (wohl pflichtgemäß) den<br />
Rücklagen/dem <strong>Wasser</strong>leitungsfonds<br />
zugeführt wurde.<br />
Unterschrieben und festgestellt<br />
wurde die 43er Rechnung im<br />
Jahre 1945 durch den damaligen<br />
Bürgermeister Wilhelm Gehbauer<br />
und Rechner Christian Kaltwasser.
„Untersuchungsbericht über die<br />
Gemeindewasserleitung in <strong>Reichenbach</strong><br />
im Odenwald“ feststellte.[6]<br />
Spatz befürchtete ein noch stärkeres<br />
Wachstum der Bevölkerung.<br />
Auch die starke „Zunahme<br />
der Einrichtung von Bädern und<br />
Spülklosetts“ trage zu einem<br />
größeren <strong>Wasser</strong>verbrauch bei.<br />
Die gewerblichen Betriebe, die<br />
Wäscherei und drei Schlächter<br />
fielen mit ihren <strong>Wasser</strong>entnahmen<br />
nicht so sehr ins Gewicht.<br />
Schuld an einer Zeit weisen <strong>Wasser</strong>knappheit<br />
trügen die Evakuierten<br />
und Flüchtlinge, die wegen<br />
Kleidermangel nahezu täglich<br />
waschen müssten, und das „nervöse<br />
Verhalten der Bevölkerung“.<br />
Er habe festgestellt, dass in fast<br />
allen Familien aus Furcht vor<br />
ausbleibendem <strong>Wasser</strong>, in den<br />
„frühesten Morgenstunden, ja in<br />
der Nacht, jedes verfügbare Gefäss<br />
mit <strong>Wasser</strong> gefüllt“ werde.<br />
Dies führe zu einem außerordentlich<br />
großen, durch „sinnlose Panik<br />
verursachten <strong>Wasser</strong>verbrauch“,<br />
der weit über den wirklichen<br />
Bedarf hinausgehe.<br />
Trotz dieses Problems entspreche<br />
die Anlage nicht mehr den<br />
„gesteigerten Anforderungen“.<br />
Zur Abhilfe macht der Bergingenieur<br />
einige Vorschläge. So solle<br />
im „Rödchen, möglichst hoch am<br />
Berge zusätzlich ein <strong>Wasser</strong>vorkommen<br />
gefaßt und gemeinsam<br />
mit dem aus der jetzigen Quellkammer<br />
kommenden <strong>Wasser</strong> in<br />
einem neu zu bauenden Hochbehälter<br />
gesammelt“ werden.<br />
Dieser Hochbehälter solle aus<br />
vielerlei Gründen kein kleineres<br />
Fassungsvermögen als 300 cbm<br />
haben. Baumaterial, Werksteine<br />
und Sand seien an Ort und Stelle<br />
verfügbar, Zement werde be-<br />
stimmt zur Verfügung stehen.<br />
Eiserne Rohrleitungen würden<br />
nur wenige Meter gebraucht und<br />
vor dem Hochbehälter könnten<br />
Tonrohre oder Steinzeugrohre<br />
verwendet werden.<br />
Nach seinen Beobachtungen<br />
werde die neue Quellfassung<br />
mehr <strong>Wasser</strong> bringen, als die gesamte<br />
bisher erfasste <strong>Wasser</strong>menge.<br />
Ein gleiches Vorgehen<br />
empfiehlt er für den Hohenstein.<br />
Auch hier sollten mindestens 300<br />
cbm Behälterraum angestrebt<br />
werden. Beide Behälter müssten<br />
in ihrer Lage zueinander und der<br />
Lage zum bereits vorhandenen<br />
dritten Behälter so aufeinander<br />
abgestimmt sein, dass ihre Ausläufer<br />
auf derselben Höhe über<br />
Normalnull zu liegen kommen.<br />
Carl Emil Spatz war der Auffassung,<br />
dass zur Behebung der aktuellen<br />
<strong>Wasser</strong>knappheit der Bau<br />
des Hochbehälters im „Rödchen“<br />
vorerst ausreichen würde. Auf<br />
den Hohenstein legte er zunächst<br />
nicht so großen Wert. Er sei „auf<br />
einiges gestoßen, was sich mit<br />
den von amtswegen verfochtenen<br />
hygienischen Grundsätzen<br />
nicht vereinbaren“ ließe.<br />
Ganz dicht oberhalb der Quellkammer<br />
wäre „eine mit Hornvieh<br />
besetzte Viehweide“. In geradezu<br />
gefährdender Nähe der Quellkammer<br />
stehe ein genutzter Viehschuppen.<br />
Die Quellkammer sei<br />
nur unzureichend gegen Mensch<br />
und Tier geschützt. Der Mindestabstand<br />
der Umzäunung,<br />
einschließlich Quellhaupt, Sickerleitungen,<br />
Zuleitungen zur Quellkammer<br />
und dieser selbst, solle<br />
mindestens 30 Meter betragen.<br />
Dies wäre hier nicht der Fall.<br />
Mit seinen Untersuchungen zur<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung lag der Bergingenieur<br />
aus heutiger Sicht weit-<br />
gehend richtig. Allerdings irrte er<br />
hinsichtlich der „starken Zunahme<br />
der Einrichtung von Bädern<br />
und Spülklosetts“. Trotz zahlreicher<br />
Neu- und Erweiterungsbauten<br />
in den fünfziger Jahren hatten<br />
mit Beginn des „Wirtschaftswunders“<br />
die meisten Haushalte<br />
noch keine Bäder. Bei einem<br />
Wohnraumbestand von nur sieben<br />
Quadratmeter je Einwohner<br />
im Jahre 1949 war dies auch<br />
bautechnisch kaum möglich [6].<br />
Die meisten Familien wuschen<br />
sich in ihrer kleinen Küche. Oftmals<br />
unter fließendem <strong>Wasser</strong>,<br />
sofern es denn lief. Oder in einer<br />
Waschschüssel aus Blech, in die<br />
das auf dem Kohleherd erwärmte<br />
<strong>Wasser</strong> eingefüllt wurde.<br />
Wochentags genügte vielfach die<br />
Reinigung des Oberkörpers.<br />
Samstags jedoch wurde gebadet,<br />
in vielen Familien in den<br />
Sommermonaten in der Waschküche,<br />
im Winter, der Temperaturen<br />
wegen, in der Küche. Da<br />
das <strong>Wasser</strong> knapp und das<br />
Erwärmen teuer war, genügte<br />
eine Wannenfüllung für die ganze<br />
Familie. Zuerst waren die Kinder<br />
dran, dann stieg die Mutter ins<br />
<strong>Wasser</strong>. Und zum guten Schluss,<br />
als die Eintrübungen und die<br />
Ablagerungen in der Wanne<br />
schon deutlich zu sehen waren,<br />
durfte auch das Oberhaupt der<br />
Familie ran.<br />
An diesem Tag war die Küche der<br />
Mittelpunkt der Familie, alle waren<br />
zusammen. Und während die<br />
Kinder in der Wanne saßen, Vater<br />
am Küchentisch seine Brieftauben<br />
für die sonntägliche Ausstellung<br />
herausputzte, backte Mutter<br />
noch schnell einen Kuchen. Da<br />
konnte es schon mal vorkommen,<br />
dass der Kuchen den direkten<br />
Weg vom Backofen in die<br />
<strong>Unser</strong> <strong>Wasser</strong> 15
16<br />
Wanne fand und ob der Aufregung<br />
die Tauben durch die<br />
Küche flatterten.<br />
Probleme bei der Körperreinigung<br />
nach ihren Spielen hatten<br />
auch die Fußballer des TSV und<br />
SSV. Da es Umkleideräume und<br />
Duschkabinen bis in die 60-iger<br />
Jahre hinein nicht gab, wurde eine<br />
„Grobreinigung“ an der Lauter<br />
oder der Graulbach vorgenom-<br />
<strong>Unser</strong> <strong>Wasser</strong><br />
men. Neben den Vereinslokalen<br />
„Zur Traube“ und „Zum Felsberg“<br />
wurde für die Gastmannschaften<br />
eine Wanne aufgestellt. Nach<br />
ihnen durfte sich die Heimelf,<br />
sofern sich das <strong>Wasser</strong> noch<br />
nicht ganz in Schlamm verwandelt<br />
hatte, auch von den gröbsten<br />
Verschmutzungen befreien.<br />
Sehr weit entgegen kam der damalige<br />
Vorsitzender des SSV,<br />
Die Errichtung eines Gemeindebades<br />
Eine große Entlastung für viele<br />
Familien ohne Bäder und teilweise<br />
auch für die Fußballvereine<br />
brachte der Neubau der Schule<br />
in der Knodener Straße. Dort wur-<br />
de 1956 im südlichen Teil des<br />
Kellergeschosses ein Gemeindebad<br />
eingerichtet. Es wurde damals<br />
insbesondere zum samstäglichen<br />
Bad rege genutzt.<br />
Treffpunkt nicht nur<br />
der Jugendlichen<br />
und Kinder war in<br />
den Sommermonaten<br />
der fünfziger<br />
Jahre der Marktplatzbrunnen.<br />
Eine<br />
große Schar wartete<br />
täglich auf<br />
den „Eis-Venedig“.<br />
Dieser hatte in<br />
Bensheim ein kleines<br />
Eis-Cafe eröffnet<br />
und bediente<br />
seine Lautertaler<br />
Kundschaft aus<br />
dem an einen<br />
Motorroller angebrachtenAnhänger<br />
mit Kühlung<br />
heraus. Das Bällchen<br />
Eis kostete<br />
damals zehn Pfennige,<br />
die jedoch<br />
nicht alle Kinder<br />
täglich aufbringen<br />
konnten.<br />
Metzgermeister Hermann Jährling,<br />
seinen Fußballern. Sie konnten<br />
sich nach den Spielen in seiner<br />
Küche im ersten Stock waschen.<br />
Als aber nach einer<br />
„Schlammschlacht“ das <strong>Wasser</strong><br />
durch die Decke tröpfelte und<br />
auch noch der „Quätschekuche“<br />
„weggeputzt“ war, hatten die<br />
Freundlichkeiten ihr Ende.<br />
Seine Wartezeiten auf finanzkräftigere<br />
Kunden verkürzte der Italiener<br />
(in dieser Zeit eine Sensation<br />
für <strong>Reichenbach</strong>) mit kleinen<br />
Spielchen. So erhielt derjenige<br />
ein Eis gratis, der sich mit Kleidung<br />
in das Becken des Marktplatzbrunnens<br />
legte. Doch in kürzester<br />
Zeit zogen die Preise an.<br />
Als der „Eis-Venedig“ merkte,<br />
dass ihn die <strong>Reichenbach</strong>er Buben<br />
über den Tisch ziehen wollten,<br />
waren die Spielchen schnell<br />
vorbei.
Die Gemeinde errichtet einen Hochbehälter<br />
Den großen Wurf nach den Vorschlägen<br />
des Bergingenieurs<br />
Spatz wagten die Gemeinderäte<br />
in den 50-iger Jahren nicht. Statt<br />
einem 300 cbm fassenden Hochbehälter<br />
im Rödchen, errichtete<br />
die Gemeinde im Jahre 1956 einen<br />
150 cbm fassenden Hochbehälter<br />
am Hohenstein. Gespeist<br />
wurde er von den beiden<br />
Quellen am Karolinenberg, die<br />
der Bergingenieur nach seinen<br />
Untersuchungen noch für ungeeignet<br />
hielt.<br />
Nach Aussagen einiger damals<br />
Beteiligter gaben finanzielle Erwägungen<br />
und Probleme bei den<br />
Grundstücksverhandlungen den<br />
Ausschlag für eine aus heutiger<br />
Sicht nicht nachvollziehbaren<br />
Entscheidung. Beim Hochbehälter<br />
am Hohenstein liegt der <strong>Wasser</strong>spiegel<br />
289,50 Meter über<br />
Normalnull (NN). Das Behältervolumen<br />
von 150 cbm war nur<br />
zur Hälfte nutzbar, weil immer<br />
75 cbm als Brandreserve vorgehalten<br />
werden mussten.<br />
Eine Verbesserung, aber nicht<br />
den entscheidenden Fortschritt<br />
brachte auch der Bau eines Tiefbrunnens<br />
am TSV-Sportplatz. Dort<br />
wurde 1963 eine Pumpe eingebaut,<br />
die das <strong>Wasser</strong> in das Leitungsnetz<br />
der Tiefzone drückte.<br />
Eine gewisse Entlastung für das<br />
weiterhin oft ausbleibende Trinkwasser<br />
ergab eine Sanierung der<br />
Brunnen am Marktplatz, im Brandauer<br />
Klinger und in der Hohensteiner<br />
Straße in den 60er Jahren.<br />
Alle drei Brunnen wurden mit<br />
Odenwälder Granit und zugehauenen<br />
Steinen aus der örtlichen<br />
Steinproduktion errichtet.<br />
Der Brunnen in der Hohensteiner Straße<br />
Besonders an Samstagen in<br />
heißen Sommermonaten standen<br />
die Einwohner vor den nun fünf<br />
Dorfbrunnen Schlange. Die Bewohner<br />
des Neubauviertels an<br />
der Hohensteiner Straße wurden<br />
zudem noch verspottet: „Ihr habt<br />
doch eine schöne Aussicht, da<br />
könnt Ihr nicht auch noch <strong>Wasser</strong><br />
verlangen“.<br />
<strong>Unser</strong> <strong>Wasser</strong> 17
18<br />
Die <strong>Wasser</strong>versorgung ist schon wieder unzureichend<br />
Durch den Einbau von Toilettenanlagen<br />
und Bädern sowie den<br />
Gebrauch von Wasch- und Spülmaschinen<br />
wurde die <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
in <strong>Reichenbach</strong> jedoch<br />
immer problematischer. Mitte und<br />
Ende der 60er Jahre halfen auch<br />
die Dorfbrunnen nicht mehr. Die<br />
Einwohnerschaft verlangte nach<br />
Lösungen, die es ihnen ermöglichte,<br />
auch an einem Samstag<br />
im Sommer in höhergelegenen<br />
Gebäuden duschen zu können.<br />
Den Forderungen der Öffentlichkeit<br />
trug der <strong>Reichenbach</strong>er Gemeinderat<br />
1968/1970 Rechnung.<br />
Der alte, 150 cbm fassende<br />
Hochbehälter an der Beedenkirchener<br />
Straße wurde um eine<br />
300 cbm aufnehmende Kammer<br />
erweitert. Das der Tiefzone zugeordnete<br />
<strong>Wasser</strong>werk liegt 238,40<br />
Meter über NN. Die Brandreserve<br />
des jetzt 450 cbm fassenden<br />
Besichtigung des Hochbehälters im Rödchen durch die <strong>Reichenbach</strong>er „Aktiven Senioren“ - Foto BA/kps)<br />
<strong>Unser</strong> <strong>Wasser</strong><br />
Behälters beträgt 100<br />
cbm, so dass nun netto<br />
350 cbm Trinkwasser<br />
zur Verfügung standen.<br />
Doch trotz dieser Maßnahme<br />
war die Trinkwasserversorgung<br />
mit<br />
steigendem Verbrauch<br />
auch in den Folgejahren<br />
nicht ausreichend.<br />
Die Schwäche des<br />
Systems wurde in Spitzenverbrauchszeitenoffensichtlich.<br />
Deshalb erhöhte<br />
man das Behältervolumen weiter<br />
und versuchte, mit einer Verbundleitung<br />
innerhalb der Gemeinde<br />
Lautertal Überschüsse<br />
und Unterdeckungen auszugleichen.<br />
1989 erfolgte endlich der 1946<br />
von dem Bergingenieur Carl Emil<br />
Spatz vorgeschlagene Bau des<br />
Hochbehälters im Rödchen. In<br />
den Kammern liegt der <strong>Wasser</strong>spiegel<br />
wie am Hohenstein<br />
289,50 Meter über NN, womit der<br />
Anschluss und die Verbindung<br />
zur Hochzone möglich war.<br />
Ebenfalls der Hochzone zugeordnet<br />
ist das 1989 errichtete Pumpwerk<br />
Rödchen, das 269,20 Meter<br />
über NN liegt und ein kleines<br />
Behältervolumen von 15 cbm hat.
Eine Steuerungsanlage hilft<br />
Anfang der 90er Jahre war „unser<br />
<strong>Wasser</strong>“ erneut Thema in<br />
allen gemeindlichen Gremien<br />
und in der Öffentlichkeit. Wegen<br />
einer angeblichen Unterdeckung<br />
des <strong>Wasser</strong>dargebots versagte<br />
das Regierungspräsidium der<br />
Gemeinde die Genehmigung<br />
weiterer Baugebiete, obwohl<br />
diese im Flächennutzungsplan<br />
ausgewiesen waren. In der Diskussion<br />
mit dem RP wurde eine<br />
<strong>Wasser</strong>bilanz erstellt. Danach<br />
schafften die Quellen in der<br />
Hochzone in <strong>Reichenbach</strong> ein<br />
Dargebot von 106 cbm täglich,<br />
dem jedoch ein Bedarf von<br />
337 cbm gegenüber stand. In<br />
der Tiefzone (der Tiefbrunnen<br />
am Sportplatz war jetzt mit dem<br />
Hochbehälter am Hohberg verbunden)<br />
stand dem Dargebot<br />
von 410 cbm ein Bedarf von<br />
608 cbm gegenüber. Damit entstand<br />
in <strong>Reichenbach</strong> eine Unterdeckung<br />
von 429 cbm täglich,<br />
die nur durch die Zuführung aus<br />
anderen Ortsteilen ausgeglichen<br />
werden konnte.<br />
Doch auch dort war die Lage<br />
nicht rosig. Insgesamt ermittelte<br />
Die <strong>Wasser</strong>bilanz in <strong>Reichenbach</strong><br />
(Angaben in cbm/Tag)<br />
die Verwaltung für alle Ortsteile<br />
der Gemeinde Lautertal eine tägliche<br />
Unterdeckung von 14 cbm.<br />
Der Forderung des Regierungspräsidenten,<br />
die laufende<br />
sowie die Spitzenzeiten-Unterdeckung<br />
durch<br />
einen Anschluss an die<br />
<strong>Wasser</strong>werke der Riedgruppe<br />
Ost auszugleichen,<br />
versagte sich die<br />
Gemeinde. Statt dessen<br />
wurde durch interne<br />
Maßnahmen den Auflagen<br />
der Behörden Rechnung<br />
getragen. So wurde<br />
das an Altersschwäche leidende<br />
Rohrnetz teilsaniert, die<br />
Verbundleitung vervollständigt<br />
und mit einer Steuerungsanlage<br />
die Verteilung optimiert.<br />
Wesentlich beeinflusst hat die<br />
Entwicklung eine Entscheidung<br />
der Gemeindevertretung aus<br />
dem Jahre 1993. Die drastische<br />
Erhöhung der <strong>Wasser</strong>gebühren<br />
auf 4,35 DM zuzüglich 7 Prozent<br />
Mehrwertsteuer und die der Abwassergebühren<br />
auf 8 DM pro<br />
cbm setzte bei den Verbrauchern<br />
deutliche Einsparungsbemühungen<br />
frei.<br />
<strong>Unser</strong> <strong>Wasser</strong> 19
20<br />
Die Brunnen gewinnen wieder an Bedeutung<br />
Und plötzlich waren, da kostenfrei<br />
- nicht nur in <strong>Reichenbach</strong> -<br />
wieder die Laufbrunnen interessant<br />
und wurden von vielen genutzt.<br />
Für den Verschönerungs-<br />
Der Brunnen in der Bangertgasse<br />
Bis um das Jahr 1900 befand<br />
sich im Hof des Anwesens Bangertgasse<br />
10 - 12 eine Ziegelhütte.<br />
Gegründet wurde diese wohl<br />
von dem im Jahr 1777 aus Pirmasens<br />
zugewanderten Michael<br />
Schneider. Die Ziegelei wurde<br />
drei Generationen von der Familie<br />
betrieben. Der Ton wurde etwa<br />
300 m oberhalb des Anwesens<br />
am Hang des Borsteins abgebaut.<br />
Dort befand sich auch eine<br />
Feldbrandhütte.<br />
Das Vorhandensein von <strong>Wasser</strong><br />
zum Reinigen der Arbeitsgeräte<br />
aber auch gegebenenfalls zum<br />
Befeuchten des Tonmaterials war<br />
sicherlich ausschlaggebend für<br />
die Standortwahl in der Bangertgasse.<br />
<strong>Unser</strong> <strong>Wasser</strong><br />
vereins war dies Anlass, entweder<br />
zusammen mit anderen Vereinen<br />
oder mit der Gemeinde die<br />
örtlichen Brunnen zu sanieren<br />
und einen neuen zu bauen.<br />
Seit etwa 90 Jahren wird das<br />
<strong>Wasser</strong> in einer unterirdischen<br />
Rinne, gebildet aus Steinabfällen<br />
der Steinindustrie zum Brunnentrog<br />
geleitet.<br />
Nachstehende Aufnahme dürfte<br />
um das Jahr 1920 entstanden<br />
sein, zeigt diese doch die im Januar<br />
1915 geborene Katharina<br />
Elise Schönig (gest. 1928 in<br />
Darmstadt), die mit Eimerchen<br />
und Gießkanne <strong>Wasser</strong> holt. Der<br />
Brunnen befindet sich heute wie<br />
damals an der Haustreppe. Lief<br />
das <strong>Wasser</strong>, wie auf dem Bild zu<br />
sehen, früher über einen hölzernen<br />
Brunnenstock in einen Holzbottich,<br />
so läuft das <strong>Wasser</strong> heute<br />
ohne Brunnenstock in einen<br />
Waschbetontrog.<br />
Zu diesem privaten <strong>Wasser</strong>spender<br />
kommen viele Nachbarn, um<br />
sich ihr Gießwasser zu holen,<br />
aber auch <strong>Wasser</strong> zum Tränken<br />
ihrer Tiere.<br />
Der Brunnen schüttet je nach<br />
Jahreszeit zwischen knapp 1,5<br />
bis 4 Liter pro Minute.
Der Brunnen in der Beedenkirchener Straße<br />
Richard Matthes formuliert in seinem<br />
Heimatbuch [2] ...in späterer<br />
Zeit kamen noch zwei Brunnen<br />
hinzu und zwar „Am Gasthaus<br />
Zum Schwanen“ ...<br />
Hiermit ist der Brunnen neben<br />
dem früheren Eiscafe „Adria“<br />
(ehemals Gasthaus „zum Schwanen“)<br />
gemeint. Dieser stand quer<br />
zur Landstraße zwischen dem<br />
Gasthaus und der ehemaligen<br />
Milchsammelstelle, die von der<br />
Gemeinde erworben wurde.<br />
Nach dem Abriss der ehemaligen<br />
Milchsammelstelle wurde 1999 in<br />
Zusammenarbeit von Gemeinde,<br />
Männergesangverein „Eintracht“<br />
und <strong>Verschönerungsverein</strong> der<br />
„Milchbrunnen“ im Eck versetzt<br />
und die kleine Anlage gestaltet.<br />
Die „Eintracht“ hatte 1998 ein<br />
„Chor- und Musikfest“ in der Lautertalhalle<br />
durchgeführt und dabei<br />
einen beachtlichen Erlös von<br />
fast 5000 DM erwirtschaftet. Den<br />
Betrag stellte sie der Gemeinde<br />
zweckgebunden für die Sanierung<br />
des Brunnens und der Anlage<br />
zur Verfügung. Der <strong>Verschönerungsverein</strong><br />
fertigte eine Planskizze<br />
und wollte zwei Bänke und<br />
die Pflanzen spendieren.<br />
Wie in <strong>Reichenbach</strong> ansonsten<br />
nicht unüblich, kam es im Vorfeld<br />
der Umsetzung (1998) bis heute<br />
zu Differenzen mit Anliegern. So<br />
wollte der eine noch „die durch<br />
die Versetzung des Brunnens<br />
zum Vorschein gekommene<br />
Mauer sanieren“,<br />
der andere „in zwei Jahren<br />
sein Haus neu streichen“.<br />
Auch wegen dieser<br />
Probleme konnten<br />
die ursprünglichen Vorstellungen<br />
nicht umgesetzt<br />
werden und wurden<br />
„abgespeckt“. Statt<br />
Kletterhortensien (Hydrangea<br />
aspera sargentiana),<br />
Wilder Wein (Parthenocissus<br />
tricuspidata<br />
„Veitchii“) und Kletterrosen<br />
(„Pauls Scarlet“,<br />
dunkelrot), wurden Roseneibisch<br />
(Hibiscus syriacus)<br />
und Strauchrosen gepflanzt.<br />
Vorher versetzte der Gemeindebauhof<br />
den Brunnen und errichtete<br />
ihn Stein für Stein neu. Auch<br />
verputzte er die angrenzenden<br />
Mauern. Am 08. Oktober 1999<br />
wurde die kleine Anlage unter<br />
Beteiligung der unterstützenden<br />
Vereine und einiger Mandatsträger<br />
eingeweiht.<br />
Helmut Kaffenberger von der<br />
„Eintracht“ strich dann 2002 die<br />
Mauern um den Brunnen mit<br />
weißer Farbe. Dabei „erwischte“<br />
er allerdings eine Mauerfläche,<br />
die nicht in Eigentum der Gemeinde<br />
war. Ergebnis: Die „Eintracht“<br />
erhielt einen auf wenig<br />
„Eintracht“ zielenden Brief mit der<br />
ultimativen Aufforderung, die Farbe<br />
von der besagten Mauer wieder<br />
zu entfernen ...<br />
<strong>Unser</strong> <strong>Wasser</strong> 21
22<br />
Der Brunnen in der Friedhofstraße<br />
Ein Jahr später wurde der Bereich<br />
um den Brunnen in der<br />
Friedhofstraße aufgepeppt. Dieser<br />
historische Brunnen aus dem<br />
Jahre 1614 steht vor historischem<br />
Gebäude. Die teilweise sanierte<br />
Hofreite Scharschmidt/Schneider/Menzel<br />
ist das wohl älteste<br />
Haus im Dorf. Mit der Teilsanierung<br />
wurde auch der Brunnen<br />
ansprechend eingegrünt.<br />
Über mehrere Jahre versuchte<br />
dann der <strong>Verschönerungsverein</strong><br />
die Harmonie zwischen der Brunnenanlage<br />
und dem Pflanzbeet<br />
an der Nibelungenstraße herzustellen.<br />
Dabei entwickelten sich<br />
aber die beiden Rosskastanien<br />
(Aesculus carnea „Briotii“) zum<br />
Problem. Die beiden eindrucksvollen<br />
Solitärbäume verfügen<br />
über ein flach- und tiefgründiges<br />
Wurzelwerk, das nur wenig neben<br />
sich duldet. Da auch innerhalb<br />
des Vereins unterschiedliche<br />
<strong>Unser</strong> <strong>Wasser</strong><br />
Auffassungen über<br />
die Art der Bepflanzungen<br />
aufkamen,<br />
gab es viele Fehlversuche.<br />
Erst Auffüllungen,<br />
der fachmännische<br />
Rat von<br />
Gärtnermeister Willi<br />
Muysers und die<br />
kenntnisreiche und<br />
liebevolle Pflege<br />
durch das Ehepaar<br />
Elisabeth und Hans<br />
Lampert führten<br />
zum Erfolg.<br />
Heute zeigt sich das Ensemble in<br />
ansprechendem, vorzeigenswertem<br />
Zustand. Die Brunnenanlage<br />
an der Friedhofstraße und das<br />
Pflanzbeet an der Nibelungenstraße<br />
sind die „grünste Ecke<br />
<strong>Reichenbach</strong>s entlang der B 47“.
Der Brunnen im Brandauer Klinger<br />
In seinem Heimatbuch beschreibt<br />
Richard Matthes[2]<br />
diesen Brunnen als denjenigen<br />
„an der Abzweigung der Wingertsberstraße<br />
von der Hauptstraße<br />
(vor dem Kolonialwarengeschäft<br />
Klinger). Er wird aus einer<br />
schlecht gefassten Quelle etwa<br />
50 Meter hinter dem Anwesen<br />
Hannewald gespeist“.<br />
1964 erfolgte eine Überholung<br />
des Brunnens ähnlich wie die des<br />
Maktplatzbrunnens.<br />
Im Jahr 2001 wurde der Brunnen<br />
im Brandauer Klinger saniert. Der<br />
<strong>Wasser</strong>spender brachte jedoch<br />
nur noch wenig <strong>Wasser</strong>. Die<br />
Quellen hinter den letzten Häusern<br />
waren schlecht gefasst und<br />
die Zuleitung über die Jahrzehnte<br />
wohl immer enger geworden.<br />
Deshalb nahm <strong>Wasser</strong>meister<br />
Helmut Fassinger Verbesserungen<br />
an der Sammelkammer vor<br />
und reinigte die Zuleitung per<br />
Lufdruck.<br />
Als fest stand, dass der Brunnen<br />
wieder genügend <strong>Wasser</strong> liefern<br />
kann, wurde die Sanierung angegangen.<br />
Wesentlich daran mitgewirkt<br />
hat der Bauhof der Gemeinde<br />
mit seinen schweren Geräten,<br />
ohne die die Aktion<br />
nicht machbar<br />
gewesen<br />
wäre. So wurde<br />
der alte Brunnen<br />
sowie die Reste<br />
der Bachmauer<br />
zur Lauter hin<br />
abgetragen. Aus<br />
Quarzfindlingen<br />
errichtete Peter<br />
Beutel mit seinem<br />
Bagger eine<br />
neue Mauer.<br />
Die Steine hierfür aus einem<br />
höhergelegenen Lautertaler Ortsteil<br />
zu erhalten schlugen allerdings<br />
fehl. „De Reischebesche gäwwe<br />
meer nix“, wurde dem <strong>Verschönerungsverein</strong><br />
beschieden.<br />
Ohne Fremdgaben, ausschließlich<br />
aus Material der Deutschen<br />
Steinindustrie AG in <strong>Reichenbach</strong>,<br />
wurde dann der Brunnen<br />
auf den zuvor vom Bauhof errichteten<br />
Fundamenten gebaut. Das<br />
„Brunnenbauteam“ um Philipp<br />
Degenhardt, Ludwig Baumunk<br />
und Horst Wolf schufen nach alten<br />
Vorgaben ein Werk das sich<br />
sehen lassen kann. Mit Unterstützung<br />
des Bauhofes wurde Mut-<br />
<strong>Reichenbach</strong>er feiern die Sanierung des Brunnens<br />
terboden aufgefüllt und eine<br />
Findlingsgruppe platziert.<br />
Neue Wege ging der Verein mit<br />
der Verlegung von aufgerauten<br />
Steinplatten und einer „weichen“<br />
Wegeführung. Die ansprechende<br />
Bepflanzung vorwiegend mit heimischen<br />
Stauden nahm Gärtnermeister<br />
Willi Muysers vor. Heinz<br />
Neff, Anlieger „Auf der Insel“, stiftete<br />
noch eine Holzbank.<br />
Die Einweihung eine Woche vor<br />
der <strong>Reichenbach</strong>er Kerb weckte<br />
dann „Erinnerungen an die legendäre<br />
Inselkerb“, wie der<br />
Bergsträßer Anzeiger titelte. Vereinsmitglied<br />
Gerhard Geil hatte<br />
Tische, Bänke und Schirme aufgebaut<br />
und bewirtete die Besucher<br />
aus dem Bierwagen heraus.<br />
Der Spielmannszug des TSV <strong>Reichenbach</strong><br />
unter Leitung des Vereinsmitglieds<br />
Peter Kaffenberger<br />
spielte schmissige Weisen. Bürgermeister<br />
und Vereinsmitglied<br />
Jürgen Kaltwasser bedankte sich<br />
bei den Helfern mit Verzehrgutscheinen<br />
und Lothar Hebel spendierte<br />
noch eine Blumenschale.<br />
Die Dank der Unterstützung vieler<br />
zustande gekommene Brunnenanlage<br />
wird heute von den Familien<br />
Hans Krichbaum und Heinz<br />
Neff vorbildlich gepflegt.<br />
<strong>Unser</strong> <strong>Wasser</strong> 23
24<br />
Der Brunnen in der Hohensteiner Straße - Vorbachbrunnen<br />
Von vielen Nachbarn unterhalten<br />
und gepflegt wird auch der 1968<br />
sanierte Brunnen in der Hohensteiner<br />
Straße. Viele Jahre achteten<br />
Karl Kindinger und Walter<br />
Gehbauer darauf, dass die<br />
Zu- und Abflüsse nicht verstopft<br />
waren, die Wanne das <strong>Wasser</strong><br />
halten konnte und die von der<br />
Gemeinde aufgestellten Blumen<br />
gewässert und gepflegt wurden.<br />
In 2002 machten sie dann Jüngeren<br />
Platz. Diese strahlten das<br />
Granitmauerwerk ab, reinigten das<br />
Becken und strichen es wieder<br />
neu. Auch die Zu- und Abläufe<br />
wurden durchgängiger gemacht.<br />
<strong>Unser</strong> <strong>Wasser</strong><br />
Heute bietet der Brunnen ein ansehnliches<br />
Bild, liefert reichlich<br />
Brauchwasser, leidet aber unter<br />
seinem Standort. Ausschließlich<br />
eine Holzbank der Gemeinde<br />
Brunnen und Bank in der Hohensteiner Straße mit dahinter liegendem<br />
Lagerplatz der Fa. DESTAG und das für seinen derzeitigen Zustand<br />
und Erhalt verantwortliche Team:<br />
Dietmar Ende (links) sowie Gabi und Peter Heil (rechts), Lisa und Nils<br />
Morbitzer sowie Isabelle, Jan, Daniel und Jasmin Heil.<br />
lockern das Mauerwerk auf, Bepflanzungen<br />
fehlen gänzlich. Für<br />
die Verantwortlichen ist dies sicher<br />
ein Anlass, über Verbesserungsmöglichkeiten<br />
nachzudenken.
Der Brunnen im Rödchen<br />
Einen „Brunnen für Kinder“ errichteten<br />
in diesem Jahr Mitglieder<br />
und Freunde des <strong>Verschönerungsverein</strong>s<br />
auf dem Spielplatz<br />
im „Rödchen“. Nach den Plänen<br />
von Philipp Degenhardt war das<br />
„Brunnenbauteam“ erneut aktiv.<br />
Es erfüllte sich einen Kindheitstraum<br />
und baute einen <strong>Wasser</strong>spender<br />
aus Odenwälder Granit.<br />
Hier können die Kleinen Schiffe<br />
schwimmen lassen, Staudämme<br />
bauen, planschen oder einfach<br />
nur dem fließenden <strong>Wasser</strong> zusehen.<br />
<strong>Wasser</strong>meister Helmut Fassinger<br />
und der Bauhof der Gemeinde<br />
unterstützten die Aktion und wa-<br />
ren dann auch bei der Einweihung<br />
am 17.08.2002 mit dabei.<br />
Diese wurde mit der viele Jahre<br />
nicht mehr gefeierten „Rödcheskerb“<br />
verbunden. Hierfür spendete<br />
die Versicherungsagentur Ker-<br />
stin Hölle die Getränke und Rudi<br />
Jährling steuerte eine deftige<br />
Vesper bei. Den zahlreichen Helfern<br />
dankte Bürgermeister Jürgen<br />
Kaltwasser und Prediger Müller<br />
erteilte den kirchlichen Segen.<br />
Zur musikalischen Umrahmung<br />
spielte der Posaunenchor der<br />
Evangelischen Kirchengemeinde<br />
unter der Leitung von Siegfried<br />
Reimund.<br />
<strong>Unser</strong> <strong>Wasser</strong> 25
26<br />
Der Brunnen am Marktplatz<br />
Durch die Chronik von Pfarrer<br />
Martin Walther ist nachgewiesen,<br />
dass der Marktplatzbrunnen<br />
schon vor 1600 bestand. Bürgermeister<br />
Peter Beßinger datierte<br />
die Entstehung des Sandsteinaufsatzes<br />
auf das Jahr<br />
1619, was sich jedoch bisher<br />
nicht belegen ließ. In der Chronik<br />
ist für das fragliche Jahr nur<br />
folgendes festgehalten: „Den<br />
15. Novembris den Reichebacher<br />
Bronn mit neuen Deicheln<br />
gelegt um 7 Gulden“.<br />
Den ältesten fotografischen<br />
Nachweis über den Marktplatzbrunnen<br />
liefert das <strong>Reichenbach</strong>er<br />
Heimatbuch im Zusammenhang<br />
mit der Errichtung des<br />
Kriegerdenkmals von 1870/71.<br />
Hierüber schreibt Richard Matthes,<br />
daß es „im Jahre 1878 auf<br />
dem Marktplatz errichtet und am<br />
14. Juni feierlich eingeweiht wurde.<br />
Der Festplatz war um das<br />
Denkmal herum hergerichtet und<br />
die Lauter zu diesem Zwecke mit<br />
Brettern überbrückt. Pfarrer Zentgraf<br />
hielt die Festrede“.<br />
Obwohl das Foto von Kriegerdenkmal<br />
und Marktplatzbrunnen<br />
für das Heimatbuch später auf-<br />
<strong>Unser</strong> <strong>Wasser</strong><br />
genommen worden ist, kann davon<br />
ausgegangen werden, daß<br />
der Brunnen in dieser Form<br />
(Sandsteintrog und -aufsatz entlang<br />
der Lauter) schon mindestens<br />
seit 1878 bestand.<br />
Standort und Aussehen blieben<br />
in den nächsten Jahrzehnten<br />
gleich, wie ein Foto aus der Zeit<br />
kurz vor dem ersten Weltkrieg<br />
zeigt. Darauf steht der Brunnen<br />
noch entlang der Lauter, der<br />
Standort des Kriegerdenkmals ist<br />
unverändert und der Aufgang zur<br />
Kirche noch in der alten Form mit<br />
der hohen Mauer als Abgrenzung<br />
zum Pfarrhof hin.<br />
Dies änderte sich erst mit der<br />
Errichtung des Kriegerdenkmals<br />
„für die im Ersten Weltkrieg gefallenen<br />
62 Söhne unserer Gemeinde“,<br />
wie Richard Matthes<br />
schreibt. „Im Jahre 1925 wurde<br />
ein schönes und würdiges Denkmal<br />
errichtet, das am 13. September<br />
1925 unter Beteiligung<br />
der ganzen Gemeinde feierlich<br />
eingeweiht wurde. Der Platz mit<br />
seinem stimmungsvollen Hintergrund<br />
könnte nicht glücklicher<br />
gewählt sein. ... Über einem basteiartigen<br />
Mauervorsprung des<br />
Kirchenaufgangs erhebt sich das<br />
3,20 Meter hohe Denkmal. Auf<br />
einem Granitsockel steht ein<br />
mächtiger Pfeiler aus poliertem<br />
Felsberggranit, darüber ein sich<br />
nach unten verjüngendes Kapitäl,<br />
das von einem kunstgeschmiedeten,<br />
feuervergoldeten Kreuz<br />
aus der Werkstätte des Schlossermeisters<br />
Weyhrauch bekrönt<br />
wird. Die Vorderseite des Pfeilers<br />
trägt in vergoldeten Buchstaben<br />
die Widmung: „Ihren im Weltkrieg<br />
gefallenen Söhnen die Gemeinde
<strong>Reichenbach</strong>“. Auf der Rückseite<br />
steht der Spruch: „Niemand hat<br />
größere Liebe denn die, daß er<br />
sein Leben lässet für seine Freunde.<br />
Joh. 15.13.“ Unterhalb des<br />
Denkmals sind in die Mauer fünf<br />
Schrifttafeln mit den dazugehörigen<br />
Kranzhaltern, beides aus<br />
Zehnessyenit hergestellt, eingelassen“.<br />
Die Fotografie, wohl aus der Zeit<br />
um 1930 zeigt vor diesem Denkmal<br />
und der veränderten Kirchentreppe<br />
auch den Marktplatzbrunnen<br />
und das Kriegerdenkmal<br />
1870/71 noch in der alten Form.<br />
Auch die beiden jungen Damen<br />
erfrischten sich in den dreißiger<br />
Jahren noch an dem alten Brunnen.<br />
Mit der Umgestaltung der<br />
Brücke über die Lauter und<br />
der Verkleidung des Mauerwerks<br />
mit Granitsteinen wurde der<br />
Sandsteinaufsatz auf die Bachmauer<br />
versetzt. Hierzu schrieb<br />
Bürgermeister Peter Beßinger am<br />
14. Juli 1939 an das Hochbauamt<br />
in Bensheim, dass „infolge<br />
der notwendig gewordenen Verbreiterung<br />
der Rathausbrücke in<br />
<strong>Reichenbach</strong> auch<br />
der dort befindliche<br />
Brunnen versetzt<br />
werden muss. Da<br />
es sich bei diesem<br />
Brunnen um ein altes<br />
Stück aus dem<br />
Jahr 1619 handelt,<br />
soll derselbe unbedingt<br />
erhalten bleiben.<br />
Es wurde nun<br />
aber festgestellt,<br />
dass der Brunnensockel,<br />
welcher<br />
sehr stark beschädigt<br />
ist, wohl die<br />
Versetzungsarbeiten nicht überdauern<br />
wird und deshalb erneuert<br />
werden muss“. Der Bürgermeister<br />
bittet deshalb<br />
um einen finanziellen<br />
Zuschuss aus dem<br />
Fonds für Denkmalpflege.<br />
Ob die Gemeinde<br />
für die Erneuerung den<br />
beantragten Zuschuss<br />
bekommen hat, geht<br />
aus den vorliegenden<br />
Unterlagen nicht hervor,<br />
jedoch wurde auf Grund<br />
des eingegangenen An-<br />
gebots am 21.07.1939 der<br />
Sockel nebst Lieferung in Auftrag<br />
gegeben und eingebaut.<br />
Ein Foto von Lauterbrücke,<br />
Teilen des Marktplatzes<br />
und dem alten<br />
Rathaus, in dem damals<br />
noch die Post untergebracht<br />
war, macht den<br />
Standort des leicht verändertenMarktplatzbrunnens<br />
deutlich. Dieses Foto<br />
zeigt allerdings auch,<br />
in welch bescheidenem<br />
Zustand damals der<br />
ganze Platz und vor allem<br />
das alte Rathaus<br />
war.<br />
<strong>Unser</strong> <strong>Wasser</strong> 27
28<br />
1964 wurde dann der Brunnen<br />
neu gestaltet, der Trog quer zur<br />
Lauter hin und mit Granitsteinen<br />
errichtet und ein Aufsatz aus Granitsteinen<br />
angebracht, in den die<br />
Jahreszahl der Veränderung und<br />
das <strong>Reichenbach</strong>er Wappen, die<br />
Wolfsangel, eingelassen wurden.<br />
Ein Bild aus dem Jahre 1967<br />
zeigt Volker Wipplinger auf dem<br />
neuen Brunnen, im Hintergrund<br />
das nur mäßig gefüllte Bett der<br />
Lauter und das „Kultauto“ der<br />
50er und 60er Jahre, einen VW-<br />
Käfer.<br />
<strong>Unser</strong> <strong>Wasser</strong><br />
Im Zuge der Erweiterung<br />
der Nibelungenstraße<br />
mit der<br />
Verdolung der Lauter<br />
erfolgte 1971 eine<br />
erneute Versetzung<br />
des Marktplatzbrunnens.<br />
Mit der Umgestaltung<br />
des Marktplatzes<br />
im Jahre<br />
1992 wurde auch<br />
der Marktplatzbrunnen<br />
verändert.<br />
Die bisherige Form aus Granitsteinen<br />
wurde durch einen sogenannten<br />
Pariser Brunnen (flache<br />
<strong>Wasser</strong>platte eingebettet in einen<br />
Steinrahmen) ersetzt. Damit war<br />
die <strong>Wasser</strong>entnahme für die Anlieger<br />
des Marktplatzes vorbei<br />
und es wurde lautstark Kritik an<br />
der Veränderung geübt. Deshalb<br />
errichtete die Gemeinde neben<br />
dem „Pariser Brunnen“ eine<br />
Schwengel-Pumpe, mit der <strong>Wasser</strong><br />
in die bereitgestellten Behältnisse<br />
gepumpt werden konnte.<br />
Wie das nachstehende Foto<br />
dokumentiert, wird davon jedoch<br />
kaum Gebrauch gemacht. Die<br />
betroffenen Anlieger beschaffen<br />
sich ihr Gebrauchswasser wohl<br />
eher an den nahegelegenen<br />
Brunnen an der Friedhofstraße<br />
oder der Beedenkirchener<br />
Straße.<br />
Da die neue Form des Marktplatzbrunnens<br />
auch sonst nicht<br />
überall Zuspruch fand, wurde<br />
1995 ein behauener Aufsatz an-<br />
Ein vergessener Brunnen am<br />
Marktplatz?<br />
gebracht. Dieser hat allerdings<br />
den Nachteil, daß sich durch das<br />
fließende <strong>Wasser</strong> auf rauhem<br />
Stein schnell Algen bilden. Auch<br />
deshalb dürfte die jetzige Fassung<br />
des ältesten <strong>Reichenbach</strong>er<br />
Brunnens sicher nicht die letzte<br />
sein.
Qualitätssicherung ist heute oberstes Gebot<br />
Da mit all den oben aufgeführten<br />
Maßnahmen derzeit eine ausreichende<br />
Versorgung der <strong>Reichenbach</strong>er<br />
Bevölkerung (rund 2.650<br />
Einwohner) [6] mit Trinkwasser<br />
wohl gesichert ist, richtete die<br />
Gemeinde ihr Augenmerk in den<br />
letzten Jahren verstärkt auf die<br />
Qualität unseres <strong>Wasser</strong>s. Dies<br />
auch, weil die Gesundheitsbehörden<br />
wegen hygienischer Probleme<br />
„Druck machten“ und mit<br />
Recht auf die Lösungen in den<br />
großen <strong>Wasser</strong>werken verwiesen.<br />
Wie schon in den fünfziger Jahren<br />
bereiten in jüngster Zeit insbesondere<br />
die beiden Quellen<br />
am Hohenstein und in der Beedenkirchener<br />
Straße den <strong>Reichenbach</strong>ern<br />
Sorgen. So wurden<br />
am Hohenstein über Jahre hinweg<br />
hohe Eintragungen von<br />
Nitrat gemessen und in der Quelle<br />
Hohenstein-2 gar Herbizide<br />
nachgewiesen. Vorwiegend Nitrateintragungen<br />
stellte das Medizinal-UntersuchungsamtDarmstadt<br />
an der Quelle in der Beedenkirchener<br />
Straße fest.<br />
Auch wegen diesen Eintragungen<br />
musste und muss Lautertal<br />
und <strong>Reichenbach</strong> große Anstren-<br />
gungenunternehmen, um die gesetzlichenVorgaben<br />
zu erfüllen.<br />
Erschwerend sind<br />
dabei die Vielzahl<br />
der Quellen, Brunnen,<br />
Pumpwerke<br />
und Hochbehälter,<br />
die fortlaufende<br />
Steigerung der<br />
gesetzlichen Vorgaben<br />
und die<br />
zum Teil rasante Entwicklung der<br />
Technik, die immer wieder Erneuerungen<br />
notwendig macht.<br />
Als wichtigste Maßnahmen wurden<br />
in die Hochbehälter Aufbereitungsanlagen<br />
eingebaut. In der<br />
Beedenkirchener Straße und im<br />
Rödchen arbeiten kleinere CO2und<br />
UV-Anlagen. Die Aufstellung<br />
von Geräten größeren Typs ist<br />
geplant. Für den Hochbehälter<br />
am Hohenstein ist eine UV-Anlage<br />
vorgesehen. Fortlaufend ist<br />
die Gemeinde dabei, die <strong>Wasser</strong>schutzzonen<br />
um die Quellen herum<br />
zu erwerben und zu sichern.<br />
Mit der Beteiligung an einem<br />
Landnutzungskonzept ist langfristig<br />
die Chance geboten, dass<br />
Aktuelle Kosten der Trinkwasserversorgung<br />
Alle Aufwendungen zur Bereitstellung<br />
eines qualitativ guten und<br />
quantitativ ausreichenden Trinkwassers<br />
kosten die Gemeinde<br />
Geld. Über die Einnahmen und<br />
Ausgaben in dem „Unterabschnitt<br />
8150 <strong>Wasser</strong>versorgung“<br />
gibt der Haushaltsplan 2002 Auskunft.<br />
Dort waren für die gesamte<br />
Gemeinde Lautertal Benutzungsgebühren<br />
in Höhe von umgerechnet<br />
650.000 EURO eingeplant.<br />
Dies entspricht einem<br />
Verbrauch von etwa 273.000 Kubikmeter.<br />
Die höchsten Kosten auf der<br />
Ausgabenseite machten die<br />
Verzinsung des Anlagekapitals<br />
mit 235.000 €, Abschreibungen<br />
(215.000 €), Personalausgaben<br />
(94.000 €), Unterhaltung Rohrnetz<br />
und Rohrbrüche (35.000 €),<br />
Bewirtschaftung der Grundstücke<br />
und baulichen Anlagen (24.000 €),<br />
Grundwasserabgabe (38.000 €),<br />
Beitrag zum <strong>Wasser</strong>wirtschaftsverband<br />
(20.000 €), <strong>Wasser</strong>untersuchungen<br />
(25.000 €) und Erstattungen<br />
für Leistungen des Bauhofes<br />
in Höhe von 17.000 € aus.<br />
Klaus Weigold<br />
die landwirtschaftlichen Betriebe<br />
weniger Eintragungen in das<br />
Grundwasser vornehmen.<br />
Die Erneuerungen und der laufende<br />
Betrieb der Anlagen werden<br />
vom Rathaus aus vorbereitet,<br />
organisiert und überwacht.<br />
Für den gesamten Arbeitsbereich<br />
„<strong>Wasser</strong>versorgung“ zuständig<br />
ist dort Klaus Weigold. Als <strong>Wasser</strong>meister<br />
fungiert Helmut Fassinger,<br />
der von Herbert Fabian<br />
unterstützt wird. Beide haben unter<br />
Berücksichtigung der technischen<br />
Entwicklung weitgehend<br />
die Aufgaben, wie sie eingangs<br />
dem „Rohrmeister“ zugeschrieben<br />
wurden.<br />
Den Einnahmen von 662.000 €<br />
stehen Ausgaben von 798.000 €<br />
gegenüber. Dies ergab einen Zuschussbedarf<br />
von 136.000 €. Nahezu<br />
identisch wurde dieser<br />
von der Gemeinde aufzubringende<br />
Betrag auch in der Jahresrechnung<br />
2000 ausgewiesen.<br />
Er betrug 134.805,56 € oder<br />
263.656,93 DM. Dies belegt,<br />
dass auch bei hohen <strong>Wasser</strong>gebühren<br />
eine Unterdeckung auftreten<br />
kann, insbesondere, wenn<br />
viele kleine Einzelwerke zu unterhalten<br />
sind.<br />
<strong>Unser</strong> <strong>Wasser</strong> 29
30<br />
Daseinsfürsorge - früher und heute<br />
Die Sicherung des Trinkwassers<br />
als unser Lebensmittel Nummer<br />
eins beschäftigte die Menschen<br />
in <strong>Reichenbach</strong> seit Gründung<br />
ihres Dorfes. Diese Sicherung<br />
war schon immer schwierig und<br />
wird immer problematischer.<br />
Schon das Anlegen eines Brunnens<br />
vor 400 Jahren war für<br />
unsere Vorfahren ein großes Vorhaben.<br />
Dieses wurde mit dem<br />
Mut und den Fähigkeiten der<br />
Männer um die vorletzte Jahrhundertwende<br />
noch gesteigert, als<br />
<strong>Unser</strong> <strong>Wasser</strong><br />
sie ein <strong>Wasser</strong>werk und die <strong>Wasser</strong>leitungen<br />
durch unser Dorf<br />
bauen ließen.<br />
Heute ist die Förderung, Aufbereitung<br />
und Weitergabe des Trinkwassers<br />
sowie die damit verbundene<br />
Verwaltung fast schon eine<br />
„Wissenschaft für sich“, bei der<br />
viele Dinge zu beachten sind und<br />
- die viel Geld kosten. Wir sollten<br />
daran denken, wenn wir den<br />
<strong>Wasser</strong>hahn aufdrehen, und „unser<br />
<strong>Wasser</strong>“ nutzen.
Quellenangaben<br />
[1] Ein Dorf im Odenwald, Hermann Bauer u.a. 1997<br />
[2] <strong>Reichenbach</strong>er Heimatbuch, Richard Matthes, 1936<br />
[3] <strong>Reichenbach</strong>er Heimatbuch, Rudolf Kunz, 1987<br />
[4] „Untersuchungsbericht über die Gemeindewasserleitung in<br />
<strong>Reichenbach</strong> im Odenwald“, Carl Emil Spatz, Wiesbaden,<br />
10. September 1946<br />
[5] Chronik des Pfarrers Walther (1599 - 1620); Eintragungen in die<br />
Kirchenbücher v. 1599 - 1620 (evangelisches Pfarrhaus<br />
<strong>Reichenbach</strong>)<br />
[6] Gemeindearchiv Lautertal-<strong>Reichenbach</strong><br />
Bildnachweis<br />
Die Quellenangaben zu allen Fotos / Reproduktionen sind der<br />
Redaktion bekannt und wurden unentgeltlich zur Verfügung gestellt;<br />
hierfür dankt der Herausgeber herzlich.<br />
Impressum:<br />
Herausgeber: <strong>Verschönerungsverein</strong> <strong>Reichenbach</strong> 1974 e.V.<br />
unter Vorsitz von Heinz Eichhorn,<br />
Nibelungenstraße 376<br />
64686 Lautertal-<strong>Reichenbach</strong><br />
Email: heinz.eichhorn@freenet.de<br />
Redaktion: Dr. Joachim Bartl<br />
Text: Heinz Eichhorn, Dr. Joachim Bartl,<br />
Manfred Schaarschmidt,<br />
Fotos: Dr. Joachim Bartl, Walter Koepff,<br />
Reinhard Saurugg, Thomas Neu, Hans Krichbaum<br />
Reproduktion: Walter Koepff (u.a. aus Familienbesitz)<br />
Dr. Joachim Bartl (aus <strong>Reichenbach</strong>er<br />
Heimatbuch und Gemeindearchiv)<br />
Quellenrecherche: Gerlinde Scharf, Heinz Eichhorn, Dr. Joachim Bartl<br />
Gestaltung/Layout: WR design, Reinhard Saurugg<br />
Alle Rechte: <strong>Verschönerungsverein</strong> <strong>Reichenbach</strong><br />
Auflage 1000 Exemplare<br />
<strong>Unser</strong> <strong>Wasser</strong> 31
„Das <strong>Wasser</strong> kann<br />
ohne Fische auskommen,<br />
aber kein einziger Fisch<br />
ohne <strong>Wasser</strong>“