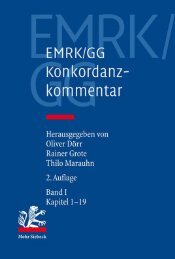PDF (552 KB) - Mohr Siebeck Verlag
PDF (552 KB) - Mohr Siebeck Verlag
PDF (552 KB) - Mohr Siebeck Verlag
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
International Yearbook for Hermeneutics<br />
12 · 2013
International Yearbook<br />
for Hermeneutics<br />
Internationales Jahrbuch für Hermeneutik<br />
edited by<br />
Günter Figal<br />
in cooperation with<br />
Damir Barbarić, Béla Bacsó, Gottfried Boehm,<br />
Luca Crescenzi, Ingolf Dalferth, Nicholas Davey,<br />
Donatella Di Cesare, Jean Grondin, Pavel Kouba,<br />
Joachim Lege, Hideki Mine, Hans Ruin,<br />
John Sallis, Dennis Schmidt<br />
12 · 2013<br />
Focus: Reading<br />
Schwerpunkt: Lesen<br />
<strong>Mohr</strong> <strong>Siebeck</strong>
Editorial team/Redaktion:<br />
Dr. David Espinet<br />
Tobias Keiling, Ph.D.<br />
Jerome Veith, Ph.D.<br />
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg<br />
Philosophisches Seminar<br />
Platz der Universität 3<br />
79085 Freiburg<br />
Germany<br />
The Yearbook calls for contributions on topics in Philosophical Hermeneutics and bordering<br />
disciplines. Please send manuscripts to: jahrbuch@philosophie.uni-freiburg.de. All<br />
articles, except when invited, are subject to blind review.<br />
We assume that manuscripts are unpublished and have not been submitted for publication<br />
elsewhere.<br />
Citations are to be made according to the style in the present volume. Detailed information<br />
on formatting manuscripts can be downloaded from: http://www.philosophie.<br />
uni-freiburg.de/ijh.<br />
Das Jahrbuch bittet um Zusendungen zu Themen der Philosophischen Hermeneutik und<br />
angrenzender Disziplinen. Bitte senden Sie Manuskripte an: jahrbuch@philosophie.unifreiburg.de.<br />
Alle Artikel, die nicht auf Einladung des Heraugebers verfasst worden sind,<br />
werden in einem blind review-Verfahren begutachtet.<br />
Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei eingereichten Manuskripten um unveröffentlichte<br />
Originalbeiträge handelt, die nicht an anderer Stelle zur Veröffentlichung<br />
vorgelegt worden sind.<br />
Literaturhinweise bitte wie im vorliegenden Band. Ausführliche Hinweise für Manuskripte<br />
können unter http://www.philosophie.uni-freiburg.de/ijh heruntergeladen<br />
werden.<br />
ISBN 978-3-16-152711-1<br />
ISSN 2196-534X<br />
Die Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliographie;<br />
detailed bibliographic data are available on the Internet at http://dnb.dnb.de.<br />
© 2013 by <strong>Mohr</strong> <strong>Siebeck</strong> Tübingen, Germany. www.mohr.de<br />
This book may not be reproduced, in whole or in part, in any form (beyond that permitted<br />
by copyright law) without the publisher’s written permission. This applies particularly<br />
to reproductions, translations, microfilms and storage and processing in electronic systems.<br />
The book was typeset by Martin Fischer in Tübingen using Bembo Antiqua and OdysseaU,<br />
printed by Laupp & Göbel in Nehren on non-aging paper and bound by Buchbinderei<br />
Nädele in Nehren.<br />
Printed in Germany.
Inhaltsverzeichnis<br />
Schwerpunkt: Lesen<br />
Heike Gfrereis (Deutsches Literaturarchiv Marbach)<br />
Nicht-Lesen. Die Entzauberung einer alten Vorstellung . ......... 1<br />
Bernhard Zimmermann (Universität Freiburg)<br />
Ovid liest Klassiker .................................... 12<br />
John Sallis (Boston College)<br />
Doubly Slow Reading .................................. 27<br />
Luca Crescenzi (Università di Pisa)<br />
Sich wandelnde Wahrheit und selbstkritisches Lesen.<br />
Nietzsche-Variationen .................................. 35<br />
Ben Vedder (Radboud Universiteit Nijmegen)<br />
The Historicity of Reading .............................. 47<br />
Dennis J. Schmidt (Pennsylvania State University)<br />
The Garden of Letters. Reading Plato’s Phaedrus on Reading . ...... 61<br />
Daniela Vallega-Neu (University of Oregon)<br />
At the Limit of Word and Thought.<br />
Reading Heidegger’s Das Ereignis .......................... 77<br />
Gert-Jan van der Heiden (Radboud Universiteit Nijmegen)<br />
Reading Bartleby, Reading Ion. On a Difference between Agamben<br />
and Nancy .......................................... 92<br />
Nicholas Davey (University of Dundee)<br />
Critical Excess and the Reasonableness of Interpretation ......... 109
VI<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
David Espinet (Universität Freiburg)<br />
Read thyself! Hobbes, Kant und Husserl über die Grenzen<br />
der Selbsterfahrung .................................... 126<br />
Beiträge<br />
Andrea Kern (Universität Leipzig)<br />
Das Kunstwerk zwischen Autonomieanspruch und Wahrheit ...... 147<br />
Alexander Schnell (Universität Paris-Sorbonne)<br />
Kontingenz und Entzug. Zum Transzendentalismus Heideggers .... 165<br />
Enrique V. Muñoz Pérez (Universidad Católica del Maule)<br />
Heidegger und Scheler. Ein vergessener Bezug ................ 182<br />
Csaba Olay (Eötvös Universität Budapest)<br />
Die Überlieferung der Gegenwart und die Gegenwart<br />
der Überlieferung. Heidegger und Gadamer über Tradition ....... 196<br />
Eberhard Geisler (Universität Mainz)<br />
Hölderlin und die Gabe ................................. 220<br />
Autoren und Herausgeber ............................... 257<br />
Namenverzeichnis ..................................... 259<br />
Sachverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Schwerpunkt: Lesen<br />
1<br />
Nicht-Lesen<br />
Die Entzauberung einer alten Vorstellung<br />
von<br />
Heike Gfrereis (Deutsches Literaturarchiv Marbach)<br />
Die Erfüllung der Literatur (auch aller anderen Texte) scheint darin zu liegen,<br />
gelesen zu werden. „Die einzige Bedingung, unter der Literatur steht“,<br />
so Hans-Georg Gadamer in Wahrheit und Methode, „ist ihre sprachliche<br />
Überlieferung und ihre Einlösung durch die Lektüre.“ 1 In diesem idealen<br />
Reich der Literatur ist Lesen existentiell, teleologisch und absolut. Literatur<br />
gibt es, damit und weil gelesen wird, und gelesen wird, weil und damit es<br />
Literatur gibt. Das eine geht im anderen auf und ist um des anderen willen<br />
da: „Wirkung ist daher weder ausschließlich im Text noch ausschließlich<br />
im Leserverhalten zu fassen; der Text ist ein Wirkungspotential, das im<br />
Lesevorgang aktualisiert wird.“ 2 „Im Gelesenwerden geschieht die für jedes<br />
literarische Werk zentrale Interaktion zwischen seiner Struktur und seinem<br />
Empfänger.“ 3 Der Sinn der Literatur liegt ganz im Leser selbst, in seiner<br />
„Einbildungskraft“. 4 Nicht zu lesen oder nur wenig oder unaufmerksam,<br />
gilt dann als Verweigerung, wenn nicht als Sakrileg: Nicht-Lesen scheint<br />
der Literatur ihre Grundlage und ihr Ziel zu entziehen.<br />
In den Dichterbibliotheken des Deutschen Literaturarchivs Marbach<br />
zeugen die Bücher beim genauen Hinsehen jedoch mehr vom Nicht-Lesen<br />
1<br />
Hans-Georg Gadamer, Hermeneutik I. Wahrheit und Methode: Grundzüge einer<br />
philosophischen Hermeneutik, Gesammelte Werke (im Folgenden: GW) Band 1, fünfte<br />
durchgesehene und erweiterte Auflage, Tübingen 1986, S. 165.<br />
2<br />
Wolfgang Iser, Der Akt des Lesens. Theorie ästhetischer Wirkung, München<br />
1976, S. 7.<br />
3<br />
Iser, Der Akt des Lesens, S. 38.<br />
4<br />
Wolfgang Iser, Die Appellstruktur der Texte. Unbestimmtheit als Wirkungsbedingung<br />
literarischer Prosa, in: Rainer Warning (Hrsg.): Rezeptionsästhetik. Theorie<br />
und Praxis, München 1975, S. 228–252, hier S. 248: „Es charakterisiert diesen [den literarischen<br />
Text], daß er in der Regel seine Intention nicht ausformuliert. Das wichtigste<br />
seiner Elemente also bleibt ungesagt. Wenn dies so ist, wo hat dann die Intention des<br />
Textes ihren Ort? Nun, in der Einbildungskraft des Lesers.“
2 Heike Gfrereis<br />
als vom Lesen: unaufgeschnittene Bögen, makellos unbenutzte Bände,<br />
mittendrin vergessene Buchzeichen, eingelegte Blumen-, Blatt‐ und Bildersammlungen;<br />
manchmal wurden Seiten einfach auch überklebt oder<br />
ganze Kapitel ausgerissen; ihre Handhabung, Lagerung, die Umzüge und<br />
Umnutzungen haben mehr Spuren hinterlassen als die Lektüre. 5 Eduard<br />
Mörike hat sein lateinisches Lexikon zum Blumenschemel zweckentfremdet,<br />
Gadamer selbst sein Exemplar von Kants Kritik der Urteilskraft zerpflückt<br />
und dafür mit anderen Dingen angereichert wie einem Kalender und einer<br />
Taxiquittung. Lesen selbst – im herkömmlichen Sinne von: einen schriftlichen<br />
Text verstehen, Buchstaben entziffern und interpretieren – scheint<br />
spurlos zu geschehen, sichtbar nur dann, wenn es ins Noch-Nicht oder<br />
Nicht-Mehr-Lesen, ins buchstäbliche Begreifen, Selber-Schreiben oder<br />
überkonzentrierte Abschweifen übergeht. Eselsohren, Büroklammern, Unterstreichungen,<br />
Kommentare, Einkreisungen, Nummerierungen, Linien,<br />
Pfeile, Verknüpfungen und Vernetzungen, Anheftungen, Einmalungen und<br />
Überschreibungen sind die Zeichen der intensiven Lektüren, die an die<br />
Grenzen des Lesens führen. Sie wuchern immer nur stellenweise, manchmal<br />
beschränkt auf einen einzigen Satz oder Vers, der markiert wird, um ihn<br />
aus seinem Kontext herauszulösen und aus dem Buch in die eigene Welt<br />
hinauszunehmen; so wie diese den Büchern einverleibt wird, indem man<br />
sie wie W. G. Sebald und Paul Celan als Sammelstätte für Wörter und Fundstücke<br />
nutzt.<br />
Das Nicht-Lesen, das möchte ich im Folgenden näher ausführen, ist ein<br />
auch hermeneutisch notwendiger Teil des Lesens. Lesen selbst bedeutet<br />
als Kulturtechnik sehr viel mehr als einen Text zu lesen und zu verstehen:<br />
Lesen ist ein ästhetischer Zustand.<br />
1. Schreiben als Lesen<br />
In den Büchern aus Martin Heideggers Bibliothek tauchen immer wieder<br />
intensive, oft mehrfarbige, aber auf wenige Seiten konzentrierte Einlassungen<br />
auf, die manchmal sogar an Umfang den zu lesenden Text überschreiten.<br />
Als habe er immer nur ein bisschen gelesen, ein Stückwerk, nie<br />
5<br />
Beispiele für diese Marbacher Lesespuren sind u. a. veröffentlicht in: Deutsches Literaturarchiv<br />
Marbach (Hrsg.), Denkbilder und Schaustücke. Das Literaturmuseum der<br />
Moderne, Marbach 2006; Deutsches Literaturarchiv Marbach (Hrsg.), Ordnung. Eine<br />
unendliche Geschichte, Marbach 2007; Ulrich von Bülow/Heike Gfrereis/Ellen Strittmatter<br />
(Hrsg.), Wandernde Schatten. W. G. Sebalds Unterwelt, Marbach 2008; Deutsches<br />
Literaturarchiv Marbach (Hrsg.), Schicksal. Sieben mal sieben unhintergehbare Dinge,<br />
Marbach 2011.
Nicht-Lesen<br />
3<br />
das Ganze – oder zumindest in einem Teil schon alles, als unterzöge er es<br />
der extremen strukturalistischen Lektüre, die Roland Barthes an Balzac<br />
versucht, 6 oder erspähe das unendliche Buch, das Jorge Luis Borges immer<br />
wieder beschwört und das wir nur nicht sehen, weil wir vergessen: „strenggenommen<br />
würde ein einziger Band gewöhnlichen Formats, gedruckt in<br />
Corpus neun oder zehn, genügen, wenn er aus einer unendlichen Zahl<br />
unendlich dünner Blätter bestünde. (Cavalieri sagte zu Anfang des 17. Jahrhunderts,<br />
daß jeder feste Körper die Überlagerung einer unendlichen Zahl<br />
von Flächen ist.) Die Handhabung dieses seidendünnen Vademecums wäre<br />
nicht leicht; jedes anscheinende Einzelblatt würde sich in andere gleichgeartete<br />
teilen; das unbegreifliche Blatt in der Mitte hätte keine Rückseite.“ 7<br />
Gerade der Versuch, die Struktur des Textes zu erkennen, seine Ursprungsformel<br />
zu entschlüsseln und somit alles zu sehen und ihn dennoch<br />
punktgenau zu lesen, entzieht den Text der Lektüre und führt dazu, dass wir<br />
ihn nicht mehr lesen. Die Literatur entgleitet uns, je mehr wir sie begreifen<br />
wollen: „Denn das Lesen wird erst dort zum Vergnügen, wo unsere Produktivität<br />
ins Spiel kommt, und das heißt, wo Texte eine Chance bieten,<br />
unsere Vermögen zu betätigen.“ 8 „[D]er Vorgang des Schreibens schließt<br />
als dialektisches Korrelativ den Vorgang des Lesens ein, und diese beiden<br />
zusammenhängenden Akte verlangen zwei verschieden tätige Menschen.<br />
Die vereinte Anstrengung des Autors und des Lesers läßt das konkrete und<br />
imaginäre Objekt erstehen, das das Werk des Geistes ist. Kunst gibt es nur<br />
für und durch den anderen.“ 9 Bei Hans-Georg Gadamer heißt es fünfzehn<br />
Jahre vor Wolfgang Iser, acht Jahre vor Roland Barthes’ La mort de l‘auteur<br />
und zwei Jahre vor Umberto Ecos Opera aperta: „Wie wir zeigen konnten,<br />
daß das Sein des Kunstwerks Spiel ist, welches sich erst mit der Aufnahme<br />
durch den Zuschauer vollendet, so gilt von Texten überhaupt, daß erst im<br />
Verstehen die Rückverwandlung toter Sinnspur in lebendigen Sinn geschieht.“<br />
10 „Nicht nur gelegentlich, sondern immer übertrifft der Sinn eines<br />
Textes seinen Autor. Daher ist Verstehen kein nur reproduktives, sondern<br />
stets auch ein produktives Verhalten.“ 11<br />
Hermeneutisch problematisch ist, dass sich die Texte einer durchgängigen<br />
Lektüre entziehen, dass sie nicht auf einen Blick sichtbar und als Ganzes<br />
6<br />
Roland Barthes, S/Z, Frankfurt 1987, S. 7: „Mit Hilfe der Askese soll es manchen<br />
Buddhisten gelingen, eine ganze Landschaft aus einer Saubohne herauszulesen.“<br />
7<br />
Jorge Luis Borges, Die Bibliothek von Babel, in: Ders., Erzählungen. 1933–1944,<br />
Gesammelte Werke Bd. 3/I, München 1981, S. 145–154, hier S. 154.<br />
8<br />
Iser, Der Akt des Lesens, S. 176.<br />
9<br />
Jean-Paul Sartre, Was ist Literatur? Ein Essay, übers. von Hans Georg Brenner,<br />
Hamburg 1958, S. 35, zitiert bei Iser, Der Akt des Lesens, S. 176–177.<br />
10<br />
Gadamer, Wahrheit und Methode, GW 1, S. 169.<br />
11<br />
Gadamer, Wahrheit und Methode, GW 1, S. 301.
4 Heike Gfrereis<br />
unmittelbar verständlich sind, sondern erst in der Abwesenheit, im Nicht-<br />
Mehr‐ oder Noch-Nicht-Lesen als solches erscheinen und damit das Nicht-<br />
Lesen – das Produzieren von Texten, das Schreiben – unumgänglich Teil des<br />
Lesens ist: „Gewiß zeigt die Literatur und ihre Aufnahme in der Lektüre ein<br />
Höchstmaß an Entbundenheit und Beweglichkeit. Das bezeugt schon die<br />
Tatsache, daß man ein Buch nicht in einem Zuge zu lesen braucht, so daß<br />
das Daranbleiben eine eigene Aufgabe des Wiederaufnehmens ist, die im<br />
Anhören oder Anschauen kein Analogon hat.“ 12 Man muss etwas verstehen,<br />
was seine Referenz nur im Leser selbst hat und dort selten als festes und<br />
gebundenes Gegenüber gegenwärtig ist. Einen Text zu lesen, in der Hand<br />
zu halten, die Buchstaben mit den Augen zu verfolgen, Wörter zu formulieren,<br />
Sätze zu verstehen, ist die Ausnahme unsrer Literaturerfahrung,<br />
nicht der Regelfall. Wolfgang Isers Theorie des Lesens ist auch ein (sicher<br />
nicht bewusster) Versuch, dieses ‚Wiederaufnehmen‘ und das vorangehende<br />
Nicht-Lesen als notwendigen hermeneutischen Bestandteil des Lesens einzuführen<br />
und zugleich eine Technik zu entwickeln, die das Nicht-Lesen<br />
kontrolliert: „Wenn wir den Text pauschal als Ansammlung von Zeichen<br />
verstehen, so geschieht im Lesen ein ständiges Gruppieren solcher Zeichen,<br />
worin sich eine elementare Aktivität des Strukturierungsprozesses der Lektüre<br />
zum Ausdruck bringt. Gruppierungen verkörpern den Versuch, das<br />
zusammen zu sehen, was man im jeweiligen Lektüreausschnitt zu übersehen<br />
vermag, so daß das Lesen als ein Vorgang der Konsistenzbildung verläuft.“ 13<br />
Isers idealer Leser konstituiert den Text permanent neu, er blättert hin und<br />
her, liest auf der Stelle und kreuz und quer, aber nicht streng sukzessiv. Er<br />
verlässt den Text, um an einer anderen Stelle zu ihm zurückzukommen.<br />
Zusammensehen, „was man im jeweiligen Lektüreabschnitt zu übersehen<br />
vermag“, das heißt auch: alles andere nicht sehen, das Lesen abbremsen<br />
und beschleunigen, vergessen und vorausblättern. Der ideale Leser betreibt<br />
ein potenziertes Lesen, ein Lesen hoch drei, eine legitime, weil heuristisch<br />
motivierte Methode der Lektürevermeidung. „Diese Intellektuellen lesen<br />
ja nie ein Buch von vorne bis hinten, das machen eben nur Kinder wie wir,<br />
wie H. und ich“, steht 1975 in der Anthologie Erste Lese-Erlebnisse. 14 Wer<br />
schon besser lesen kann, so könnte man sagen, schreibt selber.<br />
12<br />
Gadamer, Wahrheit und Methode, GW 1, S. 166.<br />
13<br />
Wolfgang Iser, Der Lesevorgang. Eine phänomenologische Perspektive, in: Rainer<br />
Warning (Hrsg.): Rezeptionsästhetik. Theorie und Praxis, München 1975, S. 253–276,<br />
hier S. 264.<br />
14<br />
Gertrud Leutenegger, in: Siegfried Unseld (Hrsg.), Erste Lese-Erlebnisse, Frankfurt<br />
am Main 1972, S. 145–154, hier S. 145.
Nicht-Lesen<br />
5<br />
2. Lesen als ästhetischer Zustand<br />
Lesen heißt viel mehr als Lesen, bedeutet immer auch: Umgang mit dem<br />
Buch, Nicht-Verstehen und Herumblättern, Überblättern, Hängenbleiben,<br />
Abbrechen und Aussortieren, Langeweile, Übermüdung, nur noch Buchstaben<br />
sehen, Staub und Fliegen fortwischen, Weglegen und Wiederherholen,<br />
Über-einem-Buch-Einschlafen und Wieder-Aufwachen, ein<br />
„Lebensstil“, 15 in dem das Buch Gegenüber, Begleiter, manchmal Freund<br />
und manchmal Feind und unumgänglicher Teil der Welt ist. Je kleiner und<br />
zahlreicher die Bücher werden, je schneller und unkörperlicher das Lesen,<br />
was um 1800 der Fall ist, 16 desto mehr nehmen die Ablenkungen vom Lesen<br />
zu, wobei auch das laute Lesen diese zulässt und sogar noch provoziert: Wer<br />
ein Gedicht auf den Takt und Reim hin vorliest, versteht zunächst selten,<br />
was er liest. Erinnerungen an das Lesen – und nicht nur die eindruckvollsten<br />
darunter (diejenigen von Jean-Paul Sartre in Les mots) – erzählen immer<br />
auch vom Nicht-Lesen, vom Nicht-Lesen-Dürfen, ‐Wollen oder ‐Können.<br />
Lesen ist ein Übergangzustand, keine Tätigkeit. Es ist ein Wahrnehmen von<br />
Schwellen, ein immer wieder Ins-Lesen-Kommen und Aus-dem-Lesen-<br />
Treten. Man muss nur in den Ersten Lese-Erlebnissen blättern: „Bücher, die<br />
man immer wieder las, weil man sie vergaß wie einen Traum.“ 17 – „Ich war<br />
als Kind viel krank, und ich lag lange im Bett“. 18 – „Ich zerriß den Bindfaden<br />
und blies den Staub von den Büchern. Auf jedem der kartonierten<br />
Bände war dasselbe Deckelbild“. 19 – „Der geborene Leser, für den ich mich<br />
halte, hatte das Glück, schon bevor er lesen lernte und die Kraft erwarb, nie<br />
ganz verloren zu sein, Bücher geschenkt oder geliehen zu bekommen, sie in<br />
der Hand zu wiegen, sie rundherum zu stapeln, eine Burg nicht aus Sand,<br />
und eine literarische Welt, das unermeßliche Reich der Gedanken, der<br />
Phantasie und der energischen Gefühle neben oder über der Erde der vernünftigen<br />
Leute zu ahnen.“ 20 – „Das erste Lese-Erlebnis ist das hundertste<br />
Buch, oder das zweihundertunderste. Jeweils bleibt es sperrig stecken in der<br />
15<br />
Hannelore Schlaffer, Goethe und ein Ende – Lektüre und Lebensstil, Süddeutsche<br />
Zeitung, 10. Mai 2012.<br />
16<br />
Vgl. Erich Schön, Der Verlust der Sinnlichkeit oder Die Verwandlungen des<br />
Lesers. Mentalitätswandel um 1800, Stuttgart 1987.<br />
17<br />
Ernst Bloch, in: Siegfried Unseld (Hrsg.), Erste Lese-Erlebnisse, Frankfurt am<br />
Main 1972, S. 17–18, hier S. 17.<br />
18<br />
Anna Seghers, in: Siegfried Unseld (Hrsg.), Erste Lese-Erlebnisse, Frankfurt am<br />
Main 1972, S. 19–22, hier S. 19.<br />
19<br />
Peter Huchel, in: Siegfried Unseld (Hrsg.), Erste Lese-Erlebnisse, Frankfurt am<br />
Main 1972, S. 25–33, hier S. 26.<br />
20<br />
Wolfgang Koeppen, in: Siegfried Unseld (Hrsg.), Erste Lese-Erlebnisse, Frankfurt<br />
am Main 1972, S. 34–42, hier S. 34.
6 Heike Gfrereis<br />
Erinnerung; manchmal nur wegen der befremdlichen Umstände, mit denen<br />
es verlorenging.“ 21 – „Wie es sich für ein Erlebnis gehört, sind auch jetzt<br />
noch alle Details gegenwärtig: ein sehr klarer Tag, indian summer, mit dem<br />
dicken Buch ging ich am Sportfeld vorbei, auf dem die Football-Mannschaft<br />
trainierte, dann ein Pfad in einem Waldstreifen am Rand des Campus,<br />
eine Wiese, ein Baum mitten auf dieser Wiese, unter diesen Baum setzte<br />
ich mich, blätterte in den rund 1600 Dünndruckseiten herum, las das erste<br />
Kapitel mit der Überschrift ‚Woraus bemerkenswerter Weise nichts hervorgeht‘<br />
– schon hakte sich etwas fest.“ 22 – „[I]ch war plötzlich erstaunt, wie<br />
tief ich in die Geschichte eingedrungen war. Es war ein angenehmes Gefühl<br />
der Schwere, ein leichter Druck im Kopf, eine Müdigkeit, auf die ich stolz<br />
war, und dann wieder die Anstrengung und der Zwang weiterzulesen, um<br />
das körperlose Gefühl beim Tagträumen wiederzugewinnen: Das Sichselbstverlieren,<br />
eine andere Identität anzunehmen, WO ANDERS ZU<br />
SEIN, ohne dort zu sein“. 23 – „Mein größtes Lese-Erlebnis war ursprünglich<br />
das Nicht-Lesen. In meiner Kindheit und frühen Jugend verfügte ich<br />
nicht über Bücher und Sprache und Dichtung.“ 24 „[J]etzt denke ich oft,<br />
die Augen fallen mir aus und sind zu klein und zu schwach“. 25 – „Nimmt<br />
doch alles Gelesene in den frühen Jahren als Literatur nur einen schmalen,<br />
unscheinbaren Platz ein. Hingegen die Umstände, die Nachwirkungen sind<br />
das Erregende, das sich im Gedächtnis Ausbreitende.“ 26 Aus einer anderen<br />
Anthologie, Mein erstes Buch: „Der Bücherschrank der frühen Kindheit ist<br />
ein Begleiter des Menschen für sein ganzes Leben. Die Anordnung seiner<br />
Fächer, die Auswahl der Bücher, die Farbe der Buchrücken gilt ihm als die<br />
Farbe, Höhe und Anordnung der Weltliteratur“. 27 – „Wenig nur habe ich<br />
genau gelesen, bestimmte Stellen jedoch allzu eingehend und den Rest gerade<br />
so aus den Augenwinkeln … Ich blättere, überfliege; selten einmal lasse ich<br />
mich nieder, aber wenn, dann gründlich. […] Es genügt mir oft schon, in<br />
einem Buch zu blättern, damit ich dem Reiz nachgebe, mir zu denken, was<br />
21<br />
Uwe Johnson, in: Siegfried Unseld (Hrsg.), Erste Lese-Erlebnisse, Frankfurt am<br />
Main 1972, S. 107–110, hier S. 107.<br />
22<br />
Dieter Kühn, in: Siegfried Unseld (Hrsg.), Erste Lese-Erlebnisse, Frankfurt am<br />
Main 1972, S. 111–118, hier S. 112.<br />
23<br />
Gerhard Rothe, in: Siegfried Unseld (Hrsg.), Erste Lese-Erlebnisse, Frankfurt am<br />
Main 1972, S. 119–121, hier S. 119.<br />
24<br />
Karin Struck, in: Siegfried Unseld (Hrsg.), Erste Lese-Erlebnisse, Frankfurt am<br />
Main 1972, S. 133–144, hier S. 133.<br />
25<br />
Struck, in: Erste Lese Erlebnisse, S. 134.<br />
26<br />
Leutenegger in: Erste Lese-Erlebnisse, S. 145.<br />
27<br />
Ossip Mandelstam, Der Bücherschrank, in: Hans Jürgen Balmes (Hrsg.), Mein<br />
erstes Buch. Autoren erzählen vom Lesen, Frankfurt am Main 2002, S. 13–16, hier S. 13.
Nicht-Lesen<br />
7<br />
darin stehen mag.“ 28 – „Oft nahm ich das Buch mit heim und hielt es noch<br />
in der Hand, wenn ich einschlief “. 29<br />
Lesen, das ist auch und nicht selten: mit dem Buch einschlafen. In vielen<br />
Religionen ist Lesen ein ritueller Akt, der sehr viel mehr ist als nur Entziffern,<br />
was da steht. Die Bibel, der Talmud oder der Koran entfalten – wie<br />
Reliquien und Monstranzen, die nur an Festtagen gezeigt werden – ihre<br />
Macht auch da, wo sie nicht gelesen werden. Ihre Anschauung und selbst<br />
ihre durch ihren Verschluss verstärkte Gegenwärtigkeit genügen, um an<br />
ihnen teilzuhaben, ohne in ihnen zu lesen. Der gute Rat, es genüge, ein<br />
Buch unter das Kopfkissen zu legen, um zu wissen, was darin stehe, bewahrt<br />
diese Vorstellung noch. „Stimmungen des Lesens“, wie sie Hans Ulrich<br />
Gumbrecht beschreibt – dieses Als-ob-man-von-innen-berührt-werde –, 30<br />
sind nicht an die Lektüre eines konkreten Textes gebunden, sondern an die<br />
Umgebung des Buchs und der Literatur. Lesen und Vorlesen sind nicht die<br />
einzigen kulturellen Praktiken, in denen sich die Literatur, die Welt der<br />
Schrift, der Geschichten und der Ideen erfüllt. Der Leser Borges entdeckt<br />
das unendliche Buch, das alle anderen enthält, durch Abschweifen, durch<br />
die Erinnerung an Lektüren, durch ein Leben mit Büchern, das sich nicht<br />
auf das Lesen begrenzt. 31 Eine der schönsten Liebesgeschichten des Mittelalters,<br />
jene von Paolo und Francesca, beginnt in Dantes Divina Commedia<br />
mit dem Lesen und endet damit, dass die Liebenden das Lesen vergessen<br />
und selbst Literatur werden:<br />
Wir lasen einst zur Kurzweil, wie die Minne<br />
Den Lanzelot bestrickt in ihren Banden;<br />
Wir waren einsam, sonder Arg im Sinne.<br />
Bei diesem Lesen oft einander fanden<br />
Die Augen sich, entfärbten sich die Wangen;<br />
Doch eines wars, wo wir nicht widerstanden:<br />
Die Stelle, wo dem liebenden Verlangen<br />
Ersehnten Kusses lächelnd ward Gewähr.<br />
Da küßt’, an dem ich ewig werde hangen,<br />
28<br />
Paul Valéry, Fragereiz, in: Hans Jürgen Balmes (Hrsg.), Mein erstes Buch. Autoren<br />
erzählen vom Lesen, Frankfurt am Main 1972, S. 129–130, hier S. 129.<br />
29<br />
Ilse Aichinger, Der Engländer im Wiener Klosterinternat, in: Hans Jürgen Balmes<br />
(Hrsg.), Mein erstes Buch. Autoren erzählen vom Lesen, Frankfurt am Main 1972,<br />
S. 135–137, hier S. 137.<br />
30<br />
Hans Ulrich Gumbrecht zitiert Tony Morrison: „touched like from inside“ (Hans<br />
Ulrich Gumbrecht, Stimmungen lesen. Über eine verdeckte Wirklichkeit der Literatur,<br />
München 2011, S. 3.).<br />
31<br />
Vgl. Heinz Schlaffer, Borges, Frankfurt am Main 1993, S. 7–13.
8 Heike Gfrereis<br />
Da küßte bebend meinen Mund auch Er.<br />
Verführer war das Buch und ders verfaßte –<br />
An jenem Tage lasen wir nicht mehr. 32<br />
3. Sich lesen<br />
Man muss wissen, was Lesen ist und was ein Buch, Erinnerungen haben an<br />
Namen und Geschichten, Zustände, Stimmungen und Atmosphären des<br />
Lesens, aber man muss nicht lesen, um der Literatur und den Büchern zu<br />
sich selbst zu verhelfen. Dazu gibt es auch andere Wege. Pierre Bayard hat<br />
das in Wie man über Bücher spricht, die man nicht gelesen hat zugespitzt und<br />
die Arten des Nichtlesens rubriziert: „Bücher, die man nicht kennt“ 33 –<br />
„Bücher, die man quergelesen hat“ 34 – „Bücher, die man vom Hörensagen<br />
kennt“ 35 – „Bücher, die man vergessen hat“ 36 . Die letzte von ihm im Fall<br />
der Nichtlektüre „empfohlene Haltung“ 37 ist: „Von sich sprechen in dem<br />
man mit Oscar Wilde zur Schlussfolgerung gelangt, dass die angemessene Lesedauer<br />
eines Buches zehn Minuten beträgt, da man sonst vergessen könne, dass die Begegnung<br />
mit einem Text hauptsächlich eine Anregung ist, seine Autobiografie zu<br />
schreiben“. 38<br />
Damit schließt sich der Kreis zum Lesen, wie es sich in den Marbacher<br />
Büchern und den Erzählungen vom Lesen findet und wie er auch ohne<br />
Lesen vorkommen kann, als Erscheinung einer ästhetischen Gestimmtheit<br />
oder eines Denkprozesses: Lesen ist ein Zustand zwischen Sich-Vergessen<br />
und Sich-Finden. Heideggers intensive, nicht extensive Lektürespuren markieren<br />
die Arbeit an der Grenze, sie rücken den primären Text weg vom<br />
Leser, legen Schichten (oder mit Borges: Blätter) dazwischen, sie positionieren<br />
aber auch den Leser im Text, helfen ihm, ihn für sich zu verstehen. Die<br />
Energie des Lesers ist immer auch auf sich selbst und seine Beziehung zur<br />
Welt gerichtet, ganz in der etymologischen Bedeutung von legere: sammeln,<br />
auswählen, lesen und der Urverwandtschaft von read: erraten. Wer liest, gibt<br />
der Schrift seine Stimme, den Wörtern seine Ohren und den Sätzen seine<br />
Augen. Er kommt ins Denken und Schreiben, liest dann aber auch nicht<br />
32<br />
Dante Alighieri, Die Göttliche Komödie, übers. von Karl Bartsch, Wiesbaden<br />
2010, S. 66.<br />
33<br />
Pierre Bayard, Wie man über Bücher spricht, die man nicht gelesen hat, übers.<br />
von Liz Künzli, München 2007, S. 21.<br />
34<br />
Bayard, Wie man über Bücher spricht, die man nicht gelesen hat, S. 33.<br />
35<br />
Bayard, Wie man über Bücher spricht, die man nicht gelesen hat, S. 52.<br />
36<br />
Bayard, Wie man über Bücher spricht, die man nicht gelesen hat, S. 69.<br />
37<br />
Bayard, Wie man über Bücher spricht, die man nicht gelesen hat, S. 141.<br />
38<br />
Bayard, Wie man über Bücher spricht, die man nicht gelesen hat, S. 199.
Nicht-Lesen<br />
9<br />
mehr nur den Text. Der ‚Sinn‘ in Gadamers Satz „Lesendes Verstehen ist<br />
nicht ein Wiederholen von etwas Vergangenem, sondern Teilhabe an einem<br />
gegenwärtigen Sinn“ 39 liegt im Leser selbst. Lesen ist Sich-Selbst-Finden:<br />
„Schriftlichkeit ist Selbstentfremdung. Ihre Überwindung, das Lesen des<br />
Textes, ist also die höchste Aufgabe des Verstehens.“ 40 Martin Walser greift<br />
bei seinen Lese-Erinnerungen auf Marcel Proust zurück: „Bei Proust las<br />
ich später, ein Leser sei, wenn er liest, ‚ein Leser seiner selbst‘. Das Werk<br />
des Schriftstellers sei ‚dabei lediglich eine Art von optischem Instrument,<br />
das der Autor dem Leser reicht, damit er erkennen möge, was er in sich<br />
selbst vielleicht sonst nicht hätte erschauen können.‘ […] Manchmal wird<br />
dann aus einem Gedicht eine Lebens‐ und Zeitlandschaft, und wenn man<br />
es wieder liest, ist man wieder dort, wo man auf keinem anderen Weg mehr<br />
hinkommen könnte, und jetzt beim Wiederlesen ist man vielleicht noch<br />
mehr dort als damals, man weiß jetzt ein bißchen besser, warum einem das<br />
Gedicht damals so gut in den eigenen Kram paßte“. 41<br />
Lesen ist Zeitvertreib, Sich-Vergessen auf der einen Seite und Sich-Gemeint-Fühlen<br />
auf der anderen. „Der Leser beginnt einen Dialog mit dem<br />
Autor und, im Falle der liebsten und wesentlichsten Bücher, den Dialog<br />
mit sich selbst“, führt Siegfried Unseld in die Ersten Lese-Erlebnisse ein. 42<br />
Lesen ist in der Erinnerung und Vorahnung gegenwärtig und auch nur hier<br />
eine ganz glückliche, ungestörte Erfahrung. Wenn wir lesen, so werden wir<br />
immer wieder dabei gestört, wir können keinen ganzen Text mit ein und<br />
derselben Aufmerksamkeit, Intensität und Faszination lesen, mit demselben<br />
Grad der Ich-Vergessenheit und des Bei-Sich-Seins lesen, selbst wenn wir<br />
ihn ‚verschlingen‘. Wir blenden dann bewusst immer wieder Zeit und<br />
Raum und die Bedürfnisse des Körpers aus. Die ästhetische Erfahrung<br />
des Lesens und Betrachtens hat ebenso ihre Grenzen wie das Verstehen:<br />
„knappe Zeit, äußere Störung, innere Zerstreutheit“. 43 So gesehen ist weder<br />
das Lesen noch das Betrachten von Kunst einem historischen Wandel unterworfen,<br />
der Wandel ist Folge einer Idealisierung, eines ewigen Traums vom<br />
idealen Lesen, das es nicht gibt: „Walter Benjamin hat zerstreute Wahrnehmung<br />
als Folge der modernen Massen sowie ihrer Medien erklärt und<br />
ihnen die Versenkung ins originale Kunstwerk entgegengehalten, wie sie<br />
39<br />
Gadamer, Wahrheit und Methode, GW 1, S. 396.<br />
40<br />
Gadamer, Wahrheit und Methode, GW 1, S. 394.<br />
41<br />
Martin Walser, in: Siegfried Unseld (Hrsg.), Erste Lese-Erlebnisse, Frankfurt am<br />
Main 1972, S. 79–90, hier S. 89.<br />
42<br />
Siegfried Unseld, in: Siegfried Unseld (Hrsg.), Erste Lese-Erlebnisse, Frankfurt<br />
am Main 1972, S. 9–13, hier S. 13.<br />
43<br />
Heinz Schlaffer, Flüchtige Wahrnehmung von Kunst. Ein Adonisfest in Alexandrien,<br />
in: Merkur, Nr. 710, Juli 2008, S. 555–564, hier S. 561.
10 Heike Gfrereis<br />
früher (wann war das wohl?) Sitte gewesen sei. […] Vermutlich ist es nicht<br />
einem historischen Wandel, sondern der menschlichen Grundausstattung<br />
geschuldet, wenn selbst so auffällige und bedeutsame Sinnbilder, wie die<br />
Kunst sie geschaffen hat, nur flüchtig bemerkt werden. Zur Meditation ist<br />
nicht jeder fähig, weshalb sich dafür die Spezialberufe des Mönchs und des<br />
Kunstgelehrten herausgebildet haben. Beider Tätigkeit orientiert sich an<br />
der erst spät erfundenen Technik der Schrift. Lesen erfordert, im Unterschied<br />
zum Sehen, Konzentration und Ausdauer.“ 44<br />
Lesen, dieses Sich-Vergessen und Anders-Finden, ist der Traum dessen,<br />
der gerade nicht liest. Das Nicht-Lesen ist seine Voraussetzung, aber auch<br />
seine höchste Erfüllung. Die poetischen Existenzen, die die Literatur selbst<br />
entwirft – alles deutliche Gegenbilder zum Mönch, Kunstgelehrten und<br />
Literaturwissenschaftler: Musensöhne, göttliche Kinder, Abenteurer und<br />
Taugenichtse, Dandys und Bohemiens –, lesen nicht. Sie sind ganz bei<br />
sich, weil sie in sich aufgehen. Eichendorffs Taugenichts und Goethes<br />
Mignon können nicht lesen, die letzte stirbt gar, als sie es dann lernt. Der<br />
Musensohn pfeift, was er im Blut hat, nicht, was er liest. Sein Lindenbaum<br />
ist ohne Lesezeichen und dennoch scheint er uns einen Idealzustand des<br />
Lesens vorzuführen:<br />
Durch Feld und Wald zu schweifen,<br />
Mein Liedchen wegzupfeifen,<br />
So geht’s von Ort zu Ort!<br />
Und nach dem Takte reget,<br />
Und nach dem Maß beweget<br />
Sich alles an mir fort.<br />
Ich kann sie kaum erwarten,<br />
Die erste Blum’ im Garten,<br />
Die erste Blüt’ am Baum.<br />
Sie grüßen meine Lieder,<br />
Und kommt der Winter wieder,<br />
Sing’ ich noch jenen Traum.<br />
Ich sing’ ihn in der Weite,<br />
Auf Eises Läng’ und Breite,<br />
Da blüht der Winter schön!<br />
Auch diese Blüte schwindet,<br />
Und neue Freude findet<br />
Sich auf bebauten Höhn.<br />
Denn wie ich bei der Linde<br />
Das junge Völkchen finde,<br />
Sogleich erreg’ ich sie.<br />
44<br />
Schlaffer, Flüchtige Wahrnehmung von Kunst, S. 561.
Nicht-Lesen<br />
11<br />
Der stumpfe Bursche bläht sich,<br />
Das steife Mädchen dreht sich<br />
Nach meiner Melodie.<br />
Ihr gebt den Sohlen Flügel,<br />
Und treibt durch Tal und Hügel<br />
Den Liebling weit von Haus.<br />
Ihr lieben holden Musen,<br />
Wann ruh’ ich ihr am Busen<br />
Auch endlich wieder aus? 45<br />
Summary<br />
One has long assumed that reading amounts to the fulfillment of literature. It arises and is<br />
actualized in the reader. Yet this view omits the fact that a not-reading attaches to every<br />
reading, and that not-reading is a necessary element in the analysis and the understanding<br />
of literature. Thus, one could conversely state: the prerequisite for the understanding of<br />
literature is not-reading.<br />
Zusammenfassung<br />
Lesen, davon ist man lange ausgegangen, ist die Erfüllung der Literatur. Sie entsteht und<br />
realisiert sich erst im Leser. Dabei wurde außer Acht gelassen, dass zu jedem Lesen das<br />
Nicht-Lesen gehört und sogar notwendiges Element der Analyse und des Verstehens von<br />
Literatur ist. Umgekehrt ließe sich daher sagen: Die Voraussetzung für das Verstehen von<br />
Literatur ist das Nicht-Lesen.<br />
45<br />
Johann Wolfgang von Goethe, Der Musensohn, in: Sämtliche Werke. Briefe,<br />
Tagebücher und Gespräche, Frankfurter Ausgabe in 40 Bänden, Band 1 (Gedichte<br />
1756–1799), hrsg. von Karl Eibl, Frankfurt am Main 1987, S. 644.
12<br />
Ovid liest Klassiker<br />
von<br />
Bernhard Zimmermann (Universität Freiburg)<br />
1.<br />
Wenn man die antike, griechisch-römische Literatur unter der Fragestellung<br />
des Lesens betrachtet, denkt man natürlich zunächst an die am Paradigma<br />
des frühgriechischen Epos, an Homer und Hesiod, sowie an der<br />
archaischen Lyrik entfachte Diskussion über oral poetry, über das Verhältnis<br />
von Mündlichkeit und Schriftlichkeit in dieser frühen Phase griechischer<br />
Literatur. Man denkt vielleicht weniger an die römische Literatur, obwohl<br />
gerade deren Beginn im Jahre 240 v. Chr. dazu Anlass gibt, als ein als<br />
freigelassener Sklave in Rom lebender Grieche namens Livius Andronicus<br />
im Auftrag der für den Festbetrieb in der Stadt zuständigen Beamten ein<br />
Drama aus dem Griechischen ins Lateinische übertrug – später ließ er eine<br />
Übersetzung der homerischen Odyssee folgen – und damit den Beginn der<br />
römischen Literatur einleitete. Die nachfolgenden römischen Tragiker und<br />
Komödiendichter – Plautus, Terenz, Naevius, Ennius, Pacuvius und Accius,<br />
um nur einige wenige zu nennen – verfuhren in ähnlicher Weise. Sie übertrugen<br />
griechische Originale ins Lateinische, wobei bis heute extensiv und<br />
kontrovers der Grad der Freiheit diskutiert wird, den sich die Römer bei<br />
ihren Bearbeitungen nahmen.<br />
Römische Autoren sind also von Anfang an ‚lesende Dichter‘, die sich<br />
mit griechischer Literatur auseinandersetzten und aus dieser Auseinandersetzung<br />
im Verlauf kurzer Zeit eine eigene Literatursprache schufen und<br />
die wichtigsten Gattungen der Griechen in Rom heimisch machten, und<br />
sie bleiben – vor allem in augusteischer Zeit – lesende Dichter, die mit<br />
einem an der alexandrinischen Literaturtheorie geschulten theoretischen<br />
Bewusstsein der griechischen eine qualitativ genauso hochstehende lateinische<br />
Literatur an die Seite stellen wollten. Als poetae docti schrieben sie für<br />
ebenso literarisch gebildete Leser. Die Werke eines Vergil und Horaz, eines<br />
Properz oder Tibull sind Palimpseste ganz im Sinne Genettes, sie enthalten<br />
eine Vielzahl von Prätexten, die die Autoren zu einem neuen Ganzen
Ovid liest Klassiker<br />
13<br />
zusammenfügen. Prätext und neuer Text stehen dabei in einer spannungsreichen<br />
Beziehung: Die Prätexte tragen entscheidend zum Sinn des neuen<br />
Werkes bei und können ihrerseits in dem neuen Zusammenhang eine neue<br />
Deutung erhalten. Viele dieser Prätexte sind für uns heute nicht mehr<br />
greifbar, so dass einige der Schichten des Palimpsests für uns unentschlüsselt<br />
bleiben müssen, ohne dass wir dies überhaupt bemerken. Wir müssen uns<br />
also immer bewusst sein, dass uns Dimensionen antiker Texte aufgrund des<br />
bruchstückhaften Erhaltungszustandes der griechisch-römischen Literatur<br />
verschlossen bleiben müssen.<br />
In besonderer Weise kann man Ovid als lesenden Dichter bezeichnen. Er<br />
steht am Ende der augusteischen Periode – er stirbt im Exil am Schwarzen<br />
Meer um 17 n. Chr. – und blickt somit sowohl auf eine eigene römische<br />
Klassik als auch auf die exemplaria Graeca, die als vorbildhaft angesehene<br />
griechische Literatur, zurück. Man könnte in allen seinen Werken die<br />
produktive Lektüre griechischer und lateinischer Werke nachzeichnen, besonders<br />
deutlich allerdings an den Heroides.<br />
2.<br />
Die Heroides sind eine Sammlung von 15 poetischen Briefen, die – mit<br />
Ausnahme des 15. Briefes – aus dem Mythos bekannte Frauen an ihre abwesenden<br />
Ehemänner oder Geliebten schreiben. Der 15. Brief – Sappho<br />
an Phaon – ist in seiner Authentizität in der Forschung umstritten. 1 In<br />
den Heroides spielen mehrere Dominaten und Subdominanten zusammen:<br />
Durch die metrische Form des elegischen Distichons werden die poetischen<br />
Briefe der Gattung Elegie zugewiesen. 2 Dies wird auf der inhaltlichen<br />
Ebene durch die ständige Verwendung elegischer ‚termini technici‘ und<br />
elegischer Vorstellungen wie der Liebe als Wahn und Raserei (insania,<br />
furor amoris), der Liebe als verzehrender Flamme (urere) sowie der Liebe als<br />
Sklaven‐ oder Kriegsdienst (servitium amoris, militia amoris) verstärkt. Als<br />
Subdominante kommt die Form sowohl des Briefes und des dramatischen<br />
Monologs als auch der tragischen Klage, des Threnos, hinzu. Da Ovid<br />
schließlich seine schreibenden Frauen der Mythologie entlehnt, erschließt<br />
sich für den zeitgenössischen Leser eine weitere Dimension: der Mythos<br />
und vor allem die literarischen Bearbeitungen des jeweiligen Mythos in den<br />
1<br />
Zur Diskussion vgl. Peter E. Knox, Ovid. Heroides. Select Epistles, Cambridge<br />
1995, S. 86–315, hier S. 278–315.<br />
2<br />
Man muss sich immer wieder vergegenwärtigen, dass für den Rezipienten der Antike<br />
zunächst das Metrum das visuelle und akustische Signal der Gattungszuordnung abgab.
14 Bernhard Zimmermann<br />
verschiedenen literarischen Gattungen, insbesondere in der Tragödie und<br />
des Epos, auf die der Brief Ovids anspielen könnte.<br />
Doch zunächst sind einige allgemeine Worte zu Ovid als Elegiker vonnöten.<br />
Man kann drei Gruppen elegischer Dichtungen im Oeuvre Ovids<br />
unterscheiden: die Liebesdichtungen – Amores (Liebeselegien in der Nachfolge<br />
des Gallus, Tibull und Properz), Heroides, Ars amandi (Liebeskunst),<br />
Remedia amoris (Heilmittel gegen die Liebe) und im weiteren Sinne die<br />
Medicamina (Kosmetikhandbüchlein) –, die Verbannungsdichtungen – Tristia<br />
(Trauergedichte), Epistulae ex Ponto (Briefe vom Schwarzen Meer) und<br />
Ibis (ein Spottgedicht) – und als einen erratischen Block die Fasten (Festkalender).<br />
Ovid spielt in diesen drei Gruppen die Möglichkeiten durch, die<br />
nach dem antiken Verständnis die Gattung Elegie bietet. In der Gruppe der<br />
Liebesdichtungen führt er, wie er an zahlreichen Stellen betont, die typisch<br />
römische Form der subjektiven Liebeselegie in vielfältiger Weise zur Vollendung.<br />
In der Verbannungsdichtung, in den Tristia und den Epistulae ex<br />
Ponto, isoliert er ein Element, das seit den frühen griechischen Elegikern<br />
mit der Gattung verbunden ist und auch in einer falschen Etymologie des<br />
Wortes „Elegie“ seinen Niederschlag findet: das Element der Klage – Elegie<br />
wurde von dem griechischen ἒ λέγειν (wehklagen) abgeleitet. Einen Vorläufer<br />
dieser speziellen Form finden wir im 3. Buch der Amores im Nachruf<br />
auf Tibull, in dem die personifizierte Gattung Elegie angerufen wird,<br />
ganz ihrem Namen gemäß in die Klagen um den toten Dichterkollegen<br />
einzustimmen. 3 Im Ibis erweitert Ovid die Klage des Verbannten um das<br />
Element der Verfluchung (Schetliasmos) eines einflussreichen, anonymen<br />
Feindes, den er in Rom hat. In den Fasten schließlich schließt er sich den<br />
aitiologischen Dichtungen des Kallimachos an, die Properz in Rom heimisch<br />
gemacht hatte.<br />
Auffallend ist, dass Ovid in allen elegischen Dichtungen versucht, verschiedene<br />
Rollen, verschiedene personae, durchzuspielen: In den Amores<br />
mimt er – ganz in der Tradition der römischen Liebeselegie – den seiner<br />
Herrin Corinna ergebenen elegischen Liebhaber. In der Ars amandi, den<br />
Remedia amoris und den Medicamina übernimmt er in der Tradition der<br />
Lehrdichtung die Rolle des mit Autorität ausgestatteten magister amoris und<br />
praeceptor cultus, des Lehrers der Liebe und der Kultur, der unabdingbaren<br />
Voraussetzung der Liebe; in den Fasten schlüpft er in die Rolle des, wenn<br />
man so will, Fremdenführers durch Roms Festkalender, eine Rolle, die Properz<br />
im 4. Buch seiner Elegien vorgeprägt hatte. In den Tristia und Epistulae<br />
3<br />
Ovid, Amores III 9, 3–4.: Flebilis indignos, Elegia, solve capillos / A! nimis ex vero nunc<br />
tibi nomen erit – „Tränenreiche Elegie, löse deine Haare, die es nicht verdient haben. Weh!<br />
Allzusehr der Wahrheit entsprechend wirst du deinen Namen jetzt tragen.“ Die Übersetzungen<br />
aus dem Lateinischen stammen vom Verfasser.
Ovid liest Klassiker<br />
15<br />
ex Ponto schließlich wird die Elegie zum Ausdruck der Klage, ja, man ging<br />
sogar soweit, auch in der Klage ein Rollenspiel zu sehen und deshalb Ovids<br />
Verbannung ans Schwarze Meer, ans Ende der Welt als literarische Fiktion<br />
abzutun. 4<br />
Aus dieser Reihe fallen, was die Erzählhaltung und das Rollenspiel des<br />
Dichters angeht, die Heroides ganz und gar heraus: In ihnen sprechen die<br />
verlassenen Frauen direkt zu uns, in personaler Erzählweise teilen sie sich<br />
mit. 5 Sie sind also schon unter narratologischen Gesichtspunkten ein literarisches<br />
Experiment: Sie sind der Versuch, unmittelbar, ohne die Zwischeninstanz<br />
eines wie auch immer gearteten Erzählers in geradezu dramatischer<br />
Weise die Situation der Frauen darzustellen.<br />
Das literarische Experiment findet dabei in einem steten Zusammenspiel<br />
zwischen poeta doctus und lector doctus auf mehreren Ebenen statt: Durch die<br />
metrische Form, das elegische Distichon, verweist Ovid den römischen<br />
Leser zunächst auf die Basisgattung, 6 die Liebeselegie mit ihren bekannten<br />
Situationen und Begriffen wie der Liebe als Sklaven‐ und Kriegsdienst; dem<br />
Liebhaber wird – in der für die römische Elegie typischen Um‐ oder Neubewertung<br />
traditioneller Begriffe – ein Treueschwur (fides) auf ewig abverlangt,<br />
der ihn zu einem ewigwährenden Bündnis (foedus aeternum) seinem<br />
Mädchen (puella) gegenüber verpflichtet, die er als seine Herrin, als seine<br />
domina, ansieht. Vor diesem Hintergrund gewinnen gewisse inhaltliche Besonderheiten<br />
der Heroides ihren eigenen Reiz: Wirbt in der Liebeselegie der<br />
Mann um seine Geliebte, ist das Verhältnis in den Heroides umgekehrt. Hier<br />
bemüht sich die Frau um den Mann. Dadurch geraten unweigerlich die<br />
dem Leser aus den Liebeselegien bekannten Begriffe in ein anderes, häufig<br />
ironisch gefärbtes Licht. Exempli gratia sei auf den 4. Brief, das Liebeswerben<br />
Phaedras um den spröden Hippolytus, verwiesen. Gleich im zweiten<br />
Vers bezeichnet sich Phaedra mit dem aus den Amores geläufigen Begriff<br />
als puella, als Mädchen, das gerade seine ersten Liebeserfahrungen macht, 7<br />
obwohl klar ist, dass sie um einiges älter als Hippolytus ist und bereits zwei<br />
Kinder von Theseus hat.<br />
Eine starke Spannung besteht zwischen Form und Inhalt: Zur leichten<br />
elegischen Kleinform passen ganz und gar nicht die schreibenden Personen,<br />
die mit Ausnahme Sapphos aus den hohen Gattungen Epos und Tragödie<br />
stammen. Das heißt: In den Heroides werden Personen der erhabenen li-<br />
4<br />
Vgl. gegen diese immer wieder durch die Forschung geisternde Meinung zuletzt<br />
überzeugend Niklas Holzberg, Ovid. Dichter und Werk, München 1997, S. 36.<br />
5<br />
Zum monologischen Charakter der Heroides vgl. zuletzt Ulrike Auhagen, Der<br />
Monolog bei Ovid, Tübingen 1999, S. 63–92.<br />
6<br />
Vgl. Friedrich Spoth, Ovids Heroides als Elegie, München 1992.<br />
7<br />
Vgl. Ovid, Heroides 4, 21–24.
259<br />
Namenverzeichnis<br />
Adonis 72<br />
Adorno, Theodor W. 220–256<br />
Aeneas 20–22, 24<br />
Agamedes 30<br />
Ambrosius von Mailand 47<br />
Anselm von Canterbury 51<br />
Aquin, Thomas von 51<br />
Aristoteles 47, 52–53, 57<br />
Augustinus von Hippo 47, 50–51<br />
Bartleby 94–95, 101, 103–105<br />
Bayard, Pierre 8<br />
Benjamin, Walter 106<br />
Bonaventura 51<br />
Bourignon, Antoinette 136<br />
Carson, Anne 61, 65<br />
Circe 31<br />
Cosmus, Oliver 168<br />
Culler, Jonathan 110–111<br />
Davis, Colin 112, 114, 117, 125<br />
Deleuze, Gilles 137<br />
Derrida, Jacques 220–256<br />
Descartes, René 128<br />
Dido 19–25<br />
Eco, Umberto 57<br />
Euripides 64–65<br />
Faye, Jan 115<br />
Fichte, Johann Gottlieb 171–172, 176–177<br />
Figal, Günter 36<br />
Gadamer, Hans-Georg 1, 3–4, 9, 53, 55, 57,<br />
110, 116–117, 120–121, 123<br />
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 33–34,<br />
118, 124, 147, 152–154, 157–158, 162,<br />
173, 196–219<br />
Heidegger, Martin 50, 52, 58–59, 61, 74,<br />
147 –164, 182–195, 221<br />
Hobbes, Thomas 126–128<br />
Hölderlin, Friedrich 81<br />
Hume, David 55<br />
Husserl, Edmund 128–129, 133, 137–146,<br />
184, 204<br />
Ion 95, 101<br />
Iser, Wolfgang 1, 3–4<br />
Kant, Immanuel 32–33, 120–121, 129–137,<br />
142, 145–146, 149, 165–171, 177, 181<br />
Keiling, Tobias 180<br />
Lacan, Jacques 119<br />
Leibniz, Gottfried Wilhelm 104<br />
Levinas, Emmanuel 173<br />
Lysias 64, 67–71, 75<br />
Marion, Jean-Luc 50<br />
Marx, Karl 223<br />
Meister Eckhart 51<br />
Midas 70–71<br />
Milbank, John 121<br />
Nietzsche, Friedrich 27–34, 35–45, 59, 81,<br />
104<br />
Odysseus 31<br />
Pascal, Blaise 136<br />
Pausanias 30<br />
Phaedrus 61–62, 64, 67–71, 73, 75<br />
Philon von Alexandria 50–51<br />
Platon 31, 36, 47, 61–62, 64–76<br />
Properz 14, 25<br />
Proust, Marcel 137<br />
Redding, Paul 118–119<br />
Robespierre, Maximilien de 32<br />
Rousseau, Jean-Jacques 32, 252<br />
Sartre, Jean-Paul 3<br />
Scheler, Max 182–185<br />
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph 171–172
260 Namenverzeichnis<br />
Schmidt, Dennis 70, 72<br />
Schnell, Alexander 171–172, 178<br />
Sokrates 37, 45, 63, 66–76<br />
Spinoza, Baruch de 52<br />
Steiner, George 109<br />
Svenbro, Jesper 63–64, 75<br />
Trophonios 30–31<br />
Vattimo, Gianni 116<br />
Vergil 19, 21<br />
Wagner, Richard 45<br />
Wright, Dale 113<br />
Žižek, Slavoj 109, 115, 117–122, 124–125<br />
Zeus 30
Sachverzeichnis<br />
7. Brief 19–20, 24<br />
abandonment 96–97, 101<br />
abandonment of being 106, 108<br />
Abschied 85<br />
abyss 33<br />
actuality 103<br />
Affektion 144–146<br />
agent provocateur 110–111, 114–115, 120,<br />
122, 124<br />
Akt 187<br />
alphabet 61–65, 75–76<br />
alter ego 140<br />
Anfang 138–142<br />
announce 107<br />
announcement 95, 97<br />
Anthropologie 189<br />
Appräsentation 140<br />
a priori 121<br />
Ästhetik 147–148, 152, 157, 162<br />
attunement 88<br />
Aufhebung 34<br />
Äußerlichkeit 140–141, 143, 146<br />
Ausstehen 179<br />
author 49<br />
Autonomie 148–149, 160–161, 163<br />
Autorität 209<br />
avant-garde 110<br />
axioms, hermeneutical 116<br />
ban 96, 100–101<br />
Bedenklichste(s) 177–180<br />
beginning 81<br />
being in the world 61–62<br />
being singular plural 95, 99<br />
being with 95, 99<br />
beingless 85<br />
Berührung 132<br />
constructivism, phenomenological 116–117, 122,<br />
124<br />
contradiction 33–34<br />
creation 103–105<br />
credibility 114–115, 122<br />
critical edition 59<br />
Dank 233<br />
dead 62, 65, 69, 71, 75<br />
decreation 103, 108<br />
desire 66, 70, 72–74<br />
Destruktion 201<br />
Dialektik 40<br />
Differenz (difference) 85, 129, 132<br />
Ding 185<br />
Ding an sich 131, 133<br />
dionysisch/Dionysos 37, 41–42<br />
dispropriation 86<br />
divine dispensation 98<br />
divine force 98<br />
divine power 96–97<br />
double 29–30<br />
downgoing 82–84<br />
economy 28<br />
ego 128, 137–139, 141, 144–145<br />
ego cogito 127<br />
εἴδωλον 71, 75<br />
Einbildungskraft 1<br />
Elegie 14<br />
Endlichkeit 130<br />
enthusiasm 96<br />
Entwindung 84<br />
equivocality 89<br />
Erde 156, 159–162<br />
Ereignis 77–78<br />
Erkenntnis 132–133, 148, 157<br />
Ermöglichung 171–172, 174–176<br />
Erscheinung 167–170<br />
event 77, 85, 92<br />
excess 109–110, 112–114, 116, 122, 124<br />
explication 95<br />
falsification 119<br />
fore-structure of understanding 87<br />
Form 13, 15, 16–18<br />
Frage 37–39, 43–45
262 Sachverzeichnis<br />
Freiheit 131, 134<br />
Freitod 240<br />
Fremdheit 215<br />
Fuge 78–79<br />
fundamentalism 48<br />
Gabe 221<br />
garden 61, 72–75<br />
garden of letters (γράμμασι κήπους) 61, 73<br />
Gastfreundschaft 239<br />
Gebrauchswert 242<br />
Geburt 141<br />
Gegenwart 197<br />
Geschehen 211<br />
Geschichtlichkeit 214<br />
glossolalia 95<br />
God 50<br />
ground 31–32, 92, 106<br />
Habitualitäten 205<br />
hermeneutic reading 80, 86–87<br />
Hermeneutik (hermeneutics) 57–58, 109–120,<br />
122, 124–125, 199<br />
hermeneutischer Zirkel 214<br />
Heroides 13–23<br />
historical-critical 47<br />
historicality 47<br />
horizon 52, 111, 113, 116, 118, 123–124<br />
humanities 114–116, 121, 123–125<br />
Ich 135, 139<br />
Identitätsdenken 225<br />
identity 56<br />
Illusion (illusion) 56, 137<br />
imagination 56<br />
inception 83<br />
inceptual 81<br />
inceptual saying 88<br />
inceptual thinking 90<br />
in-common 106<br />
Indifferenz 143<br />
Individuierung 141–142, 145<br />
Individuum 127<br />
Innestehen 179<br />
Inszenierung 36<br />
interpretation 109–112, 114–117, 120,<br />
122–125<br />
inventive thinking 81<br />
Ironie 44<br />
junctures 78–79<br />
Kinästhese 144<br />
Kindheit 138, 140, 142<br />
Klassizität 212<br />
knowledge 117, 120–121<br />
Konstitution 140<br />
Kontingenz (contingency) 93, 101, 105, 145,<br />
165–166, 172, 176, 178–180<br />
Kontinuität 212<br />
Kritik 35, 40–42<br />
Kunst 39<br />
Kunstwerke 147, 149–151, 153–162<br />
language 55, 61, 63, 70–71, 73–74, 109–110,<br />
112, 114–115, 117–118<br />
leap 83<br />
Leib 141–142<br />
Leitmotiv 16<br />
Leser (s.a. reader) 25<br />
letter 61, 63–66, 73<br />
Lichtung 154–156<br />
Liebe 14–16, 25<br />
linguisticality 110, 114, 116<br />
List der Tradition 217<br />
literarisches Experiment 15<br />
Literarisierung 36<br />
literature 59<br />
Logos 231<br />
Mangel 235<br />
meaning 49, 52, 109–110, 112–114, 116–<br />
120, 122–124<br />
meditative thinking 80<br />
Mehrdeutigkeit 89<br />
Mensch 135–136<br />
metaphor 52–55<br />
Metaphysik 189<br />
Metaphysik des Daseins 190–194<br />
Möglichkeit 172–174<br />
mole 29–30, 32–33<br />
morality 31–33<br />
multiplicity of texts 59<br />
non-determination 91<br />
non-partage 98<br />
Normativität 152<br />
not-being 86<br />
novitas 25<br />
novum opus 16<br />
Offenheit 215<br />
Ökonomie 220
Sachverzeichnis<br />
263<br />
ontology 92, 103, 106<br />
ontotheology 92<br />
over-interpretation 110–112<br />
overreading 109–110, 112, 114–115, 117,<br />
120, 122–123<br />
painting 69–71<br />
Palimpsest 12–13, 19<br />
partage 93, 98, 100, 106<br />
pass by 83–84<br />
perception 55<br />
Person 183–184<br />
Phänomen 167–170, 180<br />
Phänomenalität 137<br />
Phänomenologie 143<br />
philology 27–28<br />
φρόνησις 61<br />
plurality 93<br />
poietic 78<br />
poietic words 90<br />
potentiality 93, 105<br />
Prätext 12–13, 19, 25<br />
Present 58<br />
primordial potentiality 107<br />
principle of reason 97, 104–105<br />
Privatschrift 129<br />
Protestantismus 233<br />
Prototext 138<br />
psychoanalysis 119<br />
Raum 135<br />
reader 49, 63–65, 68, 71, 73, 113, 118–120,<br />
123<br />
reading 48, 56, 61–76<br />
Realität (reality) 110, 121, 133<br />
realm of significance 96<br />
reanimation 70, 75<br />
reconstruction 48<br />
Rekonstruktion 138–139, 143, 145–146<br />
repitition 63<br />
resistance 83<br />
resonating 83<br />
rhapsode 93, 95, 98–100<br />
Schrift 129–130, 143<br />
scriptio continua 63<br />
scrivener 93–94, 103<br />
Sein 170<br />
Seinseinheit von Akten 186<br />
Seinsgeschick 50<br />
Seinlose 85–87<br />
Selbst 129, 135<br />
Selbstaffektion 134–135<br />
Selbstbewusstsein 180<br />
Selbsterkenntnis 127, 129, 133–134, 136<br />
Selbstlektüre 126, 128, 136, 143<br />
Selbstphänomenalismus 130, 142, 145<br />
Selbstverständlichkeit 200<br />
Selbstzuschreibung 136<br />
sense 61–63<br />
sharing 93<br />
silence 47<br />
Sinnlichkeit 131–133<br />
solitude 31<br />
sovereignty 107<br />
speech writer (λογογράφον) 69<br />
Stiftung 222<br />
Subjektivität (subjectivity) 114, 124, 131<br />
Substanz 185<br />
superfluity of meaning 110, 113, 116, 120,<br />
122, 124<br />
systematic reading 79<br />
Tauschprinzip 221<br />
Tauschwert 242<br />
text 47, 49, 58<br />
theodicy 104<br />
thinking of the event 80–81<br />
Tod 172–174<br />
Tradition 196<br />
tradition 48, 53, 57<br />
transformation 113, 122–124<br />
transformational experience 113, 119, 121, 123<br />
transformational practice 113–115, 120, 122<br />
transitional thought 79<br />
translation 63<br />
transzendental 170–172, 174, 177,<br />
Transzendentalismus 165–166, 171, 174, 177<br />
Transzendentalphilosophie 166<br />
Transzendenz 178–180<br />
truth 115, 118–120<br />
Überlieferung 196<br />
understanding 48, 54, 61–63, 68, 71, 75–76<br />
Unseiendes 86<br />
Un-Sinn 142–146<br />
Untergang 84<br />
Unterschied 85<br />
Unvertretbarkeit 141<br />
Unzeit 142–146<br />
ventriloquism 68<br />
Vergessen 139<br />
verification 119
264 Sachverzeichnis<br />
Verlassenheit 97<br />
Vernunft 39, 146<br />
Verstand 131–133<br />
Verstehen 151–157, 159–163, 208<br />
Verstehensprozess 210<br />
voice 65–65, 67, 71, 75<br />
Voraussetzungen 203<br />
Vorstruktur des Verstehens 214<br />
Vorurteile 213<br />
Verwindung 84<br />
Wahnsinn 254<br />
Wahrheit (s.a. truth) 147–149, 151–152,<br />
155–156, 158, 161–163<br />
Welt 154, 156, 159, 161–162<br />
Weltentwurf 174–176<br />
Welterschließung 155<br />
Weltverständnis 155, 162–163<br />
Wirkungsgeschichte 208<br />
word 110, 113, 116–118<br />
work 80<br />
write 66, 74, 76<br />
writer 64–65<br />
writing 62, 65–66, 69–71, 73–76<br />
writing tablet 103<br />
Zeichen 137<br />
Zeit 134, 141<br />
Zeitbewusstsein 144<br />
Zuschreibung 142, 145