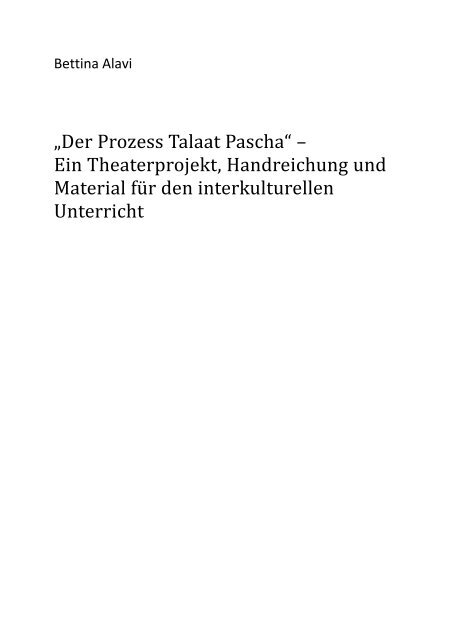„Der Prozess Talaat Pascha“ – Ein Theaterprojekt, Handreichung ...
„Der Prozess Talaat Pascha“ – Ein Theaterprojekt, Handreichung ...
„Der Prozess Talaat Pascha“ – Ein Theaterprojekt, Handreichung ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Bettina Alavi<br />
<strong>„Der</strong> <strong>Prozess</strong> <strong>Talaat</strong> <strong>Pascha“</strong> <strong>–</strong><br />
<strong>Ein</strong> <strong>Theaterprojekt</strong>, <strong>Handreichung</strong> und<br />
Material für den interkulturellen<br />
Unterricht
Prof. Dr. Bettina Alavi<br />
Professorin für Geschichte und ihre Didaktik an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg mit einem<br />
Schwerpunkt Interkulturelle Geschichtsdidaktik<br />
Heidelberg 2011 - © Alle Rechte vorbehalten<br />
2
Inhaltsverzeichnis<br />
Kurzbeschreibung .................................................................................................................................... 4<br />
Der armenische Genozid im Spiegel einer deutschen Gerichtsverhandlung als Schauspiel-Lesung ...... 5<br />
Die Armenier ....................................................................................................................................... 6<br />
Vom Berliner Kongress 1878 zum Berliner <strong>Prozess</strong> 1921 ................................................................... 7<br />
Der <strong>Prozess</strong> als Anstoß zur UN-Genozidkonvention 1948 ................................................................ 11<br />
Didaktisch-methodische Überlegungen zur Konzeption der Lesung in der Schule .......................... 12<br />
Das Projekt „Gemeinsame Vergangenheit: Deutschland, Armenien und die Türkei“ .......................... 13<br />
Material ................................................................................................................................................. 15<br />
3
Kurzbeschreibung<br />
In einer szenischen, musikalisch umrahmten Lesung mit fünf Schauspieler/innen und einem Musiker<br />
aus den Herkunftsländern Armenien, Türkei, Österreich, Frankreich und Deutschland werden<br />
Auszüge aus einem Gerichtsprotokoll aus dem Jahre 1921 als dokumentarisches Theater aufgeführt.<br />
Vor dem Schwurgericht des Berliner Landgerichts ist der armenische Student Soromon Thelerjan<br />
angeklagt den früheren türkischen Großwesir <strong>Talaat</strong> Pascha ermordet zu haben. In Anlehnung an die<br />
Behandlung des Genozids im Geschichtsunterricht ist das Theaterstück eine lebendige und<br />
spannende Darstellung der damaligen Verhältnisse in Berlin und im Osmanischen Reich.<br />
Die Lesung kann als Vorbereitung oder Begleitung für folgende Themen im Unterricht eingesetzt<br />
werden:<br />
Völkermord an den Armeniern 1915 1<br />
Terroristisches Attentat in einem Drittland<br />
Osmanisches Reich bis zum Ende des 1. Weltkriegs<br />
Gewaltbereitschaft bei Jugendlichen<br />
Ablauf in der Schule (Aula mit Klavier):<br />
<strong>Ein</strong>führung in die geschichtlichen Zusammenhänge des Berliner <strong>Prozess</strong>es<br />
„Kilikia“ („Kilikien“) Armenisches Lied mit Piano-Begleitung<br />
Aufführung der szenischen Lesung <strong>„Der</strong> <strong>Prozess</strong> <strong>Talaat</strong> <strong>Pascha“</strong><br />
Beantwortung von Fragen und Diskussion mit den Schülern<br />
10 Min.<br />
5 Min.<br />
65 Min.<br />
30 Min.<br />
1 <strong>Ein</strong> Völkermord oder Genozid ist seit der Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes<br />
von 1948 ein Straftatbestand im Völkerstrafrecht. Die Konvention definiert Völkermord in Artikel II als „eine der<br />
folgenden Handlungen, begangen in der Absicht, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe<br />
ganz oder teilweise zu zerstören: 1) das Töten von Angehörigen der Gruppe 2) das Zufügen von schweren<br />
körperlichen oder seelischen Schäden bei Angehörigen der Gruppe 3) die absichtliche Unterwerfung unter<br />
Lebensbedingungen, die auf die völlige oder teilweise physische Zerstörung der Gruppe abzielen 4) die<br />
Anordnung von Maßnahmen zur Geburtenverhinderung 5) die gewaltsame Überführung von Kindern der<br />
Gruppe in eine andere Gruppe.“ zitiert nach Bundesgesetzblatt Teil II, Nr. 15, 12. August 1954, S. 729.<br />
http://www.bgbl.de/Xaver/text.xav?bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl254<br />
015.pdf%27%5D&wc=1&skin=WC (Stand: 05.08.11)<br />
4
Der armenische Genozid im Spiegel einer deutschen<br />
Gerichtsverhandlung als Schauspiel-Lesung<br />
Die kulturelle Bildung 2 erfährt in der Gesellschaft hohe Aufmerksamkeit und ist für die Lösung<br />
anstehender gesellschaftlicher Herausforderungen, wie etwa die einer zunehmend multiethnisch<br />
zusammengesetzten Gesellschaft, sehr wichtig.<br />
Die „Schauspiel-Lesung mit Musik <strong>–</strong> Nicht ich bin der Mörder“ thematisiert ein misslungenes Beispiel<br />
von Multiethnizität in der Geschichte. „Dies ist im interkulturellen Geschichtsunterricht 3<br />
insbesondere deshalb wichtig, weil anhand dieser Beispiele nach dem Verhältnis zwischen Mehrheit<br />
und Minderheit gefragt werden kann und die Gründe für das Misslingen des Zusammenlebens<br />
kritisch thematisiert werden können.<br />
Bei diesem konkreten Beispiel geht es um den von der Regierung der Jungtürken geplanten und<br />
durchgeführten Völkermord an den Armeniern 1915/1916 und das in Berlin ausgeführte<br />
Racheattentat des armenischen Studenten Soromon Tehlerjan auf einen Hauptverantwortlichen<br />
dieses Genozids, nämlich den ehemaligen Großwesir und Innenminister <strong>Talaat</strong> Pascha. Der<br />
armenische Genozid und das Attentat wurden am 2. und 3. Juni 1921 in einer Gerichtsverhandlung<br />
am Berliner Landgericht behandelt.“ 4<br />
Mit dem stenografischen Protokoll greift das <strong>Theaterprojekt</strong> auf nichtfiktionales Material zurück, um<br />
eine größtmögliche historische Wahrheit anzustreben.<br />
Die offizielle Geschichtsschreibung der Türkischen Republik kennt keinen Völkermord an den<br />
Armeniern. Die „Umsiedlungen“ gelten als unabwendbare Folge des 1. Weltkrieges. 5 Die<br />
Zivilgesellschaft in der Türkei und die in Deutschland lebenden türkischen Migranten sind bei der<br />
Bewältigung der Armenier-Massaker des 1. Weltkrieges weiter. 6<br />
2 Aus dem Abschlussbericht der Enquete Kommission "Kultur in Deutschland": Kulturelle Bildung fördert soziale<br />
Handlungskompetenz und Teilhabe und qualifiziert den Menschen für neue gesellschaftliche<br />
Herausforderungen: Indem kulturelle Bildung die Möglichkeit bietet, sich interkulturelle Kompetenzen<br />
anzueignen, fördert sie die Verständigung zwischen Kulturen im In- und Ausland, baut Vorbehalte von Kindern<br />
und Jugendlichen vor dem „Fremden“ ab und verbessert die gegenseitige Akzeptanz in hohem Maße.<br />
11.12.2007, S. 379, http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/16/070/1607000.pdf (Stand 01.05.2011)<br />
3 „<strong>Ein</strong>e Aufgabe der Bildungspolitik sollte“ laut einer am 16. Juni 2005 einstimmig verabschiedeten Resolution<br />
des Deutschen Bundestages “die Aufarbeitung der Vertreibung und Vernichtung der Armenier als Teil der<br />
Aufarbeitung der Geschichte ethnischer Konflikte im 20. Jahrhundert auch in Deutschland“ sein. , S. 2.<br />
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/15/056/1505689.pdf (Stand 01.05.2011)<br />
4 Alavi, Bettina: Geschichtsunterricht in der multiethnischen Gesellschaft. <strong>Ein</strong>e fachdidaktische Studie zur<br />
Modifikation des Geschichtsunterrichts aufgrund migrationsbedingter Veränderungen, 1998, S. 333-334.<br />
5 Thelen, Sibylle: Die Armenierfrage in der Türkei, 2010, S.40 : „In Zeiten von Migration und Globalisierung<br />
lassen sich Informationsströme weniger denn je kontrollieren [...] <strong>Ein</strong>en internationalen Austausch pflegen<br />
nicht nur die ambitionierten Privatuniversitäten des Landes, die im Zuge der allgemeinen Öffnung und<br />
Annäherung an die EU entstanden sind, sonder auch staatliche Hochschulen. So wird die Aufarbeitung von<br />
1915 längst grenzübergreifend vorangetrieben. <strong>Ein</strong> Beispiel illustriert die Folgen: Noch in den neunziger Jahren<br />
veröffentlichte Taner Akçam als erster türkischer Wissenschaftler, der von einem Völkermord gesprochen hat,<br />
seine Werke zunächst in Deutschland und in den USA. Heute liegen sie auch auf Türkisch vor. Die türkische<br />
Geschichtsgesellschaft verfügt nicht mehr über die alleinige Deutungshoheit. Dennoch ist ein Dialog zwischen<br />
den Lagern noch immer schwierig und über ideologische Gräben hinweg so gut wie unmöglich.“<br />
6 Thelen, Sibylle, Die Armenierfrage in der Türkei, 2010, S. 57: „Die türkische Zivilgesellschaft hat mit der<br />
Aufarbeitung begonnen - zaghaft, aber mutig. Ihren bisher deutlichsten Ausdruck hat dieser <strong>Prozess</strong> Anfang des<br />
Jahres 2009 mit dem Aufruf der Internetkampagne "Ich entschuldige mich" gefunden, den über 30000 Bürger<br />
5
Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei der Behandlung eines Völkermordes um ein emotional<br />
belastendes Thema handelt und dazu die relativ komplizierte historisch-politische Lage zu dieser Zeit<br />
(Das Osmanisches Reich am Beginn des 20. Jahrhunderts im Übergang zur Türkischen Republik, der 1.<br />
Weltkrieg, die Geschichte der Armenier, die Rolle Deutschlands zur Zeit der Weimarer Republik)<br />
Berücksichtigung finden muss, ist die Lesung ab Klassenstufe 10 geeignet.<br />
Die Armenier<br />
„Die Armenier sind armenisch-apostolische Christen mit einem eigenen Ritus, einer eigenen Sprache<br />
und Schrift. Der historische Siedlungsraum 7 der Armenier umfasste ein Gebiet von 400.000<br />
Quadratkilometern, dessen Kern das armenische Hochland bildete. Es grenzt im Osten an das<br />
iranische Hochland, im Nordosten an den Kleinen Kaukasus, im Süden an die Mesopotamische<br />
Tiefebene und das Tauros-Gebirge, sowie im Westen an den Mittellauf des Euphrat.“ 8<br />
„Die Armenier lebten jahrhundertelang als religiöse und ethnische Minderheit in fremden Reichen,<br />
so z.B. im Osmanischen Reich, im Iran und im zaristischen und sozialistischen Russland. Dort lebten<br />
sie als relativ geschlossene Gemeinden, die ihre Traditionen pflegten und meist nur innerhalb der<br />
Gemeinde heirateten. Vermischungen mit anderen Bevölkerungsgruppen blieben selten, so dass sich<br />
die Armenier im Laufe der Jahrhunderte zwar an die politischen Verhältnisse des jeweiligen Landes<br />
anpassten, sich aber keineswegs assimilierten. In den jeweiligen Ländern genossen sie teilweise<br />
Minderheitenrechte, wie z.B. die Erlaubnis, im islamischen Iran der Schahzeit Alkohol konsumieren zu<br />
dürfen.<br />
unterzeichneten. [..] "Ich kann es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, dass die Katastrophe, welche die<br />
Armenier 1915 im Osmanischen Reich ereilte, verleugnet und ihr weiterhin teilnahmslos begegnet wird. *...+.“<br />
Für die Internetkampagne „Ich entschuldige mich“ vgl. http://www.ozurdiliyoruz.com/<br />
7 http://www.spiegel.de/img/0,1020,462285,00.jpg (Stand 04.06.2011)<br />
8 Hofmann, Tessa: Armenier in Berlin <strong>–</strong> Berlin und Armenien, Der Beauftragte des Senats von Berlin für<br />
Integration und Migration, 2005, S. 8.<br />
6
Im Osmanischen Reich gab es Mitte des 19. Jahrhunderts eine Vielzahl armenischer Dörfer und<br />
Gemeinden, besonders im Gebiet um Adana, Aleppo, Van und Erzerum. <strong>Ein</strong>e große Kolonie<br />
armenischer Intellektueller bestand in der Hauptstadt Konstantinopel. Das Osmanische Reich<br />
verstand sich als Vielvölkerstaat, in dem die christlichen Minderheiten ihre Religion relativ ungestört<br />
ausüben konnten, rechtlich und steuerlich aber benachteiligt waren.“ 9<br />
Vom Berliner Kongress 1878 zum Berliner <strong>Prozess</strong> 1921<br />
„1877/1878 griff Russland, das sich als Schutzmacht der Christen im Osmanischen Reich verstand,<br />
militärisch in Westarmenien (Türkisch-Armenien) ein, musste sich aber auf den Druck Englands hin<br />
weitgehend aus Westarmenien zurückziehen. Dieses russische <strong>Ein</strong>greifen hatte zur Folge, dass im<br />
Osmanischen Reich die Armenier teilweise als illoyale Untertanen und russische Kollaborateure<br />
angesehen wurden und im deutschen Kaiserreich die Angst vor einem russischen <strong>Ein</strong>greifen im<br />
Osmanischen Reich bestehen blieb.“ 10 Während des Russisch-Türkischen Krieges kam es zu<br />
Massakern an den Armeniern. Deswegen wurde das Osmanische Reich nach seiner Kriegsniederlage<br />
auf dem Berliner Kongress 1878 verpflichtet den Armeniern in den Ostprovinzen eine gewisse<br />
Autonomie zuzugestehen und sie gegen Übergriffe zu schützen.<br />
„Die europäischen Großmächte setzten Verwaltungsreformen in den sechs westarmenischen<br />
Provinzen des osmanischen Reichs durch, die den Armeniern eine stärkere Beteiligung an der<br />
Verwaltung und Schutz vor Übergriffen anderer Minderheiten (Kurden, Tscherkessen) bieten sollte.<br />
Die Kontrolle der Durchführung war jedoch nicht gewährleistet, so dass eine erfolgreiche Umsetzung<br />
von Anfang an wenig erfolgversprechend war.“ 11<br />
Die europäischen Großmächte maßen der Umsetzung der im Artikel 61 des Berliner Vertrags<br />
aufgezwungenen Reformen kein allzu großes Gewicht bei. Es wurden lediglich einige britische<br />
Beobachter in die Gegend geschickt.<br />
„Das Osmanische Reich war zu Beginn des 20. Jahrhunderts schon längst von Auflösungstendenzen<br />
gekennzeichnet. Es bildeten sich oppositionelle Strömungen wie die Jungtürken 12 und ihre İttihat-<br />
Partei („Komitee für <strong>Ein</strong>heit und Fortschritt“).“ 13 Die Rückschrittlichkeit des Sultanats rief diese innertürkische<br />
Opposition auf den Plan. Im Juli 1908 begann unter Führung von Enver Pascha und Talat<br />
Pascha eine erfolgreiche Militärrevolte gegen den Sultan. Diese „jungtürkische“ Bewegung wollte<br />
durch Reformen und Modernisierung des Staatswesens den drohenden Zerfall abwenden. Darauf<br />
setzten auch die Armenier ihre Hoffnung. Dieser demokratisch-parlamentarische Versuch zur<br />
Reformierung des Reiches blieb jedoch weitgehend erfolglos. Dazu trugen nicht nur konservative<br />
Widerstände in der osmanischen Elite bei, sondern auch die enormen Modernitätsdefizite in weiten<br />
Teilen der Gesellschaft. Entscheidend aber waren der ungebrochene Wunsch von Minderheitsvölkern<br />
nach nationaler Unabhängigkeit und der sich damit verbindende Imperialismus benachbarter<br />
9 Alavi, Bettina: Studie, S. 336.<br />
10 Ebd., S. 337.<br />
11 Ebd. S. 337<br />
12 „Jungtürken (türk.-osman. Eigenbezeichnung: Ittihâd ve teraqqî jemaîyeti, "Komitee für <strong>Ein</strong>heit und<br />
Fortschritt"), nationalist.-reformist. Gruppierung, die zwischen 1908-1918 de facto den osman. Staat<br />
beherrschte und dem Sultan die Annahme einer Verfassung aufzwang. Die Jungtürken inspirierten den Gründer<br />
der Republik Türkei Atatürk u. a. Nationalisten des Nahen Ostens“, zitiert aus dem Lexikon der Bundeszentrale<br />
für politische Bildung http://www.bpb.de/popup/popup_lemmata.html?guid=XXR4MW (Stand: 08.08.2011)<br />
13 Ebd. S. 337.<br />
7
christlicher Staaten. 14 So blieb die Idee eines zentralistischen, ethnisch homogenen türkischen<br />
Nationalstaates vorrangig - auch unter den Jungtürken.<br />
„Nach der Niederlage des Osmanischen Reiches im ersten Balkankrieg 1912 fürchteten die<br />
Jungtürken eine russisch armenische Allianz und eine damit bestehende Bedrohung ihrer Ostgebiete.<br />
Zu dieser Zeit setzte sich in der İttihat-Partei der extrem nationalistische Flügel durch, der die<br />
armenische Frage durch Ausrottung „erledigen“ wollte. Seit dieser Zeit wurde ein Anlass gesucht, um<br />
damit beginnen zu können.<br />
Im 1. Weltkrieg traten das Osmanische Reich unter der jungtürkischen Regierung auf der Seite<br />
Deutschlands und Österreich-Ungarns in den Krieg ein. Während des 1. Weltkrieges begannen die<br />
Jungtürken unter dem Vorwand einer angeblichen armenischen Kollaboration 15 mit den türkischen<br />
Kriegsgegnern Russland, England und Frankreich die Verfolgung, die in den Genozid mündete. Die<br />
Verfolgung der armenischen Bevölkerung war im Voraus bedacht, systematisch organisiert und<br />
verfolgte die Absicht eines Genozids:<br />
Nachdem die wehrfähigen Männer und die im osmanischen Heer dienenden Armenier entwaffnet<br />
worden waren, begann am 24. April 1915 der Auftakt zum Massenmord mit einer Verhaftungswelle<br />
unter den führenden armenischen Intellektuellen in Konstantinopel. Unmittelbar darauf begannen<br />
die Massendeportationen aus den Siedlungsgebieten der Armenier in Ostanatolien. In<br />
Todeskarawanen zogen monatelang Hunderttausende in Richtung der Wüsten Mesopotamiens und<br />
Syriens. Bei diesen von den Jungtürken geplanten und von einer Spezialorganisation der Partei<br />
durchgeführten Vernichtungsaktionen starben in der Zeit von 1915-1917 ca. 1,5 Millionen Armenier.<br />
<strong>Talaat</strong> Pascha war damals ein exponierter Hauptvertreter der jungtürkischen Regierung und als<br />
Innenminister maßgeblich für den Genozid verantwortlich.“ 16<br />
Die besondere Stellung des Deutschen Kaiserreiches hatte schon während des Krieges den Ländern<br />
Frankreich, England und Russland den Verdacht erweckt, die Deutschen seien die eigentlichen<br />
Urheber des Verbrechens an den Armeniern bzw. trügen zumindest eine Mitschuld. 17<br />
Für die direkte Beteiligung von deutschen Offizieren finden sich vereinzelte Beispiele. Z.B. Major<br />
Eberhard Graf Wolffskeel von Reichenberg, der in die Deportationen von Zeytun involviert war. 18<br />
Die Frage, inwieweit Deutschland sich beim Völkermord an den Armeniern engagiert hat, ist in der<br />
Forschung noch nicht endgültig geklärt. Dass Deutsche in verantwortlicher Position Armenier retten<br />
14 Taner, Açam: Armenien und der Völkermord, 2004, S. 39 <strong>–</strong> 51.<br />
15 Schaefgen, Annette: Schwieriges Erinnern: Der Völkermord an den Armeniern, 2006, S. 28 -29. “Trotz der<br />
Kriegsereignisse wurden die Vorgänge im Osmanischen Reich vom Ausland aufmerksam beobachtet und von<br />
Protesten begleitet. Aus diesem Grund hatte sich die jungtürkische Regierung bemüht, das Ausland davon zu<br />
überzeugen, dass es sich bei den Deportationen um eine kriegsbedingte Maßnahme handele, die aufgrund der<br />
Illoyalität der Armenier durchgeführt werden müsse, da sich diese *…+ mit dem Feind Russland verbündet und<br />
gegen den Staat rebelliert hätten. <strong>Ein</strong>en Vorwand, diese These zu unterlegen, bot der angebliche armenische<br />
Aufstand von Van im April 1915, der bis heute von der türkischen Regierung als Rechtfertigungsgrund<br />
angeführt wird. In Van hatten sich am 20. April 1915, nachdem Türken innerhalb von drei Tagen, vom 15. bis<br />
18. April 1915, etwa 80 armenische Dörfer nördlich der Stadt zerstört und die Bevölkerung niedergemetzelt<br />
hatte, die Armenier gegen die türkische Armee erhoben.“<br />
16 Alavi, Bettina: Studie, S. 337 <strong>–</strong> 338.<br />
17 Seit Mitte des 19. Jahrhunderts hatten deutsche Offiziere das osmanische Heer reformiert und ausgebildet.<br />
18 Schaefgen, Annette: Schwieriges Erinnern, 2006, S. 36.<br />
8
konnten, zeigte der Fall Smyrna, wo General Liman von Sanders das Sagen hatte und die Deportation<br />
der Armenier verhinderte. 19<br />
Die Regierung des deutschen Kaiserreichs enthielt sich jeder Stellungnahme und Kritik. Der<br />
Reichskanzler Bethmann Hollweg entgegnete deutschen Diplomaten, Konsuln und Missionaren, die<br />
genau und entsetzt über die Massaker berichteten: „Unser Ziel ist, die Türkei bis zum Ende des<br />
Krieges an unserer Seite zu halten, gleichgültig ob darüber Armenier zu Grunde gehen oder nicht.“ 20<br />
Die Regierungen Frankreichs, Großbritanniens und Russlands hatten im Mai 1915 die osmanische<br />
Regierung in einer gemeinsamen Erklärung davon in Kenntnis gesetzt, dass sie alle Mitglieder der<br />
osmanischen Regierung und deren Beauftragte persönlich verantwortlich machen würden, sollte sich<br />
deren Verwicklung in die an den Armeniern verübten Gräueltaten herausstellen. Unter ihrem Druck,<br />
allen voran dem Großbritanniens, ordnete Sultan Mehmed V. im Dezember 1918 die strafrechtliche<br />
Verfolgung der für den Genozid verantwortlichen jungtürkischen Funktionäre an. 21 Die osmanischen<br />
Gerichtshöfe wurden allerdings bereits am 11. August 1920 aufgelöst.<br />
Unter den damaligen Angeklagten befand sich auch der ehemalige Innenminister und Großwesir<br />
<strong>Talaat</strong> Pascha. Er hatte sich dem <strong>Prozess</strong> durch Flucht nach Deutschland entzogen und wurde in<br />
Abwesenheit zum Tode verurteilt. Mit Hilfe des deutschen Generals Hans von Seeckt gelangte er mit<br />
einem deutschen Torpedoboot im November 1918 von Konstantinopel nach Berlin, wo er mit seiner<br />
Frau eine großbürgerliche Wohnung in Berlin-Charlottenburg bezog. In seinem Berliner Exil musste<br />
<strong>Talaat</strong> keine Auslieferung fürchten.<br />
Drei Monate, nachdem ein osmanischer Militärgerichtshof am 5. Juli 1919 in Konstantinopel die<br />
Mitglieder des jungtürkischen Kriegskabinetts in Abwesenheit zum Tode verurteilt hatte, beschloss<br />
im Herbst 1919 der 9. Parteitag der damals in der Republik Armenien (1918-1920) allein regierenden<br />
Daschnakzutjun (Föderation), die Hauptverantwortlichen des Genozids weltweit aufzuspüren und zu<br />
töten. Aus einer 650 Personen umfassenden Liste wurden die 41 wichtigsten Täter ausgesucht und<br />
ein geheimes Netzwerk geschaffen, das die nach der altgriechischen Rachegöttin Nemesis benannte<br />
Vergeltungsaktion logistisch und operativ umsetzen sollte. Das Führungsgremium der Operation<br />
Nemesis leitete der einstige osmanische Parlamentsabgeordnete für Erzurum, Armen Garo, der 1919<br />
Botschafter der Republik Armenien in den USA wurde.<br />
Im Herbst 1920 erhält Soromon Thelerjan 22 in den USA den Auftrag <strong>Talaat</strong> Pascha zu ermorden.<br />
"Am 15.03.1921 passierte <strong>Talaat</strong> den Steinplatz in Berlin-Charlottenburg, während Thelerjan ihm auf<br />
der anderen Straßenseite, entlang der damaligen Hochschule der Künste, der heutigen Industrie- und<br />
Handelskammer - ca. 200 Meter vom Bahnhof "Zoologischer Garten" - auf den Fersen war."<br />
Hier überquerte <strong>Talaat</strong> die Straße. <strong>Ein</strong>e Minute später war <strong>Talaat</strong> tot <strong>–</strong> aus nächster Nähe erschossen.<br />
„Ich habe einen Menschen getötet“, sagte der spätere Angeklagte Thelerjan, „aber ein Mörder bin<br />
ich nicht gewesen“. 23<br />
19 Vgl. Korrespondenz mit der deutschen Botschaft, nachzulesen auf der Website www.armenocide.de - z.B.<br />
Schreiben vom 12. November 1916, dort Dokument Nr. 1916-11-12-DE-001<br />
20 www.armenocide.net Dokument 1915-12-07-DE-001<br />
21 Hofmann, Tessa: Annäherung an Armenien, 2006, S. 108.<br />
22 Soromon Tehlerjan, auch Soghomon Tehlirian geschrieben, in den Berliner <strong>Prozess</strong>akten: Salomon Teilirian<br />
23 Hosfeld, Rolf: Operation Nemesis, 2009, S. 23.<br />
9
„Am 2. Juni 1921 begann der <strong>Prozess</strong> gegen ihn am Landgericht in Berlin-Moabit. Soromon Thelerjan<br />
ist 25 Jahre alt, aber dem Gericht gibt er bei Beginn der Verhandlung sein Alter mit 24 an. Er wird das<br />
mit Bedacht getan haben, denn ein wesentliches Detail seiner Biographie wird dadurch<br />
unwahrscheinlicher. Keineswegs war er, wie er dem Gericht erzählt, im Sommer 1915 in Erzincan, wo<br />
seine Familie deportiert und anschließend ermordet wurde. Er war zu dieser Zeit Angehöriger eines<br />
auf russischer Seite kämpfenden armenischen Freiwilligenbataillons, das von Eriwan aus Operationen<br />
auf türkischem Staatsgebiet unternommen hatte. Die kleine Korrektur seines Alters sollte diese<br />
Möglichkeit bei eventuellen Fragen des Gerichts von vornherein ausschließen.<br />
Soromon Thelerjan folgt, nachdem er die protestantische Realschule in Erzincan beendet hat, dem<br />
Vater nach Belgrad. Nach dem Beginn des Weltkriegs verlässt er Serbien und schließt sich den<br />
armenischen Freiwilligen in Tblissi an. Von den Massakern, über die er dem Gericht in aller<br />
Ausführlichkeit berichtet, hat er nur gehört, wahrscheinlich aber immer wieder und mit allen Details.<br />
Er hört Geschichten von Flüchtlingen, die ihr Leben gerettet hatten, als sie über die russische Grenze<br />
kamen. Er selbst sieht all die 1915 durch Plünderung, Vandalismus und Massaker verursachten<br />
Zerstörungen in den armenischen Dörfern Ostanatoliens. Am Ende des Krieges ist er, eine sensible<br />
Natur, nur noch von einem Gedanken beherrscht: sich an den Verantwortlichen für all dies zu<br />
rächen.“ 24<br />
Das Gericht wusste nicht, dass Tehlerjan, ein Jahr zuvor im März 1920, in Konstantinopel den<br />
Armenier Harutjun Mkrttschjan erschossen hat. 25 Dieser hatte für die osmanischen Behörden eine<br />
Liste von Armeniern zusammengestellt. Die Liste ermöglichte die Massenverhaftung vom 24. April<br />
1915 unter der hauptstädtischen Elite der Armenier. Das Gericht wusste auch nicht, dass Tehlerjan<br />
nicht bei den Massakern zugegen war, ebenso wenig wie es von der Operation „Nemesis“ wusste.<br />
Über die Generalstaatsanwaltschaft versuchten das deutsche Außenministerium und das preußische<br />
Justizministerium zu verhindern, dass das Strafverfahren gegen Tehlerjan zum Medienereignis<br />
wurde. Insbesondere fürchtete man, dass bei einer ausführlichen Erörterung der politischen<br />
Hintergründe im Ausland Vergleiche mit der „Oberschlesischen Frage“ 26 zuungunsten Deutschlands<br />
gezogen werden könnten. Zudem standen in Leipzig die eigenen Kriegsverbrecherprozesse bevor. 27<br />
Darum wurde die Beweisaufnahme auf einen Verfahrenstag beschränkt und die Vernehmung der<br />
fünfzehn von der Verteidigung beantragten Zeugen auf vier gekürzt.<br />
In seinem Plädoyer forderte der Staatsanwalt die Geschworenen auf, den Angeklagten des Mordes<br />
schuldig zu sprechen, nannte als Motiv Rachsucht und skizzierte <strong>Talaat</strong> Pascha als einen, „der die<br />
Geschicke seines Vaterlandes gelenkt hat und als ein treuer Verbündeter des deutschen Volkes auf<br />
den Höhen der Geschichte gewandelt ist.“ 28<br />
Die Verteidiger des Angeklagten sahen in <strong>Talaat</strong> Pascha einen landesflüchtigen Verbrecher und<br />
plädierten auf Freispruch wegen vorrübergehender Unzurechnungsfähigkeit des Angeklagten<br />
24 Ebd. S. 24<br />
25 Hofmann, Tessa: Annäherung an Armenien, 2006, S. 110<br />
26 Hitze, Guido: Die Politische Meinung - Monatszeitschrift zu Fragen der Zeit, <strong>Ein</strong> fast vergessenes<br />
Stück Geschichte „Die oberschlesische Frage im Jahre 1921“, Dez. 2002, S. 61 -67.<br />
http://www.kas.de/wf/doc/kas_1185-544-1-30.pdf?040415180501 (Stand 08.05.2011)<br />
27 Barth, Boris: Genozid: Völkermord im 20. Jahrhundert : Geschichte, Theorien, Kontroversen, 2006, S. 75.<br />
28 Auszug aus dem Gerichtsprotokoll S. 84.<br />
10
während der Tat. Die Geschworenen befanden den Angeklagten für „nicht schuldig“ wegen<br />
mangelnder Zurechnungsfähigkeit. 29 <strong>Ein</strong> Schuldspruch hätte die Todesstrafe zur Folge gehabt.<br />
Das Urteil rief geteilte Meinungen in der Öffentlichkeit hervor: Armenophile Kreise, aber auch viele<br />
Sozialdemokraten äußerten sich zufrieden darüber, dass Deutschland nun endlich dazu stehe, mit<br />
einem „Großkriegsverbrecher“ 30 verbündet gewesen zu sein. Im rechten politischen Spektrum wurde<br />
dagegen heftig kritisiert, dass dieses Urteil einem <strong>Ein</strong>geständnis deutscher Schuld gleichkomme und<br />
ausschließlich der ausländischen Propaganda zu verdanken sei. Die Verteidiger Thelerjans seien<br />
„vaterlandslose Gesellen.“ 31<br />
Die Ausweisung Tehlerjans aus Deutschland unmittelbar nach seiner Freilassung verhinderte, dass es<br />
zu Revisionsverfahren kam.<br />
Der <strong>Prozess</strong> als Anstoß zur UN-Genozidkonvention 1948<br />
Auf den polnisch-jüdischen Juristen Raphael Lemkin (1890-1959) hinterließ der Strafprozess von 1921<br />
einen tiefen <strong>Ein</strong>druck, auch wenn er nur aus der Presse von ihm erfuhr. Lemkins Verdienst bestand<br />
vor allem darin, die legislative Lücke erkannt zu haben, die verhinderte, dass Staats- und<br />
Großverbrechen wie das an den Armeniern und anderen Christen im Osmanischen Reich begangene<br />
geahndet oder gar verhindert werden konnten. Von seinem Heidelberger Juraprofessor hörte er,<br />
dass es kein Gesetz zur Verhütung von Verbrechen eines Staates an seinen Bürgern gebe. 32 Lemkins<br />
Lebensaufgabe wurden der Entwurf und die Durchsetzung eines internationalen Vertragswerks zur<br />
Verhütung und Bestrafung von Genozid. Erste Versuche, eine solche Konvention in den Völkerbund<br />
einzubringen, scheiterten. Erst nach einem weiteren Weltkrieg und einem Genozid noch größeren<br />
Ausmaßes verabschiedeten die Vereinten Nationen 1948 die in ihren wesentlichen Teilen von Lemkin<br />
verfasste Konvention zur Verhütung und Bestrafung von Genozid. Die darin enthaltene Definition von<br />
Völkermord beruht empirisch auf den historischen Beispielen der Vernichtung der Armenier 1915/16,<br />
des so genannten Simele-Massakers an Aramäern und Assyrern im Irak 1933 und selbstverständlich<br />
der Schoah im Zweiten Weltkrieg. 33<br />
29 Alavi, Bettina: Studie, S. 341.<br />
30 Kieser, Hans-Lukas/Schaller, Dominik J.: Der Völkermord an den Armeniern und die Shoah/The Armenian<br />
Genocide and the Shoah, 2002, S. 535. Vorwärts vom 4. Juni 1921.<br />
31 Kieser, Hans-Lukas/Schaller, Dominik J.: Der Völkermord an den Armeniern und die Shoah/The Armenian<br />
Genocide and the Shoah, 2002, S. 535. Schaller zitiert hier unter anderem Das Deutsche Abendblatt Nr. 27 vom<br />
3. Juni 1921.<br />
32 "What is true is that the fate of Anatolian Armenians during the first World War, especially the inability of the<br />
victorious Allies to prosecute the leading Young Turks, shocked the young Lemkin deeply." (Schaller/Zimmerer:<br />
The Origins of Genocide - Raphael Lemkin as a historian of mass violence, 2009, S. 3)<br />
33 "The destruction of Carthage, the destruction of the Albigenses and Waldenses, the Crusades, the march of<br />
the Teutonic Knights, the destruction of the Christians under the Ottoman Empire, the massacres of the Herero<br />
in Africa, the extermination of the Armenians, the slaughter of the Christian Assyrians in Iraq in 1933, the<br />
destruction of the Maronites, the progroms of Jews in Tsarist Russia and Romania -- all these are classical<br />
genocide cases." (Lemkin: War against Genocide, Christian Science Monitor, 31. January 1948, 2. On the<br />
relationship between genocide and warfare.)<br />
11
Didaktisch-methodische Überlegungen zur Konzeption der Lesung in der<br />
Schule<br />
Die Schüler erhalten einen Flyer mit Hinweisen, einer historischen Karte und historischen Eckdaten,<br />
sowie Fotomaterial.<br />
Vor Beginn der Lesung wird den Schülern eine kurze historische <strong>Ein</strong>führung vorgetragen. Der Vortrag<br />
besteht aus Elementen aus den Kapiteln “Die Armenier“ und „Vom Berliner Kongress 1878 zum<br />
Berliner <strong>Prozess</strong> 1921“. Im Verlauf der Lesung, insbesondere durch den geladenen Sachverständigen<br />
Johannes Lepsius 34 , werden weitere ergänzende historische Hintergründe vorgetragen.<br />
Das darauf folgende Lied „Kilikia“ stimmt die Schüler auf das Thema ein und die Lesung beginnt.<br />
Durch den Nachvollzug des Gerichtsverfahrens gegen den Angeklagten Thelerjan schlüpfen die<br />
Schüler in die Rolle der Geschworenen, die einen klar umrissenen Fall zu entscheiden haben: Ist<br />
Thelerjan des Mordes schuldig oder muss er wegen Unzurechnungsfähigkeit nicht schuldig<br />
gesprochen werden? 35<br />
Durch diese methodische Entscheidung gibt es einen klaren zeitlichen und inhaltlichen<br />
Ausgangspunkt, nämlich das Attentat, einen klaren Handlungsort, nämlich das Berlin der Weimarer<br />
Republik sowie eine fokussierte Perspektive als Geschworene. Durch den Nachvollzug des<br />
Gerichtsverfahrens wird eine gewisse Spannung erzeugt (Wie geht der <strong>Prozess</strong> weiter? Zu welchem<br />
Urteil sind die Geschworenen gekommen?), andererseits handelt es sich um das Nachvollziehen<br />
eines authentischen historischen Falles. Durch die Lesung eines Gerichtsprotokolls von 1921 wird<br />
eine historische Situation für die Schüler heute „geöffnet“, sie können sich in die historische Zeit<br />
„hineinbegeben“ und die Handlungsspielräume der damaligen Menschen durchdenken. Die Schüler<br />
können eine Beziehung zur damaligen Geschichte aufbauen, indem sie überlegen, wie sie damals in<br />
der konkreten Situation entschieden hätten. 36<br />
Bevor der Obmann der Geschworenen seinen Urteilsspruch verkündet, kann in Absprache mit dem<br />
Lehrer die Lesung unterbrochen werden, damit die Schüler selbst ihr Urteil „Schuldig oder Nicht<br />
Schuldig“ kundgeben und begründen können.<br />
Nach der Verkündung des Urteilsspruchs könnte eine Vertiefungsphase folgen, in der die Schüler ihr<br />
Urteil und das des damaligen Gerichts auf dem Hintergrund des heutigen Informationsstands<br />
durchdenken. „Würdet ihr euer Urteil revidieren, wenn ihr folgende später bekannt gewordene<br />
Informationen hinzuzieht? (kein Augenzeuge der Massaker, Attentat auf einen Armenier in<br />
Konstantinopel, Operation Nemesis)<br />
Aus den bisherigen Erfahrungen und dem Feedback aus dem Publikum hinterlässt dieses<br />
Theaterstück bei Jugendlichen einen starken <strong>Ein</strong>druck und bleibt im Gedächtnis. Es ist davon<br />
auszugehen, dass diese sich anschließend motivierter mit dem Thema Völkermord im Unterricht und<br />
den Problemen in unserer multiethnischen Gesellschaft beschäftigen.<br />
34 Im <strong>Prozess</strong> war Lepsius als Sachverständiger geladen, um darüber Auskunft zu geben, ob die Schilderungen<br />
des Angeklagten und von Zeugen über die Massaker an der armenischen Bevölkerung im Jahre 1915 glaubhaft<br />
seien oder nicht. Siehe auch: www.lepsiushaus-potsdam.de (Johannes-Lepsius-Archiv, Bibliothek und<br />
Dauerausstellung und ein Gedenkraum)<br />
35 Alavi, Bettina: Studie, S. 342.<br />
36 Ebd.<br />
12
In einer anschließenden Diskussion können folgenden Themen besprochen werden:<br />
Das Problem der Gewalt als politisches Mittel <strong>–</strong> Terroristische Aktionen haben das Ziel, mit<br />
Gewalt zu zerstören, was einen selbst zerstört (hat) und durch Destruktivität und Anarchie<br />
beim Gegner Angst und Schrecken zu verbreiten. Die Thematisierung des Terrorismus ist<br />
didaktisch-pädagogisch wichtig, weil es hierzu Gegenwartsbezüge (PKK besetze die<br />
türkischen Generalkonsulate, Mykonos-Prozeß 1996) in Deutschland gibt. 37<br />
Erhöhte Gewaltbereitschaft bei einem Teil der Jugendlichen <strong>–</strong> <strong>Ein</strong> weiterer Grund, der die<br />
Thematisierung von Gewalt als Mittel politischer Auseinandersetzung wichtig macht, ist die<br />
derzeit erkennbare erhöhte Gewaltbereitschaft bei einem Teil der Jugendlichen. Dies gilt für<br />
Jugendliche aus der autochthonen Mehrheit (Rechtsradikale und antisemitische Gewalttaten,<br />
Skinheads) ebenso wie für Teile der Jugendlichen aus zugewanderten Minderheiten, die<br />
fundamentalistische Neigungen zeigen. Pubertierende Jugendliche, die sich ungerecht<br />
behandelt fühlen und häufig sozial benachteiligt sind, sind empfänglich für terroristisches<br />
Gedankengut und haben die Neigung, in ihren Gewaltphantasien die Täter zu Helden zu<br />
stilisieren. 38<br />
Keine Schuldzuweisung <strong>–</strong> Es muss deutlich gemacht werden, dass es nicht darum geht den<br />
Menschen aus der Türkei und den türkischen Migranten eine Schuld zuzuweisen, sondern,<br />
dass es um die Behandlung eines von dem Jungtürken-Regime organisierten Völkermordes<br />
geht, der auch im Geschichtsunterricht in der Bundesrepublik <strong>–</strong> möglichst sachlich und ohne<br />
pauschalen Schuldzuweisungen <strong>–</strong> thematisiert werden kann und muss. 39 Es muss deutlich<br />
werden, dass es kein Volksverbrechen sondern ein Staatsverbrechen war. Auch Deutschland,<br />
das mit zur Verdrängung der Verbrechen am armenischen Volk beigetragen hat, ist in der<br />
Pflicht, sich der eigenen Verantwortung zu stellen. 40<br />
Nach der Aufführung soll es für die Jugendlichen möglich sein, Fragen zu stellen, relevante<br />
Informationen zu erhalten und im Sinne eines theaterpädagogischen Ansatzes, das eben Gesehene<br />
mit den Schauspielern, dem Projektleiter des Theaterstücks und den Lehrkräften zu reflektieren.<br />
Das Projekt „Gemeinsame Vergangenheit: Deutschland, Armenien und<br />
die Türkei“<br />
Das Projekt wurde Anfang 2009 privat initiiert und wird ehrenamtlich geleitet. Der Projektleiter Heinz<br />
Böke wohnt in Berlin und ist hauptberuflich als Beamter in der Verwaltung des Deutschen<br />
Bundestages tätig. In den ersten zwei Jahren wurde das Projekt durch die Armenologin und Autorin<br />
Dr. Tessa Hofmann vom Osteuropa-Institut der FU Berlin fachlich beraten und begleitet.<br />
37 Ebd. S. 343.<br />
38 Ebd. S. 343.<br />
39 Ebd. S. 335.<br />
40 <strong>Ein</strong>stimmiger Bundestagsbeschluss „Erinnerung und Gedenken an die Vertreibungen und Massaker an den<br />
Armeniern 1915 <strong>–</strong> Deutschland muss zur Versöhnung zwischen Türken und Armeniern beitragen“ vom<br />
16.06.2005, S. 2, http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/15/056/1505689.pdf (Stand 01.05.2011)<br />
13
Seit Februar 2010 wurde die szenische Lesung in verschiedenen Orten 41 in Deutschland aufgeführt.<br />
Das Theater-Projekt besteht aus sieben Schauspielern und einem Pianisten. 42 Für eine Aufführung<br />
sind jedoch nur fünf Schauspieler und ein Pianist notwendig.<br />
Die szenische Lesung von <strong>„Der</strong> <strong>Prozess</strong> <strong>Talaat</strong> <strong>Pascha“</strong> zielt darauf ab, möglichst viele Angehörige<br />
jener Länder anzusprechen, die das Thema unmittelbar betrifft, ebenso wie solche Zuschauer, denen<br />
die Thematik, die Rolle und die politische Verantwortung Deutschlands bei dem ersten modernen<br />
Massenmord eines Staates an seinen Bürgern nicht hinreichend bekannt ist. Durch seinen<br />
interkulturellen Ansatz soll das Projekt zur Versöhnung beitragen und die Verständigung zwischen<br />
Türken, Kurden, Armeniern und Deutschen verbessern. 43 Die Erfahrung hat allerdings gezeigt, dass<br />
ein entstehender Dialog mit Bürgern der beteiligten Länder ein Fortschritt ist, aber der Weg zur<br />
Versöhnung noch ein weiter ist. 44<br />
Mit jungem und erwachsenem türkischem Publikum konnte in der Vergangenheit nach der Lesung<br />
ein sachlicher Dialog geführt werden, auch wenn man nicht der gleichen Meinung war, aber sich<br />
offen und freundlich unterhalten konnte. 45<br />
41 https://sites.google.com/site/nichtichbindermoerder/lesungsorte (Stand 01.05.2011)<br />
42 https://sites.google.com/site/nichtichbindermoerder/die-akteure (Stand 01.05.2011)<br />
43 Sechstes Kamingespräch der Kultusministerkonferenz mit Kulturschaffenden zum Thema „Integration und<br />
interkultureller Dialog“: „Auf der Basis einer grundsätzlichen Bereitschaft aller betroffenen gesellschaftlichen<br />
Gruppen zur Öffnung und Teilnahme“, so die Ministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, „bietet der<br />
interkulturelle Dialog sowohl Chancen für ein besseres Miteinander der Menschen als auch für die Entstehung<br />
eines neuen, erweiterten und vielgestaltigeren gemeinsamen kulturellen Selbstverständnisses.“ Man kam<br />
überein, dass - angesichts der zunehmenden Internationalisierung der Gesellschaft - alle Kultureinrichtungen<br />
(Theater, Museen, Konzerthäuser, Kulturverbände etc.) sich der Aufgabe stellen sollten, im Sinne<br />
zielgruppenspezifischer Angebote und Auseinandersetzung mit gesellschaftlich relevanten Themen vermehrt<br />
Migranten als Publikum zu gewinnen, während umgekehrt auch eine verstärkte Sensibilisierung des<br />
einheimischen Publikums für die unterschiedlichen kulturellen Hintergründe der Migranten erfolgen müsse. Als<br />
Grundlage zur Entwicklung nachhaltiger Zielsetzungen und wirksamer Handlungsstrategien sei es zudem<br />
wünschenswert, den Stand der Bemühungen der Länder bezüglich des <strong>Ein</strong>satzes und Erfolges des<br />
interkulturellen Dialoges als unverzichtbarem Element der Integration festzustellen.<br />
http://www.kmk.org/presse-und-aktuelles/meldung/sechstes-kamingespraech-der-kultusministerkonferenzmit-kulturschaffenden-zum-thema-integration-u.html<br />
(Stand 01.05.2011)<br />
44 Hrant Dink sprach von einem 1915 Meter tiefen Brunnen, auf dessen Grund Armenier und Türken sitzen.<br />
Gemeinsam müssten sie sich aus diesem Abgrund heraufarbeiten, aus diesem Gefängnis befreien. Zitiert nach:<br />
Baskin Oran, Vortrag und anschließendes Interview bei der Gedenkveranstaltung in Köln für Hrant Dink des<br />
Kulturforum TürkeiDeutschland am 19.1.2009<br />
45 Bei einer Lesung in Hannover fand das türkische Publikum die Lesung „ganz gut gemacht“. Das Problem war<br />
aber nicht die Frage, ob es sich um eine Umsiedlung der Armenier oder einen Genozid an den Armeniern<br />
handelte, sondern dass der Angeklagte, der Mörder von <strong>Talaat</strong> Pascha von der deutschen Justiz freigesprochen<br />
wurde. Dass die Geschworenen im Deutschen Reich, allerdings nur bis 1924, alleine über die Schuld des<br />
Angeklagten befinden konnten ist natürlich problematisch. Darüber hat sich ein Teil des deutschen Publikums<br />
mit dem türkischen Publikum unterhalten.<br />
14
Material<br />
Es wird der Schule Informationsmaterial zu der Lesung in schriftlicher und digitaler Form <strong>–</strong><br />
www.voelkermord-armenien.de/schule - bereitgestellt:<br />
Das vollständige Gerichtsprotokoll vom 02/03. Juni 1921 46<br />
Der Text der Lesung und eine historische <strong>Ein</strong>führung<br />
<strong>Ein</strong>e Fotostrecke (Lesung, beteiligte Personen, historische Orte, Karten)<br />
<strong>Ein</strong> 4-seitiger Flyer (Kurzübersicht für die Schüler)<br />
Der Prozeß <strong>Talaat</strong> Pascha. Der armenische Genozid im Spiegel einer deutschen<br />
Gerichtsverhandlung. S. 333 <strong>–</strong> 360 von Bettina Alavi, Geschichtsunterricht in der<br />
multiethnischen Gesellschaft. <strong>Ein</strong>e fachdidaktische Studie zur Modifikation des<br />
Geschichtsunterrichts aufgrund migrationsbedingter Veränderungen. Frankfurt/M.: Verlag<br />
für interkulturelle Kommunikation, 1998.<br />
Definition Genozid (Bundesgesetzblatt 1954, II, S.730, Artikel II)<br />
46 Hofmann, Tessa: Der <strong>Prozess</strong> <strong>Talaat</strong> Pascha: Stenographischer Bericht über die Verhandlungen gegen den des<br />
Mordes an <strong>Talaat</strong> Pascha angeklagten armenischen Studenten Salomon Teilirian vor dem Schwurgericht des<br />
Landgerichts III zu Berlin. Mit einem Vorwort von Armin T. Wegner und einem Anhang. Berlin: Deutsche<br />
Verlagsgesellschaft für Politik, 1921 (Neuausgabe.: Der Völkermord an den Armeniern vor Gericht: Der <strong>Prozess</strong><br />
<strong>Talaat</strong> Pascha. Herausgegeben und eingeleitet von Tessa Hofmann, 1985)<br />
15