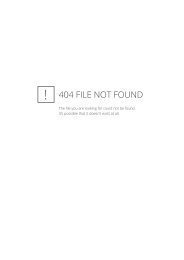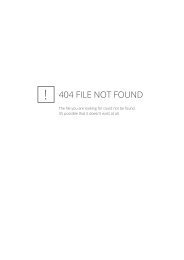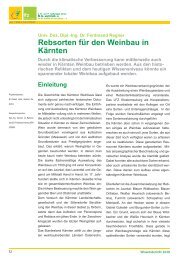download - und Obstbau Klosterneuburg
download - und Obstbau Klosterneuburg
download - und Obstbau Klosterneuburg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Mitteilungen <strong>Klosterneuburg</strong> 59 (2009): 152-158<br />
Wertebereiche qualitaÈtsrelevanter Parameter in<br />
Mosten der zehn in Deutschland am haÈufigsten<br />
angebauten Rebsorten (Vitis vinifera L.)<br />
JUÈ RGEN STURM<br />
Staatliche Lehr- <strong>und</strong> Versuchsanstalt fuÈ r Wein- <strong>und</strong> <strong>Obstbau</strong><br />
D-74189 Weinsberg, Traubenplatz 5<br />
E-mail: Juergen.Sturm@lvwo.bwl.de<br />
Mittels Fourier-Transform-Infrarot-Spektroskopie (FTIRS) koÈ nnen 15 QualitaÈtsparameter in Traubenmost bestimmt<br />
werden.UÈ ber 30.000 solcher DatensaÈtze von Traubenmosten der Jahre 2005 bis 2008 wurden hinsichtlich<br />
rebsortenabhaÈngiger AuspraÈgungen der Analysenergebnisse ausgewertet.FuÈ r Moste der zehn in Deutschland am<br />
haÈufigsten angebauten Rebsorten wurden Mittelwerte <strong>und</strong> Standardabweichungen fuÈ r die Parameter Mostgewicht<br />
(8Oechsle), GesamtsaÈure, pH-Wert, Gehalt an freiem Aminostickstoff (NOPA) <strong>und</strong> das WeinsaÈure/AÈ pfelsaÈure-VerhaÈltnis<br />
berechnet <strong>und</strong> auf Signifikanz uÈ berpruÈ ft.Zudem wurden die Messwerte auf Unterschiede zwischen Mosten<br />
aus ges<strong>und</strong>en <strong>und</strong> faulen Trauben untersucht.In EinzelfaÈllen zeigt die Datenanalyse deutliche Abweichungen zu<br />
bisherigen Publikationen von rebsortentypischen WerteauspraÈgungen.Nicht zuletzt fuÈ r die EinfuÈ hrung multivariater<br />
QualitaÈtsbewertungssysteme sind Kenntnisse uÈ ber die quantitativen AuspraÈgungen wertgebender sowie wertmindernder<br />
Inhaltsstoffe unabdingbar.<br />
SchlagwoÈ rter: Mostanalytik, FTIRS-Analysen, QualitaÈtsparameter, Inhaltsstoffe, TraubenfaÈulnis<br />
Value ranges ofquality relevant parameters in musts ofthe ten most common grape varieties grown in Germany<br />
(Vitis vinifera L.). By means of Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) fifteen quality parameters can be<br />
determined in grape must.More than 30,000 of such datasets from musts of the vintages 2005 and 2006 were evaluated<br />
with respect to variety dependent characteristics of the analysis results.For musts of the ten most common grape<br />
varieties grown in Germany, average values and standard deviations were calculated for the parameters must<br />
weight (8Oechsle), total acidity, pH value, free amino nitrogen (NOPA) and tartaric acid/malic acid ratio, and tested<br />
for significance.In addition, the measurements were analyzed for differences between musts from so<strong>und</strong> and<br />
rotten grapes.In particular cases, the data analysis shows significant deviations from previous publications of variety<br />
typical values.Not least for the introduction of multivariate quality evaluation systems knowledge about the quantitative<br />
expression of quality determining ingredients is essential.<br />
Keywords: must analysis, FTIR analysis, quality parameters, ingredients, grape rot<br />
Plage de valeurs des parameÁtres essentiels pour la qualite des mouÃts des dix ceÂpages (Vitis vinifera L.) les plus freÂquemment<br />
cultiveÂs en Allemagne. La spectroscopie infrarouge aÁ transformeÂe de Fourier (IRTF) permet de deÂterminer<br />
15 parameÁtres qualitatifs dans le mouà t de raisins.Plus de 30 000 de ces enregistrements de mouÃts de raisins des<br />
anneÂes 2005 aÁ 2008 ont eÂte deÂpouilleÂs en vue de deÂterminer les reÂsultats des analyses caracteÂristiques des diffeÂrents<br />
ceÂpages.Les valeurs moyennes et les deÂviations standard des mouà ts des dix ceÂpages les plus freÂquemment cultiveÂs<br />
en Allemagne ont eÂte calculeÂes pour les parameÁtres densite du mouÃt (8Oechsle), acidite totale, pH, teneur en azote<br />
amine libre (NOPA) et le rapport acide tartrique/acide malique, et leur signification statistique a eÂte veÂrifieÂe.En outre,<br />
les valeurs mesureÂes ont eÂte examineÂes en vue de trouver des diffeÂrences entre les mouà ts de raisins sains et de raisins<br />
pourris.Dans des cas individuels, l'analyse des donneÂes a montre des divergences claires par rapport aux publications<br />
preÂceÂdentes relatives aux valeurs typiques des diffeÂrents ceÂpages.Des connaissances sur les quantiteÂs respectives<br />
152
Mitteilungen <strong>Klosterneuburg</strong> 59 (2009): 152-158<br />
Sturm<br />
des composants augmentant ou diminuant la valeur sont indispensables, notamment pour l'introduction de systeÁmes<br />
d'eÂvaluation de la qualite multivarieÂs.<br />
Mots cleÂs : Analyse du mouà t, analyses IRTF, parameÁtres qualitatifs, composants, pourriture des raisins<br />
In Deutschland werden auf 102.026 ha Reben angebaut<br />
(Statistisches B<strong>und</strong>esamt, 2008). 77 % der AnbauflaÈche<br />
entfallen dabei auf die zehn am haÈufigsten angebauten<br />
Rebsorten (Tab. 1). FuÈ r die Charakterisierung der qualitativen<br />
Eigenschaften von Rebsorten wurde bislang<br />
haÈufig das Mostgewicht als dominierender Indikator in<br />
den Vordergr<strong>und</strong> gestellt. Dies geschah oft auch auf<br />
Gr<strong>und</strong> der eingeschraÈnkten Datenbasis zu weiteren<br />
wertgebenden Inhaltsstoffen <strong>und</strong> anderen potenziellen<br />
QualitaÈtsparametern. Bisher verfuÈ gbare Literaturhinweise<br />
gehen meist auf einzelne Versuche zur Anbaueignung<br />
von Sorten zuruÈ ck <strong>und</strong> beziehen sich haÈufig auf<br />
klimatische Bedingungen fruÈ herer Jahrzehnte, welche<br />
wegen des Klimawandels mit den heutigen nicht mehr<br />
vergleichbar sind (SCHRAMM <strong>und</strong> RESCH, 2008). Die inzwischen<br />
weite Verbreitung der Fourier-Transform-Infrarot-Spektroskopie<br />
(FTIRS) im Bereich der Most<strong>und</strong><br />
Weinanalytik ermoÈ glicht mittlerweile eine schnelle<br />
<strong>und</strong> kostenguÈ nstige Bestimmung <strong>und</strong> Dokumentation<br />
weiterer Inhaltsstoffe. So koÈ nnen mittels FTIRS-Analyse<br />
15 Parameter in Traubenmost quantifiziert <strong>und</strong><br />
auf dieser Basis Aussagen uÈ ber Reife- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitszustand<br />
der Trauben getroffen werden (PATZ <strong>und</strong> DIET-<br />
RICH, 2005). Diese Daten bilden die Basis fuÈ r eine Datenbank<br />
fuÈ r die quantitativen AuspraÈgungen von Beereninhaltsstoffen<br />
einzelner Rebsorten zum Zeitpunkt der<br />
Lese in bislang nicht erreichter empirischer Breite.<br />
In den letzten Jahren hat das FTIRS-Verfahren zur<br />
Analyse des Ernteguts in Winzergenossenschaften vermehrt<br />
Einzug gehalten. Insbesondere Genossenschaften<br />
setzen zunehmend die durch FTIRS ermittelten Analysewerte<br />
zur Preisbildung ein (STURM et al., 2007). FuÈr<br />
die Umsetzung moderner, multivariater QualitaÈtsbewertungsverfahren<br />
ist das Wissen uÈ ber rebsortentypische<br />
AuspraÈgungen der verschiedenen QualitaÈtsparameter<br />
unverzichtbar. FuÈ r diese Untersuchung wurden<br />
daher Mittelwerte <strong>und</strong> Schwankungsbereiche fuÈ r wesentliche<br />
QualitaÈtsparameter der wichtigsten deutschen<br />
Rebsorten ermittelt.<br />
Material <strong>und</strong> Methoden<br />
Datenbasis<br />
Dieser Arbeit liegen Daten von uÈ ber 30.000 Analysen<br />
mittels FTIRS (Typ GrapeScan, Fa. Foss, DaÈnemark)<br />
aus den JahrgaÈngen 2005 bis 2008 zugr<strong>und</strong>e. Erhoben<br />
wurden diese Daten in elf Winzergenossenschaften der<br />
Anbaugebiete Baden, WuÈ rttemberg, Pfalz <strong>und</strong> Franken.<br />
Die Datenbasis repraÈsentiert somit die suÈ dliche HaÈlfte<br />
der Weinanbaugebiete Deutschlands, welche uÈ ber<br />
56 % der deutschen AnbauflaÈche verfuÈ gen (Statistisches<br />
B<strong>und</strong>esamt, 2008). FuÈ r die vorliegende Analyse wurden<br />
die jeweils fuÈ nf in Deutschland am haÈufigsten angebauten<br />
roten <strong>und</strong> weiûen Rebsorten ausgewaÈhlt. Die vorliegende<br />
FTIRS-Datenbasis repraÈsentiert dabei relativ<br />
153
Mitteilungen <strong>Klosterneuburg</strong> 59 (2009): 152-158<br />
Sturm<br />
gut die jeweiligen Anteile der Rebsorten am deutschen<br />
Rebsortenspiegel (Tab. 1). Eine Ausnahme bilden die<br />
Rebsorten 'Trollinger' <strong>und</strong> 'Schwarzriesling'. Diese<br />
Sorten sind im Datensatz uÈ berrepraÈsentiert. Dies erklaÈrt<br />
sich mit dem hohen genossenschaftlichen Anteil<br />
(mit GrapeScan-Messung) in WuÈ rttemberg, dem typischen<br />
Anbaugebiet dieser Rebsorten. Da Ertragsdaten<br />
nicht erfasst wurden, koÈ nnen keine RuÈ ckschluÈ sse auf<br />
ertragsabhaÈngige Beeinflussungen der Parameter gezogen<br />
werden. Es kann davon ausgegangen werden, dass<br />
die ermittelten durchschnittlichen Analysewerte einer<br />
mittleren ErtragshoÈ he von ca. 12.000 kg/ha entsprechen.<br />
Die Untersuchungen wurden nach der Lese bei der Annahme<br />
der Trauben in den Genossenschaften durchgefuÈ<br />
hrt. Dies impliziert, dass die Analysewerte nicht nur<br />
durch die LeistungsfaÈhigkeit der Rebsorten, sondern<br />
auch durch Faktoren beeinflusst sind, welche im Bereich<br />
der jeweiligen Betriebsphilosophie <strong>und</strong> der betrieblichen<br />
AblaÈufe angesiedelt sind. Generell wird fuÈr<br />
die Bestimmung des Lesezeitpunktes ein bestmoÈ glicher<br />
Kompromiss zwischen Traubenreife <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitszustand<br />
der Trauben gewaÈhlt. Ziel ist die Sicherung einer<br />
von den jeweiligen Gegebenheiten abhaÈngigen,<br />
hoÈ chstmoÈ glichen WeinqualitaÈt. So spiegelt die Inhaltsstoffanalytik<br />
zum Zeitpunkt der Lese die relative LeistungsfaÈhigkeit<br />
der jeweiligen Rebsorte auf dem jeweiligen<br />
Standort wider. Wird auf diese Weise eine groûe<br />
Fallzahl betrachtet, so koÈ nnen statistische Ableitungen<br />
getroffen werden, welche allgemeinguÈ ltige Aussagen<br />
unter den gegebenen Rahmenbedingungen erlauben.<br />
Analysentechnik<br />
Die Analytik wurde mit FTIR-Spektrometern des Typs<br />
FT120 der Firma Foss (Typ: GrapeScan) in den Genossenschaften<br />
durchgefuÈ hrt. FuÈ r die deutsche Weinwirtschaft<br />
wurde fuÈ r deutsches Lesegut eine gemeinsame<br />
Kalibration von den Forschungseinrichtungen DLR<br />
Rheinpfalz, FA Geisenheim, LVWO Weinsberg, WBI<br />
Freiburg <strong>und</strong> LVG VeitshoÈ chheim entwickelt. Diese<br />
wurde in den Folgejahren kontinuierlich weiterentwikkelt<br />
<strong>und</strong> vom GeraÈtehersteller jahresaktuell auf die GeraÈte<br />
der Anwender uÈ berspielt. Die FTIRS-Analytik erlaubt<br />
detaillierte AuskuÈ nfte uÈ ber Reife- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitszustand<br />
von Trauben (PATZ <strong>und</strong> DIETRICH, 2005).<br />
Neben dem klassischen QualitaÈtsparameter Mostgewicht<br />
(8Oechsle) koÈ nnen Glucose, Fructose, GesamtsaÈure<br />
(als WeinsaÈure gemessen), AÈ pfelsaÈure, WeinsaÈure,<br />
pH-Wert, NOPA, Ammonium, Ethanol, Glycerin,<br />
GluconsaÈure <strong>und</strong> fluÈ chtige SaÈuren quantifiziert werden.<br />
Hinzu kommen die aus diesen Parametern errechenbaren<br />
VerhaÈltniszahlen des WeinsaÈure/AÈ pfelsaÈure-VerhaÈltnisses<br />
(WAÈ V) <strong>und</strong> des Glucose/Fructose-VerhaÈltnisses<br />
(GFV). Die Beprobung erfolgte aus dem Saftablauf<br />
nach der Traubenentrappung direkt nach der Anlieferung<br />
der Trauben. Die FTIRS-Analysen mit dem<br />
GrapeScan-GeraÈt wurden unmittelbar nach der Beprobung<br />
durchgefuÈ hrt.<br />
Klassifizierung des Ges<strong>und</strong>heitszustandes<br />
von Trauben<br />
Ein Fokus der Untersuchung liegt auf einer Analyse der<br />
Auswirkungen von TraubenfaÈulnis auf diverse QualitaÈtsparameter.<br />
HierfuÈ r wurden die auf FaÈulnis hinweisenden<br />
Indikatoren der FTIRS-Analysen zu einer in<br />
Ampelfarben signalisierenden Bewertung verrechnet.<br />
Dabei wurden fuÈ r jeden FaÈulnisindikator Schwellenwerte<br />
fuÈ r die Abstufungen gruÈ n, gelb <strong>und</strong> rot festgelegt<br />
(Tab. 2). Diese Schwellenwerte orientieren sich an Literaturangaben<br />
uÈ ber Wertebereiche fuÈ r die einzelnen Indikatoren<br />
(STURM, 2009).<br />
UÈ bersteigt eine definierte Anzahl an Indikatoren die jeweiligen<br />
Schwellenwerte, erfolgt eine Abwertung von<br />
gruÈ n zu gelb beziehungsweise von gelb zu rot. Die<br />
durchschnittlichen Messwerte der FaÈulnisindikatoren<br />
fuÈ r die Bewertungen gruÈ n <strong>und</strong> rot koÈ nnen Tabelle 3<br />
entnommen werden. Auch in den Abbildungen 1 bis 5<br />
werden die Durchschnittswerte aller als gruÈ n (ges<strong>und</strong>)<br />
bewerteten Chargen den als rot (faul) bewerteten Einheiten<br />
gegenuÈ bergestellt. Die weiûen beziehungsweise<br />
schraffierten Balken verweisen auf die Differenzen zwischen<br />
Mosten aus ges<strong>und</strong>en <strong>und</strong> faulen Trauben. Wurden<br />
statistisch signifikante Unterschiede zwischen<br />
Mosten aus ges<strong>und</strong>en <strong>und</strong> faulen Trauben ermittelt<br />
<strong>und</strong> ist ein Niveau von a = 0,05 erreicht, so ist dies mit<br />
* angegeben. Ein hohes Signifikanzniveau von a = 0,01<br />
ist mit ** gekennzeichnet, hoÈ chst signifikante Ergebnisse<br />
mit einem Niveau von a = 0,001 sind analog mit<br />
154
Mitteilungen <strong>Klosterneuburg</strong> 59 (2009): 152-158<br />
Sturm<br />
*** bezeichnet. Zudem sind die vom Ges<strong>und</strong>heitszustand<br />
unabhaÈngigen Mittelwerte <strong>und</strong> zugehoÈ rigen Standardabweichungen<br />
der Parameter fuÈ r die einzelnen<br />
Rebsorten verzeichnet.<br />
Ergebnisse<br />
Mostgewicht (8Oechsle)<br />
AuffaÈllig ist, dass die als stark tragend bekannten Sorten<br />
'Blauer Portugieser', 'Trollinger', 'Dornfelder' <strong>und</strong><br />
'MuÈ ller-Thurgau' erwartungsgemaÈû die niedrigsten<br />
durchschnittlichen Mostgewichte liefern (Abb. 1). Die<br />
hoÈ chsten Mostgewichte werden dagegen von 'Kerner',<br />
'SpaÈtburg<strong>und</strong>er' <strong>und</strong> 'Grauburg<strong>und</strong>er' erzielt. Die Auswirkung<br />
von TraubenfaÈule auf das Mostgewicht ist sehr<br />
unterschiedlich. WaÈhrend bei 'Dornfelder' <strong>und</strong> 'MuÈ ller-<br />
Thurgau' das Mostgewicht um durchschnittlich 17 %<br />
bzw. 15 % steigt, zeigen 'SpaÈtburg<strong>und</strong>er' <strong>und</strong> 'Trollinger'<br />
so gut wie keine Reaktion. FuÈ r 'Schwarzriesling'<br />
<strong>und</strong> 'Grauburg<strong>und</strong>er' ist mit FaÈulnis durchschnittlich<br />
sogar eine Mostgewichtseinbuûe von 1,5 8Oe verb<strong>und</strong>en.<br />
Dieser RuÈ ckgang des Mostgewichts ist jedoch<br />
nicht statistisch signifikant belegbar. Die deutsche Leitrebsorte<br />
'Riesling' wird in r<strong>und</strong> 68 % aller FaÈlle mit einem<br />
Mostgewicht zwischen 76 <strong>und</strong> 90 8Oe geerntet, bei<br />
einem Mittelwert von 83 8Oe. Der Bef<strong>und</strong> fuÈ r den Parameter<br />
Mostgewicht belegt im wesentlichen die haÈufige<br />
Beobachtung, dass faulende Trauben in der Regel<br />
ein hoÈ heres Mostgewicht aufweisen als ges<strong>und</strong>e Trauben.<br />
GesamtsaÈure<br />
Die durchschnittlichen Analysewerte fuÈ r den Gehalt an<br />
GesamtsaÈure (als WeinsaÈure berechnet) zum Zeitpunkt<br />
der Lese differieren fuÈ r die zehn Hauptrebsorten zwischen<br />
7g/l fuÈ r 'MuÈ ller-Thurgau' <strong>und</strong> 11,2g/l fuÈ r 'Riesling'<br />
(Abb. 2). Die als einfache Standardabweichung angegebene<br />
Schwankungsbreite differiert ebenfalls deutlich,<br />
sie liegt fuÈ r 'Trollinger' bei 0,7 <strong>und</strong> fuÈ r 'Riesling'<br />
bei 1,9. Das bedeutet, dass 'Riesling' in gut zwei Drittel<br />
der FaÈlle mit Werten zwischen 9,3g/l <strong>und</strong> 13,1g/l gele-<br />
Abb.1: Analysenspanne Mostgewicht<br />
Abb.2: Analysenspanne GesamtsaÈure<br />
155
Mitteilungen <strong>Klosterneuburg</strong> 59 (2009): 152-158<br />
Sturm<br />
Abb.3: Analysenspanne pH-Wert<br />
sen wird. AuffaÈllig ist, dass fuÈ r 'SpaÈtburg<strong>und</strong>er' mit nahezu<br />
10g/l sehr hohe Durchschnittswerte vorliegen. In<br />
Bezug auf FaÈulnis ist fuÈ r den Parameter GesamtsaÈure<br />
kein einheitlicher Zusammenhang festzustellen. Bei<br />
'Blauer Portugieser' ist mit FaÈulnis ein signifikanter<br />
SaÈureanstieg um 2,5g/l verb<strong>und</strong>en. Auch fuÈ r 'Dornfelder'<br />
<strong>und</strong> 'MuÈ ller-Thurgau' ist, auf niedrigerem Niveau,<br />
ein signifikanter Anstieg der GesamtsaÈure nachzuweisen.<br />
FuÈ r 'Silvaner', 'Schwarzriesling', 'SpaÈtburg<strong>und</strong>er'<br />
<strong>und</strong> 'Riesling' ist dagegen eine signifikante Abnahme<br />
der SaÈure im Fall von TraubenfaÈulnis festzustellen.<br />
pH-Wert<br />
Tendenziell weisen die Rebsorten mit den hoÈ chsten GesamtsaÈuregehalten<br />
die niedrigsten pH-Werte auf (Abb.<br />
3). Die durchschnittlichen pH-Werte liegen zwischen<br />
3,12 fuÈ r 'Riesling' <strong>und</strong> 3,37 fuÈ r 'Blauer Portugieser'.<br />
Die Standardabweichung des pH-Wertes betraÈgt zwischen<br />
0,11 fuÈ r 'Riesling' <strong>und</strong> 0,24 fuÈ r 'MuÈ ller-Thurgau'.<br />
FuÈ r alle Rebsorten liegen die durchschnittlichen pH-<br />
Werte fuÈ r ges<strong>und</strong>e Trauben deutlich niedriger als die<br />
Werte fuÈ r faulende Trauben. Durchschnittlich ist der<br />
pH-Wert bei faulen Trauben um 0,26 Einheiten hoÈ her.<br />
Dieser Zusammenhang ist fuÈ r alle Rebsorten hoch<br />
oder hoÈ chst signifikant. UrsaÈchlich ist im Wesentlichen<br />
der bei Auftreten von TraubenfaÈulnis meist fortgeschrittene<br />
Reifezustand. Mit diesem ist eine vermehrte<br />
Einlagerung an SaÈure puffernden Mineralstoffen verb<strong>und</strong>en,<br />
so dass hieraus ein hoÈ herer pH-Wert resultiert.<br />
Nicht erklaÈrt werden kann der hoÈ here pH-Wert mit einem<br />
niedrigeren Gehalt an GesamtsaÈure. Denn diese<br />
ist, wie aufgezeigt, bei FaÈulnis nicht generell niedriger.<br />
Abb.4: Analysenspanne WeinsaÈure/AÈ pfelsaÈure-VerhaÈltnis<br />
So ist beispielsweise bei FaÈulnis der pH-Wert bei<br />
'Blauer Portugieser' um 0,18 Einheiten erhoÈ ht, obwohl<br />
zugleich die GesamtsaÈure um uÈ ber 2,5g/l hoÈ her liegt<br />
als bei ges<strong>und</strong>en Trauben.<br />
WeinsaÈure/AÈ pfelsaÈure-VerhaÈltnis (WAÈ V)<br />
Das WAÈ V gilt als ein Indikator fuÈ r die Beerenreife.<br />
WaÈhrend WeinsaÈure im Verlauf der Reifephase absolut<br />
gesehen nahezu stabil vorliegt, wird AÈ pfelsaÈure teilweise<br />
zu CO 2 veratmet <strong>und</strong> in geringem Maû zu Zukker<br />
metabolisiert (STEFFAN <strong>und</strong> RAPP, 1979). Hierdurch<br />
verschiebt sich das VerhaÈltnis zu Gunsten der WeinsaÈure.<br />
Hohe WAÈ V-Werte sind daher als Reifeparameter<br />
anzusehen. Zu beachten ist jedoch, dass das WAÈ V stark<br />
durch die Rebsorte beeinflusst wird. So liegt das WAÈ V<br />
laut vorliegender Datenbasis fuÈ r 'Blauer Portugieser'<br />
im Durchschnitt bei 0,91, fuÈ r die Burg<strong>und</strong>er-Sorten<br />
um 1,0, fuÈ r 'Kerner' dagegen deutlich hoÈ her bei 1,37.<br />
HaÈufig wird zudem nicht beruÈ cksichtigt, dass nicht<br />
nur der fortschreitende Reifeprozess das WAÈ V beeinflusst,<br />
sondern auch FaÈulnis die SaÈurezusammensetzung<br />
veraÈndert. Bei FaÈulnis kann WeinsaÈure insbesondere<br />
durch Botrytis cinerea abgebaut werden (REDL <strong>und</strong><br />
KOBLER, 1991; SPONHOLZ et al., 1987). FaÈulnis hat demnach<br />
auf das WAÈ V einen vergleichbaren Effekt wie<br />
mangelnde Reife <strong>und</strong> fuÈ hrt zu niedrigeren VerhaÈltniszahlen.<br />
Hohe Werte fuÈ r das WAÈ VkoÈ nnen daher sowohl<br />
ein Indikator fuÈ r Traubenreife als auch fuÈ r Traubenges<strong>und</strong>heit<br />
sein. Bei 'Riesling' <strong>und</strong> 'MuÈ ller-Thurgau'<br />
ist der faÈulnisbedingte Effekt besonders ausgepraÈgt,<br />
hier geht das WAÈ V um 23 % bzw. 30 % zuruÈck<br />
(Abb. 4). Dies gilt jedoch nicht fuÈ r alle Sorten. Bei<br />
156
Mitteilungen <strong>Klosterneuburg</strong> 59 (2009): 152-158<br />
Sturm<br />
'SpaÈtburg<strong>und</strong>er' <strong>und</strong> 'Grauburg<strong>und</strong>er' ist praktisch<br />
kein Effekt zu beobachten. FuÈ r 'Schwarzriesling' <strong>und</strong><br />
'Kerner' weist die vorliegende Datenbasis sogar steigende<br />
WAÈ V in Verbindung mit FaÈulnis aus. Diese<br />
Werte sind jedoch nicht statistisch signifikant <strong>und</strong> bedingt<br />
durch die geringe Fallzahl fuÈ r Messwerte ges<strong>und</strong>heitlich<br />
beeintraÈchtigter Trauben dieser Rebsorten in<br />
der Datenbasis. Allerdings ist auffaÈllig, dass bei allen<br />
untersuchten Burg<strong>und</strong>er-Sorten ('Grauburg<strong>und</strong>er',<br />
'SpaÈtburg<strong>und</strong>er' <strong>und</strong> 'Schwarzriesling') eine Verringerung<br />
des WAÈ V bei FaÈulnis nicht eintritt. Eine Abnahme<br />
der VerhaÈltniszahl ist, mit Ausnahme von 'Kerner', bei<br />
den uÈ brigen Rebsorten statistisch als hoÈ chst signifikant<br />
belegt. Dies legt die Vermutung nahe, dass hierin eine<br />
Besonderheit der Burg<strong>und</strong>er-Gruppe besteht. Von dieser<br />
Ausnahme abgesehen stuÈ tzt die vorliegende Datenanalyse<br />
jedoch vorangegangene Untersuchungen, nach<br />
welchen FaÈulnis zu einer Verringerung des WAÈ VfuÈ hrt<br />
(BERGHOLD <strong>und</strong> EDER, 2000).<br />
Abb.5: Analysenspanne NOPA<br />
Freier Aminostickstoff (NOPA)<br />
Die Bezeichnung NOPA steht fuÈ r ¹nitrogen by o-<br />
phthaldialdehydª. NOPA bemisst eine Fraktion des hefeverfuÈ<br />
gbaren Stickstoffs im Most (FAN) <strong>und</strong> wird relativ<br />
zum Isoleucin-Gehalt in mg/l angegeben (BUTZKE,<br />
1998). FaÈulnis fuÈ hrt bei nahezu allen untersuchten<br />
Rebsorten zu einem hoÈ chst signifikanten Abbau von<br />
NOPA (Abb. 5). Der RuÈ ckgang im Vergleich mit ges<strong>und</strong>en<br />
Trauben betraÈgt dabei im Mittel 23 %. Am<br />
staÈrksten ist er bei 'Dornfelder' <strong>und</strong> 'Grauburg<strong>und</strong>er'<br />
mit nahezu 50 %. FuÈ r 'Trollinger' <strong>und</strong> 'Blauer Portugieser'<br />
ist dieser Effekt sehr viel geringer, jedoch statistisch<br />
nicht signifikant. Bei 'Schwarzriesling' wurde<br />
bei faulen Trauben durchschnittlich 8 % mehr NOPA<br />
gemessen, dies ist jedoch ebenfalls nicht signifikant belegt.<br />
Als minimal ausreichende Dosis zur VergaÈrung eines<br />
durchschnittlichen Mostes werden in der Literatur<br />
140 bis 160 mg Stickstoff pro Liter Most genannt (BIS-<br />
SON <strong>und</strong> BUTZKE, 2000), fuÈ r eine sichere VergaÈrung<br />
wird eine Stickstoffversorgung des Mostes mit 400 mg/l<br />
empfohlen (SHIVELY <strong>und</strong> HENICK-KLING, 2001). Die<br />
empfohlene Minimalgrenze kann bei 'Riesling', 'MuÈller-Thurgau'<br />
<strong>und</strong> 'Kerner' nicht allein aus der NOPA-<br />
Fraktion an gesamtverfuÈ gbarem Stickstoff gedeckt werden.<br />
Die Durchschnittswerte aller Rebsorten unterschreiten<br />
zudem die empfohlene Dosis von 400 mg/l<br />
um 36 % bis 72 %. Bei 'Riesling' liegen die NOPA-<br />
Werte mit 112 mg/l am niedrigsten, die Burg<strong>und</strong>er-Sorten<br />
weisen mit 182 bis 254 mg/l die hoÈ chsten Durchschnittswerte<br />
auf. Neben AminosaÈuren stellen Ammonium-Ionen<br />
eine weitere wichtige Stickstofffraktion im<br />
Most dar, die von Hefen zur NaÈhrstoffversorgung verwendet<br />
werden kann. Eine separate Bestimmung des<br />
Ammoniumgehalts ist sinnvoll, um die Summe des gesamten<br />
hefeverfuÈ gbaren Stickstoffs zu ermitteln (DUKES<br />
<strong>und</strong> BUTZKE, 1998).<br />
Diskussion<br />
Die auf Gr<strong>und</strong>lage dieser Datenanalyse ermittelten<br />
Kennzahlen fuÈ r verschiedene Beereninhaltsstoffe geben<br />
einen UÈ berblick uÈ ber die qualitative LeistungsfaÈhigkeit<br />
der in Deutschland am haÈufigsten angebauten Rebsorten.<br />
In einer Gesamtbetrachtung koÈ nnen bisher bekannte<br />
ZusammenhaÈnge bestaÈtigt werden, so z. B. ein<br />
Anstieg des Mostgewichts <strong>und</strong> ein RuÈ ckgang des<br />
WAÈ V bei TraubenfaÈulnis. Aussagen uÈ ber die qualitativen<br />
Ausmaûe dieser Effekte stuÈ tzten sich bisher jedoch<br />
haÈufig auf Ergebnisse aus einzelnen Versuchsanstellungen.<br />
Die Daten der vorliegenden Auswertung weichen<br />
teilweise stark von bisherigen Literaturangaben ab. So<br />
wird beispielsweise in einem Standardnachschlagewerk<br />
fuÈ r Rebsortenk<strong>und</strong>e fuÈ r 'Grauburg<strong>und</strong>er' ein um 10<br />
Grad Oechsle hoÈ heres Mostgewicht als fuÈ r 'Riesling'<br />
genannt (HILLEBRAND et al., 2003). Die aus 9.257<br />
FTIRS-Messwerten der beiden Sorten ermittelten Mittelwerte<br />
unterscheiden sich jedoch lediglich um r<strong>und</strong> 4<br />
Grad Oechsle. FuÈ r die GesamtsaÈurerelation dieser<br />
zwei Sorten gilt aÈhnliches. So wird fuÈ r 'Grauburg<strong>und</strong>er'<br />
eine im Mittel um 4,5 g/l geringere SaÈure angegeben als<br />
fuÈ r 'Riesling' (HILLEBRAND et al., 2003). Auf Basis der<br />
vorliegenden Daten unterschreitet der 'Grauburg<strong>und</strong>er'<br />
157
Mitteilungen <strong>Klosterneuburg</strong> 59 (2009): 152-158<br />
Sturm<br />
die Werte von 'Riesling' jedoch um lediglich 2,2 g/l. FuÈr<br />
'SpaÈtburg<strong>und</strong>er' ist der SaÈuregehalt mit im Durchschnitt<br />
nahezu 10 g/l deutlich hoÈ her als vielfach angenommen.<br />
'Trollinger' zeigt sich dagegen mit 7 g/l GesamtsaÈure<br />
milder als haÈufig erwartet. Einen wesentlichen<br />
Beitrag liefert die Auswertung fuÈ r die Kenntnis<br />
uÈ ber die rebsortenabhaÈngigen AuspraÈgungen bisher seltener<br />
untersuchter Parameter, wie NOPA <strong>und</strong> WAÈ V,<br />
sowie deren quantitative VeraÈnderungen bei vorliegender<br />
TraubenfaÈulnis. Weinwirtschaftliche Unternehmen,<br />
welche multivariate Systeme zur Bewertung der Trauben-<br />
<strong>und</strong> MostqualitaÈt einsetzen, koÈ nnen die hier publizierten<br />
Werte als sortentypische Richtwerte verwenden.<br />
Danksagung<br />
Der Autor dankt den beteiligten Winzergenossenschaften<br />
fuÈ r die UÈ berlassung der FTIR-GrapeScan-Daten.<br />
Literatur<br />
BERGHOLD, S. <strong>und</strong> EDER, R. 2000: Auswirkungen von Pilzbefall<br />
auf die Zusammensetzung von Mosten <strong>und</strong> Weinen <strong>und</strong><br />
Calciumgehalte nach chemischer EntsaÈuerung. Mitt. <strong>Klosterneuburg</strong><br />
50: 16-26<br />
BISSON, L.F. and BUTZKE, C.E. 2000: Diagnosis and rectification<br />
of stuck and sluggish fermentations. Amer. J. Enol. Vitic.<br />
51(2): 168-177<br />
BUTZKE, C.E. 1998: Survey of yeast assimilable nitrogen status<br />
in musts from California, Oregon, and Washington.<br />
Amer. J. Enol. Vitic. 49(2): 220-224<br />
DUKES, B.C. and BUTZKE, C.E. 1998: Rapid determination of<br />
primary amino acids in grape juice using an o-Phthaldialdehyde/N-acetyl-L-Cysteine<br />
spectrometric assay. Amer.<br />
J. Enol. Vitic. 49(2): 125-134<br />
HILLEBRAND, W., LOTT, H. <strong>und</strong> PFAFF, F. (2003): Taschenbuch<br />
der Rebsorten. 13. Aufl. - Mainz: Fra<strong>und</strong>, 2003<br />
PATZ, C.-D. <strong>und</strong> DIETRICH, H. 2005: Automatische Bestimmung<br />
der TraubenqualitaÈt. Dt. Weinbau (14): 16-22<br />
REDL, H. <strong>und</strong> KOBLER, A. 1991: Quantitative VeraÈnderungen<br />
von Traubeninhaltsstoffen bei klassifizierter Botrytis-<br />
SauerfaÈule. Mitt. <strong>Klosterneuburg</strong> 41: 177-185<br />
SCHRAMM, A. <strong>und</strong> RESCH, H.-N. 2008: Stoffwechsel <strong>und</strong> Klimawandel.<br />
Dt. Weinmagazin (9): 13-17<br />
SHIVELY, C.E. and HENICK-KLING, T. 2001: Comparison ot two<br />
procedures for assay of free amino nitrogen. Amer. J.<br />
Enol. Vitic. 52(4): 400-401<br />
SPONHOLZ, W.R., DITTRICH, H.H. <strong>und</strong> LINSSEN, U. 1987: Die<br />
VeraÈnderungen von Most-Inhaltsstoffen durch Botrytis<br />
cinerea in edelfaulen Traubenbeeren definierter Auslese-<br />
Stadien. Wein-Wiss. 42: 266-284<br />
Statistisches B<strong>und</strong>esamt (2008): RebflaÈchenstatistik vom<br />
13.03.2008. - Wiesbaden, 2008<br />
STEFFAN, H. <strong>und</strong> RAPP, A. 1979: Ein Beitrag zum Nachweis unterschiedlicher<br />
Malatpools in Beeren der Rebe. Vitis 18:<br />
100-105<br />
STURM, J., KUHLMANN, F., PATZ, C.-D. <strong>und</strong> HOFFMANN, D. 2007:<br />
Motivationssteigerung bei Traubenlieferanten. Dt. Weinbau<br />
(16/17): 22-26<br />
STURM, J. 2009: Entwicklung <strong>und</strong> Anwendung eines multivariaten<br />
Bewertungssystems fuÈ r die TraubenqualitaÈt im Weinbau.<br />
- Geisenheim: Gesellschaft zur FoÈ rderung der Forschungsanstalt<br />
Geisenheim, 2009 (Geisenheimer Berichte;<br />
63)<br />
Manuskript eingelangt am 23.September 2009<br />
158