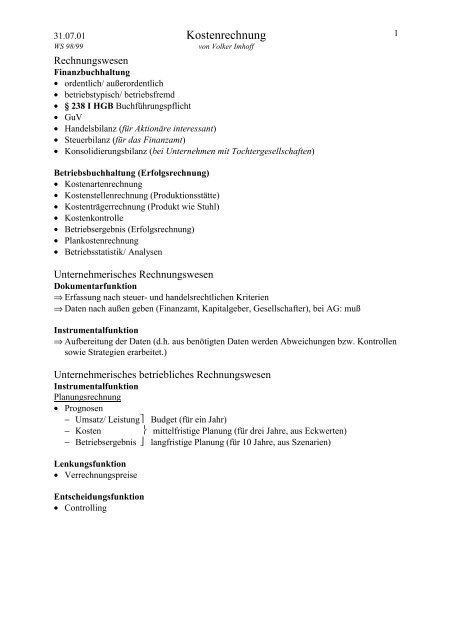Kostenrechnung - Volker-imhoff.de
Kostenrechnung - Volker-imhoff.de
Kostenrechnung - Volker-imhoff.de
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />
WS 98/99<br />
von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />
Rechnungswesen<br />
Finanzbuchhaltung<br />
• or<strong>de</strong>ntlich/ außeror<strong>de</strong>ntlich<br />
• betriebstypisch/ betriebsfremd<br />
• § 238 I HGB Buchführungspflicht<br />
• GuV<br />
• Han<strong>de</strong>lsbilanz (für Aktionäre interessant)<br />
• Steuerbilanz (für das Finanzamt)<br />
• Konsolidierungsbilanz (bei Unternehmen mit Tochtergesellschaften)<br />
1<br />
Betriebsbuchhaltung (Erfolgsrechnung)<br />
• Kostenartenrechnung<br />
• Kostenstellenrechnung (Produktionsstätte)<br />
• Kostenträgerrechnung (Produkt wie Stuhl)<br />
• Kostenkontrolle<br />
• Betriebsergebnis (Erfolgsrechnung)<br />
• Plankostenrechnung<br />
• Betriebsstatistik/ Analysen<br />
Unternehmerisches Rechnungswesen<br />
Dokumentarfunktion<br />
⇒ Erfassung nach steuer- und han<strong>de</strong>lsrechtlichen Kriterien<br />
⇒ Daten nach außen geben (Finanzamt, Kapitalgeber, Gesellschafter), bei AG: muß<br />
Instrumentalfunktion<br />
⇒ Aufbereitung <strong>de</strong>r Daten (d.h. aus benötigten Daten wer<strong>de</strong>n Abweichungen bzw. Kontrollen<br />
sowie Strategien erarbeitet.)<br />
Unternehmerisches betriebliches Rechnungswesen<br />
Instrumentalfunktion<br />
Planungsrechnung<br />
• Prognosen<br />
− Umsatz/ Leistung ⎤ Budget (für ein Jahr)<br />
− Kosten ⎬ mittelfristige Planung (für drei Jahre, aus Eckwerten)<br />
− Betriebsergebnis ⎦ langfristige Planung (für 10 Jahre, aus Szenarien)<br />
Lenkungsfunktion<br />
• Verrechnungspreise<br />
Entscheidungsfunktion<br />
• Controlling
31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />
WS 98/99<br />
von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />
Teilgebiete <strong>de</strong>s Rechnungswesens<br />
extern<br />
• Finanzbuchhaltung<br />
• Geschäftsbuchhaltung<br />
• Bilanzbuchhaltung<br />
• Ergebnis-/ Erfolgsrechnung<br />
2<br />
intern<br />
• Betriebsbuchhaltung (Kostenarten-, Kostenstellen-, Kostenträgerrechnung)<br />
• Planungsrechnung (Controlling)<br />
• Analysen/ Betriebsstatistiken<br />
Geschäftsbuchhaltung<br />
Finanzbuchhaltung Bilanzbuchhaltung Ergebnis- und Finanzrechnung<br />
Erfolgsrechnung<br />
Kreditoren/ Debitoren Jahresabschluß Spartenrechnung Cash-Management<br />
(Kalk. Zinsen)<br />
Sachkonten Steuerbilanz Produktrechnung Finanzbedarf<br />
Zahlungsverkehr Han<strong>de</strong>lsbilanz Profit-Center<br />
(Anlagen, Wertpapiere,<br />
nicht Pro-<br />
Liquiditätsplan<br />
(Einnahmen-/<br />
Ausgabenrechnung)<br />
Provision GuV dukte, Personal) Finanzkontrolle<br />
Reisekostenabrechnung Lagebericht<br />
=> Controlling<br />
Son<strong>de</strong>rbilanzen<br />
Umsatzrendite<br />
Betriebsbuchhaltung (betr. Abläufe)<br />
Anlagenbuchhaltung Material Löhne und Gehälter KLR<br />
Erfassung <strong>de</strong>s materiellen und Zu- / Abgänge aus <strong>de</strong>m Löhne und Gehälter<br />
immateriellen Wirtschaftsguts Magazin<br />
=> Abschreibung<br />
berechnen u. auszahlen<br />
Ermittlung <strong>de</strong>r SV<br />
Ermittlung + Berechnung<br />
von Überstun<strong>de</strong>n
31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />
WS 98/99<br />
von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />
Kosten- und Leistungsrechnung<br />
+ Produktionsplan (Preis vom Markt festgelegt)<br />
+ Absatzplan (Preiskalkulation – Unternehmen bestimmt Preis)<br />
+ Beschaffungsplan (Betriebsmittel, Werkstoffe)<br />
+ Personalplan (Personalbedarfsplan, Personalstellenplan)<br />
+ Personalkostenplan<br />
+ Finanzplan<br />
+ Investitionsplan<br />
= Betriebserfolg<br />
<br />
Gewinnschwelle = Zone zwischen Gewinn und Verlust<br />
<br />
Beobachtung <strong>de</strong>s Kapitals<br />
<br />
Wirtschaftlichkeitsrechnung (Cash flow, Rendite etc.)<br />
<br />
Optimierungsrechnung (Kostenstruktur minimieren, Umsatzstruktur maximieren)<br />
3<br />
Aufgaben <strong>de</strong>s KLR (Definition)<br />
Ermittlungsfunktion<br />
→ Abbildung <strong>de</strong>s Betriebsprozesses<br />
• Vergangenheit<br />
• Gegenwart (Ist)<br />
• Zukunft<br />
= Informationsbasis und Kalkulation = Planungsrechnung<br />
Lenkungsfunktion<br />
→ Steuerung <strong>de</strong>s Betriebsprozesses<br />
Kontrollfunktion<br />
→ Kontrolle <strong>de</strong>s Betriebsprozesses (Plan Soll-Ist-Vergleich)<br />
Aufgaben <strong>de</strong>r <strong>Kostenrechnung</strong> + Leistungsrechnung (inhaltlich)<br />
Kontrollfunktion<br />
• Betriebserfolg (monatlich/ jährlich das Kostenstellenergebnis ermitteln)<br />
• Kostenkontrolle (täglich/ monatlich, jährlich wäre zu spät)<br />
Planungsrechnung<br />
• Ermittlung <strong>de</strong>r Kalkulation (Kostenträger)<br />
• Beschäftigungsplanung<br />
• Sortimentsplanung<br />
• Produktionsplanung bzw. -prozeß<br />
• Betriebsgrößenplanung<br />
Dokumentationsrechnung<br />
Bestandsbewertung<br />
• Investitionsplanung } Anlagenbuchhaltung<br />
• Inventur }
31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />
WS 98/99<br />
von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />
4<br />
Vergangenheit Gegenwart Zukunft<br />
Normalkosten Istkosten Plankosten<br />
Vollkostenrechnung Normalkosten auf ============> flexible Plankosten<br />
Vollkostenbasis<br />
auf Vollkostenbasis<br />
Teilkostenrechnung Normalkosten auf ============> Teilkostenrechnung<br />
Teilkostenbasis (DB)<br />
N.menge * N.preis Istmenge * Istpreis Planmenge 1 *<br />
Planpreis 2<br />
N.zeit * N.preis Istzeit * Istpreis Planzeit * Planpreis<br />
(Durchschnittswerte)<br />
1) aus <strong>de</strong>m Ist sowie aus <strong>de</strong>m Produktions- und Absatzplan abgeleitet<br />
2) aus <strong>de</strong>r Kalkulation, aus <strong>de</strong>r Vergangenheit und vom Markt abgeleitet (2* Normal, 1 * Ist<br />
und von <strong>de</strong>r Summe <strong>de</strong>r Durchschnitt). Problem: Preise aus <strong>de</strong>r Vergangenheit<br />
berücksichtigen keine aktuellen Marktverän<strong>de</strong>rungen wie Preiserhöhungen<br />
Vollkosten<br />
Teilkosten<br />
Plan<br />
Soll<br />
= alle Kosten, die im gesamten betrieblichen Ablauf anfallen (fixe und<br />
proportionale Kosten<br />
= proportionale Kosten (= variable Kosten = Grenzkosten)<br />
= produktionsabhängige Kosten<br />
= produktionsunabhängige Kosten<br />
Sollkosten = Planmenge * Planpreis * Beschäftigungsgrad<br />
Finanzbuchhaltung<br />
• Ausgabe = alle Werte, welche die Unternehmung in Geldbeträgen verlassen<br />
• Aufwand = Werteverzehr <strong>de</strong>r Unternehmung in einer Rechnungsperio<strong>de</strong><br />
• Zweckaufwand = Güter und Dienstleistungen, die <strong>de</strong>r betrieblichen Leistungserstellung<br />
dienen<br />
• Ertrag = gesamtes Werteschaffen im Rahmen <strong>de</strong>s gesamten Unternehmens<br />
=> Unternehmensergebnis = Unternehmenserfolg = Erträge - Aufwand = Betriebsergebnis ±<br />
neutrales Ergebnis<br />
Betriebsbuchhaltung<br />
• Kosten = leistungsbedingter Verbrauch im Rahmen <strong>de</strong>s betriebstypischen Geschehens<br />
• Leistung = Werteschaffen im Rahmen <strong>de</strong>s betriebstypischen Geschehens<br />
• Grundkosten = aufwandsgleiche Kosten = Zweckaufwand<br />
• Zusatzkosten = Kosten, die kein Aufwand sind<br />
=> Betriebsergebnis = Leistung - Kosten
31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />
WS 98/99<br />
von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />
5<br />
Auszahlung, nicht Ausgabe = Privatentnahme, Anzahlung, Begleichung einer Verb.<br />
Auszahlung = Ausgabe = Bareinkauf von Waren<br />
Ausgabe nicht Auszahlung = Einkauf auf Ziel<br />
Ausgabe nicht Aufwand = Kauf und Lagerung von Rohstoffen<br />
Ausgabe = Aufwand = just-in-time-Verbrauch von Rohstoffen<br />
Aufwand nicht Ausgabe = Verbrauch von Rohstoffen vom Lager<br />
Aufwand nicht Kosten = nicht betriebsbedingte Aufwendungen<br />
Aufwand = Kosten = Löhne<br />
Kosten nicht Aufwand = kalk. Kosten<br />
Einzahlung nicht Einnahme = Kun<strong>de</strong> begleicht eine For<strong>de</strong>rung<br />
Einzahlung = Einnahme = Barverkauf<br />
Einnahme nicht Einzahlung = Verkauf auf Ziel<br />
Einnahme nicht Ertrag = Verkauf vom Lager (!!)<br />
Einnahme = Ertrag = Verkauf von Waren<br />
Ertrag nicht Einnahme = Produktion auf Lager (!!)<br />
Ertrag nicht Betriebsertrag = betriebsfrem<strong>de</strong> Erträge (Zinsen)<br />
Ertrag = Betriebsertrag = betriebsbedingte Erträge (Umsatzerlöse)<br />
Betriebsertrag nicht Ertrag =kalk. Betriebserträge (FiBu-KR)<br />
Neutraler Aufwand<br />
Gesamter Aufwand<br />
Zweckaufwand<br />
Als Kosten verrechneter Nicht als Kosten<br />
Zweckaufwand verrechneter<br />
Zweckaufwand<br />
Grundkosten An<strong>de</strong>rskosten Zusatzkosten<br />
Kalk. Kosten<br />
Gesamte Kosten<br />
Finanzbuchhaltung<br />
Betriebsbuchhaltung<br />
Lohnfortzahlung bar 100.000 DM<br />
Löhne an Kasse 100.000 DM KSt-Prod.stelle an Löhne (BAB)<br />
(Auszahlung, Ausgaben)<br />
Zweckaufwand = Grundkosten<br />
Rohstoffeinkauf gegen Scheck am 01.10 und Rohstoffverbrauch am 30.12<br />
Rohstoffe an Bank<br />
KSt-Produktion an Rohstoffe<br />
(Auszahlungen, Ausgabe)<br />
Zweckaufwand<br />
Kauf einer Maschine auf Ziel am 10.12<br />
Maschine an Verbindlichkeiten<br />
(Ausgabe)<br />
Bezahlung am 01.04<br />
Verbindlichkeiten an Bank<br />
(Auszahlung)<br />
KSt AfA-Maschine<br />
(Zweckaufwand)<br />
Kauf eines Grundstücks für die Produktion per Scheck<br />
Gebäu<strong>de</strong> an Bank (neutrales Ergebnis)
31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />
WS 98/99<br />
von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />
6<br />
Kauf eines Gebäu<strong>de</strong>s per Scheck<br />
KST Gebäu<strong>de</strong> (kalk. AfA) an Ist-AfA<br />
Kauf von Wertpapieren per Scheck<br />
Wertpapiere an Bank (neutrales Ergebnis)<br />
Zweckaufwand, <strong>de</strong>r nicht in die Kosten eingeht, ist z.B. eine Maschine mit einer Laufzeit, die<br />
nach zwei Jahren Schrott ist.<br />
Merke:<br />
• Ausgabe hängt von <strong>de</strong>r Fälligkeit ab!<br />
• Abstimmdifferenz = betrieblicher Aufwand - Kosten<br />
Kostenarten<br />
• An<strong>de</strong>rskosten (sie verhalten sich in <strong>de</strong>r FiBu an<strong>de</strong>rs)<br />
− Abschreibungen<br />
− Zinsen<br />
− Wagnisse (Wertberichtigungen)<br />
• Zusatzkosten (in <strong>de</strong>r FiBu keinen Aufwand)<br />
− Unternehmerlohn (Geschäftsführergehalt)<br />
− Miete (für eigenes Gebäu<strong>de</strong>)<br />
• Grundkosten<br />
Gesamtkosten<br />
Produktionsfaktoren<br />
dispositiver Faktor<br />
- menschliche Arbeit (RS-Verarbeitung) - Geschäftsleitung (Entscheidungsträger)<br />
- Betriebsmittel<br />
- Dienstleistungen - Planung und Organisation (Unternehmensstruktur)<br />
- Werkstoffe<br />
sprungfixe Kosten sind fixe Kosten, die bei Erreichen einer bestimmten Menge die Kosten<br />
ansteigen läßt<br />
K G = Gesamtkosten<br />
remanente Kosten<br />
fixe Kosten (K f ) variable/ proportionale Kosten (K v )<br />
Nutzenkosten (K N ) Leerkosten (K L ) progressive Kosten (Ü-Std)<br />
Kosten <strong>de</strong>r genutzten => unproduktiv <strong>de</strong>gressive Kosten (Rabatte)<br />
Kapazität<br />
= Stillstandskosten
31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />
WS 98/99<br />
von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />
7<br />
Remanente Kosten<br />
Bei rückläufiger Beschäftigung sinken die kosten nicht im gleichen Maße wie sie bei<br />
zunehmen<strong>de</strong>r Beschäftigung entstan<strong>de</strong>n sind. Fixkosten hinken <strong>de</strong>r Beschäftigungsän<strong>de</strong>rung<br />
nach. Es han<strong>de</strong>lt sich um Leerkosten, die aufgrund interner o<strong>de</strong>r externer Restriktionen nicht<br />
abgebaut wer<strong>de</strong>n können.<br />
Leerkosten stellen keine echte Kostenabweichung dar. Sie bezeichnen lediglich <strong>de</strong>n Teil <strong>de</strong>r<br />
fixen Kosten, <strong>de</strong>r nichtgenutzten Kapazität entspricht. Mit <strong>de</strong>n Leerkosten läßt sich also <strong>de</strong>r<br />
Auslastungsgrad <strong>de</strong>r Kapazität feststellen.<br />
Grenzkosten = ∆K = Differenzkosten = Zuwachs <strong>de</strong>r nächsten Beschäftigungseinheit<br />
Kostenzuwachs ∆K = (K G2 - K G1 ) / (x 2 -x 1 )<br />
K G2 = K f + k v * x - immer die letzte Größe nehmen!<br />
k v = Kostenzuwachs / Mengenzuwachs = 200/20 = 10<br />
K G = 400+ 10 * 20<br />
Aufgabe: K G1 = 220.000 DM, K G2 = 244.000 DM, x 1 = 2.000 LE, x 2 = 2.400 LE<br />
Lösung:<br />
∆K = (244.000-220.000)/ (2.400 - 2.000) = 60 DM/ LE<br />
K G2 = K f + k v * x - immer die letzte Größe nehmen!<br />
220.000 = K f + 60 * 2.000<br />
100.000 = K f<br />
Aufgabe<br />
x 3 = 2.600; K 93 = 256.000<br />
x 4 = 2.900; K 94 = 274.000<br />
x 5 = 3.400; K 95 = 304.000<br />
Produktivität:<br />
Wirtschaftlichkeit: abgeleitet aus <strong>de</strong>m Betrieb (Produktionsfaktoren?)<br />
Rentabilität: abgeleitet aus <strong>de</strong>r FiBu und Bilanz (eingesetztes Kapital)<br />
Aufgabe<br />
Mai - Kauf einer Maschine von 200.00 DM<br />
Juli - Lieferung <strong>de</strong>r Maschine<br />
Aug - Zahlung <strong>de</strong>r Maschine<br />
Sept - Produktion<br />
mtl. - Kalk. AfA von 5.000 DM<br />
AfA - in vier Jahren linear<br />
Wann und in welcher Höhe entstehen die diesen Geschäftsvorfällen entsprechen<strong>de</strong>n<br />
Auszahlungen, Ausgaben, Aufwendungen und Kosten in <strong>de</strong>r Perio<strong>de</strong><br />
a) Kalen<strong>de</strong>rmonat<br />
b) Kalen<strong>de</strong>rjahr
31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />
WS 98/99<br />
von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />
8<br />
Lösung:<br />
Mai: Kaufvertrag hat keine buchhalterische Wirkung<br />
Juli: Ausgabe 200.000<br />
Aug: Auszahlung 200.000<br />
Sept: Aufwendungen<br />
Kosten (k. AfA) 5.000<br />
Okt: Kosten (k. AfA) 5.000<br />
Nov: Kosten (k. AfA) 5.000<br />
Dez: Kosten (k. AfA) 5.000<br />
Kosten (AfA) 25.000<br />
Aufwendungen 25.000<br />
b) kein Unterschied zu a), abgesehen davon, daß hier nicht in Monate unterteilt wird.<br />
Kapazität<br />
• qualitativ (Werteverzehr <strong>de</strong>r Produkte für <strong>de</strong>n Markt => Betriebsergebnis; kalk. Wagnisse<br />
wegen eventuellen Maschinenausfall)<br />
• quantitativ<br />
− Maximum: hoher Verschleiß, geeignet für einmalige Zusatzaufträge<br />
− optimal: Maschine läuft am günstigsten, z.B. Energieverbrauch<br />
Plangröße<br />
− normal: tastet sich an das Optimum heran<br />
− Minimum: zu hohe Leerkosten<br />
Berechnung <strong>de</strong>r Kapazität<br />
• Fertigungsquerschnitt<br />
• Fertigungsintensität<br />
• Fertigungsleistung<br />
= Länge * Breite * Höhe<br />
= Leistungseinheit (Durchmesser eines Pipelinerohrs)<br />
= Geschwindigkeit<br />
= Länge <strong>de</strong>r Nutzungszeit (Leerzeit + Rüstzeit,<br />
Rüstzeit = Wartung + Reparaturarbeiten)<br />
Aufgabe<br />
Fqu = 110 LE, Fi = 20 h, Fl = 30 Tg, Maximalkapazität ?<br />
=> Fertigungszeit = 30 Tg * 24h<br />
Lösung: 110 LE * 30*24 / 20 = 3.960<br />
Beschäftigungsgrad (Auslastung <strong>de</strong>r Maschine)<br />
Ist-Leistung Ist-Intensität Ist-Zeit<br />
-------------- + ----------------- + ----------<br />
Soll-Leistung Soll-Intensität Soll-Zeit<br />
Aufgabe:<br />
geg. Fqu = 100 LE, Fi = 22 h, Fl = 25 Tg, Beschäftigungsgrad ?
31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />
WS 98/99<br />
von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />
9<br />
Lösung:<br />
Ist = 100 *(25*25) / 22 = 2.727<br />
=> Beschäftigungsgrad = 2727/ 3960 = 68,5 %<br />
Kapazität = absolute Zahl<br />
Beschäftigung = prozentuale Zahl<br />
BeBu: kalk. Wagnisse<br />
FiBu: Wertberichtigungen auf For<strong>de</strong>rungen<br />
Kalk. Kosten sind die Kosten in <strong>de</strong>r Betriebsbuchhaltung, welche die Kontinuität bewahrt.<br />
Erklärungsfunktion (verbal in Szenarien)<br />
Funktionsbereiche<br />
Betriebswirtschaftliche Theorien<br />
- FiBu Informationen - Beschaffungstheorie (just in time)<br />
- Produktion (Fertigung) Kapazität - Investitionstheorie (Optimierung von<br />
- Absatz (Vertrieb/ Marketing) Produktion und Vertrieb ermitteln; Ersatzund<br />
Neubedarf)<br />
Organisation, woher ich die<br />
- Produktionstheorie und Kostentheorie<br />
Informationen erhalte<br />
(menschliche Arbeit, Werkstoffe etc.)<br />
- Finanztheorie<br />
- Absatz- bzw. Preistheorie<br />
Erklärungsfunktion (aus <strong>de</strong>r FiBu heraus)<br />
Kosteneinflußfaktoren<br />
• Qualität ]<br />
• Beschäftigung (Maschinen, Personal) (Proportionen, Quantität) ] variabel<br />
• Preis (Markt) ]<br />
• Betriebsgröße<br />
} relativ<br />
• Fertigungsprogramm<br />
} konstant<br />
Gestaltungstheorie<br />
K G (Faktoreinsatz) = Faktoreinsatzmenge * Faktoreinsatzpreis<br />
K G = r * p<br />
K G = (r 1 + r 2 + r 3 ....) *(p 1 + p 2 + p 3 ....)
31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />
WS 98/99<br />
von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />
10<br />
Produktionstheorie<br />
Die Produktionsfunktion ist <strong>de</strong>r Zusammenhang zwischen <strong>de</strong>m mengenmäßigen Ertrag<br />
(Output) und <strong>de</strong>m eingesetzten Faktoreinsatzmengen (Input)<br />
Typ A Typ B Typ C<br />
frei variieren<strong>de</strong> Faktoreinsatzmenge Kosteneinflußgrößen<br />
Einsatzfaktoren ist nicht variierbar, wer<strong>de</strong>n durch Parameter<br />
son<strong>de</strong>rn abhängig zur bestimmt<br />
Ausbringungsmenge<br />
(Kapazität)<br />
<br />
praxisnah<br />
Produktionstyp A<br />
Ertragszuwachs ist abhängig von<br />
• Fertigungsquerschnitt = Fertigungsmaterial<br />
• Fertigungsintensität (Arbeit/ Leistung)<br />
• Fertigungszeit<br />
Stückkosten<br />
Gesamtnutzen<br />
Einheitsnutzen<br />
Differential<br />
kosten<br />
Gesamtdifferent.<br />
x K G E K =K G / x N = p*x -k Ne = p - k dk = F'(x) DK<br />
0 34.700,00 0,00 0,00 -34.700,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 48.400,00 9.500,00 4.840,00 -38.900,00 -3.890,00 1.370,00 13.700,00<br />
20 58.500,00 19.000,00 2.925,00 -39.500,00 -1.975,00 1.010,00 20.200,00<br />
30 65.600,00 28.500,00 2.186,67 -37.100,00 -1.236,67 710,00 21.300,00<br />
40 70.300,00 38.000,00 1.757,50 -32.300,00 -807,50 470,00 18.800,00<br />
50 73.200,00 47.500,00 1.464,00 -25.700,00 -514,00 290,00 14.500,00<br />
60 74.900,00 57.000,00 1.248,33 -17.900,00 -298,33 170,00 10.200,00<br />
70 76.000,00 66.500,00 1.085,71 -9.500,00 -135,71 110,00 7.700,00<br />
x = Einheiten<br />
K = F(x) = Gesamtkosten<br />
K’ = F(x) / x = Durchschnittskosten, Stückkosten<br />
dk = Differentialkosten<br />
DK = Gesamtdifferentialkosten<br />
E = Gesamterlös<br />
Ne = Nutzen je Einheit<br />
N = Gesamtnutzen<br />
Produktionstyp B<br />
Die Produktionsfunktion von Typ B entspricht <strong>de</strong>m Kombinationsgesetz <strong>de</strong>r betrieblichen<br />
Leistungserstellung, d.h. die Gesetzmäßigkeit zwischen Faktorertrag und Faktoreinsatz.<br />
Im Gegensatz zur Produktionsfunktion vom Typ A wer<strong>de</strong>n die Faktoreinsatzmengen nicht<br />
mehr unmittelbar als Funktionen <strong>de</strong>r Ausbringungsmenge (x), son<strong>de</strong>rn als Funktion <strong>de</strong>r<br />
Betriebsmittelleistung (d) verstan<strong>de</strong>n.
31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />
WS 98/99<br />
von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />
11<br />
Merke<br />
• Basis <strong>de</strong>s Maßstabes ist <strong>de</strong>r Erlös<br />
DM<br />
1,4<br />
1,2<br />
1<br />
0,8<br />
0,6<br />
0,4<br />
0,2<br />
0<br />
4000<br />
6000<br />
8000<br />
10000<br />
12000<br />
Menge<br />
kf<br />
k'<br />
kg<br />
p<br />
Bei Typ A können Fertigintensität, -querschnitt und -zeit sich beliebig än<strong>de</strong>rn. Kein<br />
proportionaler Verlauf son<strong>de</strong>rn progressiver.<br />
Bei Typ B können nur die Kosten, Preise o<strong>de</strong>r die Menge geän<strong>de</strong>rt wer<strong>de</strong>n, allerdings jeweils<br />
nur ein Parameter.<br />
Produktionsfunktion von Typ C<br />
Die Produktionsfunktion von Typ C ist eine Weiterentwicklung von Typ A und Typ B.<br />
Schönfeld erwartet von <strong>de</strong>r Produktionsfunktion C neue Denkanstösse für die Entwicklung<br />
wirtschaftspraktisch orientierter Kostenmo<strong>de</strong>lle. Eigentlich praxisfremd, nur bei Szenarien<br />
von einem zehnjährigen Zeitraum sinnvoll.<br />
Anpassungsprozesse<br />
Arten<br />
• Quantitative Anpassung => multiple( Aufbau-Kostensprünge, Abbau-Kostenremanenzen)<br />
= >mutative (variable Kosten)<br />
• Zeitliche Anpassung (in Form von Überstun<strong>de</strong>n – variabel)<br />
• Intensitätsmäßige A. (Produktionsgeschwindigkeit)<br />
Hoch- und Tiefpunktverfahren<br />
K v = (K G2 – K G1 ) / (x 2 – x 1 )<br />
Anwendung: Gesamtkosten und Fertigungsstun<strong>de</strong>n gegeben, k v und K f gesucht<br />
Immer die Extremwerte (Anfangswert und Endwert) nehmen
31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />
WS 98/99<br />
von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />
Kostenverläufe<br />
Gewinnschwelle<br />
=> K = E<br />
Gewinnmaximum => G‘(x) = 0; wenn G‘(x) ≠ 0, dann Maximum in <strong>de</strong>r maximalen<br />
Ausbringungsmenge<br />
Durchschnittskosten => K = (K f /x) + K v<br />
Variable Durchschnittskosten => K‘ = K v<br />
Grenzkosten<br />
=> K v * x<br />
Beschäftigungsgrad => Ist / Soll * 100<br />
Nutzkosten<br />
Leerkosten<br />
Kapazität<br />
quantitative K.<br />
einer Perio<strong>de</strong><br />
qualitative K.<br />
= Anteil <strong>de</strong>r ausgelasteten/ genutzten Fixkosten<br />
= Anteil <strong>de</strong>r ungenutzten Fixkosten<br />
= Leistungsvermögen (aktiver Begriff)/ Fassungsvermögen<br />
(passiver Begriff)<br />
= in Mengeneinheiten ausgedrücktes Leistungsvermögen in<br />
= in Qualität o<strong>de</strong>r in Güte mit <strong>de</strong>r ein Betriebsmittel in <strong>de</strong>r Lage<br />
ist, einen Arbeitsgang durchzuführen<br />
=> Querschnitt * Zeit * Intensität<br />
Beschäftigungsgrad = Auslastung <strong>de</strong>r Kapazität in %<br />
= tatsächliche Fertigungsstun<strong>de</strong>n / geplante Fertigungsstun<strong>de</strong>n<br />
Gewinnrate<br />
= Umsatzrendite = Gewinn/ Umsatz<br />
Fertigungszeitgrad = geplante Fertigungsstun<strong>de</strong>n / maximale Fertigungsstun<strong>de</strong>n<br />
Nutzkosten<br />
= Kosten * Beschäftigungsgrad<br />
Leerkosten in Stk = (Gesamtkosten – Nutzkosten) /<br />
(Gesamtmenge – Ist-Menge)<br />
Das Betriebsminimum entspricht <strong>de</strong>m Beschäftigungsgrad, wo Erlös und variable Kosten<br />
<strong>de</strong>ckungsgleich sind (meistens am Nullpunkt)<br />
Das Betriebsmaximum entspricht <strong>de</strong>m Beschäftigungsgrad, wo nur die variablen Kosten<br />
noch eine Deckung durch <strong>de</strong>n Erlös erhalten.<br />
Das Kostenminimum entspricht <strong>de</strong>m Beschäftigungsgrad, bei <strong>de</strong>m die Stückkosten am<br />
niedrigsten und <strong>de</strong>r Stückgewinn am höchsten sind (Kostenfaktoren optimieren, nicht<br />
Optimum)<br />
Die Nutzungsschwelle entspricht <strong>de</strong>m Beschäftigungsgrad, bei <strong>de</strong>m <strong>de</strong>r Betrieb die<br />
Gewinnzone erreicht (Break-even-point). Der Punkt, wo die fixe und proportionalen Kosten<br />
ge<strong>de</strong>ckt sind bzw. wo <strong>de</strong>r Gewinn = 0 ist (Vollkostenrechnung)<br />
Die Nutzungsgrenze entspricht <strong>de</strong>m Beschäftigungsgrad, bei <strong>de</strong>m <strong>de</strong>r die Gewinnzone<br />
verläßt. Durch progressive Kosten verliere ich soviel Gewinn, daß ich unter die<br />
Nutzungsschwelle komme. Ten<strong>de</strong>nz zum DBV.<br />
Das Nutzenmaximum entspricht <strong>de</strong>m Beschäftigungsgrad, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>n höchsten Gesamtgewinn<br />
erzielt. Der Punkt <strong>de</strong>s höchsten Deckungsbeitrags, danach progressive Kosten<br />
12
31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />
WS 98/99<br />
von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />
Die Klasseneinteilung <strong>de</strong>s allgemeinen Kontorahmens<br />
0 Ruhen<strong>de</strong> Konten bzw. Anlage und Kapitalkonten (Gebäu<strong>de</strong>, Grundstücke, Maschinen,<br />
Darlehen und Pensionsrückstellungen)<br />
1 Finanzkonten (Bank, Kasse, For<strong>de</strong>rungen und Verbindlichkeiten)<br />
2 Abgrenzungskosten (Rechnungen, die Leistungen <strong>de</strong>s nächsten Jahres betreffen)<br />
3 Konten <strong>de</strong>r RHB bzw. Wareneingangskonten<br />
4-7 Kosten <strong>de</strong>r betrieblichen Kosten- und Leistungsrechnung<br />
4: Kosten<br />
5: Kostenstellenrechnung<br />
6: Kostenträgerrechnung<br />
7: Bestän<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Halbfabrikate und Fertigfabrikate<br />
8: Erlöskonten, Warenverkaufskonten<br />
9: Abschlußkonten<br />
Kontenrahmen gibt einheitliche Kontenglie<strong>de</strong>rung/ Kontenunterglie<strong>de</strong>rung für Unternehmen<br />
vor. Ziel: Einheitlichkeit <strong>de</strong>r buchhalterischen Bearbeitung<br />
Industrie-Kontenrahmen<br />
0-8: Rechnungskreislauf I - FiBu<br />
⇒ pagatorische Kosten (= Kosten, die in <strong>de</strong>r FiBu abgearbeitet wer<strong>de</strong>n<br />
⇒ Dokumentarfunktion<br />
9: Rechnungskreislauf II - <strong>Kostenrechnung</strong><br />
Integralfunktion (innerbetriebliche Verrechnungen und Abgrenzungen)<br />
13<br />
Wirtschaftlichkeit<br />
Grundsätze <strong>de</strong>r <strong>Kostenrechnung</strong><br />
Maximalprinzip<br />
Minimalprinzip<br />
Ökonomisches Prinzip<br />
Erfolg = Ertrag - Aufwand<br />
a) Wirtschaftlichkeit = Soll/ Istgröße<br />
Ergiebigkeitsgrad = Istleistung/ Solleistung (Nutzenmaximum)<br />
Je näher wir uns <strong>de</strong>r 1 nähern, <strong>de</strong>sto vollkommener die Wirtschaftlichkeit und umgekehrt<br />
Wirtschaftlichkeitsgrad = Sollumsatz / Istumsatz (Sparsamkeitsgrad)<br />
bei 1 liegt das Optimum, je tiefer bzw. höher ich gehe, <strong>de</strong>sto unwirtschaftlicher
31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />
WS 98/99<br />
von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />
14<br />
b) Produktivität<br />
Output/ Input = Faktorertrag / Faktoreinsatzmenge<br />
Wirtschaftlichkeit <strong>de</strong>r betrieblichen Leistungserstellung, die in technischer und<br />
menschlicher Produktivität unterteilt ist<br />
c) Rentabilität<br />
Gesamtrentabilität = (Reingewinn + Fremdkapitalzinsen) / Unternehmenskapital<br />
=> aus meinem Fremdkapital Gewinn gemacht (i = 7 %)<br />
Eigenkapitalrentabilität = Reingewinn / Eigenkapital<br />
Umsatzrentabilität = Reingewinn / Umsatz<br />
=> von je<strong>de</strong>r Mark, die ich am Markt verdiene, sind 5 % Gewinn<br />
Beispiel:<br />
Umsatz: 800 TDM, FK-Zins: 12 TDM, EK: 300 TDM, FK = 100 TDM, Gewinn: 40 TDM<br />
GK = 52 / 400 = 13 %<br />
UR = 40 / 800 = 5 %<br />
ER = 40 / 300 = 13,3 %<br />
Grundsätze <strong>de</strong>r <strong>Kostenrechnung</strong><br />
Kausalität und Proportionalität<br />
• Bezugsgrößenerfassung<br />
• Kostenplanung<br />
• Kostenkontrolle<br />
• Beschäftigungsgrad<br />
• Entscheidungsvorbereitung<br />
• Entscheidungskontrolle<br />
• flexible Plankostenrechnung auf Voll- bzw. Teilkostenbasis<br />
• direkte Zuordnung<br />
• Geschlossenheit<br />
• Einmaligkeit (Kostenstruktur in einer best. Form nur einmal darstellen, d.h. Kosten<br />
dürfen nur auf <strong>de</strong>r Kostenstelle sein, wo sie verursacht sind)<br />
• Stetigkeit<br />
• Belegpflicht (keine Buchung ohne Beleg)<br />
Eine <strong>Kostenrechnung</strong> ist nur aussagefähig, wenn sie bestimmte materielle und formale<br />
Min<strong>de</strong>stanfor<strong>de</strong>rungen erfüllt.<br />
Fertigungsmaterialkosten = i.w. Bestandteil eines Erzeugnisses können diesen unmittelbar<br />
zugerechnet wer<strong>de</strong>n (z.B. Rohstoffe, Holz, Eisen)<br />
Fertigungsmaterial = Einzelkosten<br />
Gemeinkostenmaterial<br />
Hilfsstoffe<br />
= unwesentliche Bestandteile eines Erzeugnisses (z.B.<br />
wie Farben, Leim etc.) = Hilfsstoffe sind GK, wenn eine direkte<br />
Zuordnung nicht möglich ist
31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />
WS 98/99<br />
von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />
15<br />
Betriebsstoffe =<br />
Unechte GK<br />
Echte GK<br />
kein Bestandteil <strong>de</strong>r Erzeugnisse, son<strong>de</strong>rn Betreiben von<br />
Betriebsmitteln( Benzin)<br />
= sind vom Produkt direkt zuordbar<br />
= wer<strong>de</strong>n verschlüsselt<br />
Gemeinkosten<br />
- Hilfs- und Betriebsstoffe<br />
- Energie<br />
- Gehälter und Hilfslöhne<br />
- Sozialkosten<br />
- Steuern<br />
- Instandhaltung<br />
- Mieten<br />
KA-Rechnung<br />
Berechnung <strong>de</strong>s mengenmäßigen Verbrauchs<br />
• Inventurmetho<strong>de</strong> V = Zugang + AB - EB<br />
- Schwund und Diebstahl enthalten<br />
• Skontrationsmetho<strong>de</strong> Summe <strong>de</strong>r Materialentnahmescheine<br />
sehr aufwendig<br />
• retrogra<strong>de</strong>r Rechnung von Stückzahl auf die Summe <strong>de</strong>r Einsatzstoffe ermitteln<br />
- nur Sollverbrauch, dadurch mangelhafte Stücke unberücksichtigt<br />
• Sofortverbrauch<br />
Berechnung <strong>de</strong>s wertmäßigen Verbrauchs<br />
• durchschnittliche Einstandspreise<br />
=> Summe <strong>de</strong>r einzelnen DM-Beträge/ Summe <strong>de</strong>r Gesamtmenge<br />
• mit Verrechnungspreisen<br />
• gleiten<strong>de</strong> Durchschnitte<br />
Inventurmetho<strong>de</strong><br />
Befundrechnung Skontrationsmetho<strong>de</strong> Retrogra<strong>de</strong> Rechnung<br />
Anfangsbestand (Lagerwert) Bisherigen Bestand Fertigprodukt<br />
+ Zugänge (lt. Anlagenbuchhaltung) ./. Materialverbrauch<br />
- Endbestand + Zugang (lt. Beleg) = Stücklisten<br />
= Verbrauch ./. Abgang (lt. Beleg)<br />
= Neubestand Stückliste<br />
Nicht produktiver Verbrauch Mengen- und Wertkontraktion - genaue Rezeptur notwendig<br />
(Schwund etc.) HK > VP => a.o. AfA => Plausibilitätsrechnung<br />
- nur ein Produktionsstrang (Gläubigerschutz)<br />
- großzügig mit <strong>de</strong>r Kartei<br />
+ einfach u. kostengünstig Anlagenbuchhaltung<br />
Lagerbuchhaltung<br />
Bewertung zu AK-Preisen Materialentnahmeschein<br />
(beachte das Nie<strong>de</strong>rstwertprinzip)<br />
Die richtige Metho<strong>de</strong>
31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />
WS 98/99<br />
von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />
16<br />
Auftragsfertigung => Anfertigung <strong>de</strong>s Produktes nach Auftrag<br />
= Anschaffungspreis<br />
Vorratsfertigung<br />
= Durchschnittspreis<br />
= Tagespreis (Getrei<strong>de</strong>)<br />
= Wie<strong>de</strong>rbeschaffungspreis<br />
Kalkulatorische Kosten<br />
Kalk. Kosten<br />
= Kosten, die in <strong>de</strong>r KR verrechnet wer<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>nen kein o<strong>de</strong>r ein<br />
an<strong>de</strong>rer Aufwand in <strong>de</strong>r FiBu gegenübersteht<br />
Grundkosten Echte Zusatzkosten Unechte Zusatzkosten (An<strong>de</strong>rskosten)<br />
- Fertigungsmaterial - kalk. Zinsen auf EK - kalk. AfA<br />
- Fertigungslöhne - kalk. Miete - kalk. Zinsen auf FK<br />
- Son<strong>de</strong>reinzelkosten - kalk UL - kalk. Wagnisse<br />
Wagnisse sind effektiv angefallen<strong>de</strong> Aufwendungen, wie Gewährleistungsfälle und<br />
For<strong>de</strong>rungsausfälle. Sie gehen in die GuV, während kalk. Wagnisse in die BE eingehen.<br />
Verdrängter Erfolg = (DBV/ Zeitkapazität) * Mengenkapazität pro Produkt / gesamte<br />
Zeitkapazität<br />
Einbettung in <strong>de</strong>n Kontorahmen<br />
Tatsächliche Zinsen in Höhe von 500 DM<br />
kalkulatorische Zinsen in Höhe von 700 DM<br />
• Kalk. Zinsen an verr. kalk. Zinsen<br />
• kalk. Zinsen an Betriebsergebnis<br />
• verr. kalk. Zinsen an neutrales Ergebnis<br />
• Zinsen an Bank<br />
• neutrales Ergebnis an Zinsen<br />
• Betriebsergebnis an GuV<br />
• neutrales Ergebnis an GuV<br />
Kalk. AfA<br />
• Anschaffungsjahr<br />
• Anschaffungshalbjahr<br />
• Anschaffungskosten <strong>de</strong>r Hauptanlage (Abschreibung)<br />
• Anschaffungskosten <strong>de</strong>r Betriebsstoffe (Verbrauch wird durch Inventurmetho<strong>de</strong> ermittelt,<br />
s. echte und unechte GK)<br />
• Montagekosten<br />
Wirtschaftliche Nutzungsdauer (tatsächliche Nutzungsdauer)<br />
Jährliche Abschreibungsrate (kalk. Abschreibungssatz)<br />
Geringwertige GWG<br />
Zugang = Abgang
31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />
WS 98/99<br />
von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />
17<br />
Nicht abzuschreiben<strong>de</strong> Anlagegüter<br />
- Grund und Bo<strong>de</strong>n<br />
- Beteiligungen (Stammkapital)<br />
- Wertpapiere (AK-Wert)<br />
Kalk. Buchwert<br />
linear<br />
arithmetisch <strong>de</strong>gressiv<br />
= Anschaffungskosten – Liquidationserlös<br />
=> gleichmäßige Verteilung<br />
= > Summe <strong>de</strong>r einzelnen Jahr von <strong>de</strong>r Nutzungsdauer ermitteln<br />
(Nenner) und die aufsteigen<strong>de</strong> Jahreszahl als Zähler<br />
d.h. bei einer Nutzungsdauer von 4 Jahre: 4/10; 3/10 etc.<br />
Abschreibungsrate = kalk. Buchwert * Kennziffer (1/10)<br />
Anfangsbuchwert = AK, so daß am En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Laufzeit <strong>de</strong>r<br />
Liquidationserlös übrig bleibt<br />
Restwertverfahren => Summe von zwei aufeinan<strong>de</strong>rfolgen<strong>de</strong>n Restbuchwert *0,5 *<br />
i<br />
(für Zinsen)<br />
(0,5, da durchschnittliche Kapitalbindung)<br />
Verfahrensmöglichkeiten, wenn man feststellt, daß sich die Nutzungsdauer verlängert<br />
1) Bestimmung <strong>de</strong>s neuen Abschreibungsbetrags durch Berücksichtigung <strong>de</strong>r neuen<br />
Nutzungsdauer, d.h. kalk. Abschreibungsbetrag = Buchwert / neue Nutzungsdauer<br />
2) Bestimmung <strong>de</strong>s neuen Abschreibungsbetrags, in<strong>de</strong>m <strong>de</strong>r Restbuchwert mit <strong>de</strong>r<br />
verbleiben<strong>de</strong>n Nutzungsdauer dividiert wird<br />
3) Fortlaufen<strong>de</strong> Abschreibung (Verlängerung <strong>de</strong>r Laufzeit wird ignoriert, wodurch <strong>de</strong>r<br />
Buchwert negativ wird)<br />
=> die Numerierung entspricht auch <strong>de</strong>r Rangfolge, welche Metho<strong>de</strong> am sinnvollsten ist<br />
Kalk. Zinsen<br />
Eigen o<strong>de</strong>r fremd<br />
Betriebsnowendiges Kapital/ betriebsnotwendiges Vermögen<br />
./. zinsfreies Abzugskapital<br />
./. zinsloses Darlehen<br />
./. zinslose Vorauszahlung <strong>de</strong>s Kun<strong>de</strong>n<br />
./. Lieferantenkredit<br />
Aktiva<br />
Grundstücke<br />
Gebäu<strong>de</strong><br />
Maschinen<br />
BGA<br />
Fuhrpark<br />
Beteiligungen<br />
Passiva<br />
Eigenkapital = betriebsnotwendiges Kapital<br />
Verb. aus L. u. L aus <strong>de</strong>m AV<br />
Zinsfreie Kun<strong>de</strong>nvorauszahlung<br />
Unfertige und fertige Erzeugnisse<br />
Rohstoffe<br />
Liqui<strong>de</strong> Mittel
31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />
WS 98/99<br />
von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />
For<strong>de</strong>rungen<br />
Sonstiges<br />
Ermittlung <strong>de</strong>r Zinsen<br />
1. Ermittlung <strong>de</strong>s betriebsnotwendigen Vermögens<br />
./. Bei bebauten Grundstücken betriebsfrem<strong>de</strong>s Vermögen herausrechnen<br />
+ Stille Reserven auflösen<br />
+ GWG einbuchen, da dies auch Kapital bin<strong>de</strong>t<br />
./. betriebsfrem<strong>de</strong> Anteile<br />
18<br />
2. Ermittlung <strong>de</strong>s betriebsnotwendigen Kapitals<br />
betriebsnotwendiges Vermögen<br />
./. zinslose Verbindlichkeiten (Verb. aus L. u. L, Anzahlungen)<br />
3. Ermittlung <strong>de</strong>r Zinsen<br />
4: Zinseinnahmen aus Beteiligungen abziehen<br />
Durchschnittsmetho<strong>de</strong><br />
Kalk. Zinsen = [(AK - Liquiditationserlös) * 0,5 + Liquiditationserlös) * i * 1/12<br />
Restwertmetho<strong>de</strong><br />
(AK - Liquiditationserlös) * i * 1/12 * 0,5<br />
Kostenstellenrechnung<br />
Hauptkostenstelle Nebenkostenstelle Hilfskostenstelle<br />
Primäre Kosten<br />
Sekundäre Kosten<br />
=> direkt zuordbar => nicht direkt zuordbar<br />
Einzelkosten<br />
Fertigungskosten<br />
Materialkosten<br />
Umgrenzung <strong>de</strong>r KST<br />
Gemeinkosten<br />
Funktionen Verantwortungsbereich Räumlicher Bereich<br />
- Rechnerische Kriterien<br />
z. B. Energie, Strom, Öl<br />
- Verrechnungstechnische<br />
Kriterien
31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />
WS 98/99<br />
von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />
19<br />
Allgemeine KST<br />
+ Entwicklungs- u. Versuchs-KST = Forschungs-KST (nicht direkt auf ein Produkt<br />
zuordbar)<br />
+ Fertigungshilfskostenstelle (z.B. Fertigung von Autositzen in <strong>de</strong>r Automobilindustrie wie<br />
VW)<br />
+ Fertigungshauptkostenstelle (<strong>de</strong>r Verantwortliche kann nur die primären Kosten, aber<br />
nicht die innerbetrieblichen Kostensätze beeinflussen)<br />
+ Material-KST (Beschaffung und Verbrauch, Lagerung => Einkauf und Magazin)<br />
= Herstellkosten<br />
Vertriebs- und Verwaltungs-KST (Hauptkostenstelle, die aus Gemeinkosten besteht, wird auf<br />
das Produkt verteilt)<br />
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung<br />
‣Stufenleiterverfahren<br />
KST = primäre Gemeinkosten + Verbrauch an an<strong>de</strong>re KST * Kostensatz) / erstellte<br />
Leistungseinheiten - Eigenverbrauch - bis dahin abgegebene Leistungseinheiten an an<strong>de</strong>re<br />
Hilfs-KST)<br />
‣Anbauverfahren<br />
KST = primäre Gemeinkosten / insgesamt erstellte Leistungseinheiten<br />
‣Gleichungsverfahren<br />
Gesamte Leistung <strong>de</strong>r KST = Primärkosten + sekundären Kosten <br />
Aufgabe<br />
Gesamterlös = 100 Mio.<br />
k v Verkaufskosten = 5 Mio.<br />
Nettoerlös<br />
Fertigungsmaterial = 25 Mio.<br />
Fertigungslohn = 15 Mio.<br />
Sonstige k v<br />
= 5 Mio.<br />
AfA<br />
= 10 Mio.<br />
Gehälter<br />
= 20 Mio.<br />
Steuersatz = 50 %<br />
Lösung:<br />
k v : Fertigungsmaterial, Fertigungslöhne, sonstige k v , aber nicht k v Verkaufskosten<br />
K f : Gehälter, AfA<br />
Gewinn vor Steuern: 20 Mio.<br />
Gewinn nach Steuern: 10 Mio.<br />
DB: 50 Mio.<br />
Cash flow: 20 Mio.
31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />
WS 98/99<br />
von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />
20<br />
DM<br />
Gewinnzone<br />
DPU<br />
E<br />
Gewinnzone<br />
DBV<br />
K G<br />
Verlustfeld<br />
K f<br />
K v<br />
Menge<br />
Gesamt<br />
• Betriebsminimum = meist bei <strong>de</strong>r Produktion gleich null<br />
• Verlustfeld = Feld zwischen Nullpunkt und Linie <strong>de</strong>s Deckungsbeitrages<br />
• Gewinnzone = rechts vom Deckungsbeitrag<br />
• DBU = Schnittpunkt von E und K g (auch Gewinnschwelle o<strong>de</strong>r Breakeven-point<br />
genannt)<br />
• Gewinn = an <strong>de</strong>r vertikalen Linie die Spanne zwischen Erlös und<br />
Gesamtkosten<br />
• DBV = an <strong>de</strong>r vertikalen Linie die Spanne zwischen K v und Erlös<br />
• fixe Kosten = an <strong>de</strong>r vertikalen Linie Spanne zwischen variablen Kosten und<br />
Gesamtkosten<br />
• Nutzengrenze = beim Kapazitätsmaximum (beim linearen Verlauf auch das<br />
Betriebs- bzw. Nutzenmaximum) unter <strong>de</strong>r Abszisse beschriften<br />
• Betriebsoptimum = beim Kapazitätsmaximum (auch Nutzenmaximum genannt)<br />
Merke:<br />
• Bei <strong>de</strong>r Bestimmung <strong>de</strong>r variablen und fixen Kosten immer vom Nettoverkaufserlös<br />
ausgehen<br />
• Cash flow = Gewinn nach Steuern + Abschreibungen + Pensionsrückstellungen<br />
Aufgabe <strong>de</strong>r KST: Kostenkontrolle und Darstellung <strong>de</strong>r Unternehmensstruktur
31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />
WS 98/99<br />
von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />
21<br />
Aufbau einer Kostenkalkulation<br />
Fertigungsmaterial (unmittelbar, direkt zuordbar)<br />
+ Materialgemeinkosten (mittelbar)<br />
+ Fertigungslöhne (unmittelbar)<br />
+ Fertigungsgemeinkosten (mittelbar)<br />
= Herstellkosten ohne Son<strong>de</strong>reinzelkosten<br />
+ Son<strong>de</strong>reinzelkosten <strong>de</strong>r Fertigung (mittelbar)<br />
= Herstellkosten mit Son<strong>de</strong>reinzelkosten<br />
+ Verwaltungsgemeinkosten (mittelbar)<br />
+ Vertriebskosten (mittelbar)<br />
+ Son<strong>de</strong>reinzelkosten <strong>de</strong>s Vertriebs (unmittelbar)<br />
= Selbstkosten <strong>de</strong>r Fertigung => Kostenträger<br />
+ kalk. Gewinn (UL + Wagnisse)<br />
= Selbstkosten<br />
+ Gewinn => Erfolgsrechnung<br />
= Verkaufspreis<br />
./. Skonto<br />
= Verkaufspreisnetto<br />
HK auf Vollkostenbasis = alle für die betriebliche Leistungserstellung anfallen<strong>de</strong>n fixen und<br />
variablen Kostenbestandteile fließen in die Kalkulationssätze ein<br />
HK auf Teilkostenbasis = nur die variablen Kosten fließen in die Kalkulationssätze ein<br />
Pagatorisch be<strong>de</strong>utet auf Zahlungsvorgängen beruhend. Als pagatorische Kosten fin<strong>de</strong>n in<br />
<strong>de</strong>r Finanzabteilung alle aufwandsgleiche Ausgaben (neutraler Aufwand und Zweckaufwand)<br />
erfaßt und verrechnet. In <strong>de</strong>r Betriebsbuchhaltung arbeitet man mit kalkulatorischen Kosten<br />
(Grund- und Zusatzkosten).<br />
Deckungsbeitragsrechnung<br />
Gewinnbestimmung<br />
Produkt<br />
Produkt Gewinnplanung<br />
Finanzbericht<br />
Preisfindung<br />
Dokumentarfunktion Instrumentalfunktion Entscheidungsfindung<br />
(extern) (intern) Kostenkontrolle<br />
Ziel<br />
Zielformulierung Zielsteuerung Zielerfüllung<br />
- I<strong>de</strong>alziel - Erfolgsengpaß u. - Gewinnrechnung<br />
- Realziel - Wachstumsengpaß - Liquiditätsrechnung<br />
Strategische Planung => Abweichungsanalyse - zukunftssichere Planung<br />
<br />
Gegensteuerung<br />
z.B. hat Merce<strong>de</strong>s extra lange<br />
Lieferzeiten
31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />
WS 98/99<br />
von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />
Verantwortlich: Strategisches Management, operatives Management (KST-Verantwortlicher)<br />
Rechnen mit Deckungsbeiträgen<br />
Rangfolge durch <strong>de</strong>n Stück<strong>de</strong>ckungsbeitrag pro Bezugsgröße <strong>de</strong>s Engpasses (min, kg etc.)<br />
ermitteln<br />
22<br />
Preisuntergrenze<br />
= Grenzselbstkosten <strong>de</strong>s Zusatzproduktes + Opportunitätskosten<br />
= k vZ + Engpaßbelastung Z in Min/Stk * db/min verzichtetes Produkt<br />
Ist es sinnvoll bei zusätzlichen Fixkosten einen Auftrag annehmen?<br />
zusätzliche Fixkosten / db ergibt die Menge, die zusätzlich mehr verlauft wer<strong>de</strong>n muß,<br />
damit es sich lohnt<br />
Ist es sinnvoll, bei gestiegenen Grenzkosten zu verkaufen?<br />
ja, wenn <strong>de</strong>r neue db positiv ist<br />
Vollkostenrechnung<br />
Teilkostenrechnung<br />
Zuschlagsbasen Bezugsgrößen DBR auf Einzelkostenbasis<br />
- Einzelkosten - Grenzkosten - Leistungs-/ Bereit-<br />
- Gemeinkosten - fixe Kosten schaftskosten<br />
Verzicht auf die Kostenauflösung Kostenauflösung nach Anstelle <strong>de</strong>r Kosten-<br />
Überwälzungsprinzip Verursacherprinzip auflösung Kostenzurechnung<br />
nach I<strong>de</strong>ntitäts-<br />
Prinzip<br />
Gesamtkostenverfahren Umsatzkostenverfahren Umsatzkostenverfahren<br />
Erlöse<br />
Erlöse<br />
./. Gesamtkosten (EK + GK) ./. Grenzkosten Erlöse<br />
= Betriebserfolg (Grenz-EK + Grenz-GK) ./. Leistungskosten<br />
+ / - Bestandsverän<strong>de</strong>rung = Deckungsbeitrag (DBV) (direkt zurechenbare EK)<br />
= Gewinn / Verlust ./. Fixkosten ./. unechte GK<br />
= Betriebserfolg = DBV O<br />
+ / - Bestandsverän<strong>de</strong>rung ./. direkt zurechenbare<br />
= Gewinn / Verlust Bereitschaftskosten<br />
= DBV II<br />
./. Bereitschaftskosten<br />
= DBV III<br />
Proportionale Kosten <strong>de</strong>s Verlaufs<br />
Brutto-<br />
Fertigungsmaterial K v erlös<br />
Fertigungslöhne Netto- DB DBV<br />
Sonstige variablen Kosten<br />
Erlös<br />
Fixkosten<br />
Gewinn
31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />
WS 98/99<br />
von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />
23<br />
Vollkostenrechnung: E = K G bzw. p * x = K f + k v * x<br />
Kritische Menge: x db = K f / db<br />
Kritischer Preis:<br />
p krit = K f / x + k v<br />
Kritische variablen Kosten: k v krit = p - K f / x<br />
Kritische Fixkosten: k f krit = db * x<br />
Kritische Sicherheitsspanne (x plan – x db ) / x plan * 100<br />
Deckungsumsatz: DPU = U krit = K f / DG<br />
Deckungsgrad:<br />
G = db / p<br />
Kapazitätskoeffizienten KK = DBV / K f<br />
Sicherheitskoeffizienten (U Plan – DPU) / U Plan * 100<br />
Beschäftigungsgrad BG = DPU / U Plan<br />
Sonstiges<br />
Blatt 12.01.99/1<br />
e Verkaufspreis 3,00 DM<br />
- K v Produktionskosten 65' DM 1,30 DM (x p = 50)<br />
Verwaltungs- u. Vertriebskosten 15' DM 0,25 DM (x v = 60)<br />
= db Deckungsbeitrag 1,45 DM<br />
- K f Normalbeschäftigung 84' / 70' 1,20 DM (x n = 70)<br />
= g Gewinn 0,25 DM<br />
Effektive Produktion = 10.000 * 0,5 + 18.000 * 2/3 + 43.000 = 50.000 Stk<br />
FE = UE * Kostenwert<br />
Vertriebssteuerung<br />
Typ A Typ B Typ C Typ D<br />
Geplante Menge 22.000 Stk 25.000 Stk 75.000 Stk 40.000 Stk<br />
Verkaufspreis 5, 455 DM/ Stk 5,60 DM 1,20 DM 1,25 DM<br />
Variable Kosten 4,555 DM/ Stk 2,40 DM 0,40 DM 0,25 DM<br />
fixe Kosten<br />
160.000 DM<br />
Typ db DBV U DG Rangfolge<br />
A 0,90 20.000 120.000 16,7 % 4<br />
B 3,20 80.000 140.000 57,1 % 3<br />
C 0,80 60.000 90.000 66,7 % 2<br />
D 1,00 40.000 50.000 80 % 1<br />
Summe 200.000 400.000<br />
Gewinn = 200.000 - 160.000 = 40.000 DM<br />
r U = 40.000 / 400.000 = 10 %
31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />
WS 98/99<br />
von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />
24<br />
50<br />
0<br />
-50<br />
-100<br />
0 50 140 280 400<br />
DB<br />
DBU<br />
-150<br />
-200<br />
Berechnung<br />
Fixkosten Umsatz<br />
- 160.000 DM<br />
DBV von D 40.000 DM 50.000 DM<br />
- 120.000 DM<br />
DBV von C 60.000 DM 90.000 DM<br />
- 60.000 DM 140.000 DM<br />
DBV von B 80.000 DM 140.000 DM<br />
20.000 DM 280.000 DM<br />
DBV von A 20.000 DM 120.000 DM<br />
40.000 DM 400.000 DM<br />
Umsatzkostenverfahren auf Grenzkosten<br />
Bruttoerlös<br />
./. Erlösschmälerungen<br />
Nettoerlös (= Umsatzerlöse)<br />
./. variable Kosten (Materialkosten + MGK; Fertigungslöhne + FGK; Hilfslöhne;<br />
vertriebsabhängige Kosten)<br />
= Deckungsbeitrag<br />
./. fixe Kosten (Gehälter, Instandhaltung, kalk. Kosten, Verwaltungskosten)<br />
./. Bestandsverän<strong>de</strong>rungen<br />
= Betriebsergebnis (operativer Erfolg)<br />
± neutrales Ergebnis<br />
= Gewinn vor Steuern<br />
Normalkostenrechnung<br />
Ist-Herstellkosten<br />
Ist-Selbstkosten<br />
Ist-Selbstkosten pro Stk.<br />
= K v * (Ist-BG / Normal-BG)<br />
= K v * (Ist-BG / Normal-BG) + K f<br />
= Ist-HK / [(Ist-BG / Normal-BG) * Produktionsmenge]<br />
+ K f / Normalbeschäftigungsmenge
31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />
WS 98/99<br />
von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />
25<br />
Rechnungswesen<br />
• Buchhaltung (FiBu) - gesetzliche Verpflichtung<br />
• Kalkulation – Kostenträgerrechnung<br />
• Erfassung und Bewertung aller Geschäftsvorfälle<br />
• Bilanz, GuV<br />
• Sicherung <strong>de</strong>r Liquidität<br />
• Son<strong>de</strong>rbilanzen bei Fusionen<br />
<strong>Kostenrechnung</strong><br />
→ Ermittlung, in welcher Abteilung/ Produkt man Gewinn macht<br />
Kostenartenrechnung<br />
→ Abgrenzung (zwischen betriebstypisch und –frem<strong>de</strong>n Kosten)<br />
Erfassung (reine betriebswirtschaftliche Bewertungen wie Abschreibungen)<br />
Systematisierung (Einzelkosten und Gemeinkosten)<br />
Kostenstellenrechnung<br />
→ Kosten wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong>n Abteilungen zugeordnet, Verrechnungspreise für Leistungen<br />
untereinan<strong>de</strong>r (innerbetrieblicher Leistungsverrechnung, Kalk. Sätze)<br />
Kostenträgerrechnung (= Kalkulation)<br />
→ wie viel kostet ein Stück und wie viel 1.000 Stk.<br />
Aufgaben <strong>de</strong>s Controllings<br />
• Servicefunktion<br />
• Informationsversorgung <strong>de</strong>s Managements<br />
• Aufbau von Systemen<br />
• Mo<strong>de</strong>ration im Planungsprozess<br />
• betriebswirtschaftliche Kompetenz<br />
• interner Berater<br />
Rechnungsziele <strong>de</strong>r <strong>Kostenrechnung</strong><br />
• Ermittlungsfunktion (Abbildung <strong>de</strong>s Betriebsprozesses, dient als Informationsbasis für<br />
die Disposition-, Planungs- und Kontrollaufgaben<br />
• Lenkungsfunktion (d.h. für die Steuerung <strong>de</strong>s Betriebsprozesses relevanten Daten sind<br />
zur Verfügung zu stellen, Prüfung einer Produktreinigung bzw. verstärkte<br />
Wettbewerbsmaßnahmen eines Produktes)<br />
• Kontrollfunktion (d.h. Kontrolle <strong>de</strong>s Betriebsprozesses. Im Vor<strong>de</strong>rgrund stehen<br />
Kostenvergleiche (Perio<strong>de</strong>n-, Zeitvergleich, Plan-Soll-Ist-Vergleich,<br />
zwischenbetriebliche Vergleiche))<br />
Produktionsfaktoren = alle Sachgüter und Leistungen für Erstellung und Vermarktung für<br />
betriebliche Leistungen<br />
Unternehmung = juristische Einheit
31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />
WS 98/99<br />
von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />
Betrieb<br />
= Ort <strong>de</strong>r Leistungserstellung (Gutenberg sieht dies genau an<strong>de</strong>rs<br />
rum)<br />
26<br />
• systemindifferente<br />
- Kombination von Produktionsfaktoren<br />
- Wirtschaftlichkeitsprinzip<br />
- finanzielles Gleichgewicht<br />
• systembezogene Tatbestän<strong>de</strong><br />
- Autonomieprinzip – Organprinzip<br />
- Privateigentum – Gemeineigentum<br />
- Marktwirtschaft – Planwirtschaft<br />
Determinanten <strong>de</strong>s Betriebstyps<br />
Wirtschaftlichkeit<br />
W = Zielgröße/ Mitteleinsatz => Max-/ Min-Prinzip<br />
1) technische Wirtschaftlichkeit<br />
= Produktivität = Ausbringung an Produkteinheiten / Einsatzmenge eines<br />
Produktionsfaktors<br />
= 6000 Stk / 3000 kg = 25 Stk/ kg<br />
= 20 t / 8 h = 2,5 t/h<br />
2) wertmäßige W.<br />
W = Ertrag/ Aufwand<br />
3) Kostenwirtschaftlichkeit<br />
W = Istkosten / Sollkosten<br />
4) Rentabilität = Gewinn/ eingesetztes Kapital<br />
5) Eigenkapitalrentabilität = Gewinn / EK<br />
6) Umsatzrentabilität = Gewinn / Umsatz<br />
7) Gesamtrentabilität = (Gewinn + Fremdkapitalzinsen) / eingesetztes Gesamtkapital<br />
8) R.O.I. - Return on Investment (Gesamtkapitalrendite)<br />
r = G/K = G/K * U/K<br />
r = Eigenkapitalrentabilität = Umsatzrentabilität * Kapitalumschlag<br />
keine Ausgabe, aber eine Auszahlung:<br />
Auszahlung, aber kein Aufwand:<br />
Ausgabe, aber kein Aufwand:<br />
Kosten, aber kein Aufwand:<br />
Einzahlung, aber keine Einnahme:<br />
Einnahme, aber keine Einzahlung:<br />
Einnahme, aber nicht Ertrag:<br />
Lohnvorschuß<br />
Zieleinkauf<br />
Materialkauf, was nicht in die Fertigung ging<br />
Kalk. Kosten<br />
erhaltene Anzahlung<br />
Verkauf auf Ziel<br />
Verkauf von Lagerware (Leistung nicht in dieser<br />
Perio<strong>de</strong>)
31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />
WS 98/99<br />
von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />
Ertrag, aber nicht Einnahme:<br />
Betriebsertrag, aber nicht Ertrag:<br />
Produktion auf Lager<br />
Erträge wer<strong>de</strong>n an<strong>de</strong>rs bewertet als in <strong>de</strong>r KR<br />
27<br />
Bsp.<br />
Januar Bestellung => kein finanzbuchhalterischer Vorgang<br />
März Lieferung => Ausgabe<br />
April Produktion => Aufwand und Kosten, Ertrag<br />
Juni Zahlung => Auszahlung<br />
Merke:<br />
• Nachzahlung von Steuern nicht zur Perio<strong>de</strong> gehörig<br />
• Nie<strong>de</strong>rstwertprinzip beachten<br />
• LVA => Fertigerzeugnisse<br />
Kalk. Kosten<br />
Berechnung <strong>de</strong>r kalk. Zinsen<br />
1) Ausklammerung nicht betriebsnotwendiger Vermögensteile<br />
2) Ansatz <strong>de</strong>s Umlaufvermögens mit durchschnittlich in einer Perio<strong>de</strong> gebun<strong>de</strong>nen Werten<br />
3) Nicht abnutzbares Anlagevermögen wird mit Wie<strong>de</strong>rbeschaffungspreisen bewertet<br />
4) Berechnungsmetho<strong>de</strong>n für das abnutzbare Anlagevermögen (Durchschnittsverzinsung/<br />
Restwertverzinsung)<br />
Kostenstellenrechnung<br />
Aufgaben <strong>de</strong>r KSt-Rechnung<br />
• Kontrolle <strong>de</strong>r Wirtschaftlichkeit (Kostenkontrolle <strong>de</strong>r Gemeinkosten)<br />
• Bildung von Kalkulationssätzen zur Kalkulation<br />
• Bereitstellung relevanter Kosten für Entscheidungsrechnungen<br />
Bildung von Kostenstellen<br />
• selbständiger Verantwortungsbereich (nur einen Leiter)<br />
• genaue Maßgrößen <strong>de</strong>r Kostenverursachung (Bezugsgrößen)<br />
• Kontierung <strong>de</strong>r Ist-Belege (genaue Zuordnung notwendig => notwendige<br />
Differenzierung)<br />
Beispiele:<br />
Material-, Fertigungs-, Vertriebs-, Verwaltungsstellen und allgemeine Kostenstellen<br />
Nach Art <strong>de</strong>r Abrechnung<br />
• Hauptkostenstellen: ihre Kosten wer<strong>de</strong>n direkt auf die KTR verrechnet<br />
• Hilfskostenstellen: KST, <strong>de</strong>ren Kosten nicht direkt auf KTR, son<strong>de</strong>rn auf an<strong>de</strong>re Hilfso<strong>de</strong>r<br />
Haupt-KST zurechnet wer<strong>de</strong>n ⇒ interne Verrechnungspreise, z.B. für<br />
Gebäu<strong>de</strong>reinigung, Feuerwehr, Kantine<br />
Aufgaben <strong>de</strong>s BAB<br />
BAB = organisatorisches Hilfsmittel für KST, KTR und KA<br />
1. Verteilung <strong>de</strong>r primären Kostenarten auf die Kostenstelle nach <strong>de</strong>m Verursacherprinzip
31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />
WS 98/99<br />
von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />
2. innerbetriebliche Leistungsrechnung<br />
3. Bildung von Kalkulationssätzen<br />
4. Kostenkontrollen<br />
28<br />
Personalnebenkosten<br />
• gesetzliche (SV)<br />
• tarifliche (Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld)<br />
• freiwillige (Mittagessen, Fahrgeld, Betriebsrente für ltd. Angestellte)<br />
Personalkosten = Löhne/ Gehälter ( 1 + PNK/100)<br />
Verfahren <strong>de</strong>r innerbetrieblicher Leistungsverrechnung<br />
• mit Ist-Preisen<br />
− Gleichungsverfahren<br />
− Stufenleiterverfahren<br />
− Anbauverfahren<br />
• mit Verrechnungspreisen<br />
auf Vollkostenbasis o<strong>de</strong>r Grenzkostenbasis<br />
Zweck:<br />
Problematik:<br />
Ziel:<br />
Verteilung <strong>de</strong>r Kosten <strong>de</strong>r Hilfs-KST auf die Haupt-KST, sowie die<br />
Leistungsverrechnung untereinan<strong>de</strong>r durchführen<br />
Inter<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nzenproblem <strong>de</strong>r IBL, d.h. Eigenverbrauch <strong>de</strong>r KST und<br />
Leistungsaustausch <strong>de</strong>r Hilfs-KST untereinan<strong>de</strong>r<br />
Ermittlung von Verrechnungspreisen für je<strong>de</strong> Leistungseinheit einer Hilfs-<br />
KST<br />
Gleichstellungsverfahren<br />
insgesamt Kostensatz = primäre Kosten <strong>de</strong>r Hilfs-KST<br />
erstellte LE * für eine LE = + sekundäre Kosten <strong>de</strong>r Hilfs-KST<br />
<strong>de</strong>r Hilfs-KST dieser Hilfs-KST (die von an<strong>de</strong>ren KST empfangenen<br />
Leistungen bewertet mit <strong>de</strong>ren Kostenansatz)<br />
z.B.<br />
KST 1:<br />
500 q1 = 2800 DM + 50q2 +5 q3<br />
300 q2 = 1500 DM + 20q1 + 5q3<br />
100 q3 = 2400 DM + 40q1 + 200q2<br />
Stufenleiterverfahren<br />
Es wird eine Hilfs-KST mit wenig Leistungsempfang herausgesucht. Diese wird zunächst auf<br />
die an<strong>de</strong>ren Stellen verrechnet. Danach wird die zweite abgerechnet etc.<br />
Schritte<br />
KST 1<br />
KST 2<br />
= Primäre GK <strong>de</strong>r KST 1/ (erstellte Leistungseinheiten - Eigenverbrauch)<br />
= (primäre GK <strong>de</strong>r KST 2 + bewertete Leistungen <strong>de</strong>r vorherigen KST)<br />
-----------------------------------------------------------------------------------------<br />
(erstellte Leistungseinheiten <strong>de</strong>r KST 2 - Leistungen an die schon
31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />
WS 98/99<br />
von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />
abgerechneten KST inkl. Eigenverbrauch)<br />
29<br />
z.B.<br />
Hilfs-KST1 = 2.800 DM / 500 m² = 5,60 DM/ m²<br />
Hilfs-KST2 = [1.500 DM + (20*5,6 DM)] / [200 t- 50 t] = 10,75 DM/ t<br />
Hilfs-KST3 = [1.400 DM + (40 * 5,6 DM) + (100 * 10,75 DM)] / [100 - 5- 5] = 41,10 DM<br />
Kritik:<br />
• Keine genauen Ergebnisse, da Inter<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nzen <strong>de</strong>s Leistungsaustausches vernachlässigt<br />
wird<br />
• Anordnungsproblem<br />
• Wenig Aufwand, wird in <strong>de</strong>r Praxis angewen<strong>de</strong>t, wenn kaum Fehler durch geringen<br />
Leistungsaustausch vorkommen)<br />
Anbauverfahren<br />
Völlige Vernachlässigung <strong>de</strong>s Leistungsaustausches zwischen <strong>de</strong>n Hilfsstellen.<br />
KST = primäre Kosten <strong>de</strong>r KST / an Haupt-KST abgegebene Leistungen<br />
Kritik:<br />
• Sehr grobes Verfahren, <strong>de</strong>swegen nur dann vertretbar, wenn <strong>de</strong>r Leistungsaustausch unter<br />
<strong>de</strong>n Hilfs-KST kaum ins Gewicht fällt<br />
Festpreisverfahren<br />
Metho<strong>de</strong>n:<br />
• Als Normpreis (als Durchschnittssatz <strong>de</strong>r vergangenen Metho<strong>de</strong>n abzuleiten)<br />
• Als Plankostensatz (aus <strong>de</strong>r Kostenplanung abgeleitet)<br />
Auf Vollkostenbasis: umfasst auch die fixen Kosten<br />
Auf Grenzkostenbasis: nur die variablen Kosten. Die fixen Kosten wer<strong>de</strong>n dann direkt ins<br />
Betriebsergebnis gebucht<br />
z.B.<br />
KST 1 2 3<br />
Su primäre Kosten 2.800 DM 1.500 DM 2.400 DM<br />
Grundstücke 112 DM 224 DM<br />
Dampferzeugung<br />
1.075 DM<br />
Reparaturwerkstatt<br />
SU sekundäre Kosten 0 DM 112 DM 1.299 DM<br />
SU Gesamtkosten 2.800 DM 1.612 DM 3.699 DM<br />
Kostenansatz 5,60 DM 10,75 DM 41,10 DM<br />
Plan Kostenansatz 6,50 DM 9,00 DM 36,00 DM
31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />
WS 98/99<br />
von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />
Merke:<br />
• Mehr verrechnet als angefallen => Über<strong>de</strong>ckung (-)<br />
30<br />
Bildung von Kalkulationssätzen<br />
Kalkulationssatz <strong>de</strong>r KST = Gesamtkosten / Bezugsgröße<br />
Gesamtkosten: (Ist-, Normal, Plan- / Voll-, Teil-, Grenzkosten)<br />
Bezugsgrößen : Wertgrößen (DM/DM = %) o<strong>de</strong>r Mengengrößen (DM/Mengeneinheit)<br />
Kostenkontrolle<br />
Normal-KR: Gegenüberstellung von Ist-Kosten und verrechneten Normalkosten<br />
Plan-KR: Gegenüberstellung von Ist-Kosten und Sollkosten bzw. Plankosten<br />
Die entstehen<strong>de</strong>n Differenzen sind Über- bzw. Unter<strong>de</strong>ckungen, welche die Schwankungen<br />
<strong>de</strong>r Kosten um einen verrechneten Durchschnittswert ausweisen.<br />
Für die Kostenkontrolle ist auf <strong>de</strong>n einzelnen KST eine Aufglie<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Gesamtabweichung<br />
in Preis-, Beschäftigungs- und Verbrauchsabweichungen erfor<strong>de</strong>rlich. Allerdings müssen vor<br />
<strong>de</strong>r Kostenkontrolle die Kosten in fixe und variable Bestandteile aufgelöst wer<strong>de</strong>n.<br />
Verfahren <strong>de</strong>r Kostenauflösung<br />
‣Buchtechnische Analyse<br />
Der Fixkostenanteil wird dadurch bestimmt, in<strong>de</strong>m man überprüft, welcher Anteil <strong>de</strong>r<br />
Kostenart in <strong>de</strong>r KST bei Rückgang <strong>de</strong>r Beschäftigung gegen null anfällt.<br />
Mischkostenarten<br />
Abschreibungen wer<strong>de</strong>n in Gebrauchsverschleiß (K v ) und Zeitverschleiß (K f ) bestimmt.<br />
Abschreibungsrate = AK / Zeitverschleiß + (AK / Gebrauchsverschleiß - AK/<br />
Zeitverschleiß)<br />
Weitere Mischkostenarten sind Energiekosten, Reparaturen und Betriebsstoffe.<br />
‣Hoch-Tiefpunkt-Verfahren<br />
Die variablen Kosten erhält man durch das Hoch-Tiefpunkt-Verfahren:<br />
K v = (KG2 - KG1) / (x2 - x1).<br />
‣Metho<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Reihenhälften<br />
Vorgehensweise wie beim Hoch-Tiefpunkt-Verfahren. Aber vorher Durchschnittsbildung<br />
aus <strong>de</strong>n Werten eines gesamten Jahres durch die Bildung von zwei Reihenhälften, d.h. <strong>de</strong>n<br />
Durchschnitt <strong>de</strong>r sechs Monaten mit <strong>de</strong>n höchsten Kosten und <strong>de</strong>n <strong>de</strong>r mit <strong>de</strong>n niedrigsten<br />
Kosten bil<strong>de</strong>n.<br />
‣Streupunktdiagramme<br />
‣Metho<strong>de</strong> <strong>de</strong>r kleinsten Quadrate
31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />
WS 98/99<br />
von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />
31<br />
Ermittlung <strong>de</strong>r Herstellkosten <strong>de</strong>s Umsatzes<br />
Herstellkosten <strong>de</strong>r Fertigung<br />
./. Son<strong>de</strong>reinzelkosten <strong>de</strong>r Fertigung<br />
./. aktivierte Eigenleistung<br />
./. Bestandszugang <strong>de</strong>r unfertigen Erzeugnisse<br />
+ Bestandsabgang <strong>de</strong>r UE<br />
= Herstellkosten <strong>de</strong>r Fertigerzeugnisse<br />
./. Bestandszugang <strong>de</strong>r Fertigerzeugnisse<br />
+ Bestandsabgang <strong>de</strong>r FE<br />
= Herstellkosten <strong>de</strong>s Umsatzes<br />
Kostenträgerrechnung<br />
Aufgaben <strong>de</strong>r Kostenträgerrechnung<br />
• Bewertung <strong>de</strong>r Bestän<strong>de</strong><br />
• Ermittlung relevanter Daten für Entscheidungen<br />
• Ermittlung <strong>de</strong>r Ausgangsdaten für die Planungsrechnung<br />
• Preisbildung<br />
Merke:<br />
• KSR: Herstellkosten Bil: Herstellungskosten<br />
• Son<strong>de</strong>reinzelkosten kann man nicht einem einzigen Stück, aber einem einzigen Auftrag<br />
zuordnen.<br />
• Verkaufspackung = Materialkosten in <strong>de</strong>r KR, aber nicht im Sinne <strong>de</strong>s HR<br />
• Umsatzprovision wird auf <strong>de</strong>r Basis <strong>de</strong>s Barverkaufspreises ermittelt<br />
• bei Massenprodukten: genaue Rechnung mit Kommastellen<br />
bei Auftragsprodukten: run<strong>de</strong>n möglich<br />
• Trotz Kalkulation <strong>de</strong>s Preises habe ich nicht <strong>de</strong>n Verkaufspreis ermittelt, weil diesen<br />
meistens <strong>de</strong>r Markt bestimmt.<br />
Verkaufspreiskalkulation<br />
Selbstkosten<br />
+ kalkulatorischer Gewinn<br />
= Basisverkaufspreis<br />
+ Umsatzprovision<br />
= Barverkaufspreis<br />
+ Kun<strong>de</strong>nskonti<br />
= Zielverkaufspreis<br />
+ Kun<strong>de</strong>nrabatte<br />
= Netto-Angebotspreis
31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />
WS 98/99<br />
von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />
32<br />
Preistreppe bei öffentlichen Aufträgen<br />
• Marktpreise (PC-Computer)<br />
• Selbstkostenpreise, verbindlich auf Basis einer Vorkalkulation. Sie sind vorrangig zu<br />
vereinbaren (z.B. Ein Festpreis für olivfarbene Pullover für die Bun<strong>de</strong>swehr wird<br />
vereinbart); Gefahr: Mehrkosten<br />
• Selbstkostenrichtpreise, die auf einer Vorkalkulation basieren. Vor Beendigung <strong>de</strong>s<br />
Auftrages sind sie in einer neuen Verhandlung in einen Fest- o<strong>de</strong>r Erstattungspreis zu<br />
überführen (z.B. Jäger 90 - bei teuren Projekten, die meist eine lange Entwicklungszeit<br />
haben, wer<strong>de</strong>n immer nur Projektstufen freigegeben)<br />
• Selbstkostenerstattungspreise wer<strong>de</strong>n aufgrund einer Nachkalkulation erstattet.<br />
Selbstkosten + Gewinn erhält man. Diese Metho<strong>de</strong> wird nur angewen<strong>de</strong>t, wenn es nicht<br />
an<strong>de</strong>rs möglich (Geräte für <strong>de</strong>n Weltraum)<br />
Bei <strong>de</strong>r Kalkulation <strong>de</strong>r Selbstkosten nach LSP han<strong>de</strong>lt es sich um eine Vollkostenkalkulation<br />
(k f + k v ) Mengen- und Wertansätze (Abschreibungen, Zinsen und kalk. Kosten) sind in <strong>de</strong>n<br />
Richtlinien <strong>de</strong>r LSP festgelegt. Die LSP geht weiterhin meistens von Istkosten aus. Bei<br />
Anwendung einer Normal- o<strong>de</strong>r Plankostenrechnung können Unter<strong>de</strong>ckungen o<strong>de</strong>r<br />
Abweichungen berücksichtigt, wenn diese nachgewiesen wer<strong>de</strong>n kann.<br />
Preisuntergrenzen als Hilfsmittel für die Festlegung von Marktpreisen<br />
Einflussfaktoren bei <strong>de</strong>r Preisbildung<br />
• Selbstkosten<br />
• Wettbewerb<br />
• Nachfrageelastizität<br />
• Transparenz <strong>de</strong>r Märkte<br />
Arten <strong>de</strong>r Preisuntergrenze<br />
• erfolgsbezogene kurzfristige Preisuntergrenze (= Deckung <strong>de</strong>s DBV)<br />
• erfolgsbezogene langfristige Preisuntergrenze (= Deckung <strong>de</strong>r Vollkosten)<br />
• liquiditätsbezogene (kfr, lfr) Preisuntergrenze (= liquitätswirksame Kosten)<br />
Die absolut kurzfristige Preisuntergrenze beinhaltet die Grenzselbstkosten, sofern frei<br />
Kapazitäten vorhan<strong>de</strong>n sind.<br />
Beispiel von S. 44<br />
K f = 13.000 DM/ Monat<br />
k v = 3,50 DM<br />
Kapazität = 43.000 min<br />
Produktart Menge Preis Masch. Beanspruchung<br />
A 5.000 Stk 15,00 DM/ Stk 3 min/ Stk<br />
B 7.000 Stk 16,00 DM/ Stk 4 min/ Stk<br />
a) Zusatzauftrag (C) = 2.000 Stk zu 25 DM/ Stk bei 6 min Maschinenbeanspruchung<br />
DBV A = 15 - 3,50 *3 = 4,50 DM
31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />
WS 98/99<br />
von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />
DBV B = 16 - 3,50 * 4 = 2,00 DM<br />
DBV C = 25 - 3,50 * 6 = 4,00 DM<br />
=> bei Annahme <strong>de</strong>s Zusatzauftrages muss ich von <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren weniger produzieren,<br />
wodurch ich keinen wirtschaftlichen Nachteil haben darf.<br />
33<br />
relativer DBV => DM/ Min<br />
Produkt A = 4,50 DM / 3 = 1,50 DM / min<br />
Produkt B = 2,00 DM / 4 = 0,50 DM / min<br />
Produkt C = 4,00 DM / 6 = 0,66 DM / min<br />
=> folglich verzichte ich auf eine Teilproduktion von B. Ich benötige für C 12.000 min,<br />
folglich habe ich noch eine freie Kapazität von 16.000 min (4 * 7000 - 6 * 2000). Das<br />
be<strong>de</strong>utet, dass ich vom Produkt B noch 4.000 Stk herstellen kann.<br />
Der Zusatzauftrag muss also eine Preisuntergrenze haben<br />
k v = 6 min * 3,50 DM = 21,00 DM<br />
+ Opportunitätskosten: 6.000 DM : 2000 Stk = 3,00 DM<br />
=> Preisuntergrenze = 24,00 DM, folglich nehmen wir <strong>de</strong>n Auftrag bei 25,00 DM<br />
Verkaufspreis an.<br />
Opportunitätskosten = DBV B * verzichtete Menge<br />
bei freien Kapazitäten ist je<strong>de</strong>r Auftrag interessant, <strong>de</strong>r einen positiven DB bringt.<br />
bei ausgelasteten Kapazitäten bestimmt <strong>de</strong>r relativer DB meine Entscheidung (die<br />
Opportunitätskosten müssen ge<strong>de</strong>ckt wer<strong>de</strong>n)<br />
Kalkulation und Bestandsbewertung<br />
interne Bewertung: frei von Vorschriften<br />
externe Bewertung: HK<br />
Pflichtbestandteile<br />
Materialeinzelkosten<br />
+ Fertigeinzelkosten<br />
+ Son<strong>de</strong>reinzelkosten <strong>de</strong>r Fertigung<br />
------------------------------------------<br />
= Wertuntergrenze <strong>de</strong>r HK<br />
Kannbestandteile:<br />
+ Materialgemeinkosten<br />
+ Fertigungsgemeinkosten<br />
+ Abschreibungen<br />
+ Allg. Verwaltungskosten<br />
+ Aufw. für soziale Einrichtungen (freiwillige u. soziale Leistungen) und Altersversorgung<br />
---------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
= Wertobergrenze <strong>de</strong>r HK
31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />
WS 98/99<br />
von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />
34<br />
Kalkulationsverfahren<br />
Rechentechnik zur Bestimmung <strong>de</strong>r HK o<strong>de</strong>r SK<br />
1) Divisionskalkulation<br />
• einfache Divisionskalkulation<br />
• mehrstufige Divisionskalkulation<br />
• mehrfache Divisionskalkulation<br />
• Äquivalenzziffernrechnung<br />
2) Zuschlagskalkulation<br />
Massenfertigung:<br />
Sortenfertigung:<br />
Serienfertigung:<br />
Einzelfertigung:<br />
Divisionskalkulation<br />
Divisions-, Äquivalenzziffern-, Zuschlags- und Bezugsgrößenkalkulation<br />
Äquivalenzziffern-, Zuschlags- und Bezugsgrößenkalkulation<br />
Zuschlags- und Bezugsgrößenkalkulation<br />
Einfache Divisionskalkulation<br />
Selbstkosten = gesamte Kosten einer Perio<strong>de</strong> / Ausbringungsmenge <strong>de</strong>r Perio<strong>de</strong><br />
Voraussetzung:<br />
• keine Bestandsverän<strong>de</strong>rung<br />
• Ein-Produktunternehmen<br />
Das Unternehmen Y ist ein Ein-Produktunternehmen, welches ausschließlich <strong>de</strong>n Artikel A<br />
herstellt. Es sind für 12.000 Stk dieses Artikels angefallen:<br />
MK<br />
150.000 DM<br />
FL<br />
225.000 DM<br />
Hilfsmaterial<br />
40.000 DM<br />
div. kalk. Kosten<br />
25.000 DM<br />
Verwaltungskosten 140.000 DM<br />
Vertriebskosten<br />
110.000 DM<br />
Die Herstellmenge entspricht <strong>de</strong>r Absatzmenge. Wie hoch wäre <strong>de</strong>r Angebotspreis für <strong>de</strong>n<br />
Artikel bei einem Gewinnaufschlag von 20 %?<br />
SK = 690.000 DM / 12.000 Stk = 57,50 DM<br />
SK<br />
57,50 DM<br />
+ 20 % Gewinn 11,50 DM<br />
--------------------------------------------------<br />
Angebotspreis<br />
69,00 DM<br />
Einfache, mehrstufige Divisionskalkulation<br />
Absatzmenge ≠ Produktionsmenge<br />
HK / Produktionsmenge und VVGK / Absatzmenge
31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />
WS 98/99<br />
von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />
35<br />
Das Unternehmen Z ist ein Ein-Produktunternehmen, welches <strong>de</strong>n Artikel B herstellt.<br />
Folgen<strong>de</strong> Kosten sind angefallen:<br />
Rohmaterial<br />
50.000 DM<br />
Fertigungskosten 1 75.000 DM<br />
Fertigungskosten 2 40.000 DM<br />
Stromkosten für Fertigung 30.000 DM<br />
Verwaltungskosten 45.000 DM<br />
Vertriebskosten<br />
70.000 DM<br />
In <strong>de</strong>r Perio<strong>de</strong> wur<strong>de</strong>n 15.000 Stk produziert, aber nur 11.500 Stk abgesetzt. Es besteht ein<br />
Fertigwarenlager. Wie hoch sind die Herstell- und Selbstkosten je Stk?<br />
HK =<br />
VtK + VwK =<br />
210.000 DM<br />
115.000 DM<br />
HK = 210.000/ 15.000 = 14,00 DM/ Stk<br />
VW = 115.000 / 11.500 = 10,00 DM/ Stk<br />
-------------------------------------------------<br />
Selbstkosten<br />
24 DM/ Stk<br />
mehrstufige Divisionskalkulation<br />
Die Herstellkosten je<strong>de</strong>r Stufe wer<strong>de</strong>n durch die Fertigungsmenge <strong>de</strong>r Stufe dividiert, die<br />
Verwaltungs- und Vertriebskosten wer<strong>de</strong>n durch die Absatzmenge dividiert.<br />
Absatz: 450 Stk<br />
Lagerungsprozesse Lageranfangsbestand Lagerendbestand Kosten<br />
Fertigungsstufe 1 100 Stk 180 Stk 5.280 DM<br />
Fertigungsstufe 2 100 Stk 100 Stk 5.400 DM<br />
Fertigungsstufe 3 200 Stk 150 Stk 6.000 DM<br />
Ferner wur<strong>de</strong>n 3.375 DM Verwaltungs- und Vertriebskosten in <strong>de</strong>r Abrechnungsperio<strong>de</strong><br />
gemessen, die <strong>de</strong>n abgesetzten Erzeugnissen angelastet wer<strong>de</strong>n.<br />
Ermitteln Sie die Herstellkosten pro Stk. und die Selbstkosten pro Stk.<br />
III AB + Zu - EB = V<br />
200 + 400 - 150 = 450<br />
II 100 + 400 - 100 = 400<br />
I 100 + 480 - 180 = 400<br />
k HI = 5.280 DM / 480 Stk = 11 DM/ Stk<br />
k HII = (400 * 11 + 5.400 DM) / 400 Stk = 24,50 DM /Stk<br />
k HIII = (400 * 24,50 + 6.000 DM) / 400 Stk = 39,50 DM/ Stk<br />
k Hg = (400 * 39,50 + 3.375 DM) / 450 Stk = 47,00 DM/ Stk
31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />
WS 98/99<br />
von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />
36<br />
Beispiel<br />
1. Stufe<br />
Rohstoffeinsatz<br />
Bearbeitungskosten<br />
Ausbringungsmenge<br />
2. Stufe<br />
Bearbeitungskosten<br />
Einsatzmenge<br />
Ausbringungsmenge<br />
3. Stufe<br />
Bearbeitungskosten<br />
Einsatzmenge<br />
Ausbringungsmenge<br />
4. Stufe<br />
Bearbeitungskosten<br />
Einsatzmenge<br />
Ausbringungsmenge<br />
Absatzmenge:<br />
Vt + Vw<br />
Son<strong>de</strong>reinzelkosten <strong>de</strong>s Vt<br />
30.000 DM<br />
10.000 DM<br />
5.000 kg<br />
28.400 DM<br />
4.000 kg<br />
3.800 kg<br />
47.025DM<br />
5.700 kg<br />
5.985 kg<br />
16.836 DM<br />
6.900 kg<br />
6.762 kg<br />
6.500 Stk<br />
9.750 DM<br />
0,50 DM<br />
Lagerbewegungen<br />
Zwischenlager 1 + 1.000 kg Bestandserhöhung<br />
Zwischenlager 2 - 1.900 kg Bestandsmin<strong>de</strong>rung<br />
Zwischenlager 3<br />
- 915 kg<br />
Fertigwarenlager<br />
262 kg<br />
Herstellkosten pro Stk<br />
S 1= 50.000 DM / 5.000 kg = 10 DM/ kg<br />
S 2= (4.000 kg * 10 DM + 28.400) / 3.800 kg = 18 DM/ kg<br />
S 3= (5.700 kg * 18 DM + 47.025 DM) / 5985 kg = 25 DM/ kg<br />
S 4= (6.900 kg * 25 DM + 16.836 DM) / 6.762 kg = 28 DM/ kg<br />
=> Die Stückherstellkosten betragen 28 DM/ kg<br />
Stückherstellkosten 28,00 DM<br />
VtGK + VwGK 1,50 DM (9.750: 6.500)<br />
Son<strong>de</strong>reinzelkosten <strong>de</strong>s Vt 0,50 DM<br />
-------------------------------------------------<br />
Stückselbstkosten<br />
30,00 DM
31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />
WS 98/99<br />
von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />
37<br />
Wert <strong>de</strong>r Bestandsverän<strong>de</strong>rungen<br />
Lagerart Menge Einheitspreis DM-Betrag<br />
Zwischenlager 1 1.000 kg 10 DM 10.000 DM<br />
Zwischenlager 1 1.900 kg 18 DM 34.200 DM<br />
Zwischenlager 1 915 kg 25 DM 22.875 DM<br />
Fertiglager 262 kg 28 DM 7.336 DM<br />
Wenn Divisionskalkulation in <strong>de</strong>r Klausur, dann solch eine !!!<br />
mehrfache Divisionskalkulation<br />
Vorgehensweise:<br />
1. Herstellkosten <strong>de</strong>r Fertigung für alle Produkte ermitteln<br />
2. Zuschlag <strong>de</strong>r Verwaltungs- und Gemeinkosten auf <strong>de</strong>r Grundlage <strong>de</strong>r Herstellkosten <strong>de</strong>s<br />
Umsatzes ermitteln<br />
3. Den Zuschlagssatz auf alle Produkte anwen<strong>de</strong>n<br />
Eimer Gießkannen Schüsseln<br />
Herstellkosten 309.000 DM 177.500 DM 92.000 DM<br />
Vw + Vt 76.000 DM 20.700 DM 23.000 DM<br />
Lagerbestand am 01.01 0 Stk 0 Stk 0 Stk<br />
Produktion 412.000 Stk 71.000 Stk 230.000 Stk<br />
Lagerbestand am 31.12 32.000 Stk 2.000 Stk 0 Stk<br />
a) hk?<br />
b) sk?<br />
Eimer Gießkannen Schüsseln<br />
hk (DM / Stk) 309.000/ 412.000<br />
= 0,75 DM<br />
177.500 / 71.000<br />
= 2,50 DM<br />
92.000 / 230.000<br />
= 0,40 DM<br />
abgesetzte Menge 380.000 Stk 69.000 Stk 230.000 Stk<br />
k Vt, Vw 76.000 / 380.000<br />
= 0,20 DM<br />
20.700 / 69.000<br />
= 0, 30 DM<br />
23.000 / 230.000<br />
= 0,10 DM<br />
sk 0,95 DM 2,80 DM 0,50 DM<br />
Äquivalenzziffernkalkulation<br />
Voraussetzung:<br />
• Artähnliche Produkte<br />
• Keine Lagerbestandsverän<strong>de</strong>rungen<br />
Kostensatz je Einheitssorte = Gesamtkosten / (Produktionsmenge * Äquivalenzziffer)<br />
Kostensatz je Sorte = Kosten <strong>de</strong>r Einheitssorte * Äquivalenzziffer<br />
Zuschlagkalkulation<br />
Lohnzuschlagskalkulation<br />
= Ermittlung <strong>de</strong>s FGK-Satzes
31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />
WS 98/99<br />
von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />
Differenz. Betriebszuschlagkalkulation<br />
Kostenstellenzuschlagskalkulation<br />
Bezugsgrößenkalkulation<br />
= FGK wird noch mal in material- und fertigungsstun<strong>de</strong>nabhängig<br />
unterteilt<br />
= Zuschläge auf die einzelnen Kostenstellen<br />
= Summe einer KST / Bezugsgröße <strong>de</strong>r KST (Stun<strong>de</strong>n, Stk etc.)<br />
Maschinenstun<strong>de</strong>nsatzrechnung<br />
Einsatz in Fertigungskostenstellen, in <strong>de</strong>nen Maschinen unterschiedlicher Kostenstruktur<br />
stehen. Die KST-Kosten wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong>shalb in maschinenstun<strong>de</strong>nabhängige und sonstige<br />
Gemeinkosten aufgeteilt.<br />
38<br />
Maschinenstun<strong>de</strong>nsatz = maschinenstun<strong>de</strong>nabhängige Kosten /<br />
Maschinenlaufstun<strong>de</strong>n<br />
Drehbänke<br />
Fräserei<br />
Schleiferei<br />
I) mechanische Bearbeitung => 1 KST ≅ 1 Kostensatz = DM/ Bearbeitungsminute<br />
Problem: Ungenauigkeit<br />
Lösung: Maschinenstun<strong>de</strong>nsätze + pauschaler Zuschlag für die restlichen Kosten<br />
II) differenzierte KST (= für je<strong>de</strong> eigene KST ≅ eigener Kostensatz)<br />
1. DM/ Drehminute<br />
2. DM/ Fräsminute<br />
3. DM/ Schleifminute<br />
Kuppelprodukte<br />
Kuppelproduktion = Produktionsprozesse, bei <strong>de</strong>nen zwangsweise mehrere Erzeugnisse<br />
gleichzeitig entstehen<br />
Beispiele:<br />
• Kokerei - Koks, Gas, Teer<br />
• Molkerei - Milch, Käse, Fette (mehrfache)<br />
• Raffinerien - Benzin, Öle, Gase<br />
Problem: Aufteilung <strong>de</strong>r Kosten nach <strong>de</strong>m Verursacherprinzip nicht möglich<br />
Rechenverfahren<br />
‣Restwertrechnung (ein Hauptprodukte mit mehreren Nebenprodukten)<br />
Kosten <strong>de</strong>s Hauptproduktes = Gesamtkosten - Nettoerlöse <strong>de</strong>r Nebenprodukte<br />
-------------------------------------------------------------<br />
Menge <strong>de</strong>r Hauptprodukte<br />
Anschließend Divisionskalkulation<br />
Anmerkung: Wertansatz <strong>de</strong>r Nebenprodukte sind die Marktpreise<br />
‣Kostenverteilungsmetho<strong>de</strong>/<br />
Keine Unterscheidung in Haupt und Nebenprodukte, statt <strong>de</strong>ssen wird die<br />
Äquivalenzziffermetho<strong>de</strong> angewandt
31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />
WS 98/99<br />
von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />
39<br />
Aufg)<br />
Produkt Marktpreis Menge Recheneinheit Gesamtkosten pro Stück Stückgewinn<br />
A 100 DM 1.000 100.000 90.000 DM 90 DM 10 DM<br />
B 60 DM 500 30.000 27.000 DM 54 DM 6 DM<br />
C 30 DM 600 18.000 16.200 DM 27 DM 3 DM<br />
D 10 DM 200 2.000 1.800 DM 9 DM 1 DM<br />
Summe 150.000 135.000 DM<br />
Faktor = 135.000 / 150.000 = 0,9<br />
a) Berechnen Sie die Selbstkosten <strong>de</strong>r einzelnen Produkte nach <strong>de</strong>r<br />
Marktpreisäquivalenzziffernmetho<strong>de</strong>.<br />
b) Welche Aussagekraft haben auf dieser Grundlage ermittelten Stückgewinne <strong>de</strong>r<br />
Erzeugnisse.<br />
=> keine Aussagekraft, da gleichmäßige Verteilung<br />
c) Angenommen für die drei Nebenprodukte fallen zusätzlich Weiterverarbeitungskosten von<br />
2.000 für B, 1.500 für C und 500 DM für D an. Wie hoch ist <strong>de</strong>r Stückgewinn für Produkt A<br />
nach <strong>de</strong>r Restwertmetho<strong>de</strong>?<br />
Hauptprodukte = A<br />
Kosten <strong>de</strong>s Prozesses 135.000 DM<br />
./. Nettoerlöse Nebenprodukte 46.000 DM<br />
--------------------------------------------------------<br />
Restwert<br />
89.000 DM: 1.000 Stk<br />
Stückgewinn<br />
89 DM<br />
Die kurzfristige Erfolgsrechnung<br />
KA<br />
FiBu ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ KA-Rechnung Einzelkosten<br />
Gemeinkosten<br />
KSt-Rechnung<br />
BAB<br />
=> IBL<br />
Kostensätze<br />
Betriebsergebnisrechnung<br />
KTK-Rechnung/ Kalkulation<br />
kurzfristige Erfolgsrechnung<br />
Erlöse<br />
Gewinn/ Betriebsgewinn
31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />
WS 98/99<br />
von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />
FiBu<br />
GuV<br />
40<br />
Gesamtkostenverfahren<br />
• wird ausschließlich auf Vollkostenbasis durchgeführt<br />
• Bestandsverän<strong>de</strong>rung wird durch eine permanente Inventur ermittelt<br />
• Erfolgsbeitrag/ Erfolgsdifferenzierung ist aus dieser Metho<strong>de</strong> nicht erfor<strong>de</strong>rlich<br />
• Verfahren nur für Einprodukt-Unternehmen geeignet (siehe Kritik)<br />
Ermittlung <strong>de</strong>s Betriebserfolgs<br />
Umsatz<br />
+/- Bestandsverän<strong>de</strong>rungen<br />
+ aktivierte Eigenleistungen<br />
./. gesamte Kosten<br />
Darstellung in Kontenform<br />
Kosten nach KA und Leistungen nach KTR<br />
Kritik<br />
+ Aufbau wie Glie<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r GuV <strong>de</strong>r Finanzbuchhaltung (ohne neutrales Ergebnis)<br />
+ Einfache Integration in Kontensystem möglich<br />
+ Einfacher Aufbau, da sich Gesamtkosten direkte <strong>de</strong>r Kostenartenrechnung entnehmen<br />
lassen<br />
- monatliche Ermittlung <strong>de</strong>r Bestandsverän<strong>de</strong>rungen erfor<strong>de</strong>rlich<br />
- Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung erfor<strong>de</strong>rlich, um Bewertung <strong>de</strong>r UE und FE<br />
sowie <strong>de</strong>r aktivierten Eigenleistung vorzunehmen<br />
- Keine aussagekräftige Transparenz über <strong>de</strong>n Erfolg <strong>de</strong>r einzelnen Produkte<br />
Umsatzkostenverfahren<br />
• kann auf Vollkostenbasis und Grenzkostenbasis durchgeführt wer<strong>de</strong>n<br />
• nur <strong>de</strong>r Umsatz und <strong>de</strong>ren zugeordneten Kosten wer<strong>de</strong>n für <strong>de</strong>n Betriebserfolg benötigt<br />
• Bestandsverän<strong>de</strong>rung wird nicht berücksichtigt, also ist eine Inventur nicht nötig<br />
Ermittlung <strong>de</strong>s Betriebserfolgs auf Vollkostenbasis<br />
= Umsatzerlöse - Kosten <strong>de</strong>r abgesetzten Erzeugnisse<br />
Darstellung in Kontenform: nur nach KTR<br />
Kritik:<br />
+ Keine Inventur und Bestandsrechnung notwendig<br />
+ Produktorientierter Erfolgsausweis<br />
+ Aussagekräftigkeit <strong>de</strong>r Erfolgsträchtigkeit <strong>de</strong>r einzelnen Produkte ist gegeben<br />
- Keine Übereinstimmung in <strong>de</strong>r Glie<strong>de</strong>rung mit <strong>de</strong>r GuV <strong>de</strong>r FiBu<br />
- KSt-Rechnung und KTr-Rechnung erfor<strong>de</strong>rlich<br />
- Bei kurzfristigen Entscheidungen stellen die Vollkosten keine geeignete Dispositionshilfe<br />
dar, da die Fixkosten oft keine relevanten Kosten sind<br />
Ermittlung <strong>de</strong>s Betriebserfolgs auf Grenzkostenbasis<br />
= Deckungsbeitrag - fixe Kosten
31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />
WS 98/99<br />
von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />
41<br />
Die Ergebnisse <strong>de</strong>s Umsatzkostenverfahrens auf Vollkostenbasis stimmt nicht mit <strong>de</strong>m auf<br />
Grenzkostenbasis überein, wenn Produktionsmenge von <strong>de</strong>r Absatzmenge abweicht! Also, nur<br />
dann, wenn keine Bestandsverän<strong>de</strong>rungen vorliegen.<br />
Kritik:<br />
+ Nur durch <strong>de</strong>n Deckungsbeitrag kann man erkennen, ob sich ein Produkt lohnt o<strong>de</strong>r nicht<br />
- Nicht für Saisonartikel geeignet<br />
<strong>Kostenrechnung</strong>ssysteme<br />
Istkostenrechnung<br />
Istkosten = Kosten, die in einer Perio<strong>de</strong> effektiv angefallen sind = Istmenge * Istpreis<br />
Allerdings ist eine reine Istkostenrechnung aufgrund <strong>de</strong>r kalkulatorischen Abgrenzungen und <strong>de</strong>r antizipativen<br />
Abgrenzungen ( Abgrenzung von Kosten und Auszahlung) nicht möglich.<br />
Zielsetzung: lückenlose Überwälzung <strong>de</strong>r erfassten Istkosten auf die Kostenträger, d.h. <strong>de</strong>r Schwerpunkt liegt in<br />
<strong>de</strong>r Nachkalkulation.<br />
Kritik:<br />
- Keine Möglichkeit für eine laufen<strong>de</strong> Kostenkontrolle<br />
- Schwanken<strong>de</strong> Ergebnisse <strong>de</strong>r Nachkalkulation können nicht auf Ursachen zurückgeführt wer<strong>de</strong>n<br />
- Istkosten sind Vergangenheitswerte, und somit nicht zukunftsgerichtet<br />
Istkostenrechnung bei Verwendung von fester Verrechnungspreise<br />
Feste Verrechnungspreise geben die Möglichkeit, eine Kostenkontrolle durchzuführen.<br />
Normalkostenrechnung<br />
Da man monatlich die Istsätze für <strong>de</strong>n Leistungsaustausch neu ermitteln musste, ging man auf feste<br />
Verrechnungspreise über, wodurch <strong>de</strong>r Grundsatz <strong>de</strong>r vollständigen Kostenüberwälzung aufgegeben wur<strong>de</strong>. Dies<br />
hatte folgen<strong>de</strong> Auswirkungen:<br />
• Vereinfachung <strong>de</strong>r Abrechnung<br />
• Bessere Vergleichbarkeit <strong>de</strong>r KR Ergebnisse<br />
• Beschleunigung <strong>de</strong>r monatlichen Abrechnung<br />
• Differenzen zu <strong>de</strong>n Istkosten<br />
Problem: für die Nachkalkulation benötigt man aber monatlich Kostensätze. Folglich wer<strong>de</strong>n die entstehen<strong>de</strong>n<br />
Über- und Unter<strong>de</strong>ckungen auf <strong>de</strong>n nächsten Monat verschoben. Aus diesem Grund bil<strong>de</strong>te man<br />
Normalgemeinkosten für längere Zeit. Diese Kosten sind statistische Durchschnittswerte aus <strong>de</strong>r Vergangenheit.<br />
starre Normalkostenrechnung<br />
lediglich die Vereinfachung <strong>de</strong>r Istkostenrechnung sollte erreicht wer<strong>de</strong>n, in<strong>de</strong>m man Normalkostensätze<br />
mit einem Zeitraum von zwölf Monaten. Die Bildung aktualisierter Normalkostensätze diente <strong>de</strong>r<br />
Vermeidung größerer Über-/ Unter<strong>de</strong>ckungen. Ursachen waren Lohn-, Preisän<strong>de</strong>rungen und Än<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r<br />
Fixkostenstruktur, die eingearbeitet wur<strong>de</strong>n.<br />
Kritik:<br />
- Große Vereinfachung <strong>de</strong>r laufen<strong>de</strong>n <strong>Kostenrechnung</strong>, da eine Nachkalkulation mit Istkostensätzen entfällt.<br />
- Über- und Unter<strong>de</strong>ckungen sind für die Kostenkontrolle ungeeignet, da man nicht mit aktuellen Werte<br />
vergleicht<br />
+ Solange sich Über- und Unter<strong>de</strong>ckungen im Zeitablauf ausgleichen, erfolgt langfristig eine vollständige<br />
Kostenüberwälzung<br />
Flexible Normalkostenrechnung
31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />
WS 98/99<br />
von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />
Diese entstand, weil man erkannte, dass die starre Normalkostenrechnung für eine Kostenkontrolle völlig<br />
unzulänglich gewesen war. Aus diesem Grund spaltete man die Gemeinkosten in fixe und proportionale Kosten<br />
auf. Damit wollte man die Beschäftigungsabweichungen eliminieren.<br />
Vorgehensweise<br />
1) Ermittlung <strong>de</strong>r korrigierten Istgemeinkosten für je<strong>de</strong> Kostenstelle<br />
2) Kostenanalyse: Aufspaltung in fixe und proportionale Anteile<br />
3) Kostensatz für je<strong>de</strong> Beschäftigung = K v / zugehörige Beschäftigung<br />
4) Als Normalbeschäftigung wird die Durchschnittsbeschäftigung o<strong>de</strong>r die Vollbeschäftigung <strong>de</strong>r KST gewählt.<br />
5) Verrechnete Normalgemeinkosten = Istfertigungsstun<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r einzelnen Abrechnungsperio<strong>de</strong>n * gesamter<br />
Gemeinkostensatz<br />
6) Unter-/ Über<strong>de</strong>ckung = Istgemeinkosten - verrechnete Gemeinkosten<br />
7) Normgemeinkosten = fixe Normalgemeinkosten + Istbeschäftigung * prop. Normalgemeinkosten<br />
8) Beschäftigungsabweichung = Normalgemeinkosten - verrechnete Gemeinkosten<br />
42<br />
Plankostenrechnung<br />
Plankosten = Mengen- und Zeitgerüst <strong>de</strong>r Kosten wie auch <strong>de</strong>r Preise sind geplante Größen.<br />
Zielsetzung: Kostenkontrolle und Verbindung zwischen <strong>Kostenrechnung</strong> und <strong>de</strong>r<br />
betrieblichen Planung. Die dispositiven Aufgaben <strong>de</strong>r <strong>Kostenrechnung</strong> treten in <strong>de</strong>n<br />
Vor<strong>de</strong>rgrund, d.h. die Kostenplanung geht von <strong>de</strong>n geplanten Produktions- und Absatzmengen<br />
aus und löst sich dabei von <strong>de</strong>n Istkosten <strong>de</strong>r Vergangenheit.<br />
Starre Plankostenrechnung<br />
Aufbau<br />
• Festlegung von Planpreisen zur Bewertung <strong>de</strong>r Verbrauchsmengen<br />
• Einzelkosten zu Planpreisen<br />
• Innerbetriebliche Leistungen wer<strong>de</strong>n wie von außen bezogene Wirtschaftsgüter und Leistungen mit festen<br />
Verrechnungssätzen geplant und abgerechnet<br />
• Gemeinkostenplanung je KST für alle KST (Haupt- und Hilfs-KST)<br />
1) Auswahl <strong>de</strong>r Bezugsgröße<br />
2) Festlegung <strong>de</strong>r Planbeschäftigung<br />
3) Durchführung von Verbrauchsanalysen und technischen Berechnungen für die Gemeinkostenplanung<br />
4) Planpreisen * Planpreisen (für je<strong>de</strong> Kostenart in je<strong>de</strong>r Kostenstelle)<br />
5) Summe <strong>de</strong>r Plankostenbeträge aller Kostenarten für je<strong>de</strong> Kostenstelle bil<strong>de</strong>n<br />
6) Plankostenverrechnungssatz <strong>de</strong>r KST = gesamte Plankosten / Planbezugsgröße<br />
7) Vorgehensweise analog für alle KST<br />
Kritik:<br />
+ Aussagefähige Kostenkontrolle möglich<br />
- Vollkostenrechnung, so dass dispositive Aufgaben nicht immer möglich sind<br />
Flexible Plankostenrechnung<br />
Die fixen und proportionalen Kosten wer<strong>de</strong>n voneinan<strong>de</strong>r getrennt. Damit können die<br />
Plankosten an Beschäftigungsschwankungen angepasst wer<strong>de</strong>n.<br />
Aufbau<br />
• Festlegung von Planpreisen zur Bewertung <strong>de</strong>r Verbrauchsmengen
31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />
WS 98/99<br />
von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />
• Einzelkosten zu Planpreisen<br />
• Innerbetriebliche Leistungen wer<strong>de</strong>n wie von außen bezogene Wirtschaftsgüter und<br />
Leistungen mit festen Verrechnungssätzen geplant und abgerechnet<br />
• Gemeinkostenplanung je KST für alle KST (Haupt- und Hilfs-KST)<br />
1) Auswahl <strong>de</strong>r Bezugsgröße<br />
2) Festlegung <strong>de</strong>r Planbeschäftigung<br />
3) Bewertung <strong>de</strong>s ermittelten Planverbrauchs mit Planpreisen<br />
4) Summe <strong>de</strong>r Plankostenbeträge aller Kostenarten bil<strong>de</strong>n die Plankosten einer KST<br />
5) Errechnung <strong>de</strong>r Plankostenverrechnungssätze => k (p) = K (p) / x (p)<br />
43<br />
Kosten<br />
Sollkosten<br />
K(p)<br />
Kv<br />
Kf k2(p) Kf<br />
k1(p)<br />
x(i) x(p) Beschäftigung (Menge)<br />
6) Kostenauflösung, d.h. Aufspaltung <strong>de</strong>r Kosten in fixe und proportionale Bestandteile<br />
7) Sollkostenfunktion: K (s) = K f (p) + k v (p) * x<br />
8) Durchführung <strong>de</strong>r Abweichungsanalyse<br />
Istkosten Istkosten Sollkosten<br />
./. verr. Plankosten ./. Sollkosten ./. verr. Plankosten<br />
= Gesamtabweichung = Verbrauchsabweichung = Beschäftigungsabweichung<br />
∆ G ∆ V ∆ BG<br />
=> Kostenstelle => nicht vom KST-Leiter zu<br />
∆ G = ∆V + ∆BG Verantwortl. KST-Leiter verantworten<br />
Sollkosten = Plankosten * Istbeschäftigung<br />
Kritik:<br />
+ Mit <strong>de</strong>r Umrechnung <strong>de</strong>r Plankosten auf die jeweilige Istbeschäftigung können die<br />
Sollkosten als echte Maßgröße zu Kostenkontrolle <strong>de</strong>n Istkosten gegenüberstellt wer<strong>de</strong>n<br />
- Die rechnerische Proportionalisierung <strong>de</strong>r fixen Kosten bei <strong>de</strong>r Verrechnung <strong>de</strong>r Kosten<br />
auf die Kostenträger führt aber noch zu Fehlentscheidungen<br />
Grenzkostenplanung<br />
Die Vollkostenrechnung verstößt gegen das Verursachungsprinzip, da auch Fixkosten auf<br />
Leistungen verteilt wer<strong>de</strong>n. Darum verwen<strong>de</strong>t man die Grenzkostenplanung. Grenzkosten sind<br />
bei linearem Gesamtkostenverlauf die variablen Kosten.<br />
Der Aufbau ist zunächst i<strong>de</strong>ntisch mit <strong>de</strong>m Aufbau <strong>de</strong>r flexiblen Plankostenrechnung auf<br />
Vollkostenbasis. (erst ab 5 än<strong>de</strong>rt sich es)
31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />
WS 98/99<br />
von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />
44<br />
1) Grenzkostensatz = variable Plankosten <strong>de</strong>r KST / Planbezugsgröße<br />
2) Verrechnete Plankosten = Grenzkostensatz * Istbeschäftigung<br />
3) Sollkosten = fixe Plankosten + variable Plankosten * Beschäftigungsgrad<br />
4) Abweichungsanalyse vornehmen<br />
Verbrauchsabweichung = Istkosten - Sollkosten<br />
Beschäftigungsabweichung = Sollkosten - verr. Plankosten<br />
Gesamtabweichung = Istkosten - verr. Plankosten<br />
Kf<br />
kv<br />
Auf die KTR verrechnet<br />
Ins Betriebsergebnis verrechnet<br />
Ansonsten wie bei <strong>de</strong>r flexiblen Plankostenrechnung auf Vollkostenbasis (s. auch unten)<br />
Kritik:<br />
- Eine Bestandsbewertung zu Grenzkosten ist in <strong>de</strong>r Han<strong>de</strong>ls- und Steuerbilanz nicht<br />
zulässig<br />
- Grenzkostenkalkulation löst die latente Gefahr von Preissenkungen aus, die <strong>de</strong>r Angebotsund<br />
Nachfragesituation eines Betriebes nicht entsprechen. Grenzkosten sind allenfalls ein<br />
Instrument für die Betriebsleitung zur Vertriebssteuerung, aber nicht zur Erzielung von<br />
Auftragsabschlüssen geeignet.<br />
Kalk. Satz = DM / Bezugsgrößeneinheit<br />
k (p) = K (p) / x (p) = gesamte Plankosten <strong>de</strong>r KST / Planbeschäftigung <strong>de</strong>r KST<br />
S. 113)<br />
Sollkosten = 150.000 + (279.000 - 150.000)/ 12.000 * x<br />
Grenzkostensatz = 10,75 DM / Std. = K v (p) / x (p)<br />
verr. Kosten bei 9.000 Std.<br />
1) 9.000 Std. * 10,75 DM/ Std. = 96.750 DM (auf KTR)<br />
k (verr)<br />
K(s)<br />
111,11<br />
200,00<br />
Auf die KTR verrechnet<br />
in das Betriebsergebnis verrechnet<br />
k (p) = Plankosten verr. Satz = K (p) / x (p) = 36.000/ 180 = 200,00 DM
31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />
WS 98/99<br />
von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />
k s (p) = Grenzkostensatz = k v (p) / x (p) = 20.000 / 180 = 111,11 Std.<br />
=> K (s) = 16.000 + 111,11 *x<br />
45<br />
∆V = K (i) - K (s) = 48.000 - (16.000 + 111,11 *200) = 9.778<br />
∆BG = K (s) - K (verr) = 38.222 * [200 DM * 200 Std.] = - 1.778 (Über<strong>de</strong>ckung)<br />
∆G = ∆V + ∆BG = K (i) - K (verr) = 48.000 - 40.000 = 8.000<br />
∆V = K (i) - K (s) = 48.000 - 38.222 = 9.778<br />
Klausuraufgabe<br />
Planbezugsgröße = 160 Std., Istbeschäftigung = 150 Std.<br />
K G K v K f I K S K Abw ∆%<br />
FL 4.560 4.500 4.120 4.275 -155 - 3,6%<br />
Hilfslöhne 1.250 750 500 1.000 1.203 - 203 - 16,8%<br />
LNK 4.067 3.717 350 3.835 3.835 - -<br />
Energie 740 540 200 650 706 - 56 -8,0<br />
Rep. 200 100 100 180 194 - 14 - 7,2<br />
Kalk. Abs. 5.154 5.154 5.154 5.154 - -<br />
Kalk. Zinsen 837 837 837 837 - -<br />
Gesamt 16.808 9.667 7.141 15.856 16.204 - 348 - 2,1<br />
Vollkostensatz<br />
Grenzkostensatz<br />
16.808 / 160 = 105,05 DM<br />
9,667 / 160 = 60,42 DM<br />
Kalk. Abs: 285.000 * 1,085 / 5 / 12<br />
Kalk. Zinsen: 309.225 * 0,5 * 0,065 / 12<br />
LNK auf Fertigungslöhne und Hilfslöhne<br />
Fazit:<br />
Istkostenrechnung: Nachkalkulation, Erfolgsrechnung mit nachkalkulierten Istkosten<br />
Flexible Plankostenrechnung: laufen<strong>de</strong> Kostenkontrolle<br />
Grenzplankostenrechnung: Erfolgsanalyse, Gewinnplanung, dispositive Aufgaben <strong>de</strong>r KR<br />
Aufspaltung <strong>de</strong>r Kosten<br />
Istkosten = Plankosten +/- Summe <strong>de</strong>r Abweichungen<br />
Festpreise:<br />
Preisabweichungen<br />
Geplante Einzelkosten: Einzelkostenabweichung<br />
Normalsätze:<br />
Über-/ Unter<strong>de</strong>ckungen<br />
Starre PlanKR<br />
Planabweichungen <strong>de</strong>r Gemeinkosten<br />
Flexible PlanKR<br />
Verbrauchs- und Beschäftigungsabweichungen<br />
GrenzplanKR<br />
Verbrauchsabweichungen, spez. Abweichungen<br />
Grundzüge <strong>de</strong>r Plankostenrechnung
31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />
WS 98/99<br />
von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />
46<br />
Planung <strong>de</strong>r Einzelmaterialkosten<br />
1) Planung <strong>de</strong>r Netto-Planeinzelmaterialmengen (lt. Stückliste)<br />
2) Festlegung <strong>de</strong>r Abfall- und Ausschussquoten<br />
3) Bestimmung <strong>de</strong>r Bruttoplanverbrauchsmengen<br />
4) Bewertung mit <strong>de</strong>n Planpreisen<br />
Beispiele<br />
• Rohstoffe<br />
• Fremdbezogene Fertigteile<br />
• Hilfsstoffe (gelegentlich als Gemeinkosten)<br />
• Betriebsstoffe (als Gemeinkosten verrechnet)<br />
Planung <strong>de</strong>r Lohneinzelkosten<br />
1) Ermittlung <strong>de</strong>r Planarbeitszeiten<br />
2) Bewertung mit <strong>de</strong>n Planlohnsätzen<br />
Beispiele:<br />
in <strong>de</strong>r Regel sind dies nur die Fertigungslöhne. Hilfslöhne, Gehälter, Sozialkosten und<br />
sonstige Personalkosten hingegen sind Gemeinkosten, genauso wie Mehrarbeitszuschläge,<br />
Prämien und Zusatzlöhne<br />
Planung <strong>de</strong>r Gemeinkosten<br />
Vorbereiten<strong>de</strong> Maßnahmen<br />
• Kostenartenglie<strong>de</strong>rung<br />
• Kostenstellenglie<strong>de</strong>rung<br />
• Bezugsgrößenauswahl<br />
• Festlegung <strong>de</strong>s Planungs- und Kontrollzeitraums<br />
Eigentliche Maßnahmen <strong>de</strong>r Kostenplanung<br />
• Festlegung <strong>de</strong>r Planpreise<br />
• Festlegung <strong>de</strong>r Planbezugsgröße<br />
• Kostenplanung je Kostenart (Verbrauchsmengen, Bewertung mit <strong>de</strong>m Planpreis)<br />
• Kostenauflösung in fixe und proportionale Bestandteile<br />
• Festlegung <strong>de</strong>s Sollkostenverlaufs<br />
• Bildung von Kalkulationssätzen<br />
Kalkulation in <strong>de</strong>r Plankostenrechnung<br />
In Unternehmungen mit standardisierten Erzeugnissen wird eine auftragsweise Vor- und Nachkalkulation<br />
verzichtet, statt <strong>de</strong>ssen wird eine Plankalkulation erstellt<br />
Plankalkulation heißt, dass die geplanten Selbstkosten pro Erzeugniseinheit für eine Planungsperio<strong>de</strong> ermittelt<br />
wer<strong>de</strong>n. Mit an<strong>de</strong>ren Worten Plankalkulationen sind jahresbezogene Durchschnittskalkulationen. Eine Än<strong>de</strong>rung<br />
<strong>de</strong>r Plankalkulation erfolgt jedoch nur, sofern nachhaltige Verän<strong>de</strong>rungen wesentlicher Kalkulationsdaten<br />
vorliegen.<br />
In <strong>de</strong>r Auftragsfertigung wird eine Vorkalkulation als Angebotskalkulation bzw. Auftragskalkulation erstellt.<br />
Prozesskostenrechnung
31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />
WS 98/99<br />
von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />
Mit <strong>de</strong>ssen Hilfe die Kosten <strong>de</strong>r indirekten Unternehmensbereiche besser geplant und<br />
gesteuert bzw. auf die Produkte o<strong>de</strong>r Leistungen zugerechnet wer<strong>de</strong>n können. Der Grund für<br />
diese Entwicklung besteht darin, dass sich die Anfor<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>s Managements an die<br />
<strong>Kostenrechnung</strong> geän<strong>de</strong>rt haben, so haben die Gemeinkosten als Anteil am Gesamtvolumen<br />
zugenommen, während die Einzelkosten immer weiter sinken. Die Folge ist, dass <strong>de</strong>r<br />
Deckungsbeitrag seine Aussagefähigkeit verliert.<br />
Kritik an <strong>de</strong>r Grenzkostenplanung<br />
• Nur kurzfristig ausgelegt<br />
• Deckungsbeiträge wer<strong>de</strong>n bei abnehmen<strong>de</strong>n Einzelkosten ten<strong>de</strong>nziell immer höher und verlieren an<br />
Aussagekraft<br />
• Bei Ausbau zu einer Vollkostenrechnung erfolgt eine Fixkostenschlüsselung, die nicht <strong>de</strong>r<br />
Kostenverursachung entspricht.<br />
Vorgehensweise<br />
1. Auswahl eines geeigneten Untersuchungsbereichs (KST-Verantwortliche und GS-<br />
Handbuch)<br />
2. Prozesse <strong>de</strong>finieren / Aktivitäten<br />
3. Maßgrößen festlegen<br />
4. Plan-Prozessmenge planen<br />
5. Plan-Ressourcenverbrauch<br />
47<br />
Pro<br />
Systematischer kontinuierlicher Ansatz Gh-<br />
Controlling<br />
Ablösung <strong>de</strong>s Tragfähigkeitsprinzips<br />
Prozessoptimierung<br />
Kosten von Prozessen wer<strong>de</strong>n transparent<br />
Contra<br />
Aufwand <strong>de</strong>r Einführung und <strong>de</strong>r<br />
Datenerhebung<br />
Anwendbarkeit prüfen<br />
Vollkostenrechnung (Proportionalisierung <strong>de</strong>r<br />
Fixkosten)<br />
Proportionalisierung von lmn-Kosten<br />
Hauptprozess<br />
Teilprozess<br />
mehreren<br />
Lmi<br />
Lmn<br />
= Bearbeitung eines Kun<strong>de</strong>nauftrags<br />
= Kette von Aktivitäten, innerhalb einer Kostenstelle, die eine o<strong>de</strong>r<br />
Hauptprozessen zugeordnet wer<strong>de</strong>n können<br />
= leistungsabhängig<br />
= leistungsunabhängig (Abteilung leiten)<br />
Ausgangspunkt<br />
• Prozess- o<strong>de</strong>r Aktivitätenanalyse als erster Schritt <strong>de</strong>r Prozesskostenrechnung<br />
• Festhalten in <strong>de</strong>r je<strong>de</strong>r KST ablaufen<strong>de</strong>n Teilprozesse<br />
• Festhalten <strong>de</strong>r benötigten Bearbeitungszeitpunkt<br />
• Ermittlung von Maßgrößen (Teilprozesse) und Cost-Drivern (Hauptprozesse)<br />
Prozesskostensatz lmi<br />
Umlagesatz lmn je Prozess<br />
Gesamtprozesskostensatz<br />
= Prozesskosten lmi / Prozessmenge lmi<br />
= (Summe lmn-Plankosten * Prozesskostensatz)<br />
/ Summe Lmi-Plankosten<br />
= Prozesskostensatz + Umlagesatz<br />
(1) Ermittlung <strong>de</strong>r Kosten einer Kostenstelle
31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />
WS 98/99<br />
von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />
(2) Ermittlung <strong>de</strong>r Plankosten = (Kostenstellenkosten * Bezugsgröße pro Prozess) /<br />
gesamte Bezugsgröße<br />
(3) Ermittlung <strong>de</strong>r Prozesskosten = Plankosten / Planmenge<br />
(4) Ermittlung <strong>de</strong>s Umlagesatzes = (Prozesskosten + lmn-Kosten) * Prozesskosten<br />
(5) Ermittlung <strong>de</strong>r Gesamtprozesskosten pro Prozess<br />
(6) Übertragung <strong>de</strong>r Gesamtprozesskosten in die Hauptprozesskosten<br />
(7) Ermittlung <strong>de</strong>s Hauptprozesskostensatzes <strong>de</strong>r in Kalkulation einfließt<br />
48<br />
Target Costing<br />
Target Costing = Zielkostenmanagement stellt ein umfassen<strong>de</strong>s Kostenplanungs-,<br />
Kostensteuerungs- und Kostenkontrollkonzept dar, kurz Kostenmanagement-Konzept.<br />
Entschei<strong>de</strong>nd ist hier bei, dass man von <strong>de</strong>r Frage ausgeht, was darf das Produkt kosten, um<br />
auf <strong>de</strong>m Markt zu bestehen. Dabei geht man wie folgt vor:<br />
1. Ermittlung <strong>de</strong>r maximalen Kosten<br />
= Ermittlung <strong>de</strong>s Marktpreises ./. angestrebter Gewinn<br />
2. Mit <strong>de</strong>r Zielkostenspaltung prüfen, wie das Unternehmen die Kosten reduzieren kann<br />
Festlegung <strong>de</strong>r Funktionsstruktur <strong>de</strong>s neuen Produktes auf <strong>de</strong>r Basis <strong>de</strong>s vom Markt verlangten<br />
Leistungsprofils. Dabei wird zwischen harten (technische Leistung) und weichen (Bedienerfreundlichkeit)<br />
unterschie<strong>de</strong>n. => kurz: Wertanalyse<br />
3. Durchführung von Kun<strong>de</strong>nbefragungen, welchen Wert sie <strong>de</strong>n einzelnen Funktionen beimessen<br />
4. Erstellung eines Grobentwurfs für das neue Produkt<br />
5. Kostenplanung und Kalkulation <strong>de</strong>r Produktkomponenten<br />
6. Gewichtung <strong>de</strong>r Produktkomponenten für die Realisierung <strong>de</strong>r harten und weichen Funktionen<br />
7. Errechnung von Zielkostenindices für die einzelnen Produktkomponenten<br />
8. Optimierung von Zielkostenindices mit Hilfe eines Zielkostenkontrolldiagramms<br />
9. Realisierung notwendiger, weiterer Kostensenkungen bis zur Erreichung <strong>de</strong>r gewünschten Kostenhöhe.<br />
Geg. Funktionen (2), Gewichtungsfaktoren <strong>de</strong>r Funktionen (3) , prozentualer Kostenanteil bei<br />
<strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>nen Kostenstellen (5)<br />
Ges.:<br />
Gewichtete Verknüpfung = Funktionen x Produktkomponenten * Gewichtungsfaktoren<br />
Zielkostenin<strong>de</strong>x = Summe <strong>de</strong>r gewichteten Verknüpfung einer Komponente * prozentualen<br />
Kostenanteil<br />
Bei allen Komponenten, <strong>de</strong>ren Kostenindices über 1 liegen, müssen die Kosten gesenkt<br />
wer<strong>de</strong>n.<br />
Ergebnisrechnung in Form einer DB-Rechung
31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />
WS 98/99<br />
von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />
Umsatz<br />
./. Grenzselbstkosten<br />
= DB<br />
./. fixe Kosten<br />
= Gewinn/ Verlust<br />
Produkt 1 Produkt 2 Gesamt<br />
49<br />
Merke:<br />
• Eine Aussage über das beste Produkt kann man nur machen, wenn die<br />
Deckungsbeiträge bekannt sind.<br />
• Produkte mit negativem Deckungsbeitrag streichen, wenn kein nicht-wirtschaftlicher<br />
Grund vorliegt (Image, Komplementärprodukt, Großkun<strong>de</strong> etc.)<br />
• Deckungsbeitrag immer vom Nettoerlös<br />
• Son<strong>de</strong>reinzelkosten sind in <strong>de</strong>r Deckungsbeitragsrechnung fixe Kosten (?)<br />
• Mit <strong>de</strong>r Vollkostenrechnung kann ich nicht steuern, da sie mir nicht sagt, welches<br />
Produkt ich bevorzugen soll. Dies kann nur <strong>de</strong>r DB.<br />
• Produktionsmenge = Produktion - AB + EB<br />
• Bei Kapitalbindung wie Zinsen mit 0,5 multiplizieren (durchschnittliche Zinsen)<br />
• Zuschlagskalkulation nie mit Istkostensätze, son<strong>de</strong>rn immer mit Plankostensätzen<br />
rechnen<br />
• Bei <strong>de</strong>r Zuschlagskalkulation sind beson<strong>de</strong>re Einzelteile Materialkosten und keine<br />
Son<strong>de</strong>reinzelkosten<br />
• Provision und Gewinn als Umsatzrendite vom Umsatz (Umsatz = 100 %)<br />
• Bei <strong>de</strong>r Bestimmung <strong>de</strong>r variablen und fixen Kosten immer vom Nettoverkaufserlös<br />
ausgehen<br />
• Cash flow = Gewinn nach Steuern + Abschreibungen + Pensionsrückstellungen