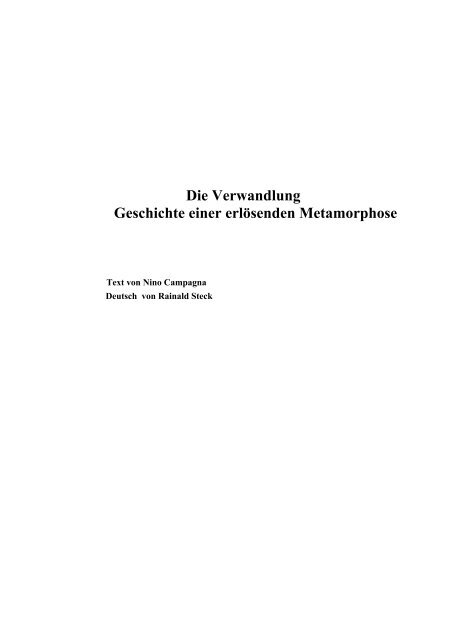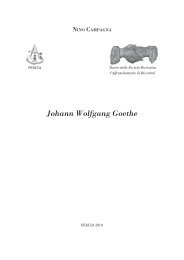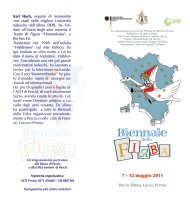Kafka D. Verw. - ACIT Pescia
Kafka D. Verw. - ACIT Pescia
Kafka D. Verw. - ACIT Pescia
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Die <strong>Verw</strong>andlung<br />
Geschichte einer erlösenden Metamorphose<br />
Text von Nino Campagna<br />
Deutsch von Rainald Steck
2<br />
Vorwort<br />
Diese Wiederbegegnung mit der “<strong>Verw</strong>andlung” , die keineswegs beabsichtigt, der bereits<br />
umfangreichen Literatur über <strong>Kafka</strong> “Wissenschaftliches” hinzuzufügen, brauchte lange<br />
heranzureifen.<br />
Ich habe <strong>Kafka</strong> zufällig entdeckt...und wer mich kennt, weiss, wie überzeugt ich von dem<br />
Marxschen Wort von der “Berechtigung des Zufalls” bin. Es war 1967, und just in jenem<br />
Jahr sind die “Briefe an Felice” erschienen.<br />
Ich dachte, es wäre bequem, darüber rasch eine Doktorarbeit zu schreiben und mein<br />
Studium moderner Sprachen und Literaturen an der Universität Messina abzuschliessen.<br />
Schon seit 1962 hatte auch ich, um leben zu können, eine Anstellung als Sekretär bei den<br />
Staatlichen Eisenbahnen akzeptiert (“Brotberuf” hatte <strong>Kafka</strong> dazu gesagt), die viele<br />
glücklich gemacht hätte, mir aber allzu häufig eine Last war.<br />
Als ich die Briefe an Felice las, habe ich den Schmerz wiedererkannt, der von einer<br />
unsäglich langweiligen Arbeit im Büro herrührt, die man wie eine unausweichliche Strafe<br />
empfindet.<br />
Seit damals habe ich mir eingebildet, dass <strong>Kafka</strong> nicht nur zu mir, sondern auch für mich<br />
spräche.<br />
Im selben Jahr war ich in Prag , wo ich in der Atmosphäre jener für viele magischen Stadt<br />
die Luft <strong>Kafka</strong>s zu atmen suchte (es war 1967, unmittelbar vor dem Prager Frühling...)<br />
Welch überwältigendes Gefühl, Briefe von <strong>Kafka</strong> in Händen zu halten, die mir die Karl-<br />
Ferdinand-Universität dieser Stadt zur Verfügung gestellt hatte, oder in demütiger Andacht<br />
vor dem Häuschen im Alchimistengässchen zu stehen, wo <strong>Kafka</strong> 50 Jahre zuvor (im<br />
Winter 1916/17) gewohnt und geschrieben hatte.<br />
Später habe ich einige Semester an der Universität Göttingen (1969/70) über <strong>Kafka</strong><br />
gearbeitet. Nach diesem Zwischenspiel habe ich mich - aus Feigheit - geweigert, mich<br />
weiterhin einem Autor zuzuwenden, dessen Lektüre zugleich mitreisst und erschüttert (1).<br />
Aus dem Abstand der Jahre, da ich glaube, gealtert und gewissermassen immunisiert zu<br />
sein, habe ich nun versucht, einer Gruppe von Freunden der deutsch-italienischen<br />
Gesellschaft in <strong>Pescia</strong> das nahezubringen, was ich von <strong>Kafka</strong> gelernt habe und<br />
darüberhinaus das, was ich über <strong>Kafka</strong> schon immer wusste.<br />
(1) “Ich glaube, man sollte überhaupt nur solche Bücher lesen, die einen beissen und stechen. Wenn das<br />
Buch, das wir lesen, uns nicht mit einem Faustschlag auf den Schädel weckt, wozu lesen wir dann das<br />
Buch?... Wir brauchen aber Bücher, die auf uns wirken wie ein Unglück, das uns sehr schmerzt, wie der Tod<br />
eines, den wir lieber hatten als uns... wie ein Selbstmord, ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer<br />
in uns... (Aus einem Brief an Oskar Pollack, 27.01.1904 - <strong>Kafka</strong>, F.: Briefe - )
3<br />
Dabei öffnete sich wieder eine "Wunde", die - ich muss es zugeben - auch Freude<br />
bereitete...<br />
In dieser Seelenlage also versuche ich jetzt, mich erneut mit der "<strong>Verw</strong>andlung" zu<br />
beschäftigen und dies mit dem Ziel, eine zweifache Lektüre zu ermöglichen: die der<br />
Erzählung und die ihrer Entstehung..<br />
Bei <strong>Kafka</strong> - aber das, denke ich, betrifft fast alle -, überrascht die Fähigkeit, mit welcher er<br />
stets zu fesseln und manchmal mitzureissen vermag, wenn er sein eigenes Unglück<br />
beschreibt (2). Man hat den Eindruck, dass er Sachen geschrieben hat, die wir schon<br />
persönlich erlebt haben, dass er Situationen heraufbeschworen hat, die wir schon einmal<br />
irgendwie empfunden haben, dass er eine Sprache benutzt hat, die uns vertraut klingt.<br />
Und so sind wir viele, die in dieser Atmosphäre <strong>Kafka</strong>s leben und das Gefühl haben, mehr<br />
als nur eine Wahlverwandtschaft mit vielen "seiner" Personen zu haben.<br />
Was mich selbst betrifft, so ist es mir häufig widerfahren, mich in dem “Hungerkünstler”<br />
wiederzuerkennen oder in dem Affen aus dem “ Ein Bericht für eine Akademie” oder auch<br />
in dem Mann vom Lande, der sein ganzes Leben "vor dem Gesetz " verbringt.<br />
Und, wenn ich ganz ehrlich bin, überrasche ich mich oft am Abend, wie ich am Fenster die<br />
"Botschaft" erwarte, die der Kaiser im Augenblick des Todes mir “... dem Einzelnen, dem<br />
jämmerlichen Untertanen, dem winzig vor der kaiserlichen Sonne in die fernste Ferne<br />
geflüchtete Schatten...” übermittelt und die expressis verbis an mich gerichtet war.<br />
(2) Es sind kaum Tatsachen, die mich hindern, es ist Furcht, eine unüberwindliche Furcht, eine Furcht davor,<br />
glücklich zu werden, eine Lust und ein Befehl, mich zu quälen für einen höheren Zweck. Dass Du, Liebste,<br />
mit mir unter die Räder dieses Wagens kommen musstest, der nur für mich bestimmt ist, das ist allerdings<br />
schrecklich. ( Aus einem Brief an Felice, 30.08.1913 - <strong>Kafka</strong>, F.: Briefe an Felice -)
4<br />
Die <strong>Verw</strong>andlung<br />
Geschichte einer erlösenden Metamorphose<br />
“Sehr geehrter Herr Oberinspektor!<br />
Ich habe heute früh einen kleinen Ohnmachtanfall gehabt und habe etwas Fieber. Ich<br />
bleibe daher zuhause. Es ist aber bestimmt ohne Bedeutung und ich komme bestimmt<br />
heute noch, wenn auch vielleicht erst nach 12 ins Bureau”(1).<br />
So kündigt sich die <strong>Verw</strong>andlung, die unglückliche Geschichte des Gregor Samsa, die<br />
nichts anderes ist als diejenige des Franz <strong>Kafka</strong> (2), auf einer Visitenkarte vom 25.9.1912<br />
an, die <strong>Kafka</strong> seinem Bürochef Pfohl geschickt hatte, dessen Foto von Klaus Wagenbach,<br />
einem der präzisesten <strong>Kafka</strong>forscher publiziert wurde.<br />
Die Erzählung hatte eine lange Inkubationszeit - schon Raban, der Protagonist der<br />
“Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande” aus dem Jahre 1907, träumt, ein Käfer zu sein<br />
und<br />
im Bett bleiben zu können (3) -, bevor sie ihre genauen Konturen fand; eine<br />
Erzählung, die als qualvoller Befreiungsprozess verstanden werden muss, die mit der<br />
erbarmungslosen Klarheit des Analytikers geschrieben ist und die sich problemlos einen<br />
Weg durch die Mäander des eigenen Unterbewusstseins bahnt.<br />
Die <strong>Verw</strong>andlung entsteht zwischen November und Dezember 1912, unmittelbar nach dem<br />
"Urteil", das in der Nacht vom 22. auf den 23. September geschrieben wurde, als <strong>Kafka</strong><br />
schon mit der Niederschrift des "Heizer" befasst war. Die letzten Monate des Jahres 1912<br />
(1) Wagenbach, K.: Franz <strong>Kafka</strong>. Bilder aus seinem Leben.<br />
(2) Der Familienname Samsa hat eine ähnliche Struktur wie <strong>Kafka</strong>. Die jeweiligen Konsonanten “S” und “K”<br />
wiederholen sich an gleicher Stelle, das gilt auch für das “A”. <strong>Kafka</strong> selbst weist auf diese Koinzidenz im<br />
Zusammenhang mit dem “Urteil” ausdrücklich hin: “Georg hat so viele Buchstaben wie Franz. In<br />
Bendemann ist “mann” nur eine für alle noch unbekannte Verstärkung von “Bende”. Bende aber hat ebenso<br />
viele Buchstaben wie <strong>Kafka</strong> und der Vokal e wiederholt sich an den gleichen Stellen wie der Vokal a in<br />
<strong>Kafka</strong>” (Aus den Tagebüchern, 12.02.1913). Auf solche “Zufälle” hatte <strong>Kafka</strong> bereits gegenüber Felice in<br />
seinem Brief vom 24.10.1912 hingewiesen, in dem er ihr die F.B. gewidmete Geschichte ankündigt: “... Im<br />
Übrigen hat die Geschichte in ihrem Wesen, soweit ich sehen kann, nicht den geringsten Zusammenhang mit<br />
Ihnen, ausser dass ein darin flüchtig erscheinendes Mädchen Frieda Brandenfeld heisst, also wie ich später<br />
merkte, die Anfangsbuchstaben des Namens mit Ihnen gemeinsam hat.” (Aus einem Brief an Felice,<br />
24.10.1912). Diese “Zufälle kommen auch in seinen Romanen wieder vor, wo die entsprechenden Helden das<br />
K gemeinsam haben Einige Jahre später gibt <strong>Kafka</strong> auf die Bemerkung Gustav Janouchs: “Der Held der<br />
Erzählung heisst Samsa, das klingt wie ein Kryprogramm für <strong>Kafka</strong>” folgende Antwort.: “ Es ist kein<br />
Kryptogramm. Samsa ist nicht restlos <strong>Kafka</strong>. Die <strong>Verw</strong>andlung ist kein Bekenntnis, obwohl es - im gewissen<br />
Sinn - eine Indiskretion ist.” (Janouch, G.: Gespräche mit <strong>Kafka</strong>)<br />
(3) Raban träumt von einer <strong>Verw</strong>andlung in einen Hirsch- oder Maikäfer, die ihm ermöglicht, im Bett zu<br />
bleiben: “Und überdies kann ich es nicht machen, wie ich es immer als Kind bei gefährlichen Geschäften<br />
machte?” (<strong>Kafka</strong>, F.: Hochzeitsvorbereitungen auf dem Land).
5<br />
erwiesen sich dank der Begegnung mit Felice Bauer (13.8.1912) als die für seine<br />
künstlerische Arbeit fruchtbarsten. <strong>Kafka</strong> selbst hängt sehr an diesen seinen Schöpfungen,<br />
die er als besonders eng miteinander verbunden betrachtet und daher gern in einem Bande<br />
publiziert gesehen hätte (4).<br />
<strong>Kafka</strong> hatte geglaubt, in jener Frau, die damals schon nicht mehr die jüngste und im<br />
übrigen auch nicht schön war (“und kam mir doch wie ein Dienstmädchen vor...”),<br />
Eigenschaften zu finden, die ihm zwar unbedeutend erschienen, deren er aber doch<br />
bedurfte. “Knochiges leeres Gesicht, das seine Leere offen trug,” trägt er eine Woche nach<br />
ihrem ersten Treffen in sein Tagebuch ein. Er wird aber schon dafür sorgen, dass diese<br />
Leere mit seiner Hektik, seiner Ungeduld und mit seinem verrückten Anderssein gefüllt<br />
wird. Er spürte, dass er in Felice schliesslich jene Hand gefunden hatte, die er absolut nötig<br />
hatte: er sucht sich verzweifelt an ihr festzuhalten: “Wer weiss, ob ich den Druck jener<br />
Hand nicht nötiger habe als Sie, nicht jener Hand, die beruhigt, aber jener Hand, die Kraft<br />
gibt.” (Aus einem Brief an Felice, 08.11.1912).<br />
Und von diesem Bedürfnis spricht er auch weiter. 1921, fast am Ende seines Lebens - er<br />
stirbt drei Jahre später -, kommt er in seinen Tagebüchern noch einmal darauf zurück:<br />
“Derjenige, der mit dem Leben nicht lebendig fertig wird, braucht die eine Hand, um die<br />
Verzweiflung über sein Schicksal ein wenig abzuwehren - es geschieht sehr<br />
unwillkommen-, mit der anderen Hand kann er eintragen, was er unter den Trümmern<br />
sieht, denn er sieht anderes und mehr als die anderen, er ist doch tot zu Lebzeiten und der<br />
eigentlich Überlebende.” (Aus den Tagebüchern, 19.10.1921).<br />
Um Felice Bauer, der ersehnten Vertrauten, seinem alter ego, spinnt er ein feines Netz, das<br />
sie schliesslich zur Gefangenen macht. Plötzlich beginnt eine atemberaubende<br />
Korrespondenz, er schreibt ihr mehrere Briefe am selben Tag, stürmt auf sie ein mit<br />
absurden Bitten und hält sie über alles auf dem laufenden. Felice ist denn auch die erste,<br />
die von seiner Absicht erfährt, diese Geschichte zu schreiben. Am Morgen des 17.11.1912<br />
(4) “Nur eine Bitte habe ich, die ich übrigens schon in meinem letzten Brief ausgesprochen habe. Der Heizer,<br />
Die <strong>Verw</strong>andlung (die 1 ½ mal so gross wie der Heizer ist) und Das Urteil gehören äusserlich und innerlich<br />
zusammen, es besteht zwischen ihnen eine offenbare und noch mehr eine geheime Verbindung, auf deren<br />
Darstellung durch Zusammenfassung in einem etwa Die Söhne betitelten Buch ich nicht verzichten möchte.<br />
Wäre es nun möglich, dass Der Heizer...später in einer beliebigen, ganz in Ihr Gutdünken gestellten, aber<br />
absehbaren Zeit mit den anderen zwei Geschichten verbunden in ein eigenes Buch aufgenommen wird...? Mir<br />
liegt eben an der Einheit der drei Geschichten nicht weniger als an der Einheit einer von ihnen.” (Aus einem<br />
Brief an Kurt Wolff - 02. 04.1913 - <strong>Kafka</strong>, F.:Briefe)
6<br />
kündigt er ihr kurz an: “Ich werde Dir übrigens heute wohl noch schreiben, wenn ich auch<br />
noch heute viel herumlaufen muss und eine kleine Geschichte niederschreiben werde, die<br />
mir in dem Jammer im Bett eingefallen ist und mich innerlichst bedrängt.” (<strong>Kafka</strong>, F.:<br />
Briefe an Felice)<br />
<strong>Kafka</strong> hat an jenem Morgen das präzise und schmerzliche Gefühl, bereits Gregor zu sein<br />
(5).<br />
Er spürt die Geburtswehen und kündigt sie umgehend Felice an. Dabei entwickelt er ihr<br />
gegenüber bereits ganz nüchtern die Grundzüge der Geschichte: es wird sich um eine<br />
Kurzgeschichte handeln, die unsagbare Leiden beschreiben wird und deren Handlungskern<br />
ihn innerlich stark bewegt. Die Konzeption dieser kleinen Geschichte reicht aber bereits<br />
einige Jahre zurück. Damals liebäugelte <strong>Kafka</strong> mit dieser Idee, die gewiss mit seinen ersten<br />
Erfahrungen mit seiner Arbeit zusammenfiel , die er mehr als Zwang denn als Möglichkeit<br />
zur Befreiung empfand. Schon im Oktober 1907 schrieb er aus Anlass seiner ersten<br />
Anstellung: “Mein Leben ist jetzt ganz ungeordnet. Ich habe allerdings einen Posten mit<br />
winzigen 80 K Gehalt und unermesslichen 8-9 Arbeitsstunden, aber die Stunden ausserhalb<br />
des Bureaus fresse ich wie ein wildes Tier....Ich bin bei der Assicurazioni-Generali.....aber<br />
meine vorläufige Arbeit ist traurig.” . In diesem Wort "traurig" liegt der ganze <strong>Kafka</strong><br />
begründet. Traurig ist nicht nur seine Arbeit (6), traurig ist seine Einsamkeit, traurig sein<br />
Junggesellen-Dasein...(7)<br />
Sein halluzinatorischer, verlorener Blick, der uns auf den Fotos dieser Zeit überliefert ist,<br />
zeugt von seiner Innenwelt, die voll ist von Gespenstern und Ängsten. Er ist typisch für<br />
einen Menschen, der “wie ein Nackter unter Angekleideten ist” (Aus einem Brief von<br />
Milena Jesenska an Max Brod). Mit der Arbeit begann der Leidensweg des Franz <strong>Kafka</strong>,<br />
(5) “Ist er nicht selbst die unglücklichste Wanze aus der “<strong>Verw</strong>andlung” - fiel mir ein.” (Janouch, G.:<br />
Gespräche mit <strong>Kafka</strong>)<br />
(6) Seine erste Arbeitserfahrung gibt ihm schon genaue Eindrücke. Hedwig Weiler vertraut er gleich an: “Die<br />
Bureauzeit nämlich lässt sich nicht zerteilen, noch in der letzten halben Stunde spürt man den Druck der 8<br />
Stunden wie in den ersten. Es ist oft wie bei einer Eisenbahnfahrt durch Nacht und Tag, wenn man<br />
schliesslich, ganz furchtsam geworden, weder an die Arbeit des Zugführers, noch an das hügelige oder flache<br />
Land mehr denkt, sondern alle Wirkung nur der Uhr zuschreibt, die man immer vor sich in der Handfläche<br />
hält”. (November, 1907, aus einem Brief an H. Weiler - <strong>Kafka</strong>, F.: Briefe)<br />
Und über das Bureau spricht er immer wieder: “Weisst Du, ich hatte eine abscheuliche Woche, im Bureau<br />
überaus viel zu tun, vielleicht wird das jetzt immer so sein, ja man muss sich sein Grab verdienen...” (1908,<br />
Aus einem Brief an H. Weiler - <strong>Kafka</strong>, F.: Briefe)<br />
(7) “Vor dem Einschlafen, es scheint so arg, Junggeselle zu sein, als alter Mensch unter schwerer Wahrung<br />
der Würde um Aufnahme zu bitten, wenn man einen Abend mit Menschen verbringen will, sein Essen in<br />
einer Hand sich nach Hause zu tragen, niemanden mit ruhiger Zuversicht faul erwarten können, nur mit<br />
Mühe oder Ärger jemanden beschenken können, vor dem Haustor Abschied nehmen, niemals mit seiner Frau<br />
sich die Treppen hinaufdrängen zu können, krank sein und nur den Trost der Aussicht aus seinem Fenster<br />
haben.” (Aus den Tagebüchern, 14.11.1911)
7<br />
seine Reise in eine Welt, in der er keinen Platz hatte (8). Das Leben ist ein absurdes Urteil<br />
und die Arbeit die daraus folgende unvermeidliche Strafe. Diese Vermutung wird sich<br />
aufgrund von Erlebnissen und Situationen, die von Mal zu Mal in höchst bedeutsame<br />
Bilder<br />
umgesetzt werden, als zutreffend erweisen. Er weiss, dass er den bitteren Kelch der<br />
täglichen Existenz bis zur Neige austrinken muss, und deutet - wie übrigens alle seine<br />
Geschöpfe auch - keinen noch so winzigen Widerstand dagegen an; wenn es hoch kommt,<br />
reicht es zu einer weinerlichen Klage. Diese Ausbrüche kraftloser Verzweiflung fallen bei<br />
seinen Schriften oft auf. Die Eintönigkeit unsäglich gleicher Tage (9) und überdies das<br />
Büro, das er wie ein Gefängnis empfindet, oder besser noch wie ein Zuchthaus, aus dem -<br />
dessen ist er sich absolut sicher - er nicht mehr lebend herauskommen wird (10), werden zu<br />
obligaten Themen in seinen Tagebüchern. Das Büro scheint also schon 1911 irreversible<br />
Schäden angerichtet zu haben (11). Wenige Jahre später wird die demütigende<br />
Aufeinanderfolge von Handlungen und Zuständen die Gewalt eines absurden und<br />
unausweichlichen Urteilsspruches erreichen: “Letzthin, als ich wieder einmal zu<br />
regelmässiger Stunde aus dem Aufzug stieg, fiel mir ein, dass mein Leben mit seinen<br />
immer tiefer ins Detail sich uniformierenden Tagen den Strafarbeiten gleicht, bei denen der<br />
Schüler je nach seiner Schuld zehnmal, hundertmal oder noch öfter den gleichen,<br />
zumindest in der Wiederholung sinnlosen Satz aufzuschreiben hat, nur dass es sich bei mir<br />
um eine Strafe handelt, bei der es heisst: “so oft, als du es aushältst”. (Aus den<br />
Tagebüchern, 24.1.1914)<br />
Die "kleine Geschichte", die sich jetzt abzuzeichnen und eine endgültige Schriftform zu<br />
finden beginnt, war also in gewisser Weise von <strong>Kafka</strong> selbst erlebt worden; nun handelt es<br />
sich nur noch darum, aus der eigenen Erfahrung zu schöpfen, um ihr präzise Züge zu<br />
verleihen. Schon der Beginn der "<strong>Verw</strong>andlung", als Gregor nicht vom Bett aufstehen<br />
kann, hat ein schreckliches Vorbild in den Tagebüchern. <strong>Kafka</strong>, dessen Vorahnungen den<br />
Leser oft sprachlos machen (“Sollte ich das vierzigste Lebensjahr erreichen…”) schreibt in<br />
den<br />
(8) “...wo ich, der Sklave lebte, unter Gesetzen, die nur für mich erfunden waren und denen ich überdies, ich<br />
wusste nicht warum, niemals völlig entsprechen konnte.” ( Aus dem Brief an den Vater, 1919)<br />
(9) “Sonntag, den 19. Juli 1910, geschlafen, aufgewacht, geschlafen, aufgewacht, elendes Leben” (Aus den<br />
Tagebüchern)<br />
(10) “Abend, halb zwölf Uhr. Dass ich, solange ich von meinem Bureau nicht befreit bin, einfach verloren<br />
bin, das ist mir über alles klar, es handelt sich nur darum, solange es geht, den Kopf so hoch zu halten, dass<br />
ich nicht ertrinke.” (Aus den Tagebüchern, 18.12.1910)<br />
(11) “ 4. Oktober. Ich bin unruhig und giftig.... Denke ich daran, so scheint es mir, dass ich es im Bureau<br />
auch dann nicht aushalten könnte, wenn man mir sagte, dass ich in einem Monat frei sein werde” (1911)
8<br />
Tagebüchern unter dem 9.10.1911, und irrt sich dabei nur um ein einziges Jahr), hat zwei<br />
Ohnmachtsanfälle, die sich als besonders bedeutsam erweisen werden; nüchtern notiert er:<br />
“Wie ich heute aus dem Bett steigen wollte, bin ich einfach zusammengeklappt. Es hat das<br />
einen sehr einfachen Grund, ich bin vollkommen überarbeitet...” - (19.02.1911); weniger<br />
als ein Jahr später, wiederum im Februar, trägt er in sein Tagebuch ein: “Kleiner<br />
Ohnmachtsanfall gestern im Café City mit Löwy. Das Herabbeugen über ein Zeitungsblatt,<br />
um ihn zu verbergen.” (05.02.1912). In der Tat sind die letzten Monate des Jahres 1911<br />
voller Notizen, die mehr als Zweifel an seinem miserablen Gesundheitszustand verraten<br />
(12).<br />
<strong>Kafka</strong> fühlt sich leer, kraftlos, von innen her krank (13); er leidet unter Schlaflosigkeit, die<br />
er - Jahre später - auch auf eigene Weise interpretieren wird (14). Er fühlt sich der Welt<br />
entfremdet (15), physisch am Ende. Auf diesen Zustand kommt er tags darauf (22.11) in<br />
einer kalten Analyse zurück (16). Diese Untersuchung führt er rücksichtslos fort, sodass er<br />
am 23. November seinen Tagebüchern eine weitere bestürzende Überlegung anvertraut:<br />
“Von was für Zuständen ich durch meine Lebensweise abhängig werde! Heute nacht habe<br />
ich etwas besser als in der letzten Woche geschlafen, heute Nachmittag sogar ziemlich gut,<br />
ich habe sogar jene Verschlafenheit, die auf mittelguten Schlaf folgt, infolgedessen<br />
befürchte ich, weniger gut schreiben zu können, fühle, wie sich einzelne Fähigkeiten tiefer<br />
ins Innere schlagen, und bin auf alle Überraschungen vorbereitet, das heisst sehe sie<br />
schon.”<br />
(12) “ 15. November. Gestern abend schon mit einem Vorgefühl die Decke vom Bett gezogen, mich gelegt<br />
und wieder aller meiner Fähigkeiten bewusst geworden, als hielte ich sie in der Hand; sie spannten mir die<br />
Brust, sie entflammten mir den Kopf, ein Weilchen wiederholte ich, um mich darüber zu trösten, dass ich<br />
nicht aufstand, um zu arbeiten: Das kann nicht gesund sein, das kann nicht gesund sein, und wollte den<br />
Schlaf mit fast sichtbarer Absicht über den Kopf ziehen...” (Aus den Tagebüchern, 1911)<br />
(13) “Drei Nächte nicht geschlafen, bei dem kleinsten Versuche, etwas zu machen, gleich auf dem Grunde<br />
meiner Kraft” (Aus den Tagebüchern, 16.11.1911)<br />
(14) “Vielleicht verbirgt sich hinter dieser Schlaflosigkeit nur eine grosse Todesangst. Vielleicht fürchte ich<br />
mich, dass die Seele - welche mich im Schlaf verlässt - nicht mehr zurückkehren könnte. Vielleicht ist die<br />
Schlaflosigkeit nur das allzu wache Bewusstsein der Sünde, das sich vor der Möglichkeit eines raschen<br />
Gerichtes fürchtet” (Janouch, G.: Gespräche mit <strong>Kafka</strong>)<br />
(15) “Nun liege ich auf dem Kanapee, mit einem Fusstritt aus der Welt geworfen, passe auf den Schlaf auf,<br />
der nicht kommen will, und wenn er kommt, mich nur streifen wird...” (Aus den Tagebüchern, 21.11.1911)<br />
(16) “Sicher ist, dass ein Haupthindernis meines Fortschritts mein körperlicher Zustand bildet. Mit einem<br />
solchen Körper lässt sich nichts erreichen. Ich werde mich an sein fortwährendes Versagen gewöhnen<br />
müssen. Von den letzten wilddurchträumten, aber kaum weilchenweise durchschlafenen Nächten bin ich<br />
heute früh so ohne Zusammenhang gewesen.” (Aus den Tagebüchern, 22.11.1911)
9<br />
Genau ein Jahr später braucht er nur eben diesen Seelenzustand heraufzubeschwören, um<br />
der "<strong>Verw</strong>andlung" Gestalt zu geben. Als der Reisende Gregor Samsa eines Morgens aus<br />
unruhigen Träumen erwacht, findet er sich in ein riesiges Insekt verwandelt und wundert<br />
sich darüber ganz und gar nicht. Die genaue Beschreibung dieses "ekelhaften" Tieres, das<br />
niemand je in Wirklichkeit gesehen hat, sondern das ausschliesslich der Erfindungskraft<br />
<strong>Kafka</strong>s entstammt, ist verblüffend.<br />
<strong>Kafka</strong> spricht von Ungeziefer, also von einem parasitären und schädlichen Insekt, als dem<br />
übelsten, was es in der Natur und, im übertragenen Sinne, in der Gesellschaft gibt. Er freut<br />
sich beinahe, wenn er sich ausführlich mit der Physiognomie des Insekts beschäftigt, das<br />
“auf seinem panzerartig harten Rücken lag und... seinen gewölbten, braunen, von<br />
bogenförmigen Versteifungen geteilten Bauch sah...” . Und um die Beschreibung zu<br />
vervollständigen, gibt er ein Bild von den vielen Füsschen, die im Vergleich zu den<br />
ungewohnten Dimensionen des Tieres angsterregend klein sind und unkontrollierbar<br />
herumstrampeln. Diese <strong>Verw</strong>andlung also wundert Gregor nicht, sie bestürzt ihn nicht<br />
einmal. Er erleidet sie einfach und akzeptiert sie sofort, sozusagen als alternative<br />
Möglichkeit, die Ketten der täglichen Routine zu sprengen und sich endlich aus jenem<br />
“anstrengenden Beruf” zu erlösen. Dass es ihm unmöglich ist, sich aus dem Bett zu<br />
erheben, gibt ihm vielmehr die Gelegenheit, über die Absurdität seines Lebens als<br />
Reisender nachzudenken, deren er sich eigentlich schon längst völlig bewusst war. Wie oft<br />
hatte er daran gedacht, alles zum Teufel zu wünschen, sich den Direktor vorzunehmen und<br />
ihm alles, was er dachte, ins Gesicht zu schreien.... Ja, er hätte schon längst dafür gesorgt,<br />
dass er entlassen würde, hätte ihn nicht der Gedanke an seine Eltern davon abgehalten. Er<br />
hing zu sehr an ihnen und wusste, wie nötig seine Arbeit für sie war. Aber nun war dank<br />
der <strong>Verw</strong>andlung der Augenblick gekommen, den er vorausgeahnt hatte und von dem er<br />
einige Monate später, am 26.6.1913, ausdrücklich zu derselben Felice gesprochen hatte:<br />
“Das Bureau? Dass ich es einmal aufgeben kann, ist überaus ausgeschlossen. Ob ich es<br />
aber nicht einmal aufgeben muss, weil ich nicht mehr weiter kann, das ist durchaus nicht so<br />
ausgeschlossen” (<strong>Kafka</strong>, F.: Briefe an Felice)<br />
Gregor kann nicht aufstehen, er hat sogar den Wecker nicht gehört. Ganz allmählich<br />
nimmt er seine <strong>Verw</strong>andlung in ein ekelhaftes und monströses Insekt wahr. Er betrachtet<br />
diese <strong>Verw</strong>andlung als den Preis für seine Erlösung und akzeptiert sie mit kaum<br />
verhülltem Vergnügen; endlich, aus unruhigen Träumen erwacht, konnte er noch ein wenig<br />
liegen bleiben und sich unter der Bettdecke räkeln.... Seine Lage ist allerdings nicht<br />
sonderlich bequem, er findet sich praktisch bewegungsunfähig “auf seinem panzerartig
harten Rücken”. Es bleibt ihm nicht erspart, vor sich diese seltsamen Beinchen zu sehen,<br />
die sich<br />
unkontrolliert bewegen - “Seine vielen, im Vergleich zu seinem sonstigen<br />
Umfang kläglich dünnen Beine flimmerten ihm hilflos vor den Augen” -.<br />
"Was ist mit mir geschehen?", ist Gregors erste Reaktion auf seinen neuen Zustand.<br />
Er denkt, er sei noch das Opfer jener wiederkehrenden hässlichen Träume und sucht<br />
Bezugspunkte, um sich vom Gegenteil zu überzeugen. Ihm genügt dabei ganz wenig; er<br />
lässt seinen Blick kurz über das Zimmer schweifen, wo er die paar Dinge erkennt, die ihm<br />
gehören und hat die gewünschte Bestätigung: Ja, er war in seinem eigenen Zimmer, es<br />
konnte sich nicht um einen Traum handeln. Dergestalt beruhigt, wendet er seinen Blick<br />
zum Fenster, ein in <strong>Kafka</strong>s Schriften häufig zu findendes Element, das oft die einzige<br />
Verbindung zur Aussenwelt darstellt und unentbehrlich ist für denjenigen, der am Leben<br />
als Zuschauer teilnehmen muss.<br />
Dieses Fenster erscheint bereits 1904 bei <strong>Kafka</strong> (17) und nimmt verschiedene Funktionen<br />
wahr; mal wird es vorübergehende Zuflucht oder bietet die Möglichkeit zur Befreiung<br />
aus einer extrem unbehaglichen Situation (18), mal wird es gefährliche Versuchung -<br />
besonders am Weihnachtstag (19). Das Fenster hat auch in dieser Erzählung präzise<br />
Funktionen : es ist fast unentbehrlich für Gregors Versuch, während er noch im Bett liegt<br />
und durch eben dieses Fenster schaut, sich Elemente ins Gedächtnis zurückzurufen, die er<br />
anschliessend mit klarem Verstand analysiert. “In solchen Augenblicken richtete er die<br />
Augen möglichst scharf auf das Fenster, aber leider war aus dem Anblick des<br />
Morgennebels, der sogar die andere Seite der engen Strasse verhüllte, wenig Zuversicht<br />
und Munterkeit zu holen.”. Auf diese Weise bildet das Fenster, ebenso wie das Kanapee -<br />
“Oft lag er dort die ganzen Nächte über, schlief keinen Augenblick und scharrte nur<br />
stundenlang auf dem Leder” - in der Folgezeit eine mögliche Alternative, die nicht<br />
endenwollenden Stunden seiner Tage zu verbringen: “Oder er scheute nicht die grosse<br />
Mühe, einen Sessel zum Fenster zuschieben,<br />
(17) “Unter allen den jungen Leuten habe ich eigentlich nur mit Dir gesprochen, und wenn ich schon mit<br />
andern sprach, so war es nur nebenbei oder Deinetwegen oder durch Dich oder in Beziehung auf Dich. Du<br />
warst, neben vielem andern, auch etwas wie ein Fenster für mich, durch das ich auf die Gassen sehen konnte.<br />
Allein konnte ich das nicht (Aus einem Brief an Oskar Pollack, 9.11.1903 - <strong>Kafka</strong>, F.: Briefe)<br />
Dieselbe Metapher kommt in der Erzählung “Das Gassenfenster” wieder: Wer verlassen lebt und sich doch<br />
hie und da irgendwo anschliessen möchte, wer mit Rücksicht auf die Veränderungen der Tageszeit, der<br />
Witterung, der Berufverhältnisse und dergleichen ohne weiteres irgend einen beliebigen Arm sehen will, an<br />
dem er sich halten könnte, - der wird es ohne ein Gassenfenster nicht lange treiben”. (<strong>Kafka</strong>, F.: Betrachtung)<br />
(18) “14. Dezember. Mein Vater machte mir mittags Vorwürfe, weil ich mich nicht um die Fabrik<br />
kümmere... der Vater zankte weiter, ich stand beim Fenster und schwieg...” (Aus den Tagebüchern, 1911)<br />
(19) “25. Dezember... Gegen das Fenster laufen und durch die zersplitterten Hölzer und Scheiben, schwach<br />
nach Anwendungen aller Kraft, die Fensterbrüstung überschreiten...” (Aus den Tagebüchern, 1911)<br />
dann die Fensterbrüstung hinaufzukriechen und, in den Sessel gestemmt, sich ans Fenster<br />
zu lehnen, offenbar nur in irgendeiner Erinnerung an das Befreiende, das früher für ihn<br />
10
11<br />
darin gelegen war, aus dem Fenster zu schauen”. Das Fenster erscheint mithin in der<br />
"<strong>Verw</strong>andlung" bereits kurz nach Beginn der Handlung: “Gregors Blick richtete sich dann<br />
zum Fenster, und das trübe Wetter - man hörte Regentropfen auf das Fensterblech<br />
aufschlagen - machte ihn ganz melanchonisch.” Das Fenster ist in diesem Fall nicht nur<br />
eine Abschweifung, sondern unterstreicht vielmehr Gregors instinktive Gleichgültigkeit<br />
gegenüber dem, was ihm geschehen ist. Es ist nicht die Erkenntnis, dass er ein ekelhaftes<br />
Insekt geworden ist, die ihn melancholisch stimmt, sondern das traurige und regnerische<br />
Wetter, das durch eben dieses Fenster hereinkommt. In diesem Zustand hat er nur einen<br />
Wunsch: “Wie wäre es, wenn ich noch ein wenig weiterschliefe und alle Narrheiten<br />
vergässe...”. Gregor erfasst intuitiv, dass das, was mit ihm geschehen ist, nicht normal ist<br />
und, da er keinen passenden Ausdruck dafür findet, nennt er das Ganze “Wahnsinn”. Mit<br />
unvergleichlicher Kunst knüpft <strong>Kafka</strong> nun ein Netz, das den Wahnsinn zu alltäglicher,<br />
unvorstellbarer Normalität macht. Von nun an ist das Ganze eine Folge von Bildern und<br />
Situationen voller Dramatik. Gregor scheint die Ruhe nicht verloren zu haben, er bleibt<br />
vollkommen klar; es muss ihm nur gelingen aufzustehen. "Sein" Zug geht um fünf... und<br />
nun zeigt sein Wecker, der auf dem Nachttischchen weiter tickt, halb sieben , und die<br />
Zeiger rücken unaufhaltsam vor und nähern sich viertel vor sieben. In ihm beginnt sich<br />
Ungläubigkeit und <strong>Verw</strong>irrung breitzumachen: “Sollte der Wecker nicht geläutet haben ?”.<br />
In der Zwischenzeit stellt er sich die Unannehmlichkeiten vor, die ihm zwangsläufig aus<br />
seiner "Schuld" entstehen werden. Er hat schon die Reihe von strengen Personen vor<br />
Augen, die ihm unbarmherzig Verspätung, Faulheit, Schlamperei, Versagen vorwerfen.<br />
Während ihn diese Gedanken gefangen halten, wird auch die Familie von der<br />
"<strong>Verw</strong>andlung" ergriffen. Auf die Besorgnis, die anfänglich mit grösster Vorsicht von der<br />
leisen Stimme der Mutter geäussert wurde und die ihn, sanft an die Tür klopfend, daran<br />
erinnerte, dass es bereits viertel vor sieben war, folgt die Reaktion des Vaters, der zuerst<br />
mit der Faust gegen die Tür hämmmert und dann laut "Gregor, Gregor!" schreit. Auf<br />
dieses Verhalten der Eltern, aus dem verschiedene Gefühle sprechen, folgt das der<br />
Schwester Grete, die, das Ganze sozusagen erahnend, in ihrem Zimmer bleibt, und von<br />
dort betrübt flüstert: ”Gregor? Ist dir nicht wohl? Brauchst du etwas?”.<br />
So zeichnen sich die Beziehungen im Hause Samsa ab, während Gregor, dessen<br />
Anderssein Fremdsein zu werden beginnt, unbeirrt seine zahlreichen, wenngleich<br />
vergeblichen Versuche fortsetzt, aus dem Bett zu kommen. Aber, trotz der Aufregung des<br />
Augenblicks, “vergass er nicht, sich zwischendurch zu erinnern, dass viel besser als<br />
verzweifelte Entschlüsse ruhige und ruhigste Überlegung sei”.
12<br />
Dieses extrem rationale Verhalten taucht in <strong>Kafka</strong>s Werken immer wieder auf und erhält<br />
seine exemplarische Bedeutung in der Erzählung “Ein Bericht für eine Akademie”. Es<br />
spricht ein Affe, der an der Elfenbeinküste gefangen worden war, als er versuchte, mit<br />
seinem Rudel am Ufer eines Flusses Wasser zu trinken, und nun in einen Holzkäfig auf<br />
einem Schiff der Firma Hagenbeck gesperrt ist, das Richtung Europa fährt. Das Tier, das<br />
sich, als es noch wild lebte, extremer Bewegungsfreiheit erfreute, findet sich nun auf<br />
wenigen Quadratmetern wieder, aus denen es, schlimmer noch, keinen Ausweg gibt. Mit<br />
grosser Klarkeit - und auf menschliche Weise, wie er selbst später zugibt - prüft er die<br />
verschiedenen Möglichkeiten. Mit seinen damaligen Zähnen wäre es ihn vielleicht<br />
gelungen, das Schloss aufzubeissen und die Flucht zu wagen; aber die sich ihm bietenden<br />
Aussichten waren alles andere als rosig. Er wäre mit Sicherheit wieder eingefangen und in<br />
einen noch engeren Käfig gesperrt worden. Oder er hätte in den Nachbarkäfigen geendet,<br />
in denen sich riesige Schlangen befanden, die ihn erdrosselt hätten, oder wenn er sich<br />
schliesslich auf Deck geschlichen hätte, wäre seine einzige Alternative der Sprung ins<br />
Meer gewesen, wo er sich einen winzigen Atemzug lang der Freiheit erfreut hätte und<br />
dann ertrunken wäre.<br />
Nein, er würde sich nicht verführen lassen von diesen vagen Aussichten, die man<br />
gemeinhin Verzweiflungstaten nennen würde. Er musste seine Ruhe wiederfinden und eine<br />
Lösung für sein Leben suchen; in seinem Falle, sich zähmen zu lassen und ein Zirkusaffe<br />
zu werden....<br />
Und so weist auch Gregor in der "<strong>Verw</strong>andlung" "Verzweiflungstaten" zurück. Masstab für<br />
sein Handeln ist es, die nötige Ruhe zu bewahren, die unentbehrlich ist, um einen<br />
möglichen Ausweg zu finden.<br />
Unterdessen scheint auch die Zeit stehen geblieben zu sein, die Minuten werden immer<br />
länger. Der unerbittliche Wecker klingelt um 7 Uhr; tatsächlich ist erst eine Viertelstunde<br />
vergangen, seit die liebevolle und besorgte Mutter an seine Tür geklopft hat, weil sie<br />
dachte, ihn wecken zu müssen.<br />
Gregor, der deutlich vorhersieht, was in Kürze geschehen wird, sucht alles zu<br />
rationalisieren. Er gibt sich präzise Zeitvorgaben, innerhalb derer er bestimmte<br />
Handlungen ausführen will und nimmt sich vor, das Bett, an das er gefesselt zu sein<br />
scheint, bis 7,15 Uhr zu verlassen. Und nun fangen die Versuche, Überlegungen und<br />
Gedanken in einer ständig wachsenden Spannung wieder an, die die Atmosphäre typisch<br />
kafkaesk werden lässt.
13<br />
Nach 10 Minuten - es fehlen noch fünf Minuten an der von ihm gesetzten Frist von 7,15<br />
Uhr erscheint der Prokurist in Person. Dieses Ereignis, das er gleichzeitig erwartet und<br />
gefürchtet hat, gibt Gregor die Kraft, sich mit mehr Schwung hin und her zu bewegen und<br />
schliesslich auf den Boden zu fallen. So gelingt es ihm endlich, das Bett zu verlassen. Die<br />
leichte Wunde, die er sich dabei am Kopf zuzog, war dafür ein noch erträglicher Preis. Die<br />
Szene mit dem Herrn Prokuristen - dessen Präsenz erst von der Schwester und dann vom<br />
Vater angekündigt wird - ist der Beginn einer raschen Folge von Ereignissen, die<br />
schlussendlich alle mitreissen.. Der Vater besteht darauf, dass Gregor die Tür öffnet, der<br />
Prokurist selbst bemüht sich freundlich und liebenswürdig zu sein, aber es ist die Mutter,<br />
die in diesem Augenblick die zentrale Rolle übernimmt und diesen Sohn verteidigt, der<br />
doch nicht plötzlich verrückt geworden sein konnte. Es musste doch eine Erklärung dafür<br />
geben,dass er sich in sein Zimmer einschloss: “ Ihm ist nicht wohl, ihm ist nicht wohl,<br />
glauben Sie mir, Herr Prokurist”. (20)<br />
So wird ein anderes Bild von anrührender Menschlichkeit gezeichnet: der Überraschung<br />
und Bestürzung des Prokuristen, der gekommen war, um die Gründe für Gregors Fehlen zu<br />
erurieren, wird die <strong>Verw</strong>irrung und Demütigung der Familie Samsa gegenübergestellt. Die<br />
Fürsorge der alten Mutter mit ihrem Versuch, ihren Sohn zu rechtfertigen, der sicherlich<br />
das<br />
Opfer einer plötzlichen Übelkeit sein muss, verrät unbewusst die Distanz zwischen<br />
ihnen: “Der Junge hat ja nichts im Kopf als das Geschäft”. Sie erstarrt buchstäblich<br />
angesichts des heftigen Urteils des Prokuristen: “Wenn ich auch andererseits sagen muss,<br />
dass wir<br />
(20) Die Beziehungen der Familie zu <strong>Kafka</strong> sind eindrucksvoll im letzten der drei Briefe beschrieben, die<br />
<strong>Kafka</strong> am 21. November 1912 an Felice richtete, an demselben Tag übrigens, an dem seine Mutter den<br />
Briefwechsel zwischen Franz und Felice "entdeckte" und beschloss, der möglichen Schwiegertochter selbst<br />
zu schreiben...Dabei muss man sich vor Augen halten, dass nur drei Tage vergangen sind, seit <strong>Kafka</strong> mit der<br />
Niederschrift der "<strong>Verw</strong>andlung" begonnen hat. Um den Schaden wieder gut zu machen, den seine Mutter<br />
mit ihrer allzu grossen"Fürsorglichkeit" angerichtet hatte, sah er sich deshalb gezwungen, seine Geschichte<br />
zu unterbrechen und sich ausschliesslich Felice zu widmen. Er schrieb ihr drei lange Briefe , in denen er<br />
sich unter anderem über seine Beziehungen zu seinen Eltern verbreitet: “Ihre Liebe zu mir ist geradeso gross,<br />
wie ihr Unverstand mir gegenüber, und die Rücksichtslosigkeit, die aus diesem Unverstand in ihre Liebe<br />
übergeht, ist womöglich noch grösser und für mich zeitweilig ganz unfassbar.... Ich habe die Eltern immer als<br />
Verfolger gefühlt, bis vor einem Jahr vielleicht war ich gegen sie wie vielleicht gegen die ganze Welt<br />
gleichgültig wie irgendeine leblose Sache, aber es war nur unterdrückte Angst, Sorge und Traurigkeit wie ich<br />
jetzt sehe”. ( <strong>Kafka</strong>, F.:Brief an Felice) In dem Brief an den Vater von Felice - 28.8.1913 - gibt es einen<br />
anderen bedeutsamen Akzent: “Ich lebe in meiner Familie, unter den besten, liebvollsten Menschen, fremder<br />
als ein Fremder”. (<strong>Kafka</strong>, F.:Briefe an Felice)<br />
Geschäftsleute - wie man will, leider oder glücklicherweise - ein leichtes Unwohlsein sehr<br />
oft aus geschäftlichen Rücksichten einfach überwinden müssen”.
14<br />
Gregor bleibt diesen Gästen gegenüber nicht unsensibel, ja, er sucht sogar, sie alle mit<br />
einem beiläufigen " Komme gleich" zu beruhigen; aber, als der Vater, ungeduldig<br />
geworden, wieder an die Tür klopft und ihn in immer entschiedenerem Ton auffordert, den<br />
Prokuristen eintreten zu lassen, reagiert er mit umso entschiedenerer Ablehnung. Dieses<br />
"Nein" Gregors führt zu einer peinlichen Stille, nur unterbrochen vom Schluchzen der<br />
Schwester, die mit Absicht im Zimmer nebenan geblieben war, wo sie Gefangene ihres<br />
Schmerzes sein konnte. In dieses Szenario vollkommener <strong>Verw</strong>irrung fügen sich nunmehr<br />
die Versuche Gregors, zuerst Erklärungen zu liefern und dann eine Reihe schmerzhafter<br />
Bewegungen zu absolvieren, um sich aufzurichten und die Tür zu öffnen. Bei seinen<br />
Erklärungen handelte es sich jedoch nur um unverständliche Seufzer, die den entsetzten<br />
Prokuristen noch weiter verwirrten.<br />
Dieser fühlt sich im ersten Augenblick sozusagen auf den Arm genommen. Als er sich<br />
jedoch plötzlich des völlig Unvollstellbaren -” Das war eine Tierstimme”- bewusst wurde,<br />
hat er nur noch einen Wunsch, so rasch wie möglich zu verschwinden. Die Situation<br />
scheint blockiert. Eine Intervention von aussen ist unumgänglich. Die Eltern übernehmen<br />
diese Aufgabe sofort, jeder auf seine Weise. Die schmerzerfüllte und tränenüberströmte<br />
Mutter - “Um Gottes willen, er ist vielleicht schwer krank, und wir quälen ihn” - bittet<br />
Grete, einen Arzt zu rufen, während vom Eingang her der Vater mit mächtiger Stimme das<br />
Hausmädchen auffordert: “Anna! Anna!...sofort einen Schlosser holen!”. Auf dieses<br />
fieberhafte und erschütternde Verhalten reagiert Gregor mit äusserster Ruhe.<br />
Unvergleichlich ist die Beschreibung seiner Bewegungen, der Anstrengung, mit der er sich<br />
zur Tür schleppt, der Kraft, mit der er sie zu öffnen versucht - “ Je nach dem Fortschreiten<br />
der Drehung des Schlüssels umtanzte er das Schloss; hielt sich jetzt nur noch mit dem<br />
Munde aufrecht, und je nach Bedarf hing er sich an den Schlüssel oder drückte ihn dann<br />
wieder nieder mit der ganzen Last seines Körpers”. Schliesslich gibt das Schloss nach, die<br />
Tür geht auf, und den Anwesenden erscheint nicht der ihnen bekannte Gregor, der<br />
sanftmütige und gefügige Reisende, sondern ein schauderhaftes Monster. Der Prokurist<br />
reagiert mit einem lauten "Oh", das zugleich Ungläubigkeit und Schrecken verrät; “die<br />
Mutter - sie stand hier trotz der Anwesenheit des Prokuristen mit von der Nacht her noch<br />
aufgelösten, hoch sich sträubenden Haaren - sah zuerst mit gefalteten Händen den Vater<br />
an, ging dann zwei Schritte zu Gregor hin und fiel inmitten ihrer rings um sie herum sich<br />
ausbreitenden Röcke nieder, das Gesicht ganz unauffindbar zu ihrer Brust gesenkt”. Gregor<br />
bleibt unerschütterlich. Seine Aufmerksamkeit in diesem unangenehmen Augenblick gilt<br />
nicht seinen Eltern, sondern dem Prokuristen. Ihm muss er nachlaufen, ihn muss er
15<br />
erreichen, ihn muss er beruhigen und davon überzeugen, dass nichts Schlimmes<br />
vorgefallen ist und dass alles wieder wie zuvor werden kann, ja werden muss. Bei diesem<br />
äussersten Versuch, die Normalität wieder herzustellen, hatte er aber nicht seinen<br />
derzeitigen Zustand bedacht. Sein Lauf endete, kaum dass er begonnen hatte, in einem<br />
fatalen Sturz . Gregor fand sich auf dem Boden wieder, mit Prellungen und benommen,<br />
gerade neben der schockierten und ohnmächtig gewordenen Mutter. Da beginnt er<br />
allmählich, sich seines eigenen Scheiterns bewusst zu werden. Er erkennt immer klarer,<br />
dass er ein unnützes Wesen geworden ist, abscheulich und obendrein auch noch Quelle des<br />
Schmerzes für die ihm liebsten Menschen. Zur gesellschaftlichen Frustration gesellt sich,<br />
gerade durch den Sturz, die Gewissheit, einen anderen, noch viel schwereren Verlust<br />
erleiden zu müssen: den Entzug von Zuneigung, konkret die Zurückweisung durch die<br />
Mutter. Die arme Frau, die ihn nun ganz aus der Nähe sehen kann, schreit:” Hilfe, um<br />
Gottes willen Hilfe!” und ergreift instinktiv die Flucht. Dabei fällt sie über den Tisch mit<br />
den Resten des Frühstücks. Gregor kann nur noch in höchstem Schmerz zwei Worte<br />
flüstern “Mutter, Mutter”, die seine Entfremdung endgültig besiegeln. Die aufgewühlte<br />
Mutter flieht vom Tisch und stürzt “dem ihr entgegeneilenden Vater in die Arme”.<br />
Vielleicht ist es gerade die Verzweiflung, die er in den Augen der sich umarmenden Eltern<br />
sieht, die Gregor dazu bringt, einen letzten vergeblichen Versuch zu machen, auf den<br />
Prokuristen zuzugehen. Dessen Flucht wirkt wie ein Peitschenschlag auf Vater und Sohn,<br />
die wie von Zauberhand zu Opfer und Henker werden. Gregor bleibt nur noch, sein<br />
vollkommenes Scheitern einzugestehen: mit der Flucht des Prokuristen verschwindet auch<br />
die Anstellung und mit ihr sein Nutzen für die Gesellschaft. Von nun an ist er gezwungen,<br />
sich gänzlich in dem schmutzigen "Ungeziefer" wiederzuerkennen, ein Wort, das <strong>Kafka</strong><br />
aus der väterlichen Sprache entliehen hat. So pflegte der "übermächtige" Vater einen<br />
Jugendfreund <strong>Kafka</strong>s, den jüdischen Schauspieler Löwy, zu bezeichen, von dessen Besuch<br />
er ihm abriet (21). Das Urteil ist gesprochen, Berufung nicht möglich. Dem Sohn, der<br />
zweifellos schuldig ist, weil er nicht imstande war, den Unterhalt der Eltern zu<br />
gewährleisten, bleibt nur, die Hinrichtung abzuwarten. Und schon droht ihm der Henker-<br />
Vater, “durch die Flucht des Prokuristen völlig verworren”, und beginnt, ihn, mit einem<br />
Stock und einer Zeitung bewaffnet, zu verfolgen. Dabei “stiess er Zischlaute aus, wie ein<br />
Wilder”. Der arme Gregor versucht sich in sein Zimmer zurückzuziehen. Nach<br />
unsäglichen Mühen - er hatte enorme Probleme rückwärtszugehen - erreicht er schliesslich<br />
die Schwelle der für seinen Umfang zu engen Tür. Dort muss er anhalten, da er Gefahr<br />
läuft steckenzubleiben. Aber “da gab ihm der Vater von hinten einen jetzt wahrhaftig
erlösenden starken Stoss, und er flog, heftig blutend, weit in sein Zimmer hinein. Die Tür<br />
wurde noch mit dem Stock zugeschlagen, dann war es endlich still”. Mit dieser Szene<br />
schliesst das erste Kapitel und, so möchte man sich fast vorstellen, auch die erste Nacht,<br />
die <strong>Kafka</strong> seiner Geschichte gewidmet hat. Sie beginnt zur Obsession zu werden. Sie<br />
verlangt totale Hingabe und darüberhinaus Zeit, viel Zeit, die <strong>Kafka</strong> nicht hat.<br />
Zu einem bestimmten Zeitpunkt im Laufe der Nacht (genau gesagt um halb zwei, wie wir<br />
aus dem Brief an Felice wissen, der er jede Nacht schrieb, sobald er seinen "Kampf" mit<br />
der<br />
Geschichte Gregors beendet hatte) ist er gezwungen, den Text zur Seite zu legen, da er von<br />
der ausserordentlich schmerzhaften Geburt entkräftet war (22).<br />
Dass er die Erzählung<br />
unterbrechen musste, macht ihn unruhig; er fürchtet, seinen<br />
Rhythmus zu verlieren, nicht durchhalten zu können und so nicht all das aufschreiben zu<br />
können, was ihn innerlich umtreibt. Er fürchtet, dass diese Pausen, die sich zwangsläufig<br />
wiederholen, schliesslich negativ auf seine Geschichte selbst wirken. Das beklagt er - in<br />
den ersten Morgenstunden des 18. November 1912 - gegenüber Felice: “Meine Liebste, es<br />
ist ½ 2 Nachts, die angekündigte Geschichte ist bei weitem noch nicht fertig... Hätte ich die<br />
Nacht frei, um sie, ohne die Feder abzusetzen, durchschreiben zu können bis zum<br />
Morgen... Nein, über das Bureau rege ich mich durchaus nicht zuviel auf, erkenne die<br />
Berechtigung der Aufregung daraus, dass sie schon fünf Jahre Bureauleben überdauert hat,<br />
von denen allerdings das erste Jahr ein ganz besonders schreckliches in einer<br />
Privatversicherungsanstalt war, mit Bureaustunden von 8 früh bis 7 abends, bis 8, bis ½ 9,<br />
pfui Teufel! Es gab da eine gewisse Stelle in einem kleinen Gang, der zu meinem Bureau<br />
führte, in dem mich fast jeden Morgen eine Verzweifelung anfiel, die für einen stärkeren,<br />
konsequenteren Charakter als ich<br />
(21) “Ohne ihn zu kennen,vergleichst du ihn in einer schrecklichen Weise, die ich schon vergessen habe, mit<br />
Ungeziefer”. (Aus dem Brief an den Vater, 1919)<br />
(22) Den Begriff "Geburt", mit dem er seine Erzählungen qualifiziert, benutzt er auch im Falle des<br />
"Urteils", das er von zehn Uhr abends bis sechs Uhr Morgens in der Nacht vom 22. auf den 23.September<br />
1912 heruntergehämmert hatte. “11. Februar. Anlässlich der Korrektur des Urteils schreibe ich alle<br />
Beziehungen auf, die mir in der Geschichte klargeworden sind, soweit ich sie gegenwärtig habe. Es ist dies<br />
notwendig, denn die Geschichte ist wie eine regelrechte Geburt mit Schmutz und Schleim bedeckt aus mir<br />
herausgekommen, und nur ich habe die Hand, die bis zum Körper dringen kann und Lust dazu hat”. (<strong>Kafka</strong>:<br />
Tagebücher, 11.2.1913)<br />
es bin überreichlich zu einem geradezu seligen Selbstmord genügt hätte”. (<strong>Kafka</strong> F.: Briefe<br />
an Felice)<br />
<strong>Kafka</strong> scheint, so der Tenor dieses Briefes, nun das Büro akzeptiert zu haben und mit ihm<br />
das Schicksal, das ihn dort erwartet. Seine Befindlichkeit spiegelt sich in gewisser Weise<br />
16
17<br />
wieder im zweiten Kapitel der <strong>Verw</strong>andlung, das ganz darauf abzielt, das zugleich<br />
menschliche und tierische Erleben Gregors glaubhaft zu machen, der das Pech hat in dem<br />
Körper eines parasitären, schädlichen und zudem auch noch "ekelhaften" Untieres seine<br />
menschliche Sensibilität bewahrt zu haben. Das monströse Insekt verbringt nun den<br />
grössten Teil seiner Zeit damit auszuruhen, auf dem Sofa zu liegen, den Blick ins Leere<br />
gerichtet, und mit sich selbst zu sprechen. Dieser Zustand ist <strong>Kafka</strong> höchst bekannt, und er<br />
spricht oft von ihm. Das "Kanapee" wird immer mehr zum idealen Refugium, um<br />
nachzudenken (23), um erbarmungslos sein eigenes Anderssein zu untersuchen (24) oder mit<br />
der Versuchung zu liebäugeln, seine Existenz zu beenden (25). Normalerweise jedoch spielt<br />
das Kanapee eine ihm angemessenere Rolle als Ort der Langeweile. Er spricht davon<br />
in einem Brief an Felice vom 27.6.1913 (26), in dem er wiederholt, was er bereits in<br />
seinen Tagebüchern (27) gesagt hatte. Später bekräftigt er es erneut - gewissermassen als<br />
Bilanz - in einem Brief an den Vater, in dem er noch einmal seine Entfremdung<br />
unterstreicht: “Es gab Jahre, in denen ich bei voller Gesundheit mehr Zeit auf dem<br />
Kanapee verfaulenzt habe, als Du in Deinem ganzen Leben, alle Krankheiten<br />
eingerechnet.... Wahrscheinlich bin ich in meiner Anlage nicht faul, aber es gab für mich<br />
nichts zu tun. Dort, wo ich lebte, war ich verworfen, abgeurteilt, niedergekämpft ...”.<br />
(<strong>Kafka</strong>, F.: Brief an den Vater, 1919) Wie sich aus diesen Hinweisen erkennen lässt, findet<br />
<strong>Kafka</strong>s eigener Zustand präzise Entsprechungen bei seinen Geschöpfen in der<br />
"<strong>Verw</strong>andlung". Die Erzählung geht so stringent und aufrüttelnd weiter, dass alles<br />
Folgende selbstverständlich erscheint. Dieses parasitäre und<br />
(23) “27. Dezember...Zum Teil habe ich den Nachmittag verschlafen, während des Wachseins lag ich auf<br />
dem Kanapee, überdachte einige Liebeserlebnisse aus meiner Jugend...” (Aus den Tagebüchern, 1910)<br />
(24) “13. Dezember. Aus Müdigkeit nicht geschrieben und abwechselnd auf dem Kanapee im warmen und<br />
im kalten Zimmer gelegen, mit kranken Beinen und ekelhaften Träumen”. (Aus den Tagebüchern, 1911)<br />
(25) “8. März. Vorgestern Vorwürfe wegen der Fabrik bekommen. Eine Stunde dann auf dem Kanapee über<br />
Aus-dem-Fenster-Springen nachgedacht”. (Aus den Tagebüchern, 1912)<br />
(26) “Ich bin so traurig, es gibt so viele Fragen, ich sehe keinen Ausweg und bin so elend und schwach, dass<br />
ich immerfort auf dem Kanapee liegen und ohne einen Unterschied zu merken die Augen offenhalten oder<br />
schliessen könnte. Ich kann nicht essen, nicht schlafen, im Bureau habe ich jeden Tag Verdruss und<br />
Vorwürfe, immer durch meine Schuld”. (Aus einem Brief an Felice, 27.06.1913)<br />
ekelhafte Tier, das mit den Menschen zusammenleben muss, wird verabscheut, verurteilt,<br />
möglichst zertreten. Es gibt keine Alternative für dieses "Monstrum", das nun nur das<br />
Problem hat, wie es die unendlichen Stunden des Tages und der Nacht verbringen soll,<br />
bevor das unabwendbare Ende auf es zukommt. An dieser Stelle zeigt <strong>Kafka</strong> seine beste
18<br />
Seite, beschreibt sich selbst, wenn er immer wieder auf diesen “Galgenhumor”<br />
zurückgreift, mithilfe dessen es ihm gelingt, den Anschein alltäglicher Normalität in das<br />
neue Leben Gregors zu bringen. Und dabei vergisst er nicht einmal die kleinsten<br />
Besonderheiten, kniet sich in Details, beschreibt die Essgewohnheiten, die zwangsläufig<br />
andere geworden sind. Das Tier verweigert nun die Milch, die die Schwester ihm in den<br />
Napf schüttet und die früher sein Lieblingsgetränk war. Statt dessen lutscht er begierig<br />
Stückchen von eben dem Käse, den er erst zwei Tage zuvor als ungeniessbar bezeichnet<br />
hatte... Seine bevorzugten Speisen werden Knochen und festgewordene Sossen, die<br />
bescheidenen Reste des Abendessens der notgredungen genügsam gewordenen Familie.<br />
Gregor benimmt sich nun wie das, was er geworden ist: ein riesiges Insekt. Man sieht das<br />
daran, was er isst und wie er es isst, aber auch an den schwarzen Strichen, die er an den<br />
Mauern hinterlässt, die er hinaufzukriechen beginnt. Aber, obwohl er zum Tier verwandelt<br />
ist, bewahrt er seine menschlichen Gefühlsregungen und empfindet Zärtlichkeit und<br />
Zuneigung zu seiner kleinen Schwester, die auf ihre Weise versucht, sich um ihn zu<br />
kümmern. Es gibt zahlreiche Briefe, in denen wir genaue Hinweise auf die zärtlichen<br />
Beziehungen zwischen <strong>Kafka</strong> und seiner jüngsten Schwester, die für ihn u.a. auch<br />
als"besonderen" Beziehungen zu Ottla auf dem Laufenden zu halten (29).<br />
Besonders anrührend ist dabei sein Hinweis auf die "üblichen" Abendessen, der in die Zeit<br />
fällt, in der er "seine Geschichte" schreibt - “...Mein Nachmahl, meine jüngste Schwester<br />
sitzt dabei, knackt die Nüsse, isst selbst mehr als sie mir gibt und wir unterhalten uns<br />
meistens ausgezeichnet. Das ist das Nachtmahl, aber es gibt Zeiten, wo die liebe Schwester<br />
nicht genügt und ich ihr nicht genüge”. (Aus einem Brief an Felice, 25.11.1912).<br />
(27) “17. März...Heute den Nachmittag mit schmerzhafter Müdigkeit auf dem Kanapee verbracht”<br />
(Aus den Tagebüchern, 1912)<br />
Sekretärin arbeitete, finden....(28)<br />
<strong>Kafka</strong>, der drei Schwestern hatte, lag offenbar am Herzen, auch Felice über seine<br />
Zwischen Gregor und der siebzehnjährigen Grete gab es sicherlich eine sehr intensive<br />
Beziehung bereits vor dem Ereignis, das das Leben der Familie Samsa erschüttert hat. Sie<br />
bleibt trotz der <strong>Verw</strong>andlung bestehen, und nährt sich von kleinen alltäglichen Gesten.<br />
Bevor sie in sein Zimmer kommt, um seine Nahrung zu bringen, dreht die Schwester<br />
langsam den Schlüssel um, sozusagen, um ihren Besuch anzukündigen. Der Bruder
19<br />
seinerseits kriecht schnell unter das Bett, um ihr auf diese Weise seinen unangenehmen<br />
Anblick zu ersparen. Dies sind zwei Arten, die tiefe Zuneigung Gregors, der davon<br />
geträumt hatte, die Schwester auf das Konservatorium zu schicken, wie die lobenswerten<br />
Anstrengungen Gretes zu zeigen, sich an die neue Lage zu gewöhnen und der Versuchung<br />
zu widerstehen, verschreckt vor dem monströsen Tier wegzulaufen.<br />
Autobiografische Elemente werden immer häufiger. <strong>Kafka</strong> ist sich dessen vollkommen<br />
bewusst und widmet weiterhin “seiner Geschichte” alle ihm zur Verfügung stehende Zeit.<br />
Sein Kummer, sie nicht zwei Abende hintereinander voranbringen zu können, wird von<br />
seiner Überzeugung gemildert, dass sie ständig an Kraft gewinnt. Diese Tatsache, die ihm<br />
zweifellos selbst entgegenkommt, muss er unverzüglich Felice mitteilen. So hat sie das<br />
Glück, die Entstehung der Geschichte, deren Folgen ihr durchaus nicht fremd sind, in<br />
jedem Augenblick verfolgen zu können. In derselben Nacht vom 23. November schreibt er<br />
ihr in den ersten Stunden des anbrechenden Tages: “Liebste, mein Gott wie lieb ich Dich!<br />
Es ist spät in der Nacht, ich habe meine kleine Geschichte weggelegt, an der ich allerdings<br />
schon zwei Abende gar nichts gearbeitet habe und die sich in der Stille zu einer grösseren<br />
Geschichte auszuwachsen beginnt. Zum Lesen Dir geben, wie soll ich das? Selbst wenn sie<br />
schon fertig wäre? ... Vorlesen will ich sie Dir. Ja, das wäre schön, diese Geschichte Dir<br />
vorzulesen und dabei gezwungen zu sein, Deine Hand zu halten, denn die Geschichte ist<br />
ein wenig fürchterlich. Sie heisst <strong>Verw</strong>andlung, sie würde Dir tüchtig Angst machen . ..Ich<br />
bin<br />
(28) Brief vom 13.11.1912 an Max Brod. <strong>Kafka</strong> ist bei der Niederschrift von “Der Heizer”, einem Kapitel,<br />
das posthum im Roman Amerika publiziert wird. Wir befinden uns am Vorabend der Niederschrift der<br />
"<strong>Verw</strong>andlung". In diesem Brief, den er selbst vom Bett aus diktierte, finden wir einen exakten Hinweis<br />
auf diese Beziehung: “Ich will noch mit meiner Schreiberin Ottla spazierengehen; sie kommt am Abend aus<br />
dem Geschäft und ich diktiere ihr jetzt als Pascha vom Bett aus und verurteile sie überdies auch noch zur<br />
Stummheit, denn sie behauptet zwischendurch, sie wolle auch etwas bemerken” (<strong>Kafka</strong>, F.: Briefe)<br />
(29) “Im übrigen ist meine jüngste Schwester (schon über 20 Jahre alt) meine beste Prager Freundin<br />
(Aus einem Brief an Felice, 25.11.1912)<br />
zu trübe jetzt und hätte vielleicht garnicht schreiben sollen. Dem Helden meiner kleinen<br />
Geschichte ist es aber auch heute gar zu schlecht gegangen und dabei ist es nur die letzte<br />
Staffel seines jetzt dauernd werdenden Unglücks”. (<strong>Kafka</strong>, F.: Brief an Felice)<br />
Die Geschichte nimmt einen selbst für <strong>Kafka</strong> erschütternden Ton und Rhythmus an. Dem<br />
legitimen Wunsch Felices, sie die Geschichte lesen zu lassen, vermag er nicht zu<br />
entsprechen. Diese Geschichte kann sie nicht allein im weit entfernten Berlin lesen.
20<br />
Vielmehr muss sie sie hören, und zwar von ihm selbst. Es ist eine schreckliche Geschichte,<br />
die aber gewissermassen ihnen beiden gehört: <strong>Kafka</strong>, der sie geschrieben hatte und Felice,<br />
die seit September seine geistige Muse geworden ist. Deshalb will er sie ihr vorlesen und<br />
beim Vorlesen ihre Hand halten. Sie würde sicherlich angesichts der Intensität seines<br />
Händedrucks verstehen, dass er diese Hand brauchte. Ohne sie glaubte er nicht leben zu<br />
können.<br />
Die Isolierung Gregors wird immer schlimmer. Auf der anderen Seite ist seine Familie,<br />
die Familie Samsa, die ihre Einkäufe ebenso wie ihr Personal auf ein Minimum reduziert<br />
hat -die Köchin hatte sofort inständig um Entlassung gebeten und war erhört worden -<br />
gezwungen, äusserste Anstrengungen zu unternehmen, um mit dieser unvorhergesehenen<br />
und unvorhersehbaren Situation fertig zu werden. Das Unglück, das ihnen plötzlich<br />
widerfahren war, bewirkt eine Konsolidierung ihrer Beziehungen. Vater, Mutter und<br />
Tochter müssen miteinander reden, besprechen ihre wirtschaftliche Lage und versuchen<br />
neue Wege zum Überleben zu finden. Von Gregor sprechen sie bewusst wenig; er ist von<br />
nun an eine lästige Bürde geworden, die ausschliesslich auf den Schultern Gretes lastet.<br />
Die Hoffnung, er könne geheilt werden, an die sich die Mutter noch klammert, wird mit<br />
der Zeit immer geringer. Grete hat von nun an die alleinige Verantwortung für Gregor und<br />
für seine Lebensumstände. Es ist auch ihre Idee, die Möbel aus dem Zimmer zu räumen,<br />
um ihm das Leben weniger unangenehm zu machen und vor allem seine Bewegungen zu<br />
erleichtern. Die Mutter, die noch nicht aufgegeben und die Vorstellung keineswegs<br />
akzeptiert hat, dass sie ihren Sohn verloren hat, hat keine Tränen mehr, ihren Schmerz zu<br />
beweinen; ihr bleibt nur noch ein gebetshafter Wunsch: “Lasst mich doch zu Gregor, er ist<br />
ja mein unglücklicher Sohn! Begreift ihr es denn nicht, dass ich zu ihm muss?”. Gregor<br />
spürt mit seiner besonderen Auffassungsgabe den Wunsch der Mutter und ist tief glücklich<br />
darüber. Er weiss wohl, dass er sie nicht sehen noch sich sehen lassen kann, aber es reicht<br />
ihm, sie ihm nahe zu wissen. Er wird von sich aus alles tun, um unbeobachtet zu bleiben<br />
und beschliesst, zu den Rücksichtsmassnahmen, die er für die Besuche der Schwester<br />
ergriffen hat, eine letzte hinzuzufügen. Er wird nicht nur rechtzeitig unter das Sofa<br />
kriechen, sondern zusätzlich ein Leintuch über sich fallen lassen, um so völlig unsichtbar<br />
zu werden. Während Gregor sich diesen Augenblicken künftiger Glückseligkeit hingibt,<br />
beginnen Schwester und Mutter, letztere schweren Herzens, die Möbel wegzuräumen.<br />
Diese ungewohnten Massnahmen stören und beunruhigen Gregor, der sich im Bewusstsein<br />
ihres wahren Zieles entschieden gegen diese Initiative wendet. Er kann nicht akzeptieren,<br />
dass man ihm seine Möbel wegnimmt und mit ihnen all die Gegenstände, die ihn mit seiner
21<br />
Vergangenheit verbinden. Er fürchtet, dass auf diese Weise der dünne Faden, der ihn noch<br />
mit dem Leben verbindet, reissen würde, und er ist entschlossen, sich mit allen Mitteln<br />
gegen das zu verteidigen, was er als Gewaltakt empfindet. Ohne jegliche Gewissenbisse<br />
zeigt er sich nun, bringt so die Pläne der Schwester durcheinander und verursacht eine<br />
Ohnmacht seiner alten Mutter.<br />
Gregor ist noch einmal und gegen seinen Willen Ursache für eine verheerende<br />
Katastrophe. Die Mutter kann gerade noch mit schriller Stimme Oh Gott, oh Gott"<br />
schreien, bevor sie besinnungslos auf das Sofa stürzt. Grete hebt verzweifelt und drohend<br />
die Faust und ruft "Gregor, Gregor!", just dieselben Worte, die der Vater benutzt hatte, als<br />
er an die Tür klopfte, damit Gregor sie öffne....Dann stürzt sie in die Küche, um<br />
Fläschchen zu holen, die Mutter wiederzubeleben, sammelt ein paar zusammen und kehrt<br />
rennend zur Mutter zurück. Die Tür hatte sie mit dem Fuss zugestossen, um den<br />
endgültigen Bruch mit diesem zunehmend gefährlichen Bruder zu verdeutlichen.<br />
Gregor, allein und niedergedrückt von seiner schrecklichen Schuld, bleibt nichts übrig als<br />
weiter herumzukriechen; an den Wänden, auf den Möbeln, an der Decke, bis er erschöpft<br />
mitten auf den grossen Tisch herabfällt. Dies ist die Lage, als es an der Tür klingelt. Nur<br />
Grete kann öffnen gehen. Es ist der Vater, der von seiner neuen Arbeit, die er sich hatte<br />
suchen müssen, nach Hause zurückkehrte. Er ist ein veränderter Vater, völlig verschieden<br />
von dem bescheidenen und sichgehenlassenden Vater, den Gregor gekannt hatte. Vor ihm<br />
steht, kerzengerade und stolz auf seine neue Uniform eines Bankangestellten eine physisch<br />
wieder erstarkte, resolute Person. Dieser Mann, ein in den Auseinandersetzungen mit<br />
Gregor schon immer feindseliger Riese, sieht in dem Bericht Gretes - “Die Mutter war<br />
ohnmächtig, aber es geht ihr schon besser. Gregor ist ausgebrochen” - die Bestätigung all<br />
seiner Befürchtungen. Nun hat er keine Zweifel mehr, ist im Gegenteil mehr denn je<br />
überzeugt, dass man dem unglückseligen Parasiten, der der Grund für so viel Unglück und<br />
so viele Schmerzen ist, ein für allemal den Garaus machen muss. Das dreckige Ungeziefer,<br />
das mittlerweile mühevoll die Tür seines Zimmers erreicht hatte, erstarrt dort vor Entsetzen<br />
angesichts der vom Vater geäusserten Absichten. Er hebt langsam den Kopf und staunt aus<br />
seiner Perspektive “über die Riesengrösse seiner Stiefelsohlen”..<br />
An dieser Stelle sei an den bereits mehrfach zitierten Brief an den Vater aus dem Jahre<br />
1919 erinnert, in dem der Sohn, von schwacher und kränklicher Konstitution, die<br />
Augenblicke schrecklicher Angst in Erinnerung ruft, die ihn bei dem blossen Gedanken<br />
paralysiert hatten, von diesem Riesen (30) bedroht zu werden. Die Atmosphäre mit einem<br />
Vater, der ihn mit Blick und Stimme terrorisiert, wird darin grossartig beschrieben:
22<br />
“Schrecklich war es auch, wenn Du schreiend um den Tisch herumliefst, um einen zu<br />
fassen, offenbar gar nicht fassen wolltest...” (Aus dem Brief an den Vater, 1919). Dies<br />
wird gerade in dieser Szene aufgenommen, in der der Vater Gregor verfolgt, ihn aber in<br />
Wirklichkeit gar nicht erreichen will. Der Vater spielt mit dem Sohn wie die Katze mit der<br />
Maus. Es sieht so aus, als empfinde er eine zynische Freude daran, ihn zu terrorisieren.<br />
Gregor entkommt, weiss aber, dass er dieses ungleiche Duell zwischen dem, der laufen<br />
kann und dem, der kriechen muss, nicht lange ertragen kann - “Allerdings musste sich<br />
Gregor sagen, dass er sogar dieses Laufen nicht lange aushalten würde, denn während der<br />
Vater einen Schritt machte, musste er eine Unzahl von Bewegungen ausführen. Atemnot<br />
begann sich schon bemerkbar zu machen, wie er ja auch in seiner früheren Zeit keine<br />
vertrauenswürdige Lunge besessen hatte” -. Es ist uns nicht bekannt, dass <strong>Kafka</strong> 1912 über<br />
Lungenprobleme klagt; wir wissen aber, woran er gestorben ist. Man kann nicht umhin, in<br />
diesem Hinweis eine unbewusste Vorankündigung jenes Blutsturzes zu sehen, der in der<br />
Nacht des 9. September 1917 aus seinen Lungen strömt, die er selbst oft als kränklich<br />
bezeichnet hatte.<br />
Die Geschichte nähert sich ihrem Ende. Gregor, gekränkt und erschüttert, kriecht in sein<br />
Gefängnis-Zimmer zurück, als er etwas neben sich rollen sieht. “Es war ein Apfel; gleich<br />
flog ihm ein zweiter nach; Gregor blieb vor Schrecken stehen; ein Weiterlaufen war<br />
nutzlos, denn der Vater hatte sich entschlossen, ihn zu bombardieren”.<br />
(30) “... Noch nach Jahren litt ich unter den quälenden Vorstellung, dass der riesige Mann, mein Vater, die<br />
letzte Instanz fast ohne Grund kommen und mich in der Nacht aus dem Bett auf die Pawlatsche tragen<br />
konnte und dass ich also ein solches Nichts für ihn war....Ich erinnere mich z.B. daran, wie wir uns öfters<br />
zusammen in einer Kabine auszogen. Ich mager, schwach, schmal. Du stark, gross breit. Schon in der Kabine<br />
kam ich mir jämmerlich vor und zwar nicht vor Dir, sondern vor der ganzen Welt, denn Du warst für mich<br />
das Mass aller Dinge. Traten wir dann aber aus der Kabine vor die Leute hinaus, ich an deiner Hand, ein<br />
kleines Gerippe... ” (Aus dem Brief an den Vater, 1919)<br />
Gregor wird von einem Apfel gestreift, ein anderer aber trifft ihn voll, dringt sogar in ihn<br />
ein. “Gregor wollte sich weiterschleppen, als könne der überraschende unglaubliche<br />
Schmerz mit dem Ortswechsel vergehen; doch fühlte er sich wie festgenagelt und streckte<br />
sich in vollständiger <strong>Verw</strong>irrung aller Sinne”. An dieser Stelle wiederholt sich die Szene<br />
voller dramatischer Intensität, die wir bereits im ersten Kapitel gesehen hatten. Die halb<br />
bekleidete Mutter - sie war von der Tochter ausgezogen worden, damit sie schneller zu<br />
sich<br />
kommt - stürzt sich auf den Vater, fällt dabei über ihre Röcke, die ihr in der Zwischenzeit<br />
heruntergerutscht waren, umklammert ihn und fleht ihn an, Gregors Leben zu schonen.<br />
Mit diesem erschütternden Bild endet das zweite Kapitel. In derselben Nacht, es ist drei
23<br />
Uhr morgens (31) am 24. November, wendet sich <strong>Kafka</strong>, - der dieser Gewohnheit, mehr<br />
noch,<br />
diesem Ritus treu bleibt - an Felice, obwohl er eigentlich mit sich selbst spricht: “Liebste!<br />
Was ist das schon für eine ausnehmende ekelhafte Geschichte, die ich jetzt wieder beiseite<br />
lege, um mich in den Gedanken an Dich zu erholen. Sie ist jetzt ein Stück über ihre Hälfte<br />
fortgeschritten und ich bin im allgemeinen mit ihr nicht unzufrieden, aber ekelhaft ist sie<br />
grenzenlos und solche Dinge, siehst Du, kommen aus dem gleichen Herzen, in dem Du<br />
wohnst und Du als Wohnung duldest...” (<strong>Kafka</strong>, F.: Briefe an Felice) Er kann nur zugeben,<br />
dass es sich um eine ekelhafte Geschichte handelt, die aber schlicht seine eigene ist; ja, -<br />
und es ist das erste Mal, dass er das offen zugibt - er ist mit ihrer Entwicklung durchaus<br />
nicht unzufrieden.<br />
Er denkt, ist sogar davon überzeugt, nun nahe am Ziel zu sein, als er vom Büro auf Reisen<br />
geschickt wird. Er muss zur Arbeit, seine Gedanken aber sind bei seiner Geschichte, an<br />
der er nicht weiterarbeiten kann. Die Bitterkeit und der Gram darüber finden ihren<br />
Ausdruck in einem Brief, den er am Abend des 24. November an Felice schreibt: “Meine<br />
kleine Geschichte wäre morgen gewiss fertig geworden und nun muss ich morgen abend<br />
um 6. Er kann sich ob der erzwungenen Unterbrechung nicht beruhigen und schreibt<br />
Felice am nächsten Tag, dem Tag der Abreise (25. November) mit tiefem Bedauern: “Nun<br />
muss ich heute, Liebste, meine kleine Geschichte, an der ich heute gar nicht soviel wie<br />
gestern gearbeitet habe, weglegen... Eine solche Geschichte müsste man höchstens mit<br />
einer Unterbrechung in zweimal 10 Stunden niederschreiben, dann hätte sie ihren<br />
natürlichen Zug und Sturm, den sie vorigen Sonntag in meinem Kopf hatte” (<strong>Kafka</strong>, F.:<br />
Briefe an Felice)<br />
(31) Dies ist eine ungewöhnliche Zeit für den Schriftsteller, der normalerweise gegen ein Uhr seine<br />
nächtliche Arbeit beendete, die aber in dieser Kurzgeschichte wieder auftauchen wird.<br />
Es war im übrigen nicht das erste Mal, dass er gezwungen war, eine Arbeit zu<br />
unterbrechen. In den Tagebüchern gibt er am 8. März 1912 einen Hinweis auf dieses<br />
“Unglück”, mit dem er immer hatte leben müssen: “Das Unglück, das man ertragen muss,<br />
wenn man in einer Arbeit, die immer nur in einem Zug gelingen kann, sich unterbricht, und<br />
das ist mir bisher immer geschehen, dieses Unglück muss man beim Durchlesen, wenn<br />
auch nicht in der alten Stärke, so gedrängter durchmachen.”<br />
Während der Reise (26. November) schreibt er erneut an Felice. Themen sind immer noch<br />
seine kleine Geschichte und seine immer konkretere Angst, sie nicht voranbringen zu<br />
können: “Diese ewige Sorge, die ich auch jetzt übrigens noch habe, dass die Reise meiner
24<br />
kleinen Geschichte schaden wird...” (<strong>Kafka</strong>, F.: Briefe an Felice). Noch nach Jahren notiert<br />
er, recht unzufrieden über den Schluss seiner kleinen Geschichte, in seine Tagebücher:<br />
“Grosser Widerwillen vor <strong>Verw</strong>andlung. Unlesbares Ende. Unvollkommen fast bis in den<br />
Grund. Es wäre viel besser geworden, wenn ich damals nicht durch die Geschäftsreise<br />
gestört worden wäre” (Aus den Tagebüchern, 19.01.1914). Nach Prag zurückgekehrt,<br />
nimmt er seine kleine Geschichte sofort wieder auf. Ein dritter Teil entwickelt sich, an den<br />
er gar nicht gedacht hatte. Noch in derselben Nacht (1. Dezember) unterrichtet er Felice<br />
über die neueste Entwicklung: “Liebste Felice, nach Beendigung des Kampfes mit meiner<br />
kleinen Geschichte - ein dritter Teil, aber nun ganz bestimmt...der letzte, hat begonnen sich<br />
anzusetzen...” (<strong>Kafka</strong>, F.: Briefe an Felice). Tatsächlich zeichnet sich nun die letzte Station<br />
des Leidensweges Gregors ab. Die Wunde, die der Apfel in seinem Körper verursacht<br />
hatte, lässt keine Hoffnung zu. Gregor leidet still, er weiss, dass er leiden muss, bis alles zu<br />
Ende ist. Er ist wie eine Kerze, die langsam ausgeht. Aber obwohl er sich im letzten<br />
Stadium befindet, zu fast völliger Bewegungslosigkeit gezwungen und durch die eiternde<br />
Wunde unweigerlich zum Tode verurteilt ist, gelingt es ihm doch, bei seiner Familie einen<br />
Funken von Mitleid zu erwecken. Ja man öffnet ihm am Abend, sozusagen als<br />
Kompensation für seinen immer schlechteren Gesundheitszustand, der ihm in Kürze den<br />
für ihn and die anderen erlösenden Tod bringen wird, die Tür zum Wohnzimmer, damit er<br />
aus dem Dunkel seines Zimmers die um den erleuchteten Tisch versammelte Familie sehen<br />
und ihren Gesprächen zuhören kann. Schliesslich und gerade weil das Ende nah ist, darf er,<br />
wenn auch nur passiv, am Leben seiner Lieben noch einmal teilnehmen. Der Vater<br />
betrachtet ihn nicht mehr als Feind, er ist entschlossen, seine Aversionen zu unterdrücken<br />
und Geduld zu üben; er braucht sich ja nur zu gedulden... Denn er weiss genau, dass es nur<br />
noch ein Frage von Tagen, wenn nicht von Stunden ist....<br />
Dieses Gefühl hat auch den Schriftsteller angesteckt. Er ist überzeugt, nunmehr am Ende<br />
zu sein, aber ihm fehlt die Zeit zum Schluss zu kommen. Er muss noch einmal vom<br />
Schreibtisch aufstehen und die Fortsetzung auf die kommende Nacht verschieben. Leider<br />
kann er sich seiner Geschichte nicht die ganze Nacht über widmen, wie er es gewollt hat<br />
und wie es vielleicht auch nötig gewesen wäre; darunter leidet er stark. Selbstverständlich<br />
spricht er darüber sofort mit Felice. Wie üblich vertraut er ihr seine letzten Gefühle an,<br />
bevor er das Licht ausmacht und in den wenigen Stunden, die ihm bleiben, die für den<br />
neuen Tag notwendigen Kräfte zu sammeln sucht: “Liebste, ich hätte heute wohl die Nacht<br />
im Schreiben durchhalten sollen. Es wäre meine Pflicht, denn ich bin knapp vor dem Ende<br />
meiner kleinen Geschichte und Einheitlichkeit und das Feuer zusammenhängender Stunden
25<br />
täte diesem Ende unglaublich wohl.... Meine Geschichte würde mich nicht schlafen lassen,<br />
Du bringst mir mit den Träumen den Schlaf..” (Aus einem Brief an Felice, 3.12.1912).<br />
Wir sind im letzten Akt dieser angekündigten Tragödie, die langsam zu Ende geht und nun<br />
Momente reiner Lyrik erreicht, wenn Gregor ins Dunkel seiner Kammer verbannt ist, der<br />
Vater schon im Bett liegt und die beiden Frauen “nahe zusammenrückten, schon Wange<br />
an Wange sassen... und wenn nun Gregor wieder im Dunkel war, während nebenan die<br />
Frauen ihre Tränen vermischten oder gar tränenlos den Tisch anstarrten”.<br />
Gregor, der nun seinem Schicksal endgültig ausgeliefert ist, verbringt die Nächte und Tage<br />
ohne Schlaf. Erinnerungen und Absichten werden immer unbestimmter, bis sie sich im<br />
Vagen verlieren. Die Schwester, müde und verbittert von diesem unmöglichen<br />
Zusammenleben, verzichtet nun auch auf die sporadischen Besuche, bringt sein Essen nicht<br />
mehr selbst, schubst sogar die Schüssel mit dem Fuss ins Zimmer und holt sie am Abend<br />
mit einer Schaufel zurück. Es vollzieht sich ein vollständiger Abbau der Beziehung. Die<br />
einzige, die noch einen winzigen Kontakt mit diesem scheusslichen Biest hält, ist die<br />
Putzfrau. Diese “alte Witwe, die in ihrem langen Leben mit Hilfe ihres starken<br />
Knochenbaues das Ärgste überstanden haben mochte, hatte keinen eigentlichen Abscheu<br />
vor Gregor”. Sie wirft sogar morgens wie abends einen flüchtigen Blick auf dieses Tier -<br />
das, wie sie meint, alles versteht - und wendet sich an ihn mit Ausdrücken , die sie<br />
vielleicht sogar als freundlich empfindet, wie : “ Komm mal herüber, alter Mistkäfer!” oder<br />
“Seht mal den alten Mistkäfer!”.<br />
Um zu überleben, ist die Familie inzwischen gezwungen unterzuvermieten. Drei neue<br />
Mieter kommen ins Haus und okkupieren schliesslich für ihre Mahlzeiten das<br />
Wohnzimmer, während die Familie in die Küche verbannt wird. Es ist eine, wenn man so<br />
will, erträgliche Zwischenlösung, während alle auf das erlösende Ereignis warten.<br />
Wir wissen nicht, ob es wirklich diese Stelle ist, an der sich <strong>Kafka</strong>, von Müdigkeit besiegt<br />
und von der Aufregung über seine Geschichte erschöpft, entschied innezuhalten. Wir<br />
wissen, dass er in der Nacht vom 4. auf den 5. Dezember die Feder weglegte und die<br />
Blätter beiseiteräumte. Vor dem Schlafengehen fand er noch die Kraft, Felice zu<br />
schreiben:” Ach Liebste, unendlich Geliebte, für meine kleine Geschichte ist nun wirklich<br />
schon zu spät, so wie ich es mit Furcht geahnt habe, unvollendet wird sie bis morgen nacht<br />
zum Himmel starren” (<strong>Kafka</strong>, F.: Briefe an Felice). In der nächsten Nacht ging die kleine<br />
Geschichte pünktlich weiter, allerdings mit einem letzten unvorhergesehenen, aber für ihr<br />
Schicksal entscheidenden Ereignis. Der Schwester, der teuren geliebten Schwester kommt<br />
eines Abends in den Sinn, Geige zu spielen. Die verständliche Neugier der Mieter wird mit
26<br />
einem improvisierten Konzert belohnt. Gregor kann dem Lockruf der Musik nicht<br />
widerstehen und kriecht, wie unter Zwang, zum Wohnzimmer. Dort versteckt er sich und<br />
geniesst unter Tränen diese für ihn vollkommene Vorstellung, die er als einziger wirklich<br />
schätzen zu können meint. Er glaubt, in diesen Noten, die von seiner Schwester so<br />
meisterlich gespielt werden, die “ersehnte und unbekannte Nahrung” zu finden. Wie von<br />
einer geheimnisvollen Macht angezogen, will er auf die Schwester zugehen und sie<br />
zwingen, für immer bei ihm zu bleiben. Er gibt diesen unmöglichen Träumen nach und<br />
bewegt sich ohne jegliche Zurückhaltung wie in "Trance" nach vorne, bis er in seiner<br />
ganzen Scheusslichkeit unter den Augen der Mieter und der <strong>Verw</strong>andten erscheint...Da<br />
bricht der Zauber ab, die Violine verstummt, die Gäste flüchten und die Familie bleibt<br />
allein zurück mit ihrem immensen Schmerz. Und ausgerechnet von der Schwester, der<br />
geliebten Schwester, kommt nun der entscheidende Schlag:” Liebe Eltern,... so geht es<br />
nicht weiter.... Ich will vor diesem Untier nicht den Namen meines Bruders aussprechen,<br />
und sage daher bloss: wir müssen versuchen, es loszuwerden”. Obwohl er die Argumente<br />
seiner Tochter teilt, ist der Vater unentschlossen und deutet eine andere Lösung an : “Wenn<br />
er uns verstünde”. Nun aber ist die Schwester die resolutere, sie lässt sich nicht mehr<br />
bremsen und will die Unschlüssigkeit des Vaters überwinden: “Weg muss es....das ist das<br />
einzige Mittel, Vater. Du musst bloss den Gedanken loszuwerden suchen, dass es Gregor<br />
ist. Dass wir es solange geglaubt haben, das ist ja unser eigentliches Unglück. Aber wie<br />
kann es denn Gregor sein? Wenn es Gregor wäre, er hätte längst eingesehen, dass ein<br />
Zusammenleben von Menschen mit einem solchen Tier nicht möglich ist, und wäre<br />
freiwillig fortgegangen...”<br />
Wir sind nahe am Epilog. Gregor begreift, dass er für immer verschwinden soll und<br />
versucht, mit grösster Anstrengung sein Zimmer zu erreichen, wo er die letzte, die<br />
verletzendste Erniedrigung erleiden muss: “Kaum war er innerhalb seines Zimmers, wurde<br />
die Tür eiligst zugedrückt, festgeriegelt und versperrt”.<br />
Es ist das Ende. Gregor wird lebendig begraben.<br />
Als <strong>Kafka</strong> Gregors endgültiges Verschwinden skizzierte, fand er ähnliche Akzente wie<br />
diejenigen, die einige Monate zuvor Georg, der athletische Sohn aus dem "Urteil" benutzt<br />
hatte, der seinen Eltern seine letzten Gedanken widmete, bevor er sich vom<br />
Brückengeländer in den Fluss stürzte: “Liebe Eltern, ich habe euch doch immer geliebt”.<br />
Auch Gregor widmet seiner Familie vor dem letzten Atemzug einen Gedanken voller<br />
Zuneigung und Rührung: “Seine Meinung darüber, dass er verschwinden müsse, war<br />
womöglich noch entschiedener als die seiner Schwester. In diesem Zustand leeren und
27<br />
friedlichen Nachdenkens blieb er, bis die Turmuhr die dritte Morgenstunde schlug. Den<br />
Anfang des allgemeinen Hellerwerdens draussen vor dem Fenster erlebte er noch. Dann<br />
sank sein Kopf ohne seinen Willen gänzlich nieder, und aus seinen Nüstern strömte sein<br />
letzter Atem schwach hervor”.<br />
Gregor stirbt ohne ein Wort der Klage. Er erlischt angesichts allgemeiner Gleichgültigkeit.<br />
Erst durch seinen Tod gelingt es ihm, den Frieden mit allen wieder zu gewinnen. In der<br />
Nacht vom 6. zum 7. Dezember überbringt <strong>Kafka</strong> Felice sofort die traurige<br />
Nachricht:”Weine, Liebste, weine, jetzt ist die Zeit des Weinens da! Der Held meiner<br />
kleinen Geschichte ist vor einer Weile gestorben. Wenn es Dich tröstet, so erfahre, dass er<br />
genug friedlich und mit allen ausgesöhnt gestorben ist. Die Geschichte selbst ist noch nicht<br />
ganz fertig, ich habe keine rechte Lust jetzt mehr für sie und lasse den Schluss bis<br />
morgen”.<br />
Dem Finale, das mehr die Familie als Gregor betreffen wird, will er sich in der Nacht des<br />
7. Dezember widmen. Es ist aber ein Finale, das dem bisherigen Rhythmus der Geschichte<br />
nicht gerecht wird und einen neuen Tonfall zeitigt. Wie wir bereits gesehen haben, ist sich<br />
<strong>Kafka</strong> dessen im übrigen durchaus bewusst und gibt aus der Distanz der Jahre die Schuld<br />
dafür jener Geschäftsreise, die ihn so brutal aus seiner Geschichte herausgerissen hatte.<br />
Gregor, “für alles unfähig ausser für Schmerzen” (32), ist in aller Stille gegangen, um den<br />
Frieden der Familie nicht mehr, auch nicht durch weinerliches Klagen zu stören. Ja, er<br />
scheint das letzte Röcheln zusammenfallen zu lassen mit dem langsamen Glockenschlag<br />
des Kirchturms - es war drei Uhr morgens - , gerade so wie es Georg einige Monate zuvor<br />
im "Urteil" getan hatte, als er sich von der Brücke stürzte, da der Verkehr besonders dicht,<br />
“unendlich” war, um den Aufschlag auf der Moldau zu übertönen. Die Helden <strong>Kafka</strong>s<br />
gehen auf Zehenspitzen von der Bühne und möchten geradezu verschwinden, ohne<br />
irgendeine Spur zu hinterlassen.<br />
Gregor ist friedlich gestorben, in Frieden zunächst mit sich, aber durch sein Sterbens<br />
dann auch mit seinen Lieben. Dieser arme, von der Wunde geschwächte und von den<br />
Entbehrungen abgemagerte Körper wird nur noch für kurze Zeit stören. Als erste bemerkt<br />
die korpulente Bedienerin seinen Tod. Im ersten Augenblick denkt sie, “er liege absichtlich<br />
so unbeweglich da und spielte den Beleidigten; sie traute ihm allen möglichen Verstand zu.<br />
Weil sie zufällig den langen Besen in der Hand hielt, suchte sie mit ihm Gregor vor der Tür<br />
aus zu kitzeln...” Als sie endlich Gregors Tod feststellt, stürzt sie los und schreit in die<br />
Dunkelheit hinein:”Sehen Sie nur mal an, es ist krepiert; da liegt es, ganz und gar<br />
krepiert!”. Dieser brutale Ausdruck, der nicht hochdeutsch ist, sondern vom väterlichen
28<br />
Dialekt stammt (33), klingt nicht nach der erwarteten Erlösung, sondern eher nach einer<br />
letzten auf die Verschiedenheit Gregors gemünzten Beleidigung. Der Vater ist der erste,<br />
der sich von seiner Bestürzung erholt und für Beruhigung sorgt: "Jetzt können wir Gott<br />
danken". Nur die heissgeliebte Schwester Grete wirft einen letzten mitleidigen Blick auf<br />
diesen schrecklich abgemagerten, verwelkten Körper und flüstert:”Seht nur, wie mager er<br />
war”. Mit dieser Szene langsamen, aber unerbittlichen Vergehens, die in <strong>Kafka</strong>s Werk<br />
häufig erscheint - man denke nur an den den Mann vom Lande aus der Parabel "Vor dem<br />
Gesetz", der sein ganzes Leben vor dem Türhüter vergeudet; oder an den<br />
“Hungerkünstler”, der fasten muss, weil er nicht die Nahrung findet, die ihm gefällt -<br />
sollen unsere Überlegungen enden. Der Rest verdient kaum weitere Betrachtung.<br />
(32) Aus den Tagebüchern, 12. 6. 1923<br />
(33) “...Oder Deine ständige Redensart hinsichtlich eines lungenkranken Kommis: Er soll krepieren der<br />
kranke Hund! “ (Aus dem Brief an den Vater, 1919)<br />
<strong>Kafka</strong> teilt in der Nacht (6./7.Dezember) selbst Felice seine Unzufriedenheit mit :<br />
“Liebste, also höre, meine kleine Geschichte ist beendet, nur macht mich der heutige<br />
Schluss gar nicht froh, er hätte schon besser sein dürfen, das ist kein Zweifel”. (<strong>Kafka</strong>, F.:<br />
Briefe an Felice).<br />
Nachdem er gezwungen war, den Schluss der Geschichte immer weiter hinauszuschieben,<br />
hatte <strong>Kafka</strong> die ursprüngliche Kraft verloren und spürte, wie er kurz vor dem Ziel ins<br />
Wanken geriet. Dennoch muss er das Stück zu Ende bringen, musste die ihm<br />
verbleibenden Kräfte mobilisieren. Dieser Kraftakt aber schadet schliesslich stark der<br />
Erzählung, gerade dieser seiner Geschichte. Wie wir sehen konnten, war sie von Anfang<br />
an von seinen Stimmungslagen abhängig, die sie perfekt wiedergibt. Ganz anders das<br />
"Urteil", das in einem Zug in einer einzigen Nacht (22-23-September 1912) von 10 Uhr<br />
abends bis sechs<br />
Uhr morgens geschrieben wurde und von ihm selbst als “Das Gespenst einer Nacht” (34)<br />
bezeichnet wurde. Die “<strong>Verw</strong>andlung” hat dagegen unter den unvorhergesehenen<br />
Unterbrechungen und den daraus folgenden Aufschüben gelitten, gerade weil sie aus einem<br />
präzisen "Projekt" heraus entstand und - das hatte sich <strong>Kafka</strong> ausdrücklich gewünscht -<br />
höchstens in zwei Tagen hätte fertig werden sollen. <strong>Kafka</strong> weist darauf hin. Er ist sich<br />
dessen bewusst und leidet als erster darunter. Er weiss genau, dass diese kreative Kraft, die<br />
ihn praktisch gezwungen hatte, mit der Niederschrift der Geschichte von Gregor - seiner<br />
eigenen Geschichte - in der Nacht zum Sonntag, dem 17. November zu beginnen, mit den
29<br />
Tagen immer schwächer wurde.Er brauchte, wie immer, diese “Gewalt” und jetzt bestand<br />
immer mehr die Gefahr, dass jenes heilige “Feuer” sich abkühlt, das unentbehrlich ist, um<br />
Gefühle und Empfindungen zu Papier zu bringen, um die angemessen Worte zu finden, um<br />
seine Geschichte lebendig zu machen. Das würde es ihm nicht mehr möglich machen,<br />
jenem Rhythmus und jener Spannung zu entsprechen, derer die Geschichte absolut<br />
bedurfte (35).<br />
Ohne jenes Feuer, das von innen heraus wie ein Fieber brennt (36) und Kraft und Energie<br />
(34) Janouch, G.: Gespräche mit <strong>Kafka</strong><br />
(35) “Die Schwierigkeiten der Beendigung, selbst eines kleinen Aufsatzes, liegen nicht darin, dass unser<br />
Gefühl für das Ende des Stückes ein Feuer verlangt, das der tatsächliche bisherige Inhalt aus sich selbst nicht<br />
hat erzeugen können, sie entstehen vielmehr dadurch, dass selbst der kleinste Aufsatz vom Verfasser eine<br />
Selbstzufriedenheit und eine Verlorenheit in sich selbst verlangt, aus der an die Luft des gewöhnlichen Tages<br />
zu treten, ohne starken Entschluss und äusseren Ansporn schwierig ist, so dass man eher, als der Aufsatz rund<br />
geschlossen wird und man still abgleiten darf, vorher, von der Unruhe getrieben, ausreisst und dann der<br />
Schluss von aussenher geradezu mit Händen beendigt werden muss, die nicht nur arbeiten, sondern sich auch<br />
festhalten müssen”. (Aus den Tagebüchern, 29.12.1911)<br />
(36) “Dichtung ist Krankheit”, sagte Franz <strong>Kafka</strong>. “Durch die Unterdrückung des Fiebers wird man aber<br />
noch nicht gesund. Im Gegenteil! Die Glut reinigt und leuchtet” (Janouch, G.: Gespräche mit <strong>Kafka</strong>)<br />
auf die eigene Schöpfung überträgt, kommt man nicht weit. Alle Künstler wissen dies, da<br />
sie es an sich selbst erlebt haben. <strong>Kafka</strong>, der diesen Seelenzustand in den ersten Stunden<br />
des 23.<br />
November 1912 beschrieben hatte, kurz nachdem er in einem Zug das Urteil geschrieben<br />
hatte (37), hat sehr viel dafür aufgewandt, Gregor kongeniale Züge zu verleihen. Jetzt, nach<br />
der ungeheuren Anstrengung, die es ihn gekostet hatte, seine Figur Schritt für Schritt zu<br />
begleiten und mit ihr die menschliche Tragödie zu teilen, ist er erschöpft und<br />
unentschlossen angesichts einer Geschichte, die mit dem Tod des Protagonisten nicht endet<br />
und doch ein Ende brauchtUm die Dramatik der Erzählung abzuschwächen, die Gregor in<br />
einem schmerzlichen Crescendo auf seinem Leidensweg begleitet hatte, ohne ihm dabei<br />
die letzte Beleidigung zu ersparen -mit der Schaufel beiseite geräumt zu werden- lenkt<br />
<strong>Kafka</strong> nun seine und unsere Aufmerksamkeit ab und widmet das Finale der Familie. Der<br />
Tod des ekelhaften Schmarotzers war für Familie Samsa das Ende eines Alptraumes,<br />
bedeutete aber zugleich, dass sie sich einer neuen, bisher unvorstellbaren Kraft bewusst<br />
wurde. Der Vater, der bis vor kurzem in seinem Sessel einzunicken pflegte und von seinen<br />
Frauen ins Bett gebracht werden musste, jener Vater findet eine derartige Energie und<br />
Vitalität wieder, dass er seine drei Mieter sogar buchstäblich aus dem Haus werfen
30<br />
kann.Um ihn herum sind nun zwei völlig veränderte Frauen, die nicht entfernt an jene<br />
erniedrigten und verzagten Figuren<br />
erinnerten, die zum Überleben schwere Arbeit annehmen mussten (die eine näht bis tief in<br />
die Nacht für fremde Leute, die andere bedient ohne Unterlass Kunden). Das tragische<br />
Ende der <strong>Verw</strong>andlung Gregors ist unerwarteter Anlass für eine andere <strong>Verw</strong>andlung. Die<br />
Familie hatte gerade dank Gregors Tod mit der Vergangenheit abgeschlossen und denkt<br />
schon an die Zukunft. Die drei Samsas, nunmehr fest entschlossen, ein neues Leben zu<br />
beginnen, benutzen die Gelegenheit, um zusammen auszugehen und sich eine Fahrt mit der<br />
Trambahn aus der Stadt hinaus zu leisten: “Dann verliessen alle drei gemeinschaftlich die<br />
Wohnung, was sie schon seit Monaten nicht getan hatten, und fuhren mit der Elektrischen<br />
ins Freie vor die Stadt”.<br />
(37) “...Mehrmals in dieser Nacht trug ich mein Gewicht auf dem Rücken. Wie alles gesagt werden kann, wie<br />
für alle, für die fremdesten Einfälle ein grosses Feuer bereitet ist, indem sie vergehen und auferstehn... Um<br />
zwei Uhr schaute ich zum letzen Male auf die Uhr. Wie das Dienstmädchen zum ersten Male durchs<br />
Vorzimmer ging, schrieb ich den letzten Satz nieder. Auslöschen der Lampe und Tageshelle. Die leichten<br />
Herzschmerzen. Die in der Mitte der Nacht vergehende Müdigkeit. Das zitternde Eintreten ins Zimmer der<br />
Schwestern. Vorlesung. Vorher das Sichstrecken vor dem Dienstmädchen und Sagen: “Ich habe bis jetzt<br />
geschrieben”... Nur so kann geschrieben werden, nur in einem solchen Zusammenhang, mit solcher<br />
vollständigen Öffnung des Leibes und der Seele...” (Aus den Tagebüchern, 23.9.1912)<br />
Den Rahmen für diese kleinbürgerliche Szene gibt ein herrlicher leuchtender Tag. Die<br />
Samsas sitzen gemütlich in der Strassenbahn, die Prag hinter sich gelassen hat und sie in<br />
das Umland bringt, und beginnen mit einer ersten Prüfung ihrer Zukunftsaussichten, die so<br />
böse nun nicht mehr waren. Sie mussten sich nur noch von jenem kleinen Erbe trennen, das<br />
sie noch an die Vergangenheit band und ihnen nicht wenig Unbehagen bereitete. Selbst die<br />
Erinnerung an jenen unglückseligen Sohn, der ihnen nun glücklicherweise nicht mehr im<br />
Wege stand, musste gelöscht werden. Die noch frische Vergangenheit musste so oder so<br />
aus der Erinnerung getilgt werden. Als erstes war ein Umzug erforderlich; sie mussten die<br />
grosse, nunmehr unbequeme Wohnung verlasssen, die ihnen Gregor besorgt hatte und in<br />
der zwangsläufig sein Geist wieder erscheinen würde. “Sie wollten nun eine kleinere und<br />
billigere, aber besser gelegene und überhaupt praktischere Wohnung nehmen”. Während<br />
sie noch dabei sind, dieses Vorhaben zu erörtern, bewundern die Eltern Samsa ihre<br />
Tochter, die nun eine Frau geworden ist und zudem “zu einem schönen und üppigen<br />
Mädchen aufgeblüht war”. Sie betrachten diese Blume mit Wohlgefallen, wobei sie sich<br />
mit Blicken verständigen. Sie sind von ihrer Schöpfung angetan und glauben, dass jetzt der<br />
Augenblick gekommen sei, für sie einen guten Ehemann zu suchen (38).
31<br />
Die Erzählung, die Geschichte Gregor Samsas , der im Frieden mit allen stirbt, schliesst<br />
mit dem Bild eben dieses Mädchens, das “am Ziele ihrer Fahrt als erste sich erhob und<br />
ihren jungen Körper dehnte”.<br />
Wie soll man an dieser Stelle nicht an das Ende des “Hungerkünstlers “denken, einem der<br />
letzten Werke <strong>Kafka</strong>s. Bei ihm handelt es sich um einen Menschen, der seinen Unterhalt<br />
mit einem untypischen Beruf bestreiten muss, der aber für ihn nicht selbstverständlicher<br />
sein könnte. Sein Fasten ist in der Tat nicht das Ergebnis besonderer Veranlagung, sondern<br />
liegt einzig und allein darin begründet, dass er sein Leben lang keine Nahrung gefunden<br />
hat, die ihm geschmeckt hätte. “Hätte ich sie gefunden, glaube mir, ich hätte kein Aufsehen<br />
gemachtund mich vollgegessen wie du und alle”; das sind seine bitteren Schlussworte, die<br />
er mit letzter Stimme an einen Diener richtet.<br />
(38) Damals war es üblich, dass Eltern ihre Töchter mit Hilfe von Vermittlerinnen verheirateten. Die zwei<br />
älteren Schwestern <strong>Kafka</strong>s Elli und Valli wurden so verheiratet. Die jüngste, Ottla (seine Lieblingsschwester)<br />
hat sich diesem Brauch widersetzt und aus Liebe geheiratet. <strong>Kafka</strong> gibt uns in seinen Tagebüchern eine<br />
hübsche Beschreibung einer dieser Vermittlerinnen, die eine seiner beiden Schwester verheiraten sollte,<br />
Das Fasten ist deshalb, wenigstens in seinem Fall, eine zwangsläufige Entscheidung. Jetzt<br />
aber, da die Kunst des Hungerns ausser Mode gekommen ist und keine Zuschauer mehr<br />
anlockt, kann er soviel fasten wie er will. Nun will er nicht mehr leben. Genau wie im<br />
Falle Gregors wird sein armer Körper ohne viel Federlesens weggeräumt und sofort<br />
begraben, mit verschimmeltem Stroh und Kot. Das Leben muss weitergehen, die Show<br />
(wir sind im Zirkus) duldet keine Unterbrechung. Der Hungerkünstler wird in seinem fast<br />
vergessenen Käfig von einem jungen und wilden Panther abgelöst - “dieser edle bis knapp<br />
zum Zerreissen ausgestattete Körper schien auch die Freiheit mit sich herumzutragen” -<br />
.Dieses Bild erinnert an jenes von der Schwester Gregors, die “ihren jungen Körper<br />
dehnte”, bevor sie aus der Trambahn springt.<br />
Im “Hungerkünstler”, der letzten Erzählung <strong>Kafka</strong>s - die Lektüre der Korrekturfahnen<br />
erregte <strong>Kafka</strong> kurz vor seinem Tod über alle Massen - zeigt sich erneut die erschütternde<br />
und provokatorische Gegensätzlichkeit der kafkaschen Botschaft.<br />
In der <strong>Verw</strong>andlung stellt er dem Tier Gregor, das als menschliches Wesen heiter<br />
entschläft und daher seine letzten sehnsüchtigen Gedanken seinen Lieben widmet, die<br />
Schwester gegenüber, die nun mehr ist als eine Knospe, in der sich eine aufblühende<br />
Weiblichkeit verbirgt.Der ausgemergelte Hungerkünstler, der zu sterben beschliesst, wird<br />
von einem wilden Panther ersetzt.
32<br />
Das sind die Dilemmata, mit denen sich <strong>Kafka</strong> stets befasst und die er uns präsentiert,<br />
wenn auch verschleiert durch seinen Galgenhumor, der paradoxerweise die dramatische<br />
Intensität steigert (39).<br />
(39) Bei <strong>Kafka</strong> taucht dieser Begriff häufig auf. Zum kafkaschen Humor scheint uns interessant zu<br />
zitieren, was Wilhelm Emrich (<strong>Kafka</strong>, Athenäum Verlag, 1965) schreibt: “Der Lachende ist sowohl dem<br />
Komischen wie Tragischen entrückt, d.h. das Lachen wird undeutbar. Das ist der Grund, weshalb man bei<br />
<strong>Kafka</strong>s sog. Humor nie weiss, ob man lachen oder ernst bleiben soll. Keines ist in seiner Gestaltung ganz<br />
adäquat. Denn dieser sog. Humor ist allen Relationen enthoben und kann daher auch nicht mehr als<br />
Tragikomik oder dgl. bezeichnet werden, etwa in den Sinne, dass “hinter” der Komik auch Tragik oder<br />
hinter dem Tragischen auch Komik sich verbirgt, dass sich Ernst und Heiterkeit “mischen”.