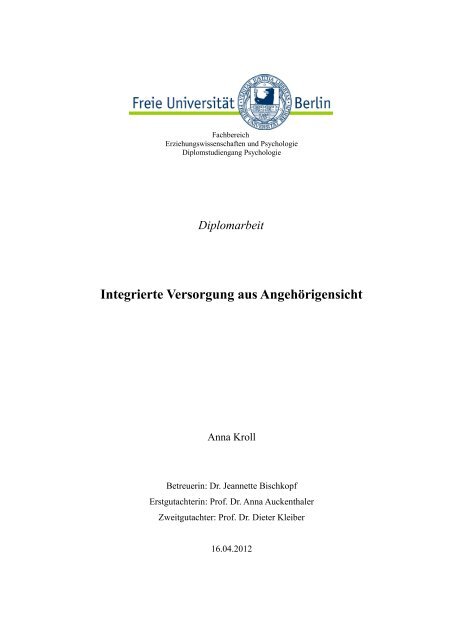Integrierte Versorgung aus Angehörigensicht - Krisenpension
Integrierte Versorgung aus Angehörigensicht - Krisenpension
Integrierte Versorgung aus Angehörigensicht - Krisenpension
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Fachbereich<br />
Erziehungswissenschaften und Psychologie<br />
Diplomstudiengang Psychologie<br />
Diplomarbeit<br />
<strong>Integrierte</strong> <strong>Versorgung</strong> <strong>aus</strong> <strong>Angehörigensicht</strong><br />
Anna Kroll<br />
Betreuerin: Dr. Jeannette Bischkopf<br />
Erstgutachterin: Prof. Dr. Anna Auckenthaler<br />
Zweitgutachter: Prof. Dr. Dieter Kleiber<br />
16.04.2012
Eidesstattliche Erklärung<br />
Ich erkläre an Eides Statt, dass ich diese Diplomarbeit selbständig und ohne fremde Hilfe<br />
verfasst, andere als die angegebenen Quellen nicht benutzt und die den benutzten Quellen<br />
wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe. Mir ist<br />
bekannt: Bei Verwendung von Inhalten <strong>aus</strong> dem Internet habe ich dies zu kennzeichnen<br />
und mit Datum sowie der Internet-Adresse (URL) ins Literaturverzeichnis aufzunehmen.<br />
Diese Arbeit hat keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegen.<br />
Ich bin mit der Einsichtnahme im Universitätsarchiv der FU und <strong>aus</strong>zugsweiser Kopie<br />
einverstanden. Alle übrigen Rechte behalte ich mir vor. Zitate sind nur mit vollständigen<br />
bibliographischen Angaben und dem Vermerk "unveröffentlichtes Manuskript einer<br />
Diplomarbeit" zulässig.<br />
Anna Kroll<br />
Berlin, den 16.04.2012
„Es gibt einen Weg, den ein Mensch geht und irgendwann ist eine Lücke in diesem Weg und<br />
dann gibt es eben Organisationen, die helfen mit einer Brücke über diesen Weg zu gehen und<br />
dann durch die Tür und dass es eben weiter geht, dass man nicht im Nirgendwo landet.“<br />
(Herr A., 258-261)
Danksagung<br />
An erster Stelle möchte ich mich bei den sechs Menschen bedanken, die mir im Rahmen<br />
der Interviews Einblicke in ihre Erfahrungen und Gedanken geschenkt haben.<br />
Ich bedanke mich außerdem bei Frau Dr. Jeannette Bischkopf für ihre verlässliche<br />
Ansprechbarkeit und ihren Optimismus sowie bei Frau Prof. Dr. Anna Auckenthaler und<br />
dem dazugehörigen DiplomandInnen-Kolloquium für die konstante fachliche Begleitung.<br />
Anna-Maria, danke, dass du all die Licht- und Schattenseiten der Diplomarbeitszeit mit mir<br />
geteilt hast. Es wäre nicht dasselbe gewesen.
Zusammenfassung<br />
In der vorliegenden Diplomarbeit wurde untersucht, wie Angehörige den Vertrag zur<br />
<strong>Integrierte</strong>n <strong>Versorgung</strong> NetzWerk psychische Gesundheit (NWpG) in Berlin beurteilen.<br />
Ziel der Untersuchung war es, einen Beitrag zur qualitativen Auswertung der<br />
gemeindepsychiatrisch umgesetzten <strong>Integrierte</strong>n <strong>Versorgung</strong> im Allgemeinen und des<br />
NWpG im Speziellen zu leisten und dabei Erkenntnisse zur Angehörigenperspektive und<br />
zur Angehörigenbeteiligung im Evaluationsprozess zu gewinnen. Sechs problemzentrierte<br />
Interviews mit Angehörigen wurden mit der qualitativen Inhaltsanalyse im Hinblick auf<br />
Erfahrungen mit dem <strong>Versorgung</strong>sangebot <strong>aus</strong>gewertet. Das Urteil der Angehörigen über<br />
das NWpG fiel sehr positiv <strong>aus</strong>: Sie benannten positive Veränderungen sowie hilfreiche<br />
Konzepte und zogen das NWpG als Vorbild für eine Idealversorgung heran. Aus<br />
identifizierten Hindernissen ließen sich Vor<strong>aus</strong>setzungen für die erfolgreiche Teilnahme am<br />
NWpG ableiten. Als Beitrag zur Angehörigenforschung wurde bestätigt, dass sich<br />
Angehörigenbeteiligung im Evaluationsprozess lohnt und mehr genutzt werden sollte. Für<br />
die <strong>Versorgung</strong>sforschung ergab sich die Konsequenz, dass gemeindepsychiatrisch<br />
umgesetzte <strong>Integrierte</strong> <strong>Versorgung</strong> <strong>aus</strong>gebaut und in die Regelversorgung implementiert<br />
werden sollte.<br />
Schlagwörter: <strong>Integrierte</strong> <strong>Versorgung</strong> – Angehörige – Gemeindepsychiatrie
Abstract<br />
This degree thesis investigated how caregivers evaluate the integrated health care contract<br />
NetzWerk psychische Gesundheit (network mental health, NWpG) in Berlin. The aim of<br />
this study was to contribute to the qualitative evaluation of integrated health care as<br />
delivered, in the instance, by the NWpG programme with a focus on the aspects of<br />
community mental health service employed within this scheme and thereby gain insight<br />
into the caregivers' perspective and into caregivers' participation in the evaluation process.<br />
Six problem-centered interviews with caregivers were analyzed with the qualitative content<br />
analysis in terms of their experience with the care programme. The judgment of the<br />
caregivers of the NWpG was very positive: They cited positive changes as well as helpful<br />
concepts and used the NWpG approach as a role model for an ideal mental health care<br />
system. Requirements for a successful participation in the NWpG were derived from<br />
identified barriers to successful delivery of care. As a result of caregivers' research it was<br />
confirmed that caregivers' participation in the evaluation is worthwhile and should be<br />
employed more. As a consequence for the health service research it was found that the<br />
community mental health approach of integrated health care should be expanded and<br />
implemented in the standard health care system.<br />
key words: integrated health care - caregivers - community mental health care
Inhaltsverzeichnis<br />
Zusammenfassung...........................................................................................5<br />
Abstract............................................................................................................6<br />
1 Einleitung......................................................................................................9<br />
2 Theoretische Hinführung...........................................................................11<br />
2.1 <strong>Integrierte</strong> <strong>Versorgung</strong>............................................................................................11<br />
2.1.1 Ziele...................................................................................................................12<br />
2.1.2 Gesetzliche Grundlage.......................................................................................13<br />
2.1.3 Ausgestaltungsmöglichkeiten............................................................................14<br />
2.1.4 Kritikpunkte.......................................................................................................15<br />
2.2 Konzepte der Sozialen Psychiatrie.........................................................................16<br />
2.2.1 Empowerment....................................................................................................16<br />
2.2.2 Recovery............................................................................................................19<br />
2.2.3 Soteria................................................................................................................22<br />
2.2.4 Home Treatment.................................................................................................25<br />
2.2.5 Bedürfnisangepasste Behandlung......................................................................26<br />
2.2.6 Offener Dialog im Netzwerk..............................................................................27<br />
2.2.7 Trialog................................................................................................................29<br />
2.2.8 Zusammenfassung: Konzepte der Sozialen Psychiatrie im Zusammenhang.....30<br />
2.3 Angehörige psychisch erkrankter Menschen........................................................31<br />
2.3.1 Entstehung der Angehörigenbewegung: „Vom Sündenbock zum Partner“.......32<br />
2.3.2 Angehörigenbeteiligung.....................................................................................33<br />
2.3.3 Angehörigenforschung.......................................................................................35<br />
2.3.4 Fazit: Die Bedeutung Angehöriger in der psychiatrischen <strong>Versorgung</strong>.............36<br />
3 Fragestellung...............................................................................................37<br />
3.1 Entstehungskontext.................................................................................................37<br />
3.2 Ableitung der eigenen Fragestellung......................................................................38<br />
3.3 Das NetzWerk psychische Gesundheit als Beispiel <strong>Integrierte</strong>r <strong>Versorgung</strong>.....39<br />
4 Methodik.....................................................................................................40<br />
4.1 Begründung des qualitativen Forschungsansatzes...............................................40<br />
4.2 Zugang zum Feld.....................................................................................................41<br />
4.2.1 Samplingstrategie...............................................................................................41<br />
4.2.2 Sample................................................................................................................42<br />
4.3 Methoden der Datenerhebung................................................................................44<br />
4.3.1 Das problemzentrierte Interview........................................................................44<br />
4.3.2 Konstruktion des Interviewleitfadens................................................................46<br />
4.3.3 Durchführung der Interviews.............................................................................47<br />
4.4 Methoden der Daten<strong>aus</strong>wertung............................................................................48<br />
4.4.1 Transkription......................................................................................................48<br />
4.4.2 Die Qualitative Inhaltsanalyse...........................................................................49<br />
4.5 Gütekriterien qualitativer Forschung....................................................................51<br />
4.5.1 Intersubjektive Nachvollziehbarkeit..................................................................51<br />
4.5.2 Indikation der Methoden....................................................................................52
5 Ergebnisse...................................................................................................53<br />
5.1 K1 Veränderungen...................................................................................................54<br />
5.1.1 Langfristigkeit, Teilerfolge, Prozesscharakter...................................................55<br />
5.1.2 Veränderungen bei Betroffenen.........................................................................57<br />
5.1.3 Veränderungen bei Angehörigen........................................................................62<br />
5.1.4 Veränderungen in der Betroffenen-Angehörigen-Beziehung............................65<br />
5.2 K2 Hindernisse.........................................................................................................66<br />
5.2.1 Drei Haupthindernisse.......................................................................................67<br />
5.2.2 Weitere Hindernisse...........................................................................................69<br />
5.3 K3 Hilfreiche Konzepte...........................................................................................71<br />
5.3.1 Grundlegende Haltungen...................................................................................72<br />
5.3.2 Arbeitsweisen.....................................................................................................74<br />
5.3.3 Vermittlung der Grundhaltungen und Arbeitsweisen.........................................77<br />
5.4 K4 Idealversorgung.................................................................................................80<br />
5.4.1 Gesellschaftliche Ebene.....................................................................................80<br />
5.4.2 Allgemeine <strong>Versorgung</strong>......................................................................................81<br />
5.4.3 NetzWerk psychische Gesundheit......................................................................84<br />
5.5 Ergebnisübersicht....................................................................................................85<br />
6 Diskussion....................................................................................................87<br />
6.1 Diskussion inhaltlicher Aspekte..............................................................................87<br />
6.2 Diskussion methodischer Aspekte..........................................................................94<br />
6.3 Fazit...........................................................................................................................96<br />
Literaturverzeichnis......................................................................................98<br />
Tabellenverzeichnis.....................................................................................109<br />
Abbildungsverzeichnis................................................................................110<br />
Anhang..........................................................................................................111
1 Einleitung<br />
1 Einleitung<br />
In der Agenda 2020 zur Weiterentwicklung der psychiatrischen <strong>Versorgung</strong> fordern<br />
Angehörige psychisch Kranker eine Behandlung „wie <strong>aus</strong> einer Hand“ (BApK 1 , 2010, S.<br />
8) mit aufeinander abgestimmten Komponenten und demselben Ziel. Dafür halten sie die<br />
„optimierte Vernetzung von ambulanten und stationären Angeboten unter der<br />
Berücksichtigung des Prinzips ambulant vor stationär“ (BApK, 2010, S. 8) für nötig. Ein<br />
erster großer Schritt zur Umsetzung dieser Forderung wurde mit der gesetzlichen<br />
Einführung der <strong>Integrierte</strong>n <strong>Versorgung</strong> (IV) getan. Die IV eröffnet endlich die<br />
Möglichkeit, lange geforderte Reformen der psychiatrischen <strong>Versorgung</strong>sstruktur<br />
umzusetzen und die <strong>Versorgung</strong> psychisch erkrankter Menschen zu verbessern. Bereits im<br />
Jahre 1975 wies die Psychiatrie-Enquete auf Missstände hin und betonte die<br />
Notwendigkeit von Veränderungen hin zu mehr Gleichstellung, Gemeindenähe,<br />
Dezentralisierung und Enthospitalisierung der LangzeitpatientInnen durch Schaffung<br />
ambulanter komplementärer Angebote (Pörksen, 2001). Trotzdem blieb die starre<br />
Säulenstruktur von stationärem und ambulantem Sektor erhalten. Die IV will diese<br />
Trennung der <strong>Versorgung</strong>slandschaft überwinden und die einzelnen Elemente integrieren.<br />
Dabei bietet sie unterschiedliche konzeptuelle Umsetzungsmöglichkeiten: Behandlungsqualität<br />
und Kosteneffektivität sind <strong>aus</strong>schlaggebend, so dass klassisch psychiatrische<br />
Ansätze nicht präferiert werden, sondern auch alternative <strong>Versorgung</strong>sformen<br />
gleichberechtigt berücksichtigt werden. Darin liegt eine große Chance für gemeindepsychiatrische<br />
Träger sozialpsychiatrische Konzepte wie bedürfnisangepasste Behandlung,<br />
Home Treatment, Recovery, Empowerment, Trialog oder Soteria zu realisieren und zu<br />
einem „ernsthaften Mitgestalter“ (Faulbaum-Decke & Zechert, 2010, S. 13) in der<br />
ambulanten psychiatrischen <strong>Versorgung</strong> zu werden.<br />
Die vorliegende Diplomarbeit beschäftigt sich am Beispiel des IV-Vertrages NetzWerk<br />
psychische Gesundheit (NWpG) in Berlin mit der gemeindepsychiatrisch orientierten<br />
Umsetzung <strong>Integrierte</strong>r <strong>Versorgung</strong>. Angehörige von TeilnehmerInnen am IV-Vertrag<br />
NWpG wurden dazu interviewt, wie sie das NWpG beurteilen. Dadurch sollen<br />
Erkenntnisse zu Nutzen und Einschätzung des <strong>Versorgung</strong>sangebots NWpG im Speziellen<br />
und <strong>Integrierte</strong>r <strong>Versorgung</strong> im Allgemeinen gewonnen werden. Angehörige psychisch<br />
erkrankter Menschen sind als „bedeutsamer Teil des Hilfssystems und [...] größte<br />
1 Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker e.V.<br />
9
1 Einleitung<br />
Ressource für die Verbesserung der Situation psychiatrie-erfahrener Menschen“ (BeB &<br />
CBP 2 , 2009, S. 82) eine hervorragende Quelle für eine solche Rückmeldung und sollten in<br />
jedem evaluativen Vorhaben einbezogen werden (Schmid, Spießl, Vukovich & Cording,<br />
2003). Die Untersuchung versteht sich somit gleichzeitig als Beitrag zur<br />
<strong>Versorgung</strong>sforschung und zur Angehörigenforschung.<br />
Die Arbeit besteht insgesamt <strong>aus</strong> sechs Kapiteln. In der im nächsten Kapitel folgenden<br />
theoretischen Hinführung (Kapitel 2) werden die für das Verständnis dieser Arbeit<br />
notwendigen theoretischen Konzepte dargestellt. Diese theoretische Grundlage der Arbeit<br />
bilden die drei thematischen Blöcke <strong>Integrierte</strong> <strong>Versorgung</strong>, Konzepte der Sozialen<br />
Psychiatrie und Angehörige psychisch erkrankter Menschen. In Kapitel 3 wird die<br />
Entstehung der Fragestellung „Wie beurteilen Angehörige das NetzWerk psychische<br />
Gesundheit?“ erläutert und das NWpG vorgestellt. Das Kapitel 4 beschäftigt sich mit der<br />
Konzeption der in dieser Diplomarbeit durchgeführten Untersuchung und der dafür<br />
<strong>aus</strong>gewählten Methodik. Um die Forschungsfrage zu beantworten, wurde ein qualitativer<br />
Forschungsansatz gewählt. Dabei wurden die Daten mit dem problemzentrierten Interview<br />
erhoben, für das ein Interviewleitfaden konstruierte wurde. Ausgewertet wurden die so<br />
gewonnenen verbalen Daten mit der qualitativen Inhaltsanalyse. In Kapitel 5 werden<br />
schließlich die Ergebnisse der empirischen Untersuchung präsentiert. Diese unterteilen sich<br />
in die vier Ergebniskategorien Veränderungen, Hindernisse, hilfreiche Konzepte und<br />
Idealversorgung, welche sich für das Forschungsinteresse als relevant erwiesen haben. Die<br />
Arbeit schließt mit der Diskussion in Kapitel 6 ab, in dem die Ergebnisse im Hinblick auf<br />
die Fragestellung interpretiert und bewertet werden.<br />
Schließlich sei noch darauf hingewiesen, wie bestimmte Begriffe in dieser Arbeit<br />
verwendet werden: Wenn von Angehörigen die Rede ist, sind Angehörige psychisch<br />
erkrankter Menschen gemeint. Der Begriff Betroffene meint Menschen, die psychisch<br />
erkrankt sind bzw. sich in einer psychischen Krise befinden. Weiterhin sei angemerkt, dass<br />
sich <strong>Integrierte</strong> <strong>Versorgung</strong> zwar auf das gesamte Gesundheitssystem beziehen kann, sich<br />
diese Arbeit jedoch auf die IV in der psychiatrischen <strong>Versorgung</strong> beschränkt.<br />
2 Bundesverband evangelische Behindertenhilfe e. V. & Charitas Behindertenhilfe und Psychiatrie e.V.<br />
10
2 Theoretische Hinführung<br />
2 Theoretische Hinführung<br />
Das Kapitel 2 bildet die theoretische Einbettung für die empirische Untersuchung der<br />
vorliegenden Arbeit. Dieser theoretische Hintergrund setzt sich <strong>aus</strong> drei großen<br />
Themenblöcken zusammen: Die <strong>Integrierte</strong> <strong>Versorgung</strong> (2.1) gibt den gesetzlichen<br />
Rahmen zur Schaffung neuer <strong>Versorgung</strong>sstrukturen vor, lässt bei der inhaltlichen<br />
Gestaltung der IV-Verträge aber viel Freiraum zu. Die für den untersuchten IV-Vertrag<br />
NWpG relevanten inhaltlichen Konzepte werden in Kapitel 2.2 (Konzepte der Sozialen<br />
Psychiatrie) vorgestellt. In Kapitel 2.3 geht es um Angehörige psychisch erkrankter<br />
Menschen, <strong>aus</strong> deren Perspektive das NWpG in der Untersuchung beurteilt wird.<br />
2.1 <strong>Integrierte</strong> <strong>Versorgung</strong><br />
Der Begriff der <strong>Integrierte</strong>n <strong>Versorgung</strong> (IV) zeichnet sich durch eine Reihe von<br />
unterschiedlichen Aspekten <strong>aus</strong>. Eine erste Orientierung zum Verständnis vermittelt die<br />
folgende Definition:<br />
„Definiert wird ,Integration' als die [Wieder]herstellung einer Einheit [<strong>aus</strong> Differenziertem].<br />
<strong>Integrierte</strong> <strong>Versorgung</strong>sstrukturen bedeuten somit eine ganzheitliche Sichtweise der Leistungserbringung<br />
im Gesundheitswesen, die im Idealfall alle Etappen einer Patientenbehandlung über<br />
verschiedene Sektoren hinweg berücksichtigt.“ (Güssow, Schumann, Braun, Hildebrandt &<br />
Stüve, 2008, S. 3)<br />
Das Grundprinzip der IV besteht in der Forderung nach einer reformierten integrierten<br />
<strong>Versorgung</strong>sstruktur. Integriert meint dabei eine bessere Vernetzung und Koordination<br />
zwischen allen Leistungserbringern der <strong>Versorgung</strong>slandschaft. Diese wird im deutschen<br />
Gesundheitswesen stark erschwert, da rechtlich eine Trennung nach Sektoren vorgegeben<br />
ist, an denen sich auch die für die Finanzierung vorgesehenen Budgets orientieren (Rössler,<br />
2008).<br />
Nach dieser ersten Einordnung des Begriffs der <strong>Integrierte</strong>n <strong>Versorgung</strong>, soll zum<br />
vertiefenden Verständnis auf folgende weiterführenden Fragen eingegangen werden: Was<br />
sind die Ziele der IV und was ist deren Hintergrund (2.1.1)? Wie ist die IV gesetzlich<br />
verankert und wie viele IV-Verträge bestehen aktuell (2.1.2)? Welche Rahmenbedingungen<br />
werden vom Gesetzgeber festgelegt und welcher Freiraum wird bei der inhaltlichen<br />
Ausgestaltung gelassen (2.1.3)? Welche Aspekte der IV können kritisiert werden (2.1.4)?<br />
11
2 Theoretische Hinführung<br />
2.1.1 Ziele<br />
Die starre sektorale Trennung im deutschen Gesundheitssystem birgt vor allem für<br />
chronisch kranke Menschen Probleme in sich, da sie zwischen stationärem, ambulantem<br />
und Rehabilitationssektor hin und her wechseln (Fritze, 2005). Dabei findet meist wenig<br />
Abstimmung bzw. Kooperation über die Sektoren hinweg statt, wodurch “Zeit- und<br />
Reibungsverluste an den Übergängen, nicht optimale Behandlungsergebnisse, Doppelversorgung<br />
für die einen, Unterversorgung für die anderen Patienten und nicht zuletzt<br />
unnötige Kosten“ (DGP 3 , 2010, S. 1) entstehen. Aus diesen Problemen des Gesundheitswesens<br />
leiten sich die Ziele der <strong>Integrierte</strong>n <strong>Versorgung</strong> ab, für die im Jahre 2000 die erste<br />
gesetzliche Grundlage geschaffen wurde (s. Kap. 2.1.2): Eine flächendeckende<br />
sektorenübergreifende <strong>Versorgung</strong> wird als Hauptziel angestrebt, da sie das Potenzial hat,<br />
Behandlungsqualität zu verbessern und Kosten einzusparen (Fritze, 2005). Mit der<br />
Überwindung der starren Trennung zwischen ambulanten, stationären und weiteren<br />
Sektoren hin zur IV im Sinne einer Integration der einzelnen Sektoren können<br />
Qualitätsverluste der Behandlung an den Sektorübergängen verhindert werden (Zechert et<br />
al., 2010). Eine stärkere Vernetzung der Fachdisziplinen schafft sektorenübergreifende<br />
Kooperation und Kommunikation und ermöglicht so eine am Patienten statt am Sektor<br />
orientierte Behandlung (Kissling, 2008). Diese verspricht eine Verbesserung der<br />
Behandlungsqualität, da eine zielorientierte, gut abgestimmte kontinuierliche Behandlung<br />
mit Rückfallprävention erleichtert wird (Kissling, 2008; Treeck, Bergmann & Schneider,<br />
2008). Aufgrund ihres sektorenübergreifenden <strong>Versorgung</strong>sbedarfs sind vor allem<br />
Menschen mit chronisch rezidivierenden Erkrankungen auf die Verbesserung der<br />
Behandlungskontinuität angewiesen. Psychische Erkrankungen sind geradezu prädestiniert<br />
für die IV, da diese oft zur Chronifizierung oder Rezidiven neigen (Fritze, 2005). Die IV<br />
stellt individuelle, bedarfsgerechte „Behandlungs- und <strong>Versorgung</strong>spakete“ (DGP, 2010, S.<br />
3) zur Verfügung, die „dem multidimensionalen Charakter seelischer Erkrankungen besser<br />
gerecht werden“ (DGP, 2010, S. 3). Des Weiteren soll eine effektivere Sektorenvernetzung<br />
das Zurechtfinden im bisher zwar vielfältigen, aber unübersichtlichen und teils schlecht<br />
vernetzten psychosozialen <strong>Versorgung</strong>sangebot in Deutschland erleichtern (Treeck et al.,<br />
2008). Neben der Verbesserung der Behandlungsqualität ist die Reduktion der<br />
Gesundheitskosten ein wesentliches Ziel der IV und von Interesse für die Krankenkassen<br />
(Fritze, 2005; Kissling, 2008). Kosten lassen sich einsparen durch eine effizientere<br />
3 Dachverband Gemeindepsychiatrie e.V.<br />
12
2 Theoretische Hinführung<br />
Behandlung, das Vermeiden von Doppeluntersuchungen oder durch den Ausbau der<br />
ambulanten <strong>Versorgung</strong> und das Verringern der stationären kostenintensiven <strong>Versorgung</strong><br />
(Fritze, 2005; Kissling, 2008). Ein weiteres Ziel der IV ist die Sicherstellung einer<br />
flächendeckenden <strong>Versorgung</strong> (Zechert et al., 2010). Kann die Vernetzung der Sektoren<br />
und mit ihr die sektorenübergreifende Kommunikation flächendeckend erhöht werden,<br />
würde so auch dem „Efficacy-Effectiveness-Gap“ (Kissling, 2008, S. 964) entgegen<br />
gewirkt werden. Dieser beschreibt das Phänomen, dass die allgemeine Behandlungsqualität<br />
schlechter als nötig ist, da es ungefähr 10 Jahre dauert, bis sich die neusten Erkenntnisse<br />
flächendeckend umgesetzt haben (Kissling, 2008). Wichtig zu bemerken ist, dass das<br />
Konzept der IV, bezogen auf den psychiatrischen Bereich, kein grundsätzlich neues ist. Die<br />
Wurzeln der IV liegen bereits in den 70er Jahren, als im Zusammenhang mit der<br />
Psychiatrie-Enquete Forderungen nach einer Reform des Gesundheitssystems in<br />
Deutschland aufkamen, die sich in den Zielen der IV wiederfinden lassen (Rössler, 2008;<br />
Zechert et al., 2010). Als Bilanz lässt sich demnach feststellen, dass 30 Jahre vergangen<br />
sind, bis es zu einer ersten tatsächlichen strukturellen Veränderung kam.<br />
2.1.2 Gesetzliche Grundlage<br />
Mit der Einführung des Gesundheitsreformgesetzes im Jahre 2000 wurde erstmals eine<br />
gesetzliche Grundlage für die Umsetzung <strong>Integrierte</strong>r <strong>Versorgung</strong> im Sozialgesetzbuch V<br />
gelegt (Kunze & Priebe, 2006; Treeck et al., 2008). Es wurde jedoch kaum Gebrauch von<br />
der gesetzlichen Möglichkeit gemacht, IV-Verträge abzuschließen (Zechert et al., 2010).<br />
Dies ist vermutlich der Komplexität der gesetzlichen Vorgaben geschuldet oder aber auch<br />
dem Bedenken der Akteure, die ökonomische Verantwortung neu zu verteilen (Fritze,<br />
2005; Kunze & Priebe, 2006). Richtig in Schwung kamen die IV-Vertragsabschlüsse erst<br />
mit dem GKV-Modernisierungsgesetz 2004, das diese neu regelte (SGB V §§ 140a - d).<br />
Das Verfahren wurde entbürokratisiert und die einzelnen Krankenkassen erhielten<br />
gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung mehr Eigenständigkeit beim Vertragsabschluss,<br />
indem deren Zustimmungspflicht aufgehoben wurde (Fritze, 2005; Kunze &<br />
Priebe, 2006; Zechert et al., 2010). Hinzu kam ein finanzieller Anreiz in Form einer<br />
Anschubfinanzierung, deren Höhe allein für den psychiatrischen <strong>Versorgung</strong>sbereich ca.<br />
210 Mio. € betrug. Ursprünglich war die Anschubfinanzierung bis auf Ende 2006 begrenzt,<br />
wurde dann aber noch bis Ende 2008 verlängert (Kissling, 2008). Allerdings werden diese<br />
Gelder nicht zusätzlich vergeben, sondern stammen <strong>aus</strong> dem Gesamtbudget des<br />
Gesundheitswesens (Hambrecht, 2004). Es handelt sich dabei um eine Umverteilung von<br />
13
2 Theoretische Hinführung<br />
1% der Gesamtvergütung ambulanter und stationärer Leistungen. Das heißt, dass eine<br />
Situation geschaffen wurde, bei der Kliniken und niedergelassene Ärzte mit den neu<br />
entstehenden <strong>Versorgung</strong>smodellen um Gelder konkurrieren (Hambrecht, 2004). Die<br />
Finanzmittel für die IV werden nämlich <strong>aus</strong> den Budgets aller Krankenhäuser und<br />
niedergelassener Ärzte abgezogen und danach an erfolgreiche Antragsteller <strong>aus</strong>gezahlt<br />
(Kissling, 2008). Ein weiterer Aspekt, den die IV mit sich bringt, ist eine Art Kunden-<br />
Bindung an einen bestimmten IV-Vertrag und dem darin festgelegten Behandlungsangebot,<br />
der bzw. das von der jeweiligen Krankenkasse abhängt (Zechert et al., 2010). Das<br />
Einschreiben in einen IV-Vertrag ist aber lediglich ein Angebot der Krankenkassen und<br />
erfolgt freiwillig. Teilweise wird diese freiwillige Einschränkung der Anbieterwahl mit<br />
einem vergünstigten Versicherungstarif entlohnt (Zechert et al., 2010). Weitere<br />
Gesetzesänderungen traten im April 2007 mit dem GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz in<br />
Kraft, in dem das Ziel der flächendeckenden <strong>Versorgung</strong> und die Einbeziehung des<br />
Pflegesektors festgelegt wurden (Groth<strong>aus</strong>, 2009). Im Jahre 2011 wurde die Liste<br />
potenzieller Vertragspartner im SBG V erweitert, so dass seitdem auch Verträge mit<br />
pharmazeutischen Unternehmen zulässig sind (§ 140b Abs. 1 SGB V). Den aktuellsten<br />
Stand über registrierte IV-Verträge im deutschen Gesundheitssystem liefert die<br />
Bundesgeschäftsstelle Qualitätssicherung GmbH (BQS) und beziffert diesen mit 6407<br />
Registrierungen bis Ende 2008 (Groth<strong>aus</strong>, 2009). Die Zahl der neu abgeschlossenen IV-<br />
Verträge sank darüber hin<strong>aus</strong> im Jahr 2008 um die Hälfte, was mit dem Auslaufen der<br />
Anschubfinanzierung zum Jahresende in Verbindung gebracht werden kann (Groth<strong>aus</strong>,<br />
2009). Eine Übersicht über 61 Verträge der IV im psychiatrischen Bereich (Stand 05/11),<br />
die nicht den Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, stellt die Deutsche Gesellschaft für<br />
Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN, 2011) zur Verfügung.<br />
2.1.3 Ausgestaltungsmöglichkeiten<br />
§ 140 SGB V lässt einen großen Spielraum bei der Ausgestaltung des konkreten<br />
<strong>Versorgung</strong>sangebotes. Prinzipiell kann alles darüber finanziert werden, was<br />
sektorenübergreifend oder fachübergreifend konzipiert ist und zu einer verbesserten<br />
Behandlungsqualität sowie zu einer mittelfristigen Kostensenkung führt (Kissling, 2008).<br />
Dadurch, dass die IV-Verträge frei <strong>aus</strong>gestaltet werden können, wird eine weitreichende<br />
Veränderung der bisherigen <strong>Versorgung</strong>slandschaft möglich (DGP, 2010). Die IV wird<br />
sogar für die erste realistische Möglichkeit seit der Psychiatrie-Enquete gehalten, neue<br />
<strong>Versorgung</strong>skonzepte in der Regelversorgung zu implementieren und diese auch<br />
14
2 Theoretische Hinführung<br />
finanzieren zu können (vgl. Kissling, 2008). Das große Gestaltungspotenzial der IV bietet<br />
besonders gemeindepsychiatrischen Trägern eine Chance, die ambulante psychiatrische<br />
<strong>Versorgung</strong> ernsthaft mitzugestalten und die bisherige klassische Arztzentrierung in der<br />
psychiatrischen <strong>Versorgung</strong> zu überwinden (vgl. Zechert et al., 2010). Zusammenfassend<br />
lässt sich sagen, dass die IV eine neue Konkurrenzsituation geschaffen hat, die allen<br />
Behandlungskonzepten die Möglichkeit eröffnet, eine Rolle im <strong>Versorgung</strong>ssystem zu<br />
spielen, so lange Behandlungsqualität und Kosteneffektivität gegeben sind.<br />
2.1.4 Kritikpunkte<br />
Neben all den Chancen und dem positiven Wandel, den die <strong>Integrierte</strong> <strong>Versorgung</strong><br />
verspricht, gibt es aber auch kritisch zu betrachtende Aspekte. Ein Kritikpunkt ist der Stand<br />
der wissenschaftlichen Begleitevaluation. Eine fundierte wissenschaftliche Auswertung<br />
könnte u. a. die Kontroverse klären, welche gemeindepsychiatrischen Angebote im Zuge<br />
der IV als Alternative zur stationären Behandlung <strong>aus</strong>gebaut werden sollten (Weinmann &<br />
Gaebel, 2005). In Deutschland sind solche Evaluationen von innovativen <strong>Versorgung</strong>smodellen<br />
wie der IV aber nur unzureichend vorhanden. Dies zeigt insbesondere eine<br />
systematische Untersuchung von Metaanalysen und kontrollierten Studien zu<br />
gemeindepsychiatrischer <strong>Versorgung</strong> als Alternative zur stationären <strong>Versorgung</strong> bei<br />
schweren psychischen Erkrankungen (Weinmann & Gaebel, 2005). Als Ergebnis der<br />
Untersuchung ergab sich, dass in Deutschland strukturelle Vor<strong>aus</strong>setzungen für die<br />
Implementierung evidenzbasierter nicht-stationärer <strong>Versorgung</strong> fehlen. Daher können<br />
bisher nur Ergebnisse <strong>aus</strong> dem angloamerikanischen Sprachraum für Deutschland<br />
übernommen werden (Weinmann & Gaebel, 2005). Dies stellt ein Problem für die<br />
Nachweisbarkeit der Behandlungsqualität dar, die in der IV gefordert wird. Aus der<br />
erwähnten Analyse von <strong>Versorgung</strong>sstudien (Weinmann & Gaebel, 2005) konnten<br />
außerdem drei Erfolgsfaktoren her<strong>aus</strong>gearbeitet werden, die wichtig für eine integrierte<br />
psychiatrische <strong>Versorgung</strong> sind. Das ist 1) die Gewährleistung wissenschaftlich fundierter<br />
gemeindepsychiatrischer Behandlung durch verbindliche Kooperationsmodelle oder<br />
personelle und finanzielle Gesamtverantwortung, 2) H<strong>aus</strong>besuche und 3) multiprofessionelle<br />
Teams mit multiprofessionellen Kompetenzen. Das Problem einer fehlenden<br />
umfassenden Evaluation der IV-Projekte wird durch deren Heterogenität noch erschwert<br />
(Hambrecht, 2004). Dieser Umstand ist der gesetzlich unscharfen Definition der IV<br />
geschuldet: Es ist lediglich festgeschrieben, dass die <strong>Versorgung</strong>smodelle sektorübergreifend<br />
oder fachübergreifend konzipiert sein müssen (Kissling, 2008). Dadurch<br />
15
2 Theoretische Hinführung<br />
könne laut Hambrecht „alles mögliche“ (2004, S. 218) als IV verstanden werden und es<br />
bestehe die Gefahr, dass bereits bestehende Angebote zu IV-Projekten „aufgeblasen“<br />
(Hambrecht, 2004, S. 218) werden. Ein anderer kritisch zu betrachtender Aspekt ist die<br />
Finanzierung der IV. Da keine zusätzlichen Mittel für die IV bereit gestellt werden, geht<br />
die Finanzierung alternativer <strong>Versorgung</strong>smodelle zu Lasten der Regelversorgung. Dies<br />
einen solidarischen Wettbewerb zu nennen, stellt für Fritze (2005) einen Widerspruch an<br />
sich dar. In der bereits chronisch unterfinanzierten Krankenversorgung führe die finanzielle<br />
Umverteilung dazu, dass langfristig viele Leistungserbringer <strong>aus</strong> der <strong>Versorgung</strong>slandschaft<br />
<strong>aus</strong>scheiden. Problematisch sei außerdem, dass die Krankenkassen die zu<br />
fördernden IV-Projekte <strong>aus</strong>wählen, obwohl es keine festgelegten Kriterien für die<br />
Entscheidung über die Mittelvergabe gibt (Hambrecht, 2004). Dies führe zu neuen<br />
Abhängigkeiten von den gesetzlichen Krankenkassen, so dass Leistungserbringer guten<br />
Kontakt zu ihnen pflegen müssten.<br />
2.2 Konzepte der Sozialen Psychiatrie<br />
Dieser zweite Teil der theoretischen Hinführung stellt wesentliche Konzepte der Sozialen<br />
Psychiatrie vor, die in gemeindeorientierter <strong>Integrierte</strong>r <strong>Versorgung</strong> umgesetzt werden.<br />
Zunächst werden die folgenden Konzepte im Einzelnen beschrieben: Empowerment<br />
(2.2.1), Recovery (2.2.2), Soteria (2.2.3), Home Treatment (2.2.4), bedürfnisangepasste<br />
Behandlung (2.2.5), Offener Dialog im Netzwerk (2.2.6) und der Trialog (2.2.7). Als<br />
Zusammenfassung und Abschluss des Kapitels werden <strong>aus</strong>gewählte Konzepte der Sozialen<br />
Psychiatrie im Zusammenhang (2.2.8) dargestellt.<br />
Anzumerken ist noch, dass Sozial- und Gemeindepsychiatrie in dieser Arbeit im Sinne von<br />
Haselmann (2010) als eine Einheit verstanden werden sollen. Beide Begriffe lassen sich<br />
unter dem Oberbegriff Soziale Psychiatrie (S. 232) zusammenfassen. Haselmann (2010)<br />
hält diese Zusammenfassung für sinnvoll, „insoweit sich die Gemeindepsychiatrie als<br />
Handlungs- und Organisationsprinzip für die Umsetzung sozialpsychiatrischen Ideenguts<br />
und der entsprechenden Grundhaltungen versteht“ (S. 232).<br />
2.2.1 Empowerment<br />
Empowerment ist ein zentrales Rahmenkonzept der Sozialen Psychiatrie (Haselmann,<br />
2008), das mit vielen weiteren Konzepten verflochten ist bzw. diese einbettet (s. Kap. 2.2.2<br />
Recovery). Kern des Empowerment-Konzepts ist die Stärkung von Selbstbestimmung und<br />
16
2 Theoretische Hinführung<br />
Eigenständigkeit Betroffener durch Aktivierung eigener Ressourcen (Haselmann, 2008).<br />
Damit stellt es, ähnlich wie Antonovskys Salutogenese-Konzept (1997), der weit<br />
verbreiteten defizitären Sichtweise eine ressourcenorientierte gegenüber. Statt Mängel<br />
werden Potenziale in betroffenen Menschen gesehen, die sich in einem fortwährenden<br />
Wachstumsprozess entfalten können. Außerdem werden bereits bestehende Fähigkeiten<br />
anerkannt und soweit möglich genutzt. Zum Empowerment-Begriff gibt es in der Literatur<br />
unterschiedliche Definitionen und Auslegungen, für diese Arbeit soll er im Sinne von<br />
Herringers (2006) Arbeitsdefinition verwendet werden:<br />
Der Begriff ,Empowerment' bedeutet Selbstbefähigung und Selbstbemächtigung, Stärkung von<br />
Eigenmacht, Autonomie und Selbstverfügung. Empowerment beschreibt mutmachende<br />
Prozesse der Selbstbemächtigung, in denen Menschen in Situationen des Mangels, der<br />
Benachteiligung oder der gesellschaftlichen Ausgrenzung beginnen, ihre Angelegenheiten<br />
selbst in die Hand zu nehmen, in denen sie sich ihrer Fähigkeiten bewusst werden, eigene<br />
Kräfte entwickeln und ihre individuellen und kollektiven Ressourcen zu einer selbstbestimmten<br />
Lebensführung nutzen lernen. Empowerment - auf eine kurze Formel gebracht - zielt auf die<br />
(Wieder) Herstellung von Selbstbestimmung über die Umstände des eigenen Alltags. (S. 20)<br />
Entstehung<br />
Hervorgegangen ist der Empowerment-Begriff ursprünglich <strong>aus</strong> der amerikanischen<br />
Emanzipationsbewegung der Frauen und der Befreiungsbewegung der Schwarzen, die sich<br />
im Kampf gegen Unterdrückung und Machtlosigkeit einsetzten (Knuf, 2005).<br />
Empowerment stellt als Ermächtigung das Gegenstück zu Machtlosigkeit dar. In den<br />
psychologischen Kontext fand das Empowerment im Zuge der amerikanischen Gemeindepsychologie<br />
Einzug. In diesem Zusammenhang prägte Rappaport (1984) den Begriff mit<br />
der folgenden Definition:<br />
„Empowerment is viewed as a process: the mechanism by which people, organizations, and<br />
communities gain mastery over their lives.“ (S. 2)<br />
Damit werden die drei Ebenen, auf die sich Empowerment beziehen kann, angesprochen.<br />
Neben der in der Literatur im Vordergrund stehenden individuellen Ebene, kann<br />
Empowerment auch auf institutioneller oder politischer Ebene stattfinden (Zimmerman,<br />
2000). Letztere basiert auf Partizipation, wie der Teilhabe an wichtigen politischen<br />
Entscheidungen. Selbsthilfeorganisationen sind ein Beispiel für die Umsetzung einer<br />
solchen Einflussnahme. Sie sind mittlerweile auch in Gremien psychiatrischer <strong>Versorgung</strong><br />
vertreten und können dort ihre Perspektive einbringen. Empowerment ist generell eine<br />
17
2 Theoretische Hinführung<br />
wichtige Größe in der Selbsthilfe-Bewegung (Knuf, 2005): Als Hilfe zur Selbsthilfe geht<br />
Selbsthilfe automatisch einher mit Empowerment.<br />
Grundlage des Empowermentkonzeptes im psychosozialen Bereich bilden sozialpsychologische<br />
Theorien zur Generalisierung von Kontrollerwartungen von Rotter und<br />
Seligman sowie der Selbstwirksamkeit durch soziales Lernen nach Bandura (Kilian, 2008).<br />
Das Konzept der erlernten Hilflosigkeit von Seligman steht Empowerment in besonderer<br />
Weise gegenüber: Während Seligman die Hilflosigkeit durch frühe Erfahrungen der<br />
Kontrolllosigkeit erklärt, steht im Empowermentkonzept die Wiedergewinnung von<br />
Kontrollerwartungen durch das Erleben von Kontrolle über das eigene Leben im<br />
Mittelpunkt. Diese Kontrollerfahrung kann durch Einflussnahme in Entscheidungsprozesse<br />
und Verantwortungsübernahme ermöglicht werden (Kilian, 2008).<br />
Empowerment in der psychosozialen Praxis<br />
Für den psychiatrischen Kontext bedeutet Empowerment vor allem eine Änderung der<br />
Professionellen-Betroffenen-Beziehung hin zu einer gleichberechtigten Begegnung, die<br />
„frei ist von expertendominierten normativen Vorgaben“ (Haselmann, 2008, S. 100) und<br />
stattdessen Betroffene als Experten in eigener Sache einbezieht. In der Behandlungssituation<br />
drückt sich dies durch Mitbestimmung der Betroffenen <strong>aus</strong>, zum Beispiel in Form<br />
eines gemeinsam erarbeiteten Behandlungsplanes. Empowerment beinhaltet laut Seibert<br />
(2000) immer eine Doppelperspektive, die der Betroffenen und die der Professionellen.<br />
Bewirken könne Empowerment nur der Betroffene selbst, Professionelle hätten dabei aber<br />
die Aufgabe, empowernde Prozesse zu unterstützen und günstige Rahmenbedingungen<br />
dafür zu schaffen (Haselmann, 2008). Im Bezug darauf stellt Haselmann (2008) fest, dass<br />
es sich beim Empowerment-Konzept vor allem um eine professionelle Haltung und<br />
weniger um Handlungsstrategien handelt. Dies erschwere die konkrete Umsetzung in die<br />
Praxis. Eine Hilfestellung für diese Problematik hat Knuf (2005) erarbeitet, indem er u. a.<br />
ganz konkrete Handlungsanleitungen zur Förderung von Selbstbestimmungsfähigkeit gibt<br />
(z. B. „Keinen Druck auf Klienten <strong>aus</strong>üben, damit er sich entscheidet“ (S. 5)). An anderer<br />
Stelle (vgl. Knuf, 2000a, S. 41-44) werden Professionellen die folgenden drei<br />
Grundprinzipien als Orientierung zur praktischen Umsetzung von Empowerment an die<br />
Hand gegeben:<br />
1) Vertrauen in die Fähigkeit jedes Einzelnen: Betroffene wissen z. B. selbst oft gut, was<br />
ihnen hilft<br />
18
2 Theoretische Hinführung<br />
2) Nicht beurteilende Haltung: Akzeptanz z. B. vor alternativen Lebensentwürfen<br />
Betroffener haben<br />
3) Passive Aktivität: Zurückhaltung ermöglicht Betroffenen, eigene Fähigkeiten zu nutzen<br />
Knuf (2005) gibt aber auch zu bedenken, dass Empowerment-Förderung im Sinne von<br />
Wahlfreiheit und Selbstbestimmung auch die Möglichkeit beinhaltet, das eigene<br />
Empowerment abzulehnen. Es solle demnach nie Aktivität und Verantwortungsübernahme<br />
aufgezwungen werden, sondern „empowerment-ermöglichend“ (S. 5) gearbeitet werden.<br />
Als weitere Einschränkung für die Umsetzung von Empowerment-Strategien wird in der<br />
Literatur das Vorliegen einer akuten Hilfsbedürftigkeit genannt, in der KlientInnen in einer<br />
abhängig-passiven Position feststecken und Sicherheit brauchen oder Situationen, in denen<br />
Eigen- oder Fremdbedrohung besteht (Lenz, 2002). Dar<strong>aus</strong> ergibt sich für Professionelle<br />
bei der Umsetzung des Empowerment-Konzepts als weitere Her<strong>aus</strong>forderung, den<br />
Balanceakt zwischen Selbsthilfe und Fremdhilfe sowie Aktivität und Passivität zu meistern<br />
(Knuf, 2005). Dabei sollte die Regel „so viel Selbsthilfe wie möglich, so viel Fremdhilfe<br />
wie nötig“ (Knuf, 2000b, S. 278) eine grobe Orientierungshilfe leisten. Die aktuell wohl<br />
größte Her<strong>aus</strong>forderung sei jedoch darin zu sehen, finanziellen Kürzungen zum Trotz<br />
Empowerment-Prozesse von KlientInnen zu unterstützen und ihnen nicht <strong>aus</strong><br />
wirtschaftlichem Druck her<strong>aus</strong> die Chance zu nehmen, selbst zu handeln und neue<br />
Fähigkeiten zu entfalten (Knuf, 2005). Mit zunehmend schwieriger finanzieller Lage werde<br />
psychiatrische <strong>Versorgung</strong> immer mehr auch auf die professionelle Arbeit von<br />
Angehörigen und Psychiatrie-Erfahrenen angewiesen sein. Dies könne auch die<br />
gleichberechtigte Beziehung aller Personengruppen weiter fördern (Knuf, 2005).<br />
2.2.2 Recovery<br />
Die ersten VertreterInnen der Recovery-Bewegung waren Psychiatrie-Erfahrene, die sich<br />
nicht mit einer negativen Diagnose abfanden und entgegen professioneller Einschätzung<br />
gesundeten (Knuf, 2008). Eine beeindruckende Entwicklung durchlief zum Beispiel Pat<br />
Deegan 4 : Trotz der Schizophrenie-Diagnose in der Jugend promovierte sie später in<br />
Klinischer Psychologie. Heute setzt sie sich in verschiedenen Projekten und Institutionen<br />
für Betroffene ein, forscht, lehrt und berät (Amering & Schmolke, 2012). Als lebende<br />
Beweise tragen Psychiatrie-Erfahrene wie Pat Deegan die Recovery-Botschaft zu anderen<br />
Betroffenen weiter, um ihnen Mut zu machen und die noch immer tiefsitzende<br />
4 (online: www.patdeegan.com, Stand: 17.01.2012)<br />
19
2 Theoretische Hinführung<br />
Überzeugung der Unheilbarkeit von sogenannten schweren psychiatrischen Erkrankungen<br />
zu bekämpfen. Mittlerweile hat der Recovery-Ansatz auch in der professionellen Welt Fuß<br />
gefasst und ist in vielen englischsprachigen Ländern als gesundheitspolitische Vorgabe<br />
verankert (Knuf, 2008). Dennoch gibt es KritikerInnen des Recovery-Konzepts in der<br />
Fachwelt (Bottlender, 2009). Eine solche Skepsis erscheint allerdings Missverständnissen<br />
und Unklarheiten bezüglich des Konzepts geschuldet, die durch das Fehlen einer klar<br />
umrissenen und allgemeingültigen Definition von Recovery noch verschärft wird<br />
(Amering & Schmolke, 2012). Ein Beispiel für so ein mögliches Missverständnis ist die<br />
Annahme, dass Recovery mit der Wiederherstellung des Zustandes vor der Erkrankung<br />
gleichzusetzen sei und somit ein völliges Verschwinden jeglicher Symptome verlange.<br />
Amering und Schmolke stellen in ihrem Buch „Recovery. Das Ende der Unheilbarkeit“<br />
(2012) aber klar, dass Recovery sowohl mit als auch ohne bestehende Symptome möglich<br />
ist. Was Recovery dagegen <strong>aus</strong>mache, sei ein erfülltes und befriedigendes Leben führen zu<br />
können. Es bedeute sogar vor allem, trotz vorliegender Einschränkungen ein solch erfülltes<br />
Leben zu führen, wie in der folgenden viel zitierten Definition von Anthony betont wird:<br />
“(Recovery) is a way of living a satisfying, hopeful, and contributing life even with the<br />
limitations c<strong>aus</strong>ed by illness. Recovery involves the development of new meaning and purpose<br />
in one’s life as one grows beyond the catastrophic effects of mental illness.” (1993, S. 13)<br />
Menschen, die sich „in Recovery“ (Davidson & Roe, 2007, S. 464) befinden – ein<br />
Ausdruck, der verdeutlicht, dass es sich bei Recovery nicht um einen Endzustand, sondern<br />
vielmehr um einen Prozess handelt – sind so mit der Her<strong>aus</strong>forderung konfrontiert, eigene<br />
Grenzen zu akzeptieren, konstruktiv mit diesen umzugehen und daran zu wachsen. Pat<br />
Deegan (1996) beschreibt diese Aspekte im folgenden Zitat <strong>aus</strong> eigener Erfahrung:<br />
„Recovery often involves a transformation of the self wherein one both accepts ones limitation<br />
and discovers a new world of possibility. This is the paradox of recovery i.e., that in accepting<br />
what we cannot do or be, we begin to discover who we can be and what we can do. Thus,<br />
recovery is a process.“ (S. 13)<br />
Die angesprochenen Missverständnisse können auch von einem grundlegend<br />
unterschiedlichen Verständnis von Gesundheit herrühren. Während in der klassischen<br />
Psychiatrie noch weitgehend die vollkommene Abwesenheit von Krankheit als<br />
Gesundheitskonzept verbreitet ist, sieht der Recovery-Ansatz Gesundheit darin, dass<br />
Menschen möglichst gut mit psychischen Problemen leben können (Knuf, 2008). Dar<strong>aus</strong><br />
lässt sich der Schluss ziehen, dass ein Mensch psychisch krank ist, weil ihm „aktuell die<br />
20
2 Theoretische Hinführung<br />
Fähigkeit fehlt, mit diesen Symptomen so umzugehen, dass er sein Leben auf eine<br />
möglichst zufriedene Art weiterleben kann“ (Knuf, 2008, S. 9). Dieses Gesundheits- bzw.<br />
Krankheitsverständnis eröffnet Menschen, die bisher als chronisch psychisch erkrankt<br />
stigmatisiert wurden, eine Perspektive für ihre eigene Weiterentwicklung und Genesung,<br />
weil Fähigkeiten erlernt werden können. Amering (2009) erklärt, dass diese Hoffnung auch<br />
ihre Berechtigung hat, da der Verlauf der meisten psychischen Störungen variabel sei und<br />
Angst davor, Hoffnungen enttäuschen zu können, kein Grund für negative Prognosen sein<br />
dürfe. Aus der Recovery-Forschung ist bekannt, dass Hoffnung eine wesentliche<br />
Vor<strong>aus</strong>setzung für den Genesungsprozess ist (Bradstreet, 2004). In der psychiatrischen<br />
Praxis ist es auch Aufgabe der professionellen HelferInnen, ihren KlientInnen diese<br />
Hoffnung zu vermitteln (Knuf, 2008). Wenn sie jedoch selbst eine Genesung von<br />
vornherein <strong>aus</strong>schließen, kann sich diese Hoffnungslosigkeit an ihre KlientInnen<br />
übertragen und ihnen so eine wichtige Vor<strong>aus</strong>setzung für eine Gesundung verwehren (vgl.<br />
Bradstreet, 2004). Dadurch wird die Unheilbarkeitsüberzeugung zu einer selbsterfüllenden<br />
Prophezeiung (Amering & Schmolke, 2012). Die Recovery-Bewegung versucht, diesen<br />
Kreislauf zu durchbrechen. Wie professionelle HelferInnen Zuversicht konkret vermitteln<br />
können und welche weiteren Rahmenbedingungen Wachstums- und Reifungsprozesse<br />
fördern, wurde in der Literatur erarbeitet (Knuf & Bridler, 2008). Dazu zählen u. a. Geduld<br />
und Zeit zu haben sowie sich als Mensch in die Klientenbeziehung einzubringen. Ein<br />
weiteres Recovery-Element, das in einem Übersichtsartikel zu bisherigen Erkenntnissen<br />
internationaler Recovery-Literatur (Bradstreet, 2004) identifiziert wurde, ist das Erleben<br />
von Kontrolle über das eigene Leben. Dies veranschaulicht die Verflechtung mit dem<br />
Empowerment-Konzept, zu dessen Kernelementen Selbstbestimmung und Kontrollerleben<br />
zählen: „Wer wieder mehr Einfluss auf sein Leben gewinnt, wer selber entscheidet und<br />
sich weniger <strong>aus</strong>geliefert fühlt, der wird eher wieder genesen“ (Knuf, 2005, S. 6).<br />
Erfahrungsberichte und qualitative Interviews stellen die zentrale Datenquellen für<br />
Recovery-Forschung dar (Knuf, 2008), <strong>aus</strong> denen viele Beiträge zur Theorieentwicklung<br />
hervorgegangen sind (s. u. a. Andresen, Caputi & Oades, 2006; Ralph & The Recovery<br />
Advisory Group, 1999). Ein <strong>aus</strong>führlicher Überblick zu vorliegenden Konzepten und<br />
Forschungsergebnissen findet sich in einem Literaturreview (Ralph, 2000). Neben den<br />
zahlreichen persönlichen Recovery-Geschichten von Betroffenen belegen auch Recovery-<br />
Raten, dass Recovery möglich ist. Aus Vergleichen von Langzeitstudien zum Verlauf von<br />
Schizophrenie wird von 20% klinischer Recovery (Rückgang Symptome und Rückkehr<br />
zum vorherigen Funktionsniveau) und 35-45% sozialer Recovery (ökonomische und<br />
21
2 Theoretische Hinführung<br />
soziale Unabhängigkeit) berichtet (Warner, 2004). In anderen Untersuchungen ergaben sich<br />
durchschnittlich 28% (klinisch) bzw. 52% (sozial) als Recovery-Raten (de Girolamo,<br />
2000).<br />
2.2.3 Soteria<br />
Der Begriff Soteria stammt <strong>aus</strong> dem Griechischen und bedeutet Schutz, Geborgenheit und<br />
Entspannung (Ciompi, 2012). Der amerikanische Psychiater Lauren Mosher gründete 1971<br />
das erste Soteria-H<strong>aus</strong> in San Francisco, um Menschen in psychotischen Krisen eine<br />
Alternative zur stationären psychiatrischen Behandlung zu geben. Es entstand eine<br />
innovative Psychosebehandlung, die ohne bzw. mit gering dosierten Medikamenten<br />
<strong>aus</strong>kommt und stattdessen primär mit intensiver mitmenschlicher Begleitung 5 und<br />
entspannendem und heilendem Milieu arbeitet (Hasse, 2007). Damit wurde die<br />
Schizophreniebehandlung „entmedikalisiert, entprofessionalisiert, enthospitalisiert“<br />
(Mosher, 2001, S. 28) und der Weg hin zu einer Psychosebehandlung eröffnet.<br />
Entwicklung<br />
In Europa wurde das Soteria-Konzept erstmals 1984 vom Schweizer Psychiater Luc<br />
Ciompi umgesetzt (Ciompi, 2012). Das ursprüngliche Moshersche Konzept wurde für die<br />
therapeutische Wohngemeinschaft Soteria Bern jedoch weiterentwickelt und teilweise<br />
modifiziert. Ciompis Umsetzung der Soteria-Idee ist weniger radikal (Fink, 2011): Er<br />
arbeitet nach dem Prinzip Medikation so niedrig wie möglich (statt kompletter Verzicht)<br />
und mit einem halb professionell zusammengesetzten Team (statt nur Laien-<br />
MitarbeiterInnen). Während sich Moshers Konzept als antipsychiatrisch beschreiben lässt,<br />
ist Ciompis Umsetzung sozialpsychiatrisch orientiert (Fink, 2011). Außerdem führte<br />
Ciompi auf der Grundlage seiner Hypothesen zur Affektlogik (Ciompi, 1982) mit dem<br />
weichen Zimmer ein neues Kernelement ein. Das mit nur zwei Betten und Kissen<br />
eingerichtete Zimmer können NutzerInnen 6 und BetreuerInnen in der Akutphase<br />
gemeinsam nutzen, um in beruhigender, sicherer und reizarmer Umgebung emotionale<br />
Spannung abzubauen. Da Ciompi den emotionalen Spannungspegel als entscheidenden<br />
Kontrollparameter postuliert, der „bei disponierten Individuen – den Umschlag von einer<br />
alltäglich-normalen in eine psychotisch-krankhafte Funktionsweise der Psyche provoziert“<br />
(2001, S. 64), ist die emotionale Entspannung das erklärte Hauptziel. Diese Entspannung<br />
5 Die Begleitung statt Behandlung betont, dass sich Professionelle und Betroffene auf Augenhöhe begegnen.<br />
6 Auch die Verwendung von NutzerInnen statt PatientInnen betont, dass sich Professionelle und Betroffene auf<br />
Augenhöhe begegnen.<br />
22
2 Theoretische Hinführung<br />
wird nicht allein durch die Psychosebegleitung im weichen Zimmer, sondern durch die<br />
Kombination der einzelnen Soteria-Elemente wie der wohnlichen Atmosphäre des H<strong>aus</strong>es,<br />
der Normalität alltäglicher Beschäftigungen (Kochen, Einkäufe, ...), dem respektvollen<br />
Umgang mit den Bewohnern etc. geschaffen (Ciompi, 2001). Insgesamt beruft sich die<br />
Soteria Bern auf acht zentrale Behandlungsgrundsätze. Darunter besonders hervorzuheben<br />
sind, wie bereits beschrieben, (1) das möglichst normale, entspannende, gut überschaubare<br />
und reizgeschützte Milieu sowie (2) die kontinuierliche verständnisvolle Begleitung durch<br />
die (psychotische) Krise in Form eines Dabeiseins (being-with). Die weiteren<br />
Behandlungsgrundsätze werden wie folgt beschrieben (Vgl. Ciompi, 2009, S. 12):<br />
3. Persönliche und konzeptuelle Kontinuität über die ganze Zeit der Behandlung<br />
4. Kontinuierliche enge Zusammenarbeit mit der Familie und anderen wichtigen<br />
Bezugspersonen<br />
5. Klare und gleichsinnige Informationen für Patienten, Familie und Betreuer<br />
betreffend der Krankheit, ihrer Behandlung und den bestehenden Risiken und<br />
Chancen<br />
6. Gemeinsame Erarbeitung von klaren und realistischen Behandlungszielen und<br />
Zukunftserwartungen auf der Wohn- und Arbeitsachse<br />
7. Niedrigdosierte medikamentöse Behandlungsstrategien nach Übereinkunft, mit dem<br />
Ziel der kontrollierten Selbstmedikation<br />
8. Organisation von Nachbetreuung und Rückfallprophylaxe über mindestens zwei<br />
Jahre<br />
Forschungsergebnisse<br />
Aus Studien zur Wirksamkeit von Soteria lässt sich insgesamt ableiten, dass das Soteria-<br />
Setting ermöglicht, akut psychotische Symptome mit deutlich geringerer<br />
Medikamentierung als im stationären Setting zu beseitigen bzw. stark zu verringern<br />
(Hoffmann, 2001). Außerdem konnte in einer kontrollierten Vergleichsstudie über zwei<br />
Jahre (Ciompi et al., 1993) gezeigt werden, dass die Kriterien Psychopathologie, soziale<br />
und berufliche Wiedereingliederung, Gesamtzustand und Rückfallrate so gut wie im<br />
stationären Rahmen <strong>aus</strong>fallen, dabei jedoch 56% weniger Neuroleptika eingesetzt wurden.<br />
Deshalb spricht Ciompi von der „neuroleptikartigen Wirkung“ (2009, S. 17) von Soteria,<br />
wobei letzteres aber ohne die mit Neuroleptika einhergehenden schädlichen Nebenwirkungen<br />
<strong>aus</strong>kommt.<br />
23
2 Theoretische Hinführung<br />
Soteria heute<br />
Nach nunmehr 28 Jahren hat sich auch die Soteria Bern weiterentwickelt. Inzwischen ist<br />
<strong>aus</strong> der therapeutischen Wohngemeinschaft ein milieutherapeutisches Zentrum geworden<br />
(Hoffmann, 2009). Die Soteria Bern bietet heute eine integrierte Behandlung akuter<br />
Psychosen an und ist im Sinne <strong>Integrierte</strong>r <strong>Versorgung</strong> gut mit weiteren ambulanten und<br />
stationären <strong>Versorgung</strong>sangeboten vernetzt. <strong>Integrierte</strong> Tageskliniken, Home Treatment,<br />
Übergangs-WGs mit Soteria-Elementen und Ehemaligen-Gruppen sollen den<br />
Stabilisierungsprozess auch nach dem Auszug <strong>aus</strong> dem Soteriah<strong>aus</strong> weiterführen. Darüber<br />
hin<strong>aus</strong> wurde ein Cannabis-Behandlungskonzept eingeführt und das Recovery-Konzept in<br />
die Leitideen aufgenommen (Hoffmann, 2009). Hinzuzufügen ist auch, dass sich das<br />
Angebot nicht mehr auf den schizophrenen Formenkreis beschränkt, sondern auch offen<br />
für Betroffene anderer Problematiken wie Boderline-Persönlichkeitsstörung und<br />
Depression ist. Die neuste Innovation der Soteria Bern ist das Früherkennungs- und<br />
Therapiezentrum für psychische Krisen (FETZ Bern), das 2009 startete (Hoffmann, 2009).<br />
Während sich das Soteria-Konzept in den USA nicht halten konnte, entstanden v. a. im<br />
deutschsprachigen Raum zahlreiche Ableger der Soteriologie, unter der Mosher die<br />
philosophische Grundhaltung der Soteria-Idee versteht (Kroll, Machleidt, Debus & Stigler,<br />
2001). Dabei unterscheiden Kroll et al. (2001) drei Arten der Umsetzung der Soteriologie:<br />
Nach US-amerikanischem bzw. Schweizer Vorbild konzipiert entstanden (1) Soteria-<br />
Einrichtungen als Alternative zur Klinik u. a. in Frankfurt/Oder, Zwiefalten, Wien,<br />
Niederösterreich, Bremen, Köln, Nürnberg und München. Entgegen des Ursprungsgedankens<br />
gibt es mittlerweile auch (2) psychiatrische Stationen mit integrierten Soteria-<br />
Elementen. In Gütersloh und Gießen wurden zum Beispiel Konzepte wie Wohnküche,<br />
Bezugspersonensystem und ein stärkeres Einbeziehen von Angehörigen im stationären<br />
Setting integriert, um die Behandlungsqualität zu verbessern (Kroll et al., 2001). Als<br />
weitere Art der Umsetzung finden sich (3) Soteria inspirierte Projekte, die im<br />
gemeindenahen ambulant-komplementären <strong>Versorgung</strong>sbereich angesiedelt sind und sich<br />
meist nicht explizit nach Soteria benennen. Beispiele dafür sind die Wohngruppe des PTV<br />
Solingen, das Weglaufh<strong>aus</strong> Berlin und die <strong>Krisenpension</strong> Berlin (IAS 7 , 2011). Inzwischen<br />
wurde der Soteria-Bewegung eine Position zwischen „Euphorie und Ernüchterung“ (Kroll<br />
et al., 2001, S. 115) bilanziert. Trotz ermutigender Forschungsergebnisse ist Soteria bis<br />
heute nicht in der psychiatrischen Regelversorgung implementiert worden. Einerseits ist<br />
7 Internationale Arbeitsgemeinschaft Soteria<br />
24
2 Theoretische Hinführung<br />
die Soteria-Idee noch immer wenig psychiatrische Wirklichkeit, andererseits ist sie als<br />
„Ideenbewegung“ (Kroll et al., 2001, S. 116) seit 40 Jahren im Gespräch und noch immer<br />
aktuell. Die Umsetzung vom Soteria-Original (1) stagniert schon seit einiger Zeit, dafür<br />
machen immer mehr Projekte Gebrauch von einzelnen Soteria-Elementen (2 + 3), die sich<br />
auf unterschiedlichste Bereiche anwenden lassen. Dies berge laut Kroll et al. (2001) zum<br />
einen die Gefahr der „Aushöhlung des Soteria-Konzeptes“ (S. 123) in sich, bei der nicht<br />
mehr klar ist, welche inhaltlichen Konzepte unter dem Soteria-Label umgesetzt werden.<br />
Auf der anderen Seite stelle diese offene Umsetzung eine Chance für die Soteria-Idee dar,<br />
langfristig bestehen zu bleiben und sich weiter in der psychiatrischen <strong>Versorgung</strong> zu<br />
profilieren (Kroll et al., 2001). Wie neuste Entwicklungen der psychiatrischen<br />
<strong>Versorgung</strong>slandschaft zeigen, ist der Typ 3 außerdem gut dafür geeignet, um die bisher für<br />
innovative psychiatrische Konzepte fehlenden Mittel über die <strong>Integrierte</strong> <strong>Versorgung</strong> zu<br />
erhalten.<br />
2.2.4 Home Treatment<br />
Home Treatment (Zu-H<strong>aus</strong>e-Behandlung) ist eine Alternative zur stationären Behandlung,<br />
bei der ein multiprofessionelles Team Betroffene im Rahmen eines vereinbarten<br />
Behandlungsplanes im privaten Wohnraum aufsucht (Berhe, Puschner, Kilian & Becker,<br />
2005). Eine solche aufsuchende Hilfe hat den Vorteil, dass Betroffene in ihrem gewohnten<br />
Lebensumfeld verbleiben können, eigene Ressourcen (u. a. Angehörige, Beruf, Aktivitäten)<br />
erhalten bleiben und keine „Wiedereingliederung“ nach der Behandlung nötig wird. Home<br />
Treatment ermöglicht aber nicht nur das Aufrechterhalten von Lebensgewohnheiten,<br />
sondern eröffnet dem Behandlungsteam gleichzeitig Einblicke in das Leben der<br />
Betroffenen vor Ort (Munz et al., 2011). Dadurch können Ressourcen und Defizite direkt<br />
erfasst werden und in den Behandlungsplan einfließen. Das Behandlungsteam ist rund um<br />
die Uhr erreichbar und ermöglicht so, Krisen schnell abzufangen und Krankenh<strong>aus</strong>aufenthalte<br />
zu vermeiden. Dies ist im Sinne einer primären Prävention, wie Caplan sie in<br />
seiner Krisentheorie betont, die zugleich das Grundfundament für die Entwicklung des<br />
Home Treatments (HT) liefert (Fenton, Tessier, Struening, Smith & Benoit, 1982). HT<br />
verfolgt das Ziel, die Lebensqualität der Betroffenen aufrechtzuerhalten bzw. zu<br />
verbessern. Zu diesem Zweck werden unnötig lange Hospitalisierung, Rückfälle und<br />
Stigmatisierung so weit wie möglich vermieden und das soziale Netzwerk bestmöglich<br />
einbezogen. Weiterhin wird angestrebt, Betroffene und Angehörige möglichst gut zu<br />
unterstützen und zu informieren (Fischer, 2009).<br />
25
2 Theoretische Hinführung<br />
Wichtige Erkenntnisse zur Wirksamkeit vom HT konnten in einer Literaturrecherche zum<br />
Vergleich von HT und stationärer Behandlung gewonnen werden (Berhe et al., 2005). Es<br />
zeigte sich, dass das HT in den Ergebniskriterien Symptomreduktion, soziales Funktionsniveau<br />
und Patienten- und Angehörigenzufriedenheit der stationären Behandlung<br />
gegenüber gleichwertig oder überlegen ist. Insgesamt waren alle <strong>aus</strong>gewerteten Studien<br />
hinsichtlich der Krankenh<strong>aus</strong>vermeidung erfolgreich. Eine weitere systematische<br />
Literaturrecherche zur Wirksamkeit des HT sowie dessen Implementierungsstand in<br />
Deutschland (Gühne et al., 2011) kommt zu einem ähnlichen Ergebnis: In den Kriterien<br />
Allgemeinzustand und psychische Gesundheit stellte sich das HT gegenüber einer<br />
klassischen stationären Behandlung als mindestens gleichwertig dar, stationäre Aufnahmen<br />
und stationäre Behandlungsdauer konnten durch HT reduziert werden. Außerdem ergaben<br />
sich als Vorteile gegenüber stationärer Behandlung, dass HT das Risiko für einen<br />
Behandlungsabbruch senkt, die Behandlungszufriedenheit Betroffener und Angehöriger<br />
erhöht und die Belastung Angehöriger verringert. Insgesamt wird HT in der Studie als<br />
wirksame und vermutlich auch in Deutschland kosteneffektivere Ergänzung (Belege zu<br />
Kosteneffektivität des HT fanden sich nur in Studien <strong>aus</strong> dem Ausland) bestehender<br />
psychiatrischer Angebote beurteilt. Trotz der guten international vorliegenden Evidenz für<br />
die Wirksamkeit des HT bleibt dieses ein in Deutschland bisher wenig genutztes Potenzial<br />
des <strong>Versorgung</strong>ssystems (Gühne et al., 2011).<br />
2.2.5 Bedürfnisangepasste Behandlung<br />
Die bedürfnisangepasste Behandlung (need adapted treatment) wurde über Jahre hinweg<br />
von Alanen und MitarbeiterInnen an der psychiatrischen Universitätsklinik von Turku in<br />
Finnland entwickelt (Aderhold & Greve, 2010). Inspiriert wurden sie dabei durch die<br />
Heterogenität und Einzigartigkeit der therapeutischen Bedürfnisse von Schizophrenie-<br />
PatientInnen (Alanen, 1997). Während der Konzepterarbeitung wurde der Begriff needspecific-treatment<br />
durch need-adapted-treatment ersetzt. Dies sollte <strong>aus</strong>drücken, dass sich<br />
Bedürfnisse auch ändern können und die Flexibilität des Ansatzes betonen (Alanen, 1997).<br />
Außerdem steckt in need-adapted die Beschränkung auf wirklich notwendige Behandlung<br />
und die Vermeidung überflüssiger Behandlung wie übermäßiger Medikamentierung.<br />
Kernelement einer bedürfnisangepassten Behandlung ist die Therapieversammlung<br />
(Aderhold & Greve, 2010). Darin kommen Professionelle, Betroffene und möglichst alle<br />
wichtigen Bezugspersonen des Betroffenen zusammen, um den Hilfeprozess gemeinsam<br />
zu planen und flexibel auf Bedürfnisveränderungen zu reagieren. Neben der Therapie-<br />
26
2 Theoretische Hinführung<br />
versammlung und einer psychotherapeutischen Grundhaltung zeichnet sich die<br />
bedürfnisangepasste Behandlung durch weitere Grundprinzipien <strong>aus</strong> (Aderhold & Greve,<br />
2010): Die Behandlung wird als kontinuierlicher Prozess und nicht als Routinesitzung<br />
verstanden. Verschiedene therapeutische Ansätze ergänzen sich statt sich gegenseitig zu<br />
behindern. Betroffene sollten regelmäßig in allen therapeutischen Situationen anwesend<br />
sein, so dass sie an allen wichtigen Entscheidungen beteiligt werden und ihr<br />
Expertenwissen für die eigene Situation einbringen können. Eine Nachuntersuchung sollte<br />
immer nach 5 Jahren erfolgen, um die Wirksamkeit zu überprüfen. Diesem Prinzip<br />
folgende Evaluationen ergaben deutliche Hinweise darauf, dass der Ansatz der<br />
bedürfnisangepassten Behandlung traditionellen Behandlungsansätzen gegenüber<br />
überlegen ist (vgl. Aderhold & Greve, 2010). Katamnesen über 2 bzw. 5 Jahre ergaben u. a.<br />
die Reduktion von Symptomen, mehr vollständige Remissionen, höhere Funktionsfähigkeit<br />
und weniger Medikamentierung (Cullberg, 2008). Die aktuelle Form des skandinavischen<br />
Modells der bedürfnisangepassten Behandlung stellt eine idealtypische Verbindung von<br />
systemischen und subjektorientierten Ansätzen dar (Haselmann, 2008). Das Element der<br />
Therapieversammlung ist ein grundlegend systemisches, jedoch wird diese mittlerweile<br />
mehr durch dialogische Formen des Aust<strong>aus</strong>ches, wie z. B. dem Offenen Dialog (s. Kap.<br />
2.2.6) statt durch Interventionen gestaltet. Außerdem werden subjektorientierte<br />
Therapieangebote in die Gesamtbehandlung integriert. Die große Stärke des<br />
bedürfnisangepassten Behandlungsmodells sehen Aderhold und Greve (2010) darin, dass<br />
es alle Phasen und Kontexte eines betroffenen Menschen umfasst und diese in<br />
psychiatrisch-psychotherapeutische Interventionen einbezieht.<br />
2.2.6 Offener Dialog im Netzwerk<br />
Der Offene Dialog ist eine Weiterentwicklung bzw. besondere Methode innerhalb der<br />
bedürfnisangepassten Behandlung, die vom Finnen Seikkula konzipiert wurde (Haselmann,<br />
2008). Die Netzwerkversammlungen 8 zeichnen sich dabei durch dialogische Prinzipien und<br />
freies Reflektieren, das durch den Schweden Andersen (1996) inspiriert wurde, <strong>aus</strong>. Wenn<br />
in diesen Treffen alle wichtigen Menschen des sozialen Netzwerks des Betroffenen<br />
zusammenkommen, wird die Methode des Offenen Dialoges genutzt, um mit einer<br />
„zuhörenden und respektierenden Einstellung gegenüber allen Beteiligten“ (Seikkula &<br />
Arnkil, 2007, S. 9) gemeinsam nachzudenken, sich über eine gemeinsame Bedeutung der<br />
8 Der Begriff der Netzwerkversammlung steht synonym für den Begriff der Therapieversammlung, verdeutlicht aber die<br />
Verlagerung vom stationären Entstehungskontext in den ambulant psychosozialen Bereich.<br />
27
2 Theoretische Hinführung<br />
derzeitigen Situation zu verständigen und letztendlich weiterführende Schritte zu<br />
beschließen. Es geht demnach vor allem darum, die Angehörigen und Betroffenen<br />
miteinander ins Gespräch zu bringen und eine Vielfalt von Perspektiven einzubringen, um<br />
schließlich eine gemeinsame Wirklichkeit des Problems zu konstruieren (Seikkula &<br />
Arnkil, 2007). Als konsequente Weiterführung des Prinzips der Anwesenheit von<br />
Betroffenen in allen therapeutischen Situationen <strong>aus</strong> der bedürfnisangepassten Behandlung<br />
lässt sich das reflektierende Team der Professionellen verstehen. Dieses reflektiert in<br />
Anwesenheit aller Gesagtes und erörtert darüber hin<strong>aus</strong> weitere Fragen, Ideen etc.<br />
(Seikkula & Arnkil, 2007). Dies wiederum ermöglicht den Zuhörenden einen<br />
Perspektivwechsel, der zum Verständnis der Situation beitragen kann. Aus Effektivitätsund<br />
Prozessevaluationsstudien wurden sieben Grundprinzipien des Offenen Dialogs für die<br />
Praxis abgeleitet (vgl. Seikkula & Arnkil, 2007, S. 68 ff.):<br />
1) Sofortige Hilfe: Bei Hilfebedarf sollte eine Reaktion immer sofort erfolgen, d.h.<br />
innerhalb von 24 Stunden. Dies gilt auch für die erste Versammlung, wenn eine<br />
Krisensituation gegeben ist.<br />
2) Einbeziehung des sozialen Netzwerks: Alle wichtigen Schlüsselpersonen des sozialen<br />
Netzwerkes sollten möglichst von Anfang an einbezogen werden. Im ersten Treffen sind<br />
sie eine wichtige Unterstützung für Betroffene, außerdem kann nur mit ihnen eine<br />
komplexe Definition des Problems entstehen.<br />
3) Flexibilität und Mobilität: Analog zu den Grundsätzen der bedürfnisangepassten<br />
Behandlung sollte sich die Behandlung flexibel an die sich ändernden Bedürfnisse der<br />
Betroffenen anpassen. Statt eines festen Programmes herrscht eine Offenheit für<br />
Vorschläge und Ideen vor, die eine individuell zugeschnittene Behandlung ermöglicht.<br />
Auch die Wahl des Versammlungsortes ist flexibel und kann gemeinsam erfolgen.<br />
4) Teamverantwortung: Es gilt die F<strong>aus</strong>tregel, dass jede bzw. jeder MitarbeiterIn, die bzw.<br />
der angesprochen wird, die Verantwortung dafür übernimmt, eine Behandlungsversammlung<br />
einzuberufen und alle wichtigen Personen einzuladen, die für den Beschluss<br />
nächster Schritte von Bedeutung sind. Dies soll sicherstellen, dass die Zuständigkeit immer<br />
geklärt ist und die sofortige Hilfe umgesetzt werden kann.<br />
5) Psychologische Kontinuität: Ein Behandlungsteam ist so lange wie nötig für die<br />
Betroffenen verantwortlich und das über die unterschiedlichen <strong>Versorgung</strong>ssektoren<br />
hinweg. Eine Behandlungskontinuität kann so durch die Integration einzelner<br />
<strong>Versorgung</strong>sb<strong>aus</strong>teine zu einer komplexen Behandlung sichergestellt werden. Die<br />
28
2 Theoretische Hinführung<br />
Beziehungskontinuität zu den Teammitgliedern gibt Betroffenen darüber hin<strong>aus</strong> Sicherheit<br />
und vermeidet Behandlungsabbrüche.<br />
6) Unsicherheitstoleranz: An erster Stelle stehen das Schaffen von Sicherheit und das<br />
Mobilisieren von Ressourcen der Betroffenen und des sozialen Netzwerks. Eine Lösung<br />
für das Problem lässt sich so meist erst nach einiger Zeit finden. Das Aushalten dieser<br />
andauernden Unsicherheit ist daher sehr wichtig.<br />
7) Dialogik: Zentral ist die Förderung von Dialogen im sozialen Netzwerk, um allen<br />
Beteiligten zu ermöglichen, sich über das Problem <strong>aus</strong>zut<strong>aus</strong>chen. Dabei erhält jeder eine<br />
gleichwertige Stimme und erläutert seine Perspektive, was als „Vielstimmigkeit“ (Seikkula<br />
& Arnkil, 2007, S. 80) bezeichnet wird. Wichtiger als eine Interviewführung ist dabei das<br />
Zuhören des Behandlungsteams, das später vor allen Anwesenden über das Gesagte<br />
reflektiert (reflektierendes Team). So wird ein gemeinsames Nachdenken über die Situation<br />
möglich, das durch das Zulassen von gegenseitigem „Erstaunen“ (Seikkula & Arnkil, 2007,<br />
S. 78) über die unterschiedlichen Sichtweisen zu einem neuen Verständnis führen kann.<br />
2.2.7 Trialog<br />
Trialog ist ein „Aust<strong>aus</strong>ch im Dreieck“ (Borchers, 2009, S. 18) zwischen Psychiatrie-<br />
Erfahrenen, Angehörigen und professionell Tätigen. Dieser Aust<strong>aus</strong>ch geschieht in Form<br />
einer gleichberechtigten Begegnung auf Augenhöhe und kann auf unterschiedlichen<br />
Ebenen wie Behandlung, Öffentlichkeitsarbeit, Antistigmaarbeit, Lehre, Forschung,<br />
Qualitätssicherung, Psychiatrieplanung etc. stattfinden (Bock, Buck & Meyer, 2009). Neu<br />
an diesem Ansatz ist, dass Professionelle erstmals Psychiatrie-Erfahrene und Angehörige<br />
als Erfahrungsexperten anerkennen und <strong>aus</strong> ihrem Wissen für die Verbesserung der<br />
Psychiatrie lernen wollen. Die Geburtsstunde des Trialogs ist das Jahr 1989, in dem der<br />
Psychologe Thomas Bock die Psychiatrie-Erfahrene Dorothea Buck in ein universitäres<br />
Psychose-Seminar für StudentenInnen und Berufstätige einlud, um mit Menschen mit<br />
Schizophrenie-Diagnose statt über sie zu reden (Bock et al., 2009). Diese Veranstaltung<br />
wandelte sich im darauf folgenden Semester zu einem Erfahrungs<strong>aus</strong>t<strong>aus</strong>ch zwischen<br />
eingeladenen Mitgliedern von Selbsthilfe- und Angehörigengruppen (Bock et al., 2009)<br />
und brachte schließlich das heute im deutschsprachigem Raum weit verbreitete<br />
Psychoseseminar hervor. Für die Verbreitung des trialogischen Ansatzes war darüber<br />
hin<strong>aus</strong> der 1994 in Hamburg stattfindende Sozialpsychiatrische Weltkongress von großer<br />
Bedeutung, bei dem Veranstaltungen möglichst trialogisch gestaltet wurden (Dörner,<br />
2003). Wichtiger Wegbereiter für den Trialog war außerdem der Sozialpsychiater Kl<strong>aus</strong><br />
29
2 Theoretische Hinführung<br />
Dörner, der unabhängig von den Entwicklungen in Hamburg, Trialog in Gütersloh<br />
umsetzte. Dörner versteht unter Psychoseseminar „regelmäßige Treffen von Psychiatrie-<br />
Erfahrenen, Angehörigen und psychiatrisch Tätigen mit dem Ziel, sich über Fragen der<br />
Angemessenheit psychiatrischer Praxis, <strong>Versorgung</strong> und Wissenschaft so zu verständigen,<br />
dass die Belange aller drei Gruppen gleichermaßen Berücksichtigung finden und somit die<br />
Trialogisierung der Psychiatrie gefördert wird“ (2003, S. 37). Somit lässt sich das<br />
Psychoseseminar, neben der Aufgabe des Erfahrungs<strong>aus</strong>t<strong>aus</strong>chs, auch als eine<br />
Ethikkommission der Psychiatrie verstehen. Wichtig für die Ermöglichung eines<br />
herrschaftsfreien Diskurses (Habermas, 1996), in dem jeder frei sprechen kann und jeder<br />
Beitrag das gleiche Gewicht erhält, ist dabei die Wahl eines neutralen Ortes. Ein weiterer<br />
Schritt für die Anerkennung von „Psychiatrie-Erfahrung als Kompetenz“ (Mücke, 2009, S.<br />
23) wurde 2006 mit Einführung des europäischen Pilotprojekts Experience Involvement<br />
getan. Dabei handelt es sich um eine einjährige Fortbildung für Psychiatrie-Erfahrene, mit<br />
der diese eine Statusverbesserung hinsichtlich Qualifikation und Vergütung erreichen<br />
können (Freitag, 2011). Hinzuzufügen ist noch, dass der Trialog durch die Gleichstellung<br />
von Angehörigen mit Betroffenen und Professionellen eine besondere Form der<br />
Angehörigenbeteiligung darstellt. Der 3.Teil der theoretischen Hinführung (2.3) beschäftigt<br />
sich eingehend mit der Gruppe der Angehörigen.<br />
2.2.8 Zusammenfassung: Konzepte der Sozialen Psychiatrie im<br />
Zusammenhang<br />
Die Konzepte der Sozialen Psychiatrie bieten Menschen mit psychischen Problemen bzw.<br />
in psychischen Krisen alternative Ansätze für ihre Behandlung bzw. Begleitung. Ungleich<br />
des klassisch psychiatrisch stationären Ansatzes bleibt die Lebenswelt der Betroffenen<br />
samt Ressourcen bestehen, denn mit gemeindenah ist in der Sozialen Psychiatrie auch<br />
lebensnah gemeint. Soweit möglich wird ambulant im gewohnten Lebensumfeld<br />
gearbeitet, um vorhandene Ressourcen nutzen zu können. Dazu gehören bereits bestehende<br />
Beziehungen zu Professionellen wie Ärzten, Therapeuten sowie das soziale Umfeld und<br />
alle anderen denkbaren Netzwerke. Eine Umsetzung für eine solch lebensnahe Begleitung<br />
stellt das Home Treatment dar. Als Alternative zur Krankenh<strong>aus</strong>aufnahme wird hier die<br />
Akutbehandlung durch ein multiprofessionelles Team im vertrauten Wohnumfeld<br />
durchgeführt. Dies erleichtert auch das Einbeziehen des sozialen Umfeldes. Ein spezieller<br />
Ansatz, um alle wichtigen Personen eines sozialen Netzwerkes zusammen zu bringen, ist<br />
das Initiieren von Netzwerkversammlungen. Durch Offenen Dialog wird darin der<br />
30
2 Theoretische Hinführung<br />
Aust<strong>aus</strong>ch aller Beteiligten gefördert, um so zu einem gemeinsamen Problemverständnis<br />
und weiterführenden Schritten zu gelangen. In der klassischen Psychiatrie findet sich<br />
häufig eine hierarchische Arzt-Patienten-Beziehung, in der Betroffene möglichst passiv<br />
und „complient“ den Anweisungen des Behandlers folgen sollen. Im Gegensatz dazu<br />
werden Betroffene in der Sozialen Psychiatrie als gleichberechtigte NutzerInnen gesehen,<br />
die gemeinsam mit ihren Angehörigen aktiv am Entscheidungs- und Gestaltungsprozess<br />
der Behandlung bzw. Begleitung teilhaben. Betroffene und Angehörige sind Experten in<br />
eigener Sache, eine Expertise, die in sozialpsychiatrischen Ansätzen nicht ungenutzt bleibt.<br />
Statt als Patient behandelt zu werden, wird gemeinsam verhandelt, welche Maßnahmen<br />
den individuellen Bedürfnissen der NutzerInnen entsprechen. Das Grundprinzip der<br />
bedürfnisangepassten Behandlung besteht in einer individuellen Behandlung, die sich im<br />
Gegensatz zur starren Standard- bzw. Einheitsbehandlung flexibel den Bedürfnissen von<br />
Betroffenen anpasst. Die aktive Beteiligung der NutzerInnen sowie deren Angehöriger<br />
verdeutlicht, dass ihre Kompetenzen und Ressourcen gewürdigt und geschätzt werden.<br />
Damit verbunden werden sie ermutigt, selbst aktiv zu werden und so weit möglich<br />
Verantwortung und Kontrolle für ihr Leben zu übernehmen. Eine so angestrebte<br />
Autonomie und Selbstbestimmung von Betroffenen sind Kennzeichen von Empowerment,<br />
einem Schlüsselkonzept in der Sozialen Psychiatrie. Ohne eine solche Selbstbefähigung ist<br />
im sozialpsychiatrischen Verständnis keine Gesundung möglich. Das Recovery-Konzept<br />
beschäftigt sich mit nötigen Vor<strong>aus</strong>setzungen für psychische Genesung, wobei die<br />
Vermittlung von Hoffnung eine Hauptvor<strong>aus</strong>setzung ist. Der Kern des Konzeptes besteht<br />
darin, davon <strong>aus</strong>zugehen, dass ein erfülltes Leben grundsätzlich, das heißt mit oder ohne<br />
Symptome, möglich ist. Im Sinne der <strong>Integrierte</strong>n <strong>Versorgung</strong> sollten alle B<strong>aus</strong>teine der<br />
psychiatrischen <strong>Versorgung</strong> möglichst gut miteinander vernetzt sein, so dass mit vereinter<br />
Kraft auf ein gemeinsames Ziel, nämlich einer verbesserten Lebensqualität der<br />
NutzerInnen, hingearbeitet werden kann.<br />
2.3 Angehörige psychisch erkrankter Menschen<br />
In diesem Kapitel soll auf die Gruppe der Angehörigen von psychisch erkrankten<br />
Menschen eingegangen werden, die in zweierlei Hinsicht eine wichtige Rolle in der<br />
psychiatrischen <strong>Versorgung</strong> spielen: Zum einen haben sie selbst Bedürfnisse, da sie durch<br />
ihre konstante Unterstützung der Betroffenen auch belastet werden und so indirekt zu<br />
Betroffenen werden (2.3.3 Angehörigenforschung). Zum anderen verfügen sie durch ihre<br />
31
2 Theoretische Hinführung<br />
Alltagserfahrungen über wertvolle Kompetenzen, die sowohl den Behandlungs- als auch<br />
den Evaluationsprozess bereichern können (2.3.2 Angehörigenbeteiligung). Diese<br />
Erkenntnis war jedoch lange nicht selbstverständlich und ist das Ergebnis langwieriger<br />
Bestrebungen für die Anerkennung der besonderen Position Angehöriger (2.3.1 Entstehung<br />
der Angehörigenbewegung). Auf die angesprochenen Aspekte zu Angehörigen soll in<br />
diesem Kapitel näher eingegangen werden. Ein Fazit zur Bedeutung der Angehörigen in<br />
der psychiatrischen <strong>Versorgung</strong> (2.3.4) rundet das Kapitel ab.<br />
2.3.1 Entstehung der Angehörigenbewegung: „Vom Sündenbock zum<br />
Partner“ 9<br />
Angehörige sind eine in der Psychiatrie lange vernachlässigte Gruppe. Statt ihre eigenen<br />
Bedürfnisse, ihre wichtige Rolle im Behandlungsverlauf und ihr Potenzial zu erkennen,<br />
wurde ihnen lange die Schuld an der Entwicklung psychischer Störungen gegeben<br />
(Bastiaan, 2005; Simon, 2000). Besonders die Störungsmodelle der Schizophrenie machten<br />
mit Begriffen wie „schizophrenogener Mutter“ Angehörige zu Sündenböcken (Bastiaan,<br />
2005). Obwohl Angehörige die Hauptlast der Psychiatriereform tragen und als ambulanter<br />
Teil psychiatrischer <strong>Versorgung</strong> einspringen, wurde ihre Leistung von professioneller Seite<br />
abgewertet (Simon, 2000). In den 80er Jahren begannen sich Angehörige gegen<br />
Schuldzuweisung und fehlende Anerkennung zu wehren, auf eigene Nöte aufmerksam zu<br />
machen und sich zu organisieren: 1982 fand das erste Bundestreffen der Angehörigen<br />
psychisch Kranker statt und 1985 wurde der Bundesverband der Angehörigen psychisch<br />
Kranker (BApK) gegründet (Deger-Erlenmaier, 1987). Neben diesen Ereignissen gehört<br />
auch das 1982 erstmals erschienene Buch „Freispruch der Familie“ (Dörner, Egetmeyer &<br />
Koenning, 1987) zu den Meilensteinen der Angehörigenbewegung (Deger-Erlenmaier,<br />
1987). Darin decken die AutorInnen das Unrecht auf, das Angehörigen in der Psychiatrie<br />
zu Teil wurde und lassen diese selbst zu Wort kommen. Weiterhin wird auf den Missstand<br />
hingewiesen, dass Familien in fast allen modernen psychologischen Theorien zwar eine<br />
bedeutende Rolle zukommt, diese aber nicht in den psychiatrischen Alltag einbezogen wird<br />
(Dörner, 1987). Dar<strong>aus</strong> leitet Dörner (1987) ein neues Verständnis psychiatrischen<br />
Handelns ab:<br />
„Psychiatrisches Handeln bedeutet, dass ich mich nie auf einen Einzelmenschen, sondern<br />
immer auf eine ganze Familie einlasse.“ ( S. 65)<br />
9 Titel von Bastiaan, 2005<br />
32
2 Theoretische Hinführung<br />
Im Zuge der erwähnten Meilensteine entstanden zahlreiche Selbsthilfegruppen und<br />
Selbsthilfeorganisationen für Angehörige, um sich gegenseitig zu unterstützen und<br />
<strong>aus</strong>zut<strong>aus</strong>chen bzw. die Interessen Angehöriger auch politisch zu vertreten. Diesen<br />
Anstrengungen ist es zu verdanken, dass die Arbeit mit Angehörigen heute „wichtiger<br />
Bestandteil jeder sozialpsychiatrischen Arbeit“ (Haselmann, 2008, S. 172) ist und<br />
„Angehörige als Experten“ (Finzen, 2001, S. 156) und kompetente Partner in der<br />
Behandlung wahrgenommen werden (Bastiaan, 2005).<br />
2.3.2 Angehörigenbeteiligung<br />
Kennzeichnend für die gestärkte Position Angehöriger in der Psychiatrie ist auch, dass<br />
Angehörigenbeteiligung als wichtiges Qualitätsmerkmal zur Beurteilung psychiatrischer<br />
Angebote gilt (BeB & CBP, 2009). Ein Grundsatz des leitzielorientierten Qualitätsmanagements<br />
ProPsychiatrieQualität (PPQ) besteht darin, Kompetenzen und Bedürfnisse<br />
Angehöriger auf unterschiedlichsten Ebenen einzubeziehen (BeB & CBP, 2009). Die<br />
wichtigsten Ebenen der Angehörigenbeteiligung sind Hilfeplanung, -gestaltung und<br />
-evaluation.<br />
Behandlungsprozess<br />
Als Formen der Angehörigenbeteiligung auf Ebene der Hilfegestaltung lassen sich<br />
Einzelgespräche, Gespräche gemeinsam mit Betroffenen, psychoedukative Angehörigengruppen,<br />
Angehörigenselbsthilfegruppen, Angehörigeninformationstage, Angehörigenvisiten<br />
sowie der Trialog als besondere Form von Angehörigenarbeit nennen (Schmid et<br />
al., 2003). Allerdings wird Angehörigenarbeit in der Praxis von Professionellen noch<br />
unzureichend umgesetzt (Schmid, Spießl, Vukovich & Cording, 2004). Dies verwundert in<br />
Anbetracht von zahlreichen Studienergebnissen, die einen positiven Einfluss von<br />
Angehörigenbeteiligung im Behandlungsprozess für die Betroffenen sowie die<br />
Angehörigen selber belegen (Falloon, 2003; Lamm, 1991; Wiedemann & Buchkremer,<br />
1996). Als Gründe für die bisher nur eingeschränkte Umsetzung können mangelnde<br />
Auswertung von Angehörigenangeboten, fehlende Wissensvermittlung zu Angehörigenarbeit<br />
in der Ausbildung und geringe finanzielle Mittel angesehen werden (Bischkopf,<br />
2007).<br />
Evaluationsprozess<br />
Auch die Angehörigenbeteiligung auf Ebene der Evaluation wird in der Fachliteratur als<br />
über<strong>aus</strong> wichtig erachtet:<br />
33
2 Theoretische Hinführung<br />
„Im Rahmen der <strong>Versorgung</strong>sforschung und des Qualitätsmanagements ist das Einbeziehen der<br />
Sichtweise der Angehörigen ein wichtiger Teil einer umfassenden Evaluation der sog.<br />
,Nutzerzufriedenheit' “. (Schmid, Spießl, Vukovich & Cording, 2003, S. 119)<br />
Damit wird <strong>aus</strong>gedrückt, dass eine Nutzerzufriedenheit nicht nur von den Betroffenen als<br />
primäre NutzerInnen abhängt, sondern auch von den Angehörigen, die selbst indirekte<br />
sekundäre NutzerInnen von <strong>Versorgung</strong>seinrichtungen sind (Vieten & Brinkmann, 2004).<br />
Dass ein <strong>Versorgung</strong>sangebot eine Stütze für Betroffene und Angehörige ist, zeichnet eine<br />
gute Einrichtung <strong>aus</strong>. Dies findet sich auch im PPQ (BeB & CBP, 2009) wieder, das die<br />
Beteiligung Angehöriger als eine von sechs Qualitätsdimensionen nennt. Diese lässt sich<br />
zum Beispiel durch Angehörigenbefragungen umsetzen, welche eine gute Möglichkeit<br />
darstellen, „Rückmeldungen und Bewertungen der Nutzerinnen und Nutzer zu erhalten“<br />
(BeB & CBP, 2009, S. 84). Angehörige sind besonders qualifiziert dafür, <strong>Versorgung</strong>sangebote<br />
zu evaluieren, weil sie Veränderungen bei Betroffenen im Allgemeinen sowie in<br />
deren Krankheits-Symptomatik oft sehr gut einschätzen können (Bastiaan, 2005). Leider<br />
wird die Perspektive von Angehörigen immer noch zu selten für die Entwicklung bzw.<br />
Evaluation von Behandlungskonzepten genutzt (Schmid et al., 2004). Eine Studie zu<br />
Erwartungen Angehöriger an die psychiatrische Klinik ist ein Beispiel für<br />
Angehörigenbeteiligung bei der Evaluation von psychiatrischen <strong>Versorgung</strong>sangeboten<br />
(Spießl, Schmid, Vukovich & Cording, 2003). Auf Grundlage der im Rahmen dieser Studie<br />
geführten Interviews konnte ein Fragebogen zur Erfassung der Erwartungen und<br />
Zufriedenheit Angehöriger von psychiatrischen Patienten in stationärer Behandlung<br />
entwickelt werden (Spießl, Schmid, Vukovich & Cording, 2004). Die Ergebnisse dieser<br />
zweiten Untersuchung trugen wiederum durch wichtige Anregungen für Maßnahmen zur<br />
Verbesserung des Behandlungskonzepts bei. Ein anderes Beispiel für den Einbezug<br />
Angehöriger in den Evaluationsprozess ist eine Studie, bei der Angehörige in narrativen<br />
Interviews zu ihren Erfahrungen mit der psychiatrischen Behandlung und im besonderen<br />
mit den Ärzten befragt wurden (Jungbauer, Wittmund & Angermeyer, 2002). Anhand der<br />
gewonnenen Daten konnte identifiziert werden, mit welchen Bereichen Angehörige<br />
unzufrieden sind. Eine weitere Angehörigenbefragung wurde zur Evaluation des<br />
Deinstitutionalisierungsprozesses eines Teilbereiches der Psychiatrie Eckardtsheim<br />
angewandt (Vieten & Brinkmann, 2000). Die Befragung erbrachte der Klinik eine positive<br />
Rückbestätigung für die vollzogenen Veränderungsprozesse sowie Hinweise auf noch zu<br />
behebende Probleme. Insgesamt belegen die genannten Studien, dass sich Angehörigenbeteiligung<br />
nicht nur im Behandlungsprozess für alle Beteiligten lohnt. Auch im<br />
34
2 Theoretische Hinführung<br />
Evaluationsprozess kann die Perspektive Angehöriger wichtige Erkenntnisse für die<br />
Bewertung und Weiterentwicklung psychiatrischer <strong>Versorgung</strong>sangebote erbringen.<br />
2.3.3 Angehörigenforschung<br />
Die bisherige Angehörigenforschung beschäftigt sich überwiegend mit Erwartungen und<br />
Zufriedenheit sowie Belastungen und Bedürfnissen Angehöriger. Angehörigenzufriedenheit<br />
ist ein mehrdimensionales Konstrukt, das sich <strong>aus</strong> der Angehörigen-<br />
Betroffenen-Beziehung und Behandlungsaspekten zusammensetzt (Spießl, Schmid,<br />
Wiedemann & Cording, 2005). Zur Verbesserung der Zufriedenheit bedarf es vor allem<br />
guter Information und Unterstützung für Angehörige (Spießl et al., 2005). Studien zur<br />
Erfassung der Erwartungen und Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit von Angehörigen als<br />
indirekte NutzerInnen psychiatrischer <strong>Versorgung</strong>sangebote wurden bereits im<br />
Zusammenhang mit der Angehörigenbeteiligung im Evaluationsprozess erwähnt<br />
(Jungbauer et al., 2002; Schmid et al., 2004; Spießl et al., 2003, 2004; Vieten &<br />
Brinkmann, 2000). Zur Erfassung der Situation Angehöriger und insbesondere ihrer<br />
Belastungen lassen sich die Konzepte Burden, Distress und Lebensqualität unterscheiden<br />
(Fischer, Kemmler & Meise, 2004). Während sich das Konzept der Lebensqualität auf die<br />
gesamte Lebenssituation der bzw. des Angehörigen bezieht, beschränkt sich das Burden-<br />
Konzept auf die Auswirkungen der psychischen Erkrankung des Betroffenen. Das Distress-<br />
Konzept wiederum fokussiert auf generelle stressbedingte Befindlichkeiten (Fischer et al.,<br />
2004). In einem systematischen Literaturüberblick wurden vielfältige Belastungen<br />
Angehöriger offen gelegt (Schmid et al., 2003). Dazu zählen vor allem zeitliche,<br />
finanzielle, berufliche, gesundheitliche und emotionale Belastungen sowie Belastungen für<br />
andere Beziehungen. Darüber hin<strong>aus</strong> wurden zahlreiche weitere Arbeiten veröffentlicht,<br />
die sich eingehend mit den Belastungen Angehöriger beschäftigen (u. a. Jungbauer,<br />
Bischkopf & Angermeyer, 2001a; Wittmund & Kilian, 2002). Klassischerweise befasst<br />
sich die Forschung zur Angehörigenbelastung vor allem mit Eltern psychisch erkrankter<br />
Menschen. Inzwischen rücken aber zunehmend auch Partner (Jungbauer, Bischkopf &<br />
Angermeyer, 2001b) in den Fokus der Forschung. Meist vernachlässigt wird die<br />
Angehörigengruppe der Kinder, die sich jedoch durch einen besonders großen Hilfebedarf<br />
<strong>aus</strong>zeichnet (Lenz, 2005). Außer Acht gelassen werden sollte aber auch nicht die Gruppe<br />
der „vergessenen Angehörigen“ (Schmid, Spießl & Peukert, 2004, S. 225), die der<br />
Geschwister, mit der sich die Forschung bisher eher am Rande beschäftigt hat (Peukert &<br />
Munkert, 2009).<br />
35
2 Theoretische Hinführung<br />
2.3.4 Fazit: Die Bedeutung Angehöriger in der psychiatrischen <strong>Versorgung</strong><br />
Abschließend lässt sich über die Bedeutung Angehöriger in der psychiatrischen <strong>Versorgung</strong><br />
Folgendes <strong>aus</strong> den vorangehenden Abschnitten festhalten:<br />
1) Angehörige leisten täglich emotionale und oft auch finanzielle Unterstützung für<br />
Betroffene, dafür verdienen sie Anerkennung.<br />
2) Angehörige üben damit einen großen Einfluss auf das Leben und somit den<br />
Krankheitsverlauf bzw. die Gesundung Betroffener <strong>aus</strong>, daher dürfen sie im<br />
Behandlungsprozess nicht <strong>aus</strong>geklammert werden.<br />
3) Außerdem verfügen Angehörige über ein differenziertes Expertenwissen <strong>aus</strong><br />
Alltagserfahrung, welches sie zu einer maßgeblichen Ressource in der Behandlung sowie<br />
in der Evaluation des Behandlungserfolges macht.<br />
4) Gleichzeitig haben Angehörige als meist einzige kontinuierliche Bezugspersonen aber<br />
auch starke Belastungen zu tragen und werden so zu Mitbetroffenen mit eigenen Nöten und<br />
Bedürfnissen. Aus diesem Grund benötigen auch Angehörige Unterstützung.<br />
5) Auch auf gesundheitspolitischer Ebene ist die Angehörigenperspektive, die auf von<br />
Professionellen nicht wahrgenommene Defizite hinweisen kann, ein Gewinn.<br />
36
3 Fragestellung<br />
3 Fragestellung<br />
Das Kapitel 3 beschäftigt sich mit den zur Entwicklung der Fragestellung relevanten<br />
Aspekten: Zunächst wird im Entstehungskontext (3.1) erläutert, wie die Idee zur Arbeit<br />
entstand. In Kapitel 3.2 wird unter Bezugnahme auf die theoretische Hinführung die<br />
konkrete Fragestellung abgeleitet. Das Kapitel schließt mit der Vorstellung des NetzWerkes<br />
psychische Gesundheit ab (3.3), anhand dessen <strong>Integrierte</strong> <strong>Versorgung</strong> in der vorliegenden<br />
Arbeit beispielhaft untersucht wurde.<br />
3.1 Entstehungskontext<br />
Ambulante und gemeindepsychiatrische bzw. sozialpsychiatrische Konzepte werden<br />
sowohl im Studium der Psychologie meist vernachlässigt als auch Betroffenen selten als<br />
Behandlungsoption vermittelt. Ich selbst wurde im Studium erst relativ spät auf solche<br />
Alternativen zur klassisch psychiatrischen Behandlung aufmerksam. Ein Seminar<br />
verschaffte mir durch Exkursionen in ambulante Einrichtungen Berlins einen<br />
praxisorientierten Einblick in die vielfältige <strong>Versorgung</strong>slandschaft abseits der stationären<br />
Psychiatrie. Eine dieser Exkursionen ging in das Projekt <strong>Krisenpension</strong> und<br />
Hometreatment: Hier wird Menschen die Alternative geboten, eine psychische Krise in der<br />
häuslichen Umgebung der <strong>Krisenpension</strong> zu bewältigen anstatt sich in stationäre<br />
Behandlung zu begeben. Ein solcher Ansatz war mir neu, schloss für mich aber eine Lücke<br />
im Behandlungsspektrum der Psychiatrie. Dass die NutzerInnen dort ihr Leben möglichst<br />
normal weiterführen können, Eigenständigkeit als etwas Positives gesehen wird und die<br />
Mitbestimmung in der Begleitung dementsprechend groß ist, beeindruckte mich sehr. Auch<br />
dass Angehörige durch regelmäßige Netzwerkgespräche mit den Betroffenen und deren<br />
BezugsbegleiterInnen stark in den Prozess einbezogen werden, ergab für mich sofort Sinn.<br />
Ich wunderte mich, dass solche Konzepte nicht bekannter und verbreiteter sind und<br />
bedauerte, dass nur so wenigen Menschen diese Alternative überhaupt zur Wahl gestellt<br />
wird. So entstand der Wunsch in mir, mich näher mit gemeindepsychiatrischen Konzepten<br />
zu beschäftigen und mehr über ihr Potenzial für mögliche Entwicklungen in der<br />
psychiatrischen <strong>Versorgung</strong>slandschaft zu erfahren. Ich nahm Kontakt zu MitarbeiterInnen<br />
von <strong>Krisenpension</strong> und Hometreatment auf und erfragte die Möglichkeit, mich im Rahmen<br />
einer Diplomarbeit mit ihrem <strong>Versorgung</strong>sangebot <strong>aus</strong>einanderzusetzen. Im gemeinsamen<br />
Gespräch entstand dann die Idee zu der vorliegenden Arbeit.<br />
37
3 Fragestellung<br />
3.2 Ableitung der eigenen Fragestellung<br />
Wie in Kapitel 2.1 dargestellt, besitzt die <strong>Integrierte</strong> <strong>Versorgung</strong> (IV) das Potenzial, die<br />
psychiatrische <strong>Versorgung</strong>slandschaft zu verändern. Dadurch, dass sie inhaltlich offen<br />
gehalten wird, kann die stationäre <strong>Versorgung</strong> im Rahmen der IV nicht gegenüber<br />
ambulanter <strong>Versorgung</strong> präferiert werden, was langfristig eine stärkere Implementierung<br />
ambulanter Angebote in der Regelversorgung ermöglicht. Die außerstationäre Krisenbegleitung<br />
<strong>Krisenpension</strong> und Hometreatment, die auf Konzepten der Sozialen Psychiatrie<br />
(s. Kap. 2.2) basiert, hat diese Chance als Teil des IV-Vertrages NetzWerk psychische<br />
Gesundheit (NWpG) ergriffen. Es gibt bisher allerdings nur wenige Untersuchungen im<br />
Bezug auf Qualität und Nutzerzufriedenheit zum neuen <strong>Versorgung</strong>skonzept der<br />
<strong>Integrierte</strong>n <strong>Versorgung</strong>, besonders im psychiatrischen Bereich. Wie Kapitel 2.3<br />
verdeutlicht, sind Angehörige eine in der Psychiatrie lange zu unrecht vernachlässigte<br />
Gruppe, die u. a. einen wertvollen Beitrag für die Evaluation von <strong>Versorgung</strong>sangeboten<br />
leisten kann. Als Experten für die Betroffenen können sie Veränderungen bei diesen gut<br />
einschätzen und haben meist schon viel Erfahrung mit psychiatrischen Angeboten. Damit<br />
sind sie eine hervorragende Quelle, um Rückmeldung über die Qualität der Einrichtung<br />
sowie Anregungen zur Verbesserung zu geben. Da der Großteil der Evaluationsforschung<br />
<strong>aus</strong> Betroffenensicht erfolgt, ist über die Angehörigenperspektive viel weniger bekannt.<br />
Insgesamt gibt es noch viel Forschungsbedarf für die qualitative Auswertung von<br />
<strong>Integrierte</strong>r <strong>Versorgung</strong> sowie zur Angehörigenperspektive im Evaluationsprozess. Deshalb<br />
möchte ich diese beiden Felder in meiner Diplomarbeit kombinieren und die subjektive<br />
Bewertung des IV-Vertrages NWpG von Angehörigen untersuchen. Meine zentrale Frage<br />
lautet damit:<br />
Wie beurteilen Angehörige das NetzWerk psychische Gesundheit?<br />
Ziel meiner Arbeit ist demnach, die Perspektive der Angehörigen bei der Bewertung des<br />
NWpG zu untersuchen und damit einen Beitrag zur Qualitätsanalyse und Evaluation eines<br />
gemeindepsychiatrisch orientierten IV-Vertrages zu leisten. Dabei soll her<strong>aus</strong>gefunden<br />
werden, was als positiv bzw. negativ bewertet wird, um so Verbesserungsvorschläge zu<br />
gewinnen. Die Angehörigenbefragung überprüft auch, ob Angehörige den theoretischen<br />
Schlüsselkonzepten, die dem NWpG zu Grunde liegen, die gleiche Bedeutsamkeit für den<br />
Behandlungsprozess zuschreiben. Die vorliegende Arbeit versteht sich somit zum einen als<br />
<strong>Versorgung</strong>sforschung im Bezug auf die <strong>Integrierte</strong> <strong>Versorgung</strong> und zum anderen als<br />
Angehörigenforschung, deren Perspektive hier eingenommen wird.<br />
38
3 Fragestellung<br />
3.3 Das NetzWerk psychische Gesundheit als Beispiel <strong>Integrierte</strong>r<br />
<strong>Versorgung</strong><br />
Das NetzWerk psychische Gesundheit in Berlin stellt ein Beispiel für die<br />
gemeindepsychiatrisch orientierte Umsetzung eines IV-Vertrages dar. Das <strong>Versorgung</strong>sangebot<br />
kann von Betroffenen genutzt werden, die sich über ihre Krankenkasse in das<br />
Angebot eingeschrieben haben. Ziel des NWpG ist es, Menschen in psychischen Krisen<br />
mit niedrigschwelligen ambulanten Angeboten eine Alternative zur stationären <strong>Versorgung</strong><br />
anzubieten. Das <strong>Versorgung</strong>skonzept des NWpG besteht vor allem darin, durch Krisenprävention<br />
bzw. frühzeitige Krisenintervention einen stationären Behandlungsbedarf und<br />
Chronifizierung zu vermeiden. Alle NutzerInnen erhalten ein festes Behandlungsteam,<br />
bestehend <strong>aus</strong> zwei BezugsbegleiterInnen, mit denen ein ganz individuelles <strong>Versorgung</strong>smodell<br />
(bedürfnisangepasste Behandlung) zusammengestellt wird. Im Mittelpunkt des<br />
Modells steht das Home Treatment als aufsuchende Begleitung, das meist den<br />
gemeinsamen Nenner der sonst von NutzerIn zu NutzerIn variabel gestalteten Angebote<br />
darstellt. Gleich große Bedeutung kommt den Netzwerkgesprächen (Offener Dialog) zu, in<br />
denen das persönliche Netzwerk der NutzerInnen, vor allem die Angehörigen, einbezogen<br />
werden. Weitere mögliche B<strong>aus</strong>teine für die Zusammensetzung des individuellen Angebots<br />
sind u. a. die Nutzung der 24-Stunden besetzten <strong>Krisenpension</strong> (Soteria) sowie Gruppenangebote.<br />
Darüber hin<strong>aus</strong> zeichnet sich das NWpG durch seine trialogische Arbeitsweise<br />
und seine Erreichbarkeit an 24 Stunden des Tages und 7 Tagen der Woche <strong>aus</strong>.<br />
39
4 Methodik<br />
4 Methodik<br />
Das folgende Kapitel 4 beschäftigt sich mit der methodischen Konzeption der in dieser<br />
Diplomarbeit durchgeführten Untersuchung und den dafür <strong>aus</strong>gewählten Methoden.<br />
Einleitend wird die Wahl des qualitativen Ansatz begründet (4.1). Darauf folgt die<br />
Darstellung des Zugangs zum Feld (4.2), wobei zum einen die Samplingstrategie (4.2.1)<br />
und zum anderen das Sample (4.2.2) selbst beschrieben werden. Das Kapitel 4.3<br />
beschäftigt sich näher mit den Methoden der Datenerhebung. Die Daten wurden mit dem<br />
problemzentrierten Interview (4.3.1) erhoben, für das ein auf die Fragestellung<br />
zugeschnittener Interviewleitfaden konstruiert wurde (4.3.2). Weiterhin werden<br />
Informationen zur Durchführung der Interviews gegeben (4.3.3). In Kapitel 4.4 werden die<br />
Methoden zur Daten<strong>aus</strong>wertung vorgestellt: Zunächst wird das Vorgehen bei der<br />
Transkription (4.4.1) des Datenmaterials erläutert, darauf folgt die Beschreibung der<br />
qualitativen Inhaltsanalyse (4.4.2), mit der die Transkripte <strong>aus</strong>gewertet wurden.<br />
Abschließend werden Gütekriterien qualitativer Forschung (4.5) herangezogen, um die<br />
Güte der vorliegenden Untersuchung zu bewerten. Dazu erwiesen sich die Kriterien<br />
Intersubjektive Nachvollziehbarkeit (4.5.1) und Indikation der Methoden (4.5.2) als<br />
geeignet.<br />
4.1 Begründung des qualitativen Forschungsansatzes<br />
Zur Beantwortung der Fragestellung wurde ein qualitativer Forschungsansatz gewählt. Ein<br />
Grundprinzip dieses Forschungsansatzes ist Offenheit (Lamnek, 2005). Sie erlaubt es, sich<br />
unvoreingenommen einer Fragestellung zu nähern und im Gegensatz zum quantitativen<br />
Ansatz auch Antworten abseits des Erwarteten zu erhalten. Diese Offenheit für Neues ist<br />
auch im Rahmen eines evaluativen Beitrages vorteilhaft. So können alle Aspekte, die für<br />
relevant erachtet werden, geäußert werden und wichtige unerwartete Hinweise zur<br />
Beurteilung der Einrichtung gehen nicht verloren. Außerdem ermöglicht ein offenes<br />
Erhebungsverfahren durch das weitere Grundprinzip der Kommunikation die Darstellung<br />
von Zusammenhängen: So kann nicht nur eine Aussage darüber getroffen werden, was<br />
genau gut bzw. schlecht ist, es kann auch geschildert werden, warum dies so ist. Dadurch<br />
können auch scheinbare Widersprüche aufgeklärt werden: Das Konzept X ist zwar<br />
hilfreich und sinnvoll, aber <strong>aus</strong> den Gründen Y konnte es beim Betroffenen nichts<br />
bewirken. Auch soll in dieser Untersuchung keine Häufigkeit von Zufriedenheit bzw.<br />
40
4 Methodik<br />
Unzufriedenheit erhoben werden, sondern ein Einblick in die individuellen Erfahrungen<br />
von Angehörigen zum NWpG gegeben werden. Genau diese Erfahrungen zu verstehen und<br />
subjektive Sichtweisen zu rekonstruieren, macht den Charakter qualitativer Forschung <strong>aus</strong><br />
(Helfferich, 2011). Darüber hin<strong>aus</strong> eignet sie sich besonders gut, die Unterschiedlichkeit<br />
von Perspektiven aller Beteiligten und somit eine Vielschichtigkeit in der Wahrnehmung zu<br />
verdeutlichen (Flick, 1995). Dies ist besonders für die Fragestellung dieser Arbeit relevant,<br />
da die befragten Angehörigen in der Darstellung ihrer Bewertung zwischen eigenen und<br />
fremden, von den Betroffenen angenommenen Perspektiven, hin und her wechseln.<br />
4.2 Zugang zum Feld<br />
In den meisten Arbeiten zu psychiatrischen <strong>Versorgung</strong>sangeboten werden Mitarbeiter-<br />
Innen oder KlientInnen als InterviewpartnerInnen gewählt. Dieses Feld ist leichter zu<br />
erreichen als das der Angehörigen, da letztere nicht regelmäßig in den Institutionen<br />
anzutreffen sind. Im Falle dieser Arbeit war ein doppelt indirekter Weg zur Gewinnung von<br />
InterviewpartnerInnen nötig: Ich selbst hatte nur Kontakt zu den MitarbeiterInnen des<br />
NWpG, die Kontakt zu den Betroffenen aufnehmen konnten. Diese sollten wiederum die<br />
Angehörigen um Mitarbeit bitten. So war ich auf das Engagement der MitarbeiterInnen<br />
angewiesen. Den größten Erfolg hatten Rekrutierungsversuche, bei denen die<br />
MitarbeiterInnen in gutem Kontakt zu den Angehörigen standen und diese direkt fragten.<br />
Als fremde Forscherin ergaben sich die beschriebenen Schwierigkeiten zwar für den<br />
Zugang zu InterviewpartnerInnen, gleichzeitig erhöht eine solche Außenseiterperspektive<br />
aber auch das Erkenntnispotenzial durch die damit einhergehende Unvoreingenommenheit<br />
(Flick, 1995).<br />
4.2.1 Samplingstrategie<br />
Der Einstieg zur Auswahl der InterviewpartnerInnen erfolgte nach dem Schneeballsystem.<br />
Bei diesem werden bekannte Personen gefragt, ob sie Personen kennen, die die Kriterien<br />
für die Interviewteilnahme erfüllen (Helfferich, 2011). Nachdem der Kontakt zum ersten<br />
Mitarbeiter hergestellt war, gab dieser das Gesuch nach Angehörigen als InterviewpartnerInnen<br />
an seine KollegInnen weiter. Für genauere Informationen zum Anliegen und<br />
Rahmen des Interviews wurde den MitarbeiterInnen eine Intervieweinladung zum<br />
Weiterreichen an interessierte Angehörige zur Verfügung gestellt (s. Anhang A). Im<br />
weiteren Verlauf orientierte sich die Samplingstrategie aber auch am theoretischen<br />
41
4 Methodik<br />
Sampling (Glaser & Str<strong>aus</strong>s, 1998) und zielte auf eine maximale Kontrastierung ab:<br />
Nachdem die ersten zwei Interviews in Bezug auf das Behandlungsergebnis sehr positive<br />
Fälle waren, wurde gezielt nach negativen und durchschnittlichen Fällen gesucht, um ein<br />
möglichst breites Spektrum an Erfahrungen abzudecken. Die Stichprobe wurde demnach<br />
nicht nach Repräsentativität zusammengesetzt, sondern vielmehr nach dem Kriterium des<br />
„(zu erwartenden) Gehalt an Neuem“ (Flick, 1995, S. 82) <strong>aus</strong>gewählt. Als interne Experten<br />
wurden MitarbeiterInnen des NWpG bei der Auswahl zu Rate gezogen. Diese schrittweise<br />
Auswahl der InterviewpartnerInnen kann aber auch als Umsetzung der Prozessorientierung<br />
des problemzentrierten Interviews (s. Kap. 4.3.1) verstanden werden (Flick, 1995).<br />
Insgesamt ergab sich so ein heterogenes Sample, das sich <strong>aus</strong> Fällen mit positiven,<br />
negativen (Abbruch der Teilnahme bzw. keine Besserung) und durchschnittlichen Fällen<br />
zusammensetzte. Ziel des theoretischen Samplings ist die theoretische Sättigung. Letztere<br />
ist erreicht, wenn keine für die Fragestellung relevanten Ähnlichkeiten oder Unterschiede<br />
mehr im Datenmaterial gefunden werden können (Kelle & Kluge, 1999, zit. nach Lamnek,<br />
2005). Es konnte zwar keine völlige theoretische Sättigung erreicht werden, aber es wurde<br />
sich dieser, soweit im Rahmen einer Diplomarbeit möglich, angenähert.<br />
4.2.2 Sample<br />
Das Sample setzt sich zusammen <strong>aus</strong> vier Männern und zwei Frauen im Alter zwischen 42<br />
und 66 Jahren. Vier der InterviewparterInnen sind PartnerInnen von Betroffenen, darüber<br />
hin<strong>aus</strong> wurden eine Mutter und ein enger Freund interviewt. Bei den NutzerInnen wurden<br />
affektive oder psychotische Störungen diagnostiziert. Die Nutzungsdauer der Angebote des<br />
NWpG variierte zwischen ½ bis hin zu 3 ½ Jahren. Die Tabelle 1 enthält eine Übersicht<br />
über diese und weitere demografische Daten der sechs interviewten Angehörigen sowie der<br />
Betroffenen, die anhand eines Kurzfragebogens (s. Anhang D) erhoben wurden.<br />
42
4 Methodik<br />
Tabelle 1<br />
Demografische Daten des Samplings (reduzierte Version <strong>aus</strong> Datenschutzgründen)<br />
Angehörige<br />
Herr A. Herr B. Herr K. Frau T. Frau D. Herr M.<br />
Geschlecht m m m w w m<br />
Alter 52 44 62 66 62 45<br />
Beruf<br />
IT-Supporter<br />
z.Z.<br />
freiberuflich,<br />
Lehrer/<br />
Psychologe/<br />
Künstler<br />
Studienrätin<br />
(pensioniert)<br />
Familienstand ledig ledig ledig eingetragene<br />
Partnerschaft<br />
Beziehung zum<br />
Betroffenen<br />
gemeinsamer<br />
H<strong>aus</strong>halt<br />
Betroffene<br />
10-15 Jahre<br />
befreundet<br />
Ingenieurin<br />
(berentet)<br />
verheiratet<br />
Ingenieur<br />
verheiratet<br />
Mutter Ehefrau Ehemann<br />
nein ja nein nein ja ja<br />
Geschlecht m w m w m w<br />
Alter 49 36 62 40 67 42<br />
Beruf<br />
Selbstständiger<br />
Unternehmensberater<br />
Lebenspartner<br />
Lebenspartner<br />
Grafikdesigner<br />
Religionslehrerin<br />
Computerfachmann<br />
(arbeitslos)<br />
Ingenieurin<br />
Familienstand ledig ledig ledig verheiratet<br />
(getrennt)<br />
angegebene<br />
Diagnose<br />
Paranoide<br />
Schizophrenie<br />
Nutzungsdauer<br />
ª<strong>Krisenpension</strong><br />
~ 3 ½ Jahre ~ 3 Jahre<br />
(8 Wochen<br />
KPª)<br />
Chemie<br />
ing.(berentet)<br />
verheiratet<br />
Sängerin<br />
verheiratet<br />
Psychose Suizidalität Psychose Depression Bipolare<br />
Störung<br />
~¾ Jahr 3 Wochen KP,<br />
6 Monate<br />
Kontakt<br />
6-8 Monate 1 ¾ Jahre<br />
43
4 Methodik<br />
4.3 Methoden der Datenerhebung<br />
Die Daten der vorliegenden Untersuchung wurden mit dem problemzentrierten Interview<br />
nach Witzel (2000) erhoben. Dieses eignet sich besonders gut für die zu bearbeitende<br />
Fragestellung, da es einerseits ein offenes Vorgehen ist, welches im Sinne einer<br />
Unvoreingenommenheit genug Spielraum für neue unerwartete Themen zulässt, die sich<br />
erst in der Interviewsituation ergeben. Andererseits stellt die Problemzentrierung sicher,<br />
dass das Interview auf die Fragestellung fokussiert bleibt und der Interviewte auf die<br />
interessierenden Aspekte zu sprechen kommt. Dies ist notwendig, da der Rahmen einer<br />
Diplomarbeit eine gewisse thematische Begrenzung verlangt, um die gewonnenen Daten<br />
auf angemessene Weise <strong>aus</strong>werten zu können. Ein weiterer Vorteil ist die Vergleichbarkeit<br />
mit anderen Interviews durch eine vorgegebene Grundstruktur sowie eine thematische<br />
Vorstrukturierung mit Hilfe des Leitfadens. Im nächsten Abschnitt wird die Methode des<br />
problemzentrierten Interviews genauer vorgestellt.<br />
4.3.1 Das problemzentrierte Interview<br />
Das problemzentrierte Interview wurde von Witzel (1982, 1985) entwickelt und zeichnet<br />
sich durch die drei Grundpositionen Problemzentrierung, Gegenstandorientierung und<br />
Prozessorientierung <strong>aus</strong>.<br />
Grundpositionen<br />
Problemzentrierung bedeutet allgemein, dass sich das Forschungsvorhaben an<br />
gesellschaftlich relevanten Problemstellungen orientiert (Witzel, 2000). Diesem Anspruch<br />
wird der Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit gerecht, da die <strong>Integrierte</strong><br />
<strong>Versorgung</strong> eine Innovation für die <strong>Versorgung</strong>slandschaft darstellt, die starken Einfluss<br />
darauf hat, wie psychiatrische Behandlung zukünftig <strong>aus</strong>sehen wird. In der methodischen<br />
Umsetzung bedeutet Problemzentrierung weiterhin, dass Vorwissen in problemzentrierte<br />
Fragen einfließen kann und so die Kommunikation präziser auf das Problem zuspitzt<br />
(Witzel, 2000).<br />
Gegenstandorientierung betont die methodische Flexibilität des problemzentrierten<br />
Interviews. Das heißt, dass je nach Anforderungen des Untersuchungsgegenstandes<br />
unterschiedliche Gesprächstechniken und Methoden gewählt und kombiniert werden<br />
können. Witzel (2000) nennt die Gruppendiskussion, die biografische Methode oder auch<br />
standardisierte Fragebögen als Beispiele für mögliche Ergänzungsmethoden. Um in der<br />
Interviewsituation die größtmögliche Flexibilität bei gleichzeitiger Themenfokussierung<br />
44
4 Methodik<br />
beizubehalten, wurde für diese Arbeit ein Leitfaden konzipiert (s. Kap. 4.2.5). Dieser<br />
ermöglicht eine spontane Anpassung an die InterviewparterInnen während des Interviews.<br />
Themenreihenfolge und Schwerpunkte können vom Interviewten bestimmt werden, so dass<br />
die subjektiven Bedeutungsstrukturen möglichst ungebremst geschildert werden können.<br />
Prozessorientierung bezieht sich auf den kompletten Forschungsablauf, inklusive<br />
Vorrecherche und Vorinterpretation, und das Gegenstandsverständnis (Witzel, 2000). Beim<br />
eigentlichen Interview sollte der Interviewte sensibel und akzeptierend bei der<br />
Rekonstruktion von Orientierungen und Handlungen unterstützt werden, so dass eine<br />
möglichst vertraute und offene Atmosphäre geschaffen wird. Diese wiederum sollte beim<br />
Interviewten Erinnerungsfähigkeit und Selbstreflexion fördern, so dass sich die subjektive<br />
Problemsicht ungeschützt entfalten kann und neue Aspekte freigelegt werden (Witzel,<br />
2000).<br />
Instrumente<br />
Zur Datenerfassung stellt das problemzentrierte Interview vier Instrumente zur Verfügung<br />
(Lamnek, 2005): Der Kurzfragebogen erfasst wichtige Fakten - meist demografische Daten<br />
-, die keiner weiteren Erläuterung bedürfen, und entlastet so den Hauptteil des Interviews.<br />
Dieser beruht auf dem Interviewleitfaden, welcher der Materialgenerierung dient und<br />
Fragen zu den relevanten Forschungsthemen beinhaltet. Zu betonen ist hierbei allerdings,<br />
dass er lediglich eine Gedankenstütze darstellt. Es besteht jedoch kein Zwang, ihn zu<br />
benutzen, falls alle relevanten Themen bereits von den InterviewpartnerInnen<br />
angesprochen wurden. Das Aufnahmegerät zeichnet das komplette Interview auf, welches<br />
dann transkribiert werden kann und die Grundlage für die spätere Auswertung liefert. Das<br />
Postskript wird nach dem Interview angefertigt und kann nonverbale Interviewinhalte,<br />
Rahmenbedingungen, Äußerungen vor oder nach der Aufnahme sowie spontane Eindrücke<br />
und weitere Anmerkungen enthalten (Lamnek, 2005).<br />
Phasen<br />
Der konkrete Ablauf des problemzentrierten Interviews lässt sich in mehrere Phasen<br />
unterteilen (Lamnek, 2005). Der Einstieg erfolgt durch eine im Leitfaden vorformulierte<br />
Erzählaufforderung, die möglichst erzählgenerierend wirken sollte. In der darauffolgenden<br />
Phase der allgemeinen Sondierung werden bereits angesprochene Themen aufgegriffen und<br />
weitere Nachfragen gestellt, um detailliertere Ausführungen anzuregen. Die Phase der<br />
spezifischen Sondierung hingegen dient der Verständnisgenerierung. Die Zurückspiegelung<br />
dient dabei der Überprüfung der richtigen Interpretation des Gesagten durch den<br />
45
4 Methodik<br />
Interviewer, der dem Interviewten damit die Möglichkeit der Korrektur anbietet. Außerdem<br />
können Verständnisfragen gestellt werden, um Widersprüche oder <strong>aus</strong>weichende<br />
Antworten zu thematisieren. Möglich ist auch die direkte Konfrontation damit. Wenn<br />
dieser durch immanente Fragen gekennzeichnete Teil des Interviews <strong>aus</strong>geschöpft ist,<br />
können exmanente Ad-hoc-Fragen <strong>aus</strong> dem Interviewleitfaden gestellt werden, soweit<br />
diese Themen bisher noch nicht vom Interviewten selbst angesprochen wurden.<br />
Zentral für die Gestaltung des problemzentrierten Interviews ist der Interviewleitfaden<br />
(Lamnek, 2005). Das Vorwissen bzw. Vorverständnis, das sich der bzw. die ForscherIn zur<br />
Vorbereitung der Erhebungsphase aneignet, kann über den Leitfaden ins Interview<br />
einfließen und ist für dessen Erstellung sogar notwendig. Wichtig zu betonen ist hierbei,<br />
dass dies keine Abkehr vom induktiven Ansatz bedeutet, sondern fast immer gegebenes<br />
Vorwissen transparent macht. Außerdem sichern offen gestellte Fragen, dass der bzw. die<br />
ForscherIn trotz möglicher theoretischer Vorüberlegungen offen für die „Bedeutungsstrukturierung<br />
der sozialen Wirklichkeit“ (Lamnek, 2005, S. 364) der Befragten bleibt. Der<br />
zu interessierende Problembereich kann so eingegrenzt werden, ohne die Antworten zu<br />
beeinflussen. Das folgende Kapitel beschreibt, wie der Interviewleitfaden für diese Arbeit<br />
erstellt wurde.<br />
4.3.2 Konstruktion des Interviewleitfadens<br />
Der Leitfaden für die problemzentrierten Interviews, die in dieser Arbeit durchgeführt<br />
wurden, wurde nach dem von Helfferich (2011) vorgeschlagenem SPSS-Prinzip erstellt.<br />
Dieses folgt dem Grundsatz so offen und flexibel wie möglich und gleichzeitig so<br />
strukturiert wie nötig zu sein. SPSS steht für die Schritte der Leitfadenkonstruktion<br />
Sammeln, Prüfen, Sortieren und Subsumieren. Als erster Schritt wurden möglichst viele<br />
unterschiedliche Fragen gesammelt, die im Zusammenhang mit der Fragestellung dieser<br />
Arbeit von Interesse sind. Im zweiten Schritt wurde diese Fragensammlung deutlich<br />
reduziert: Faktenfragen wurden entfernt oder in den Kurzfragebogen verschoben und<br />
Fragen, die nicht erzählgenerierend waren, die implizit Vorwissen bestätigen sollten oder<br />
nicht offen genug formuliert waren, wurden gestrichen oder verändert. Im nächsten Schritt<br />
wurden die verbliebenen Fragen thematisch sortiert. Nach dem Durchlaufen des<br />
beschriebenen Prozedere entstanden folgende Themenblöcke mit entsprechenden<br />
Leitfragen:<br />
46
4 Methodik<br />
I. Einstieg: Erzählaufforderung<br />
→ Wie kam es zum Einstieg ins Projekt? Welche Erfahrungen wurden bisher mit dem<br />
Projekt gemacht?<br />
II. Hinweise auf Nutzen des NWpG<br />
→ Wurden seit dem Einstieg Veränderungen festgestellt? Was wird als hilfreich/weniger<br />
hilfreich erlebt?<br />
III. Besondere Merkmale des NWpG (in Abgrenzung zur klassischen Psychiatrie:<br />
Kontrastfrage)<br />
→ Welche Unterschiede konnten zur klassischen Psychiatrie festgestellt werden?<br />
IV. Anregungen zur Verbesserung (Idealfrage)<br />
→ Wie sieht das ideale psychiatrische <strong>Versorgung</strong>sangebot <strong>aus</strong>?<br />
V. Abschluss<br />
→ Gibt es noch offene Punkte?<br />
In einem letzten Schritt wurden die Themenblöcke durch weitere Unterfragen zu<br />
Einzelaspekten <strong>aus</strong>gefüllt, so dass untergliederte Fragenbündel entstanden. Auch die<br />
formale Gestaltung des Interviewleitfadens orientiert sich an Helfferich (2011). Einzig die<br />
Spalte der Aufrechterhaltungsfragen wurde der Übersicht halber unter die drei Spalten für<br />
die Leitfragen, die zu erwartenden Aspekte und die konkreten Nachfragen platziert. Der so<br />
entwickelte erste Entwurf für den Interviewleitfaden wurde im Rahmen eines<br />
DiplomandInnen-Kolloquiums vorgestellt und diskutiert. Durch Berücksichtigung der dort<br />
gewonnenen Anregungen entstand die Endversion des Interviewleitfadens, die im Anhang<br />
D zu finden ist. Darin enthalten ist auch der Kurzfragebogen.<br />
4.3.3 Durchführung der Interviews<br />
Die sechs Interviews fanden im Zeitraum von Juni bis September 2011 statt. Ich erhielt die<br />
Telefonnummern der InterviewteilnehmerInnen - nach Erteilung deren Einverständnisses -<br />
entweder von den MitarbeiterInnen oder von ihnen selber per Email oder per SMS. In allen<br />
Fällen nahm ich so telefonisch Kontakt auf. In diesem Gespräch erklärte ich noch einmal<br />
den Rahmen und den Hintergrund des Interviews und stellte sicher, dass alle Fragen dazu<br />
geklärt waren. Die InterviewpartnerInnen konnten Zeit und Ort nach eigener Präferenz<br />
wählen. Vier der Interviews fanden in der eigenen Wohnung der Befragten statt, die beiden<br />
anderen in öffentlichen Örtlichkeiten (Restaurant, Stadtbibliothek). Als zeitlicher Rahmen<br />
war etwa eine Stunde geplant, die tatsächliche Dauer variierte zwischen 1 und 2 Stunden.<br />
47
4 Methodik<br />
Nach der Begrüßung und dem Einfinden in die Situation erklärte ich noch einmal den<br />
Ablauf und Rahmen des Interviews. Vor dem eigentlichen Interview wies ich auf<br />
Anonymität und datenschutzrechtliche Bedingungen hin und schloss den Datenschutzvertrag<br />
(s. Anhang B) mit den Interviewteilnehmern ab. Das komplette Interview wurde<br />
nach Einverständnis der Angehörigen mit einem Diktiergerät aufgezeichnet. Alle<br />
InterviewpartnerInnen waren dem Thema gegenüber sehr aufgeschlossen und berichteten<br />
<strong>aus</strong>führlich und selbstständig über selbst gewählte Schwerpunkte. Den Kurzfragebogen<br />
ließ ich erst nach Abschluss des Interviewhauptteils <strong>aus</strong>füllen, um zu vermeiden, dass sich<br />
seine Frage-Antwort-Struktur auf den Dialog im Interview <strong>aus</strong>wirkt (Flick, 1995). Nach<br />
der Beendigung des Interviews und Verabschiedung der bzw. des Interviewten fertigte ich<br />
das Postskriptum an. Damit sollten Eindrücke und Gedanken zum Interview festgehalten<br />
werden, die mir bei der späteren Auswertung von Nutzen sein könnten.<br />
4.4 Methoden der Daten<strong>aus</strong>wertung<br />
Als Methode der Daten<strong>aus</strong>wertung wurde die zusammenfassende qualitative Inhaltsanalyse<br />
nach Mayring (2002) gewählt. Diese eignet sich gut, um die Interviewtexte systematisch zu<br />
analysieren und das Material auf die wesentlichen Inhalte zu reduzieren.<br />
4.4.1 Transkription<br />
Bereits die Transkription stellt den ersten Schritt der Daten<strong>aus</strong>wertung dar. Der<br />
Transkriptionsprozess bietet nämlich die Möglichkeit, sich intensiv mit dem<br />
aufgenommenen Material zu beschäftigen und erste Interpretationsideen zu sammeln. Da<br />
so ein tieferes Verständnis für das Material entstehen kann (Dresing & Pehl, 2010), wurden<br />
alle Transkripte von mir selbst erstellt. Das Audiotranskriptionsprogramm f4 lieferte die<br />
technische Unterstützung dafür. Zur Nachvollziehbarkeit des Entstehungsprozesses wurden<br />
Transkriptionsregeln festgelegt (s. Anhang C). Diese wurden so gewählt, dass eine<br />
möglichst gute Lesbarkeit bei gleichzeitigem Erhalt einer möglichst originalgetreuen<br />
Interviewabbildung (Kuckartz, Dresing, Rädiker & Stefer, 2008) gewährleistet wird. Alle<br />
Personennamen und Orte wurden zur Wahrung der Anonymität entfernt bzw.<br />
verallgemeinert. In Anhang F befindet sich ein Beispieltranskript, das nach diesem Prinzip<br />
erstellt wurde.<br />
48
4 Methodik<br />
4.4.2 Die Qualitative Inhaltsanalyse<br />
Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2002) ist eine Methode, mit der Material<br />
streng methodisch kontrolliert analysiert werden kann. Aus dem Material wird dazu<br />
schrittweise ein Kategoriensystem erarbeitet. Dieses Kategoriensystem steht im Zentrum<br />
der qualitativen Inhaltsanalyse und wird je nach Analysetechnik induktiv <strong>aus</strong> den Daten<br />
gewonnen oder deduktiv <strong>aus</strong> der Theorie abgeleitet. Weiterhin zeichnet sich die qualitative<br />
Inhaltsanalyse durch ihre Regelgeleitetheit <strong>aus</strong>, die durch das allgemeine inhaltsanalytische<br />
Ablaufmodell sichergestellt wird (Mayring, 2000). Darin wird das Datenmaterial in<br />
Analyseeinheiten zerlegt und schrittweise bearbeitet. Folgende neun Stufen werden bei<br />
diesem Prozess durchlaufen (Lamnek, 2005): Bei der Festlegung des Materials (1) werden<br />
die <strong>aus</strong>zuwertenden Textstellen nach Relevanz für die Beantwortung der Fragestellung<br />
eingegrenzt. Dies ist besonders bei großen Datenmengen sinnvoll, um den Arbeitsaufwand<br />
zu reduzieren. In der Analyse der Entstehungssituation (2) werden alle verfügbaren Daten<br />
zur Interviewsituation wie zum Beispiel Postskripte <strong>aus</strong>gewertet, um diese auch bei der<br />
Gesamtanalyse berücksichtigen zu können. Als formale Charakterisierung des Materials<br />
(3) ist zu klären, in welcher Form die Daten vorliegen. Dies ist meist die Audiodatei und<br />
das dar<strong>aus</strong> erarbeitete Transkript. Es sollte dabei auch beschrieben sein, nach welchen<br />
Transkriptionsregeln verfahren wurde. Die Stufe der Richtung der Analyse (4) zielt darauf<br />
ab, zu reflektieren, was genau interpretiert werden soll. In der qualitativen Sozialforschung<br />
geht es darum, latente Sinnstrukturen <strong>aus</strong> den expliziten Aussagen her<strong>aus</strong>zuarbeiten. Durch<br />
die theoretische Differenzierung der Fragestellung (5) soll sichergestellt werden, dass die<br />
Fragestellung zum einen vorab genau feststeht und zum anderen einen theoretischen Bezug<br />
zur aktuellen Forschung hat. In der Bestimmung der Analysetechnik (6) wird das konkrete<br />
Ablaufmodell festgelegt. Je nachdem, welche Technik gewählt wird, resultiert eine andere<br />
Grundform der qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring, 2002). Zu unterscheiden sind die<br />
zusammenfassende, die explikative und die strukturierende Inhaltsanalyse. Bei der<br />
Definition der Analyseeinheiten (7) wird bestimmt, wie ein Text<strong>aus</strong>schnitt beschaffen sein<br />
muss, damit er zu einer bestimmten Kategorie zugeordnet werden kann (Lamnek, 2005).<br />
Der Hauptteil der qualitativen Inhaltsanalyse ist die Analyse des Materials (8)<br />
entsprechend der in Schritt 6 festgelegten Analysetechnik. Bei der Zusammenfassung wird<br />
das Material so reduziert, dass nur die wesentlichen Inhalte bestehen bleiben. Durch<br />
schrittweise Abstraktion wird so ein überschaubarer Corpus her<strong>aus</strong>gearbeitet, der das<br />
Grundmaterial abbildet (Mayring, 2002). Die Explikation trägt als Kontextanalyse<br />
49
4 Methodik<br />
zusätzliches Material zu einzelnen unverständlich gebliebenen Textstellen heran, um diese<br />
<strong>aus</strong>zudeuten. Die Strukturierung filtert bestimmte Strukturen - je nach Fragestellung sind<br />
formale, inhaltliche, typisierende oder skalierende Strukturierungen möglich - <strong>aus</strong> dem<br />
Material und versucht, einen Querschnitt durch das Material zu legen. Der letzte Schritt<br />
besteht in der Interpretation (9) der Ergebnisse in Richtung der Hauptfragestellung.<br />
Anzustreben ist dabei die fallübergreifende Generalisierung hin zu einer Gesamtdarstellung<br />
typischer Fälle durch die Kategorien (Lamnek, 2005).<br />
Für die Auswertung der erhobenen Daten der vorliegenden Arbeit wurde die<br />
zusammenfassende Inhaltsanalyse gewählt. Diese bietet sich laut Mayring (2005) immer<br />
dann an, wenn man in erster Linie an der inhaltlichen Ebene des Materials und einer<br />
überschaubaren Zusammenfassung dessen interessiert ist. Dies ist für die zu bearbeitende<br />
Fragestellung der Fall, für die der Inhalt der Aussagen zum NWpG von Interesse ist und<br />
zusammengefasst werden soll. Außerdem stellt die zusammenfassende Inhaltsanalyse - im<br />
Vergleich zu den zwei anderen Grundformen der qualitativen Inhaltsanalyse - die offenste<br />
Herangehensweise an die Fragestellung dar. So sollen den Angehörigen dabei keine zu<br />
beurteilenden Kriterien des NWpG in Form von deduktiv gewonnenen Kategorien<br />
vorgegeben werden. Stattdessen soll das Untersuchungsdesign den Angehörigen vielmehr<br />
ermöglichen, ihre subjektiv relevanten Aspekte zur Einschätzung des NWpG zu äußern.<br />
Gerade die besondere Perspektive Angehöriger könnte neue unerwartete Aspekte<br />
hervorbringen, die für die Auswertung bzw. Verbesserung des NWpG von Bedeutung sind<br />
und bei einem deduktiven Ansatz verloren gehen würden. Dies wird durch die induktive<br />
Kategorienbildung ermöglicht, bei der die Kategorien in einem Verallgemeinerungsprozess<br />
direkt <strong>aus</strong> dem Material abgeleitet werden, ohne sich auf bereits festgelegte<br />
Theoriekonzepte zu beziehen (Mayring, 2008). Diese Verallgemeinerung entsteht durch<br />
einen systematischen Reduktionsprozess, bei dem schrittweise immer abstraktere Nive<strong>aus</strong><br />
erreicht werden. Als erster Reduktionsschritt wurden die <strong>aus</strong> den geführten Interviews<br />
entstandenen Transkripte einer Paraphrasierung unterzogen. Das heißt, dass alle nicht<br />
inhaltstragenden Textbestandteile her<strong>aus</strong>gekürzt und danach alle verbliebenen auf ihre<br />
grammatikalische Kurzform reduziert wurden. Als nächster Schritt wurde das<br />
paraphrasierte Textmaterial auf ein höheres Abstraktionsniveau verallgemeinert<br />
(Generalisierung). In der darauf folgenden ersten Reduktion wurden weniger relevante<br />
bzw. bedeutungsgleiche Passagen gestrichen. Die zweite Reduktion führte schließlich zu<br />
den fallspezifischen Kategorien, indem ähnliche Passagen gebündelt und zusammengefasst<br />
50
4 Methodik<br />
bzw. ineinander integriert wurden. Beispielhaft ist die Auswertung eines Interviews nach<br />
dem beschriebenen Prinzip der systematischen Reduktion in Anhang E zu finden. Um zu<br />
einem fallübergreifenden Kategoriensystem zu gelangen, wurde darüber hin<strong>aus</strong> eine<br />
Tabelle erstellt, die alle in der zweiten Reduktion gewonnenen Kategorien der befragten<br />
InterviewpartnerInnen miteinander vergleicht. Zur Unterstützung der Zuordnung von<br />
Textpassagen zu fallübergreifenden Kategorien diente außerdem das PC-Programm für<br />
qualitative Datenanalyse MAXQDA. Das endgültige Kategoriensystem wird im<br />
Ergebnisteil (Kapitel 5) vorgestellt.<br />
4.5 Gütekriterien qualitativer Forschung<br />
Steinke (1999) hat speziell für die Bewertung qualitativer Forschungsarbeiten universelle<br />
Kernkriterien entwickelt. Allgemein und unspezifisch gehalten sollen diese einen Pool<br />
darstellen, <strong>aus</strong> dem untersuchungsspezifisch angemessene Kriterien <strong>aus</strong>gewählt werden<br />
können.<br />
4.5.1 Intersubjektive Nachvollziehbarkeit<br />
Für die qualitative Untersuchung dieser Arbeit erscheint das Kriterium der intersubjektiven<br />
Nachvollziehbarkeit angemessen. Mit diesem Kriterium soll sichergestellt werden, dass<br />
Dritte den gesamten Forschungsprozess nachvollziehen und dadurch bewerten können<br />
(Steinke, 2007). Dies ist im Rahmen einer Diplomarbeit gut möglich und wurde durch die<br />
Dokumentation der <strong>aus</strong>gewählten Forschungsstrategien und der einzelnen Untersuchungsschritte<br />
umgesetzt. In diesem Kapitel wurden dementsprechend das Sampling, die<br />
Methoden der Datenerhebung und Daten<strong>aus</strong>wertung, Begründungen für deren Wahl sowie<br />
die erfüllten Gütekriterien dokumentiert. Darüber hin<strong>aus</strong> wurde der Weg von den<br />
erhobenen Daten hinzu den Ergebniskategorien zum einen anhand eines beispielhaften<br />
Interviews im Anhang (Anhang C, E und F) und zum anderen durch die Verwendung des<br />
PC-Programmes MAXQDA transparent gemacht.<br />
Auch die Interpretation in Gruppen (Steinke, 1999) wurde als Umsetzung von<br />
intersubjektiver Nachvollziehbarkeit für diese Arbeit wahrgenommen. Einerseits wurden<br />
wesentliche Schritte des Forschungsprozesses (Wahl der Erhebungsmethode, Leitfadenkonstruktion,<br />
Ergebniskategorien, Diskussion) im Diplomandinnen-Kolloquium diskutiert<br />
und angeregt, andererseits fand zu jeder Zeit ein intensiver Aust<strong>aus</strong>ch in der<br />
Kleinarbeitsgruppe mit einer anderen Diplomandin statt.<br />
51
4 Methodik<br />
4.5.2 Indikation der Methoden<br />
Ein weiteres für die vorliegende Untersuchung relevantes Gütekriterium ist die<br />
Angemessenheit der Methodenwahl (Steinke, 2007). In diesem Kapitel wurde bereits<br />
beschrieben, <strong>aus</strong> welchen Gründen die jeweilige Methode bzw. der qualitative Ansatz im<br />
Allgemeinen (s. Kap. 4.1) gewählt wurde. Ob sich die Methode tatsächlich als dem<br />
Untersuchungsgegenstand angemessen erwiesen hat, lässt sich am besten anhand der<br />
Durchführung beurteilen. Dafür spricht, dass der konstruierte Interviewleitfaden eine<br />
flexible Interviewgestaltung möglich machte, die sich der bzw. dem jeweiligen InterviewpartnerIn<br />
anpassen konnte. Zusätzliche bzw. unerwartete Themen (s. Kap. 5.2 K2<br />
Hindernisse) konnten so ins Interview eingehen. Ein weiteres Indiz für eine angemessene<br />
Datenerhebungsstrategie ist, dass die Interviewten frei und <strong>aus</strong>führlich auf Fragen<br />
antworteten, und auch persönliche Themen nicht scheuten. Die geführten Interviews<br />
zeichneten sich durch eine große Offenheit und z. T. sehr emotionale Momente <strong>aus</strong>. Alle<br />
Interviewten sprachen sehr frei und brauchten nur wenig unterstützende Fragen. Dies<br />
spricht für ein gelungenes Arbeitsbündnis und eine stimmige Atmosphäre (Steinke, 2007).<br />
Für die Angemessenheit der Auswertungsmethode spricht, dass diese co-indiziert mit der<br />
Methode der Datenerhebung ist. Die Erhebung mittels problemzentriertem Interview liefert<br />
Daten, die sich für eine fallübergreifende Analyse und eine Kategoriezuordnung eignen,<br />
wie sie in der qualitativen Inhaltsanalyse nötig sind (Steinke, 2007).<br />
52
5 Ergebnisse<br />
5 Ergebnisse<br />
Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der durchgeführten Untersuchung dargestellt.<br />
Aus den sechs Angehörigeninterviews ergaben sich fünf Themenschwerpunkte: 1)<br />
wahrgenommene Veränderungen während der Zeit im NWpG, 2) Hindernisse für den<br />
Nutzen des NWpG, 3) Konzepte des NWpG, die als hilfreich empfunden wurden, 4) Ideen<br />
zu einer verbesserten bzw. sogar idealen <strong>Versorgung</strong> und schließlich 5) Erfahrungen mit<br />
der klassischen Psychiatrie. Da die Daten zu den Erfahrungen mit der klassischen<br />
Psychiatrie nicht direkt zur Beantwortung der Fragestellung beitragen, werden diese in der<br />
Ergebnisdarstellung nicht in eine eigene Kategorie aufgenommen. Veranschaulicht wird<br />
diese Grobeinteilung vorhandener Daten in Abbildung 1.<br />
K1 Veränderungen<br />
K2 Hindernisse<br />
Erfahrungen mit<br />
klassischer Psychiatrie<br />
K3 Hilfreiche Konzepte<br />
K4 Idealversorgung<br />
Abbildung 1. Datenübersicht<br />
Im Vordergrund stehen die von den Betroffenen und Angehörigen angestrebten<br />
Veränderungen (K1). Aus Fällen, in denen weitreichende positive Veränderungen nicht<br />
bzw. noch nicht eingetreten sind, lassen sich grundlegende Hindernisse (K2) identifizieren,<br />
die den Nutzen des Angebotes blockieren. Weiterhin wurden in den Interviews als hilfreich<br />
empfundene Haltungen und Arbeitsweisen des NWpG genannt, die sich unter der<br />
Kategorie hilfreiche Konzepte (K3) zusammenfassen lassen. Die Kategorie<br />
Idealversorgung (K4) beinhaltet Ideen und Wünsche zur Verbesserung der <strong>Versorgung</strong>.<br />
Erfahrungen mit der klassischen Psychiatrie und Psychotherapie machen zwar auch einen<br />
Teil der Daten <strong>aus</strong>, werden im Ergebnisteil aber nicht direkt dargestellt, da sie auch nicht<br />
direkt zur Beantwortung der Fragestellung beitragen. Indirekt kommen sie aber immer<br />
wieder vor, da die Schilderungen der Angehörigen zur klassischen Psychiatrie oft zur<br />
Abgrenzung der Konzepte des NWpG herangezogen wurden. Sie stellen teilweise einen<br />
53
5 Ergebnisse<br />
Gegenpol zu diesen dar und lassen somit Rückschlüsse auf das Spezifische der Haltungen<br />
und Arbeitsweisen des NWpG zu. Dementsprechend haben die Daten zur klassischen<br />
Psychiatrie vor allem zur Entwicklung der Kategorie hilfreiche Konzepte beigetragen. Sie<br />
fließen jedoch auch unterschiedlich stark in die übrigen Kategorien ein.<br />
Als Ergebnis der Untersuchung ergeben sich so vier Hauptkategorien, die in den Kapiteln<br />
5.1 – 5.4 im Einzelnen erläutert werden. Die Darstellung der Ergebnisse wird durch eine<br />
zusammenfassende Ergebnisübersicht (5.5) abgeschlossen.<br />
5.1 K1 Veränderungen<br />
Die Kategorie Veränderungen ist eine der zentralen Kategorien dieser Untersuchung, da sie<br />
einen Rückschluss auf vorhandenen Nutzen des <strong>Versorgung</strong>sangebotes zulässt, welcher<br />
letzten Endes das angestrebte Ziel der Betroffenen ist. Dadurch stehen die subjektiv<br />
wahrgenommenen Veränderungen für Betroffene sowie Angehörige im Mittelpunkt ihres<br />
Interesses, wodurch sie - soweit gegeben - im Interview besonders präsent sind und ohne<br />
längere Reflexion mitgeteilt werden können. Da die Veränderungen individuell je nach<br />
Problematik, Symptomatik und Situation stark variieren, erschien es sinnvoll, die einzelnen<br />
Veränderungen auf einem eher spezifischen Niveau zu belassen und weniger fallübergreifend<br />
zu abstrahieren.<br />
Langfristige Veränderung<br />
Teilerfolge<br />
Umgang<br />
Krise<br />
informierte<br />
Angehörige<br />
Stabilität<br />
Problemverständnis<br />
Problembewusstsein<br />
Lebenseinstellung<br />
Eigenständigkeit<br />
Lebensqualität<br />
Perspektiven<br />
Umgang<br />
Krankheit<br />
partnerschaftl.<br />
Konfliktbewältigung<br />
Medikamentierung<br />
Freiheit<br />
Zeit<br />
Abbildung 2. K1 Veränderungen<br />
54
5 Ergebnisse<br />
Abbildung 2 veranschaulicht die gesamte Kategorie 1 Veränderungen und beinhaltet damit<br />
neben den Prinzipien von Langfristigkeit, Teilerfolgen und Prozesscharakter auch die<br />
konkreten Veränderungen, die in Anlehnung an Herrn B. als B<strong>aus</strong>teine dargestellt werden<br />
(s. Zitat unten, Herr B., 687-694). Die von den InterviewpartnerInnen berichteten<br />
Veränderungen beziehen sich auf drei unterschiedliche Bereiche: Sie konnten nicht nur bei<br />
den Betroffenen verzeichnet werden, sondern auch bei den Angehörigen selbst. Als dritter<br />
Bereich ergaben sich Veränderungen in der Betroffenen-Angehörigen-Beziehung, was sich<br />
wiederum positiv auf beide für sich genommen <strong>aus</strong>wirken kann. Die vorgestellten Aspekte<br />
wahrgenommener Veränderung sollen in diesem Kapitel im Einzelnen mit Zitaten <strong>aus</strong> den<br />
Interviews veranschaulicht werden. Damit ergeben sich die Unterkapitel Langfristigkeit,<br />
Teilerfolge und Prozesscharakter (5.1.1), Veränderungen bei Betroffenen (5.1.2),<br />
Veränderungen bei Angehörigen (5.1.3) und Veränderungen in der Betroffenen-<br />
Angehörigen-Beziehung (5.1.4).<br />
5.1.1 Langfristigkeit, Teilerfolge, Prozesscharakter<br />
In den Interviews zeigte sich, dass die Prinzipien Langfristigkeit und Teilerfolge eine<br />
bedeutende Rolle in dieser Kategorie einnehmen, da sie Einfluss auf die Wahrnehmung<br />
und Entwicklung der konkreten Veränderungen haben. Dar<strong>aus</strong> ergab sich weiterhin, dass<br />
eine gewisse Bescheidenheit bei Veränderungen angebracht ist: Jede (noch so kleine)<br />
Veränderung benötigt viel Zeit und Anstrengung und wird dabei schnell einmal übersehen<br />
(1. folgendes Zitat) oder wenig gewürdigt (2. folgendes Zitat ).<br />
„Ja, zumal den Fortschritt man ja auch immer nicht so schnell sehen kann unter Umständen,<br />
ja.“ (Herr M., 140-141)<br />
Aber gerade weil selbst „diese kleinen Erfolge“ (Herr B., 716) solche Anstrengungen<br />
bedeuten, ist eine Würdigung dieser extrem wichtig, damit die bzw. der Betroffene<br />
Motivation zum weiteren Durchhalten sowie eine Bestätigung dafür erhält, dass sie bzw. er<br />
auf dem richtigen Weg ist. Im folgenden Fall übernimmt der Angehörige diese Würdigung<br />
für seine Partnerin und gibt ihr damit eine Rückmeldung über seine Einschätzung zu ihrem<br />
Fortschritt:<br />
„Also, das sind die ganzen Erfolge, die sie auch feiert und - Leider gehört sie nicht zu den<br />
feiernden Menschen, sondern zu den sehr strebsamen, sie tut das dann nach einer Weile immer<br />
ab und sagt: Ok, ist jetzt halt so. Jetzt müssen wir aber weiter (lacht). Ich finde bei ihrer<br />
Geschichte, da kann man schon oft den Champagner r<strong>aus</strong>holen und den Korken knallen<br />
lassen.“ (Herr B., 791-797)<br />
55
5 Ergebnisse<br />
Besonders eindrücklich beschreibt Herr B. das Prinzip des Teilerfolges mit der Vorstellung,<br />
dass sich jedes Problem <strong>aus</strong> vielen kleinen B<strong>aus</strong>teinen zusammensetzt und verdeutlicht,<br />
dass jedes Wegfallen eines solchen B<strong>aus</strong>teines zu Entlastung führt:<br />
„Ja. Und ich sage mal, wenn man so in einer Krise hängt und da sind jetzt, sagen wir mal, 20<br />
große Probleme und wenn die wiederum 20 kleine B<strong>aus</strong>teine beinhalten. Und wenn davon 10<br />
schon mal weg sind, also jeder B<strong>aus</strong>tein, der irgendwie gelöst wird […] Das nimmt<br />
unwahrscheinlich viel Druck weg, ja?.“ (Herr B., 687-691)<br />
Auch Herr M. sieht in den „kleinen Teilerfolgen“ (s. u.) seiner Frau einen wichtigen<br />
Beitrag für die Gesamtveränderung:<br />
„wo vielleicht auch schon kleine Teilerfolge dazu geführt haben, dass dort Besserung<br />
aufgetreten ist“ (Herr M., 326-227)<br />
Er erkennt in ihnen einen ersten Schritt in die richtige Richtung und fühlt sich darin<br />
bestärkt, dass das langfristige Ziel erreicht werden kann:<br />
„Aber, es geht zumindest in die eine Richtung und es ist die richtige Richtung und deswegen bin<br />
ich durch<strong>aus</strong> positiv gestimmt. Ich würde es mir schon wünschen, dass es schneller geht, ja.“<br />
(Herr M., 362-364)<br />
Gleichzeitig drückt das Zitat aber auch eine Ambivalenz zwischen Hoffnung und Ungeduld<br />
<strong>aus</strong>. Auch Angehörige werden auf eine Geduldsprobe beim Warten auf Erfolge und<br />
Veränderung gestellt und oft geht es langsam voran - aber eben doch voran, in die richtige<br />
Richtung. Genau dieses Phänomen ist mit Langfristigkeit gemeint, nämlich, dass sich<br />
greifbare Veränderungen erst nach längerer Zeit einstellen und wahrgenommen werden<br />
können. Damit stellt der Zeitfaktor eine Her<strong>aus</strong>forderung für Betroffene und Angehörige<br />
dar. Diese Langfristigkeit wird in folgenden Zitaten angesprochen:<br />
„Also es gab nichts,(..) das kann man glaube ich auch gar nicht erwarten, wo irgendeine Aktion<br />
stattfand und als die beendet war, war danach alles schick. Das [...] führte halt (..) längerfristig<br />
mal wieder zum Erfolg.“ (Herr B., 679-682)<br />
„Also, und wir sind noch dabei und das wird sicher auch noch länger dauern, könnte ich mir<br />
vorstellen.“ (Herr M., 135-136)<br />
Wenn in bestimmten Bereichen noch keine Veränderung komplett vollzogen bzw.<br />
benennbar war, behalfen sich die befragten InterviewpartnerInnen fallübergreifend mit dem<br />
Begriff „Prozess“ (Herr M., 358) bzw. „Lernprozess“ (Herr A., 1327; 1717):<br />
„Und man muss ja auch nicht gleich das ganz große Rad drehen, weil das ist einfach, so wie<br />
immer, in kleinen Schritten kann man das immer nur messen und deswegen ist das ganze ein<br />
Prozess.“ (Herr M.,131-133)<br />
Der Prozesscharakter von Veränderungen besteht darin, dass, obwohl etwas schon<br />
begonnen wurde und obwohl man sich schon ein Stück in die richtige Richtung bewegt<br />
hat, es noch keinen so greifbaren großen Erfolg zu berichten gibt. Der Weg dahin ist noch<br />
56
5 Ergebnisse<br />
länger, man befindet sich noch im Prozess, welcher aber letztendlich in langfristiger<br />
Veränderung münden kann. Das Verständnis dafür zu erlangen, dass nachhaltige<br />
Veränderungen viel Zeit und Anstrengung in Anspruch nehmen, ist wiederum eine erste<br />
Veränderung für Herrn M., der sein neues Bewusstsein dafür im Interview immer wieder<br />
thematisiert und folgendermaßen schildert:<br />
„Und ich glaube, das ist einfach ein Prozess und dessen muss man sich bewusst sein, dass man<br />
nicht mit 1, 2, 3 Sitzungen dann irgendwelche größeren Probleme vom Tisch hat, das ist<br />
einfach, das geht nicht, nicht möglich.“ (Herr M., 160-162)<br />
„Aber, wie gesagt, wir sind da auf dem richtigen Weg und müssen halt jeden Tag daran<br />
arbeiten, ansonsten ja, ansonsten wird man das nicht erreichen, dass man dementsprechend<br />
deutliche Veränderungen dann auch verspürt, die dann auch nachhaltig sind.“<br />
(Herr M., 377-380)<br />
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Veränderung als langfristiger Lernprozess<br />
erlebt wird, bei dem zunächst nur Teilerfolge zeigen, dass der richtige Weg eingeschlagen<br />
worden ist. Dieser Umstand verlangt von allen Beteiligten viel Geduld und Ausdauer, da<br />
die große greifbare Veränderung auf sich warten lässt und die Hoffnung auf schnelle<br />
Veränderung schnell enttäuscht werden kann:<br />
„aber man muss ganz klar feststellen, dass die Schritte relativ klein sind im Verhältnis zu den<br />
Erwartungen, die man anfangs hatte und das war auch jetzt ein Prozess, ein Lernprozess für<br />
mich, dass man einfach nicht erwarten kann: Ja, ich mache das und lege den Hebel um und<br />
dann ist alles anders, sondern das sind manchmal einfach auch Verhaltensmuster, die über<br />
Jahre gewachsen sind, die man eben auch nur über einen längeren Zeitraum wieder verändern<br />
kann.“ (Herr M., 205-210)<br />
5.1.2 Veränderungen bei Betroffenen<br />
✔<br />
Perspektiven<br />
Das Lösen psychischer Probleme und Krisen ist, wie bereits <strong>aus</strong>geführt, oft ein<br />
langwieriger Prozess, bei dem Fortschritte lange auf sich warten lassen oder nur schwer<br />
erkennbar sind. Das führt dazu, das betroffene Menschen ihre Situation schnell als<br />
<strong>aus</strong>weglos empfinden können. Der erste Schritt, um den Weg für Veränderungen frei zu<br />
machen, ist es aufzuzeigen, dass es überhaupt Auswege gibt und damit eine Perspektive zu<br />
geben:<br />
„War noch nicht greifbar und dann werden ihm durch die beiden auch verschiedene Wege<br />
aufgezeigt: So kann es gehen, so kann es gehen, so kann es gehen, wäre das eine Lösung, wäre<br />
das eine Lösung?“ (Herr A., 760-762)<br />
Für Herrn B. gehört zu dieser Perspektivgabe auch, zu vermitteln, dass zum Leben neben<br />
Höhen auch Tiefen als notwendige Zwischenetappen gehören, welche schließlich zum Ziel<br />
führen. Dies verdeutlicht er im Folgenden anschaulich, indem er das Leben mit einem<br />
Bergaufstieg vergleicht:<br />
57
5 Ergebnisse<br />
✔<br />
„Die Perspektiven.[...] Ja. Also auch einfach vorgelebt oder bewusst gemacht zu werden: Hey,<br />
das ist jetzt hier nicht vorbei und das Leben ist auch kein gerader Weg, sondern es geht nach<br />
links und nach rechts und ab und zu geht es auch mal einen Abhang herunter und ab und zu<br />
muss man einen Berg hoch klimmen, aber dann hat man auch die Spitze erreicht und kann man<br />
ins Tal gucken.“ (Herr B., 821-827)<br />
Problembewusstsein und -verständnis<br />
Eine wichtige erste Veränderung kann eine bessere Einsicht in die eigene Problematik sein.<br />
Herr M. schildert, wie seine Frau zunächst zu einem besseren Problembewusstsein<br />
gelangte:<br />
„Und was gut war, ist dass ihr viele Dinge jetzt im Nachhinein bewusst geworden sind, [...].<br />
Das hat sie vorher nie so gesehen“ (Herr M., 396-398)<br />
Darüber hin<strong>aus</strong> veränderte sich ihr Problemverständnis, was eine wichtige Grundlage für<br />
alle weiteren Veränderungen legen kann.<br />
✔<br />
„ja schon dass ihr auch viel die Augen geöffnet worden sind. [...] dass sie viele viele Dinge<br />
jetzt viel besser versteht und ja, und das ist ja schon mal wichtig eine Erkenntnis zu haben<br />
irgendwie, ja?“ (Herr M., 548-552)<br />
Medikamentierung<br />
Eine weitere Veränderung mit zum Teil weit reichenden Folgen ist die Änderung der<br />
Medikamentierung. Bei den Angehörigen von Herrn A. und Herrn B. wurden besonders<br />
starke Veränderungen durch eine deutliche Reduktion der Medikamente hervorgerufen:<br />
„Und da muss ich sagen, da haben wir hier Megafortschritte gemacht, also die Medikamente<br />
sind auf einem Minimum, ein notwendiges Minimum reduziert.“ (Herr B., 89-90)<br />
Herr A. berichtet in Übereinstimmung dazu, dass „das Medikament [...] nur noch ein<br />
Hilfsmittel“ mit geringer Dosierung ist (908-909) und die auf ein Drittel reduzierte<br />
„Minimaldosis“ gen<strong>aus</strong>o gut funktioniert (1237-1238). Besonders auffällig ist, dass Herr A.<br />
und Herr B. den Zustand ihrer Partner vor der Medikamentenreduktion unabhängig von<br />
einander mit sehr ähnlichen Bildern beschreiben.<br />
Herr A.: „Da hat er, ja wie in so einer Glocke gelebt und es gab nur ein paar Leute, die Zugang hatten.<br />
Und das hat sich verändert.“ (Herr A., 929-930)<br />
„Ja, das glaube ich auch im Nachhinein für ihn das Gefühl, dass er fremdbestimmt wird über<br />
diese Medikamente, dass er nicht mehr kontrollieren konnte, wann, wer er ist, was er tut,<br />
sondern er, ja, er hat sich einfach wie in einer Käseglocke bewegt, die <strong>aus</strong> Glas war und ist<br />
überall angestoßen. Und konnte nicht mehr er sein.“ (Herr A. 1773-1176)<br />
Herr B.: „Da hat man so das Gefühl gehabt: Ok, da ist ein Mensch hinter einer ganz dicken<br />
Milchglasscheibe, ja, der einfach nicht r<strong>aus</strong>kommen kann, der aber will.“ (Herr B., 95-96)<br />
Sowohl die Käseglocke als auch die Milchglasscheibe verdeutlichen, dass sich die<br />
Betroffenen unter der starken Medikamentierung beeinträchtigt gefühlt haben. Ein<br />
zentraler Aspekt dabei ist die Freiheit: Unter einer Käseglocke sowie hinter einer<br />
58
5 Ergebnisse<br />
Milchglasscheibe ist man eingeschlossen, kann man sich nicht frei bewegen („überall<br />
angestoßen“ s. o.), ist man abgeschnitten von seinen Mitmenschen („nur ein paar Leute,<br />
die Zugang hatten“) und kann man auch nicht her<strong>aus</strong> (s. o). Entscheidend dabei ist auch<br />
der Nachsatz „der aber will“ (s. o.), da dies zeigt, dass die Medikamentierung die<br />
Selbstbestimmung beschneiden kann. Noch deutlicher wird dies, wenn Herr A. von<br />
„fremdbestimmt“ (s. o.) und Kontrollverlust („wer er ist“; „konnte nicht mehr er sein“ (s.<br />
o.)) spricht. Die Fremdbestimmung durch Medikamente wird auch im folgenden Zitat sehr<br />
deutlich, das beschreibt, wie die Medikamente wie ein Lichtschalter über Schlaf oder<br />
Wachheit bestimmen:<br />
„Also das war, ist dann wie so ein Lichtschaltereffekt. Das eine macht richtig wach und das<br />
andere dröhnt wieder wieder richtig runter.“ (Herr A., 1271-1275)<br />
Insgesamt wird deutlich, dass sich der Aspekt der Freiheit bzw. Selbstbestimmung auf zwei<br />
unterschiedliche Dimensionen bezieht: Zum einen auf Handlungs- bzw. Bewegungsfreiheit<br />
(Was kann ich machen?) und zum anderen auf eine Identitätsdimension (Wie kann ich<br />
sein?). Bezüglich des letzten Aspektes hat Herr K. unterschiedliche Erfahrungen mit<br />
Medikamenten gemacht: Vor der medikamentösen Neueinstellung berichtet er über eine<br />
Art Abstumpfung seines Angehörigen, analog zum Bild der Milchglasscheibe, durch die<br />
man alles nur noch verschwommen wahrnehmen kann:<br />
„und die Medikamente schneiden Teile von ihm ab, verdumpfen, machen dumpf“ (Herr K., 246)<br />
Nach einer Neueinstellung wirkten sich die Medikamente jedoch positiv <strong>aus</strong> und führten zu<br />
einer Stabilisierung 10 der Charakterzüge bzw. der Stimmung des Betroffenen:<br />
„Momentan führt das dazu, dass er jetzt wieder so ist, wie ich ihn seit 10 Jahren kenne: Ruhig,<br />
still und <strong>aus</strong>geglichen.“ (Herr K., 239-240)<br />
Diese gegensätzlichen Erfahrungen verdeutlichen, wie groß der mögliche Einfluss von<br />
Medikamenten ist, dass sie sehr hilfreich, aber auch sehr destruktiv sein können.<br />
Dementsprechend sollte sehr vorsichtig und überlegt mit ihnen umgegangen werden, so<br />
dass sich Menschen nicht wie Versuchskaninchen fühlen:<br />
✔<br />
„Und jeder versucht sich an ihm […] Klar, dann fällt das Wort Versuchskaninchen […] Das<br />
will er nicht mehr sein“ (Herr A., 544-548)<br />
Freiheit<br />
Der Zugewinn von Freiheit ist jedoch nicht nur ein Folgeaspekt der reduzierten<br />
Medikamentierung, sondern wird in den Interviews auch allgemein als gravierende<br />
Veränderung her<strong>aus</strong>gestellt:<br />
10 Auf die Veränderung Stabilität, die eng mit der veränderten Medikamentierung verbunden ist, wird im Folgenden<br />
gesondert eingegangen.<br />
59
5 Ergebnisse<br />
„So hat er, so offen und frei hat er noch nicht gelebt.“ (Herr A., 985)<br />
Auch Herr B. beschreibt seine Partnerin als „immer befreiter“ (91) und Herr A. fügt an<br />
anderer Stelle noch hinzu, dass sein Partner nun „unbefangen und frei“ lebt (992).<br />
✔<br />
Stabilität<br />
Wie schon angesprochen kann eine veränderte Medikamentierung zur Stabilisierung von<br />
Charaktereigenschaften führen (s. auch Medikamentierung), diese Erfahrung hat auch Herr<br />
B. gemacht:<br />
„Sie wird immer, auch von den Charakterzügen, immer stabiler. Also die waren, sie verändert<br />
sich nicht, die waren schon immer da, die waren bloß halt früher unterdrückt, ja? Und unter<br />
Medikamenten natürlich noch mehr als ohne.“ (Herr B., 91-93)<br />
Eine andere wichtige Art der Stabilisierung hat sich beim Partner von Herrn A. auch durch<br />
die Medikamentenreduktion eingestellt: Das große Problem der Müdigkeit tagsüber wurde<br />
damit gelöst und führte zur Normalisierung des Tagesrhythmus, was wiederum<br />
gemeinsame Aktivitäten des Paares ermöglichte und die Beziehung förderte.<br />
„Also wir können gemeinsam was unternehmen [...] und das ist alles miteinander wieder<br />
möglich, weil dieser Tagesablauf, der Tagesrhythmus wiederhergestellt ist.“ (Herr A., 177-180)<br />
Ein weiterer Aspekt von Stabilität besteht in der Abnahme von Krisen bzw. von ihrer<br />
Intensität im Sinne einer höheren Ausgeglichenheit. Herr A. beispielsweise kommt im<br />
Laufe des Interviews immer wieder auf diesen Punkt zu sprechen:<br />
„wir haben kaum noch Situationen, wo es kippt, sondern, so eher, so die Ansätze dazu“<br />
(Herr A., 1106-1107)<br />
An anderer Stelle spricht er davon, dass es nicht mehr „eskaliert“ (1780), Krisensituationen<br />
„beherrschbar“ (38) sind, es keine so „dramatischen Geschichten“ (878) oder „Abstürze“<br />
(1607) mehr gibt. Das Leben seines Partners verliefe nun nun eher in „Wellenform“ (876)<br />
statt „himmelhochjauchzend zu Tode betrübt“ (876). Herr M. äußert sich in ähnlicher<br />
Form: „Und dann hatte sich das ein bisschen beruhigt, entschärft“ (Herr M., 39-40)<br />
✔<br />
Umgang mit Krankheit<br />
In den Interviews mit den Angehörigen zeigte sich weiterhin, dass die Betroffenen im<br />
Laufe der Zeit einen Umgang mit der Krankheit finden, mit dem sie leben können. Dies<br />
geht u. a. mit einer Akzeptanz der Krankheit einher.<br />
„Er sagt: ,Ich habe diese Krankheit, ich muss damit leben und so wie ich es im Moment leben<br />
kann, ist es super'.“ (Herr A., 1613-1614)<br />
Diese Akzeptanz spiegelt sich auch in dem Ausspruch wider, dass die Krankheit „heute<br />
kein Thema mehr“ ist (1190) und dass Herr A.s Partner offener damit umgehen kann:<br />
60
5 Ergebnisse<br />
Also er nimmt sich selber auch nicht so ernst. Hat, geht auch mit seiner Krankheit anders um<br />
heute.“ (Herr A., 894-895)<br />
Es wird außerdem angestrebt, einen Umgang zu finden, der ein „normales“ Leben<br />
ermöglicht. Diesem Ziel sind Herr B. und seine Partnerin schon näher gekommen:<br />
„Ich bin mittlerweile bei ihr speziell ganz großer Hoffnung, dass sie ganz normal mit ihrer<br />
Krankheit leben kann, {auch} ein ganz normales Leben führt. Das wird auch heute noch<br />
zusehends besser, auch heute noch deswegen, weil sie schon enorme, gewaltige Schritte<br />
gemacht hat.“ (Herr B., 266-269)<br />
Darüber hin<strong>aus</strong> berichtet Herr B., dass sich ihr Umgang dahingehend verbessert hat, dass<br />
sie sich ihren Problemfeldern stellt und daran arbeitet (Herr B., 612).<br />
✔<br />
Lebenseinstellung<br />
Grundlegende Veränderungen gibt es auch im Bereich der Lebenseinstellung zu<br />
verzeichnen. Dies ist zum einen eine Veränderung der Prioritäten im Leben. Im<br />
Beruflichen hat bei der Partnerin von Herrn B. eine Umorientierung (751) von viel Geld<br />
verdienen zu wohl fühlen stattgefunden:<br />
„Und während vorher natürlich ihr ganzes Leben darauf <strong>aus</strong>gerichtet war: ich muss genug<br />
Geld verdienen, um meine Krankheit bedienen zu können [...] Jetzt ist der Fokus mehr so: Nein,<br />
ich muss mich wohl fühlen“ (Herr B., 764-766)<br />
Zum anderen ist es eine wiedergewonnene Offenheit dem Leben gegenüber, die durch ein<br />
Grundvertrauen in Mitmenschen erst möglich wird.<br />
„Ja, das ist. es ist jetzt seine Offenheit. Völlig vorbehaltlos in Situationen gehen zu können<br />
ohne diese Gedanken zu haben: Die wollen mir alle was.“ (Herr A., 926-927)<br />
Konkret bedeutet das in diesem Fall, wieder mehr Menschen am eigenen Leben teilhaben<br />
zu lassen (Herr A., 942-944) und mit positiver Erwartungshaltung auf Menschen<br />
zuzugehen.<br />
✔<br />
„Ja, völlig verändert. Ja, die kennen ihn teilweise nicht wieder. Er ist ein lebensfroher Mensch,<br />
er war früher eher introvertiert“ (Herr A., 999-1000)<br />
Eigenständigkeit<br />
In unterschiedlichen Facetten zeigt sich immer wieder die wachsende Eigenständigkeit der<br />
Betroffenen. Zunächst einmal gründet diese auf dem eigenen Willen und somit der<br />
Fähigkeit, eigene Entscheidungen zu treffen.<br />
„der erste Wille, den sie dann wieder hatte, der erste freie und feste Wille, den sie auch<br />
durchgesetzt hat“ (Herr B., 610-612)<br />
Außerdem ist ein starker Wille ein Motivator, der dabei hilft, die gesteckten Ziele auch<br />
umzusetzen. So schafft es die Partnerin von Herrn B. beispielsweise mit einem<br />
„unbändigen Willen“, ihren Aktionsradius zu vergrößern (781-783), <strong>aus</strong> „freier<br />
61
5 Ergebnisse<br />
Entscheidung“ den Beruf <strong>aus</strong>zuüben, der ihr gut tut (755-756), oder auch mal ganz spontan<br />
etwas allein zu unternehmen:<br />
„ohne vorher zu planen. Mal zu sagen: ,So Freund, ich gehe jetzt mal ohne dich los.' […]<br />
Eigentlich macht sie das schon ganz viel, […] auch Sachen, vor denen sie früher Panik gehabt<br />
hätte“ (Herr B., 785-789)<br />
Insgesamt führt dies zu einer größeren Selbstständigkeit bzw. Unabhängigkeit, die vom<br />
Angehörigen beobachtet werden kann:<br />
„also sie ist sehr selbstständig geworden“ (Herr B., 809)<br />
„Es ist auch der Wille, absolut unabhängig zu sein.“ (Herr B., 784)<br />
Von einer größeren Selbstständigkeit zeugt auch das Suchen und Annehmen von Hilfe, im<br />
Beispiel von wichtigen Entscheidungen, sowie Nein sagen zu können (Herr A., 1407-1410;<br />
1432-1433).<br />
✔<br />
„Er konsultiert, er macht das jetzt nicht mehr mit sich selbst <strong>aus</strong>.[...]Und das hilft natürlich<br />
auch seiner Selbstständigkeit. Gute Erfahrungen zu machen [...]Und er hat, ist heute auch in<br />
der Lage zu sagen, in bestimmten Situationen: Nein. Er konnte ganz schlecht ,nein' sagen<br />
früher.“ (Herr A., 1377-1386)<br />
Lebensqualität<br />
Mit neuen Perspektiven, einem verbesserten Problembewusstsein und -verständnis,<br />
veränderter Medikamentierung, mehr Freiheit und Stabilität, verbessertem Umgang mit der<br />
Krankheit, einer veränderten Lebenseinstellung und mehr Eigenständigkeit steigert sich<br />
auch die Lebensqualität insgesamt. Diese ergibt sich jedoch nicht nur <strong>aus</strong> der Bündelung<br />
der genannten einzelnen Veränderungen, sondern wird auch direkt, wie im folgenden Zitat,<br />
angesprochen (s. a. Herr A., 1180).<br />
„Und das ist jetzt ganz anders, also die Lebensqualität für ihn ist auch wirklich gestiegen.“<br />
(Herr A., 920-921)<br />
5.1.3 Veränderungen bei Angehörigen<br />
Wenn Angehörige stark in den Begleitungsprozess eines <strong>Versorgung</strong>sangebotes<br />
eingebunden sind, hat dieser auch großen Einfluss auf ihr Leben.<br />
„Ja, es ist schon, ja, auch als Angehöriger eine unglaubliche Erfahrung, sowas erleben zu<br />
können.“ (Herr A., 1712-1713)<br />
In den Interviews wurde berichtet, dass BezugsbegleiterInnen nicht nur für die<br />
Betroffenen, sondern auch für Angehörige als Unterstützung empfunden werden. Frau D.<br />
beispielsweise fühlt sich in ihrer schwierigen Position ihrem Ehemann gegenüber<br />
unterstützt und nicht mehr so allein:<br />
62
5 Ergebnisse<br />
✔<br />
„Mensch, endlich ist mal einer da, der ihm das von der anderen Seite sagt und nicht nur ich“<br />
(Frau D., 136-137)<br />
Informierte Angehörige<br />
Wenn man als Angehöriger zum ersten Mal mit einer Diagnose seines Angehörigen<br />
konfrontiert wird, entstehen 1000 Fragen im Kopf: Was verbirgt sich hinter diesem Begriff,<br />
welche Auswirkungen hat dies auf meinen Angehörigen, welche auf unsere Beziehung, wie<br />
gehe ich damit um? So erging es auch Herrn A., der darauf zunächst keine hilfreichen<br />
Antworten fand.<br />
„Er hat mir [...] erzählt: ,Du, ich leide an paranoider Schizophrenie.' Ich so: ,Ja, okay.'[...] Ich<br />
nach H<strong>aus</strong>e, gegoogelt: Was ist das? […] Ja, und denn guckt man und recherchiert und man<br />
fragt 100 Leute, kriegt 120 Meinungen und [...] und nichts, was man wirklich zuordnen kann“<br />
(Herr A., 1318-1327)<br />
Das NWpG konnte ihm schließlich wichtige Informationen vermitteln, durch die er ein<br />
besseres Verständnis für die Krankheit entwickelte. Dabei war für ihn die Abgrenzung von<br />
störungsbedingtem Verhalten besonders wichtig. Das heißt, es war oft schwer zu<br />
unterscheiden, welches Verhalten tatsächlich auf die eigene Person bezogen ist und<br />
welches „mit dieser Erkrankung zu tun“ hat (Herr A., 1332). Bei dieser schwierigen<br />
Abgrenzung gaben die BezugsbegleiterInnen immer wieder Rückbestätigung:<br />
„Und auch von den beiden immer wieder mal gesagt zu kriegen[...]: Das ist seine Krankheit.<br />
[…] Am Anfang bezieht man das natürlich alles auf sich. Man hat ja auch keine andere<br />
Möglichkeit, wenn man das nicht einschätzen kann. Man stellt den Zusammenhang auch nicht<br />
her. Aber da, sind die beiden wirklich eine große Hilfe“ (Herr A., 835-847)<br />
Wie wichtig diese Einschätzung für Herrn A. war, macht er mit dem folgenden Zitat<br />
überdeutlich:<br />
„Ohne diese Information führt das natürlich dazu, dass eine Beziehung gen<strong>aus</strong>o schnell<br />
beendet, ist wie sie begonnen hat.“ (Herr A., 361-363)<br />
Insgesamt führt die Informationsvermittlung und das bessere Verständnis dazu, einen<br />
Umgang mit der Erkrankung zu finden. Für Herrn A. beinhaltet dies im Besonderen zu<br />
akzeptieren, dass sich sein Partner in bestimmten Situationen an erster Stelle an<br />
Professionelle und nicht an ihn wendet.<br />
✔<br />
„zu dieser Krankheit gehören eben auch Beziehungspersonen, die daran teilhaben […] , die in<br />
bestimmten Dingen, von ihm frei gewählt, seine Vertrauten in der Situation sind“<br />
(Herr A., 1719-1728)<br />
Umgang Krise<br />
Nach teils jahrelanger persönlicher Erfahrung und mit beständiger Unterstützung durch die<br />
BezugsbegleiterInnen haben einige der Angehörigen beeindruckende Fähigkeiten im<br />
Umgang mit den Krisen ihrer Betroffenen erlernt. Dazu gehört unter anderem eine<br />
63
5 Ergebnisse<br />
wachsende Routine im Umgang mit Krisen („wie im Uhrwerk“ Herr B., 251). Eine weitere<br />
Fähigkeit ist eine Sensibilität für Krisen, die der oder dem Angehörigen ermöglicht,<br />
Anzeichen für Krisen vorzeitig wahrzunehmen und so zu reagieren, dass sich diese<br />
teilweise vermeiden lassen (Prävention).<br />
„die Antennen werden immer sensibler. Also ich kriege es heute viel früher mit, wenn etwas<br />
nicht läuft (..) und das entkrampft natürlich auch und entspannt“ (Herr A., 1778-1780)<br />
In den Interviews kristallisierte sich die Fähigkeit, eine Gelassenheit selbst im Auge einer<br />
heftigen Krise zu bewahren, als besonders hilfreich her<strong>aus</strong>.<br />
„Man wird als Angehöriger gelassen oder gelassener. Nein, man wird extrem gelassen. Also, es<br />
gab jetzt mehr als eine Situation, wo man denn so, wo ich denn so sagte und sie mit den<br />
Schultern zuckte und sagte:"Naja, ok."“ (Herr B., 532-534)<br />
Von dieser Gelassenheit profitieren sowohl Angehörige als auch Betroffene:<br />
„Diese Ruhe und Gelassenheit (...) ist auch übrigens sehr hilfreich für Y [Betroffene],<br />
logischerweise.“ (Herr B., 584)<br />
Herr B. vergleicht diese gelassene Haltung mit der Grundhaltung eines Rettungshelfers<br />
und verdeutlicht damit, dass man Gefahrensituationen - physischer und psychischer Natur -<br />
am besten mit deren Gegenpol, nämlich der Ruhe, begegnet:<br />
„So bei einer Psychose nicht gleich in Panik zu verfallen. [...] Das erste, was man als Sanitäter<br />
lernt, ist übrigens: ruhig bleiben, durchatmen und an die eigene Sicherheit denken.[...] Also<br />
wenn ich an einen Unfall rankomme oder an andere Stresssituationen: Dann erst mal<br />
durchatmen. [...] dank der <strong>Krisenpension</strong> habe ich auch da wieder gelernt. Also irgendwann<br />
habe ich Y mal vom Zug abgeholt und sie war mittendrin in einer Psychose. Und (lachend) die<br />
erste Reaktion war: ,Ok. Ist mal wieder so weit.' (lacht) ja? Anstatt ,Oh Gott, Hilfe, was<br />
machen wir jetzt?'“ (Herr B., 240-250)<br />
Auch Herr A. berichtet davon, dass er gelernt hat, gelassener mit schwierigen Situationen<br />
umzugehen. Dabei hat besonders geholfen, dass ihm die BezugsbegleiterInnen dies auch<br />
vorgelebt haben.<br />
„und da habe ich es dann, auch durch dieses Vorgehen, was mir Frau X und Herr Y<br />
[BezugsbegleiterInnen] vorleben, wenn solche Krisensituationen waren. Ganz cool genommen<br />
und gesagt: "Komm, wir gehen erst einmal eine rauchen.“ (Herr A., 1769-1770)<br />
Besonders eindrucksvoll veranschaulicht Herr B., wie Gelassenheit auf krisenhafte<br />
Situationen wirken kann, als er das folgende Erlebnis schildert:<br />
„Da gibt es so eine ganz lustige Geschichte. [...] also ich kam da von, auf die <strong>Krisenpension</strong> zu<br />
und vor der <strong>Krisenpension</strong>, habe ich schon gesehen, wild gestikulierende Eltern. […] Eine<br />
Psychologin [...] plus 2 Bewohner der <strong>Krisenpension</strong>. […] In großer Aufgeregtheit wurde mir<br />
dann erzählt: ,Ja, Y ist weg!' (weinerliche Stimme) (..) So, man wird wirklich gelassener, mein<br />
1. Gedanke war: Die Frau ist 34, warum soll die nicht weg gehen dürfen? ,Mit einem<br />
Morgenmantel, in Badelatschen und einer Kaffeetasse in der Hand!' (weinerliche Stimme) -<br />
,Dann bin ich beruhigt.' (lacht) Weil: Mit Badelatschen läuft sie nicht gerne lange herum und<br />
spätestens, wenn die Kaffeetasse alle ist, kommt sie zurück und holt sich Nachschub (lachend).<br />
Und im Morgenmantel hat sie bestimmt kein Geld dabei, um sich {welchen} zu kaufen. So.“<br />
(Herr B., 537-555)<br />
64
5 Ergebnisse<br />
Dass Herr B. diese Begebenheit als „eine ganz lustige Geschichte“ bezeichnet, macht<br />
deutlich, dass die Bewertung einer Situation den entscheidenden Unterschied für seinen<br />
Ausgang machen kann.<br />
5.1.4 Veränderungen in der Betroffenen-Angehörigen-Beziehung<br />
✔<br />
Problembewusstsein und -verständnis<br />
Im Zentrum der von Herrn M. wahrgenommenen Veränderungen steht ein neues<br />
Bewusstsein über ursächliche Zusammenhänge von Beziehungsschwierigkeiten:<br />
„Was sich am meisten verändert hat, ist, würde ich sagen, das Bewusstsein um diese Dinge, wie<br />
bestimmte Sachen zusammen hängen, bestimmte Verhaltensmuster, Mechanismen in der<br />
Beziehung, miteinander wie man manchmal wirkt, ja, durch bestimmte Dinge. Also man ist,<br />
glaube ich, ein bisschen reflektierter als sonst“ (Herr M., 344-347)<br />
Über Veränderungen auf Verhaltensebene lässt sich sagen, dass bevor sich das eigene<br />
Verhalten ändern kann, ein Bewusstsein für das Problem an sich und ein Verständnis für<br />
dessen Ursache vorhanden sein muss. Folglich sind diese Erkenntnisse auf gedanklicher<br />
Ebene die erste Vor<strong>aus</strong>setzung für alle weiteren Veränderungen. Dies gilt nicht nur für<br />
Veränderungen bei Betroffenen, bei denen sich diese Veränderung auch fand, sondern<br />
besonders bei Veränderungen auf Beziehungsebene. Eine Beziehung äußert sich nämlich<br />
zu großen Teilen auf Verhaltensebene, der sozialen Interaktion. Deshalb ist ein solches<br />
Verständnis über die Problemzusammenhänge unerlässlich für Veränderungen in der<br />
Beziehung.<br />
„Ja, wichtig ist, dass man sich dessen bewusst ist und [...] wenn man sich dann in<br />
Alltagssituationen dieser Gespräche wieder bewusst wird, dann hat man auch die Chance,<br />
etwas zu verändern in seinem Verhalten“ (Herr M., 210-215)<br />
Herr M. spricht dabei aber auch die damit verbundene große Her<strong>aus</strong>forderung an, die<br />
gewonnenen Erkenntnisse im Alltag immer präsent zu haben und umzusetzen, so dass<br />
langfristig ein neues Verhaltensmuster entstehen kann:<br />
✔<br />
„aber das umsetzen ist natürlich nach wie vor das größere Problem. Alle diese Dinge so immer<br />
präsent zu halten, [...] und um nicht wieder in diesen alten Mechanismus und dieses alte<br />
Muster zurück zu fallen“ (Herr M., 349-354)<br />
Konfliktbewältigung<br />
In einigen der Fälle spielt die Partnerschaft der Betroffenen eine zentrale Rolle in der<br />
Begleitung durch das NWpG. Dementsprechend wurde der Fokus darauf gelegt,<br />
gemeinsam an dieser Beziehung zu arbeiten. Die Partner der Betroffenen äußerten sich in<br />
den Interviews sehr positiv über das Ergebnis dieser Arbeit. Situationen, die die Beziehung<br />
belasten, hätten „dramatisch abgenommen“ (Herr A., 787) und die Beziehung habe sich<br />
65
5 Ergebnisse<br />
allgemein „harmonisiert“ (Herr M., 377). Im Speziellen wurde berichtet, dass sich die<br />
Konfliktbewältigung verbessert hat, vor allen Dingen durch eine gute partnerschaftliche<br />
Kommunikation wie beispielsweise Herr A. im Folgenden beschreibt:<br />
„Und er äußert heute auch mir gegenüber, was er vor 2 Jahren nicht konnte, seine<br />
Befindlichkeit und sagt: ,Du, damit fühle ich mich jetzt nicht so wohl. Können wir da morgen<br />
drüber reden?' - ,Na klar, könn' wir.' (Herr A., 1197-1200)<br />
„reden! Nur ein Signal, ein Signal reicht, ein halber Satz, eine SMS, eine kurze~ Email, setzt<br />
jeden davon in Kenntnis und keiner ist irgendwie böse“ (Herr A., 1201-1205)<br />
Hilfreich für das Lösen von partnerschaftlichen Konflikten war weiterhin die<br />
Konfrontation mit den Problemen, die Anstoß zur Handlung und Verantwortungsübernahme<br />
gibt.<br />
„,Ja, da ist ein Problem, das musst du lösen und du musst etwas tun.' “ (Herr M., 192-193)<br />
„also man konfrontiert jemanden auch mit bestimmten Dingen, um einfach auch auf den Kern<br />
zu kommen und eruieren zu können: Was können wir denn wirklich machen? Warum ist das so?<br />
Wie kann ich das verändern? Und dafür musste natürlich auch Tacheles geredet werden, aber<br />
jetzt in ganz normalen Tonfall, sachlich“ (Herr M., 180-181)<br />
So ein Handlungsanstoß ist besonders dann von Nutzen, wenn die Konflikte in der<br />
Partnerschaft nur schwer thematisiert und bearbeitet werden können:<br />
„das hat vielleicht auch dazu geführt, dass sie diese Themen auch nicht innerhalb der<br />
Beziehung lösen konnte, sondern einfach über 3. das machen musste, was nicht unüblich ist,<br />
weil man kann bestimmte Dinge einfach nicht innerhalb der Beziehung machen“<br />
(Herr M., 259-262)<br />
Um ein anschauliches Beispiel für eine so angestoßene Veränderung auf Beziehungsebene<br />
zu geben, sei folgender Lösungsansatz von Herrn M. genannt, das Problem seiner<br />
Überstunden und der dar<strong>aus</strong> resultierenden häufigen Abwesenheit anzugehen:<br />
„Also ich schon nur noch leicht über dem Soll sozusagen arbeite. Und das heißt ich komme<br />
also da deutlich eher nach H<strong>aus</strong>e und zeige dann Präsenz und habe auch die Möglichkeit an<br />
anderen alltäglichen Dingen teilzunehmen, die vorher an mir vorbei gegangen sind und die<br />
jemand anders dann erledigt hat, nämlich meine Frau in der Regel, und was dann wiederum zu<br />
Überforderung geführt hat oder zu ja, Missmutigkeit, weil sie eben alles machen musste. Und<br />
da sind wir auf einem guten Weg, dass wir an diesem kleinen Punkt zum Beispiel schon<br />
Veränderungen spüren“ (Herr M., 225-231)<br />
5.2 K2 Hindernisse<br />
Unter den InterviewpartnerInnen gab es auch Fälle, bei denen es wenig bzw. keine<br />
Veränderungen zu berichten gab. Die Daten dieser Interviews erwiesen sich aber dennoch<br />
als wertvoll, da sie Aufschluss über mögliche Hindernisse geben, die dem Nutzen des<br />
Angebotes im Weg stehen können und Veränderung verhindern.<br />
66
5 Ergebnisse<br />
5.2.1 Drei Haupthindernisse<br />
Aus diesen Interviews ergaben sich die drei folgenden Haupthindernisse:<br />
1) fehlende Einsicht<br />
2) fehlender Veränderungswille und mangelnde Verantwortungsübernahme<br />
3) Passivität bzw. externe Verantwortungsüberzeugung<br />
1) Fehlende Einsicht<br />
Fehlende Einsicht bedeutet, dass die bzw. der Betroffene selber nicht davon überzeugt ist,<br />
dass sie bzw. er Hilfe braucht. Die Frage, ob tatsächlich ein Hilfebedarf gegeben ist oder<br />
nicht, spielt dabei keine Rolle (Frage des „Recht-habens“). Entscheidend ist lediglich, dass<br />
Hilfebedarf bei sich gesehen wird, um offen für Hilfe zu sein. Dieses Hindernis lässt sich<br />
noch direkter als interne Überzeugung in Form der wörtlichen Rede <strong>aus</strong>drücken. Die<br />
interne Überzeugung lautet dann: Ich brauche keine Hilfe bzw. mich betrifft das nicht. Die<br />
Reaktion eines Betroffenen nach Erhalt des Informationsschreibens über das NWpG<br />
veranschaulicht eine solche Überzeugung:<br />
„Er hat es aufgemacht und gelesen und einfach so auf den Tisch gelegt, so nach dem Motto -<br />
Als ich fragte ,Was ist denn das?' -,Och, ich weiß gar nicht, was die von mir wollen. Die sollen<br />
mich in Ruhe lassen!' “ (Frau D., 57-60)<br />
Wenn die Notwendigkeit für Hilfe von Betroffenen selbst nicht gesehen wird, werden sich<br />
diese auch nicht richtig auf einen Hilfeprozess einlassen.<br />
„die Notwendigkeit {von Treffen} in regelmäßigen Abständen, das gar nicht so gesehen hat“<br />
(Frau D., 89-90)<br />
„Also er selber hatte nicht das Bedürfnis, dass die wieder kommen.“ (Frau D., 91-92)<br />
Das kann dann dazu führen, dass, wie im folgenden Beispiel, ein Betroffener sich zwar<br />
gern Informationen zum Thema anhört, diese aber nicht auf sich selbst bezieht. Dies<br />
entspricht der Überzeugung: Das betrifft mich nicht.<br />
„,Die anderen ja, aber ich ja nicht. Es ist interessant darüber was zu wissen, aber ich, für mich<br />
nicht.' Ja. ",ich für mich nicht.'" (Frau D., 190-191)<br />
Einen Grund für diese Haltung ihres Mannes sieht Frau D. in seiner Krankheit selber, die<br />
es ihm erschwere, die eigene Betroffenheit zu akzeptieren. Sie erhofft sich jedoch, dass<br />
sich diese Schwierigkeit mit genügend Zeit auflösen lässt.<br />
„Also ich glaube, dass ist sowieso die Schwierigkeit bei dieser Erkrankung, dass man das<br />
selber nicht annehmen will und dass der Zeitfaktor da also erst die ganze Sache so ins rollen<br />
bringt, dass man das selber akzeptiert.“ (Frau D., 185-188)<br />
67
5 Ergebnisse<br />
2) Fehlender Veränderungswille und mangelnde Verantwortungsübernahme<br />
Fehlender Veränderungswille bedeutet, dass die bzw. der Betroffene selber gar keine<br />
Veränderung will, sondern diese nur um anderer Menschen Willen anstrebt.<br />
„Er lässt es sich gefallen, weil er vielleicht auch spürt, dass ich es möchte. Also insofern denke<br />
ich, dass er mir zu Gefallen das doch mehr macht als dass er für sich einen Gewinn dar<strong>aus</strong><br />
zieht.“ (Frau D., 488-490)<br />
Unter mangelnder Verantwortungsübernahme ist weiterhin zu verstehen, dass die bzw. der<br />
Betroffene die Verantwortung für die Veränderung an andere abgibt, sich Veränderungsanstrengungen<br />
also von anderen abnehmen lässt.<br />
„,Na, hast du denn schon mal Kontakt aufgenommen? Du solltest doch auf jeden Fall Bescheid<br />
geben.' und so ja? - ,Nö.' - [...] Ich habe erst mal dort angerufen“ (Frau D., 65-68)<br />
Als interne Überzeugung ergibt sich das Hindernis: Ich will selber keine Hilfe bzw. ich<br />
mache das nur für die anderen. Wichtig anzumerken ist, dass hier zwar die Einsicht<br />
vorhanden sein kann, dass man Hilfe braucht, man diese Hilfe aber nicht (für sich selbst)<br />
will. Problematisch daran ist, dass so lange die Motivation an eine andere Person gebunden<br />
ist, die Anstrengungen zur Veränderung auch nur so lange erhalten bleiben, wie diese<br />
Person präsent ist. Nachhaltige Veränderungen rücken damit in weite Ferne.<br />
„Ich will, dass er von sich <strong>aus</strong> was macht und nicht unter dem Druck: Jetzt kommt die Frau und<br />
will sehen, ob er was geschafft hat“ (Frau D., 814-816)<br />
Da Angehörige häufig stark durch die Situation der Betroffenen mitbelastet werden, haben<br />
sie eine große Motivation, aktiv an der Veränderung mitzuwirken.<br />
"Mensch, nimm doch erst mal teil. Absagen kannst du immer noch. Du weißt doch noch gar<br />
nicht, was sich dahinter verbirgt. Ich kann mir das gut vorstellen und nötig wäre es auch, für<br />
uns beide.“ (Frau D., 61-64)<br />
Die Mithilfe der Angehörigen ist ohne Frage von großer Bedeutung und eine zentrale<br />
Ressource. Dabei ist anzumerken, dass ein großes Engagement möglicherweise ab einem<br />
gewissen Grad dahin umschwenken kann, dass es für den Betroffenen eher dazu führt,<br />
selbst weniger Verantwortung für den Veränderungsvorgang zu übernehmen.<br />
3) Passivität bzw. externe Veränderungsüberzeugung<br />
Passivität leitet sich u. a. <strong>aus</strong> externer Veränderungsüberzeugung ab, denn wenn jemand<br />
der Überzeugung ist, dass Hilfe und Veränderung von außen kommen, bleibt die- bzw.<br />
derjenige passiv im Veränderungsprozess. Die interne Überzeugung ist folglich: Ich<br />
brauche nicht aktiv zu werden, die Hilfe kommt von außen.<br />
„konnte sie in der Zeit wahrscheinlich wenig mit dem was anfangen, was ihr gesagt wurde, weil<br />
sie von außen was erwartet“ (Frau T., 208-209)<br />
68
5 Ergebnisse<br />
Eine Form der externen Hilfe können zum Beispiel Medikamente sein.<br />
„aber ich erwarte nicht, das nur von Tabletten, sondern - Und, aber sie glaubt daran und sie<br />
sagt immer wieder: Die Ärzte haben noch nicht, ja,das richtige Medikament“<br />
(Frau T., 194-196)<br />
Auch die Annahme einer ärztliche Expertise, die ohne Aust<strong>aus</strong>ch mit den Betroffenen<br />
<strong>aus</strong>kommt, kann zur Folgerung führen, nicht aktiv werden zu müssen.<br />
„Ich muss nicht mit ihnen reden, die gucken mich an und die wissen schon, was ich brauche.“<br />
(Frau T., 244-245)<br />
Frau T. nimmt genau diese externen Veränderungsüberzeugungen als Grund dafür an, dass<br />
ihre Tochter nicht mehr vom NWpG profitieren konnte.<br />
„Ich glaube, es hing einzig und allein mit der Einstellung meiner Tochter (zusammen).“<br />
(Frau T., 503-504)<br />
Als mögliche Erklärung für die Entstehung dieser Überzeugungen nennt Frau T. die<br />
langjährige Erfahrung in psychiatrischen Kliniken, in denen sich ihre Tochter an ihre<br />
passive Rolle gewöhnt hat.<br />
„dass man mehr mit den Patienten redet (..), so dass sie sich daran gewöhnen, nicht so wie bei<br />
meiner Tochter. 10 Jahre gewöhnt sie sich an diese Routine, gewöhnt sich da so an die<br />
allmächtigen Ärzte. (Sieht) sie als erfahrene Ärzte und (denkt) die werden sie retten, die werden<br />
irgendwann auf die richtige Pille kommen und wenn sie diese Pille genommen hat, sind alle<br />
Probleme gelöst“ (Frau T., 627-632)<br />
5.2.2 Weitere Hindernisse<br />
Aber auch wenn diese Haupthindernisse überwunden sind, gibt es weitere Hindernisse, die<br />
die Veränderung dennoch blockieren können.<br />
4) Fehlender Glaube an Veränderung<br />
Selbst wenn Betroffene der Ansicht sind, eine Veränderung zu benötigen, diese auch<br />
wollen und bereit sind aktiv dafür einzutreten, kann fehlender Glaube daran, dass die<br />
Veränderung auch möglich ist, diese scheitern lassen.<br />
„-,Ach, der hat das ja bloß 10 Jahre gehabt. Da kann er ja schnell drüber hinwegkommen!<br />
Aber ich mit meinen 25 Jahren, der ich schon an dieser Krankheit leide. Ich packe das nicht<br />
mehr'-“ (Frau D., 128-130)<br />
5) Misstrauen und Kontrahaltung<br />
Weiterhin stoppen kann den Veränderungsprozess ein Misstrauen von Betroffenen der<br />
Hilfssituation gegenüber, im Besonderen, wenn keine Vertrauensbasis mit den<br />
Hilfspersonen zustande kommt. Ein allgemeines Misstrauen kann sich zunächst in einer<br />
grundlegenden Kontrahaltung (Frau D., 74; 110) äußern, die es verhindert, sich auf die<br />
Hilfssituation einzulassen.<br />
69
5 Ergebnisse<br />
„er war erst mal kontra“ (Frau D., 64)<br />
„er immer wieder skeptisch“ (Frau D., 76)<br />
Eine fehlende Vertrauensbasis kann sich zum Beispiel in einer mangelnden Anerkennung<br />
bzw. Überzeugung von fachlicher Kompetenz äußern.<br />
„Also er erkennt junge Leute nicht gleich fachlich kompetent an“ (Frau D., 76-79)<br />
Durch stetigen Beziehungsaufbau lässt sich diese Skepsis jedoch überwinden.<br />
„Also er hat in dem Herrn W [Bezugsbegleiter]. jetzt auch den Partner, den er akzeptiert,<br />
gefunden.“ (Frau D., 132)<br />
„Und von daher denke ich, dass der Herr W. der Partner sein wird, der auf jeden Fall dieses<br />
Kontra abgebaut hat, ja?“ (Frau D., 110-111)<br />
Die Vertrauensbeziehung zu Hilfspersonen wie BezugsbegleiterInnen ist demnach von<br />
zentraler Bedeutung dafür, ob sich Betroffene auf die gemeinsame Arbeit am<br />
Veränderungsprozess einlassen. Mit beginnendem Vertrauen stellt sich auch die Hoffnung<br />
ein, dass diese gemeinsame Arbeit zukünftig möglich wird.<br />
„Wenn er es besser annimmt. Noch ist er glaube ich nicht so weit. Wenn er es besser annimmt<br />
und sich da auch einbinden lässt in regelmäßige Besuche.“ (Frau D., 759-760)<br />
Eine gravierende Blockade kann auch ein „Loyalitätsproblem“ (Frau T., 139) zwischen<br />
Professionellen darstellen. Dieses entsteht, wenn Professionelle, die bereits eine gute<br />
Vertrauensbasis zu den Betroffenen aufgebaut haben, trotz fehlenden Wissens<br />
„vernichtende Urteile“ (Frau T., 136) über die anderen Professionellen <strong>aus</strong>sprechen und<br />
den Betroffenen vom fremden Hilfsangebot abraten.<br />
„Und ja, ungünstigerweise hat ihr Therapeut große große Widerstände geleistet. Die habe<br />
solche Vorurteile gegenüber (der) <strong>Krisenpension</strong> und auch ihre Neurologin, also die, die<br />
Medikamente verschreibt.“ (Frau T., 89-91)<br />
Solche Einwände einer professionellen Vertrauensperson führen bei Betroffenen schnell zu<br />
Misstrauen und einem Vertrauenskonflikt zwischen den verschiedenen Professionellen. Die<br />
Mutter einer Betroffenen wundert sich über dieses Verhalten, da es die doch eigentlich<br />
allerseits angestrebte Veränderung blockiert.<br />
„Ja, der erste {wollte es} blockieren. Warum? Aber es war - und ich kann es mir vorstellen,<br />
dass die beiden meine Tochter in eine große Konfliktsituation gebracht haben“ (Frau T., 98-99)<br />
Zusätzliche Faktoren<br />
Über die genannten möglichen Hindernisse hin<strong>aus</strong>, können je nach spezifischen<br />
Umständen alle möglichen Faktoren ein Hindernis darstellen. Der Faktor Zeit kann zum<br />
Beispiel eine Rolle spielen, wenn das Timing schlecht ist.<br />
70
5 Ergebnisse<br />
„Bloß er [Bezugsbegleiter] hatte in der Zeit Urlaub genommen und dieses Treffen wurde für<br />
Ende Mai, denke ich, oder Mitte Mai (abgemacht). Und schon Anfang Mai ging es ihr ganz<br />
schlecht und schon Anfang Mai musste die Entscheidung getroffen werden.“ (Frau T., 107-109)<br />
Allein, dass ein Hilfsangebot sich von Erfahrungen mit bisherigen Angeboten<br />
unterscheidet, kann abschreckend wirken. Dies kann dazu führen, dass Betroffene sich<br />
lieber für Gewohntes entscheiden anstatt zu vergleichen und sich für das beim Vergleich<br />
besser abschneidende Angebot zu entscheiden.<br />
„Sie kennt die, es [stationäre <strong>Versorgung</strong>] ist etwas vertrauter.“ (Frau T., 85)<br />
Möglicherweise sind auch hohe Erwartungen („große Hoffnung“, Frau T., 501) hinderlich,<br />
die bei nicht schnell eintretenden Erfolgen schnell in Enttäuschung umschlagen können.<br />
„Also ich glaube nicht, dass das für sie eine unangenehme Erfahrung war, aber (es) war für sie<br />
sehr belastend, dass vielleicht unsere Erwartungen viel zu groß waren.“ (Frau T., 437)<br />
5.3 K3 Hilfreiche Konzepte<br />
In der folgenden Kategorie 3 hilfreiche Konzepte werden grundlegende Haltungen und<br />
konkrete Arbeitsweisen des NWpG vorgestellt, die die InterviewpartnerInnen als hilfreich<br />
erlebt haben. Aus den Interviews ergaben sich Konzepte sowohl auf der eher abstrakten<br />
Ebene der Haltungen, in denen sich ein bestimmtes Menschenbild widerspiegelt, als auch<br />
auf der konkreteren Ebene der Arbeitsweisen. Beides konnte von den InterviewteilnehmerInnen<br />
durch die BezugsbegleiterInnen des NWpG und meist in der Situation des<br />
Netzwerkgespräches erlebt werden. Abbildung 3 stellt alle Komponenten der Kategorie 3<br />
dar.<br />
grundlegende Haltungen<br />
➢ Orientierung an individuellen<br />
Bedürfnissen<br />
➢ Mitbestimmung der NutzerInnen<br />
➢ Förderung der Eigenständigkeit<br />
Arbeitsweisen<br />
➢ Zuhören & Zeit nehmen<br />
➢ Alltagstipps<br />
➢ Blick in die Zukunft<br />
➢ Ganz Normales<br />
➢ Ständige Erreichbarkeit &<br />
schnelle Hilfe<br />
➢ Angehörige einbeziehen<br />
Vermittlung<br />
➢<br />
➢<br />
Netzwerkgespräche<br />
BezugsbegleiterInnen<br />
Abbildung 3. K3 Hilfreiche Konzepte<br />
71
5 Ergebnisse<br />
5.3.1 Grundlegende Haltungen<br />
In den Interviews zeigte sich, dass Angehörige bestimmte grundlegende Haltungen in der<br />
Arbeit mit dem NWpG als förderlich empfanden. Ihnen fiel positiv auf, dass sich die<br />
Begleitung an den individuellen Bedürfnissen der NutzerInnen orientiert, letztere eine<br />
Mitspracherecht in der Begleitung erhalten und über wichtige Schritte entscheiden können.<br />
Darüber hin<strong>aus</strong> befürworteten sie die Haltung, dass die NutzerInnen dazu ermutigt werden,<br />
möglichst aktiv und eigenständig zu bleiben bzw. zu werden.<br />
➢ Orientierung an individuellen Bedürfnissen<br />
Aus den Erfahrungen, die die InterviewpartnerInnen mit dem NWpG gemacht haben,<br />
gewannen sie den Eindruck, dass dort der „Erkrankte im Mittelpunkt steht“ (Herr A., 1540-<br />
1541). Dar<strong>aus</strong> leitet sich ab, dass die Begleitung „total flexibel“ (Herr M., 85) auf die bzw.<br />
den Betroffene/n „zugeschnitten“ (Herr A., 1115) wird. Dafür werden die Behandlungskomponenten<br />
und richtigen Partner für jeden individuell gesucht, so dass ein<br />
„ganzheitliches“ und „umfassendes“ Angebot entsteht (Herr A., 1671-1675). Diese<br />
„maßgeschneiderte Lösung“ (Herr A., 1152) ermöglicht ganz unterschiedliche Angebote<br />
mit nutzerspezifischem Ziel bzw. Fokus. Als Gegensatz zur im NWpG erlebten<br />
individuellen Herangehensweise stellen die interviewten Angehörigen dieser eine<br />
Behandlung nach „Schema F“ (Herr B., 378) gegenüber. Damit ist eine Standardbehandlung<br />
gemeint, in der keine flexible Anpassung an die unterschiedlichen Bedürfnisse<br />
von Menschen vorgesehen ist.<br />
„Also ich denke, da ist so das klassische Muster, mal drüber gelegt worden irgendwann und ja<br />
erst diese ganz individuelle Betreuung, wie er sie beim Netzwerk erfährt, hat ihm die<br />
Lebensqualität zurück gebracht.“ (Herr A., 1178-1180)<br />
Durch diese Gegenüberstellung von individueller und Standardbehandlung verdeutlichen<br />
die Angehörigen das für sie Neue und Besondere am Ansatz des NWpG im Vergleich zu<br />
ihren bisherigen Erfahrungen <strong>aus</strong> dem klassisch psychiatrischen Bereich. Zuvor kam ihnen<br />
der Ansatz oft „aufgestülpt“ (Herr A., 1534; Herr M., 150-151) und vorgefertigt vor, beim<br />
NWpG dagegen wird die Begleitung grundlegend auf die Betroffenen abgestimmt.<br />
„Das gibt es auch, aber nicht so per Zettel oder: "Mach mal so und so", sondern das ergibt<br />
sich <strong>aus</strong> dem Gespräch her<strong>aus</strong> und es ist dann eben sehr individuell abgestimmt.“<br />
(Herr M., 129-131)<br />
➢ Mitbestimmung der NutzerInnen<br />
Eine weitere grundlegende Haltung des NWpG, die von den Interviewten her<strong>aus</strong>gestellt<br />
wurde, ist die Achtung des Entscheidungsrechts der NutzerInnen. In der Begleitung durch<br />
72
5 Ergebnisse<br />
das NWpG schlägt sich diese Haltung darin nieder, dass die Betroffenen „selbst bestimmen<br />
dürfen“ (Herr A., 1841), wie diese Begleitung <strong>aus</strong>sieht und dass sie an allen wichtigen<br />
Entscheidungen teilhaben.<br />
„Ja. Und er entscheidet. Er sagt auch, er hält ja auch bestimmte Leute r<strong>aus</strong>.[...] Er bestimmt.“<br />
(Herr A., 1531-1534)<br />
„den Menschen Freiheiten zu geben, Freiheiten, selbst zu entscheiden, Freiheiten, ja, dahin<br />
geht es. Und den Eindruck hatte ich bei der <strong>Krisenpension</strong> gehabt, dass das in diese Richtung<br />
geht“ (Herr K., 407-409)<br />
Dadurch wird die Rolle der Betroffenen im Hilfsprozess als gleichberechtigt anerkannt:<br />
Professionelle und Betroffene verfolgen in einem partnerschaftlichen Verhältnis ein<br />
gemeinsames Ziel, zu dem jeder seinen Teil beiträgt (Herr A., 1102-1103). Da sich die<br />
NutzerInnen miteinbezogen fühlen, ihre Wünsche berücksichtigt werden (Herr B., 848-<br />
849) und der Betreuungsansatz „in Zusammenarbeit“ (Herr M., 150 ) entwickelt wird,<br />
erleben diese ein Kontrollgefühl über die eigene Situation (Herr A., 1533-1536). Für Herrn<br />
M. ist eine solche Haltung für das Gelingen einer Veränderung unabdingbar, wie er im<br />
Folgenden erklärt:<br />
„Also, es ist ganz wichtig, dass die Betroffenen davon überzeugt sind, dass das, was man jetzt dort,<br />
sagen wir mal, sich vornimmt, dass das auch deren Zustimmung findet und dann hat man eine gute<br />
Chance auch, Situationen zu verändern und dann dementsprechenden Erfolg auch zu haben.“<br />
(Herr M., 148-155)<br />
➢ Förderung der Eigenständigkeit<br />
Das NWpG versucht generell, die Eigenständigkeit seiner NutzerInnen zu fördern. Herr M.<br />
erlebt sie als eine „helfende Hand“, die Menschen dabei hilft, sich „selber wieder <strong>aus</strong><br />
dieser Situation befreien zu können“ (Herr M. 478-481). Umgesetzt werden kann diese<br />
Haltung beispielsweise dadurch, dass sich die Professionellen möglichst zurücknehmen<br />
und den anderen aktiv sein lassen.<br />
„nicht mit Rat und Tat {da mit dabei} stehen, außer man bittet sie darum.“ (Herr B., 625-626)<br />
„Sie geben einem das Gefühl, dass sie nicht einfach sagen, was sie wollen oder was man tun<br />
soll“ (Herr M., 148-149)<br />
Herr K. stellt auch einen Zusammenhang zur Mitbestimmung her und verdeutlicht, dass<br />
diese die Eigenständigkeit des Menschen fördert und ihn handlungsfähig macht.<br />
„So viel wie möglich Freiraum, wieder den Menschen in seine eigene Handlungs- und<br />
Entscheidungsfähigkeit zu bringen, ihn selbstständig zu belassen und ihn nicht abhängig zu<br />
machen. […] gesund werden heißt Verantwortung übernehmen, entscheidungs- und<br />
handlungsfähig zu sein, das ist Zielsetzung einer gesunden Gesellschaft.“ (Herr K., 401-406)<br />
Eigenständigkeit, Verantwortungsübernahme und aktive Einbindung in den Veränderungsprozess<br />
ermöglichen Betroffenen so, Veränderung <strong>aus</strong> eigener Kraft her<strong>aus</strong> einzuleiten.<br />
73
5 Ergebnisse<br />
5.3.2 Arbeitsweisen<br />
➢ Zuhören und Zeit nehmen<br />
Aus den beschriebenen grundlegenden Haltungen ergeben sich konkrete Arbeitsweisen für<br />
das NWpG. Aus einer befürwortenden Haltung von Mitbestimmung und Eigenständigkeit<br />
der NutzerInnen ergibt sich unter anderem das Zuhören (Frau T., 500; Herr B., 254-255;<br />
603-605) als konkrete Arbeitsweise der Professionellen.<br />
„Aber nichtsdestotrotz ist es dann halt auch schön, dass man mit Hometreatment denn hier<br />
Leute hat, die einfach darüber reden, auch gelernt haben eher zuzuhören, hin und wieder mal<br />
eine Frage zu stellen, klar, aber eher zuzuhören.“ (Herr B., 622-625)<br />
„Der hat eine ganz ruhige Art, lässt ihn reden, fragt nur kurz“ (Frau D., 686-687)<br />
Indirekt sagen diese den Betroffenen mit ihrer „Zurückhaltung“ im Gespräch (Frau T.,498-<br />
501): Du bist hier der Experte, die Lösung liegt in dir selbst. Betroffene werden demnach<br />
ernst und wichtig genommen. Eng mit dem Zuhören verbunden ist auch das sich „Zeit<br />
nehmen“ (Herr A., 1650; 1300), da erst <strong>aus</strong>reichend Zeit das Zuhören ermöglicht und<br />
wiederum ein Ausdruck der Anerkennung ist.<br />
„Und die Tatsache, dass die eben ganz offen waren, also ganz viel zugehört haben, also eher<br />
uns haben reden lassen, uns haben erzählen lassen und erst dann zu einer Meinung gekommen<br />
sind und dann, und das stundenlang.“ (Herr A., 1490-1492)<br />
➢ Alltagstipps<br />
Eine zentrale Arbeitsweise des NWpG bezeichnen einige InterviewpartnerInnen als „lauter<br />
kleiner Tipps“ (B., 716-717), „kleine […] und große Verhaltenstipps“ (Herr B., 577) oder<br />
Alltagstipps geben.<br />
„Alltagstipps ist ein gutes Stichwort, das finde ich [...] auch eine ganz wichtige Hilfe. […] Viele<br />
nehmen wirklich solche Alltagsratschläge dankend an, setzen die auch um, ja?“ (Herr B., 652-660)<br />
Darin sind mehrere Aspekte enthalten. Zum einen ist dies die Alltagsbezogenheit, zum<br />
anderen bedeuten „Tipps“ sowohl eine Unverbindlichkeit der Annahme des Tipps im Sinne<br />
eines Vorschlages als auch die Suche nach Lösungen. Alltagsbezogenheit heißt einerseits,<br />
dass die bzw. der Betroffene während ihrer bzw. seiner Begleitung möglichst „nicht r<strong>aus</strong><br />
gerissen <strong>aus</strong> ihrem bzw. seinem Alltag“ wird (Frau D., 893-894). Andererseits heißt es,<br />
dass die Hilfen bei „überwiegend Alltagssachen“ (Herr A., 517) ansetzen und so „ganz<br />
lebensnah“ (Herr A., 522) sind.<br />
„Ganz ganz wichtig ist, wie gestaltet sich denn der Alltag […] Und die haben den ein oder<br />
anderen Vorschlag gemacht: Mach das doch so! Oder wäre das nicht ein Weg?“<br />
(Herr A., 1739-1743)<br />
Das Wort Vorschlag verdeutlicht dabei ein weiteres Mal, dass sich hinter der konkreten<br />
Arbeitsweise eine selbstbestimmungsachtende Haltung verbirgt: Vorschlag bedeutet nur<br />
74
5 Ergebnisse<br />
das unverbindliche Aufzeigen einer Möglichkeit ohne einen „Zwang“ (Herr A., 1118),<br />
diesen bestimmten Lösungsweg auch annehmen zu müssen.<br />
„mit vielen Vorschlägen, nicht eindringen, also zumindestens so: Ich habe nicht den Eindruck,<br />
dass sie ja etwas rein pauken wollten, ja?“ (Frau T., 526-527)<br />
Die Option des Ablehnens wird demnach offen gelassen und akzeptiert.<br />
„Ja, ich bestimme. Ich sage, was ich möchte. Ich wähle <strong>aus</strong> der Palette <strong>aus</strong> und komme<br />
manchmal auch zurück und sage ,ich glaube, das ist nichts für mich'.“ (Herr A., 1053-1054)<br />
Anstelle von Vorschlägen wird auch von „Angebote“ (Frau T., 544), „Denkanstöße“ (Frau<br />
D., 688) oder „Anregungen“ (Herr M., 58) gesprochen, wodurch die gleiche<br />
Unverbindlichkeit <strong>aus</strong>gedrückt wird. Das NWpG versucht seine NutzerInnen dabei zu<br />
unterstützen, ihren eigenen Weg, keinen vorgefertigten, zu finden. Die Unterstützung dabei<br />
erfolgt durch die Fokussierung auf mögliche Lösungen. Im Begleitungsprozess werden<br />
dazu mit „ganz viel kreativen Ideen“ (Herr B. 602) „Lösungsansätze“ (Herr A., 1230)<br />
gesucht, wobei das NWpG eine „ganze breite Palette anbietet“ (Herr A., 1046) und „3, 4, 5<br />
verschiedene Möglichkeiten“ (Herr A., 1231) aufzeigt.<br />
„mögliche Lösungen, mögliche Schritte aufzeigen und entwickeln und ja, immer wieder<br />
nachfragen, wie es denn <strong>aus</strong>sieht. Ob das der richtige Weg ist“ (Herr M., 57-61)<br />
Wichtig dabei ist auch, dass den NutzerInnen des NWpG dabei vermittelt wird, dass es<br />
immer einen Ausweg bzw. eine Lösung für eine schwierige Lage gibt (Herr A., 1708-<br />
1709).<br />
„Und, dass es für jedes Problem eine Lösung gibt, egal wie die <strong>aus</strong>sieht und, das […] Dass<br />
eine ist. Genau das ist der Punkt. Und dass sie aufgezeigt wird.“ (Herr A., 1087-1090)<br />
➢ Blick in die Zukunft<br />
So wie die Perspektive für eine Lösung Hoffnung geben kann, so zeugt auch der Blick in<br />
die Zukunft von einer Zuversicht, dass sich die Dinge bessern werden. In der<br />
Zusammenarbeit mit dem NWpG geht es daher oft um Dinge, die die „Zukunft betreffen“<br />
(Herr A., 532) und darum, „einfach eine Perspektive wieder (zu) bekommen für die<br />
Zukunft“ (Herr M., 481-482). Dass es nicht immer selbstverständlich ist, dass einem von<br />
Professionellen „große Hoffnung gegeben“ (Frau T., 501) wird, macht folgende Äußerung<br />
von Herrn B. deutlich:<br />
„Und man spürte nicht mal so eine Hoffnung, dass die Behandlung an sich vielleicht<br />
Fortschritte bringt. Mit der <strong>Krisenpension</strong> änderte sich das. Also nicht schlagartig, aber so<br />
Stück für Stück keimte dann halt so auf [...] Ok, wir leben jetzt nicht mehr in der Vergangenheit,<br />
wir leben jetzt in der Gegenwart, ja? Und heute rückwirkend betrachtet (lachend), muss ich<br />
sagen, war das schon ein riesiger Schritt, ja? Und Stück für Stück ging das dann aber auch in<br />
die Zukunft über.“ (Herr B., 526-532)<br />
75
5 Ergebnisse<br />
➢ Ganz Normales<br />
In den Interviews mit den Angehörigen wurde immer wieder deutlich, dass es bei der<br />
Begleitung gar nicht immer so sehr auf <strong>aus</strong>gefeilte Konzepte ankommt, sondern dass das<br />
„normale“ oder das „naheliegendste“ (Herr A., 886), oft das Allerhilfreichste ist. Dies<br />
drückt sich in verschiedenen Aspekten <strong>aus</strong>: Dieses „naheliegendste“ kann zum Beispiel<br />
sein, dass man in einer Krisensituation ein „ganz stinknormales Gespräch“ (Herr B., 708)<br />
führt, das eben diese Krise abzuwenden weiß. Es können „ganz informelle Gespräche“<br />
(Herr A., 624) sein, die Sicherheit und Rückhalt für die Bewältigung des Alltags geben.<br />
Herr B. findet, dass man also generell „seelisch kranke Menschen ruhig gen<strong>aus</strong>o behandeln<br />
darf wie gesunde Menschen“ (Herr B., 665), was in der <strong>Krisenpension</strong> u. a. dadurch<br />
geschieht, dass „da gekocht wurde zum Beispiel mit den Leuten, also dass da ein ganz<br />
normal, wie in einer Wohngemeinschaft, ein ganz normales Leben stattfand“ (Herr B., 233-<br />
235). Ein weiterer solcher Aspekt ist das Prinzip „Was tut mir gut?“ (Herr B., 319) bzw.<br />
„Geht es dem Betroffenem damit besser?“ (Herr A., 1744), welches Herr B.<br />
folgendermaßen erklärt:<br />
„Also das, was ich als gesunder Mensch auch mache, ja? Was tut mir gut? Das mache ich, ja?<br />
Dabei bleibe ich und was mir nicht gut tut, das stoße ich ab oder verändere es so, dass ich<br />
damit leben kann.“ (Herr B., 319-321)<br />
Ein Gefühl für den richtigen Einsatz dieser „normalen“ Dinge wird auch als „gesunde(r)<br />
Menschenverstand“ (Herr A., 1485) oder „Lebenserfahrung“ bezeichnet, die Professionelle<br />
gern einfließen lassen sollten (Herr B., 346-350).<br />
➢ Erreichbarkeit & schnelle Hilfe<br />
Als besonders hilfreich stellen mehrere Angehörige die beispiellose Erreichbarkeit (Herr<br />
M., 269) und die „fantastische Reaktionszeit“ (Herr B., 637-638) des NWpG her<strong>aus</strong>. Sie<br />
schildern, dass sie „zu jeder Tages- und Nachtzeit“ (Herr A., 682-683) anrufen können<br />
(Herr B., 632) und das NWpG ihnen „jederzeit jede Hilfe anbietet“ (Herr D., 763). Zu<br />
wissen, dass immer jemand für einen da ist (Herr M., 507-508), bietet Betroffenen und<br />
Angehörigen eine enorme Sicherheit.<br />
„Und, was mich da am meisten beeindruckt, ist diese ständige Erreichbarkeit.“ (Herr A., 855)<br />
Dazu kommt, dass die Hilfe „schnell und umfassend“ (Herr M., 582) bzw. „sofort und<br />
direkt“ (Herr A., 1303) erfolgt. So wurde beispielsweise berichtet, dass in einem Zeitraum<br />
von „einer halben Stunde“(Herr A., 285) bis zu „einer Stunde“ (Herr A., 1752) eine Lösung<br />
für das Problem gefunden wurde.<br />
76
5 Ergebnisse<br />
„Denn dieses, dieses relativ lockere und ganz flexible und schnell reagieren können, das ist ja<br />
erst die letzten 2, 5, 3 Jahre. Ein völlig anderer Ansatz, den er so gar nicht kannte.“<br />
(Herr A., 1143-1145)<br />
➢ Angehörige einbeziehen<br />
In der gesamten Begleitung der Betroffenen legt das NWpG großen Wert auf eine „ganz<br />
enge Einbindung“ (Herr A., 1517) von Angehörigen. Es wird dabei angestrebt, dass alle<br />
Beteiligten mit vereinten Kräften auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten.<br />
„Und dann war auch sehr schnell ein Ziehen am gleichen Strang sichtbar und mein ernstes<br />
Bemühen, also mich da auch einzubringen“ (Herr K., 349-351)<br />
In diesem Zuge werden Gespräche nur für die Angehörigen angeboten (Herr M., 196-197;<br />
Frau T., 476; Herr A., 847-849) oder es besteht die Möglichkeit für Angehörige, die<br />
BezugsbegleiterInnen bei Bedarf zu kontaktieren:<br />
„wenn ich Hilfe brauche, unabhängig von ihm, dass ich mich gen<strong>aus</strong>o an Frau X. wenden kann<br />
oder an Herrn Y..“ (Herr A., 1030-1033)<br />
Darüber hin<strong>aus</strong> werden, wenn auch vom Betroffenen befürwortet, Netzwerkgespräche<br />
gemeinsam mit den Angehörigen und Betroffenen geführt.<br />
„da hatte der Herr W. auch mich extra darum gebeten, dass ich mitkomme.“ (Frau D., 114-115)<br />
Von den Angehörigen wird dieser Ansatz begrüßt und für unabdingbar gehalten:<br />
„Also wer die Angehörigen außen vorhält, wie Kliniken das tun und wie Ärzte das tun, der hat<br />
eigentlich schon verloren.“ (Herr A., 1516-1517)<br />
Gute Gründe für das Einbeziehen von Angehörigen nennen auch die Angehörigen selber.<br />
Es reiche nicht, nur am Betroffenen selbst zu arbeiten, auch die Umwelt, zu der die<br />
Angehörigen unmittelbar zählen, müssten am Änderungsprozess teilhaben (Herr B., 835-<br />
837), was z. B. durch Netzwerkgespräche realisiert werden kann. Weiter wurde<br />
argumentiert, dass Angehörige gen<strong>aus</strong>o Betroffene sind und daher auch Unterstützungsbedarf,<br />
z. B. in Form eines Angehörigengespräches, benötigen.<br />
„Die Tatsache, sich bewusst zu machen, dass man als Angehöriger eines Betroffenen, als<br />
Partner eines Betroffenen, gen<strong>aus</strong>o betroffen ist. Und man genau die gleichen Experten<br />
konsultieren muss, die der Betroffene selber konsultieren muss. Also es, ich kann das nicht<br />
alleine mit mir abmachen.“ (A., 1340-1342)<br />
5.3.3 Vermittlung der Grundhaltungen und Arbeitsweisen<br />
➢ Netzwerkgespräche<br />
Die zuvor beschriebenen grundlegenden Haltungen und Arbeitsweisen werden für<br />
Angehörige vor allem in den Netzwerkgesprächen erlebbar. Diese Kontakte sind eine der<br />
Hauptquellen, <strong>aus</strong> denen die Angehörigen ihre Erfahrungen mit dem NWpG schöpfen.<br />
77
5 Ergebnisse<br />
Neben dem indirekten Erleben durch die Erzählungen der Betroffenen haben Angehörige<br />
hier direkten Kontakt mit dem NWpG. Ausgangspunkt der Gestaltung dieser Gespräche<br />
stellt die Orientierung an den Bedürfnissen der NutzerInnen dar, so dass diese sehr<br />
individuell <strong>aus</strong>sehen können. Bei den InterviewpartnerInnen variierte die Häufigkeit und<br />
der Inhalt der Gespräche daher sehr. In den von Herrn A. erlebten Netzwerkgesprächen<br />
ging es beispielsweise um die Inhalte „Aktuelles“ (Herr A., 504), Wohlbefinden (Herr A.,<br />
508), in der „Zwischenzeit“ (Herr A., 403) Erlebtes, „bedrückende Situationen“ (Herr A.,<br />
406) und partnerschaftliche „Beziehung“ (Herr A., 405). Je nach Art der Beziehung von<br />
Betroffenen und Angehörigen ergeben sich dementsprechend andere Inhalte. Die<br />
Konstellation der GesprächsteilnehmerInnen bietet aber in jedem Fall eine günstige<br />
Möglichkeit, die Betroffenen-Angehörigen-Beziehung zu thematisieren, was gerade bei<br />
Partnerschaften oft auf Bedarf stößt. So sieht Herr M. die Treffen auch teilweise als<br />
Moderation (Herr M., 56) für die Besprechung von „Beziehungsproblematiken“ (Herr M.,<br />
44). Als besonders wichtig an den Netzwerkgesprächen wurde auch mehrmals<br />
her<strong>aus</strong>gestellt, „die Meinung Dritter zu hören“ (Herr A., 511). Eine solche 3. Perspektive<br />
ermöglicht mit „relativ neutraler Sicht“ (Herr A., 512) einen „anderen point of view auf die<br />
Sache zu kriegen“ (Herr B., 578) oder mit „Überzeugungsarbeit [...] immer wieder zu<br />
bestätigen“ (Herr A., 466), dass der eingeschlagene Weg auch der richtige ist.<br />
Neben Netzwerkgesprächen mit Angehörigen wird auch versucht, andere Professionelle<br />
miteinzubeziehen. So berichtet Herr K. beispielsweise, dass zusammen mit dem NWpG<br />
„Gespräche mit dem dort betreuenden Arzt“ (Herr K., 190) geführt wurden. Darüber<br />
hin<strong>aus</strong> sind auch größere Versammlungen mit Professionellen, Angehörigen und<br />
Betroffenen möglich, bei denen versucht wird, alle wichtigen Personen an einen Tisch zu<br />
bringen, um wichtige Entscheidungen zusammen zu treffen (Herr K., 267-268). Dabei<br />
kann jeder seine Position schildern und dem Betroffenen diese auf Augenhöhe näher<br />
bringen (Herr K., 322-324).<br />
➢ BezugsbegleiterInnen<br />
Als zentral stellte sich auch die Person der bzw. des Bezugsbegleiterin/s für die<br />
Betroffenen und Angehörigen her<strong>aus</strong>. In einigen Äußerungen der InterviewparterInnen<br />
werden BezugsbegleiterInnen mehr oder weniger synonym mit dem NWpG verwendet.<br />
„Also im Prinzip ist es jetzt die Person des Herrn W., die ich jetzt super finde“ (Frau D., 685)<br />
„Und was mir die beiden oder dieses Netzwerk sympathisch gemacht hat, waren natürlich die<br />
beiden Personen. Ich kann das ja nirgendwo anders dran festmachen.“ (Herr A., 1486-1488)<br />
78
5 Ergebnisse<br />
Dies ist insofern nicht verwunderlich, als dass der Großteil des Angebotes des NWpG in<br />
der Arbeit mit den BezugsbegleiterInnen besteht. Diese können einen „ganz starken<br />
Einfluss“ auf das Leben der Betroffenen haben (Herr A., 541-542) und eine „sehr<br />
vertrauensvolle Beziehung“ (Herr A., 608) mit ihnen entwickeln. Daher ist es sehr wichtig,<br />
eine konstante Begleitung zu gewährleisten, in der es feste Bezugspersonen und kaum<br />
Wechsel gibt (Herr A., 544-545). Die BezugsbegleiterInnen sind gleichermaßen<br />
„Notfallhelfer“, „Alltagsseelsorger“ (Herr A., 629) und Kümmergruppe“ (Herr A., 1680;<br />
„gekümmert“ Herr B., 933-934), auf die sich sowohl Betroffene als auch Angehörige<br />
verlassen (Herr A., 643). Die „regelmäßigen Kontakte“ (Herr A., 1603) mit den<br />
BezugsbegleiterInnen und die Gewissheit „da ist immer einer“ (Herr A., 1014) stellen eine<br />
„Sicherheit im Hintergrund“ (Herr A., 931) dar, die für die NutzerInnen sehr wichtig ist.<br />
„Nein. Ich glaube, das ist für ihn ganz wichtig, dass er weiß, das ist so sein Fahrplan, das<br />
bleibt so. Und die können ja auch, brauchen ja auch nur eine Stunde dauern oder es können<br />
dann eine Tasse Kaffee sein, sonst nichts. Aber ganz wichtig für ihn ist zu wissen: Ja, das ist<br />
eine konstante Größe für mich, das ist eine Größe, auf die ich bauen kann.“<br />
(Herr A., 1795-1799)<br />
Abschließend<br />
Insgesamt wird in den Aussagen der Angehörigen deutlich, dass Betroffene und<br />
Angehörige wertvolle Hilfen <strong>aus</strong> den Grundhaltungen und Arbeitsweisen des NWpG<br />
ziehen können. Das gilt im Besonderen für Krisenzeiten, bei deren Bewältigung das<br />
NWpG Unterstützung leistet. Die folgende Beschreibung von Herrn A. bringt dies noch<br />
einmal auf den Punkt:<br />
„Also, es gibt einen Weg, den ein Mensch geht und irgendwann ist eine Lücke in diesem Weg<br />
und dann gibt es eben Organisationen, die helfen mit einer Brücke über diesen Weg zu gehen<br />
und dann durch die Tür und dass es eben weiter geht, dass man nicht im nirgendwo landet.“<br />
(Herr A., 258-261)<br />
79
5 Ergebnisse<br />
5.4 K4 Idealversorgung<br />
Die Kategorie Idealversorgung leitet sich <strong>aus</strong> der Idealfrage nach einer perfekten<br />
<strong>Versorgung</strong> ab. Da diese Frage auf unterschiedlichen Ebenen beantwortet wurde, ist sie<br />
relativ heterogen zusammengesetzt: Es wird die gesellschaftliche Ebene im Sinne einer für<br />
psychisch erkrankte Menschen bessere Gesellschaft angesprochen, die Ebene der<br />
strukturellen und konzeptionellen psychiatrischen <strong>Versorgung</strong> im Allgemeinen sowie die<br />
Ebene einer Verbesserung des konkreten <strong>Versorgung</strong>sangebotes NWpG (s. Abb. 4).<br />
Gesellschaftlich:<br />
Aufklärung & Thematisierung<br />
für Offenheit, Prävention, Entstigmatisierung & Enttabuisierung<br />
Allgemeine <strong>Versorgung</strong>:<br />
Mehr Mitbestimmung, individuelle Betreuung, Zeit haben,<br />
„Auffangstation“, enge Zusammenarbeit, Mut<br />
NWpG:<br />
Mehr davon!<br />
Bessere Räumlichkeiten,<br />
Standort, Therapieangebot,<br />
Werbung<br />
Abbildung 4. K4 Idealversorgung<br />
5.4.1 Gesellschaftliche Ebene<br />
Bei der Frage nach der idealen <strong>Versorgung</strong> wurde von mehreren InterviewpartnerInnen die<br />
gesellschaftliche Ebene angesprochen, da sie tagtäglich mit den dort herrschenden<br />
Problemen konfrontiert werden. Als grundlegende Missstände werden die anhaltende<br />
Tabuisierung und Stigmatisierung im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen und<br />
Problemen festgestellt.<br />
„Aber dafür ist das Thema oder die Gesellschaft auch noch nicht offen genug für solche<br />
Sachen. Das ist alles sehr tabuisiert “ (Herr M., 109-110)<br />
„Und da haben viele andere Menschen ja eher Berührungsängste und fühlen sich gleich<br />
stigmatisiert oder so. Das ist sicherlich noch ein Tabuthema in unserer Gesellschaft“<br />
(Herr M., 284-285)<br />
Ein leicht greifbares Beispiel einer Stigmatisierung <strong>aus</strong> seinem Alltag berichtet Herr B.:<br />
„Passant: ,Habt ihr den gesehen?'(aufgebracht)<br />
Herr B: ,Joa, das war einer mit einem Tourette-Syndrom.' (gelassen)<br />
Passant: ,Jaa, das kann doch nicht wahr sein, einsperren müsste man den!'[...],Ich hab' die Tür<br />
meines Autos für meinen Vater offen gelassen, nur damit ich ihn da reintragen kann. Dann<br />
kommt der vorbei, tickt da <strong>aus</strong> und schmeißt die Tür zu.'<br />
Und warb richtig, wir müssten doch Verständnis haben. Wir hatten nun kein Verständnis,<br />
sondern sagten: ,Der Mann kann nichts dafür.' “ (Herr B., 434-441)<br />
80
5 Ergebnisse<br />
Aus entsprechenden Erfahrungen her<strong>aus</strong> wird die Forderung nach mehr Offenheit und<br />
Thematisierung in der Gesellschaft laut:<br />
„das ist auch eine Her<strong>aus</strong>forderung, sich wirklich auch mit diesem Thema [...]<br />
<strong>aus</strong>einanderzusetzen und auch offen zu sein. Das darf kein Tabu sein.“ (Herr A., 1699-1701)<br />
„Ja, dass es mehr thematisiert wird, ja. Ich meine, wer geht denn freiwillig her und sagt: Ich<br />
leide an paranoider Schizophrenie. Das ist doch ein Tabuthema“ Herr A., 1689-1690)<br />
Da die „Unwissenheit der Menschen“ (Herr B., 484-485) ein Grund für die festgestellte<br />
Stigmatisierung ist, stellt „Aufklärungsarbeit“ einen Ansatz (Herr B., 488) zur Umsetzung<br />
von mehr Offenheit und Thematisierung dar. Idealerweise sollte sie bereits in den Schulen<br />
(Herr B., 489) stattfinden und fest in die Lehrpläne, zum Beispiel unter dem Begriff<br />
„seelische Gesundheit“ (s. u.), verankert werden.<br />
„Erst mal würde ich anfangen die Leute aufzuklären, am besten in den Schulen.[...] Seelische<br />
Gesundheit ist irgendwas, was kaum einer kennt und -[...] Ja, obwohl wir alle damit zu tun<br />
haben. Jeder weiß, was bei einem Schnupfen zu tun ist, aber bei seelische Gesundheit, was ist<br />
das überhaupt?“ (Herr B., 412-419)<br />
Eine andere Möglichkeit wäre es, einen solchen Kurs verpflichtend im beruflichen Bereich<br />
einzuführen.<br />
„Mittlerweile würde ich sogar so weit gehen, [...] jede Firma muss, da müssen die Mitarbeiter<br />
einen 1.Hilfekurs besuchen. […] gen<strong>aus</strong>o sollte so ein Kurs über [...]seelische Hygiene, auch<br />
dazu“ (Herr B., 491-505)<br />
Diese Maßnahmen könnten zwei zentrale Effekte erzielen:<br />
1) Prävention: besser auf eigene psychische Gesundheit achten<br />
2) Entstigmatisierung<br />
„Effekt Nummer 1: Die Leute würden mehr auf sich achten (..) und Effekt Nummer 2: Diese<br />
ganzen Vorurteile, Vorbehalte, die wir ja, hier auch in unserer Familie erlebt haben, würden<br />
damit abgebaut werden.“ (Herr B., 428-430)<br />
5.4.2 Allgemeine <strong>Versorgung</strong><br />
Auch zur Verbesserung der allgemeinen psychiatrischen <strong>Versorgung</strong> gaben die InterviewpartnerInnen<br />
Rückmeldung, dabei stand die Forderung nach mehr Mitbestimmung und<br />
einer individuelleren Behandlung im Vordergrund.<br />
Mehr Mitbestimmung<br />
Besonders in psychiatrischen Kliniken gibt es nach Auffassung der Angehörigen Bedarf an<br />
Verbesserung. So spricht Frau T. davon, dass die Behandlung in der Klinik „von Grund<br />
auf“ erneuert werden muss, wobei ihr am wichtigsten ist, dass Patienten mehr einbezogen<br />
werden (628). Dies bekräftigt auch Herr B., indem er sich dafür <strong>aus</strong>spricht, dass dem<br />
Patienten zumindest die Möglichkeit gegeben werden sollte, auch darüber zu entscheiden,<br />
81
5 Ergebnisse<br />
wie er gesund werden möchte (371). Seine Erfahrung mit Kliniken war im Gegensatz dazu,<br />
dass diese Entscheidung dem Patienten abgenommen wird und so eine Bevormundung<br />
stattfindet (372-373). In diesem Zusammenhang verwendet Herr B. die Analogie der<br />
Speisekarte im Restaurant. Damit wird verdeutlicht, dass die Mitbestimmung in der<br />
Behandlung so selbstverständlich wie die eigene Wahl des Essens sein sollte.<br />
„Also ich gehe ja auch nicht ins Restaurant und lasse mir vom Kellner vorschreiben (lachend),<br />
was er mir jetzt auf den Tisch knallt. Ich kriege immerhin ein Angebot, nämlich eine<br />
Speisekarte, <strong>aus</strong> dem ich <strong>aus</strong>wählen kann und selbst da kann ich das Essen noch variieren.“<br />
(Herr B., 374-377)<br />
Individuelle statt Musterbehandlung<br />
Weiterhin wird eine Behandlung kritisiert, die sich dem einzelnen Individuum überhaupt<br />
nicht anpasst, sondern sich nur daran orientiert, was „irgendwo im Buch drin steht“ (Herr<br />
B., 365). Statt einer solch vielmals erlebten Musterbehandlung, wird die Forderung nach<br />
einer „individuelleren Behandlung“ (Herr B., 470) laut.<br />
„Und ich denke, viele Leute werden behandelt nach irgendwelchen Mustern, die vielleicht nicht<br />
die Chance haben (..) ja richtig individuell betreut zu werden.“ (Herr A., 1685-1687)<br />
Die Notwendigkeit für diese individuelle Behandlung begründet Herr B. damit, dass jeder<br />
Mensch selbst individuell ist und dazu seine ganz individuelle Lebenswelt mitbringt.<br />
Würde man diese individuellen Faktoren in der Behandlung unbeachtet lassen, käme dies<br />
der Behandlung von Menschen wie „ferngesteuerte Roboter“ gleich:<br />
„Und gen<strong>aus</strong>o stelle ich mir ein Angebot für psychisch kranke Menschen vor. (...) Irgendwie<br />
was nach Schema F zu machen. Und vieles kommt mir nach Schema F vor. Das geht schon mal<br />
deshalb nicht, weil alle Menschen Individualisten sind. Jeder hat eine andere Lebenssituation,<br />
ja? Die wie ferngesteuerte Roboter alle in eine Schiene zu zwingen ist so ziemlich, ist auch bei<br />
gesunden Menschen ziemlicher Blödsinn, ja? Und bei kranken Menschen fällt es dann mal<br />
komplett durch.“ (Herr B., 377-382)<br />
Zeit haben statt Kontingent<br />
Außerdem wird deutlich, dass es in psychiatrischen Kliniken oft an Zeit für den Patienten<br />
fehlt.<br />
„die Ärzte haben Visite 15 Minuten“ (Frau T., 635)<br />
Anzustreben ist daher, Zeit nicht nach Kontingenten zu vergeben, sondern nach dem<br />
individuellen Bedarf der bzw. des Betroffenen.<br />
„bei einer psychischen Krankheit, das ist ja die letzte Krankheit, bei der man sagen kann: Die<br />
ist in 3 Monaten abgeschlossen und trotzdem stoßen wir momentan an diese Grenzen, die<br />
Behandlung X Y Z muss innerhalb von 6 Wochen abgeschlossen sein, eine Therapie darf nicht<br />
länger als 6 Monate dauern oder so und so viele Sitzungen“ (Herr B., 479-483)<br />
Um dies umzusetzen, müsste jedoch zunächst einmal ein höherer Personalschlüssel<br />
durchgesetzt werden.<br />
82
5 Ergebnisse<br />
„aber bei psychisch kranken Menschen, da darf so ein Verhältnis, würde ich sagen, 1-zu-5“<br />
(Herr B., 466-467)<br />
Angemessene Auffangstation<br />
Einig darüber, dass eine angemessene Krisenaufnahme eigens für die psychiatrische Klinik<br />
fehlt, sind sich mehrere der InterviewpartnerInnen. Im Notfall muss meist das normale<br />
Krankenh<strong>aus</strong>-Notaufnahmeprozedere durchlaufen werden, welches in einer psychischen<br />
Krise extrem kontraproduktiv sein kann.<br />
„ich habe schon einmal 5 Stunden mit meiner Tochter gewartet bis sie im Zimmer war. Also<br />
wenn man noch keine Psychose hatte, kriegt man spätestens dann (eine), wenn man diese<br />
Prozedur da durch macht.“ (Frau T.,508-511)<br />
Solch eine „Anlaufstelle“ (Herr B., 383) sollte sich dadurch <strong>aus</strong>zeichnen, dass die bzw. der<br />
Betroffene in einer Krisensituation eine umfassende Absicherung erfährt.<br />
„ärztliche Betreuung gesichert, psychologische Betreuung gesichert, aufgehobene Atmosphäre<br />
gesichert“ (Herr A., 1637-1638)<br />
Neben der Sicherung der professionellen Behandlung, gehört dazu aber unbedingt auch die<br />
Sicherung der alltäglichen Aufgaben.<br />
„Ich stelle mir da [...]sowas vor, dass man erst mal eine Auffangstation schon mal hat für<br />
psychisch kranke Menschen, die in einen Ort kommen, in den sie sich zurückziehen können.<br />
Das ist erst mal ganz wichtig. Dann natürlich, dass sie sozial abgefangen werden. [...] das<br />
Tagesgeschäft ist für viele psychisch kranke Menschen (...) nochmal besonders schwer.<br />
(Herr B., 354-359)<br />
Enge Zusammenarbeit<br />
Angesprochen wurde auch der Wunsch nach einer besseren Abstimmung der Behandlung.<br />
„aber wenn es so besser integriert wäre, in dem ganzen Konzept, ja? Ich glaube, dass wäre<br />
eine Bereicherung“ (Frau T., 602-603)<br />
Dies bezieht sich zum einen auf die einzelnen Behandlungsb<strong>aus</strong>teine, zum anderen aber<br />
auch auf die Zusammenarbeit der verschiedenen professionellen Anbieter bzw. Personen.<br />
„Unter einem Dach, mit einer Psychologin, so dass das ganz nah ist, Kooperationen mit<br />
Kliniken“ (Herr A., 1631-1632)<br />
„alle arbeiten eng miteinander, eng verzahnt“ (Herr A., 1645-1646)<br />
Mutige Klinikchefs<br />
Zur Umsetzung aller von den Angehörigen eingebrachten Anregungen bedarf es eines<br />
Klinikchefs, der als erstes zu Veränderungen bereit ist und der einer „Klinik, die den<br />
Namen ,Klinik der seelischen Gesundheit' auch wirklich verdient“ (Herr B., 453-454) den<br />
Weg bereitet.<br />
„Und (5) ja im Prinzip bräuchten wir eigentlich nur ein, zwei offene Klinikchefs, die auch<br />
wirklich offen sind, die auch Mut haben, mal was durchzusetzen oder bzw. was aufzubauen,<br />
ja?“ (Herr B., 392-395)<br />
83
5 Ergebnisse<br />
5.4.3 NetzWerk psychische Gesundheit<br />
Im Zusammenhang mit der Frage zur idealen <strong>Versorgung</strong> äußerten sich die InterviewteilnehmerInnen<br />
auch zum NWpG. So wurde es beispielsweise als Vorbild für eine ideale<br />
<strong>Versorgung</strong> herangezogen, an deren Grundprinzipien man sich orientieren sollte.<br />
„Ja, natürlich die Betreuung sowie in der <strong>Krisenpension</strong>, also ich glaube die Prinzipien“<br />
(Frau T., 586)<br />
Besonders hervorgehoben wurden dabei die Prinzipien „menschlichen Einsatz“ (Frau T.,<br />
150) und ständige Erreichbarkeit.<br />
„das Netzwerk in Anspruch nehmen zu können, jeder Zeit, zu jeder Tages- und Nachtzeit (..)<br />
sind eigentlich Idealvorstellungen, Idealbilder, die Realität sind in Berlin, Gott sei dank.“<br />
(Herr A., 682-683)<br />
Zwar wurden auch Vorschläge zur Verbesserung eingebracht, allerdings immer mit dem<br />
Zusatz, dass es sich dabei um „Kleinigkeiten“ (Herr B., 859) handelt bzw. die Dinge von<br />
Priorität bereits erfüllt sind.<br />
„also in meinen Augen könnte (es) nicht besser sein, vielleicht von der Räumlichkeit, von ein<br />
paar so Aspekten, aber von so dem menschlichen Einsatz könnte (es) wirklich nicht besser<br />
sein“ (Frau T., 148-151)<br />
„Viel wichtiger finde ich, ist das, was wir erleben, dass sich Leute Zeit nehmen, darauf<br />
einlassen, sich intensiv darum kümmern.“ (Herr A., 1649-1650)<br />
Die Verbesserungsvorschläge sind daher als Anregungen zur Erweiterung des bestehenden<br />
Angebotes zu verstehen, die nur durch eine entsprechende finanzielle Förderung umsetzbar<br />
sind.<br />
„Also das wäre auch dann schon eher mein großer Wunsch, dass die ein bisschen mehr<br />
Unterstützung bekommen.[...] Die <strong>Krisenpension</strong>. (..) Mehr Mittel, mehr Möglichkeiten, mehr<br />
Akzeptanz“ (Herr B., 867-870)<br />
Die gemachten Vorschläge beziehen sich vor allem auf den B<strong>aus</strong>tein der <strong>Krisenpension</strong>. Im<br />
Einzelnen betreffen diese eine Verbesserung des Standortes (Herr B., 876-879) und der<br />
Räumlichkeiten, in einem Fall wird außerdem ein Therapieangebot (Frau T., 231-232; 236-<br />
237; 595) gewünscht. Auf das NWpG insgesamt bezogen wird empfohlen, mehr Werbung<br />
(Herr M., 72; 99-100; 572-576) für das Angebot zu machen, um bekannter zu werden. Die<br />
Räumlichkeiten der <strong>Krisenpension</strong> wünschen sich die Angehörigen weniger steril und kühl<br />
(Herr B., 224) und vor allen Dingen größer (Herr B., 845; Frau T., 226; 568) bzw. erweitert<br />
(Frau T., 591). Zu so einer Erweiterung könnte eine Bank zum Draußen-Sitzen oder eine<br />
Marquise als Regenschutz gehören (Herr B., 859-860). Der Wunsch nach mehr Werbung<br />
für das NWpG rührt zum einen von der Erfahrung her, in Notlagen nur wenig Wissen über<br />
Hilfsangebote und deren verschiedenen Alternativen zu haben.<br />
84
5 Ergebnisse<br />
„Aber (ich) wusste von keiner besseren Möglichkeit.“ (Frau T, 41)<br />
Zum anderen könnten mit höherer Bekanntheit auch Betroffene erreicht werden, die<br />
weniger aktiv bei der Suche nach dem für sie richtigen Hilfsangebot sind.<br />
„aber wie gesagt, Leute, die jetzt nicht initiativ sind, die werden nicht erreicht, […] Wie kann<br />
man die irgendwie auch bekommen, ja, oder berücksichtigen“ (Herr M., 673-676)<br />
„nicht so aufbauen würde, dass immer man als Betroffener ankommen muss“ (Herr M., 62)<br />
Insgesamt zeigt der Wunsch nach größerer Bekanntheit durch Werbung, dass das Urteil<br />
über das NWpG so positiv <strong>aus</strong>gefallen ist, dass Angehörige es weiter empfehlen möchten.<br />
5.5 Ergebnisübersicht<br />
Abschließend wird in Tabelle 2 ein kompakter Überblick über die Ergebnisse gegeben.<br />
Ermittelt wurden die vier Hauptkategorien Veränderungen (K1), Hindernisse (K2),<br />
hilfreiche Konzepte (K3) und Idealversorgung (K4), die einen Beitrag zur Beantwortung<br />
der Fragestellung leisten können. Zu Veränderungen zeigte sich, dass sich diese durch<br />
einen Prozesscharakter <strong>aus</strong>zeichnen. Das heißt, dass eine Veränderung meist erst langfristig<br />
und in vielen Teilschritten erreicht werden kann. Dies kann dazu führen, dass erste<br />
Teilerfolge nicht wahrgenommen werden. Zudem wurde festgestellt, dass Veränderungen<br />
je nach persönlicher Situation, Problematik bzw. Symptomatik ganz individuell <strong>aus</strong>fallen<br />
können. Konkrete Veränderungen seit Eintritt ins NWpG wurden von den Angehörigen bei<br />
sich selbst, bei den Betroffenen sowie in deren gemeinsamer Beziehung wahrgenommen.<br />
Als mögliche Hindernisse, die einem Nutzen vom NWpG im Weg stehen können, konnten<br />
fehlende Einsicht, fehlender Veränderungswille und mangelnde Verantwortungsübernahme<br />
sowie Passivität bzw. externe Veränderungsüberzeugung identifiziert werden. Neben<br />
diesen Haupthindernissen stellen der fehlende Glaube an Veränderung sowie Misstrauen<br />
und Kontrahaltung weitere Hindernisse dar. Darüber hin<strong>aus</strong> können hohe Erwartungen und<br />
Zeit als zusätzliche Faktoren einen Einfluss haben. Zu den hilfreichen Konzepten, die von<br />
den Angehörigen genannt wurden, zählen grundlegende Haltungen wie z. B. die Förderung<br />
von Eigenständigkeit und konkrete Arbeitsweisen wie z.B. Zuhören. Für deren Vermittlung<br />
haben sich die BezugsbegleiterInnen und die Netzwerkgespräche als besonders wichtig<br />
erwiesen. Über die Wünsche an eine Idealversorgung konnten Anregungen bezogen auf die<br />
gesellschaftliche Ebene, auf die allgemeine psychiatrische <strong>Versorgung</strong> sowie auf das<br />
NWpG gesammelt werden.<br />
85
5 Ergebnisse<br />
Tabelle 2<br />
Ergebnisübersicht<br />
K1 Veränderungen<br />
Individuell je Problematik, Symptomatik, Situation<br />
✔<br />
Langfristigkeit, Teilerfolge,<br />
Prozesscharakter<br />
→ Veränderungen als langfristiger Prozess:<br />
es geht zu langsam, Teilerfolge werden<br />
leicht übersehen<br />
Betroffene<br />
✔ Perspektiven<br />
✔ Problembewusstsein und -verständnis<br />
✔ Medikamentierung<br />
✔ Freiheit<br />
✔ Stabilität<br />
✔ Umgang mit Krankheit<br />
✔ Lebenseinstellung<br />
✔ Eigenständigkeit<br />
✔ Lebensqualität<br />
Angehörige<br />
✔ Informierte Angehörige<br />
✔ Umgang Krise<br />
Beziehung<br />
✔ Problembewusstsein und -verständnis<br />
✔ Konfliktbewältigung<br />
K2 Hilfreiche Konzepte<br />
Grundlegende Haltungen<br />
➢ Orientierung an individuellen<br />
Bedürfnissen<br />
➢ Mitbestimmung der NutzerInnen<br />
➢ Förderung der Eigenständigkeit<br />
Arbeitsweisen<br />
➢ Zuhören & Zeit nehmen<br />
➢ Alltagstipps<br />
➢ Blick in die Zukunft<br />
➢ Ganz Normales<br />
➢ Ständige Erreichbarkeit & schnelle Hilfe<br />
➢ Angehörige einbeziehen<br />
Vermittlung der Grundhaltungen & Arbeitsweisen<br />
➢ Netzwerkgespräche<br />
➢ BezugsbegleiterInnen<br />
K2 Hindernisse<br />
Haupthindernisse<br />
1) Fehlende Einsicht:<br />
Ich brauche keine Hilfe<br />
Mich betrifft das nicht<br />
2) Fehlender Veränderungswille und<br />
mangelnde Verantwortungsübernahme:<br />
Ich will selber keine Hilfe<br />
Ich mache das nur für andere<br />
3) Passivität bzw. externe<br />
Veränderungsüberzeugung:<br />
Ich muss nicht aktiv werden,<br />
die Hilfe kommt von außen<br />
Weitere Hindernisse<br />
4) Fehlender Glaube an Veränderung<br />
5) Misstrauen und Kontrahaltung<br />
Zusätzliche Faktoren<br />
- Zeit<br />
- Hohe Erwartungen<br />
K4 Idealversorgung<br />
a) Gesellschaftliche Dimension<br />
Aufklärung & Thematisierung für Offenheit,<br />
Prävention, Entstigmatisierung und Enttabuisierung<br />
b) Allgemeine <strong>Versorgung</strong><br />
mehr Mitbestimmung, individuelle statt<br />
Musterbetreuung, Zeit haben statt Kontingent,<br />
angemessene „Auffangstation“, enge<br />
Zusammenarbeit, mutige Klinikchefs<br />
c) NWpG<br />
Ausbau (mehr davon!), mehr Mittel:<br />
Räumlichkeiten, Standort, Therapieangebot,<br />
Werbung zur Bekanntmachung<br />
86
6 Diskussion<br />
6 Diskussion<br />
Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit diskutiert. In der<br />
Diskussion inhaltlicher Aspekte (6.1) werden die einzelnen Ergebnisse genauer betrachtet<br />
und hinsichtlich der Fragestellung bewertet und interpretiert. Folgend werden in der<br />
Diskussion methodischer Aspekte (6.2) Konsequenzen des gewählten Untersuchungsdesigns<br />
beleuchtet und wichtige Hinweise zur richtigen Interpretation der Ergebnisse<br />
gegeben. Mögliche weiterführende Fragestellungen werden an entsprechender Stelle<br />
vorgeschlagen. Das Kapitel schließt mit dem Fazit (6.3) ab, das sich für die Beantwortung<br />
der Fragestellung dieser Arbeit ergibt.<br />
6.1 Diskussion inhaltlicher Aspekte<br />
Hilfreiche Konzepte<br />
Die hilfreichen Konzepte, die im Ergebnisteil erarbeitet wurden, lassen sich in zwei<br />
Gruppen einteilen: Ein Teil dieser empirisch gefundenen Konzepte lässt sich in die<br />
Literatur einordnen, der andere Teil beschreibt Konzepte, die spezifisch für die in dieser<br />
Untersuchung interviewten Angehörigen sind. Dementsprechend gliedert sich die<br />
Bewertung und Interpretation dieses Ergebnisteils in einen Vergleich der Konzepte des<br />
NWpG in Theorie und Empirie (1. Abschnitt) und die angehörigenspezifischen Konzepte<br />
(2. Abschnitt).<br />
In Bezug auf die Konzepte des NWpG hat sich für diese Arbeit die Frage gestellt, ob<br />
Angehörige den theoretischen Schlüsselkonzepten, die dem NWpG zu Grunde liegen, die<br />
gleiche Bedeutsamkeit für den Behandlungsprozess zuschreiben. Es soll hierzu ein<br />
Abgleich zwischen theoretischen, vom NWpG intendierten, und empirischen, von den<br />
Angehörigen als hilfreich empfundenen, Konzepten erfolgen. Daran kann einerseits<br />
festgestellt werden, wie gut die Konzepte von den MitarbeiterInnen umgesetzt werden.<br />
Andererseits kann ein solcher Vergleich Aufschluss darüber geben, ob die NutzerInnen<br />
tatsächlich von den als entscheidend angenommenen Konzepten profitieren und welche<br />
anderen Aspekte auch wichtig oder sogar wichtiger sind. Vergleicht man die in der Theorie<br />
vorgestellten Konzepte mit den Konzepten, die sich <strong>aus</strong> der Untersuchung ergaben (5.3), so<br />
lassen sich viele Übereinstimmungen finden: Die grundlegende Haltung, sich an den<br />
individuellen Bedürfnissen der NutzerInnen zu orientieren, entspricht dem Grundprinzip<br />
der bedürfnisangepassten Behandlung (2.2.5). Beim NWpG wird dieses Konzept vor allem<br />
87
6 Diskussion<br />
dadurch umgesetzt, dass sich das <strong>Versorgung</strong>sangebot je nach Bedarf individuell<br />
zusammensetzt und <strong>aus</strong>gestaltet werden kann. Dies wurde von den Angehörigen als sehr<br />
hilfreich und vorteilhaft her<strong>aus</strong>gestellt. Von den befragten Angehörigen wird weiter<br />
besonders geschätzt, dass den Betroffenen ein großes Mitspracherecht in der Behandlung<br />
eingeräumt wird, so dass letztere mehr Einflussmöglichkeiten auf die Behandlung haben<br />
als in anderen Modellen psychiatrischer <strong>Versorgung</strong>. Auch dass Betroffene so viel wie<br />
möglich selbstständig erledigen bzw. aktiv bleiben sollen, um eigene Ressourcen auch für<br />
die Zukunft möglichst aufrecht zu erhalten, stößt bei den Angehörigen auf Zuspruch. Diese<br />
im Ergebnisteil unter Mitbestimmung der NutzerInnen und Förderung der Eigenständigkeit<br />
gefassten hilfreichen Konzepte können als Umsetzung von Empowerment verstanden<br />
werden. Die Erhaltung bzw. Wiederherstellung von Selbstbestimmung und Autonomie<br />
zeichnen Empowerment, wie in Kapitel 2.2.1 dargestellt, <strong>aus</strong>. Unter dem Blick in die<br />
Zukunft wird der Ansatz des NWpG gefasst, zukunftsorientiert zu arbeiten. Die Zuversicht<br />
auf Besserung, die darin steckt, ist Ausdruck des Kerngedankens der Recovery-Idee<br />
(2.2.2). Den Netzwerkgesprächen mit den BezugsbegleiterInnen und gegebenenfalls<br />
Angehörigen schreiben letztere eine zentrale Rolle im Hilfsprozess in der Begleitung durch<br />
das NWpG zu. Diese Gespräche schaffen Rahmenbedingungen für einen Aust<strong>aus</strong>ch mit<br />
dem Netzwerk der Betroffenen, so wie er im Konzept des Offenen Dialogs im Netzwerk<br />
(2.2.6) angestrebt wird. Als besonders beeindruckt zeigten sich die Angehörigen weiterhin<br />
von der Möglichkeit der ständigen Erreichbarkeit und schnellen Hilfe, die in<br />
Krisensituationen eine große Hilfe sein kann. Dieser Ansatz findet sich in den sieben<br />
Prinzipien des Offenen Dialoges wieder, nämlich als Prinzip der sofortigen Hilfe.<br />
Angehörige so stark einzubeziehen, wie es im NWpG der Fall ist, wurde von diesen als<br />
weiteres wichtiges Konzept genannt. Es lässt sich zum einen dem Prinzip des Offenen<br />
Dialoges Einbeziehung des sozialen Netzwerks (2.2.6, Punkt 2) zuordnen, zum anderen<br />
kann es als Form des Trialogs (2.2.7) verstanden werden. Insgesamt hat sich demnach in<br />
den Ergebnissen gezeigt, dass einschlägige Konzepte der Sozialen Psychiatrie wie<br />
Empowerment, Recovery, Trialog, bedürfnisangepasste Behandlung sowie Prinzipien des<br />
Offenen Dialogs im NWpG so gut umgesetzt werden, dass sie auch bei den Betroffenen<br />
bzw. Angehörigen ankommen. Diese Konzepte wurden nicht nur von den Angehörigen<br />
genannt, sondern auch als positiv und hilfreich erachtet.<br />
Neben den her<strong>aus</strong>gearbeiteten Konzepten, die sich klar den in der Literatur vorhandenen<br />
Konzepten zuordnen lassen, kristallisierten sich aber auch andere Schwerpunkte her<strong>aus</strong>,<br />
die als angehörigenspezifischer Fokus verstanden werden können. Dieser neue<br />
88
6 Diskussion<br />
angehörigenspezifische Beitrag an hilfreichen Konzepten zeichnet sich durch eine gewisse<br />
Praktikabilität für den Alltag <strong>aus</strong>, die diesen Konzepten gemein ist. Dazu zählt das Konzept<br />
der Alltagstipps: Hilfen beim Aufzeigen von Lösungswegen, die unverbindlich sind und<br />
vor allem bei alltäglichen Problemen ansetzen, sind für die Angehörigen von essentieller<br />
Bedeutung. Auch das Konzept des Ganz Normalen beinhaltet alltagspraktische<br />
Herangehensweisen, wie sich daran zu orientieren, was dem Betroffenen gut tut, oder die<br />
eigene Lebenserfahrung einzubringen. Letztere kann zum Beispiel hilfreich sein, um zu<br />
entscheiden, wann ein einfaches Gespräch besser hilft als alles andere. So könnten diese<br />
Konzepte unter das gemeinsame Motto „weniger ist mehr“ gestellt werden. Dieses zeigt<br />
sich auch beim Zuhören und Zeit nehmen, das als eine Zurückhaltung von professioneller<br />
Seite zugunsten der NutzerInnen als Experten für ihre eigene Situation verstanden werden<br />
kann. Schließlich wurde auch die Bedeutung der Personen der BezugsbegleiterInnen von<br />
den Angehörigen her<strong>aus</strong>gestellt. Diese sind der direkteste Kontaktpunkt der Angehörigen<br />
zum NWpG. Durch sie werden die Konzepte erst vermittelt und umgesetzt, so dass auch<br />
deren persönliche Eigenschaften darin einfließen. Die Beziehung zu den Bezugsbegleiter-<br />
Innen stellt letztlich eine grundlegende Basis für das Gelingen des gemeinsamen<br />
Vorhabens dar, da der Hilfsprozess konkret auf dieser Ebene stattfindet. Dies deckt sich<br />
auch mit der fünften Vor<strong>aus</strong>setzung Vertrauensbasis, die im Folgenden <strong>aus</strong> der Kategorie<br />
Hindernisse abgeleitet wird.<br />
Insgesamt zeigt sich in diesem Ergebnisteil, dass Angehörige von den intendierten<br />
Konzepten des NWpG profitieren, aber auch zusätzliche angehörigenspezifische Aspekte<br />
eine gleichermaßen wichtige Rolle spielen.<br />
Veränderungen<br />
Die von den Angehörigen wahrgenommenen Veränderungen während der Zeit beim<br />
NWpG stellen ein Kernstück der Ergebnisse dar (5.1). Angestrebte Veränderungen sind<br />
meist der Grund für das Aufsuchen von Hilfsangeboten und stellen so eine subjektive<br />
Zielgröße für die Betroffenen und deren Angehöriger dar. Diese Zielgröße wollen sie<br />
erfüllt oder sich ihr zumindest angenähert sehen. Außerdem können sie an ihr den Erfolg<br />
der Begleitung messen. Die Veränderungen, die die Angehörigen dieser Untersuchung<br />
wahrgenommen haben, sind beeindruckend breit gefächert und betreffen verschiedene<br />
Ebenen und Bereiche, in denen sich etwas für die Betroffenen (5.1.2), die Angehörigen<br />
(5.1.3) oder deren Beziehung zu einander (5.1.4) positiv verändert hat: Die Betroffenen<br />
gewannen neue Perspektiven für die Zukunft und eine bessere Einsicht in die eigene<br />
89
6 Diskussion<br />
Problematik, lernten besser mit der eigenen Situation umzugehen und gelangten so letztlich<br />
zu mehr Stabilität, Selbstbestimmtheit, Eigenständigkeit und insgesamt zu einer höheren<br />
Lebensqualität. Auch die Angehörigen erhielten mit der Unterstützung des NWpG ein<br />
besseres Verständnis für die Betroffenenproblematik und wurden routinierter im Umgang<br />
mit Krisen, so dass auch die Betroffenen indirekt davon profitieren können. Auf<br />
Beziehungsebene zeigte sich außerdem, dass Beziehungsproblematiken her<strong>aus</strong>gearbeitet<br />
werden konnten und sich die gemeinsame Konfliktbewältigung verbesserte. Diese<br />
Veränderungen veranschaulichen am deutlichsten den Nutzen, den Betroffene sowie<br />
Angehörige <strong>aus</strong> dem NWpG ziehen. Aus der Beschreibung der Angehörigen bezüglich<br />
beobachteter Veränderungen ergab sich ein Veränderungsmodell (s. Abb. 2, S. 54). Dieses<br />
verdeutlicht, wie Veränderungen beschaffen sind und was diese behindern kann.<br />
Veränderungen zeichnen sich durch einen Prozesscharakter (5.1.1) <strong>aus</strong>, der es erschwert,<br />
diese greifbar zu machen. Es ist unklar, wann eine Veränderung abgeschlossen ist, da diese<br />
<strong>aus</strong> vielen Teilschritten oder Teilerfolgen besteht. Außerdem geht der Veränderungsprozess<br />
oft so langsam voran und die Verbesserung ist noch so weit von dem angestrebten<br />
Zielzustand entfernt, dass sie nicht wahrgenommen und/ oder nicht wertgeschätzt wird.<br />
Dies kann schnell zu Demotivation und Hoffnungslosigkeit führen, was wiederum den<br />
Besserungsprozess gefährdet. Die vorliegende Arbeit hat gezeigt, dass Angehörige an<br />
dieser Stelle oft die wichtige Aufgabe übernehmen, den Betroffenen bereits gemachte<br />
Fortschritte vor Augen zu führen und sie so darin unterstützen, im langwierigen<br />
Veränderungsprozess durchzuhalten. Der Zeitfaktor, der für das Erreichen einer<br />
nachhaltigen Veränderung nötig ist und viele „Durststrecken“ mit sich bringt, scheint eine<br />
der größten Her<strong>aus</strong>forderungen zu sein, die alle Beteiligten auf dem Weg zur nachhaltigen<br />
Besserung meistern müssen.<br />
Idealversorgung<br />
Die Angehörigen wünschten sich für die allgemeine <strong>Versorgung</strong> (5.4.2) viele Konzepte<br />
bzw. Ansätze, die sie <strong>aus</strong> dem NWpG kennen: Mitbestimmung, individuelle Behandlung<br />
und Zeit haben finden sich in den als hilfreich beschriebenen Konzepten des NWpG<br />
wieder, so dass diese für eine Idealversorgung geforderten Aspekte im NWpG bereits<br />
erfüllt sind. Auch die beschriebene Auffangstation für Notfälle wird in Form der<br />
<strong>Krisenpension</strong> vom NWpG umgesetzt. Dem Wunsch nach engerer Zusammenarbeit der<br />
<strong>Versorgung</strong>sanbieter kommt das NWpG wiederum durch Netzwerkversammlungen mit<br />
Professionellen und der Unterstützung bei der Suche nach weiteren Hilfsangeboten nach.<br />
90
6 Diskussion<br />
So gesehen stellt die durchs NWpG umgesetzte <strong>Versorgung</strong>sform ein Vorbild für<br />
psychiatrische <strong>Versorgung</strong> im Allgemeinen dar, wie sie die Angehörigen auch gern in der<br />
Regelversorgung sehen würden. Dies ist eine über<strong>aus</strong> positive Rückmeldung im Bezug auf<br />
die Beurteilung des NWpG und verdeutlicht, dass - zumindest für die in dieser Arbeit<br />
interviewten Angehörigen - das NWpG nicht nur eine gleichwertige <strong>Versorgung</strong>sform zur<br />
stationären <strong>Versorgung</strong> darstellt, sondern die bevorzugte psychiatrische <strong>Versorgung</strong>sform<br />
ist. Dies ist eine sehr wichtige Erkenntnis für die <strong>Versorgung</strong>sforschung.<br />
Die konkreten Verbesserungsvorschläge zum NWpG (5.4.3) wurden von den Angehörigen<br />
nur unter dem Vorbehalt geäußert, dass es sich dabei um Kritik „auf hohem Niveau“<br />
handelt und sie grundsätzlich sehr mit dem Angebot zufrieden sind. Wenn sie sich dennoch<br />
etwas wünschen dürften, betrifft dies Rahmenbedingungen der <strong>Krisenpension</strong> wie Standort<br />
und Räumlichkeiten. Auch der Vorschlag für mehr Werbung zeugt von einer grundsätzlich<br />
positiven Beurteilung des Angebotes, da er <strong>aus</strong>drückt, dass noch mehr Menschen von<br />
diesem profitieren sollten. Insgesamt fiel bei der Beurteilung des NWpG auf, dass die<br />
Angehörigen, bis auf wenige Verbesserungsvorschläge (s. oben), nur Positives zu berichten<br />
hatten:<br />
„Also ich (6), nein eigentlich habe ich wirklich nur viel Positives zu berichten.“<br />
(Herr B., 847-848)<br />
Zunächst einmal ist das natürlich sehr erfreulich und ein Verdienst der Arbeit, die die<br />
MitarbeiterInnen des NWpG leisten. Dennoch sollte hier die Frage nach Gründen für diese<br />
so <strong>aus</strong>schließlich positive Resonanz gestellt werden. Eine mögliche Erklärung ist, dass die<br />
vorherigen Erfahrungen mit klassisch psychiatrischer <strong>Versorgung</strong> so im Kontrast zu den<br />
Konzepten des NWpG stehen, dass dessen Beurteilung beim Vergleich mit stationärer<br />
<strong>Versorgung</strong> <strong>aus</strong>nahmslos gut <strong>aus</strong>fällt. Es ist vorstellbar, dass differenziertere<br />
Verbesserungsvorschläge erst durch eine Vergleichsmöglichkeit mit ähnlicheren<br />
<strong>Versorgung</strong>sangeboten im ambulanten Bereich gegeben werden könnten. Da aber<br />
allgemein nur wenige Personen gleich mit mehreren ambulanten gemeindepsychiatrischen<br />
Angeboten Erfahrungen haben, erweist sich dies in der Praxis als schwierig. Es wäre aber<br />
interessant, dieser Frage in einer weiteren Forschungsarbeit nachzugehen.<br />
Von Hindernissen zu Vor<strong>aus</strong>setzungen<br />
Einen besonders unerwarteten Erkenntnisgewinn brachten die „negativen Fälle“ ein: Aus<br />
diesen Interviews konnten Hindernisse (5.2) abgeleitet werden, die das Einsetzen positiver<br />
Veränderungen, wie sie in den anderen Fällen geschildert wurden, blockieren. Dabei ist es<br />
91
6 Diskussion<br />
als Rückmeldung für das NWpG von Interesse, dass die Gründe für diesen fehlenden<br />
Erfolg der Teilnahme nicht im Ansatz das NWpG gesehen wurden. Stattdessen wurde<br />
dieser gelobt und Überlegungen darüber angestellt, warum trotz der Teilnahme am NWpG<br />
keine Besserung aufgetreten ist. Die Kenntnis über diese Hindernisse kann im praktischen<br />
Alltag des NWpG Anhaltspunkte dafür geben, was erfüllt sein muss, damit die Betroffenen<br />
einen Nutzen <strong>aus</strong> dem <strong>Versorgung</strong>sangebot ziehen können. Das heißt, dass sich <strong>aus</strong> den<br />
bekannten Hindernissen Vor<strong>aus</strong>setzungen für den Nutzen des Angebots ableiten lassen,<br />
wenn die Hindernisse in ihre positive Form verkehrt werden. Dieses Vorgehen wird in<br />
Tabelle 3 dargestellt.<br />
Tabelle 3<br />
Ableitung von Vor<strong>aus</strong>setzungen<br />
1) Fehlende Einsicht:<br />
Ich brauche keine Hilfe<br />
Mich betrifft das nicht<br />
Hindernisse → Vor<strong>aus</strong>setzungen<br />
1) Einsicht:<br />
Ich brauche Hilfe<br />
2) Fehlender Veränderungswille<br />
und mangelnde<br />
Verantwortungsübernahme:<br />
Ich will selber keine Hilfe<br />
Ich mache das nur für andere<br />
3) Passivität bzw. externe<br />
Veränderungsüberzeugung:<br />
Ich muss nicht aktiv werden, die Hilfe<br />
kommt von außen<br />
4) Misstrauen/Kontrahaltung<br />
→ ablehnen<br />
5) Fehlender Glaube an Veränderung<br />
2) Änderungswille und eigene<br />
Verantwortungsübernahme:<br />
Ich möchte für mich etwas verändern<br />
3) Aktivität bzw. interne<br />
Veränderungsüberzeugung:<br />
Ich werde selbst aktiv, um etwas zu<br />
verändern<br />
4) Vertrauensbasis<br />
→ sich einlassen/annehmen, öffnen<br />
5) Glaube an Veränderung<br />
Analog zu den im Ergebnisteil zusammengestellten Hindernissen ergeben sich damit als<br />
grundlegende Vor<strong>aus</strong>setzungen (1) Einsicht, (2) Änderungswille und Verantwortungsübernahme<br />
sowie (3) Aktivität bzw. interne Verantwortungsüberzeugung, als weitere<br />
Vor<strong>aus</strong>setzungen (4) Glaube an Veränderung und (5) Vertrauensbasis. Die ersten vier<br />
Vor<strong>aus</strong>setzungen sind hierarchisch zu verstehen. Das heißt, dass die Erfüllung der jeweils<br />
übergeordneten Vor<strong>aus</strong>setzung für die Erfüllung der darunter stehenden Vor<strong>aus</strong>setzung<br />
nötig ist. Umgekehrt <strong>aus</strong>gedrückt kann man <strong>aus</strong> der Erfüllung der unteren Vor<strong>aus</strong>setzung<br />
92
6 Diskussion<br />
ableiten, dass die darüber liegenden erfüllt sein müssen. Ein Nutzen des Angebotes wird<br />
erst durch die Überwindung aller Hindernisse möglich. Veranschaulicht wird die<br />
beschriebene hierarchische Anordnung in Abbildung 5.<br />
Brauche ich Veränderung?<br />
Will ich für mich selbst<br />
Veränderung?<br />
Werde ich selbst aktiv?<br />
Vertraue ich der Hilfsperson?<br />
Glaube ich an die Veränderung?<br />
Ja<br />
Ja<br />
Ja<br />
Ja<br />
Veränderung<br />
Ja<br />
Abbildung 5. Vor<strong>aus</strong>setzungen<br />
Konkret kann man sich den Ablauf wie eine interne Checkliste vorstellen: Als erstes frage<br />
ich mich, ob es in meinem Leben etwas gibt, das änderungsbedürftig ist. Ist dem so, frage<br />
ich mich, ob ich diese Veränderung für mich selbst auch will. Ist dem wiederum so, stellt<br />
sich die Frage, ob ich selbst bereit bin, aktiv etwas für diese Veränderung zu tun. Kann ich<br />
alle Punkte bejahen, bleibt nur noch zu fragen, ob ich auch daran glaube, dass eine<br />
Veränderung möglich ist. Zusätzlich spielt es eine Rolle, ob ich eine Vertrauensbeziehung<br />
zur Hilfsperson habe. Ohne eine solche ist die „Veränderungsarbeit“ erheblich erschwert.<br />
Angehörigenbeteiligung<br />
Den Angehörigen kommt in dieser Arbeit die wichtige Rolle zu, ihre ganz eigene Sicht<br />
zum NWpG zu schildern, welche sich indirekt <strong>aus</strong> den Erfahrungen der Betroffenen, direkt<br />
aber auch <strong>aus</strong> den eigenen Erfahrungen speist. Dabei sind sie Beobachter und<br />
TeilnehmerInnen zugleich. In den Interviews brachten sie ihr reflektiertes und fundiertes<br />
Erfahrungswissen ein, <strong>aus</strong> dem alle Erkenntnisse dieser Arbeit gezogen werden konnten.<br />
Dies belegt das große Potenzial, das in Angehörigen steckt und auch in der Evaluation von<br />
<strong>Versorgung</strong>sangeboten von großem Nutzen ist (vgl. Kap. 2.3.2). Darüber hin<strong>aus</strong><br />
beeindruckten sie aber auch durch ihre unermüdliche Unterstützung der Betroffenen und<br />
die persönlichen Entwicklungen, die sie durch das Leben mit diesen gemacht haben. Zum<br />
Beispiel entwickelten einige im Laufe der Zeit eine unumstößliche Ruhe und Gelassenheit,<br />
auch im Angesicht heraufziehender Krisen.<br />
93
6 Diskussion<br />
6.2 Diskussion methodischer Aspekte<br />
Reflexion der Angehörigenperspektive<br />
Um die Ergebnisse richtig zu interpretieren, wird an dieser Stelle noch einmal betont, dass<br />
für die Beantwortung der Fragestellung bewusst die Angehörigenperspektive gewählt<br />
wurde. Diese lässt zwar Schlüsse auf die Betroffenen zu, soll deren Perspektive jedoch<br />
nicht ersetzen und darf davon abweichen. Es geht gerade darum, dass Angehörige als<br />
indirekte NutzerInnen einen besonderen Blickwinkel auf <strong>Versorgung</strong>sangebote haben und<br />
eine angehörigenspezifische Einschätzung geben können, die bisher noch zu selten im<br />
Rahmen von evaluativen Vorhaben genutzt wurde. Ein Beispiel für eine solch<br />
angehörigenspezifische Einschätzung ist die Wahrnehmung von ersten Veränderungen: Wie<br />
im Ergebnisteil 5.1.1 dargestellt, fällt es Betroffenen schwer, erste eigene kleine Erfolge<br />
wahrzunehmen und zu schätzen. Angehörige dagegen können solche Veränderungen<br />
leichter wahrnehmen und dementsprechend im Interview schildern. Außerdem geht es in<br />
dieser Arbeit auch um den Gewinn für Angehörige <strong>aus</strong> dem Projekt: Die Ergebnisse<br />
ergaben, dass auch Angehörige positive Veränderungen bei sich selber (5.1.3) sowie in der<br />
Beziehung zu den Betroffenen (5.1.4) erleben. Dies wirkt sich wiederum indirekt positiv<br />
auf die Betroffenen <strong>aus</strong>, da dies eine Stärkung ihrer sozialen Ressourcen bedeutet. Das<br />
Untersuchungsdesign dieser Forschungsarbeit schafft also die besondere Situation, dass für<br />
die Einschätzung des NWpG über die Betroffenen berichtet wird. Dies ist aber nicht von<br />
Nachteil, da die Sicht der Angehörigen neue Aspekte zu Tage fördern kann, die von den<br />
Betroffenen nicht geäußert worden wären. Außerdem berichten die Angehörigen nicht nur<br />
indirekt <strong>aus</strong> der Drittperspektive über die Erfahrungen der Betroffenen, sondern auch ganz<br />
direkt <strong>aus</strong> eigener Erfahrung als sekundäre NutzerInnen des Angebots. Wie bereits<br />
angemerkt, zeichnet sich ein gutes <strong>Versorgung</strong>sangebot dadurch <strong>aus</strong>, dass es für Betroffene<br />
und Angehörige von Nutzen ist. Letztlich ist jede subjektive Einschätzung eine Frage der<br />
Wirklichkeitskonstruktion, also der Frage, welche Wahrnehmung der Realität denn die<br />
„wahre“ ist. Subjektiv gesehen sind sowohl Betroffenen- als auch Angehörigenperspektive<br />
wahr. Wichtig für diese Arbeit ist letzten Endes aber nur die <strong>Angehörigensicht</strong>. Selbst wenn<br />
z. B. von Angehörigen geschilderte Veränderungen nicht im gleichen Maße von<br />
Betroffenen empfunden werden, sind diese für Angehörige nicht weniger real und können<br />
z. B. zu deren Entlastung beitragen, so dass insgesamt ein Nutzen bilanziert werden kann.<br />
Als weiterführende Fragestellung wäre in diesem Zusammenhang ein Vergleich der Sicht<br />
der Angehörigen mit der der Betroffenen interessant. Dazu wäre eine Gruppendiskussion<br />
94
6 Diskussion<br />
beider Seiten oder zusätzlich zu den Angehörigeninterviews Interviews mit den<br />
dazugehörigen Betroffenen denkbar.<br />
Ursache-Wirkungszuschreibungen<br />
Für die Bewertung der Ergebnisse ist es weiterhin wichtig darauf hinzuweisen, dass das<br />
gewählte Untersuchungsdesign keine direkte Aussage über K<strong>aus</strong>alität im Sinne von klaren<br />
Ursache-Wirkungszusammenhängen machen kann. Dies ist besonders für die Bewertung<br />
der erfassten Veränderungen zu berücksichtigen. Die zeitliche Übereinstimmung von<br />
Veränderung und Teilnahme am NWpG bedeutet zunächst nicht unbedingt, dass das<br />
NWpG die Ursache für die Veränderung ist bzw. nicht zwingend die alleinige Ursache.<br />
Dieser Umstand wurde auch von einem Interviewteilnehmer beschrieben:<br />
„Aber das ist nun eine Koinzidenz der Umstände. Also, er kam zu dem Netzwerk, fast zeitgleich<br />
mit dieser neuen Beziehung.“ (A., 1185-1186)<br />
Da aber nicht alle anderen Variablen bis auf das NWpG im quantitativen Sinne<br />
„<strong>aus</strong>geschaltet“ werden können und sich verschiedene Einflüsse wie Begleitung durch das<br />
NWpG, berufliche, finanzielle, physische oder soziale Situation gegenseitig beeinflussen,<br />
können die Veränderungen dennoch als Hinweis auf den Nutzen des NWpG interpretiert<br />
werden. Dies wird auch durch Zitate der Angehörigen gestützt, in denen positive<br />
Veränderungen auf das NWpG zurückgeführt werden:<br />
„Das ist etwas, das ich auch durch das Netzwerk kennen gelernt habe, was auch mein Leben<br />
{verändert hat}“ (Herr A., 1730)<br />
„Und man spürte nicht mal so eine Hoffnung, dass die Behandlung an sich vielleicht<br />
Fortschritte bringt. Mit der <strong>Krisenpension</strong> änderte sich das.“ (Herr B., 527)<br />
Auch liegt die Vermutung nahe, dass die von einer Person positiv beschriebenen Konzepte<br />
einen Einfluss auf die genannten Veränderungen bei selbiger Person haben könnten. Zwar<br />
wurde von den InterviewpartnerInnen nicht explizit gesagt, dass ein bestimmtes Konzept<br />
zu einer bestimmten Veränderung geführt hat, aber es ist auch fraglich, ob ihnen eine solch<br />
genaue Zuschreibung möglich wäre. Eine weitere Forschungsarbeit könnte die hier<br />
vermuteten Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge überprüfen.<br />
Den bereits genannten methodischen Aspekten ist noch hinzuzufügen, dass sich die<br />
vorliegende Arbeit auf eine Momentaufnahme der Einschätzung der Angehörigen zum<br />
NWpG beschränkt. Die Langzeitperspektive Angehöriger könnte in einer weiteren Arbeit<br />
durch Interviews in Intervallen über mehrere Jahre untersucht werden.<br />
95
6 Diskussion<br />
6.3 Fazit<br />
Zurückblickend auf die Fragestellung wurde die vorliegende Arbeit mit dem Ziel<br />
angefertigt, her<strong>aus</strong>zufinden, wie Angehörige das NWpG beurteilen, um damit auch<br />
Erkenntnisse über die gemeindepsychiatrische Umsetzung <strong>Integrierte</strong>r <strong>Versorgung</strong> zu<br />
gewinnen. Die Abbildung 6 verdeutlicht noch einmal im Überblick, welchen Beitrag die<br />
einzelnen Ergebniskategorien zur Beantwortung der Fragestellung leisten: Die<br />
beschriebenen Veränderungen, die sich während der Teilnahme am NWpG im Leben der<br />
Betroffenen und Angehörigen einstellten, sind der ganz konkrete Nutzen, den jeder einzeln<br />
oder beide für ihre gemeinsame Beziehung <strong>aus</strong> dem NWpG ziehen konnten. Die als<br />
hilfreich empfundenen Konzepte sind genau das, was die Angehörigen positiv am NWpG<br />
bewerten. Die her<strong>aus</strong>gearbeiteten Hindernisse decken Gründe dafür auf, warum es in<br />
bestimmten Fällen zu keiner Besserung bzw. keinem Nutzen <strong>aus</strong> dem NWpG kam. Im<br />
Umkehrschluss erlaubten sie die Ableitung von Vor<strong>aus</strong>setzungen, die für das Gelingen<br />
einer Besserung erfüllt sein sollten. In der Idealversorgung wurde deutlich, dass die<br />
Angehörigen wenig am NWpG ändern würden bzw. negativ bewerten, sich stattdessen aber<br />
wünschen, dass viele der Konzepte des NWpG in die allgemeine psychiatrische<br />
<strong>Versorgung</strong> übernommen werden.<br />
Konzepte<br />
Das fanden wir<br />
gut/hilfreich<br />
Das hat uns das<br />
NWpG konkret<br />
gebracht<br />
Veränderungen<br />
Der Ansatz des<br />
NWpG ist gut,...<br />
Hindernisse<br />
...aber dies stand<br />
dem Nutzen im<br />
Wege<br />
Wie beurteilen Angehörige<br />
das NWpG?<br />
Das würden wir uns<br />
noch wünschen/das<br />
könnte besser sein<br />
Vor<strong>aus</strong>setzungen<br />
Dies sollte gegeben<br />
sein, damit es einen<br />
Nutzen hat<br />
Das gefällt uns so gut,<br />
das sollte in der gesamten<br />
<strong>Versorgung</strong> so sein<br />
Idealversorgung<br />
andere<br />
Fragestellung<br />
Das muss sich<br />
gesellschaftlich<br />
noch verändern<br />
Abbildung 6. Ergebniskategorien und Fragestellung im Zusammenhang<br />
96
6 Diskussion<br />
Als Beantwortung der Fragestellung ergibt sich so insgesamt eine sehr positive Beurteilung<br />
des NWpG durch Angehörige: Sie beurteilten viele Konzepte des NWpG als hilfreich,<br />
wichtige Veränderungen wurden in der Zeit beim NWpG erreicht, wenig Kritik wurde<br />
geäußert, stattdessen wurde das NWpG als Vorbild für die psychiatrische Gesamtversorgung<br />
herangezogen.<br />
Für die <strong>Versorgung</strong>sforschung ergibt sich dar<strong>aus</strong> die Konsequenz, dass die gemeindepsychiatrisch<br />
umgesetzte <strong>Integrierte</strong> <strong>Versorgung</strong> für die im Rahmen dieser Arbeit<br />
untersuchten Fälle nicht nur ein gelungenes <strong>Versorgung</strong>sangebot darstellt, sondern dieses<br />
auch gegenüber stationärer <strong>Versorgung</strong> bevorzugt wird. Die Möglichkeiten der <strong>Integrierte</strong>n<br />
<strong>Versorgung</strong> sollten deshalb noch mehr genutzt werden, um ähnliche <strong>Versorgung</strong>sangebote<br />
zu realisieren und mehr Menschen eine Alternative zur stationären <strong>Versorgung</strong> anbieten zu<br />
können.<br />
In Bezug auf die Angehörigenforschung kann diese Arbeit bestätigen, dass Angehörigenbeteiligung<br />
auch in der Evaluation von <strong>Versorgung</strong>sangeboten von großem Nutzen ist. Um<br />
dieses Potenzial nicht länger zu vergeuden, sollten Angehörige zukünftig weitgreifender<br />
beteiligt werden.<br />
Konkret für die Arbeitspraxis des NWpG nutzbar ist das Wissen über Vor<strong>aus</strong>setzungen,<br />
die erfüllt sein sollten, um einen Nutzen vom Angebot zu ermöglichen. Außerdem kann als<br />
Rückmeldung abgeleitet werden, dass die Umsetzung intendierter Konzepte erfolgreich<br />
war. Die Arbeit liefert aber auch Wissen über weitere angehörigenspezifische Konzepte.<br />
Insgesamt zeigen die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung, dass das NWpG und<br />
insbesondere die BezugsbegleiterInnen mit ihrer Arbeit einen zentralen Beitrag zur<br />
Bewältigung der schwierigen Situation ihrer NutzerInnen sowie deren Angehöriger leisten.<br />
Damit in Zukunft jedoch mehr Menschen davon profitieren können, wünschen sich<br />
Angehörige, dass <strong>Versorgung</strong>sangebote gemeindepsychiatrisch orientierter <strong>Integrierte</strong>r<br />
<strong>Versorgung</strong> in der Regelversorgung implementiert werden.<br />
97
Literaturverzeichnis<br />
Literaturverzeichnis<br />
Aderhold, V. & Greve, N. (2010). Bedürfnisangepasste Behandlung und Offene Dialoge.<br />
Psychotherapie im Dialog, 11 (3), 258-261.<br />
Alanen, Y. O. (1997). Schizophrenia. It's origins and need-adapted treatment. London:<br />
Karnac Books.<br />
Amering, M. (2009). Das Konzept der Chronizität psychischer Erkrankungen ist<br />
aufzugeben. Pro. Psychiatrische Praxis, 36, 4-6.<br />
Amering, M. & Schmolke, M. (2012). Recovery. Das Ende der Unheilbarkeit. Bonn:<br />
Psychiatrie-Verlag.<br />
Andersen, T. (1996). Das Reflektierende Team. Dialoge und Dialoge über Dialoge.<br />
Dortmund: Verlag Modernes Lernen.<br />
Andresen, R., Caputi, P. & Oades, L. (2006). Stages of recovery instrument: development<br />
of a measure of recovery from serious mental illness. Australian and New Zealand<br />
Journal of Psychiatry, 40, 972-980.<br />
Anthony, W. A. (1993). Recovery from mental illness: The guiding vision of the mental<br />
health service system in the 1990s. Psychiatric Rehabilitation Journal, 16 (4),<br />
11-23.<br />
Antonovsky, A. (1997). Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit. Dgvt-Verlag:<br />
Tübingen.<br />
Bastiaan, P. (2005). Vom Sündenbock zum Partner. Angehörigen professionell begegnen.<br />
Psychosoziale Umschau, 4, 13-15.<br />
Berhe, T., Puschner, B., Kilian, R. & Becker, T. (2005). „Home Treatment“ für psychische<br />
Erkrankungen. Begriffserklärung und Wirksamkeit. Der Nervenarzt, 76 (7), 822-<br />
831.<br />
Bischkopf, J. (2007). Aspekte der Beratung von Angehörigen depressiver Patienten. In<br />
Elmer, O. (Hrsg.), Psychotherapie affektiver Störungen (S. 123-135). Tübingen:<br />
dgvt-Verlag.
Literaturverzeichnis<br />
Bock, T., Buck, D. & Meyer, H.-J. (2009). Entwicklungslinien des Trialogs.<br />
Sozialpsychiatrische Informationen, 2, 4-6.<br />
Borchers, D. (2009). Wir fördern den Trialog! Sozialpsychiatrische Informationen, 2,<br />
18-19.<br />
Bottlender, R. (2009). Das Konzept der Chronizität psychischer Erkrankungen ist<br />
aufzugeben. Kontra. Psychiatrische Praxis, 36, 4-6.<br />
Bradstreet, S. (2004). Elements of Recovery: International learning and the Scottish<br />
context. In Bradstreet, S. & Brown, W. (Hrsg.), SRN Discussion Paper Series.<br />
Report No.1. Glasgow: Scottish Recovery Network. Zugriff am 10.04.2012.<br />
Verfügbar unter http://www.scottishrecovery.net/Related-documents/<br />
related-documents.html<br />
Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker e.V., Familien-Selbsthilfe Psychiatrie<br />
(2010). Was zu tun ist. Agenda 2020 zur Weiterentwicklung der psychiatrischen<br />
<strong>Versorgung</strong>. Bad Honnef: Siebengebirgsdruck.<br />
Bundesverband evangelische Behindertenhilfe e. V. & Charitas Behindertenhilfe und<br />
Psychiatrie e.V. (Hrsg.). (2009). PPQ: ProPsychiatrieQualität. Leitzielorientiertes<br />
Qualitätsmanagement. Bonn: Psychiatrie-Verlag.<br />
Ciompi, L. (1982). Affektlogik. Über die Struktur der Psyche und ihre Entwicklung. Ein<br />
Beitrag zur Schizophrenieforschung. Stuttgart: Klett-Cotta.<br />
Ciompi, L. (2001). Soteria Bern: Konzeptuelle und empirische Grundlagen,<br />
Wirkhypothesen. In Ciompi, L., Hoffmann, H. & Broccard, M. (Hrsg.), Wie wirkt<br />
Soteria? Eine atypische Schizophreniebehandlung - kritisch durchleuchtet (S. 43-<br />
68). Bern: Huber.<br />
Ciompi, L. (2009, Mai). Soteria Bern und die Zukunft der Psychiatrie. Vortrag gehalten auf<br />
der Jubiläumstagung 25 Jahre Soteria Bern, Bern, Schweiz. Zugriff am 10.04.2012.<br />
Verfügbar unter http://www.soteria.ch/pdf/referate/Luc_Ciompi.pdf<br />
Ciompi, L. (2012). Soteria Bern. Zugriff am 08.04.2012. Verfügbar unter<br />
http://www.ciompi.com/de/soteria.html
Literaturverzeichnis<br />
Ciompi, L., Kupper, Z., Aebi, E., Dauwalder, H.-P., Hubschmid, T., Trütsch, K.,<br />
Rutishauer, C. (1993). Das Pilot-Projekt "Soteria Bern" zur Behandlung akut<br />
Schizophrener. II. Ergebnisse einer vergleichenden prospektiven Verlaufsstudie<br />
über 2 Jahre. Der Nervenarzt, 64, 440-450.<br />
Cullberg, J. (2008). Therapie der Psychosen. Ein interdisziplinärer Ansatz. Bonn:<br />
Psychiatrie-Verlag.<br />
Dachverband Gemeindepsychiatrie e.V. (2010). <strong>Integrierte</strong> <strong>Versorgung</strong>. Factsheet, 3.<br />
Zugriff am 25.02.2012. Verfügbar unter http://www.psychiatrie.de/fileadmin/<br />
redakteure/bapk/ueberuns/materialien/agenda_2020_2010.pdf<br />
Davidson, L. & Roe, D. (2007). Recovey from versus recovery in serious mental illness:<br />
One stratgedy for lessening confusion plaguing recovery. Journal of Mental Health,<br />
16, (4), 459-470.<br />
Deegan, P. (1996). Recovery and the conspiracy of hope. Paper, presented at the Sixth<br />
Annual Mental Health Services Conference of Australia and New Zealand,<br />
Brisbane, Australia.<br />
Deger-Erlenmaier, H. (1987). Zum Geleit. In Dörner, K., Egetmeyer, A. & Koenning, K.<br />
(Hrsg.), Freispruch der Familie (S. 7-8). Bonn: Psychiatrie-Verlag.<br />
de Girolamo, G. (1996). WHO studies of schizophrenia: An overview of the results and<br />
their implications for an understanding of the disorder. In Breggin, P. & Stern, E.<br />
M. (Hrsg.), Psychosocial Approaches to Deeply Disturbed Patients (S. 213-231).<br />
New York: Haworth Press.<br />
Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (Mai, 2011).<br />
Aktuelle Informationen zur integrierten <strong>Versorgung</strong> in der Psychiatrie (Stand<br />
04.05.2011). Zugriff am 16.03.2012. Verfügbar unter www.dgppn.de/<br />
fileadmin/user_upload/_medien/dokumente/integrierte-versorgung/<br />
iv-projekte-dgppn-mai_2011.pdf<br />
Dörner, K. (1987). Handwerksregeln für Angehörigengruppen. In Dörner K., Egetmeyer,<br />
A. & Koenning, K. (Hrsg.), Freispruch der Familie (S. 59-98). Bonn: Psychiatrie-<br />
Verlag.
Literaturverzeichnis<br />
Dörner, K. (2003). Der „Trialog“ – eine Spielart der Ethik-Kommission in der Psychiatrie?<br />
Ethik in der Medizin, 1, 37-42.<br />
Dörner, K., Egetmeyer, A. & Koenning, K. (Hrsg.). (1982). Freispruch der Familie. Bonn:<br />
Psychiatrie-Verlag.<br />
Dresing, T. & Pehl, T. (2010). Transkription. In Mey, G. & Mruck, K. (Hrsg.), Handbuch<br />
Qualitative Forschung in der Psychologie (S. 723-733). Wiesbaden: VS Verlag für<br />
Sozialwissenschaften.<br />
Falloon, I. R. H. (2003). Family interventions for mental disorders: efficacy and<br />
effectiveness. World Psychiatry, 2, 20–28.<br />
Faulbaum-Decke, W. & Zechert, C. (2010). Warum <strong>Integrierte</strong> <strong>Versorgung</strong> in der<br />
Gemeindepsychiatrie? In Faulbaum-Decke, W. & Zechert, C. (Hrsg.), Ambulant<br />
statt stationär. Psychiatrische Behandlung durch integrierte <strong>Versorgung</strong> (S. 10-18).<br />
Bonn: Psychiatrie-Verlag.<br />
Fenton, F. R., Tessier, L., Struening, E. L., Smith, F. A. & Benoit, C. (1982). Home and<br />
Hospital Psychiatric Treatment. London: Billing and Sons Limited.<br />
Fink, E. (2011). Soteria Bern – Wo steht sie heute? ApK Info, 3, 15. Zugriff am<br />
28.12.2011. Verfügbar unter http://www.apk-berlin.de/redaxo/files/file/info/<br />
ApK-Info_2011-3_web_bearb.pdf<br />
Finzen, A. (2001). Psychose und Stigma. Stigmabewältigung – zum Umgang mit<br />
Vorurteilen und Schuldzuweisung. Bonn: Psychiatrie-Verlag.<br />
Fischer, G. (2009). Der Demente in der Akutklinik. Home-Treatment - Psychiatrische<br />
Akutbehandlung im häuslichen Umfeld. Abstract des Vortrages gehalten auf dem<br />
Pflegekongress, Berlin, Deutschland. Zugriff am 26.02.2012. Verfügbar unter<br />
http://www.heilberufe-online.de/kongress/rueckblick/berlin2009/abstracts/Fischer.<br />
pdfPHPSESSID=53fe215c715eac8df6a587dd60fcfad3<br />
Fischer, M., Kemmler, G. & Meise, U. (2004). Burden – Distress – Lebensqualität. Drei<br />
Konzepte zur Erfassung der Situation von Angehörigen chronisch psychisch<br />
Erkrankter. Psychiatrische Praxis, 31, 57-59.
Literaturverzeichnis<br />
Flick, U. (1995). Qualitative Forschung. Theorie, Methoden, Anwendung in Psychologie<br />
und Sozialwissenschaften. Reinbek: Rowohlt Taschenbuch Verlag.<br />
Freitag, R. (2011). Experienced Involvement – EX-IN. Einbeziehung Psychiatrie-<br />
Erfahrener als Exerten <strong>aus</strong> Erfahrung. Sozialpsychiatrische Informationen, 1,<br />
30-32.<br />
Fritze, J. (2005). <strong>Integrierte</strong> <strong>Versorgung</strong>. Was ist das? Wie funktioniert das? In Berger,<br />
M., Fritze, J. & Roth-Sackenheim, C. (Hrsg.), Die <strong>Versorgung</strong> psychischer<br />
Erkrankungen in Deutschland: aktuelle Stellungnahmen der DGPPN 2003-2004<br />
(S. 73-76). Heidelberg: Springer Medizin Verlag.<br />
Glaser, B. G. & Str<strong>aus</strong>s, A. L. (1998). Grounded Theory. Strategien qualitativer<br />
Forschung. Bern: Hans Huber Verlag.<br />
Groth<strong>aus</strong>, F.-J. (2009). Entwicklung der integrierten <strong>Versorgung</strong> in der Bundesrepublik<br />
Deutschland 2004-2008 – Bericht gemäß § 140d SGB V auf der Grundlage der<br />
Meldungen von Verträgen zur integrierten <strong>Versorgung</strong>. Zugriff am<br />
25.02.2012. Verfügbar unter http://www.bqs-register140d.de/dokumente/<br />
bericht-140d.pdf.<br />
Gühne, U., Weinmann, S., Arnold, K., Atav, E.-S., Becker, T. & Riedel-Heller, S. (2011).<br />
Akutbehandlung im häuslichen Umfeld: Systematische Übersicht und<br />
Implementierungsstand in Deutschland. Psychiatrische Praxis, 38, 123-128.<br />
Güssow, J., Schumann, A., Braun, G. E., Hildebrandt, H., Stüve, M. (2008). <strong>Integrierte</strong><br />
<strong>Versorgung</strong> nach Inkrafttreten des Wettbewerbsstärkungsgesetzes (GKV-WSG). In<br />
Dieffenbach, S., Harms, K., Heßling-Hohl, M., Müller, J. F. W., Rosenthal, T.,<br />
Schmidt, H.-U. & Thiele, G. (Hrsg.), Management Handbuch Pflege (S. 1-41).<br />
Heidelberg: Economica.<br />
Habermas, J. (1996). Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln. Suhrkamp:<br />
Frankfurt.<br />
Hambrecht, M. (2004). Langer Anlauf, kurzer Sprung: „<strong>Integrierte</strong> <strong>Versorgung</strong>“ nach dem<br />
GMG. Psychiatrische Praxis, 31, 217-218.<br />
Haselmann, S. (2008). Psychosoziale Arbeit in der Psychiatrie - systemisch oder<br />
subjektorientiert? Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Literaturverzeichnis<br />
Haselmann, S. (2010). Die neue Hilfeplanung in der Psychiatrie – Soziale Arbeit zwischen<br />
alten Spannungsfeldern und aktuellen Kontroversen. In Michel-Schwartze, B.<br />
(Hrsg.), "Modernisierungen" methodischen Handelns in der Sozialen Arbeit. (S.<br />
231-287). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.<br />
Hasse, D. (2007). Das Soteria-Konzept. ApK Info, 3, 8-9. Zugriff am 26.02.2012.<br />
Verfügbar unter http://www.apk-berlin.de/redaxo/files/file/info/<br />
InfoHeft2007- 3Farbe-neu.pdf<br />
Helfferich, C. (2011). Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung<br />
qualitativer Interviews. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.<br />
Herriger, N. (2006). Empowerment in der Sozialen Arbeit. Eine Einführung. Stuttgart:<br />
Kohlhammer-Verlag.<br />
Hoffmann, H. (2001). Empirische Untersuchungen zu Soteria <strong>aus</strong> den USA und Europa –<br />
Eine kritische Würdigung. In Ciompi, L., Hoffmann, H. & Broccard, M. (Hrsg.),<br />
Wie wirkt Soteria? Eine atypische Schizophreniebehandlung - kritisch<br />
durchleuchtet (S. 69-102). Bern: Huber.<br />
Hoffmann, H. (2009, Mai). 25 Jahre Soteria Bern – <strong>aus</strong> Freude zur Innovation! Vortrag<br />
gehalten auf der Jubiläumstagung 25 Jahre Soteria Bern, Bern, Schweiz. Zugriff am<br />
10.04.2012. Verfügbar unter http://www.soteria.ch/pdf/referate/Holger_Hoffmann.<br />
pdf<br />
Internationale Arbeitsgemeinschaft Soteria (2011). Soteria – Netzwerk. Umsetzung des<br />
Soteria-Gedanken. Zugriff am 26.02.2012. Verfügbar unter<br />
http://soteria-netzwerk.de/Umsetzung.htm<br />
Jungbauer, J., Bischkopf, J. & Angermeyer, M. C. (2001a). Belastungen von Angehörigen<br />
psychisch Kranker. Entwicklungslinien, Konzepte und Ergebnisse der Forschung.<br />
Psychiatrische Praxis, 28, 105–114.<br />
Jungbauer, J. Bischkopf, J. & Angermeyer, M. C. (2001b). „Die Krankheit hat unser Leben<br />
total verändert“ - Belastungen von Partnern schizophrener Patienten beim Beginn<br />
der Erkrankung. Psychiatrische Praxis, 28, 133–138.
Literaturverzeichnis<br />
Jungbauer, J., Wittmund, B. & Angermeyer, M. C. (2002). Der behandelnde Arzt <strong>aus</strong> Sicht<br />
der Angehörigen: Bewältigungsressource oder zusätzliche Belastung?<br />
Psychiatrische Praxis, 29, 279-284.<br />
Kilian, R. (2008). Lebensqualität und Empowerment in der Psychiatrie. In Groenemeyer,<br />
A. & Wieseler, S. (Hrsg.), Soziologie sozialer Probleme und sozialer Kontrolle.<br />
Realitäten, Repräsentationen und Politik. (S. 314-335). Wiesbaden: Verlag für<br />
Sozialwissenschaften.<br />
Kissling, W. (2008). <strong>Integrierte</strong> <strong>Versorgung</strong>/Disease Management. In Möller, H.-J., Laux,<br />
G. & Kapfhammer, H.-P. (Hrsg.), Psychiatrie und Psychotherapie (S. 963-969).<br />
Heidelberg: Springer Medizin Verlag.<br />
Knuf, A. (2000a). Steine <strong>aus</strong> dem Weg räumen! Empowerment und Gesundheitsförderung<br />
in der Psychiatrie. In Knuf, A. & Seibert, U. (Hrsg.), Selbstbefähigung fördern –<br />
Empowerment und psychiatrische Arbeit (S. 32-44). Bonn: Psychiatie-Verlag.<br />
Knuf, A. (2000b). Fragen zur Anregung von Empowerment-Prozessen. In Knuf, A. &<br />
Seibert, U. (Hrsg.), Selbstbefähigung fördern – Empowerment und psychiatrische<br />
Arbeit (S. 278-280). Bonn: Psychiatrie-Verlag.<br />
Knuf, A. (2005). Empowerment-Förderung: Zentrales Anliegen psychiatrischer Arbeit. Die<br />
Kerbe - Forum für Sozialpsychiatrie, 4, 4-7.<br />
Knuf, A. (2008). Recovery: Wider den demoralisierenden Pessimismus. Genesung auch bei<br />
langzeiterkrankten Menschen. Die Kerbe - Forum für Sozialpsychiatrie, 1, 8-11.<br />
Knuf, A. & Bridler, S. (2008). Recovery konkret.Wie man Zuversicht im psychiatrischen<br />
Alltag vermitteln kann. Psychosoziale Umschau, 4, 26-29.<br />
Kroll, B., Machleidt, W., Debus, S. & Stigler, M. (2001). Soteria zwischen Euphorie und<br />
Ernüchterung. In Bremer, F., Hansen, H., Blume, J. (Hrsg.), Wie geht's uns denn<br />
heute! Sozialpsychiatrie zwischen alten Idealen und neuen Her<strong>aus</strong>forderungen (S.<br />
115-125). Neumünster: Paranus.<br />
Kuckartz, U., Dresing, T., Rädiker, S. & Stefer, C. (2008). Qualitative Evaluation. Der<br />
Einstieg in die Praxis. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Literaturverzeichnis<br />
Kunze, H. & Priebe, S. (2006). <strong>Integrierte</strong> <strong>Versorgung</strong> – Perspektiven für die Psychiatrie<br />
und Psychotherapie. Psychiatrische Praxis, 33, 53-55.<br />
Lamm, D. H. (1991). Psychosocial family intervention in schizophrenia: a review of<br />
empirical studies. Psychological Medicine, 2, 209 – 213.<br />
Lamnek, S. (2005). Qualitative Sozialforschung. Weinheim: Beltz Verlag<br />
Lenz, A. (2002). Empowerment und Ressourcenaktivierung – Perspektiven für die<br />
psychosoziale Praxis. In Lenz, A. & Stark, W. (Hrsg.), Empowerment. Neue<br />
Perspektiven für psychosoziale Praxis und Organisation (S. 13-53). Tübingen:<br />
dgvt-Verlag.<br />
Lenz, A. (2005). Kinder psychisch kranker Eltern. Göttingen: Hogrefe-Verlag.<br />
Mayring, P. (2000, Juni). Qualitative Inhaltsanalyse [28 Absätze]. Forum Qualitative<br />
Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research [Online Journal], 1(2).<br />
Zugriff am 17.02.2012. Verfügbar unter http://qualitative-research.net/fqs/fqs-d/<br />
2-00inhalt-d.htm<br />
Mayring, P. (2002). Einführung in die Qualitative Sozialforschung. Weinheim und Basel:<br />
Beltz Verlag.<br />
Mayring, P. (2005). Qualitative Inhaltsanalyse. In Flick, U., von Kardorrf, E. & Steike, I.<br />
(Hrsg.), Qualitative Forschung. Ein Handbuch (S. 468-475). Reinbek: Rowohlt<br />
Taschenbuch.<br />
Mayring, P. (2008). Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. Weinheim und<br />
Basel: Beltz Verlag.<br />
Mosher, L. R. (2001). Soteria California und ihre amerikanischen Nachfolgeprojekte – Die<br />
therapeutischen Elemente. In Ciompi, L., Hoffmann, H. & Broccard, M. (Hrsg.),<br />
Wie wirkt Soteria? Eine atypische Schizophreniebehandlung - kritisch<br />
durchleuchtet (S. 13-42). Bern: Huber.<br />
Mücke, B. (2009). Psychiatrie-Erfahrung als Kompetenz. Zum trialogischen Arbeiten in<br />
der Berliner ,<strong>Krisenpension</strong>'. Soziale Psychiatrie, 1, 23-25.
Literaturverzeichnis<br />
Munz, I., Ott, M., Jahn, H., R<strong>aus</strong>cher, A., Jäger, M., Kilian, R. & Frasch, K. (2011).<br />
Vergleich stationär-psychiatrischer Routinebehandlung mit wohnfeldbasierter<br />
psychiatrischer Akutbehandlung („Home Treatment“). Psychiatrische Praxis, 38,<br />
114-122.<br />
Peukert, R. & Munkert, M. (2009). „Sie fördern und sie fordern uns“. Psychosoziale<br />
Umschau, 3, 37-38.<br />
Pörksen, N. (2001). Perspektiven in der Psychiatrie – Reform <strong>aus</strong> der Sicht der AKTION<br />
PSYCHISCH KRANKE. In Aktion Psychisch Kranke (Hrsg.), 25 Jahre<br />
Psychiatrie-Enquete (S. 51-58). Bonn: Psychiatrie-Verlag.<br />
Ralph, R. (2000). Review of Recovery Literature. A Synthesis of a Sample of Recovery<br />
Literature. Zugriff am 19.01.2012. Verfügbar unter http://www.nasmhpd.org/<br />
general_files/publications/ntac_pubs/reports/ralphrecovweb.pdf<br />
Ralph, R. & The Recovery Advisory Goup (1999, June). Recovery advisory group<br />
recovery model, a work in progress. Presentation at the National Mental Health<br />
Statistics Conference, Washington, USA. Zugriff am 19.01.2012. Verfügbar unter<br />
www.mhsip.org/recovery<br />
Rappaport, J. (1984). Studies in empowerment: Introduction to the issue. In Rappaport, J.,<br />
Swift, C. F. & Hess, R. E. (Hrsg.), Studies in empowerment (S. 1-7). New York:<br />
Haworth Press.<br />
Rössler, W. (2008). <strong>Versorgung</strong>sstrukturen. In Möller, H.-J., Laux, G. & Kapfhammer, H.-<br />
P. (Hrsg.), Psychiatrie und Psychotherapie (S. 937-962). Heidelberg: Springer<br />
Medizin Verlag.<br />
Schmid, R., Spießl, H. & Peukert, R. (2004). „Außen vor und doch mitten drin“: - Die<br />
Situation von Geschwistern psychisch Kranker. Psychiatrische Praxis, 32, 225-<br />
227.<br />
Schmid, R., Spießl, H., Vukovich, A. & Cording, C. (2003). Belastungen und ihre<br />
Erwartungen an psychiatrische Institutionen. Literaturübersicht und eigene<br />
Ergebnisse. Fortschritte der Neurologie-Psychiatrie, 71, 118-128.
Literaturverzeichnis<br />
Schmid, R., Spießl, H., Vukovich, A. & Cording, C. (2004). „Nutzerorientierung“ in der<br />
stationär-psychiatrischen <strong>Versorgung</strong>: die Perspektive der Angehörigen.<br />
Psychiatrische Praxis, 31 (1), 117-119.<br />
Seibert, U. (2000). Die „Nutzer-Orientierung“ in der Psychiatrie – ein Paradigmenwechsel<br />
hin zum Empowerment? In Knuf, A. & Seibert, U. (Hrsg.), Selbstbefähigung<br />
fördern – Empowerment und psychiatrische Arbeit (S. 20-29). Bonn: Psychiatie-<br />
Verlag.<br />
Seikkula, J. & Arnkil, T. E. (2007). Dialoge im Netzwerk. Neumünster: Paranus Verlag<br />
Brücke Neumünster.<br />
Simon, M. D. (2000). Wir melden uns zu Wort. Die Angehörigen von psychisch Kranken<br />
beziehen Position. Psychiatrische Praxis, 27, 209-213.<br />
Spießl, H., Schmid, R., Vukovich, A. & Cording, C. (2003). Erwartungen von Angehörigen<br />
an die psychiatrische Klinik. Psychiatrische Praxis, 30, 51–55.<br />
Spießl, H., Schmid, R., Vukovich, A. & Cording, C. (2004). Erwartungen und<br />
Zufriedenheit von Angehörigen psychiatrischer Patienten in stationärer<br />
Behandlung. Der Nervenarzt, 75, 475-482.<br />
Spießl, H., Schmid, R., Wiedemann, G. & Cording, C. (2005). Unzufriedene Angehörige –<br />
Kunstfehler psychiatrischer Behandlung oder ökonomische Notwendigkeit?<br />
Psychiatrische Praxis, 32, 215-217.<br />
Steinke, I. (1999). Kriterien qualitativer Forschung. Ansätze zur Bewertung qualitativempirischer<br />
Sozialforschung. Weinheim und München: Juventa Verlag.<br />
Steinke, I. (2007). Qualitätssicherung in der qualitativen Forschung. In Kuckartz, U.,<br />
Grunenberg, H. & Dresing, T. (Hrsg.), Qualitative Datenanalyse: computergestützt.<br />
Methodische Hintergründe und Beispiele <strong>aus</strong> der Forschungspraxis (S. 176-187).<br />
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.<br />
Treeck, B., Bergmann, F. & Schneider, F. (2008). Psychosoziale <strong>Versorgung</strong>. In Schneider,<br />
F. (Hrsg.), Klinikmanual Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (S. 7-16).<br />
Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
Literaturverzeichnis<br />
Vieten, B. & Brinkmann, H. (2000). Zufriedenheit der Angehörigen im Prozess der<br />
Deinstitutionalisierung. Psychiatrische Praxis, 27, 221-227.<br />
Warner, R. (2004). Recovery from Schizophrenia. Psychiatry and Political Economy. New<br />
York: Brunner-Routledge.<br />
Weinmann, S. & Gaebel, W. (2005).<strong>Versorgung</strong>serfordernisse bei schweren psychischen<br />
Erkrankungen. Wissenschaftliche Evidenz zur Integration von klinischer<br />
Psychiatrie und Gemeindepsychiatrie. Der Nervenarzt, 76 (7), 809-821.<br />
Wiedemann, G. & Buchkremer, G. (1996). Familientherapie und Angehörigenarbeit bei<br />
verschiedenen psychiatrischen Erkrankungen. Der Nervenarzt, 67, 524–544.<br />
Wittmund, B. & Kilian, R. (2002). Welche Kosten tragen Angehörige für die Betreuung<br />
psychisch kranker Familienmitglieder? Psychiatrische Praxis, 29, 171-172.<br />
Witzel, A. (1982). Verfahren der qualitativen Sozialforschung. Überblick und Alternativen.<br />
Frankfurt/New York: Campus.<br />
Witzel, A. (1985). Das problemzentrierte Interview. In Jüttemann, G. (Hrsg.),<br />
Qualitative Forschung in der Psychologie. Grundfragen, Verfahrensweisen,<br />
Anwendungsfelder (S. 227-256). Heidelberg: Asanger.<br />
Witzel, A. (2000). The problem-centered interview [26 Absätze]. Forum Qualitative<br />
Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research [Online Journal], 1 (1),<br />
Zugriff am 13.02.2012. Verfügbar unter http://nbn-resolving.de/<br />
urn:nbn:de:0114-fqs0001228<br />
Zechert, C., Faulbaum-Decke, W., Floeth, T., Greuèl, M., Kleinschmidt, M. & Schädle, J.<br />
(2010). <strong>Integrierte</strong> <strong>Versorgung</strong> in der Gemeindepsychiatrie – jetzt! Soziale<br />
Psychiatrie, 1, 4-9.<br />
Zimmerman, M. A. (2000). Empowerment Theory. Psychological, Organizational and<br />
Community Levels of Analysis. In Rappaport, J. & Seidman, E. (Hrsg.), Handbook<br />
of Community Psychology (S. 43-63). New York: Kluwer Academic/Plenum<br />
Publishers.
Tabellenverzeichnis<br />
Tabellenverzeichnis<br />
Tabelle 1:<br />
Tabelle 2:<br />
Tabelle 3:<br />
Demografische Daten des Samplings..........................................................43<br />
Ergebnisübersicht........................................................................................86<br />
Ableitung von Vor<strong>aus</strong>setzungen..................................................................92
Abbildungsverzeichnis<br />
Abbildungsverzeichnis<br />
Abbildung 1: Datenübersicht.…........................................................................................53<br />
Abbildung 2: K1 Veränderungen.......................................................................................54<br />
Abbildung 3: K3 Hilfreiche Konzepte...............................................................................71<br />
Abbildung 4: K4 Idealversorgung.....................................................................................80<br />
Abbildung 5: Vor<strong>aus</strong>setzungen..........................................................................................93<br />
Abbildung 6: Ergebniskategorien und Fragestellung im Zusammenhang........................96
Anhang<br />
Anhang<br />
Der Anhang der vorliegenden Arbeit befindet sich als separates Dokument auf der<br />
beiliegenden Daten-CD. Im Folgenden wird eine Übersicht über die Zusammensetzung des<br />
Anhanges gegeben:<br />
Inhaltsverzeichnis des Anhanges<br />
Anhang A: Informationsschreiben................................................................................3<br />
Anhang B: Datenschutzvertrag.....................................................................................4<br />
Anhang C: Transkriptionsregeln...................................................................................5<br />
Anhang D: Interviewleitfaden.......................................................................................6<br />
Anhang E: Beispiel<strong>aus</strong>wertung...................................................................................12<br />
Anhang F: Beispieltranskript......................................................................................24<br />
Darüber hin<strong>aus</strong> enthält die Daten-CD den Ordner zusätzliche Daten, in dem alle<br />
Transkripte, die Beispiel<strong>aus</strong>wertung als einzelne Datei sowie die Datei Interviewvergleich<br />
zu finden sind. Letztere Datei ist eine Tabelle, in der eine Gegenüberstellung aller<br />
Interviews über alle Kategorien vorgenommen wurde, um einen Überblick über alle Daten<br />
zu erhalten.