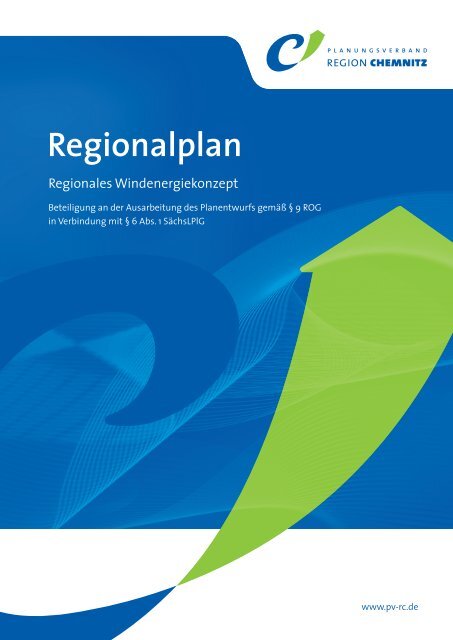Regionalplan
Regionalplan
Regionalplan
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Regionalplan</strong><br />
Regionales Windenergiekonzept<br />
Beteiligung an der Ausarbeitung des Planentwurfs gemäß § 9 ROG<br />
in Verbindung mit § 6 Abs. 1 SächsLPlG<br />
www.pv-rc.de
Impressum<br />
Plangeber und<br />
Herausgeber:<br />
Planungsverband Region Chemnitz<br />
Paulus-Jenisius-Str. 24<br />
09456 Annaberg-Buchholz<br />
Telefon: (03733) 831 1000<br />
Telefax: (03733) 831 1027<br />
E-Mail: info@pv-rc.de<br />
Bearbeitung:<br />
Planungsverband Region Chemnitz<br />
Verbandsgeschäftsstelle<br />
Werdauer Straße 62<br />
08056 Zwickau<br />
Telefon: (0375) 289 405 0<br />
Telefax: (0375) 289 405 90<br />
E-Mail: info@pv-rc.de<br />
Druck:<br />
reprogress GmbH<br />
Chemnitzer Straße 46b<br />
01187 Dresden
<strong>Regionalplan</strong> Region Chemnitz; Regionales Windenergiekonzept - Fachkonzept<br />
Beteiligung an der Ausarbeitung des Planentwurfs gemäß § 9 ROG<br />
in Verbindung mit § 6 Abs. 1 SächsLPlG<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
Vorbemerkung 5<br />
1 Bundesweite Vorgaben 6<br />
1.1 Fachliche Rahmenbedingungen 6<br />
1.2 Rechtliche Rahmenbedingungen 7<br />
1.2.1 Privilegierung von Windenergieanlagen 7<br />
1.2.2 Harte und weiche Tabuzonen 7<br />
1.3 Raumbedeutsamkeit von Windenergieanlagen 9<br />
2 Sächsische Vorgaben 9<br />
3 Derzeitige Nutzung der Windenergie in der Region 12<br />
4 Planungsmethodik und Arbeitsschritte 12<br />
4.1 Planungsmethodik 12<br />
4.2 Arbeitsschritte 13<br />
4.2.1 Bestimmung von harten Tabuzonen 13<br />
4.2.1.1 Siedlung 13<br />
4.2.1.2 Wald 15<br />
4.2.1.3 Einrichtungen, Trassen und Leitungen der technischen Infrastruktur 19<br />
4.2.1.4 Still- und Fließgewässer 23<br />
4.2.1.5 Wasser- und Heilwasserschutzgebiete 23<br />
4.2.1.6 Hochwasserschutz 24<br />
4.2.1.7 Luftverkehr und Landesverteidigung 27<br />
4.2.1.8 Naturschutz 28<br />
4.2.1.9 Bergbau 28<br />
4.2.1.n<br />
ggf. weitere harte Tabuzonen<br />
4.2.2 Bestimmung von weichen Tabuzonen 29<br />
4.2.2.1 Besonderer Artenschutz 30<br />
4.2.2.1.1 Gebiete mit besonderer avifaunistischer Bedeutung 32<br />
4.2.2.1.2 Gebiete mit besonderer Bedeutung für Fledermäuse 38<br />
4.2.2.2 Kulturlandschaft 40<br />
4.2.2.2.1 Landschaftsprägende Erhebungen 40<br />
4.2.2.2.2 Regional bedeutsame Aussichtspunkte und Aussichtsbereiche 43<br />
4.2.2.2.3 Wertvolle historische Kulturlandschaften 43<br />
4.2.2.2.4 Regional bedeutsame Kulturdenkmale 45<br />
4.2.2.n<br />
ggf. weitere weiche Tabuzonen<br />
4.2.3 Ermittlung des Windpotenzials<br />
4.2.4<br />
Abwägung mit anderen Raumfunktionen bzw. konkurrierenden<br />
Raumnutzungen<br />
4.2.5 Einzelfallprüfung der potenziellen VREG Wind unter Berücksichtigung<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Seite 3 (von 46)
<strong>Regionalplan</strong> Region Chemnitz; Regionales Windenergiekonzept - Fachkonzept<br />
Beteiligung an der Ausarbeitung des Planentwurfs gemäß § 9 ROG<br />
in Verbindung mit § 6 Abs. 1 SächsLPlG<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
des Anlagenbestandes, der bisher regionalplanerisch ausgewiesenen<br />
Vorrang-/Eignungsgebiete sowie benachbarten geeigneten Gebieten<br />
4.2.6 Nachweis der Erbringung des regionalen Mindestenergieertrages<br />
ggf. Überprüfung, Änderung bzw. Wiederholung der Arbeitsschritte<br />
4.2.7 4.2.2 bis 4.2.6, wenn der Windenergienutzung nicht in substanzieller<br />
Weise Raum geschaffen wurde<br />
5 Festlegung der VREG Wind<br />
Hinweis: Die grau markierten Themen sind kein Gegenstand des Entwurfes des <strong>Regionalplan</strong>es für die Ausarbeitung nach § 6<br />
Abs. 1 SächsLPlG. Sie sind erst Bestandteil des voraussichtlich im Jahr 2014 folgenden nächsten Verfahrensschrittes<br />
bei der Erarbeitung des <strong>Regionalplan</strong>es, der öffentlichen Auslegung des Plans nach § 10 Abs. 1 Satz 2 ROG i. V.<br />
m. § 6 Abs. 2 SächsLPlG.<br />
Karten<br />
Nr. Bezeichnung und Inhalte der Karte Maßstab<br />
1<br />
2<br />
3<br />
Siedlung (Kap. 4.2.1.1)<br />
• Siedlungsbestand<br />
• differenzierte Abstandzone zur Siedlung aufgrund unterschiedlicher Schutzansprüche<br />
Wald (Kap. 4.2.1.2)<br />
• Waldbestand<br />
• Wald mit Funktionen von besonderer Bedeutung<br />
• Wald mit gesetzlicher vorgegebener Funktion (SächsWaldG)<br />
Avifauna (Kap. 4.2.2.1.1)<br />
• Gebiete mit besonderer avifaunistischer Bedeutung<br />
1 : 450 000<br />
1 : 450 000<br />
1 : 450 000<br />
4<br />
5<br />
Fledermäuse (Kap. 4.2.2.1.2)<br />
• Gebiete mit besonderer Bedeutung für Fledermäuse<br />
Kulturlandschaft<br />
• Landschaftsprägende Erhebungen<br />
• Regional bedeutsame Aussichtspunkte<br />
• Wertvolle historische Kulturlandschaften<br />
• Regional bedeutsame Kulturdenkmale<br />
1 : 450 000<br />
1 : 450 000<br />
6 Potenzialgebiete (Übersicht) 1 : 450 000<br />
7<br />
Anlagen<br />
Potenzialgebiete - Kreiskarten -<br />
7.1 Erzgebirgskreis, Landkreis Mittelsachsen sowie kreisfreie Stadt<br />
Chemnitz<br />
7.2 Landkreis Zwickau und Vogtlandkreis<br />
1 : 100 000<br />
1<br />
2<br />
Überblick zu landesplanerischen Abstandsempfehlungen für die <strong>Regionalplan</strong>ung zur<br />
Ausweisung von Windenergiegebieten<br />
Überblick von „harten“ und „weichen“ Tabuzonen für die Windenergienutzung (vereinfacht,<br />
nicht abschließend)<br />
3 Regional bedeutsame Aussichtspunkte<br />
4 Kulturdenkmale mit besonderer Freiraumrelevanz<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Seite 4 (von 46)
<strong>Regionalplan</strong> Region Chemnitz; Regionales Windenergiekonzept - Fachkonzept<br />
Beteiligung an der Ausarbeitung des Planentwurfs gemäß § 9 ROG<br />
in Verbindung mit § 6 Abs. 1 SächsLPlG<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
Vorbemerkung<br />
Im Gegensatz zu den beiden möglichen „Extrem“ Varianten bei der Beteiligung an der Ausarbeitung<br />
des <strong>Regionalplan</strong>entwurfs gemäß § 9 ROG i. Z. m. § 6 SächsLPlG - dem Ausreichen<br />
eines groben Eckpunktepapiers einerseits bzw. der Ausweisung der konkreten VREG<br />
Wind in der Raumnutzungskarte andererseits – ist der PV RC bei der Erarbeitung des Regionalen<br />
Windenergiekonzeptes schrittweise vorgegangen.<br />
Wesentliches Leitmotiv war dabei, von Anfang an die Gemeinden und Landkreise, die Träger<br />
öffentlicher Belange, die Investoren, Vertreter der Wirtschaft, die Befürworter und Gegner der<br />
Windenergienutzung durch eine für alle Seiten nachvollziehbare und transparente Vorgehensweise<br />
in die Erarbeitung des regionalen Windenergiekonzeptes mit einzubeziehen und<br />
die einzelnen Arbeitsschritte jeweils ausführlich zu erläutern.<br />
Auf bisher vier öffentlichen Sitzungen des Planungsausschusses (PA) des Verbandes (9. PA<br />
am 7. Februar, 10. PA am 20. März, 11. PA am 26. Juni 2012 sowie 13. PA am 26.02.2013)<br />
wurde das Vorgehen zur Erarbeitung des Regionalen Windenergiekonzeptes vorgestellt und<br />
beraten. Dabei wurden alle Themen außer dem Pkt. 4.2.1.n bis zum Gliederungspunkt<br />
4.2.2.n des Inhaltsverzeichnisses behandelt. Die im Rahmen der öffentlichen Sitzungen dazu<br />
erarbeiteten Sitzungsvorlagen bildeten die Grundlage für den vorliegenden Entwurf des Regionalen<br />
Windenergiekonzeptes. Abweichend davon wurden in diesem Konzept nur die ausgewählten<br />
Kriterien auch kartographisch dargestellt, die auf andere Weise räumlich nicht einfach<br />
zu bestimmen sind.<br />
Durch die Realisierung dieser Verfahrensweise geht der Planungsträger auch davon aus,<br />
dass damit der von den Verwaltungsgerichten immer wieder geforderten Dokumentationspflicht<br />
der Planungsmethodik und der einzelnen Arbeitsschritte entsprochen wird.<br />
Gegenstand des Entwurfes für das Beteiligungsverfahren an der Ausarbeitung des Planentwurfes<br />
nach § 6 Abs. 1 SächsLPlG ist somit der Entwurf des Regionalen Windenergiekonzeptes<br />
einschließlich der kartographischen Darstellung der Potenzial- und Ausschlussgebiete für<br />
Windenergie (siehe Karte 6 zur Übersicht bzw. auch Karten 7.1 und 7.2). Diese Gebiete entsprechen<br />
somit ausschließlich dem Sachstand der bisher erfolgten Erarbeitung des Regionalen<br />
Windenergiekonzeptes. Dieser Sachstand stellt lediglich ein Zwischenergebnis dar und<br />
ist somit nicht abschließend. Die ermittelten und dargestellten Potenzial- und Ausschlussgebiete<br />
Wind sind somit keinesfalls gleichzusetzen mit Vorrang- und Eignungsgebieten Wind.<br />
Dafür erforderlich sind sowohl die abschließende Bearbeitung aller im Inhaltsverzeichnis<br />
noch grau markierten Plankapitel als auch die weiteren, voraussichtlich im Jahr 2014 folgenden<br />
nächsten Verfahrensschritte bei der Erarbeitung des <strong>Regionalplan</strong>es, insbesondere die<br />
öffentliche Auslegung des Plans nach § 10 Abs. 1 Satz 2 ROG i. V. m. § 6 Abs. 2 Sächs-<br />
LPlG.<br />
Das regionale Windenergiekonzept ist durch die bei der Ausarbeitung des <strong>Regionalplan</strong>es zu<br />
Beteiligenden insbesondere hinsichtlich nachfolgender Fragestellungen zu prüfen:<br />
• Definition der Raumbedeutsamkeit von Windenergieanlagen (siehe Kap. 1.3)<br />
• Kriterien – Vollständigkeit, räumliche Ausprägung und Bestimmung der Ausschlusskriterien<br />
in harte und weiche Tabuzonen/Kriterien, hier insbesondere in Bezug auf die<br />
Siedlungsfläche, den Wald sowie Hochwasserentstehungsgebiete sowie die Einordnung<br />
aller im vorliegenden Konzept bisher als weiche Tabuzonen bestimmten Kriterien<br />
• Durchführung der Einzelfallprüfung der zuständigen Fachbehörden (insbesondere der<br />
Natur-, Denkmalschutz- und Baubehörden) in Bezug auf die sachliche und räumliche<br />
Bestimmung der harten Tabuzonen innerhalb von Natura 2000- Gebieten (FFH-,<br />
SPA-Gebiete), LSG, Naturpark, ND, GLB, bei artenschutzrechtlichen Tatbeständen<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Seite 5 (von 46)
<strong>Regionalplan</strong> Region Chemnitz; Regionales Windenergiekonzept - Fachkonzept<br />
Beteiligung an der Ausarbeitung des Planentwurfs gemäß § 9 ROG<br />
in Verbindung mit § 6 Abs. 1 SächsLPlG<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
sowie bei Abgrabungen und beim Denkmalschutz (siehe Kap. 4.2.1.8, 4.2.2.1 und<br />
4.2.2.2)<br />
• Hinweise zu (weiteren) öffentlich- rechtlichen Belangen, die für oder gegen die Nutzung<br />
der Windenergie in den bisher ermittelten und dargestellten Potenzialgebieten<br />
sprechen (Ergänzung der Kriterien in Kap. 4.2.1 n bzw. 4.2.2.n).<br />
Im Ergebnis der Beteiligung an der Ausarbeitung erfolgt die abschließende Bestimmung der<br />
Definition der Raumbedeutsamkeit von Windenergieanlagen sowie der Kriterien einschließlich<br />
ihrer räumlichen Ausprägung. Danach werden insbesondere die Planungsschritte ab<br />
dem Kapitel 4.2.3 des Konzeptes durchgeführt. Die daraus ermittelten möglichen Vorrangund<br />
Eignungsgebiete Wind sind sodann Gegenstand der Strategischen Umweltprüfung entsprechend<br />
der Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 27.<br />
Juni 2001, die gemäß § 2 Abs. 2 Satz 2 SächsLPlG zugleich die Prüfung der Verträglichkeit<br />
mit den Erhaltungszielen oder dem Schutzzweck der Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung<br />
und der Europäischen Vogelschutzgebiete (FFH- und SPA- Gebiete) umfasst. Die im Ergebnis<br />
dieser Prüfung auszuweisenden Vorrang- und Eignungsgebiete Wind sind dann Bestandteil<br />
des nächsten Verfahrensschrittes bei der Erarbeitung des <strong>Regionalplan</strong>es, der öffentlichen<br />
Auslegung des Plans nach § 10 Abs. 1 Satz 2 ROG i. V. m. § 6 Abs. 2 SächsLPlG.<br />
Diese wird voraussichtlich im Jahr 2014 stattfinden.<br />
1. Bundesweite Vorgaben<br />
1.1 Fachliche Rahmenbedingungen<br />
Seit dem schnellen Gesetzgebungsverfahren des Gesetzespakets zur Energiewende im<br />
Sommer 2011 (am 6. Juni im Kabinett, am 30. Juni im Bundestag, am 8. Juli im Bundesrat,<br />
ausgefertigt am 22. Juli, in Kraft im Wesentlichen noch im August 2011, EEG zum 1. Januar<br />
2012) mit der Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG), des Gesetzes zur Stärkung<br />
der klimagerechten Entwicklung in den Städten und Gemeinden und des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes<br />
(NABEG) beschränkten sich die weiteren Aktivitäten der Bundesregierung<br />
im zweiten Halbjahr 2011 und im Jahr 2012 auf die Einberufung von Energiegipfeln<br />
und den Diskussionen zu den Auswirkungen des EEG vor dem Hintergrund steigender<br />
Energiepreise sowie zum Stromnetzausbau.<br />
Die im Mai 2011 erstmals zusammengetretene Bund-Länder-Initiative zur Ausweisung von<br />
Flächen für neue Windenergiegebiete (BLWE) tagte bisher zehnmal (letzte Sitzung am 21.<br />
Januar 2013). Es wurden zwar eine breite Palette von Themen diskutiert (Abstandsregelungen,<br />
Höhenbegrenzungen, Tabukriterien, Windenergienutzung im Wald u. a.) und einzelne<br />
Länderregelungen synoptisch aufbereitet, regionalplanerisch für Sachsen Verwertbares kam<br />
dabei aber nicht heraus. Der anfängliche Wille des Bundes, nämlich gemeinsam mit den<br />
Ländern pauschale, „starre“ Abstands- und Höhenbegrenzungen durch bundesweit (einheitliche)<br />
Kriterien für die Anwendung von sachgerechten Abstands- und Höhenbegrenzungen<br />
im Einzelfall zu ersetzen, konnte nicht umgesetzt werden. Eine umfassende Dokumentation<br />
zur Arbeit der BLWE soll im Frühjahr 2013 erstellt werden.<br />
Die Bundesregierung sieht auch keine Notwendigkeit für einen gesamtdeutschen Raumordnungsplan<br />
mit verbindlichen Flächenvorgaben für erneuerbare Energien für die einzelnen<br />
Bundesländer. Dies erklärte die Bundesregierung in ihrer Antwort (Bundestags-Drucksache<br />
17/7752 vom 17. November 2011) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen<br />
(Bundestags-Drucksache 17/7573 vom 31. Oktober 2011). Eine verbindliche Vorgabe<br />
durch den Bund sei in der Praxis schon deshalb nicht sachgerecht, weil für ein effizientes<br />
Raummanagement die örtlichen Gegebenheiten der einzelnen Regionen im Ansatz gebracht<br />
werden müssten.<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Seite 6 (von 46)
<strong>Regionalplan</strong> Region Chemnitz; Regionales Windenergiekonzept - Fachkonzept<br />
Beteiligung an der Ausarbeitung des Planentwurfs gemäß § 9 ROG<br />
in Verbindung mit § 6 Abs. 1 SächsLPlG<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
1.2 Rechtliche Rahmenbedingungen<br />
1.2.1 Privilegierung von Windenergieanlagen<br />
Mit der Novelle des Baugesetzbuches (BauGB) 1996 wurden Vorhaben, die der Erforschung,<br />
Entwicklung oder Nutzung der Windenergie dienen, explizit in den Katalog des § 35 Abs. 1<br />
BauGB der privilegierten Vorhaben im Außenbereich aufgenommen. Sie sind somit im Außenbereich<br />
prinzipiell zulässig, soweit sie der öffentlichen Stromversorgung dienen, die Erschließung<br />
gesichert ist und ihnen keine öffentlichen Belange entgegenstehen. Gleichzeitig<br />
mit dieser Privilegierung hat der Gesetzgeber mit dem Planvorbehalt (Konzentrationsanordnung)<br />
nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB aber auch ein Korrektiv eingeführt. Dieses eröffnet<br />
sowohl den Gemeinden als auch den Regionen als Trägern der Flächennutzungs- bzw. <strong>Regionalplan</strong>ung<br />
die Möglichkeit, durch die Ausweisung geeigneter Flächen sowohl eine Konzentration<br />
der Windenergieanlagen als auch gleichzeitig den Ausschluss dieser Nutzung im<br />
übrigen Planungsraum zu erreichen.<br />
Dabei enthält § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB keine Pflicht, sondern nur das Recht, Konzentrationszonen<br />
auszuweisen. Die Planungsträger sind somit aufgrund der bundesdeutschen Vorgaben<br />
in ihrer Entscheidung grundsätzlich frei, ob sie überhaupt eine solche Planung für erforderlich<br />
halten bzw. wann sie diese durchführen. Allerdings hat im Freistaat Sachsen das<br />
Land bereits mit dem Ziel 11.4 des LEP 2003 (inhaltliche Übereinstimmung mit dem Ziel<br />
5.1.3 des Entwurfs des LEP 2012 für das Beteiligungsverfahren nach §§ 9 und 10 ROG in<br />
Verbindung mit § 6 Abs. 2 SächsLPlG) bestimmt, dass in den Regionalplänen der Planvorbehalt<br />
zwingend anzuwenden und damit durch die regionalen Planungsträger eine abschließende,<br />
flächendeckende Planung vorzunehmen ist. Im Ergebnis wird mit dieser Festlegung<br />
den Regionen und Kommunen einerseits die durch den Bund grundsätzlich eröffnete Wahlmöglichkeit<br />
für oder gegen die Inanspruchnahme des Planvorbehaltes verwehrt und andererseits<br />
verpflichtend den Planungsverbänden der Auftrag zur Erarbeitung eines abschließenden<br />
Windenergiekonzeptes und damit die Ordnung, Steuerung und letztendlich auch<br />
Kontingentierung von raumbedeutsamen Windenergieanlagen erteilt. Für einen Überblick zu<br />
den gegenwärtig in den einzelnen Bundesländern verwendeten Gebietskategorien zur Nutzung<br />
der Windenergie siehe Anlage 1.<br />
Als Planungsinstrument für die Erstellung eines abschließenden und flächendeckenden<br />
Windenergiekonzeptes ist dabei von den Trägern der <strong>Regionalplan</strong>ung in Sachsen in Übereinstimmung<br />
mit § 2 Abs. 2 Satz 2 SächsLPlG, wonach Eignungsgebiete nur in Verbindung<br />
mit Vorranggebieten ausgewiesen werden dürfen, ausschließlich die Ausweisung von Vorrang-/Eignungsgebieten<br />
(VREG) vorzunehmen. Damit wird regelmäßig der Vorrang der Errichtung<br />
von Windenergieanlagen innerhalb des ausgewiesenen Gebietes mit dem Ausschluss<br />
von Windenergieanlagen außerhalb dieses Gebietes kombiniert. Deshalb muss die<br />
planerische Entscheidung nicht nur Auskunft darüber geben, von welchen Erwägungen die<br />
positive Standortzuweisung getragen wird, sondern auch deutlich machen, welche Gründe<br />
es rechtfertigen, den übrigen Planungsraum von Windenergieanlagen freizuhalten. Die positive<br />
und die negative Komponente der festgelegten Konzentrationszonen bedingen einander.<br />
1.2.2 Harte und weiche Tabuzonen<br />
Bundesweit wird gegenwärtig eine breite und noch nicht abgeschlossene Diskussion zu harten<br />
und weichen Tabukriterien und -zonen, insbesondere zu deren Definition, Bestimmung<br />
und vor allem Abgrenzung unter- und gegeneinander (zuletzt vorm Bundesverwaltungsgericht<br />
Leipzig am 13. Dezember 2012 in der Rechtssache Wustermark, BVerwG 4 CN 1.11<br />
und 4 CN 2.11 und zur Eröffnungsveranstaltung der Koordinierungsstelle Windenergierecht<br />
in Braunschweig am 11. Januar 2013) geführt.<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Seite 7 (von 46)
<strong>Regionalplan</strong> Region Chemnitz; Regionales Windenergiekonzept - Fachkonzept<br />
Beteiligung an der Ausarbeitung des Planentwurfs gemäß § 9 ROG<br />
in Verbindung mit § 6 Abs. 1 SächsLPlG<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
Die Unterscheidung bzw. Differenzierung in harte und weiche Kriterien bzw. Tabuzonen wird<br />
in der Rechtsprechung und Literatur erst seit dem Jahr 2009 [vgl. GATZ (2009); BVerwG 4<br />
BN 25.09 Beschluss vom 15. September 2009] vorgenommen. Zuvor wurden im fachlichen<br />
Sprachgebrauch weitgehend synonym Begriffe mit der ersten Worthälfte Ausschluss-, Restriktions-,<br />
Abstands- und Tabu- und der zweiten Worthälfte -flächen, -gebiete, -bereiche und -<br />
zonen sowie den damit möglichen verschiedenen Wortkombinationen gebildet und verwendet.<br />
Gegenwärtig ist die aktuelle höchstrichterliche Rechtsprechung der Auffassung, dass ein<br />
Plangeber ausdrücklich zwischen harten und weichen Tabuzonen zu differenzieren hat (so<br />
BVerwG, Urteile vom 13.12.2012, Az.: 4 CN 1.11 und 4 CN 2.11, zuvor OVG Berlin-<br />
Brandenburg, Urteile von 24.2.2011, Az.: 2 A 24.09 und 2 A 2.09). Danach müsse der Planungsträger<br />
ermitteln und dokumentieren, welcher Teil eines angewendeten Kriteriums - z.<br />
B. einer Abstandszone - tatsächlich immissionsschutzrechtlich (z. B. zur Einhaltung der TA<br />
Lärm) geboten ist (entspricht dem harten Tabukritierium) und welcher aus Gründen des vorbeugenden<br />
Immissionsschutzes (entspricht dem weichen Tabukriterium) darüber hinausgeht.<br />
Im Rahmen des Regionalen Windenergiekonzeptes wird unter einem Kriterium ein charakteristisches<br />
Kennzeichen bzw. unterscheidendes Merkmal und damit eine für die Region regionsweit<br />
vergleichbare Bewertungsnorm verstanden. Ausschluss- bzw. Tabuzonen und -<br />
gebiete bedeuten dabei, dass in diesen raumbedeutsame Windenergieanlagen im Sinne des<br />
Planvorbehaltes des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB regelmäßig unzulässig sind. Hart sind die<br />
Kriterien für diese Zonen bzw. Gebiete dann, wenn in ihnen rechtlich und/oder tatsächlich die<br />
Errichtung dieser Anlagen unzulässig bzw. unmöglich ist. Harte Kriterien bzw. ihre räumliche<br />
Ausprägung können sowohl pauschal oder auch auf den Einzelfall bezogen bestimmt werden.<br />
Sie sind einer regionalplanerischen Abwägung nicht zugänglich.<br />
In der praktischen Anwendung gestaltet sich die Bestimmung der harten Kriterien bzw. ihrer<br />
räumlichen Ausprägung teilweise jedoch schwierig. So ist z. B. der Siedlungsbestand unbestritten<br />
ein hartes Kriterium im Sinne der Definition. Einer differenzierten Betrachtung bedarf<br />
es hingegen bei der Bestimmung des Maßes des Abstandes zum Siedlungsbestand (siehe<br />
dazu auch die Vorgehensweise in Kap. 4.2.1.1 bzw. zur Abgrenzung der weichen Tabuzonen/Kriterien<br />
in Kap. 4.2.2).<br />
Der Plangeber sichert im Ergebnis der Erarbeitung des regionalen Windenergiekonzeptes<br />
durch die Ausweisung von Vorrang- und Eignungsgebieten Wind ausschließlich Räume bzw.<br />
Gebiete, in denen die Windenergienutzung Vorrang vor allen anderen Raumnutzungen hat.<br />
Die Art und Anzahl der in diesen Räumen und Gebieten tatsächlich zu errichtenden Windenergieanlagen<br />
einschließlich der konkreten Standorte dieser Anlagen sind dem Plangeber<br />
dabei jedoch nicht bekannt. Sie sind durch diesen im Rahmen des regionalen Windenergiekonzeptes<br />
auch nicht vorhersehbar. Insofern ist auf der regionalen Planungsebene eine konkrete<br />
anlagenbezogene Prüfung der Auswirkungen des Standortes z. B. in Bezug auf Geräuschimmissionen<br />
und Schattenwurf, wie sie im Rahmen eines immissionsschutzrechtlichen<br />
Zulassungsverfahrens im Einzelfall durch entsprechende Schallimmissions- und Schattenwurfprognosen<br />
durchzuführen sind, nicht möglich.<br />
Unabhängig davon hat der Plangeber jedoch zu beachten und zu sichern, dass innerhalb der<br />
durch ihn ausgewiesenen Vorrang- und Eignungsgebieten Wind der Windenergienutzung unter<br />
Beachtung der Konzentrationsanordnung auch tatsächlich den im Geltungszeitraum des<br />
Planes nach Stand der Technik üblicherweise zu errichtenden raumbedeutsamen Windenergieanlagen<br />
Raum gegeben werden kann und insoweit in diesen Gebieten der Windenergienutzung<br />
regelmäßig keine öffentlich- rechtlichen Belange mehr entgegenstehen. Darüber<br />
hinaus sind dem regionalen Planungsträger Regelungen zum Emissionsverhalten der Anlagen<br />
jedoch regelmäßig verwehrt. Die Nutzung der Vorrang- und Eignungsgebiete Wind hat<br />
er deshalb auch dann zu gewährleisten, wenn in ihnen Anlagen errichtet werden, die hinsichtlich<br />
ihrer Ausmaße sowie Leistungs- bzw. Emissionsparameter die im Geltungszeitraum<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Seite 8 (von 46)
<strong>Regionalplan</strong> Region Chemnitz; Regionales Windenergiekonzept - Fachkonzept<br />
Beteiligung an der Ausarbeitung des Planentwurfs gemäß § 9 ROG<br />
in Verbindung mit § 6 Abs. 1 SächsLPlG<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
des Planes jeweilig verfügbaren größten bzw. ungünstigsten Werte (z. B. hinsichtlich der Geräuschemissionen<br />
oder des Schattenwurfs) aufweisen.<br />
1.3 Raumbedeutsamkeit von Windenergieanlagen<br />
Gegenstand des regionalen Windenergiekonzeptes sind ausschließlich raumbedeutsame<br />
Windenergieanlagen. Nach der Legaldefinition in § 3 Abs. 1 Nr. 6 Raumordnungsgesetz<br />
(ROG) ist ein Vorhaben raumbedeutsam, wenn es Raum in Anspruch nimmt oder die räumliche<br />
Entwicklung bzw. Funktion eines Gebietes beeinflusst. In der Rechtsprechung ist bislang<br />
nicht abschließend geklärt, ab welcher Größe, welcher Anlagenzahl und unter welchen Voraussetzungen<br />
Windenergieanlagen als raumbedeutsam anzusehen sind. Bei der Frage der<br />
Beurteilung der Raumbedeutsamkeit von Vorhaben zur Windenergienutzung handelt es sich<br />
um eine im konkreten Einzelfall zu treffende Entscheidung (vgl. OVG Münster, Beschluss<br />
vom 3. September 1999, 10 B 1283/99, Urteil des BVerwG vom 13. März 2003, 4 C 4.02).<br />
Um raumbedeutsam zu sein, müssen von einem Vorhaben Auswirkungen über seinen unmittelbaren<br />
Nahbereich hinausgehen. Das kann bei Windenergieanlagen auch schon bei einer<br />
einzelnen Anlage ab einer Gesamthöhe von 35 Metern (vgl. GATZ 2009) über der bestehenden<br />
Geländeoberfläche der Fall sein.<br />
Als Beurteilungskriterien für die Raumbedeutsamkeit können herangezogen werden:<br />
1. die besondere Dimension der Windenergieanlage(n) (Höhe und Durchmesser des Rotors),<br />
2. der Standort, die Lage der Windenergieanlage(n) und die damit verbundenen Sichtverhältnisse,<br />
auch im Hinblick auf vorhandenes Konfliktpotential,<br />
3. die Auswirkungen auf bestimmte planerische Ziele der Raumordnung.<br />
Im Rahmen des regionalen Windenergiekonzeptes wird unter Beachtung der in der Region<br />
vorhandenen Landschaftsräume bereits eine einzelne Windenergieanlage ab 50 m Gesamthöhe<br />
als raumbedeutsam angesehen. Diese Höhe korrespondiert mit der immissionsschutzrechtlich<br />
Genehmigungsbedürftigkeit solcher Anlagen nach § 4 Bundes-<br />
Immissionsschutzgesetz [BlmSchG vom 26. September 2002 (BGBl. I S. 3830)], i. V. m. Nr.<br />
1.6 Spalte 2 des Anhangs zur Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4.<br />
BlmSchV). Regelungsgegenstand des regionalen Windenergiekonzeptes sind somit regelmäßig<br />
alle Windenergieanlagen mit 50 und mehr Metern Gesamthöhe.<br />
2. Sächsische Vorgaben<br />
Die sächsische Staatsregierung hat mit Kabinettsbeschluss vom 12. März 2012 das gemeinsam<br />
vom SMWA uns SMUL erarbeitete Energie- und Klimaprogramms Sachsen 2012 (EKP)<br />
verabschiedet. Danach soll der Anteil erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch im<br />
Freistaat Sachsen bis zum Jahr 2020 auf 28 % steigen.<br />
Das Potenzial zur Stromerzeugung aus Wasserkraft ist mit 320 GWh/a nahezu ausgeschöpft.<br />
Aus Biomasse werden derzeit 1.385 GWh/a erzeugt, ein Anstieg auf 1.800 GWh/a<br />
als realistisch angesehen. Aus solarer Strahlungsenergie könnten aus Sicht der Sächsischen<br />
Staatsregierung von derzeit 900 GWh/a in den nächsten zehn Jahren rund 1.800 GWh/a<br />
wirtschaftlich sinnvoll bereitgestellt werden. Wann und inwieweit in einem nennenswerten<br />
Umfang Strom aus Tiefengeothermie erzeugt werden kann, ist derzeit nicht absehbar.<br />
Die Sächsische Staatsregierung sieht es als möglich an, in den nächsten zehn Jahren die<br />
Stromerzeugung aus Windenergie im Wesentlichen auf den bereits durch die <strong>Regionalplan</strong>ung<br />
festgelegten Flächen, einer moderaten Erweiterung dieser Flächen, durch sensibles<br />
Repowering bestehender Anlagen und die zurückhaltende Erschließung neuer Standorte<br />
von derzeit 1.700 GWh/a auf 2.200 GWh/a zu steigern. Dabei ist es unerlässlich, dass die<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Seite 9 (von 46)
<strong>Regionalplan</strong> Region Chemnitz; Regionales Windenergiekonzept - Fachkonzept<br />
Beteiligung an der Ausarbeitung des Planentwurfs gemäß § 9 ROG<br />
in Verbindung mit § 6 Abs. 1 SächsLPlG<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
Bürger sowohl bei Neu-Standorten, als auch bei Repowering frühzeitig und umfassend in die<br />
Planungen einbezogen werden. Denn auch Repowering-Anlagen können durch ihre Größe<br />
und die damit verbundenen Auswirkungen auf das Landschaftsbild, die Umwelt und den<br />
Menschen zu vielen Problemen führen. Bei der Errichtung von Windenergieanlagen müssen<br />
die lokale Akzeptanz, der Schutz der betroffenen Anwohner, die Beachtung der Belange des<br />
Umwelt- und Naturschutzes sowie die Einhaltung hinreichend großer Abstandsflächen zur<br />
umgebenden Wohnbebauung Priorität haben. Darüber hinaus müssen Aspekte des Wertverlustes<br />
betroffener Nachbargrundstücke in die Abwägung zur Ausweisung neuer Standorte<br />
einbezogen werden (EKP, S. 37).<br />
Aufgrund der gesetzlichen Regelungen in § 4 Abs. 1 Satz 3 SächsLPlG, nachdem die Regionalpläne<br />
sich in die angestrebte Entwicklung des Landes einfügen müssen, wie sie sich<br />
auch aus den für die Raumordnung und Landesentwicklung bedeutsamen Entscheidungen<br />
der Staatsregierung und der obersten Raumordnungs- und Landesplanungsbehörde ergibt,<br />
sind diese Rahmensetzungen wohl bereits gegenwärtig und unabhängig der zukünftigen<br />
verbindlichen Festlegungen im LEP 2012 durch die Regionen zu beachten. Der Planungsverband<br />
Region Chemnitz hatte sich in seiner Stellungnahme im Rahmen der Novellierung<br />
des SächsLPlG allerdings ausdrücklich gegen diese gesetzliche Regelung ausgesprochen<br />
(siehe dazu auch Beschluss des PV RC Nr. 13/2009, bzw. 3. Sitzung der Verbandsversammlung<br />
am 2. November 2009, TOP 10, S. 4-5).<br />
Auf die Benennung eines angestrebten Flächenanteils der Vorrang-/Eignungsgebiete an der<br />
Landesfläche wird dabei im Freistaat Sachsen verzichtet. Vielmehr sollen in den Regionalplänen<br />
die räumlichen Voraussetzungen zum Erreichen des für die Nutzung der Windenergie<br />
geltenden Zieles der Sächsischen Staatsregierung entsprechend des Flächenanteils<br />
der jeweiligen Planungsregion an der Gesamtfläche des Freistaates Sachsen über den regionalen<br />
Mindestenergieertrag gesichert und über den Ertragsnachweis erbracht werden (Z<br />
5.1.3 Entwurf LEP 2012). Dazu wurde in Z 5.1.3 Entwurf LEP 2012 ein dynamischer Verweis<br />
(Sicherung des regionalen Mindestenergieertrages entsprechend des für die Nutzung der<br />
Windenergie geltenden Zieles der Sächsischen Staatsregierung in der jeweils geltenden<br />
Fassung) integriert. Der Planungsverband Region Chemnitz hat sich in seinen Stellungnahmen<br />
im Rahmen der Beteiligung bei der Erarbeitung des LEP 2012 ausdrücklich gegen diese<br />
Regelung ausgesprochen (siehe dazu auch Beschlüsse des PV RC Nr. 06/2012 bzw.<br />
03/2013).<br />
Der Ertragsnachweis ist auf der Grundlage des Handlungsleitfaden des Sächsischen<br />
Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die Berechnung der Ertragsprognosen<br />
für Windkraftanlagen bei der Aufstellung der Regionalpläne im Freistaat Sachsen vom<br />
14. Dezember 2011 zu erbringen. Im Entwurf des LEP 2012 wird auf diesen Handlungsleitfaden<br />
jedoch nicht verwiesen.<br />
Der Handlungsleitfaden beinhaltet eine Empfehlung für eine landesweit einheitliche Berechnung<br />
der Ertragsprognosen für Windenergieanlagen. Damit soll eine pragmatische und zeitnahe<br />
Prüfung der Erfüllung der Ziele für die Windenergienutzung im Freistaat Sachsen und<br />
in den Planungsregionen ermöglicht werden. Darüber hinaus trägt dieser Ertragsnachweis<br />
zur Planungssicherheit bei und kann auch als eine Grundlage für ein diesbezügliches Monitoring<br />
dienen.<br />
Zeithorizont für den Ertragsnachweis ist dabei das Jahr 2021/22 und die damit verbundenen<br />
klimaschutzpolitischen Ziele des Freistaates Sachsen.<br />
Die im Rahmen des Ertragsnachweises zu erstellende Prognoseberechnung berücksichtigt<br />
dabei ausschließlich<br />
1. die bereits in Betrieb befindlichen, vorhandenen bzw. genehmigten Anlagen innerhalb<br />
der ausgewiesenen VREG Wind („bestehende Anlagen“) bzw.<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Seite 10 (von 46)
<strong>Regionalplan</strong> Region Chemnitz; Regionales Windenergiekonzept - Fachkonzept<br />
Beteiligung an der Ausarbeitung des Planentwurfs gemäß § 9 ROG<br />
in Verbindung mit § 6 Abs. 1 SächsLPlG<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
2. die in einem VREG Wind ggf. zukünftig noch möglichen zu errichtenden weiteren<br />
Anlagen („zukünftige Anlagen“).<br />
Bei den „bestehenden Anlagen“ sind die für das Jahr 2008 in das öffentliche Netz tatsächlich<br />
eingespeisten Energieerträge aus den Einspeisedaten nach dem Erneuerbare-Energien-<br />
Gesetz (EEG) maßgeblich. Diese tatsächlich eingespeisten Energieerträge werden als in der<br />
Prognose zu beachtende und zukünftig voraussichtlich auch weiterhin zu erzielende Erträge<br />
eingestellt. Soweit durch die bestehenden Anlagen im Jahr 2008 noch keine bzw. nur eine<br />
zeitlich verkürzte Einspeisung in das Netz erfolgte, kann dabei auch der Energieertrag eines<br />
späteren Jahres berücksichtigt werden.<br />
Die Berechnung der zu prognostizierenden Erträge für „zukünftige Anlagen“ basiert auf einem<br />
Vergleichsverfahren von Referenzerträgen und tatsächlichen Erträgen. Dazu ist für jeden<br />
Standort anhand der Erträge von bestehenden Anlagen auf der Grundlage der Referenzerträge<br />
der Neuanlage(n) eine Berechnung der zukünftig möglichen Erträge der Neuanlage<br />
(n) vorzunehmen. In einem ersten Schritt ist dazu die Ermittlung von Anzahl und Typ der am<br />
Standort zukünftig möglichen Anlagen erforderlich. Dabei ist allerdings zu beachten, dass<br />
durch die regionalplanerische Ausweisung von VREG Wind ausschließlich Gebiete für Windenergieanlagen<br />
gesichert werden. Somit sind dem Plangeber weder der Zeitpunkt noch der<br />
Anlagentyp oder die Anlagenanzahl der in den zukünftig auszuweisenden VREG Wind zu errichtenden<br />
Windenergieanlagen bekannt bzw. durch diesen steuerbar. Dementsprechend<br />
sind bei der Abschätzung von Anzahl und Typ der zukünftigen Anlagen die in der Handlungsanleitung<br />
zu Grunde gelegten drei verschiedenen Typen von Windenergieanlagen mit<br />
jeweils unterschiedlichen Referenzerträgen zu berücksichtigen. Gleichwohl wird die Ermittlung<br />
insbesondere der Anzahl der zukünftigen Anlagen dadurch erschwert, da es gegenwärtig<br />
keine allgemein anerkannten Regeln für die Bestimmung des Flächenbedarfs einer Windenergieanlage<br />
gibt. Letztendlich ist somit bei der Ermittlung von Anzahl und Typ der zukünftigen<br />
Anlagen stets erforderlich, eine nachvollziehbare Betrachtung des Einzelfalls durchzuführen.<br />
Zentraler Bestandteil der Prognose ist die Ermittlung des „prognostizierten Referenzertrages“<br />
jeder Anlage. Dabei wird auf der Grundlage des ermittelten durchschnittlich erzielten Prozentanteils<br />
des tatsächlichen Ertrages im Verhältnis zum Referenzertrag (zur Definition des Referenzertrages<br />
siehe auch Anlage 3 Nr. 2-4 EEG 2012) von in dem oder in vergleichbaren<br />
benachbarten VREG Wind oder Standorten bereits bestehenden (gleichen oder ähnlichen)<br />
Windenergieanlagen der prognostizierte Referenzertrag berechnet. In größeren Gebieten ist<br />
dieser prognostizierte Ertrag aufgrund des zu erwartenden Abschattungseffektes und der<br />
damit verbundenen Verminderung des Energieertrages im Vergleich zu einer frei stehenden<br />
einzelnen Windenergieanlage noch mit einem Parkwirkungsgrad von i. d. R. 90 % zu multiplizieren.<br />
Der in der Prognose in den auszuweisenden VREG Wind ermittelte Energieertrag muss dabei<br />
wenigstens dem regionalen Mindestenergieertrag entsprechen. Soweit dieser durch den<br />
Plangeber nicht nachgewiesen werden kann, besteht keine Genehmigungsfähigkeit des regionalen<br />
Windenergiekonzeptes.<br />
Aufgrund des Flächenanteils der Region Chemnitz von 35,4 % an der Fläche des Freistaates<br />
Sachsen und unter Beachtung der gegenwärtigen energiepolitischen Zielstellungen des Freistaates<br />
Sachsen ist in den VREG Wind der Region demnach voraussichtlich eine Energiemenge<br />
von etwa 780 GWh/a als regionaler Mindestenergieertrag planungsrechtlich im <strong>Regionalplan</strong><br />
zu sichern.<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Seite 11 (von 46)
<strong>Regionalplan</strong> Region Chemnitz; Regionales Windenergiekonzept - Fachkonzept<br />
Beteiligung an der Ausarbeitung des Planentwurfs gemäß § 9 ROG<br />
in Verbindung mit § 6 Abs. 1 SächsLPlG<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
3. Derzeitige Nutzung der Windenergie in der Region<br />
Ende 2012 waren (lt. Angaben von www.50hertz.com) in Sachsen ca. 850 Windkraftanlagen<br />
mit einer Gesamtleistung von 1.028 MW installiert. Etwa 335 Anlagen (40%) mit einer Nennleistung<br />
von zusammen ca. 360 MW (35%) entfielen davon auf unsere Planungsregion. Die<br />
Anlagen der Region erbringen unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen entsprechend<br />
des Ertragsnachweises gegenwärtig einen Energieertrag von rund 570 GWh/a, was<br />
rund 73% des derzeit von der Region geforderten Mindestenergieertrages von 780 GWh/a<br />
im Jahr 2020 entspricht.<br />
Von den 335 Windkraftanlagen der Region befinden sich gegenwärtig 173 Anlagen (52%)<br />
innerhalb der in den Regionalplänen ausgewiesenen 36 VREG Wind* mit einem aktuellen<br />
Anteil von nur 267 GWh/a (bzw. 47%) an der regionalen Stromproduktion. Bezogen auf den<br />
o. a. Mindestenergieertrag 2020 beträgt der Strombeitrag der VREG zurzeit sogar nur rund<br />
34%. Jedoch ergeben erste Berechnungen zu den Auslastungsreserven und zum<br />
Repoweringpotenzial der bestehenden VREG* einen prognostizierbaren Energieertrag in<br />
Summe von etwa 710 GWh/a.<br />
Die Erschließung dieser Potenziale würde es somit ermöglichen, rund 91% des künftigen<br />
Windenergieertrages allein aus den bereits rechtskräftig bestehenden 36 VREG der Region<br />
bereitzustellen.<br />
*) Ohne Einbeziehung bzw. Berücksichtigung der aktuellen Rechtslage im Gebiet des ehemaligen Regionalen Planungsverbandes<br />
Südwestsachsen nach dem Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 23. Oktober 2012 (Az.: 4 BN 35.12) in Bezug<br />
auf die beiden Regionsteile mit und ohne abschließender Regelung zur Nutzung der Windenergie.<br />
4. Planungsmethodik und Arbeitsschritte<br />
Die Standortplanung für Windenergieanlagen erfordert nach der gefestigten Rechtsprechung<br />
des Bundesverwaltungsgerichts eine gestufte Prüfungsabfolge, wie es das BVerwG zuletzt<br />
im Urteil in der Rechtssache Wustermark vom 13. Dezember 2012 (BVerwG 4 CN 1.11 und<br />
4 CN 2.11) bekräftigt hat. Zunächst hat der Plangeber danach harte und weiche Tabuzonen<br />
zu ermitteln, die sich aus rechtlichen, tatsächlichen (= harte Tabuzonen) aber auch aus planerischen<br />
(= weiche Tabuzonen) Gründen nicht für eine Windenergienutzung eignen. Bei<br />
den verbleibenden Potenzialflächen, die für die Darstellung von Konzentrationsflächen in Betracht<br />
kommen, hat der Plangeber konkurrierende Nutzungen zur Windenergienutzung in<br />
Beziehung zu setzen, d. h. öffentliche Belange, die gegen eine Windenergienutzung sprechen,<br />
mit dem Anliegen abzuwägen, der Windenergienutzung an geeigneten Standorten eine<br />
Chance zu geben, die ihrer Privilegierung gerecht wird. In einem weiteren Schritt hat der<br />
Planungsträger zu überprüfen, ob der Windenergienutzung in substanzieller Weise Raum<br />
geschaffen wurde. Erforderlichenfalls muss er sein Auswahlkonzept überprüfen und ändern.<br />
4.1 Planungsmethodik<br />
Die Ausfüllung des Planvorbehaltes in § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB im <strong>Regionalplan</strong> setzt ein<br />
schlüssiges und gesamträumliches Planungskonzept für die Region voraus.<br />
Mit der Erarbeitung dieses Konzeptes sollen im Wesentlichen drei Hauptziele verfolgt werden:<br />
1. Die Bündelung von raumbedeutsamen Windenergieanlagen, um einer sog.<br />
,,Verspargelung der Landschaft“ durch planerisch ungesteuerte (Einzel-)Anlagenstandorte<br />
vorzubeugen und örtliche Überlastungen zu vermeiden,<br />
2. den Schutz von Landschaftsteilen und Landschaftsbildern, die von Windenergieanlagen<br />
freizuhalten sind und<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Seite 12 (von 46)
<strong>Regionalplan</strong> Region Chemnitz; Regionales Windenergiekonzept - Fachkonzept<br />
Beteiligung an der Ausarbeitung des Planentwurfs gemäß § 9 ROG<br />
in Verbindung mit § 6 Abs. 1 SächsLPlG<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
3. die Schaffung von Planungs- und Rechtssicherheit für Investoren und Kommunen durch<br />
die Festlegung von VREG Wind.<br />
Die Ermittlung der VREG Wind erfolgt auf der Grundlage von unterschiedlichen, aufeinander<br />
aufbauenden Arbeitsschritten:<br />
1. Bestimmung von Ausschlussgebieten (harte und weiche Tabuzonen bzw. - kriterien) einerseits<br />
und Potenzialräumen für die Nutzung von Windenergie andererseits<br />
2. Abwägung der Windenergienutzung in den Potenzialräumen mit anderen Raumfunktionen<br />
bzw. konkurrierenden Raumnutzungen unter Beachtung des Privilegierungstatbestandes<br />
von Windenergieanlagen und der windenergetischen Eignung (Windpotenzial)<br />
des Standortes,<br />
3. Festlegung der zukünftig zu sichernden VREG Wind unter Berücksichtigung sowohl anderer<br />
benachbarter Potenzialräume als auch des bisherigen Anlagenbestandes an WEA<br />
und der gegenwärtig bisher regionalplanerisch festgelegten VREG Wind und ggf.<br />
4. Überprüfung und Änderung der Arbeitsschritte 1 bis 3, soweit der Windenergienutzung<br />
nicht in substanzieller Weise Raum geschaffen wurde, d.h. der regionale Mindestenergieertrag<br />
der Region bisher nicht gesichert und der Ertragsnachweis darüber nicht erbracht<br />
werden konnte.<br />
In der Tabelle in der Anlage 2 wird in den Spalten 2 bis 5 ein Überblick über die wichtigsten<br />
in den gegenwärtig rechtskräftigen Regionalplänen der Region sowie den in den Plänen der<br />
beiden Nachbarregionen verwendeten Ausschlusskriterien und Abstandszonen für die Windenergienutzung<br />
gegeben. In Spalte 6 sind Ausschlussgebiete und berücksichtigte Abstände<br />
aus der Dissertation von GATZ „Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis“<br />
aus dem Jahr 2009 zum Vergleich dargestellt. Spalte 7 beinhaltet die in den nachfolgenden<br />
Kapiteln 4.2.1 bzw. 4.2.2 verwendeten Kriterien.<br />
4.2 Arbeitsschritte<br />
4.2.1 Bestimmung von harten Tabuzonen<br />
4.2.1.1 Siedlung (Karte 1)<br />
Zunächst wurde der aktuelle Siedlungsbestand auf der Grundlage der ATKIS Daten 2010<br />
und unter Berücksichtigung der genehmigten Bauleitplanungen gemäß des Raumordnungskatasters<br />
der Landesdirektion Sachsen (Stand August 2011) bestimmt. Mit diesem Siedlungsbestand<br />
erfolgte eine Typisierung der Gebiete mit Wohn- und/oder Erholungsfunktion<br />
unter Größen- und Lagegesichtspunkten in isolierte Einzel- bzw. Gruppenanwesen sowie in<br />
Flächensiedlungen. Diese Differenzierung war erforderlich, um in Übereinstimmung mit dem<br />
unterschiedlichen Gebietstyp und der daraus resultierenden entsprechend differenzierten<br />
Schutzbedürftigkeit der Gebiete auch dementsprechend abgestufte Abstandszonen um den<br />
Siedlungsbestand als Ausschlusskriterium verwenden zu können.<br />
Folgende auch digital anwend- und umsetzbare Typisierung der Gebiete mit Wohn- und/oder<br />
Erholungsfunktion wurden zur Bestimmung des Siedlungsbestandes definiert.<br />
1. isoliertes Einzelanwesen:<br />
Siedlungsfläche mit Wohn- und/oder Erholungsfunktion mit einer Fläche von < 0,4 ha,<br />
die von anderen Siedlungsflächen mit Wohn- und/oder Erholungsfunktion mit einer Fläche<br />
von ≥ 0,4 ha mehr als 200 m entfernt liegt und auch gemeinsam mit benachbarten<br />
(d. h. ≤ 200 m entfernten) Siedlungsflächen mit Wohn- oder/und Erholungsfunktion mit<br />
einer Fläche von < 0,4 ha in der Summe ihrer Einzelflächen eine Fläche von nicht mehr<br />
als 0,4 ha aufweist.<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Seite 13 (von 46)
<strong>Regionalplan</strong> Region Chemnitz; Regionales Windenergiekonzept - Fachkonzept<br />
Beteiligung an der Ausarbeitung des Planentwurfs gemäß § 9 ROG<br />
in Verbindung mit § 6 Abs. 1 SächsLPlG<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
2. isoliertes Gruppenanwesen:<br />
Siedlungsfläche mit Wohn- oder/und Erholungsfunktion mit einer Fläche von ≥ 0,4 ha<br />
bis < 1 ha, die von anderen Siedlungsflächen mit Wohn- und/oder Erholungsfunktion<br />
und einer Fläche von ≥ 1 ha mehr als 200 m entfernt liegt und auch gemeinsam mit benachbarten<br />
(d. h. ≤ 200 m entfernten ) Siedlungsflächen mit Wohn- oder/und Erholungsfunktion<br />
mit einer Fläche von < 1 ha in der Summe ihrer Einzelflächen eine Fläche von<br />
nicht mehr als 1 ha aufweist.<br />
3. Flächensiedlung:<br />
übrige Siedlungsfläche mit Wohn- und/oder Erholungsfunktion, die nicht dem Typ isoliertes<br />
Einzel- bzw. Gruppenanwesen angehört.<br />
Darüber hinaus wurden in die Karte 1 auch die Flächen (Bestand und genehmigte Bauleitplanung)<br />
mit der Funktion Industrie und Gewerbe sowie die Gebiete mit der Funktion<br />
Kur/Klinik als Sonderfall von Gebieten mit der Funktion Wohnen/Erholen als Siedlungsbestand<br />
mit einer differenzierten Schutzbedürftigkeit mit aufgenommen.<br />
Eine gesetzliche Bestimmung der Siedlungsabstände fehlt. Bundesweit einheitliche bzw.<br />
sächsische Abstandsempfehlungen zur Bestimmung des harten Kriteriums Siedlungsabstand<br />
sind nicht vorhanden. Unter Beachtung der in Kap. 1.1.2 dargestellten Problematik der<br />
Abgrenzung von harten und weichen Tabuzonen ist es dem regionalen Planungsträger somit<br />
ausschließlich möglich, seinem Konzept auf Erfahrungswerten beruhende, pauschalierte<br />
Siedlungsabstände unter Beachtung des Geltungszeitraums und dem Gewährleistungsgebotes<br />
des Plans zur Errichtung von Windenergieanlagen außerhalb der Siedlungsabstände,<br />
soweit im Übrigen keine weiteren öffentlich- rechtlichen Belange entgegenstehen, zu Grunde<br />
zu legen. Dabei ist auch die im Geltungszeitraum des Konzeptes zu erwartenden Weiterentwicklung<br />
der Leistungsparameter von Windenergieanlagen zu beachten. Schon heute werden<br />
Windkraftanlagen mit einer Gesamthöhe von über 200m gebaut. Die Abstände, die<br />
Windkraftanlagen zur Wohnbebauung aus rechtlichen Gründen (TA Lärm, Schattenwurfrichtlinie<br />
etc.) in jedem Fall einhalten müssen (harte Tabuzonen) hängen neben der Höhe auch<br />
vom Anlagentyp und der Schutzbedürftigkeit der Wohnbebauung (reines oder Allgemeines<br />
Wohngebiet etc.) ab. Nach der Rechtsprechung soll vom Planungsträger auf der jeweiligen<br />
Ebene aber nichts Unmögliches abverlangt werden. Er kann sich für die Bestimmung auf Erfahrungswerte<br />
berufen. Die Ermittlung dieser Erfahrungswerte aus den immissionsschutzrechtlichen<br />
Genehmigungsverfahren wird unter anderem Gegenstand der Beteiligungsverfahren<br />
sein. Sobald die Erkenntnisse vorliegen, werden die entsprechenden Abstandsflächen<br />
als „harte Tabuzonen“ in die entsprechenden Karten mit eingezeichnet, erläutert und damit –<br />
wie von der Rechtsprechung verlangt – ausdrücklich dokumentiert.<br />
Gleichzeitig ist in der Rechtsprechung anerkannt, dass es dem Planungsträger nicht verwehrt<br />
ist, einen über den immissionsschutzrechtlichen Schutzabstand hinausgehenden, weitergehenden<br />
Abstand zur Wohnbebauung aus Gründen des vorbeugenden Immissionsschutzes<br />
(„weiches“ Tabukriterium) bei seiner Planung in Ansatz zu bringen. Bei der Bestimmung<br />
dieses vorbeugenden Schutzabstands können die landesplanerischen Empfehlungen<br />
als Orientierung dienen (vgl. Anlage 1, S. 2). Mit dem so in Ansatz gebrachten 750 m-<br />
Abstand zur Wohnbebauung und den weiteren, aufgrund des unterschiedlichen Schutzanspruches<br />
der verschiedenen Siedlungstypen verwendeten differenzierten Abstandzonen<br />
(Abstandzone für isoliertes Einzel- bzw. Gruppenanwesen 250 bzw. 500 m, für Industrie- und<br />
Gewerbe von 250 m und für Kur/Klinik von 1.200 m) im Konzept bewegt sich der Verband im<br />
bundesweiten Vergleich bereits an der schon heute in vergleichbaren Planungen verwendeten<br />
Untergrenze des Siedlungsabstands (siehe Anlage 1, Seite 2).<br />
In den Grenzgebieten zu den Nachbarregionen in Sachsen, Thüringen und Bayern und der<br />
Tschechischen Republik erfolgte bisher noch keine abschließende Prüfung des Siedlungsbestandes.<br />
Hier können sich die gegenwärtig in der Darstellung noch vorhandenen Potenzi-<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Seite 14 (von 46)
<strong>Regionalplan</strong> Region Chemnitz; Regionales Windenergiekonzept - Fachkonzept<br />
Beteiligung an der Ausarbeitung des Planentwurfs gemäß § 9 ROG<br />
in Verbindung mit § 6 Abs. 1 SächsLPlG<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
algebiete („weiße Gebiete“) durch die Beachtung der in den Nachbarregionen gelegenen<br />
Siedlungen einschließlich der dort auf der Grundlage der Methodik anzulegenden Abstandszonen<br />
nach Einzelfallprüfung noch weiter verringern oder auch ganz entfallen.<br />
Durch den Siedlungsbestand wird in der Region eine Fläche von 88.221 ha eingenommen.<br />
Dies entspricht einem Flächenanteil von 13,5 % an der Gesamtfläche der Region. Durch den<br />
Siedlungsbestand einschließlich der verwendeten differenzierten Abstandzonen bei den ermittelten<br />
verschiedenen Siedlungstypen wird in der Region eine Fläche von 564.400 ha eingenommen.<br />
Dies entspricht einem Flächenanteil von 86,4 % an der Gesamtfläche der Region.<br />
4.2.1.2 Wald (Karte 2)<br />
Rechtslage<br />
Entsprechend § 1 Abs. 1 Bundeswaldgesetz [BWaldG vom 2. Mai 1975 (BGBl. I S. 1037),<br />
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 31. Juli 2010 (BGBl. I S. 1050)] ist Wald<br />
sowohl wegen seines wirtschaftlichen Nutzens (Nutzfunktion) als auch seiner Bedeutung für<br />
die Umwelt, insbesondere für die dauernde Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, das Klima,<br />
den Wasserhaushalt, die Reinhaltung der Luft, die Bodenfruchtbarkeit, das Landschaftsbild,<br />
die Agrar- und Infrastruktur und die Erholung der Bevölkerung (Schutz- und Erholungsfunktion)<br />
zu erhalten und erforderlichenfalls zu mehren. Auch nach § 1 Nr. 1 des Waldgesetzes<br />
für den Freistaat Sachsen [SächsWaldG vom 10. April 1992 (SächsGVBl. S. 137) zuletzt<br />
geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 8. Juni 2012 (SächsGVBl. S. 308)] ist Wald in der<br />
Einheit seines wirtschaftlichen Nutzens (Nutzfunktion) und seiner Bedeutung für die Umwelt,<br />
insbesondere für die dauernde Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, das<br />
Klima, den Wasserhaushalt, die Reinhaltung der Luft, die Bodenfruchtbarkeit, die Pflanzenund<br />
Tierwelt, das Landschaftsbild, die Agrar- und Infrastruktur und die Erholung der Bevölkerung<br />
(Schutz- und Erholungsfunktion) zu erhalten und erforderlichenfalls zu mehren. Dementsprechend<br />
ist auch die Rodung bzw. dauerhafte Umwandlung von Wald in eine andere<br />
Nutzungsart entsprechend § 9 BWaldG i. Z. m. § 8 SächsWaldG genehmigungspflichtig.<br />
Aufgrund der, schon gesetzlich definierten, vielfältigen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen<br />
Funktionen des Waldes wird Wald gegenwärtig sowohl durch die Rechtsprechung des<br />
Bundesverwaltungsgerichts (siehe BVerwG, Urteil vom 17. Dezember 2002 - BVerwG 4 C<br />
15.01) als auch durch die Rechtsprechung des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts (siehe<br />
OVG Sachsen, Urteil vom 7. April 2005 – 1 D 2/03 ) grundsätzlich als ein mögliches und zulässiges<br />
Ausschlusskriterium für Windenergieanlagen angesehen.<br />
Windenergieanlagen im Wald<br />
Unabhängig der gesetzlichen Erfordernisse sowie der aktuellen Rechtsprechung gibt es jedoch<br />
zunehmend Bestrebungen, Wald sowohl im Rahmen von Planungen zur Steuerung von<br />
Windenergieanlagen nicht mehr als Ausschlusskriterium anzusehen als auch konkrete<br />
Standorte für Windenergieanlagen in Wäldern planerisch vorzubereiten und auch zu realisieren.<br />
Diese Bestrebungen basieren auf nachfolgenden Beweggründen.<br />
• Ein weiterer Ausbau der Windenergie auch auf dem Festland ist unumgänglich, um die<br />
umfassenden energiepolitischen Zielstellungen zu erfüllen.<br />
• Die bisher durch Planungen zur Steuerung von Windenergieanlagen ausgewiesenen<br />
Gebiete zur Nutzung der Windenergie sind vielfach bereits (vollständig) belegt.<br />
• Die in der Vergangenheit erfolgte Vergrößerung der Siedlungsabstände für Windenergieanlagen<br />
bewirkte eine erhebliche Verknappung von möglichen neuen Standorten im<br />
Offenland.<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Seite 15 (von 46)
<strong>Regionalplan</strong> Region Chemnitz; Regionales Windenergiekonzept - Fachkonzept<br />
Beteiligung an der Ausarbeitung des Planentwurfs gemäß § 9 ROG<br />
in Verbindung mit § 6 Abs. 1 SächsLPlG<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
• Wald ist nicht gleich Wald. Er ist in weiten Teilen Kulturlandschaft mit unterschiedlichen<br />
Waldfunktionen. Dabei bestehen erhebliche Unterschiede sowohl in Bezug auf seine<br />
Waldfunktionen einschließlich der Überlagerungen als auch hinsichtlich seiner Anteile<br />
an der Flächennutzung der einzelnen Bundesländer bzw. Regionen.<br />
• Moderne Windenergieanlagen gewährleisten neben einem ausreichend freien Luftraum<br />
über den Baumkronen auch einen wirtschaftlichen Betrieb im Wald.<br />
• Waldeigentümer haben ein verstärktes Interesse an Windenergieanlagen im Wald und<br />
bieten zunehmend Standorte an.<br />
Nach Kenntnis des Plangebers werden gegenwärtig in mehreren Bundesländern (z. B. im<br />
Freistaat Bayern, in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen) bereits Windenergieanlagen<br />
im Wald errichtet bzw. wird Wald nicht mehr generell als Ausschlusskriterium für<br />
die Windenergienutzung angesehen. Zum Teil wird auch in der jüngsten Rechtsprechung eine<br />
differenzierte Betrachtung bei Waldflächen gefordert (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, Urteile<br />
von 24.2.2011, Az.: 2 A 24.09 und 2 A 2.09).<br />
Windenergieanlagen und Wald im Freistaat Sachsen<br />
In allen Regionalplänen im Freistaat Sachsen wird gegenwärtig Wald einschließlich einer zusätzlichen<br />
Abstandszone von in der Regel 200 Metern pauschal als Ausschlusskriterium für<br />
die Windenergienutzung angesehen. Vor dem Hintergrund der geplanten stärkeren Nutzung<br />
erneuerbarer Energien spricht sich allerdings mittlerweile auch das Sächsische Staatsministerium<br />
für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL) in seiner Eigenschaft als Oberste Forstbehörde<br />
für die Möglichkeit aus, zukünftig Windenergieanlagen auch in Sachsen auf Waldflächen<br />
errichten und betreiben zu können (siehe dazu Schreiben des Staatsbetrieb Sachsenforst<br />
vom 28. Dezember 2012 – Empfehlungen für die Regionalen Planungsverbände aus forstfachlicher<br />
Sicht für die Bewertung der Standorteignung von Waldflächen bei der Ausweisung<br />
von Vorrang- und Eignungsgebieten zur Nutzung der Windenergie), soweit sowohl die Belange<br />
des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie die Erfüllung der Waldfunktionen<br />
im Einzelfall nicht entgegenstehen. Unter Beachtung des in Sachsen im Vergleich zu anderen<br />
Bundesländern unterdurchschnittlich hohen Waldanteils sollten dabei nach Auffassung<br />
des SMUL zunächst mögliche Standorte für Windenergieanlagen außerhalb des Waldes geprüft<br />
sowie die Möglichkeiten des Repowerings bestehender Anlagen genutzt werden. Soweit<br />
die Einbeziehung von Waldflächen geboten ist, sollten vorrangig solche Gebiete ausgewählt<br />
werden, wo bereits eine technische bzw. infrastrukturelle Vorbelastung gegeben ist.<br />
Unabhängig davon wird durch das Ziel 4.2.2.1 des Entwurfs des LEP 2012 (siehe dort S.<br />
137/138) auch vorgegeben, dass in der Region der Waldanteil auf 32 % der Regionsfläche<br />
zu erhöhen ist. Dafür sind in den Regionalplänen über die Vorrang- und Vorbehaltsgebiete<br />
zum Schutz des vorhandenen Waldes (Z 4.2.2.2 Entwurf des LEP 2012) auch Vorrang-<br />
/Vorbehaltsgebiete Waldmehrung festzulegen. Gleichwohl sieht der Entwurf des LEP 2012<br />
von einer entsprechenden Darstellung von landesweiten Schwerpunkten der Waldmehrung<br />
wie bisher in der Karte 10 LEP 2003 ab.<br />
Forstliche Rahmenplanung und Waldfunktionenkartierung<br />
Die Waldfunktionenkartierung ist eine wesentliche Grundlage der forstlichen Rahmenplanung<br />
(siehe dazu auch § 6 Abs. 1 Satz 2 bzw. § 6 a SächsWaldG). Sie beinhaltet die gesamte<br />
Waldfläche unabhängig von Eigentumsarten und dient der Darstellung und Beschreibung der<br />
besonderen Schutz- und Erholungsfunktionen des Waldes. Die Waldfunktionenkartierung ist<br />
eine Stichtagsinventur und erfolgt im Maßstab 1:25.000. Dabei werden alle, sich ggf. überlagernde,<br />
besonderen Schutz- und/oder Erholungsfunktionen einer Waldfläche ohne die Erstellung<br />
einer Rangfolge erfasst. Waldfunktionen werden grundsätzlich in Funktionen mit einem<br />
speziellen Schutzstatus, d.h. Funktionen, die kraft eines Gesetzes bestehen bzw. durch<br />
eine Rechtsvorschrift förmlich festgesetzt wurden und in Funktionen ohne speziellen Schutz-<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Seite 16 (von 46)
<strong>Regionalplan</strong> Region Chemnitz; Regionales Windenergiekonzept - Fachkonzept<br />
Beteiligung an der Ausarbeitung des Planentwurfs gemäß § 9 ROG<br />
in Verbindung mit § 6 Abs. 1 SächsLPlG<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
status, d.h. Wald mit Funktionen von besonderer Bedeutung differenziert (siehe dazu nachfolgende<br />
Tabelle 1). Gegenwärtig werden in der Waldfunktionenkartierung in sieben Themenbereichen<br />
insgesamt 28 Waldfunktionen mit und 21 Waldfunktionen ohne einen speziellen<br />
Schutzstatus dargestellt bzw. ausgewiesen.<br />
Nach § 7 Satz 1 SächsWaldG haben die Träger öffentlicher Vorhaben bei Planungen und<br />
Maßnahmen, die in ihren Auswirkungen Waldflächen betreffen können, sowohl die Funktionen<br />
des Waldes als auch die Waldfunktionskarte nach den §§ 1 und 6a SächsWaldG zu berücksichtigen.<br />
Darüber hinaus ist der Wald so zu bewirtschaften, dass seine Funktionen gemäß<br />
§ 1 Nr. 1 SächsWaldG stetig und auf Dauer erfüllt werden (Nachhaltigkeit). Für alle<br />
Waldflächen mit einem speziellen Schutzstatus gilt zudem der damit verbundene rechtliche<br />
Schutz.<br />
Tabelle 1 Gliederung der Schutz- und Erholungsfunktionen des Waldes<br />
1. Boden<br />
2. Wasser<br />
3. Luft<br />
4. Natur<br />
Wald mit gesetzlich vorgegebenen Funktionen<br />
(Schutzgebiete)<br />
förmlich festgesetzt<br />
Anlagenschutzwald<br />
Straßenschutzwald<br />
Wasserschutzgebiet<br />
Heilquellenschutzgebiet<br />
Überschwemmungsgebiet<br />
(1)<br />
Wald mit besonderer Hochwasserschutzfunktion<br />
Hochwasserentstehungsgebiet<br />
Wasserschutzwald<br />
Klimaschutzwald<br />
Immissionsschutzwald<br />
Lärmschutzwald<br />
Nationalpark<br />
Natura 2000<br />
Fauna-Flora-Habitat<br />
Gebiet)<br />
Vogelschutzgebiet<br />
Gebiet)<br />
Naturschutzgebiet<br />
Naturdenkmale<br />
Gebilde)<br />
Naturwaldzelle<br />
Wald mit besonderer Biotopschutzfunktion<br />
(FFH-<br />
(SPA-<br />
(Fläche;<br />
Schutzwald in Schutzgebieten<br />
Wildschutzgebiet<br />
per Gesetz bestehend<br />
Bodenschutzwald<br />
Wald mit besonderer Anlagenschutzfunktion<br />
Überschwemmungsgebiet<br />
(2)<br />
Geschütztes Biotop<br />
Wald mit Funktionen von besonderer<br />
Bedeutung<br />
Wald mit besonderer Bodenschutzfunktion<br />
Wald mit besonderer Wasserschutzfunktion<br />
Wald mit besonderer lokalen Klimaschutzfunktion<br />
Wald mit besonderer regionalen Klimaschutzfunktion<br />
Wald mit besonderer Immissionsschutzfunktion<br />
Wald mit besonderer Lärmschutzfunktion<br />
Restwaldfläche in waldarmer Region<br />
Wald auf Renaturierungsfläche<br />
Wald mit besonderer Generhaltungsfunktion<br />
Forstsaatgutbestand<br />
Wald für Forschung und Lehre<br />
Wald mit besonderer Brandschutzfunktion<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Seite 17 (von 46)
<strong>Regionalplan</strong> Region Chemnitz; Regionales Windenergiekonzept - Fachkonzept<br />
Beteiligung an der Ausarbeitung des Planentwurfs gemäß § 9 ROG<br />
in Verbindung mit § 6 Abs. 1 SächsLPlG<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
Wald mit gesetzlich vorgegebenen Funktionen<br />
(Schutzgebiete)<br />
förmlich festgesetzt<br />
per Gesetz bestehend<br />
Wald mit Funktionen von besonderer<br />
Bedeutung<br />
5. Landschaft<br />
6. Kultur<br />
7. Erholung<br />
Landschaftsschutzgebiet<br />
Biosphärenreservat<br />
Denkmalschutzgebiet<br />
Grabungsschutzgebiet<br />
Archäologisches Reservat<br />
Erholungswald<br />
Naturpark<br />
Kulturdenkmal<br />
das Landschaftsbild prägender Wald<br />
Wald mit besonderer Sichtschutzfunktion<br />
Wald mit besonderer Denkmalschutzfunktion<br />
Dokumentationsfläche<br />
Waldbauform<br />
historischer<br />
Wald mit besonderer Erholungsfunktion<br />
– Intensitätsstufe I<br />
Wald mit besonderer Erholungsfunktion<br />
– Intensitätsstufe II<br />
Quelle: Freistaat Sachsen Staatsbetrieb Sachsenforst, Waldfunktionenkartierung, Dezember 2010, S. 8<br />
Um den Suchraum für Potenzialgebiete für Windenergieanlagen zu vergrößern werden zukünftig<br />
nicht mehr pauschale Abstandszonen um den Wald als Ausschlusskriterium angesehen.<br />
Darüber hinaus wird auch Wald ohne besondere Funktion, d.h. Wald, der nicht durch<br />
eine Funktion mit besonderer Bedeutung entsprechend der Waldfunktionskartierung charakterisiert<br />
ist, in diesen Suchraum mit einbezogen.<br />
Um den räumlichen Umgriff des Waldes mit Funktionen von besonderer Bedeutung zu ermitteln,<br />
wurde in einem ersten Schritt mit Hilfe der aktuellen Waldfunktionenkartierung die flächenhaften<br />
Waldgebiete ohne einen speziellen Schutzstatus (zu den Funktionen siehe Tabelle<br />
1 rechte Spalte) ermittelt und im Verhältnis zum Waldbestand entsprechend § 2<br />
SächsWaldG dargestellt (siehe Karte 2). Dabei bleibt die in einigen Waldfunktionen erfolgte<br />
räumliche Übernahme von Gebieten des LEP 2003 (Wald mit besonderer Hochwasserschutzfunktion<br />
bzw. besonderer regionaler Klimaschutzfunktion sowie Restwaldfläche in<br />
waldarmer Region) unberücksichtigt. Da im Entwurf des LEP 2012 eine Darstellung dieser<br />
landesweiten Schwerpunkte der Waldmehrung gegenwärtig nicht mehr beinhaltet ist, sind<br />
die bisher durch diese Schwerpunkte verfolgten Zielstellungen einer späteren Einzelfallprüfung<br />
vorbehalten.<br />
In einem zweiten Schritt wurden die flächenhaften Waldgebiete mit einem speziellen Schutzstatus<br />
(gesetzlich vorgegebene Funktion) erfasst und ebenfalls als hartes Ausschlusskriterium<br />
eingestellt. Für gesetzlich vorgegebenen Funktionen nach dem Sächsischen Waldgesetz<br />
(Bodenschutzwald sowie Naturwaldzellen entsprechend § 29 Abs. 1 bzw. 3 SächsWaldG) erfolgt<br />
dies in diesem Verfahrensschritt.<br />
Bodenschutzwald dient insbesondere der Sicherung von erosionsgefährdeten Standorten vor<br />
Erosion durch Wasser, Wind, Steinschlag und Bodenkriechen. Dementsprechend wird dieser<br />
auf erosionsgefährdeten Standorten, insbesondere auf rutschgefährdeten Hängen sowie felsigen<br />
oder flachgründigen Steilhängen ausgewiesen. Entsprechend seiner Bedeutung ist<br />
Bodenschutzwald so zu behandeln, dass eine standortgerechte ausreichende Bestockung<br />
erhalten bleibt und die rechtzeitige Erneuerung gewährleistet ist (§ 29 Abs. 4 SächsWaldG).<br />
Naturwaldzellen dienen dem Schutz und der Erforschung sowie der Dokumentation repräsentativer,<br />
naturnaher Waldgesellschaften sowie den Belangen des Biotop- und Artenschutzes.<br />
In ihnen ist eine Bewirtschaftung unzulässig.<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Seite 18 (von 46)
<strong>Regionalplan</strong> Region Chemnitz; Regionales Windenergiekonzept - Fachkonzept<br />
Beteiligung an der Ausarbeitung des Planentwurfs gemäß § 9 ROG<br />
in Verbindung mit § 6 Abs. 1 SächsLPlG<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
Für gesetzlich vorgegebenen Funktionen außerhalb des Waldgesetzes (z. B. spezieller<br />
Schutzstatus nach Naturschutzrecht) erfolgt dies in Zusammenhang mit der Ermittlung der<br />
Anforderungen des flächenbezogenen Naturschutzes (siehe Kap. 4.2.1.8) oder des besonderen<br />
Artenschutzes (siehe Kap. 4.2.2.1).<br />
Über die in den beiden o.g. Schritten erfolgte flächenhafte Bestimmung von harten Tabukriterien<br />
des Waldes hinaus ist die noch nicht vorgenommene Beachtung der Waldfunktionen mit<br />
linien- und punkthafter Ausprägung einer späteren Einzelfallprüfung vorbehalten.<br />
Unabhängig der oben angewendeten Methodik ist für die Umwandlung von Wald in eine andere<br />
Nutzungsart eine Genehmigung erforderlich (siehe § 8 Abs. 1 SächsWaldG). Soweit für<br />
eine Waldfläche in einem Bauleitplan eine anderweitige Nutzung festgesetzt werden soll,<br />
prüft die Forstbehörde ob die Voraussetzungen für eine Genehmigung der Waldumwandlung<br />
vorliegen und erteilt, sowie diese in Aussicht gestellt werden kann, eine Umwandlungserklärung<br />
(siehe § 9 Abs. 1 und 2 SächsWaldG).<br />
Der Plangeber des regionalen Windenergiekonzeptes hat mit der Ausweisung von VREG<br />
Wind die Inanspruchnahme der vorrangigen Nutzung innerhalb der Gebiete auch rechtlich<br />
sicherzustellen. Unbeschadet des ausschließlichen Wortlautes von § 9 Abs. 1 SächsWaldG<br />
in Bezug auf einen Bauleitplan ist es somit zwingend erforderlich, bei Ausweisung von VREG<br />
Wind im Wald (zumindest) diese Umwandlungserklärung durch die Forstbehörde auch aufgrund<br />
der Festlegung im <strong>Regionalplan</strong> zu erteilen (und nicht nur in Aussicht zu stellen). Umstritten<br />
ist unter Beachtung von § 9 Abs. 2 Satz 2 SächsWaldG hingegen, inwieweit bereits<br />
eine erteilte Umwandlungserklärung oder aber doch erst die Umwandlungsgenehmigung (§ 8<br />
Abs. 1 SächsWaldG) für die Sicherstellung der vorrangigen Nutzung ausreichend ist.<br />
Durch das harte Tabukriterium Wald wird in der Region eine Fläche von 110.937 ha eingenommen.<br />
Dies entspricht einem Flächenanteil von 17 % an der Gesamtfläche der Region.<br />
4.2.1.3 Einrichtungen, Trassen und Leitungen der technischen Infrastruktur<br />
Eine Vielzahl von Gründen spricht dafür, VREG Wind insbesondere auch entlang an Standorten<br />
von vorhandenen Infrastrukturen auszuweisen. Dazu gehören u. a. die technische Vorbelastung<br />
der Standorte, der i. d. R. geringere Erschließungsaufwand, die Möglichkeit der<br />
Bündelung von Infrastrukturen sowie die Vermeidung von zusätzlicher Freiraumzerschneidung<br />
und von Zusatzbelastungen durch die zu errichtenden Windenergieanlagen.<br />
Allgemein sind für bauliche Anlagen und insbesondere damit auch für Windenergieanlagen<br />
zu Einrichtungen, Trassen und Leitungen der technischen Infrastruktur regelmäßig gesetzliche<br />
Mindestabstände einzuhalten. Einen Überblick über die Abstandswerte zu Einrichtungen,<br />
Trassen und Leitungen der technischen Infrastruktur gibt die nachfolgende Tabelle 2.<br />
Neben den bestehenden gesetzlich bestimmten Werten und der Bandbreite aus den Unterlagen<br />
der Bund-Länder-Initiative Windenergie (BLIW 2012) sind darin auch die derzeit gültigen<br />
Abstandswerte der rechtsgültigen Regionalpläne unserer Region und der sächsischen<br />
Nachbarverbände enthalten. Auffällig ist, dass sowohl in Bezug auf die einzelnen Bundesländer<br />
als auch auf die verschiedenen Infrastrukturtypen eine Vielfalt an Abstandsregelungen<br />
existieren. Teilweise fehlen bundes- bzw. landesweite Regelungen auch völlig (siehe dazu<br />
Bahnlinien und Leitungen in Tabelle 2).<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Seite 19 (von 46)
<strong>Regionalplan</strong> Region Chemnitz; Regionales Windenergiekonzept - Fachkonzept<br />
Beteiligung an der Ausarbeitung des Planentwurfs gemäß § 9 ROG<br />
in Verbindung mit § 6 Abs. 1 SächsLPlG<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
Tabelle 2<br />
Abstandswerte zu Einrichtungen, Trassen und Leitungen der technischen<br />
Infrastruktur (Abstand in m)<br />
Technische Infrastruktur<br />
gesetzlich<br />
bestimmte<br />
Werte<br />
RPV<br />
C-E<br />
RPV<br />
SWS<br />
RPV<br />
WS<br />
RPV<br />
OE/OE<br />
Bayern<br />
Entwurf<br />
LEP<br />
2012<br />
Bandbreite<br />
Werte BLIW<br />
PV RC<br />
neu<br />
Bundesautobahnen 40 200 100 250 250 150 40<br />
Autobahnkreuze<br />
Anschlussstellen<br />
300 300<br />
Bundesstraßen 20 100 100 100 100 150 20<br />
Staatsstraßen 20 20<br />
Kreisstraßen 20 100 100 100 100 150 20<br />
alle Straßen 15-300<br />
Bahnstrecken elektrifiziert 150 100 250 150 150<br />
Bahnstrecken nicht elektr. 100 100 100<br />
alle Bahnlinien 50-200 50<br />
Hochspannungsfreileitung 200 200 200 150 150 100-400 100<br />
Produktenleitungen 60 200 50<br />
Ferngasleitungen 100 50<br />
Im Rahmen des regionalen Windenergiekonzeptes sieht der Plangeber die Werte entsprechend<br />
der rechten Spalte der Tabelle 2 als harte Tabukriterien an. Diese beachten die gesetzlich<br />
zwingend vorgeschriebenen Mindestforderungen bzw. orientieren sich, soweit gesetzliche<br />
Vorgaben überhaupt fehlen unter Beachtung der Anforderungen aus Kap. 1.2.2 am<br />
unteren Ende der bundesweiten Bandbreite des entsprechenden Infrastrukturtyps um bei<br />
wirklich harten Tabuzonen zu bleiben.<br />
Soweit wie nachfolgend dargestellt, die Errichtung von baulichen Anlagen in Abständen die<br />
größer als die in der Tabelle 2 und in diesem Konzept verwendeten Mindestabstände sind<br />
dem Erlaubnis- oder Zustimmungsvorbehalt unterliegen, muss die zuständige Genehmigungsbehörde<br />
diese Erlaubnis bzw. Zustimmung zumindest in Aussicht stellen (wenn nicht<br />
sogar pauschal erteilen). Ansonsten sind, da der Plangeber des regionalen Windenergiekonzeptes<br />
mit der Ausweisung von VREG Wind die Inanspruchnahme der vorrangigen Nutzung<br />
innerhalb der Gebiete auch rechtlich sicherzustellen, die Abstände entsprechend anzupassen.<br />
Durch das harte Tabukriterium Einrichtungen, Trassen und Leitungen der technischen Infrastruktur<br />
wird in der Region eine Fläche von 60.023 ha eingenommen. Dies entspricht einem<br />
Flächenanteil von 9,2 % an der Gesamtfläche der Region.<br />
a) Bundesautobahnen und Bundesstraßen<br />
Gemäß § 9 Abs. 1 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) in der Fassung der Bekanntmachung<br />
vom 28. Juni 2007 (BGBl. I S. 1206), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom<br />
31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) geändert worden ist, dürfen längs der Bundesfernstraßen<br />
nicht errichtet werden:<br />
1. Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 40 Meter bei Bundesautobahnen und<br />
bis zu 20 Meter bei Bundesstraßen außerhalb der zur Erschließung der anliegenden<br />
Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten, jeweils gemessen vom äußeren<br />
Rand der befestigten Fahrbahn,<br />
2. bauliche Anlagen, die außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke<br />
bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten über Zufahrten oder Zugänge an Bundesstraßen<br />
unmittelbar oder mittelbar angeschlossen werden sollen.<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Seite 20 (von 46)
<strong>Regionalplan</strong> Region Chemnitz; Regionales Windenergiekonzept - Fachkonzept<br />
Beteiligung an der Ausarbeitung des Planentwurfs gemäß § 9 ROG<br />
in Verbindung mit § 6 Abs. 1 SächsLPlG<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
Satz 1 Nr. 1 gilt entsprechend für Aufschüttungen oder Abgrabungen größeren Umfangs.<br />
Weitergehende bundes- oder landesrechtliche Vorschriften bleiben unberührt.<br />
Gemäß § 9 Abs. 2 FStrG bedürfen Baugenehmigungen oder nach anderen Vorschriften<br />
notwendige Genehmigungen der Zustimmung der obersten Landesstraßenbaubehörde,<br />
wenn<br />
1. bauliche Anlagen längs der Bundesautobahnen in einer Entfernung bis zu 100 Meter<br />
und längs der Bundesstraßen außerhalb der zur Erschließung der anliegenden<br />
Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten bis zu 40 Meter, gemessen<br />
vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, errichtet, erheblich geändert oder<br />
anders genutzt werden sollen,<br />
2. bauliche Anlagen auf Grundstücken, die außerhalb der zur Erschließung der anliegenden<br />
Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten über Zufahrten oder<br />
Zugänge an Bundesstraßen unmittelbar oder mittelbar angeschlossen sind, erheblich<br />
geändert oder anders genutzt werden sollen.<br />
Die Zustimmungsbedürftigkeit nach Satz 1 gilt entsprechend für bauliche Anlagen, die nach<br />
Landesrecht anzeigepflichtig sind. Weitergehende bundes- oder landesrechtliche Vorschriften<br />
bleiben unberührt.<br />
b) Staatsstraßen und Kreisstraßen<br />
Gemäß § 24 Abs. 1 des Straßengesetzes für den Freistaat Sachsen (SächsStrG) vom<br />
21. Januar 1993 (SächsGVBl. S. 93), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Sächsischen<br />
Standortegesetzes vom 27. Januar 2012 (SächsGVBl. S. 130) dürfen außerhalb der zur Erschließung<br />
der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten längs der<br />
Staatsstraßen oder Kreisstraßen nicht errichtet werden:<br />
1. Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 20 m, gemessen vom äußeren Rand<br />
der befestigten Fahrbahn,<br />
2. bauliche Anlagen, die über Zufahrten an Staatsstraßen oder Kreisstraßen unmittelbar<br />
oder mittelbar angeschlossen werden sollen.<br />
Satz 1 Nr. 1 gilt entsprechend für Aufschüttungen oder Abgrabungen größeren Umfangs.<br />
Weitergehende bundes- oder landesrechtliche Vorschriften bleiben unberührt.<br />
Gemäß § 24 Abs. 2 SächsStrG bedürfen Baugenehmigungen oder nach anderen Vorschriften<br />
notwendige Genehmigungen der Zustimmung der Straßenbaubehörde, wenn<br />
1. bauliche Anlagen längs der Staatsstraßen oder Kreisstraßen außerhalb der zur Erschließung<br />
der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten in<br />
einer Entfernung bis zu 40 m, gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn<br />
errichtet, erheblich geändert oder anders genutzt werden sollen,<br />
2. bauliche Anlagen auf Grundstücken, die außerhalb der zur Erschließung der anliegenden<br />
Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten von Staatsstraßen oder<br />
Kreisstraßen über Zufahrten unmittelbar oder mittelbar angeschlossen sind, erheblich<br />
geändert oder anders genutzt werden sollen.<br />
Die Zustimmungspflicht nach Satz 1 gilt entsprechend für bauliche Anlagen, die nach der<br />
Bauordnung zustimmungsbedürftig sind. Weitergehende bundes- oder landesrechtliche Vorschriften<br />
bleiben unberührt.<br />
c) Bahnstrecken elektrifiziert und nicht elektrifiziert<br />
Im Allgemeinen Eisenbahngesetz (AEG) vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2396;<br />
1994 I S. 2439), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. September 2012 (BGBl. I<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Seite 21 (von 46)
<strong>Regionalplan</strong> Region Chemnitz; Regionales Windenergiekonzept - Fachkonzept<br />
Beteiligung an der Ausarbeitung des Planentwurfs gemäß § 9 ROG<br />
in Verbindung mit § 6 Abs. 1 SächsLPlG<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
S. 1884) geändert worden ist, sind im § 4 Sicherheitspflichten und Zuständigkeiten des Eisenbahn-Bundesamtes<br />
geregelt.<br />
Gemäß § 4 Abs. 1 AEG sind die Eisenbahnen verpflichtet, ihren Betrieb sicher zu führen und<br />
die Eisenbahninfrastruktur, Fahrzeuge und Zubehör sicher zu bauen und in betriebssicherem<br />
Zustand zu halten. Sie sind auch verpflichtet, an Maßnahmen des Brandschutzes und der<br />
Technischen Hilfeleistung mitzuwirken.<br />
Gemäß § 4 Abs. 6 AEG obliegen Baufreigaben, Abnahmen, Prüfungen, Zulassungen, Genehmigungen<br />
und Überwachungen für Errichtung, Änderung, Unterhaltung und Betrieb der<br />
Betriebsanlagen und für Schienenfahrzeuge von Eisenbahnen des Bundes auf Grund anderer<br />
Gesetze und Verordnungen ausschließlich dem Eisenbahn-Bundesamt.<br />
Konkrete Abstandsforderungen sind im AEG nicht enthalten. Das Eisenbahn-Bundesamt<br />
(EBA) hat mit Rundschreiben vom 18. November 1999 eine Abstandsempfehlung von WEA<br />
zu Bahntrassen von 2 WEA-Rotordurchmessern empfohlen, was bei heutigen 2 bis 3 MW-<br />
Anlagen etwa 150 bis 200 m entsprechen würde. Die damaligen Mindestabstände sollten<br />
verhindern, dass Fahrfreileitungen durch Nachluftturbulenzen der Rotoren in Schwingungen<br />
geraten. Bei den heutigen Anlagenhöhen ist diese Beeinflussung erheblich geringer, weil die<br />
Turbulenzen die deutlich niedrigeren Fahrleitungen der Bahn (ca. 5 m) und die Bahnstromleitungen<br />
(max. 15 m) nicht mehr erreichen und damit dieses Argument für die einzuhaltenden<br />
Mindestabstände zu Bahntrassen heute sachlich nicht mehr gerechtfertigt ist<br />
(BMU 2009). Für die Richtfunkstrecke beiderseits des Schienenweges sollen 35 m freigehalten<br />
werden.<br />
Im regionalen Windenergiekonzept wird von einer Abstandszone von 50 m von Windenergieanlagen<br />
zu allen gewidmeten Bahnlinien als hartes Tabukriterium ausgegangen. Dies<br />
stellt eine Orientierung an der Untergrenze der Bandbreite nach der BLIW (2012) dar.<br />
d) Hochspannungsfreileitungen<br />
Gesetzliche Regelungen zu Abständen zu Hochspannungsfreileitungen gibt es nicht.<br />
Frühere Studien, die Abstände wissenschaftlich untersuchten und dabei die von den WEA-<br />
Rotoren ausgehenden Nachlaufströmungen einbezogen, gingen von einem Abstand von einem<br />
Rotordurchmesser d (bei gedämpften Leiterseilen) und 3 d bei nicht gedämpften Leiterseilen<br />
aus. Der Verband der Elektrizitätswirtschaft e. V. (VDEW) übernahm diese Ergebnisse<br />
Ende der 90er Jahre in seine Materialien. Durch die weitere Entwicklung hin zu immer höheren<br />
WEA, die die Höhe der Leiterseilebene deutlich überschreiten, überschneiden sich die<br />
Einflussbereiche jedoch immer weniger, so dass wegen der geringeren Turbulenzen auch<br />
ein geringerer Abstand als d möglich ist. Die Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik<br />
Informationstechnik (DKE) im Deutschen Institut für Normung e.V. (DIN) und der Verband<br />
der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. (VDE) sind u. a. zuständig für die Erarbeitung<br />
von Normen zur Errichtung von Freileitungen aller Spannungen und deren Leiter.<br />
Auf europäischer Ebene ist die Erstellung einer neuen Norm zur Errichtung von Freileitungen<br />
über 1 kV abgeschlossen worden. Die Einarbeitung in das nationale Normenwerk ist in Arbeit,<br />
die Veröffentlichung wird bis spätestens November 2013 erfolgen. Die beiden bisherigen<br />
Normen für Freileitungen von 1 kV bis einschließlich 45 kV und für Freileitungen über 45<br />
kV wurden zusammengeführt und aktuelle Themen berücksichtigt. Anfang 2013 ist die Veröffentlichung<br />
eines Norm-Entwurfs der im nationalen Arbeitsgremium beschlossenen Überarbeitung<br />
der nationalen normativen Festlegungen für Freileitungen bis einschließlich 45 kV<br />
geplant, um die Öffentlichkeit über die Arbeiten der letzten beiden Jahre zu informieren. Dabei<br />
wurden die bisherigen Ergänzungen der Norm für Freileitungen über 45 kV integriert und<br />
neue Erkenntnis eingearbeitet (Windlasten, Eislasten, Anforderungen an Holzmaste usw.).<br />
Es ist beabsichtigt, die durch die Einspruchsberatung gewonnenen Ergebnisse in die gemeinsamen<br />
nationalen normativen Festlegungen des neuen Normenteils einzuarbeiten. Die<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Seite 22 (von 46)
<strong>Regionalplan</strong> Region Chemnitz; Regionales Windenergiekonzept - Fachkonzept<br />
Beteiligung an der Ausarbeitung des Planentwurfs gemäß § 9 ROG<br />
in Verbindung mit § 6 Abs. 1 SächsLPlG<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
Veröffentlichung dieses Norm-Entwurfs ist für Ende 2013/Anfang 2014 geplant. Bis dahin<br />
wird im regionalen Windenergiekonzept von einer Abstandszone von 100 m von Windenergieanlagen<br />
zu allen Hochspannungsfreileitungen als hartes Tabukriterium ausgegangen.<br />
Dies stellt eine Orientierung an GATZ (2009) sowie an der Untergrenze der Bandbreite nach<br />
der BLIW (2012) dar.<br />
4.2.1.4 Still- und Fließgewässer<br />
Gewässer bedürfen aufgrund ihrer vielfältigen ökologischen und Erholungsfunktionen sowohl<br />
im Bereich der offenen Wasserflächen als auch im Uferbereich und im weiteren Umfeld eines<br />
besonderen Schutzes vor Beeinträchtigungen.<br />
Die entsprechenden Bestimmungen des Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009<br />
(BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBl. I S.<br />
95) geändert worden ist, erlauben in vielen Fällen die Umsetzung in Landesrecht, weshalb<br />
nachfolgend zumeist auf die Bestimmungen des Sächsischen Wassergesetzes (SächsWG)<br />
vom 18. Oktober 2004 (SächsGVBl. S. 482), zuletzt geändert durch Art. 7 Haushaltsbegleitgesetz<br />
2013/2014 vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725) verwiesen wird.<br />
Nach § 50 Abs. 1 SächsWG sind die Uferbereiche und Randstreifen der Gewässer einschließlich<br />
ihres Bewuchses zu schützen. Als Ufer gilt die zwischen der Uferlinie und der Böschungsoberkante<br />
liegende Landfläche. Fehlt eine Böschungsoberkante, tritt an ihre Stelle<br />
die Linie des mittleren Hochwasserstandes. Als mittlerer Hochwasserstand gilt das arithmetische<br />
Mittel der Höchstwerte der Wasserstände der letzten zwanzig Jahre, bei gestauten<br />
Gewässern die Linie des höchsten Stauziels. Stehen für diesen Zeitraum keine vollständigen<br />
Pegelbeobachtungen zur Verfügung, bezeichnet die zuständige Wasserbehörde die Beobachtungen,<br />
die zu verwenden sind.<br />
Nach § 50 Abs. 2 SächsWG schließt sich an das Ufer landwärts ein zehn Meter, innerhalb<br />
von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen fünf Meter breiter Gewässerrandstreifen an.<br />
Entsprechend § 50 Abs. 3 Nr. 1 b SächsWG ist in Anwendung von § 38 Abs. 4 WHG in diesen<br />
Gewässerrandstreifen die Errichtung von baulichen Anlagen soweit sie nicht standortgebunden<br />
oder wasserwirtschaftlich erforderlich sind und damit auch von Windenergieanlagen<br />
verboten.<br />
Im regionalen Windenergiekonzept wird deshalb von einer Abstandszone von 10 m vom Ufer<br />
als hartes Tabukriterium ausgegangen.<br />
Durch das harte Tabukriterium Still- und Fließgewässer wird in der Region eine Fläche von<br />
9.823 ha eingenommen. Dies entspricht einem Flächenanteil von 1,5 % an der Gesamtfläche<br />
der Region.<br />
4.2.1.5 Wasser- und Heilwasserschutzgebiete<br />
Nach § 48 Abs. 1 (SächsWG) wird die Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen<br />
zur Festsetzung von Wasserschutzgebieten nach § 51 Abs. 1 WHG auf die unteren Wasserbehörden<br />
übertragen. Die unteren Wasserbehörden können Regelungen zur Kennzeichnung<br />
und Sicherung des Wasserschutzgebiets und zu seiner Überwachung durch den Träger der<br />
öffentlichen Wasserversorgung oder den Betreiber der Wasserversorgungsanlagen treffen.<br />
Anstelle von Verboten und Nutzungsbeschränkungen können Handlungspflichten angeordnet<br />
werden, wenn und soweit dadurch für die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von<br />
Grundstücken im Wasserschutzgebiet keine weitergehenden wirtschaftlichen Nachteile entstehen.<br />
In der Verordnung sollen die Voraussetzungen für eine Befreiung von den Verboten,<br />
Nutzungsbeschränkungen, Duldungs- und Handlungspflichten für den Fall geregelt werden,<br />
dass im Einzelfall überwiegende Gründe des Allgemeinwohls eine Abweichung erfordern<br />
oder der mit der Festsetzung bezweckte Schutz eine Abweichung zulässt. Nach Abs. 2 kön-<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Seite 23 (von 46)
<strong>Regionalplan</strong> Region Chemnitz; Regionales Windenergiekonzept - Fachkonzept<br />
Beteiligung an der Ausarbeitung des Planentwurfs gemäß § 9 ROG<br />
in Verbindung mit § 6 Abs. 1 SächsLPlG<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
nen die Wasserschutzgebiete in Zonen mit verschiedenen Schutzbestimmungen eingeteilt<br />
werden.<br />
Trinkwasserschutzgebiete sollen gemäß § 48 Abs. 3 SächsWG in die weitere Schutzzone<br />
(TWSZ 3), die engere Schutzzone (TWSZ 2) und die Fassungszone (TWSZ 1) unterteilt<br />
werden. Die weitere Schutzzone soll den Schutz vor weitreichenden Beeinträchtigungen,<br />
insbesondere vor nicht oder nur schwer abbaubaren chemischen und vor radioaktiven Verunreinigungen,<br />
die geeignet sind, die menschliche Gesundheit zu schädigen, gewährleisten.<br />
Die engere Schutzzone soll insbesondere den Schutz vor Verunreinigungen sowie vor sonstigen<br />
Beeinträchtigungen gewährleisten, die wegen ihrer geringen Entfernung zur Gewinnungsanlage<br />
gefährlich sind. Die Fassungszone soll die Fassungsanlage und ihre unmittelbare<br />
Umgebung vor jeglicher Verunreinigung und Beeinträchtigung schützen. Dabei geht es<br />
hierbei nicht nur um die Vorsorge für Havariefälle (mögliche Verunreinigung z. B. durch Öl),<br />
sondern auch um die Vermeidung von Eingriffen in den Boden und damit in die Grundwasser<br />
überdeckenden Schichten.<br />
Die Errichtung und Erweiterung baulicher Anlagen, wozu WEA gehören, ist nach den allgemeingültigen<br />
Richtlinien des DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.) in<br />
den Zonen I und II nicht gestattet (Arbeitsblätter W 101 und W 102 Richtlinien für Trinkwasserschutzgebiete;<br />
Teil 1 Schutzgebiete für Grundwasser und Teil 2 Schutzgebiete für Talsperren).<br />
Die Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen zum Schutz staatlich anerkannter<br />
Heilquellen nach § 53 Abs. 4 WHG wird nach § 46 Abs. 3 SächsWG ebenfalls auf die unteren<br />
Wasserbehörden übertragen. Die Rechtsverordnung wird im Einvernehmen mit der zuständigen<br />
Gesundheitsbehörde erlassen. § 19 Abs. 2 bis 4 WHG und § 48 SächsWG gelten<br />
entsprechend. Damit gelten bei Heilwasserschutzgebieten die gleichen Anforderungen in<br />
den jeweiligen Schutzzonen wie bei Trinkwasserschutzgebieten.<br />
Im regionalen Windenergiekonzept werden deshalb alle Zonen I und II der rechtskräftig festgesetzten<br />
Wasser- und Heilwasserschutzgebiete als hartes Tabukriterium beachtet.<br />
Durch das harte Tabukriterium Wasser- und Heilwasserschutzgebiete wird in der Region eine<br />
Fläche von 22.376 ha eingenommen. Dies entspricht einem Flächenanteil von 3,4 % an<br />
der Gesamtfläche der Region.<br />
4.2.1.6 Hochwasserschutz<br />
Die bisherigen Vorschriften zum Hochwasserschutz (u. a. Hochwasserschutzgesetz von<br />
2005) wurden in Abschnitt 6 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) überführt. Gleichzeitig<br />
wurden die Vorgaben der EU-Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie von 2007 in nationales<br />
Recht umgesetzt. Als fortgeltendes Landesrecht sind insbesondere die §§ 99, 99a, 100,<br />
100b, 100c bis 100h Sächsisches Wassergesetz (SächsWG) zu nennen.<br />
Nach § 99 Abs. 2 SächsWG sind durch die zuständigen Behörden bei Planungen und bei der<br />
Ausführung bestimmter Vorhaben Möglichkeiten zur Erhaltung, Verbesserung und Wiederherstellung<br />
des natürlichen Rückhaltevermögens zu berücksichtigen (vorbeugender Hochwasserschutz).<br />
Hierzu gehören insbesondere die Gewährleistung und Verbesserung der<br />
Leistungsfähigkeit von Retentionsflächen und Überschwemmungsgebieten, die Vermeidung<br />
oder der Rückbau von Bodenversiegelungen, die Versickerung von Niederschlagswasser,<br />
die Renaturierung von Gewässern und sonstige Maßnahmen, die geeignet sind, den Abfluss<br />
des Niederschlagswassers zu vermindern.<br />
Nach § 73 Abs.1 WHG haben die zuständigen Behörden das Hochwasserrisiko zu bewerten<br />
und danach die Gebiete mit signifikantem Hochwasserrisiko (Risikogebiete) zu bestimmen.<br />
Hochwasserrisiko ist die Kombination der Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Hochwasserereignisses<br />
mit den möglichen nachteiligen Hochwasserfolgen für die menschliche Gesund-<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Seite 24 (von 46)
<strong>Regionalplan</strong> Region Chemnitz; Regionales Windenergiekonzept - Fachkonzept<br />
Beteiligung an der Ausarbeitung des Planentwurfs gemäß § 9 ROG<br />
in Verbindung mit § 6 Abs. 1 SächsLPlG<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
heit, die Umwelt, das Kulturerbe, wirtschaftliche Tätigkeiten und erhebliche Sachwerte. Gemäß<br />
Abs. 5 sind die Hochwasserrisiken bis zum 22. Dezember 2011 zu bewerten. Die Bewertung<br />
ist nicht erforderlich, wenn die zuständigen Behörden vor dem 22. Dezember 2010<br />
1. nach Durchführung einer Bewertung des Hochwasserrisikos festgestellt haben, dass<br />
ein mögliches signifikantes Risiko für ein Gebiet besteht oder als wahrscheinlich gelten<br />
kann und eine entsprechende Zuordnung des Gebietes erfolgt ist oder<br />
2. Gefahrenkarten und Risikokarten gemäß § 74 sowie Risikomanagementpläne gemäß<br />
§ 75 erstellt oder ihre Erstellung beschlossen haben. Nach Abs. 6 sind die Risikobewertung<br />
und die Bestimmung der Risikogebiete nach Absatz 1 sowie die Entscheidungen<br />
und Maßnahmen nach Abs. 5 bis zum 22. Dezember 2018 und danach alle<br />
sechs Jahre zu überprüfen und erforderlichenfalls zu aktualisieren. Dabei ist den voraussichtlichen<br />
Auswirkungen des Klimawandels auf das Hochwasserrisiko Rechnung<br />
zu tragen.<br />
Es ist davon auszugehen, dass die sächsischen Hochwasserschutzkonzepte diese Anforderungen<br />
grundsätzlich erfüllen.<br />
Nach § 74 Abs. 1 WHG haben die zuständigen Behörden für die Risikogebiete Gefahrenkarten<br />
und Risikokarten in dem Maßstab, der hierfür am besten geeignet ist, zu erstellen. Zur<br />
Klarstellung ergänzt § 99b Abs. 4 SächsWG, dass die Erstellung der Gefahrenkarten und Risikokarten<br />
nach § 74 WHG und die Aufstellung der Risikomanagementpläne nach § 75 WHG<br />
den Trägern der Unterhaltungslast nach § 70 Abs. 1 (SächsWG) obliegt. Dabei erfassen<br />
nach § 74 Abs. 2 WHG die Gefahrenkarten die Gebiete, die bei folgenden Hochwasserereignissen<br />
überflutet werden:<br />
1. Hochwasser mit niedriger Wahrscheinlichkeit oder bei Extremereignissen,<br />
2. Hochwasser mit mittlerer Wahrscheinlichkeit (voraussichtliches Wiederkehrintervall<br />
mindestens 100 Jahre),<br />
3. soweit erforderlich, Hochwasser mit hoher Wahrscheinlichkeit.<br />
Die Gefahrenkarten und Risikokarten sind gemäß Abs. 6 bis zum 22. Dezember 2013 zu erstellen.<br />
Alle Karten sind bis zum 22. Dezember 2019 und danach alle sechs Jahre zu überprüfen<br />
und erforderlichenfalls zu aktualisieren. Es ist davon auszugehen, dass die sächsischen<br />
Hochwasserschutzkonzepte diese Anforderungen grundsätzlich erfüllen.<br />
Nach § 75 Abs. 1 WHG haben die zuständigen Behörden für die Risikogebiete auf der<br />
Grundlage der Gefahrenkarten und Risikokarten Risikomanagementpläne zu erstellen. Die<br />
Aufstellung der Risikomanagementpläne nach § 75 WHG obliegt den Trägern der Unterhaltungslast<br />
nach § 70 Abs. 1 (SächsWG). Diese dienen gemäß Abs. 2 dazu, die nachteiligen<br />
Folgen, die an oberirdischen Gewässern mindestens von einem Hochwasser mit mittlerer<br />
Wahrscheinlichkeit und beim Schutz von Küstengebieten mindestens von einem Extremereignis<br />
ausgehen, zu verringern, soweit dies möglich und verhältnismäßig ist. Die Pläne legen<br />
für die Risikogebiete angemessene Ziele für das Risikomanagement fest. Die Risikomanagementpläne<br />
sind gemäß Abs. 6 bis zum 22. Dezember 2015 zu erstellen. Alle Pläne sind<br />
bis zum 22. Dezember 2021 und danach alle sechs Jahre unter Berücksichtigung der voraussichtlichen<br />
Auswirkungen des Klimawandels auf das Hochwasserrisiko zu überprüfen<br />
und erforderlichenfalls zu aktualisieren. Es ist davon auszugehen, dass die sächsischen<br />
Hochwasserschutzkonzepte diese Anforderungen grundsätzlich erfüllen.<br />
Nach § 76 Abs. 2 WHG setzt die Landesregierung durch Rechtsverordnung<br />
1. innerhalb der Risikogebiete mindestens die Gebiete, in denen ein Hochwasserereignis<br />
statistisch einmal in 100 Jahren zu erwarten ist, und<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Seite 25 (von 46)
<strong>Regionalplan</strong> Region Chemnitz; Regionales Windenergiekonzept - Fachkonzept<br />
Beteiligung an der Ausarbeitung des Planentwurfs gemäß § 9 ROG<br />
in Verbindung mit § 6 Abs. 1 SächsLPlG<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
2. die zur Hochwasserentlastung und Rückhaltung beanspruchten Gebiete als Überschwemmungsgebiete<br />
fest. Nach § 77 WHG sind die Überschwemmungsgebiete in<br />
ihrer Funktion als Rückhalteflächen zu erhalten.<br />
§ 100 Abs. 2 SächsWG bekräftigt, dass die Gelände zwischen Ufern und Deichen sowie<br />
Hochwasserrückhalteräume von Talsperren und Rückhaltebecken sowie Flutungspolder als<br />
Überschwemmungsgebiete gelten. Die Herstellung oder wesentliche Änderung eines Flutungspolders<br />
bedarf der Planfeststellung oder Plangenehmigung. § 100 Abs. 2 SächsWG ergänzt,<br />
dass Gebiete im Sinne von § 76 Abs. 1 WHG, auch wenn sie nicht als Überschwemmungsgebiet<br />
festgesetzt sind, für den schadlosen Abfluss des Hochwassers und die dafür<br />
erforderliche Wasserrückhaltung freizuhalten sind. Die natürliche Wasserrückhaltung ist zu<br />
sichern sowie erforderlichenfalls wiederherzustellen und zu verbessern.<br />
Gemäß § 78 WHG ist in den festgesetzten Überschwemmungsgebieten u a. die Errichtung<br />
oder Erweiterung baulicher Anlagen nach den §§ 30, 33, 34 und 35 BauGB untersagt.<br />
Im regionalen Windenergiekonzept werden deshalb festgesetzte Überschwemmungsgebiete<br />
pauschal als hartes Tabukriterium für die Errichtung von WEA beachtet.<br />
Darüber hinaus sind nach § 100b SächsWG auch noch Hochwasserentstehungsgebiete zu<br />
berücksichtigen. Hochwasserentstehungsgebiete sind nach § 100 b Abs. 1 SächsWG Gebiete,<br />
insbesondere in den Mittelgebirgs- und Hügellandschaften, in denen bei Starkniederschlägen<br />
oder bei Schneeschmelze in kurzer Zeit starke oberirdische Abflüsse eintreten<br />
können, die zu einer Hochwassergefahr in den Fließgewässern und damit zu einer erheblichen<br />
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung führen können. Die obere Wasserbehörde<br />
setzt die Hochwasserentstehungsgebiete durch Rechtsverordnung fest. Nach § 100 b<br />
Abs. 2 SächsWG ist in Hochwasserentstehungsgebieten das natürliche Wasserversickerungs-<br />
und Wasserrückhaltevermögen zu erhalten und zu verbessern. Insbesondere sollen<br />
in Hochwasserentstehungsgebieten die Böden so weit wie möglich entsiegelt und geeignete<br />
Gebiete aufgeforstet werden. Gemäß § 100 b Abs. 3 SächsWG bedürfen im Hochwasserentstehungsgebiet<br />
folgende Vorhaben der Genehmigung durch die zuständige Wasserbehörde:<br />
1. die Errichtung oder wesentliche Änderung baulicher Anlagen einschließlich Nebenanlagen<br />
und sonstiger zu versiegelnder Flächen nach § 35 BauGB ab einer zu versiegelnden<br />
Gesamtfläche von 1.000 m²,<br />
2. der Bau neuer Straßen,<br />
3. die Umwandlung von Wald,<br />
4. die Umwandlung von Grün- in Ackerland.<br />
Nach § 100 b Abs. 5 SächsWG ist in Hochwasserentstehungsgebieten die Ausweisung neuer<br />
Baugebiete nur zulässig, wenn nachgewiesen wird, dass das Wasserversickerungs- oder<br />
das Wasserrückhaltevermögen durch das Vorhaben nicht wesentlich beeinträchtigt oder die<br />
Beeinträchtigung im Zuge des Vorhabens durch Maßnahmen wie das Anlegen von Wald o-<br />
der den Bau technischer Rückhalteeinrichtungen im von dem Vorhaben betroffenen Hochwasserentstehungsgebiet<br />
angemessen kompensiert wird.<br />
Bei der Errichtung von WEA ist davon auszugehen, dass einschließlich der für die Nutzung<br />
der Windenergieanlagen zuständigen Infrastruktur regelmäßig eine Fläche von mehr als<br />
1.000 m² Fläche versiegelt wird. Insofern steht die Errichtung von WEA in Hochwasserentstehungsgebieten<br />
unter dem Genehmigungsvorbehalt durch die zuständige Wasserbehörde.<br />
Soweit unter Beachtung der in Kapitel 1.2.2 enthaltenen Ausführungen nicht pauschal eine<br />
Genehmigung von WEA in Hochwasserentstehungsgebieten erteilt (oder zumindest durch<br />
die zuständige Wasserbehörde in Aussicht gestellt werden kann), sind Hochwasserentstehungsgebiete<br />
pauschal als harte Tabukriterien für die Errichtung von WEA zu beachten.<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Seite 26 (von 46)
<strong>Regionalplan</strong> Region Chemnitz; Regionales Windenergiekonzept - Fachkonzept<br />
Beteiligung an der Ausarbeitung des Planentwurfs gemäß § 9 ROG<br />
in Verbindung mit § 6 Abs. 1 SächsLPlG<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
Durch das harte Tabukriterium Hochwasserschutz wird in der Region eine Fläche von 15.452<br />
ha eingenommen. Dies entspricht einem Flächenanteil von 2,4 % an der Gesamtfläche der<br />
Region.<br />
4.2.1.7 Luftverkehr und Landesverteidigung<br />
Gemäß § 18a Abs. 1 des Luftverkehrsgesetzes (LuftVG) in der Fassung der Bekanntmachung<br />
vom 10. Mai 2007 (BGBl. I S. 698), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5.<br />
Dezember 2012 (BGBl. I S. 2454) geändert worden ist, dürfen Bauwerke nicht errichtet werden,<br />
wenn dadurch Flugsicherungseinrichtungen gestört werden können. Das Bundesaufsichtsamt<br />
für Flugsicherung entscheidet auf der Grundlage einer gutachterlichen Stellungnahme<br />
der Flugsicherungsorganisation, ob durch die Errichtung der Bauwerke Flugsicherungseinrichtungen<br />
gestört werden können. Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung teilt<br />
seine Entscheidung der zuständigen Luftfahrtbehörde des Landes mit.<br />
Bei der Genehmigung von Landeplätzen und Segelfluggeländen können die Luftfahrtbehörden<br />
gemäß § 17 LuftVG bestimmen, dass die zur Erteilung einer Baugenehmigung zuständige<br />
Behörde die Errichtung von Bauwerken im Umkreis von 1,5 Kilometer Halbmesser um<br />
den dem Flughafenbezugspunkt entsprechenden Punkt nur mit Zustimmung der Luftfahrtbehörden<br />
genehmigen darf (beschränkter Bauschutzbereich).<br />
Nach § 14 Abs.1 LuftVG darf außerhalb des Bauschutzbereichs die für die Erteilung einer<br />
Baugenehmigung zuständige Behörde die Errichtung von Bauwerken, die eine Höhe von 100<br />
Metern über der Erdoberfläche überschreiten, nur mit Zustimmung der Luftfahrtbehörden genehmigen.<br />
Das Gleiche gilt nach Abs. 2 für Anlagen von mehr als 30 Meter Höhe auf natürlichen<br />
oder künstlichen Bodenerhebungen, sofern die Spitze dieser Anlage um mehr als 100<br />
Meter die Höhe der höchsten Bodenerhebung im Umkreis von 1,6 Kilometer Halbmesser um<br />
die für die Anlage vorgesehene Bodenerhebung überragt. Im Umkreis von 10 Kilometer<br />
Halbmesser um einen Flughafenbezugspunkt gilt als Höhe der höchsten Bodenerhebung die<br />
Höhe des Flughafenbezugspunktes.<br />
In der Region existieren Bauschutzbereiche für die Verkehrslandeplätze Auerbach/Vogtl.,<br />
Chemnitz-Jahnsdorf, Großrückerswalde und Zwickau und den Sonderlandeplatz Langhennersdorf.<br />
Die räumliche Ausprägung dieser Bauschutzbereiche ist dem Verband gegenwärtig<br />
nicht bekannt. Unter Beachtung von §§ 14 und 17 LuftVG und in Anlehnung an die bisherige<br />
Planungspraxis und an GATZ (2009) wird deshalb gegenwärtig im Windenergiekonzept eine<br />
Abstandszone von 1.000 m zu den Landeplätzen als hartes Tabukriterium verwendet.<br />
Entsprechend § 3 Abs. 1 Nr. 1 Schutzbereichsgesetz bedarf die Errichtung von baulichen<br />
Anlagen innerhalb von Schutzbereichen der Genehmigung. Diese darf nur versagt werden,<br />
soweit es zur Erreichung der Zwecke des Schutzbereichs erforderlich ist. Windenergieanlagen<br />
als bauliche Anlagen stehen dem Zweck eines militärischen Schutzbereichs regelmäßig<br />
entgegen. Deshalb werden die in der Region vorhandenen Schutzbereiche der Bundeswehr<br />
[Standortübungsplätze Gelobtland und Dreibrüderhöhe (Marienberg) und Standortübungsplätze<br />
Altenhain und Dittersbach (Frankenberg)] pauschal als harte Tabuzone im regionalen<br />
Windenergiekonzept beachtet. Der darüber hinaus bestehende militärische Interessenbereich<br />
für die Radarführungsanlage Gleina (Freistaat Thüringen) unter Beachtung der in Kap.<br />
1.2.2 enthaltenen Ausführungen im Einzelfall zu betrachten.<br />
Durch das harte Tabukriterium Luftverkehr und Landesverteidigung wird in der Region eine<br />
Fläche von 4.877 ha eingenommen. Dies entspricht einem Flächenanteil von 0,7 % an der<br />
Gesamtfläche der Region.<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Seite 27 (von 46)
<strong>Regionalplan</strong> Region Chemnitz; Regionales Windenergiekonzept - Fachkonzept<br />
Beteiligung an der Ausarbeitung des Planentwurfs gemäß § 9 ROG<br />
in Verbindung mit § 6 Abs. 1 SächsLPlG<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
4.2.1.8 Naturschutz<br />
In diesem Kapitel wird ausschließlich der sich aus den naturschutzrechtlichen Anforderungen<br />
ergebende Gebietsschutz von bestimmten Teilen von Natur und Landschaft betrachtet. Die<br />
Beachtung der sich aus dem besonderen Artenschutz ergebenden Anforderungen des Naturschutzrechts<br />
in Bezug auf die Errichtung von WEA sind hingegen in Kap. 4.2.2.1 und<br />
4.2.2.2 dargestellt.<br />
Nach § 20 Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S.<br />
2542), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95) geändert<br />
worden ist, wird ein Netz verbundener Biotope (Biotopverbund) geschaffen, das mindestens<br />
10 Prozent der Fläche eines jeden Landes umfassen soll.<br />
Teile von Natur und Landschaft können nach § 20 Abs. 2 BNatSchG geschützt werden<br />
1. nach Maßgabe des § 23 als Naturschutzgebiet,<br />
2. nach Maßgabe des § 24 als Nationalpark oder als Nationales Naturmonument,<br />
3. als Biosphärenreservat,<br />
4. nach Maßgabe des § 26 als Landschaftsschutzgebiet,<br />
5. als Naturpark,<br />
6. als Naturdenkmal oder<br />
7. als geschützter Landschaftsbestandteil<br />
und sind, soweit sie geeignet sind, Bestandteile des Biotopverbundes (§ 20 Abs. 3<br />
BNatSchG)<br />
Naturschutzgebiete sind gemäß § 23 Abs. 1 BNatSchG rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete,<br />
in denen ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft in ihrer Ganzheit oder in einzelnen<br />
Teilen erforderlich ist<br />
1. zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung von Lebensstätten, Biotopen oder<br />
Lebensgemeinschaften bestimmter wild lebender Tier- und Pflanzenarten,<br />
2. aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen oder<br />
3. wegen ihrer Seltenheit, besonderen Eigenart oder hervorragenden Schönheit.<br />
Nach Abs. 2 sind nach Maßgabe näherer Bestimmungen alle Handlungen, die zu einer Zerstörung,<br />
Beschädigung oder Veränderung des Naturschutzgebiets oder seiner Bestandteile<br />
oder zu einer nachhaltigen Störung führen können, verboten.<br />
Im Regionalen Windenergiekonzept werden deshalb die rechtsverbindlich festgesetzten Naturschutzgebiete<br />
als harte Tabuzonen angesehen.<br />
Alle weiteren nach § 20 Abs. 2 Nr. 4-7 BNatSchG geschützten Teile von Natur- und Landschaft<br />
(Landschaftsschutzgebiete, Naturpark, Naturdenkmal, geschützte Landschaftsbestandteile)<br />
sowie die Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung [Natura 2000 Gebiete bzw.<br />
Fauna- Flora- Habitat (FFH)- Gebiete und europäische Vogelschutzgebiete (SPA- Gebiete)]<br />
werden nicht pauschal als harte Tabuzonen bestimmt. Sie sind entsprechend ihrer Erklärung<br />
zur Unterschutzstellung und in Abhängigkeit des darin enthaltenen Schutzgegenstandes und<br />
Schutzzweckes bzw. Erhaltungszieles und der für die Erreichung dieser dazu notwendigen<br />
Ge- und Verbote im Einzelfall zu prüfen und zu bewerten.<br />
Durch das harte Tabukriterium Naturschutz wird in der Region eine Fläche von 7.503 ha eingenommen.<br />
Dies entspricht einem Flächenanteil von 1,2 % an der Gesamtfläche der Region.<br />
4.2.1.9 Bergbau<br />
Als harte Tabuzonen für den Belang des Bergbaus über Tage sind Bereiche, für die zugelassene<br />
bergrechtliche Betriebspläne (fakultative sowie obligatorische Rahmenbetriebspläne,<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Seite 28 (von 46)
<strong>Regionalplan</strong> Region Chemnitz; Regionales Windenergiekonzept - Fachkonzept<br />
Beteiligung an der Ausarbeitung des Planentwurfs gemäß § 9 ROG<br />
in Verbindung mit § 6 Abs. 1 SächsLPlG<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
Hauptbetriebspläne, Abschlussbetriebspläne) gemäß § 52 Bundesberggesetz (BBergG) vorhanden<br />
sind sowie Baubeschränkungsgebiete nach § 107 BBergG anzusehen und dementsprechend<br />
zu beachten. Baubeschränkungsgebiete sind dabei im Regelfall deckungsgleich<br />
mit den zugelassenen Rahmenbetriebsplänen. Der rechtliche Ausschlussgrund einer Windenergienutzung<br />
ergibt sich dabei aus dem öffentlichen Belang der Gewinnung von Rohstoffen,<br />
die im Falle zugelassener bergrechtlicher Betriebspläne auch ausreichend konkret sind,<br />
um Windenergieanlagen als privilegiertem Außenbereichsvorhaben nach § 35 Abs. 1 BauGB<br />
entgegenzustehen.<br />
Von dieser Regelung ausgenommen wurden die beiden großen Sanierungsgebiete der<br />
WISMUT (Pöhla, Schlema-Alberoda) mit einer Flächengröße von jeweils mehr als 20 km²,<br />
für die jeweils Abschlussbetriebspläne vorliegen. Aufgrund ihrer Spezifik und der Tatsache,<br />
dass es sich dabei nicht um Flächen für die Rohstoffgewinnung handelt, soll hier eine Einzelfallprüfung<br />
wie nachfolgend für die untertägigen Lagerstätten dargestellt, erfolgen.<br />
Eine Einzelfallprüfung ist bei untertägigen Lagerstätten und hierfür zugelassenen Betriebsplänen<br />
erforderlich. Diese sind dahingehend zu prüfen, inwieweit durch die untertägige Gewinnung<br />
ggf. die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen an der Oberfläche<br />
ausgeschlossen sein könnte. Dies wäre insbesondere dann der Fall, wenn durch Erschließung,<br />
Tageszugänge, Bergsenkungen oder Sprengerschütterungen der gemeinsame Betrieb<br />
nicht vereinbar wäre. Diese Prüfung hat durch die zuständigen Behörden zu erfolgen.<br />
Dem gegenüber stehen Bergbauberechtigungen nach §§ 6 bis 9 BBergG, denen kein zugelassener<br />
Betriebsplan zugrunde liegt, ebenso wie Grundstücke, in denen grundeigene Bodenschätze<br />
vorhanden sind, der Errichtung von Windenergieanlagen nicht pauschal entgegen.<br />
Der Gewinnungsberechtigte hat hier noch keinen Anspruch darauf, seine Gewinnungsberechtigung<br />
durch spätere Errichtung eines Gewinnungsbetriebs tatsächlich im vollen Umfang<br />
ausnutzen zu können. Dementsprechend ist der allgemeine öffentliche Belang der Rohstoffsicherung<br />
noch nicht konkret genug, um im Sinne einer harten Tabuzone der Ausweisung<br />
von Gebieten zur Nutzung der Windenergie entgegenzustehen.<br />
Die Geltungsbereiche der im Rahmen der bauordnungs-, wasser-, immissions- und naturschutzrechtlichen<br />
Verfahren für die Abgrabungen zur Gewinnung von Bodenschätzen erteilten<br />
Genehmigungen, sind ebenfalls als harte Tabukriterien zu beachten. Die Abgrenzungen<br />
dieser Geltungsbereiche liegen dem Verband gegenwärtig allerdings weder flächendeckend,<br />
noch vollständig und aktuell vor. Unabhängig ihrer tatsächlichen Auswirkungen auf die flächenhafte<br />
Vergrößerung des möglichen Ausschlussgebietes, bleiben diese deshalb vorerst<br />
unbeachtet. Allerdings sind die Angaben im Rahmen der Beteiligung bei der Ausarbeitung<br />
des Planentwurfes nach § 6 Abs. 1 SächsLPlG insbesondere durch die jeweiligen Genehmigungsbehörden<br />
zu ergänzen.<br />
Über die Geltungsbereiche der zugelassenen Betriebspläne sowie der Baubeschränkungsgebiete<br />
hinaus wurde entsprechend dem Vorschlag von GATZ (2009) zudem eine Abstandszone<br />
von 30 m berücksichtigt.<br />
Durch das harte Tabukriterium Bergbau wird in der Region eine Fläche von 4.064 ha eingenommen.<br />
Dies entspricht einem Flächenanteil von 0,6 % an der Gesamtfläche der Region.<br />
4.2.2 Bestimmung von weichen Tabuzonen<br />
In Abgrenzung zu den harten Tabuzonen/Kriterien sind die weichen Tabuzonen/Kriterien<br />
durch das durch den Plangeber im Planungsprozess anzuwendende Abwägungsgebot entsprechend<br />
§ 7 Abs. 2 Satz 1 ROG bestimmt. Danach sind bei der Aufstellung der Raumordnungspläne<br />
die öffentlichen und privaten Belange, soweit sie auf der jeweiligen Planungsebene<br />
erkennbar und von Bedeutung sind, gegeneinander und untereinander sowie bei der<br />
Festlegung von Zielen der Raumordnung abschließend abzuwägen. Dem Planungsträger ist<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Seite 29 (von 46)
<strong>Regionalplan</strong> Region Chemnitz; Regionales Windenergiekonzept - Fachkonzept<br />
Beteiligung an der Ausarbeitung des Planentwurfs gemäß § 9 ROG<br />
in Verbindung mit § 6 Abs. 1 SächsLPlG<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
es somit gestattet, bestimmte Räume aus Gründen, die nicht zwingend tatsächlicher<br />
und/oder rechtlicher Natur sein müssen, die von ihm aus (regional)planerischen Überlegungen<br />
heraus aber für die Nutzung von Windenergie nicht in Anspruch genommen werden sollen,<br />
von vornherein für die Nutzung von Windenergie außer Betracht zu lassen (= regionaler /<br />
regionalplanerischer Gestaltungsspielraum).<br />
Unabhängig der in Kap. 4 dargestellten Planungsmethodik und der grundsätzlichen Schwierigkeiten<br />
bei der Unterscheidung von harten und weichen Tabuzonen/Kriterien (siehe dazu<br />
Kap. 1.2.2) liegt entsprechend § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB eine Beeinträchtigung öffentlicher<br />
Belange insbesondere (auch dann) vor, wenn Belange des Naturschutzes und der<br />
Landschaftspflege, des Bodenschutzes, des Denkmalschutzes oder auch die natürlichen Eigenart<br />
der Landschaft und ihr Erholungswert beeinträchtigt oder das Orts- und Landschaftsbild<br />
verunstaltet wird. Diese Belange haben eine eigenständige Bedeutung neben den entsprechenden<br />
fachgesetzlichen Vorschriften zu Naturschutz und Landschaftspflege sowie<br />
Denkmalschutz auf der Ebene des Bundes und des Landes.<br />
Darüber hinaus stehen in Bezug auf die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege<br />
neben dem Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft, deren Gebietsschutz<br />
durch die Bestimmungen des Kapitels 4 BNatSchG vermittelt wird, die artenschutzrechtlichen<br />
Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG.<br />
Die Schwierigkeit der Abgrenzung dieser Kriterien ergibt sich insbesondere daraus, dass<br />
diese nicht aufgrund fachgesetzlich bestimmter Schutzgebietsabgrenzungen oder Abstandsnormen<br />
(pauschal) ermittelt werden können. Die besondere Schwierigkeit bei der Zuordnung<br />
der Tabuzonen/Kriterien in die Kategorien hart oder weich besteht in der Bestimmung und<br />
Unterscheidung ihres in Anwendung von § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB bzw. § 44 Abs. 1<br />
BNatSchG tatsächlich bestehenden harten Teils (Erfüllung gesetzlicher Verbotstatbestände)<br />
einerseits und ihres regionalplanerischen Gestaltungsspielraums andererseits sowie insgesamt<br />
in der Bestimmung der räumlichen Ausprägung dieser Kriterien und ihrer Teile in der<br />
Region. Hier ist eine spezifische fachrechtliche Prüfung im Einzelfall erforderlich. Angesicht<br />
des Erfordernisses der Sicherstellung der vorrangigen Nutzung in den auszuweisenden<br />
VREG Wind durch den Plangeber hat diese Prüfung jedoch zwingend auch im Rahmen des<br />
Regionalen Windenergiekonzeptes zu erfolgen.<br />
Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Zuordnung bei diesen Kriterien noch nicht abschließend<br />
vorgenommen werden kann, werden diese vorerst in den nachfolgenden Kapiteln unter<br />
der Rubrik weiche Tabuzonen/Kriterien geführt. Soweit sich in der Weiterarbeit des Regionalen<br />
Windenergiekonzeptes jedoch herausstellt, dass diese Kriterien tatsächlich ganz bzw.<br />
auch teilweise die Merkmale von § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB bzw. auch § 44 Abs. 1<br />
BNatSchG erfüllen, sind sie bzw. ihre als hartes Tabu zu klassifizierenden Teile zukünftig jedoch<br />
auch als harte Kriterien zu beachten.<br />
Um die gegenwärtig noch nicht abgeschlossene Zuordnung der harten und weichen<br />
Tabuzonen/Kriterien auch graphisch zu verdeutlichen, wurde in der Karte der Potenzialgebiete<br />
eine unterschiedliche farbige Darstellung gewählt.<br />
4.2.2.1 Besonderer Artenschutz<br />
Der Gebietsschutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft wurde im Rahmen des regionalen<br />
Windenergiekonzeptes bereits im Kap. 4.2.1 durch die pauschale Beachtung von<br />
Wald-, Wasser- und Naturschutzgebieten berücksichtigt. Unabhängig davon bestehen entsprechend<br />
des besonderen Artenschutzes nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bzw. 2 BNatSchG jedoch<br />
noch weitere Schutzanforderungen in Gestalt der Zugriffs- bzw. Störungsverbote für wild lebende<br />
Tiere der besonders geschützten Arten bzw. der streng geschützten Arten und der europäischen<br />
Vogelarten. Insofern ist für diese Tiere bzw. Arten eine artenschutzrechtliche Prüfung<br />
auf der regionalen Ebene durchzuführen.<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Seite 30 (von 46)
<strong>Regionalplan</strong> Region Chemnitz; Regionales Windenergiekonzept - Fachkonzept<br />
Beteiligung an der Ausarbeitung des Planentwurfs gemäß § 9 ROG<br />
in Verbindung mit § 6 Abs. 1 SächsLPlG<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
Zugriffsverbot<br />
Der Tatbestand einer Verletzung oder Tötung im Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG liegt<br />
erst dann vor, wenn sich das Risiko einer Verletzung oder Tötung durch ein Vorhaben aufgrund<br />
der besonderen Umstände, z. B. der Konstruktion des Vorhabens, der topographischen<br />
Verhältnisse oder der Biologie der betroffenen Arten, signifikant erhöht. Unvermeidbare<br />
betriebsbedingte Tötungen oder Verletzungen einzelner Individuen bei der Planung und<br />
Zulassung von öffentlichen Infrastruktur- und privaten Bauvorhaben fallen dementsprechend<br />
als Verwirklichung sozialadäquater Risiken nicht unter den Verbotstatbestand (BT- Drs.<br />
16/5199, S. 21 und 16/12274, S. 70 f.). Bei der Beurteilung des Vorliegens eines Verbotstatbestandes<br />
sind zudem die Maßnahmen der Risikovermeidung und -verminderung mit einzubeziehen.<br />
Störungsverbot<br />
Als eine Störung ist jede zwanghafte Einwirkung auf das natürliche Verhalten von Tieren,<br />
insbesondere durch akustische und optische Reize anzusehen. Die Annahme einer Störung<br />
setzt die Feststellung voraus, welche Arten auf konkrete Störwirkungen wie Lärm oder visuelle<br />
Störreize bei der Balz, während des Brütens und der Aufzucht von Jungen negativ reagieren.<br />
Die Erheblichkeitsschwelle der Störung ist auf die Entwicklung des Erhaltungszustandes<br />
der lokalen Population zu beziehen. Entsprechend der Gesetzesbegründung umfasst<br />
eine lokale Population diejenigen (Teil-)Habitate und Aktivitätsbereiche der Individuen<br />
einer Art, die in einem für die Lebens-(raum)ansprüche der Art ausreichenden räumlichfunktionalen<br />
Zusammenhang stehen (BT-Drs. 16/5100, S. 21). Die Bestimmung der Abgrenzung<br />
dieser Habitate und Aktivitätsbereiche ist dabei bei Arten mit einer punktuellen oder<br />
zerstreuten Verbreitung bzw. bei Arten mit lokalen Dichtezentren durch die Orientierung an<br />
eher kleinräumigen Landschaftseinheiten (z. B. Grünlandkomplexen, Waldgebieten, Bachläufen)<br />
möglich. Bei Arten mit einer flächigen Verbreitung sowie bei revierbildenden Arten mit<br />
großen Aktionsräumen kann die lokale Population jedoch auch auf naturräumliche Landschaftseinheiten<br />
bezogen werden.<br />
Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes ist dann anzunehmen, wenn sich infolge<br />
der Störung die Größe oder der Fortpflanzungserfolg der lokalen Population nicht nur unerheblich<br />
oder nicht nur vorübergehend verringert. Bei seltenen Arten kann dies bereits dann<br />
der Fall sein, wenn die Überlebenschancen, der Fortpflanzungserfolg oder die Reproduktionsfähigkeit<br />
einzelner Individuen vermindert werden.<br />
Die artenschutzrechtliche Prüfung auf der regionalen Ebene wurde für Vögel und Fledermäuse<br />
und somit für Arten, die in besonderem Maße durch die Errichtung von WEA beeinträchtigt<br />
werden können, in den Kapiteln 4.2.2.1.1 bzw. 4.2.2.1.2 (Bestimmung der Gebiete<br />
mit besonderer avifaunistischer Bedeutung bzw. mit besonderer Bedeutung für Fledermäuse)<br />
durchgeführt. Bei dieser Prüfung wurden dabei die nachfolgend aufgeführten allgemeinen<br />
Anforderungen an eine artenschutzrechtliche Prüfung beachtet.<br />
Der grundsätzlich individuenbezogene Ansatz der artenschutzrechtlichen Prüfung verlangt<br />
zwar Ermittlungen, die es gestatten, die tatbestandlichen Voraussetzungen der Verbote zu<br />
prüfen. Die Erstellung eines lückenlosen Arteninventars ist dabei jedoch nicht geboten. Vielmehr<br />
ist, soweit z.B. bestimmte Vegetationsstrukturen Rückschlüsse auf die artspezifische<br />
Ausstattung von Gebieten zulassen, auch eine Beschränkung auf repräsentative Daten zulässig.<br />
Die fachgerechte Beurteilung, wann ein Tötungs- oder Verletzungsrisiko „signifikant“<br />
erhöht ist, lässt sich dabei im strengen Sinne jedoch nicht „beweisen“, sondern unterliegt einer<br />
wertenden Betrachtung. Da in Planverfahren zu treffende Entscheidungen prognostische<br />
Elemente enthalten und überdies naturschutzfachlich allgemein anerkannte standardisierte<br />
Maßstäbe und rechenhaft handhabbare Verfahren zur Ermittlung dieser Maßstäbe fehlen,<br />
kann im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung bei Kenntnislücken und Prognoseunsicherheiten<br />
mit Analogieschlüssen und worst-case-Betrachtungen gearbeitet werden. Dabei<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Seite 31 (von 46)
<strong>Regionalplan</strong> Region Chemnitz; Regionales Windenergiekonzept - Fachkonzept<br />
Beteiligung an der Ausarbeitung des Planentwurfs gemäß § 9 ROG<br />
in Verbindung mit § 6 Abs. 1 SächsLPlG<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
steht den zuständigen Behörden hinsichtlich der Bestandserfassung und -bewertung eine<br />
naturschutzfachliche Einschätzungsprärogative (= Vorrecht der Einschätzung) zu (BVerwG,<br />
Urteil vom 14. April 2010 – 9 A 5.08 und OVG Sachsen-Anhalt, Urteil vom 26. Oktober 2011<br />
– 2 L 6/09).<br />
Entsprechend § 5 Abs. 1 Sächsisches Naturschutzgesetz (SächsNatSchG) sind die Grundlagen<br />
und Inhalte der Landschaftsplanung für das Gebiet jeder Planungsregion als Fachbeitrag<br />
zusammenhängend darzustellen. Die Inhalte der Landschaftsplanung werden entsprechend<br />
§ 5 Abs. 2 SächsNatSchG nach Abstimmung mit anderen raumbedeutsamen Planungen<br />
und Maßnahmen in den <strong>Regionalplan</strong> aufgenommen, sowie sie zur Koordinierung von<br />
Raumansprüchen erforderlich und geeignet sind und durch Ziele und Grundsätze der Raumordnung<br />
gesichert werden können. Im Übrigen werden sie den Plänen als Anlage beigefügt.<br />
Die Regionalpläne übernehmen nach § 5 Abs. 4 SächsNatSchG damit zugleich die Funktion<br />
der Landschaftsrahmenpläne im Sinne von § 10 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Die<br />
sächsischen Planungsverbände sind somit auch Fachplanungsträger für die Erarbeitung,<br />
Begründung und kartographische Darstellung von regional konkretisierten Zielen des Naturschutzes<br />
und der Landschaftspflege einschließlich der für ihre Verwirklichung erforderlichen<br />
Maßnahmen (§§ 4 und 7 SächsNatSchG).<br />
Aufgrund dieser gesetzlich zugewiesenen Fachaufgaben von Natur und Landschaft an den<br />
Planungsträger des Regionalen Windenergiekonzeptes wird davon ausgegangen, dass dem<br />
Planungsverband Region Chemnitz auch eine eigenständige Einschätzungsprärogative bei<br />
der artenschutzrechtlichen Prüfung in Zusammenhang mit der Erstellung des Konzeptes zukommt.<br />
Unabhängig dieser eigenständigen Einschätzungsprärogative werden die weiteren<br />
zuständigen Fachbehörden für die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes [Untere Naturschutzbehörden,<br />
Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG)] im Rahmen<br />
der Beteiligung an der Ausarbeitung jedoch explizit um eine besonderes intensive Prüfung<br />
der Kategorisierung der harten/weichen Tabuzonen/Kriterien und der Bestimmung der<br />
räumlichen Ausprägung dieser Tabuzonen/Kriterien in Zusammenhang mit dem besonderen<br />
Artenschutz gebeten.<br />
4.2.2.1.1 Gebiete mit besonderer avifaunistischer Bedeutung (Karte 3)<br />
Zur Ermittlung und Beachtung der artenschutzrechtlichen Tatbestände der Avifauna in Zusammenhang<br />
mit dem Zugriffs- und Störungsverbot wurde ein regionsweites Gutachten<br />
durch die Bearbeiter igc Ingenieurgruppe Chemnitz GbR und Herrn Jens Hering, Untere Naturschutzbehörde<br />
Landkreis Zwickau zur Auswahl, Abgrenzung und inhaltliche Kennzeichnung<br />
von Gebieten mit besonderer avifaunistischer Bedeutung in der Region Chemnitz erstellt.<br />
Der Abschluss der Arbeiten zum Gutachten erfolgte im Oktober 2012.<br />
Den fachlichen und methodischen Ausgangspunkt für die Untersuchungen bildete das bereits<br />
2003 durch das damalige Staatliche Umweltfachamt Chemnitz, Abteilung Naturschutz<br />
für das Gebiet der Altregion Chemnitz-Erzgebirge erarbeitete Gutachten zu Gebieten mit besonderer<br />
Bedeutung für den Vogelschutz. Als wesentliche fachliche Grundlagen im Rahmen<br />
der erneuten Untersuchungen wurden die aktuellen Vorkommensdaten und gezielt zusammengefassten<br />
Mitteilungen (Beobachtungsdaten) der auf diesem Gebiet tätigen Fachspezialisten<br />
verwendet.<br />
Ziel des Gutachtens war es, die Abgrenzung von Habitaten und Aktivitätsbereichen der<br />
Avifauna unter Beachtung von kleinräumigen Landschaftseinheiten im Sinne einer lokalen<br />
Population (= Gebiete mit besonderer avifaunistischer Bedeutung) auf der regionalen Ebene<br />
vorzunehmen. Neben dieser Abgrenzung wurden für jedes Gebiet Datenblätter mit den Charakteristika<br />
und wertbestimmenden Merkmalen (u.a. zu den avifaunistischen Haupt- und Nebenfunktionen,<br />
zur Bedeutungsstufe regional/überregional und zum Vorkommen wertbe-<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Seite 32 (von 46)
<strong>Regionalplan</strong> Region Chemnitz; Regionales Windenergiekonzept - Fachkonzept<br />
Beteiligung an der Ausarbeitung des Planentwurfs gemäß § 9 ROG<br />
in Verbindung mit § 6 Abs. 1 SächsLPlG<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
stimmender Arten qualitativ/teilweise quantitativ) erarbeitet. Gegenwärtig wird die Veröffentlichung<br />
des Gutachtens vorbereitet.<br />
In Zusammenhang mit der Abgrenzung der Gebiete wurden unter Berücksichtigung ihrer unterschiedlichen<br />
Bedeutung als Brut- und Nahrungshabitat bzw. als Zug- und Rastgebiet<br />
nachfolgende verschiedene Gebietstypen (siehe Tabelle 3) definiert.<br />
Tabelle 3<br />
Gebietstypen und ihre dominanten avifaunistischen Bedeutungen<br />
dominante avifaunistische Bedeutung<br />
Gebietstyp<br />
Brut / Nahrung Zug / Rast<br />
Tallebensräume × ×<br />
Standgewässerlebensräume × ×<br />
Waldlebensräume ×<br />
Offenlandlebensräume / Brut ×<br />
Offenlandlebensräume / Brut + Rast × ×<br />
Offenlandlebensräume / Rast ×<br />
Lebensräume hoher avifaunistischer Vielfalt × ×<br />
Europäische Vogelschutzgebiete × ×<br />
Brutplätze ausgewählter Arten ×<br />
Tallebensräume repräsentieren den Komplex der an Fließgewässer, typische Auenbiotope<br />
oder an die i.d.R. steileren und relativ naturnahen Leitewälder der Talhänge gebundenen<br />
Brutvogelvorkommen. Talräume der Flüsse und größeren Bäche sind darüber hinaus für bestimmte<br />
Arten bevorzugte Zug- und Rastkorridore und auch Leitlinien für z.B. Nahrungsflüge<br />
oder Flüge zu Rast- bzw. Schlafplätzen. Die Standgewässerlebensräume umfassen neben<br />
der Wasserfläche selbst auch Uferzonen und benachbarte terrestrische Rastflächen für gewässerorientierte<br />
Vogelarten. Waldlebensräume schließen fallweise funktional damit im Zusammenhang<br />
zu betrachtende Waldumgebungszonen und auch weiteres waldbezogenes<br />
Offenland mit ein. Bei den eigentlichen Offenlandlebensräumen wird zwischen den Funktionstypen<br />
„Brut“, „Rast“ sowie „Brut und Rast“ unterschieden. Auch hier können untergeordnet<br />
halboffene und bewaldete Bereiche integriert sein. Lebensräume hoher avifaunistischer<br />
Vielfalt sind komplex wertvoll, ohne dass einzelne Funktionen klar dominieren.<br />
In Europäischen Vogelschutzgebieten (Special Protected Areas - SPA) als europaweit<br />
nach einheitlichen Standards ausgewählten und geschützten Gebieten entsprechend Artikel<br />
3 der Vogelschutzrichtlinie (kodifizierte Fassung RL 2009/147/EG über die Erhaltung der<br />
wildlebenden Vogelarten - Amtsblatt der Europäischen Union L 20 vom 26. Januar 2010, S.<br />
7 ff.) sind sowohl innerhalb als auch außerhalb der Gebiete die nötigen Erhaltungs- oder<br />
Wiederherstellungsmaßnahmen für die Pflege und Gestaltung der Lebensräume der Vogelarten<br />
zu gewährleisten sowie zerstörte Lebensstätten wiederherzustellen oder Lebensstätten<br />
auch neu zu schaffen. Einzeln erfasst wurden außerdem Brutplätze ausgewählter besonders<br />
empfindlicher Arten (Schwarzstorch, Weißstorch, Uhu, Schleiereule).<br />
Ausgehend von einer für das Gebiet der Region Chemnitz aktualisierten Artenliste der in der<br />
Region vorkommenden europäischen Brut- und Rastvogelarten (siehe nachfolgende Tabellen<br />
4 und 5) wurde zunächst eine Auswahl der für die Untersuchung relevanten Vogelarten<br />
(graue Markierung der wertgebenden Brut- bzw. Rastvögel) getroffen. Bei dieser Auswahl<br />
wurden dabei die jeweilige besondere spezifische Störempfindlichkeit, der allgemeine Gefährdungsgrad,<br />
der internationale und nationale Schutzstatus sowie die regionale Repräsentanz<br />
der jeweiligen Art berücksichtigt.<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Seite 33 (von 46)
<strong>Regionalplan</strong> Region Chemnitz; Regionales Windenergiekonzept - Fachkonzept<br />
Beteiligung an der Ausarbeitung des Planentwurfs gemäß § 9 ROG<br />
in Verbindung mit § 6 Abs. 1 SächsLPlG<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
Tabelle 4 Wertgebende Brutvogelarten für die Auswahl und Abgrenzung von Gebieten<br />
mit besonderer avifaunistischer Bedeutung und ihre bevorzugten Lebensräume<br />
Deutscher Name<br />
Wissenschaftlicher Name<br />
Offenland Wald Standgewässer Fließgewässer<br />
BPl NR BPl NR BPl NR BPl NR<br />
Höckerschwan Cygnus olor ● ● ●<br />
Schnatterente Anas strepera ● ●<br />
Krickente Anas crecca ● ● ●<br />
Knäkente Anas querquedula ● ●<br />
Tafelente Aythya ferina ● ●<br />
Reiherente Aythya fuligula ● ● ● ●<br />
Wachtel Coturnix coturnix ● ●<br />
Rebhuhn Perdix perdix ● ●<br />
Birkhuhn Tetrao tetrix ● ● ● ●<br />
Auerhuhn Tetrao urogallus ● ●<br />
Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis ● ●<br />
Haubentaucher Podiceps cristatus ● ●<br />
Schwarzhalstaucher Podiceps nigricollis ● ●<br />
Rohrdommel Botaurus stellaris ● ●<br />
Zwergdommel Ixobrychus minutus ● ●<br />
Graureiher Ardea cinerea ● ● ● ● ● ●<br />
Weißstorch Ciconia ciconia (●) ● ●<br />
Schwarzstorch Ciconia nigra ● ● ●<br />
Wespenbussard Pernis apivorus ● ● ●<br />
Wiesenweihe Circus pygargus ● ●<br />
Rohrweihe Circus aeruginosus ● ● ● ●<br />
Habicht Accipiter gentilis ● ● ● ● ●<br />
Sperber Accipiter nisus ● ● ● ● ●<br />
Rotmilan Milvus milvus ● ● ●<br />
Schwarzmilan Milvus migrans ● ● ● ●<br />
Baumfalke Falco subbuteo ● ● ● ●<br />
Wanderfalke Falco peregrinus ● ● ●<br />
Wasserralle Rallus aquaticus ● ● ● ●<br />
Wachtelkönig Crex crex ● ●<br />
Tüpfelsumpfhuhn Porzana porzana ● ● ● ●<br />
Teichhuhn Gallinula chloropus ● ●<br />
Kiebitz Vanellus vanellus ● ● ● ●<br />
Flussregenpfeifer Charadrius dubius ● ● ● ● ● ●<br />
Waldschnepfe Scolopax rusticola ● ●<br />
Bekassine Gallinago gallinago ● ● ●<br />
Flussuferläufer Actitis hypoleucos ● ● ● ●<br />
Waldwasserläufer Tringa ochropus ● ● ● ● ●<br />
Lachmöwe Larus ridibundus ● ● ● ●<br />
Hohltaube Columba oenas ● ● ●<br />
Turteltaube Streptopelia turtur ● ● ●<br />
Kuckuck Cuculus canorus ● ● ● ● ●<br />
Schleiereule Tyto alba (●) ●<br />
Raufußkauz Aegolius funereus ● ●<br />
Steinkauz Athene noctua ● ●<br />
Sperlingskauz Glaucidium passerinum ● ●<br />
Uhu Bubo bubo ● ● ● ● ●<br />
Ziegenmelker Caprimulgus europaeus ● ● ●<br />
Eisvogel Alcedo atthis ● ● ● ●<br />
Wendehals Jynx torquilla ● ● ● ●<br />
Grauspecht Picus canus ● ●<br />
Grünspecht Picus viridis ● ● ●<br />
Schwarzspecht Dryocopus martius ● ●<br />
Mittelspecht Dendrocopos medius ● ●<br />
Kleinspecht Dryobates minor ● ●<br />
Neuntöter Lanius collurio ● ● ● ●<br />
Raubwürger Lanius excubitor ● ● ● ●<br />
Tannenhäher Nucifraga caryocatactes ● ●<br />
Saatkrähe Corvus frugilegus ● ●<br />
Kolkrabe Corvus corax ● ● ●<br />
Beutelmeise Remiz pendulinus ● ● ● ●<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Seite 34 (von 46)
<strong>Regionalplan</strong> Region Chemnitz; Regionales Windenergiekonzept - Fachkonzept<br />
Beteiligung an der Ausarbeitung des Planentwurfs gemäß § 9 ROG<br />
in Verbindung mit § 6 Abs. 1 SächsLPlG<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
Deutscher Name<br />
Wissenschaftlicher Name<br />
Offenland Wald Standgewässer Fließgewässer<br />
BPl NR BPl NR BPl NR BPl NR<br />
Sumpfmeise Parus palustris ● ●<br />
Heidelerche Lullula arborea ● ● ● ●<br />
Uferschwalbe Riparia riparia ● ● ● ● ●<br />
Waldlaubsänger Phylloscopus sibilatrix ● ●<br />
Schlagschwirl Locustella fluviatilis ● ●<br />
Rohrschwirl Locustella luscinioides ● ●<br />
Schilfrohrsänger Acrocephalus schoenobaenus ● ●<br />
Drosselrohrsänger Acrocephalus arundinaceus ● ●<br />
Sperbergrasmücke Sylvia nisoria ● ●<br />
Wasseramsel Cinclus cinclus ● ●<br />
Ringdrossel Turdus torquatus ● ●<br />
Zwergschnäpper Ficedula parva ● ●<br />
Braunkehlchen Saxicola rubetra ● ●<br />
Schwarzkehlchen Saxicola rubicola ● ●<br />
Nachtigall Luscinia megarhynchos ● ●<br />
Blaukehlchen Luscinia svecica ● ● ● ●<br />
Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus ● ● ● ●<br />
Steinschmätzer Oenanthe oenanthe ● ●<br />
Wiesenpieper Anthus pratensis ● ●<br />
Wiesenschafstelze Motacilla flava ● ●<br />
Karmingimpel Carpodacus erythrinus ● ●<br />
Grauammer Emberiza calandra ● ●<br />
Ortolan Emberiza hortulana ● ●<br />
Erläuterungen: BPl – Brutplatz NR – Nahrungsraum (●) – Lebensraum mit eingeschränkter Bedeutung<br />
grau markiert = wertgebender Brutvogel<br />
unmarkiert = Brutvogel mit Zusatzinformation (untergeordnete Berücksichtigung bei Gebietsauswahl und -begrenzung)<br />
Tabelle 5<br />
Wertgebende Rastvogelarten für die Auswahl und Abgrenzung von<br />
Gebieten mit besonderer avifaunistischer Bedeutung und ihre<br />
bevorzugten Rasträume<br />
Deutscher Name Wissenschaftlicher Name Offenland<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Seite 35 (von 46)<br />
Standgewässer<br />
Fließgewässer<br />
Höckerschwan Cygnus olor ● ● ●<br />
Singschwan Cygnus cygnus ● ●<br />
Saatgans Anser fabalis ●<br />
Blässgans Anser albifrons ●<br />
Brandgans Tadorna tadorna ●<br />
Schnatterente Anas strepera ●<br />
Pfeifente Anas penelope ●<br />
Krickente Anas crecca ● ●<br />
Stockente Anas platyrhynchos ● ●<br />
Spießente Anas acuta ● ●<br />
Knäkente Anas querquedula ●<br />
Löffelente Anas clypeata ●<br />
Kolbenente Netta rufina ●<br />
Tafelente Aythya ferina ● ●<br />
Moorente Aythya nyroca ●<br />
Reiherente Aythya fuligula ● ●<br />
Bergente Aythya marila ●<br />
Eiderente Somateria mollisima ●<br />
Eisente Clangula hyemalis ●<br />
Trauerente Melanitta nigra ●<br />
Samtente Melanitta fusca ●<br />
Schellente Bucephala clangula ● ●<br />
Zwergsäger Mergus albellus ● ●<br />
Mittelsäger Mergus serrator ● ●<br />
Gänsesäger Mergus merganser ● ●<br />
Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis ● ●<br />
Haubentaucher Podiceps cristatus ●<br />
Rothalstaucher Podiceps grisegena ●<br />
Schwarzhalstaucher Podiceps nigricollis ●<br />
Ohrentaucher Podiceps auritus ● ●<br />
Sterntaucher Gavia stellata ●<br />
Schlafplatz<br />
Sonstige
<strong>Regionalplan</strong> Region Chemnitz; Regionales Windenergiekonzept - Fachkonzept<br />
Beteiligung an der Ausarbeitung des Planentwurfs gemäß § 9 ROG<br />
in Verbindung mit § 6 Abs. 1 SächsLPlG<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
Deutscher Name Wissenschaftlicher Name Offenland<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Seite 36 (von 46)<br />
Standgewässer<br />
Fließgewässer<br />
Schlafplatz<br />
Prachtaucher Gavia arctica ●<br />
Eistaucher Gavia immer ●<br />
Kormoran Phalacrocorax carbo ● ● ●<br />
Rohrdommel Botaurus stellaris ●<br />
Zwergdommel Ixobrychus minutus ●<br />
Silberreiher Casmerodius albus ● ● ● ●<br />
Graureiher Ardea cinerea ● ● ● ●<br />
Schwarzstorch Ciconia nigra ● ●<br />
Weißstorch Ciconia ciconia ● ●<br />
Fischadler Pandion haliaetus ●<br />
Wespenbussard Pernis apivorus ●<br />
Kornweihe Circus cyaneus ●<br />
Wiesenweihe Circus pygargus ●<br />
Rohrweihe Circus aeruginosus ● ●<br />
Rotmilan Milvus milvus ● ●<br />
Schwarzmilan Milvus migrans ● ● ●<br />
Raufußbussard Buteo lagopus ●<br />
Mäusebussard Buteo buteo ●<br />
Merlin Falco columbarius ●<br />
Rotfußfalke Falco vespertinus ●<br />
Wanderfalke Falco peregrinus ●<br />
Kranich Grus grus ●<br />
Wasserralle Rallus aquaticus ●<br />
Tüpfelsumpfhuhn Porzana porzana ●<br />
Teichhuhn Gallinula chloropus ● ●<br />
Blässhuhn Fulica atra ● ●<br />
Kiebitzregenpfeifer Pluvialis squatarola ●<br />
Goldregenpfeifer Pluvialis apricaria ● ●<br />
Kiebitz Vanellus vanellus ● ●<br />
Flussregenpfeifer Charadrius dubius ● ●<br />
Sandregenpfeifer Charadrius hiaticula ●<br />
Mornellregenpfeifer Charadrius morinellus ●<br />
Regenbrachvogel Numenius phaeopus ● ●<br />
Großer Brachvogel Numenius arquata ● ●<br />
Uferschnepfe Limosa limosa ●<br />
Pfuhlschnepfe Limosa lapponica ●<br />
Waldschnepfe Scolopax rusticola ●<br />
Zwergschnepfe Lymnocryptes minimus ● ● ●<br />
Doppelschnepfe Gallinago media ● ●<br />
Bekassine Gallinago gallinago ● ● ●<br />
Odinshühnchen Phalaropus lobatus ●<br />
Flussuferläufer Actitis hypoleucos ● ●<br />
Dunkler Wasserläufer Tringa erythropus ●<br />
Rotschenkel Tringa totanus ●<br />
Grünschenkel Tringa nebularia ●<br />
Waldwasserläufer Tringa ochropus ● ●<br />
Bruchwasserläufer Tringa glareola ●<br />
Kampfläufer Philomachus pugnax ● ●<br />
Sanderling Calidris alba ●<br />
Zwergstrandläufer Calidris minuta ●<br />
Temminckstrandläufer Calidris temminckii ●<br />
Sichelstrandläufer Calidris ferruginea ●<br />
Alpenstrandläufer Calidris alpina ●<br />
Zwergmöwe Larus minutus ●<br />
Lachmöwe Larus ridibundus ● ●<br />
Schwarzkopfmöwe Larus melanocephalus ●<br />
Sturmmöwe Larus canus ● ●<br />
Mantelmöwe Larus marinus ● ●<br />
Silbermöwe Larus argentatus ● ●<br />
Mittelmeermöwe Larus michahellis ● ●<br />
Steppenmöwe Larus cachinnans ● ●<br />
Heringsmöwe Larus fuscus ● ●<br />
Zwergseeschwalbe Sternula albifrons ●<br />
Raubseeschwalbe Sterna caspia ●<br />
Weißbart-Seeschwalbe Chlidonias hybridus ●<br />
Weißflügel-Seeschwalbe Chlidonias leucopterus ●<br />
Sonstige
<strong>Regionalplan</strong> Region Chemnitz; Regionales Windenergiekonzept - Fachkonzept<br />
Beteiligung an der Ausarbeitung des Planentwurfs gemäß § 9 ROG<br />
in Verbindung mit § 6 Abs. 1 SächsLPlG<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
Deutscher Name Wissenschaftlicher Name Offenland<br />
Standgewässer<br />
Fließgewässer<br />
Schlafplatz<br />
Trauerseeschwalbe Chlidonias niger ●<br />
Flussseeschwalbe Sterna hirundo ●<br />
Küstenseeschwalbe Sterna paradisaea ●<br />
Hohltaube Columba oenas ● ●<br />
Ringeltaube Columba palumbus ● ●<br />
Turteltaube Streptopelia turtur ●<br />
Waldohreule Asio otus ●<br />
Sumpfohreule Asio flammeus ● ●<br />
Eisvogel Alcedo atthis ● ●<br />
Raubwürger Lanius excubitor ●<br />
Dohle Coloeus monedula ● ●<br />
Saatkrähe Corvus frugilegus ● ●<br />
Kolkrabe Corvus corax ●<br />
Beutelmeise Remiz pendulinus ●<br />
Feldlerche Alauda arvensis ●<br />
Heidelerche Lullula arborea ●<br />
Ohrenlerche Eremophila alpestris ●<br />
Uferschwalbe Riparia riparia ● ●<br />
Rauchschwalbe Hirundo rustica ● ● ●<br />
Mehlschwalbe Delichon urbicum ● ● ●<br />
Bartmeise Panurus biarmicus ●<br />
Feldschwirl Locustella naevia ● ●<br />
Rohrschwirl Locustella luscinoides ●<br />
Schilfrohrsänger Acrocephalus schoenobaenus ●<br />
Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris ● ●<br />
Teichrohrsänger Acrocephalus scirpaceus ●<br />
Drosselrohrsänger Acrocephalus arundinaceus ●<br />
Sperbergrasmücke Sylvia nisoria ● ●<br />
Star Sturnus vulgaris ●<br />
Misteldrossel Turdus viscivorus ●<br />
Ringdrossel Turdus torquatus ●<br />
Wacholderdrossel Turdus pilaris ●<br />
Rotdrossel Turdus iliacus ●<br />
Braunkehlchen Saxicola rubetra ●<br />
Schwarzkehlchen Saxicola rubicola ●<br />
Blaukehlchen Luscinia svecica ●<br />
Steinschmätzer Oenanthe oenanthe ●<br />
Brachpieper Anthus campestris ●<br />
Wiesenpieper Anthus pratensis ● ●<br />
Bergpieper Anthus spinoletta ● ●<br />
Wiesenschafstelze Motacilla flava ● ●<br />
Thunbergschafstelze Motacilla thunbergi ● ●<br />
Bachstelze Motacilla alba ● ● ●<br />
Buchfink Fringilla coelebs ●<br />
Bergfink Fringilla montifringilla ●<br />
Gimpel Pyrrhula pyrrhula ●<br />
Fichtenkreuzschnabel Loxia curvirostra ●<br />
Grünfink Carduelis chloris ●<br />
Erlenzeisig Carduelis spinus ●<br />
Stieglitz Carduelis carduelis ●<br />
Bluthänfling Carduelis cannabina ●<br />
Berghänfling Carduelis flavirostris ●<br />
Birkenzeisig Carduelis flammea ●<br />
Schneeammer Plectrophenax nivalis ●<br />
Goldammer Emberiza citrinella ●<br />
Ortolan Emberiza hortulana ●<br />
Rohrammer Emberiza schoeniclus ● ●<br />
Sonstige<br />
Erläuterungen:<br />
Hinweis:<br />
grau markiert = wertgebender Rastvogel<br />
unmarkiert = Rasttvogel mit Zusatzinformation (untergeordnete Berücksichtigung bei Gebietsauswahl und -begrenzung)<br />
Für die Auswahl und Abgrenzung von Gebieten mit besonderer avifaunistischer Bedeutung sind die gekennzeichneten bevorzugten<br />
Rasträume maßgeblich. In Einzelfällen (Star, Waldohreule) betrifft das nur die Schlafplätze.<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Seite 37 (von 46)
<strong>Regionalplan</strong> Region Chemnitz; Regionales Windenergiekonzept - Fachkonzept<br />
Beteiligung an der Ausarbeitung des Planentwurfs gemäß § 9 ROG<br />
in Verbindung mit § 6 Abs. 1 SächsLPlG<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
Der Abgrenzung der Gebiete mit besonderer avifaunistischer Bedeutung lagen somit unter<br />
Beachtung der Anforderungen des § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BNatSchG insgesamt strenge<br />
Maßstäbe zu Grunde. Einer weitergehenden Betrachtung im Einzelfall bedürfen darüber hinaus<br />
die unmittelbar auf einen Brutplatz bezogenen Bereiche der wertgebenden Arten, soweit<br />
sich diese außerhalb der abgegrenzten Gebiete mit besonderer avifaunistischer Bedeutung<br />
befinden. Nur örtlich bedeutsame, unbeständige oder unsicher belegte Vorkommensgebiete<br />
wurden im Gutachten bzw. bei der Bestimmung der Gebiete nicht berücksichtigt.<br />
Die Darstellung der Abgrenzung der ermittelten Gebiete mit besonderer avifaunistischer Bedeutung<br />
differenziert nach den unterschiedlichen Gebietstypen erfolgt in Karte 3.<br />
Durch das Tabukriterium Gebiete mit besonderer avifaunistischer Bedeutung wird in der Region<br />
eine Fläche von 195.765 ha eingenommen. Dies entspricht einem Flächenanteil von<br />
30 % an der Gesamtfläche der Region.<br />
4.2.2.1.2 Gebiete mit besonderer Bedeutung für Fledermäuse (Karte 4)<br />
Zur Ermittlung und Beachtung der artenschutzrechtlichen Tatbestände der Fledermäuse in<br />
Zusammenhang mit dem Zugriffs- und Störungsverbot wurde im Auftrag des Planungsverbandes<br />
Region Chemnitz ein regionsweites Gutachten durch Fachbearbeiter des Landratsamtes<br />
Mittelsachsen (Frau Dr. Ursula Heinrich, Frau Franziska Streich, Referat Unmweltfachaufgaben)<br />
erarbeitet. Die Erarbeitung des Gutachtens erfolgte unter Begleitung einer<br />
projektbezogenen Arbeitsgruppe. Mitglieder dieser Arbeitsgruppe waren weitere Artspezialisten<br />
von anderen Unteren Naturschutzbehörden der Landratsämter der Region sowie des<br />
LfULG. Der Abschluss der Arbeiten erfolgte im Oktober 2012.<br />
Das Ziel der Untersuchung bestand in der Abgrenzung von Gebieten mit besonderer Bedeutung<br />
für Fledermäuse auf der Ebene der Region. Den Ausgangspunkt bildeten dabei die derzeitigen<br />
Kenntnisse über Vorkommen, Verbreitung und Gefährdung von Fledermäusen in der<br />
Planungsregion (siehe Tabelle 6), den Habitatansprüchen dieser Arten und der aktuelle Wissensstand<br />
zum Konfliktrisiko der Arten gegenüber Windenergieanlagen.<br />
Tabelle 6<br />
Häufigkeit und Gefährdung der in der Planungsregion Chemnitz vorkommenden<br />
Fledermausarten<br />
Deutscher Name<br />
Wissenschaftlicher Name<br />
Rote Liste<br />
Sachsen<br />
BRD<br />
FFH<br />
II/IV<br />
Häufigkeit in der Region Chemnitz<br />
Abendsegler Nyctalus noctula 3 V IV seltener<br />
Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii R 2 II/IV sehr selten<br />
Braunes Langohr Plecotus auritus V V IV häufiger<br />
Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus 3 G IV seltener; auf tiefere Lagen beschränkt und dort häufiger<br />
Fransenfledermaus Myotis nattereri 2 * IV häufiger<br />
Graues Langohr Plecotus austriacus 2 2 IV sehr selten; auf tiefere Lagen beschränkt<br />
Große Bartfledermaus Myotis brandtii 2 V IV Seltener<br />
Großes Mausohr Myotis myotis 2 V II/IV Seltener<br />
Kleinabendsegler Nyctalus leisleri R D IV sehr selten<br />
Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus 2 V IV Seltener<br />
Kleine Hufeisennase Rhinolophus hipposideros 1 1 II/IV sehr selten<br />
Mopsfledermaus Barbastella barbastellus 1 2 II/IV Seltener<br />
Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus / D IV sehr selten<br />
Nordfledermaus Eptesicus nilssonii 2 G IV Ssltener; im Bergland vorkommend und dort häufiger<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Seite 38 (von 46)
<strong>Regionalplan</strong> Region Chemnitz; Regionales Windenergiekonzept - Fachkonzept<br />
Beteiligung an der Ausarbeitung des Planentwurfs gemäß § 9 ROG<br />
in Verbindung mit § 6 Abs. 1 SächsLPlG<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
Deutscher Name<br />
Wissenschaftlicher Name<br />
Rote Liste<br />
Sachsen<br />
BRD<br />
FFH<br />
II/IV<br />
Häufigkeit in der Region Chemnitz<br />
Nymphenfledermaus Myotis alcathoe / 1 IV sehr selten<br />
Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii R * IV sehr selten<br />
Teichfledermaus Myotis dasycneme R D II/IV sehr selten<br />
Wasserfledermaus Myotis daubentonii * * IV häufiger<br />
Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus R D IV seltener<br />
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus V * IV häufiger<br />
Erläuterungen:<br />
Rote Liste Deutschland, nach HAUPT et al., 2009, Hrsg.: BfN; Rote Liste Sachsen, nach RAU et al (1999): Rote Liste Wirbeltiere,<br />
Hrsg.: LfUG, Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege<br />
0 = ausgestorben oder verschollen; 1 = vom Aussterben bedroht; 2 = stark gefährdet; 3 = gefährdet<br />
G = Gefährdung unbekannten Ausmaßes; R = extrem selten; D = Daten unzureichend (- keine Gefährdungskategorie)<br />
V = Vorwarnliste (- keine Gefährdungskategorie); * = ungefährdet; / = nicht bewertet<br />
Im Einzelnen wurden regionsweit wichtige Sommer- und Winterquartiere der Arten mit ihrem<br />
spezifischen Umfeld, Wander- bzw. Zugkorridore (Flusstäler) sowie zusätzlich fledermausrelevante<br />
Landschaftsstrukturen in verschiedenen Stufen ermittelt. Bei der Abgrenzung dieser<br />
Bereiche wurden dabei die bisherigen Kenntnisse über akute Schädigungen (z. B. Totfunde<br />
von Fledermäusen an Windenergieanlagen), Artspezifika (differenzierte Konfliktrisiken bedingt<br />
z. B. durch das unterschiedliche Wanderverhalten, die Typik der Quartiere, die Art und<br />
Höhenlage der Jagdhabitate oder die charakteristischen Entfernungen zwischen Quartierund<br />
Nahrungsgebiet) sowie Quartiergrößen der unterschiedlichen Arten berücksichtigt.<br />
Durch die Verschneidung der in unterschiedlichen Stufen ermittelten fledermausrelevanten<br />
Strukturen mit ihrer Lage zu Zugkorridoren und Quartieren von Fledermäusen wurden Endwertstufen<br />
zur Bestimmung von Räumen mit unterschiedlicher Bedeutung für Fledermäuse<br />
gebildet (siehe dazu die Tabellen 7 bzw. 8).<br />
Tabelle 7<br />
Additionsschema des Flächenverschnitt zur Bildung der Endwertstufe<br />
innerhalb Zugkorridor<br />
und innerhalb<br />
Quartierpuffer<br />
innerhalb Zugkorridor<br />
und<br />
außerhalb<br />
Quartierpuffer<br />
außerhalb<br />
Zugkorridor<br />
und innerhalb<br />
Quartierpuffer<br />
außerhalb<br />
Zugkorridor<br />
und außerhalb<br />
Quartierpuffer<br />
keine fledermausrelevanten Strukturen II I I 0<br />
fledermausrelevante Strukturen III II II I<br />
sehr fledermausrelevante Strukturen IV III III II<br />
Tabelle 8<br />
Bezeichnung der unterschiedlich fledermausrelevanten Räume und ihrer<br />
entsprechenden Endwertstufe<br />
Endwertstufe 0 I II III IV<br />
Raumbezeichnung<br />
für Fledermäuse<br />
irrelevanter<br />
Raum<br />
für Fledermäuse<br />
relevanter<br />
Raum<br />
für Fledermäuse<br />
sehr<br />
relevanter<br />
Raum<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Seite 39 (von 46)<br />
für Fledermäuse<br />
relevanter Multifunktionsraum<br />
für Fledermäuse<br />
sehr relevanter<br />
Multifunktionsraum<br />
Der Abgrenzung der Gebiete mit besonderer Bedeutung für Fledermäuse lagen unter Beachtung<br />
der Anforderungen des § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BNatSchG insgesamt strenge Maßstäbe<br />
zu Grunde. Als pauschale Ausschlussbereiche für die Windenergienutzung im Sinne von<br />
harten Tabuzonen werden wegen des erhöhten Tötungs-, Verletzungs- bzw. Störungsrisikos<br />
die Gebiete der Endwertstufen III und IV (relevante und sehr relevante Multifunktionsräume)<br />
sowie alle Großwälder (Wälder ab ca. 3 km 2 ) angesehen. In Gebieten der Endwertstufen I
<strong>Regionalplan</strong> Region Chemnitz; Regionales Windenergiekonzept - Fachkonzept<br />
Beteiligung an der Ausarbeitung des Planentwurfs gemäß § 9 ROG<br />
in Verbindung mit § 6 Abs. 1 SächsLPlG<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
und II (relevante und sehr relevante Räume) ist eine Einzelfallbetrachtung in Abstimmung mit<br />
der jeweils zuständigen Unteren Naturschutzbehörde erforderlich.<br />
Unabhängig davon ist im Sinne von weichen Tabuzonen für Gebiete der Endwertstufen I und<br />
II einzelfallbezogen sowie für die Endwertstufen III und IV pauschal ein Abstand von 200 m<br />
ausgehend von der Flügelspitze der WEA in waagerechter Stellung zu den ermittelten fledermausrelevanten<br />
Räumen zu beachten.<br />
Die Darstellung der Abgrenzung der Gebiete differenziert nach unterschiedlichen Endwertstufen<br />
einschließlich des pauschalen Abstandes von 200 m für die Räume mit den Endwertstufen<br />
III und IV sowie aller Großwälder erfolgt in der Karte 4.<br />
Durch das Tabukriterium Gebiete mit besonderer Bedeutung für Fledermäuse wird in der<br />
Region eine Fläche von 309.873 ha eingenommen. Dies entspricht einem Flächenanteil von<br />
47,4 % an der Gesamtfläche der Region.<br />
4.2.2.2 Kulturlandschaft (Karte 5)<br />
Entsprechend § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB liegt eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange<br />
insbesondere (auch dann) vor, wenn Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege,<br />
des Bodenschutzes, des Denkmalschutzes oder auch die natürlichen Eigenart der<br />
Landschaft und ihr Erholungswert beeinträchtigt oder das Orts- und Landschaftsbild verunstaltet<br />
wird. Diese Belange haben eine eigenständige Bedeutung neben den entsprechenden<br />
fachgesetzlichen Vorschriften zu Naturschutz und Landschaftspflege sowie Denkmalschutz<br />
auf der Ebene des Bundes und des Landes. Sie können grundsätzlich auch privilegierten<br />
Vorhaben entgegengehalten werden. Allerdings ist das Gewicht der Privilegierung ist einem<br />
besonderem Maße zu beachten. Insofern können der Errichtung von WEA diese Belange nur<br />
bei einem entsprechenden Gewicht und/oder erheblicher Beeinträchtigung entgegen gehalten<br />
werden. So kann eine Verunstaltung des Landschaftsbildes nur dann angenommen werden,<br />
wenn es sich um eine in ihrer Schönheit und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung<br />
oder um einen besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Die im Rahmen<br />
des § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB erforderliche Prüfung verlangt eine nachvollziehbare<br />
Abwägung im Einzelfall, bei der die Schutzwürdigkeit des jeweils betroffenen Belangs sowie<br />
die Intensität und die Auswirkungen des Eingriffs dem Interesse an der Realisierung der<br />
WEA gegenüberzustellen sind.<br />
Die Erfordernisse des § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB werden nachfolgend unter dem Oberbegriff<br />
Kulturlandschaft im Rahmen der Ermittlung von regional bedeutsamen Landschaftsprägenden<br />
Erhebungen, Aussichtspunkten, wertvollen historischen Kulturlandschaften<br />
sowie Kulturdenkmalen dargestellt und geprüft.<br />
Durch das Tabukriterium Kulturlandschaft wird in der Region eine Fläche von 365.345 ha<br />
eingenommen. Dies entspricht einem Flächenanteil von 55,9 % an der Gesamtfläche der<br />
Region.<br />
4.2.2.2.1 Landschaftsprägende Erhebungen<br />
Der erreichte Sachstand einzelner Schwerpunktthemen in Vorbereitung der Erarbeitung des<br />
<strong>Regionalplan</strong>s, hier insbesondere zum Freiraum wurden in der 4. und 5. Sitzung des Planungsausschusses<br />
am 7. September 2010 (Teil 1) und 1. Dezember 2010 (Teil 2) jeweils im<br />
Tagesordnungspunkt 3 vorgestellt. Die damaligen Arbeitsergebnisse und ausgereichten<br />
thematischen Arbeitskarten bilden nach nochmaliger Prüfung die Grundlage für dieses Kapitel<br />
sowie die dazu entsprechenden kartographischen Darstellung.<br />
Die Auswahl und Abgrenzung von landschaftsprägenden Erhebungen erfolgte im Ergebnis<br />
von flächendeckenden Recherchen, gestützt auf mikrochorische Naturraumanalysen (Sächsische<br />
Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Arbeitsstelle „Naturhaushalt und Gebiets-<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Seite 40 (von 46)
<strong>Regionalplan</strong> Region Chemnitz; Regionales Windenergiekonzept - Fachkonzept<br />
Beteiligung an der Ausarbeitung des Planentwurfs gemäß § 9 ROG<br />
in Verbindung mit § 6 Abs. 1 SächsLPlG<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
charakter“: Naturräume und Naturraumpotenziale des Freistaates Sachsen im Maßstab<br />
1:50.000 Dresden 2001) und umfangreiche Bewertungen im Gelände. Die zwischen den<br />
rechtskräftigen Regionalplänen der Altregionen Westsachsen, Chemnitz-Erzgebirge und<br />
Südwestsachsen bestehenden methodischen Unterschiede in Klassifizierung und Bewertung,<br />
insbesondere liegt in der schwächer reliefierten (Alt-)Region Westsachsen die Auswahlschwelle<br />
niedriger, wurden dazu vereinheitlicht.<br />
Mit einer landschaftsprägenden Bedeutung auf der regionalen Ebene wurden dabei solche<br />
Erhebungen bestimmt, die sich durch eine markante Gestalt und eine exponierte Hochlage<br />
von den (mittleren) Reliefverhältnissen ihrer naturräumlichen Umgebung erkennbar absetzen<br />
(„markante Hochlagen“). Die besondere Bedeutung dieser (in der Regel überörtlich bekannten)<br />
Erhebungen wird in den meisten Fällen auch sprachlich durch alte Bezeichnungen dieser<br />
Standorte unterstrichen. Sie korrelieren in starkem Maße mit touristisch interessanten<br />
Aussichtspunkten und dem touristisch genutzten Wegenetz. Bei der Analyse wurden die<br />
Formtypen Kuppen/Einzelberge/Kuppengebiet, Rücken/Riedel/Höhenzüge, Stufen/Hanggebiete<br />
und Hochflächen/Hochplateaus unterschieden. Dabei treten im Einzelnen<br />
auch Mischformen und Formenkombinationen auf. Über die bestimmten und in der Karte<br />
ausgewiesenen regional bedeutsamen landschaftsprägenden Erhebungen hinaus gibt es eine<br />
Vielzahl aus örtlicher Sicht durchaus markanter Reliefgestalten. Diese können im regionalen<br />
Windenergiekonzept jedoch keine explizite Berücksichtigung finden.<br />
Die ermittelten Erhebungen wurden planungsbezogen bewertet und vier visuellen Bedeutungsstufen<br />
(sehr hoch, hoch, mittel und mäßige Bedeutung) zugeordnet. Grundlage dafür<br />
bildet eine vergleichende Einschätzung dieser Hochlagen nach ihrer Gestaltausprägung<br />
(markante Form - Gestaltmerkmal) und ihrer Lage im Relief in Verbindung mit ihrer relativen<br />
Höhe und flächenmäßigen Ausdehnung (exponierte Position - Lagemerkmal). Diese differenzierende<br />
Betrachtung entspricht einer Einzelfallbetrachtung auf regionaler Ebene.<br />
Die höchste Bewertungsstufe bilden acht ausgewählte Einzelfälle: der Fichtelberg, die drei<br />
großen Basaltberge Bärenstein, Pöhlberg und Scheibenberg im Mittelerzgebirge, der Auersberg,<br />
der vogtländische Kuhberg, die markante Landstufe am Kapellenberg sowie der Rochlitzer<br />
Berg.<br />
Einzelne weitere bedeutende landschaftsprägende Erhebungen in der Region wurden in eine<br />
hohe Bedeutungsstufe klassifiziert.<br />
So markiert der Rabensteiner Höhenzug auf über 12 km Länge die naturräumliche Grenze<br />
zum Erzgebirgsbecken. Zwischen Stollberg und dem Striegistal westlich von Freiberg beginnt<br />
das Erzgebirge mit einer markanten Randstufe, die allerdings durch Getälezonen unterbrochen<br />
ist.<br />
Im Erzgebirge selbst heben sich die Basalt-Tafelberge (Pöhlberg, Scheibenberg, Bärenstein),<br />
Härtlingskuppen des Quarzporphyrs (z.B. Augustusburg), einige markante Riedel<br />
zwischen eng benachbarten Tälern, hoch gelegene Rückengebiete (z.B. Kalter Muff) - oft mit<br />
aufgesetzten Kuppen - und großräumig vor allem im Naturparkgebiet Erzgebirge-Vogtland<br />
die hochgelegenen kammnahen Hochflächen mit ihren steilen Randstufen von den im Übrigen<br />
vorherrschenden Tal-, Riedel-, Rücken- und Hochflächengebieten ab. Die schon den<br />
oberen Gebirgslagen zuzurechnende Geyersche Platte, das Auersberg-Massiv und vor allem<br />
das Fichtelberg-Keilberg-Massiv mit den angrenzenden Hochlagen gehören zu den<br />
bedeutendsten Erhebungen des Erzgebirges.<br />
Für das Mittelvogtländische Kuppenland ist die Vielzahl, oft bewaldeter Diabaskuppen<br />
(„Pöhle“) kennzeichnend. Das waldreiche obere Vogtland ist von markanten Riedeln zwischen<br />
den Seitenbächen der Weißen Elster geprägt. Die bei Kirchberg im Westerzgebirge<br />
und bei Bobritzsch an der Regionsostgrenze die metamorphen Gesteine durchbrechenden<br />
Granite bilden Kuppenlandschaften, die von ständigen Wechseln zwischen Wald und Offen-<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Seite 41 (von 46)
<strong>Regionalplan</strong> Region Chemnitz; Regionales Windenergiekonzept - Fachkonzept<br />
Beteiligung an der Ausarbeitung des Planentwurfs gemäß § 9 ROG<br />
in Verbindung mit § 6 Abs. 1 SächsLPlG<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
flächen, zwischen Kuppen und Tälern mit vielen Bachläufen, Teichen und zahlreichen kleineren<br />
Landschaftsbestandteilen und abwechslungsreichen Blickpunkten gekennzeichnet sind.<br />
Die Abraumhalden des Steinkohlenbergbaus bei Zwickau und Oelsnitz/E. bzw. der Erzgewinnung<br />
bei Mechelgrün sind kleinräumige Besonderheiten der Reliefgestalt der Region.<br />
Berücksichtigung regional bedeutsamer landschaftsprägender Erhebungen als<br />
Tabuzonen für die Windenergienutzung<br />
Die Errichtung von Windenergieanlagen auf landschaftsbildprägenden Erhebungen ist mit<br />
dem beabsichtigten Zweck der Ausweisung (Erhaltung der charakteristischen visuellen Ausprägung)<br />
schwer vereinbar. Zu beachten ist dabei, dass für die Erhaltung des charakteristischen<br />
Landschaftsbildes dieser Erhebungen auch deren bildbedeutsames Umfeld zu schützen<br />
ist. Windenergieanlagen stehen funktionsbedingt vorzugsweise an exponierten Standorten<br />
mit nur unbedeutenden windhemmenden Strukturen. Eine großflächig wirksame Sichtverschattung<br />
ergibt sich somit für die heute üblichen großen Anlagen kaum durch eventuell<br />
dem Standort benachbarte abschirmende Landschaftsstrukturen, sondern eher auf Grund<br />
des speziellen Standortes des Betrachters (im Wald, im Tal). Windenergieanlagen sind regelmäßig<br />
weithin („regional“) sichtbar. Sie schöpfen die theoretischen „ästhetischen Wirkzonen“<br />
mastartiger Bauwerke auf Grund ihrer Standortspezifik in besonderem Maße auch tatsächlich<br />
aus. Die Wahrnehmungsintensität wird durch den sich drehenden Rotor noch verstärkt.<br />
Ein wirksamer Schutz visuell empfindlicher Landschaftsteile ist daher in erster Linie<br />
durch das Einhalten von Abständen möglich. Als äußere ästhetische Wirkzone mastartiger<br />
Bauwerke sehen mehrere Autoren (z.B. NOHL 1993) für Windenergieanlagen wichtige Entfernungsschwellwerte<br />
hinsichtlich ihrer visuellen Wirksamkeit überwiegend innerhalb einer<br />
Spanne schon für Anlagen der damaligen Größenordnung zwischen 1,5 und 10 km (Fernzone).<br />
In diesem Entfernungsbereich verlieren solche Bauwerke in Abhängigkeit von den konkreten<br />
örtlichen Bedingungen aus verschiedenen Gründen schließlich allmählich ihre visuelle<br />
Dominanz und Bedeutung. Eine vom damaligen Landesamt für Umwelt und Geologie des<br />
Freistaates Sachsen in Auftrag gegebene Studie zur „Windkraft im Erzgebirge“ (OEKOKART<br />
GmbH, 1994) kommt als Vorschlag für das Erzgebirge u. a. zu dem Ergebnis, dass im Umkreis<br />
markanter Kuppen, Höhenzüge und Felslandschaften standortspezifisch bis in 5 km<br />
Entfernung die Errichtung von Windenergieanlagen unterbunden werden sollte. Mit Blick auf<br />
eine Vielzahl regionaler Beispielfälle sowie in Abwägung zwischen dem Schutz des Landschaftsbildes<br />
und der privilegierten Nutzung von WEA wird deshalb bei der Bestimmung der<br />
Abstandszonen in Abhängigkeit von den Bedeutungsstufen der Erhebungen von einem Abstand<br />
zwischen 2 und 5 km (gemessen zwischen dem Rand der Landschaftsbildprägenden<br />
Erhebung und dem Rand des Windenergienutzungsgebietes) ausgegangen.<br />
Als hartes Tabukriterium werden dementsprechend die acht Einzelfälle der höchsten Bewertungsstufe<br />
einschließlich einer Abstandszone von 5 km beachtet. Alle übrigen landschaftsbildprägenden<br />
Erhebungen sind pauschal als weiche Tabuzonen zu berücksichtigen. Einzelfallbezogen<br />
sind hier zudem Abstandszonen zwischen 2 km für die Bedeutungsstufe „mäßig“,<br />
über 3 km („mittel“), bis 4 km („hoch“) differenziert zu berücksichtigen.<br />
Abweichend dazu sind in Gebieten mit bereits errichteten oder rechtskräftig genehmigten<br />
Windenergieanlagen ausnahmsweise Abstandsunterschreitungen gegenüber landschaftsbildprägenden<br />
Erhebungen im Einzelfall planerisch zulässig. Dies gilt insbesondere dann,<br />
wenn in den rechtsverbindlichen Regionalplänen der Altregionen im betroffenen Bereich bisher<br />
schon Ausweisungen für die Windenergienutzung erfolgten (Berücksichtigung der Vorbelastung,<br />
Planungskontinuität, Vertrauensschutz).<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Seite 42 (von 46)
<strong>Regionalplan</strong> Region Chemnitz; Regionales Windenergiekonzept - Fachkonzept<br />
Beteiligung an der Ausarbeitung des Planentwurfs gemäß § 9 ROG<br />
in Verbindung mit § 6 Abs. 1 SächsLPlG<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
4.2.2.2.2 Regional bedeutsame Aussichtspunkte und Aussichtsbereiche<br />
Regional bedeutsame Aussichtspunkte sind zumeist traditionelle und stark frequentierte<br />
Punkte, die regelmäßig von Besuchern aus den umliegenden Orten als auch von Touristen<br />
vor allem wegen des hervorragenden Ausblicks gezielt aufgesucht werden. Zu regional bedeutsamen<br />
Aussichtspunkten zählen insbesondere auch Aussichtstürme, Aussichtsfelsen<br />
sowie Burgen und Schlösser mit hervorragenden Ausblickmöglichkeiten und weitere exponierte<br />
Standorte. Zusätzlich zu den Aussichtspunkten i.e.S. wurden linienhafte Bereiche mit<br />
besonderer Sichtexposition („sichtexponierte Höhenzüge“), etwa entlang von Höhenwanderwegen,<br />
die über längere Strecken hervorragende Ausblicksmöglichkeiten bieten, identifiziert<br />
und als regional bedeutsame Aussichtsbereiche ausgewiesen.<br />
Durch eine flächendeckende Suche und Prüfung in der Region wurde eine Vielzahl von Aussichtspunkten<br />
ermittelt. Im Ergebnis dieser Untersuchung wurden die regional bedeutsamen<br />
Aussichtspunkte und Aussichtsbereiche der Region, differenziert nach zwei Bedeutungsstufen<br />
(hoch und sehr hoch), bestimmt (siehe dazu auch Anlage 3). Die in der Region darüber<br />
hinaus vorhandene Vielzahl von weiteren, örtlich ggf. durchaus interessanten Aussichtspunkten,<br />
blieb unberücksichtigt.<br />
Als hartes Tabukriterium ist der unmittelbare Standort der regional bedeutsamen Aussichtspunkte<br />
und -bereiche pauschal zu beachten. Als weiches Tabukriterium sind im Einzelfall unter<br />
Beachtung der differenzierten ästhetischen Wirkzonen von Windenergieanlagen und in<br />
Abhängigkeit von der Bedeutungsstufe des regional bedeutsamen Aussichtpunktes Abstandzonen<br />
von bis 3 bzw. bis 5 km Entfernung für die Bedeutungsstufe „hoch“ bzw. „sehr<br />
hoch“, gemessen zwischen dem Rand des Aussichtspunktes und dem Rand des Windenergienutzungsgebietes,<br />
zu berücksichtigen. Die gegenüber den regional bedeutsamen Aussichtspunkten<br />
und -bereichen zu deren Funktionsschutz konkret einzuhaltenden Abstände<br />
sind unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Wertigkeit dieser Punkte und unter Beachtung<br />
der für den Aussichtspunkt wichtigen Blicksektoren einzelfallbezogen zu bestimmen.<br />
4.2.2.2.3 Wertvolle historische Kulturlandschaften<br />
Die Sicherung und Entwicklung historischer Kulturlandschaften ist, unabhängig der sich aus<br />
§ 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 ergebenden Erfordernisse in weiteren fachrechtlichen Vorschriften<br />
verankert (siehe z.B. § 1 Abs. 4 Nr. 1 BNatSchG, § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG). Im Entwurf des LEP<br />
2012 wird bereits im Leitbild darauf hingewiesen, dass Sachsen attraktive und vielfältig genutzte<br />
Kulturlandschaften mit regionaltypischen Eigenarten bietet, deren historische Entwicklung<br />
erlebbar ist. Spezifische landesweite Erfordernisse der Raumordnung zur Entwicklung<br />
und zum Schutz der Kulturlandschaft sind insbesondere in den Plansätzen 4.1.1.11-13 des<br />
Entwurfs des LEP 2012 enthalten. Auch die gegenwärtig rechtskräftigen Regionalpläne der<br />
bisherigen Planungsregionen enthalten Ziele und Grundsätze zu Kulturlandschaften. Allerdings<br />
sind die Fachgrundlagen der Altregionen diesbezüglich sehr unterschiedlich.<br />
In Bezug auf das regionale Windenergiekonzept sind insbesondere die nachfolgend dargestellten<br />
Kulturlandschaften relevant, die durch die Errichtung von Windenergieanlagen in ihrem<br />
ästhetisch wertvollen Erscheinungsbild erheblich beeinträchtigt bzw. verunstaltet werden<br />
könnten.<br />
Als Rochlitzer Pflege wird der vergleichsweise schon früh besiedelte Raum beiderseits der<br />
Zwickauer Mulde, etwa zwischen Wechselburg und der nördlichen Regionsgrenze, verstanden.<br />
Dieses von fruchtbaren Lössböden und mildem Klima geprägte Altsiedelland hebt sich<br />
noch heute durch die hier vorherrschenden auffallend kleinen vor allem Platzdörfer, Rundund<br />
Bauernweiler altsorbischer Entstehung, die entsprechenden Flurformen, reiche Streuobstbestände<br />
an den Siedlungsrändern und im Freiraum sowie ein filigranes Wege- und<br />
Straßennetz vom umliegenden „Waldhufenland“ markant ab. Die Besonderheiten dieses<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Seite 43 (von 46)
<strong>Regionalplan</strong> Region Chemnitz; Regionales Windenergiekonzept - Fachkonzept<br />
Beteiligung an der Ausarbeitung des Planentwurfs gemäß § 9 ROG<br />
in Verbindung mit § 6 Abs. 1 SächsLPlG<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
kleingliedrigen Kulturlandschaftsraums erstrecken sich neben dem visuellen Aspekt und dem<br />
Erholungspotenzial auch auf Funktionen für den Arten- und Biotopschutz.<br />
Das Vogtländische Mühlenviertel-Burgsteingebiet bildet mit seinen Kleinkuppenlandschaften<br />
des mittelvogtländischen Diabasgebietes einen Kulturlandschaftsraum, der durch<br />
eine besondere Vielfalt und Vielzahl von Strukturelementen der bäuerlichen und gewerblichen<br />
Nutzung geprägt wird und in dem diese in ihrer spezifischen Eigenart und ihrem kleinteiligen<br />
Nebeneinander noch erkennbar und erlebbar sind. Vor allem auf Grund seines Wertes<br />
für landschaftsbezogene Erholung sollen diese Bereiche außerhalb der bereits städtisch<br />
geprägten Teilgebiete des Vogtlandes gegenüber landschaftsverändernden Maßnahmen geschützt<br />
und notwendige Vorhaben unter Berücksichtigung des spezifischen Landschaftscharakters<br />
vorgenommen werden.<br />
Die Planungsregion trägt für die sächsischen Hecken- und Steinrückengebiete eine herausgehobene<br />
Verantwortung. Ein erheblicher Teil dieses Landschaftstyps ist in der Region<br />
konzentriert. Die Hecken- und Steinrückengebiete gehören zu den beeindruckendsten Bereichen<br />
der erzgebirgischen Kulturlandschaft. Räume, in denen Hecken und Steinrücken nicht<br />
nur als isolierte Kulturlandschaftselemente, sondern „landschaftsbildend“ vorkommen, zeichnen<br />
sich stets durch eine besondere Bedeutung für die Tier- und Pflanzenwelt und durch einen<br />
besonderen Bildwert aus. Dieser ist im Gebirgsraum reliefbedingt in besonderem Maße<br />
erlebbar. Als wertvolle historische Kulturlandschaftsbereiche wurden auf der Grundlage der<br />
Ergebnisdaten des zweiten Durchganges der selektiven Biotopkartierung für den Freistaat<br />
Sachsen (LfULG 2001) Heckengebiete mit etwa 2 km Längserstreckung und überwiegend<br />
geschlossenen („flächenhaft“) und in überdurchschnittlich hoher Dichte verbreiteten Hecken<br />
bzw. Steinrücken ermittelt.<br />
Altbergbaulandschaft / Erz: Der über 800 jährige, insbesondere mittelalterliche Erzbergbau<br />
hat die Entwicklung und Bedeutung der Region, ihrer Landschaft und ihrer Menschen über<br />
Jahrhunderte geprägt und nachhaltig beeinflusst. Bei den historischen Altbergbaulandschaften<br />
handelt es sich um produktionsgeschichtlich bedeutsame und teilweise auch heute industriell<br />
geprägte Räume. Bis heute sind eine Vielzahl technischer Denkmale des Montanwesens<br />
oder mit ihm in Verbindung stehender Objekte weitgehend original erhalten und<br />
formten eine einzigartige Kulturlandschaft von internationaler Bedeutung. Diese waren 1998<br />
ausschlaggebend für die offizielle Aufnahme der „Montan- und Kulturlandschaft Erzgebirge“<br />
in die deutsche Welterbe-Tentativliste, auf dem Weg zur Aufnahme als UNESCO-<br />
Weltkulturerbe im Jahr 2014. Die bedeutsamen in der Landschaft sichtbaren Sachzeugen<br />
und technischen Denkmale des historischen Bergbaus, wie Halden, Bingen, Fördertürme,<br />
Raithalden, Stollenmundlöcher, Röschen, Kunstgräben und Kunstteiche, sollen im Kontext<br />
ihrer landschaftlichen Gesamtwirkung, d.h. möglichst im Rahmen zusammenhängender historischer<br />
Altbergbaulandschaften dauerhaft erhalten und erlebbar bleiben.<br />
Unter Verwendung regionaler Literaturquellen, topografischer Karten, aktueller Luftbilder sowie<br />
der Haldenerfassung des ehemaligen Sächsischen Bergamtes Chemnitz wurden besondere<br />
Konzentrationsgebiete landschaftlich wahrnehmbarer Sachzeugen des Altbergbaues<br />
abgegrenzt. Der Auswahl der Gebiete liegen strenge Maßstäbe zu Grunde. Einzelobjekte<br />
und kleinere Reviere blieben unberücksichtigt.<br />
Die Bergbaulandschaft der Steinkohle im Erzgebirgsbecken um Zwickau, Oelsnitz/Erzgebirge<br />
und Lugau ist auf Grund der noch sichtbaren Sachzeugen des Steinkohlenbergbaues<br />
ebenfalls von besonderer regionaler kulturlandschaftlichen Bedeutung. Zu den<br />
Besonderheiten zählen neben den verbliebenen Schachtgebäuden und Anlagen vor allem<br />
die Abraumhalden, die heute als prägende Erhebungen sichtbar sind und zugleich für Vorkommen<br />
bestimmter Tier- und Pflanzenarten sowie Lebensgemeinschaften Raum bieten.<br />
Als Streusiedlungen als kulturgeschichtliche Besonderheit, vor allem des Erzgebirges, wurden<br />
regellos angeordnete, sehr locker besiedelte Räume erfasst, die von Einzelhäusern und<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Seite 44 (von 46)
<strong>Regionalplan</strong> Region Chemnitz; Regionales Windenergiekonzept - Fachkonzept<br />
Beteiligung an der Ausarbeitung des Planentwurfs gemäß § 9 ROG<br />
in Verbindung mit § 6 Abs. 1 SächsLPlG<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
Häuslerzeilen geprägt sind, die überwiegend auf Hochflächen oder hochgelegenen Talbereichen<br />
angelegt wurden. In diesen Siedlungen beträgt der Anteil der bebauten Fläche einschließlich<br />
des funktional dazugehörigen Gartenlandes deutlich weniger als ein Prozent bei<br />
einem überdurchschnittlich hohen Anteil an Erschließungsstraßen bzw. -wegen.<br />
Die wertvollen historischen Kulturlandschaften der Rochlitzer Pflege, des vogtländischen<br />
Mühlenviertels- Burgsteingebietes sowie die Hecken- und Steinrückengebiete werden aufgrund<br />
ihrer besonderen Bedeutung pauschal, die Altbergbaulandschaft/Erz sowie die Bergbaulandschaft<br />
der Steinkohle und die Streusiedlungen im Einzelfall als weiches Kriterium<br />
angesehen.<br />
4.2.2.2.4 Regional bedeutsame Kulturdenkmale<br />
Das Erscheinungsbild und damit die Erlebbarkeit von Kulturdenkmalen im Sinne von § 2<br />
Abs. 5 Pkt. a bis e des Gesetzes zum Schutz und zur Pflege der Kulturdenkmale im Freistaat<br />
Sachsen (Sächsisches Denkmalschutzgesetz - SächsDSchG) wird von der Gestalt ihrer<br />
Umgebung mitbestimmt. Im Regionalen Windenergiekonzept sind deshalb solche Denkmale<br />
zu beachten, deren bildbedeutsames Umfeld über den engeren Rahmen einzelner Siedlungen<br />
hinausgreift. Regional freiraumrelevant sind Kulturdenkmale dann, wenn sie im Freiraum<br />
lokalisiert oder zumindest in erheblichem Maße vom Freiraum aus als Denkmal erlebbar<br />
oder visuell zu beeinflussen sind. Überwiegend handelt es sich dabei um überörtlich bedeutsame<br />
Denkmale der Architektur und des Städtebaues, aber auch um Denkmale der Gartenund<br />
Landschaftsgestaltung (Burgen, Schlösser, Kirchen, Ortsansichten, historische Parks u.<br />
a.). Solche Denkmale prägen als Teil der gewachsenen Kulturlandschaft in Verbindung mit<br />
der Oberflächengestalt und der Landnutzung maßgeblich das regionale Landschaftsbild, sind<br />
Bezugspunkte der regionalen Heimatverbundenheit und für den Tourismus relevant.<br />
Bildkonflikte mit Windenergieanlagen entstehen vor allem durch veränderte Dominanzverhältnisse<br />
zu Ungunsten der Denkmale, Harmonie störende Größendisproportionen, rotationsbedingte<br />
Ablenkung, störende Über- oder Hinterschneidungen sowie durch Eingriffe in<br />
Sichtachsen.<br />
Der Bestimmung der regional bedeutsamen Kulturdenkmale mit besonderer Freiraumrelevanz<br />
liegen sowohl die Denkmalliste des Landesamtes für Denkmalpflege als auch fachliche<br />
Vorschläge zur Festsetzung von Denkmalschutzgebieten sowie eigene Bewertungen des<br />
Plangebers und Hinweise von in früheren Aufstellungsverfahren von Regionalplänen insbesondere<br />
von den Denkmalbehörden vorgebrachten Hinweise zu Grunde.<br />
Maßgebliche Auswahlkriterien für die Bestimmung und Bewertung der regional bedeutsamen<br />
freiraumrelevanten Kulturdenkmale sind:<br />
• der denkmalrechtliche Schutzstatus,<br />
• die denkmalpflegerische Bedeutungsstufe (raumbezogen: mindestens regional bedeutsam),<br />
• die Sichtbarkeit/Erlebbarkeit vom siedlungsumgebenden Freiraum aus (Position im Relief,<br />
visuell abschirmendes Siedlungsvorland vorhanden / nicht vorhanden),<br />
• die Bildvorbelastung durch störende Bauwerke (Ansicht vom Freiraum aus) sowie der<br />
• der Denkmalcharakter (Windenergieanlagenspezifische Empfindlichkeit).<br />
Die ermittelten Kulturdenkmale wurden planungsbezogen bewertet und drei verschiedenen<br />
Bedeutungsstufen (sehr hoch, hoch, mittlere Bedeutung) zugeordnet. Die höchste Bewertungsstufe<br />
erhielten aufgrund ihrer besonderen Bedeutung dabei fünf ausgewählte Einzelfälle<br />
(Schneeberg, Annaberg-Buchholz, Augustusburg, Leisnig und Frauenstein; siehe Tabelle<br />
11 und Karte 13).<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Seite 45 (von 46)
<strong>Regionalplan</strong> Region Chemnitz; Regionales Windenergiekonzept - Fachkonzept<br />
Beteiligung an der Ausarbeitung des Planentwurfs gemäß § 9 ROG<br />
in Verbindung mit § 6 Abs. 1 SächsLPlG<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
Unter umfassender Berücksichtigung der maßgeblichen Auswahlkriterien und mit Blick auf<br />
die Vielzahl der Denkmale sowie in Abwägung zwischen dem Schutz des Denkmals und der<br />
Nutzung der Windenergie wird im Regionalen Windenergiekonzept über den unmittelbaren<br />
Standort hinaus grundsätzlich von Abstandszonen zwischen 2 und 5 km (gemessen zwischen<br />
dem Rand des Denkmals und dem Rand des Windenergienutzungsgebietes) ausgegangen.<br />
Als hartes Tabukriterium werden die fünf Einzelfälle der höchsten Bewertungsstufe einschließlich<br />
einer Abstandszone von 5 km beachtet. Alle übrigen regional bedeutsamen Kulturdenkmale<br />
sind pauschal als weiche Tabuzonen zu berücksichtigen. Einzelfallbezogen sind<br />
hier zudem entsprechende Abstandszonen von 2 bzw. 3 km für die Bedeutungsstufen mittel<br />
bzw. hoch zu berücksichtigen.<br />
Zusammenfassung (Karte 6 bzw. Karten 7.1 und 7.2)<br />
Die räumliche Ausprägung der durch die Überlagerung der im Kapitel 4.1 als harte Tabuzonen<br />
(hellgraue Farbe) sowie der im Kapitel 4.2 als weiche Tabuzonen (dunkelgraue Farbe)<br />
bestimmten Kriterien enthalten die synoptischen Karten 6 bzw. 7.1 und 7.2. in der Übersicht<br />
bzw. im Planungsmaßstab 1:100.000. Dabei ist die räumliche Ausprägung der weichen<br />
Tabuzonen ausschließlich nur dort als dunkelgraue Farbe in der Karte dargestellt, soweit<br />
diese über die räumliche Ausprägung der harten Tabuzonen hinausgeht. Die in den Karten<br />
noch enthaltenen rosa Flächen sind die Potenzialräume.<br />
Durch die Überlagerung von harten Tabuzonen wird in der Region insgesamt eine Fläche<br />
von 605.109 ha eingenommen. Dies entspricht einem Flächenanteil von 92,6 % an der Gesamtfläche<br />
der Region. Durch die Überlagerung von weichen Tabuzonen wird in der Region<br />
insgesamt eine Fläche von 528.196 ha eingenommen. Dies entspricht einem Flächenanteil<br />
von 80,9 % an der Gesamtfläche der Region. Im Ergebnis der Überlagerung aller harten und<br />
weichen Tabuzonen zum gegenwärtigen Stand der Erarbeitung des regionalen Windenergiekonzeptes<br />
sind 646.324 ha nicht für die Windenergienutzung geeignet. Dies entspricht 99<br />
% der Gesamtregionsfläche. Somit sind in der Region noch Flächen mit einer Größe von<br />
insgesamt 6.866 ha, mithin 1 % der Gesamtfläche der Region, als Potenzialraum für die<br />
Windenergienutzung vorhanden.<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Seite 46 (von 46)
Anlage 1 Überblick zu den landesplanerischen Abstandsempfehlungen für die <strong>Regionalplan</strong>ung zur Ausweisung von Windenergiegebieten<br />
(Bund-Länder Initiative Windenergie, Stand Juni 2012)<br />
Kriterienbereich<br />
(Abstände)<br />
Informationsgrundlage<br />
(HINWEIS: Einige Bundesländer schreiben aktuell ihre Empfehlungen fort,<br />
sodass die Angaben zu überprüfen sind.)<br />
Gebietskategorien zur Ausweisung von Windenergiegebieten<br />
Bundesländer Erlass / Empfehlung / Hinweispapier Vorrang Vorbehalt Eignung Anmerkungen<br />
Änderung des §11 Abs.7 LplG vom 25. Mai 2012 (GBl. S. 285):<br />
Baden-Württemberg "Windenergieerlass Baden-Württemberg" (Mai 2012) Ja Nein Nein Festlegung von Vorranggebieten ohne Ausschlusswirkung. Bestehende<br />
Regionalpläne werden zum 1.1.2013 aufgehoben<br />
Bayern<br />
Brandenburg / Berlin<br />
"Hinweise zur Planung und Genehmigung von Windkraftanlagen (WKA)"<br />
(Dezember 2011)<br />
Ja Ja Nein<br />
Instrument des Ausschlussgebiets vorhanden, jedoch kein<br />
grundlegender Ausschluss außerhalb von Eignungsgebieten<br />
(§ 11 Abs. 2 BayLplG).<br />
Abfrage im August 2011; "Hinweise an die Regionalen Planungsgemeinschaften<br />
Alle Regionalpläne befinden sich derzeit in der Überarbeitung bzw.<br />
Nein Nein Ja<br />
zur Festlegung von Eignungsgebieten 'Windenergie'" (Juni 2009) Neuaufstellung.<br />
Hamburg "Ausschlussgebiete für Windkraftanlagen in Hamburg" (August 2010) Nein Nein Ja Flächennutzungsplan ist im Moment in der Überarbeitung.<br />
Hessen<br />
"Handlungsempfehlungen zu Abständen von raumbedeutsamen<br />
Windenergieanlagen zu schutzwürdigen Räumen und Einrichtungen" (Mai 2010)<br />
Ja Nein Ja Alle drei Regionalpläne sollen in 2012 geändert werden<br />
Mecklenburg-<br />
Vorpommern<br />
Niedersachsen<br />
Nordrhein Westfalen<br />
Abfrage im August 2011; "Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung<br />
oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-<br />
Vorpommern (RL - RREP)" (Juli 2006)<br />
Abfrage im August 2011; "Empfehlungen zur Festlegung von Vorrang- oder<br />
Eignungsgebieten für die Windenergienutzung" (Juli 2004)<br />
Ja Nein Ja<br />
Abfrage im August 2011; "Erlass für die Planung und Genehmigung von<br />
Windenergieanlagen und Hinweise für die Zielsetzung und Anwendung<br />
(Windenergie-Erlass)" (Juli 2011)<br />
Nein Nein Ja<br />
Alle vier Regionalpläne befinden sich gegenwärtig in der<br />
Neuaufstellung.<br />
Nein<br />
(mögl., bisher aber<br />
nicht realisiert)<br />
Nein<br />
Ja<br />
(<strong>Regionalplan</strong><br />
Münsterland)<br />
Unterschiedliche Steuerungsansätze:17 RROP= Vorranggebiete mit<br />
Ausschlusswirkung, 7 RROP Vorranggebiete ohne Ausschlusswirkung,<br />
5 RROP ohne Vorrangausweisung.<br />
Abstandsempfehlungen gelten vor allem für Kommunale Ausweisung<br />
von „Konzentrationszonen“ in Flächennutzungsplänen (da nur ein<br />
<strong>Regionalplan</strong> vorhanden).<br />
Abfrage im August 2011; Hinweise zur Beurteilung der Zulässigkeit von<br />
Instrument des Ausschlussgebiets nach §6 Abs.2 LPlG (RLP)<br />
Rheinland-Pfalz Ja Ja Ja<br />
Windenergieanlagen (Juni 2006) vorhanden.<br />
Saarland<br />
Abfrage im August 2011; "Pufferabstände um Ausschlussflächen der<br />
Mit der 1. Änderung des LEP Umwelt wurde die Ausschlusswirkung<br />
Ja Nein Nein<br />
Windpotenzialstudie" (o. J.) aufgehoben, die Vorranggebiete bleiben jedoch bestehen.<br />
Sachsen<br />
Sachsen-Anhalt<br />
Abfrage im August 2011; durch die Regionalen Planungsgemeinschaften<br />
unterschiedlich geregelt. Bewusst keine konkreten Abstandsempfehlungen des<br />
Landes.<br />
Abfrage im August 2011; durch die Regionalen Planungsgemeinschaften<br />
unterschiedlich geregelt. Bewusst keine konkreten Abstandsempfehlungen des<br />
Landes.<br />
Ja Nein Ja<br />
Ausweisung von Vorranggebieten zwingend (laut §2 Abs.2 Satz 2<br />
SächsLPlG).<br />
Ja Nein Ja Vorranggebiete haben zugleich die Wirkung von Eignungsgebieten.<br />
Schleswig-Holstein<br />
Abfrage im August 2011; "Grundsätze zur Planung von Windkraftanlagen" (März<br />
Das Instrument der Zielabweichung (§ 6 Abs. 2 ROG) wurde in<br />
Nein Nein Ja<br />
2011) besonderen Einzelfällen genutzt.<br />
Thüringen<br />
Bandbreite inkl.<br />
Einzelfall<br />
Abfrage im August 2011; "Handlungsempfehlung für die Fortschreibung der<br />
Regionalpläne zur Ausweisung von Vorranggebieten „Windenergie", die zugleich<br />
die Wirkung von Eignungsgebieten haben" (2005)<br />
Ja Ja Ja<br />
RROP wurden fortgeschrieben. Zukünftig nur noch Vorranggebiete, die<br />
zugleich die Wirkung von Eignungsgebieten besitzen.<br />
HINWEIS: In den Regionalplänen und vergleichbaren Planwerken können abweichende Abstände zugrunde gelegt werden. Bremen bleibt ohne Abstandsempfehlungen.
Anlage 1 Überblick zu den landesplanerischen Abstandsempfehlungen für die <strong>Regionalplan</strong>ung zur Ausweisung von Windenergiegebieten<br />
(Bund-Länder Initiative Windenergie, Stand Juni 2012)<br />
Kriterienbereich<br />
(Abstände)<br />
Allgemeine und<br />
reine Wohngebiete<br />
Einzelwohngebäude<br />
und<br />
Splittersiedlungen<br />
Kur und Klinikgebiete<br />
Campingplätze<br />
Gewerbe und<br />
Industriegebiete<br />
Einrichtungen für<br />
Sport, Freizeit<br />
/Erholung<br />
Kultur,<br />
Naturdenkmale und<br />
geschützte<br />
Ensembles<br />
Freiraum mit<br />
bes.Schutzanspruch/<br />
Freiraumverbund/<br />
Vorrang Natur und<br />
Landschaft<br />
SPA-Gebiete<br />
(Richtlinie 79/409<br />
EWG)<br />
Bundesländer Siedlung (Abstände) Natur- und Landschaftsschutz (Abstände)<br />
FFH-Gebiete<br />
(Richtlinie<br />
92/43EWG)<br />
Baden-Württemberg<br />
700 m,<br />
Einzelfall<br />
700 m,<br />
Einzelfall<br />
- - - - - - 700 m -<br />
Bayern 800 m 500 m - - 300 m -<br />
Einzelfall,<br />
max. 1000 m<br />
Einzelfall,<br />
max. 1000 m<br />
- -<br />
Brandenburg / Berlin 1000 m - - - - - - Einzelfall Einzelfall Einzelfall<br />
Hamburg 500 m 300 m - - - - - - 300 m 200 m<br />
Hessen<br />
1000 m,<br />
Einzelfall<br />
1000 m, im Einzelfall<br />
weniger<br />
1000 m, im Einzelfall<br />
mehr<br />
-<br />
1000 m, im Einzelfall<br />
weniger<br />
-<br />
Grundfläche, im<br />
Umfeld Einzelfall<br />
Einzelfall Einzelfall Einzelfall<br />
Mecklenburg-<br />
Vorpommern<br />
1000 m 800 m - 1000 m - - Einzelfall Einzelfall bis 1000 m bis 500 m<br />
Niedersachsen 1000 m - - - - - - - - -<br />
Nordrhein Westfalen<br />
Einzelfall,<br />
Berechnung nach<br />
TA Lärm<br />
Einzelfall - - - - Einzelfall Einzelfall<br />
Einzelfall,<br />
i.d.R. 300 m<br />
Einzelfall,<br />
i.d.R. 300 m<br />
Rheinland-Pfalz 1000 m 400 m - - - - Einzelfall - Einzelfall 200 m<br />
Saarland<br />
Einzelfall,<br />
je nach Anlagentyp<br />
Einzelfall - - 20 m - - 200 m Einzelfall 200 m<br />
Sachsen<br />
Sachsen-Anhalt<br />
750-1000 m,<br />
WKA > 100 m:<br />
10 x Nabenhöhe<br />
1000 m,<br />
WKA > 100 m: 10 x<br />
Gesamthöhe<br />
300 - 500 m 1200 m -<br />
250 - 500 m,<br />
Einzelfall<br />
- 2000 - 5000 m Einzelfall Einzelfall Einzelfall<br />
1000 m 1200 - 5000 m<br />
mind. 1000 m,<br />
10 x Gesamthöhe<br />
500 m -<br />
1000 m,<br />
Einzelfall<br />
Einzelfall<br />
1000 m,<br />
Einzelfall<br />
Schleswig-Holstein 800 m 400 m 800 m 800 m 500 m 800 m Einzelfall<br />
Einzelfall,<br />
charakteristische<br />
Landschaftsräume<br />
1000 m,<br />
Einzelfall<br />
300 m 300 m<br />
Thüringen<br />
750 tlw. bis<br />
1000 m<br />
- mind. 750 m<br />
300 m,<br />
Einzelfall<br />
300 m<br />
300 m,<br />
Einzelfall<br />
Einzelfall Einzelfall Einzelfall Einzelfall<br />
Bandbreite inkl.<br />
Einzelfall<br />
500 - 1000 m,<br />
Einzelfall<br />
300 - 1000 m,<br />
Einzelfall<br />
700 - 5000 m<br />
300 - 1000 m,<br />
Einzelfall<br />
20 - 500 m,<br />
Einzelfall<br />
300 - 800 m,<br />
Einzelfall<br />
300 - 5000 m,<br />
Einzelfall<br />
200 m,<br />
Einzelfall<br />
200 - 1000 m,<br />
Einzelfall<br />
200 - 1000 m,<br />
Einzelfall<br />
HINWEIS: In den Regionalplänen und vergleichbaren Planwerken können abweichende Abstände zugrunde gelegt werden. Bremen bleibt ohne Abstandsempfehlungen.
Anlage 1 Überblick zu den landesplanerischen Abstandsempfehlungen für die <strong>Regionalplan</strong>ung zur Ausweisung von Windenergiegebieten<br />
(Bund-Länder Initiative Windenergie, Stand Juni 2012)<br />
Kriterienbereich<br />
(Abstände)<br />
Bundesländer<br />
Naturschutz-gebiete<br />
(§ 23 BNatSchG)<br />
Nationalparke (§ 24<br />
BNatSchG)<br />
Landschaftsschutzgebiete<br />
(§ 26<br />
BNatSchG)<br />
Biosphärenreservate<br />
(§ 25<br />
BNatSchG)<br />
gesetzlich<br />
geschützte Biotope<br />
geschützter Wald<br />
(Schutzwald,<br />
Erholungswald)<br />
Natur- und Landschaftsschutz (Abstände)<br />
Rast und<br />
Überwinterungsgebiete<br />
störungssensibler<br />
Zugvögel,<br />
Vogelzugkorridore<br />
Brutgebiete<br />
störungssensibler<br />
Großvogelarten,<br />
Vogelzugkorridore<br />
Brutgebiete<br />
gefährdeter und<br />
störungssensibler<br />
Vogelarten<br />
Lebensraum von<br />
Fledermäusen<br />
Baden-Württemberg 200 m 200 m - 200 m um Kernzone - - 700 m<br />
artabhängig,<br />
nach LAG VSW<br />
artabhängig,<br />
nach LAG VSW<br />
-<br />
Bayern<br />
Einzelfall,<br />
max. 1000 m<br />
Einzelfall,<br />
max. 1000 m<br />
-<br />
Um Kernzonen im<br />
Einzelfall,<br />
max. 1000 m<br />
Einzelfall,<br />
max. 1000 m<br />
- - - - -<br />
Brandenburg / Berlin Einzellfall - Einzelfall Einzelfall - -<br />
artabhängig,<br />
1000 - 5000 m<br />
artabhängig,<br />
500 m - 6000 m<br />
artabhängig,<br />
1000 bis 3000 m<br />
1000 m<br />
Hamburg 300 m - - - - 200 m 500 m 500 m 500 m -<br />
Hessen Grundfläche Grundfläche -<br />
Grundfläche der<br />
Kernzone<br />
- Grundfläche Einzelfall Einzelfall Einzelfall Einzelfall<br />
Mecklenburg-<br />
Vorpommern<br />
500 - 1000 m Einzelfall bis 1000 m bis 1000 m - 200 - 500 m 1000 m 1000 - 3000 m 1000 - 3000 m -<br />
Niedersachsen - - - - - - - - - -<br />
Nordrhein Westfalen<br />
Einzelfall,<br />
bei europ. Arten<br />
i.d.R. 300 m<br />
Einzelfall,<br />
bei europ. Arten<br />
i.d.R. 300 m<br />
Einzelfall<br />
Einzelfall<br />
Einzelfall,<br />
bei europ. Arten<br />
i.d.R. 300 m<br />
- Einzelfall - - -<br />
Rheinland-Pfalz 200 m - - - 200 m 200 m 200-500 m 200-500 m 200 – 500 m -<br />
Saarland 200 m Einzelfall - - - Einzelfall Einzelfall Einzelfall Einzelfall -<br />
Sachsen Einzelfall Einzelfall Einzelfall Einzelfall Einzelfall 200-400 m<br />
200-500 m,<br />
max. 10 x<br />
Anlagenhöhe<br />
- 100 - 12000 m Einzelfall<br />
Sachsen-Anhalt<br />
200 - 1000 m,<br />
Einzelfall<br />
1000 m,<br />
200 - 500 m,<br />
500 - 1000 m 1000 m 200 m - 1000 m - -<br />
Einzelfall Einzelfall<br />
Schleswig-Holstein 300 m 300 m Einzelfall - Einzelfall 100 m (ab 0,2 ha) Einzelfall Einzelfall Einzelfall Einzelfall<br />
Thüringen Einzelfall Einzelfall Einzelfall Einzelfall 200 m, Einzelfall 200 m Einzelfall Einzelfall Einzelfall Einzelfall<br />
Bandbreite inkl.<br />
Einzelfall<br />
200 - 1000 m,<br />
Einzelfall<br />
300 - 1000 m,<br />
Einzelfall<br />
200 - 1000 m,<br />
Einzelfall<br />
1000 m,<br />
Einzelfall<br />
200 - 500 m,<br />
Einzelfall<br />
100 - 400 m<br />
200 - 5000 m,<br />
Einzelfall<br />
200 - 6000 m,<br />
Einzelfall<br />
100 - 12000 m,<br />
Einzelfall<br />
1000 m,<br />
Einzelfall<br />
HINWEIS: In den Regionalplänen und vergleichbaren Planwerken können abweichende Abstände zugrunde gelegt werden. Bremen bleibt ohne Abstandsempfehlungen.
Anlage 1 Überblick zu den landesplanerischen Abstandsempfehlungen für die <strong>Regionalplan</strong>ung zur Ausweisung von Windenergiegebieten<br />
(Bund-Länder Initiative Windenergie, Stand Juni 2012)<br />
Kriterienbereich<br />
(Abstände)<br />
Landschaftsprägende<br />
Kuppen<br />
und Hangkanten,<br />
markante<br />
Sichtachsen und<br />
Sichtbeziehungen<br />
Ufer und Deiche an<br />
Gewässern und<br />
Meeresküste<br />
stehende Gewässer<br />
> 1 ha<br />
Gewässer 1.<br />
Ordnung<br />
(Wasserschutz<br />
- gebiete)<br />
Gewässer 2.<br />
Ordnung<br />
(Wasserschutz<br />
- gebiete)<br />
Heilquellenschutzge<br />
biet,<br />
Trinkwasserschutzgebiet<br />
Bundesländer Natur- und Landschaftsschutz (Abstände)<br />
Überschwemmungsgebiete<br />
und<br />
Hochwasserschutzdeiche<br />
(§ 100<br />
BbgWG)<br />
Feuchtgebiete<br />
internationaler<br />
Bedeutung<br />
(RAMSAR)<br />
Schwerpunkt-räume<br />
für Tourismus und<br />
Erholung<br />
(Fremdenverkehr)<br />
Militärische Anlagen<br />
sowie angeordnete<br />
Schutzbereich,<br />
Sonderflächen Bund<br />
Baden-Württemberg - - - - - - - - - -<br />
Bayern - - - - - - - - - -<br />
Brandenburg / Berlin - - -<br />
Einzelfall<br />
(mit Funktion für<br />
Vogelzug: 1000 m)<br />
- -<br />
Bestandteil des<br />
Freiraum-verbundes<br />
- - -<br />
Hamburg - - 50 m Einzelfall - - - 500 m - -<br />
Hessen - - - - - - - - - -<br />
Mecklenburg-<br />
Vorpommern<br />
500 m 1000 - 3000 m 200 m und 1000 m 400 m - Einzelfall Einzelfall - 200 - 1000 m<br />
äußere Schutzbereichszone<br />
Niedersachsen - - - - - - - - - -<br />
Nordrhein Westfalen Einzelfall - > 5 ha: 50 m - - Einzelfall<br />
Im Einzelfall als<br />
Ausnahme<br />
- -<br />
Nach Schutzbereichsgesetz<br />
Rheinland-Pfalz - - - - - - - - -<br />
äußere Schutzbereichszone<br />
Saarland<br />
> 30° Neigung,<br />
flächenhaft<br />
- - - - - - - - -<br />
50 m,<br />
äußere Schutz-<br />
Sachsen Hangfuß, Einzelfall - Einzelfall Einzelfall Einzelfall Einzelfall - 500 m<br />
Einzelfall bereichszone<br />
Sachsen-Anhalt - -<br />
500 m,<br />
Einzelfall<br />
500 m,<br />
Einzelfall<br />
- Einzelfall 50 - 300 m - 1000 m, Einzelfall<br />
äußere Schutzbereichszone<br />
Schleswig-Holstein<br />
Einzelfall,<br />
charakteristische<br />
Landschaftsräume<br />
300 – 500 m Einzelfall 50 m - - Einzelfall 300 m - Einzelfall<br />
Thüringen Einzelfall -<br />
>10 ha bis 10 x<br />
Anlagenhöhe<br />
bis 10 x<br />
äußere Schutz-<br />
- - - Einzelfall -<br />
Anlagenhöhe bereichszone<br />
Bandbreite inkl.<br />
Einzelfall<br />
500 - 1000 m,<br />
Einzelfall<br />
300 - 3000 m<br />
50 - 1000 m,<br />
Einzelfall<br />
50 - 1000 m,<br />
Einzelfall<br />
50 m, Einzelfall Einzelfall<br />
50 - 300 m,<br />
Einzelfall<br />
300 - 500 m,<br />
Einzelfall<br />
200 - 1000 m,<br />
Einzelfall<br />
äußere Schutzbereichszone<br />
HINWEIS: In den Regionalplänen und vergleichbaren Planwerken können abweichende Abstände zugrunde gelegt werden. Bremen bleibt ohne Abstandsempfehlungen.
Anlage 1 Überblick zu den landesplanerischen Abstandsempfehlungen für die <strong>Regionalplan</strong>ung zur Ausweisung von Windenergiegebieten<br />
(Bund-Länder Initiative Windenergie, Stand Juni 2012)<br />
Kriterienbereich<br />
(Abstände)<br />
Flugplätze,<br />
Landeplätze,<br />
Segelfluggelände,<br />
Tieffluggebiete<br />
(Bauschutzbereiche)<br />
Rohstoffsicherung<br />
Bundesautobahnen,<br />
Bundes-,<br />
Landes- und<br />
Kreisstraßen<br />
Bahnlinien<br />
Freileitungen<br />
Alter Bergbau,<br />
Erdfall und<br />
Senkungsgebiete<br />
Abstände zwischen<br />
Eignungsgebieten<br />
Windnutzung<br />
Mindestflächengröße<br />
Höhenbeschränkung<br />
Windhöfigkeit<br />
Bundesländer Sonstige Abstände aus Fachplanungen (Abstände) Weitere Anforderungen<br />
Baden-Württemberg - -<br />
100 m, 40 m,<br />
40 m , 30 m<br />
50-500 m - - - - - -<br />
Bayern<br />
Brandenburg / Berlin<br />
Einzelfall in<br />
Abstimmung mit<br />
Luftfahrtbehörde<br />
Einzelfall<br />
(gilt nur für Großflughafen<br />
BER)<br />
-<br />
100 m, 50 m,<br />
50 m, 30 m<br />
- - - - - - -<br />
- - - - - - - - -<br />
Hamburg - - 100 m + Einzelfall 50 m + Einzelfall 100 m + Einzelfall - - - - -<br />
Hessen - -<br />
150 m, 100 m<br />
100 m, 100 m<br />
100 m - - - - - -<br />
Mecklenburg-<br />
Vorpommern<br />
Einzelfall Einzelfall 100 m 100 m 100 m - 5000 m 75 ha - -<br />
Niedersachsen - - - - - - 5000 m - - -<br />
Nordrhein Westfalen<br />
Nach LUftVG bzw.<br />
Bauschutzbereich<br />
Einzelfall<br />
Nach FstrG,<br />
StrWG NRW,<br />
ab Rotorradius<br />
-<br />
1 x Rotordurchmesser,<br />
Einzelfall<br />
- - - Einzelfall -<br />
Rheinland-Pfalz - - - -<br />
3 x Roterdurchmesser<br />
- - - - -<br />
Saarland<br />
500 m (im Bereich<br />
von Einflugschneisen<br />
größer)<br />
-<br />
100 m, 100m,<br />
100 m, 50 m<br />
100 m 100 m - - - - -<br />
Sachsen<br />
2100 m<br />
Einzelfall,<br />
50-300 m, Einzelfall 40 - 250 m 150 m 100-200 m - 5000 m 10 ha -<br />
(max. h = 100 m) bis 200 m<br />
Sachsen-Anhalt Bauschutzbereich 300 m 200 - 300 m 200 m 200-400 m - 5000 m - - Einzelfall<br />
Schleswig-Holstein Einzelfall - 130 m 130 m - - - 20 ha Einzelfall -<br />
Thüringen Bauschutzbereich -<br />
100 m, 100m,<br />
40 m, 40 m<br />
50 m Einzelfall Einzelfall 5000 m 10 ha Einzelfall Einzelfall<br />
Bandbreite inkl.<br />
Einzelfall<br />
500 - 1000 m,<br />
gesetzlicher<br />
Abstand, Einzelfall<br />
50 - 300 m,<br />
Einzelfall<br />
15 - 300 m 50 - 200 m 100 - 400 m Einzelfall keine 10 - 75 ha<br />
HINWEIS: In den Regionalplänen und vergleichbaren Planwerken können abweichende Abstände zugrunde gelegt werden. Bremen bleibt ohne Abstandsempfehlungen.
<strong>Regionalplan</strong> Region Chemnitz; Regionales Windenergiekonzept - Fachkonzept<br />
Beteiligung an der Ausarbeitung des Planentwurfs gemäß § 9 ROG<br />
in Verbindung mit § 6 Abs. 1 SächsLPlG<br />
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Anlage 2 Überblick von „harten“ und „weichen“ Tabuzonen für die Windenergienutzung (vereinfacht, nicht abschließend)<br />
Nr RPV Oberes Elbtal/Osterzgebirge<br />
(in ∑ 15 Kriterien)<br />
1 Siedlungs- mit Abstandsflächen<br />
1200 m zu Kur- und<br />
Klinikbereichen, Pflegeanstalten<br />
und reinen<br />
Wohngebieten (A 10 a)<br />
750 m zu zusammenhängender<br />
Wohnbebauung<br />
(A 10 b)<br />
300 m zu Einzelwohnbebauung<br />
(A 10 c)<br />
2 Waldbestand (ab 5 ha)<br />
+ i.d.R. 200 m Pufferzone<br />
(A 9)<br />
3 Abstandswerte zu Einrichtungen<br />
der technischen<br />
Infrastruktur<br />
(A 14)<br />
RPV Westsachsen<br />
(in ∑ 20 Kriterien)<br />
Siedlungs- mit Abstandsflächen<br />
1200 m zu Kur- und<br />
Klinikbereichen, Pflegeanstalten<br />
(A 11 a)<br />
1000 m zu zusammenhängender<br />
Wohnbebauung<br />
(A 11b)<br />
500 m zu Gewerbegebieten<br />
(A 11 c)<br />
Waldbestand + i.d.R.<br />
200 m Pufferzone<br />
(A 10 a)<br />
VRG Waldmehrung<br />
(A 10 b)<br />
Abstandswerte zu Einrichtungen<br />
der technischen<br />
Infrastruktur<br />
(A 16)<br />
RPV Südwestsachsen<br />
(Auswahl von in ∑ 26)<br />
Siedlungs- mit Abstandsflächen<br />
EF zu Kur- und Klinikbereichen,<br />
Pflegeanstalten,<br />
850 m zu zusammenhängender<br />
Wohnbebauung<br />
EF zu Einzelwohnbebauung<br />
250 m zu Gewerbegebieten<br />
und Regionalen<br />
Vorsorgestandorten<br />
Wälder (ab 1 ha) mit<br />
Abstand von 200m<br />
Abstandswerte zu Einrichtungen<br />
der technischen<br />
Infrastruktur<br />
RPV Chemnitz-<br />
Erzgebirge<br />
(Auswahl von in ∑ 23)<br />
Siedlungs- mit Abstandsflächen<br />
1200 m zu Kur- und<br />
Klinikbereichen, Pflegeanstalten<br />
750 m zu zusammenhängender<br />
Wohnbebauung<br />
500 m zu Gruppen- und<br />
300 m zu Einzelwohnbebauung<br />
250 m zu Gewerbegebieten<br />
und Regionalen<br />
Vorsorgestandorten<br />
Waldflächen (ab 1 ha)<br />
mit 200 m Abstand (EF<br />
bis 400 m)<br />
200 m zu Autobahnen,<br />
100 m zu Bundes-,<br />
Staats- u. Kreisstraßen,<br />
150 m zu Bahnstrecken<br />
200 m zu Hochspannungsfreileitungen;<br />
60 m zu Produktenund<br />
Ferngasleitungen<br />
GATZ (2009)<br />
S. 285 / 286<br />
Siedlungsflächen + berücksichtigter<br />
Abstand<br />
700 m zu Wohnbauflächen<br />
450 m zu gemischten Bauflächen<br />
450 m zu Siedlungssplitter<br />
und Einzelgehöfte<br />
250 m zu Gewerbe- und Industrieflächen<br />
700 m zu Freizeit- und Erholungseinrichtungen<br />
450 m zu Grünanlagen und<br />
Friedhöfe<br />
200 m zu Bannwälder<br />
200 m zu Schonwald<br />
200 m zu besonders geschützten<br />
Biotopen nach<br />
Landes WaldG<br />
150 m zu Autobahnen<br />
150 m zu Bundes-, Landesund<br />
Kreisstraßen<br />
150 m zu Bahnlinien<br />
100 m zu Kabelfreileitungen<br />
50 m zu Richtfunkstrecken,<br />
Fernmelde- und Radaranlagen<br />
PV Region Chemnitz<br />
- Kriterien Entwurf Regionales<br />
Windenergiekonzept<br />
Siedlungsbestand mit<br />
Abstandszonen<br />
1200 m zu Kur- und Klinikbereichen,<br />
Pflegeanstalten<br />
750 m zu Flächensiedlung<br />
500 m zu isolierten<br />
Gruppenanwesen<br />
250 m zu isolierten<br />
Einzelanwesen<br />
250 m zu Gewerbe- und Industriegebieten<br />
Wald mit speziellem Schutzstatus<br />
aufgrund des<br />
SächsWaldG sowie Wald<br />
mit besonderen Schutzfunktionen<br />
nach Waldfunktionenkartierung<br />
Linien- und Punkthafte Darstellungen<br />
Einzelfallprüfung<br />
40 m zu Autobahnen<br />
20 m zu Bundes-, Staatsund<br />
Kreisstraßen,<br />
100 m zu Bahnstrecken;<br />
100 m zu Hochspannungsfreileitungen<br />
ab 110 kV;<br />
50 m zu Produkten- und<br />
Ferngasleitungen
<strong>Regionalplan</strong> Region Chemnitz; Regionales Windenergiekonzept - Fachkonzept<br />
Beteiligung an der Ausarbeitung des Planentwurfs gemäß § 9 ROG<br />
in Verbindung mit § 6 Abs. 1 SächsLPlG<br />
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Nr RPV Oberes Elbtal/Osterzgebirge<br />
(in ∑ 15 Kriterien)<br />
4 Gewässer und ihre natürliche<br />
Auen- und<br />
Uferbereiche und<br />
Rechtskräftige Überschwemmungsgebiete<br />
(A 4)<br />
5 Trinkwasser- und Heilwasserschutzgebiete<br />
(Zonen 1 und 2)<br />
(A 11)<br />
6 Rohstoffabbauflächen<br />
+ i.d.R. 300 m Pufferzone<br />
(A 12)<br />
7 VRG Natur- und Landschaft<br />
(A 1); Nationalpark<br />
Sächsische<br />
Schweiz und LSG (A 2)<br />
8 FFH- und SPA-Gebiete<br />
Regional bedeutsame<br />
avifaunistische Berei-<br />
RPV Westsachsen<br />
(in ∑ 20 Kriterien)<br />
Offene Wasserflächen<br />
(A 5)<br />
Auenbereiche und<br />
Überschwemmungsgebiete<br />
(A 20)<br />
Wasserschutzgebiete –<br />
Trinkwasserschutzzonen<br />
I und II<br />
(A 14)<br />
Rohstoffabbauflächen<br />
+ i.d.R. 300 m Pufferzone<br />
(A 9)<br />
VRG Natur und Landschaft<br />
(A 1)<br />
NSG (A 2)<br />
LSG (A 18)<br />
FFH- und SPA-Gebiete<br />
(A 3)<br />
che (A 3)<br />
9 Pufferzonen zu VRG<br />
NuL; NSG; FFH; SPA;<br />
Offene Wasserflächen<br />
(A 19)<br />
10 Rastgebiete, Zugbahnen<br />
usw. geschützter<br />
Vogelarten und Quartiere,<br />
Nahrungsgebiete<br />
usw. geschützter Fledermausarten<br />
(A 4)<br />
RPV Südwestsachsen<br />
(Auswahl von in ∑ 26)<br />
Still- und Fließgewässer<br />
Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiete<br />
Zonen 1 und 2<br />
VRG oberflächennahe<br />
Rohstoffe<br />
VRG Natur und Landschaft,<br />
NSG, LSG, Naturpark<br />
„Erzgebirge/Vogtland“<br />
FFH- undSPA-Gebiete<br />
RPV Chemnitz-<br />
Erzgebirge<br />
(Auswahl von in ∑ 23)<br />
Trinkwasser- und Heilwasserschutzgebiete<br />
(Zonen 1 und 2)<br />
Rohstoffabbauflächen<br />
+ i.d.R. 300 m Pufferzone<br />
VRG und VBG Natur<br />
und Landschaft, FND,<br />
NSG mit 300 m Puffer<br />
FFH – und SPA-<br />
Gebiete<br />
VBG für das Landschaftsbild/<br />
Landschaftserleben<br />
und<br />
LSG<br />
Gebiete mit besonderer<br />
avifaunistischer Bedeutung<br />
Gebiete mit besonderer<br />
Bedeutung für Fledermäuse<br />
GATZ (2009)<br />
S. 285 / 286<br />
10 m zu Fließgewässer<br />
150 m zu Binnengewässer<br />
>0,5 ha<br />
50 m zu Wasserschutzzone<br />
I<br />
150 m zu Gewässer 1. Ordnung<br />
Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiete<br />
(Zonen 1<br />
und 2)<br />
Rohstoffabbauflächen + 30<br />
m Pufferzone<br />
200 m zu bestehenden und<br />
geplanten Naturschutzgebieten<br />
PV Region Chemnitz<br />
- Kriterien Entwurf Regionales<br />
Windenergiekonzept<br />
Still- und Fließgewässer<br />
Auenbereiche<br />
Überschwemmungsgebiete<br />
Trink- und Heilwasserschutzgebiete<br />
(Zonen 1 und<br />
2)<br />
zugelassene Betriebspläne<br />
sowie Baubeschränkungsgebiete<br />
nach BBergG<br />
NSG<br />
Einzelfallprüfung<br />
Gebiete mit besonderer<br />
Avifaunistischer Bedeutung,<br />
Gebiete mit besonderer Bedeutung<br />
für Fledermäuse
<strong>Regionalplan</strong> Region Chemnitz; Regionales Windenergiekonzept - Fachkonzept<br />
Beteiligung an der Ausarbeitung des Planentwurfs gemäß § 9 ROG<br />
in Verbindung mit § 6 Abs. 1 SächsLPlG<br />
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Nr<br />
RPV Oberes Elbtal/Osterzgebirge<br />
(in ∑ 15 Kriterien)<br />
11 Naturdenkmale und besonders<br />
geschützte Biotope<br />
(A 5)<br />
12 Landschaftsprägende Höhenrücken,<br />
Kuppen und<br />
Hanglagen …<br />
(A 6)<br />
13 Gebiete mit herausragender<br />
Sichtbeziehung von<br />
und zu sichtexponierten<br />
historischen Kulturdenkmalbereichen<br />
(A 7)<br />
14 Siedlungstypische historische<br />
Ortsrandlagen<br />
(A 8)<br />
15 Hindernisbegrenzungsbereiche<br />
für Flugplätze<br />
(A 13)<br />
RPV Westsachsen<br />
(in ∑ 20 Kriterien)<br />
Heidelandschaften<br />
(A 6)<br />
Landschaftsprägende Höhenrücken,<br />
Kuppen und<br />
Hanglagen<br />
(A 7)<br />
Regional bedeutsame Bereiche<br />
des baulichen(A 8<br />
a) und archäologische<br />
Denkmalschutzes<br />
(A 8 b)<br />
Gebiete in denen WEA<br />
gravierende und unausgleichbare<br />
Beeinträchtigungen<br />
des Landschaftsbildes<br />
hervorrufen (A 17)<br />
Bauschutzbereiche von<br />
Flugplätzen und zivilen<br />
Flugsicherungsanlagen (A<br />
12)<br />
16 Schutzbereiche von Militärischen<br />
Flugsicherungsanlagen<br />
(A 13)<br />
17 Abstand zwischen VREG<br />
und VREG i.d.R.5 km (A<br />
15)<br />
Abstand zwischen VREG<br />
und VREG i.d.R.5 km (A<br />
15)<br />
RPV Südwestsachsen<br />
(Auswahl von in ∑ 26)<br />
FND, GLB, § 26-Biotope<br />
Landschaftsprägende Höhenrücken,<br />
Kuppen und<br />
Hanglagen;<br />
Nah- und Dominanzbereich<br />
regional bedeutsamer<br />
Aussichtspunkte<br />
Kulturdenkmale und<br />
Ortsensembles mit herausragender<br />
Landschaftsbildbedeutung<br />
einschließlich<br />
ihres bild- bedeutsamen<br />
Umfeldes<br />
Militärische Interessenbereiche<br />
Abstand zwischen VREG<br />
und VREG i.d.R.5 km<br />
RPV Chemnitz-<br />
Erzgebirge<br />
(Auswahl von in ∑ 23)<br />
Kleinräumige Bereiche mit<br />
besonderer Bedeutung für<br />
Naturschutz und Landschaftspflege<br />
Regional bedeutsame<br />
landschaftsprägende Erhebungen<br />
mit 2 bis 6 km<br />
Puffer<br />
Regional bedeutsame<br />
Aussichtspunkte mit bis<br />
zu 5 km Pufferzone<br />
Archäologische Denkmäler<br />
und Fundstellen<br />
Wertvolle historische Kulturlandschaften<br />
Schutzbedürftige Umgebung<br />
freiraumrelevanter<br />
Kulturdenkmale mit 2 bis<br />
5 km Puffer<br />
Gebiete mit besonderer<br />
Bedeutung für den zivilen<br />
Luftverkehr<br />
Gebiete mit besonderer<br />
Bedeutung für die Landesverteidigung<br />
Abstand zwischen VREG<br />
und VREG i.d.R.5 km<br />
GATZ (2009)<br />
S. 285 / 286<br />
1000 m zu Verkehrsflughäfen<br />
und Verkehrslandeplätze<br />
PV Region Chemnitz<br />
- Kriterien Entwurf Regionales<br />
Windenergiekonzept<br />
Einzelfallprüfung<br />
Anmerkungen:<br />
1.) Die Nummerierung in Spalte 1 stellt keine Rang- und Reihenfolge dar, aus der sich Prioritäten bzw. Abstufungen in einzelnen Abwägungsvorgängen und/oder -schritten ableiten lassen.<br />
Landschaftsprägende Erhebungen,<br />
Regional bedeutsame<br />
Aussichtspunkte<br />
Wertvolle historische Kulturlandschaften,<br />
Regional bedeutsame<br />
Kulturdenkmale<br />
1000 m zu Verkehrslandeplätze<br />
Militärische Schutzbereiche
<strong>Regionalplan</strong> Region Chemnitz; Regionales Windenergiekonzept - Fachkonzept<br />
Beteiligung an der Ausarbeitung des Planentwurfs gemäß § 9 ROG<br />
in Verbindung mit § 6 Abs. 1 SächsLPlG<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
Anlage 3<br />
Regional bedeutsame Aussichtspunkte und Aussichtsbereiche<br />
Aussichtspunkt Lage Stadt/Gemeinde Typ Bedeutungsstufe<br />
Adelsberg Chemnitz Aussichtsturm hoch<br />
Alberthöhe Mülsen Aussichtsturm hoch<br />
Alter Söll Schöneck/Vogtl. Berg sehr hoch<br />
Aschberg Klingenthal Aussichtsturm hoch<br />
Aschberg-Ochsenkopf Wildenfels Aussichtsbereich hoch<br />
Auersberg Eibenstock Aussichtsturm sehr hoch<br />
Bärenstein Bärenstein Aussichtsturm sehr hoch<br />
Bismarckturm Thermalb. Wiesenbad Aussichtsturm hoch<br />
Borberg Kirchberg Aussichtsturm hoch<br />
Burgberg Mulda/Sa. Berg hoch<br />
Burg Schönfels Lichtentanne Burg sehr hoch<br />
Dittersdorfer Höhe Amtsberg Berg hoch<br />
Dreibrüderhöhe Marienberg Aussichtsturm hoch<br />
Einsiedel-Spiegelwald Lauter-Bernsbach/ Aussichtbereich sehr hoch<br />
Grünhain-Beierfeld<br />
Eisenberg Pöhl Aussichtsturm hoch<br />
Eisenweg<br />
Burkhardtsd./Neukirchen Aussichtsbereich sehr hoch<br />
Erlsberg-Liebberg-Schönfels Lichtentanne Aussichtsbereich<br />
Fichtelberg Oberwiesenthal, Kurort Aussichtsturm sehr hoch<br />
Friedrich-August-Turm Rochlitz Aussichtsturm sehr hoch<br />
Fuchsberg Chemnitz Berg hoch<br />
Gleesberg Schneeberg Aussichtsturm hoch<br />
Glück-Auf-Turm Oelsnitz/Erzgeb. Aussichtsturm sehr hoch<br />
Greifensteine Ehrenfriedersdorf Felsen sehr hoch<br />
Harrasfelsen Frankenberg/Sa. Felsen hoch<br />
Heidelbergturm Hohenstein-Ernstthal Aussichtsturm hoch<br />
Hetzdorfer Viadukt Flöha Brücke hoch<br />
Hirtstein Marienberg Felsen sehr hoch<br />
Höhenzug westl. Mülsengrund Mülsen Aussichtsbereich hoch<br />
Kalter Muff - Franzenshöhe Thermalb. Wiesenbad Berg hoch<br />
Kapellenberg Bad Brambach Aussichtsturm sehr hoch<br />
Karolinenhöhe Oederan Hochfläche hoch<br />
Katzenstein Marienberg Felsen hoch<br />
Katzenstein Lößnitz Berg hoch<br />
Keilberg - Griesbacher Höhe Schneeberg Aussichtsbereich hoch<br />
Kemmler Plauen Aussichtsturm sehr hoch<br />
König-Albert-Turm -<br />
Lauter-Bernsbach Aussichtsturm sehr hoch<br />
Spiegelwald<br />
König-Friedrich-August-Turm Geringswalde Aussichtsturm hoch<br />
Kuhberg im Vogtland Netzschkau Aussichtsturm sehr hoch<br />
Kuhberg im Erzgebirge Stützengrün Aussichtsturm sehr hoch<br />
Morgenleithe Lauter-Bernsbach Aussichtsturm hoch<br />
Mildensteinblick Leisnig Aussichtsbereich hoch<br />
Oberbecken Pumpspeicherwerk<br />
Raschau-Markersbach Tech. Bauwerk sehr hoch<br />
Pöhlberg Annaberg-Buchholz Aussichtsturm sehr hoch<br />
Scheibenberg Scheibenberg Aussichtsturm sehr hoch<br />
Schloss Augustusburg Augustusburg Schloss/Berg sehr hoch
<strong>Regionalplan</strong> Region Chemnitz; Regionales Windenergiekonzept - Fachkonzept<br />
Beteiligung an der Ausarbeitung des Planentwurfs gemäß § 9 ROG<br />
in Verbindung mit § 6 Abs. 1 SächsLPlG<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
Aussichtspunkt Lage Stadt/Gemeinde Typ Bedeutungsstufe<br />
Schloss Frauenstein Frauenstein Schloss/Berg hoch<br />
Schloss Mildenstein Leisnig Schloss sehr hoch<br />
Schneckenstein Muldenhammer Wismuthalde sehr hoch<br />
Schwartenberg Neuhausen/Erzgeb. Aussichtsturm sehr hoch<br />
Taurastein Burgstädt Wasserturm hoch<br />
Totenstein Chemnitz Aussichtsturm sehr hoch<br />
Turm am Sportareal Gelenau Aussichtsturm hoch<br />
Wasserturm Reichenbach im Vogtl. Wasserturm hoch<br />
Wilhelmshöhe Treuen Aussichtsturm hoch<br />
Wirtsberg Markneukirchen Aussichtsturm hoch
<strong>Regionalplan</strong> Region Chemnitz; Regionales Windenergiekonzept - Fachkonzept<br />
Beteiligung an der Ausarbeitung des Planentwurfs gemäß § 9 ROG<br />
in Verbindung mit § 6 Abs. 1 SächsLPlG<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
Anlage 4 Kulturdenkmale mit besonderer Freiraumrelevanz in der Region Chemnitz<br />
Kulturdenkmal mit besonderer<br />
Freiraumrelevanz<br />
Lage:<br />
Stadt/Gemeinde<br />
Typ<br />
Bedeutungsstufe<br />
Annaberg-Buchholz Annaberg-Buchholz Ortskern/Silhouette, Kirche sehr hoch<br />
Augustusburg Augustusburg Burg/Schloss, Ort/Silhouette sehr hoch<br />
Frauenstein Frauenstein Burg/Schloss,Ortskern/Silhouette sehr hoch<br />
Leisnig Leisnig Burg/Schloss , Ortskern/Silhouette, sehr hoch<br />
Kirche<br />
Schneeberg Schneeberg Ortskern/Silhouette sehr hoch<br />
Burg Schönfels Lichtentanne Burg/Schloss hoch<br />
Göltzschtalbrücke Netzschkau/Mylau Brücke hoch<br />
Heinersgrün Weischlitz Burg/Schloss, Kirche hoch<br />
Kirche Mildenau Mildenau Kirche hoch<br />
Kirche Seelitz Seelitz Kirche hoch<br />
Landwüst Markneukirchen Ort/Silhouette hoch<br />
Lichtenwalde Niederwiesa Burg/Schloss, Park hoch<br />
Marienberg Marienberg Ortskern/Silhouette hoch<br />
Oberwiesenthal<br />
Oberwiesenthal, Ortskern/Silhouette<br />
hoch<br />
Kurort<br />
Raun Bad Brambach Ort/Silhouette hoch<br />
Scheibenberg Scheibenberg Ortskern/Silhouette hoch<br />
Schöneck Schöneck/Vogtl. Ortskern/Silhouette, Kirche hoch<br />
Spielzeugdorf Seiffen Seiffen/Erzgeb. Ort/Silhouette, Kirche hoch<br />
Syrau Rosenbach/Vogtl. Windmühle hoch<br />
Waldenburg Waldenburg Burg/Schloss,Ortskern/Silhouette,<br />
Park<br />
hoch<br />
Wasserturm Bräunsdorf Oberschöna Wasserturm hoch<br />
Schloss Wildenfels Wildenfels Burg/Schloss hoch<br />
Wolkenstein Wolkenstein Burg/Schloss, Ort/Silhouette hoch<br />
Beedeln Seelitz Ort/Silhouette mittel<br />
Blankenhain Crimmitschau Ort/Silhouette mittel<br />
Burg Kriebstein Kriebstein Burg/Schloss mittel<br />
Burg Mylau Mylau Burg/Schloss mittel<br />
Burg Scharfenstein Drebach Burg/Schloss mittel<br />
Burgsteinruine Weischlitz Kirchenruine mittel<br />
Dürrenuhlsdorf Waldenburg Ort/Silhouette mittel<br />
Ebersdorf Chemnitz Kirche, Ort/Silhouette mittel<br />
Eibenstock Eibenstock Ort/Silhouette mittel<br />
Elstertalbrücke Pöhl Brücke mittel<br />
Elsterberg Elsterberg Burg/Schloss, Ortskern/Silhouette mittel
<strong>Regionalplan</strong> Region Chemnitz; Regionales Windenergiekonzept - Fachkonzept<br />
Beteiligung an der Ausarbeitung des Planentwurfs gemäß § 9 ROG<br />
in Verbindung mit § 6 Abs. 1 SächsLPlG<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
Kulturdenkmal mit besonderer<br />
Freiraumrelevanz<br />
Lage: Stadt/Gemeinde Typ Bedeutungsstufe<br />
Förderturm Karl- Oelsnitz/Erzgeb. Bergbauanlage mittel<br />
Liebknecht-Schacht<br />
Förderturm Reiche Zeche Freiberg Bergbauanlage mittel<br />
Förderturm Türkschacht Zschorlau Bergbauanlage mittel<br />
Franken Waldenburg Ort/Silhouette mittel<br />
Frankenberg Frankenberg/Sa. Ortskern/Silhouette mittel<br />
Freiberg Freiberg Ortskern/Silhouette,Burg/Schloss mittel<br />
Geringswalde Geringswalde Ortskern/Silhouette, Wasserturm mittel<br />
Göhrener Viadukt Wechselburg/Lunzenau Brücke mittel<br />
Großweitzschen Großweitzschen Ort/Silhouette, Kirche mittel<br />
Halsbrücker Esse Halsbrücke Schornstein mittel<br />
Hartha Oederan Ort/Silhouette mittel<br />
Helsdorf Burgstädt Ort/Silhouette mittel<br />
Hetzdorfer Viadukt Oederan/Falkenau Brücke mittel<br />
Kirche Frankenstein Oederan Kirche mittel<br />
Kirche Gersdorf Hartha Kirche mittel<br />
Kirche Göhren Wechselburg Kirche mittel<br />
Kirche Greifendorf Rossau Kirche mittel<br />
Kirche Polditz Leisnig Kirche mittel<br />
Kleinchursdorf Remse Ort/Silhouette mittel<br />
Kloster Buch Leisnig Kloster mittel<br />
Kürbitz Weischlitz Ortskern/Silhouette, Kirche mittel<br />
Lichtenstein Lichtenstein/Sa. Burg/Schloss,Ortskern/Silhouette mittel<br />
Limmritzer Viadukt Döbeln Brücke mittel<br />
Markersbacher Viadukt Markersbach Brücke mittel<br />
Neukirchen Oberwiera Ort/Silhouette mittel<br />
Niederalbertsdorf Langenbernsdorf Ort/Silhouette mittel<br />
Oederan Oederan Ortskern/Silhouette, Kirche mittel<br />
Pirk Weischlitz Autobahnbrücke mittel<br />
Rochlitz Rochlitz Burg,Ortskern/Silhouette, Brücke mittel<br />
Rochsburg Lunzenau Burg,Ortskern/Silhouette, Brücke mittel<br />
Roßwein Roßwein Ortskern/Silhouette mittel<br />
Sachsenburg Frankenberg/Sa. Burg/Schloss, Brücke mittel<br />
Sayda Sayda Ortskern/Silhouette mittel<br />
Schlagwitz Waldenburg Ort/Silhouette mittel<br />
Schlettau Schlettau Schloss, Ortskern/Silhouette mittel
<strong>Regionalplan</strong> Region Chemnitz; Regionales Windenergiekonzept - Fachkonzept<br />
Beteiligung an der Ausarbeitung des Planentwurfs gemäß § 9 ROG<br />
in Verbindung mit § 6 Abs. 1 SächsLPlG<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
Kulturdenkmal mit besonderer<br />
Freiraumrelevanz<br />
Lage: Stadt/Gemeinde Typ Bedeutungsstufe<br />
Schloss Bieberstein Reinsberg Burg/Schloss mittel<br />
Schloss Hoheneck Stollberg/Erzgeb. Burg/Schloss mittel<br />
Schloss Pfaffroda Pfaffroda Burg/Schloss mittel<br />
Schloss Purschenstein Neuhausen/Erzgeb. Burg/Schloss mittel<br />
Schloss Rauenstein Lengefeld Burg/Schloss mittel<br />
Schloss Reinsberg Reinsberg Burg/Schloss mittel<br />
Schloss Voigtsberg Oelsnitz/Vogtl. Burg/Schloss mittel<br />
Schönberg Bad Brambach Burg/Schloss, Ort/Silhouette mittel<br />
Schwarzenberg Schwarzenberg/Erzgeb. Burg/Schloss, Ortskern/Silhouette mittel<br />
Wasserturm Taurastein Taura Wasserturm mittel<br />
Wechselburg Wechselburg Burg/Schloss,Ort/Silhouette,Park mittel<br />
Wehrkirche Lauterbach Marienberg Kirche mittel<br />
Weiditz Königsfeld Ort/Silhouette mittel<br />
Wolfsgrund Dorfchemnitz Ort/Silhouette mittel<br />
Wolkenburg Limbach-Oberfrohna Burg/Schloss,Ort/Silhouette, Brücke mittel<br />
Zschopau Zschopau Ortskern/Silhouette, Burg/Schloss mittel
<strong>Regionalplan</strong> Region Chemnitz; Regionales Windenergiekonzept - Fachkonzept<br />
Beteiligung an der Ausarbeitung des Planentwurfs gemäß § 9 ROG<br />
in Verbindung mit § 6 Abs. 1 SächsLPlG<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
Literaturverzeichnis:<br />
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (2009): Abschätzung der Ausbaupotenziale<br />
der Windenergie an Infrastrukturachsen und Entwicklung von Kriterien der Zulässigkeit.- Forschungszentrum<br />
Jülich PTJ und Team „Bosch & Partner + Peters Umweltplanung + Deutsche WindGuard + Prof. Stefan Klinski +<br />
OVGU Magdeburg“ Abschlussbericht vom 31. März 2009<br />
Freistaat Sachsen (2011): Entwurf eines Energie- und Klimaprogramms Sachsen (Stand 12. Oktober 2011)<br />
Freistaat Sachsen (2012): Entwurf Landesentwicklungsplan 2012 (Stand 25.09.2012).- Dresden, 163 S.<br />
Freistaat Sachsen Staatsbetrieb Sachsenforst (2010): Waldfunktionenkartierung - Grundsätze und Verfahren<br />
zur Erfassung der besonderen Schutz- und Erholungsfunktionen des Waldes im Freistaat Sachsen.- Pirna/OT<br />
Graupa, 71 S.<br />
GATZ, S. (2009): Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis.- vhw – Dienstleistung GmbH Verlag,<br />
Bonn, 320 S.2020 - Perspektiven für Erneuerbare Energien in Sachsen (2008):<br />
Vereinigung zur Förderung der Nutzung Erneuerbarer Energien / VEE SACHSEN e. V. Ermittlung der technischen<br />
Potenziale der erneuerbaren Energieträger in Sachsen sowie deren wirtschaftliche Umsetzungsmöglichkeiten<br />
für die Stromerzeugung bis zum Jahr 2020 im Auftrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Sächsischen<br />
Landtag, 150 S.<br />
MASLATON, M. (2011): Windrechtsfibel.- Verlag für alternatives Energierecht, Prof. D. Martin Maslaton, Leipzig,<br />
471 S.<br />
<strong>Regionalplan</strong> Chemnitz-Erzgebirge (2008): RPV Chemnitz-Erzgebirge, Annaberg-Buchholz (in Kraft seit 31. Juli<br />
2008)<br />
<strong>Regionalplan</strong> Chemnitz-Erzgebirge (2004): Teilfortschreibung bezüglich der Plansätze zur Nutzung der Windenergie,<br />
(in Kraft seit 20. Oktober 2005)<br />
<strong>Regionalplan</strong> Oberes Elbtal/Osterzgebirge (2009): Regionaler Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge,<br />
Radebeul , (in Kraft seit 19. November 2009; da der Teil Windenergienutzung von der Genehmigung ausgenommen<br />
worden ist, gilt diesbezüglich die Teilfortschreibung, die seit dem 24. April 2003 in Kraft ist; Kriterien in Tabelle<br />
1 = Stand 09/2010)<br />
<strong>Regionalplan</strong> Westsachsen (2008): RPV Westsachsen, Grimma, (in Kraft seit 25. Juli 2008)<br />
<strong>Regionalplan</strong> Südwestsachsen (2008): RPV Südwestsachsen, Aue, (in Kraft seit 6. Oktober 2011)<br />
SAENA (2011): Fallstudie zum Ausbau der Erneuerbaren Energien in Sachsen.-<br />
Wind Energy Market (2009): Darstellung der Windgeschwindigkeiten in 120 m über Grund für Sachsen.- Bundesverband<br />
für Windenergie e. V.<br />
Besuchte Internetseiten:<br />
www.50hertz-transmission.net<br />
Abkürzungsverzeichnis:<br />
a<br />
Jahr<br />
A<br />
Ausschlusskriterien in den Regionalplänen Oberes Elbtal/ Osterzgebirge und Westsachsen<br />
Abs.<br />
Absatz<br />
AEG<br />
Allgemeines Eisenbahngesetz<br />
ArcGIS Oberbegriff für verschiedene GIS-Softwareprodukte des Unternehmens ESRI<br />
ATKIS<br />
Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem<br />
BauGB Baugesetzbuch<br />
BGBl. I Bundesgesetzblatt Teil I<br />
BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz<br />
BImSchV Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes<br />
BLIW<br />
Bund-Länder-Initiative Windenergie<br />
BMU<br />
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit<br />
BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz<br />
BVerwG Bundesverwaltungsgericht<br />
bzw.<br />
beziehungsweise<br />
ca.<br />
Zirka, ungefähr, etwa<br />
d<br />
Durchmesser<br />
dB<br />
Dezibel<br />
d.h.<br />
das heißt<br />
DIN Deutsches Institut für Normung e. V.<br />
DKE<br />
Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik<br />
DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.<br />
EBA<br />
Eisenbahn-Bundesamt<br />
EEG<br />
Erneuerbare-Energien-Gesetz<br />
EF<br />
Einzelfall<br />
ESRI<br />
Environmental Systems Research Institute ist ein US-amerikanischer Softwarehersteller von<br />
Geoinformationssystemen
<strong>Regionalplan</strong> Region Chemnitz; Regionales Windenergiekonzept - Fachkonzept<br />
Beteiligung an der Ausarbeitung des Planentwurfs gemäß § 9 ROG<br />
in Verbindung mit § 6 Abs. 1 SächsLPlG<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
EU<br />
Europäische Union<br />
FFH<br />
Fauna-Flora-Habitat<br />
FStrG<br />
Bundesfernstraßengesetz<br />
ggf.<br />
gegebenenfalls<br />
GIS<br />
Geographische Informationssysteme<br />
GLB<br />
Geschützter Landschaftsbestandteil<br />
GW<br />
Gigawatt (=1 Milliarde Watt)<br />
GWh<br />
Gigawattstunde<br />
GWh/a Gigawattstunden pro Jahr<br />
h<br />
Stunde<br />
ha<br />
Hektar (100 m x 100 m = 10.000 m²)<br />
Hz<br />
Hertz, physikalische Einheit der Frequenz<br />
i. d. R. in der Regel<br />
i. V. m. in Verbindung mit<br />
i. Z. m. im Zusammenhang mit<br />
km<br />
Kilometer<br />
kV<br />
Kilovolt (= Tausend Volt, physikalische Einheit der elektrischen Spannung)<br />
kW<br />
Kilowatt (= Tausend Watt)<br />
kWh<br />
Kilowattstunde<br />
kWh/a<br />
Kilowattstunden pro Jahr<br />
LEP<br />
Landesentwicklungsplan<br />
LEP 2012 Landesentwicklungsplan Sachsen 2012 (Entwurf Stand 20.12.2011)<br />
LfULG<br />
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie<br />
LISt<br />
Gesellschaft für Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH<br />
LK<br />
Landkreis<br />
LSG<br />
Landschaftsschutzgebiet<br />
LuftVG Luftverkehrsgesetz<br />
m<br />
Meter<br />
m/s<br />
Meter pro Sekunde<br />
MW<br />
Megawatt (=1 Million Watt)<br />
NABEG Netzausbaubeschleunigungsgesetz<br />
NATURA Kohärentes Netz von Schutzgebieten in der EU zum Schutz wildlebender 2000 heimischer Tierund<br />
Pflanzenarten und ihrer natürlichen Lebensräume<br />
Nr.<br />
Nummer<br />
NSG<br />
Naturschutzgebiet<br />
NuL<br />
Natur und Landschaft<br />
OVG<br />
Oberverwaltungsgericht<br />
PV<br />
Planungsverband<br />
RC<br />
Region Chemnitz<br />
ROG<br />
Raumordnungsgesetz<br />
RPV<br />
Regionaler Planungsverband<br />
S. Seite(n)<br />
SächsGVBl. Sächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt<br />
SächsLPlG Sächsisches Landesplanungsgesetz<br />
SächsStrG Sächsisches Straßengesetz<br />
SächsWaldG Sächsisches Waldgesetz<br />
SächsWG Sächsisches Wassergesetz<br />
SAENA Sächsische Energieagentur<br />
SMI<br />
Sächsisches Staatsministerium des Innern<br />
SMUL<br />
Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
SMWA Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
sog.<br />
so genannt (-e, -er, -es)<br />
SPA<br />
Special Protection Areas = Europäisches Vogelschutzgebiet<br />
∑<br />
Summe<br />
TOP<br />
Tagesordnungspunkt<br />
TWSZ<br />
Trinkwasserschutzzone<br />
u. a. unter anderem<br />
UVP<br />
Umweltverträglichkeitsprüfung<br />
UVPG<br />
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung<br />
VBG<br />
Vorbehaltsgebiet<br />
VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V.<br />
VDEW Verband der Elektrizitätswirtschaft e. V.<br />
VG<br />
Verwaltungsgericht<br />
vgl.<br />
vergleiche<br />
VREG<br />
Vorrang-/Eignungsgebiet<br />
VRG<br />
Vorranggebiet
<strong>Regionalplan</strong> Region Chemnitz; Regionales Windenergiekonzept - Fachkonzept<br />
Beteiligung an der Ausarbeitung des Planentwurfs gemäß § 9 ROG<br />
in Verbindung mit § 6 Abs. 1 SächsLPlG<br />
_____________________________________________________________________________________________________<br />
W<br />
Watt , physikalische Einheit der Leistung<br />
WASP<br />
Wind Atlas Analysis and Application Program<br />
WEA<br />
Windenergieanlage<br />
WHG<br />
Wasserhaushaltsgesetz<br />
WKA<br />
Windkraftanlage<br />
z. B. zum Beispiel<br />
aktualisiert mit Stand vom 15. März 2013
Karten