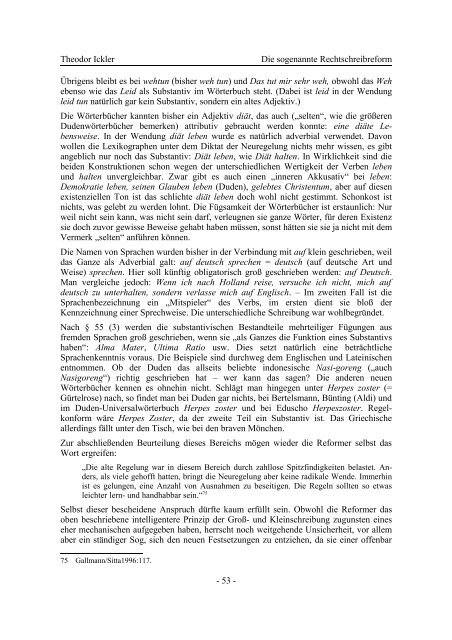Die sogenannte Rechtschreibreform - ein Schildbürgerstreich
Die sogenannte Rechtschreibreform - ein Schildbürgerstreich
Die sogenannte Rechtschreibreform - ein Schildbürgerstreich
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Theodor Ickler<br />
<strong>Die</strong> <strong>sogenannte</strong> <strong>Rechtschreibreform</strong><br />
Übrigens bleibt es bei wehtun (bisher weh tun) und Das tut mir sehr weh, obwohl das Weh<br />
ebenso wie das Leid als Substantiv im Wörterbuch steht. (Dabei ist leid in der Wendung<br />
leid tun natürlich gar k<strong>ein</strong> Substantiv, sondern <strong>ein</strong> altes Adjektiv.)<br />
<strong>Die</strong> Wörterbücher kannten bisher <strong>ein</strong> Adjektiv diät, das auch („selten“, wie die größeren<br />
Dudenwörterbücher bemerken) attributiv gebraucht werden konnte: <strong>ein</strong>e diäte Lebensweise.<br />
In der Wendung diät leben wurde es natürlich adverbial verwendet. Davon<br />
wollen die Lexikographen unter dem Diktat der Neuregelung nichts mehr wissen, es gibt<br />
angeblich nur noch das Substantiv: Diät leben, wie Diät halten. In Wirklichkeit sind die<br />
beiden Konstruktionen schon wegen der unterschiedlichen Wertigkeit der Verben leben<br />
und halten unvergleichbar. Zwar gibt es auch <strong>ein</strong>en „inneren Akkusativ“ bei leben:<br />
Demokratie leben, s<strong>ein</strong>en Glauben leben (Duden), gelebtes Christentum, aber auf diesen<br />
existenziellen Ton ist das schlichte diät leben doch wohl nicht gestimmt. Schonkost ist<br />
nichts, was gelebt zu werden lohnt. <strong>Die</strong> Fügsamkeit der Wörterbücher ist erstaunlich: Nur<br />
weil nicht s<strong>ein</strong> kann, was nicht s<strong>ein</strong> darf, verleugnen sie ganze Wörter, für deren Existenz<br />
sie doch zuvor gewisse Beweise gehabt haben müssen, sonst hätten sie sie ja nicht mit dem<br />
Vermerk „selten“ anführen können.<br />
<strong>Die</strong> Namen von Sprachen wurden bisher in der Verbindung mit auf kl<strong>ein</strong> geschrieben, weil<br />
das Ganze als Adverbial galt: auf deutsch sprechen = deutsch (auf deutsche Art und<br />
Weise) sprechen. Hier soll künftig obligatorisch groß geschrieben werden: auf Deutsch.<br />
Man vergleiche jedoch: Wenn ich nach Holland reise, versuche ich nicht, mich auf<br />
deutsch zu unterhalten, sondern verlasse mich auf Englisch. – Im zweiten Fall ist die<br />
Sprachenbezeichnung <strong>ein</strong> „Mitspieler“ des Verbs, im ersten dient sie bloß der<br />
Kennzeichnung <strong>ein</strong>er Sprechweise. <strong>Die</strong> unterschiedliche Schreibung war wohlbegründet.<br />
Nach § 55 (3) werden die substantivischen Bestandteile mehrteiliger Fügungen aus<br />
fremden Sprachen groß geschrieben, wenn sie „als Ganzes die Funktion <strong>ein</strong>es Substantivs<br />
haben“: Alma Mater, Ultima Ratio usw. <strong>Die</strong>s setzt natürlich <strong>ein</strong>e beträchtliche<br />
Sprachenkenntnis voraus. <strong>Die</strong> Beispiele sind durchweg dem Englischen und Lat<strong>ein</strong>ischen<br />
entnommen. Ob der Duden das allseits beliebte indonesische Nasi-goreng („auch<br />
Nasigoreng“) richtig geschrieben hat – wer kann das sagen? <strong>Die</strong> anderen neuen<br />
Wörterbücher kennen es ohnehin nicht. Schlägt man hingegen unter Herpes zoster (=<br />
Gürtelrose) nach, so findet man bei Duden gar nichts, bei Bertelsmann, Bünting (Aldi) und<br />
im Duden-Universalwörterbuch Herpes zoster und bei Eduscho Herpeszoster. Regelkonform<br />
wäre Herpes Zoster, da der zweite Teil <strong>ein</strong> Substantiv ist. Das Griechische<br />
allerdings fällt unter den Tisch, wie bei den braven Mönchen.<br />
Zur abschließenden Beurteilung dieses Bereichs mögen wieder die Reformer selbst das<br />
Wort ergreifen:<br />
„<strong>Die</strong> alte Regelung war in diesem Bereich durch zahllose Spitzfindigkeiten belastet. Anders,<br />
als viele gehofft hatten, bringt die Neuregelung aber k<strong>ein</strong>e radikale Wende. Immerhin<br />
ist es gelungen, <strong>ein</strong>e Anzahl von Ausnahmen zu beseitigen. <strong>Die</strong> Regeln sollten so etwas<br />
leichter lern- und handhabbar s<strong>ein</strong>.“ 75<br />
Selbst dieser bescheidene Anspruch dürfte kaum erfüllt s<strong>ein</strong>. Obwohl die Reformer das<br />
oben beschriebene intelligentere Prinzip der Groß- und Kl<strong>ein</strong>schreibung zugunsten <strong>ein</strong>es<br />
eher mechanischen aufgegeben haben, herrscht noch weitgehende Unsicherheit, vor allem<br />
aber <strong>ein</strong> ständiger Sog, sich den neuen Festsetzungen zu entziehen, da sie <strong>ein</strong>er offenbar<br />
75 Gallmann/Sitta1996:117.<br />
- 53 -