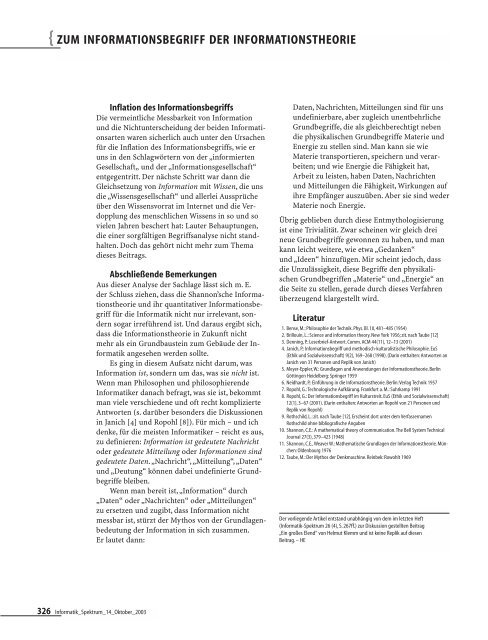Zum Informationsbegriff der Informationstheorie
Zum Informationsbegriff der Informationstheorie
Zum Informationsbegriff der Informationstheorie
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
}<br />
ZUM INFORMATIONSBEGRIFF DER INFORMATIONSTHEORIE<br />
Inflation des <strong>Informationsbegriff</strong>s<br />
Die vermeintliche Messbarkeit von Information<br />
und die Nichtunterscheidung <strong>der</strong> beiden Informationsarten<br />
waren sicherlich auch unter den Ursachen<br />
für die Inflation des <strong>Informationsbegriff</strong>s, wie er<br />
uns in den Schlagwörtern von <strong>der</strong> „informierten<br />
Gesellschaft„ und <strong>der</strong> „Informationsgesellschaft“<br />
entgegentritt. Der nächste Schritt war dann die<br />
Gleichsetzung von Information mit Wissen, die uns<br />
die „Wissensgesellschaft“ und allerlei Aussprüche<br />
über den Wissensvorrat im Internet und die Verdopplung<br />
des menschlichen Wissens in so und so<br />
vielen Jahren beschert hat: Lauter Behauptungen,<br />
die einer sorgfältigen Begriffsanalyse nicht standhalten.<br />
Doch das gehört nicht mehr zum Thema<br />
dieses Beitrags.<br />
Abschließende Bemerkungen<br />
Aus dieser Analyse <strong>der</strong> Sachlage lässt sich m. E.<br />
<strong>der</strong> Schluss ziehen, dass die Shannon’sche <strong>Informationstheorie</strong><br />
und ihr quantitativer <strong>Informationsbegriff</strong><br />
für die Informatik nicht nur irrelevant, son<strong>der</strong>n<br />
sogar irreführend ist. Und daraus ergibt sich,<br />
dass die <strong>Informationstheorie</strong> in Zukunft nicht<br />
mehr als ein Grundbaustein zum Gebäude <strong>der</strong> Informatik<br />
angesehen werden sollte.<br />
Es ging in diesem Aufsatz nicht darum, was<br />
Information ist, son<strong>der</strong>n um das, was sie nicht ist.<br />
Wenn man Philosophen und philosophierende<br />
Informatiker danach befragt, was sie ist, bekommt<br />
man viele verschiedene und oft recht komplizierte<br />
Antworten (s. darüber beson<strong>der</strong>s die Diskussionen<br />
in Janich [4] und Ropohl [8]). Für mich – und ich<br />
denke, für die meisten Informatiker – reicht es aus,<br />
zu definieren: Information ist gedeutete Nachricht<br />
o<strong>der</strong> gedeutete Mitteilung o<strong>der</strong> Informationen sind<br />
gedeutete Daten. „Nachricht“, „Mitteilung“, „Daten“<br />
und „Deutung“ können dabei undefinierte Grundbegriffe<br />
bleiben.<br />
Wenn man bereit ist, „Information“ durch<br />
„Daten“ o<strong>der</strong> „Nachrichten“ o<strong>der</strong> „Mitteilungen“<br />
zu ersetzen und zugibt, dass Information nicht<br />
messbar ist, stürzt <strong>der</strong> Mythos von <strong>der</strong> Grundlagenbedeutung<br />
<strong>der</strong> Information in sich zusammen.<br />
Er lautet dann:<br />
Daten, Nachrichten, Mitteilungen sind für uns<br />
undefinierbare, aber zugleich unentbehrliche<br />
Grundbegriffe, die als gleichberechtigt neben<br />
die physikalischen Grundbegriffe Materie und<br />
Energie zu stellen sind. Man kann sie wie<br />
Materie transportieren, speichern und verarbeiten;<br />
und wie Energie die Fähigkeit hat,<br />
Arbeit zu leisten, haben Daten, Nachrichten<br />
und Mitteilungen die Fähigkeit, Wirkungen auf<br />
ihre Empfänger auszuüben. Aber sie sind we<strong>der</strong><br />
Materie noch Energie.<br />
Übrig geblieben durch diese Entmythologisierung<br />
ist eine Trivialität. Zwar scheinen wir gleich drei<br />
neue Grundbegriffe gewonnen zu haben, und man<br />
kann leicht weitere, wie etwa „Gedanken“<br />
und „Ideen“ hinzufügen. Mir scheint jedoch, dass<br />
die Unzulässigkeit, diese Begriffe den physikalischen<br />
Grundbegriffen „Materie“ und „Energie“ an<br />
die Seite zu stellen, gerade durch dieses Verfahren<br />
überzeugend klargestellt wird.<br />
Literatur<br />
1. Bense, M.: Philosophie <strong>der</strong> Technik. Phys. Bl. 10, 481–485 (1954)<br />
2. Brillouin, L.: Science and information theory. New York 1956; zit. nach Taube [12]<br />
3. Denning, P.: Leserbrief-Antwort. Comm. ACM 44(11), 12–13 (2001)<br />
4. Janich, P.: <strong>Informationsbegriff</strong> und methodisch-kulturalistische Philosophie. EuS<br />
(Ethik und Sozialwissenschaft) 9(2), 169–268 (1998). (Darin enthalten: Antworten an<br />
Janich von 31 Personen und Replik von Janich)<br />
5. Meyer-Eppler, W.: Grundlagen und Anwendungen <strong>der</strong> <strong>Informationstheorie</strong>. Berlin<br />
Göttingen Heidelberg: Springer 1959<br />
6. Neidhardt, P.: Einführung in die <strong>Informationstheorie</strong>. Berlin: Verlag Technik 1957<br />
7. Ropohl, G.: Technologische Aufklärung. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1991<br />
8. Ropohl, G.: Der <strong>Informationsbegriff</strong> im Kulturstreit. EuS (Ethik und Sozialwissenschaft)<br />
12(1), 3–67 (2001). (Darin enthalten: Antworten an Ropohl von 21 Personen und<br />
Replik von Ropohl)<br />
9. Rothschild, L.: zit. nach Taube [12]. Erscheint dort unter dem Verfassernamen<br />
Rothschild ohne bibliografische Angaben<br />
10. Shannon, C.E.: A mathematical theory of communication.The Bell System Technical<br />
Journal 27(3), 379–423 (1948)<br />
11. Shannon, C.E., Weaver W.: Mathematische Grundlagen <strong>der</strong> <strong>Informationstheorie</strong>. München:<br />
Oldenbourg 1976<br />
12. Taube, M.: Der Mythos <strong>der</strong> Denkmaschine. Reinbek: Rowohlt 1969<br />
Der vorliegende Artikel entstand unabhängig von dem im letzten Heft<br />
(Informatik-Spektrum 26 (4), S. 267ff.) zur Diskussion gestellten Beitrag<br />
„Ein großes Elend“ von Helmut Klemm und ist keine Replik auf diesen<br />
Beitrag. – HE<br />
326<br />
Informatik_Spektrum_14_Oktober_2003