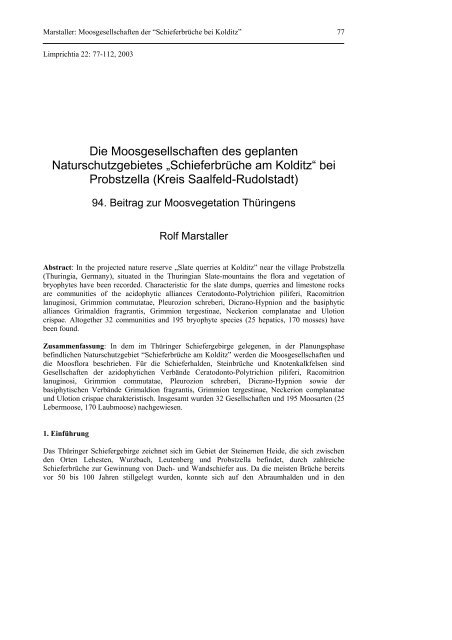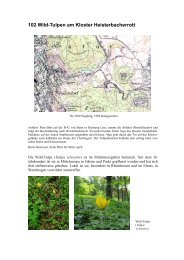Marstaller, R. - Jan-Peter Frahm
Marstaller, R. - Jan-Peter Frahm
Marstaller, R. - Jan-Peter Frahm
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Marstaller</strong>: Moosgesellschaften der “Schieferbrüche bei Kolditz” 77<br />
Limprichtia 22: 77-112, 2003<br />
Die Moosgesellschaften des geplanten<br />
Naturschutzgebietes „Schieferbrüche am Kolditz“ bei<br />
Probstzella (Kreis Saalfeld-Rudolstadt)<br />
94. Beitrag zur Moosvegetation Thüringens<br />
Rolf <strong>Marstaller</strong><br />
Abstract: In the projected nature reserve „Slate querries at Kolditz” near the village Probstzella<br />
(Thuringia, Germany), situated in the Thuringian Slate-mountains the flora and vegetation of<br />
bryophytes have been recorded. Characteristic for the slate dumps, querries and limestone rocks<br />
are communities of the acidophytic alliances Ceratodonto-Polytrichion piliferi, Racomitrion<br />
lanuginosi, Grimmion commutatae, Pleurozion schreberi, Dicrano-Hypnion and the basiphytic<br />
alliances Grimaldion fragrantis, Grimmion tergestinae, Neckerion complanatae and Ulotion<br />
crispae. Altogether 32 communities and 195 bryophyte species (25 hepatics, 170 mosses) have<br />
been found.<br />
Zusammenfassung: In dem im Thüringer Schiefergebirge gelegenen, in der Planungsphase<br />
befindlichen Naturschutzgebiet “Schieferbrüche am Kolditz” werden die Moosgesellschaften und<br />
die Moosflora beschrieben. Für die Schieferhalden, Steinbrüche und Knotenkalkfelsen sind<br />
Gesellschaften der azidophytichen Verbände Ceratodonto-Polytrichion piliferi, Racomitrion<br />
lanuginosi, Grimmion commutatae, Pleurozion schreberi, Dicrano-Hypnion sowie der<br />
basiphytischen Verbände Grimaldion fragrantis, Grimmion tergestinae, Neckerion complanatae<br />
und Ulotion crispae charakteristisch. Insgesamt wurden 32 Gesellschaften und 195 Moosarten (25<br />
Lebermoose, 170 Laubmoose) nachgewiesen.<br />
1. Einführung<br />
Das Thüringer Schiefergebirge zeichnet sich im Gebiet der Steinernen Heide, die sich zwischen<br />
den Orten Lehesten, Wurzbach, Leutenberg und Probstzella befindet, durch zahlreiche<br />
Schieferbrüche zur Gewinnung von Dach- und Wandschiefer aus. Da die meisten Brüche bereits<br />
vor 50 bis 100 Jahren stillgelegt wurden, konnte sich auf den Abraumhalden und in den
78<br />
Limprichtia 22, 2003<br />
Steinbrüchen die Vegetation ungestört ausbreiten. Dabei spielen bei der Besiedlung<br />
Kryptogamengemeinschaften eine große Rolle und bestimmen insbesondere auf den Halden die<br />
Physiognomie. Da fast alle bedeutenden Schieferbrüche im ehemaligen Grenzgebiet zu Bayern bis<br />
1990 nur schwer zugänglich waren, wurde man erst im vergangenen Jahrzehnt auf deren große<br />
floristische und ökologische Bedeutung aufmerksam. Zunächst konnten einige besonders<br />
repräsentativ ausgestattete Gebiete vorläufig als Naturschutzgebiet (NSG) gesichert werden, doch<br />
sind bisher nur der Bocksberg bei Probstzella und der Staatsbruch bei Lehesten entgültig als NSG<br />
ausgewiesen. In diesem Beitrag soll über die reiche Moosvegetation der Schieferbrüche am<br />
Kolditz berichtet werden, der zugleich dessen große Bedeutung als NSG betont.<br />
2. Naturräumliche Situation<br />
Das NSG umfasst den mehr oder weniger südexponierten Hang des Kolditzberges und des<br />
Bockhügels im Loquitztal zwischen den Orten Probstzella und Gabe Gottes. Es gliedert sich in die<br />
durch tief eingeschnittene Täler und steile Hänge ausgezeichnete Mittelgebirgslandschaft<br />
Thüringisches Schiefergebirge Westteil (SCHULTZE 1955) bzw. Thüringisch-fränkisches<br />
Schiefergebirge (LIEDTKE 1994) ein. Seine Größe wird auf ca. 80 ha geschätzt und reicht vom<br />
Rande der Loquitzaue bei 326 m über NN bis zu einer Höhenlage von 550 m, doch steigt das<br />
Gelände außerhalb des NSG im Gipfelgebiet des Kolditzberges bis auf 584 m an. Die Umgrenzung<br />
beruht zum Teil auf den Vorstellungen in GÖRNER (1991) und HIRSCH (1993), allerdings wird in<br />
dieser Arbeit vorgeschlagen, die sehr einförmigen Fichtenforste am Kolditzberg auszugliedern und<br />
dafür den sehr bedeutungsvollen, durch natürliche Laubwälder und Laubwaldreste<br />
ausgezeichneten Abschnitt am Unterhang unterhalb von Probstzella dem künftigen NSG<br />
anzugliedern, in dem bereits ein Geschützter Landschaftsbestandteil (GLB) ausgewiesen ist, der<br />
die bryologisch bemerkenswerten Felsen im Übergang vom Devon zum Karbon umfasst (Abb. 1).<br />
Da zum NSG nicht nur die für den Schieferbergbau typischen Abraumhalden, Steinbrüche und die<br />
tiefen, durch unterirdischen Abbau entstandenen, zum Teil unzugänglichen Einsturztrichter<br />
gehören, sondern auch Fichtenforste, Kiefernforste sowie Übergänge zu natürlichen<br />
Kiefernwäldern, weiterhin Buchenbestände, montanen Hainbuchenwälder, verschiedene<br />
Bergwiesengesellschaften und Quellfluren, weist das NSG eine sehr vielfältige und<br />
abwechslungsreiche Biotopstruktur und damit auch eine reiche Moosvegetation auf.<br />
Geologisch wird der steile Mittelhang und der sanftere Oberhang von den sehr mineralarmen<br />
Tonschiefersedimenten des Unterkarbon (Kulm) bestimmt. In diesem Bereich fand der<br />
Schieferbergbau statt, so dass auf den Halden und in den Brüchen nur sehr selten basisches<br />
Gestein zu finden ist, zu denen die kalkhaltigen Kieskälber (vgl. MARSTALLER 2002) gehören.<br />
Dagegen steht am Unterhang der überwiegend aus Knotenkalk und Kalkknotenschiefer bestehende
<strong>Marstaller</strong>: Moosgesellschaften der “Schieferbrüche bei Kolditz” 79<br />
Abb. 1: Lage des geplanten Naturschutzgebietes „Schieferbrüche am Kolditz“ bei Probstzella<br />
(Kreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen). 1: Bockhügel, 2: Kalksteinbruch, 3: GLB.<br />
Devon an, der einige kleinere Felsen bildet und außerdem im südlichen Abschnitt des NSG nahe<br />
der Landstraße nach Probstzella durch einen Steinbruch und Steinhalden aufgeschlossen ist. Die<br />
Böden im Bereich des Kulmschiefers, die fast ausschließlich mit Nadelbäumen bestockt sind,<br />
weisen fast immer einen ausgeprägten Rohhumushorizont auf, während unter Laubwald am<br />
Unterhang basenreichere Mullböden dominieren<br />
Der nördlich der Kammlinie befindliche Abschnitt des Schiefergebirges, zu dem auch das NSG<br />
gehört, liegt im Regenschatten und weist deshalb ein verhältnismäßig kontinentales<br />
Mittelgebirgsklima auf. Bezeichnend sind die recht geringen mittleren Jahresniederschläge, die für<br />
das 2 km entfernte Probstzella 683 mm betragen (nach Klimatologische Normalwerte 1955, 1961).<br />
Bezüglich der Temperaturen gibt es in der Nähe keine Station, so dass die mittlere<br />
Jahrestemperatur mit etwa 6,5°C (<strong>Jan</strong>uarmittel –2,3°, Julimittel + 15,5°) nur geschätzt werden<br />
kann. Da sich das NSG überwiegend in Südexposition befindet, spielt freilich die thermisch<br />
begünstigte geländeklimatische Situation eine bedeutsame Rolle.
80<br />
Limprichtia 22, 2003<br />
Der Beginn des Schieferabbaus ist im NSG nicht bekannt, doch wurde er seit der ersten Hälfte des<br />
19. Jahrhunderts bereits in größerem Umfang im Tagebau betrieben, später untertage fortgesetzt<br />
und seit dem Ende des 19. Jh. zu verschiedenen Zeiten in den einzelnen Brüchen eingestellt,<br />
zuletzt 1958 auf der unteren Sohle des im westlichen Abschnitt des NSG befindlichen<br />
Kolditzbruches (GOLDSCHMIDT 1993, HIRSCH 1993). Damit weisen die Schieferhalden ein recht<br />
unterschiedliches Alter auf. Die Haldenschüttungen bestehen aus einem Gemisch verschieden<br />
großer Schieferplatten und vereinzelter auch -blöcken, die die lange Zeit in Bewegung<br />
befindlichen Hangflächen und die gefestigten Plateauflächen der Halden auszeichnen. Vereinzelt<br />
wurden auch feinkörniger Schiefergrus und sehr lokal sogar Kalkmörtel abgelagert. Nur im<br />
Bereich ehemaliger Gebäude gibt es mineralkräftigere Deckschichten.<br />
3. Vegetation und Bodenmoose<br />
An den Hangflächen fast aller Halden, doch nur auf den Plateauflächen der jüngeren Halden,<br />
dominieren Kryptogamengemeinschaften. Zum überwiegenden Teil weisen die noch unbewaldeten<br />
Plateauflächen zweischichtige, krautige Gefäßpflanzengesellschaften auf, die in ihrer Struktur<br />
Beziehungen zu den Pioniergesellschaften der Ordnung Sedo-Scleranthethalia, den<br />
Ruderalgesellschaften, doch auch den Heidegesellschaften besitzen und oft wegen der<br />
fragmentarischen Artengarnitur nicht klar einer Assoziation zuzuordnen sind. Sie zeigen auf etwas<br />
mineralkräftigeren Silikatböden Anklänge an das Echio vulgare-Melilotetum officinalis Tx. 1947,<br />
Poo compressae-Anthemetum tinctoriae Th. Müller et Görs 1969 und Linario vulgaris-Brometum<br />
tectori Knapp 1963 (HIRSCH 1993). Innerhalb der meist lückenhaften Bestände zeichnen sich die<br />
mäßig sauren Mineral- und Humusböden durch Ceratodon purpureus, Hypnum cupressiforme,<br />
Racomitrium elongatum, Brachythecium albicans, an etwas nährstoffreicheren Stellen lokal durch<br />
Barbula convoluta, Bryum argenteum, B. caespiticium und B. pallescens aus.<br />
Im Bereich sehr mineralarmer Schieferböden wird die Entwicklung zum Cladonio-Callunetum<br />
Krieger 1937 eingeleitet, dessen Vorkommen meist von Deschampsia flexuosa bestimmt werden,<br />
zu der sich oft nur spärlich auf den älteren Halden Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus und V.<br />
vitis-idaea gesellen. Unter den Strauchflechten dominieren Arten der Gattung Cladonia, unter den<br />
Moosen Dicranum scoparium, Pohlia nutans, Polytrichum piliferum, Cephaloziella divaricata,<br />
mitunter auch Dicranum polysetum, Racomitrium elongatum, Polytrichum formosum und P.<br />
juniperinum.<br />
Auf den Plateauflächen der älteren Halden gedeiht bereits ein lichter Pionierwald aus Betula<br />
pendula und Pinus sylvestris, dem mitunter in geringen Mengen Picea abies, Populus tremula und<br />
Salix caprea beigemengt sind und der sich fast immer durch die Pleurozium schreberi-Synusie<br />
auszeichnet, die sich hauptsächlich aus Pleurozium schreberi, Ptilidium ciliare, Polytrichum<br />
formosum und Dicranum scoparium, viel seltener aus Hylocomium splendens, Dicranum<br />
polysetum oder gar D. spurium zusammensetzt. Besonders trockene Plateaukanten zeigen lokal<br />
Beziehungen zum strauchflechtenreichen Cladonio-Pinetum Kobendza 1930. Nur selten entwickelt<br />
sich auf Hangflächen dieser Pionierwald, da auf den noch nicht zur Ruhe gekommenen Halden<br />
lediglich Einzelbäume aufwachsen. Hier bleiben, vergleichbar mit natürlichen Blockhalden, die<br />
Kryptogamengemeinschaften über lange Zeit erhalten.<br />
Außerhalb des Bergbaugeländes herrschen im NSG meist Forste, doch mitunter auch natürliche<br />
Waldgesellschaften vor. Am Unterhang auf etwas mineralkräftigeren Böden des Devon gibt es<br />
noch Reste des Luzulo-Fagetum Meusel 1937 und sicherlich durch Niederwaldbetrieb daraus<br />
hervorgegangene Hainbuchenbestände, die dem Galio-Carpinetum Oberd. 1957 in einer
<strong>Marstaller</strong>: Moosgesellschaften der “Schieferbrüche bei Kolditz” 81<br />
bodensauren Ausbildung nahestehen. Unter den Moosen wachsen die meist azidophytischen<br />
Vertreter Mnium hornum, Atrichum undulatum, Hypnum cupressiforme, Dicranella heteromalla,<br />
Polytrichum formosum, Dicranum scoparium, Plagiothecium laetum und P. denticulatum, soweit<br />
noch genügend Licht den Waldboden erreicht. Nur bei mineralkräftigeren Verhältnissen stellen<br />
sich auch Plagiothecium succulentum, P. cavifolium, Brachythecium velutinum und B. rutabulum<br />
ein.<br />
Am steilen Südhang weist vereinzelter Stockausschlag von Fagus sylvatica auf ehemalige<br />
Buchenwälder des Luzulo-Fagetum hin und an einer Felsrippe hat sich ein Mischwald aus Betula<br />
pendula, Quercus robur und Pinus sylvestris erhalten, der in das Luzulo-Quercetum Knapp 1942<br />
zu stellen ist. Hier und im angrenzenden, großflächig verbreiteten Leucobryo-Pinetum typicum<br />
Matusz. 1962 besitzt die Moosvegetation mit der Pleurozium schreberi-Synusie enge Beziehungen<br />
zu den Pionierwaldformationen der Halden. Nur an besonders trockenen Hanglagen kommt auch<br />
das seltene Leucobryo-Pinetum cladonietosum mit Cladonia arbuscula, C. portentosa, C.<br />
rangiferina sowie den Moosen Dicranum spurium und Ptilidium ciliare vor.<br />
Die an sanfteren Hängen vorherrschenden, sehr uniformen Fichtenforste sind infolge der trockenen<br />
Böden und häufigen Lichtmangels meist sehr unterwuchsarm. Nur lokal treten Plagiothecium<br />
curvifolium, Dicranum scoparium, Polytrichum formosum, Pohlia nutans und Hypnum<br />
jutlandicum stärker in Erscheinung.<br />
Im südöstlichen Abschnitt gehören einige durch intensive Beweidung verarmte Wirtschaftswiesen<br />
zum NSG, die vom Alchemillo-Arrhenatheretum elatioris (Oberd. 1957) Sougn. et Limb. 1963<br />
zum Poo-Trisetetum flavescentis Knapp 1951 vermitteln und sehr moosarm sind. Im trockeneren<br />
Bereich gedeiht nur Brachythecium albicans, frischere Bestände weisen vereinzelt Brachythecium<br />
rutabulum und Rhytidiadelphus squarrosus auf. Die an den Rändern eines Bachlaufes diese<br />
Wiesen ablösenden Quellfluren zeichnen sich durch Calliergonella cuspidata, Brachythecium<br />
rivulare und selten Philonotis fontana aus.<br />
4. Moosgesellschaften<br />
Im NSG konzentrieren sich die licht- und säureliebenden terricolen und saxicolen<br />
Bryophytengesellschaften auf die Halden und Brüche des Schieferbergbaus. Weitere<br />
bemerkenswerte basiphytische bis azidophytische, meist sciophytische Moosvereine sind an den<br />
natürlich anstehenden kalkhaltigen Devonfelsen und im Bereich eines Steinbruches am Unterhang,<br />
außerdem an den angesprengten Felsen an der Straße zwischen Probstzella und Gabe Gottes<br />
vorhanden. Infolge der recht trockenen Verhältnisse am Südhang finden die Gesellschaften des<br />
morschen Holzes keine günstigen Bedingungen, auch die epiphytischen Moosvereine bleiben<br />
selten.<br />
Die in den Jahren 2000 bis 2002 nach der Methode von BRAUN-BLANQUET durchgeführten<br />
bryosoziologischen Erhebungen und das Erfassen des Moosbestandes berücksichtigt das NSG in<br />
der von GÖRNER (1991) und HIRSCH (1993) vorgesehenen Umgrenzung, außerdem die<br />
vorgeschlagene Erweiterung im Südostabschnitt (vgl. Abb. 1). In der Nomenklatur der<br />
Kryptogamen wird, abgesehen von Ausnahmen, FREY. et al. (1995), BLOM (1996) und WIRTH<br />
(1995), der Syntaxa MARSTALLER (1993) gefolgt. Die Größe der Aufnahmeflächen ist<br />
unterschiedlich und beträgt bei dem meisten Gesellschaften der Halden 12-16 dm² (Tab. 1-5, 7, 9-<br />
10), bei den Felsspaltengesellschaften maximal 1 dm², den übrigen epilithischen und terricolen<br />
Gesellschaften etwa 4 dm² (Tab.6, 8, 11-18), falls nichts abweichendes angeführt ist.
82<br />
Limprichtia 22, 2003<br />
4.1 Eu- bis mesofote terricole Azidophytengesellschaften<br />
Die fotophytischen terricolen Gesellschaften saurer Böden konzentrieren sich auf die<br />
Plateauflächen der Schieferhalden. Für die besonders trockenen, stark der Strahlung ausgesetzten<br />
flachgründigen, sehr skelettreichen Mineralböden ist an den Hangkanten, bei jüngeren Halden<br />
auch auf den Plateauflächen das Racomitrio-Polytrichetum piliferi (Tab. 1, 2) eines der<br />
häufigsten Assoziationen des NSG. Da die Kryptogamen dieser Gesellschaft eine starke<br />
Ausbreitungstendenz besitzen, haben sie sich auf auf allen Halden eingestellt. Zunächst entwickelt<br />
sich das für humusarme Mineralböden spezifische Racomitrio-Polytrichetum typicum, das neben<br />
zahlreichen Flechten der Gattung Cladonia unter den Moosen vorwiegend durch Polytrichum<br />
piliferum, Cephaloziella divaricata und Pohlia nutans, lokaler durch Ceratodon purpureus<br />
charakterisiert wird.<br />
Mit der Bildung und Ansammlung von saurem Humus finden sich Moose ein, die dichte Rasen<br />
bzw. große, zusammenhängende Decken bilden und zu denen der Neophyt Campylopus<br />
introflexus, Racomitrium elongatum und R. lanuginosum gehören. Gesellig mit Dicranum<br />
scoparium entwickelt sich auf einem dünnen Humushorizont das Racomitrio-Polytrichetum<br />
racomitrietosum elongati, bei beginnender Rohhumusbildung das Racomitrio-Polytrichetum<br />
campylopodetosum introflexi und auf besonders skelettreichen Böden das Racomitrio-<br />
Polytrichetum racomitrietosum lanuginosi. Bedingt durch den raschen Wechsel dieser<br />
Bodenverhältnisse stellt sich in der Regel auf dem Haldenplateau ein Mosaik dieser<br />
Subassoziationen ein und mitunter kommt es zur Bildung von Mischbeständen, deren<br />
synsystematische Wertung dann eine Ermessensfrage bleibt. Schließlich soll noch auf die seltene<br />
Campylopus flexuosus-Ausbildung hingewiesen werden, die lokal in einer mit saurem Rohhumus<br />
bedeckten Mulde einer Plateaufläche auftritt.<br />
Aufnahme: Plateaufläche W 5°, Deckung der Kryptogamen 80%, Gehölze 5%.<br />
Kennart der Assoziation: Polytrichum piliferum 2.<br />
Ceratodonto-Polytrichion: Cephaloziella divaricata 1.<br />
Polytrichetalia piliferi: Racomitrium lanuginosum 2.<br />
Ceratodonto-Polytrichetea: Cladonia gracilis 1, C. portentosa +, C. uncialis +, C. coccifera +.<br />
Trennart der Ausbildung: Campylopus flexuosus 4.<br />
Begleiter, Moose: Pohlia nutans 2, Dicranum scoparium +.<br />
Begleiter, Flechten: Cladonia chlorophaea +, C. floerkeana +, C. deformis +, Baeomyces rufus +.<br />
Im weiteren Sukzessionsprozess werden konkurrenzschwache Kryptogamen gänzlich verdrängt,<br />
und es entfaltet sich auf einem schwachen Humushorizont aus dem Racomitrio-Polytrichetum<br />
piliferi racomitrietosum elongati das Racomitrietum elongati (Tab. 3), dessen artenarme, von<br />
Racomitrium elongatum dominierten Bestände nur Dicranum scoparium und wenige Cladonia-<br />
Arten regelmäßig auszeichnen. Neben der auf Kulmschiefer verbreiteten Typischen Var. findet<br />
man im SO-Teil des NSG auf einer Halde aus Knotenkalk die seltene Rhytidium rugosum-Var.<br />
Auf Rohhumus vermittelt das Racomitrio-Polytrichetum piliferi campylopodetosum introflexi zum<br />
Cladonio-Campylopodetum introflexi (Tab. 4), das sich auch gegenwärtig noch in starker<br />
Ausbreitung befindet und insbesondere die Schieferhalden des Schiefergebirges, weiterhin im<br />
Berg- und Hügelland Thüringens Steinbrüche, doch auch humusbedeckte, natürlich waldfreie<br />
Felsköpfe besiedelt.
<strong>Marstaller</strong>: Moosgesellschaften der “Schieferbrüche bei Kolditz” 83<br />
Zu den häufigsten Gesellschaften gehört das Polytrichetum juniperini (Tab. 5). Es ist nicht nur<br />
den weniger trockenen Plateauflächen, sondern auch den luftfrischeren, mäßig beschatteten<br />
Hangflächen der Halden eigen. Sämtliche Vorkommen im NSG gehören mit Dicranum scoparium,<br />
Polytrichum formosum und Ptilidium ciliare zum Polytrichetum juniperini dicranetosum scoparii,<br />
das humusreichere Böden charakterisiert. Das in den oberen, kühleren Lagen des Schiefergebirges<br />
neben dem Racomitrio-Polytrichetum piliferi ebenfalls auf Plateauflächen als Erstbesiedler unter<br />
den Moosgesellschaften eine größere Rolle spielende Polytrichetum juniperini typicum kann sich<br />
am warmen Südhang des Kolditz nicht entfalten.<br />
Nur auf recht mineralkräftigen, feinerdereichen Mineralböden stellt sich lokal das mäßig<br />
azidophytische Brachythecietum albicantis (Tab. 6) ein. Es wird als kurzlebige Gesellschaft<br />
rasch von Gefäßpflanzen verdrängt. Zu den Seltenheiten gehört das Polytrichetum pallidiseti, das<br />
einzig an einer südexponierten Halde am halbschattigen, luftfeuchten Unterhang die mit Humus<br />
bedeckten Lücken zwischen den Blöcken besiedelt. Die montan verbreitete Assoziation gehört in<br />
den unteren, warmen Lagen des Schiefergebirges zu den Seltenheiten und erscheint erst in den<br />
kühleren, höher gelegenen Abschnitten häufiger.<br />
Aufnahme: Bockhügel, Halde am Unterhang S 15°, Deckung Kryptogamen 95%, Gehölze 60%.<br />
Kennart der Assoziation: Polytrichum pallidisetum 4.<br />
Ceratodonto-Polytrichetea: Cladonia subulata +.<br />
Begleiter, Moose: Polytrichum formosum 2, Dicranum scoparium 1, Cynodontium polycarpon +,<br />
Hypnum cupressiforme +.<br />
Begleiter, Flechten: Cladonia chlorophaea +.<br />
Obwohl bereits zu den Flechtengesellschaften gehörend, fallen an besonders trockenen Kanten<br />
einiger Plateauflächen älterer Halden die an Humusböden angewiesenen Bestände des<br />
Cladonietum mitis (Tab. 7) auf, die meist in engem Kontakt zum Cladonio-Pinetum gedeihen. Sie<br />
zeichnen sich durch die Strauchflechten Cladonia arbuscula, C. portentosa, C. gracilis, mitunter<br />
C. mitis und C. rangiferina neben weiteren, unauffälligeren Cladonia-Arten aus, während Moose,<br />
zu denen Dicranum scoparium, D. polysetum, Pohlia nutans und Polytrichum piliferum gehören,<br />
in den Hintergrund treten.<br />
4.2 Eu- bis mesofote saxicole Gesellschaften<br />
Unter den xerophytischen Polstermoosgesellschaften beobachtet man vereinzelt im Bereich der<br />
Halden auf Schieferplatten sowie am anstehenden Gestein der Brüche das ausbreitungsfreudige,<br />
oft Sekundärstandorte besiedelnde Coscinodontetum cribrosi (Tab. 8). Während in den Brüchen<br />
fast nur sehr artenarme Ausbildungen anzutreffen sind, zeichnen sich die Vorkommen am<br />
natürlichen Fels öfters durch Racomitrium heterostichum und Lepraria caesioalba aus. Neben der<br />
verbreiteten Typischen Var. vermittelt auf mineralkräftigerem Schiefer die seltene Schistidium-<br />
Var. bereits zu den basiphytischen Assoziationen des Grimmion tergestinae.<br />
Einzig an einer südexponierten Felsrippe des Bockhügels gedeiht lokal das ebenfalls mineralarme<br />
Silikatgesteine, doch im Gegensatz zum Coscinodontetum meist luftfeuchtere, kühlere Standorte<br />
besiedelnde Grimmietum montanae.<br />
Aufnahme: Schieferfelsen S 45°, 2 dm², Deckung Kryptogamen 40%, Gehölze 50%.<br />
Kennart der Assoziation: Grimmia montana 3.<br />
Grimmion commutatae: Grimmia trichophylla +.
84<br />
Limprichtia 22, 2003<br />
Begleiter, Moose: Cynodontium polycarpon 2.<br />
Begleiter, Flechten: Umbilicaria hirsuta 1, Lepraria caesioalba 1, Lepraria spec. +, Cladonia<br />
chlorophaea +.<br />
Relativ häufig erscheint dagegen auf mäßig beschatteten Halden das Racomitrietum lanuginosi<br />
(Tab. 9). Es stellt sich an Hangflächen direkt auf dem mit Krustenflechten bewachsenen<br />
Schiefergestein ein, entwickelt sich dagegen auf den Plateauflächen oft aus dem Racomitrio-<br />
Polytrichetum piliferi racomitrietosum lanuginosi. Bei optimalem Gedeihen überzieht die<br />
Gesellschaft großflächig das Schiefergestein und die Zwischenräume, doch auch den steinigen<br />
Mineralboden auf den Plateauflächen. Zunächst entfaltet sich das sehr uniforme Racomitrietum<br />
lanuginosi typicum, das erst wenig Humus unter den Moosdecken bildet. Da Racomitrium<br />
lanuginosum sich an steileren Flächen leicht vom Gestein lösen kann, werden nur Horizontal- und<br />
wenig steile Neigungsflächen besiedelt. Mit weiterer Ansammlung von Humus und stärkerer<br />
Beschattung durch Gehölze vermittelt die Typische Subass. zum Racomitrietum lanuginosi<br />
dicranetosum scoparii, das durch Dicranum scoparium und Polytrichum formosum differenziert<br />
ist.<br />
Das Racomitrietum lanuginosi, doch auch das Polytrichetum juniperini, Racomitrietum elongati<br />
und Cladonio-Campylopodetum introflexi werden schließlich mit dem Eindringen von krautigen<br />
Gefäßpflanzen und der zunehmenden Beschattung durch Gehölze von der Pleurozium schreberi-<br />
Synusie abgelöst. Sehr lokal stellt sich im Kolditz an den Rändern von Hangflächen als letzte<br />
eigenständige Gesellschaft der Schieferhalden im Sukzessionsprozess das Pleurozietum<br />
schreberi (Tab. 10) ein, das im NSG in einer artenarmen Ausbildung nur von Pleurozium<br />
schreberi, Dicranum scoparium, mitunter von Polytrichum formosum und Ptilidium ciliare<br />
beherrscht wird. Die Moose liegen bedingt durch den meist gut entwickelten Rohhumushorizont<br />
dem Gestein lose auf, und mit dem Eindringen von Gefäßpflanzen vollzieht sich der Übergang zur<br />
Pleurozium schreberi-Synusie.<br />
4.3 Terricole oligofote bis sciophytische Azidophytengesellschaften<br />
Die an schattige Wälder gebundenen azidophytischen, oft kurzlebigen Erdmoosgesellschaften, die<br />
mehr oder weniger humushaltige Mineralböden besiedeln, gehören infolge der trockenen<br />
bestandesklimatischen Verhältnisse im NSG zu den Seltenheiten. Die nur außerhalb der<br />
Bergbaugebiete an Wegböschungen nachgewiesenen Assoziationen gehören sämtlich zu den für<br />
das Hügelland bezeichnenden Gesellschaften, die in wärmeren Lagen Thüringens in die<br />
Mittelgebirge eindringen. Im Bereich der Hainbuchenwälder gedeiht am Unterhang sehr lokal auf<br />
kalkfreiem, doch mineralkräftigem Lehm das Fissidentetum bryoidis.<br />
Aufnahme: Böschung eines Hohlweges SO 30°, Deckung Kryptogamen 90%, Gehölze 95%.<br />
Kennart der Assoziation: Fissidens bryoides 4.<br />
Dicranellion heteromallae: Dicranella heteromalla 1, Atrichum undulatum +.<br />
Cladonio-Lepidozietea: Plagiothecium denticulatum 1.<br />
Begleiter, Moose: Brachythecium velutinum 2.<br />
Mit der Entwicklung eines Humushorizontes breitet sich Plagiothecium cavifolium aus und<br />
verdrängt den konkurrenzschwachen Fissidens bryoides. Auch das Plagiothecietum cavifolii<br />
gehört in den Mittelgebirgen zu den seltenen Gesellschaften.<br />
Aufnahme: Wegböschung S 45°, Deckung Kryptogamen 95%, Gehölze 90%.
<strong>Marstaller</strong>: Moosgesellschaften der “Schieferbrüche bei Kolditz” 85<br />
Kennart der Assoziation: Plagiothecium cavifolium 5.<br />
Dicranellion heteromallae: Atrichum undulatum 1, Dicranella heteromalla +.<br />
Begleiter, Moose: Brachythecium velutinum 2, Pohlia nutans +.<br />
Zu den bemerkenswerten, auch im Hügelland nur vereinzelt und unbeständig erscheinenden<br />
wärmeliebenden Gesellschaften gehört das für frisch aufgerissene Lehmböden bezeichnende<br />
Pleuridio acuminati-Ditrichetum pallidi, das im NSG im Hainbuchenwald am Rande einer<br />
Wegböschung auftritt.<br />
Aufnahme: Lehmblöße, Horizontalfläche, 1 dm², Deckung Kryptogamen 90%, Gehölze 95%.<br />
Kennart der Assoziation: Ditrichum pallidum 1.<br />
Trennart der Assoziation: Pleuridium acuminatum 3.<br />
Dicranellion heteromallae: Atrichum undulatum 2, Dicranella heteromalla 1.<br />
Cladonio-Lepidozietea: Plagiothecium laetum +.<br />
Begleiter, Moose: Polytrichum formosum 1, Pohlia bornholmense 1.<br />
4.4 Saxicole oligofote bis sciophytische Azidophytengesellschaften<br />
Da es im NSG nur wenige geeignete Standorte gibt, erscheinen die an mineralarmes Gestein und<br />
Makrospalten angewiesenen Moosgesellschaften selten. In den Buchenbeständen im SO-Abschnitt<br />
des NSG hat sich auf kleinen Felsen und Blöcken aus Tonschiefer und Quarzit das für die<br />
montanen Laubwälder typische Grimmietum hartmanii (Tab. 11) in der Ausbildung mit<br />
Paraleucobryum longifolium erhalten. Es gedeiht in der Typischen Var. und der für luft- und<br />
gesteinsfeuchtere Verhältnisse charakteristischen Plagiothecium succulentum-Var.<br />
Darüber hinaus gibt es in den sehr luftfeuchten und kühlen Einsturztrichtern artenarme Bestände<br />
mit Diplophyllum albicans, doch nur selten konnte das Diplophyllo-Scapanietum in typischer<br />
Ausbildung beobachtet werden.<br />
Aufnahme: Steilfläche W 80°, Deckung Kryptogamen 80%, Gehölze 75%.<br />
Kennart der Assoziation: Diplophyllum albicans 3.<br />
Diplophyllion albicantis: Cynodontium polycarpon +.<br />
Cladonio-Lepidozietea: Lophozia silvicola 3, L. excisa 1, Tritomaria exsectiformis 2,<br />
Plagiothecium laetum +.<br />
Begleiter, Moose: Polytrichum formosum +, Dicranum scoparium +, Pohlia nutans +.<br />
Das Makrospalten besiedelnde montane Moos Rhabdoweisia fugax hat sich zwar sekundär an<br />
einem Stolleneingang angesiedelt, dagegen beschränkt sich das für relativ trockene Felsspalten<br />
bezeichnende Rhabdoweisietum fugacis auf einen Schieferfelsen am Südhang des Bockhügels.<br />
Aufnahme: Makrospalte S 90°, Deckung Kryptogamen 80%, Gehölze 50%.<br />
Kennart der Assoziation: Rhabdoweisia fugax 4.<br />
Diplophyllion albicantis: Cynodontium polycarpon 2.<br />
Begleiter, Moose: Pohlia nutans +, Hypnum cupressiforme +.<br />
Begleiter, Flechten: Cladonia chlorophaea +, Lepraria spec. +.
86<br />
Limprichtia 22, 2003<br />
4.5 Terricole basiphytische Gesellschaften<br />
Die basische Mineral- und Humusböden bevorzugenden Gesellschaften beschränken sich im NSG<br />
auf wenige fotophytische Vereine, die sehr kleinflächig im Bereich der Schieferhalden auftreten.<br />
Der auf einer Plateaufläche abgelagerte und bereits verwitterte Kalkmörtel ist vom Tortelletum<br />
inclinatae in der Barbula unguiculata-Subass. besiedelt. Diese an Trockenheit gebundene<br />
Gesellschaft gedeiht im Hügelland auf flachgründigen Rendzinaböden.<br />
Aufnahme: Plateaufläche nahe der Hangkante S 3°, Deckung Kryptogamen 95%, Gehölze 25%.<br />
Kennart der Assoziation: Tortella inclinata 5.<br />
Trennarten der Assoziation: Tortella tortuosa 2, Encalypta streptocarpa +.<br />
Trennart der Subassoziation: Barbula convoluta 2.<br />
Begleiter, Moose: Ceratodon purpureus +. Bryum argenteum +.<br />
Begleiter, Flechten: Collema tenax +, Cladonia chlorophaea +, C. pyxidata +.<br />
Auf der Plateaufläche der untersten Abbausohle im westlichen Abschnitt des NSG hat sich auf<br />
recht mineralkräftigem, basischem Mineralboden eines Weges das für Trittstellen bezeichnende,<br />
weit verbreitete Barbuletum convolutae angesiedelt.<br />
Aufnahme: Horizontalfläche 2 dm², Deckung Kryptogamen 95%, Gehölze 0%.<br />
Kennart der Assoziation: Barbula convoluta 4.<br />
Grimaldion fragrantis: Didymodon vinealis 1, D. ferrugineus 1, Pseudocrossidium<br />
hornschuchianum +.<br />
Barbuletalia unguiculatae: Barbula unguiculata +.<br />
Begleiter, Moose: Bryum caespiticium +, Hypnum cupressiforme +.<br />
Begleiter, Flechten: Cladonia pyxidata 2.<br />
Das im Hügelland bevorzugt an trockenwarme Standorte gebundene Aloinetum rigidae gedeiht<br />
im NSG auf angewittertem Kalkmörtel einer Schiefermauer.<br />
Aufnahme: Fuge einer Schiefermauer S 80°, Deckung Kryptogamen 90%, Gehölze 10%.<br />
Kennart der Assoziation: Aloina rigida 3.<br />
Grimaldion fragrantis: Barbula convoluta 2.<br />
Barbuletalia unguiculatae: Barbula unguiculata +.<br />
Begleiter, Moose: Tortula muralis 3, Bryum pallescens +.<br />
4.6 Basi- bis neutrophytische Epilithen- und Felsspaltengesellschaften<br />
Die an den basisch verwitternden Knotenkalk und Kalkknotenschiefer angewiesenen<br />
Epilithengesellschaften konzentrieren sich am Unterhang auf die anstehenden kleinen Felsen, die<br />
angesprengten Felsen an der Landstraße nach Probstzella und auf den Kalksteinbruch mit seinen<br />
Abraumhalden im SO-Abschnitt des NSG. Das meso- bis oligofote, durch Polstermoose<br />
ausgezeichnete Orthotricho-Grimmietum pulvinatae (Tab. 12, Nr. 1-10) beschränkt sich auf die<br />
Felswände und Kalkblöcke eines seit längerer Zeit stillgelegten Steinbruches, der bereits teilweise<br />
bewaldet ist, darüber hinaus auf eine Betonmauer im NW-Abschnitt des NSG. Dagegen konnte auf<br />
mineralkräftigem Schiefergestein der Halden (Kieskälber) nur die artenärmere Schistidium<br />
robustum-Gesellschaft (Tab. 12, Nr. 11-14), die auf anderen Schieferhalden im Schiefergebirge<br />
viel häufiger zu beobachten ist, nachgewiesen werden (MARSTALLER 2002).
<strong>Marstaller</strong>: Moosgesellschaften der “Schieferbrüche bei Kolditz” 87<br />
Mit zunehmender Beschattung durch Laubgehölze stellt sich auf Knotenkalk, Kalkknotenschiefer<br />
und basischem Schiefergesteinen, die durch den Niederschlag und die Kryptogamenbesiedlung auf<br />
der Oberfläche entkalkt werden, die Hypnum cupressiforme-Gesellschaft (Tab. 13) ein. Sie<br />
zeichnet sich durch die Dominanz von Hypnum cupressiforme aus, darüber hinaus wachsen<br />
Dicranum scoparium, Racomitrium elongatum und Polytrichum formosum in meist mittlerer<br />
Stetigkeit. Die Gesellschaft gliedert sich in die Typische Ausbildung auf mineralreichem Schiefer,<br />
die Rhytidium rugosum-Ausbildung auf Knotenkalk und die an luftfeuchte, schattige Verhältnisse<br />
angewiesene Brachythecium-Ausbildung. Einzig auf einer kleinen Schotterhalde aus Knotenkalk<br />
konnte das basiphytische Abietinelletum abietinae nachgewesen werden.<br />
Aufnahme: Kalkstein S 30°, Deckung Kryptogamen 80%, Gehölze 50%.<br />
Lokale Kennarten: Homalothecium lutescens 3, Rhytidium rugosum 2, Abietinella abietina 1.<br />
Begleiter, Moose: Hypnum lacunosum 2, H. cupressiforme 1, Schistidium crassipilum +.<br />
Südexponierte Felsen aus Knotenkalk und Kalksteine weisen hauptsächlich im Westabschnitt des<br />
NSG, doch auch im Bereich des Kalksteinbruches, das trockenheitsliebende Homomallietum<br />
incurvati (Tab. 14, Nr. 1-11) in repräsentativen Beständen auf. Die unauffällige Gesellschaft<br />
erscheint in den Silikat-Mittelgebirgen nur sehr vereinzelt und hat ihre Hauptverbreitung auf<br />
Kalkstein im Hügelland. Im NSG gedeihen das Homomallietum incurvati typicum und das an<br />
luftfeuchtere Standorte angewiesene, viel seltenere Homomallietum incurvati brachythecietosum<br />
populei, das zum Brachythecietum populei (Tab. 14, Nr. 12-14) vermittelt. Als<br />
Pioniergesellschaft besiedelt diese Assoziation oft lose am Waldboden liegende Steine aus Kalk<br />
oder basischem Silikatgestein. Das an trockenen Vertikalflächen optimal gedeihende<br />
Homalothecio-Porelletum platyphyllae konnte nur mit einem typischen Vorkommen erfasst<br />
werden.<br />
Aufnahme: basischer Schiefer SW 90°, Deckung Kryptogamen 70%, Gehölze 50%.<br />
Neckeretalia complanatae: Homalothecium sericeum 4, Porella platyphylla 2.<br />
Begleiter, Moose: Bryoerythrophyllum recurvirostre +, Encalypta streptocarpa +, Tortula<br />
subulata +.<br />
An halbschattigen, feuchten Neigungsflächen im Kalksteinbruch hat sich die Fissidens<br />
adianthoides-Gesellschaft (Tab. 15) ausgebreitet, die mit Tortella tortuosa und Encalypta<br />
streptocarpa im Artenspektrum Beziehungen zum fugenbesiedelnden Encalypto-Fissidentetum<br />
cristati Neum. 1971 besitzt. Weitere basiphytische Gesellschaften besiedeln die Makrospalten der<br />
angesprengten Devonfelsen an der Straße nach Probstzella. Hier gedeiht auf Mullboden der<br />
trockenen Fugen die Encalypta streptocarpa-Bryoerythrophyllum recurvirostre-Gesellschaft, die<br />
sich hauptsächlich durch mäßig basiphytische bis neutrophytische Moose auszeichnet.<br />
Aufnahme: Fuge SO 70°, Deckung Kryptogamen und Gehölze 90%.<br />
Encalypta streptocarpa 3, Bryoerythrophyllum recurvirostre 4, Tortula subulata +, T. muralis +,<br />
Schistidium crassipilum +, Bryum laevifilum +, Brachythecium velutinum +.<br />
Bei feuchteren Verhältnissen konnte lokal Gymnostomum aeruginosum angetroffen werden. Auf<br />
nassem, kalkinkrustiertem Gestein haben sich einartige Bestände mit Eucladium verticillatum bzw.<br />
Cratoneuron commutatum eingestellt. Von besonderem Interesse ist eine sickernasse Felswand<br />
(GLB) neben der Straße unterhalb von Probstzella, an der Amphidium mougeottii dominiert. Die<br />
Amphidium mougeottii-Gesellschaft (Tab. 16), die sowohl die Spalten und das benachbarte<br />
Gestein überzieht, zeigt mit Fissidens adianthoides, Bryum pseudotriquetrum, Cratoneuron
88<br />
Limprichtia 22, 2003<br />
filicinum und Pellia endiviifolia gewisse Beziehungen zum Cratoneuretum commutati Aichinger<br />
1933.<br />
4.7 Epiphytische Gesellschaften<br />
Epiphytische Moosvereine auf der Borke lebender Bäume trifft man im NSG nur vereinzelt an.<br />
Auf einigen Laubgehölzen mit mineralarmer Borke, vorwiegend Betula pendula, gedeiht im<br />
Bereich der Halden das lichtbedürftige, meso- bis oligofote Dicrano-Hypnetum filiformis (Tab.<br />
17, Nr. 1-10), während bei luftfeuchteren Verhältnissen das im NSG seltenere, oligofote bis<br />
sciophytische Orthodicrano montani-Hypnetum filiformis (Tab. 17, 11-16) vorkommt. An<br />
einem Stammfuß von Carpinus betulus konnte im SO-Abschnitt des NSG das im Hügelland viel<br />
häufigere Platygyrietum repentis (Tab. 17, Nr. 17) nachgewiesen werden<br />
Die basiphytischen Orthotrichetalia-Gesellschaften, die an die mineralkräftige Borke<br />
verschiedener Laubgehölze angewiesen sind, können nur mit wenigen Beispielen ausgewiesen<br />
werden. Auf den Plateauflächen der Halden, doch auch im übrigen NSG, hat sich das im 20.<br />
Jahrhundert durch Schadstoffbelastung der Luft sehr selten gewordene, doch nun wieder in<br />
Ausbreitung befindliche Ulotetum crispae (Tab. 18, Nr. 1-5) eingestellt, das neben Ulota bruchii<br />
auch durch Orthotrichum affine, O. diaphanum, mitunter O. stramineum, O. lyellii, O. speciosum<br />
und Radula complanata ausgezeichnet ist. Einzig am NW-Rand des NSG wächst an einem Stamm<br />
von Malus domestica das nitrophytische, für die offene Kulturlandschaft bezeichnende<br />
Orthotrichetum fallacis (Tab. 18, Nr. 6).<br />
Die Gesellschaften des morschen Holzes finden infolge der trockenen bestandesklimatischen<br />
Verhältnisse des vorwiegend nach Süden exponierten NSG kaum zusagende Wuchsbedingungen.<br />
Bestände des Lophocoleo-Dolichothecetum seligeri und Leucobryo-Tetraphidetum pellucidae<br />
bleiben als Seltenheiten sehr fragmentarisch und untypisch. Einzig das auf weniger saurem Holz<br />
wachsende Brachythecio-Hypnetum cupressiformis zeichnet einen toten Stamm von Betula<br />
pendula auf der Plateaufläche einer Halde aus.<br />
Aufnahme: morscher, noch berindeter Stamm, Horizontalfläche, Deckung Kryptogamen 90%,<br />
Gehölze 70%.<br />
Bryo-Brachythecion: Brachythecium salebrosum 2, B. rutabulum 1 (Trennart).<br />
Cladonio-Lepidozietea: Lophocolea heterophylla +.<br />
Begleiter: Hypnum cupressiforme 4, Dicranum scoparium +, Cladonia chlorophaea +.<br />
4. 8 Synsystematischer Konspekt<br />
In dieser Übersicht sind alle im Gebiet des Kolditz nachgewiesenen Moosgesellschaften sowie der<br />
Flechtengesellschaft Cladonietum mitis in ihrer synsystematischen Stellung ausgewiesen. Die<br />
ausschließlich außerhalb der Schieferhalden und -brüche gedeihenden Gesellschaften wurden<br />
durch Stern (*) gekennzeichnet.<br />
Ceratodonto-Polytrichetea piliferi Mohan 1978<br />
Polytrichetalia piliferi v. Hübschm. 1975<br />
Ceratodonto-Polytrichion piliferi (Waldh. 1947) v. Hübschm. 1967<br />
Racomitrio-Polytrichetum piliferi v. Hübschm. 1967<br />
– typicum
<strong>Marstaller</strong>: Moosgesellschaften der “Schieferbrüche bei Kolditz” 89<br />
– racomitrietosum elongati Marst. 1989<br />
– campylopodetosum introflexi Marst. 1989<br />
– racomitrietosum lanuginosi (Marst. 1986) Marst. 2002<br />
Racomitrietum elongati Marst. 2002<br />
Cladonio gracilis-Campylopodetum introflexi Marst. 2001<br />
Polytrichetum juniperini v. Krus. 1945<br />
– dicranetosum scoparii v. Krus. 1945<br />
Brachythecietum albicantis Gams ex Neum. 1971<br />
Polytrichetum pallidiseti Marst. 2002 (synsystematische Stellung unsicher)<br />
Racomitrion lanuginosi v. Krus. 1945<br />
Racomitrietum lanuginosi v. Krus. 1945<br />
– typicum<br />
– dicranetosum scoparii Marst. 1986<br />
Peltigeretalia Klement 1950<br />
Cladonion sylvaticae Klement 1950<br />
Cladonietum mitis Krieger 1937<br />
Racomitrietea heterostichi Neum. 1971<br />
Grimmietalia commutatae Šm. et Van. in Kl. et Had. ex Šm. 1947<br />
Grimmion commutatae v. Krus. 1945<br />
Coscinodontetum cribrosi v. Hübschm. 1955<br />
Grimmietum montanae Marst. 1984*<br />
Hylocomietea splendentis Gillet ex Marst. 1993<br />
Hylocomietalia splendentis Gillet ex Marst. 1993<br />
Pleurozion schreberi v. Krus. 1945<br />
Pleurozietum schreberi Wiśn. 1930<br />
Cladonio-Lepidozietea reptantis Jež. et Vondr. 1962<br />
Grimmietalia hartmanii Phil. 1956<br />
Grimmio hartmanii-Hypnion cupressiformis Phil. 1956<br />
Grimmietum hartmanii Størm. 1938*<br />
Diplophylletalia albicantis Phil. 1963<br />
Diplophyllion albicantis Phil. 1956<br />
Diplophyllo-Scapanietum Šm. 1947<br />
Rhabdoweisietum fugacis Gams ex Neum. 1971<br />
Dicranellion heteromallae (Phil. 1956) Phil. 1963<br />
Fissidentetum bryoidis Phil. ex Marst. 1983*<br />
Plagiothecietum cavifolii Marst. 1984*<br />
Pleuridio acuminati-Ditrichetum pallidi Gillet ex Marst. 1991*<br />
Dicranetalia scoparii Barkm. 1958<br />
Dicrano scoparii-Hypnion filiformis Barkm. 1958<br />
Dicrano scoparii-Hypnetum filiformis Barkm. 1958<br />
Orthodicrano montani-Hypnetum filiformis Wiśn. 1930<br />
Platygyrietum repentis Le Blanc 1963*<br />
Brachythecietalia rutabulo-salebrosi Marst. 1987<br />
Bryo-Brachythecion Lec. 1975<br />
Brachythecio-Hypnetum cupressiformis Nörr 1969<br />
Cladonio-Lepidozietalia reptantis Jež. et Vondr. 1962<br />
Nowellion curvifoliae Phil. 1965
90<br />
Limprichtia 22, 2003<br />
Lophocoleo-Dolichothecetum seligeri Phil. 1965*<br />
Tetraphidion pellucidae v. Krus. 1945<br />
Leucobryo-Tetraphidetum pellucidae Barkm. 1958*<br />
Psoretea decipientis Matt. ex Follm. 1974<br />
Barbuletalia unguiculatae v. Hübschm. 1960<br />
Grimaldion fragrantis Šm. et Had. 1944<br />
Tortelletum inclinatae Stod. 1937<br />
– barbuletosum convolutae Marst. 1983<br />
Barbuletum convolutae Had. et Šm. 1944<br />
Aloinetum rigidae Stod. 1937<br />
Grimmietea anodontis Had. et Vondr. in Jež. et Vondr. 1962<br />
Grimmietalia anodontis Šm. 1947<br />
Grimmion tergestinae Šm. 1947<br />
Orthotricho-Grimmietum pulvinatae Stod. 1937*<br />
Schistidium robustum-Gesellschaft<br />
Pleurochaeto-Abietinelletea abietinae Marst. 2002<br />
Pleurochaeto-Abietinelletalia abietinae Marst. 2002<br />
Abietinellion abietinae Giac. ex Neum. 1971<br />
Abietinelletum abietinae Stod. 1937*<br />
Ctenidietea mollusci v. Hübschm. ex Grgić 1980<br />
Ctenidietalia mollusci Had. et Šm. in Kl. et Had. 1944<br />
Ctenidion mollusci Ştef. 1941<br />
Fissidens adianthoides-Gesellschaft*<br />
Neckeretea complanatae Marst. 1986<br />
Neckeretalia complanatae Jež. et Vondr. 1962<br />
Neckerion complanatae Šm. et Had. in Kl. et Had. 1944<br />
Homomallietum incurvati Phil. 1965*<br />
– typicum<br />
– brachythecietosum populei Marst. 1991<br />
Brachythecietum populei Phil. 1972*<br />
Homalothecio-Porelletum platyphyllae Størm. 1938*<br />
Frullanio dilatatae-Leucodontetea sciuroidis Mohan 1978<br />
Orthotrichetalia Had. in Kl. et Had. 1944<br />
Ulotion crispae Barkm. 1958<br />
Ulotetum crispae Ochsn. 1928<br />
Syntrichion laevipilae Ochsn. 1928<br />
Orthotrichetum fallacis v. Krus. 1945*<br />
Unbestimmter Anschluß<br />
Hypnum cupressiforme-Gesellschaft<br />
Encalypta streptocarpa-Bryoerythrophyllum recurvirostre-Gesellschaft*<br />
Amphidium mougeottii-Gesellschaft*
<strong>Marstaller</strong>: Moosgesellschaften der “Schieferbrüche bei Kolditz” 91<br />
5. Moosflora<br />
Bedingt durch die Vielfalt recht unterschiedlicher Standorte gehört das NSG hinsichtlich der<br />
Moosflora zu den besonders reich ausgestatteten Gebieten, das freilich bisher in der<br />
bryofloristischen Literatur unberücksichtigt blieb. Einige für das Thüringer Schiefergebirge und<br />
den angrenzenden Frankenwald bzw. für ganz Thüringen seltene Arten zeichnen den Kolditz aus,<br />
zu denen insbesondere die Laubmoose Polytrichum pallidisetum, Fissidens viridulus, Dicranum<br />
spurium, Ditrichum pallidum, Tortella bambergeri, Aloina rigida, Schistidium dupretii, S.<br />
pruinosum, Bryum gemmiferum, B. bornholmense, Philonotis calcarea Orthotrichum lyellii und<br />
Hypnum mammillatum gehören. Insgesamt konnten 195 Moosarten (25 Lebermoose, 170<br />
Laubmoose) nachgewiesen werden. In der folgenden Artenliste bedeuten Stern*: nur außerhalb der<br />
Schieferhalden und -brüche vorkommend, Stern eingeklammert (*): nur auf Knotenkalk und<br />
Kalkknotenschiefer vorhanden, Kreuz +: ausschließlich im Gebiet der Schieferhalden und -brüche,<br />
(+): Beton und aufgeschotterte Wege außerhalb der Halden und Brüche besiedelnd. Die sehr<br />
seltenen, nur 1- bis 2-mal nachgewiesenen Arten sind durch Ausrufezeichen (!) markiert.<br />
Hepaticae: 1. + ! Riccia sorocarpa Bisch. – 2. (*) Pellia endiviifolia (Dicks.) Dum. – 3. ! *P.<br />
epiphylla (L.) Corda – 4. (+) ! Fossombronia wondraczekii (Corda) Lindb. – 5. *Bazzania<br />
trilobata (L.) S. F. Gray – 6. Lepidozia reptans (L.) Dum. – 7. Calypogeia muelleriana (Schiffn.)<br />
K. Müll. – 8. Cephalozia bicuspidata (L.) Dum. – 9. Cephaloziella divaricata (Sm.) Schiffn. – 10.<br />
*C. hampeana (Nees) Schiffn. – 11. + Gymnocolea inflata (Huds.) Dum. – 12. + Lophozia<br />
silvicola Buch – 13. + ! L. excisa (Dicks.) Dum. – 14. + ! Tritomaria exsectiformis (Breidl.)<br />
Loeske – 15. + Nardia geoscyphus (De Not.) Lindb. – 16. (+) Jungermannia gracillima Sm. – 17.<br />
Diplophyllum albicans (L.) Dum. – 18. + Scapania nemorea (L.) Grolle – 19. Lophocolea<br />
bidentata (L.) Dum. – 20. ! (*) L. minor Nees – 21. L. heterophylla (Schrad.) Dum. – 22. ! Radula<br />
complanata (L.) Dum. – 23. Ptilidium ciliare (L.) Hampe – 24. P. pulcherrimum (G. Web.) Vainio<br />
– 25. ! (*) Porella platyphylla (L.) Pfeiff.<br />
Musci: 26. + ! Sphagnum palustre L. – 27. S. capillifolium (Ehrh.) Hedw. – 28. ! *S. russowii<br />
Warnst. – 29. + ! S. girgensohnii Russ. – 30. + ! S. squarrosum Crome – 31. Atrichum undulatum<br />
(Hedw.) P. Beauv. – 32. Polytrichum commune Hedw. – 33. P. formosum Hedw. – 34. P.<br />
juniperinum Hedw. – 35. P. piliferum Hedw. – 36 + ! P. pallidisetum Funck – 37. (+) Pogonatum<br />
urnigerum (Hedw.) P. Beauv. – 38. ! *P. aloides (Hedw.) P. Beauv. – 39. Tetraphis pellucida<br />
Hedw. – 40. *Fissidens taxifolius Hedw. – 41. (*) F. dubius P. Beauv. – 42. (*) F. adianthoides<br />
Hedw. – 43. ! *F. bryoides Hedw. – 44. ! (*) F. viridulus (Sw.) Wahlenb. – 45. Ceratodon<br />
purpureus (Hedw.) Brid. – 46. ! *Ditrichum pallidum (Hedw.) Hampe – 47.(+) D. heteromallum<br />
(Hedw.) Britt. – 48. *D. cylindricum (Hedw.) Grout – 49 ! *Pleuridium acuminatum Lindb. – 50.<br />
Dicranum polysetum Sw. – 51. D. spurium Hedw. – 52. D. scoparium Hedw. – 53. ! + D. tauricum<br />
Sap. – 54. Orthodicranum montanum (Hedw.) Loeske – 55. Dicranoweisia cirrata (Hedw.) Lindb.<br />
– 56. Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. – 57. ! + D. cerviculata (Hedw.) Schimp. – 58. (+)<br />
D. varia (Hedw.) Schimp. – 59. ! (+) D. rufescens (With.) Schimp. – 60. Cynodontium polycarpon<br />
(Hedw.) Schimp. – 61.! Rhabdoweisia fugax (Hedw.) B.S.G. – 62. + ! Campylopus flexuosus<br />
(Hedw.) Brid. – 63. C. introflexus (Hedw.) Brid. – 64. *Paraleucobryum longifolium (Hedw.)<br />
Loeske – 65. *Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr. – 66. ! (*) Encalypta vulgaris Hedw. – 67.<br />
E. streptocarpa Hedw. – 68. Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. – 69. ! + T. inclinata (Hedw.. f.)<br />
Jenn. – 70. ! (*) T. bambergeri (Schimp.) Broth. – 71. (*) Weissia controversa Hedw. – 72. (*) W.<br />
brachycarpa (Nees & Hornsch.) C. Müll. – 73. ! *W. longifolia Mitt. – 74. ! + Aloina rigida<br />
(Hedw.) Limpr. – 75. *Phascum cuspidatum Hedw. – 76. (+) Pottia truncata (Hedw.) B.S.G. – 77.<br />
Tortula subulata Hedw. – 78. T. ruralis (Hedw.) Gaertn., Meyer & Scherb. – 79. T. muralis Hedw.<br />
– 80. (*) Eucladium verticillatum (Brid.) B.S.G. – 81. ! (*) Gymnostomum aeruginosum Sm. – 82.<br />
Pseudocrossidium hornschuchianum (K. F. Schultz) Zander (nur auf Trittstellen) – 83. Barbula
92<br />
Limprichtia 22, 2003<br />
unguiculata Hedw. – 84. B. convoluta Hedw. (nur auf Trittstellen) – 85. (*) Didymodon fallax<br />
(Hedw.) Zander – 86. ! (*) D. vinealis (Brid.) Zander – 87. (*) D. insulanus (De Not.) M. Hill –<br />
88. (*) D. ferrugineus (Schimp. ex Besch.) M. Hill – 89. ! (*) D. spadiceus (Mitt.) Limpr. – 90. !<br />
(*) D. rigidulus Hedw. – 91. Bryoerythrophyllum recurvirostre (Hedw.) Chen – 92. +<br />
Racomitrium elongatum Frisv. – 93. + R. lanuginosum (Hedw.) Brid. – 94. R. heterostichum<br />
(Hedw.) Brid. – 95. Coscinodon cribrosus (Hedw.) Spruce – 96. Schistidium crassipilum Blom –<br />
97. S. apocarpum (Hedw.) Bruch & Schimp. – 98. + S. papillosum Culm – 99. ! (*) S. pruinosum<br />
(Wils. ex Schimp.) Roth – 100. S. robustum (Nees & Hornsch.) Blom – 101 ! + S. dupretii (Thér.)<br />
W. A. Weber – 102. ! + S. trichodon (Brid.) Poelt – 103. Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. – 104. !<br />
*G. montana B.S.G. – 105. ! *G. trichophylla Grev. – 106. Funaria hygrometrica Hedw. – 107.<br />
Orthodontium lineare Schwaegr. – 108. Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. – 109. (+) P. wahlenbergii<br />
(Web. & Mohr) Andr. – 110. *P. lutescens (Limpr.) Lindb. – 111. (+) P. annotina (Hedw.) Loeske<br />
– 112. Bryum argenteum Hedw. – 113. B. caespiticium Hedw. – 114. B. pseudotriquetrum (Hedw.)<br />
Schwaegr. – 115. B. pallescens Schleich. ex Schwaegr. – 116. B. laevifilum Syed – 117. B.<br />
capillare Hedw. – 118. (+) B. bicolor Dicks. s. str. – 119. (+) B. barnesii Wood ex Schimp. – 120.<br />
! + B. gemmiferum Wilcz. & Demar. – 121. ! *B. bornholmense Winkelm. & Ruthe – 122.<br />
Plagiomnium undulatum (Hedw.) T. Kop. – 123. *P. cuspidatum (Hedw.) T. Kop. – 124. P. affine<br />
(Bland.) T. Kop. – 125. ! (*) P. rostratum (Schrad.) T. Kop. – 126. Rhizomnium punctatum<br />
(Hedw.) T. Kop. – 127. Mnium hornum Hedw. – 128. ! (*) Philonotis calcarea (B.S.G.) Schimp. –<br />
129. ! *Ph. fontana (Hedw.) Brid. – 130. Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schwaegr. – 131. !<br />
*Amphidium mougeottii (B.S.G.) Schimp. – 132. Ulota bruchii Hornsch. ex Brid. – 133. (*) (+)<br />
Orthotrichum anomalum Hedw. – 134.! (*) O. cupulatum Brid. – 135. O. diaphanum Brid. – 136. !<br />
O. lyellii Hook & Tayl. – 137. ! + O. stramineum Hornsch. ex Brid. – 138. O. affine Brid. – 139.<br />
O. pumilum Sw. – 140. ! + O. speciosum Nees – 141. Climacium dendroides (Hedw.) Web. &<br />
Mohr – 142. ! + Anomodon attenuatus (Hedw.) Hüb. (an Acer pseudoplatanus, Stammfuß) – 143.<br />
(*) Abietinella abietina (Hedw.) Fleisch. – 144. ! *Thuidium tamariscinum (Hedw.) B.S.G. – 145.<br />
*T. philibertii Limpr. – 146. (*) Cratoneuron commutatum (Hedw.) Roth – 147. (*) C. filicinum<br />
(Hedw.) Spruce – 148. *Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske – 149. (*) Campylium<br />
chrysophyllum (Brid.) J. Lange – 150. ! (*) C. calcareum Crundw. & Nyh. – 151. (*) C. stellatum<br />
(Hedw.) J. Lange & C. Jens. var. protensum (Brid.) C. Jens. – 152. ! (*) Hygrohypnum luridum<br />
(Hedw.) Jenn. – 153. Drepanocladus uncinatus (Hedw.) Warnst. – 154. Amblystegium serpens<br />
(Hedw.) B.S.G. – 155. *A. juratzkanum Schimp. – 156. (*) Homalothecium sericeum (Hedw.)<br />
B.S.G. – 157. ! (*) H. lutescens (Hedw.) Robins. – 158. Brachythecium albicans (Hedw.) B.S.G. –<br />
159. B. rutabulum (Hedw.) B.S.G. – 160. *B. rivulare B.S.G. – 161. B. salebrosum (Web. &<br />
Mohr) B.S.G. – 162. (*) B. populeum (Hedw.) B.S.G. – 163. B. velutinum (Hedw.) B.S.G. – 164.<br />
(*) B. glareosum (Spruce) B.S.G. – 165. ! + B. oedipodium (Mitt.) Jaeg. – 166. Eurhynchium<br />
striatum (Hedw.) Schimp. – 167. E. angustirete Broth. – 168. *E. hians (Hedw.) Lac. – 169. *E.<br />
praelongum (Hedw.) B.S.G. – 170. Scleropodium purum (Hedw.) Limpr. – 171. *Cirriphyllum<br />
piliferum (Hedw.) Grout – 172. (*) Rhynchostegium murale (Hedw.) B.S.G. – 173 ! *R.<br />
riparioides (Hedw.) Card. – 174. Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. – 175. ! (*) Entodon<br />
concinnus (De Not.) Par. – 176. (*) Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb. – 177.<br />
Pseudotaxiphyllum elegans (Brid.) Iwats. – 178. Herzogiella seligeri (Brid.) Iwats. – 179.<br />
Plagiothecium laetum B.S.G. – 180. P. curvifolium Schlieph. ex Limpr. – 181. P. denticulatum<br />
(Hedw.) B.S.G. – 182. *P. succulentum (Wils.) Lindb. – 183. *P. cavifolium (Brid.) Iwats. – 184. !<br />
(*) Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. – 185. (*) Homomallium incurvatum (Brid.) Loeske –<br />
186. ! Platygyrium repens (Brid.) B.S.G. – 187. Hypnum jutlandicum Holmen & Warncke – 188. !<br />
(*) H. lacunosum – 189. H. cupressiforme Hedw. – 190. (+) H. lindbergii Mitt. – 191. ! *H.<br />
mammillatum (Brid.) Loeske – 192. Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. – 193. R. loreus<br />
(Hedw.) Warnst. – 194. ! + R. triquetrus (Hedw.) Warnst. – 195. Hylocomium splendens (Hedw.)<br />
B.S.G.
<strong>Marstaller</strong>: Moosgesellschaften der “Schieferbrüche bei Kolditz” 93<br />
6. Bryogeographische Situation<br />
Da das Gebiet des Kolditz zum relativ trockenen, thermisch bevorzugten Leeabschnitt des<br />
Schiefergebirges gehört, werden vorwiegend an den südexponierten Hängen die an Wärme und<br />
Trockenheit gebundenen Arten begünstigt. So fallen bereits unter den Gefäßpflanzen die für<br />
warme Standorte des Hügellandes und auch der größeren Mittelgebirgstäler bezeichnenden<br />
Holzgewächse Rubus tomentosus, Cornus sanguinea, Lembotropis nigricans sowie die Kräuter<br />
Digitalis grandiflora, Campanula persicifolia, Genista tinctoria, Origanum vulgare, Erysimum<br />
crepidifolium und Sedum telephium auf.<br />
Unter den Bryophyten haben sich vorwiegend im Bereich der Sekundärstandorte etliche<br />
wärmeliebende oder doch wenigstens für xerophytische Gefäßpflanzengesellschaften<br />
bezeichnende Arten eingestellt. Zu ihnen gehören die meridionalen Laubmoose Fissidens<br />
viridulus, Ditrichum pallidum, Eucladium verticillatum, Encalypta vulgaris und Didymodon<br />
vinealis, weiterhin die atlantisch-mediterranen Vertreter Didymodon insulanus und<br />
Pseudocrossidium hornschuchianum. Innerhalb der für die Kalkmagerrasen des Hügellandes bzw.<br />
überhaupt für trockenwarme Standorte charakteristischen Moose sind für den Kolditz Rhytidium<br />
rugosum, Homalothecium lutescens, Abietinella abietina, Entodon concinnus, Weissia<br />
brachycarpa, W. longifolia, Aloina rigida, darüber hinaus Anomodon attenuatus und Schistidium<br />
pruinosum hervorzuheben.<br />
Da das NSG einen thermisch begünstigten, überwiegend südexponierten Hang umfasst, kann das<br />
Arealtypenspektrum nicht für diesen Abschnitt des Schiefergebirges repräsentativ sein, denn<br />
bereits an dem gegenüber liegenden Nordhang des Bocksberges bei Probstzella kommen weitere<br />
montane Moose vor, die dem Kolditz fehlen. Der hohe Anteil des temperaten Florenelementes ist<br />
ein bezeichnendes Merkmal für das Hügelland und auch die relativ geringe Zahl montaner<br />
Vertreter mit 17,1% ist durchaus für die höheren Lagen der kollinen Stufe charakteristisch. Unter<br />
den montanen Moosen sind insbesondere boreal-montane Vertreter hervorzuheben, von denen<br />
freilich nur Cynodontium polycarpon, Coscinodon cribrosus und Racomitrium lanuginosum<br />
häufiger vorkommen. Dagegen gehören die Lebermoose Lophozia excisa, L. silvicola und<br />
Tritomaria quinquedentata, weiterhin die Torfmoose Sphagnum girgensohnii und S. russowii<br />
sowie die Laubmoose Pogonatum urnigerum, Polytrichum pallidisetum, Rhabdoweisia fugax,<br />
Ditrichum heteromallum, Gymnostomum aeruginosum und Schistidium dupretii fast ausnahmslos<br />
zu den Seltenheiten. Auch die an hohe Luftfeuchte gebundenen ozeanischen Arten erscheinen<br />
überwiegend sehr lokal, bleiben zum Teil an die kühlfeuchten Einsturztrichter oder Quellstellen<br />
gebunden. Nur die Neophyten Campylopus introflexus und Orthodontium lineare, außerdem<br />
Mnium hornum, Pseudotaxiphyllum elegans und Hypnum jutlandicum beobachtet man häufiger.<br />
Insgesamt konnte auf der Basis der bryogeographischen Angaben in DÜLL (1983, 1984/85) für den<br />
Kolditz folgendes Arealtypenspektrum ermittelt werden: boreal 15,9% (davon 7,9% montan),<br />
subboreal 14,9% (davon 1,0% montan), temperat 49,7% (davon 4,1% montan, 3,1% westlich,<br />
2,6% östlich), ozeanisch 15,4% (davon 4,1% montan), meridional 4,1% (davon 1,5% atlantischmediterran).
94<br />
Limprichtia 22, 2003<br />
7. Literatur<br />
BLOM, H. H. 1996: A revision of the Schistidium apocarpum complex in Norway and Sweden. –<br />
Bryophytorum Bibliotheca 49, Berlin, Stuttgart: Cramer.<br />
DÜLL, R. 1983: Distribution of the European and Macaronesian Liverworts (Hepaticophytina. –<br />
Bryol. Beitr. 2: 1-115.<br />
DÜLL, R. 1984/85: Distribution of the European and Macaronesian Mosses (Bryophytina). –<br />
Bryol. Beitr. 4, 5: 1-232.<br />
FREY, W., FRAHM, J.-P., FISCHER, E. & LOBIN, W.: Die Moos- und Farnpflanzen Europas. – In:<br />
GAMS, H.: Kleine Kryptogamenflora Bd. 4, Stuttgart, Jena, New York: Fischer.<br />
GOLDSCHMIDT, B. 1993: Sukzession auf Schieferhalden. Vegetation, Standortbedingungen und<br />
Sukzession auf Abraumhalden des Schieferbergbaus im Thüringisch-fränkischen<br />
Schiefergebirge. – Diplomarbeit, Mskr., Bayreuth.<br />
GÖRNER, M. 1991: Naturschutzgebiet „Schieferbrüche am Kolditz“. In: Übersicht über die<br />
Naturschutzgebiete, Biosphärenreservate, Schongebiete und Naturparke Thüringens sowie<br />
über die Naturschutzgebiete des angrenzenden Raumes in Niedersachsen, Hessen und<br />
Bayern (Stand: 30. 9. 1990). – Naturschutzreport 2/3: S. 164-166<br />
HIRSCH, G. 1993: Schutzwürdigkeitsgutachten über das einstweilig gesicherte Naturschutzgebiet<br />
„Schieferbrüche am Kolditz“ (Landkreis Saalfeld). – Mskr., Jena.<br />
Klimatologische Normalwerte für das Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik (1901-<br />
1950). – Berlin: Akademie, 1955, 1961.<br />
LIEDTKE, H. 1994: Namen und Abgrenzung von Landschaften in der Bundesrepublik Deutschland.<br />
– Trier: Zentralausschuß für Dt. Landeskunde.<br />
MARSTALLER, R. 1993: Synsystematische Übersicht über die Moosgesellschaften Zentraleuropas.<br />
– Herzogia 9: 513-541.<br />
MARSTALLER, R. 2002: Moosgesellschaften der Schieferhalden im Thüringer Schiefergebirge und<br />
Frankenwald. – Feddes Repert. 113, im Druck.<br />
SCHULTZE, J. H. 1955: Die Naturbedingten Landschaften der Deutschen Demokratischen<br />
Republik. – Gotha: Geograph.-Kartograph. Anstalt.<br />
WIRTH, V. 1995: Flechtenflora, 2. Aufl. – Stuttgart: Ulmer.<br />
Anschrift des Verfassers:<br />
Dr. Rolf <strong>Marstaller</strong><br />
Distelweg 9<br />
D-07745 Jena
<strong>Marstaller</strong>: Moosgesellschaften der “Schieferbrüche bei Kolditz” 95
96<br />
Limprichtia 22, 2003
<strong>Marstaller</strong>: Moosgesellschaften der “Schieferbrüche bei Kolditz” 97<br />
Tabelle 3: Racomitrietum elongati Marst. 2002<br />
Aufnahme Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13<br />
Exposition S SW . . . SW SW . . SW S W W<br />
Neigung in Grad 5 10 . . . 5 2 . . 10 10 10 15<br />
Deckung Kryptogamen % 99 98 99 98 99 99 99 99 99 95 99 98 98<br />
Deckung Gehölze % 50 40 40 50 30 50 40 40 40 20 50 45 45<br />
Kennart der Assoziation:<br />
Racomitrium elongatum 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5<br />
Ceratodonto-Polytrichion:<br />
Polytrichum juniperinum . . . . . . 2 . . . . . .<br />
Cephaloziella divaricata . . . . . . . . . 1 . . .<br />
Campylopus introflexus . . . . . . . + . . . . .<br />
Ceratodon purpureus . . . . . . . . . . . + .<br />
Ceratodonto-Polytrichetea:<br />
Cladonia gracilis . 1 2 1 2 1 + 2 1 2 + . .<br />
Cladonia portentosa . . . + + + + . 1 . . . .<br />
Cladonia arbuscula . . . . 1 . . + 1 1 1 . .<br />
Cladonia furcata + + . + . . . . . . . . .<br />
Cladonia uncialis . . + . . + . . + . . . .<br />
Cladonia rangiferina . . . . + . . . + . . . .<br />
Trennarten der Var.:<br />
Rhytidium rugosum . . . . . . . . . . . + 1<br />
Hypnum cupressiforme . . . . . . . . . . . 2 2<br />
Begleiter, Moose:<br />
Dicranum scoparium + . 2 1 + + + + + 2 + 1 +<br />
Pohlia nutans . + . 1 . . . + . 2 . . .<br />
Polytrichum formosum . . . 2 . . . . . . . 1 +<br />
Begleiter, Flechten:<br />
Cladonia chlorophaea . . + + . . . . + + . + +<br />
Cladonia floerkeana . . + . . . . . . + . . .<br />
Nr. 1-11: Typische Var., Nr. 12-13: Rhytidium rugosum-Var.<br />
Zusätzliche Arten: Nr. 2: Racomitrium heterostichum +. Nr. 4: Pleurozium schreberi +. Nr. 5:<br />
Racomitrium lanuginosum 1. Nr. 10: Cladonia coccifera 1. Nr. 11: Dicranum polysetum 2. Nr. 12:<br />
Cynodontium polycarpon +.
98<br />
Limprichtia 22, 2003<br />
Tabelle 4: Cladonio-Campylopodetum introflexi Marst. 2001<br />
Aufnahme Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20<br />
Exposition . . . . . . S . . . . . . . . . S N . W<br />
Neigung in Grad . . . . . . 15 . . . . . . . . . 30 3 . 20<br />
Deckung Kryptogamen % 95 98 95 90 95 98 90 99 95 95 98 99 98 95 95 99 95 90 95 85<br />
Deckung Gehölze % 25 30 25 30 50 40 30 40 15 20 20 15 25 15 30 50 30 . 25 50<br />
Kennart der Assoziation:<br />
Campylopus introflexus 4 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3<br />
Ceratodonto-Polytrichion:<br />
Cephaloziella divaricata 1 . . + . . . . . + . . . . . . . + . .<br />
Racomitrium elongatum . + . . . . . . + . . . . . . . . . . .<br />
Polytrichetalia piliferi:<br />
Racomitrium lanuginosum 1 1 1 + 2 1 + 1 . . . . . . . . . . . .<br />
Ceratodonto-Polytrichetea:<br />
Cladonia gracilis + + 2 + . + 2 + . . . 1 . + 1 1 1 1 1 +<br />
Cladonia subulata + . . + . . . . . + . . + + . . + + + +<br />
Cladonia arbuscula . . 2 + . + . + + . . . . . + 1 . . 2 .<br />
Cladonia portentosa . + + . . + . . . . . . . . . r . . + .<br />
Cladonia furcata 1 1 . . . . . . . + . . . + . . . . . .<br />
Cladonia coccifera . . . + . + . . . . . . . . . + . + . .<br />
Cladonia uncialis . . . . . . . r . . . . . . . + . . + .<br />
Cladonia rangiferina . . . . . . . . + . . . . . . . . . 1 .<br />
Cetraria aculeata . + . . . + . . . . . . . . . . . . . .<br />
Begleiter, Moose:<br />
Pohlia nutans 2 + . 2 . . 1 . . . + + 2 + + . 2 + + 2<br />
Dicranum scoparium + 1 + + . + 3 . . . . . . . . 1 + + + 2<br />
Polytrichum formosum . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1 +<br />
Begleiter, Flechten:<br />
Cladonia chlorophaea + . . 1 . . 2 + . 1 + . + . . . + + 1 +<br />
Cladonia floerkeana . . . + . . . . . . . . . . . + . . + .<br />
Cladonia macilenta . . . . . . . . r . . . . . . . . + . +<br />
Cladonia fimbriata . . . + . . . . + . . . . . . . . . . .<br />
Zusätzliche Arten: Nr. 7: Hypnum cupressiforme +. Nr. 9: Pycnothela papillaria +. Nr. 18:<br />
Cladonia pleurota +, Stereocaulon dactylophyllum +. Nr. 19: Cetraria islandica +. Nr. 20:<br />
Dicranum polysetum 1, Dicranum spurium +.
<strong>Marstaller</strong>: Moosgesellschaften der “Schieferbrüche bei Kolditz” 99<br />
Tabelle 5: Polytrichetum juniperini v. Krus. 1945<br />
Aufnahme Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />
Exposition NW NW NO N . S N S S S S S SW SW O SW<br />
Neigung in Grad 10 15 30 10 . 20 10 10 5 5 20 20 10 10 5 20<br />
Deckung Kryptogamen % 99 99 99 98 99 95 98 95 99 95 90 90 95 95 99 85<br />
Deckung Gehölze % 60 50 25 40 20 40 60 60 35 35 50 50 45 40 50 40<br />
Kennart der Assoziation:<br />
Polytrichum juniperinum 3 3 3 4 5 3 3 2 3 3 5 2 3 3 3 3<br />
Ceratodonto-Polytrichion:<br />
Racomitrium elongatum . . . . + . . . . . . 1 . . + .<br />
Ceratodonto-Polytrichetea:<br />
Cladonia gracilis . . + + 1 . 1 + + 2 + + . . . +<br />
Cladonia subulata . . + + . + + + . + . . + 1 + +<br />
Cladonia furcata + . + + . . . . . . . 1 + . + .<br />
Cladonia arbuscula . . 1 . 2 . + . . . . . . . . .<br />
Trennarten der Subass.:<br />
Dicranum scoparium 4 3 4 2 + 1 2 4 2 3 + 2 3 3 3 1<br />
Polytrichum formosum 2 2 + 2 . 2 4 1 2 2 + 4 2 1 . 3<br />
Pleurozium schreberi + + + . + . . . . . . + + . 1 .<br />
Ptilidium ciliare . 2 . . . . 2 . 3 1 . . . 2 2 .<br />
Begleiter, Moose:<br />
Pohlia nutans . . . . . 3 . 2 + + . . 1 1 1 1<br />
Hypnum cupressiforme . . . . . . . . . + . + + + . .<br />
Cynodontium polycarpon . . . . . + . . . + + . . . . .<br />
Dicranum polysetum . . . + . . . . . . . + . . . .<br />
Begleiter, Flechten:<br />
Cladonia chlorophaea . . + + . + . . + + + . . + . .<br />
Cladonia squamosa . . + . . + . . . . . . . + . .<br />
Cladonia deformis . . . . . + . . . . + . . . . .<br />
Zusätzliche Arten: Spalte 5: Cladonia portentosa +, C. rangiferina +. Nr. 6: Cladonia floerkeana<br />
+. Nr. 8: Cladonia coccifera 1, C. cervicornis ssp. verticillata +.Nr. 9: Cladonia coniocraea +,<br />
Parmelia saxatilis +. Nr. 13: Plagiothecium curvifolium +. Nr. 14: Cladonia uncialis +.
100<br />
Limprichtia 22, 2003<br />
Tabelle 6: Brachythecietum albicantis Gams ex Neum. 1971<br />
Aufnahme Nr. 1 2 3 4 5<br />
Exposition S . . . .<br />
Neigung in Grad 15 . . . .<br />
Deckung Kryptogamen % 98 80 95 95 95<br />
Deckung Gehölze % 70 . 10 . .<br />
Kennart der Assoziation:<br />
Brachythecium albicans 4 4 4 3 2<br />
Ceratodonto-Polytrichion:<br />
Ceratodon purpureus 1 2 + 2 4<br />
Racomitrium elongatum . 2 2 3 +<br />
Cephaloziella divaricata . 2 1 + +<br />
Polytrichum piliferum . . . . +<br />
Ceratodonto-Polytrichetea:<br />
Cladonia furcata . + 2 1 +<br />
Cladonia subulata . . + . .<br />
Begleiter, Moose:<br />
Hypnum cupressiforme + . 1 + .<br />
Dicranum scoparium 1 . . . .<br />
Brachythecium velutinum + . . . .<br />
Begleiter, Flechten:<br />
Cladonia chlorophaea . 1 1 1 2<br />
Zusätzliche Arten: Nr. 1: Polytrichum formosum +, Bryum capillare +. Nr. 4: Herniaria glabra +.<br />
Nr. 5: Peltigera canina +.
<strong>Marstaller</strong>: Moosgesellschaften der “Schieferbrüche bei Kolditz” 101<br />
Tabelle 7: Cladonietum mitis Krieger 1937<br />
Aufnahme Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17<br />
Exposition . . . NW NW N . S S . . . . . . . .<br />
Neigung in Grad . . . 5 10 10 . 3 3 . . . . . . . .<br />
Deckung Kryptogamen % 95 98 95 98 98 95 98 90 95 95 95 95 90 70 70 90 95<br />
Deckung Gehölze % 30 30 20 . . 15 20 10 15 10 30 20 20 25 10 40 40<br />
Kennarten der Assoziation:<br />
Cladonia portentosa 1 . + 2 2 1 . . . + 1 2 2 + . 2 1<br />
Cladonia mitis 1 1 . . . . + . . + . 1 . . . . 1<br />
Cladonion sylvaticae:<br />
Cladonia arbuscula 5 4 5 4 4 4 5 3 4 4 3 3 4 3 4 4 2<br />
Cladonia gracilis 1 2 1 2 3 1 2 2 2 2 1 1 3 2 2 1 1<br />
Cladonia uncialis 1 2 1 . + 1 1 + . + . . . . . . .<br />
Cladonia rangiferina . . . . 1 2 . + . . 3 1 . . . 3 4<br />
Cladonia subulata + . . . . + . . . . . + 1 + . . +<br />
Cetraria aculeata . . 1 . . . . 2 1 1 . . . + . . .<br />
Cladonia coccifera . . + + + . . . . . . r . . + . .<br />
Cladonia furcata . . + . + . . 2 . . . . . . . + .<br />
Cetraria islandica . . . + . . 1 . . . + . . . . + .<br />
Cladonia cervicornis* + . . . . . . . . . . . . . + . .<br />
Cladonia phyllophora + . . . . . . . . . . . . . . + .<br />
Ceratodonto-Polytrichetea:<br />
Polytrichum piliferum . . 1 . . . . 2 + + . + . + . . +<br />
Racomitrium elongatum . . . . . . . . . + 1 2 1 . . . +<br />
Racomitrium lanuginosum . . + . . . . . 1 + . . . . . . .<br />
Cephaloziella divaricata . . . . . . . + . . . . . + + . .<br />
Polytrichum juniperinum . . . + . . . . . . . . . . . . 1<br />
Begleiter, Flechten:<br />
Cladonia floerkeana . + + . + . . + . r . . + 1 + . .<br />
Cladonia chlorophaea . . . + + . . . . . . + + 1 + . .<br />
Cladonia deformis . . + + + + . . . . . . . . + . .<br />
Cladonia macilenta . . . + . . . . . . . . . . r . +<br />
Cladonia squamosa + . . . . . . . . . . . . + . . .<br />
Begleiter, Moose:<br />
Dicranum scoparium 2 2 + 1 2 2 + . + + + + 1 + . + +<br />
Pohlia nutans + + . + + . . . + + . 1 + . . . .<br />
Dicranum polysetum . + . . . + + + . + 1 . . . . + .<br />
Dicranum spurium . . . . . 1 1 . . . . . . . . . .<br />
Pleurozium schreberi . . . . . + . . . . . . . . . + .<br />
Ptilidium ciliare . . . . . + . . . . . . . . . + .<br />
Zusätzliche Arten: Nr. 1: Campylopus introflexus +. Nr. 8: Pycnothela papillaria +. Nr. 11:<br />
Polytrichum formosum 1. Nr. 13: Cladonia fimbriata +. Nr. 15: Stereocaulon dactylophullum +. *<br />
= ssp. verticillata.
102<br />
Limprichtia 22, 2003<br />
Tabelle 8: Coscinodontetum cribrosi v. Hübschm. 1955<br />
Aufnahme Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />
Exposition SW W SW SW W SW S SO . S N S<br />
Neigung in Grad 30 30 25 25 50 60 5 35 . 5 5 20<br />
Deckung Kryptogamen % 60 85 60 80 50 80 40 40 35 50 50 50<br />
Deckung Gehölze % 45 40 30 50 60 20 40 70 40 30 10 35<br />
Kennart der Assoziation:<br />
Coscinodon cribrosus 1 3 2 1 3 4 3 3 2 3 3 2<br />
Racomitrietalia heterostichi:<br />
Racomitrium heterostichum 2 1 3 2 + . . . . . . +<br />
Racomitrium lanuginosum D . . + . . . . . . . + .<br />
Trennarten der Var.:<br />
Schistidium crassipilum . . . . . . . . . . . 2<br />
Physcia tenella . . . . . . . . . . . 2<br />
Grimmia pulvinata . . . . . . . . . . . +<br />
Begleiter, Moose:<br />
Pohlia nutans . + + + + 2 + . + + 1 .<br />
Cephaloziella divaricata + 2 . + . 1 + . + + . .<br />
Ceratodon purpureus 2 + . + . . . . . . . 1<br />
Racomitrium elongatum + . . 1 . . . . . . . .<br />
Begleiter, Flechten:<br />
Cladonia chlorophaea + 2 + + + 1 1 . + + . +<br />
Lepraria caesioalba 2 3 . 2 2 + . . . 2 . .<br />
Umbilicaria hirsuta . 1 2 . 1 1 . . + . + .<br />
Parmelia saxatilis 2 + . 1 . . . . . . . +<br />
Parmelia conspersa + . . . . . . 2 + . . .<br />
Parmelia verruculifera . . . + + . . . + . . .<br />
Cladonia coccifera . . . . + . . . . 1 . .<br />
Cladonia pleurota . . 1 . . + . . . . . .<br />
Cladonia floerkeana . + . . . . + . . . . .<br />
Parmelia glabratula + . . . . . . + . . . .<br />
Nr. 1-11:Typische Var., Nr. 12: Schistidium-Var.<br />
Zusätzliche Arten: Nr. 2: Cladonia gracilis 1 ° , C. furcata +. Nr. 6: Polytrichum piliferum +. Nr.<br />
8: Hypnum cupressiforme +, Parmelia mougeotii +.Nr. 10: Cynodontium polycarpon +.<br />
Nr. 1-6: Schieferfelsen außerhalb der Bergbaugebiete, Nr. 7-12: auf Schieferhalden. D: Trennart.
<strong>Marstaller</strong>: Moosgesellschaften der “Schieferbrüche bei Kolditz” 103
104<br />
Limprichtia 22, 2003<br />
Tabelle 10: Pleurozietum schreberi Wiśn. 1930<br />
Aufnahme Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15<br />
Exposition S S W NO N W NW N W S N NO N SW S<br />
Neigung in Grad 15 25 20 30 20 5 20 10 10 15 15 30 5 10 20<br />
Deckung Kryptogamen % 99 99 99 99 99 99 99 99 99 95 98 99 99 95 99<br />
Deckung Gehölze % 70 70 40 40 30 40 60 50 30 50 60 50 40 60 45<br />
Kennarten der Assoziation:<br />
Pleurozium schreberi 4 4 5 4 2 4 4 5 5 3 4 5 3 3 3<br />
Hylocomium splendens . . . . . . . . . . . 1 . . .<br />
Pleurozion schreberi:<br />
Dicranum scoparium D 3 3 1 2 4 3 2 2 2 2 3 2 3 + 1<br />
Polytrichum formosum D . . . 2 2 . . + . 2 1 . . . 3<br />
Ptilidium ciliare . + . . 1 2 . . 1 . 2 . . 1 .<br />
Begleiter, Moose:<br />
Pohlia nutans + + . . + + + + . + . . . + +<br />
Hypnum cupressiforme + 1 . . . . . . . . . . . . 2<br />
Racomitrium elongatum . . . . 1 . . . . . . . . 3 .<br />
Dicranum polysetum . . . . . . . . . . . 1 1 . .<br />
Begleiter, Flechten:<br />
Cladonia gracilis . + + 1 . 2 + + + . . . 1 1 .<br />
Cladonia arbuscula . . 2 2 . . 1 + + . . . 1 . .<br />
Cladonia subulata . . . . . . . + . + . . . + .<br />
Cladonia rangiferina . . . + . . . . . . . . 1 . .<br />
Cladonia portentosa . . . . . . . . . . . . 1 r .<br />
Cladonia uncialis . . + . . . . . . . . . + . .<br />
Zusätzliche Arten: Nr. 4: Polytrichum juniperinum +. Nr. 6: Dicranum spurium +, Cladonia<br />
furcata +. Nr. 9: Racomitrium lanuginosum +. Nr. 10: Plagiothecium curvifolium +. Nr. 14:<br />
Cladonia coniocraea +, C. chlorophaea +.
<strong>Marstaller</strong>: Moosgesellschaften der “Schieferbrüche bei Kolditz” 105<br />
Tabelle 11: Grimmietum hartmanii Størm. 1938<br />
Aufnahme Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Exposition S S S W NW NW NW SW SW<br />
Neigung in Grad 40 45 30 45 60 10 20 10 15<br />
Deckung Kryptogamen % 85 90 90 30 70 95 70 95 80<br />
Deckung Gehölze % 95 95 95 75 90 95 85 95 95<br />
Kennart der Assoziation:<br />
Paraleucobryum longifolium 1 2 3 2 2 2 3 2 3<br />
Cladonio-Lepidozietea:<br />
Plagiothecium laetum 1 1 + . 1 + . . .<br />
Hypnum mammillatum 4 4 . . . . . . .<br />
Aulacomnium androgynum . . . . r . 1 . .<br />
Plagiothecium curvifolium . . . . . . + . .<br />
Orthodicranum montanum . . . . + . . . .<br />
Lophocolea heterophylla . . + . . . . . .<br />
Cladonia coniocraea . . . + . . . . .<br />
Trennarten der Var.:<br />
Plagiothecium succulentum . . . . . . . 2 +<br />
Mnium hornum K . . . . . . . . 1<br />
Begleiter, Moose:<br />
Dicranum scoparium + + . + + + + 1 .<br />
Hypnum cupressiforme + . 4 . 2 4 . 4 3<br />
Pohlia nutans + 1 . + . + 2 1 .<br />
Begleiter, Flechten:<br />
Parmelia saxatilis . . . . 3 . . . .<br />
Nr. 1-7: Typische Var., Nr. 8-9: Plagiothecium succulentum-Var. K: zugleich Kennart Cladonio-<br />
Lepidozietea.<br />
Zusätzliche Arten: Nr. 2: Polytrichum formosum +. Nr. 4: Parmelia glabratula 1.
106<br />
Limprichtia 22, 2003<br />
Tabelle 12: Orthotricho-Grimmietum pulvinatae Stod. 1937 (Nr. 1-10)<br />
Schistidium robustum Gesellschaft (Nr. 11-14)<br />
Aufnahme Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
Exposition SO S NO NW W SW SW SW SW SW S S . SW<br />
Neigung in Grad 80 80 10 35 15 25 15 5 5 30 20 20 . 20<br />
Deckung Kryptogamen % 30 30 70 50 40 60 65 30 50 40 40 60 50 40<br />
Deckung Gehölze % 60 60 50 70 50 40 50 50 40 40 15 30 20 .<br />
Substrat K K B K K K K K K K S S S S<br />
Kennarten Orthotricho-Grimmietum:<br />
Orthotrichum anomalum 1 + 2 1 1 2 2 2 + 2 . . . .<br />
Orthotrichum cupulatum + . . . . . . . . . . . . .<br />
Grimmion tergestinae:<br />
Schistidium crassipilum 3 2 3 4 . 2 1 2 2 3 3 . . .<br />
Schistidium robustum . . + . 3 . . . 1 + 1 2 + 2<br />
Tortula muralis 1 + + + 1 . + . 1 . . . . .<br />
Grimmia pulvinata . 1 . . . . 1 + + . . . + .<br />
Schistidium dupretii . . . . . . . . . . . 3 3 .<br />
Schistidium pruinosum . + . . . . . . . . . . . .<br />
Begleiter, Moose:<br />
Hypnum cupressiforme 1 1 . . 1 1 + 1 + . . . . .<br />
Tortula ruralis . . . . . 2 2 1 2 . + . . .<br />
Ceratodon purpureus . . . . . . . + . . + + + .<br />
Tortella tortuosa + + . . . . . . . . . . . 1<br />
Bryum laevifilum . . . . + + . . . + . . . .<br />
Coscinodon cribrosus . . . . . . . . . . . + . .<br />
Begleiter, Flechten:<br />
Cladonia pyxidata . . . . + . . . + . . . . .<br />
Zusätzliche Arten: Nr. 1: Lepraria spec. +. Nr. 2: Collema fuscovirens +. Nr. 3: Orthotrichum<br />
diaphanum +. Nr. 5: Collema tenax +. Nr. 11: Bryum argenteum +, Brachythecium velutinum +.<br />
Nr. 12: Cladonia chlorophaea +. Nr. 13: Encalypta streptocarpa 1, Cladonia subulata +. Nr. 14:<br />
Racomitrium lanuginosum +, Stereocaulon dactylophyllum +.<br />
Substrat: B = Beton, K = Knotenkalk, S = kalkhaltiger Schiefer bzw. Kieskalb.
<strong>Marstaller</strong>: Moosgesellschaften der “Schieferbrüche bei Kolditz” 107
108<br />
Limprichtia 22, 2003<br />
Tabelle 14: Homomallietum incurvati Phil. 1965 (Nr. 1-11)<br />
Brachythecietum populei Phil. 1972 (Nr. 12-14)<br />
Aufnahme Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
Exposition . S SW S SW S S S O S S SW S S<br />
Neigung in Grad . 60 60 25 10 75 10 80 10 10 40 30 35 40<br />
Deckung Kryptogamen % 70 70 80 80 90 95 90 90 90 90 95 90 75 99<br />
Deckung Gehölze % 80 85 80 85 80 85 85 85 85 85 90 90 75 95<br />
Kennarten der Assoziationen:<br />
Homomallium incurvatum 3 2 4 3 4 3 4 4 2 3 4 . . .<br />
Brachythecium populeum . . . . . . . . . 1 2 4 4 4<br />
Neckeretalia complanatae:<br />
Rhynchostegium murale . . . . . . . . . . . + 1 1<br />
Begleiter, Moose:<br />
Hypnum cupressiforme + 3 1 3 2 1 1 2 1 2 + 2 2 2<br />
Schistidium crassipilum 1 2 1 1 1 3 2 2 1 2 + + . .<br />
Bryum laevifilum . + 2 . . 1 . . + 1 + + + 2<br />
Brachythecium velutinum + . + + 1 . + . 1 1 1 . . .<br />
Tortella tortuosa . . . . . . 2 2 . . . . . 1<br />
Brachythecium rutabulum . . . . . . . . . . . 2 1 1<br />
Bryoerythrophyllum recurvirostre . . + . . . . . 1 . . . . +<br />
Plagiomnium affine . . . . . . . . + + . . . .<br />
Tortella bambergeri . . . . . . . . 3 . . . . .<br />
Nr. 1-9: typicum, Nr. 10-11: brachythecietosum populei.<br />
Zusätzliche Arten: Nr. 2: Lepraria spec. +. Nr. 8: Didymodon fallax +.
<strong>Marstaller</strong>: Moosgesellschaften der “Schieferbrüche bei Kolditz” 109<br />
Tabelle 15: Fissidens adianthoides-Gesellschaft<br />
Aufnahme Nr. 1 2 3 4 5<br />
Exposition N N N N N<br />
Neigung in Grad 45 40 40 35 40<br />
Deckung Kryptogamen % 90 95 75 75 80<br />
Deckung Gehölze % 50 50 60 50 50<br />
Kennzeichnende Art:<br />
Fissidens adianthoides 3 4 + 1 +<br />
Ctenidion, Ctenidietalia mollusci:<br />
Tortella tortuosa 2 + 3 3 3<br />
Encalypta streptocarpa + 2 2 3 3<br />
Campylium chrysophyllum 1 . + + .<br />
Begleiter:<br />
Hypnum cupressiforme 1 2 1 + +<br />
Didymodon ferrugineus . . + + 1<br />
Homalothecium lutescens . . + . +<br />
Rhynchostegium murale . . 1 . .<br />
Bryum laevifilum . + . . .<br />
Bryoerythrophyllum recurvirostre . . . + .<br />
Schistidium crassipilum . . . + .<br />
Tabelle 16: Amphidium mougeottii-Gesellschaft<br />
Aufnahme Nr. 1 2 3 4 5<br />
Exposition SW SW W SW SW<br />
Neigung in Grad 90 80 30 85 90<br />
Deckung Kryptogamen % 85 75 90 70 80<br />
Deckung Gehölze % 60 60 60 80 50<br />
Kennzeichnende Art:<br />
Amphidium mougeottii 4 3 3 3 3<br />
Übrige Moose:<br />
Bryum pseudotriquetrum 1 2 2 3 .<br />
Cratoneuron filicinum . . 4 2 2<br />
Fissidens adianthoides 2 2 . 2 .<br />
Pellia endiviifolia 1 . . . 3<br />
Brachythecium rivulare + . + . .
110<br />
Limprichtia 22, 2003<br />
Tabelle 17: Dicrano-Hypnetum filiformis Barkm. 1958 (Nr. 1-10)<br />
Orthodicrano-Hypnetum filiformis Wiśn. 1930 (Nr. 11-16)<br />
Platygyrietum repentis Le Blanc 1962 (Nr. 17)<br />
Aufnahme Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17<br />
Exposition N N SO . N N N NWNW N NWNWNW N SW N NW<br />
Neigung in Grad 80 50 15 . 30 10 30 75 70 15 30 60 70 80 75 80 30<br />
Deckung Kryptogamen % 90 70 75 85 40 90 70 90 80 90 85 70 75 65 80 70 70<br />
Deckung Gehölze % 75 75 70 75 80 85 60 70 70 70 90 80 75 75 70 85 90<br />
Phorophyt B B B P B Qp B M B B B B B B B B C<br />
Kennarten der Assoziationen:<br />
Orthodicranum montanum . . . . . . . . . . 3 4 3 2 + 2 .<br />
Platygyrium repens . . . . . . . . . . . . . . . . 4<br />
Dicrano-Hypnion: .<br />
Ptilidium pulcherrimum . + 1 . + . . . . . 2 . . . . 2 .<br />
Dicranoweisia cirrata . + + + . 2 1 . . . . . . . . . .<br />
Cladonio-Lepidozietea:<br />
Cladonia coniocraea + + 1 + . + 1 . + + + 2 2 2 2 1 .<br />
Lophocolea heterophylla 2 . . . . . . . 1 . . . 2 2 . 1 .<br />
Cynodontium polycarpon . 2 . . 2 . . . . . . + . . + . .<br />
Plagiothecium curvifolium + . . . . . . . . . + + . . . + .<br />
Plagiothecium laetum . . . . + . . . . . . . . + . + .<br />
Begleiter, Moose:<br />
Hypnum cupressiforme 4 3 2 4 2 4 3 4 4 4 1 + + 1 3 + 2<br />
Dicranum scoparium + 1 + 1 + + + + 2 3 2 1 2 2 1 1 .<br />
Pohlia nutans . . + . + . 2 . . + 1 . . . + . .<br />
Ceratodon purpureus . . + . . . + 2 . . . . . . . . 1<br />
Cephaloziella divaricata . . . . . . . . . . + + . . . + .<br />
Brachythecium velutinum 1 . . . . . . + . . . . . . . . .<br />
Brachythecium rutabulum . . . . . . + + . . . . . . . . .<br />
Begleiter, Flechten:<br />
Cladonia chlorophaea 1 + 2 2 + . + + . 1 . + + 1 1 . .<br />
Parmeliopsis ambigua 1 . 1 . . . . . 1 . 1 . + . + . .<br />
Parmelia saxatilis . . . . + 1 + . . + . . . . . . .<br />
Hypocenomyce scalaris . . . . . . . . . . . . + + 1 . .<br />
Hypogymnia physodes . . 1 . . . + . . + . . . . . . .<br />
Lepraria spec. + . . . . . . . . . . . 1 + . . .<br />
Zusätzliche Arten: Nr. 8: Aulacomnium androgynum +, Orthotrichum affine +, O. diaphanum r.<br />
Nr. 10: Cladonia macilenta +. Nr. 13: Orthodontium lineare r.<br />
Phorophyt: B = Betula pendula, C = Carpinus betulus, M = Malus domestica, Qp = Quercus<br />
petraea, P = Populus tremula.
<strong>Marstaller</strong>: Moosgesellschaften der “Schieferbrüche bei Kolditz” 111<br />
Tabelle 18: Ulotetum crispae Ochsn. 1928 (Nr. 1-5)<br />
Orthotrichetum fallacis v. Krus. 1945 (Nr. 6)<br />
Aufnahme Nr. 1 2 3 4 5 6<br />
Exposition SO S S NW NO W<br />
Neigung in Grad 60 40 15 30 20 . 85<br />
Deckung Kryptogamen % 50 90 40 70 50 50<br />
Deckung Gehölze % 75 85 40 80 90 80<br />
Phorophyt B Sy P As As M<br />
Kennarten der Assoziationen:<br />
Ulota bruchii 1 + + 1 + .<br />
Orthotrichum pumilum . . . . r 2<br />
Ulotion crispae:<br />
Orthotrichum stramineum . + + . . .<br />
Orthotrichum lyellii . + . . . .<br />
Syntrichion laevipilae:<br />
Orthotrichum diaphanum 2 . + + + +<br />
Orthotrichetalia:<br />
Orthotrichum affine . 2 2 1 1 +<br />
Orthotrichum speciosum . . + . . .<br />
Frullanio-Leucodontetea sciuroidis:<br />
Radula complanata . + . + . +<br />
Begleiter, Moose:<br />
Hypnum cupressiforme 3 4 2 3 + 2<br />
Ceratodon purpureus + . + r . 2<br />
Brachythecium velutinum . 1 . 1 2 .<br />
Amblystegium serpens . . + 2 + .<br />
Brachythecium rutabulum . . . 1 . +<br />
Zusätzliche Arten: Nr. 1: Cladonia chlorophaea +. Nr. 2: Dicranoweisia cirrata +. Nr. 4: Bryum<br />
laevifilum +. Nr. 6: Lepraria spec. +.<br />
Phorophyt: As: = Acer pseudoplatanus, B = Betula pendula, M = Malus domestica, P = Populus<br />
tremula, Sy = Syringa vulgaris.
112<br />
Limprichtia 22, 2003