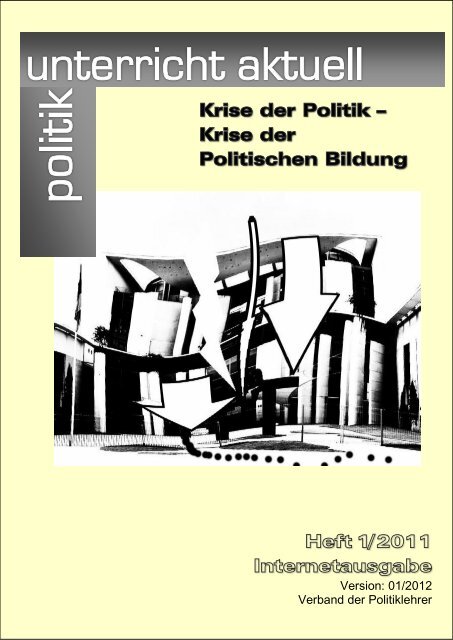Textausgabe als PDF-Datei - Politik Unterricht Aktuell
Textausgabe als PDF-Datei - Politik Unterricht Aktuell
Textausgabe als PDF-Datei - Politik Unterricht Aktuell
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 1<br />
Version: 01/2012<br />
Verband der <strong>Politik</strong>lehrer
Gerhard Voigt:<br />
Perspektiven der Politischen Bildung<br />
in der Gegenwartsepoche<br />
Krisenbefunde und Paradigmenwechsel in der Politischen Bildung<br />
1. Das Bewusstsein, krisenhafte Umbrüche zu erleben<br />
1.1 Das Ende der Gegenwart<br />
In einer Szene in Shakespeares »König Lear« sagt Gloucester, der geblendet wurde, weil er<br />
seinem König treu blieb: „...was Fliegen sind dem müßigen Knaben, das sind wir den Göttern;<br />
sie töten uns zum Spaß.“ In diesen Zeilen liegt eine ganze – verstörend genaue – Kosmogonie,<br />
die Vision einer von übel wollenden Göttern regierten Welt und von Menschen, die in<br />
Nachahmung dieser Götter andere Menschen verstümmeln und umbringen. Ich habe keinen<br />
Zweifel daran, dass wir die grundlegende menschliche Veranlagung besitzen, Böses zu tun und<br />
Schmerz zuzufügen. Ebenso grundlegend ist unsere Gleichgültigkeit gegenüber dem Leiden<br />
anderer, es sei denn, wir erkannten uns in ihnen so genau wieder, dass ein Schlag, der sich<br />
gegen sie richtet, auch uns träfe. In der überwiegenden Mehrheit werden wir durch Erziehung<br />
gezügelt (zu der manchmal die Prägung durch wohlmeinende religiöse Grundsätze gehört) und<br />
– sofern wir in stabilen und gut verwalteten Gesellschaften leben – auch durch Gesetze, die<br />
Gewalttätigkeit eindämmen und bestrafen.“<br />
Louis Begley: „Ein satanisches Requiem“. Über die Bestie Mensch im 20. Jahrhundert.<br />
Das bevorstehende Jahr 2000 wird in der öffentlichen wie den veröffentlichten Perspektiven sehr<br />
deutlich <strong>als</strong> erwarteter oder befürchteter Einschnitt wahrgenommen, bei dem in einem<br />
résumierenden Rückblick auf die »vergangene Gegenwart« diese immer mehr <strong>als</strong> sich abschließende<br />
oder abzuschließende Epoche begriffen wird; diese »Gegenwartsepoche« wird <strong>als</strong> sich<br />
abschließend, zu Ende gehend nicht nur sorgenvoll begriffen sondern in diesem Sinne auch in<br />
Medien und in der veröffentlichten Meinung bewusst funktionalisiert. [1] Unabhängig von der grundsätzlichen<br />
Skepsis, mit der solche »epochalen Perspektiven« und oft sehr irrationalen Emotionalisierungen<br />
der »Einschnitterwartungen« gewertet werden müssen, ist die unmittelbare politische<br />
Wirksamkeit dieser Befindlichkeiten nicht zu übersehen. Für die Pädagogik und Didaktik ist es<br />
daher notwendig und sinnvoll, sich kritisch-distanzierend in diese Diskurse einzumischen, um<br />
entsprechende didaktische und methodische Akzente für die Praxis des Schulunterrichts <strong>als</strong> Beitrag<br />
zur Bewältigung der irrationalen Endzeitängste und damit <strong>als</strong> Beitrag zur Krisenbewältigung der<br />
<strong>Politik</strong> setzen zu können. Erwartete grundsätzliche Veränderungen können daher auch <strong>als</strong> Chancen<br />
für einen notwendigen Paradigmenwechsel in der Politischen Bildung begriffen werden. Zunächst<br />
ist es aber notwendig, die subjektiven Erfahrungshorizonte und Befindlichkeiten in der<br />
Öffentlichkeit wie in der Schule kritisch zu durchleuchten. Eine zentrale Rolle spielt dabei der<br />
Krisenbegriff, der eine wertende Verbindung zwischen objektivem gesellschaftlichen Wandel und<br />
subjektiv-biographischer gesellschaftlicher Erfahrung herstellt und zentraler Topos in der<br />
veröffentlichen Meinung ist: Das »Ende der Gegenwartsepoche«, der Übergang von Moderne zur<br />
Postmoderne, zur postindustriellen Gesellschaft – diese Begriffskontexte sind bezeichnend für die<br />
vorherrschende Wertung einer Zukunft, die sich weniger durch Neues, <strong>als</strong> durch Nachfolge<br />
auszeichnen wird – wird <strong>als</strong> Krise, <strong>als</strong> krisenhafter Umbruch verstanden.<br />
1.2 Zur Psychologie der Krisenwahrnehmung<br />
Die gegenwärtigen Entwicklungen der Gesellschaft, betreffend die innerstaatliche Befindlichkeit,<br />
wie auch die sich dramatisch umgestaltenden äußeren Beziehungen, erwecken beim zeitgenössischen<br />
Betrachter den nachhaltigen Eindruck, dass hier nicht nur die Wandlungsprozesse aus der frü-<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 1
hen Nachkriegszeit oder noch ältere Kontinuitäten fortgeschrieben werden, sondern dass sich<br />
epochal neue Lebensbedingungen und Entwicklungstrends andeuten. Dabei ist die Wahrnehmung<br />
kontrovers, ob diese Umgestaltung der gesellschaftlichen und politischen Determinanten etwa in<br />
den letzten beiden Jahrzehnten zu einem vorläufigen Abschluss kommen und mit der Jahrtausendwende<br />
neue Entwicklungsimpulse zu erwarten sind [2] , oder ob diese beiden Jahrzehnte der so<br />
genannten »Postmoderne« letztlich nur das Präludium sind für eine gerechtere Welt und noch<br />
weiter bevorstehende Umwälzungen. Auch wenn eine den gesellschaftlichen Zuständen in höherem<br />
Maße entsprechende Kategorisierung erst aus geschichtlicher Distanz heraus möglich sein wird, hat<br />
sich in unserem Bewusstsein der Eindruck festgesetzt, dass wir eine qualitativ besondere und<br />
gesonderte Gegenwartsepoche durchleben, die eher den Charakter der Krise <strong>als</strong> den der Konsolidierung<br />
trägt.<br />
Diese Wandlungen der gesellschaftlichen Realitäten sozialwissenschaftlich adäquat zu analysieren,<br />
stößt derzeit noch auf große Schwierigkeiten und bleibt weitgehend kontrovers, so dass es sicherlich<br />
nicht abwegig ist, von der Notwendigkeit eines sozialwissenschaftlichen Paradigmenwandels<br />
zu sprechen. [3]<br />
Damit soll auch die im Thema implizierte Begriffsdimension und Realitätsdeutung <strong>als</strong> »Krise«<br />
deutlich und nachdrücklich relativiert werden. Auf den Begriff der »Krise« können wir erst im<br />
Zusammenhang mit der subjektiven Wahrnehmung und Bewertung gesellschaftlicher Realitäten<br />
eingehen, nicht jedoch mit dem Anspruch, eine objektivierbare Analysekategorie gefunden zu<br />
haben.<br />
Wie müssen uns vielmehr damit beschäftigen, die Situation der Politische Bildung in der Schule<br />
auszuleuchten und die Anforderungen, die eine veränderte gesellschaftliche Realität an die<br />
Politische Bildung stellt, im Sinne eines notwendigen Paradigmenwandels untersuchen.<br />
1.3 Krise, Realitätsdefinition und Wertordnung<br />
Gerade auch für diejenigen, die im Bereich der Politischen Bildung und im <strong>Politik</strong>unterricht der<br />
Schule tätig sind, ergibt sich ein deutlicher Perspektivwandel sowohl betreffend die Gegenstände<br />
und Inhalte der Vermittlung <strong>als</strong> auch die unmittelbaren Lernsituationen, im außerschulischen wie<br />
im schulisch-institutionellen Bereich. Zum Teil werden diese Veränderungen von den Lehrkräften<br />
in diesem Bereich subjektiv <strong>als</strong> schmerzlich empfunden, da sie viele Sicherheiten und Orientierungen,<br />
bisher bewährte Selbstverständnisse auflösen und ein grundlegendes Überdenken der Berufssituation<br />
notwendig machen.<br />
Was kennzeichnet nun die im Thema angesprochene »Gegenwartsepoche« in Hinblick auf die<br />
Erfahrungs- und Lebenswelt »Schule und Politische Bildung«?<br />
Zur charakteristischen Berufserfahrung der in der Politischen Bildung Tätigen wird die Konfrontation<br />
mit dem Bedeutungsverlust des »Politischen« und dem Legitimationsdefizit [4] der Träger<br />
politischen Handelns in der heutigen Gesellschaft. »Bedeutungsverlust« bedeutet jedoch durchaus<br />
nicht, dass unter funktionalen Gesichtspunkten <strong>Politik</strong> überflüssig oder Politisches Handeln obsolet<br />
geworden wäre, ganz im Gegenteil! Es handelt sich aus verschiedenen Gründen zunächst einmal um<br />
einen Vertrauensverlust gegenüber den politisch Handelnden, den <strong>Politik</strong>ern. Vordergründig wird<br />
der Vertrauensverlust der <strong>Politik</strong>er mit ihren wahrgenommenen oder vermuteten charakterlichen<br />
Schwächen, mit der Erfahrung des Versagens und der Unglaubwürdigkeit politischer Aussagen und<br />
Versprechen oder mit oft sehr pauschalisierten Korruptionsvorwürfen begründet. Wenn dies auch<br />
im Einzelnen zutreffen mag, ist diese Argumentations- und Wahrnehmungsebene nicht ausreichend.<br />
Alle diese Vorwürfe sind so alt, wie es Herrschaft und <strong>Politik</strong> gibt. [5] Sie sind die Perspektive des<br />
Beherrschten, des Machtschwächeren, oder die Perspektive des Machtkonkurrenten. Der grundlegende<br />
Legitimationsverlust ist demgegenüber strukturell begründet. Die ins Unüberschaubare<br />
gewachsene Menge der Entscheidungsnotwendigkeiten in der <strong>Politik</strong>, in der sich die langen Interdependenzketten<br />
[6] der modernen Gesellschaft ebenso widerspiegeln wie die sozioökonomische Ver-<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 2
flochtenheit und Vernetzung, korrespondiert mit einem relativen Wirkungsverlust der Einzelentscheidung,<br />
mit dem Verlust der Möglichkeit unmittelbarer Erfolgswahrnehmung und sinkender<br />
Entscheidungsspielräume und Autonomie der <strong>Politik</strong>er selbst. Es wächst die Diskrepanz zwischen<br />
Entscheidungsdruck, Erfolgserwartung und Gestaltungsspielräumen, die in der Öffentlichkeit <strong>als</strong><br />
<strong>Politik</strong>versagen wahrgenommen wird. Eine weitere Begründung des offenkundigen oder auch nur<br />
vermuteten Bedeutungsverlustes des »Politischen« liegt in der zunehmenden strukturellen und<br />
funktionalen Auseinanderentwicklung der Gesellschaft, in der kein eindeutiges Machtzentrum mehr<br />
ortbar ist, sondern nur noch eine große Zahl konkurrierender Machteliten, die unterschiedlichen<br />
Funktionsgruppen zuzuordnen sind. Am klarsten, wenn auch in gewissem Sinne einseitig, hat dieses<br />
Phänomen Niklas Luhmann herausgearbeitet. [7]<br />
1.4 Zur begrifflichen Bestimmung der Wahrnehmung des »Zerfalls der Gesellschaft« und<br />
des »Zerfalls der gültigen Wertnormen«<br />
Zerfallswahrnehmungen liegen im Zentrum der Krisenerfahrung in unserer gesellschaftlichen<br />
Realität. Ob es dabei um den zu beklagenden Zerfall einer überkommenen Wertordnung oder um<br />
die Orientierungsprobleme in einer unübersichtlicher gewordenen Gesellschaftsstruktur handelt:<br />
politisches Handeln und gesellschaftliches Alltagsverhalten wird zunehmend schwieriger, da allgemein<br />
anerkannte, konsensfähige Maßstäbe und Orientierungen fehlen. Diese Grundbefindlichkeit<br />
wird wissenschaftlich vor allem im Individualisierungsdiskurs aufgenommen und dann sofort mit<br />
dem Diskurs über Universalisierungs- und Globalisierungsprozesse konfrontiert. Inhaltlich soll<br />
dieser Problemkreis später noch einmal aufgegriffen werden. [8]<br />
Begrifflich sind diese Prozesse nur schwer eindeutig zu fassen. Terminologische Differenzen<br />
prägen die wissenschaftlichen und publizistischen Diskussionen über die zunehmende Ausdifferenzierung<br />
der heterogener werdenden Gesellschaftsstruktur. Der traditionelle Schichtbegriff reicht<br />
für eine genauere Beschreibung der gegenwärtigen gesellschaftlichen Prozesse sicher nicht mehr<br />
aus. Als Beschreibung bestimmter mittelfristiger Entwicklungen vor allem im Bereich der<br />
Migrationsforschung kann man sicherlich noch von »Unterschichtungsprozessen« durch die<br />
internationale Arbeitsmigration wie, abgeleitet aus der historischen Perspektive, von »Überschichtungen«<br />
durch den Herrschafts- oder auch ökonomischen Hegemonialoktroy sprechen, wobei die<br />
betroffenen auszugrenzenden »Schichten« weder von ihrer sozioökonomischen wie von ihrer<br />
Statussituation her noch zutreffend <strong>als</strong> Oberschicht oder Unterschicht klassifiziert werden könnten.<br />
Gerade auch in der statusmäßigen Selbstdefinition gibt es erhebliche Abweichungen, die z.B. den<br />
traditionellen Oberschichtenbegriff obsolet werden lassen zu Gunsten differenzierter und konkurrierender<br />
Macht-, Status- und Wirtschafts- (= auch Konsum-) Eliten. Wenn im internationalen Kontext<br />
noch von Oberschichten gesprochen wird, ist hier nicht der klassische Schichtbegriff zu sehen,<br />
sondern die verkürzte Beschreibung internationaler Eliten, die oftm<strong>als</strong> eher an den globalisiertenund<br />
universalisierten Kontexten <strong>als</strong> der regionalen kulturellen Verwurzelung orientiert sind und in<br />
ihrem Alltagsverhalten eine »universalisierte Weltkultur« repräsentieren, jedoch nur in dem Maße,<br />
in dem es dieser Personengruppe gelingt, diese mit persönlicher Macht und wirksamem Einfluss zu<br />
unterfüttern.<br />
Auch die Unterschichten sind in dieser Form nicht mehr <strong>als</strong> Schicht oder geschlossene Gruppe<br />
greifbar; die hier zusammengefassten Lebenssituationen sind hochgradig different und auch in ihren<br />
biographischen Chancen und Begrenzungen so unterschiedlich, dass heute ein allgemeines, in der<br />
älteren Klassentheorie erwartetes und gefordertes Klassenbewusstsein oder ein Bewusstsein vergleichbarer<br />
Schichtinteresse zwischen Arbeitslosen, Obdachlosen, verarmten Familien, ausländischen<br />
Arbeitskräften, arbeitslosen Jugendlichen etc. etc. nicht mehr anzutreffen und auch nicht<br />
mehr zu erwarten ist.<br />
Die in den fünfziger Jahren entwickelte Deutungsperspektive einer nivellierten Mittelstandsgesellschaft<br />
oder die Subsumption aller Gruppen zu einer gesellschaftlichen Mittelschicht mag zwar<br />
im formalen historischen Vergleich zu der Klassengesellschaft des beginnenden Industrialismus<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 3
und <strong>als</strong> provokante Gegenthese zu marxistischen Gesellschaftsvorstellung sinnvoll und geltungsrelevant<br />
gewesen sein, trifft aber die heutigen Lebensrealitäten und gesellschaftlichen Konflikte nicht<br />
mehr. Auch die These vom »Mittelschichtbewusstsein« sollte eher durch die Feststellung<br />
induzierter vergleichbarer Verhaltensreaktionen auf eine industrielle Konsumgesellschaft und ihre<br />
Individualisierungszumutungen ersetzt werden. Der Schichtdiskurs ist wie der Klassendiskurs in<br />
seiner traditionellen Form zu Ende geführt.<br />
Der Versuch, die Heterogenität der Gesellschaft durch die Einführung des Milieubegriffes zu<br />
ersetzen, mag einen Schritt weiter führen, evoziert aber auf der Grundlage vorausgesetzter sozialisationstheoretischer<br />
Grundannahmen, die unter dem Aspekt der heutigen Kultur- und Zivilisationswissenschaft<br />
eher in Frage zu stellen sind, ein harmonisierendes Gesellschaftsbild. Es wird noch<br />
problematischer, wenn durch die breite Resonanz von milieugestützten Gesellschaftsmodellen<br />
gerade die publizistisch etikettierten Gruppen im Sinne einer self-fulfilling prophecy sich erst expost<br />
ausdifferenzieren, wie es erkennbarer Weise bei einer Reihe von ausseparierten Jugendkulturen<br />
eindeutig der Fall gewesen ist. Jugendliche, in ihrer Orientierungsunsicherheit, verstehen publizistische<br />
Milieugruppierungen <strong>als</strong> Verhaltens- und Identifikationsangebote, mit denen sich erst rekursiv<br />
in einer gegenseitigen Wechselbeziehung bestimmte Wertorientierungen und Gesellschaftsbilder<br />
verbinden. [9]<br />
Der Verfasser bevorzugt in Kenntnis der semantischen Ambivalenzen zur Bezeichnung dieser<br />
Gruppierungsprozesse den durchaus werthaltigen und dynamischen Begriff der »Fraktionierung«,<br />
der sowohl das Auseinanderfallen selbst, <strong>als</strong> auch die Unterschiedlichkeit der zu Grunde liegenden<br />
Maßstäbe mit bezeichnen kann. Fraktionen gehen sprachlich auf den Vorgang des Bruches oder des<br />
Auseinanderbrechens zurück. Damit bezeichnet dieser Begriff deutlicher <strong>als</strong> der Begriff der<br />
unterschiedlichen Milieus die problematische Spannung zwischen der <strong>als</strong> Gesamtheit verstandenen<br />
Gesellschaft und den (sich) ausdifferenzierenden, ausgliedernden, konfligierenden oder sich<br />
auseinander entwickelnden Teilen dieser Gesellschaft. Sowohl in Bezug auf die sozioökonomischen<br />
Lebensperspektiven wie auch der Ausdifferenzierung der Wertnormen (bzw. Zivilisationsstandards)<br />
und Realitätsbilder der Alltagskultur sind diese Prozesse der Fraktionierung bis hin zur Individualisierung<br />
zu beobachten und stehen, wie schon angedeutet, in einem interdependenten dialektischen<br />
Zusammenhang [10] mit den Prozessen der kulturellen Universalisierung.<br />
Der Begriff der Fraktionierung ist zu bevorzugen, da er einmal den noch immer wichtigen Blick auf<br />
gesamtgesellschaftliche Prozesse und Interdependenzen nicht verstellt, dabei aber das, so die zu<br />
Grunde liegende These, tendenziell fortschreitende Auseinanderfallen heterogener Teilgruppen in<br />
den Ländern der sozioökonomischen Zentren [11] auch qualitativ <strong>als</strong> Auseinanderbrechen kennzeichnet,<br />
ohne dabei scheinrationalen funktionalistischen Deutungsmuster [12] einerseits oder sehr eingeschränkt<br />
erklärungsmächtigen Deutungen der Systemtheorie unterworfen zu werden (Vgl. Fußnote<br />
7). Es wird durch diesen Begriff weder eine stringente gesellschaftliche Hierarchisierung der sich<br />
ausdifferenzierenden Gruppen impliziert, noch eine harmonisierende Deutung vermittelt, wie sie<br />
klassische Schicht- und Milieutheorien nahe legen.<br />
Begriffsgeschichtlich muss jedoch eine Distanzierung von der ideologischen Konnotation des<br />
Begriffs Fraktionierung in den sozialistischen und kommunistischen Parteien der Arbeiterbewegung<br />
erfolgen, wo damit oft diffamierend der ideologische Vorwurf der Spaltung der Partei durch<br />
parteiinterne Gruppenbildungen bzw. der Verrat an der Klassensolidarität durch ideologisches Abweichlertum<br />
gemeint war und dies zur vermeintlichen Schwächung der eigenen Position führen<br />
müsse <strong>als</strong> Folge von schuldhafter Konsensverletzung seitens der Vertreter bzw. Vertreterinnen<br />
anderer Auffassungen. Dieser eingeschränkten Begriffsbedeutung folgen wir ausdrücklich nicht und<br />
denken, dass diese Funktionalisierung heute geschichtlich so überholt ist, dass eine erneuerte,<br />
grundsätzliche gesellschaftswissenschaftliche Verwendung des Begriffes aus den schon genannten<br />
Gründen möglich und sinnvoll ist. Wenn dennoch eine kritische semantische Konnotation mit-<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 4
transportiert wird, ist dies aus der Perspektive der Entwicklung der modernen Staatsgesellschaft<br />
auch nicht abzuweisen. [13]<br />
1.5 Anmerkungen zu den gegenwärtigen Problemen der Theorie und Rezeption des<br />
Krisenbegriffs [14]<br />
Der Krisenbegriff wird in den »westlichen Ländern der sozioökonomischen Zentren« [15] und in den<br />
so genannten »Transformationsländern«, den ehemaligen Staaten des »real existierenden Sozialismus«<br />
sehr unterschiedlich rezipiert, wie es in Hinblick auf die unterschiedlichen historischen und<br />
gesellschaftlichen Erfahrungen schon diskutiert worden ist. Am Rande sei bemerkt, dass der<br />
Krisenbegriff in den Ländern der so genannten »Semiperipherien« und den peripheren Regionen der<br />
»Dritten Welt« auf Grund stark abweichender Maßstäbe und Zukunftshoffnungen und -befürchtungen<br />
wieder anders verstanden und rezipiert wird. [16] Doch das soll hier nicht das Thema sein.<br />
Wichtiger ist jedoch, dass der Gebrauch des Begriffes »Krise« in der subjektiv geprägten Alltagssprache<br />
ein anderer ist, <strong>als</strong> in den veröffentlichten Diskursen der Massenmedien oder der<br />
wissenschaftlichen Diskussion. [17]<br />
Die theoriegeschichtlichen Ambivalenzen des Krisenbegriffes sind bei einem Anspruch auf<br />
begriffliche Vertiefung und Differenzierung nicht ohne ausdrücklichen Bezug auf die marxistische<br />
Krisentheorie darzustellen. In wie weit eine ursprünglich marxistische Krisenzyklentheorie Eingang<br />
in die »westliche« Volkswirtschaftslehre und die Wirtschaftspolitik von Ländern wie der Bundesrepublik<br />
Deutschland oder anderen westeuropäischen Staaten gefunden hat, ist in der Literatur<br />
im Blick auf die wechselnde Bedeutung keynesianischer Kategorien und nachfrageorientierter<br />
»staatsinterventionistischer« wirtschaftspolitischer Konzepte schon mehrfach angerissen worden.<br />
Doch scheint darüber hinaus eine differenziertere Überlegung notwendig zu sein, um die notwendige<br />
begriffliche Klarheit zu schaffen. In der für die politologische Diskussion des Krisenbegriffes<br />
wesentlichen marxistischen und neomarxistischen Diskurstradition sind zwei Elemente von<br />
besonderer Bedeutung; einmal in der Konsequenz der Basis-Überbau-Thematik zur Bestimmung<br />
des »Politischen« die eindeutige wirtschaftliche bzw. sozioökonomische – aus den nationalökonomischen<br />
Reflexionen der klassischen marxistischen Schriften hergeleitete – Fundierung des<br />
Krisenbegriffes, die die Ebene der subjektiven Rezeption und der daraus erwachsenden gesellschaftlichen<br />
Handlungsebenen weitgehend ausblendet [18] , zum anderen die Zuordnung des ökonomischen<br />
Krisenphänomens selbst zu einer bestimmten, nämlich der bürgerlich-kapitalistischen<br />
Gesellschafts- und Wirtschaftsformation. In dieser, so der Vorstellung des historisch-dialektischen<br />
Materialismus entspringend, „historischen Entwicklungsstufe“ ist die »Wirtschaftskrise« Ursache<br />
und Agens der Entstehung der geschichtsnotwendigen »revolutionären Situation«, die durch den<br />
Klassenkampf zwischen den antagonistischen Klassen der Bourgeoisie und des Proletariates den<br />
Übergang zur sozialistischen und damit folgend der klassenlosen kommunistischen Gesellschaft <strong>als</strong><br />
Endziel der Geschichte führt.<br />
Die »Krise« ist damit historische eindeutig der kapitalistischen Gesellschaft zuzuordnen und sie ist<br />
ein objektiver Tatbestand in der kapitalistischen Wirtschaft <strong>als</strong> Phase der kapitalistischen<br />
Konjunkturzyklen [19] . Diese aus der marxistischen Kapitalismusanalyse entwickelte Krisenzyklentheorie<br />
ist dabei so detailliert und bindet in überzeugender Weise die ökonomischen Handlungsdeterminanten<br />
Gewinnorientierung und Konkurrenz ein, dass es nicht verwundert, dass in wirtschaftsgeschichtlichen<br />
Phasen entwickelter Konkurrenz und geringen Staatseinflusses, wie in Mitteleuropa<br />
und stärker noch in den USA bis zur Weltwirtschaftskrise die von der Krisenzyklentheorie<br />
vorhergesagten und beschriebenen Konjunkturzyklen weitgehend der ökonomisch-gesellschaftlichen<br />
Realität entsprachen [20] und damit auch wie schon angesprochen zur Grundlage der wirtschaftspolitischen<br />
Konzepte von Keynes wurde. Hofmann [21] leitet aus der Darstellung der Krisenzyklentheorie<br />
und der durch diese Konjunkturzyklen verursachte Weltwirtschaftskrise – historisch<br />
damit die Überlegungen Keynes teilweise nachvollziehend – den „dauernden Staatseintritt“ in die<br />
Wirtschaft (»Staatsinterventionismus«) und schließlich die „Vermachtung der Märkte“ durch<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 5
Konzentrationsprozesse ab. Letzterer Aspekt wird heute wieder aufgegriffen in der ökonomischen<br />
Analyse von Globalisierungsprozessen. Über die keynesianische Rezeption der Krisenzyklentheorie<br />
ist der ökonomische Krisenbegriff seiner marxistischen Bedeutungskonnotation entkleidet worden<br />
und konnte damit auch in die volkswirtschaftliche Terminologie der kapitalistischen Ökonomien<br />
eingehen.<br />
Doch darf der grundlegende Bedeutungs- und Funktionswandel des Krisenbegriffes dabei nicht<br />
übersehen werden. Im Gegensatz zur marxistischen und neomarxistischen Tradition überlagert sich<br />
der ökonomisch-fachliche Krisenbegriff mit dem subjektivistischen Begriff »Krise« der Umgangssprache<br />
[22] und übernimmt damit auch die gesellschaftliche Funktion, <strong>als</strong> populäre Begriffskategorie<br />
zwischen objektiver gesellschaftlicher Erfahrung und wertender Rezeption der eigenen Situation im<br />
unüberschaubar werdenden Wirtschaftszusammenhang zu vermitteln und damit gesellschaftlichaffirmativ<br />
ökonomische Sachverhalte subjektiv zu legitimieren. [23]<br />
Diese Funktion kann jedoch in anderen wirtschaftsgeschichtlichen und intellektuellen Traditionen<br />
nicht in gleicher Weise übernommen werden. Mit dem politisch gewollten und plötzlich vollzogenen<br />
Systemwandel in den Transformationsländern Ost- und Südosteuropas musste auch die das<br />
vorherige politische System stützende und legitimierende politische Ideologie des Marxismus in<br />
seiner damaligen marxistisch-leninistischen Ausprägung beiseitegeschoben werden. Gegenwärtig<br />
werden diese Erklärungsansätze und Gesellschaftsvorstellungen eher anathematisiert und aus<br />
politischen Gründen nicht in die aktuellen Diskurse einbezogen. Die Krisenzyklentheorie <strong>als</strong><br />
Kernstück der marxistischen Kapitalismuskritik unterliegt damit diesem Verdikt auch. War vor der<br />
»politischen Wende« im politischen Selbstverständnis der Länder des »real existierenden Sozialismus«<br />
eine Anwendung des Begriffs »Krise« auf die eigene Situation systemfremd und nicht<br />
erfolgt, so war eine fundamentale Kapitalismuskritik gerade auch mit den Begriffen aus der<br />
marxistischen Tradition in Bezug auf die gewollte und neu übernommene kapitalistisch-marktwirtschaftliche<br />
Systementscheidung kontraproduktiv und auch aus Gründen des eigenen Selbstverständnisses<br />
nicht möglich.<br />
Bestenfalls, wenn auch nicht durchgängig, wurde die Systemkritik mit einem verallgemeinerten,<br />
eher unpolitischen Begriff der »Krise« auf das »überwundene« bisherige sozioökonomische System<br />
angewandt und die Transformation gerade <strong>als</strong> Krisenlösungsstrategie verstanden. Dem können nun<br />
aber die Verlierer der Transformation, wie es vor allem bei den Aus- und Umsiedlern aber auch bei<br />
breiten Schichten in den Gebieten der ehemaligen DDR zu beobachten ist, nicht folgen, bei denen<br />
die subjektiv nachvollziehbare, objektiv aber kontraproduktive und historisch f<strong>als</strong>che Tendenz zur<br />
Idyllisierung der sozialistischen Vergangenheit im Sinne einer rückwärtsgewandten Utopie zu<br />
beobachten ist. [24]<br />
So unterscheidet sich der Begriffsgebrauch der Kategorie »Krise« beträchtlich je nach ideologischhistorischer<br />
Tradition und Wahrnehmung und Sinngebung der eigenen gesellschaftlichen Erfahrungen.<br />
Die Realerfahrung der »Krise im sozialistische System« wie auch »im nachsozialistischen<br />
System« ist durch die marxistische oder neomarxistische Krisenzyklen- und Revolutionstheorie des<br />
dialektisch-historischen Materialismus nicht hinreichend zu erklären und verständlich zu machen,<br />
widerspricht <strong>als</strong> der eindimensional gerichteten Fortschritts- und Geschichtserwartung oder -<br />
hoffnung <strong>als</strong> gegenläufige Bewegung grundsätzlich. Gesellschaftswissenschaftliche Ansätze in den<br />
Transformationsländern haben daher – auch subjektiv in der Lebenssituation der Wissenschaftlerinnen<br />
und Wissenschaftler begründet – große Schwierigkeiten mit einem differenzierten analytischen<br />
Zugang zur eigenen Krisengeschichte, bis hin zur verdrängten und gerade heute diskursnotwendigen<br />
Frage, in wie weit das »überwundene« System des »real existierenden Sozialismus« überhaupt<br />
sozialistisch – oder wie es die westliche Kritik schon früher formulierte: staatskapitalistisch –<br />
gewesen ist und in wie weit die politischen Strategien dieses Systems überhaupt noch auf marxistischen<br />
Kriterien und Erkenntnismethoden einer materialistischen Gesellschaftskritik beruhten.<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 6
Auch im Westen wird dieser Diskurs nicht geführt, sondern die Phase der Existenz sozialistischer<br />
Staaten und Systeme <strong>als</strong> historisch überholt und damit <strong>als</strong> politische Modelle und Ideen widerlegt<br />
anathematisiert. Eine differenzierte Diskussion des Krisenbegriffs in seiner unterschiedlichen<br />
Rezeption in den Transformationsländern und in den Ländern der westlichen sozioökonomischen<br />
Zentren, die die historischen Kontexte über den keynesianischen Staatsinterventionismus ebenso<br />
wenig ausblendet wie eine differenziertere Untersuchung der Krisenabläufe in den sozialistischen<br />
Ländern und den sich aus ihnen entwickelnden Transformationsregionen kann diese Blockierungen<br />
in der politisch-theoretischen Aufarbeitung der sozioökonomischen Zeitgeschichte aufzubrechen<br />
helfen.<br />
2. Veränderungen der Situation des Politischen <strong>Unterricht</strong>es<br />
2.1 Der Erfahrungshintergrund<br />
Der Verfasser gehört zu der Lehrergeneration, die bewusst und aktiv in der Reformphase in den<br />
70er Jahren versucht haben, pädagogische, das heißt sowohl fachdidaktische wie unterrichtsmethodische<br />
Alternativen und Innovationen zu entwickeln, zu erproben und sowohl auf administrativer<br />
Ebene, in Rahmenrichtlinien- und Reformkommissionen, <strong>als</strong> auch in der innerschulischen<br />
Situation <strong>als</strong> neue pädagogische Standards durchzusetzen.<br />
Die Erfahrung der vielfältigen Widerstände, der Rückschläge und gerade in den beiden letzten Jahrzehnten<br />
der tendenziellen Rückentwicklung macht eine reflektierende Analyse der zu Grunde<br />
liegenden gesellschaftlichen, politischen und schulinstitutionellen Veränderungen und Wandlungen<br />
notwendig, auch um die Intention und die Realisierbarkeit dieser reformpädagogischen Intentionen<br />
zu überprüfen. [25]<br />
Bei einem Überdenken der Erfahrungen in der konkreten <strong>Unterricht</strong>s- und Schulsituation sollte von<br />
den vor allem im gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld, in den Fächern <strong>Politik</strong> oder<br />
Geographie, leitenden methodischen Innovationen ausgegangen werden, die in den 70er Jahren <strong>als</strong><br />
zentrale Elemente und Kennzeichen eines veränderten <strong>Unterricht</strong>s gesehen wurden. So sollte ein<br />
»moderner« <strong>Unterricht</strong> regelmäßig zum Beispiel durch Exkursionen und Geländearbeit, durch<br />
Betriebsbesichtigungen in Industrie, Landwirtschaft und Verkehrswesen durch regelmäßige<br />
selbständige Projektarbeitsphasen didaktisch strukturiert und methodisch gestaltet werden.<br />
Die heutigen praktischen Erfahrungen damit sind aber eher ernüchternd, ganz abgesehen davon,<br />
dass derzeit nur noch eine Minderheit der Kolleginnen und Kollegen vor allen im gymnasialen<br />
Bereich überhaupt bereit und in der Lage sind, diese <strong>Unterricht</strong>smethoden regelmäßig und intensiv<br />
zu pflegen.<br />
Erstaunlicherweise ergibt sich das Problem gerade heute zu einem Zeitpunkt, da die Fachdidaktik<br />
diese methodischen und didaktischen Schwerpunktsetzungen aus dem Ghetto einer angeblichen<br />
Reformpädagogik [26] herauszuholen versucht und ihre faktische Beschränkung auf die Didaktik der<br />
Primarstufe, wie auch der Schulen im Sekundarbereich I aufheben will und diese methodischdidaktischen<br />
Formen <strong>als</strong> selbstverständlichen Teil des Fachunterrichte zu akzeptieren beginnt, ist<br />
deren praktische Umsetzung im <strong>Unterricht</strong> durch wachsende Probleme und Inakzeptanz, gar aktive<br />
Widerstände, in der Öffentlichkeit, bei den Schülerinnen und Schülern selbst deutlich schwieriger<br />
geworden <strong>als</strong> es die Entwicklung seit den siebziger Jahren erwarten ließ. Entsprechendes gilt in der<br />
Folge auch im Rahmen der institutionellen Voraussetzung an der Schule selbst vor allem hier<br />
wiederum im Gymnasialbereich.<br />
Im Folgenden sollen dazu einige Faktoren benannt werden, die diese wachsende Schwierigkeit dem<br />
Augenschein nach bedingen, ohne an dieser Stelle die Ursachen vertieft zu diskutieren oder didaktische<br />
und schulpraktische Auswege vorzuschlagen.<br />
Nicht diskutiert werden kann in diesem Zusammenhang der subjektive Faktor, nämlich dass das<br />
Durchschnittsalter der Lehrerinnen und Lehrer in den letzten Jahren an den Schulen permanent an-<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 7
gestiegen ist, wodurch neben nachlassender persönlicher Leistungsfähigkeit auch das Risiko des<br />
Berufsüberdrusses und der Demotivation in der Lehrerschaft wächst und sich im Verhältnis zur<br />
Schülerschaft eine »Großelternperspektive« herausbildet.<br />
2.2 Gesellschaftliche Rahmenbedingungen<br />
2.21 Phasen des Wandels der Zielparadigmen der Politischen Bildung<br />
Die Geschichte der Politischen Bildung ist durch häufige Paradigmenwechsel wie durch<br />
kontroverse Vorstellungen von ihrer Bedeutung und Funktion in der Öffentlichkeit und der Schule<br />
geprägt. Bis zur Reformphase der 70er Jahre wurde Politische Bildung bzw. die heute der<br />
Politischen Bildung zugeordneten Themen und Inhalte in den Fächern Geschichte und Erdkunde<br />
fast ausschließlich <strong>als</strong> Aufgabe für die „Erziehung zum Staatsbürger“ verstanden und dementsprechend<br />
im Sinne der jeweiligen Staatsführung bzw. auch der wechselnden politischen Mehrheiten<br />
in der Demokratie funktionalisiert.<br />
Es sollte aber betont werden, dass dies allgemein <strong>als</strong> legitim und notwendig akzeptiert wurde, und<br />
dass erst der gesellschaftswissenschaftliche Paradigmenwechsel zu Beginn der 70er Jahre, der zur<br />
zeitweiligen wissenschaftlichen Dominanz der »kritischen Theorie« führte, diesen funktionalistischen<br />
und affirmativen Kontext des <strong>Unterricht</strong>s grundsätzlich ideologiekritisch in Frage zu<br />
stellen begann und an die Stelle der so genannten »Staatsdidaktik« pädagogische Ziele wie<br />
Kritikfähigkeit, Emanzipation oder Widerständigkeit zu setzen wollte.<br />
Dass dies in der Kultuspolitik in der Bundesrepublik Deutschland durchaus noch heute umstritten<br />
und kontrovers bewertet ist, zeigt sowohl die emotional geführte Diskussion über die Schulpolitik<br />
im Zusammenhang mit Landtagswahlkämpfen, wie auch der unmittelbare Vergleich von Rahmenrichtlinien<br />
und schulpolitischen Grundsätzen zwischen den Bundesländern Süddeutschlands, vor<br />
allem Bayerns und Baden-Württembergs, mit der Schulpolitik der norddeutschen Bundesländer wie<br />
Niedersachsen, Bremen oder Hamburg. [27]<br />
Die kontroversen Paradigmen der Politischen Bildung sollten – idealtypisch – hier nebeneinander<br />
und gegeneinander gestellt werden, wobei damit auch im Prinzip eine zeitliche Abfolge der Geltung<br />
angedeutet werden kann.<br />
Eine ältere Politische Bildung sieht in der schulischen Erziehung zunächst eine Disziplinierungsund<br />
Anpassungsagentur mit dem Ziel mittelschichtenspezifischer Homogenisierung in der Staatsgesellschaft<br />
[28] ; dieses ist im engeren Sinne eine »Staatsdidaktik«;<br />
Politische Bildung bedeutet später aber auch: Schule <strong>als</strong> Ort der generationsspezifisch hierarchisierten<br />
Vermittlung und Durchsetzung von strukturstabilisierenden Wert- und Bildungsnormen:<br />
Staat, Demokratie, Westorientierung (Gagel, »Mut zur Erziehung«, »Werteerziehung« in der<br />
»Grundbildung«). Von einer rational-kritischen wissenschaftlichen <strong>Politik</strong>didaktik wird eine solche<br />
Politische Bildung aber eher skeptisch betrachtet, obwohl sie den Stimmungen in vielen Kollegien<br />
und Elternschaften durchaus entgegen kommt.<br />
Sachlich-pragmatische und schülerorientiert-kritische Ansätze treffen sich in jüngerer Zeit dort, wo<br />
Politische Bildung die Schule vorrangig <strong>als</strong> Funktionsträger der gesellschaftlichen Intellektualisierung<br />
versteht. Die gesellschaftlichen Ziele einer solchen Intellektualisierung ist unterschiedlich<br />
und politischen Kontroversen unterworfen; sie eignet unter bestimmen Bedingungen vor allem zur<br />
beruflichen Qualifikation, wobei die ökonomische Nachfrage nach höherwertigen Schulabschlüssen<br />
vorrangig ist – oft recht einseitig auch an den Interessen der Betriebe und Arbeitgeber ausgerichtet<br />
– und zu dem zum gesellschaftlichen Konsens gewordenen Postulat »Bildung ist Bürgerrecht«<br />
führen konnte; zum Funktionieren von Staat und Gesellschaft, wobei affirmative Konzepte der<br />
»Staatsbürgerkunde« neben offenen didaktischen Ansätzen für einen selbstbewussten demokratischen<br />
Umgang mit der gesellschaftlichen Realität und den politischen Zukunftsaufgaben steht; in<br />
den 70er Jahren differenzieren sich hierbei wesentliche inhaltliche Arbeitsfelder aus, die im metho-<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 8
disch-didaktischen Bereich <strong>als</strong> Konfliktdidaktik oder emanzipative Pädagogik, im didaktisch-curricularen<br />
Bereich <strong>als</strong> Umweltpädagogik [29] , Friedenspädagogik [30] oder Pädagogik der »Dritten<br />
Welt« [31] wesentliche Resonanz aber auch heftige politische Auseinandersetzungen gefunden haben;<br />
zum Erreichen politischer Ziele; dies dürfte ein sehr umstrittener und mehrfach ambivalenter Ansatz<br />
sein, da er wiederum wie auch die konservativen Entwürfe nicht in erster Linie von den Lebensperspektiven<br />
der Schülerinnen und Schüler ausgeht, auch nicht einfach affirmativ herrschende<br />
staatliche Wertvorstellungen umsetzen will, sondern dezidiert politisches Handeln, nämlich das<br />
Eintreten z.B. für Reformen, für gesellschaftlichen Wandel, oder für eine »Revolution« fordert,<br />
wobei das Problem der Legitimierung dieser Ansprüche niem<strong>als</strong> hinreichen zu klären war, es sei<br />
denn, objektivistische Gesellschaftsbilder und Geschichtsmythen vermittelten dieser Art von<br />
»Gesellschaftslehre« eine Scheinrationalität.<br />
Festzustellen ist die Aufgabe und – zumindest in Kernbereichen – das offensichtliche Scheitern<br />
dieser didaktischen Konzeptionen vor dem Hintergrund des eingangs geschilderten gesellschaftlichen<br />
Wandels, das Zurückbleiben hinter den durch den »Staat« postulierten Ansprüche, die tendenziell<br />
auch <strong>als</strong> »Staatsversagen« generalisiert werden. In anderem Kontext werden sie viel grundsätzlicher<br />
<strong>als</strong> Scheitern von Nation<strong>als</strong>taatskonzepten und der mitteleuropäischen Staatsgesellschaften<br />
selbst zu verstehen.<br />
Generell hat sich die Zahl der Außer-Haus-Aktivitäten in den Fächern des gesellschaftswissenschaftlichen<br />
Aufgabenfeldes, insbesondere des Erdkundeunterrichts, in den letzten beiden<br />
Jahrzehnten deutlich erhöht, ohne dass die Zahl der lohnenden Arbeits- und Besichtigungsobjekte in<br />
entsprechendem Maße gestiegen ist. Dazu ist gerade auch bei Betrieben und Dienststellen der »Reiz<br />
des Neuen« von Besuchen durch Schülergruppen (<strong>als</strong> sogar Lokalzeitungen noch darüber berichteten!)<br />
verloren gegangen. In den Vordergrund der Wahrnehmung tritt für Lehrer und Schüler,<br />
teilweise wohl aber auch für die »Gastgeber« und Betreuer in den Betrieben der dafür notwendige<br />
Aufwand und die aufzubringende Arbeitszeit. Dies korrespondiert mit einer wachsenden<br />
Orientierung vieler Betriebe an kurzfristigen Rentabilitätsüberlegungen. Ein Ausdruck dieses<br />
Paradigmenwechsels ist das ›shareholder value‹. Besuche gelten eher <strong>als</strong> Belastung und Kostenfaktor,<br />
denn <strong>als</strong> Chance für public relations. Einige Betriebe erwarten bei Besuchen von Schülergruppen<br />
und anderen Publikumsbesichtigungen von vornherein vorliegende hohe Motivation oder gar<br />
eine finanzielle Aufwandsentschädigung, wenn dies auch bislang eher im Ausland zu beobachten<br />
ist. Der Vorbereitungsaufwand für eine Betriebsbesichtigung wird für die Lehrkräfte dadurch erheblich<br />
größer und die notwendige Langfristigkeit kann einen flexiblen Einsatz dieses <strong>Unterricht</strong>sbestandteils<br />
möglicherweise verhindern.<br />
Die teilweise schlechte Konjunkturlage (Stahlkrise, Kohlekrise, Werftkrise) veranlasst betroffene<br />
Firmen und Branchen, eine restriktive und bedeckte Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Die Betriebe<br />
öffnen sich dann weniger gerne Einblicken von außen, was langfristig durchaus kontraproduktiv<br />
sein kann. Zugleich wird die gezielte Ansprache von Schülerinnen und Schülern dann ›uninteressant‹,<br />
wenn in absehbarer Zukunft im Betrieb oder in der Branche Neueinstellungen und das<br />
Angebot von Ausbildungsplätzen nicht zu erwarten ist.<br />
2.22 Veränderungen in der Schülerschaft<br />
Die Schülerschaft hat sich insbesondere in den Zentren der Großstädte in den vergangenen zehn<br />
Jahren stark verändert und zwar sowohl generell in Bezug auf das ihr eigene »Generationenschicksal«<br />
<strong>als</strong> auch in Hinblick auf ihre kulturelle und herkunftsmäßige Zusammensetzung, die<br />
durch wachsende Heterogenität und Vielfalt der soziokulturellen Prägungen zu charakterisieren ist.<br />
Die biographischen Rahmenbedingungen der derzeitigen Schülergeneration haben sich durch<br />
Veränderungen der familialen Sozialisation, durch Veränderungen der politischen Kultur und der<br />
öffentlichen Diskurse und Lebenswelten und durch die Veränderungen in den schulischen Curricula<br />
wesentlich und generell geändert. In gleicher Richtung wirkte der vor allem subjektiv wahrgenom-<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 9
mene, zunehmend aber auch objektiv erweisbare Bedeutungsverlust der schulischen Sozialisation<br />
für die Schülerbiographien. Schulische Erfahrung wird durch eine Multiplikation der vor allem<br />
medial vermittelten außerschulischen Erlebnis- und Erfahrungswelten zurückgesetzt. Ob sie unter<br />
diesen Bedingungen noch in eine sinnvolle Konkurrenz, zu diesen lebensweltlichen Differenzierungen<br />
und Fragmentierungen treten kann, zumindest noch <strong>als</strong> Begleitung und Ergänzung,<br />
soll im gegebenen Zusammenhang nicht weiter diskutiert werden, da diese Erfahrungsstrukturen<br />
weitaus getreuer die »Fraktionierung der politischen Kultur« widerspiegelt, <strong>als</strong> es die traditionelle<br />
Schulwelt vermag.<br />
Nachdenklichkeit erzeugt jedoch die Beobachtung, dass diese Situation durchaus nicht generell zu<br />
größeren Lebenschancen und positiven biographischen Erwartungen bei der Schülergeneration<br />
fährt, sondern vielfach Prozesse der nicht bewältigten Dissonanzerfahrungen und Psychotisierungen<br />
evoziert, die die Schule <strong>als</strong> gesellschaftlich verantwortliche Institution durchaus interessieren<br />
müsste.<br />
Bezogen auf unser Thema im Bereich der gesellschaftswissenschaftlichen Fächer, wobei die<br />
Geographiedidaktik einmal durch die besondere Bedeutung empirischer Verfahrensweisen,<br />
andererseits durch die verhängnisvollen Traditionen eines reflexionsarmen Empirismus besonders<br />
gefordert ist, bewirkt die veränderte Lebenssituation der heutigen Schülergeneration jedoch einige<br />
didaktische und methodische Probleme und Einengungen:<br />
Die Bereitschaft, wie auch zeitliche Fähigkeit, zusätzlichen Engagements in Schulveranstaltungen –<br />
wie Studienfahrten, Gelände- und Projektarbeit – außerhalb der üblichen <strong>Unterricht</strong>szeiten sinkt.<br />
Die Erwartung, auch aus ambitionierten schulischen Projekten und Lernsituationen neue und<br />
persönlich belangvolle, »interessante« Erfahrungen ziehen zu können, sinkt.<br />
Die Erwartung, dass sich schulische Bildungsangebote auf eine Verbesserung der Lebenschancen,<br />
Berufsperspektiven oder einsehbarer Persönlichkeitsbildung auswirken könnte, sinkt in dem Maße,<br />
<strong>als</strong> schulische Ausbildung zunehmend <strong>als</strong> Institution zum Erwerb von gesellschaftlich erforderlichen<br />
Formalqualifikationen wahrgenommen wird. [32]<br />
Die zunehmende Heterogenität der Schülerschaft durch Migranten, Aussiedler und soziale<br />
Binnenmigranten bewirkt kontroverse Haltungen zur Schule, die von ausgesprochener<br />
Aufsteigermentalität z.B. bei Flüchtlingen aus den Funktionseliten des Nahen Ostens, über<br />
statusbezogene Intellektualisierungsstrategien vor allem bei jüdischen Kontingentflüchtlingen aus<br />
den Ländern der ehemaligen Sowjetunion bis zur völligen Demotivierung von (unfreiwillig in der<br />
Familie mitgenommenen) Aussiedlerkindern aus Osteuropa reichen. Aber unabhängig von der<br />
Sozialmotivation oder der stärkeren oder fehlenden Aufstiegsorientierung fehlt in der Regel durch<br />
eine völlig andere schulische Primär-Enkulturation das Verständnis für die Individualisierungsforderung,<br />
die mit emanzipationsorientierten <strong>Unterricht</strong>sstrategien verbunden ist.<br />
Die – politisch eher konservative – öffentliche Fundamentalkritik an der schulischen Ausbildung,<br />
die gerade auch die informellen und »riskanten« Lernangebote trifft, verstärkt diesen Bedeutungsverlust<br />
der Schule ebenso wie die zunehmende öffentliche Abwertung der Professionalität des<br />
Lehrerberufes. Kritische anzumerken ist auch die häufig unprofessionelle öffentliche Darstellung<br />
der Lehrersituation durch die Lehrerverbände. Dieses negative Erscheinungsbild des Lehrerberufes<br />
wird vor allem durch die GEW ungewollt gefördert. Die Schülerperspektive spiegelt damit<br />
weitgehend den Stand der veröffentlichten Diskurse wider.<br />
Die – politisch eher konservative – öffentliche Fundamentalkritik an der schulischen Ausbildung,<br />
die gerade auch die informellen und »riskanten« Lernangebote betrifft, verstärkt diesen Bedeutungsverlust<br />
der Schule ebenso wie die zunehmende öffentliche Abwertung der Professionalität des<br />
Lehrerberufs. Kritisch anzumerken ist die häufig unprofessionelle oder gar dilettantische öffentliche<br />
Darstellung der Lehrersituation durch die Lehrerverbände. Dieses negative Erscheinungsbild des<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 10
Lehrerberufs wird vor allem durch die GEW ungewollt gefördert und evoziert. Die Schülerperspektive<br />
spiegelt damit weitgehend den Stand der veröffentlichten Diskurse wider.<br />
Die Gesellschafts- und Sozialordnungen sind weltweit in Bewegung geraten. Die politisch-ökonomischen<br />
Transformationsprozesse in den Ländern des ehemaligen RGW-Bereichs sind nur ein<br />
Beispiel, das korrespondiert mit tief greifenden gesellschaftlichen Umwälzungen vor allem in den<br />
Ländern der Semiperipherien.<br />
Zwar sind die Erscheinungsformen dieser Umwandlungen und Transformationen sehr unterschiedlich,<br />
das heißt, den jeweils individuellen historisch-ökonomischen Bedingungen der<br />
einzelnen Regionen und Länder entsprechend, doch stehen sie in hohem Grade in einem<br />
internationalen Kontext – <strong>als</strong> Dependenz, zentral-periphere Disparität oder im politisch-kulturellen<br />
Einflussbereich der Hegemonialmächte –, der bestimmte Entwicklungstendenzen vorzeichnet und<br />
überprägt und damit im Sinne der Globalisierung und Universalisierung vergleichbar macht.<br />
Die wirkt sich bis in die soziale Existenz des Einzelnen, d.h. auch der Schülerinnen und Schüler aus<br />
und kann skizziert werden mit folgenden Erscheinungsformen, die die gesamtgesellschaftlichen und<br />
ökonomischen Chancen von Globalisierung und Universalisierung zunächst bewusst ausblenden:<br />
Trotz Wirtschaftswachstum und positiven Einkommensentwicklungen in den Mittelschichten<br />
wächst der Anteil der Armen und derjenigen, die sich in der gegebenen Gesellschaft <strong>als</strong> arm,<br />
armselig oder chancenlos eingruppieren lassen.<br />
Traditionelle »Armut« wird durch »Verelendungsprozesse« und der Ausbreitung von »Armseligkeit«<br />
[33] abgelöst, die die Menschenwürde tangiert und katastrophale psychische Folgen der Perspektiv-<br />
und Hoffnungslosigkeit wie auch das Anwachsen der Gewaltbereitschaft und Radikalisierung<br />
nach sich zieht.<br />
Der soziale Halt traditionaler Institutionen und Sozialverbände geht verloren und mit ihr die damit<br />
verbundene soziale Kontrolle und sozialpsychologische Stabilisierung. Die Menschen werden zur<br />
Freiheit gezwungen, was nur in den ökonomisch stabilen Sozi<strong>als</strong>chichten auch tatsächlich <strong>als</strong> positiver<br />
Wert und Chance für den Erhalt des sozialen Status oder gar weitere Aufstiege wahrgenommen<br />
wird.<br />
Die Migrationsströme nehmen weltweit zu und führen zu einer Heterogenisierung und Fraktionierung<br />
[34] der Bevölkerungen einerseits und zu gegensteuernder Zunahme von staatlicher Repression<br />
andererseits; was letztlich einen sich gegenseitig verstärkenden und bedingenden Prozess darstellt.<br />
Die Schülerschaft, mit der heute die Schule im Allgemeinen und die Politische Bildung im<br />
Besonderen konfrontiert werden, ist in mehrfacher Hinsicht von den Auswirkungen der<br />
Globalisierungs- und Universalisierungsprozessen betroffen. Dabei stehen materielle und<br />
strukturelle Veränderungen, die regional und sozial zu differenzieren sind, mentalen und<br />
habitutionellen Entwicklungen und Problemen gegenüber, die vor allem kulturell und identitätsgruppenorientiert<br />
zentrifugalen Kräften unterliegen und daher in hohem Maße <strong>als</strong> »fraktioniert«<br />
erscheinen. Daraus entstehen neue, für die Schule gerade auch in den Industriestaaten ungewohnte<br />
Konfliktpotentiale und soziale Bruchlinien. Im Vordergrund steht die Beobachtung – oder auch nur<br />
die Vermutung – der sozialen und kulturellen Desintegration und mentalen Verunsicherung auch<br />
bei den Lehrerinnen und Lehrern selbst. Das mag insofern überraschen, <strong>als</strong> die Prozesse der<br />
Globalisierung und Universalisierung begrifflich und realpolitisch ja zunächst Integrationsprozesse<br />
und Angleichungsvorgänge bezeichnen sollen. Doch treten hier die schon erwähnten sozialen und<br />
kulturellen Gegenströmungen in den Vordergrund, die für die innergesellschaftliche Wahrnehmung<br />
der Folgen der Globalisierung signifikanter zu Tage treten <strong>als</strong> die ökonomisch-strukturellen<br />
Angleichungsprozesse selbst.<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 11
Beginnen wir mit der schulischen Wahrnehmung materiell-struktureller Veränderungen. Von vielen<br />
Lehrerinnen und Lehrern wird ein Verlust der Homogenität der Schülerschaft wahrgenommen und<br />
<strong>als</strong> Problem für die eigene <strong>Unterricht</strong>sführung definiert. [35] Im Hintergrund stehen die regionalen<br />
und globalen Migrationsprozesse, die im Rahmen der Herausbildung hoch differenzierter »Sub-Milieus«<br />
zu einer ethnisch-kulturellen Fraktionierung der Bevölkerung und damit auch der Schülerschaft<br />
führen. Dabei spielen innerschulisch die Migrations-Bedingungen und -Ursachen ebenso<br />
wenig eine bedeutsame Rolle wie die qualitativen Unterschiede in den Lernvoraussetzungen und<br />
kulturellen Orientierungen der Schülerinnen und Schüler. Inhomogenität <strong>als</strong> solche und Fremdheit<br />
bzw. Distanz werden pauschal und weitgehend undifferenziert <strong>als</strong> Entitäten und wenig beeinflussbare<br />
Existenzvoraussetzungen wahrgenommen. Anstelle einer notwendigen Differenzierung<br />
der <strong>Unterricht</strong>sstrategien erfolgt tendenziell sogar eine Entdifferenzierung in der Wahrnehmung<br />
sozialer und ethnischer Dichotomien. [36] Es ist hier nicht der Ort, die sozialpsychologischen<br />
Grundlagen dieser inadäquaten Reaktionen zu untersuchen; die Stereotypien- und Vorurteilsforschung<br />
hat dazu ebenso wie die Didaktik der Politischen Bildung seit den klassischen Untersuchungen<br />
von Adorno et al. [37] maßgebliches ausgesagt. Die kulturelle Seite dieser Fremdheitswahrnehmung<br />
ist auch im Rahmen des tiersmondisme [38] und vor allem der französischen kritischen<br />
Ethnologie [39] aufgearbeitet worden.<br />
Untersuchen wir die Ursachen dieser innerschulischen Problemdifferenzierungen, so müssen wir,<br />
entgegen der Eigenwahrnehmung in der Schule, gerade die externen Verursachungsfaktoren in den<br />
Vordergrund rücken. Migrationswellen, die das heutige Weltsystem maßgeblich bestimmen – was<br />
an sich in der Weltgeschichte nichts Neues ist, da auf Veränderungsprozesse und Notlagen immer<br />
schon Migrationen und »Völkerwanderungen« sinnvolle und notwendige Reaktionen waren [40] –<br />
sind vor allem auch Reaktionen auf sozioökonomische Veränderungen, die durch Globalisierungsprozesse<br />
verursacht werden. Das führt nicht zu einer stärkeren regionalen Differenzierung zwischen<br />
unerwünschten Migranten und zur Binnenmobilität gezwungenen Arbeitnehmern, sondern auch zu<br />
einer Chancendifferenzierung zwischen der an Globalisierungsprozessen und internationaler<br />
Mobilität teilhabenden Oberschichten [41] und regional immer stärker staatlich festgelegten Unterschichten.<br />
So wird gleichermaßen auch die soziale Hierarchisierung verstärkt und das Spannungsniveau<br />
gesellschaftlicher Konflikte deutlich erhöht.<br />
Zweitens führt es in der Schule erfahrbar zu einer stärkeren Ausprägung sozialer Differenzen und<br />
zur Vergrößerung des Anteils Armer und Bedürftiger in der Schülerschaft. Dieses ist tendenziell<br />
ursächlich mit Globalisierungsprozessen verbunden.<br />
Gegen diese Gruppe richten sich von Seiten der traditionellen Mittelschichten verstärkt ebenso<br />
ausgrenzend-aggressive Vorurteile und Ablehnung wie gegen die Gruppe der Migranten insgesamt.<br />
So kommt die Schule in eine letztlich von ihr selbst kaum zu lösende Konfliktlage zwischen den<br />
Privilegierungsansprüchen der traditionellen Mittelschichten einerseits, die an Bilder von Schule<br />
und <strong>Unterricht</strong> appellieren, die von einer Mehrzahl der Lehrerinnen und Lehrer vor allem in den<br />
weiterführenden Schulformen entsprechend ihrer eigenen sozialen Herkunft geteilt werden. Diese<br />
Ansprüche kollidieren mit den grundgesetzlich verankerten Bildungs-, Ausbildungs- und Qualifizierungsansprüchen<br />
einer neuen Schülerklientel hoher Differenziertheit und kulturell-ethnischer<br />
Abgrenzung, die daher oft gar nicht zu einer gemeinsamen und schon gar nicht einer identischen<br />
Interessenwahrnehmung und damit zu einer Gegenmacht zu Privilegierungsanmaßungen in der<br />
Lage sind.<br />
2.23 Lehrersituation und Schulinstitution<br />
Wesentlichen Anteil an der heutigen Erschwernis, einen projektorientierten <strong>Unterricht</strong> in den<br />
gesellschaftswissenschaftlichen Fächern, vordringlich gerade auch im Erdkundeunterricht, der von<br />
der empirischen Arbeit »im Gelände« so abhängig ist wie der <strong>Politik</strong>unterricht von der realen<br />
Erfahrung in der Gesellschaft, <strong>als</strong> »Normalangebot« der Schule durchzusetzen, liegt aber auch an<br />
zunehmend restaurativen Bildungsvorstellungen in der Schulpolitik, unabhängig von der Partei-<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 12
zugehörigkeit der Kultusminister bzw. -ministerinnen, wie das Beispiel Niedersachsen sehr deutlich<br />
zeigt. [42]<br />
Primäres Ziel der Bildungspolitik scheint derzeit zu sein, konservativer Schulkritik und vor allem<br />
eher gymnasial ausgerichteter Elternvereine und -vertretungen durch politische Spannungen vermeidende<br />
und gesellschaftliche Konflikte zu unterlaufende Maßnahmen zuvorzukommen. Im Vordergrund<br />
stehen dabei Formalkriterien wie Verminderung des <strong>Unterricht</strong>sausfalls (völlig unabhängig<br />
davon, wie sinnvoll oder zwangsläufig seine Ursachen auch sein. mögen; dabei soll zudem<br />
grundsätzlich die Neueinstellung von Lehrerinnen und Lehrern restriktiv erfolgen). [43]<br />
Ein weiteres Element dieser restaurativen Bildungspolitik ist die scheinbar fortschrittliche Förderung<br />
verpflichtender Schulprogramme, die scheinbar und vorgeblich eine erhöhte Vergleichbarkeit<br />
zulassen, vordergründig Verantwortung an die Schulen delegieren, tatsächlich aber zu einem wirkungsvollen<br />
Instrument pädagogischer und didaktischer Nivellierung und Entdifferenzierung bzw.<br />
Homogenisierung [44] werden können, indem pädagogische Experimente durch Mehrheitsvoten und<br />
die Persistenz einmal getroffener Entscheidungen blockiert, didaktischer Fortschritt durch Abstimmung<br />
verhindert und scheinbar individuell auf die jeweiligen Lerngruppen und Lernsituationen<br />
eingehende <strong>Unterricht</strong>skonzeptionen zu Gunsten vorgeblicher »fachlicher Vergleichbarkeit« reduziert<br />
wird. Gleichzeitig werden solche Schulprogramme, zumindest bei der derzeitigen Zusammensetzung<br />
der Lehrerschaft, zu einem zusätzlichen Hemmnis betreffend einer engeren Verzahnung<br />
der wissenschaftlichen Didaktik mit der alltäglichen Schulpraxis. Das was der Staat<br />
insgesamt nicht mehr <strong>als</strong> Homogenisierungsleistung durchsetzen kann, soll oder will, wird im<br />
Subsidaritätsprinzip an die schulischen Instanzen delegiert und damit doppelt effizient durchgesetzt,<br />
an Stelle der eigentlich notwendigen Überlegung, Schuldidaktik prinzipiell zu dynamisieren, an den<br />
fortschreitenden gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Diskursen zu beteiligen und letztlich<br />
widerständig zu machen.<br />
3. Notwendiger Paradigmenwechsel der <strong>Politik</strong>didaktik<br />
3.1 Widerständigkeit statt auf Nationsmythen fixierte Affirmation<br />
Wenn das »Politische« selbst, Gegenstand der Politischen Bildung wie des <strong>Politik</strong>unterrichtes, in<br />
unserer Gesellschaft in Frage gestellt wird, ist es nur folgerichtig, von einem Bedeutungsverlust und<br />
Legitimationsdefizit der Träger der Politischen Bildung zu sprechen. Dies wird in der politischen<br />
Öffentlichkeit noch dadurch verstärkt, dass Politische Bildung generell unter inhaltliche Legitimationszwänge<br />
gesetzt wird, die an anderer Stelle zu erörtern sind und davon abhängen, dass Politische<br />
Bildung in ihrem Selbstverständnis zumeist nicht-affirmative, distanzierende und kritisch-rationale<br />
Lernprozesse zu evozieren sucht, die das Fach in Widerspruch zu Legitimationswünschen der institutionellen<br />
<strong>Politik</strong> und der Machteliten in der Gesellschaft bringt.<br />
Bildungstheoretiker sehen die genannten Bedeutungsverluste bezogen auf die Sozialisationsbedingungen<br />
des Einzelnen viel grundsätzlicher und beobachten einen Bedeutungsverlust und Legitimationsdefizit<br />
der Träger der schulischen Sozialisation. Dies liegt einmal an dem aus unserem<br />
ersten Punkt hervorgehenden Eindruck des Bedeutungsverlustes aller staatlichen (politischen) Institutionen,<br />
der real unterstützt wird durch die immer größere Distanz zwischen Entscheidungs- und<br />
Wirkungsebene im Rahmen der Globalisierungs- und Universalisierungsprozesse; zum anderen an<br />
den Veränderungen der individuellen Entwicklungsabschnitte zwischen Kindheit, Adoleszenz,<br />
Post-Adoleszenz und Erwachsensein, wobei immer mehr immer wirksamere nicht-familiale, unpersönliche<br />
und öffentliche Einflüsse immer früher auf den Sozialisationsprozess einwirken und fest<br />
gefügte Intimität und Privatheit tendenziell in Frage stellen. Die Sozialisation wird damit in hohem<br />
Maße unvorhersehbar und unsteuerbar, was den erzieherischen Einfluss von Elternhaus und Schule<br />
– und damit auch die real zu fordernde Erziehungsverantwortung – zurückdrängt und grundsätzlich<br />
immer mehr in Frage stellt. Diesen Einschränkungen ist aus denselben Gründen neben der<br />
familialen Sozialisation auch die schulische Bildung ausgeliefert, bei der der Bedeutungsverlust im<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 13
öffentlichen Bewusstsein wie in den Lebenskonzeptionen der Schülerinnen und Schüler noch viel<br />
offensichtlicher wird. [45]<br />
Politische Bildung hat sich mit der rational-distanzierten Aufarbeitung der existentiellen und<br />
mentalen Folgen dieser veränderten Sozialisationsbedingungen und Lebensperspektiven auseinanderzusetzen.<br />
In dem Maße, in dem schulisch-institutionelle und staatliche Erziehungseinrichtungen und <strong>Unterricht</strong>ssituationen<br />
fragwürdig und einer erneuten Legitimierung bedürftig werden – sowohl gegenüber<br />
den Schülerinnen und Schülern selbst, <strong>als</strong> auch gegenüber der Öffentlichkeit, die zunächst von<br />
der Elternschaft repräsentiert wird –, muss das historisch gewachsene staatliche System der<br />
Institutionen und Einrichtungen kritisch in das wissenschaftliche und didaktische Blickfeld<br />
genommen werden.<br />
Es stellt sich mit Nachdruck die Frage nach der staatlichen Kompetenz und Fähigkeit, Bildungsziele<br />
zu setzen und adäquat zu konkretisieren, schulische <strong>Unterricht</strong>e zu bestimmen. Dass in den neueren<br />
Rahmenrichtlinien des Faches <strong>Politik</strong> von den Lernzielkonzepten oder der inhaltlichen Lehrplanfestlegung<br />
zunehmend abgegangen wird zu Gunsten des Konzeptes der Schlüsselprobleme, auf<br />
das wir hier inhaltlich unsere Aufmerksamkeit konzentrieren werden, zeigt, dass zumindest an<br />
aufgeschlosseneren Kultusministerien der dargestellte aktuelle Problemkontext nicht vorbei<br />
gegangen ist.<br />
Doch sind die zu Grunde liegenden Fragestellungen damit noch nicht abschließend geklärt. Claußen<br />
(z.B. »politik unterricht aktuell«) und Voigt (1999) stellen diese Frage ganz grundsätzlich und<br />
fordern die Distanz zu den »Selbstverständlichkeiten« der Staatsgesellschaft und des Staates<br />
(„Staatsapologetik“ bei Claußen, , Bernhard, 1994: Strukturveränderungen politischer Herrschaft,<br />
Sozialisation und Politische Bildung: Prospektive Reflexionen über ihren Zusammenhang, politik<br />
unterricht aktuell, Heft 2 / 1994. - Claußen, Bernhard, 1993: Von der nationfixierten Systemapologetik<br />
zum interkulturellen Lerndiskurs. Historisch-systematisch orientierte Anmerkungen zu<br />
Paradigmatischen Wandlungstendenzen in der Politischen Bildung. In: Voigt, Gerhard, Hg., 1993:<br />
Interkulturelles Lernen. Schriftenreihe des UNESCO-Clubs für die UNESCO-Schule am Maschsee,<br />
Bismarckschule Hannover, Heft 5. Hannover. S. 55-76. ) sowie des Nationenbegriffes. Damit<br />
tendiert Politische Bildung zunächst nicht zu einer grundsätzlichen »Fundamentalablehnung« des<br />
Staates – oder gar der Demokratie, wie es ihr konservativerseits manchmal vorgeworfen wird –,<br />
sondern fordert ein widerständiges Selbstverständnis und die Erziehung zur Fähigkeit zur eigenen<br />
Widerständigkeit, d.h. damit vor allem zur Fähigkeit distanzierten und selbstdistanzierten Denkens,<br />
zu Rationalität – aber auch zu Empathie. Dieses kritisch-widerständige Denken begreift Staat und<br />
Nation nun nicht mehr <strong>als</strong> Selbstverständlichkeiten, sondern <strong>als</strong> historisch-prozessuale Entitäten<br />
und Artefakte, die verändernder und entwickelnder politischer Handlung offen stehen. Der<br />
Leitbegriff der Nation, wie die Begriffe von Volk und Ethnie werden <strong>als</strong> machtprozessual in<br />
gesellschaftlichen Figurationen verortete Legitimationsmythen begriffen, die einer kritisch-distanzierten<br />
Aufklärung bedürfen.<br />
Widerständigkeit [46] der Politischen Bildung und der <strong>Politik</strong>didaktik ist daher zuallererst gegen<br />
staatsaffirmative, nicht rational fundierte Erziehungskonzepte anzustreben, Kritik an den<br />
herrschenden Nationalitäts- und Ethnizitätsmythen, die irrationale »Zusammengehörigkeitsgefühle«<br />
<strong>als</strong> machtprozessuale Homogenisierungsstrategien und -mittel im Prozess des nation building<br />
einsetzen, ist die fachliche Grundlage dieses aufklärerischen didaktischen Konzeptes.<br />
3.2 Diskursorientierte didaktische Konzepte<br />
Der Hinweis auf die unterschiedlichen Zeitdimensionen und Zeitvorstellungen gesellschaftlicher<br />
Zielvorstellungen und gesellschaftlichen Handels ist notwendig.<br />
Sehr vordergründig ist dies bereits das zentrale Motiv der globalen Ökologiebewegung nach der<br />
MIT-Studie des »Club of Rome«.<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 14
Philosophisch ist der Blick auf die theoretischen Konzepte von Braudel (»Die lange Dauer«)<br />
sinnvoll, oder die interkulturellen Zeitkonzepte bei Wendorff oder aus der Zivilisationstheorie abgeleitet<br />
bei Waldhoff (1995).<br />
Aufzugeben ist die Vorstellung, Schule und Politische Bildung könnten Agenturen der zielgerichteten<br />
Steuerung politischen und gesellschaftlichen Wandels sein. Dies ist zu vordergründig und widerspricht<br />
der Einsicht in die zugrunde liegenden Sozialisations- und Enkulturationsprozesse, die<br />
vor allem in der Entwicklung der Vorstellung der Differenz gründen. Politischer Wandel erfolgt<br />
über Dissonanz- und Differenzerfahrungen, nicht jedoch durch das Erlernen politischer Ziele.<br />
Abschließend sollten drei mögliche Wirkungsdimensionen der Politischen Bildung angesprochen,<br />
charakterisiert und diskutiert werden:<br />
Politische Bildung vermittelt die Fähigkeit zur Alternative, d.h. sie hilft bei der Entwicklung einer<br />
differenzierten Persönlichkeit; Alternativen haben hierbei sowohl eine wichtige kognitive Fundierung<br />
nötig, <strong>als</strong> auch einen affektiv-emotionalen Rahmen, der <strong>als</strong> Widerstand oder Blockierung<br />
erfahrbar und meist biographisch verortbar ist.<br />
Politische Bildung entwickelt durch die systematische Einbeziehung in reflektive schulische und<br />
gesellschaftliche Diskurse die Fähigkeit zum distanzierten und selbstdistanzierten Denken, was<br />
durchaus im Widerspruch zu traditionellen Forderungen nach emotionaler Geborgenheit und<br />
Wärme stehen kann und muss, aber in der Dialektik von Globalisierungszwängen und Individualisierungszumutung<br />
notwendige Persönlichkeitsausstattung sein muss.<br />
Politische Bildung versteht sich selbst <strong>als</strong> rekursiver und selbstreferentieller Teil umfassender<br />
gesellschaftlicher Diskurse. In diesem Sinne orientiert sich Politische Bildung nicht nur an<br />
Schlüsselproblemen der Gesellschaft, sondern trägt zu deren Entwicklung und diskursiven Erhellung<br />
bei.<br />
Politische Bildung versteht sich <strong>als</strong> Teil und Agens einer »Zweiten Zivilisation« parallel zur Forderung<br />
nach einer »Zweiten Aufklärung«.<br />
Diese Charakteristiken der Politischen Bildung in didaktische und curriculare Konzeptionen<br />
umzusetzen, verlangt inhaltliche Konzeptualisierungen, die von den üblichen Inhalts- und Problemsetzungen<br />
durch die Schulbehörde, die Schule oder die Lehrkräfte selbst grundsätzlich abweichen.<br />
Zum einen trägt der Gedanke, der Didaktik sei („handwerkliche“) Umsetzung von Wissenschaft,<br />
den „Bezugswissenschaften“, in der heutigen gesellschaftlichen und schulisch-institutionellen<br />
Realität nicht mehr. Dazu ist der dieser Vorstellung zu Grunde liegende Wissenschaftsbegriff<br />
„idyllisiert“ und mit Wahrheitsansprüchen etikettiert, die einem philosophisch und soziologisch<br />
verantworteten Wissenschaftskonzept nicht mehr entsprechen. Realitätserhellung geschieht nicht<br />
(nur) durch Wissensvermittlung, sondern durch situatives Erarbeiten adäquater Realitätsperspektiven<br />
höherer Selbstreferenzialität – auch und gerade im <strong>Unterricht</strong>. Politische Bildung ist<br />
daher potentiell immer interdisziplinär und <strong>als</strong> offener Arbeitsauftrag zur kontinuierlichen Realitätserschließung<br />
zu verstehen.<br />
Das Problem staatsaffirmativer Grundkonzepte der Politischen Bildung ist schon erörtert und<br />
zurückgewiesen worden. Widerständigkeit und gesellschaftlich adäquate Realitätsperspektiven<br />
entwickelt Politische Bildung nur durch die diskursive Einbeziehung in die gesellschaftliche<br />
Meinungs- und Willensbildungsprozesse und die kritisch-distanzierte Bezugnahme auf die<br />
herrschenden kulturellen Wert-, Verhaltens- und Symbolinventare.<br />
<strong>Unterricht</strong>sinhalte sind keine Entitäten der gesellschaftlichen Realität, sondern sie bilden<br />
gesellschaftliche Realität symbolisch ab. <strong>Unterricht</strong> ist dabei Teil einer symbolischen Interaktion [47] ,<br />
bei der wissenschaftspropädeutische Relevanz- und Realitätskriterien aus der expliziten Thematisierung<br />
der Rezeptionsvorgänge selbst im Rahmen eines reflexiv-distanzierten, tendenziell<br />
selbstreferenziellen Diskurses gewonnen werden.<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 15
Diese Charakteristiken erweisen die zentrale Bedeutung eines didaktischen Ansatzes, der in den<br />
gesellschaftlichen Diskursen fundiert ist und sich selbst <strong>als</strong> integraler Bestandteil eben dieser<br />
Diskurse versteht. Der Diskursbegriff selbst müsste in seiner philosophischen und theoriegeschichtlichen<br />
Bedeutung eingehender untersucht und kritisch gewürdigt werden. Das kann an<br />
dieser Stelle nicht geschehen. Es sollte nur auf den Doppelcharakter des Begriffes hingewiesen<br />
werden, der in seiner Konsequenz über den in diesem Aufsatz zu Grunde gelegten pragmatischen<br />
Gebrauch des Diskursbegriffes hinausweist. Nach Habermas ist der Diskurs Element eines<br />
gesellschaftlich-ethischen Handlungskonzeptes, der Diskursethik. Der »herrschaftsfreie Diskurs«<br />
folgt dem anthropologischen Leitbild des freien, verantwortlichen und gleichen Bürgers, der in den<br />
selbst gestalteten Diskurs um die gesellschaftlichen Ziele und politischen Handlungsperspektiven<br />
eintritt und diese damit letztlich verantwortet. Es ist eine zutiefst demokratisch-egalitäre gesellschaftliche<br />
Zielvorstellung, in der Herrschaftsabbau und eine optimistische Anthropologie<br />
Fortschritt und Gerechtigkeit in einer Form garantieren, die mit der ökonomistischen Bezeichnung<br />
Sozialismus nur unzureichend gekennzeichnet wäre. [48] Wir nehmen die positiven gesellschaftlichethischen<br />
Konnotationen Diskursbegriffes gerne war, beschränken uns aber auf das Konzept, das im<br />
Diskurs die differenzierte und vermittelnde (auch symbolische, auch durch Medien vermittelte)<br />
Kommunikation in der Gesellschaft ins Auge fasst und sie auf der einen Seite von der Ebene einer<br />
umfassenderen, persistenteren bzw. nur begrenzt aktiven Veränderungs- und Entwicklungsstrategien<br />
ausgesetzten Politischen Kultur, in der sich die historische Erfahrung einer Gesellschaft<br />
in Wert- und Handlungsoptionen und in verfügbaren Symbolinventaren verfestigt (die dann den<br />
aktuellen Diskursen die kommunikative Basis geben), auf der anderen Seite von der Ebene der<br />
persönlichen, privaten, in abgeschlossenen intimeren Gruppen ablaufenden Kommunikations- und<br />
Interaktionsbeziehungen absetzt. Demgegenüber sind öffentliche Diskurse prinzipiell für alle offen,<br />
aber durchaus nicht allen zugänglich. Ein diskursives Konzept der Didaktik der Politischen Bildung<br />
zielt nun gerade darauf, solche Diskurse verfügbar und beeinflussbar zu machen und sie <strong>als</strong> das<br />
eigentliche Medium des Politischen zu versehen und <strong>als</strong> Ebene von politischen Handlungsoptionen<br />
zu begreifen. Da aber Schule, <strong>Unterricht</strong> und Politische Bildung nicht über unbegrenzte<br />
Diskursressourcen, sowohl was die Lehrerinnen und Lehrer, die Schülerinnen und Schüler <strong>als</strong> auch<br />
die formal-institutionellen Rahmenbedingungen der Schule angeht, müssen Kriterien der Auswahl,<br />
der Entwicklung, der Umsetzung und der Inwertsetzung öffentlicher Diskurse gefunden werden.<br />
Unsere These ist es, dass die Diskurse selbst Instrumentarium und Kriterien zur Auswahl und<br />
Relevanzprüfung wie zur methodischen Umsetzung bergen, dass <strong>als</strong> Didaktik einerseits sich <strong>als</strong> Teil<br />
dieser öffentlichen gesellschaftlichen Diskurse verstehen muss, andererseits aber auch gezwungen<br />
ist, sich in diesen Diskursen zu behaupten und zu legitimieren. Dieser methodische Zugang zum<br />
didaktischen Arbeiten in Diskursen konkretisiert sich derzeit im Konzept der Schlüsselprobleme.<br />
Hier wäre noch kritisch auf das jüngst veröffentlichte Gutachten des Sachverständigenrates Bildung<br />
der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung „Jugend, Bildung und Zivilgesellschaft“ zur<br />
Entwicklung der Bildung in Deutschland einzugehen. Die in diesem Gutachten aufgeführten<br />
Zielbestimmungen einer zukunftsorientierten Bildung stehen in der Tradition eines an<br />
gesellschaftlicher Verantwortung orientierten <strong>Unterricht</strong>sverständnisses und repräsentieren somit<br />
ein Menschenbild, das weitgehend auch von unserer Untersuchung geteilt werden kann und weckt<br />
die Hoffnung, dass damit die in dem Text selbst angesprochenen, aber durch den Verantwortungsbegriff<br />
eingegrenzten emanzipatorische Diskurse in der Öffentlichkeit wieder breiteren Raum<br />
gewinnen können: „Leitbild der Bildung ist der freie Mensch, der aus eigenem Interesse sein Leben<br />
in Verantwortung für sich selbst wie für andere Menschen und für die Gesellschaft gestaltet, nicht<br />
das von jeder Verpflichtung ‚emanzipierte‘ Individuum. ... Das Lehrerbild darf sich nicht nur an der<br />
individuellen <strong>Unterricht</strong>sgestaltung orientieren, sondern muss auch auf die kooperative Gestaltung<br />
des pädagogischen ‚ Gesamtkunstwerks‘ Schule ausgerichtet sein; deren Eigenverantwortung ist der<br />
Rahmen für die Arbeit der einzelnen Lehrerin, des einzelnen Lehrers...“ Es sind hier zwei bezeichnende<br />
Textstellen ausgewählt worden, die für die wenig konkrete Argumentationsstruktur des<br />
Gutachtens ebenso typisch sind wie für einige widersprüchliche Denk- und Werttraditionen der<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 16
gewerkschaftlichen Linken. Die Formulierungen bleiben ausdeutbar und sind von einer für ein<br />
Gutachten eigentlich zu großen interpretatorischen Beliebigkeit, deren Didaktisch-methodische<br />
Umsetzung nicht unmittelbar aus den Argumentationskontexten herleitbar ist. Zum weiteren ist das<br />
Bildungskonzept, das letztlich aus der Arbeiterbewegung heraus sich entwickelt hat, uneindeutig in<br />
der nur leerformelhaften Verklammerung individualistischer, emanzipatorischer Wertbestimmungen<br />
und ihrer Einbindung in das Verantwortungskonzept, das hier in der Tradition kollektivistischer<br />
Traditionen steht, die letztlich aus dem revolutionären Egalitätspostulat herzuleiten ist.<br />
Es fehlt hier ein philosophisch-methodischer Ansatz, der diese Denkpolarität dynamisiert und „zum<br />
Tanzen bringt“. Der Bildungsbegriff bleibt statisch-normativ und widerspricht damit moderneren<br />
auf (symbolische) Interaktion und (kulturelle) Kommunikation aufbauenden prozessualen Gesellschaftsvorstellungen.<br />
Die Folge wäre letztlich ein moralisierendes Bildungsverständnis, dessen<br />
Problematik wir schon erörtert haben. Hier könnte die bewusste Einbeziehung des Diskurskonzeptes,<br />
u.U. gerade in Erfüllung der deutlichen Wertdimensionen des Gewerkschaftspapiers<br />
rekurrierend auf Habermas’ Diskursethik, Missverständnisse und Folgenlosigkeit abwenden helfen.<br />
Mit diesen Charakteristiken ist das Papier des Sachverständigenrates trotz aller bedenkenswerten<br />
Überlegungen und Argumente noch keine gültige Antwort auf die Krisenanalyse, von der wir in<br />
unseren eigenen Überlegungen ausgegangen sind. Denn es widerspricht damit auch der hieraus<br />
entwickelten Vorstellung, dass Werte und gesellschaftliche Handlungsoptionen nicht postuliert,<br />
sondern in einer offenen, kulturell sich fraktionierenden postmodernen Gesellschaft nur in<br />
diskursiven Prozessen, das heißt nur vermittels Interaktion und Kommunikation in den gegebenen<br />
und sich entwickelnden gesellschaftlichen Figurationen handlungsleitend werden können; ansonsten<br />
bleiben sie, ganz im Sinne eines säkularen Laizismus Privatangelegenheit des Einzelnen.<br />
Damit wird auch deutlich, wie eine Gegenposition zu dem Gewerkschaftspapier aussehen könnte,<br />
gerade wenn dessen Intentionen zu akzeptieren sind: <strong>als</strong> diskursorientiertes didaktisches Konzept.<br />
3.3 Das traditionelle Beharrungsvermögen im Selbstverständnis von<br />
Fachlehrerinnen und Fachlehrern<br />
Sucht mach nach tiefer liegenden Ursachen der Persistenz überkommener und zunehmend obsolet<br />
gewordener pädagogischer und fachdidaktischer Strukturen und Konzepte, so sind Begründungszusammenhänge<br />
in grundlegenden Verfestigungen innerhalb der Politischen Kultur unserer<br />
Gesellschaft zu sehen, vor allem was die Verankerung der schulischen Bildung in den weitgehend<br />
unumstrittenen Wertvorstellungen angeht. Daher ist es nicht verwunderlich, wenn ähnliche kritische<br />
Perspektiven nicht nur für die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer aufgezeigt werden können,<br />
sondern dass diese eigentlich in allen Sektoren unseres Bildungswesens Gültigkeit beanspruchen<br />
können.<br />
In der konkreten schulischen Situation zeigt sich das vor allem in der immer wieder zu beobachtenden<br />
Hemmnis, sich – das eigenen überkommenen Selbstverständnis infrage stellend – mit innovativen<br />
Fachkonzepten einzulassen, kritische und selbstbezügliche wissenschaftliche Entwicklungen<br />
aufzugreifen und umzusetzen und überhaupt Veränderungen der gesellschaftlichen Bedeutungskategorien<br />
auch nur anzudenken.<br />
Dafür ist das Fach Erdkunde ein besonders auffälliges Beispiel. Besonders deutlich wird diese<br />
»Scheuklappensicht« der fachlichen Perspektiven auch im Fach Geschichte. Es mangelt der<br />
Mehrzahl der <strong>als</strong> Schuldidaktiker tätigen Historikerinnen und Historiker an der Bereitschaft,<br />
tradierte Methoden des Geschichtsunterrichtes prinzipiell in Frage zu stellen. Hier nimmt z.B. das<br />
fiktive »historische Kontinuum« einen ähnlich unumstößlichen und inadäquaten Platz ein wie in der<br />
Geographie das Ideologem vom »räumlichen Kontinuum«. In beiden Fällen werden daraus<br />
didaktische Konsequenzen in Richtung auf fachliche Sequenzialität und fachintern zu bestimmenden<br />
»Vollständigkeitskonzepte« eines herkömmlichen Grundbildungsverständnisses gezogen, die<br />
sowohl einerseits die lernpsychologisch zu begründenden unterrichtlichen Rezeptionssituationen,<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 17
die <strong>als</strong> Interaktions- und Kommunikationsorte zu definieren sind, <strong>als</strong> auch andererseits die gesellschaftlichen<br />
Diskurse ausblenden. Dass daraus nur herkömmlicher Vermittlungsunterricht zu entwickeln<br />
ist, dürfte klar daraus hervorgehen. [49]<br />
Gerade der Mangel an fachlicher und gesellschaftlicher Diskursorientierung ist dann auch ein<br />
Hemmnis, im Fach Geschichte die komplexeren Ansätze z.B. der historischen Soziologie, der<br />
Zivilisationsforschung oder der Ansätze der Geschichte der Politischen Kulturen aufzugreifen und<br />
umzusetzen. Das Unverständnis, mit dem auch angesehene Fachhistoriker in ihrer Rolle <strong>als</strong><br />
»gelernte Historiographen« Werken der historischen Soziologie begegnen, ist auffällig und zu<br />
bedauern. [50]<br />
In der Geographie wäre es ebenfalls an der Zeit, intensiver in die kultur- und wirtschaftsgeographischen<br />
Analysen Ansätze der Zivilisationsgeschichte und z.B. der Weltsystem-Theorie<br />
Wallersteins mit einzubeziehen, auch um die in ihrem Realitätsgehalt – nicht in Fragestellung und<br />
Motivation! –zunehmend fragwürdig werdenden Kategorien und Begriffsmuster der »Dritte-Welt«-<br />
Forschung oder der »Entwicklungstheorien« neu zu überdenken – oder wie Wallerstein formuliert:<br />
„Unthinking Social Sciences“! [51] Diese kritischen Perspektiven bleiben jedoch noch immer weitgehend<br />
im universitären Raum und dringen auch dort nur langsam zu den Didaktikern durch. Dabei<br />
wäre eine permanente fachliche Neuorientierung gerade in den Schulen dringend notwendig. Hier<br />
besteht unmittelbarer Handlungsbedarf!<br />
Ein möglicher Ansatz, diese Situation aufzubrechen, wäre, die z.T. in den gültigen Rahmenrichtlinien<br />
angeführten Ansätze der didaktischen Orientierung an »Schlüsselprobleme« [52] inhaltlich<br />
ernst zu nehmen und <strong>als</strong> Diskurs- und Dynamisierungsangebote und -potentiale zu begreifen. Dazu<br />
müsste aber eine intensive Förderung einer diesbezüglichen Lehrerfortbildung und ein Eingehen der<br />
Hochschulen auf diese Qualifikationsdefizite erfolgen. Die derzeitige Schul- und Wissenschaftspolitik<br />
steht dem, z.B. durch die zeitliche und finanzielle »Austrocknung« der Lehrerfortbildung<br />
diametral entgegen.<br />
Das Résumé dieser Thesen und Überlegungen ist somit eher pessimistisch: Ansätze zu einer<br />
grundlegenden Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine Erneuerung der Geographiedidaktik<br />
in der Schulpraxis sind m. E. gegenwärtig nicht erkennbar, es gilt aber, einen dementsprechenden<br />
öffentlichen Diskurs anzustoßen.<br />
4. »Schlüsselprobleme« <strong>als</strong> gesellschaftliche Diskursfelder<br />
4.1 Probleme der curricularen Eignung des Konzeptes der »Schlüsselprobleme«<br />
Das Konzept der »Schlüsselprobleme« geht auf Klafki [53] zurück und hat sowohl in der Fachdidaktik<br />
wie in neueren Rahmenrichtlinien vor allem des gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeldes<br />
Resonanz gefunden. »Schlüsselprobleme« zu formulieren ist zunächst einmal ein Versuch,<br />
von der engen thematisch-inhaltlichen Formulierung von Richtlinien und Fachcurricula weg zu<br />
kommen, deren normativer Charakter einen konsensfähigen Bildungs- oder Allgemeinbildungsbegriff<br />
voraussetzen würde, der in dieser Form in unserer Gesellschaft weder in der Öffentlichkeit<br />
noch bei Schulpolitikern noch existiert. Dies gilt insbesondere, wenn in der Publizistik immer<br />
wieder methodisch recht oberflächliche und im Ergebnis untaugliche Versuche gemacht werden,<br />
solche »Bildungsstandards« in einem fiktiven Bildungskanon zu fixieren und zu behaupten. [54] Dass<br />
Klafkis Intentionen selbst eher auf eine Rettung des traditionellen Allgemeinbildungsbegriffes<br />
hinauslaufen, zeigen spätere Aufsätze (Klafki 1990).<br />
Diese öffentlichen inhaltlich fixierten Allgemeinbildungsdiskurse eignen aber letztlich nur für<br />
tagespolitische Auseinandersetzungen zwischen den Parteien und politischen Strömungen und – in<br />
bedenklicher Weise – dazu, die Institution Schule in inadäquate Rechtfertigungszwänge für ihr<br />
scheinbares Ungenügen in der Wissensvermittlung zu bringen, die eine unabhängige oder gar<br />
widerständige Pädagogik zunehmend verunmöglichen und daher Teil des schon erörterten päd-<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 18
agogisch-didaktischen Rückschritts sind. Das liegt nun durchaus im kurzfristigen politischen<br />
Interesse einer inhaltlich eigentlich völlig ratlosen Schul- und Bildungspolitik, die damit ihr eigenes<br />
Versagen kaschieren kann, nicht jedoch im Interesse einer zukunftsoffenen Innovation der<br />
Didaktiken und der schulischen Curricula.<br />
So ist das »Schlüsselproblemkonzept« zunächst einmal pragmatisch zu begründen und dennoch<br />
durch seine immanenten diskursiven Strukturen ein Fortschritt gegenüber älteren Lehrplänen und<br />
Rahmenrichtlinienkonzepten, ein Fortschritt, den die Fachdidaktik umso deutlicher zur Umsetzung<br />
und Realisierung einfordern kann. Der tatsächliche Wert der Formulierung von »Schlüsselproblemen«<br />
erweist sich aber erst in ihrer methodischen Herleitung und wissenschaftlichen Fundierung,<br />
die erst zeigt, ob der Anspruch, mehr und qualitativ Anderes zu sein <strong>als</strong> nur eine neue Verbrämung<br />
von verbindlichen Themenvorgaben, eingehalten werden kann.<br />
Dazu muss vor allem verhindert werden, dass diese »Schlüsselprobleme« wieder <strong>als</strong> Themata<br />
ausformuliert und administrativ festgeschrieben werden. »Schlüsselprobleme« müssen in ihrer<br />
inhaltlichen Umsetzung grundsätzlich offen sein und ein dynamisches, diskursives Vorgehen bei<br />
der Findung und Gestaltung konkreter <strong>Unterricht</strong>sprobleme und unterrichtlicher Vermittlungssituationen<br />
nicht nur ermöglichen sondern herausfordern. Gerade diese Forderung stellt sich dann aber<br />
<strong>als</strong> grundlegendes Problem bei der Aufnahme des »Schlüsselproblem-Konzeptes« der Rahmenrichtlinien<br />
in den Schulen heraus.<br />
Die ersten Erfahrungen mit den neuen Rahmenrichtlinien auf der Grundlage von »Schlüsselproblemen«<br />
– in Niedersachsen ohnehin durch die parallel verbindlich gemachten Rahmenthemen im<br />
Sinne eines administrativen Formelkompromisses in ihrer direkten Wirkungsweise konterkariert –<br />
zeigen, dass eigentlich keine dem Verfasser bekannte Schule, vor allem keine Schule des<br />
Gymnasialbereiches, ernsthaft versucht hat, diese »Schlüsselprobleme« tatsächlich und konsequent<br />
aufzunehmen und umzusetzen. Die pädagogischen Potentiale des Konzeptes sind schlichtweg nicht<br />
erkannt worden, oder werden <strong>als</strong> belastende Neuerung unterlaufen und verdrängt. Soweit Lehrerinnen<br />
und Lehrer ohnehin noch traditionellen Grundbildungsvorstellungen verhaftet sind, ist es<br />
ihnen ohnehin wohl kaum möglich, die Bedeutung des alternativen diskursiven Konzeptes der<br />
»Schlüsselprobleme« zu ermessen und zu akzeptieren. Hier wäre nun eine wichtige Aufgabe der<br />
Hochschuldidaktik, in die Öffentlichkeit und in die Schulen wirkende innovative didaktische<br />
Diskurse zu initiieren. Bislang werden »Schlüsselprobleme« vorwiegend <strong>als</strong> Rahmenthemen<br />
missverstanden und in traditioneller Weise didaktisch-methodisch umgesetzt.<br />
Um einen Einblick in die administrative Umsetzung des »Schlüsselproblemkonzeptes« zu geben,<br />
soll noch einmal auf das Beispiel Niedersachsen zurückgegangen werden. In den Rahmenrichtlinien<br />
<strong>Politik</strong> [55] für die Sekundarstufe II wird das Schlüsselproblemkonzept folgendermaßen eingeführt:<br />
„Die skizzierten Herausforderungen lassen sich in sechs Schlüsselprobleme fassen, deren Lösung<br />
für die Menschen der heutigen und der zukünftigen Generationen im Interesse ihres Überlebens und<br />
ihrer Sicherheit von herausragender Bedeutung ist:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Frieden und Gewalt<br />
Ökonomie und Umwelt<br />
Technologischer Wandel<br />
Soziale Ungleichheiten<br />
Verhältnis der Geschlechter und der Generationen<br />
Herrschaft und Politische Ordnung<br />
Der Begriff des Problems verdeutlicht, dass grundsätzlich von einer zukunftsoffenen politischen Situation<br />
ausgegangen wird.<br />
Didaktisch eignen sich diese Schlüsselprobleme <strong>als</strong> Ausgangspunkte für die Auswahl und Legitimation<br />
von <strong>Unterricht</strong>sinhalten und <strong>als</strong> Orientierung für die Strukturierung von <strong>Unterricht</strong>sthemen. Die<br />
über die Schlüsselprobleme gewonnenen Inhalte und Strukturierungen werden bei der weiteren Pla-<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 19
nung des <strong>Unterricht</strong>s durch die fachwissenschaftlichen Dimensionen und <strong>Politik</strong>dimensionen ergänzt<br />
und differenziert.“ Die einzelnen Schlüsselprobleme werden dann in einzelnen Abschnitten<br />
inhaltlich und in Bezug auf ihre gesellschaftlich-politische Relevanz erläutert.<br />
Zwei argumentative Defizite, die wohl in Rahmenrichtlinien <strong>als</strong> administrativ-normativen<br />
Vorgaben (»Setzungen«) nicht zu vermeiden sind, haben aber mit zur Folge, dass ein umsetzungsfähiges<br />
Schlüsselproblemkonzept für die Schule wie für die einzelnen Kolleginnen und Kollegen<br />
nicht erkennbar und nachvollziehbar wird: Die Begründung der Schlüsselprobleme in den<br />
Rahmenrichtlinien erfolgt allein mit dem Argument der gesellschaftlichen Relevanz, die bei den<br />
genannten Schlüsselproblemen ja durchaus einsichtig, in ihrer Abgrenzung und Vollständigkeit von<br />
einer gewissen »Willkürlichkeit« behaftet ist, nicht jedoch mit Hinweis auf die diskursive Methode,<br />
in der die Besonderheit des Schlüsselproblemkonzeptes begründet liegt. Die Unterscheidung der<br />
Schlüsselprobleme von gesellschaftlichen Themenschwerpunkten wird nicht deutlich. [56] Zum<br />
andern ist die durchaus sinnvolle Erläuterung der didaktischen Eignung von Schlüsselproblemen<br />
„<strong>als</strong> Ausgangspunkte für die Auswahl und Legitimation von <strong>Unterricht</strong>sinhalten und <strong>als</strong><br />
Orientierung für die Strukturierung von <strong>Unterricht</strong>sthemen“ viel zu offen und unverbindlich, um<br />
ohne vorherige intensive Beschäftigung mit diesem didaktischen Konzept überhaupt zu sinnvollen<br />
unterrichtspraktischen Umsetzungen zu gelangen.<br />
Dies deutet wieder einmal darauf hin, die Frage zu stellen, ob es nicht Zeit ist, nach der Ersetzung<br />
von Richtlinien und Lehrplänen durch Rahmenrichtlinien in den 70er und 80er Jahren, einen<br />
weiteren Schritt zu wagen, und auch die Rahmenrichtlinien zu ersetzen durch aktuellere und<br />
angemessenere Formen der Bestimmung und inhaltlichen Ausgestaltung schulischer <strong>Unterricht</strong>ssituationen.<br />
Diese Forderung ist aber sicherlich zu verknüpfen mit grundlegenden Reformimpulsen<br />
in der Lehrerausbildung wie mit einer Neukonzeption von Lehrerfortbildung und Lehrerweiterbildung,<br />
die <strong>als</strong> permanente dienstliche Verpflichtungen verstanden werden müssen und entsprechend<br />
ihrer Bedeutung und ihrem notwendigen Zeitaufwand Eingang in die Arbeitszeitvorgaben<br />
und Stundenpläne der Lehrerinnen und Lehrer finden müssen. In diesem Falle ist ein<br />
sinnvolles Schlüsselproblemkonzept umsetzbar und kann zu einer grundlegenden Erneuerung des<br />
<strong>Unterricht</strong>s vor allem auch in der Politischen Bildung beitragen.<br />
Ohne an dieser Stelle ein positives Konzept der Entwicklung und Umsetzung von<br />
Schlüsselproblemen versuchen zu wollen, ist doch abschließend auf einige notwendigerweise zu<br />
berücksichtigende und zu diskutierende Determinanten des Schlüsselproblemkonzeptes hinzuweisen.<br />
Das Ziel, das mit einem Schlüsselproblemkonzept verfolgt wird, bedeutet, inhaltliche Entscheidungen<br />
für den Schulunterricht, vor allem in unserem Falle für den <strong>Politik</strong>unterricht, von<br />
administrativen, konventionellen und affirmativ-normativen Vorgaben und Plänen abzukoppeln,<br />
aus der Einsicht heraus, dass heute weder ein (fach-) wissenschaftliches oder (fach-) didaktisches<br />
Konzept in der Lage ist, unumstrittene und gültige Kriterien zur Auswahl von Lernstoffen<br />
anzubieten, noch dass in der (politischen) Öffentlichkeit davon ausgegangen werden kann, dass<br />
auch nur ansatzweise konsensfähige und praxistaugliche Vorstellungen über Bildungsziele, Lernschwerpunkte<br />
und <strong>Unterricht</strong>sinhalte – ja noch nicht einmal über die zu unterrichtenden Fächer und<br />
ihre Stundenanteile im Gesamtcurriculum! – gefunden werden können. Curriculare Entscheidungen<br />
von dieser biographischen und gesellschaftlichen Bedeutung sind daher weitgehend von kurzfristigen<br />
politischen Setzungen der Kultusministerien und Landtage mit ihren wechselnden politischen<br />
Mehrheiten ebenso zu lösen, wie von Konsens vorspiegelnden Formalkompromissen und<br />
inhaltsleeren Zielbeschreibungen.<br />
Der Ansatz, Schlüsselproblemkonzepte zu entwickeln, liegt in der Einsicht, dass es möglich sein<br />
kann, die für die Gesellschaft überlebensnotwendigen und zukunftsoffenen Problemfelder in<br />
Diskursen zu erfahren und in der Beobachtung der öffentlichen Diskurse temporär einzugrenzen.<br />
Notwendige Voraussetzung einer solchen diskursorientierten Problemdefinition ist jedoch, den Zugang<br />
zu diesen Diskursen so weit wie möglich offen zu halten, um so kontroverse Realitätssichten<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 20
und Interessenlagen ebenso einzubeziehen können wie Fachkompetenz und wissenschaftliche Diskurse.<br />
Das setzt eine offene, liberale und in ihrem Selbstverständnis demokratische Öffentlichkeit<br />
voraus. Ein pädagogisches Schlüsselproblemkonzept kann daher auch nur unter diesen strukturellen<br />
Voraussetzungen gültig sein und ist daher wie alle pädagogischen Konzepte nicht ahistorisch und<br />
von den konkreten gesellschaftlichen Voraussetzungen abstrahierend zu verstehen. Gerade dies ist<br />
aber der erste, fundamentale Diskurs, ob diese politisch-strukturellen Voraussetzungen gegeben und<br />
<strong>als</strong> Werte zu akzeptieren sind. Daher ist es durchaus sinnvoll und im Sinne eines Diskurskonzeptes<br />
richtig, das frühere »Lernfeld <strong>Politik</strong> / bzw. Demokratie« durch das Schlüsselproblem »Herrschaft<br />
und Politische Ordnung« [57] zu ersetzen, denn politisch-strukturelle Fragen sind, so der Diskursbeitrag<br />
der politischen Wissenschaften, niem<strong>als</strong> Unabhängig von Machtprozessen und Herrschaftsformen<br />
zu verstehen und zu behandeln.<br />
Letztlich führt <strong>als</strong>o ein Schlüsselproblemkonzept zu einer permanenten Curriculumreform, in die<br />
auch die Schulen selbst und die Lehrerinnen und Lehrer direkt und aktiv einbezogen sind. Schule<br />
wird somit zu einem integralen Bestandteil und nicht nur zu einem Objekt öffentlicher und<br />
fachlicher Diskurse und »pädagogische Diskurse« sind in die allgemeinen gesellschaftlichen<br />
Diskurse zu integrieren.<br />
4.2 Zum Theorie-Praxis-Problem<br />
Die Diskussion um die »Schlüsselprobleme« in den Schulen wird oft unter dem subjektiven<br />
Eindruck geführt, dass hier durch die »praxisfremden Theoretiker« an den Hochschulen ein<br />
überzogenes »theoretisches Konstrukt« der »Schulpraxis« und den »Schulpraktikern«, nämlich den<br />
Lehrerinnen und Lehrern, aufgezwungen wird. Der Vorwurf ist dann nicht weit, dass diese Theoretiker<br />
nun mal „von den realen Problemen der Praxis keine Ahnung“ haben und „intellektuelle<br />
Spielereien“ betreiben.<br />
Diese innerschulische Problemsicht fügt sich in einige dominante Urteilsstrukturen, die nicht nur in<br />
den Schulen, sondern auch in weiten Teilen der Öffentlichkeit präsent sind, nämlich der Hochschätzung<br />
der »Praxis« und der ablehnenden Skepsis gegenüber den »lebensfremden Intellektuellen«.<br />
Diese ideologischen Topoi haben gerade in Deutschland einerseits einen ideengeschichtlichen<br />
Hintergrund, der auch von den »Intellektuellen« selbst kaum je realisiert wird, <strong>als</strong> auch einen<br />
sozialen Kontext in der staatsgesellschaftlichen Entwicklung in Deutschland, die gerade in diesem<br />
Bereich deutlich anders <strong>als</strong> in Frankreich abläuft, wie es Norbert Elias in seinen Untersuchungen<br />
zur französischen Civilité im Unterschied zur deutschen Kultur sehr detailliert darstellt [58] .<br />
Die Theorie-Praxis-Dichotomie wird letztlich auch <strong>als</strong> oft berechtigter Vorwurf von denen<br />
akzeptiert, die davon sozial getroffen werden, nämlich Wissenschaftlern und Hochschulangehörigen,<br />
die, gerade wenn sie ihre eigene gesellschaftliche Funktion kritisch zu überdenken bereit<br />
sind, die angebliche „Praxisferne“ der Hochschullehre sowie der Forschung beklagen und eine<br />
stärkere „Praxisorientierung“ der universitären Ausbildung fordern. [59] In dieser positiven Sicht der<br />
Theorie-Praxis-Problematik richtet sich das Augenmerk vor allem auf Struktur- und Kommunikationsprobleme<br />
zwischen Schule und Hochschule.<br />
Die These von der Theorie-Praxis-Dichotomie sollte aber grundsätzlich viel kritischer gesehen<br />
werden. Es ist anzunehmen, dass sie zur Problembeschreibung selbst eher nicht mehr taugt. Die<br />
Behauptung und Wahrnehmung eines Theorie-Praxis-Gegensatzes ist heute eine ideologische<br />
Revitalisierung veralteter Theorie-Dichotomien, von denen die »Natur-Kultur-Dichotomie«, in den<br />
<strong>Politik</strong>wissenschaften die »Gesellschaft-Gemeinschafts-Dichotomien« repräsentativ sind (vgl.<br />
Schramke 1975 oder Filipp 1987 für die Geographiedidaktik). Die angesprochene Problematik der<br />
mangelnden Kommunikation zwischen Hochschule und Schule ist weniger unter den Stichworten<br />
»Praxisferne« und »Kontrollfurcht« zu subsumieren, <strong>als</strong> auf eine grundsätzlich andere<br />
sozialpsychologische Fundierung des <strong>Unterricht</strong>ens, nämlich aus der individuell erfahrenen, aber<br />
niem<strong>als</strong> systematisch reflektierten Situation heraus; dabei erfüllen dann Didaktik und Pädagogik<br />
bestenfalls ex post legitimatorische Funktionen. Die Sprachlosigkeit ist daher auch nicht durch eine<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 21
essere Fachdidaktik oder Gesprächsinitiativen der universitären Fachdidaktiker aufzuheben,<br />
sondern nur durch eine grundlegende Veränderung der institutionellen Situation von Schule – es<br />
wäre unter Umständen hier Ivan Illich (1971) zu folgen: durch eine »Entschulung der Gesellschaft«.<br />
Von der anderen, universitären Seite her wäre das durch die kritische Untersuchung der Situation<br />
und Motivation der Fachdidaktiker selbst zu untermauern, von denen zu vermuten ist, dass die<br />
Arbeitsmotivation primär nicht aus den inhaltlich-didaktischen Problemlagen erwächst, sondern aus<br />
der eigenen Einbindung in universitäre Diskurse, in Arbeitsplatz- und Statussorgen und den<br />
Publikationszwang. Es wäre <strong>als</strong>o notwendig, nicht Schule oder Hochschule <strong>als</strong> solche zu verändern<br />
und zu verbessern, sondern die bisher induzierten Diskurse zusammenzuführen und in der politischen<br />
Öffentlichkeit den pädagogischen Diskurs neu zu eröffnen, der die institutionellen Verengungen<br />
überwinden hilft.<br />
Die »Sprachlosigkeit« zwischen Universität und Schule ist weniger in den inhaltlichen und<br />
methodischen Defiziten der betreffenden Fachdidaktiken bzw. der Erziehungswissenschaften zu<br />
suchen, <strong>als</strong> in institutioneller Fremdheit, die sich am gesellschaftlichen Ort der Institution ebenso<br />
festmachen lässt, wie an der biographischen und funktionalen Separation von beruflichen Lebensabschnitten.<br />
Dies zu überwinden verlangt eine stärkere funktionale Verklammerung (vom Ideal des<br />
»lebenslangen Lernens« ganz zu schweigen).<br />
Für die <strong>Politik</strong>lehrerschaft können in einem auf die Biographie zentrierten Ansatz, der vor allem<br />
auch konkrete gesellschaftliche und politische Zeiterfahrungen thematisiert, Gründe für ihre heutige<br />
»Sprachlosigkeit«, um nicht zu sagen: Gedankenferne, gefunden werden. [60] Die in diesem<br />
Zusammenhang oft beklagte »Abkoppelung der Hauptschule« kann der Verfasser <strong>als</strong> Gymnasiallehrer<br />
nicht letztgültig beurteilen. Es mag auch auf die universitäre Situation bezogen sein. In der<br />
Praxis der Lehrerfortbildung ist jedoch zu sehen, dass die Bereitschaft, sich überhaupt auf<br />
Pädagogik einzulassen, überwiegend im Grund- und Hauptschulbereich, und dann folgend auch<br />
noch im Real-, Gesamtschul- wie Berufsschulbereich zu finden ist, kaum je aber im Gymnasialbereich.<br />
So genannte »pädagogische Diskussionen« gibt es im Gymnasium nur, wenn die<br />
Schülerzahlen sinken oder Mittel gekürzt werden, was ein wirkliches Einlassen auf diese Probleme<br />
jedoch nicht ermöglicht. Die Entpädagogisierung der Kultuspolitik tut ein Übriges dazu. Das neue<br />
»progressive« Instrument der Schulprogramme ist dann auch primär <strong>als</strong> schulpolitisches<br />
Druckmittel zu sehen, in den Schulen pädagogische Minderheitenpositionen mundtot zu machen,<br />
pädagogische und didaktische Diskurse zu unterbinden und notwendigen fachdidaktischen Paradigmenwandel<br />
unmöglich zu machen. Im gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld könnte man<br />
sich <strong>als</strong> Ergebnis der Abstimmungen über ein Schulprogramm folgendes vorstellen: die Rückkehr<br />
im Fach <strong>Politik</strong> zur normativen Wertbindung (z.B. nach Gagel 1990 oder Sutor 1992) und zur<br />
Institutionenkunde bei Ausschluss kritischer Ansätze aus dem Bereich der Sozialpsychologie, der<br />
Zivilisationstheorie (Elias) wie auch den Konzepten der »Dritte-Welt-Theorie« und der Weltsystem-Theorie<br />
(Wallerstein). [61] Im Fach Erdkunde würden allein die Positionen der Konservativen im<br />
Schulgeographenverband dominieren. Geographie <strong>als</strong> »Politische Bildung« wäre dann tabu und die<br />
Landschaftskunde wieder Zentrum des <strong>Unterricht</strong>s. [62]<br />
Übereinstimmung besteht zwischen kritischen Lehrerinnen und Lehrern und Hochschulangehörigen<br />
jedoch sicherlich in der Forderung, dass ein didaktischer Paradigmenwandel stattfinden muss, der<br />
gerade auch Selbstverständnis und gesellschaftliche Stellung der Fachdidaktik umfassen sollte und<br />
das Wahrnehmungsproblem einer Theorie-Praxis-Dichotomie in einen größeren fach- und theoriegeschichtlichen<br />
Zusammenhang stellt.<br />
Dieser Hintergrund kann hier nur angedeutet werden und harrt einer umfassenderen zivilisationsgeschichtlichen<br />
Untersuchung und Darstellung. Die Theorie-Praxis-Dichotomie ist geschichtlich in<br />
den Rahmen der abendländischen Entwicklung dichotomer Realitätsbilder zu stellen, die zwar<br />
gesellschaftlich-politisch an die mittelalterliche Lehre von den »Zwei Reichen« anknüpfen konnte,<br />
allgemeine Bedeutung aber erst durch den Prozess der Säkularisierung erlangte, in dem der Glaube-<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 22
Welt-Gegensatz sich transformierte zur These der Dichotomie von Geist und Natur. Die gesamte<br />
Staatsentstehung in der mittel- und westeuropäischen Soziogenese basiert auf der dualen Sichtweise,<br />
dass außerhalb des Menschlichen Geistes eine objektiv sinnvolle Natur existiert und wirkt.<br />
„Der Mensch ist frei geboren, doch überall ist er in Ketten“: Dieser Einleitungssatz des Contrat<br />
Social von Rousseau war das Fanal der Vorstellung von einem allgemein gültigen Naturrecht des<br />
Menschen, und leitet in seinem zweiten Satzteil den darauf aufbauende Natur-Kultur-Widerspruch<br />
ein. Im 20. Jahrhundert leitet sich aus eben diesem Widerspruch die These von der Theorie-Praxis-<br />
Dichotomie ab. Erst in der Gegenwart wird in der Philosophie mit den Thesen vom<br />
Kulturrelativismus [63] , den Konstruktivismus (Solipsismus) [64] und dem Dekonstruktivismus [65] die<br />
Gegenthese wieder größeres Gewicht erhalten. [66]<br />
Auf der anderen Seite ist, und hierin ist Elias zu folgen, [67] der soziologische Hintergrund der<br />
dichotomen Realitätsvorstellungen von wesentlicher Bedeutung. Es geht um die soziale Stellung<br />
der Intellektuellen in der Gesellschaft, um die Selbst- und Fremdwahrnehmung der Rolle, die diese<br />
Wissenschaftler, Hochschullehrer und Autoren von ihrer Funktion in der Gesellschaft haben. Es<br />
wurde schon angedeutet, dass diese Wahrnehmungsperspektiven in Deutschland und in Frankreich,<br />
wo diese Schicht recht früh <strong>als</strong> Funktionsträger in die höfischen Hierarchien integriert worden sind,<br />
recht unterschiedliche Züge aufweisen. [68]<br />
Die deutsche Intelligenz verstand sich <strong>als</strong> benachteiligter Widerpart der herrschenden Adelsschicht,<br />
die selbst wenig Neigung zur eigenen Intellektualisierung zeigte, wie die bis heute auffällige<br />
Dummheit und Borniertheit des funktionslosen »Hochadels« noch jetzt zeigt, was sich entweder<br />
durch servile Affirmation oder durch meist aber in der gesellschaftlichen Praxis folgenloses »revolutionäres<br />
Bewusstsein« äußerte, jeweils aber völlig abgekoppelt von der realen gesellschaftlichen<br />
und industriegeschichtlichen Entwicklung und von dieser auch nicht verstanden. Hier schon<br />
zerbrach eine mögliche innergesellschaftliche Kommunikation und die Integration der Intelligenz in<br />
die Geschichte: die soziale Unterfütterung der Theorie-Praxis-Dichotomie.<br />
4.3 Diskurs »Gerechtigkeit, Ungleichheit, Wertewandel« [69]<br />
Ausgangspunkt der Behandlung von Themen im Bereich der »Sozialen Ungleichheit« ist die<br />
Einsicht, dass soziale Ungleichheit zunächst einmal ein wahrgenommenes und mit oft<br />
widersprüchlichen Wertvorstellungen behaftetes Problem ist. Inhalt und Vermittlung der Wahrnehmung<br />
sowie die handlungsleitenden Wertoptionen, die sich um den zentralen Wert der<br />
Gerechtigkeit gruppieren lassen, bestimmen die Verhaltensweisen des Einzelnen, seine Einstellungsoptionen<br />
und politischen Handlungspotentiale. Soziale Ungleichheit ist gleichermaßen ein<br />
materielles wie ein Vermittlungs- und Wahrnehmungsproblem. Die Situationsdefinition »Soziale<br />
Ungleichheit« impliziert ein bestimmtes Gesellschaftsbild und die daraus abzuleitenden Handlungsspielräume.<br />
Eingangs wurde schon darauf hingewiesen, wie sehr die traditionellen Schicht- und<br />
Klassenvorstellungen vom gesellschaftlichen Wandel überholt worden sind, so dass heute in den<br />
Industriestaaten weder im klassischen Sinne noch von Oberschichten noch von einer in sich auch<br />
nur ansatzweise homogenen Unterschicht gesprochen werden kann. dass damit ein scheinobjektiver<br />
antagonistischer Klassenbegriff ebenso deutlich von den Realitäten weg führt, wie die für die erste<br />
Nachkriegszeit in der Bundesrepublik Deutschland so bezeichnende These von der nivellierten<br />
Mittelstandsgesellschaft, ergibt sich daraus zwangsläufig. Soziale Ungleichheit muss <strong>als</strong> Diskurs<br />
daher auf eine andere begriffliche und theoretische Grundlage gestellt werden und muss ausgehen<br />
von der Ungleichheitswahrnehmung, von den realen Machtprozessen und den historischen<br />
Kontexten, die einerseits die Gesellschaftsentwicklung zur modernen Staatsgesellschaft, andererseits<br />
die Einbindung in Globalisierungs-, internationale Interdependenz- und Universalisierungsprozesse<br />
ansprechen. [70]<br />
Es kann nicht Aufgabe einer didaktisch orientierten Überlegung sein, einen Überblick über die<br />
Theorien des sozialen Wandels zu geben. Das würde letztlich bedeuten, eine Geschichte der<br />
Soziologie schreiben zu wollen, ist doch die Frage nach dem sozialen Wandel seit Beginn des<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 23
Nachdenkens über Gesellschaft die zentrale Frage der Sozial-, <strong>Politik</strong>- und Staatswissenschaften<br />
überhaupt. In unserem Kontext kann es nur darum gehen, den Ansatz selbst zu problematisieren<br />
und damit die Urteilsperspektiven zurecht zu rücken, um diejenigen Theoreme, die derzeit zu jenen<br />
gesellschaftlichen Prozessen, die die Problemdimension der heutigen Gesellschaft bestimmen,<br />
erklärend herangezogen werden und die sich noch nicht zu umfassenderen gesellschaftlichen Theorien<br />
zusammenfügen lassen, die aber zu zentralen Elementen der heutigen Politischen Bildung<br />
geworden sind, kritisch in Frage stellen zu können. Es ist dabei zu fragen, inwieweit diese aktuellen<br />
Theoreme hilfreich sind, didaktisch aufzubereitende Perspektiven zu entwickeln.<br />
Geht das Gesellschafts- und Menschenbild der Sozialwissenschaften auch primär von relativ<br />
verfestigten Struktur- und Identitätskonzepten aus, ist die Problem- und Fragestellung der<br />
Soziologie jedoch seit jeher auf den sozialen Wandel gerichtet, der zu untersuchen und zu verstehen<br />
ist. Aus der unmittelbaren Lebenserfahrung heraus ist dieses Konzept sofort nachvollziehbar.<br />
Fragen, Aufgaben und Probleme entstehen im Alltagsleben wie in der Wissenschaft zumeist aus der<br />
Wahrnehmung von Veränderungen, im gesellschaftlichen Bereich wie aus der Wahrnehmung von<br />
Veränderungen in der sozialen Umwelt. Das gilt nun vor allem für Sozial- und <strong>Politik</strong>wissenschaftler<br />
<strong>als</strong> forschende und lehrende Personen mit jeweils individueller Wahrnehmungsperspektive.<br />
Für die Didaktik ist diese auf Veränderungen und Wandel gerichtete Aufmerksamkeit<br />
Ansatz der pädagogischen Neugier, der Motivation, die dem Fragenden zu Grunde liegt. Darauf<br />
gründet vor allem die Politische Bildung und das politische Lernen, z.B. im Sinne der Konzepte der<br />
Konfliktdidaktik und der Problemorientierung des <strong>Unterricht</strong>s, um daraus Grundlagen für die<br />
Fähigkeit zum politischen Handeln legen zu können. Doch wird auch hier wiederum die Ausgangsperspektive<br />
deutlich, dass der erwartete Normalzustand ebenso der erhoffte oder erwartete »Endzustand«<br />
einer gesellschaftlichen Entwicklung die gesellschaftliche Stabilität ist. Politisches Handeln<br />
motiviert und rechtfertigt sich durch seine Orientierung auf ein Ziel, auf eine finale Perspektive.<br />
Sehr tief liegt hier verankert und verborgen eine auf absolute Endgültigkeiten gerichtete, letztlich<br />
transzendentale Hoffnung auf ein zu erreichendes Ziel gesellschaftlicher Entwicklungen, wenn<br />
nicht eine letztlich eschatologische Perspektive.<br />
In welcher Weise nun lässt sich das Problemfeld »Soziale Ungleichheit und Gerechtigkeitsvorstellungen«<br />
<strong>als</strong> gesellschaftlichen Diskurs in das Konzept der Schlüsselprobleme einbinden und<br />
damit didaktisch in Wert setzen? Schlüsselprobleme sind Erfahrungs- und Realitätsbereiche, die das<br />
Leben und die Zukunftsplanung des einzelnen wesentlich bestimmen und die Grundlage für politisches<br />
Handeln sind. Sie sind nicht Teil eines bestimmten Faches sondern müssen interdisziplinär<br />
bedacht werden. Jede curriculare und didaktische Umsetzung bezieht sich in ihrer Konzeption im<br />
Wesentlichen auf die Einsicht, dass umfassende gesellschaftliche Diskurse in verschiedene Aspekte,<br />
Perspektiven oder <strong>Unterricht</strong>sschwerpunkte aufzugliedern sind. Damit kommen wir zu einem<br />
dynamischen Begriff der »Schlüsselprobleme«, denen eine zentrale Bedeutung für die Gestaltung<br />
der Zukunft zukommen, und die unter anderem diskursiven Kontext zu Neuabgrenzungen<br />
untereinander dependenter und vernetzter »Schlüsselprobleme« geringerer zeitlicher und gesellschaftlicher<br />
Reichweiteführen können. Hier seien, nur stichwortartig, solche Problemfelder<br />
aufgeführt, die notwendigerweise einem »Schlüsselproblem ›Soziale Ungleichheiten‹« – so in den<br />
niedersächsischen Rahmenrichtlinien – oder einem »Schlüsselproblem ›Gerechtigkeit, Ungleichheit,<br />
Wertewandel‹« – wie wir es aus dem fachlichen Diskurs erweitert ablesen – zu- und<br />
unterzuordnen sind:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Gewalt und Frieden<br />
Soziale Ungleichheit und soziale Gerechtigkeit<br />
Lebensformen, Selbstfindung und die Erwartungen der Gesellschaft<br />
Politische Realität und mediale Vermittlung<br />
Aus soziologischer Sicht [71] geht es bei dem Thema »Soziale Ungleichheit« um das entscheidende<br />
Problem der Soziologie schlechthin – nämlich um die „Hobbes’sche Frage“: Was hält die Gesell-<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 24
schaft überhaupt zusammen? Oder: Wie werden Menschen dazu gebracht, sich so zu verhalten, dass<br />
eine dauerhafte Gesellschaft entsteht? Das Thema gewährt demgemäß Zugang zu grundlegenden<br />
Theorien der Soziologie.<br />
Die grundsätzlichen Positionen in dieser Frage haben bereits Hobbes und Rousseau bezogen. (Dazu<br />
auch: Dahrendorf, 1968, S. 164.) Die Soziologie des 20.Jahrhunderts hat mit dem »Funktionalismus«<br />
eine erste Antwort versucht, wobei Talcott Parsons – der „Mentor des Funktionalismus“ –<br />
von Rousseaus Vorstellungen eines allgemeinen Konsensus ausging.<br />
Seit Mitte der sechziger Jahre kann die funktionalistische Theorienbildung <strong>als</strong> überholt gelten zu<br />
Gunsten eines Erklärungsansatzes aus den Begriffen »Macht« und »Herrschaft« heraus, der auch<br />
über die Gedanken von Marx zur sozialen Ungleichheit hinausgeht. Die Stationen dieser Diskussion<br />
sind nachgezeichnet worden von Wiehn (1968) und, besonders in Hinblick auf das Verhältnis zum<br />
Marxismus, von Bottomore (1967).<br />
Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass auch die traditionell funktionalistische amerikanische<br />
Soziologie diesen Ansatz revidiert und nach neuen Frageansätzen sucht, wie z.B. Robert K. Merton<br />
(1957). Entwicklung und Niedergang des amerikanischen Funktionalismus stellt Heinz Hartmann<br />
(1973) in seinem Reader „Moderne amerikanische Soziologie“ dar.<br />
Aber auch ausgehend von traditionell funktionalistischen Problemstellungen gelangt soziologische<br />
Theorie in allerjüngster Zeit zu Ergebnissen, die sich denen der genannten »Herrschaftstheorie«<br />
weitgehend angenähert haben und in den Werken der »Systemtheorie« dargelegt werden. [Vgl. dazu<br />
die Ausführungen von Niklas Luhmann 1975, später auch 1986.]<br />
Besondere Bedeutung hat jetzt nicht mehr nur die Frage nach Macht und Herrschaft schlechthin,<br />
sondern nach den Bedingungen für die Durchsetzung und Aufrechterhaltung von Herrschaft – oder<br />
umgekehrt: nach den Voraussetzungen für Aufhebung von Herrschaftssystemen.<br />
Dazu scheint eine kurze Erläuterung notwendig: Der genannte theoretische Ansatz geht davon aus,<br />
dass das Handeln des Menschen weitgehend abhängig ist von der – gesellschaftlichen – Situation,<br />
in der es sich vollzieht. Da eine solche Situation aber selten unmittelbar und quasi ›objektiv‹<br />
erfahrbar ist, sondern vielmehr unterschiedlich interpretiert werden kann, ist es möglich, dass der<br />
eine der Beteiligten gegenüber den anderen Beteiligten in einem Kommunikations- und Interaktionsverhältnis<br />
seine »Definition der Situation« durchsetzen kann. [72] Er gewinnt Einfluss auf<br />
das Verhalten des anderen, indem die mit einer Situation verbundenen, unendlich vielen Handlungsmöglichkeiten<br />
reduziert und die zulässigen und unzulässigen Handlungsmöglichkeiten und<br />
Motive sowie das gemeinsame Sinnverständnis des Handelns festgelegt werden. Es zeigt sich nun,<br />
dass diese Fähigkeit zur Situationsdefinition keineswegs gleich verteilt ist, sondern dass einige<br />
Partner immer wieder in der Lage sind, die Handlungsmöglichkeiten einseitig festzulegen. Die<br />
Fähigkeit zur Situationsdefinition wird so zum Instrument für die Durchsetzung eines Herrschaftsverhältnisses<br />
und soziale Ungleichheit ist demzufolge das Ergebnis eines solchen Definitionsprozesses.<br />
Die weitere gesellschaftswissenschaftliche Diskussion im Übergang von den achtziger und den<br />
neunziger Jahren knüpft an die Erfahrung an, die schon Popitz in seinem Aufsatz „Prozesse der<br />
Machtbildung“ <strong>als</strong> „absurde Situation“ gekennzeichnet hatte. Die stringenten Kategorien des<br />
»Herrschaftsansatzes« erscheinen angesichts „absurder gesellschaftlicher Entwicklungen“ teilweise<br />
<strong>als</strong> zu formal, zu wenig inhaltlich bestimmt: Wie sehen denn die gemeinsamen Sinnverständnisse<br />
inhaltlich aus, wie werden die Situationen im Herrschaftsverband inhaltlich definiert, sind nicht<br />
formal gleichwertige Situationsdefinitionen in unterschiedlichen kulturellen Kontext unvereinbar,<br />
konflikterzeugend? Der scheinbare Rückfall in überwunden geglaubte Sinnverständnisse, die auf<br />
Gewaltbereitschaft, Irrationalität, Staatsraison, Primat militärischer Souveränität, religiösen Ordnungsvorstellungen<br />
abheben, lässt eine theoretische Wendung in historische, kultur- und sozialanthropologische<br />
Fragestellungen mit stärker vergleichenden und auf längerfristige Prozess- und<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 25
Kontinuitätsdichotomien zielende Forschungsperspektiven aktuell werden. Die ethnographische<br />
Perspektive wurde vor allem in Frankreich gesucht (Lévy-Strauss, Leiris) und wurde für die<br />
kritische Dritte-Welt-Forschung wichtig. In Deutschland wird mit dem Konzept der »Politischen<br />
Kultur« und der Rezeption des Ziviliationsbegriffes Norbert Elias ›wiederentdeckt‹ und zum Ausgangspunkt<br />
historisch-kritischer sozialwissenschaftlicher Studien. [73] Herrschaft, so zeigte es sich<br />
nun, ist stärker <strong>als</strong> bisher angenommen, an symbolische Traditionen gebunden und in staatlichen Institutionen<br />
verwurzelt. Die etatistische Vergesellschaftung Westeuropas prägt immer noch<br />
Reichweite und Grenzen von Gruppenautonomien und politischen Durchsetzungschancen, ist durch<br />
das von Westeuropa geprägte Völkerrecht zum absolutierten Ordnungsmaßstab auch für fremde<br />
Länder und Kulturen geworden – auch hier eine herrschaftserhaltende Situationsdefinition, die<br />
internationale soziale Ungleichheit verfestigt.<br />
Die Auswahl von <strong>Unterricht</strong>smaterialien zur didaktischen Umsetzung im Bereich des Schlüsselproblems<br />
»Soziale Ungleichheiten« orientiert sich sicherlich daran, die heute aktuellen und gültigen<br />
»tragenden Konzepte« der Fachwissenschaft zu vermitteln, die zu kennen erst ein kritisches<br />
Verstehen der komplexen sozialen Realität ermöglicht. Als »Tragende Konzepte« sind dabei<br />
wissenschaftliche Diskurse zu verstehen, die – in einem ersten auswählenden Ansatz – mit<br />
folgenden Stichworten zu benennen sind:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Symbolischer Interaktionismus<br />
Prozess der Zivilisation<br />
Politische Kultur<br />
Weltsystemtheorie, internationale Disparitäten und Peripherien<br />
Das Entschwinden der Realität<br />
Die Fortsetzung dieser durchaus didaktisch-unterrichtspraktisch zu verstehenden Vorschläge zum<br />
pädagogischen und wissenschaftlichen Verständnis des »Schlüsselproblems« Soziale Ungleichheit<br />
legt einen Übergang zu folgenden Konzepten nahe, die jedoch sinnvoller Weise im Zusammenhang<br />
mit den weiteren Diskursen und »Schlüsselproblemen« umzusetzen sind, was die immanenten<br />
Interdependenzen der »Schlüsselproblemdiskurse« hervorhebt:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Strukturelle Gewalt<br />
Ethnozentrismus-Kritik<br />
Authentizitäts-Postulat<br />
Interkultureller <strong>Politik</strong>- und Kultur-Vergleich (komparative Kultur- und Sozialanthropologie)<br />
Zur Rezeption des Problembereiches Soziale Ungleichheit sind abschließend einige zusätzliche<br />
Ausführungen zu machen [74] : Soziale Ungleichheit wird in der eigenen Gesellschaft wahrgenommen<br />
<strong>als</strong> unterschiedliche Chance, soziale Positionen, materielle Güter, Einflussmöglichkeiten, Ansehen<br />
oder berufliches Fortkommen zu erhalten; zumeist wird soziale Ungleichheit <strong>als</strong> Zwang und Beschränkung,<br />
<strong>als</strong> Schicksal oder <strong>als</strong> Versagen erlebt. Daher ist bei der diskursiven Aufnahme des<br />
Schlüsselproblems Soziale Ungleichheit zunächst der Zusammenhang von Sozialer Ungleichheit<br />
und staatlicher Herrschaft und gesellschaftlicher Macht zu thematisieren.<br />
Schon die verbreiteten, grundlegenden Definitionen von »Macht« und »Herrschaft« von Weber<br />
oder Strzelewicz [75] zeigen recht unterschiedliche Möglichkeiten, sich dem Thema »Macht und<br />
Herrschaft« zu nähern: entweder über die abstrakte Beschreibung dessen, wie Macht wirkt und an<br />
welchen Wirkungen sie zu erkennen ist und welche besondere Form der Macht durch Herrschaft<br />
charakterisiert wird, oder aber über die gesellschaftliche Funktion, die Macht und Herrschaft<br />
einnehmen und wie sie Grundlage gesellschaftlicher Differenzierung, d.h. <strong>als</strong>o Sozialer Ungleichheit<br />
sind.<br />
Dieser Ansatz führt zu der Einsicht, dass die Herrschaft darauf angewiesen ist, der Sozialen<br />
Ungleichheit einen gesellschaftlichen Sinn zu geben. Die kritisch-distanzierte Betrachtung der<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 26
gesellschaftlichen Diskurse zur Problematik der »Sozialen Ungleichheit« zeigt, dass eine erhebliche<br />
Diskrepanz besteht zwischen einer rational-angemessenen Beschreibung der Gesellschaft, in der<br />
Machtprozesse und Soziale Ungleichheiten – wenn auch, wie wir schon diskutiert haben, nicht<br />
mehr geordnet nach den Mustern eindimensionaler Schicht- und Klassenmodelle, sondern im Sinne<br />
einer zunehmenden »Fraktionierung« der gesellschaftlichen Lebensbereiche bis hin zur Individualisierung<br />
– im Mittelpunkt stehen werden, und den gesellschaftlichen Wahrnehmungsperspektiven<br />
und Realitätsdefinitionen in einer breiteren Öffentlichkeit, in der funktionalistische<br />
Ordnungsvorstellungen [76] (Leistungsideologie, Gemeinschaftsideologien und teilweise auch noch<br />
biologistische Erklärungsmodelle, z.B. was die rassistisch motivierte Diskriminierung von<br />
»Ausländern« und anderen »Fremden« angeht) vorherrschen.<br />
Wichtig ist im didaktischen Zusammenhang, dass erkannt wird, dass es für die gesellschaftliche<br />
Handlungsfähigkeit und die eigenen politischen Optionen und Ziele durchaus nicht egal ist, welche<br />
Erklärung für die Soziale Ungleichheit für zutreffend genommen wird, sondern dass mit der<br />
Entscheidung für bestimmte Gesellschaftsbilder ganze Lebenskonzepte – Aufstiegsorientierung,<br />
politische Konfliktbereitschaft, soziale Verantwortung, Gewaltakzeptanz, Toleranz oder Ausgrenzungs-<br />
und Diskriminierungsbereitschaft – verbunden sind.<br />
Inwieweit gesellschaftliche Traditionen – die »Politische Kultur« – und individuelle biographische<br />
Erfahrungen – Enkulturations- und Akkulturationsprobleme – dabei eine Rolle spielen, muss<br />
sowohl in der Diskussion der Schlüsselprobleme selbst, wie in geeigneter didaktischer Umsetzung<br />
auch mit den Schülerinnen und Schülern <strong>als</strong> den von diesen Problemen unmittelbar betroffenen<br />
erörtert werden. Hier soll abschließend auf das äußerst problematische Selbstbild unserer gegenwärtigen<br />
Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft <strong>als</strong> »Leistungs- und Wettbewerbsgesellschaft«<br />
im Sinne einer »funktionalistischen Schichtungstheorie« verwiesen werden. Die Vorstellung<br />
von »sozialen Schichten« und dem »Statusaufbau« unserer Gesellschaft ist längst<br />
Allgemeinplatz des öffentlichen Bewusstseins geworden und muss daher genauer und kritisch<br />
untersucht werden. Ein diskursives Aufarbeiten des Schlüsselproblems »Soziale Ungleichheit«<br />
kann dazu beitragen, diese Verengungen der Wahrnehmung und Deutung der gesellschaftlichen<br />
Realitäten aufzubrechen und bei den Schülerinnen und Schüler eine erhöhte eigene Diskursfähigkeit<br />
zu erreichen. Gerade daher ist für den <strong>Politik</strong>unterricht dieses Schlüsselproblem von entscheidender<br />
Bedeutung. [78]<br />
4.4 Diskurs »Individualisierung, Gewalt, Soziabilität«<br />
Der Diskurs »Individualisierung, Gewalt, Soziabilität« wird in der Öffentlichkeit vor allem in<br />
einem Teilaspekt, der Diskussion der Inneren Sicherheit und der Jugendgewalt wahrgenommen. In<br />
dieser Form tritt er auch in massiver Form an die Schule und an die Politische Bildung heran. Im<br />
Vordergrund steht dabei jedoch nicht Wunsch und Erwartung nach gesellschaftlicher Erhellung und<br />
Erklärung, sondern die Forderung nach affirmativen, angstreduzierenden Erziehungskonzepten.<br />
Es ist kein Zufall, dass der Diskursaspekt der »Individualisierungsprozesse« vor allem im Diskurssegment<br />
der Intellektuellen und Lehrkräfte der Politischen Bildung thematisiert und aufgegriffen<br />
wird. Der Wunsch nach Verständigungsmustern zu dem bedrückenden Problem wird dabei deutlich,<br />
aber auch die Funktionalisierung der Individualisierungshypothese zur allgemein kulturkritischen<br />
Selbstentlastung. Die soziologischen und zivilisationstheoretischen Hintergründe von erweisbaren<br />
Individualisierungsprozessen und „Individualisierungszumutungen« [79] werden dabei jedoch nicht<br />
bewusst und rational in den Diskurs eingeführt.<br />
Es sind zwar einige bemerkenswerte sozialpsychologische Studien über Jugendgewalt und<br />
Rechtsextremismus vorgelegt worden [80] , für den <strong>Unterricht</strong> auch brauchbare Materi<strong>als</strong>ammlungen<br />
und <strong>Unterricht</strong>sentwürfe [81] , doch ist es bisher nicht gelungen, umfassendere rational-analytische<br />
wissenschaftliche Ansätze für die Öffentlichkeit rezipierbar und für die <strong>Politik</strong>beratung brauchbar<br />
zu machen. In den allgemeinen öffentlichen Diskursen herrschen stereotype Ursachenvermutungen<br />
und allgemeine kultur- und politikkritische Perspektiven und Sinngebungen vor. Gerade das aber<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 27
ermöglicht es der Politischen Bildung, an die öffentlichen Diskurse anknüpfend, auf rationaldistanzierte<br />
Diskursmodelle zu insistieren und diese zur Grundlage diskursiver <strong>Unterricht</strong>ssituationen<br />
zu machen.<br />
Einige sehr interessante und reflektierte Beiträge zu diesem Diskursfeld »Individualisierung,<br />
Gewalt, Soziabilität« haben jedoch über aufgeschlossene Massenmedien wie DIE ZEIT oder die<br />
Frankfurter Rundschau [82] lassen die Hoffnung auf eine Versachlichung der öffentlichen Diskurse zu<br />
diesem zentralen Thema gesellschaftlicher Kontroversen in Deutschland aufkommen, bei denen die<br />
einzelnen Konfliktfelder überaus differenziert und »fraktioniert« wahrgenommen werden: Fragen<br />
der Bildungsmüdigkeit der Jugend, Gewalt und Ausländerfeindlichkeit, Gewalt durch Medien etc.<br />
Damit überlagert sich dieser Kurs mit zentralen Diskursfeldern aus dem Bereich »Soziale Ungleichheit«<br />
mit der zentralen Armuts- und Diskriminierungsthematik, aus dem Bereich »Globalisierung<br />
und ökonomischer Wandel« wie aus dem Bereich Staat und Staatsversagen – dem Ausgangspunkt<br />
unserer »Krisenanalyse«. Als theoretisch-analytischen Integrationsbegriff dieses Diskursfeldes<br />
wählen wir zivilisationstheoretischen Perspektiven folgend den Prozess der Individualisierung,<br />
den wir in die Prozessdichotomie von Integration und Differenzierung einordnen wollen.<br />
Prozesse der »Individualisierung« gelten <strong>als</strong> bezeichnend und prägend für die Politische Kultur der<br />
so genannten »Industrieländer« d.h. der Länder der sozioökonomischen Zentren. Die Leitvorstellungen<br />
von der Individualisierung sind – oft <strong>als</strong> Ideologeme wie »Freiheitliche Ordnung«,<br />
»Leistungs- und Konkurrenzgesellschaft« formuliert – Teil heutiger Universalisierungsprozesse im<br />
Kontext der ökonomisch-politischen Globalisierung. In diesem Kontext wird die theoretische und<br />
gesellschaftliche Problematik dieses Individualisierungsprozesses besonders deutlich.<br />
Die gesellschaftlichen Konflikte in den so genannten Transformationsländern, d.h. denjenigen vor<br />
allem ost- und südosteuropäischen Ländern, die Anfang der 90er Jahre den politisch-gesellschaftlichen<br />
und sozioökonomischen Wandel vom »real existierenden Sozialismus« <strong>als</strong> Mitgliedstaaten<br />
des RGW und der Warschauer Pakt-Organisation zum kapitalistisch-marktwirtschaftlichen<br />
Staats- und Gesellschaftsmodell Westeuropas vollzogen haben, was weltpolitisch das Ende des<br />
vierzig Jahre dominierenden West-Ost-Konfliktes bedeutete, thematisieren vor allem auch den<br />
Wandel der Beziehungen des Einzelnen zur Gesellschaft. Herkömmliche Kollektivvorstellungen der<br />
sozialistischen Gesellschaften wurden im Transformationsprozess aufgegeben; an ihre Stelle treten<br />
gerade auch in den ideologischen und kulturellen Kontexten die Forderungen und Wertvorstellungen<br />
des Individualismus.<br />
Ökonomisch wird dieser Prozess <strong>als</strong> Konsequenz des Privatisierungstheorems verstanden, das im<br />
wirtschaftlichen Strukturwandel dieser Länder eine leitmotivische Rolle einnimmt.<br />
dass diese Privatisierungsthematik volkswirtschaftlich und gesellschaftswissenschaftlich weitaus<br />
problematischer und differenzierter ist, <strong>als</strong> es das politische Postulat gelten lassen will, zeigen – hier<br />
nur ganz kurz angerissen – folgende Aspekte:<br />
Der Begriff »Privatwirtschaft« ist nicht eindeutig, sondern umfasst sowohl die firmenrechtlichen<br />
Kategorien (GmbH, AG; <strong>als</strong>o neben dem mittelständischen Selbstunternehmer alle Formen der<br />
Kapitalgesellschaften, unabhängig davon, ob die realen Eigentümer Personen, Institutionen oder<br />
auch der Staat sind), wie auch die Bezeichnung einer eigenverantwortlichen Unternehmertätigkeit,<br />
vor allem in den so genannten mittelständischen Betrieben.<br />
Die Verteilung von Staatseigentum (unabhängig von der geltenden Rechtsform), genossenschaftlichen<br />
Eigentumsverhältnissen (die staatskontrolliert wie in der DDR, staatsnah wie in der VR<br />
Ungarn oder rein privatrechtlich wie in der Bundesrepublik Deutschland sein konnten) und<br />
Privatunternehmungen war auch zur Zeit des West-Ost-Konfliktes nie so eindeutig den jeweiligen<br />
politischen Konkurrenten zugeordnet, wie es aus der politischen Ideologie zu erwarten gewesen<br />
wäre; so hatten Frankreich und Italien Mitte der 80er Jahre höhere staatswirtschaftliche Sektoren <strong>als</strong><br />
zu der Zeit Polen und Ungarn, wenn Industrie und Landwirtschaft zusammen gesehen werden; nach<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 28
der Privatisierung bleiben demgegenüber in Polen und Ungarn, viel mehr aber in den GUS-<br />
Ländern, weite Teile der Industrie trotz privatrechtlicher Firmenverfassung im Eigentum des<br />
Staates. Auch in der Bundesrepublik Deutschland ist der Sektor wirtschaftlichen Staatseigentums<br />
noch immer erheblich. Privatisierungen sind <strong>als</strong>o nicht exklusives Thema der Transformationsländer.<br />
Überhaupt nicht thematisiert wird in diesem Zusammenhang der heute in der Volkswirtschaftslehre<br />
kritisch diskutierte Prozess, dass traditionelle persönliche Eigentumsformen weitgehend abgelöst<br />
werden durch anonyme Kapitaleigentumsverhältnisse – Holdings, Fonds, Bankenkapital,<br />
gegenseitige Kapitalverflechtungen –, dass <strong>als</strong>o eindeutige persönliche Eigner kaum noch<br />
auszumachen sind und erst recht keinen verantwortlichen Einfluss auf unternehmerische Entscheidungen<br />
nehmen. Die klassische Unternehmerfunktion wird daher zunehmend durch die Entscheidungskompetenzen<br />
eines angestellten Managements ersetzt, die unternehmerische Entscheidung<br />
vom Eigentum abgekoppelt. [83]<br />
Hier tut sich ein deutlicher Widerspruch zwischen der »kapitalistischen« Gesellschaftsutopie, die<br />
Erbe der bürgerlichen Revolution und der Aufklärung ist und die das »selbstverantwortliche<br />
Individuum« und dadurch auch die autonome Unternehmerpersönlichkeit, die auf einem freien<br />
Markt nach rationaler Überlegung die volkswirtschaftlichen Prozesse bestimmt, <strong>als</strong> Leitbild<br />
postuliert, und der Realität der tendenziell bist in die globale Dimension eingebundenen anonymen<br />
und strukturell-interdependenten, vernetzten Entscheidungs- und Machtstrukturen, die die reale<br />
Autonomie des Einzelnen immer mehr einschränken.<br />
Der reale Prozess ist durch die zivilisationstheoretischen und historisch-soziologischen Analysen<br />
aufzuhellen und verständlich zu machen. Die schon angesprochenen Verlängerungen der Interdependenzketten,<br />
in denen der Einzelne steht, [84] die kulturellen Homogenisierungsprozesse [85]<br />
bezeichnen den für die europäische Gesellschaftsentwicklung bezeichnenden Prozess der sozioökonomischen<br />
und politisch-kulturellen Integration von der Feudalgesellschaft über die bürgerlich<br />
und national orientierte Staatsgesellschaft (vgl. den Diskurs »Zivilisation, Gesellschaft, Staat« in<br />
Abschnitt 4.5) der Neuzeit hinzu den schon angesprochenen Globalisierungsprozessen, deren<br />
Ergebnis noch nicht deutlich genug abzusehen ist.<br />
Die Widersprüchlichkeit dieser Gesellschaftsvorstellungen in Bezug auf die hier thematisierten<br />
Individualisierungsprozesse ergibt sich bei der Betrachtung der diesen Prozessen parallelen aber<br />
gegenläufigen Ausdifferenzierungen der gesellschaftlichen und ökonomischen Funktionen und<br />
sozialen Positionen. Dies ist keine zufällige Widersprüchlichkeit, sondern sie ist funktionaler<br />
Bestandteil des zu Grunde liegenden historischen Ablaufes. Die ökonomische Differenzierung<br />
ermöglicht erst die sozioökonomisch und politische Integration und die Herausbildung immer<br />
größerer Überlebenseinheiten von der Subsistenzwirtschaft, der ›Ökumene des Ganzen Hauses‹<br />
über die städtischen Handels- und Handwerkergesellschaften in zunehmender Arbeitsteilung und<br />
beruflich-sozialer Aufgliederung und Stratigraphierung, über die Phasen der Fabrikkultur der<br />
Industriellen Revolution, die Rationalisierung und Automatisierung, die eine Industriegesellschaft<br />
repräsentiert, die auf der einen Seite maximale Spezialisierung und berufliche Differenzierung, auf<br />
der anderen Seite eine Integration der Märkte bis hin zur Globalisierung erforderlich macht.<br />
Parallel kann auch das Sektorenmodell nach Fourastié zur Beschreibung dieses Prozesses<br />
herangezogen werden, das die epochale Verschiebung von einer Wirtschaftsform, die vor allem auf<br />
dem Primären Sektor (Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischfang, Bergbau) beruht, über die<br />
Industriegesellschaften des Sekundären Sektors (produzierendes Gewerbe) hin zur Dienstleistungsgesellschaft<br />
mit Beschäftigten hauptsächlich im Tertiären Sektor postuliert. [86]<br />
Die europäische Geschichte, der so genannte »Zivilisationsprozess« ist gekennzeichnet von der<br />
Gleichzeitigkeit und funktionalen Interdependenz von Integrations- und Differenzierungsprozessen,<br />
die in den einzelnen Phase der Geschichte mit unterschiedlicher Stärke und Dominanz sichtbar<br />
werden.<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 29
Für die Wahrnehmung der gesellschaftlichen Umwelt des Einzelnen bedeutet das, dass mit<br />
zunehmender institutioneller und anonymer werdenden sozioökonomischer und politischer<br />
Abhängigkeit von Staat und Wirtschaft der unmittelbar erfahrbare Schutz einer gesellschaftlichen<br />
Nähe in der kleinen Gruppe oder Familie weitgehend verloren geht und dass an die Stelle äußerer<br />
Verhaltensselbstverständlichkeiten und Verhaltenssteuerungen die sich im Zivilisationsprozess<br />
entwickelnden inneren Verhaltenskontrollen und internalisierten Verhaltensstandards treten müssen.<br />
Dies hat Norbert Elias <strong>als</strong> das Hinter-die-Kulissen-Verlegen der persönlichen Lebensäußerungen,<br />
das Errichten von inneren Scham- und Peinlichkeitsschranken beschrieben. Auf der persönlichen<br />
Wahrnehmungsebene kann dies auch der Erfahrung des Auf-sich-selbst-Gestelltseins oder der<br />
Individualisierungszumutung verstanden werden, des äußersten Grades der gesellschaftlichen<br />
Differenzierung, in der Handlungsmotivationen allein in der individuellen Persönlichkeit zu suchen<br />
sind, was aber dem objektiven Eingebundensein in »lange Interdependenzketten« widerspricht.<br />
Der »real existierende Sozialismus« ist wohl auch an dem Anachronismus und dem inneren<br />
Widerspruch gescheitert, dass er einerseits die modernen Integrationsprozesse der sozioökonomischen<br />
Entwicklung bewusst vorantreiben wollte, da er sich <strong>als</strong> die fortschrittlichste Gesellschaftsund<br />
Wirtschaftsform verstand, die parallelen, der ökonomischen Basisentwicklung interdependenten<br />
kulturellen und gesellschaftlich-politischen Differenzierungsprozesse aber negierte oder<br />
abkoppeln wollte, um sie durch eine utopische Gemeinschaftsideologie unter einem emotionalisierten<br />
Solidaritätspostulat und durch kollektivistische Lebensentwürfe ersetzen wollte, die letztlich<br />
wieder auf eine historisch überholte Außensteuerung des Verhaltens hinauslaufen.<br />
Und hier werden die Absurditäten gewisser Züge der beobachteten Transformationsprozesse besser<br />
verständlich. Die kollektivistische Außenlenkung des individuellen Verhaltens wird <strong>als</strong> »Unfreiheit«,<br />
»Gängelei«, Belastung empfunden, weil sie, wie es der Einzelne eher intuitiv erfasst, einen<br />
Anachronismus in der Entwicklung der Staatsgesellschaft, in der auch der Sozialismus steht,<br />
darstellt – der zunächst in Ländern der Semiperipherien wie Russland besser durchzusetzen war <strong>als</strong><br />
in den Ländern der sozioökonomischen Zentren Mittel- und Westeuropas – und objektiv dysfunktional<br />
zur ökonomischen Entwicklung ist.<br />
dass dies verstärkt wurde durch den naiven, die gesellschaftlichen Hintergründe oft nicht<br />
verstehenden Vergleich mit den »offensichtlichen westlichen Lebensformen«, wobei diese »westlichen<br />
Leitbilder« ja oft nicht mit der realen Situation übereinstimmten, hat das Gefühl der<br />
Dissonanz und des eigenen Ungenügen nur verstärkt und zur Einleitung der Transformationsprozesse<br />
beigetragen.<br />
Nach der Systemtransformation erfährt der Einzelne nun den »Zwang zum Individualismus«, die<br />
Zumutung einer Individualisierungsforderung, auf die er nur ungenügend biographisch vorbereitet<br />
worden ist. Die Dissonanzerfahrungen erneuern sich unter umgekehrtem Vorzeichen. Dies erklärt<br />
dann die mit zeitlichem Abstand zunehmende »Kollektivismus-Nostalgie«, in der die unfreien<br />
Lebensformen nicht mehr <strong>als</strong> bedrückend und entmündigend, sondern <strong>als</strong> schützend und emotional<br />
bergend erinnert werden.<br />
Soziologisch gesehen weist das darauf hin, dass es der »westlichen Gesellschaft« nicht gelungen ist,<br />
den Menschen in den Transformationsgesellschaften ein genügendes Maß an »Ordnungssicherheit«<br />
zu vermitteln [87] , da die »westliche Ordnung« eben nicht voraussetzungslos übertragbar ist – das<br />
zeigt sich auch an den fundamentalen Problemen und Konflikten von »Verwestlichungsstrategien«<br />
in den Ländern der Semiperipherien und der »Dritten Welt« –, sondern einen im Prozess der<br />
Staatenbildung und der Herausbildung der Staatsgesellschaft historisch definierten<br />
Enkulturationstyp und die mit ihm verbundene, institutionalisierte gesellschaftliche Figuration<br />
voraussetzt, die sich durch den Eigensinn ihrer Ordnungs- und Wertvorstellungen <strong>als</strong> Politische<br />
Kultur kennzeichnen lässt.<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 30
Zunehmend wird aber auch für die Menschen der »westlichen« sozioökonomischen Zentren die<br />
Dichotomie von Integration und Differenzierung, d.h. auch: die Individualisierungszumutung zum<br />
existenziellen Wahrnehmungs- und Wertproblem.<br />
Die sich verstärkende soziostrukturelle [88] und sozioökonomische Differenzierung, die Dynamisierung<br />
der Arbeitsmärkte, zerstört die Sicherheiten der biographischen Perspektiven. Die gesellschaftlich-kulturelle<br />
Fraktionierung der Gesellschaft bewirkt eine ebensolche Fraktionierung der Lebensläufe,<br />
die Zunahme der so genannten »patchwork biographies« [89] , die auch die erwartete Ordnungsund<br />
Zukunftssicherheit und damit den Investitionswert der eigenen Gesellschaft tendenziell<br />
aufheben.<br />
Das verlangt neue Sozialisations- und Enkulturationstypen, denen sich die Schule und insbesondere<br />
die Politische Bildung stellen muss: eine noch nicht in ihren Umrissen klar erkennbare Aufgabe, die<br />
viel zur derzeitigen Rollenunsicherheit in der Lehrerschaft beiträgt. Ordnungssicherheit kann<br />
zukünftig immer weniger von der äußeren, gesellschaftlichen Realität erwartet und eingefordert<br />
werden. Wie im Laufe des Zivilisationsprozesses die Verhaltenssteuerung muss in einer neuen<br />
Entwicklungsphase auch die Orientierungssicherheit internalisiert, <strong>als</strong>o hinter die gesellschaftlichen<br />
Kulissen verlegt werden. Das ist nicht unproblematisch und gemessen an den Bildungszielen auch<br />
immanent widersprüchlich. Letztlich zielt es auf eine völlig in die Person verlegte Identität, die sich<br />
immer mehr von den Realitäten abkoppelt, abkoppeln muss: ein Aspekt des »langsamen<br />
Verschwindens der Realität«. Die Identität wird im hohen Maße virtuell und damit auch beliebig.<br />
Der Individualisierungsprozess erzeugt damit den Hedonismus und die Selbstbezüglichkeiten der<br />
unverantwortlichen Ellbogengesellschaft. [90] Die Kehrseite dieses gesellschaftlichen Prozesses ist<br />
dann auch die tendenzielle Umkehr eines der Kernentwicklungen der europäischen Zivilisationsund<br />
Staatenbildungsgeschichte: der Durchsetzung des Gewaltmonopols des Staates. Das geht einher<br />
mit dem Funktionsverlust des klassischen westeuropäischen Nation<strong>als</strong>taates und den vielfältigen<br />
Erfahrungen des Staatsversagens. Damit schließt sich ein Bogen unserer Eingangs angesprochenen<br />
Krisendiagnose der Gegenwartsepoche. Das Entwicklungsziel ist noch nicht hinreichend erkennbar,<br />
die gesellschaftlichen Widersprüchlichkeiten und Risiken stehen im Vordergrund, die<br />
Individualisierung, die den Kern der bürgerlichen Freiheitsbemühungen seit dem 18. Jahrhundert<br />
und der Durchsetzung der Menschenrechte war, wird zunehmend <strong>als</strong> Individualisierungszumutung<br />
wahrgenommen; Freiheit und Menschenrechte verlieren damit ihre immanente gesellschaftlichpositive<br />
und fortschrittliche Konnotation. Dies entsprich auch der originären Wahrnehmung des<br />
freiheitlichen Kernbestandes der europäischen Politischen Kultur durch die Gesellschaften eines<br />
Teils der Länder der sozioökonomischen Semiperipherien, die darin eher europäisches Oktroi denn<br />
Modernisierungschancen für die eigene Existenz erkennen können. Doch sollte dies auch aus<br />
unserer Sicht nicht zu einem interesse- und engagementlosen Kulturrelativismus führen, der<br />
ahistorisch ist, da er für die eigene Geschichte außer Acht lässt, dass diese zentralen Rechte ja in<br />
einem langwierigen und z.T. blutigen Kampf gegen die Herrschaft und gegen überlebte Traditionen<br />
erkämpft worden sind. [91]<br />
Indem sich gesellschaftliche Verhaltensformen strukturell und funktional ausdifferenzieren,<br />
fraktionieren sich zunehmend die gesellschaftlichen Orte [92] – Orte der Kommunikation, Interaktion<br />
und der gesellschaftlichen Symbole – und die individuellen und sozialen Verhaltensformen in<br />
differenzierten sozialen Milieus, die sich durch kohärente symbolische Interaktionsformen beschreiben<br />
und bis zu einem gewissen Grade auch gegeneinander abgrenzen lassen.<br />
Dabei wird es zunehmend auch zu einer innerpsychischen und mentalen »Fraktionierung« der<br />
individuellen Persönlichkeiten kommen, die die These von der personalen Identität und ihrer<br />
zeitlichen und situativen Persistenz grundsätzlich Frage stellen kann und unsere grundlegenden<br />
psychologischen Überzeugungen und damit auch pädagogischen Konzepte tendenziell erschüttert.<br />
Der Einzelne durchläuft in seiner Biographie viel deutlicher sichtbar <strong>als</strong> früher nicht nur konsistente<br />
Entwicklungsphasen, sondern immer schneller differenzierende Situationen, die zudem im gesell-<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 31
schaftlichen Kontext immer widersprüchlicher werden. Nach Ulrich Beck und Elisabeth Beck-<br />
Gernsheim (1990) ist „das Idealbild der arbeitsmarktkonformen Lebensführung der oder die vollmobile<br />
Einzelne, der ohne Rücksicht auf die sozialen Bindungen und Voraussetzungen seiner<br />
Existenz und Identität sich selbst zur fungiblen, flexiblen, leistungs- und konkurrenzbewussten<br />
Arbeitskraft macht, stylt, hin und her fliegt und zieht, wie es die Nachfrage und Nachfrager am<br />
Arbeitsmarkt wünschen“. [93]<br />
dass in der Eingebundenheit in solche »patchwork-Identitäten« von konsistenten, haltbaren Wertorientierungen<br />
und Realitätssichten nicht mehr ausgegangen werden kann, bestätigt die gesellschaftliche<br />
Analyse der medial vermittelten »virtuellen Welten«, in denen sich gerade auch<br />
Jugendliche existenziell eingebunden und geborgen fühlen und die damit zu einem Ersatz für die<br />
mangelnde Sicherheit der äußeren Realität werden, in denen Lara Croft mehr Schutz und<br />
Orientierung verspricht <strong>als</strong> Gerhard Schröder. Es sollte hier aber nicht das Missverständnis auftreten,<br />
dass diese Jugendlichen nicht mehr tatsächlich die verschiedenen Stufen von Realität und<br />
Virtualität unterscheiden könnten, das ist durchaus der Fall. Es liegt <strong>als</strong>o keine Intellektuelle<br />
Verwirrung oder Verdummung vor, sondern eine Verschiebung der kulturellen Symbolinventare<br />
und der Symbole für Verhaltensnormen, Verhaltensoptionen und Wertsichten in Bereiche, die sich<br />
zunehmend gesellschaftlicher und damit sowohl familialer wie schulisch-institutioneller Kontrolle<br />
entziehen.<br />
Dieses Thema wird hier nur <strong>als</strong> Perspektive des notwendigen Diskurses über »Individuum, Gewalt,<br />
Soziabilität« angerissen und muss in sozialisationstheoretischer, medien-(kommunikations-)wissenschaftlicher<br />
und kulturwissenschaftlicher Hinsicht vertieft und empirisch verfestigt werden. Es<br />
zeigt aber, dass das gesellschaftliche Diskursfeld »Individualisierung« sehr enge Verflochtenheiten<br />
zur Existenz und Befindlichkeit sowohl der Lehrerschaft wie der Schülerinnen und Schüler aufweist<br />
und durch den daraus hervorgehenden hohen Betroffenheits- und Emotionalitätsgrad besondere<br />
Anforderungen an die didaktische und methodische (Vor-) Arbeit für den <strong>Unterricht</strong> stellt, dafür<br />
aber auch große Chancen birgt, sich selbst auch aus der Situation der Schule heraus in die<br />
öffentlichen Diskurse einzuschalten. Die Qualifikationsanforderungen für die Lehrerausbildung und<br />
eine permanente Lehrerweiterbildung in diesem Bereich sind offensichtlich.<br />
Über den Individualisierungs- und Differenzierungsansatz eröffnen sich dabei auch weitere<br />
argumentative Möglichkeiten, über das Thema »Gewalt« <strong>als</strong> gesellschaftliche Verhaltensoption zu<br />
sprechen und die Gewaltthematik nicht ausschließlich in der Alternative des moralisierenden<br />
Diskurses oder der psychologisierenden Gewaltprophylaxe zu sehen und zu bearbeiten. Beide<br />
Ansätze greifen zu kurz, da sie den Bezug zu den übergreifenden gesellschaftlichen Prozessen und<br />
Veränderungen ausblenden und damit selbst in die »Falle der Individualisierung« argumentativ<br />
herein geraten. Gewalt muss <strong>als</strong> pädagogisch verantwortetes Thema aber weniger in seinen – dem<br />
Stand der Wissenschaft nach teilweise recht kontroversen und spekulativen – psychologischanthropologische<br />
Kontexten, dafür aber mehr im Zusammenhang der Gewalt <strong>als</strong> zentraler Topos<br />
des Zivilisierungsprozesses gesehen werden. Auch hier steht der Prozess zivilisatorischer<br />
Integration – abzulesen an dem Grad der erreichten verinnerlichten Soziabilität – den gegenläufigen<br />
desintegrativen Differenzierungs- und Individualisierungsprozessen entgegen, der potentiell eine<br />
Infragestellung des Gewaltmonopols des Staates bedeutet.<br />
Eine Fortführung dieses Diskurses wird damit die über die staatsgesellschaftlichen Urteilskategorien<br />
heraus weisenden Interdependenzen und Einwirkungen durch den Prozess der Globalisierung<br />
zu thematisieren haben, dessen universelle Integration wiederum den grundlegenden<br />
Aussonderungs- und Differenzierungsprozessen vor allem in den Ländern der globalen Peripherien<br />
und Semiperipherien entgegensteht.<br />
Hier befinden wir uns schon im nachfolgenden Diskursfeld »Zivilisation, Gesellschaft, Staat«,<br />
wenn die grundsätzlichen Widersprüchlichkeiten des Zivilisationsprozesses zwischen Integration<br />
und Desintegration in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit Rücken und <strong>als</strong> zentrales Problem zu<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 32
egreifen sind, das unmittelbare Auswirkungen auf die Grundlegungen einer gesellschaftsorientierten<br />
<strong>Politik</strong>didaktik gewinnt.<br />
4.5 Diskurs »Zivilisation, Gesellschaft, Staat«<br />
4.51 Die Problematik eines »unübersichtlichen Diskurses«<br />
Der Diskurs zu »Zivilisation, Gesellschaft, Staat« zeigt besonders deutlich die inneren Divergenzen<br />
und die über den Diskursgegenstand hinausweisenden Verflochtenheiten einer inhaltlich bestimmten<br />
Konzeption von »Schlüsselproblemen«, die im Gegensatz zu traditionellen Rahmenthemen für<br />
den <strong>Unterricht</strong> sich nicht im Prozess einer thematischen Reduktion, sondern nur durch die Teilnahme<br />
an den Diskursen selbst realisieren. Schlüsselprobleme tendieren daher einerseits zur thematischen<br />
Entgrenzung, andererseits zur schrittweise fortschreitenden Ausdifferenzierung von Diskussionsschwerpunkten<br />
und Problemdefinitionen.<br />
Umso wichtiger ist es einzusehen, dass nur innerhalb des Diskurses selbst Kriterien für<br />
exemplarische und für situations- und rezipientenorientierte Komplexitätsreduktion, wie sie unter<br />
didaktischen Gesichtspunkten für den Schulunterricht unabdingbar sind, gefunden werden können.<br />
Die auch in der öffentlichen Diskussion zu verfolgende Entgrenzung des in Frage stehenden<br />
Diskurses kann im Extrem dazu führen, dass letztlich das gesamte Problem- und Realitätsfeld<br />
<strong>Politik</strong> und Gesellschaft undifferenziert und amorph in den ausufernden Diskurs einbezogen wird.<br />
Gerade unter dieser mangelnden Eindeutigkeit und fehlenden Distinktivität der kommunizierten<br />
Diskussionsbeiträge leidet auch der öffentliche Meinungsaustausch über dieses »Thema« – wie wir<br />
es derzeit an Stelle einer Klassifizierung <strong>als</strong> Diskurs wohl eher bezeichnen müssen – Staat und<br />
Gesellschaft: es ist tatsächlich nicht viel mehr <strong>als</strong> ein Meinungs-Austausch oder auch eine gesellschaftlich<br />
folgenlose Meinungs-Konfrontation, die rationaler und diskursiver Strukturen mangelt.<br />
Einen solchen entgrenzten und umfassenden Realitätsbereich <strong>als</strong> notwendigen und möglichen<br />
Diskurs zu postulieren, setzt die Hoffnung auf eine wachsende Diskursfähigkeit der Gesellschaft<br />
voraus. Diese Hoffnung fällt zusammen mit den Zielen einer erneuerten <strong>Politik</strong>didaktik und ist ohne<br />
die Einbeziehung der gesellschaftswissenschaftlichen Kompetenz nicht denkbar.<br />
Dort wo dem »freien Diskurs« in der Öffentlichkeit rationalen Strukturen mangelt, wo Meinungsaustausch<br />
zu Beliebigkeit oder Banalität der Auseinandersetzungen führt, muss verstärkt Wissenschaftlichkeit<br />
eingefordert und Sach- und Fachkompetenz zur leitenden und strukturierenden<br />
Diskursintegration geführt werden.<br />
Das Diskursfeld »Zivilisation, Gesellschaft, Staat« ist gerade dadurch so amorph und uneindeutig,<br />
weil die fachliche Fundierung vage, umstritten und teilweise von wissenschaftsgeschichtlichen<br />
Zufälligkeiten bestimmt ist, wie wir es für die <strong>Politik</strong>didaktik und den <strong>Politik</strong>unterricht <strong>als</strong> Teil der<br />
Beschäftigung mit dem Problemfeld ›Staat und <strong>Politik</strong>‹ eingangs schon nachgewiesen haben.<br />
An dieser Stelle kann nun der intensive wissenschaftliche Diskurs der Gegenwart nicht aufgearbeitet<br />
oder auch nur ansatzweise referiert werden. Es genügt der Hinweis auf aktuelle<br />
Forschungs- und Diskursgegenstände, die den Interdependenzcharakter der differenzierten Aspekte<br />
des Diskursfeldes »Zivilisation, Gesellschaft, Staat« exemplarisch verdeutlichen. Der semantisch<br />
allgemeingebräuchliche Begriff Staat wird nicht nur in seiner konkreten Ausgestaltung einmal unter<br />
dem Problemfeld des »Staatsversagens« und zum anderen durch seine Relativierung durch<br />
allgegenwärtig wahrgenommene Globalisierungs- und Universalisierungsprozesse zunehmend in<br />
Frage gestellt sondern zunehmend auch unter historisch-soziologischer Perspektive begrifflich und<br />
<strong>als</strong> konkrete Entität auf die heutige Staatsform der »westlichen Staatsgesellschaft« reduziert. Er<br />
trennt sich damit im Sinne einer konkreten begrifflichen Ausdifferenzierung von abweichenden<br />
Herrschaftsformen und -verbänden, von nichtstaatlichen Gesellschaftsstrukturen. Das macht die<br />
Frage nach dem Entstehen des modernen Nation<strong>als</strong>taates ebenso aktuell und dringlich wie die Frage<br />
nach dem Entstehen unseres Allgemeingültigkeit beanspruchenden Staatsbegriffes und seiner histo-<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 33
isch-gesellschaftlichen Funktion. Norbert Elias in seiner Zivilisationstheorie und Immanuel<br />
Wallerstein mit seiner Welt-Systemtheorie nähern sich dieser Frage in neuer und origineller Weise<br />
und werden dadurch zum Ausgangs- und Anknüpfungspunkt heutiger gesellschaftswissenschaftlicher<br />
Arbeiten, die sich dann auch mit aktuellen <strong>Politik</strong>feldern wie »Globalisierung, Migration und<br />
Multikulturalität« [94] befassen, Themen, die einer rational-diskursiven Erhellung mit den »klassischen«<br />
Theoremen der <strong>Politik</strong>wissenschaft bislang erhebliche Schwierigkeiten bereiteten. Damit<br />
wird aber die grundsätzliche Interdisziplinarität der diskursiven Arbeit mit Schlüsselproblemen<br />
wieder verdeutlicht.<br />
4.52 Die aktuelle Bedeutung des Diskurses über Zivilisation und Höflichkeit<br />
4.521 Zivilisation und Alltagsverhalten – Das Alltägliche und das Besondere«<br />
Verhaltensweisen unseres Alltags, die uns selbstverständlich erscheinen, sind einem auffälligen historischen<br />
Wandel unterworfen. dass man im Mittelalter anders lebte, aß, trank, spuckte, liebte,<br />
kämpfte... <strong>als</strong> heute, ist nun keineswegs ein »kurioser Zufall«, sondern Ergebnis eines nachvollziehbaren<br />
gesellschaftlichen Wandels, den wir <strong>als</strong> Zivilisationsprozess bezeichnen. Die zivilisatorischen<br />
Normen sind durch Erziehung, Sozialisation und ›Enkulturation‹ tief in der eigenen<br />
Persönlichkeit verankert, habitualisiert, was dadurch erkennbar wird, dass eigene oder fremde<br />
Verstöße gegen das ›zivilisierte Verhalten‹ mehr oder weniger ausgeprägt mit Ekel, Unbehagen,<br />
Scham oder Peinlichkeitsgefühlen abgewehrt oder mit einem »moralischen Verdikt« belegt werden.<br />
Dabei ist die eigene Zivilisation im Bewusstsein der Menschen immer die richtige, die selbstverständliche<br />
Zivilisationsform, obwohl sie weder historisch unveränderbar und sicher ist, noch von<br />
den Nachbarvölkern geteilt wird. Gerade dieser aktuelle Problembezug macht den Diskurs über die<br />
Zivilisation so aktuell und auch exemplarisch für den Umgang mit dem Konzept der<br />
Schlüsselprobleme. Einige differenzierte Ausführungen sollen dabei zeigen, dass zentrale Diskurse<br />
in den öffentlichen Bereichen durchaus differenziert und oft sehr eingeschränkt wahrgenommen<br />
werden. Eine analytische Rationalisierung belegt, dass der Diskurs über gesellschaftliche Schlüsselprobleme<br />
auf verschiedenen Ebenen geführt wird, so z.B. der Ebene der unmittelbaren gesellschaftlichen<br />
Alltagswahrnehmung, die dann didaktischer Ausgangspunkt sein wird, der Ebene der<br />
interessengeleiteten Deutungen und Realitätssichten, die vor allem politisches Verhalten begründen<br />
und strukturieren, sowie die wissenschaftliche Diskursebene, die durchaus nicht naiv mit größerer<br />
»Wahrheit« oder Realitätshaltigkeit gleichgesetzt werden darf – obwohl sie am ehesten über das<br />
distanzierend-rationale Instrumentarium einer sachlichen Realitätsnäherung verfügen –, sondern oft<br />
eher die personalen und institutionellen Probleme, Strukturen und Konflikte im Wissenschaftsbetrieb<br />
nachzeichnen.<br />
Die Ebene der unmittelbaren Erfahrung spiegelt sich in der Wahrnehmung des Alltagsverhaltens,<br />
vor allem der Formen der „Höflichkeit“. Dabei spielt nicht nur die innergesellschaftliche Perspektive<br />
eine Rolle, sondern die interkulturelle Perspektive tritt zunehmend in den Wahrnehmungsvordergrund.<br />
Viele Alltagsverhaltensweisen weichen sogar in so eng verwandten und historisch<br />
verknüpften Nachbarvölkern wie Frankreich, England, Polen oder Ungarn, von unserem deutschen<br />
Verhalten ab: Quell für Missverständnisse, Peinlichkeiten und Vorurteile.<br />
Es ist faszinierend und auch didaktisch ergiebig, den historischen Erfahrungen der anderen Völker<br />
[95] nachzugehen, um damit die unterschiedlichen Verläufe des Zivilisationsprozesses erkennen<br />
und erklären zu können.<br />
In diesem Zusammenhang lässt sich der ›Zivilisations-Prozess‹ eines Volkes erkennen und erklären<br />
<strong>als</strong> verarbeitete und mit gesellschaftlichem Sinn versehene Erfahrung in der Begegnung mit dem<br />
›Fremden‹ – Freund oder Feind – und dem ›Eigenen‹ – in Schutz oder Herrschaft –. Verallgemeinernd<br />
lässt das Fragen nach der Bedeutung von Kulturkontakten für den Zivilisationsprozess.<br />
Soziologische und sozialpsychologische Erklärungsansätze helfen zum Verständnis von<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 34
Enkulturations- und Akkulturationsprozessen, die Voraussetzung der gesellschaftlichen Verarbeitung<br />
der Fülle individueller Erfahrungen und Biographien sind.<br />
Der Zivilisationsprozess muss damit immer eine Balance zwischen dem durch den gesellschaftlichen<br />
Wandel und den technisch-ökonomischen Fortschritt forcierten Individualisierungsprozess<br />
und der Universalisierung und Globalisierung der materiellen gesellschaftlichen Lebens- und<br />
Herrschaftsbedingungen finden – Weltökonomie, Universalitätsanspruch des wissenschaftlichen<br />
Weltbildes, Globalisierung der Kommunikation und der medial vermittelten Leitbilder, Entdifferenzierung<br />
des Sprachgebrauchs, Internationalisierung der Herrschaftszentren erzwingen Normierungen<br />
und Einschränkungen der individuellen und gruppenbezogenen Differenzen, die im krassen<br />
Widerspruch zur Zumutung der individuellen Freiheit und Verantwortlichkeit erlebt werden; oder<br />
reduziert sich die humane Freiheit auf die Freiheit der Konsumentscheidung, ersetzen materielle<br />
Komfortversprechungen den »psychischen Reichtum« von Kreativität und sozialer Kompetenz?<br />
Das deutet auch die Notwendigkeit an, Diskurse und Schlüsselprobleme grundsätzlich nicht abgeschlossen<br />
und primär distinktiv, sondern interdependent verwoben und <strong>als</strong> Näherungen an eine<br />
komplexe gesellschaftliche Realität zu verstehen. Aufgabe der Didaktik ist dabei gerade, die der<br />
Lernsituation, der Lerngruppe und der Altersstufe entsprechende Komplexitätsreduktion zu entwickeln,<br />
die ein Höchstmaß der gesellschaftlichen Komplexität zu vermitteln sucht, ohne dass diese<br />
Komplexität zum unüberwindlichen Motivations- und Rezeptionshemmnis wird. Schülerinnen und<br />
Schüler sind im Lernprozess schrittweise an diese gesellschaftliche Komplexität und Verflochtenheit<br />
heranzuführen, wobei Distanz und Differenzierungsfähigkeit neben motivationaler Nähe<br />
unabdingbare pädagogische Leitlinien sein müssen. Dabei ist die gesellschaftliche Erfahrung der<br />
Schülerinnen und Schüler und ihre außerschulische Eingebundenheit in öffentliche und private<br />
Kommunikationsprozesse Ausgangspunkt der didaktischen Problemstrukturierung, wie das nachfolgend<br />
noch angedeutet werden soll.<br />
Als Krisensymptome erlebt unsere Gesellschaft den offensichtlichen Verfall der alltäglichen Selbstverständlichkeiten,<br />
wie Gewaltfreiheit, höflicher Umgang, Respekt vor dem Fremden und seinem<br />
Eigentum... Doch es verstoßen immer nur die Anderen, der Jugendliche, der Ausländer, dagegen,<br />
nie die eigene Gesellschaft, die eigenen Bekannten und Kolleginnen und Kollegen ...<br />
Ob die westliche Zivilisation diesen Spagat zwischen individualisiertem Menschenbild, Individualisierung<br />
<strong>als</strong> Vereinsamung in der Massengesellschaft und den wachsenden Vereinheitlichungszwängen<br />
bewältigen kann, soll mit der Frage erörtert werden: Wie viel Zivilisation braucht der<br />
Mensch, welche Zivilisationsstandards sollen unserer Gesellschaft erhalten bleiben?<br />
4.522 Didaktische Zwischenbemerkungen<br />
Nachfolgend sollten in einer tabellarischen didaktischen Aufbereitung wesentliche Arbeitsschwerpunkte<br />
in Form einer thematischen Gliederung vorgestellt werden, die eine erste unterrichtlichdidaktische<br />
Umsetzung bedeuten könnte und auf die eigene <strong>Unterricht</strong>spraxis des Verfassers<br />
zurückgeht:<br />
Begegnung mit der fremden Alltagskultur: Das Bazargespräch [96]<br />
Der Zivilisationsprozess in Europa<br />
Textarbeit (Norbert Elias: Zivilisationstheorie)<br />
Rollenspiele und Berichte: Essen, Schlafen, Spucken, Kämpfen im Wandel der Zeit<br />
Das ›Eigene‹ und das ›Fremde‹ (Leiris)<br />
Texte zum Kulturkontakt<br />
Referate über die Alltagskultur der europäischen Nachbarländer: Wie verhält man sich<br />
in verschiedenen Situationen gegenüber dem Fremden und gegenüber dem Freund?<br />
Ist unsere Zivilisation gefährdet?<br />
Individualisierungsprozesse in der Massengesellschaft und Universalisierung von<br />
Kommunikation und Problemsituationen<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 35
Diskussion: Ist unsere Schule noch in der Lage, Zivilisationsprozesse zu fördern, zu<br />
fordern und zu ermöglichen?<br />
Die Auseinandersetzung mit Zivilisationsprozessen ist immer auch eine Auseinandersetzung mit<br />
der eigenen Identität und mit den eigenen Selbstverständlichkeiten, die nur durch Distanz und<br />
Verfremdung, durch den Blick in den Spiegel des Fremden, rational bewältigt werden kann.<br />
Deshalb müssen im <strong>Unterricht</strong> bezogen auf die jeweils konkrete Lerngruppe ganz unterschiedliche<br />
Arbeitsformen von verschiedener Seite her ein differenziertes Problembewusstsein ermöglichen.<br />
Einiges Gewicht wird in der gymnasialen Sekundarstufe II z.B. in den Fächern <strong>Politik</strong>, Geschichte<br />
oder den so genannten »Wertefächern« sicherlich die Textarbeit z.B. mit Quellentexten des<br />
»Klassikers der Zivilisationstheorie«, Norbert Elias, haben. Daneben treten aber mehrere Phasen<br />
selbständigen Arbeitens. Schon am Anfang eines Kurses im Bereich des Diskursfeldes Zivilisation<br />
sollte die Geschichte von Elementen des Alltags zwischen Mittelalter und Moderne entdeckt und in<br />
Berichten und Rollenspielen verdeutlicht werden. Wie wir uns grüßen, wie wir essen, wie wir<br />
lieben, wie wir hassen und unsere Aggressionen verarbeiten wird kaum durch die »Zehn Gebote«,<br />
sehr wohl aber durch die Zivilisationsnormen bestimmt, ist daher auch zwischen den Völkern und<br />
den Zeitaltern sehr unterschiedlich geregelt: die wichtigste Voraussetzung für ein »Interkulturelles<br />
Lernen«!<br />
Einerseits stellen die ökonomisch mächtigen Nationen des »Westens« des Anspruch, ihre<br />
Alltagswerte <strong>als</strong> verbindlichen und unbezweifelbaren Lebensstil zu »universalisieren«, d.h. global<br />
durchzusetzen – und rufen damit oft Verachtung, Entrüstung und Hass bei den abhängigen Völkern<br />
der Peripherien hervor (der so genannte »Krieg der Kulturen« nach Huntington) –, andererseits<br />
zerfällt die Verbindlichkeit dieser zivilisatorischen Regeln in den Industriestaaten selbst im<br />
dominanten Prozess der ökonomisch begründeten und durch Medien durchgesetzten Tendenz zur<br />
Individualisierung. Diese Widersprüchlichkeiten des Zivilisationsprozesses besser begreifen zu<br />
können und Folgerungen für unsere eigenen Verhaltensnormen zu ziehen, wird Aufgabe dieses<br />
<strong>Unterricht</strong>s sein.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Geschichte des Essens und der Tafelsitten<br />
Geschichte des Bades und der Körperpflege<br />
Geschichte des Arbeitstages<br />
Geschichte des Schnäuzens, Spuckens und Rülpsens...<br />
Geschichte der Angriffslust und der Alltagsgewalt<br />
Geschichte der Liebe und der Sexualität<br />
Der interkulturelle Kontakt verlangt nicht nur den historischen Blick und die zeitliche<br />
Verfremdung, sondern auch die Begegnung mit dem Alltag des Fremden. Dazu könnten im zweiten<br />
Teil eines solchen Kurses [97] Referate gehalten werden über die Selbstverständlichkeiten unserer<br />
europäischen Nachbarn. Vielleicht können hier auch eigene Erfahrungen und Erlebnisse mit<br />
eingebracht werden?<br />
Höflichkeit, Alltag und Gesellschaft in Frankreich<br />
Höflichkeit, Alltag und Gesellschaft in England<br />
Höflichkeit, Alltag und Gesellschaft in Polen<br />
Höflichkeit, Alltag und Gesellschaft in Russland<br />
Höflichkeit, Alltag und Gesellschaft in ... ... ...<br />
Die Frage nach der Zukunft der Zivilisation führt zu der Frage nach der Zukunft der Schule <strong>als</strong> Instanz<br />
der Wertevermittlung und der Enkulturation, der Einführung in die zivilisatorischen<br />
Standards... Wie ist dann dieses – pessimistische? – Statement zu beurteilen: »Die Zivilisation ist<br />
nicht gefährdet, die Zivilisation ist schon beendet!« Stimmt das mit dem eigenen Gesellschaftsbild<br />
überein? Diese Selbstbezüglichkeit ist bei der Behandlung von »Wertethemen« und in den eigent-<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 36
lichen »Wertefächern«, die wesentliche Wirkungen im Bereich der Politischen Bildung evozieren,<br />
besonders wichtig.<br />
Zu erkennen ist im <strong>Unterricht</strong> zunächst einmal, dass »Zivilisation« die Summe der »selbstverständlichen«<br />
Verhaltensregeln, Sichtweisen und Realitätsdefinitionen des Alltags ist, die ein Zusammenleben<br />
der Menschen ermöglichen sollen, fernab der hohen Werte, der religiösen, moralischen<br />
und philosophischen Normen. Zivilisation ist keine Selbstverständlichkeit, sondern das Produkt der<br />
Geschichte des gesellschaftlichen Zusammenlebens, der Konflikte und kollektiven Erfahrungen, vor<br />
allem aber auch der Prozesse der Machdurchsetzung und der Herrschaftsansprüche, die über<br />
Sprache, Höflichkeit, Umgangsformen und Tabus bestimmen wollen.<br />
4.523 Die Zivilisation im Staatenbildungsprozess: Ein problematisches Wahrnehmungsfeld<br />
„Der Staat“ (<strong>als</strong> nicht besonders zutreffende Übersetzung auch für das altgriechische Gebilde<br />
„Polis“ ebenso gebraucht wie für antike und mittelalterliche „Reiche“ oder ethnische Stammesverbände<br />
oder die modernen „Nation<strong>als</strong>taaten“) ist eine gedankliche Kategorie, die eine Vielheit historisch<br />
differenzierter Formen organisierten oder institutionalisierten, machtgeordneten menschlichen<br />
Zusammenlebens subsumiert. Staatstheorien sind daher viel weniger Erklärungen zum Verständnis<br />
vorfindbarer Realitäten – diese werden von den historischen Sozialwissenschaften erarbeitet – <strong>als</strong><br />
Versuche, offensichtliche Probleme und Defizite im gesellschaftlichen Zusammenleben durch ordnende<br />
gedankliche Konzepte zu begreifen und politisch handhabbar zu machen. Die Inhalte dieser<br />
Konzepte, Kategorien oder Utopien, sind daher unmittelbar abhängig von den anthropologischen<br />
Grundannahmen und Überzeugungen – z.B. über die Befähigung des Menschen zum Zusammenleben<br />
und die Ursachen der Sozialen Ungleichheit – der Gesellschaft bzw. der Philosophie, <strong>als</strong> auch<br />
von den ethischen Prämissen und Wertvorstellungen, von denen das ordnende Denken des Philosophen<br />
ausgeht – Gerechtigkeitspostulat, Freiheitspostulat, Individualitätspostulat etc. – .<br />
An exemplarischen Beispielen – Platon, Rousseau/Hobbes, Staatsgesellschaftstheorien/Communitarismus<br />
– können im Bereich der Diskurse zum Schlüsselproblemfeld »Zivilisation, Gesellschaft,<br />
Staat« einmal philosophisch-geschichtliche Marksteine für die anthropologische und ethische<br />
Fundierung des Staatsgedankens im historisch-gesellschaftlichen Wandel gesetzt werden,<br />
andererseits sind mit diesem Vorgehen grundsätzliche Einsichten in die historisch-sozialen<br />
Bedingtheiten des Denkens zu vermitteln. [98]<br />
4.53 Zur heutigen sozialgeschichtlichen Problematik der Soziogenese der „Höflichkeit“<br />
Norbert Elias hat mit Blick auf die mitteleuropäische Geschichte die Interdependenz der Entwicklung<br />
der „Staatsgesellschaft“ in den entstehenden europäischen Nation<strong>als</strong>taaten mit der fundamentalen<br />
Habitusentwicklung vom „mittelalterlichen Menschen“, der vom Leben in der Feudalgesellschaft<br />
bestimmt war, zur „modernen Zivilisation“ <strong>als</strong> komplexen und an Verschiebungen von<br />
gesellschaftlichen Machtbalancen geknüpften Prozess dargestellt und historisch belegt. Die innere<br />
Differenzierung und Spannweite dieses Prozesses konnte er durch den Vergleich der unterschiedlichen<br />
Entwicklungen in Frankreich und Deutschland, den Vergleich französischer „civilté“ und<br />
deutscher „Kultur“ darstellen.<br />
Die nachfolgenden Ausführungen sollen deutlich machen, dass der wissenschaftliche Diskurs zum<br />
Schlüsselproblem »Zivilisation, Gesellschaft, Staat« zunächst einen anderen Charakter zeigt <strong>als</strong> die<br />
unmittelbare gesellschaftliche Wahrnehmung z.B. des »höflichen Verhaltens« und der interkulturellen<br />
Wahrnehmungsdifferenzen der Alltagskultur. So ist zum einen die innere, gesellschaftliche<br />
Einheit dieses Diskurses zu erweisen und dann zu erarbeiten, dass dieser Diskurs grundsätzlich<br />
interdisziplinär zu führen ist und im Ergebnis offen ist. Es ist nicht von einem abgeschlossenen<br />
Ergebnis der zivilisationstheoretischen Realitätserschließungen auszugehen, sondern wesentliche<br />
neue, gerade auch diskursfeldübergreifende Fragestellungen ergeben sich gerade im Rahmen der<br />
Rezeption der bahnbrechenden Arbeiten von Elias und Wallerstein. Diese Diskurse sollen hier nicht<br />
inhaltlich weitergeführt werden; es genügt in einem Aufsatz über die Konsequenzen der Krise der<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 37
<strong>Politik</strong> und der Krise der Politischen Bildung mit seiner deutlichen didaktischen Akzentuierung,<br />
diese offenen Frageperspektiven anzudeuten, um damit die Bedeutung des öffentlichen Diskurses<br />
für den notwendigen Paradigmenwechsel in <strong>Politik</strong> und Politischer Bildung zu verdeutlichen und<br />
damit auch die Notwendigkeit der inhaltlichen Offenheit von Schlüsselproblemen im geforderten<br />
Prozess der permanenten curricularen Revision zu betonen. Es erscheint aber dennoch sinnvoll,<br />
noch einmal eine Zusammenfassung der wichtigsten Elemente zivilisationstheoretischer Fragestellungen<br />
zu formulieren, soweit sie Grundlage für eine didaktische Umsetzung sind, wie wir sie<br />
vorstehend, von der unmittelbaren gesellschaftlichen Wahrnehmung ausgehend, versucht haben zu<br />
formulieren.<br />
Im Zentrum der Habitusentwicklung steht eine grundlegende Verhaltensänderung und eine Änderung<br />
der gesellschaftlichen und individuellen Realitätssichten und Wertorientierungen, die<br />
zunächst gekennzeichnet sind durch die zunehmende Zentralisierung und Orientierung auf den<br />
„Hof“ hin, welcher Anerkennung und Praktizierung von „höfischen Verhaltensstandards“ verlangt,<br />
ein Prozess, der und am Vorabend der Französischen Revolution seinen Höhepunkt erreicht hat,<br />
dann aber in einem lang andauernden Internalisierungsprozess und einer sozialhierarchischen<br />
Durchsetzung von „Zivilisationsstandards“ und „Habitusformen“ genereller und allgemein verbindlicher<br />
durchgesetzt wird. Dies geschieht auch im Sinne einer machtbezogenen kulturellen „Homogenisierung“,<br />
die eng verknüpft ist mit der Entstehung und Durchsetzung des Bildes der Nation, des<br />
Volkes und der Ethnie. Diese Durchsetzung erfolgt in einem asymmetrischen Prozess „von oben<br />
nach unten“, vom Hof über das aufsteigende Bürgertum hin letztlich auch in die Arbeiterschaft und<br />
die Arbeiterbewegung. [99]<br />
Elias erklärt damit ein wesentliches Element der gesellschaftlichen Entwicklung Europas und der<br />
Habitusunterschiedes des „mittelalterlichen Menschen“ und des „modernen Staatsbürgers“. Das entspricht<br />
wissenschaftsgeschichtlich der historisch-soziologischen Forschungsmotivation, bei der die<br />
Biographie von Elias und anderen bedeutenden Sozialwissenschaftlern sicher erhellend herangezogen<br />
werden kann, vor dem Hintergrund des traumatischen Erlebnisses des Zusammenbruchs<br />
der <strong>als</strong> gültig geglaubten Zivilisationsstandards in der Zeit des Nation<strong>als</strong>ozialismus in Deutschland<br />
und im Zweiten Weltkrieg, die bisherige „Selbstverständlichkeiten“ fragwürdig und erneut erklärungsbedürftig<br />
werden ließen.<br />
Es wäre aber ein Missverständnis, diesen Forschungsansatz einfach „umdrehen“ zu wollen und <strong>als</strong><br />
allgemeine Beantwortung der Frage nach der gesellschaftlich-historischen Entstehung von „höflichen<br />
Habitusformen“ verstehen zu wollen. Gerade in einem heute über Deutschland und Europa<br />
hinausblickenden Forschungsinteresse ist deutlich zu machen, dass das, was wir in Mitteleuropa <strong>als</strong><br />
„höfliches Verhalten“, <strong>als</strong> Internalisierung, Habitualisierung und Ritualisierung von sozialen „befriedenden“<br />
Umgangsformen verstehen, auch in anderen Kulturen und unter abweichenden soziogenetischen<br />
und psychogenetischen Bedingungen seinen Platz hat und für Erhalt und Selbstverständnis<br />
dieser Kulturen eine zentrale Bedeutung einnimmt.<br />
Gerade der unter Heranziehung der Ansätze der „Weltsystemtheorie“ nach Immanuel Wallerstein<br />
aktuell gewordenen Forschungsrichtung, die sich auf das Entstehen regionaler und globaler zentralperipherer<br />
Disparitäten konzentriert und dabei die „schillernde und ambivalente“ gesellschaftliche<br />
und sozioökonomische Situation in den „Semiperipherien“ in den Vordergrund rückt, zeigt nur zu<br />
deutlich, dass hier ein auf die europäische Geschichte reduzierter Habitusbegriff der „Höflichkeit“<br />
nicht ausreicht. „Höflichkeit“, bleiben wir trotz semantischer Bedenken bei diesem Begriff, spielt<br />
nicht nur eine psychogenetische Schlüsselrolle in der Herausbildung der modernen Staatsgesellschaft,<br />
sondern kann geradezu in gegenteiliger Funktion zur Stabilisierung von machtschwachen<br />
Gruppen beitragen. Gerade das Fehlen des institutionalisierten Nation<strong>als</strong>taates macht die<br />
stabilisierende Funktion von internalisierten kollektiven Wertbegriffen und ritualisierten Alltagsverhaltensweisen,<br />
die uns in hohem Maße <strong>als</strong> „zivilisiert“ und „höflich“ erscheinen wollen,<br />
notwendig.<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 38
Solche Begriffe, die auch in der europäischen Gesellschaft vor der Herausbildung der Staatsgesellschaften<br />
eine wichtige Rolle spielten, sind z.B. der zentrale Begriff der „Ehre“, im engeren<br />
Sinne vor allem der „Familienehre“, aus dem das Verhalten der Blutrache, der „Vendetta“,<br />
abzuleiten ist – das dann wieder vor dem Hintergrund der modernen europäischen Durchsetzung<br />
des „Gewaltmonopols“ des Staates <strong>als</strong> „unzivilisiert“ und „anachronistisch“, gar <strong>als</strong> Verstoß gegen<br />
die „Menschenrechte“ erscheint und wahrgenommen wird –, oder das Rechtsgebot der „Gastfreundschaft“,<br />
das durchaus nicht aus religiösen Geboten abzuleiten ist, sondern der Pazifizierung und<br />
Stabilisierung einer nicht staatsgeordneten Gesellschaft dient.<br />
Gerade Staaten, die durch innere und äußere historische Faktoren erst spät eine Transformation zur<br />
modernen Staatsgesellschaft eingeleitet haben, die z.T. bis heute nicht widerspruchsfrei abgeschlossen<br />
ist, wie z.B. Polen oder die Türkei, die beide den schillernden Begriff der „Semiperipherien“<br />
und der „Transformationsgesellschaft“ illustrieren, zeigen bis heute nichtstaatsgesellschaftliche<br />
Höflichkeitsformen und habitualisierte Verankerungen in traditionellen Verhaltens- und Wertstrukturen.<br />
Dies sollte der Ansatz sein, über Elias hinausgehend, den Zivilisationsbegriff in<br />
historisch-kultureller Hinsicht zu erweitern und neu zu reflektieren.<br />
Es wird nicht leichter, dass auch in diesen Semiperipherien über gewisse historische Zeiträume<br />
echte höfische Kulturen entstanden sind, wie der Sultanshof des Osmanischen Reiches oder die<br />
Magnatenhöfe der Szlachta-Gesellschaft in Polen, deren nostalgisch-romantisierende Reminiszenz<br />
im 19. Jahrhundert sich noch im so genannten Sarmatismus wieder fand. Doch waren diese<br />
Perioden keineswegs Auftakt zur Herausbildung nationaler Staatsgesellschaften wie in Westeuropa.<br />
Der Sarmatismus <strong>als</strong> „anachronistische“ Bewegung, der sich Vertreter des alten, entmachteten<br />
Szlachta-Adels ebenso zuordneten wie national-romantische Dichter und Intellektuelle, die in<br />
überkommenen Lebensstilen und Habitusorientierungen Halt und Sinngebung gegen die allgemeine<br />
Entwicklung der Gesellschaft suchten, ist eine ebenso typische und für Polen und Länder der<br />
Semiperipherien in der Neuzeit bezeichnende Funktionalisierung des „höflichen Habitus“, der jetzt<br />
aber nicht vom Machtzentrum, vom „Hof“ ausgeht, sondern <strong>als</strong> gegenläufiger Prozess den eingeleiteten<br />
Verschiebungen der innergesellschaftlichen Machtbalancen entgegengesetzt wird. Das<br />
Festhalten an einem längst nicht mehr real existenten Macht- und Kulturzentrum des „Hofes“, seine<br />
völlige Internalisierung in der Alltagskultur, ist der unbewusste Versuch, notwendige gesellschaftliche<br />
Modernisierungsschübe aufzuhalten, ist Ausdruck einer „Angst vor der Moderne“.<br />
dass diese anachronistische Habitusorientierung sehr häufig religiös motiviert und legitimiert wird,<br />
basiert auf dem Unvermögen, sich bewusst Antimodernismus oder, in einer polemischeren Auseinandersetzung<br />
„reaktionäre Gesinnung“ einzugestehen und zuschreiben zu lassen. Religion wird<br />
in diesem Sinne gesellschaftlich funktionalisiert. Das geschah im Sarmatismus in Polen mit dem<br />
Katholizismus, der erst <strong>als</strong> „Bollwerk gegen die Moderne“, später im 20. Jahrhundert aber auch <strong>als</strong><br />
„Gegenmacht“ gegen den <strong>als</strong> Oktroi wahrgenommenen (vor allem den sozialistischen) Staat<br />
funktionalisiert wurde.<br />
Im Osmanischen Reich des 19. Jahrhunderts formierte sich in ähnlicher Weise eine sich religiös<br />
definierende antimodernistische Bewegung, in der sich die ihren Einfluss verlierenden Hodschas<br />
(türk. hoca, ländlichen Religionslehrer [100] ) und die nicht zur geistigen Elite zählenden Ulemas<br />
(islamische Theologen) mit traditionalistischen Großgrundbesitzern (Feudalherren, Aǧas) und<br />
ländlich-regionalen Funktionsträgern und Honoratioren der Feudalgesellschaft gegen die von<br />
westlichen Intellektuellen vor allem in der Hauptstadt İstanbul eingeforderte grundlegende<br />
Modernisierung der Türkei formierten. In halbherziger Form schloss sich der Sultanshof zeitweise<br />
der Einsicht in diese Modernisierungsnotwendigkeit an und leitete die Phase der tanzimat-Reformen<br />
ein; vor allem aber das Militär, geschockt durch eine Reihe von Niederlagen, wurde zum<br />
Bannerträger eines westlich orientierten Modernismus, wie es sich vor allem seit der Zeit der<br />
Jungtürkischen Revolution zeigte, und wurde damit zum entschiedenen Gegner religiöser, regionalistischer<br />
und ländlicher traditionalistischer separatistischer Bewegungen. Die heutige Situation<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 39
und Machtverteilung in der Türkischen Republik schließt sich nahezu bruchlos an die dam<strong>als</strong><br />
herausgebildeten Gruppierungen und Machtrivalitäten in der Gesellschaft an.<br />
In einer zivilisationstheoretischen Überlegung ist es dabei von besonderem Interesse, dass innerhalb<br />
der genannten Gruppen jeweils rivalisierende Machteliten herausgebildet werden, die sich in jeweils<br />
sehr ähnlicher Form gleicher psychogenetisch zu verstehender zivilisatorischer Durchsetzungsprozesse<br />
bedienen, inhaltlich dabei in gleicher Weise traditionell sind. „Höflichkeit“ <strong>als</strong> ritualisiertes<br />
und formalisiertes, der Konfliktvermeidung dienendes Alltagsverhalten, ist beiden Seiten zu eigen.<br />
Vier unterschiedliche zivilisatorische Formen und Funktionen der „Höflichkeit“ können daher<br />
zunächst einmal verglichen und nebeneinander gestellt werden. Einmal in der Form des traditionellen<br />
west-mitteleuropäischen Zivilisationsprozesses, der vom Hof ausgeht und gleicherweise<br />
eine Machtzentralisierung durch die Durchsetzung des Gewalt- und Steuermonopols, eine kulturelle<br />
„Homogenisierung“ und die Durchsetzung des Nationenbegriffes umfasst und damit die<br />
Entwicklung des modernen Nation<strong>als</strong>taates wie der „Staatsgesellschaft“ begleitet und ermöglicht.<br />
Diese von Elias vor allem untersuchte Form des Zivilisationsprozesses ist typisch für die späteren<br />
Länder der globalen sozio-ökonomischen Zentren, wobei später dazu stoßende Räume wie die USA<br />
und erst recht nach dem 2. Weltkrieg Japan noch gesondert untersucht werden müssen. In beiden<br />
Ländern sind gemessen am Maßstab westeuropäischer staatsgesellschaftlicher Zivilitätsvorstellungen<br />
auch heute noch erhebliche Defizite festzustellen. Japan hat zwar eine westlich orientierte<br />
ökonomische Funktionselite herausgebildet, doch sind vorherrschende Lebensmodelle und wichtige<br />
Züge der Politischen Kultur, die sich z.B. auch im autoritär-hierarchischen Bildungswesen ausdrücken,<br />
eher traditionalistisch und tragen gewisse Charakterzüge einer vormodernen »geschlossenen<br />
Gesellschaft«. In den USA ist auch das Gewaltmonopol des Staates weitaus weniger durchgesetzt<br />
<strong>als</strong> in Europa, was sich am verfassungsmäßigen Recht, Waffen zu tragen und einer hohen<br />
gesellschaftlichen Akzeptanz der Selbstverteidigung ablesen lässt. Auch die Zivilitätsmerkmale des<br />
europäischen Wertekanons, Egalitätsvorstellungen, soziale Verantwortung des Staates, Ablehnung<br />
der Todesstrafe, haben sich in den USA nicht in dieser Weise durchgesetzt. [101] Ob dies nun<br />
grundsätzlich <strong>als</strong> Modernitätsdefizit zu werten ist, oder ob die europäischen Zivilitätsvorstellungen<br />
relativiert werden müssten, um auch Zivilisationsmodelle der Moderne, die bewusst stärker auf<br />
Dezentralität, Subsidarität und kommunitaristische Ordnungsvorstellungen bauen, <strong>als</strong> gültige<br />
Alternativen verstehen zu können, sei dahingestellt; es berührt aber die grundsätzliche Problematik<br />
der Übertragbarkeit gesellschaftlicher Wertvorstellungen und dem alternativen Konzept des<br />
Kulturrelativismus und hat damit unmittelbare Folgen auf Wertungs- und Einordnungsmöglichkeiten<br />
auch gegenüber Kulturen außerhalb der sozio-ökonomischen Zentren, wie z.B. des Kulturkreises<br />
des Islam. Das leitet zu einem weiteren Zivilitätskonzept über, das hier angesprochen<br />
werden soll.<br />
Neben den europäischen Zivilitätsvorstellungen sollten auch hochritualisierte Zivilitätsformen mit<br />
einem ausdrücklichen „Höflichkeitshabitus“ nicht ausgespart bleiben. Elias selbst kommt z.B. beim<br />
Darstellen der Zivilisationsprozesse bei Alltagsverrichtungen wie dem Essen auf chinesische<br />
Speiserituale und -sitten <strong>als</strong> Beispiel hoch entwickelter Formen des „Hinter-die-Kulissen-Legens“<br />
des Persönlichen, Gewaltsymbolhaften, Intimen zu sprechen. Diese Höflichkeit <strong>als</strong> »Höfischkeit«,<br />
die von den Feudalhöfen ausgeht, ist bei einer interkulturellen Zivilisationsgeschichte von<br />
außerordentlicher Bedeutung, auch wenn die west-mitteleuropäische historische Komponente der<br />
Entwicklung des Nation<strong>als</strong>taates und der modernen Staatsgesellschaft hier vollständig fehlt. Der<br />
persische Hof gehört zu diesem Typus seit Jahrhunderten dazu ebenso wie das mittelalterliche<br />
islamische Kalifat von Damaskus und Baghdad; ebenso alte Hofkulturen in Indien, Südostasien,<br />
Afrika und dem vorkolumbianischen Amerika. Es ist fraglich, ob es hier historisch ausreicht, von<br />
Vormoderne oder im gesellschaftlichen Prozess „unabgeschlossenen Zivilisationsprozessen“ zu<br />
sprechen, oder ob eher der west-mitteleuropäische Weg vor dem Hintergrund der ökonomischen<br />
Modernisierung seit dem Zeitalter des Imperialismus <strong>als</strong> der weltgeschichtliche Sonderweg auch in<br />
Hinblick auf die Zivilisationsprozesse gewertet werden muss.<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 40
Der dritte davon abweichende Zivilisationsprozess konzentriert sich auf das Festhalten an überkommenen<br />
Höflichkeits- und Zivilitätsvorstellungen beim drohenden Einflussverlust durch Modernisierungsprozesse<br />
und konzentriert sich auf älterer Ober- und Funktionsschichten. Die Wortführer<br />
so genannter „fundamentalistischer“ religiöser Schichten gehören in diese Gruppe.<br />
Habitualisierte „Höflichkeit“ ist aber auch ein Mittel und ein Symbol der Widerständigkeit<br />
machtarmer Schichten, die sich in ihrer Formung nicht an konkretem höfischem Verhalten, sondern<br />
an unreflektiert überkommenen Verhaltensmustern und mythischen Realitätsdeutungen orientiert.<br />
Verharrung und Abwehr gegenüber Veränderungs- und Modernisierungszumutungen sind die<br />
gesellschaftliche Funktion dieser gruppenorientierten Form traditionalistischen Verhaltens, wie es<br />
in ruralen Gesellschaften die Regel ist. Gerade diese Verhaltensrituale sind heute in Ländern der<br />
Semiperipherien wichtigste Widerstände gegen sozio-ökonomische Modernisierungsschübe und<br />
staatsgesellschaftliche Entwicklungen, wie es die Genese des Südostanatolienkonfliktes sehr<br />
deutlich zeigt. [102] Gerade hier zeigt sich aber auch die grundsätzliche Ambivalenz zivilisatorischer<br />
Prozesse, die zum einen durch Angst vor der Moderne, Widerstand gegen Veränderungs-, Homogenisierungs-<br />
und Integrationszumutungen [103] motiviert sein können, zum anderen aber auf Symbolund<br />
Kategorienrepertoires zurückgreifen (müssen?), wie der Entwicklung von nationalen und<br />
ethnischen Herkunfts- und Zusammengehörigkeitsmythen.<br />
Aus der Sicht einer interkulturell orientierten historischen Soziologie differenziert sich <strong>als</strong>o das Bild<br />
der Zivilisationsprozesse deutlich und wirft letztlich mehr Fragen auf, <strong>als</strong> die theoretischen Ansätze<br />
bislang an historischen Realitäten erklären können. Doch zeigt eine aktuelle Fortführung des historisch-soziologischen<br />
Diskurses sehr bald, dass heute auch wissenschaftlich neben die Frage nach<br />
Herkunft und Entwicklung der Zivilisation die Frage nach dem »Ende der Zivilisation« und nach<br />
den »zivilisatorischen Alternativen« tritt.<br />
4.54 Das Problem der Dezivilisierung<br />
Zivilität ist keine »Einbahnstraße«, sondern ein permanenter gesellschaftlicher Kampf um die<br />
Durchsetzung und Gültigkeit zivilisatorischer Verhaltensstandards. Diese zivilisierenden gesellschaftlichen<br />
Ziele sind aber, wir haben es angedeutet, immer in Machtprozesse eingebunden, mit<br />
Verschiebungen in den Machtbalancen verbunden und daher nicht unwidersprochen. Verhaltensmächtige<br />
gegenläufige Prozesse lernen wir im Diskurs »Individualisierung, Gewalt, Soziabilität«<br />
kennen. „Die Zivilisation, so wird man nach alldem sagen müssen, ist nicht bedroht. Sie ist<br />
schon vorbei“ schreibt Stefan Breuer 1993. Wesentliche materielle Gründe für diese wahrgenommene<br />
und beklagte Dezivilisierung finden sich in den sozio-ökonomischen Kontexten des<br />
Diskurses »Universalisierung, Globalisierung, Ökonomisierung«. Doch verlangt die Diagnose »Dezivilisierung«<br />
einer differenzierteren Sichtweise, die über den reinen Moralismus und die<br />
millenniaren Ängste hinausweist.<br />
Doch ist diese Wahrnehmung, in einer zunehmend gewalttätigen Welt zu leben, eine gültige<br />
Grundbefindlichkeit, die wesentlichen Einfluss sowohl auf das innergesellschaftliche Zusammenleben<br />
wie auf die über die nationalen Grenzen hinausblickenden Perspektiven und interkulturellen<br />
Werturteile nimmt. Louis Begley, den wir schon Eingangs zitiert haben, fasst diese<br />
Wahrnehmung in folgende Worte: „Straftaten einzelner in nie da gewesener Brutalität und<br />
Häufigkeit sind ein weiteres Symptom für die Ausbreitung des Virus Gewalt. Jack the Rippers Prostituiertenmorde<br />
in London am Ende des vorigen Jahrhunderts sind zahm im Vergleich zu den Serienmorden<br />
mit Folter und Kannibalismus, die in den letzten Jahren in den Vereinigten Staaten<br />
begangen wurden, dem Gemetzel von Männern, die mit automatischen Waffen in Menschenmengen<br />
feuern, der lautlosen Grausamkeit von Heckenschützen, die sich auf einem friedlichen<br />
Universitätscampus Opfer herauspicken, oder dem Giftgasanschlag in der U-Bahn von Tokio.“<br />
Unabhängig davon, ob wir der Diagnose folgen wollen, dass damit tatsächlich eine Gewaltzunahme<br />
bezeichnet werden kann, oder ob nicht verbesserte Tötungsmittel und bessere Kommunikationsmittel<br />
ein verändertes Bild der Gewalt erzeugen, ist die Wahrnehmung einer Gewaltzunahmen real<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 41
und verhaltenswirksam [104] . Gewalt interessiert in diesem diskursiven Kontext aber weniger <strong>als</strong><br />
psychologisches Problem denn <strong>als</strong> Ursache oder Folge von Dezivilisationsprozessen. Gleichmann<br />
(1995) paraphrasiert im Titel eines sehr anrührenden Aufsatzes eine Aussage von Norbert Elias,<br />
wenn er die Frage stellt: „Sind Menschen in der Lage, vom gegenseitigen Töten abzulassen?“<br />
Weit über die individuelle Gewalt zielt diese Frage auch und zuerst auf die staatliche Gewalt, auch<br />
die Gewalt der Kriege und in den Kriegen. Entsteht doch hier im west-mitteleuropäischen<br />
Zivilisationsprozess ein Verständniswiderspruch, wenn die Durchsetzung des Gewaltmonopols<br />
durch die entstehenden Nation<strong>als</strong>taaten gleichzeitig die Identität von Staatssouveränität und<br />
Staatsräson mit der Fähigkeit und Bereitschaft zur Kriegführung gleichzusetzen ist. Kulturkritische<br />
Perspektiven können hier durchaus sinnvoll die Frage nach der Gewichtung der Leidpotentiale<br />
innergesellschaftlicher individueller Gewalt zur staatlichen Gewaltausübung in Kriegen, in Diktaturen,<br />
letztlich im Holocaust stellen. Oder evoziert staatliche Gewalt letztlich sogar zusätzliche<br />
individuelle Gewalt, wenn sie zum Beispiel in Kriegssituationen im Sinne der Kriegsführungsfähigkeit<br />
die Tötungsbarrieren herabsetzt, weg erzieht durch militärische Institutionalisierung [105] ,<br />
die im zivilen Leben gültigen Zivilisationsstandards temporär und situativ außer Kraft setzt, und<br />
nicht nur dies, sondern die zivilen, <strong>als</strong> »natürlich« empfundenen Affekte und Emotionen unterdrückt<br />
oder verbietet: Mitleid, Empathie, Angst, Todesfurcht, Tötungshemmung und dagegen setzt:<br />
Entpersonalisierung, Hass, Aggression, Gehorsam. [106]<br />
Wie sehr dies Thema, dieser bedrückende Sachverhalt auch heute an gesellschaftliche Emotionen<br />
rührt, zeigt die emotionalisierte kontroverse, z.T. äußerst aggressiv geführte öffentliche und private<br />
Auseinandersetzung um die verdienstvolle Ausstellung über die Verbrechen der Wehrmacht, die<br />
1998 in vielen deutschen Großstädten gezeigt wurde und von sehr vielen Besuchern, darunter auch<br />
vielen Schulklassen aufgesucht worden ist.<br />
Birgit Beck (1998) ist in diesem Zusammenhang der Frage nachgegangen, inwieweit ein solch<br />
»persönliches Verbrechen« wie die Vergewaltigung von Frauen im Zweiten Weltkrieg Teil einer<br />
bewussten Kriegsstrategie gewesen ist. Auch wenn dies für die Befehlsebene der Armeen nicht<br />
zweifelsfrei nachgewiesen werden kann, ist doch zumindest die Duldung der Vergewaltigung von<br />
Frauen – auch Kindern und jungen Mädchen! – des Feindes <strong>als</strong> Massenphänomen, wenn nicht ein<br />
unausgesprochenes Fördern dieses Verhaltens an der rechtlichen Beurteilung und Behandlung der<br />
Täter deutlich erkennbar. Die Grenze der Gewalt, die Schamgrenze und die Tötungshemmung der<br />
Zivilisation werden sehr weit weg geschoben. „Im Hinblick auf die Verantwortung der<br />
militärischen und politischen Führung und die Einordnung von Notzuchtverbrechen <strong>als</strong> Mittel der<br />
Kriegführung bietet sich hier vor allem der Rückgriff auf interne Mitteilungen an. So wurden durch<br />
Wehrmachtstellen dem Reichssicherheitshauptamt Informationen über Ausschreitungen von SS-<br />
Angehörigen in den besetzten Ostgebieten übermittelt. In einem Schreiben des Wehrmachtamtes im<br />
Oberkommando der Wehrmacht an den SS-Obergruppenführer Wolff wurde beklagt, dass ‚die Zahl<br />
von Vergewaltigungen ... groß‘ sei. Durch die Geheime Feldpolizei konnten 18 Fälle von<br />
Notzuchtverbrechen ermittelt werden, wobei in 12 Fällen die Täter Angehörige der Waffen-SS<br />
waren und bei den übrigen Beteiligten die Gruppenzugehörigkeit nicht mehr nachgewiesen werden<br />
konnte. [107] Über die Zustände in Rogosjanka meldete der Chef des Allgemeinen Wehrmachtamtes<br />
‚Viehdiebstähle, Verprügeln der Einwohner, Vergewaltigungen der Frauen und Mädchen‘. [108] Bei<br />
den meisten dieser Straftaten soll es sich um Gruppenvergewaltigungen gehandelt haben, die<br />
häufigste Art von Sexualdelikten in Kriegen, da sich die Männer zumeist in kleineren Verbänden<br />
und Gruppen aufhalten. Bei dieser Form von Vergewaltigung spielt das Motiv, vor den Mittätern<br />
seine Männlichkeit beweisen zu wollen, eine wichtige Rolle. [109] Auffällig sind die in dem Schreiben<br />
erwähnten Bestrafungen der Täter. In einem ‚besonders. krassen Fall von Vergewaltigung einer<br />
über 70 Jahre alten Frau und deren Tochter durch neun SS-Männer‘ wurden die beiden Rädelsführer<br />
lediglich ‚strafweise versetzt‘, und auch die versuchte Vergewaltigung von zwei Frauen durch einen<br />
SS-Angehörigen wurde mit drei Tagen Arrest sehr milde geahndet. [110] “<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 42
Die sozialpsychologische Dimension wird aber dann noch deutlicher, wenn die Aufmerksamkeit<br />
verstärkt nicht nur auf den Krieg und das Kriegsgeschehen selbst fällt, sondern auf die Kriegsvorbereitung.<br />
Ehe ein Feind bekämpft wird, muss er erst <strong>als</strong> Feind definiert werden. Das Themenfeld<br />
der Fremdheitswahrnehmung <strong>als</strong> zentraler Diskurs in unserer heutigen Gesellschaft wie auch<br />
<strong>als</strong> zentrales Thema der Sozialwissenschaften wurde schon angesprochen<br />
4.6 Diskurs »Universalisierung, Globalisierung, Ökonomisierung«<br />
Globalisierung ist in den Medien seit einiger Zeit ein »ubiquitäres Thema«, dessen Aussagekraft,<br />
Bedeutung und Abgrenzung immer unschärfer und ungenauer wird. Es ist in dieser Form vor allem<br />
für politisch und ökonomisch informierte und interessierte Teilnehmer an öffentlichen Diskursen<br />
ein Modethema geworden. Kein Wunder, dass sich Widerstand gegen dieses Thema sowohl in der<br />
Fachwissenschaft (z.B. beim Soziologen Michael Vester, der die Globalisierungsthese <strong>als</strong> eine<br />
„Phantomtheorie“ bezeichnet [111] ), bei ökonomischen Interessengruppen (wie den Gewerkschaften,<br />
die den Verweis auf die „Zwänge der Globalisierung“ zunehmend <strong>als</strong> unredliches »Schlagtot-<br />
Argument“ wahrnehmen) und vor allem auch bei Angehörigen vieler derjeniger Länder, die in der<br />
Globalisierung eine neue, ökonomistisch verbrämte Form des »westlichen Imperialismus« [112] sehen<br />
wollen und die hinter den ökonomischen Globalisierungsprozessen politische und kulturelle<br />
Hegemonialansprüche Europas vermuten.<br />
Diese Ambiguitäten machen den Diskurs »Universalisierung, Globalisierung, Ökonomisierung«<br />
geeignet, grundlegende Bedenken gegen das diskursive Konzept der Schlüsselprobleme zu<br />
artikulieren und zu diskutieren. Öffentliche Diskurse bilden Realitäten immer in mehreren, oft auch<br />
unüberschaubar vielen Ebenen ab. Aus einer Diskursebene heraus lassen sich zwar konkrete Diskussionsanstöße,<br />
auch in didaktischer Hinsicht, ableiten, jedoch weder ein umfassenderes,<br />
treffenderes Realitätsverständnis im Sinne des leitenden Diskurses noch eine adäquate Formulierung<br />
oder Strukturierung eines »Schlüsselproblems« herleiten.<br />
Die Konsequenz ist widersprüchlich, verlangt sie doch einen distanziert-überblickenden Zugang zu<br />
den gesellschaftlichen Problemen, die dem zu Grunde gelegten innerdiskursiven Realitätsverständnis<br />
zuwider läuft und damit »sinnvollen Umgang« mit gesellschaftlichen Schlüsselproblemen<br />
und Diskursen wiederum abhängig macht von distanzierenden Qualifikationen, die zu<br />
einer Hierarchisierung der innergesellschaftlichen Auseinandersetzung und damit wieder zu einer<br />
machtorientierten Funktionalisierbarkeit führen. Dieser Widerspruch ist logisch kaum aufzuheben.<br />
Mangels sinnvoller Alternativen, auch im Sinne der erforderlichen grundsätzlichen Widerständigkeit<br />
der Politischen Bildung und ihrer Didaktik, bleibt dennoch das Insistieren auf diskursiver<br />
Realitätserschließung eine Chance, affirmative Bildungsmodelle zu überwinden und auch im<br />
Bereich der Politischen Kultur die grundlegenden Partizipationsforderungen ohne zu Grunde<br />
liegende formalistische Institutionalisierungen »auf den Weg zu bringen«.<br />
Der Diskurs »Universalisierung, Globalisierung, Ökonomisierung« sollte daher eigentlich,<br />
ausgehend von den genannten Kritikfeldern, differenzierter erörtert und aufgefächert werden. Doch<br />
kann in diesem Kontext keine umfassende Übersicht über die umfangreiche Literatur zu diesem<br />
Thema gegeben werden; die Ausführungen sind nicht nur notwendigerweise exkursorisch, sondern<br />
auch nur <strong>als</strong> Diskussionsanstöße für eine didaktisch orientierte Diskussion und Erarbeitung zu<br />
verstehen.<br />
Globalisierung ist zunächst einmal unmittelbar auf die Entwicklung der Wirtschaft und zwar<br />
zunächst auf betriebswirtschaftlicher Ebene zu beziehen und bezeichnet die zunehmende internationale<br />
und interregionale Kapitalverflechtung, die wachsende Flexibilität bei internationalen<br />
Investitionen und die zunehmende Kurzfristigkeit von Investitionsentscheidungen, die eine<br />
schnellere Anpassung auf Veränderungen der Teilmärkte auch im internationalen Kontext ermöglicht.<br />
Voraussetzungen dafür sind einmal der Abbau staatlicher Investitionshemmnisse (Zölle, Einund<br />
Ausführbeschränkungen, Investitionskontrollen, Subventionspraktiken), wie sie zunächst der<br />
GATT, heute die WTO betreibt. Voraussetzung ist aber auch der Aufbau einer geldwirtschaftlichen<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 43
internationalen Infrastruktur, die durch die Internationalisierung des Bankwesens ebenso wie durch<br />
den Aufbau der technischen Kommunikationsnetze begründet ist. Die bedrohlichen Konsequenzen<br />
sieht Horst Afheld, ehem<strong>als</strong> Wissenschaftler am Starnberger Institut zur Erforschung globaler<br />
Strukturen und Krisen, in schon heute existierenden Strukturen:<br />
In den USA leben Unterschichten bereits in Dritte-Welt-Slums, „ohne sich freilich mit tropischen<br />
Sonnenuntergängen oder Familienzusammenhalt trösten zu können“.<br />
Swissair lässt sein Buchungssystem in Indien bearbeiten, Siemens seine Informationssysteme auf<br />
den Philippinen; französische Anwälte beziehen juristische Texte von der afrikanischen Elfenbein-<br />
Küste.<br />
Auch in Deutschland haben Billiglöhne für polnische oder portugiesische Bauarbeiter zum Konflikt<br />
geführt. Und ebenso wie in den USA wachsen in Europa Wohlstandssiedlungen, durch Mauern,<br />
Wassergräben und Wachdienste abgeschottet.“ (Sagolla 1996)<br />
Afheld plädiert hier für eine deutlich wirksame politische Gegenmacht, die er derzeit noch in den<br />
existierenden Nation<strong>als</strong>taaten sieht. Schutzzölle und Regulierungen, <strong>als</strong> letztlich auch staatsinterventionistische<br />
Konzepte, sollten die Phase der bedingungslosen Deregulierung im Interesse sozialverträglicher<br />
Entwicklungsprozesse ablösen. Doch vertritt er hier, wie im Rahmen einer Diskussionsveranstaltung<br />
mit Gewerkschaftlern und Europapolitikern in Hannover, politische Thesen<br />
abseits vom mainstream, die jedoch durchaus über den sozialpolitischen Ansatz hinausweisen und<br />
auf die grundsätzliche historisch-soziologische Fragestellung verweisen, wie ökonomische Ausweitung<br />
und die Inkorporation weiterer Regionen in sozioökonomische Interdependenzsysteme von<br />
einer Ausweitung gesellschaftlich-politischer Macht begleitet werden kann.<br />
Zur Beurteilung der ökonomischen Globalisierungsprozesse sind aber vor allem die über die reine<br />
ökonomische Beurteilung hinausweisenden Kontexte und Folgerungen zu untersuchen. Und erst<br />
hier wird die Globalisierungsthematik zu einem Diskurs, der wesentlich auch die Politische Bildung<br />
berührt. Ganz grundsätzlich und mit erheblicher theoretischer und politikkonzeptueller Bedeutung<br />
sind die Verschiebungen der Aktivitäts- und Einflussbalancen zwischen den traditionellen<br />
Nation<strong>als</strong>taaten und den wirtschaftenden Subjekten. Gerade hier aber setzen auch schon kritische<br />
Stimmen ein, die die öffentliche Aufmerksamkeit, die sich auf die aktuelle Fusionswelle z.B. im<br />
Automobilsektor, im Banken- und Versicherungswesen wie in den Verkehrs- und Kommunikationsmärkten<br />
richtet, <strong>als</strong> eine Verfälschung der tatsächlichen Gewichte in den ökonomischen<br />
Abläufen einschätzen, welche durch den Primat der mittelständischen und kleineren Unternehmungen,<br />
von noch immer primär auf den Binnenmarkt ausgerichteten Produktions- und Distributionssektoren<br />
auf das Entstehen der Wirtschaftsleistung und die Entwicklung der Beschäftigungssituation<br />
mehr gekennzeichnet ist <strong>als</strong> durch die sicherlich spektakulären ökonomischen Macht- und<br />
Marktgewinne der internationalen Großkonzerne und »Oligopole«. [113]<br />
Auf der anderen Seite wird die politische und soziale Auswirkung der genannten ökonomischen<br />
Globalisierung vor allem für die Länder der so genannten Semiperipherien, aber auch für die<br />
Transformationsländer Ost- und Südosteuropas in weitaus höherem Maße aktuell und brisant, da<br />
hier die in den Ländern der ökonomischen Zentren vorhandenen traditionelle, ausgewogeneren<br />
Wirtschaftsstrukturen <strong>als</strong> Gegengewichte gegen die Machtdominanz der Oligopole weitgehend<br />
fehlen.<br />
Dennoch stellt sich hier das Thema nach einer Neubestimmung und Neugewichtung des<br />
traditionellen Nation<strong>als</strong>taates nach westeuropäischem Muster ganz massiv. Außerhalb der ökonomischen<br />
Zentren finden sich zwar eine Vielzahl von Nationalismen und Ethnifizierungsprozessen,<br />
aber Prozesse des nation building im Sinne einer Entwicklung zur modernen »Staatsgesellschaft«<br />
finden sich kaum in den Ländern der Peripherien und Semiperipherien. Auch in den Transformationsländern<br />
ist diese Entwicklung trotz der ganz bewussten und auch weitgehend von der<br />
Bevölkerung getragenen ökonomischen und gesellschaftlichen Annäherung an west- und mittel-<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 44
europäische Staats- und Gesellschaftsformen, oftm<strong>als</strong> verstanden <strong>als</strong> Anknüpfung an eigene<br />
autochthone Entwicklungsansätze vor der Zeit der re<strong>als</strong>ozialistischen Herrschaft, nicht problemfrei<br />
und von Strukturdisparitäten und gesellschaftlichen Konflikten begleitet. Hier ist eine eingehendere<br />
Diskussion nur im Kontext mit den Diskursfeldern »Zivilisation, Gesellschaft, Staat« und<br />
»Gerechtigkeit, Ungleichheit, Wertewandel« sinnvoll zu führen. Der vorläufige und interdisziplinär<br />
fließende Charakter des Versuches, gesellschaftliche »Schlüsselprobleme« zu formulieren, wird<br />
hier sehr deutlich.<br />
Wichtig ist aber noch ein anderer Bedeutungskontext des Diskurses über die Globalisierungsprobleme.<br />
Ökonomischer Austausch und ökonomische Verflechtungen, die auch mit sich<br />
intensivierenden persönlichen und personellen Kontakten ebenso verbunden sich, wie die<br />
Erschließung internationaler Märkte mit Konsumprodukten, die zumindest ansatzweise auch die<br />
Lebensformen, Symbolwelten und Konsumgewohnheiten, das heißt <strong>als</strong> die Werte und<br />
gesellschaftlichen symbolischen Interaktionsformen des Produkt-Herkunftslandes mit transportieren<br />
und zunehmend nivellierend gegenüber regionalen und lokalen Besonderheiten und Sinnverständnissen<br />
wirken müssen, bedeutet letztlich, auch wenn es ungewollt sein sollte, kulturellen<br />
Universalismus.<br />
Dies kann sehr unterschiedlich rezipiert werden und wirkt damit politisch-gesellschaftlich in höchst<br />
unterschiedlicher Weise. Solange internationale Produkte <strong>als</strong> Erweiterung der materiellen<br />
Konsumchancen wahrgenommen werden, tritt das immanent Fremde nicht in den Vordergrund des<br />
Bewusstseins und der Wirkung. Dabei muss im Bewusstsein bleiben, dass überregionaler<br />
Warenaustausch, Fernhandel die Menschheitsgeschichte vom Kupferhandel der Bronzezeit, über<br />
den Seehandel der altorientalischen Reiche bis zur Seidenstraße und Marco Polo begleitet hat und<br />
unverzichtbares Element gesellschaftlicher Entwicklungen, Innovationen und auch kulturellen<br />
Fortschritts gewesen ist. Kaum ein Land verschließt sich heute dem internationalen Warenaustausch.<br />
Doch dann, wenn neue Konsumgewohnheiten mit traditionellen Lebensformen in Konflikt<br />
geraten, tritt ein politischer Dissens über die Folgen der Globalisierung ebenso in den Vordergrund,<br />
wie in den vielen Fällen, wo von den ökonomischen Zentren ausgehende politische Macht<br />
zur Durchsetzung von Marktöffnungen und Konsumstrategien eingesetzt wird, wenn <strong>als</strong>o nicht die<br />
üblichen Folgen des ökonomischen Wandels im Vordergrund stehen, sondern die Durchsetzung<br />
politischer Macht zum Erhalt ökonomischer Machtdifferenziale.<br />
Wie sich die Folgen der Globalisierungsprozesse im Zusammenhang mit den sozioökonomischen<br />
Transformationen und den daraus resultierenden Migrationsbewegungen auf die heutige Schülerschaft<br />
auswirken, wird schon in der einleitenden Krisenanalyse. Didaktische Ansätze in diesem<br />
Diskursfeld stehen daher zwischen der sehr konkreten Reaktion auf die Situation der eigenen<br />
Schülerschaft, in der sich die Auswirkungen der Globalisierungs- und Universalisierungsprozesse<br />
existenziell wirksam festmachen lassen und diese Prozesse und die mit ihnen verbundenen<br />
Konflikte in der Schule abbilden und <strong>als</strong> <strong>Unterricht</strong>ssituationen wahrgenommen werden, und der<br />
gesellschaftlichen Relevanz und Diskursivität in den politischen Auseinandersetzungen, wie sie uns<br />
in den Medien entgegentreten und wie sie <strong>als</strong> neue Forschungsgegenstände in ihrer tief greifenden<br />
Umstrittenheit an Breite und Aktualität gewinnen.<br />
5. Anmerkungen zu den Konsequenzen für die <strong>Unterricht</strong>spraxis<br />
Die bisherigen Überlegungen gerade auch zur Theorie-Praxis-Problematik haben gezeigt, dass<br />
»Konsequenzen für die <strong>Unterricht</strong>spraxis« nicht in erster Linie <strong>als</strong> Tipps für die »erfolgreiche«<br />
Vermittlung vorbestimmter Wissensinhalte verstanden werden dürfen, sondern sich auf die<br />
didaktischen Denk- und Herangehensweisen beziehen, die dann der unmittelbaren unterrichtlichen<br />
Umsetzung breiten Spielraum lassen.<br />
Die Diskussion des Konzepts der »Schlüsselprobleme« geht von der Vorstellung aus, dass<br />
erfolgreicher und zukunftsoffener <strong>Unterricht</strong> nicht in der »Weitergabe« von Stoffen und Inhalten<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 45
gesehen werden darf, sondern dass die Verantwortung für den <strong>Unterricht</strong> bei den Lehrern und<br />
Lehrerinnen <strong>als</strong> Gestalter der <strong>Unterricht</strong>ssituation und Bezugspersonen der Schülerinnen und<br />
Schüler liegt und liegen muss. Das erstreckt sich damit letztlich auch auf die Verantwortung für die<br />
Inhalte und ihre konkrete Legitimation. Diese Verantwortung kann aber nur dann übernommen<br />
werden, wenn einerseits die institutionellen Voraussetzungen dafür gegeben sind, andererseits die<br />
Qualifikation der Lehrerinnen und Lehrer auch diese Verantwortungskompetenz auszufüllen<br />
erlaubt. Dies hat unmittelbare und wohl auch einschneidende Konsequenzen sowohl für die<br />
Lehrerausbildung an den Hochschulen, wie auch für die Lehrerfort- und -weiterbildung in<br />
Verantwortung der Kultusministerien.<br />
Ein erster Schritt, die Einbeziehung der Schulen und der Lehrerschaft in die Verantwortung für die<br />
<strong>Unterricht</strong>sinhalte und -stoffe zu ermöglichen, ist die Neukonzeption von Rahmenrichtlinien für die<br />
einzelnen Fächer auf der Grundlage des Konzeptes der Schlüsselprobleme, die zwar ansatzweise in<br />
einzelnen Bundesländern, aber wohl noch recht ›halbherzig‹ erfolgt ist. Im curricularen und<br />
methodischen Bereich muss diese didaktische Neuorientierung verstärkt ergänzt werden um die im<br />
folgenden Abschnitt angesprochenen Ansätze von Interdisziplinarität und projektorientiertem<br />
Lernen.<br />
Doch ist dieses Konzept der Schlüsselprobleme erst die eine Seite eines zu fordernden<br />
umfassenderen Innovations- und Modernisierungsprozesses für die Schulbildung. So wie in der<br />
fachdidaktischen Diskussion die Schlüsselprobleme <strong>als</strong> Teil und Ergebnis von Diskurszusammenhängen<br />
konzipiert und verstanden werden, muss die Schule und die Lehrerschaft mehr noch <strong>als</strong><br />
die allgemeine politische Öffentlichkeit bewusst und andauernd in diese konzeptionellen Diskurse<br />
einbezogen werden, um die einzelne Lehrkraft zu befähigen, im diskursiven Kontext verantwortliche<br />
und begründbare didaktische Entscheidungen zu treffen.<br />
Schule muss sich daher wieder <strong>als</strong> Ort der pädagogischen Diskurse verstehen und auch auf dieser<br />
Ebene die viel zitierte Öffnung zur Gesellschaft vollziehen. Damit wird für das konkrete<br />
Individualcurriculum ein Kommunikations- und Interaktionszusammenhang maßgeblich, dessen<br />
primäre Protagonisten Schülerinnen und Schüler auf der einen Seite – in ihrer konkreten aktuellen<br />
und biographisch geprägten Situation – und der betreffende Fachlehrer bzw. die Fachlehrerin –<br />
eingebunden in die Gruppe der Fachkonferenz wie der Klassenlehrerschaft – auf der anderen Seite<br />
jeweils zu beziehen sind auf die gesellschaftlichen Diskurse. Damit wird die traditionelle Fachabgrenzung,<br />
die auf herkömmlichen Fachselbstverständnissen beruht, zumindest ergänzt wenn nicht<br />
langfristig abgelöst durch individuelle Fachprojektdifferenzierungen, die sowohl auf der augenblicklichen<br />
Interaktions- wie Diskurssituation <strong>als</strong> auch auf der konkreten Fachkonferenz der<br />
<strong>Unterricht</strong>enden beruht. Damit kann in verstärktem Maße Biographie im <strong>Unterricht</strong> wirksam<br />
werden. Sinnvoll sind dabei natürlich verstärkte, in der Ausbildung zu erwerbende Kompetenzen<br />
der gesamten Lehrerschaft in den Bereichen der Kulturwissenschaften, gerade unter dem Aspekt der<br />
dauernden Konfrontation mit interkulturellen Situationen, der symbolischen Interaktion, gerade um<br />
das nonverbale und situative <strong>Unterricht</strong>sgeschehen entschlüsseln und verstehen zu können, wie der<br />
Sozialisationsforschung, gerade um einen verantworteten Umgang mit Schülerbiographien zu<br />
erlernen. Interesse, Neugier und Flexibilität muss zuvörderst von der Lehrerschaft selbst erwartet<br />
werden.<br />
In diesem Konzept ist die Einbindung in Diskurse dominierendes Strukturierungsprinzip der<br />
curricularen und didaktischen Arbeit. Erst so wird aus Schlüsselproblemen <strong>Unterricht</strong>, erst so<br />
entstehen immer neu revidierte Schlüsselproblemverständnisse. Das traditionelle Konzept des<br />
exemplarischen Lernens geht in das diskursive Lernen ein und ist notwendiger Bestandteil der<br />
Arbeit an den konkreten Stoffen und Inhalten. Dabei sollte an dieser Stelle noch einmal deutlich<br />
gemacht werden, dass der Verfasser die mehrfach diskutierten Ansätze der 70er Jahre, Lernen <strong>als</strong><br />
abstrakte Struktur zu verstehen, bestenfalls methodisch <strong>als</strong> Lernen des Lernens zu verstehen, für<br />
nicht tragfähig und auch lernpsychologisch nicht hinreichend begründbar hält. Lernen ist immer<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 46
konkret, Problemlösungsvermögen setzt den Umgang mit konkreten Problemen voraus, Metalernen<br />
in Strukturen und »Mustern« setzt eine inhaltliche Wissensbasis voraus. Ohne Lerninhalte kein<br />
Lernen! Das Problem ist <strong>als</strong>o nicht, wie Reformvorstellungen zeitweilig mutmaßten, von inhaltlichem<br />
Lernen abzurücken, sondern die Frage, wer bestimmt die Inhalte, welche konkrete, situative<br />
Bedeutung, Funktion und Rechtfertigung finden die Lerninhalte und wie können über das Punktuelle<br />
Lernen hinaus Kontexte hergestellt und Verständnisse entwickelt werden. These dieses<br />
Aufsatzes ist es, dass hier der Begriff des diskursiven Lernens vorrangig eignet.<br />
Der diskursorientierte Ansatz hat grundlegende Auswirkungen auf die traditionellen Organisationsformen<br />
von <strong>Unterricht</strong> und Schule. Wenn der Diskurs über die Ziele und Inhalte von der administrativen<br />
Ebene in die Schule selbst hineingezogen wird – wenn auch in der Einbindung in die die<br />
Schule übergreifenden gesellschaftlichen Kommunikatons- und Diskursstrukturen und Vernetzungen,<br />
nicht <strong>als</strong>o im Sinne einer absoluten Autonomie der Schule –, muss eine Öffnung der<br />
curricularen Vorbestimmungen und Bindungen erfolgen, bei der die Orientierung am Konzept der<br />
Schlüsselprobleme ein erster Schritt ist, in dem dann aber die Fachdisziplinarität <strong>als</strong> Strukturierungsgrundlage<br />
des schulischen Lernens in Frage gestellt und die (wissens-) vermittelnde<br />
<strong>Unterricht</strong>sform in eine erarbeitende, projektorientierte Arbeitsform überführt werden muss.<br />
Im Gegensatz zu den Lernzielkonzepten der 70er Jahre muss festgestellt werden, dass gesellschaftliche<br />
Diskurse viel weniger formal-abstrakt, sondern im Prinzip politisch-konkret geführt<br />
werden. Es geht <strong>als</strong> durchaus um Inhalte. Hoch abstrahierte, anthropologisch fundierte Lernzieldimensionen,<br />
wie sie auch in der schon herangezogenen Denkschrift des Sachverständigenrates<br />
Bildung der Hans-Böckler-Stiftung, 1999, dominieren, sind in diesem Ansatz nicht normativ<br />
vermittel- und umsetzbar, sondern können bestenfalls <strong>als</strong> noch zu konkretisierende Diskursbeiträge<br />
verstanden und aufgegriffen werden und befürchtend auf die curricularen Auseinandersetzungen<br />
wirken.<br />
Interdisziplinarität und projektorientiertes Lernen können <strong>als</strong> solche zwar in üblicher pädagogischmethodischer<br />
Weise bestimmt und beschrieben werden. Doch auch in dieser Stufe der Überlegungen<br />
muss das diskursive Denken darauf insistieren, »Projekte« <strong>als</strong> Ergebnis des pädagogischen<br />
Agierens, <strong>als</strong> Erfahrung und Erfahrungsauswertung und nicht <strong>als</strong> normative Vorgabe zu<br />
verstehen. Die Projektorientierung ist die pragmatische Konsequenz aus diskursivem, interdisziplinärem<br />
Denken und pädagogischer Erfahrung; das Projekt selbst konkretisiert sich jedoch<br />
erst in der unterrichtlichen Situation selbst. Mit jedem Projekt sollte einerseits das Wissen darüber,<br />
was ein Projekt ist und sein kann, erweitert und vertieft werden, sollte andererseits auch die<br />
Variationsbreite des projektorientierten, interdisziplinären <strong>Unterricht</strong>shandelns erweitert werden.<br />
Ein grundsätzliches Problem tritt hier zu Tage, das in den hohen Qualifikationsanforderungen an<br />
die Lehrerschaft liegt. Das hat einerseits, auch bei einer pragmatischen Beschränkung auf den<br />
Bereich der Politischen Bildung – wenngleich unsere Überlegungen im Grundsatz die gesamte<br />
schulische Bildung betreffen –, wesentliche Auswirkungen auf die Anforderungen an die Lehrerausbildung,<br />
Lehrerfortbildung und innerschulische Supervision. Andererseits folgt daraus aber auch<br />
die notwendige Beschränkung auf realistische Reformziele, für die die konkreten Menschen in der<br />
Schule und nicht das Leitbild einer idealen oder utopischen Schule Entwicklungsmaßstab sind. Das<br />
bedeutet, dass Fachdisziplinen, in denen Lehrerinnen und Lehrer ihre Qualifikation erwerben, auch<br />
in Zukunft zumindest eine Grundlage der Organisation der schulischen Curricula bleiben werden.<br />
Dabei muss an dieser Stelle das Verständnisproblem angesprochen werden, dass Lernen grundsätzlich<br />
ein weiteres Themenfeld ist, <strong>als</strong> es im Rahmen dieser didaktischen Reflexion zur<br />
Politischen Bildung thematisiert werden kann, ohne dass dadurch eine breitere Auseinandersetzung<br />
mit den dadurch aufgeworfenen Fragen möglich erscheint. Lernen umfasst einen unüberschaubaren<br />
Komplex von letztlich genetisch fundierten Reaktionen des Menschen auf Umweltreize und die<br />
Reaktionen des Organismus darauf. Diese Fragen werden zunächst im Rahmen der Biologie,<br />
insbesondere der Verhaltensbiologie und der Gehirnforschung untersucht und in äußerst kontro-<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 47
verser Weise diskutiert. Darauf baut nun die allgemeine Lernpsychologie auf. Schon in diesem<br />
Bereich, mehr noch im Bereich der Reaktion der Pädagogik auf die biologischen Befunde, vor<br />
allem bei der »IQ-Forschung«, beginnt dann die begriffliche Verwirrung, dass je nach anthropologische<br />
Option [114] auf der einen Seite die schicksalhafte Verhaftung an die »Begabung«, die <strong>als</strong><br />
genetisch vorgegeben verstanden wird, auf der anderen Seite die soziale Herkunft <strong>als</strong><br />
ausschlaggebend für die Lernchancen und den Lernerfolg angesehen werden. Dabei wird die Komplexität<br />
des Lernens und seine hohe Selbstbezüglichkeit übersehen. Lernen ist kein eindimensionaler<br />
Vorgang oder eine schlichte Konditionierung, sondern ein mit allen Lebens- und<br />
Erfahrungsbereichen interdependenter Prozess. Auf der anderen Seite sind Lernerwartungen, d.h.<br />
die ehemaligen Lernziele, immer nur analytisch bzw. ergebnisorientiert zu formulieren <strong>als</strong> erwartete<br />
Qualifikationen. Diese Lernerwartungen sind folglich nicht nur nicht identisch mit den zugrunde<br />
liegenden oder evozierten Lernprozessen, die grundsätzlich ganzheitlich, komplex, situativ und mit<br />
der Person wie ihrer Umwelt interdependent prozesshaft verbunden sind, sondern in vielen Fällen<br />
kaum noch in eine rationale, geschweige denn vorhersehbare Kausalitäts- und Begründungsbeziehung<br />
zu bringen.<br />
Auch wenn die pädagogische Wissenschaft auf lerntheoretischen Grundlagen und Erkenntnissen<br />
fußt, ist sie letztlich doch in erster Linie eine Sozialwissenschaft, die aus den gesellschaftlichen<br />
Kontexten heraus zu vermitteln hat zwischen der empirisch-analytischen Fragestellung, welche<br />
Lernprozesse in der konkreten Situation tatsächlich regelhaft oder exemplarisch vorfindlich sind,<br />
und der Prüfung und Rationalisierung bzw. Distanzierung normativer gesellschaftlicher Lernansprüche.<br />
Pädagogik ist daher im Gegensatz zur Lerntheorie inhaltlich orientiert und fragt nicht nur,<br />
wie gelernt wird, sondern vor allem auch was gelernt wird. Dies ist die kulturwissenschaftliche<br />
Dimension der Pädagogik, die ihre Stellung in den Science Wars gegen behavioristische und<br />
objektivistische philosophische Grundpositionen definiert, damit aber auch die Problematik des<br />
wissenschaftlichen Legitimitätsanspruches deutlich kennzeichnet.<br />
Lehrerinnen und Lehrer müssen sich dieses Dilemmas bewusst sein, um verantwortlich didaktischcurricular<br />
arbeiten zu können; Hilfestellung dazu hat die wissenschaftliche Pädagogik und Didaktik<br />
in der Lehrerausbildung wirre der Lehrerfortbildung zu geben. Es ist an der Zeit, Wissenschaftlichkeit<br />
der Lehrerausbildung weniger <strong>als</strong> fachwissenschaftliche Kompetenz – die ohnehin<br />
vorausgesetzt werden muss –, denn <strong>als</strong> einen höheren intellektuellen Anspruch an das Selbstverständnis<br />
der Lehrerinnen und Lehrer, höhere Reflexions- und Distanzfähigkeit, letztlich <strong>als</strong>:<br />
Diskursfähigkeit zu stellen.<br />
Ein rational-differenzierter Blick auf die tatsächlichen bestimmenden Lernprozesse in unserer<br />
Gesellschaft zeigen ein höheres Maß an Differenziertheit – und, anknüpfend an unsere gesellschaftsanalytische<br />
Einleitung: eine zunehmende »Fraktionierung« –, <strong>als</strong> es der Universalitätsanspruch<br />
der schulischen Ausbildung in seiner traditionellen Ausprägung wahrnimmt. Dies hat,<br />
um es <strong>als</strong> Résumé gleich vorweg zu nehmen, wesentliche Auswirkungen auf die Konzeption und<br />
Abgrenzung der traditionellen Schulfächer, die in keiner Weise mehr den gesellschaftlichen<br />
Strukturen und den kulturellen Entwicklungen entspricht, was sich am deutlichsten beim Konzept<br />
der so genannten Haupt- oder Zentralfächer nachweisen lässt, das derzeit vor allem in Bezug auf die<br />
sich in einer äußerst kritischen didaktischen Situation befindlichen Fächer Deutsch und Mathematik<br />
eine unerwartete Renaissance erfährt. [115]<br />
Das zentrale Problem dieser überkommenen Bildungsvorstellungen liegt darin, dass notwendige<br />
Differenzierungen und Entdifferenzierungen im Bereich der Pädagogik von der gesellschaftlichen<br />
Logik her und nicht vom Subjekt der Lernenden aus getrennt werden; gesellschaftliche Logik ist<br />
zunächst einmal die durch die kulturelle Symbolik definierte Realitätssicht nach Fächern und<br />
konventionellen und professionalisierten Differenzierungskategorien, die das Weltbild der Politischen<br />
Kultur ausmachen. Diese Differenzierung wird jedoch gelernt und anerzogen gegen die<br />
subjektiven Prozesse des Lernens selbst. Hier geht, innerhalb der Fächer, das allgemeine pädago-<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 48
gische Grundverständnis von einer Einheitlichkeit des Lernens, von einem innerfachlichen Totalitätsanspruch<br />
aus, der sich in einer möglichst konsistenten Fachsystematik ausdrückt. Nur dort, wo<br />
die Fachsystematik nun wirklich nicht unmittelbare Grundlage schulischer Vermittlung sein kann,<br />
modifiziert die wissenschaftliche Fachdidaktik diese zu curricular-didaktischen Systematiken. [116]<br />
Dabei vereinen diese Fächer immanent widersprüchliche Lernanforderungen, widersprüchliche<br />
Realitätskonzepte und widersprüchliche Tätigkeitsanforderungen, ohne den Lernenden die notwendigen<br />
kritischen und realitätsorientierten Differenzierungsinstrumente an die Hand zu geben. Die<br />
These von der Einheit des Lernens ist zwar richtig, bezieht sich aber gerade nicht auf Fächer und<br />
gesellschaftliche Realitätskategorien, sondern auf Probleme und Realitäten der Wahrnehmung des<br />
Lernenden, die sich nichts weniger verstehen lassen <strong>als</strong> gerade fachgebunden zu sein. Die<br />
Einheitlichkeit des Lernens erfüllt sich gerade darin, traditionelle Fächer und Realitätskategorien zu<br />
überschreiten und interdisziplinär und projektorientiert zu lernen.<br />
Die Differenzierung des Lernens aus der Wahrnehmungsperspektive des Lernenden leitet sich nun<br />
aus den Lebens- und Erfahrungssituationen und der biographisch-psychologischen Bedeutung der<br />
mit dem Lernen verbundenen Realitätsanforderung ab. Hier ist durchaus deutlich zu unterscheiden<br />
– auch in Hinblick auf die darauf bezogenen Lernmethoden und Lernstrategien, soweit dieses<br />
Lernen überhaupt bewusst-strategisch geleitet werden muss – zwischen den verschiedenen zunächst<br />
lebensalterbestimmten Lernstufen.<br />
Grundlegend ist zunächst das Erlernen der Lebensgrundfunktionen, das mit der Geburt beginnt und<br />
zunächst noch eng einem genetischen Programm unterworfen ist, jedoch das gesellschaftliche<br />
Gegenüber in Mutter, Eltern, Familie usw. zur Ausdifferenzierung notwendig benötigt und daher<br />
bewusster Förderung durchaus offen ist. In einer nächsten Stufe folgt dann das Erlernen der<br />
kulturellen Grundfähigkeiten, die eine Orientierung und Behauptung in der eigenen Lebensumwelt<br />
ermöglicht, wobei gerade hier Defizite noch sehr deutlich <strong>als</strong> Schulprobleme auftreten, denen das<br />
traditionelle fächerorientierte moderne Schulprinzip weitaus hilfloser gegenübersteht <strong>als</strong> frühere<br />
pragmatischen und oft völlig unreflektiert-autoritären Erziehungsstrategien, bei denen Erziehungserfolg<br />
eher die Persönlichkeit und Vorbildlichkeit des Lehrers <strong>als</strong> durch bewusste Lehrfähigkeiten<br />
und -methoden garantiert war (vgl. Fußnote 120).<br />
Die Schule ist zunächst Ort des Erlernens der in unserer Gesellschaft notwendigen Kulturtechniken<br />
wie Lesen, Schreiben, Rechnen, Fremdsprachen beherrschen, Umgang mit grundlegenden Alltagstechniken<br />
wie heute vor allem der Informationstechnologie usw. Dieser Bereich ist eine zentrale<br />
Aufgabe der Schule; sie wird vor allem deshalb mangelhaft bewältigt, weil die Schule und die<br />
Gesellschaft ihre Vermittlung gering achtet, ihre Beherrschung aber voraussetzt. Unter dem hier<br />
nicht adäquaten Leitbild der Einheitlichkeit des Lernens wird das Vermitteln der Kulturtechniken zu<br />
einem Nebeneffekt eines sich verwissenschaftlichen Fachunterrichts, der seine Aufgabe vor allem<br />
in den komplexeren sozial determinierten Bildungszielen sieht. Das hat unter Umständen für<br />
Schülerinnen und Schüler verhängnisvolle Folgen: mangelhafte Beherrschung von bestimmten<br />
Kulturtechniken, wie z.B. Sprach- und Schreibkompetenz bei Schülerinnen und Schüler<br />
nichtdeutscher Herkunft oder aus „bildungsfernen“ Sozi<strong>als</strong>chichten, führt zum Versagen bei den<br />
umfassenderen Bildungszielen. Umgekehrt kann wie auch immer begründetes und motiviertes<br />
Versagen gegenüber den allgemeinen Fachzielen, z.B. bei biographischen Brüchen, Akkulturationsproblemen<br />
oder schlicht auch veranlagungs- oder sozialhintergrundsbedingten Begabungsund<br />
Leistungsschwächen das Erlernen der genannten Kulturtechniken grundlegend behindern. Es<br />
scheint daher dringend notwendig zu sein, in der Schulpraxis, gerade im Prozess der verstärkten<br />
Orientierung der fachlichen und überfachlichen Bildungsziele, wie sie auch in den Postulaten der<br />
Politischen Bildung ihren Ausdruck finden, am Konzept von diskursiv sich fortentwickelnden<br />
Schlüsselproblemen, eine grundsätzliche Entkoppelung der Bildungsfächer und der verpflichtenden<br />
Lernangebote für die grundlegenden Kulturtechniken und damit eine fundamentale Neubestimmung<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 49
der Fachselbstverständnisse vorzunehmen, die die Stundentafeln des Schulunterrichts sehr stark<br />
verändern werden. [117]<br />
Wie schon Illich (1971) exemplarisch ausgeführt hat, ist unser Schulsystem denkbar ungeeignet, die<br />
Anforderungen an den Erwerb von Lebenstüchtigkeit, Lernvermögen und Kulturtechniken auch nur<br />
einigermaßen rational und erfolgreich zu erfüllen. Sein freies Lern- und Ausbildungskonzept in<br />
Cuernavaca hat modellhaft gezeigt, wie die Aufgabe von konstruierten Lerngesamtheiten der<br />
Fächer und Professionalitäten erst zu einer echten Einheitlichkeit des Lernens selbst führen kann.<br />
Doch wie schon von Hentig (1971) wohlwollend-kritisch ergänzt, hat die Schule in hoch differenzierten<br />
Industriegesellschaften umfassendere, sozial determinierte Bildungsaufgaben, die durch das<br />
strikt dezentrale Lernkonzept von Cuernavaca, durch eine „Entschulung der Gesellschaft“, nicht<br />
hinreichend erfüllt werden kann.<br />
Bildung ist mehr <strong>als</strong> der Erwerb definierter Kulturtechniken und Kenntnisse; Bildungserwerb ist<br />
soziale Praxis eines bestimmten Lebensabschnittes, der nicht nur propädeutisch definiert, sondern<br />
zunehmend in die gesellschaftlichen Interdependenzen mit einzubeziehen und in Wert gesetzt<br />
werden muss. Es muss <strong>als</strong>o ein Entschulung der Schule erfolgen. Diesem Ziel können die neuen<br />
Verklammerungen von Schule und Öffentlichkeit, die sich aus dem Schlüsselproblemkonzept<br />
zwangsläufig ergeben, dienen. Zentrale Aufgabe ist es daher, das traditionell statische Fächerprinzip<br />
der Schule mittelfristig aufzubrechen, ohne die hohen auch fachlichen Kompetenzanforderungen an<br />
die Lehrerschaft aufzugeben, und auf der einen Seite strikt erfolgsorientierte, nicht auf Auslese oder<br />
Leistungsdifferenzierung abhebende Lernangebote zu den grundlegenden Kulturtechniken während<br />
der ganzen Schulzeit zu entwickeln [118] , auf der anderen Seite anspruchsvolle, an Schlüsselproblemen<br />
orientierte und methodisch interdisziplinär-projektorientierte Bildungsangebote zur zentralen<br />
Aufgabe der Schule zu machen, in denen Schülerinnen und Schüler in identitätsstiftenden<br />
und die Soziabilität fördernden Lernsituationen in die gesellschaftlichen Diskurse eingeführt<br />
werden.<br />
6. Anmerkungen zu den Konsequenzen für die Ausbildung und<br />
Qualifikation der <strong>Politik</strong>lehrerschaft<br />
6.1 Modellvorstellungen für die universitäre Lehrerausbildung<br />
Mehrfach führten unsere bisherigen Überlegungen schon zu dem Schluss, dass eine Schlüsselrolle<br />
für eine Innovation der Politischen Bildung in den Schulen und des geforderten Paradigmenwechsels<br />
in der Didaktik des <strong>Politik</strong>unterrichts der Veränderung und Modernisierung der universitären<br />
Lehrerausbildung sowie einer deutlichen Neuorientierung des wissenschaftlichen Selbstverständnisses<br />
zukommt.<br />
Dabei kann hier nur aus der Sicht der Schule und im Interesse des <strong>Politik</strong>unterrichtes argumentiert<br />
werden. Konkrete Umsetzungen und Veränderungen setzen eine Resonanz an den Hochschulen und<br />
einen entsprechenden Diskurs der betroffenen Fachbereiche und der in ihnen arbeitenden Kolleginnen<br />
und Kollegen voraus.<br />
In den universitären Diskursen, so sie überhaupt innovationsorientiert geführt werden, steht noch<br />
immer die Diskussion der angeblichen Praxisdefizite, bzw. die Probleme einer Theorie-Praxis-<br />
Dichotomie im Vordergrund, die wir schon grundsätzlich und ideologiegeschichtlich kritisch beleuchtet<br />
haben. Dabei wird übersehen, dass ein scheinbar „praxisorientierter“ didaktischer Ansatz,<br />
wenn er nicht platt „rezepthaft-methodisch“ verstanden wird sondern den Kriterien wissenschaftlicher<br />
Rationalität und Reflexivität folgt, oft erst die geeigneten Fragen aufwirft, nicht nur<br />
fachdidaktische, sondern auch fachwissenschaftliche Probleme neu zu überdenken, und damit neue<br />
Forschungsansätze zu erschließen.<br />
Im traditionellen dichotomen Wissens- und Arbeitsverständnis wird nur zu sehr übersehen, dass<br />
Forschung selbst ein Rezeptions- und Verständigungsvorgang und damit ganz wesentlich imma-<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 50
nenten didaktischen Problemstrukturen unterworfen ist; eine Wissenschaftssoziologie wird sich sehr<br />
weitgehend didaktischer Verständigungsmuster zu bedienen haben. So ist auch die universitäre<br />
Trennung von Fachwissenschaft und – in der Wertschätzung oft nachgeordneter – Fachdidaktik<br />
nicht sachadäquat und Ausfluss des schon kritisch benannten dichotomen Theorie-Praxis-<br />
Verständnisses. In einem zeitgerechten Problemverständnis kann hier durchaus an die spezifisch<br />
deutsche Universitätstradition der Einheit von Lehre und Forschung angeknüpft werden, wenn<br />
nicht, wie es zu häufig geschieht, in diesem Kontext Lehre nur noch <strong>als</strong> nachgeordneter<br />
Forschungsbericht verstanden, sondern wenn Forschung selbst <strong>als</strong> didaktisch konzipierter Kommunikations-,<br />
Rezeptions- und Diskursvorgang verstanden wird. [119] Das ist sicherlich aber auch ein<br />
charakterliches und habituelles Moment der Lehrenden und Forschenden selbst, das sich vordergründiger<br />
Anforderung entzieht und nur durch eine entsprechende geistige und politische Kultur,<br />
durch eine bewusste Auseinandersetzung mit der kulturellen Tradition ermöglichen lässt. [120]<br />
Die Schule erwartet Fachlehrerinnen und Fachlehrern, die in die zentralen Diskurse der Gesellschaft,<br />
wie sie schon im Zusammenhang mit dem Thema der Schlüsselprobleme erörtert worden<br />
sind, eingeführt sind und in ihnen eigenständige Positionen vertreten, erarbeiten und vermitteln<br />
können. Diese inhaltlich-diskursive Ausbildung muss von Anfang an rezeptiv-umsetzungsorientiert<br />
strukturiert sein, ohne auf eine banale »Anwendungsdidaktik« reduziert zu werden.<br />
Eine Vorlesungs- und Seminarabfolge sollte daher, parallel zu den »klassischen« Einführungsveranstaltungen<br />
in die Bezugsfächer – die Beschränkung der Politischen Bildung auf die Politologie<br />
wäre aus Sicht der Schule und des <strong>Politik</strong>unterrichts verhängnisvoll – projekt- und diskursorientierte<br />
Semesterschwerpunkte anbieten, deren methodische Ausgestaltung den Diskursstrukturen<br />
der Politischen Bildung, wie sie schon erörtert worden sind, adäquat zugeordnet werden.<br />
Ein, sicherlich hochschuldidaktisch noch nicht angemessen durchformulierter und strukturierter<br />
Vorschlag einer Folge inhaltlich-didaktisch bestimmter Semesterschwerpunkte über einen Zeitraum<br />
von zwei Jahren, soll, orientiert an den Qualifikations- und Ausbildungsbedürfnissen des Schulunterrichts<br />
nachfolgend konzipiert werden. Dabei wird, ohne sich streng an den universitären Usus<br />
zu halten, jeweils eine Kernveranstaltung formuliert, die Elemente der Vorlesung und des Seminars<br />
vereint und zur Einführung in die zu Grunde gelegten Diskurse dienen soll, der dann eine stärker<br />
auf Selbstarbeit und Projektlernen zielende Übungsveranstaltung <strong>als</strong> verpflichtende Ergänzung<br />
beizuordnen ist. Diese Gliederung ersetzt die überkommene Dichotomie von fachwissenschaftlicher<br />
Einführung und didaktischen Praxisbezügen, die dem schon eingehend problematisierten<br />
herkömmlichen Theorie-Praxis-Widerspruch verpflichtet bleibt.<br />
Sehr bewusst wird ausgehend von den beruflichen Bedürfnissen von <strong>Politik</strong>-Lehrerinnen und -<br />
Lehrern auch eine kritische Revision universitärer Vermittlungstraditionen und Lehrveranstaltungsschemata<br />
zu fordern sein, ohne dabei in das bei Schul- und Universitätskritikern verbreitete und im<br />
Motiv durchaus nachvollziehbare Lamento einer angeblichen Praxisferne des Studiums einzustimmen,<br />
in dem sich zu leicht Elemente eines idyllisierenden Antirationalismus einmischen. [121]<br />
Wissenschaftssoziologisch sind diese Zielkonflikte jedoch weitaus tief greifender, <strong>als</strong> sie äußerlich<br />
in Erscheinung treten und projizieren philosophisch sehr ernst zu nehmende Konflikte um die<br />
Bedeutung des Postulats der Wissenschaftlichkeit der sozialwissenschaftlichen Theoriebildung, wie<br />
sie in einem spannenden philosophischen Diskurs <strong>als</strong> »science wars« in den letzten Jahren transatlantisch<br />
thematisiert worden sind. In Deutschland hat sich die Themenseite Forum Humanwissenschaften<br />
der Frankfurter Rundschau um die Ausbreitung dieses Diskurses seit einem Jahr erhebliche<br />
Verdienste erworben. [122] Da diese Diskussion gut dokumentiert ist, soll hier auf ein Referat ihrer<br />
Ergebnisse verzichtet werden. Für uns ist es interessant zu beobachten, wie und wie weit zeittypische<br />
intellektuelle Konflikte sich zu fundamentalen Diskursen zunächst noch beschränkt auf die<br />
»science community« vertiefen und damit die Chance bekommen, über den wissenschaftlichen<br />
Disput hinaus zu einem grundlegenden diskursiven Paradigmenwechsel beizutragen. Vordergründig<br />
berührt das unser Thema auch dadurch, dass einmal unwillkürliche, unreflektierte Spiegelungen und<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 51
Referenzen in der Alltagspraxis von Forschung und Lehre aufkommen – wie die Wiederbelebung<br />
der Theorie-Praxis-Diskussion –, die bewusst aufgegriffen werden sollten, zum anderen dadurch,<br />
dass sich in der intellektuellen Referenz die Eingangs thematisierten Krisenerfahrungen unserer<br />
Politischen Kultur ausdrücken, was Ansätze einer möglichen Krisenbewältigung aufscheinen lässt.<br />
Daher muss es eine grundlegende Forderung sein, dass nicht nur der <strong>Politik</strong>unterricht in die<br />
existenziellen Diskurse durch eine Orientierung am Konzept von Schlüsselproblemen eingebunden<br />
werden muss, sondern dass sich auch die universitären Sozialwissenschaften unter Einbeziehung<br />
der Fachdidaktik ihrer selbst wieder kritisch bewusst werden und eine erhöhte Selbstreferenzialität<br />
entwickeln, um so die gesellschaftlich notwendige Schlüsselrolle in der rational-distanzierten Steuerung<br />
der gesellschaftlichen Diskurse übernehmen zu können: nur auf dieser Ebene und nicht im<br />
kurzschrittigen pragmatischen »Praxisdenken« ist auf Dauer eine sinnvolle und nachhaltige<br />
<strong>Politik</strong>beratung durch die Sozialwissenschaften und ihre Didaktik möglich.<br />
Semesterschwerpunkt »Gerechtigkeit, Ungleichheit, Wertewandel«<br />
Hauptveranstaltung: »Macht und Herrschaft«<br />
Geschichte der Herrschaftstheorien<br />
Entwicklung der Staatsgesellschaft<br />
Symbolischer Interaktionismus, medium range theories<br />
Situationsdefinitionen und Selbstkonzepte, Kultur und Wertorientierungen<br />
Übung:<br />
Projektarbeit zum Thema »Außenseiter, Randgruppen, Diskriminierungen, Stigmatisierungen«<br />
mit empirischen Arbeitsanteil (begleitend: Methodenlernen der empirischen Sozialforschung)<br />
Semesterschwerpunkt »Individualisierung, Gewalt, Soziabilität«<br />
Hauptveranstaltung: »Sozialisation und Enkulturation«<br />
Geschichte der Sozialisationsvorstellungen und ihre Bedeutung für die Pädagogik<br />
Kultur, Politische Kultur, Symbolinventare mit regionalen Beispielen (Zentrum-Peripherie-<br />
Modelle)<br />
Interaktionistische Bildungsvorstellungen, Lebenswelten, Biographie und Milieu<br />
Neuere Diskurse zum Thema Individualisierung<br />
Übung:<br />
Umgang mit der Gewalt – Ursachen der Gewalt. Entwicklung von didaktischen Vorstellungen;<br />
mit Erprobungsphase in der Schule oder der außerschulischen Bildungsarbeit<br />
Semesterschwerpunkt »Zivilisation, Gesellschaft, Staat«<br />
Hauptveranstaltung: »Die Zivilisation Mitteleuropas im Zeitalter der Globalisierung«<br />
Die Zivilisationstheorie von Norbert Elias<br />
Die These vom »Ende der Kultur« und dem »Ende der Geschichte«<br />
Krise oder Staatsversagen? Konfliktmodelle und Partizipationsvorstellungen<br />
Kommunitarismus, Entstaatlichung und sozialer Paradigmenwandel<br />
Übung:<br />
Rollenspiele mit Konzeption, Dokumentation und Auswertung: Staaten, Konflikte,<br />
Kriegsvermeidung nach dem Modell der THIMUN-Programme („The Hague Model United<br />
Nations“)<br />
Semesterschwerpunkt »Universalisierung, Globalisierung, Ökonomisierung«<br />
Hauptveranstaltung: »Die Zukunft in einer „Weltkultur“? Chancen und Bedrohungen«<br />
Einführung in die Medien- und Kommunikationswissenschaften<br />
Technischer Wandel und Bewusstseinsveränderungen mit regionalen Vergleichsbeispielen<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 52
Die kulturelle Ambivalenz des Modernismus und antimodernistische Bewegungen in den<br />
Semiperipherien<br />
»Krieg der Kulturen« oder »multikulturelle Gesellschaftsmodelle«?<br />
Übung:<br />
Forschungsaufträge zur Minderheiten- und Migrationsproblematik.<br />
6.2 Permanente Fort- und Weiterbildung<br />
Das Thema Lehrerfortbildung könnte in unseren Überlegungen zu einem Paradigmenwandel im<br />
Bereich der Politischen Bildung und im <strong>Politik</strong>unterricht eine entscheidende Rolle spielen und in<br />
einer integrativen Sichtweise im Zusammenhang mit der universitären Lehrerausbildung ein inhaltliches<br />
und didaktisches Koordinatensystem herstellen, in dem sich didaktische Innovation und<br />
diskursiv fundierte <strong>Unterricht</strong>spraxis sinnvoll einordnen können.<br />
Diese Vorstellung ist von der bedrückenden Realität so weit entfernt, dass eine ernsthafte und<br />
ausführliche inhaltliche Auseinandersetzung mit solchen positiven Perspektiven illusorisch<br />
erscheint und für die in unserem Rahmen angesprochenen Ziele eines rational-kritischen Umgangs<br />
mit politischen und didaktischen Krisensituationen oder auch Krisenwahrnehmungen unerheblich<br />
bleibt.<br />
Lehrerfortbildung und Lehrerweiterbildung wird weder von den Kultusministerien ernst genommen<br />
– sonst wäre Lehrerfortbildung nicht der erste Bereich, in dem massive Einsparungen und Programmausdünnungen<br />
durchgesetzt worden wären und Lehrerfortbildung würde nicht zunehmend<br />
<strong>als</strong> nur noch »moralisch erwünschte« Eigeninitiative der Lehrerinnen und Lehrer verstanden, für die<br />
Dienst- bzw. <strong>Unterricht</strong>szeit nur noch in Ausnahmefällen zur Verfügung gestellt werden soll und<br />
die in Folge dessen vorwiegend in den Schulferien stattfinden wird (mit entsprechend geringer<br />
Resonanz und Motivation) –, noch <strong>als</strong> besonders wichtig von den Kolleginnen und Kollegen selbst<br />
eingeschätzt wird. Deren Erwartungen im Rahmen des Angebotes an Lehrerfortbildungskursen<br />
richten sich in erster Linie<br />
auf Kurse, die der »Einübung« von Rechtsvorschriften (Rahmenrichtlinien, Abituranforderungen,<br />
Aufgaben der schulischen Funktionsträger und Koordinatoren) oder der institutionellen Abläufe<br />
(Prüfungen, Zensierungen, leistungsrelevante Pflichtarbeitsformen wie Facharbeit oder Praktika,<br />
Verkehrsunterricht etc.) dienen, deren »Wichtigkeit« vom »Dienstherren« wie von der Lehrerschaft<br />
kaum je angezweifelt wird;<br />
auf Kurse, die der Vermittlung »erprobter <strong>Unterricht</strong>smodelle« zu den in den Richtlinien vorgesehenen<br />
Pflichtthemen dienen, wobei die Erwartung vor allem den Materialien gilt, die mit nach<br />
Hause genommen werden können und dann noch unmittelbar »unterrichtstauglich« sind; [123] auf<br />
Kurse im Bereich der Lehrerweiterbildung (Vermittlung zusätzlicher fachlicher Formalqualifikationen),<br />
um in den Neuen Fächern (Werteerziehung, Informatik etc., so wie vor etwa 30 Jahren<br />
für das neue Fach <strong>Politik</strong> eine erste Fachlehrerschaft ebenfalls durch Weiterbildung von Geschichtsund<br />
Erdkundelehrern auf den Fachunterricht vorbereitet wurde) eine »kleine Fakultas« und damit<br />
die Abiturprüfungsberechtigung zu erlangen.<br />
Der Gesamtbereich der Lehrerfortbildung, meist von Landesinstituten [124] getragen, teilweise aber<br />
auch an Fremdanbieter delegiert [125] , wirkt daher mehr <strong>als</strong> sachlich notwendig und auch unter liberal-demokratischen<br />
Prämissen politisch vertretbar »systemstabilisierend« in Bezug auf schulische<br />
Institutionen und Hierarchien sowie die didaktischen Grundstrukturen und inhaltlich daher staatsaffirmativ.<br />
Eine Unterstützung und Begleitung eines notwendigen Paradigmenwandels ist hier nicht<br />
abzusehen.<br />
Drei inhaltliche Bereiche, bei denen ihr Charakter <strong>als</strong> Diskursfelder nicht eindeutig zu bestimmen<br />
sind, auch wenn die öffentliche Aufmerksamkeit ebenso wie ihre politisch-gesellschaftliche<br />
Funktionalisierbarkeit eher dafür sprechen [126] , fallen zunächst einmal in der Betrachtung der Lehrer-<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 53
fortbildungsprogramme aus dieser restriktiven Perspektive <strong>als</strong> eher überrepräsentiert heraus. Es sind<br />
kontroverse Themenbereiche unbestreitbarer sachlicher Bedeutung, die auch für die staatliche<br />
<strong>Politik</strong> relevant und handlungsbestimmend geworden sind, da sich hier durch den entsprechenden<br />
Druck artikulierter, etablierter und organisierter politischer Interessen, vor allem der politischen<br />
Parteien und großen Verbände, zunehmend die Machfrage stellt. Damit werden hier, den politischen<br />
Mehrheiten entsprechend, durchaus gesellschaftlich kontroverse Themenangebote in die Lehrerfortbildung<br />
aufgenommen, ohne dass dies aber die grundsätzliche kritische Einschätzung der<br />
Lehrerfortbildung <strong>als</strong> ihrem Charakter nach vorwiegend staatlich-affirmativ in Frage zu stellen in<br />
der Lage wäre. Diese regelmäßig in der Lehrerfortbildung auftretenden Themenfelder sind:<br />
<br />
<br />
<br />
Fragen der Umwelt und der Ökologie (auch Gesundheitserziehung und Alternative<br />
Lebenskonzepte),<br />
Frauenfragen (feministische Realitätsdeutungen und politische Konzepte),<br />
Gewalt und Interkulturalismus (auch Jugendgewalt, Drogen und politischer Radikalismus).<br />
Zu diesen Themen sind inhaltlich einige kritische Anmerkungen angebracht. Das Thema Gewalt<br />
und Interkulturalismus ist <strong>als</strong> problemorientierter Diskurs aus den Programmen fast schon wieder<br />
verschwunden. Vor allem Interkulturalismus wird mit der pauschalen Banalisierung eines »Multi-<br />
Kulti« <strong>als</strong> unseriös diskreditiert, die internationalen Perspektiven (Dritte-Welt-Pädagogik, Friedenspädagogik,<br />
Schulpartnerschaften und Schüleraustausch <strong>als</strong> zentrale Themen der 70er und 80er<br />
Jahre) gelten <strong>als</strong> überholt und auch für Schülerinnen und Schüler zunehmend uninteressant. Die<br />
interkulturellen Ansätze im Bereich der Politischen Bildung und des Schulunterrichts entstanden<br />
unter dem Eindruck weltweiter Bürgerrechtsbewegungen, des Antikolonialismus der Nachkriegszeit<br />
und der gesellschaftlichen Umwertung des Pazifismus in den 70er Jahren und gingen zunächst von<br />
den Hochschulen aus. So ist eine ganze Generation von <strong>Politik</strong>-Lehrerinnen und -Lehrern von der<br />
Auseinandersetzung mit diesen Themen geprägt, ohne das es gelang, sie <strong>als</strong> Selbstverständlichkeiten<br />
den nachfolgenden jüngeren Kolleginnen und Kollegen hinreichend nahe zu bringen gar<br />
entsprechende öffentliche Diskurse nachhaltig anzustoßen. Im Gegenteil: die Entwicklung der<br />
Politischen Kultur in der Bundesrepublik Deutschland geht zunehmend in die entgegengesetzte<br />
Richtung: erneute Betonung der nationalen Interessen, Paradigmen der Staatlichkeit, Volk <strong>als</strong><br />
Kultur- und Wertegemeinschaft. [127] Gerade dieser Prozess ist ein Teil der Krisendefinition, von der<br />
die Argumentation in diesem Aufsatz ausgeht; die Situation und Entwicklung in der Lehrerfortbildung<br />
klang dabei <strong>als</strong> symptomatisch aufgefasst und <strong>als</strong> Indiz für verpasste Chancen eines notwendigen<br />
gesellschaftlichen Paradigmenwechsels gesehen werden.<br />
Der kulturelle mainstream in Deutschland wie auch international geht zunehmend an den Themen<br />
der interkulturellen Kontakte und Beziehungen vorbei; Abgrenzung und Identifikations- (Identitäts-<br />
) Forderungen treten in der derzeitigen Macht- und Konfliktsituation wieder in den Vordergrund.<br />
Damit wird auch Gewalt nicht mehr <strong>als</strong> universelles gesellschaftliches Problem wie in den 70er und<br />
teilweise noch in den 80er Jahren verstanden, wie es das Konzept der Strukturellen Gewalt von<br />
Johan Galtung entwickelt hat, oder wie es sich im internationalen Kontext in der Thematisierung<br />
von strukturell gewalttätigen ökonomisch-politischen Dependenzen oder in Penetrationsprozessen<br />
des Kulturimperialismus verstanden worden ist; die Gewaltdiskussion polarisiert sich zunehmend in<br />
konventionell nation<strong>als</strong>taatlicher Perspektive auf die Frage der legitimen staatlichen (oder überstaatlichen)<br />
Gewalt, die sich in erwünschtem militärischen Interventionismus ausdrücken soll, und<br />
dagegen der Frage nach der delinquenten individuellen Gewalt, die <strong>als</strong> ein Angriff auf das<br />
Gewaltmonopol des Staates verstanden wird und unter Einsatz massiver Machtmittel abgewehrt<br />
werden soll. Dieser Themenansatz determiniert heute didaktische Konzepte der Gewaltprävention<br />
bei Schülerinnen und Schülern, die im Spannungsfeld von Kriminalisierung und Psychologisierung<br />
angedacht werden [128] , sowie auf der anderen Seite die Verengung weltpolitischer Perspektiven auf<br />
multinationales (militärisches) Krisenmanagement und die (positive) Darstellung der NATO- und<br />
Bundeswehr-Aktivitäten und -Strategien.<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 54
Kaum noch Interesse finden Konzeptualisierungen von Schüleraustauschprogrammen, die <strong>als</strong><br />
praktischer Beitrag zur Völkerverständigung schon in der ersten Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg<br />
entwickelt und im Kontext westeuropäisch-integrativer <strong>Politik</strong>verständnisse (»Westbindung« [129] )<br />
erheblichen Beitrag zur Öffnung der deutschen gesellschaftlichen Perspektiven beigetragen hat.<br />
Zentrales Moment war dabei die deutsch-französische Aussöhnung, die ihren Niederschlag sehr<br />
bald in den lange Zeit pädagogisch äußerst lebendigen Impulsen des Deutsch-Französischen<br />
Jugendwerks fand. Auch die Niederlande und Großbritannien wurden recht früh schon in diese<br />
Austausch- und Begegnungskonzepte einbezogen.<br />
Erst sehr viel später, im Rahmen des außenpolitischen Paradigmenwechsels der »Neuen Ostpolitik«<br />
folgten zunächst gegen große Widerstände auf allen Seiten und eher zaghaft die Versuche, auch die<br />
Osteuropäischen Länder in den Gesprächs- und Austauschprozess einzubeziehen, zunächst vor<br />
allem Polen, wo sich die Begegnungsthematik auch aus der bewussteren pädagogischen<br />
Aufbereitung der Geschichte des Nation<strong>als</strong>ozialismus mit dem Okkupationskrieg und den<br />
deutschen Vernichtungslagern des Holocaust auf polnischem Territorium – heute Gedenkstätten –<br />
<strong>als</strong> unabdingbare pädagogische und politische Aufgabe herleiten ließ. Doch waren hier die innergesellschaftlichen<br />
Widerstände auch aus den Reihen der Vertriebenen erheblich. In dieser Zeit<br />
konnten aber die Kultusministerien [130] einiger Bundesländer, darunter auch Niedersachsens, das im<br />
deutsch-polnischen Kontakt teilweise eine Vorreiterrolle einnahm, und die Institute für Lehrerfortbildung<br />
wie die Landeszentralen für politische Bildung eine wichtige und fortschrittliche Rolle<br />
spielen. Hier wären zeitgeschichtliche Anknüpfungspunkte für eine inhaltliche Revitalisierung der<br />
Konzepte der Lehrerfortbildung in reicher Auswahl zu finden.<br />
Zur Behandlung der Frauenfrage im Rahmen der Lehrerfortbildung will der Verfasser (<strong>als</strong> Mann)<br />
hier nicht ausführlicher Stellung nehmen, bis auf die Anmerkung, dass er die Konzeptualisierung<br />
dieses politisch durchaus aktuellen und faszinierenden Themenbereiches unter den Perspektiven der<br />
»Selbstfindung«, »Abgrenzung einer eigenen Frauenrealität« oder »Selbstverwirklichung« [131] auf<br />
der Verarbeitungsstufe einer Halb-Intellektualisierung ebenso für bedenklich und einem notwendigen<br />
diskursiven Paradigmenwandel abträglich hält, wie überhaupt jedes rein handwerklichmethodische<br />
oder praxisverliebte Kursangebot. Interessant wäre es hier soziologisch und sozialpsychologisch<br />
genauer zu untersuchen, wie reale soziale und berufliche Benachteiligungen oder<br />
zumindest die Wahrnehmung einer solchen sich verfestigt zu einer Nischenintellektualität mit oft<br />
sektiererischem Charakter, der zur realen Verringerung von Benachteiligungs- und Diskriminierungsstrukturen<br />
keineswegs beiträgt. Letztlich dienen diese Selbstinszenierungen real zur Öffnung<br />
neuer und gesicherter beruflicher Perspektiven, die sich in einem Netz von Quoten, Absicherungen<br />
und Gegendiskriminierungen stabilisieren. Der Diskurs, in den in dieser Perspektive die Behandlung<br />
der Frauenfrage einmündet, ist der Diskurs der political correctness, der im universitären<br />
Milieu der USA heute schon dominierenden bewusstseinsbildenden Charakter einnimmt, aus<br />
verschiedenen Gründen in Europa aber nur sehr partiell wahrgenommen und rezipiert wird.<br />
Haselbach hat 1997 in einem grundlegenden Aufsatz die Grundlagen und sozialen Folgerungen der<br />
political correctness thematisiert. Die Aufnahme dieser kritischen Thesen könnte helfen, die<br />
Frauenfrage in der Lehrerfortbildung wie im universitären und Verwaltungsbereich zu objektivieren<br />
und <strong>als</strong> wesentlichen Bestandteil der schon erörterten Diskursfelder zu erkennen. Damit wäre seine<br />
vordergründige politische Besetzung aufgehoben und stände einer intensiveren selbstrekursiven<br />
Arbeit nicht mehr im Wege.<br />
Fragen der Umweltpädagogik treten tendenziell in der Schulpraxis ebenfalls zurück, obwohl »ökologisches<br />
Bewusstsein« und »Verantwortung für die Umwelt« zunehmend zu einem fest internalisierten<br />
Lebenskonzept einer ganzen Lehrergeneration, eng verbunden mit einem sich <strong>als</strong><br />
fortschrittlich verstehenden intellektuell-schulischen Milieu, geworden ist. dass aber daraus die<br />
Bereitschaft und das Interesse an einer gezielten Weiterbildung in diesem Problembereich erwächst,<br />
ist nur vereinzelt und individuell zu beobachten. [132]<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 55
Auf der anderen Seite gibt sich auch die Schülerschaft häufig »überfüttert« mit »Umweltthemen«.<br />
Das deutet weniger auf eine tatsächliche f<strong>als</strong>che Gewichtung der <strong>Unterricht</strong>sschwerpunkte gemessen<br />
an den Lebensrealitäten der Schülerinnen und Schüler hin, auch nicht auf eine notwendige<br />
Neubewertung der objektivierbaren gesellschaftlichen Bedeutung der Ökologie – ganz im Gegenteil<br />
–, sondern auf das f<strong>als</strong>che pädagogische Konzept einer moralisierenden »Umweltethik« <strong>als</strong> Ersatz<br />
für eine rationale und handlungsorientierte Erarbeitung der ökologischen Probleme selbst. Hier<br />
liegen <strong>als</strong>o beträchtliche Defizite im didaktischen Selbstverständnis der Lehrerschaft selbst. [133]<br />
Es wäre für die Lehrerfortbildung schon viel gewonnen, wenn zunächst diese drei letztlich öffentlich<br />
akzeptierten Themenbereiche erneut aktiv aufgegriffen und in den Kursangeboten umgesetzt<br />
und sich dazu einer bewussteren wissenschaftlichen Begleitung stellen würden. Diese permanente<br />
Evaluation könnte mittelfristig eine Brücke zu den Innovationskonzepten in der universitären<br />
Lehrerausbildung herstellen.<br />
Voraussetzung ist aber, dass die Kultusministerien sich von populären Sparvorstellungen freimachen<br />
und die Kosten des gesamten Bildungswesens einmal rational kalkulieren; das ließe sich dann<br />
abseits jeder Flickschusterei öffentlich und offensiv vertreten, auch wenn »Modelle der Sparsamkeit«<br />
die materielle Ausstattung der Bildung eventuell weiter und vielleicht noch mehr <strong>als</strong> bisher<br />
limitieren müssen. Es geht daher in erster Linie um organisatorische, curriculare und didaktische<br />
Innovationen, die sich dem geforderten Paradigmenwechsel für eine »<strong>Politik</strong> in der Krise« bewusst<br />
stellen. [134]<br />
Literatur<br />
Adorno, Theodor W., u.a., 1973: Studien zum autoritären Charakter. Frankfurt am Main.<br />
Ahlers, Ingolf, 1999: Im Zeichen der Globalisierung – Weltökonomie und Neoliberalismus. Eine Einführung in den<br />
Diskussionsstand aus abweichender Perspektive. In: Kürşat-Ahlers, Elçin / Tan, Dursun / Waldhoff, Hans-Peter, Hg.,<br />
1999: Globalisierung, Migration und Multikulturalität Werden zwischenstaatliche Grenzen in innerstaatliche Demarkationslinien<br />
verwandelt? Wissenschaftliche Schriftenreihe: ZwischenWelten: Theorien, Prozesse und Migrationen.<br />
Hg. Kürşat-Ahlers, Elçin / Tan, Dursun / Waldhoff, Hans-Peter, Institut für Soziologie der Universität Hannover in<br />
Verbindung mit der Deutsch-türkischen Vereinigung zum sozial- und geisteswissenschaftlichen Austausch (DTA),<br />
Hannover. Hannover (IKO – Verlag für Interkulturelle Kommunikation). S. 15-48<br />
Albers, Irene, 1992: „Vereinigungslust“ <strong>als</strong> „Kunst der Freiheit“. Individualisierung und Gemeinschaft VI:<br />
Kommunitaristische Anleihen bei Tocqueville. Frankfurter Rundschau, 28.01.1992. Forum Humanwissenschaften.<br />
Autorenkollektiv, 1974: Politische Ökonomie – Kapitalismus. Berlin [DDR] (Dietz Verlag).<br />
Bade, Klaus J., Hg., 1992: Ausländer, Aussiedler, Asyl in der Bundesrepublik Deutschland. Bundeszentrale für<br />
politische Bildung, Bonn.<br />
Barlösius, Eva / Kürşat-Ahlers, Elçin / Waldhoff, Hans-Peter, Hg., 1997: Distanzierte Verstrickungen. Die ambivalente<br />
Bindung soziologisch Forschender an ihren Gegenstand. Festschrift für Peter Gleichmann. Hannover.<br />
Battmer, Gerd / Rischmüller, Werner / Voigt, Gerhard, 1979/1981: Faschismus in Deutschland und Neonazismus.<br />
Materialien für den <strong>Politik</strong>unterricht. Herausgegeben vom Landesverband Niedersachen der GEW. Neue Reihe Heft<br />
1. Hannover 1980. Nachdruck bei Pädagogische Arbeitsstelle Dortmund (pad), Dortmund 1981.<br />
Beck, Birgit, 1995: Vergewaltigung von Frauen <strong>als</strong> Kriegsstrategie im Zweiten Weltkrieg. In: Gestrich, A., Hg., 1995:<br />
Gewalt im Krieg: Ausübung, Erfahrung und Verweigerung von Gewalt in Kriegen des 20. Jahrhunderts. Jahrbuch für<br />
Historische Friedensforschung 4. Münster 1995. S. 34-50.<br />
Beck, Ulrich, 1986: Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt am Main.<br />
Beck, Ulrich / Beck-Gernsheim, Elisabeth, 1990: Das ganz normale Chaos der Liebe. Frankfurt am Main.<br />
Begley, Louis, 1995: „Ein satanisches Requiem“. Über die Bestie Mensch im 20. Jahrhundert. DER SPIEGEL, Nr.<br />
23/1995, 5.6.95: 180-186.<br />
Bitterli, Urs, 1982: Die „Wilden“ und die „Zivilisierten“. Grundzüge einer Geistes- und Kulturgeschichte der<br />
europäisch-überseeischen Begegnung. München [dtv 4396] {München 1976 [C.H.Beck]}.<br />
Bolte, Karl Martin / Hradil, Stefan, 1984: Soziale Ungleichheit in der Bundesrepublik Deutschland. 19845. Opladen<br />
(Leske).<br />
Bolte, Karl Martin / Kappe, Dieter / Neidhard, Friedhelm, 1974: Soziale Ungleichheit. Struktur und Wandel der Gesellschaft.<br />
Reihe B der Beiträge zur Sozialkunde, Band 4. Opladen 19743 (Leske).<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 56
Bottomore, T. B., 1967: Die sozialen Klassen in der modernen Gesellschaft. München (Nymphenburger. Sammlung<br />
Dialog Bd. 21)<br />
Breit, Gotthard, Hg., 1994: Globale Schlüsselprobleme im <strong>Politik</strong>unterricht. Stuttgart.<br />
Breuer, Stefan, 1993: Jenseits der Zivilisation. Der adlige und der bürgerliche Tugendkanon müssen auseinander<br />
gehalten werden. Frankfurter Rundschau, Nr. 255, 2. November 1993, S. 10. Forum Humanwissenschaften.<br />
Brumlik, M., 1973: Der Symbolische Interaktionismus und seine pädagogische Bedeutung. Frankfurt/M.<br />
Claußen, Bernhard / Wellie, Birgit, Hg., 1996: Umweltpädagogische Diskurse. Sozialwissenschaftliche, politische und<br />
didaktische Aspekte ökologiezentrierter Bildungsarbeit. Materialien zur sozialwissenschaftlichen Forschung<br />
(MaSoFo), Band 10. Frankfurt am Main (Haag + Herchen).<br />
Claußen, Bernhard, 1991: Risikogesellschaft und Politische Bildung. Didaktische Dimensionen des ökologischen<br />
Gesellschaftskonflikts. In: Heitmeyer, Wilhelm / Jacobi, Juliane, Hg., 1991: Politische Sozialisation und Individualisierung.<br />
Perspektiven und Chancen politischer Bildung. Weinheim/München. S. 229-248.<br />
Claußen, Bernhard, 1995: Zur Sozialgeschichte der politischen Erziehung in der Bundesrepublik Deutschland:<br />
Versäumnisse der Vergangenheitsbewältigung, Pluralismus und die Grenzenlosigkeit strikter West-Orientierung. In:<br />
Claußen, Bernhard / Wellie, Birgit, Hg., 1995: Bewältigungen. <strong>Politik</strong> und Politische Bildung im vereinigten<br />
Deutschland. Sonderausgabe. Hamburg. S. 376-496.<br />
Dahrendorf, Ralf, 1967: Pfade aus Utopia. München (Pieper)<br />
Dahrendorf, Ralf, 1968: Die angewandte Aufklärung. Frankfurt (Fischer TB)<br />
Durth, Werner, 1977: Die Inszenierung der Alltagswelt. Zur Kritik der Stadtgestaltung. Bauwelt Fundamente 47. Braunschweig.<br />
Elias, Norbert, 1936: Über den Prozess der Zivilisation [1936]. Frankfurt 199015 (stw 158)<br />
Engler, Wolfgang, 1992: Die zivilisatorische Lücke. Versuche über den Staatssozialismus. Frankfurt am Main (Edition<br />
Suhrkamp 1772).<br />
Engler, Wolfgang, 1993: Rundumerneuerung des öffentlichen Lebens. Die vierfache Krise der Zivilisation erfordert<br />
neue Institutionen und Praktiken. Frankfurter Rundschau, Nr. 231, 5. Oktober 1993, S. 12. Forum<br />
Humanwissenschaften.<br />
Erman, Tahire / Turan, Neslihan, 1999: Emigration und Integration. In: Kürşat-Ahlers, Elçin / Tan, Dursun / Waldhoff,<br />
Hans-Peter, Hg., 1999: Globalisierung, Migration und Multikulturalität Werden zwischenstaatliche Grenzen in innerstaatliche<br />
Demarkationslinien verwandelt? Wissenschaftliche Schriftenreihe: ZwischenWelten: Theorien,<br />
Prozesse und Migrationen. Hg. Kürşat-Ahlers, Elçin / Tan, Dursun / Waldhoff, Hans-Peter, Institut für Soziologie<br />
der Universität Hannover in Verbindung mit der Deutsch-türkischen Vereinigung zum sozial- und<br />
geisteswissenschaftlichen Austausch (DTA), Hannover. Hannover (IKO – Verlag für Interkulturelle Kommunikation).<br />
S. 93-102<br />
FILIPP, Karlheinz, 1987: Kritische Didaktik der Geographie. Prolegomena zur Emanzipation einer Disziplin. Materialien<br />
zur sozialwissenschaftlichen Forschung. Band 1. Frankfurt am Main.<br />
Fohrbeck, Karla / Wiesand, Andreas J. / Zahar, Renate, 1971: Heile Welt und Dritte Welt. Medien und politischer<br />
<strong>Unterricht</strong> (I.): Schulbuchanalyse. Leske. Opladen.<br />
Fohrbeck, Karla / Wiesand, Andreas J., 1983: „Wir Eingeborenen“. Zivilisierte Wilde und exotische Europäer. Magie<br />
und Aufklärung im Kulturvergleich. Reinbek bei Hamburg.<br />
Fourastié, Jean, 1949: Le grand espoir du XXe siècle. Paris. {dt.: Die große Hoffnung des 20. Jahrhunderts. 19543}.<br />
Fukuyama, Francis, 1989: La fin de l’histoire. In: Commentaire, Nr. 47, 457-469.<br />
Fukuyama, Francis, 1992: Das Ende der Geschichte. München. (The End of History and the Last Man. London: Hamish<br />
Hamilton, 1992).<br />
Fuller, Graham, 1995: Der Kampf der Ideologien geht weiter. Die nächsten Konfrontationen. DIE ZEIT, Nr. 21, 19.<br />
Mai 1995: 3. <strong>Politik</strong>.<br />
Gagel, Walter, 1990: Theorie muss in der Praxis vermittelt werden. In: Cremer, Will / Commichau, Imke (Red.), 1990:<br />
Zur Theorie und Praxis der politischen Bildung. Diskussionsbeiträge zur politischen Didaktik. Schriftenreihe der<br />
Bundeszentrale für politische Bildung, Band 290. Bundeszentrale für politische Bildung. Bonn. S. 284-287.<br />
Galeano, Eduardo, 1990: Die Geringschätzung <strong>als</strong> Schicksal. Die Theorie vom Ende der Geschichte kommt in Mode.<br />
In: »Kommune« 10/1990, Seite 34-35. Übersetzt von Michael Bünte, Mitarbeiter beim Kinderhilfswerk terre des<br />
hommes.- Aus der chilenischen Zeitschrift »analisis« vom 20. bis 26. August 1990.<br />
Gleichmann, Peter, 1989: Zivilisierung Deutschlands. Neun Thesen [1988]. In: Aller, M. / Hoffmann-Nowotny, H.-J. /<br />
Zapf, W., Hg., 1989: Kultur und Gesellschaft. Verhandlungen des 24. Deutschen Soziologentages in Zürich 1988.<br />
Frankfurt am Main/New York. S. 392-401 (Campus Verlag).<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 57
Gleichmann, Peter, 1995: Sind Menschen in der Lage, vom gegenseitigen Töten abzulassen. In: Gestrich, A., Hg., 1995:<br />
Gewalt im Krieg: Ausübung, Erfahrung und Verweigerung von Gewalt in Kriegen des 20. Jahrhunderts. Jahrbuch für<br />
Historische Friedensforschung 4. Münster 1995.<br />
Gottschalch, Wilfried, 1977: Schülerkrisen. Entstehungsgeschichten autoritärer Persönlichkeiten. Reinbek.<br />
Habermas, Jürgen, 1991: Erläuterungen zur Diskursethik. Frankfurt am Main.<br />
Habermas, Jürgen, 1992: Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen<br />
Rechtsstaats. Frankfurt am Main.<br />
Hagner, Michael, 1999: Annäherung an die Experimentalkultur. Plädoyer für eine dynamische Betrachtung der<br />
Wissensentwicklung. Frankfurter Rundschau, Nr. 51, Dienstag, 2. März 1999, Seite 7. Forum Humanwissenschaften.<br />
Hartfiel, G., Hg., 1972: Die autoritäre Gesellschaft [= ›Kritik 1‹]. Opladen 19723 (Westdeutscher Verlag)<br />
Hartmann, Heinz, Hg., 1973: Moderne amerikanische Soziologie. Neuere Beiträge zur soziologischen Theorie. München/Stuttgart<br />
19732 (dtv 4131/Enke)<br />
Heitmeyer, Wilhelm / Jacobi, Juliane, Hg., 1991: Politische Sozialisation und Individualisierung. Perspektiven und<br />
Chancen politischer Bildung. Weinheim/München.<br />
Heitmeyer, Wilhelm / Möller, Kurt / Sünker, Hans, Hg., 1989: Jugend – Staat – Gewalt. Weinheim/München.<br />
HENTIG, Hartmut von, 1971: Cuernavaca oder: Alternativen zur Schule? Stuttgart/München.<br />
Hilligen, Wolfgang, 1992: Optionen zur politischen Bildung, neu durchdacht angesichts der Vereinigung Deutschlands.<br />
In: Gegenwartskunde 41. S. 117-139.<br />
Hobbes, Thomas, 1651: Leviathan oder: Wesen, Form und Gewalt des kirchlichen und bürgerlichen Staates [London<br />
1651]. Reinbek 1965 (Rowohlts Klassiker 1879)<br />
Hofmann, Werner, 1969: Grundelemente der Wirtschaftsgesellschaft. Reinbek bei Hamburg (rororo 1149)<br />
Hörz, Peter F. N., 1999: Großmütterchen fällt die Tür auf die Nase. Die Individualisierung der Gesellschaft hat das Ego<br />
in den Vordergrund gerückt. Frankfurter Rundschau, Nr. 61, Samstag, 13. März 1999. S. ZB 5.<br />
Huntington, Samuel P., 1996: in einem ›Frankfurter Rundschau-Interview‹: Ich bin ein Generalist. Samuel Huntington<br />
über den Zusammenprall der Zivilisationen. Frankfurter Rundschau, Nr. 303, Montag, 30. Dezember 1996: 12. Das<br />
Gespräch.<br />
Huntington, Samuel P., 1998: Kampf der Kulturen. Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert. Aus dem<br />
Amerikanischen von Holger Fliessbach. (Berlin und München) (Siedler Taschenbuch 75506 im Goldmann Verlag)<br />
{The Clash of Civilizations. New York 1996; dt.: München und Wien 1996}.<br />
ILLICH , Ivan, 1971: Entschulung der Gesellschaft. München.<br />
Illich, Ivan, 1982: Vom Recht auf Gemeinheit. Reinbek bei Hamburg.<br />
Karaganow, Sergej, et al., 1999: Ein Teil der Machtstrukturen ist schon außer Kontrolle geraten. Warum die russischen<br />
Eliten im Rückzug Boris Jelzins den optimalen Ausweg aus der Krise sehen. Thesen einer Tagung des Rates für Außen-<br />
und Sicherheitspolitik, Moskau, Februar 1999. Frankfurter Rundschau, Nr. 61, Samstag, 13. März 1999. S. 20.<br />
Dokumentation. {Auszüge aus: Nesawissimaja Gaseta, 16. Februar 1999}.<br />
Klafki, Wolfgang 1994: Schlüsselprobleme <strong>als</strong> inhaltlicher Kern internationaler Erziehung. In: Seibert, Norbert, Serve,<br />
Helmut J. (Hg.), Bildung und Erziehung an der Schwelle zum dritten Jahrtausend. Multidisziplinäre Aspekte, Analysen,<br />
Positionen, Perspektiven. München.<br />
Klafki, Wolfgang, 1990: Allgemeinbildung für eine fundamental-demokratisch gestaltete Gesellschaft. In: Cremer, Will<br />
/ Klein, Ansgar, Hg., 1990: Umbrüche in der Industriegesellschaft. Herausforderungen für die politische Bildung.<br />
Opladen.<br />
Krippendorff, Ekkehart, 1985: Staat und Krieg. Die historische Logik politischer Unvernunft. Frankfurt am Main (es<br />
1305)<br />
Kuhlmann, Andreas, 1993: Zivilisation vor dem Zerfall. Verhaltensstandards und gesellschaftliche Erosion. Frankfurter<br />
Rundschau, Nr. 219, 21. September 1993, S. 12. Forum Humanwissenschaften.<br />
Kürşat-Ahlers, Elçin / Tan, Dursun / Waldhoff, Hans-Peter, 1999: Globalisierung, Migration, Multikulturalität – ein<br />
deutsch-türkischer Dialog. In: Kürşat-Ahlers, Elçin / Tan, Dursun / Waldhoff, Hans-Peter, Hg., 1999: Globalisierung,<br />
Migration und Multikulturalität Werden zwischenstaatliche Grenzen in innerstaatliche Demarkationslinien verwandelt?<br />
Wissenschaftliche Schriftenreihe: ZwischenWelten: Theorien, Prozesse und Migrationen. Hg. Kürşat-<br />
Ahlers, Elçin / Tan, Dursun / Waldhoff, Hans-Peter, Institut für Soziologie der Universität Hannover in Verbindung<br />
mit der Deutsch-türkischen Vereinigung zum sozial- und geisteswissenschaftlichen Austausch (DTA), Hannover.<br />
Hannover (IKO – Verlag für Interkulturelle Kommunikation). S. 9-13<br />
Kürşat-Ahlers, Elçin, 1995: Die Brutalisierung von Gesellschaft und Kriegsführung im Osmanischen Reich während<br />
der Balkankriege (1903-1914). Brutalisierung der Gesellschaft und literarische Intelligenz. In: Gestrich, A., Hg.,<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 58
1995: Gewalt im Krieg: Ausübung, Erfahrung und Verweigerung von Gewalt in Kriegen des 20. Jahrhunderts.<br />
Jahrbuch für Historische Friedensforschung 4. Münster 1995. S. 51-74.<br />
Legendre, Pierre, 1983: L’empire de la vérité. Introductions aux espaces dogmatiques industriels. Paris (Fayard).<br />
Legendre, Pierre, 1988: Le désir politique de Dieu. Études sur les montages de l’Etat et du Droit. Paris (Fayard).<br />
Leiris, Michel, 1977: Die eigene und die fremde Kultur. Ethnologische Schriften [1938-1968]. Frankfurt am Main<br />
(Syndikat).<br />
Lévi-Strauss, Claude, 1978: Traurige Tropen. Frankfurt am Main [suhrkamp taschenbuch wissenschaft 240] {Tristes<br />
Tropiques. Paris 1955}.<br />
Luhmann, Niklas, 1975: Macht. Stuttgart (Enke)<br />
Luhmann, Niklas, 1985: Soziale Differenzierung. Zur Geschichte einer Idee. Opladen (Westdeutscher Verlag)<br />
Luhmann, Niklas, 1986: Ökologische Kommunikation. Kann die moderne Gesellschaft sich auf ökologische<br />
Gefährdungen einstellen? Opladen (Westdeutscher Verlag)<br />
Lumer, Christoph, 1997: Habermas’ Diskursethik. Zeitschrift für philosophische Forschung, Band 51 (1997), 1. S. 42-<br />
64.<br />
Lynch, Kevin, 1968: Das Bild der Stadt. Bauwelt Fundamente. Gütersloh.<br />
Memmi, Albert, 1980: Der Kolonisator und der Kolonisierte. Zwei Porträts. Mit einem Vorort von Jean-Paul Sartre.<br />
Frank1977furt/M. [Syndikat] {Portrait du colonisé précédé du Portrait du colonisateur. Paris 1966}<br />
Merton, Robert K., 1957: Social Theory and Social Structure. Glencoe, Ill. (Free Press)<br />
Negt, Oskar, 1997: Das permanente Macht-Dilemma der Geistes- und Sozialwissenschaften. In: Barlösius, Eva /<br />
Kürşat-Ahlers, Elçin / Waldhoff, Hans-Peter, Hg., 1997: Distanzierte Verstrickungen. Die ambivalente Bindung<br />
soziologisch Forschender an ihren Gegenstand. Festschrift für Peter Gleichmann. Hannover. S. 43-60.<br />
Nettelmann, Lothar / Voigt, Gerhard / Plavšić, Vesna / Holm, Helena, 1999: Zur Bestimmung des Begriffes einer<br />
»Staatsgesellschaft«. Eine Einführung. In: Voigt, Gerhard, Hg., 1999: Staatsgesellschaft. Forum Politologie und<br />
Soziologie. Galda + Wilch Verlag. Glienicke/Berlin / Cambridge/Massachusetts. (In Vorbereitung.).<br />
Nettelmann, Lothar / Voigt, Gerhard, 1986: Polen – Nation ohne Ausweg? Eine Einführung in <strong>Politik</strong>, Wirtschaft,<br />
Kultur und Umwelt. Geschichte und Staat, Bd. 274. Olzog. München.<br />
Nettelmann, Lothar / Voigt, Gerhard, 1996: Reflexionen über den Begriff der Krise. In: »politik unterricht aktuell« Heft<br />
1-2/1996, S. 24-38 (Verband der <strong>Politik</strong>lehrer e.V., Hannover)<br />
Offe, Claus, 1970: Leistungsprinzip und industrielle Arbeit. Mechanismen der Statusverteilung in Arbeitsorganisationen<br />
der industriellen Leistungsgesellschaft (Diss.). Frankfurt .<br />
Offe, Claus, 1977: Industriegesellschaft oder Kapitalismus? Theorien der gegenwärtigen Gesellschaft. In: Furth /<br />
Greffath, 1977: Soziologische Positionen, Interviews und Kommentare. Frankfurt, S. 32 ff. (Fischer TB 1976) – Zitiert<br />
aus: K. Böttcher, Hg., 1988: Moderne Industriegesellschaft und sozialer Wandel. „Sozialwissenschaften“, herausgegeben<br />
und bearbeitet von W. Breuer, F. J. Floren u.a., H.15. Paderborn, S.165 [M=154]. (Schöningh Verlag)<br />
Opitz, Peter J., 1993: Armut, Not und Krieg verursachen die Flucht von Menschen. Rückblick auf die Wanderungen aus<br />
Europa und Ausblick auf die Wanderungen nach Europa. Frankfurter Rundschau, Nr. 172, Mi., 28. Juli 1993: 10,<br />
Dokumentation<br />
Oran, Baskin, 1999: Bedeutet Globalisierung Imperialismus? In: Kürşat-Ahlers, Elçin / Tan, Dursun / Waldhoff, Hans-<br />
Peter, Hg., 1999: Globalisierung, Migration und Multikulturalität Werden zwischenstaatliche Grenzen in<br />
innerstaatliche Demarkationslinien verwandelt? Wissenschaftliche Schriftenreihe: ZwischenWelten: Theorien,<br />
Prozesse und Migrationen. Hg. Kürşat-Ahlers, Elçin / Tan, Dursun / Waldhoff, Hans-Peter, Institut für Soziologie<br />
der Universität Hannover in Verbindung mit der Deutsch-türkischen Vereinigung zum sozial- und<br />
geisteswissenschaftlichen Austausch (DTA), Hannover. Hannover (IKO – Verlag für Interkulturelle Kommunikation).<br />
S. 49-60<br />
Ostendorf, Heribert, et al., 1999: Magdeburger Erklärung. Auszüge: Eine Ellenbodengesellschaft ist eine gewalttätige<br />
Gesellschaft. Erwachsene <strong>als</strong> negative Vorbilder für Jugendliche. Die Magdeburger Initiative plädiert für eine neue<br />
Kultur zwischen den Generationen. Frankfurter Rundschau, Nr. 60, Freitag, 12. März 1999. S. 20. Dokumentation.<br />
Papcke, Sven, 1974: Wandel oder Zwangswandel? Marx und das Problem der Revolution. In: Jahrbuch<br />
Arbeiterbewegung. Band 2: Marxistische Revolutionstheorien. Fischer Taschenbuch. Frankfurt am Main<br />
Parsons, Talcott, 1953: The Social System. Glencoe, Ill. (Free Press)<br />
Renn, Ortwin / Webler, Thomas, 1996: Der kooperative Diskurs: Grundkonzeption und Fallbeispiel. Analyse & Kritik<br />
18 (1996). S. 175-207. Opladen (Westdeutscher Verlag).<br />
Roth, Gerhard, 1998: „Das Gehirn weiß wenig von der Wirklichkeit“. Jeder irrt, der zu wissen glaubt, was ein anderer<br />
denkt Interview mit Jürgen Nakott. bild der wissenschaft, Heft 10/1998, S. 71-73<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 59
Rousseau, Jean Jaques, 1762: Der Gesellschaftsvertrag oder: Die Grundsätze des Staatsrechtes (‚Du Contrat Social ou<br />
Principes du Droit Politique‘, 1762). Stuttgart 1963 (Reclam UB 1769/70)<br />
Rufin, Jean-Christophe, 1993: Das Reich und die neuen Barbaren. Berlin. (frz.: L’Empire et les nouveaux barbares.<br />
Paris 1992).<br />
Sachverständigenrat Bildung der Hans-Böckler-Stiftung, 1999: Jugend, Bildung und Zivilgesellschaft. Auszüge: Was<br />
sollen Jugendliche künftig lernen und leisten? Der Sachverständigenrat Bildung schlägt eine Veränderung der<br />
Aufgaben der Schulen vor. Frankfurter Rundschau, Nr. 57, Dienstag, 9. März 1999. S. 7. Dokumentation.<br />
Sagolla, Dieter 1996: Menschliche Arbeit „billig wie Dreck“. Horst Afhelds Thesen zur Globalisierung zu Billiglohnökonomien.<br />
Neue Presse (Hannover), September 1996.<br />
Said, Edward W., 1981: Orientalismus. Frankfurt/M. [Ullstein Materialien, Ullstein Buch 35097] {Orientalism. 1978}<br />
Scharping, Michael, 1999: Keine freie Erfindung. Der Konstruktivismus und sein Verhältnis zur Realität. Frankfurter<br />
Rundschau, Nr. 51, Dienstag, 2. März 1999, Seite 7. Forum Humanwissenschaften.<br />
Schneider, Manfred, 1998: „Es genügt nicht, Menschenfleisch herzustellen“. Ein Porträt des Rechtshistorikers und Psychoanalytikers<br />
Pierre Legendre. Frankfurter Rundschau, Nr. 229, Freitag, 2. Oktober 1998, S. ZB 3. Feuilleton.<br />
Schramke, Wolfgang, 1975: Zur Paradigmengeschichte der Geographie und ihrer Didaktik. Eine Untersuchung über<br />
Geltungsanspruch und Identitätskrise eines Faches. Geographische Hochschulmanuskripte Heft 2. Göttingen.<br />
Seyfarth, C., 1969: Zur Logik der Leistungsgesellschaft. Grundlagen der Kritik der gesellschaftlichen Geltung von Leistung<br />
(Diss.). München.<br />
Sommermeyer, Wolfgang, 1994: Die künftige Dominanz des Kleeblatts. Patchwork-Biographien werden uns eine völlig<br />
veränderte Realität bescheren. Frankfurter Rundschau, Nr. 230, Di., 4. 10. 94, S. 9, Forum Humanwissenschaften<br />
Steinert, Heinz, Hg., 1973: Symbolische Interaktion. Arbeiten zu einer reflexiven Soziologie. Stuttgart (Klett)<br />
Steinkamp, G., 1971: Über einige Funktionen und Folgen des Leistungsprinzips in industriellen Gesellschaften. In:<br />
Ortlieb, H. D. / Molitor, B. / Krone, W., Hg., 1971: Hamburger Jahrbuch für Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik.<br />
Tübingen<br />
Stief, Gabi, 1996: „Die Globalisierung ist eine Phantomtheorie“. Michael Vester, <strong>Politik</strong>wissenschaftler an der Universität<br />
Hannover im Gespräch. Hannoversche Allgemeine Zeitung, Nr. 191, Donnerstag, 15. August 1996, S.2. <strong>Politik</strong>.<br />
Strzelewicz, W., 1972: Herrschaft ohne Zwang? Systeme und Interpretationen der Autorität heute. In: Hartfiel, G., Hg.,<br />
1972: Die autoritäre Gesellschaft [= ›Kritik 1‹]. Opladen 19723, S. 21 ff.<br />
Sutor, Bernhard, 1992: Politische Bildung <strong>als</strong> kategoriale Bildung. In: Breit, Gotthard u.a., Hg., 1992: Grundfragen und<br />
Praxisprobleme der politischen Bildung. Ein Studienbuch. Bonn. S. 339-351.<br />
Tan, Dursun / Gomani, Corrina,1997: Zur Rolle des religiösen Diskurses in der Erziehung unter besonderer<br />
Berücksichtigung der deutschen türkisch-muslimischen Minderheit in Deutschland. politik unterricht aktuell 1-<br />
2/1997 (Verband der <strong>Politik</strong>lehrer e.V.). Hannover. S. 14-41.<br />
Tan, Dursun, 1998: Menschenrechte – eine fixe Idee des Abendlandes? Zur Kritik der Kritik an den Menschenrechten.<br />
Internationaler Arbeitskreis Sonnenberg. Tagungsbericht Menschenrechte. Braunschweig.<br />
Thomas, William I. / Thomas, Dorothy S., 1928: The Child in America. New York (Alfred A. Knopf) {deutscher<br />
Auszug in: Thomas, W. I., 1965: Person und Sozialverhalten. Hg. von E. H. Volkart. Neuwied (Luchterhand). – in<br />
diesem Aufsatz zitiert nach: Steinert, Heinz, Hg., 1973: Symbolische Interaktion. Arbeiten zu einer reflexiven<br />
Soziologie. Stuttgart (Klett), S. 333-335.<br />
Treuheit, Werner / Otten, Hendrik, 1986: Akkulturation junger Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland. Probleme<br />
und Konzepte. Opladen.<br />
Treuheit, Werner / Otten, Hendrik, 1993: Theoretische Grundlagen der Akkulturationsdidaktik. Interaktion und Soziales<br />
Lernen. In: Gerhard Voigt, Hg: Interkulturelles Lernen. Eine Antwort der Didaktik der Gesellschaftswissenschaften<br />
auf den Realitätsverlust der politischen Kultur Mitteleuropas. politik unterricht aktuell, Sonderheft 1993<br />
(Schriftenreihe des UNESCO-Clubs für die UNESCO-Schule am Maschsee, Bismarckschule Hannover, e.V., Heft 5.<br />
Rekonstruiert / restauriert Juli 2011) S.79 ff.<br />
http://pu-aktuell.de/pua1993-s/p93S_IKU_anhang.htm<br />
Treuheit, Werner, 1993: Interkulturelles Lernen im politischen <strong>Unterricht</strong> <strong>als</strong> Akkulturationshilfe. In: Gerhard Voigt,<br />
Hg: Interkulturelles Lernen. Eine Antwort der Didaktik der Gesellschaftswissenschaften auf den Realitätsverlust der<br />
politischen Kultur Mitteleuropas. politik unterricht aktuell, Sonderheft 1993 (Schriftenreihe des UNESCO-Clubs für<br />
die UNESCO-Schule am Maschsee, Bismarckschule Hannover, e.V., Heft 5. Rekonstruiert / restauriert Juli 2011)<br />
http://pu-aktuell.de/pua1993-s/p93s_IKU_akkulturationshilfe.htm<br />
Voigt, Gerhard, 1982: Motivation und affektive Lernhindernisse zum Thema »Dritte Welt« und ihre Bedeutung für das<br />
geographische Curriculum, Text eines Referates auf der Entwicklungspolitischen Tagung des Verbandes Deutscher<br />
Schulgeographen in Berlin 1.-3.11.82, Bonn (<strong>als</strong> Manuskript veröffentlicht).<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 60
Voigt, Gerhard, 1993: Interkulturelle Erziehung im Geographieunterricht und in der politischen Bildung. Positionen zu<br />
den Aufgaben der interkulturellen Erziehung und politischen Bildung. In: Zeitschrift für den Erdkundeunterricht 45,<br />
Berlin, 6-7/93, 254-259.<br />
Voigt, Gerhard, 1993: Rechtsextremismus und Ausländerinnen und Ausländer im <strong>Unterricht</strong>. Ausgewählte Aspekte der<br />
Methodik und Didaktik. <strong>Politik</strong>-Wissenschaft-Bildung, Heft 12, Hg. von Bernhard Claußen. Krämer Verlag.<br />
Hamburg.<br />
Voigt, Gerhard, 1995: Südostanatolien <strong>als</strong> internationaler Konfliktherd – Ursachen und Perspektiven. In: politik<br />
unterricht aktuell (Verband der <strong>Politik</strong>lehrer e.V.). Heft 1, 1995: 14-27.<br />
Voigt, Gerhard, 1996a: Ontologisierte Geschichte: Über das Geschichtsbild des Historikers. Zu einer Rezension von<br />
Imanuel Geiss über Elçin Kürşat-Ahlers Untersuchung der frühen zentralasiatischen Staatenbildungen. Historische<br />
Mitteilungen. Ranke Gesellschaft. 9/1996, Heft 2. S. 310-314.<br />
Voigt, Gerhard, 1996b: Ökologische Fragen im <strong>Unterricht</strong>: ein integrativ-sozialwissenschaftliches Umwelt-Curriculum<br />
für Gymnasien und Gesamtschulen. In: Claußen, Bernhard / Wellie, Birgit, Hg., 1996: Umweltpädagogische<br />
Diskurse. Sozialwissenschaftliche, politische und didaktische Aspekte ökologiezentrierter Bildungsarbeit.<br />
Materialien zur sozialwissenschaftlichen Forschung (MaSoFo), Band 10. Frankfurt am Main (Haag + Herchen).<br />
Voigt, Gerhard, 1998a: Über den Zusammenhang zwischen öffentlichem <strong>Politik</strong>diskurs und Selbstbild von<br />
<strong>Politik</strong>lehrerinnen und <strong>Politik</strong>lehrern. In: Hufer, Klaus-Peter / Wellie, Birgit, Hg., 1998: Sozialwissenschaftliche und<br />
bildungstheoretische Reflexionen: fachliche und didaktische Perspektiven zur politisch-gesellschaftlichen<br />
Aufklärung. Festschrift für Bernhard Claußen. Galda + Wilch Verlag. Glienicke/Berlin / Cambridge/Massachusetts.<br />
S. 237-249.<br />
Voigt, Gerhard, 1998b: <strong>Politik</strong> in der Schule? Über den Zusammenhang zwischen öffentlichem <strong>Politik</strong>diskurs und<br />
Selbstbild von <strong>Politik</strong>lehrerinnen und <strong>Politik</strong>lehrern: Erfahrungen an der Bismarckschule Hannover. In: Kronig,<br />
Michael / Nettelmann, Lothar / Voigt, Gerhard / Wehking, Ulrich, Hg., 1998: Reform – vom Gedanken zur Praxis.<br />
Für Ulrich Bauermeister. Schriftenreihe des UNESCO-Clubs für die UNESCO-Schule am Maschsee,<br />
Bismarckschule Hannover, e.V. Heft 10. Hannover. S. 103-127.<br />
Voigt, Gerhard, 1998c: <strong>Politik</strong> in der Schule? Über den Zusammenhang zwischen öffentlichem <strong>Politik</strong>diskurs und<br />
Selbstbild von <strong>Politik</strong>lehrerinnen und <strong>Politik</strong>lehrern: Erfahrungen in der Schulpraxis. politik unterricht aktuell<br />
(Verband der <strong>Politik</strong>lehrer e.V.) Heft 1, 1998. S. 23-35.<br />
Voigt, Gerhard, 1999a: Widerständigkeit <strong>als</strong> Gültigkeitsproblem der Politischen Bildung. Krisen und Konfliktfelder<br />
zwischen Universalisierungsanspruch und Nationfixierung.<br />
Voigt, Gerhard, 1999b: Zur Begriffsbestimmung von „Staat“ und „Staatsgesellschaft“. Anmerkungen zur begrifflichen<br />
Differenzierung. In: Voigt, Gerhard, Hrsg., 1999: »Staatsgesellschaft« : Historisch-sozialwissenschaftliche Beiträge<br />
zur Diskussion von Entwicklungen, Problemen und Perspektiven. / Gerhard Voigt. – Hannover : UNESCO-Club für<br />
die UNESCO-Schule am Maschsee, Bismarckschule Hannover, e.V. 2002 (Schriftenreihe des UNESCO-Clubs für<br />
die UNESCO-Schule am Maschsee, Bismarckschule Hannover, e.V., ISSN 0945-1536 - Materialien zur Didaktik der<br />
Interkulturellen Bildung Heft 1). 2. verbesserte Auflage. - Internet Publikation<br />
Waldhoff, Hans-Peter, 1995: Fremde und Zivilisierung. Wissenssoziologische Studien über das Verarbeiten von<br />
Gefühlen der Fremdheit. Probleme der modernen Peripherie-Zentrums-Migration am türkisch-deutschen Beispiel.<br />
Frankfurt am Main (Suhrkamp Verlag).<br />
Wallerstein, Immanuel, 1995: Die Sozialwissenschaft »kaputtdenken«. Die Grenzen der Paradigmen des 19. Jahrhunderts.<br />
{Orig. Unthinking Social Science.} Weinheim<br />
Weiss, Walter M. / Westermann, Kurt-Michael, 1994: Der Basar. Mittelpunkt des Lebens in der islamischen Welt. Geschichte<br />
und Gegenwart eines menschengerechten Stadtmodells. Wien (Edition Christian Brandstätter).<br />
Wiehn, E., 1968 : Theorien der sozialen Schichtung. München (Pieper)<br />
Wiswede, G. / Kutsch, Th., 1979: Sozialer Wandel <strong>als</strong> „Modernisierung“ – Problematik eines Konzepts.<br />
In: J. Matthes, Hg., Sozialer Wandel in Westeuropa. Verhandlungen des 19. Deutschen Soziologentages 1979.<br />
Frankfurt/New York, S.416/420 f. (Campus) – {Zitiert aus: K. Böttcher, Hg., Moderne Industriegesellschaft und<br />
sozialer Wandel. „Sozialwissenschaften“, herausgegeben und bearbeitet von W. Breuer, F. J. Floren u.a., Heft 15.<br />
Paderborn 1988, S. 170 f. [M158]. (Schöningh Verlag)}<br />
Wolf, Jürgen / Voigt, Gerhard, 1977: Soziale Ungleichheit. Leistungskurs Soziologie. Nichtveröffentlichter<br />
Handreichungskurs. Materialdienst GEW Landesverband Niedersachsen. Hannover [Als Manuskript gedruckt:<br />
Sonderdienst 12/77].<br />
Wouters, Cas, 1994: Konformitätsdruck und Profilierungszwang. Zwischen Identifikation und Individualisierung:<br />
Ambivalenzen des Affektmanagements. Aus dem Niederländischen von Anne Fritz Middelhoek. Frankfurter Rundschau,<br />
Nr. 8, 11. Januar 1994, S. 10. Forum Humanwissenschaften.<br />
Ziehe, Thomas, 1991: Formen der Individualisierung. Unspektakuläre Zivilisationsgewinne. Auch Individualisierung<br />
kann »kommunitär« sein. Frankfurter Rundschau, Nr. 269, 19./20.11.1991, S. 25.<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 61
[1]<br />
[2]<br />
[3]<br />
[4]<br />
[5]<br />
[6]<br />
[7]<br />
[8]<br />
[9]<br />
Anmerkungen<br />
dass diese Zukunftsangst in den USA erneut panikartige »Weltuntergangsbewegungen« Resonanz finden lässt, ist<br />
einerseits eine Besonderheit der US-amerikanischen Politischen Kultur und steht damit in einer alten irrationalfrömmlerischen,<br />
fundamentalistischen Tradition dieses Landes; andererseits durch die enge Medienverbundenheit<br />
Europas mit den USA verstärken diese amerikanischen Massenpsychosen auch in Europa vorfindliche Zukunftsängste,<br />
die sich nicht nur auf das durch die Medien hochstilisierte »Jahr-2000-Problem« in der Computerbranche<br />
konzentrieren. Vielleicht ist aber der, hoffentlich dann noch vorhandene, pragmatische Optimismus für Mensch,<br />
Natur und Technik auf der Weltausstellung EXPO 2000 in Hannover ein angemessenes Gegengewicht gegen das<br />
befürchtete Armageddon.<br />
Diese Millenniumsbefindlichkeit drückt sich in Ängsten und Hoffnungen, zumindest aber in einem Wechsel von<br />
Leitbildern und einer wachsenden Instabilität bisher gefügter politischer Optionen und Orientierungen aus.<br />
So oft dies auch von unterschiedlichen Positionen her gefordert wird, krankt die derzeitige universitäre Sozialwissenschaft<br />
zumindest in Deutschland daran, dass inhaltliche Kontroversen nicht zum Ansatz der Eröffnung<br />
innovativer Diskurse sondern oftm<strong>als</strong> <strong>als</strong> Waffen in persönlichen Rivalitäten genutzt werden. Das ist umso bedauerlicher,<br />
<strong>als</strong> gerade in Zeiten des gesellschaftlichen Umbruchs eine wache und innovativ-kritische Sozialwissenschaft<br />
dringend zur <strong>Politik</strong>beratung und zur neuen Grundlegung der Politischen Bildung erforderlich ist. Doch<br />
wird dies wohl gerade dadurch verhindert, dass die zu untersuchenden Umbrüche in der Hochschulrealität zu einer<br />
dramatischen Verschlechterung der akademischen Berufsperspektiven und der Arbeitsmöglichkeiten geführt<br />
haben, und viele Sozialwissenschaftler und Sozialwissenschaftlerinnen nur schwer noch die Kraft finden, diese<br />
Selbstbezüglichkeit des Forschungsgegenstandes in der notwendigen Selbstdistanz wahrzunehmen und zu<br />
reflektieren.<br />
Es ist notwendig, den Gebrauch des Begriffes »Legitimation«, der in der Literatur und vor allem im philosophischen<br />
Kontext uneinheitlich ist, zu präzisieren. Im Kontext dieser Ausführungen soll »legitimieren« im Sinne von<br />
»rechtfertigen« ohne weiterführende positive Wertannotation gemeint sein. Legitimationsprozesse meinen somit<br />
Prozesse, die die Hinnahme von Machtungleichgewichten und erfolgten Entscheidungsprozessen bzw. einzelner<br />
Akte der ausgeübten Herrschaft durch die Beherrschten ermöglichen, weil sie verbunden sind mit strukturellen,<br />
erfahrbaren Vorteilen (Ordnungssicherheit, Orientierungssicherheit, Planbarkeit der eigenen Alltagszukunft, Ermöglichung<br />
von Selbstgewissheiten). Nicht gemeint ist dabei kurzfristig-opportunistisches Verhalten; ebenso<br />
wenig die Notwendigkeit einer, letztlich in transzendentale Ordnungsvorstellungen zielende affektive Zuwendung<br />
zur Herrschaftsordnung oder den Maßnahmen der Herrschaft, wie sie in religiösen oder vorstaatsgesellschaftlichen<br />
Legitimationsvorstellungen zum Ausdruck kommen. Staatlicherseits ist dies am grundsätzlichen<br />
Widerspruch zwischen den alternativen Legitimationsmodellen für unseren Staat herauszuarbeiten, in<br />
denen »Verfassungstreue« gegen »Verfassungsloyalität« zu stellen ist.<br />
„The Strongest Poison ever known, Came from Cesar’s Laurel Crown.“ William Blake: Auguries of Innocence.<br />
Vgl. Fußnote 23.<br />
Niklas Luhmann (1986) schreibt dazu: „Die Analyse der drei Funktionssysteme Wirtschaft, Recht und<br />
Wissenschaft hat ergeben, dass in allen diesen Fällen eine durch einen Code geschlossene autopoietische<br />
Selbstreproduktion Bedingung der Offenheit des Systems ist, <strong>als</strong>o Bedingung der Resonanzfähigkeit und ihrer<br />
Grenzen... Nach alter Tradition wird auch heute noch für <strong>Politik</strong> eine Ausnahmestellung beansprucht... Die<br />
Funktion der <strong>Politik</strong> wurde in der Struktur gesellschaftlicher Differenzierung an eine bestimmte, einzigartige<br />
Systemstellung geknüpft. In der Corpus-Metaphorik wurde sie mit dem Kopf oder mit der Seele identifiziert...<br />
Solche Zuordnungen hatten ihre Plausibilität aufgrund vorherrschender Formen struktureller Differenzierung des<br />
Gesellschaftssystems... In Wirklichkeit hat auch das politische System sich unter einem Spezialcode<br />
ausdifferenziert und damit die Geschlossenheit des eigenen Operationsmodus und eine Offenheit durch<br />
Umweltreferenz und Wechsel politischer Programme erreicht. Der Code ist mit der staatlichen Zentrierung politischer<br />
Macht gegeben.“ (S. 167, 168, 169.) Typisch ist die in sich stringente funktionalistisch Systemzentrierung<br />
der Darstellung des »Politischen«, in der von der subsystemübergreifenden, oft mehrdeutigen Handlungsmotivation<br />
des einzelnen Menschen und einzelner Gruppen abstrahiert wird. Diese in der Systemtheorien<br />
notwendige Komplexitäts- und Ambivalenzreduktion ist jedoch für eine didaktische Forschung wenig hilfreich,<br />
ermöglicht jedoch ein vertieftes Verständnis für die oft beklagten unvorhergesehenen und unvorhersehbaren<br />
Reaktionen in den gesellschaftlichen Teilsystemen auf einleuchtend motivierte und begründete gesellschaftliche<br />
Aktivitäten und Anstöße.<br />
An dieser Stelle genügt der Hinweis darauf, dass dieser Diskurs, ausgehend auch von der Zivilisationstheorie,<br />
selbstreferenziell-distanziert geführt wird z.B. bei Oskar Negt und in anderen Aufsätzen der betreffenden<br />
Festschrift für Peter Gleichmann mit dem für die Situation der Soziologen und der Soziologie bezeichnenden Titel<br />
»Distanzierte Verstrickungen« (Barlösius u.a. 1997), der auch die existenzielle Grundbefindlichkeit des im<br />
Bereich der Politischen Bildung <strong>Unterricht</strong>enden kennzeichnen kann.<br />
Näher zu untersuchen ist dies im Kontext mit dem Begriff der Mode wie allgemeiner mit dem Problem der<br />
Rezeption der Massenmedien. Zu den Jugendgruppen, die allein sich durch mediale Vermittlung haben<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 62
[10]<br />
[11]<br />
[12]<br />
[13]<br />
[14]<br />
[15]<br />
[16]<br />
[17]<br />
[18]<br />
[19]<br />
[20]<br />
[21]<br />
[22]<br />
[23]<br />
[24]<br />
[25]<br />
entwickeln und konstituieren können, gehören die an Musikstilen orientierten Gruppierungen, »Yuppies« und<br />
»Popper«, »Skins« und – entgegen ihrem Selbstidentifikationsmythos auch – »Punks«.<br />
Wenn eine solche begriffliche Zusammenstellung entgegen philosophischer Stringenz hier erlaubt sei!<br />
Eine auch im Folgenden weiter verwendete Begriffsbildung, die sich an den Modellen der »Weltsystemtheorie«<br />
von Immanuel Wallerstein orientiert.<br />
Diese spielen aber z.B. in Form der Leistungsideologie im öffentlichen Diskurs noch eine große Rolle; zu den<br />
Missverständnissen des Funktionalismus vgl. u.a. Bolte 1974, S. 20-22 und 96-99; diese Texte sind auch für<br />
ideologiekritisches Arbeiten im <strong>Politik</strong>unterricht gut zu verwenden und wurden daher auch aufgenommen in den<br />
<strong>Unterricht</strong>sentwurf »Soziale Ungleichheit«, Wolf / Voigt 1978.<br />
In der didaktischen Perspektive sind diese Problemdiskussionen wieder aufzugreifen bei der Erörterung der vier<br />
zentralen Diskurse, mit denen weiter unten das didaktisch-curriculare Konzept der »Schlüsselprobleme«<br />
vorgestellt werden soll.<br />
Diese Diskussion gewinnt aktuelle Bedeutung vor allem in der Diskussion über die Situation in den<br />
Transformationsländern, wo aus noch darzustellenden Gründen die fachliche Verwendung des Krisenbegriffs auf<br />
Probleme stößt. Diese Ausführungen sind auch eine ergänzende Reaktion zu einem Aufsatz von Lothar<br />
Nettelmann über die Krise in Polen 1999, in: Claußen, Bernhard / Donner, Wolfgang / Voigt, Gerhard, Hrsg.,<br />
2001: Krise der <strong>Politik</strong> – Politische Bildung in der Krise? Diskurse im Kontext von Globalisierung und Ost-West-<br />
Perspektiven. Materialien aus der Zusammenarbeit zwischen der Akademie für Wirtschaft, <strong>Politik</strong> und Kultur<br />
Mecklenburg-Vorpommern und dem Verband der <strong>Politik</strong>lehrenden. Demokratie und Aufklärung: Kritische<br />
Sozialwissenschaften und Politische Bildung im Diskurs – Materialien –, Band 1. Galda + Wilch Verlag.<br />
Glienicke/Berlin / Cambridge/Massachusetts.<br />
Zur Begrifflichkeit vgl. die Ansätze von Wallerstein, vgl. Fußnote 11. Für eine inhaltliche Neuorientierung der<br />
<strong>Politik</strong>didaktik an zentralen, diskursiv gegründeten Schlüsselproblemen ist es notwendig, vor allem die<br />
Entwicklungen in diesen Ländern der sozioökonomischen Semiperipherien (z.B. Türkei, Naher Osten, Südasien<br />
und Lateinamerika) und den so genannten Transformationsländern (z.B. die Länder der ehemaligen Sowjetunion<br />
und ehemalige Mitgliedstaaten des RGW wie Polen, Ungarn), oder Regionen, in denen sich beide Kategorien<br />
überschneiden wie in Südosteuropa (ehemaliges Jugoslawien) <strong>als</strong> »Krisenregionen« in den Vordergrund zu<br />
stellen. Gerade die Beschäftigung mit diesen semiperipheren Regionen, deren politisch-gesellschaftlichen<br />
Realitätsperspektiven und Selbstdefinitionen oft fundamental von unseren Einordnungskategorien unterscheiden,<br />
ermöglichen die Relativierung und Überprüfung unserer politiktheoretischen »Selbstverständlichkeiten« und<br />
damit auch unseres eigenen Selbstbildes, wie es sich gerade an der unterschiedlichen Rezeption des »Krisenbegriffes«<br />
deutlich machen lässt.<br />
Diese selbstreferenzielle Begriffsrezeption kann didaktisch von Bedeutung sein, wenn in schulischen Lerngruppen<br />
zunehmend Schülerinnen und Schüler aus den globalen Semiperipherien (Türkei, Naher Osten, Iran) oder den<br />
Transformationsländern des ehemaligen »Ostblocks« zu finden sind, in denen schon die Kategorisierung ihrer<br />
Herkunftsländer in dem Begriffsraster der Weltsystemtheorie in sozioökonomische und politische Zentrums-<br />
Peripherie-Vorstellungen <strong>als</strong> stigmatisierend empfunden und dementsprechend zurückgewiesen wird. Hier ist<br />
pädagogisch nach Strategien zur Erzeugung von Distanz und Selbstdistanz zu fragen, die wiederum im Rahmen<br />
zivilisationstheoretischer Konzepte zu fundieren sind.<br />
Vgl. dazu Nettelmann / Voigt 1996, S. 24-38<br />
So die heutige gesellschaftswissenschaftliche Kritik, die in der »Neuen Linken« z.B. von Papcke aufgegriffen<br />
bzw. zeitlich gesehen wohl schon vorweggenommen wurde! (Vgl. Papcke 1974, S. 11-32).<br />
Dieser wird, auch für schulische Zwecke gut verwendbar, dargestellt bei Hofmann 1969, v.a. S. 90 ff. Im<br />
zeitgeschichtlichen Zusammenhang vgl. dabei auch die <strong>Unterricht</strong>seinheit von Battmer/Rischmüller/Voigt<br />
1980/1981.<br />
Vgl. die Darstellung bei Autorenkollektiv 1974, S. 91 – Auch wiedergegeben bei Battmer/Rischmüller/Voigt 1979<br />
S. 81/83.<br />
Hofmann 1969; vgl. Fußnote 19.<br />
„Ich glaub’ ich krieg ‘ne Krise!“<br />
Vgl. dazu wieder die historisch-soziologischen Analysen von Elias und Wallerstein. Vor diesem Hintergrund<br />
spricht Waldhoff (1996) von den länger werdenden »Interdependenzketten«, in denen der Einzelne mit der<br />
Entwicklung der Moderne hineingestellt wird, und die die eigenen Abhängigkeiten unüberschaubarer und<br />
unverständlicher machen.<br />
Die sozialpsychologischen Hintergründe erörtert Engler 1992 in seinem „Versuch über den Staatssozialismus“ am<br />
Beispiel der DDR.<br />
Ein Teil der allgemeinen wie der gesellschaftswissenschaftlichen Fachdidaktik versteht diese Überprüfung und<br />
Revision auch von Seiten der Hochschule her <strong>als</strong> erste und permanente Aufgabe der wissenschaftlichen Arbeit in<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 63
[26]<br />
[27]<br />
[28]<br />
[29]<br />
pädagogischen und didaktischen Zusammenhängen. Doch sind Autoren wie von Hentig, Hilligen oder heute<br />
Bernhard Claußen im universitären Arbeitsbereich in der Minderheit geblieben, was auch Anstöße für<br />
Veränderungen in den Hochschulen aus der Sicht der Schule heraus umso dringlicher erscheinen lässt!<br />
Diese Reformpädagogik ist dann oft privaten Initiativen und Schulversuchen überlassen geblieben, z.B. den<br />
Montessori-Schulen, der Glocksee-Schule in Hannover u.a., was dann zwangsläufig die Gefahr birgt,<br />
sektiererhafte Züge anzunehmen, die einer ernsthaften Rezeption in der pädagogischen Öffentlichkeit entgegenstehen.<br />
Wobei durchaus auch hier im letzten Jahrzehnt deutliche pädagogische Rückentwicklungen zu beobachten sind;<br />
doch existiert dieses Nord-Süd-Gefälle nicht nur zwischen den unterschiedlichen politischen Mehrheiten, sondern<br />
auch in den Parteien selbst. Inwieweit das auf kultur- und zivilisationsgeschichtliche Wurzeln der<br />
unterschiedlichen Entwicklung der Staatsgesellschaft und ihrer Politischen Kultur – gekennzeichnet z.B. auch<br />
durch die unterschiedliche konfessionelle Prägung – sei zwar <strong>als</strong> Fragestellung formuliert, kann hier aber nicht<br />
weiter vertieft werden.<br />
Die Terminologie leitet sich aus der Zivilisationstheorie ab und bezieht sich auf Norbert Elias und begrifflich auf<br />
Hans-Peter Waldhoff (vgl. Fußnote 23); nur durch diese Zuordnung kann der verwendete Begriff der<br />
»Homogenisierungen« vor Missverständnissen bewahrt bleiben; er meint hier die mit der Entwicklung der<br />
modernen westlichen Staatsgesellschaft, gekennzeichnet durch die Institutionalisierung des Flächenstaates wie der<br />
zumindest weitgehenden Durchsetzung des Gewaltmonopols und der Steuerhoheit des Staates, einhergehende<br />
Reduzierung kultureller regionaler Vielfalt und Dezentralität, die Einführung einer verbindlichen Staats- und<br />
»Hoch«-Sprache wie die Durchsetzung eines egalisierenden Rechts- und Pflichtensystems in der Gesellschaft.<br />
dass dies in der europäischen Neuzeit teilweise nur unter erheblichem Zwang geschah, zeigt die französische wie<br />
die spanische Nationenwerdung (»nation building«); vgl. Ivan Illich 1982: „Vom Recht auf Gemeinheit“, wo er<br />
vor allem die Nationsbildung und Durchsetzung der kastilischen Sprache <strong>als</strong> »Spanisch« nach der Reconquista<br />
darstellt. Verallgemeinernd vgl. auch bei: Voigt 1999 (i.V.) und Nettelmann / Voigt u.a. 1999 (i.V.). Das Problem<br />
der Staatsgesellschaft auch für die Grundlagen der Didaktik zeigt besonders prägnant Gleichmann in seinen Neun<br />
Thesen zur „Zivilisierung Deutschlands“ (1989): „Wenn wir von Staatsgesellschaften sprechen, geschieht dies,<br />
um die fortschreitende Verschmelzung von »Staaten« und »Gesellschaften« besser zu kennzeichnen. Die Grenzen<br />
von »Nationen« bleiben dagegen meist unscharf oder fiktiv. Und diese besondere Durchdringung der<br />
Gesellschaften durch den Staat unterscheidet die meisten Staaten Europas auch deutlicher von anderen Gebieten<br />
der Erde. Nahezu jegliche Lebensäußerung des einzelnen Menschen ist von »staatlichen« Maßnahmen, Zwängen<br />
mitbestimmt. Es ist kaum mehr möglich, von separaten Entitäten auszugehen, wie sie den Denkern des 18. und 19.<br />
Jahrhunderts. selbstverständlich dünkten. Eine Ursache für das raschere Entstehen von Staatsgesellschaften<br />
besteht in der Tatsache, dass die Gesellschaften – wenigstens der zentralen Teile – Europas niem<strong>als</strong> über sehr<br />
lange Zeiträume unter die rücksichtsloseste Fremdherrschaft gerieten; das Vertrauen in sämtliche »staatlichen«<br />
Einrichtungen konnte hier niem<strong>als</strong> derart grundsätzlich und langfristig zerstört werden, wie es etwa in Lateinamerika<br />
oder weiten Teilen Asiens geschehen ist. Die Prozesse einer innergesellschaftlichen Zivilisierung<br />
prägen auch die seelischen Antriebs- und Empfindensmuster des einzelnen Menschen. Die Deutschen haben die<br />
Fähigkeit des Einzelnen, sich selbst steuern zu lernen, sich »individueller« zu verhalten, sicher »später« <strong>als</strong> einige<br />
benachbarte »Nationen« erworben, blickt man etwa auf die Niederlande, England oder Frankreich: ihre Staatsbildung<br />
ist auch vergleichsweise stärker von Diskontinuitäten bestimmt. Diese Vorgänge lassen sich an zentralen<br />
Zwangsinstanzen, die von vielen oder allen Menschen durchlaufen werden, gut ablesen. Sozialisation und Individuation<br />
sind zwei verschiedene Ausdrücke für diesen Vorgang des Geprägtwerdens durch bestimmte seelische<br />
Verhaltensmuster. Die Herausbildung einer staatlichen Erziehung ist einer der wichtigsten Prozesse geworden,<br />
wenn auch noch im 20. Jahrhundert mit dem Wort von der »Schule der Nation« keine Einrichtung des<br />
Schulwesens bezeichnet worden ist. Vor allem Militärdienst, Schulen, viele staatliche »Anstalten« und besonders<br />
alle Einrichtungen der Menschen zu Naturkontrollen, heute meist »technologische« genannt, prägen die<br />
Antriebsmuster des einzelnen bis in die unscheinbarsten Nuancen hinein. Veranschaulicht wird dies auch durch<br />
die Einrichtungen des »Sozi<strong>als</strong>taates« mit seinen besonderen Tendenzen zur Bürokratisierung, Monetarisierung,<br />
und Zentralisierung sämtlicher seiner Leistungen. Die »Fabrik« und gegen Ende des 20. Jahrhunderts dazu das<br />
»Büro« sind zu beinahe universalen Prägeinstanzen geworden; wobei zu den Struktureigentümlichkeiten des<br />
östlichen deutschen Staates zählt, dass hier die Staatsspitze, das Politbüro, sich darüber hinaus auch faktisch zum<br />
»zentralen Arbeitsherrn« der Gesellschaft gemacht hat. - Die Zivilisierung einer großen Zahl von Personen ist auf<br />
einigen Gebieten besonders für das 19. Jahrhundert von Geschichtsforschern unter der Bezeichnung »Sozialdisziplinierung«<br />
untersucht worden (W. Schulze). Die eigentlichen »Modernisierungsleistungen« der Zivilisierungsinstanzen,<br />
die zunehmende Fähigkeit der einzelnen, sich genauer selbst zu steuern, sind dabei weniger beachtet<br />
worden. Doch im realgeschichtlichen Verlauf des inneren gesellschaftlichen und staatlichen Ausbaus der »inneren<br />
Staatsbildung« wie die Geschichtsforscher meist sagen, gehören beide Prozesse zusammen“ (These 4, S. 395).<br />
Ein aktueller Sammelband, herausgegeben von Claußen und Wellie (1996) gibt einen guten Überblick über die<br />
Façetten und Entwicklungen dieses wichtigen didaktischen Bereiches.<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 64
[30]<br />
[31]<br />
[32]<br />
[33]<br />
[34]<br />
[35]<br />
[36]<br />
[37]<br />
[38]<br />
[39]<br />
[40]<br />
[41]<br />
[42]<br />
Vgl. Gronemeyer in GEW – Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Landesverband Niedersachsen, 1997:<br />
Zur Funktion der Politischen Bildung in Schule und Gesellschaft.<br />
Schmidt-Wulffen, Wulf D., 1979: Theorien der Unterentwicklung. In: GEW – Gewerkschaft Erziehung und<br />
Wissenschaft, Landesverband Niedersachsen, 1997 – Vgl. Fußnote 38 und 39.<br />
Diese Erklärung trifft vor allem die deutsche Durchschnittsschülerschaft und gilt in dieser Form nicht für alle<br />
Migranten. Die dort z.T. zu beobachtenden im nächsten Punkt angesprochenen Formen eines dezidierten<br />
Aufstiegsverhaltens lässt unter zivilisationstheoretischen Gesichtspunkten die Frage nach einer eventuellen<br />
Phasenverschiebung im Habitus (vergleichbar mit deutschen »Nachkriegsorientierungen« in den 50er/60er Jahren)<br />
aufkommen. Dies soll jedoch hier nicht vertieft werden.<br />
Vgl. dazu die Ausführungen von Nettelmann zur Entwicklung in Polen in: Nettelmann / Voigt 1986, S. 78 ff.<br />
Vgl. Abschnitt 1.5<br />
Ein Problem besteht sicherlich darin, dass einem Großteil der Lehrerinnen und Lehrer die Problematik sehr wohl<br />
bewusst ist, sie aber sich gegenüber der Komplexität der Problematik hilflos gegenüber sehen. Gegenüber<br />
notwendigen Lösungen sehen sie sich <strong>als</strong> überfordert.<br />
Hier ergeben sich, auch begründet in Unkenntnis und mangelnder Wahrnehmungsdistanz, in der unterrichtlichen<br />
Situation ganz erhebliche Probleme, wenn z.B. in einer Lerngruppe ›Türken‹ und ›Kurden‹ nicht unterschieden,<br />
›Ukrainer‹, aus Russland stammende Juden und Russlanddeutsche differenzlos unter die (Sprach-) Kategorie<br />
»Russen« subsumiert werden. Die soziologische Einsicht der Historizität der Ethnogenese und der<br />
Problemhaltigkeit dieser Eigenwahrnehmungen <strong>als</strong> Angehörige ethnischer Gruppen rechtfertigt es pädagogisch<br />
keinesfalls, diese von vorne herein kategorial wegzudefinieren. Dies wird subjektiv <strong>als</strong> Aggression und<br />
Geringschätzung durch die deutsche Schule wahrgenommen – mit den entsprechenden Selbstausgrenzungs- und<br />
Abwehrreaktionen dieser Schülerinnen und Schüler. Eine Aufarbeitung der Problematik dieser selbst erlebten<br />
Gruppenidentitäten und nationalen Zugehörigkeiten kann nur durch eine behutsame pädagogische Förderung der<br />
Entwicklung von Ich-Stärke und Selbstdistanzierungsfähigkeit erfolgen. Der Respekt vor mitgebrachten und biographisch<br />
verankerten Identitätsvorstellungen und Selbstbildern muss oberste Maxime pädagogischen Verhaltens<br />
sein. Vgl. Demirkan (1998): „Respekt statt Integration“!<br />
Klassische Einführungen in die Thematik z.B. bei Adorno u.a. 1973, S. 46-61, Gottschalch 1977, S. 35 ff., Battmer<br />
/ Rischmüller / Voigt 1981, S. 47-54; schulbezogene Studien und <strong>Unterricht</strong>shilfen z.B. Bade 1992, S. 9-49<br />
und Materialteil, Heitmeier 1992, insbes. S. 18-19 und Materialteil, Voigt 1993, Rechtextremismus: passim.<br />
Literatur dazu z.B. Bitterli 1982. – Fohrbeck / Wiesand / Zahar 1971. – Fohrbeck / Wiesand, 1983. – Voigt 1982.<br />
Leiris 1977, Memmi 1980, Lévi-Strauss 1978, Said 1981.<br />
Dabei ist noch zu berücksichtigen, dass wahrgenommene und problematisierte Migrationen heute <strong>als</strong> Folge zweier<br />
Weltkriege durch die vorgegebene Lage staatlicher Grenzziehungen in Europa und dem Vorderen Orient definiert<br />
sind, wie Rufin 1993 sehr klar herausgearbeitet hat. So ist z.B. der Umzug eines Texaners nach Maine in den USA<br />
eine übliche, z.T. sogar erwünschte Reaktion auf Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt, die Migration des Mexikaners<br />
wenige Kilometer weiter in die USA aber eine meist illegale, kriminalisierte Grenzverletzung! Das Gleiche<br />
wird in Zukunft zunehmend zur Unterscheidung von Wanderungen in der EU und in die EU hinein beitragen.<br />
Vgl. die Ausführungen zum Schicht- und Differenzierungsbegriff im Abschnitt 1.4. Zur allgemeinen didaktischen<br />
Bedeutung des Schichtbegriffes vgl. die Ausführungen zum »Schlüsselproblem« Soziale Ungleichheit im Diskurs<br />
»Gerechtigkeit, Ungleichheit, Wertewandel« im Abschnitt 4.3. Der Begriff der Oberschicht darf in diesem<br />
Zusammenhang nicht im traditionelle Sinne gebraucht werden, auch wenn <strong>als</strong> soziale Reliktformen solche<br />
traditionellen Oberschichten vor allem in den Ländern der Semiperipherien und globalen Peripherien noch eine<br />
soziale und politische Rolle spiele, wobei ihre Funktion meist <strong>als</strong> Widerpart zu heute anstehenden<br />
Modernisierungsschüben zu beschreiben ist. Im Kontext der Globalisierung bilden sich jedoch über vorhandene<br />
Staats- und Volkstumsgrenzen hinweg »neue Oberschichten« heraus, die zunächst einmal aus den ökonomischen,<br />
kulturellen, teilweise auch militärischen und politischen Funktionseliten der einzelnen Staaten hervorgehen, deren<br />
Verhaltens-, Ziel- und Wertoptionen aber in stärkerem Maße Universalisierungstendenzen unterliegen, wie sie<br />
hier angesprochen werden. Gerade durch das zumindest graduelle Absetzen vom nation<strong>als</strong>taatlich fixierten<br />
Habitus der bisherigen Mittelschichten, aus denen sie sich zumeist heraus entwickeln, kann von einem neuen<br />
Habitustyp einer internationalen Oberschicht gesprochen werden.<br />
Zum Beispiel wurden 1976 beim Wechsel von einer SPD-geführten Landesregierung zu einem CDU-<br />
Kultusminister zwar verbal grundlegende Änderungen angekündigt, letztlich blieben aber sowohl die umstrittene<br />
Orientierungsstufe wie die bestehenden Gesamtschulen bestehen, wie auch die Struktur der Rahmenrichtlinien<br />
und ihre Erstellung in Kommissionen sich nur graduell veränderte. Nur der groß anlegte Versuch einer Reform<br />
der Sekundarstufe II (Kursstufe) musste sehr wesentliche Rückentwicklungen erfahren (gravierende<br />
Einschränkungen in den Kursangeboten, Beendigung der Arbeit an den so genannten »Handreichungen«, d.h. zur<br />
Erprobung vorgelegter Kursentwürfe [vgl. Kursentwurf »Soziale Ungleichheit« von Wolf / Voigt 1978],<br />
Einschränkung von freien Lernangeboten (Projekten, Orientierungskursen, kursunabhängigen Facharbeiten etc.).<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 65
[43]<br />
[44]<br />
[45]<br />
[46]<br />
[47]<br />
[48]<br />
[49]<br />
Aber auch die Rückkehr einer SPD-Landesregierung im Jahre 1990 fand keinen Weg zurück in die Reformphase<br />
der 70er Jahre. Andererseits blieb der Interessengegensatz in der Kultusministerkonferenz mit den süddeutschen<br />
Ländern allen niedersächsischen Landesregierungen erhalten, was bis zum Streit um die bayrische Anerkennung<br />
Niedersächsischer Abiturzeugnisse zur Zeit eines CDU-Kultusministers in den 80er Jahren ging.<br />
Das Problem einen mangelhaft konzeptualisierten Schul- und Bildungspolitik wird – ohne dass sich dabei gewisse<br />
Schärfen in der politischen Beurteilung vermeiden lassen werden – am Ende dieses Aufsatzes im Zusammenhang<br />
mit der Erörterung der verpassten Chancen in der Lehrerfortbildung angesprochen werde.<br />
Zum Begriff der Homogenisierung vgl. die Ausführungen weiter oben.<br />
Die den traditionellen Erziehungsvorstellungen verhaftete <strong>Politik</strong> reagiert angesichts der immer offensichtlicher<br />
werdenden Nichtsteuerbarkeit der Wert- und Verhaltensvermittlung zwischen den Generationen und dem damit<br />
verbundenen drohenden weiteren Einflussverlust der <strong>Politik</strong> und des Staates und anderen institutionellen Trägern<br />
panisch. Es kann unter diesen Umständen nur <strong>als</strong> purer Zynismus verstanden werden, wenn Vorstellungen, die an<br />
Sippenhaftung grenzen gegenwärtig wieder diskutiert werden, wie z.B. in der von einigen gesellschaftlichen<br />
Gruppen gewünschten Ausweisung von Ausländern bei Delinquenz ihrer Kinder oder der Streichung von<br />
Sozialhilfe in einem entsprechenden Fall bei deutschen Staatsbürgern. dass diese Vorstellungen zumeist gegen<br />
ohnehin benachteiligte und ausgegrenzte machtarme Unterschichtgruppen gerichtet sind, ist bezeichnend für das<br />
Gesellschaftsbild und das Demokratieverständnis der so argumentierenden <strong>Politik</strong>er. Ein Verständnisproblem,<br />
aber kein grundsätzlicher Widerspruch zu diesen Ausführungen ist der allgemeinere Verweis auf die im<br />
mitteleuropäischen Rechtsverständnis verankerte grundsätzliche Schadenshaftung der Eltern für ihre Kinder.<br />
Diese gilt natürlich auch für Mittelschichtenangehörige <strong>als</strong> Eltern von Kindern, die z.B. durch Farbsprays Sachbeschädigungen<br />
verursacht haben. Die geforderte, geplante und praktizierte Durchsetzung finanzieller Forderungen<br />
stellen erhebliche finanzielle Belastungen dar. Doch wird diese Haltung begrenzt, wenn die Einsichtsfähigkeit der<br />
Kinder rechtlich vorausgesetzt werden kann; in diesem Falle bleibt die Schadenshaftung einer späteren<br />
Regulierung durch die erwachsen werdenden Delinquenten <strong>als</strong> Schuldtitel vorbehalten. Die Schadenshaftung ist<br />
aber sicher nicht substantiell zu vergleichen mit strafrechtlich motivierten Maßnahmen, die ansonsten nur bei<br />
eigener Straffälligkeit greifen, wie z.B. die Ausweisung. dass damit sippenrechtliche Vorstellungen der türkischen<br />
Bevölkerungsminderheit in Deutschland, die den Ehrenkodices ihres Heimatlandes entsprechen (vgl. Waldhoff<br />
1995 oder Tan / Gomani 1997), reflektiert und verstärkt werden, ist ein zusätzliches faktisches Integrationshemmnis<br />
und widerspricht den grundrechtlich orientierten Vorstellungen einer deutschen Integrationspolitik.<br />
Vgl. den entsprechenden Aufsatz von Voigt in: Claußen, Bernhard / Donner, Wolfgang / Voigt, Gerhard, Hrsg.,<br />
2001: Krise der <strong>Politik</strong> – Politische Bildung in der Krise? Diskurse im Kontext von Globalisierung und Ost-West-<br />
Perspektiven. Materialien aus der Zusammenarbeit zwischen der Akademie für Wirtschaft, <strong>Politik</strong> und Kultur<br />
Mecklenburg-Vorpommern und dem Verband der <strong>Politik</strong>lehrenden. Demokratie und Aufklärung: Kritische<br />
Sozialwissenschaften und Politische Bildung im Diskurs – Materialien –, Band 1. Galda + Wilch Verlag.<br />
Glienicke/Berlin / Cambridge/Massachusetts.<br />
Vgl. zum wissenschaftlichen Konzept des Symbolischen Interaktionismus die von Steinert 1973 herausgegebene<br />
Aufsatz-Sammlung; didaktisch in Wert gesetzt wird dieser Ansatz z.B. bei Treuheit / Otten (1986 und 1993) oder<br />
bei Brumlik (1973).<br />
Man verzeihe diese bildhaft-konkretistische Umsetzung des Konzeptes von Habermas, das weitaus abstrakter und<br />
philosophisch-formaler entwickelt wird; hier soll nur die gesellschaftliche Dimension herausgestellt werden, die<br />
<strong>als</strong> Wertoption zwar unseren Vorstellungen nicht widerspricht, aber bei unserer Verwendung des Diskursbegriffes<br />
nicht mitgedacht ist. dass in der Folge in der Philosophie der Diskursbegriff vor allem auch erkenntnistheoretischmethodisch<br />
verwendet kritisiert wird, zeigen – ohne dass dies weitere Folgen für unsere eigenen Überlegungen<br />
haben könnte – Lumer 1997 in seiner Kritik an Habermas’ Diskursethik und Renn / Webler 1996 in ihrem<br />
Konzept eines kooperativen Diskurses.<br />
Der Widerspruch zwischen lernpsychologischen Kategorien und einer immanenten Fachsystematik wird<br />
besonders deutlich, wenn „klassische“ didaktische Postulate wie das lange Zeit in der Erdkunde dominierende<br />
»Vom Nahen zum Fernen« kritisch auf ihre tatsächliche Bedeutung hinterfragt werden. In diesem Beispiel mit der<br />
Überlegung, dass in einer Gesellschaft, die zunehmend weniger von unmittelbaren Realerfahrungen geprägt wird<br />
– zumindest im Vergleich zur Menge der dem Einzelnen verfügbaren und handlungsrelevant werdenden<br />
Informationen und indirekten Realitätsvermittlungen – und deren personale Mobilität zunimmt, ist räumliche<br />
Nähe nicht gleichzusetzen mit psychologischer Erlebnisnähe. Pädagogisch ist daher Nähe nicht am Maßstab<br />
räumlicher (z.T. auch zeitlicher) Distanz sondern wurzelt zumeist in der medialen Präsenz (Kriege, Katastrophen;<br />
virtuelle Welten), biographischer Bedeutung (Herkunft, Migration; Urlaubseindrücke) oder emotionalen<br />
Affinitäten (vermittelt durch Sprache, Kultur, Religion; Literatur, Leitbilder, Moden). Ein »Anknüpfen an Nahes«<br />
bedeutet nicht mehr wie früher, intime Kenntnis des Wohnortes und der (räumlich) näheren Umgebung<br />
vorauszusetzen oder voraussetzen zu können, sondern muss situativ differenzierend die Orte und Situationen der<br />
affektiven Nähe bei den Schülerinnen und Schülern aufspüren und in allem Respekt ansprechen. Der aktuelle<br />
Wohnort ist häufig nur biographisches Intermezzo, oft sogar noch <strong>als</strong> fremd und fern und mit emotionaler Distanz<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 66
[50]<br />
[51]<br />
[52]<br />
[53]<br />
[54]<br />
[55]<br />
[56]<br />
wahrgenommen. So kann es einen Hauch ungeahnter »Exotik« gewinnen, mit einer Schülergruppe den eigenen<br />
Wohn- und Schulort erkundend für sich zu »erobern«.<br />
Vgl. die unter Verständnisproblemen leidende Rezension von Immanuel Geiss (1996) über Elçin Kürşat-Ahlers<br />
Untersuchung der frühen zentralasiatischen Staatenbildungen, einer historisch-soziologischen Studie in der<br />
Tradition von Norbert Elias. Als Erwiderung hat der Verfasser ebenfalls in den Historische Mitteilungen der<br />
Ranke Gesellschaft eine Replik vorgelegt unter dem für unseren Zusammenhang interessanten Titel<br />
„Ontologisierte Geschichte: Über das Geschichtsbild des Historikers“ (Voigt 1996a).<br />
Wallerstein 1995: »Unthinking Social Science«.<br />
»Schlüsselprobleme« setzen zudem die Bereitschaft zu einem an ›exemplarischen Lernen‹ orientierten methodischen<br />
Neubestimmung und die Fähigkeit zu einem erhöht distanzierten Wissenschafts- und Didaktikverständnis.<br />
Vor allem das Defizit an letzterem scheint dem Berufsalltag immanent. Bisherige Versuche einer Kompensation<br />
durch Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen waren nur sehr wenig Erfolg versprechend. Es scheint, dass auch die<br />
mit der psychosozialen Situation von Lehrerinnen und Lehrern und ihren zurückliegenden Berufsentscheidungen<br />
bisher zu wenig erforschte Ursachen darstellen. Die Abwehrhaltung beamteter Fachdidaktiker darf dabei nicht<br />
unterschätzt werden. Hinzu kommen strukturelle Rahmenbedingungen, die nach wie vor Hemmung und<br />
Verweigerung begünstigen. Ein weiteres mentales Hemmnis stellt die Abwehrhaltung der ›didaktischen Praktiker‹<br />
gegenüber den ›universitäten Theoretikern‹ dar, verbunden mit Unterstellungen, dass letztere aus Profilierungsmotivationen<br />
heraus ‘exotische Neuansätze’ propagieren und deren Umsetzung seitens der ›Praktiker‹ kritiklos<br />
erwarten, die ihre Rolle subjektiv <strong>als</strong> ‘Versuchskaninchen’ von Hochschuldidaktiker/innen bzw. verbunden<br />
mit einer Rolle der Schule <strong>als</strong> Spielwiese der <strong>Politik</strong> missbraucht sehen und die daran leiden.<br />
Vgl. u.a. Klafki, Wolfgang 1994: Schlüsselprobleme <strong>als</strong> inhaltlicher Kern internationaler Erziehung. In: Seibert,<br />
Norbert, Serve, Helmut J. (Hg.), Bildung und Erziehung an der Schwelle zum dritten Jahrtausend.<br />
Multidisziplinäre Aspekte, Analysen, Positionen, Perspektiven. München: 135-161. – Klafki, Wolfgang, 1990:<br />
Allgemeinbildung für eine fundamental-demokratisch gestaltete Gesellschaft. In: Cremer, Will / Klein, Ansgar,<br />
Hg., 1990: Umbrüche in der Industriegesellschaft. Herausforderungen für die politische Bildung. Opladen. S. 297-<br />
310. – Breit, Gotthard, Hg., 1994: Globale Schlüsselprobleme im <strong>Politik</strong>unterricht. Stuttgart.<br />
In diese Kategorie fällt z.B. die ländervergleichende Wissensumfrage der Illustrierten »DER STERN« im Januar<br />
1999.<br />
Niedersächsisches Kultusministerium: Rahmenrichtlinien für das Gymnasium – gymnasiale Oberstufe, die Gesamtschule<br />
– gymnasiale Oberstufe, das Fachgymnasium, das Abendgymnasium, das Kolleg. Gemeinschaftskunde<br />
(1994). Herausgegeben vom Niedersächsischen Kultusministerium im Schroedel Schulbuchverlag GmbH,<br />
Hannover 1994. – Die Umbenennung des bisherigen Oberstufenfaches Gemeinschaftskunde – in der<br />
Sekundarstufe I galt die Bezeichnung »Sozialkunde« – in »<strong>Politik</strong>«, der Bezeichnung, die jetzt durchgängig für<br />
alle Schulformen und -stufen gilt, erfolgte erst drei Jahre später in der Revision des niedersächsischen<br />
Schulgesetzes. Die Rahmenrichtlinien bleiben aber gültig.<br />
Dabei wird dieser Eindruck noch dadurch verstärkt, dass die genannten Schlüsselprobleme »ergänzt« und damit<br />
unterlaufen werden durch verbindliche Rahmenthemen im letzten Hauptabschnitt [3.] der Rahmenrichtlinien, die<br />
in der verbindlichen Abfolge der Schulhalbjahre der Klassenstufen 11 bis 13 auch noch den Schlüsselproblemen<br />
in einer Tabelle verbindlich zugeordnet werden: „Die Ziele und Dimensionen politischen Lernens werden im<br />
<strong>Unterricht</strong> in Auseinandersetzung mit Inhalten realisiert, die politisch bedeutsam für das heutige und zukünftige<br />
Leben sind. Diese werden in sechs Rahmenthemen gefasst, die durch den Bezug zu den Schlüsselproblemen und<br />
die verbindlichen Intentionen didaktisch strukturiert werden. Die Übersicht zeigt, welchem Schlüsselproblem das<br />
jeweilige Rahmenthema verbindlich zugeordnet ist. Die inhaltlichen Schwerpunkte zu den Rahmenthemen zeigen,<br />
wie sich durch Bezug auf weitere Schlüsselprobleme zusätzliche Fragestellungen für den <strong>Unterricht</strong> ergeben.<br />
Diese Schwerpunkte zeigen jeweils verschiedene Möglichkeiten der unterrichtlichen Konkretisierung sowie die<br />
Spannweite des Rahmenthemas auf. Neben Beispielen für <strong>Unterricht</strong>s- bzw. Kursthemen werden schließlich<br />
verschiedene Vorschläge zum Methodenlernen gemacht.<br />
Rahmenthemen<br />
Schlüsselprobleme<br />
Frieden und<br />
Gewalt<br />
Ökonomie und<br />
Umwelt<br />
Technologischer<br />
Wandel<br />
Soziale Ungleichheiten<br />
Verhältnis der<br />
Geschlechter<br />
und der<br />
Generationen<br />
Herrschaft und<br />
politische Ordnung<br />
1 Arbeit und Strukturwandel X<br />
2 <strong>Politik</strong> und Wirtschaft der EU X<br />
3 Demokratie in Deutschland X<br />
4 Modernisierungsprozesse in<br />
X<br />
Gesellschaften<br />
5 Internationale <strong>Politik</strong> und globale Verantwortung<br />
X<br />
6 Zukunftsentwürfe: Individuum und Gesellschaft<br />
X<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 67
x = verbindliches Schlüsselproblem“ – Auch diese Rahmenthemen werden anschließend in einzelnen Abschnitten in Hinblick auf ihre gesellschaftlichpolitische<br />
Relevanz begründet und ansatzweise didaktisch erläutert.<br />
[57]<br />
[58]<br />
[59]<br />
[60]<br />
[61]<br />
[62]<br />
[63]<br />
[64]<br />
[65]<br />
In unserer nachfolgenden, eher unterrichtspraktisch motivierten Konzeption von Diskursen und Schlüsselproblemen<br />
soll versucht werden, den integrativen Charakter von gesellschaftlichen Diskursen mit Einbeziehung<br />
sozialwissenschaftlicher Kriterien für Diskurskonzepte dadurch zu betonen, dass zunächst eine Reduzierung und<br />
Konzentration auf vier umfassende Diskursfelder erfolgt, die in der didaktischen Auffächerung, Konkretisierung<br />
und Umsetzung dann durchaus wieder gegliedert und unterteilt werden müssen. Das Schlüsselproblem<br />
»Herrschaft und Politische Ordnung« wird dabei in das Diskursfeld »Zivilisation, Gesellschaft, Staat« einbezogen.<br />
Elias 1936/1976, ab S. 1, insbes. S. 65 ff. – Im Staatenbildungsprozess in Deutschland wird im Gegensatz zu<br />
Frankreich die »bürgerliche Intelligenzschicht« weder in die entstehende Staatskonzeption funktional einbezogen,<br />
da sie auch in der deutschen höfischen Kultur nicht oder nur am Rande präsent war, noch ökonomisch im<br />
Bürgertum integriert. Das führte zu distanzierten und distanzierenden Figurationen, bei denen teilweise auch<br />
diskriminierende zugeschriebene Minderheitenrollen z.B. der (»zersetzenden«) jüdischen Intelligenz maßgeblich<br />
auf der einen Seite Furcht vor den revolutionären Intellektuellen, auf der anderen Seite die Erfahrung des<br />
Ausgeschlossenseins vermittelten und damit auf Dauer die Distanz Deutschlands zur Intelligenz festigte (vgl.<br />
Marx, Heine).<br />
Der Verfasser folgt in seinen Gedankengängen hier einer interessanten Diskussion mit einem befreundeten<br />
Hochschullehrer, der sich intensiv gerade um eine stärkere Orientierung an der Schulpraxis in seinem Fach, der<br />
Geographiedidaktik, bemüht und der gerade auch aus der Sicht unserer <strong>Politik</strong>didaktik zu den aufgeschlossenen<br />
und gesellschaftlich verantwortungsbereiten Schulgeographen in Deutschland gehört.<br />
Vgl. die Ausführungen in: Voigt 1998a/b/c und 1999a<br />
Dabei möchte der Verfasser anfügen, dass seine eigene Praxis des <strong>Politik</strong>-<strong>Unterricht</strong>s gerade diese Ansätze in den<br />
Vordergrund stellt und interdisziplinär mit Erdkunde und Geschichte vor allem Themen aus den so genannten<br />
»Semiperipherien« (Türkei, Naher Osten) und den »Transformationsräumen« (Polen, Ungarn, Russland)<br />
behandelt und dabei auch Reisen und Studienfahrten in diese Länder anbietet (1998 z.B. nach Sankt Petersburg)<br />
oder Schulpartnerschaftsprogramme (z.B. mit der Istanbul Lisesi in der Türkei) initiiert und betreut.<br />
Ein Erlebnis aus der Erdkunde-Fachkonferenz an der Schule des Verfassers soll diesen Überlegungen noch eine<br />
gewisse anekdotisch-persönliche Note geben: Von einer Elternvertreterin ist der Verfasser kürzlich in verletzender<br />
Weise diskreditiert worden – wobei der rechtswidrige Antrag auf Ausschluss aus der Fachkonferenz und auf ein<br />
Redeverbot noch das Harmloseste war –, weil er angesichts sinkender Schülerzahlen wagte, gegen eine (jetzt erst<br />
in diesem Gymnasium erfolgte) zusätzliche Einführung eines Erdkunde-Leistungskurses zu votieren. Unterstützung<br />
bei Fachkollegen fand diese seltsame Konferenzvertreterin jedoch bei der Auffassung, stattdessen den<br />
<strong>Politik</strong>-Leistungskurs zu streichen (was nicht erfolgen wird) und das Fach Erdkunde von »fachfremder<br />
Politisierung« zu befreien (was der Verfasser <strong>als</strong> Erdkunde- und <strong>Politik</strong>lehrer jedoch verhindern wird)!<br />
Die aktuelle Menschenrechtsdebatte zeigt, dass gerade zu diesem Paradigma einfache Antworten schwer möglich<br />
sind. Zu sehr überschneiden sich hier sprachlich-semantische Probleme unterschiedlicher Realitätsdefinitionen<br />
(so, wenn im Arabischen die wörtliche Übersetzung von »Menschenrecht« eindeutig negativ konnotiert ist, weil in<br />
ihr, ebenfalls in einer dichotomen Weltsicht – wenn auch wie im Christentum mit monistischer Endzeitperspektive<br />
–, eine Polemik gegen Gottesrecht und Recht der »umma«, der Gemeinschaft der Gläubigen notwendig<br />
in das Verständnis eingeschlossen ist), Identitäts- und Integrationsforderungen wie unterschiedliche kollektive<br />
geschichtliche Erfahrungen, die in den Wertordnungen der jeweilige Politischen Kultur ihren Ausdruck finden.<br />
Diese im Grunde eher <strong>als</strong> skeptizistisch und agnostisch zu kennzeichnende Denktradition findet in den Naturwissenschaften<br />
zunehmen Resonanz, vor allem auch in der Biologie und der Gehirnforschung. Vgl. dazu Gerhard<br />
Roth 1998.<br />
Hier soll der Verweis auf eine kritische Weiterführung des Dekonstruktivismus und dem Versuch seiner<br />
Zusammenführung mit psychoanalytischen wie hermeneutischen Denktraditionen bei Pierre Legendre (u.a. 1983;<br />
1988). „Diese industrielle Moderne erhebt in Legendres Augen immer noch Anspruch auf Führung der gesamten<br />
Menschheit, sie operiert immer noch unter dem dogmatischen Design, das die juristischen Meisterdenker des<br />
ausgehenden Mittelalters entworfen haben: Sie ist immer noch ein System, das die Menschen an ihren unreifen<br />
Stellen packt: am sterblichen Körper, an der sozialen Abhängigkeit und am Unbewussten. Also doch auch Freud!<br />
Aber was Legendre aus dem Verdrängten der modernen Gesellschaft, nämlich aus ihren alten Akten zieht, das<br />
sind nicht Triebe, Begehren, Inzest, die nur allzu bekannten Ungeheuer der schlafenden Vernunft: Es ist das<br />
Gesetz. Die industrielle Kultur und die Wissenschaftskultur der Moderne oder Hypermoderne, wie Legendre<br />
gerne sagt, arbeiten Hand in Hand. Sie formen, bilden, steuern die Menschen nach harten, auf Selbsterhaltung<br />
ausgelegten Prinzipien. Ihre Wissenschaften beschreiben das Ergebnis dieser Dressur <strong>als</strong> Verhalten. Legendres<br />
Bücher sind daher erfüllt von Groll und Gelächter über die Social Behavioural Sciences unserer Tage. Auf sie berufen<br />
sich die Führer, <strong>Politik</strong>er, Manager, Richter. Die Menschenwissenschaften rücken in die Position der absoluten<br />
Referenz, wo doch eben unsere Referenz nur ein mythischer Name sein kann, ein Name, der das Nichts<br />
versiegelt. Das Nichts, aus dem wir kommen und wohin wir <strong>als</strong> unsterbliches Protoplasma, wie Freud sagte,<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 68
[66]<br />
[67]<br />
[68]<br />
[69]<br />
[70]<br />
[71]<br />
[72]<br />
[73]<br />
[74]<br />
[75]<br />
[76]<br />
gehen. Die Wahrheit und die Wirklichkeit der sprechenden Tierchen, die wir tatsächlich sind, finden sich allein<br />
durch institutionelle Systeme organisiert. Menschen kommen in der Natur nicht vor, sondern nur in kulturellen<br />
Milieus, die sich in der Moderne selbst für Natur halten. Kann man die Seele des Löwen beim Pfötchengeben<br />
studieren? Der wahre, natürliche Mensch ist das phantastisch zurechtgestutzte Zirkustier der Aufklärung,<br />
phantastischer <strong>als</strong> der Gott, den sie stürzte.“ Schneider 1998.<br />
Ergänzend ist anzumerken, dass die erneute philosophische Problematisierung der traditionellen erkenntnistheoretischen<br />
und historischen Dichotomien nicht nur ideengeschichtliche Gründe hat, sondern dass der Übergang<br />
vom Konstruktivismus zum höchst problematischen Dekonstruktivismus und der philosophische Diskurs darüber<br />
seine realgesellschaftliche Parallele im politischen Scheitern des Marxismus – verbunden mit dem »Scheitern« der<br />
gesellschaftswissenschaftlichen wie philosophischen Dialektik – findet, wobei Fukuyamas These vom „Ende der<br />
Geschichte“ (1992) in der politischen Umbruchsituation unserer Zeit wurzelt. Der vehemente und berechtigte<br />
Protest gegen diese säkulare Endzeitthese, die mit der Eingangs angesprochenen Milleniumsbefindlichkeit<br />
korrespondiert, sollte hier mit Eduardo Galeano seinen Ausdruck finden: „Ende der Geschichte. Die Zeit geht in<br />
Rente, die Welt hört auf, sich zu drehen. Morgen ist ein anderer Name für heute. Der Tisch ist gedeckt; die westliche<br />
Welt verweigert niemandem das Recht, die Reste zu erbetteln. Ronald Reagan erwacht und sagt: ‚Der Kalte<br />
Krieg ist zu Ende. Wir haben gewonnen.‘ Und Francis Fukuyama, ein Mitarbeiter des State Departments, gelangt<br />
plötzlich zu Erfolg und Ruhm, indem er entdeckt, dass das Ende des Kalten Krieges das Ende der Geschichte ist.<br />
Der Kapitalismus, der sich liberale Demokratie nennt, ist der Ankunftshafen aller Reisen, ‚die endgültige Form<br />
der menschlichen Regierung‘. Stunde des Ruhmes. Der Klassenkampf existiert nicht mehr, und im Osten gibt es<br />
keine Feinde mehr, sondern Alliierte. Der freie Markt und die Gesellschaft des Konsums erobern die weltweite<br />
Zustimmung, die sich durch den historischen Umweg der kommunistischen Fata Morgana verzögert hatte. So wie<br />
es die Französische Revolution gewollt hat, sind wir jetzt alle frei, gleich und brüderlich. Und alle Besitzer. Königreich<br />
der Habsucht, weltliches Paradies. So wie Gott hat der Kapitalismus die beste Meinung über sich und<br />
zweifelt nicht an seiner eigenen Unvergänglichkeit.“ (1990). – Vgl. Fukuyama 1992 (in deutscher Übersetzung);<br />
<strong>als</strong> Gegenposition dazu auch Fuller 1995, aber auch die These vom „Krieg der Kulturen“ von Huntington<br />
1996/1998; im Diskurs besonders aufschlussreich das Frankfurter Rundschau-Gespräch von 1996.<br />
Vgl. Fußnote 58 / Literaturverweis.<br />
Vgl. Fußnote 58 / Anmerkungen zur Situation der Intelligenzschicht.<br />
Dieser Abschnitt folgt einleitend in überarbeiteter Fassung dem allgemein-didaktischen Teil des Soziologie-<br />
Leistungskurses „Soziale Ungleichheit“, Wolf / Voigt 1977. Der Kursentwurf „Soziale Ungleichheit“ wurde<br />
1976/77 im Auftrage des Niedersächsischen Kultusministers im Rahmen der Reform der gymnasialen Oberstufe<br />
<strong>als</strong> Leistungskurs Soziologie entwickelt, nach dem Regierungswechsel in Niedersachsen und der Auflösung der<br />
bisherigen Reformkommissionen Anfang 1977 aber nicht mehr veröffentlicht. Im Juli 1977 hat die GEW<br />
Niedersachsen das Manuskript des Kurses <strong>als</strong> „Sonderdienst 12/77. Nicht veröffentlichter Kurs für Handreichungskurse<br />
der Sekundarstufe II“ vorgelegt. Dieser <strong>Unterricht</strong>sentwurf kursiert seither in unterschiedlichen<br />
Bearbeitungen und Aktualisierungen für das Fach <strong>Politik</strong> und zeigt damit, entgegen der damaligen Behauptung<br />
des Kultusministers, der die Veröffentlichung dieses Kursentwurfs grundsätzlich ablehnte, dass sowohl das<br />
fachliche und didaktische Konzept seine Bewährungsprobe besser bestanden hat, <strong>als</strong> viele andere veröffentlichte<br />
»Handreichungskurse«, die ohnehin oftm<strong>als</strong> besser waren <strong>als</strong> die Mehrzahl der Verlagspublikationen seither, <strong>als</strong><br />
auch, dass ein fundamentales Bedürfnis, dieses Thema in der Schule zu behandeln, existiert, wie es heute ja das<br />
Kultusministerium mit der Übernahme des Schlüsselproblemkonzeptes nachträglich bewiesen hat. Es wäre Zeit,<br />
eine sorgfältig redigierte und aktualisierte Fassung dieses Kursentwurfs erneut zu publizieren.<br />
Vgl. weiter oben Ausführungen zu<br />
Diese fachlichen Überlegungen folgen weitgehend Ausführungen von Jürgen Wolf in Wolf / Voigt 1977.<br />
„Wenn die Menschen Situationen <strong>als</strong> real definieren, so sind auch ihre Folgen real.“ Thomas / Thomas 1928,<br />
zitiert nach Steinert 1973, S. 334. – Der Herausgeber des Werkes von Thomas und Thomas, E. H. Volkart, merkt<br />
dazu an: „Dieser in der Literatur häufig zitierte Satz wird neuerdings Znaniecki zugeschrieben. Vgl. Howard<br />
Becker, Interpretative Sociology Hand Constructive Typologie, in: Georges Gurvich und Wilbert E. More (Hg.),<br />
Twentieth Century Sociology. New York 1945, S. 80, Anm. 21. Die Beweise für diese Auffassung sind sehr<br />
dürftig, weil der Satz entgegen der Behauptung Beckers in The Polish Peasant nicht vorkommt“ (Steinert, ibid., S.<br />
335, Anm. 2).<br />
Bemerkenswert auch für eine didaktische Umsetzung sind dabei die Studien in Krippendorff: Staat und Krieg<br />
(1985).<br />
Vgl. Fußnote 69.<br />
Max Weber 1960, S. 42 f.; Willy Strzelewicz 19723, S. 27.<br />
Bolte u.a. 19743, S. 15 f., 20-22, 114-117. Diese Textstellen eignen sich auch für den Einsatz im <strong>Politik</strong>unterricht.<br />
– Dazu auch: Offe 1970; Seyfarth 1969; Steinkamp 1971.<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 69
[78]<br />
[79]<br />
[80]<br />
[81]<br />
[82]<br />
[83]<br />
[84]<br />
[85]<br />
[86]<br />
[87]<br />
[88]<br />
[89]<br />
[90]<br />
[91]<br />
[92]<br />
[93]<br />
[94]<br />
Dem entspricht in der niedersächsischen Rahmenrichtlinien-Konzeption, dass in etwas modifizierter Formulierung<br />
dieses Schlüsselproblem eine zentrale Bedeutung nicht nur im Fach <strong>Politik</strong>, sondern auch in anderen<br />
Schulfächern, wie z.B. Geschichte und Erdkunde erhält, wo die fachliche Umsetzung sich jedoch vor allem auf<br />
die Erörterung regionaler Disparitäten bezieht.<br />
Ziehe 1991, Engler 1993.<br />
Zum autoritären Charakter: Gottschalch 1977; zu Individualisierung und Gewalt: Heitmeyer et al. 1989 und 1991;<br />
zur gesellschaftlichen Funktion der Individualisierung: Ulrich Beck: Individualisierte „Gesellschaft der Unselbständigen“.<br />
In: Beck, 1986, S. 157 ff. oder diverse empirische Studien wie die mehrfach erstellten SHELL-<br />
Jugendstudien; zur didaktischen Umsetzung: Claußen 1991, Voigt 1993.<br />
Bade 1992; Battmer / Rischmüller / Voigt 1981.<br />
Formen der Individualisierung. Unspektakuläre Zivilisationsgewinne. Auch Individualisierung kann „kommunitär“<br />
sein. [Ziehe 1991] – „Vereinigungslust“ <strong>als</strong> „Kunst der Freiheit“. Individualisierung und Gemeinschaft<br />
VI: Kommunitaristische Anleihen bei Tocqueville. [Albers 1992]. – „Konformitätsdruck und Profilierungszwang.<br />
Zwischen Identifikation und Individualisierung: Ambivalenzen des Affektmanagements“. [Wouters 1994]<br />
Es würde den sozialen und ökonomischen Interessen der Managementklasse und ihrer gesellschaftlichen<br />
Bedeutung aber sicher nicht gerecht werden, hier von deiner schleichenden »Selbstsozialisierung« des Kapit<strong>als</strong> zu<br />
sprechen wie es Claus Offe 1977 vorschlägt. Er sagt dabei einen wachsenden Staatsinterventionismus voraus, der<br />
den derzeitigen Deregulierungsansätzen der Globalisierung nicht entspricht.<br />
Vgl. Fußnote 23.<br />
Vgl. Fußnote 28<br />
dass dieses Modell aus der Mitte dieses Jahrhunderts für die Charakterisierung der aktuellen Situation wie für eine<br />
Übertragung auf die Länder der Peripherien und Semiperipherien nicht differenziert genug ist, zeigt die<br />
Ambivalenz der inhaltlichen Füllung des Begriffes Tertiärer Beschäftigungssektor. Dies meint, im Sinne von<br />
Fourastié, sowohl die modernen, hoch differenzierten Dienstleistungsberufe in Forschung, Lehre, Entwicklung<br />
und Produktionsüberwachung, daneben auch den spezialisierten Service und Reparaturdienstleistungen, auf denen<br />
nach Fourastié 1949 die »Hoffnung des 20. Jahrhunderts« beruht, <strong>als</strong> auch, vornehmlich in den Transformationsund<br />
den Entwicklungsländern, die Sektoren der »verdeckten Arbeitslosigkeit« (Schuhputzer, ambulante<br />
Straßendienstleistungen, unqualifizierte Aushilfstätigkeiten), wie der Sektor der »Schattenwirtschaft« (Müllwirtschaft,<br />
illegaler Handel, Kriminalität, Prostitution; aber auch unbezahlte Hauswirtschaft), bei derem ökonomischen<br />
Vorherrschen das Wachstum des Tertiären Sektors <strong>als</strong> gravierendes Krisensymptom gewertet werden kann.<br />
Entgegen den Vorstellungen des »common sense« ist auch das Vorherrschen des Tourismus in einer Region ein<br />
Indiz für sozioökonomisch-strukturelle Defizite und Entwicklungsrückstände, da dieser Bereich wenig<br />
Wachstumspotentiale, die in andere Wirtschaftsbereiche ausstrahlen, impliziert und Teile der Unternehmensgewinne<br />
ins Ausland transferieren muss.<br />
Vgl. Fußnote 4 und die Ausführungen zum Diskurs »Soziale Ungleichheit«.<br />
Im Sinne der schon erörterten »Fraktionierung« von Gesellschaft und Politischer Kultur.<br />
Sommermeyer 1994: „Patchwork-Biographien werden uns eine völlig veränderte Realität bescheren“.<br />
Ohne tiefere historisch-soziologische Fundierung beschäftigen sich gerade in letzter Zeit ernstzunehmende und für<br />
die Didaktik maßstabsetzende Diskurse mit diesem Problemkreis, wie z.B. die »Magdeburger Erklärung«<br />
[Ostendorf 1999] oder die Auseinandersetzung mit den Folgen der Individualisierung bei Peter F. N. Hörz 1999.<br />
Auch aus der Sicht der Semiperipherien ist der Rückzug auf den Kulturrelativismus nicht schlüssig und ebenfalls<br />
ahistorisch, wie die Überlegungen von Dursun Tan 1998 zur Frage der Menschenrechte in den islamischen<br />
Ländern sehr deutlich erweisen.<br />
Damit wird dieses Thema auch interessant für raumwissenschaftliche und stadtsoziologische Ansätze. Es sei hier<br />
auf grundlegende Arbeiten hingewiesen, die das Bild der Stadt wahrnehmungs-soziologisch deuten (Kevin Lynch<br />
1968) oder Stadtgeographie aus den Ansätzen des symbolischen Interaktionismus heraus neu bestimmen (Werner<br />
Durth 1977).<br />
Sommermeyer 1994 schlussfolgert aus diesem Zitat: „Der Mensch wird <strong>als</strong>o nur noch so viel wert sein, wie sein<br />
augenblicklicher Job – eine Garantie für die Zukunft wird es nicht mehr geben. Schon heute kennen wir aus den<br />
USA die Fälle der freigesetzten älteren Physiker, die ihre unzureichende Altersversorgung durch einen Job bei<br />
McDonalds aufbessern müssen. Durch das Primat der Ökonomie und des Wettbewerbs wird der Arbeitsmarkt<br />
zunehmend zu einem Ort, an dem sich ein immer rücksichtsloserer Sozialdarwinismus breit machen wird. Dies<br />
vor allem dann, wenn weiterhin soziale und rechtliche Korsettstangen unter dem Vorwand geopfert werden, die<br />
Wettbewerbsfähigkeit und die Wohlstandssicherung fördern zu wollen.“<br />
So der Titel einer von Elçin Kürşat-Ahlers, Dursun Tan und Hans-Peter Waldhoff 1999 herausgegebenen Aufsatzsammlung,<br />
die auf den Vorträgen eines internationalen soziologischen Colloquiums 1998 in Mersin/Türkei<br />
beruht.<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 70
[95]<br />
[96]<br />
[97]<br />
[98]<br />
[99]<br />
[100]<br />
[101]<br />
[102]<br />
[103]<br />
[104]<br />
[105]<br />
[106]<br />
[107]<br />
[108]<br />
[109]<br />
[110]<br />
Der Begriff Volk wird hier ohne analytische Trennschärfe pragmatisch-beschreibend gebraucht. Im weiteren<br />
Verlauf der Analyse wird gerade unter zivilisationstheoretischen und historisch-soziologischen Perspektiven der<br />
Begriff Volk in eine historische Reihe mit den Begriffen Ethnie und Nation zu stellen sein, mit denen die im<br />
Prozess des nation building zur Herstellung einer ausschließenden Gruppenidentität sich im Machtprozess<br />
entwickelnden Bewusstseinsinhalte und Selbstdefinitionen zu kennzeichnen sind.<br />
Literaturhinweis für den <strong>Unterricht</strong>: Weiss / Westermann, 1994.<br />
Auch wenn diese didaktischen Konkretisierungen exemplarisch am Beispiel von Kursmodellen der gymnasialen<br />
Oberstufe entwickelt werden, lassen sich die Grundüberlegungen leicht auf andere Schulformen und -stufen<br />
übertragen, wobei natürlich viel genauer die historischen Kenntnisvoraussetzungen und die eigenen gesellschaftlichen<br />
Lebenssituationen in der Lerngruppe berücksichtigt und thematisiert werden müssen. Als<br />
Kursabläufe sind diese Vorschläge in der Praxis erprobt.<br />
Weitere Ausführungen zu diesem Thema finden sich in Voigt 1999b und Nettelmann / Voigt u.a. 1999.<br />
Die zentrale Rolle von „Arbeiterbildungsvereinen“ und einer inhaltlich sehr deutlich von den genannten Zivilisationsvorstellungen<br />
geprägten „Arbeiterkultur“ in der sozialistischen Arbeiterbewegung bis in die 20er Jahre des 20.<br />
Jahrhunderts, zeigt dies sehr deutlich. Der Versuch, eine „eigene sozialistische Kultur“ zu definieren war in<br />
größerer historischer Perspektive doch nur der Abschluss der Durchsetzung der Zivilisation der „Höflichkeit“ und<br />
des Habitus des modernen Staatsbürgers.<br />
Nasreddin Hoca ist in der Türkei eine Schelmenfigur der Volkserzählungen und Anekdoten – etwa wie in<br />
Deutschland Till Eulenspiegel –, die diesen mit Bauernschläue, Naivität und mangelnder Bildung charakterisiert<br />
und dies <strong>als</strong> Grundlagen des Witzes nimmt, darüber aber auch einiges über Ansehen und soziale Stellung dieser<br />
ländlichen Hodschas aussagt.<br />
Rechtsgutachten belegen, dass die USA nach Maßstab ihres Rechtssystems und der Einhaltung der Menschenrechte<br />
nicht Mitglied des Europarates sein könnten.<br />
Vgl. Voigt 1995<br />
Genau dies ist auch die Funktion traditionalistischer und islamistischer Entwicklungen und Selbstverständnisse<br />
unter den türkischen Migranten in Deutschland.<br />
Vgl. dazu den schon zitierten Satz: „Wenn die Menschen Situationen <strong>als</strong> real definieren, so sind auch ihre Folgen<br />
real“ mit den Ausführungen weiter oben (zur Quelle dieses Satzes vgl. Fußnote 72).<br />
Dazu ist der philosophische Ansatz interessant heranzuziehen, der die humanitas <strong>als</strong> eine unmittelbare und<br />
ausschließliche Folge des vitam instituere, der institutionalisierten Existenz begreift. In den letzten Jahren hat vor<br />
allem der Rechtshistoriker und Psychoanalytiker Pierre Legendre (1983, 1988) in seiner Kritik der Beliebigkeit<br />
des postmodernen Dekonstruktivismus diesen antiken Gedanken wieder aufgegriffen (vgl. auch Schneider 1998:<br />
„Was ist damit gesagt? Der versuchte Vatermord stellt nicht die Frage nach dem Geisteszustand des Täters. Er<br />
stellt vielmehr die Frage nach den Fundamenten der Verbote. Diese Frage wieder zu entdecken, ist die Mission<br />
Legendres. Aber um sie zu verstehen, muss man ein Projekt des Fortschritts liquidieren, nämlich die Liquidation<br />
des Gesetzes.“).<br />
Dabei stellt sich wohl kaum die anthropologische Frage nach der Geschichte dieser habitualisierten<br />
Affektausstattungen, die Kernfrage der Zivilisationstheorie ist. Wirksam ist, was gegenwärtig ist. Anknüpfen kann<br />
diese Uminstitutionalisierung des Menschen an sein ursprüngliches Bedürfnis nach »Ordnungssicherheit« (vgl.<br />
die Ausführungen zur Soziologie der »Sozialen Ungleichheit«) und an die psychischen Strukturen des<br />
»Autoritären Charakters«, den Adorno diskutiert hat; vgl. dazu u.a. die Untersuchungen von Strzelewicz 1972 und<br />
die Anmerkungen im Text; zur Literatur vgl. Fußnote 37.<br />
Zit. nach Sander/Johr (Helke Sander/Barbara Johr (Hg.): BeFreier und Befreite. Krieg, Vergewaltigungen, Kinder,<br />
München 19922. Siehe auch die Kritik an diesem Titel von G. Koch: Blut, Spermia, Tränen. BeFreier und<br />
Befreite – ein Dokumentarfilm von H. Sander, in: Frauen und Film, Jg. 54/55, 1994, S. 3-14), S. 67, Abb. 14:<br />
Auszug aus dem Schreiben des Chefs des Allgemeinen Wehrmachtamts im OKW an SS-Obergruppenführer<br />
Wolff vom 2.8.1943. [Anm. B. Beck.]<br />
Zit. nach ebd., S. 67. [Anm. B. Beck.]<br />
Vgl. dazu Brownmiller (Susan Brownmiller: Gegen unseren Willen. Vergewaltigung und Männerherrschaft,<br />
Frankfurt/Main 1980 (Originalausgabe New York 1975)), S. 151, sowie Ruth Seifert, Krieg wird Vergewaltigung.<br />
Ansätze zu einer Analyse, in: Stiglmayer (A. Stiglmayer: Vergewaltigungen in Bosnien-Herzegowina, in: dies.<br />
(Hg.), Massenvergewaltigungen. Krieg gegen die Frauen, Freiburg/Breisgau 1993, S. 109-216), S. 85-107, hier S.<br />
87f. [Anm. B. Beck.]<br />
Sander/Johr (Helke Sander/Barbara Johr (Hg.): BeFreier und Befreite. Krieg, Vergewaltigungen, Kinder,<br />
München 19922.), S. 67, Abb. 14: Auszug aus dem Schreiben des Chefs des Allgemeinen Wehrmachtamts im<br />
OKW an SS-Obergruppenführer Wolff, 2.8.1943. [Anm. B. Beck.]<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 71
[111]<br />
[112]<br />
[113]<br />
[114]<br />
[115]<br />
[116]<br />
[117]<br />
[118]<br />
[119]<br />
In einem Gespräch mit der Hannoversche Allgemeine Zeitung. Vgl. Stief 1996: „Für Vester hat die Globalisierung<br />
weiterhin nationale Grenzen. Geklagt werde über hohe Löhne und Kosten; doch auch nach Meinung der<br />
Bundesanstalt für Arbeit kämen diesem Posten im Reigen aller Standortfaktoren gerade einmal 26 Prozent des<br />
Gewichts zu. Nach wie vor gebe es eigenständige Warenkreisläufe. Innovationen seien nicht nur in<br />
kapitalintensiven Weltmarktbranchen, sondern auch in arbeitsintensiven Branchen möglich. Sie würden jedoch<br />
blockiert. Und nicht zuletzt sei auch die Staatsverschuldung durch eine andere <strong>Politik</strong> zu korrigieren.“<br />
Vgl. Oran 1999 („Bedeutet Globalisierung Imperialismus?“); Ahlers 1999.<br />
Im übrigen ist auch hier noch eine zumindest partielle Einbeziehung der schon angesprochenen klassischen<br />
Erklärungsansätze über Wirtschaftskrisen und die »Vermachtung der Märkte« durch Hofmann 1969 möglich und<br />
auch didaktisch sinnvoll (Vgl. Fußnote 19).<br />
Die Kontroverse zwischen Milieu-Theoretikern und Behaviouristen oder Soziobiologen, den die genetische<br />
Prägung alleiniger Erklärungsrahmen für menschliches Verhalten ist, zieht sich durch die Wissenschaftsgeschichte<br />
und hat heute wieder erkenntnistheoretische Brisanz in den Science Wars erhalten, in denen die<br />
Wissenschaftlichkeit <strong>als</strong> solche zwischen Humanwissenschaften und Naturwissenschaften gegenseitig in Frage<br />
gestellt wird. dass hier teilweise Scheinkontroversen geführt werden, die in der Subjekt-Objekt-Dichotomie <strong>als</strong><br />
Teil des abendländischen dichotomen Denkens wurzeln und letztlich auf unterschiedliche begriffliche<br />
Entdifferenzierungen zurück zu führen sind, sei nur am Rande angemerkt.<br />
Wenn gesellschaftliche Prozesse nicht grundsätzlich mehrschichtig und komplex wären, würde sich sicher mit<br />
einer gewissen Berechtigung die vordergründige Erklärung aufdrängen, dass mit dem Fach Deutsch ausgrenzende,<br />
einem renationalisierten Bewusstsein verpflichtete politische Bestrebungen zu Grunde liegen und dass mit dem<br />
Fach Mathematik eine Mischung zwischen »Ehrfurcht und Schauer« vor Fähigkeiten, die in der Öffentlichkeit<br />
kaum begriffen oder nachvollzogen werden (die Legende eigener Schulerfahrungen, dass eben gute<br />
mathematische Leistung angeblich den »guten Schüler« ausmachen würden), und dem Wunsch nach elitärer<br />
Ausgrenzung gegenüber neuen Aufsteigerschichten. Die Ironie liegt daran, dass Mathematik <strong>als</strong> formalisierte<br />
Sprache oft Ausländern oder vor allem Aussiedlern aus Osteuropa, die den so genannten Ober- oder Intelligenzschichten<br />
entstammen, besondere Chancen zum Ausgleich von noch vorhandenen allgemeinen Sprachdefiziten<br />
gibt. Schichtunabhängig ist diese traditionelle Definition von »Hauptfächern« aber niem<strong>als</strong>, im<br />
Gegenteil, sie läuft dem Konzept emanzipativer und fördernder Erziehung zuwider.<br />
Diese den Lehrerinnen und Lehrern vor allem aus der Referendariatszeit wohlbekannten didaktischen Schemata<br />
brauchen hier nicht mehr eigens diskutiert zu werden, da sie für ein diskursives Konzept einer erneuerten<br />
<strong>Politik</strong>didaktik keine Bedeutung mehr haben. Sie sind heuristische und pragmatische Modelle, deren<br />
lernpsychologische Relevanz ebenso fragwürdig ist wie ihr praktischer oder fachlicher Nutzen. Schlagwörter wie<br />
„vom Nahen zum Fernen“ wurden schon ideologiekritisch angesprochen; die anthropologischen Stereotypien die<br />
hinter Leitvorstellungen wie „Sequenzialität“, „Säulen-, Spiral- oder Schichtcurriculum“, „Stufencurriculum“<br />
stehen, bedurften einer eingehenderen kritischen Würdigung. Ihr wissenschaftlicher Wert ist grundsätzlich in<br />
Frage zu stellen.<br />
In der politischen Analyse ist noch eine weitere Dimension zu berücksichtigen. Die traditionelle Einheitlichkeit<br />
des Lernens in den Fächern und die Vernachlässigung separater Lernangebote für die grundlegenden<br />
Kulturtechniken vor allem in der weiterführenden Schulausbildung bevorzugt massiv diejenigen Schülerinnen und<br />
Schüler, deren familiare Sozialisation und durchlaufene Schulbiographie dem traditionellen Mustern des<br />
„deutschen Bildungsbürgertums“ entspricht, das selbst dieses Fachprinzip im Schulwesen durchgesetzt hatte. Die<br />
Aufstiegs- und Integrationsbarrieren, die das institutionelle Gerüst der Schule vor allem weniger integrierten<br />
Sozialgruppen in den Weg legt, ist Teil des „Verdeckten Curriculum“ der Schule und Teil eine sozialen<br />
Privilegierung; ob dieses so gesellschaftlich oder politisch gewollt, hingenommen oder <strong>als</strong> grundsätzliches<br />
Problem verstanden wird, dürfte in der Gesellschaft sehr kontrovers gesehen werden. Unsere Überlegungen sollen<br />
dazu beitragen, die Folgen solcher institutioneller struktureller Barrieren abzubauen.<br />
Erfolgreiche Muster für solche Angebote finden sich heute vor allem bei Einführungs- und Fortgeschrittenenkursen<br />
im Bereich Computernutzung und Neue Medien (z.B. Internet); es wäre nicht ausgeschlossen, Rechnen,<br />
Rechtschreibung, Rhetorik und andere Techniken <strong>als</strong> verpflichtende aber zeitlich individuell zu staffelnde<br />
Kursangebote bis in die gymnasiale Oberstufe hinein ähnlich wie Instrumentalunterricht in der Musik oder<br />
leistungsdifferenzierte Sportkurse anzubieten. Das es organisatorisch und didaktisch möglich ist, ist erwiesen. Es<br />
setzt nur ein Umdenken z.B. in den Fächern Deutsch und Mathematik voraus, die einerseits wesentlich<br />
„entschlackt“ werden, andererseits aber in Bezug auf ihre angebliche Vorrangstellung in Begründungsschwierigkeiten<br />
kommen dürften. Und hier liegt das Problem der praktischen Umsetzung dieser Vorschläge.<br />
Philosophisch ist hier auf eine immanente Relativierung der Subjekt-Objekt-Beziehung zu verweisen, bei der zum<br />
einen ein erweiterter Kommunikationsbegriff zu verwenden ist, in dem jegliche Hinwendung des Erkenntnissubjekts<br />
zu seiner Außenwelt – die im Sinne der Kulturwissenschaften oder Legendres nur im Rahmen<br />
existentieller Institutionalisierungen überhaupt bewusst wahrgenommen werden kann, wobei soziale und<br />
materielle Umwelt qualitativ nicht unterscheidbar sind, sondern immer <strong>als</strong> gesellschaftlich vermittelte Entitäten<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 72
[120]<br />
[121]<br />
[122]<br />
[123]<br />
[124]<br />
[125]<br />
[126]<br />
[127]<br />
[128]<br />
auftreten – <strong>als</strong> Kommunikation zu begreifen ist, und innerhalb der zum andern die Hinwendung des Erkenntnissubjekts<br />
zu seiner Außenwelt strukturell und notwendig Selbstbezüglichkeit voraussetzt und wiederum neu<br />
evoziert: letztlich die klassische didaktische Problemstellung.<br />
„Es gibt keine Lehrer mehr. Jene Lehrer, auf die man sich bezieht, wenn man für oder gegen ein Kunstwerk, eine<br />
wissenschaftliche Theorie, eine politische Entscheidung plädiert, sind offensichtlich zu historischen Figuren<br />
geworden. ... Bedarf es, um zu lernen, was Welt ist, nicht eines korrigierenden, eingreifenden, präsenten Lehrers<br />
oder wenigstens des geduldigen Lesens, Hörens, Begreifens von in schriftlichen Dokumenten, in Bildern und<br />
Tonaufzeichnungen festgehaltenen Ideen bereits verstorbener Lehrer? Mit Computer-Disketten, CD-ROM,<br />
Videos, Internet-Surfen wird das Wissen über die Zusammenhänge der Welt um gigantische Dimensionen<br />
erweitert. Aber wird damit der Lehrer in personam überflüssig, von dem man lernen kann oder sich durch eigene<br />
Arbeiten emanzipieren kann? Gegen den man fluchen oder für den man demonstrieren kann?“ Carl Wilhelm<br />
Macke: Nachruf auf den Lehrer. Frankfurter Rundschau<br />
Es ist zu erwarten, dass Praktiker und »Routiniers« des <strong>Politik</strong>unterrichts ebenso wie die Fachleiter der zweiten<br />
Ausbildungsphase in den Studienseminaren diesen kritischen Zustandsbeschreibungen und den geforderten<br />
didaktischen Auf- und Umbrüchen kaum zu folgen bereit sein werden, da sie sich einer scheinbar gesicherten<br />
<strong>Unterricht</strong>spraxis verpflichtet wissen, die im Sinne einer pragmatischen Methodenoptimierung die Dimension des<br />
Selbstverständnisses und der gesellschaftlich-diskursiven Grundlagen curricularen Denkens ausklammern müssen<br />
und letztlich für wenig praxisrelevant halten. Diese Summierung von Innovationshemmnissen und Blockierungen<br />
gegenüber einem notwendigen grundlegenden Paradigmenwechsel sind nur vor dem Hintergrund einer Analyse<br />
der biographischen Kontexte und Brüche der <strong>Politik</strong>-Lehrerinnen und -Lehrer zu verstehen. Vgl. zu dieser<br />
Thematik u.a. Voigt 1998a, S. 237 ff. und ders. 1998b und 1998c.<br />
Dazu u.a. Hagner 1999, Scharping 1999<br />
Dies zeigt aber auch eine tiefe Unsicherheit der Lehrerschaft gegenüber dem eigenen Rollenverständnis und<br />
gegenüber einer zunehmend <strong>als</strong> unübersichtlich wahrgenommenen sich ändernden gesellschaftlichen Realität!<br />
Z.B. das NLI in Hildesheim für Niedersachsen, das organisatorisch im Kultusministerium zusammengefasst<br />
worden ist mit der weiter bestehenden Landeszentrale für Politische Bildung in Hannover.<br />
Vor allem an Akademien in der konfessioneller Trägerschaft wie den evangelischen Akademien in Tutzing oder<br />
Loccum, oder in gemeinnützigen, daher oft thematisch spezialisierten Häusern, wie der Bildungsstätte des<br />
Internationalen Arbeitskreises Sonnenberg in St. Andreasberg im Harz. Andere Häuser werden für die staatliche<br />
Lehrerfort- und Weiterbildung angemietet oder auch organisatorisch beteiligt wie das katholische Ludwig-<br />
Windthorst-Haus in Lingen (Ems).<br />
In unserer auf die Formulierung diskursiver Schlüsselprobleme hin orientierten Auffassung von öffentlichen<br />
Diskursfeldern spielt zusätzlich und mit erheblichen Gewicht auch die Vorstellung von Mehrschichtenmodellen<br />
der Realität und der gesellschaftlichen Kommunikation eine Rolle, die eine Reduzierung auf sehr viel<br />
eingeschränktere Problemdefinitionen und Themenstichworte eigentlich ausschließt. Doch sollte der Diskursbegriff<br />
selbst ebenfalls im diskursiven Kontext konzeptualisiert werden, so dass die Grenzen zwischen realen<br />
öffentlichen Diskursen und innergesellschaftlichen Problemfelddefinitionen durchaus fließen sein können und<br />
unter einer breiteren sozialen Einbeziehung sich auch zu Diskursen in unserem Sinne ausweiten lassen. Die drei<br />
nachfolgend kurz erörterten gesellschaftlichen Problemfelder »Ökologie«, »Feminismus« und »Gewalt und<br />
Interkulturalismus« weichen durch ihre sehr stark eingeengte und tagespolitisch fest gruppenspezifisch<br />
zugeordnete Bedeutungswahrnehmung, die die Aufmerksamkeit eher auf das Problem ihrer Funktionalisierbarkeit<br />
im Prozess der Machtauseinandersetzungen lenken <strong>als</strong> auf ihren diskursiv erschließbaren gesellschaftlichen<br />
Problemgehalt, von den umfassenden und offenen Diskursvorstellungen ab, die Distanz und Rationalität erfordern<br />
und erst so ihre didaktische und curriculare Relevanz zur Begründung von gültigen Schlüsselproblemen erfahren.<br />
Die Peinlichkeiten der Auseinandersetzungen um ein dringend erforderliches neues Staatsbürgerschaftsrecht für<br />
die Bundesrepublik Deutschland Ende 1998 / Anfang 1999, eine populistische und von verfälschenden und<br />
unangemessenen Argumenten gestützte, aber in der unaufgeklärten und angstgeleiteten Bevölkerung äußerst<br />
erfolgreiche Unterschriftendaktion der CDU/CSU gegen den so genannten »Doppelpass«, d.h. gegen die (auch<br />
heute in gewissen Fällen ja schon durchaus mögliche) doppelte Staatsangehörigkeit, und der schließlich von der<br />
Koalition und Teilen der FDP getragene und verabschiedete, jedoch inkonsistente und völlig unzureichende<br />
»Kompromiss« zeigen, dass sich in der Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland eine Übereinstimmung der<br />
Volks- und Nationsvorstellungen des politisch konservativen Teils der politischen Eliten unabhängig von der<br />
konkreten Parteizugehörigkeit und eines großen Teils der Öffentlichkeit gibt, dass es sich <strong>als</strong>o um herrschende<br />
Vorstellungen handelt. Das dürfte wiederum eines der Krisensymptome unserer Thematik sein, die der Krise auch<br />
der Politischen Bildung zu Grunde liegt.<br />
Lehrerfortbildungskurse in diesem Bereich verengen sich zunehmend auf den Versuch, Rezepte zum Umgang mit<br />
»gewalttätigen« Schülerinnen und Schülern vorzustellen und die psychologische und rechtliche Bedeutung von<br />
Disziplinarmaßnahmen zu erörtern. Gesamtgesellschaftliche Perspektiven werden hier nicht entwickelt.<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 73
[129]<br />
[130]<br />
[131]<br />
[132]<br />
[133]<br />
[134]<br />
In den 50er Jahren für die Bundesrepublik Deutschland sicherlich legitim und <strong>als</strong> Reaktion auf noch nicht<br />
verarbeitete zeitgeschichtliche Erfahrungen sinnvoll und gesellschaftlich fortschrittlich, wirkt das Konzept einer<br />
»Westorientierung« und Wertbindung an eine westliche Wertegemeinschaft <strong>als</strong> didaktische Leitidee der<br />
Politischen Bildung z.B. bei Gagel heute merkwürdig anachronistisch und letztlich obsolet. Das Notwendige ist<br />
bei Claußen 1997 gesagt worden, auch wenn Gagels Replik (1998) ehrenhaft und durchaus nachvollziehbar<br />
erscheint.<br />
Konnten in den 70er und 80er Jahren besonders motivierte Schulen z.B. im Rahmen der UNESCO-Projekt-Schul-<br />
Arbeit ein wichtiges internationales »Netzwerk« der Begegnungen und des Austausches aufbauen, das Dritte-<br />
Welt-Paten- und Partnerschaften ebenso umfasste wie aktiv betriebene Schulpartnerschaften mit Ländern,<br />
gegenüber denen in der deutschen Öffentlichkeit besonders verhängnisvolle Negativstereotypen vorherrschten und<br />
wohl auch noch heute vorhanden sind, wie z.B. mit Polen oder der Türkei (vgl. die Berichte von Nettelmann und<br />
Voigt zu diesen Programmen – hier am Beispiel der UNESCO-Projekt-Schule am Maschsee, Bismarckschule<br />
Hannover – im Literaturverzeichnis), finden sich heute kaum noch Lehrkräfte oder wirklich motivierte<br />
Schülerinnen und Schüler, die dieses Konzept inhaltlich nachvollziehen und aktiv tragen wollen. Sogar schrecken<br />
heute Schulleitungen davor zurück, Polen- und Türkei-Kontakte öffentlich werbend einzusetzen aus sehr<br />
ängstlichen Befürchtungen, gewisse Elternkreise damit vor einer Entscheidung für den Schulbesuch ihrer Kinder<br />
in diesen Schulen abzuschrecken. Einmal werden im Bezug auf die genannten Vorurteilshaltungen damit in der<br />
Öffentlichkeit Prozesse der self-fulfilling prophecy evoziert, zum anderen dürfte diese Art der vorurteilsaffirmativen<br />
Ängstlichkeit ein verhängnisvolles Signal für das pädagogische Selbstverständnis einer UNESCO-Schule<br />
sein (oder auch generell eines Schulwesens in einer weltoffenen und liberalen Demokratie, die auf die Zivilcourage<br />
ihre Bürgerinnen und Bürger angewiesen ist).<br />
Dies würde der Verfasser spiegelbildlich auch unter »männlichen Vorzeichen« genauso kritisieren, da er in ihnen<br />
die notwendige Distanzfähigkeit und philosophische Rationalität einer interpersonalen Vermittelbarkeit<br />
grundsätzlich vermisst und diese Arbeitsansätze nicht für Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für zulässig hält.<br />
Deutliche sozialpsychologische Hemmschwellen sind hier auszumachen, da dieses »Umweltbewusstsein« zu<br />
einem moralisierten und moralisierenden Lebenskonzept gehört, das einer rational-distanzierten Infragestellung<br />
nicht offen ist. Generell ist hier das Problem des »Moralismus« anzusprechen, der eine denkbar schlechte<br />
Grundlage für ein pädagogisches Selbstverständnis abgibt. Das ist jedoch nicht misszuverstehen mit einer<br />
Ablehnung einer ethischen Bindung der eigenen Lebensführung, die sich mit rationalen, distanzierten und auf<br />
Empathie und Toleranz ausgerichteten pädagogischen Leitvorstellungen im Gegensatz zu einer moralistischen<br />
Perspektivverengung durchaus vereinbaren lässt.<br />
Es soll darauf hingewiesen werden, dass die unterrichtlichen Probleme vieler Kolleginnen und Kollegen mit »Umweltthemen«<br />
nicht auf mangelnde Verfügbarkeit von geeigneten <strong>Unterricht</strong>skonzepten zurückzuführen ist, die die<br />
genannten Voraussetzungsprobleme erkennen und bewältigen helfen könnten; auch die Lehrerfortbildung hat hier<br />
durchaus positive und aufklärerische Leistungen erbracht, auch wenn davon heute nur noch wenig nachgeblieben<br />
ist. Dabei soll auf den umfangreichen Sammelband zur Umweltpädagogik von Claußen und Wellie 1996<br />
hingewiesen werden, in dem auch der Verfasser mit einem didaktischen Konzept für die Sekundarstufen vertreten<br />
ist.<br />
Die stereotype »Lehrerbeschimpfung« durch führende <strong>Politik</strong>er führt sicherlich im Bildungsbereich – vice versa –<br />
zu einer ebenso stereotypen und irrationalen »<strong>Politik</strong>verdrossenheit«, die letztlich das Ende einer innovativen<br />
Politischen Bildung sein kann. Inhaltlich ist sie genaues haltbar und interessant wie eine Schornsteinfegerverdrossenheit...<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 74
Gerhard Voigt / Lothar Nettelmann:<br />
Gleichheit – Freiheit<br />
Zur politischen und didaktischen Problematik kategorialer<br />
Scheingegensätze<br />
Anlass dieser grundsätzlichen kritischen Überlegungen war das Erscheinen von neuen „<strong>Unterricht</strong>sblättern der BPB [1[ “,<br />
die uns typisch erscheinen für die Entwicklung politikdidaktischer Diskurse der Gegenwart. Auch wenn die<br />
Überlegungen auf einem Skript vom Januar 2005 kurz nach Erscheinen der „<strong>Unterricht</strong>sblätter“ basieren, ist die<br />
grundsätzliche Bedeutung der Überlegungen heute, Dezember 2009, nicht geringer geworden, eher im Gegenteil.<br />
Eine Grundsatzkritik soll am Anfang stehen. Die von der Bundeszentrale für Politische Bildung angestrebte <strong>Unterricht</strong>skonzeption<br />
dient nicht der politischen Einsicht, sondern bildet Stereotype, die in der Machtkonkurrenz zu politisch<br />
affirmativen Situations- und Eigendefinitionen direkt verwendet werden können.<br />
„Freiheit“ und „Gleichheit“ <strong>als</strong> begrifflichen Widerspruch gegenüber zu stellen – wie es die „<strong>Unterricht</strong>sblätter“ tun –<br />
ist nicht aufklärerisch, sondern ein holzschnittartiges Mittel den Anschein von Verstehen und Originalität zu evozieren,<br />
ohne tatsächliche analytische – auch begriffskritische – Aufklärung leisten zu müssen. Dichotome Begriffspaare sind in<br />
der „Alltagsphilosophie“ und <strong>Politik</strong> beliebt, weil sie eine einengende Komplexitätsreduktion der Realität darstellen, die<br />
fälschlicherweise leichte Verstehbarkeit und praktische Handlungsbegründung suggerieren. Damit sind diese <strong>als</strong><br />
Ideologeme einzuordnen, die zudem für beliebige Interessen und Funktionen abrufbar sind. In der reduzierten<br />
„Studienseminardidaktik“ basiert ein großer Teil der didaktischen Konzepte auf solchen pädagogischen oder inhaltlichen<br />
„Gegenüberstellungen“, zum Beispiel „vom Nahen zum Fernen“ [2[ , „Heimat und Fremde“, „Natur und Kultur“<br />
… aber hier kommen wir schon zu einer hochbrisanten philosophiegeschichtlichen Kontroverse... Auch das beliebte<br />
didaktische Mittel des „Vergleichens“ fällt in diese oberflächliche Dichotomisierung der Realitätswahrnehmung. Am<br />
Beispiel des geographischen Vergleichens (hier zwischen England und Algerien) hat dies der Verfasser vor einiger Zeit<br />
in der Fachzeitschrift »Praxis Geographie« einer kritischen Analyse unterzogen. [3]<br />
Es ist kein Zufall, dass eine zunehmend auf Affirmation zielende Bildungspolitik zunehmend solcher Denkmuster<br />
bedarf, die darauf gerichtet sind, entsprechende Inhalte zu begründen und kritische Problembereiche zu anathematisieren.<br />
Damit ist auch das beliebte aber auf Beliebigkeit zeichnende Didaktikmodell der „Pro und Contra“-Gegenüberstellung<br />
im Ansatz in Frage zu stellen, weil die Mehrzahl der gesellschaftlichen Probleme mit diesem Muster nicht zu fassen<br />
sind. Es ist letztlich ein klassisches rhetorisches Mittel, das auch <strong>als</strong> zur Gedanken- und Einsichtsentwicklung <strong>als</strong><br />
solches einzusetzen und entsprechend zu moderieren ist. Die Funktionalisierung ist offenkundig. Das Ziel ist eigentlich<br />
nicht die inhaltliche Gegenüberstellung, sondern die Erfahrung disziplinierter Verbalisierung und Klärung von<br />
Positionen – und das Aushalten von Widersprüchen.<br />
Um jetzt zum Inhalt der in Frage stehenden „<strong>Unterricht</strong>sblätter“ überzuleiten: „Freiheit“ und „Gleichheit“ liegen auf<br />
verschiedenen begrifflichen Ebenen. Ihre Gegenüberstellung impliziert eine gemeinsame ethische oder politische Ebene<br />
und impliziert die Gedanken daran, die Begriffsbedeutung ohne weitere Bestimmungen oder Attribute <strong>als</strong> „selbstverständliche“<br />
verstehen zu können, bzw. dass es eine gültige interpersonell gültige Begriffsdefinition gebe.<br />
Dass tagespolitisch gesehen, gerade diese Diskussion zur heute gängigen Kritik am „Sozi<strong>als</strong>taatspostulat“ (Art. 20 GG)<br />
<strong>als</strong> „Widerspruch“ zu den „Freiheitsrechten“ des GG instrumentalisiert werden kann und wird, sollte bei der Diskussion<br />
im Gedächtnis behalten werden – es begründet wohl auch ein politisches Motiv für diese Publikation der Bundeszentrale.<br />
Alle „Selbstverständlichkeiten“ sind Ergebnis eines Prozesses zur Konsensfindung, der die politische und zivilisatorische<br />
Entwicklungen (Interessen) voraussetzt. Sie sind immer neue Augenblicksaufnahmen eines gesellschaftlichen<br />
Diskurses in einer konkreten gesellschaftlichen Situation. Es ist Aufgabe der Politischen Bildung, diese „Selbstverständlichkeiten“<br />
<strong>als</strong> historische Artefakte aufzudecken und sie konstruktiv verfügbar und weiterdenkbar zu machen,<br />
um einer Funktionalisierung „von oben“ zu widerstehen. [4] Im Gegensatz zur banalen Gegenüberstellung von <strong>als</strong><br />
dichotom verstandenen Begriffspaaren ist anzustreben, die gesellschaftlichen Diskurse selbst in den Fokus zu rücken<br />
und sie einerseits distanziert zu objektivieren und andererseits <strong>als</strong> Medium eigener politischer Beteiligung – und<br />
Veränderungsmotivation – zu verstehen. Damit wäre der „Diskurs“ zu einer zentralen didaktischen Kategorie auch für<br />
den Schulunterricht zu entwickeln.<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 75
„Gleichheit“ und „Freiheit“ <strong>als</strong> Widersetzlichkeiten zu verstehen suggeriert ihre Geschichte schon zum Zeitpunkt, <strong>als</strong><br />
sie in die bürgerliche Gesellschaft <strong>als</strong> gleichrangige Zielvorstellungen einbezogen wurden; [Rousseau; Französische<br />
Revolution]. Sie wurde gerade ihrer nicht <strong>als</strong> Gegenseite, sondern <strong>als</strong> Bedingung der Gesellschaft verstanden, nicht<br />
jedoch <strong>als</strong> Attribut einer konkreten Gesellschaft.<br />
Gleichheit<br />
Gleichheit ist <strong>als</strong> Metapher aus dem qualitativen Denken generaliter nur verständlich zu machen mit der Frage nach<br />
dem „was ist, kann oder soll gleich sein“ auch mit der Frage nach dem Rahmen, in dem die Anwendung von<br />
„bestimmten Rechten oder ökonomisch von Einkommen und Vermögen“ nach dem „Gleichheitspostulat“ gewährleistet<br />
werden soll. Es handelt sich um politisch-ethische Zielvorgaben, vermutlich auch um Realutopien.<br />
Die Konsequenz aus der unterschiedlichen Beantwortung dieser Fragen kann an ganz konkreten politischen Fällen<br />
exemplarisch verdeutlicht werden, von denen wir hier zwei Beispiele aus dem schulpolitischen Bereich benennen<br />
wollen:<br />
1978 wurde ein in einer Arbeitsgruppe des niedersächsischen Kultusministeriums entwickelter Kursentwurf mit dem<br />
Thema „Soziale Ungleichheit“ [5] nach einem politischen Wechsel in der Landesregierung abgelehnt, was mit einem<br />
Gutachten begründet wurden, in dem expressis verbis bestritten wurde, dass es „Soziale Ungleichheit“ in der<br />
Bundesrepublik Deutschland überhaupt gebe und dass das Postulat einer „Sozialen Ungleichheit“ in der Schule „nicht<br />
auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung“ stehe (dass den Verfassern dennoch nicht mit<br />
disziplinarischen Maßnahmen gedroht wurde, aber im Landtag eine heftige Debatte um dieses „Skandalon“ geführt<br />
wurde ist eine der Absurditäten dieses bildungspolitischen Satyrspiels). Wenig später wurde bei gleichen politischen<br />
Konstellationen das Konzept der „Schlüsselprobleme“ nach Klafki für die Rahmenrichtlinienarbeit verbindlich eingeführt<br />
(leider heute wieder weitgehend in Vergessenheit geraten), bei dem ein zentrales, fächerübergreifendes<br />
„Schlüsselproblem“ die „Soziale Ungleichheit“ ist.<br />
Die zweite auch persönlich erfahrene Kontroverse beleuchtet die grundlegende Problematik, die wir zum<br />
„Gleichheitspostulat“ aufgezeigt haben, ebenso deutlich. In den niedersächsischen Studienseminaren für die<br />
Lehrerausbildung wurde von Seiten konservativer Fachleiter heftig gegen die pädagogisch-soziale Forderung nach<br />
„Chancengleichheit“ polemisiert mit dem Diktum, dass Menschen nun einmal von ihrer Veranlagung und Herkunft her<br />
„nicht gleich“ seien. Dass dies in Bezug auf die Forderung nach „Chancengleichheit“ ein inadäquates und von der<br />
Bedeutungsebene (semantisch) unrichtiges Argument ist, konnte nicht verständlich gemacht werden, was den Charakter<br />
der Kritik <strong>als</strong> Ideologem verdeutlicht. Als Gegenbegriff wurde die angeblich erzielbare „Chancengerechtigkeit“ gesetzt,<br />
wobei unter keinen Umständen diskutiert werden sollte, wer nun den Begriff der „Gerechtigkeit“ zu bestimmen hätte.<br />
Dass diese Begrifflichkeit durchweg herrschaftsaffinen Charakter trägt, ist evident. Genau diese Diskussion lebt heute<br />
wieder in der Diskussion um die „Integrationspolitik“ auf, was hier aber nicht weiter auszuführen ist. Es ist wiederum<br />
zu konstatieren, dass im Wesentlichen diesbezügliche Entscheidungsprozesse auf der Machtebene erfolgen.<br />
Andererseits ist Gleichheit eine ethische Kategorie, die sich in der Vorstellung des gleichen Wertes aller Menschen<br />
äußert. (Die Würde des Menschen ist unantastbar) [6] . Diese Gleichheit wird von Rousseau in Verbindung gebracht mit<br />
der Freiheit in seinem Satz: „Der Mensch ist frei geboren, aber überall liegt er in Ketten.“<br />
Freiheit<br />
Freiheit ist entweder ein subjektiver Befriedungsakt in einer konkreten Situation frei von unerwünschten<br />
(unlegitimierten) Zwängen über Gewaltdrohungen zu sein und handeln zu können oder ein philosophisch-moralischer –<br />
bei anderen Autoren eher ethischer – Grundbegriff der modernen „westlichen“ Wertordnung. Eine Verbindung<br />
zwischen beidem zu finden ist schwer, wenn nicht aus historisch-zivilisatorischen Gründen unmöglich. Der ethische<br />
Gehalt steht im Kontext mit dem politischen-moralischen Grundbegriff „Weltfrieden“ und ist nur im Rahmen einer<br />
kritischen Gegenüberstellung philosophischer „Utopien“ beziehungsweise ethisch-moralischer Setzungen (vgl. Kant)<br />
und der unüberwindlich erscheinenden Probleme, diese Normen in praktische (Welt-)<strong>Politik</strong> umzusetzen, zu<br />
erschließen, In der politischen Praxis findet die Widersprüchlichkeit dieses Freiheitsbegriffes keine praxisbegründende<br />
Kohäsion.<br />
Dies ist exemplarisch darzustellen an der Ideengeschichte des mitteleuropäischen Liberalismus. In aller Kürze ergeben<br />
sich hier folgende Aspekte. Vom Anfang im 19. Jahrhundert an teilt sich der Liberalismus – hervorgehend aus dem<br />
Kampf gegen den Feudalismus und die Adelsherrschaft, gestützt auf die Klasseninteressen des aufstrebenden<br />
(städtischen) Bürgertums – in divergierende Strömungen, deren gemeinsame Wurzel eigentlich nur in der sozioökonomischen<br />
und herrschaftspolitischen Situation des 19. Jahrhunderts zu verstehen ist –, die jeweils um unterschiedlich<br />
zentrale politische Leitbegriffe gruppiert sind. Der „Bürgerrechtsliberalismus“ steht in der Tradition des<br />
Kampfes um Menschen- und Grundrechte – aus dem sich auch der Charakter des ersten Teils des GG, philosophisch<br />
fußend auf dem Art. 1 GG und dem Begriff der Menschenwürde bestimmt –, die wiederum rechtsgeschichtlich auf der<br />
Entwicklung des Völkerrechts und philosophisch auf dem Gedanken des Gesellschaftsvertrages (Rousseau u.a.)<br />
basieren, und konkretisiert sich in der Nationalversammlung in der Paulskirche 1848 in der Forderung nach einer<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 76
deutschen Verfassung. Der „Nationalliberalismus“ konnte im 19. Jahrhundert in der Nation, und damit im modernen<br />
Staat mit der darin entstehenden Staatsgesellschaft, das moderne Gegenbild zum Feud<strong>als</strong>taat, dessen Legitimation<br />
letztlich mittelalterlichen Mustern folgte, mit enormer revolutionärer Sprengkraft sehen, in der sich die bürgerlichen<br />
Freiheiten erst realisieren könnten; dass der Nation<strong>als</strong>taat im weiteren Verlauf von der restaurierten Fürstenherrschaft<br />
usurpiert und umgedeutet werden konnte, ist die Tragik Europas, in der der daraus entstandene Nationalismus die<br />
Katastrophen des 20. Jahrhunderts verursachte. Damit ist heute der „Nationalliberalismus“ obsolet und anachronistisch<br />
geworden und tendiert, wo noch formal vorhanden, an das äußerste rechte Lager des politischen Spektrums, wie zum<br />
Beispiel in der FPÖ in Österreich. Der „Wirtschaftsliberalismus“ bringt noch am deutlichsten die schon angesprochenen<br />
eigentlichen Klasseninteressen der in der Französischen Revolution noch „revolutionären“ Bourgeoisie zum<br />
Ausdruck, indem Verfügung über das Eigentum einmal Machtgarant gegenüber der Adelsherrschaft („Steuerprivileg“,<br />
vgl. Norbert Elias) war und zum anderen Wurzel eigener Selbstbestimmungs- und Freiheitsräume.<br />
Erst hier beginnt tatsächlich die Freiheit in der Gesellschaft, die sich im Individualismus, dem Wunsch, eigene<br />
Lebensentwürfe zu verfolgen, ausdrückt. Die Widersprüche zwischen den auseinander laufenden Zielen dieses fraktionierten<br />
Liberalismus ergeben und im 20. Jahrhundert den politischen Bedeutungsverlust gegenüber den jeweils dominierenden<br />
politischen Mächten und bewirkten den merkwürdig irisierenden politischen Charakter der FDP in<br />
Deutschland <strong>als</strong> „Mehrheitsbeschafferin“ oder „Umfallerpartei“. Doch hier käme man schon in die tagespolitische<br />
Polemik...<br />
Sehr pragmatisch unterscheidet sich die Forderung nach „Freiheit“ in durch die Frage „Freiheit wovon oder Freiheit<br />
wozu?“. Das teilweise Scheitern des Antikolonialismus, in dem die Freiheit von der Kolonialmacht überleitet in die<br />
Unfreiheit von Diktaturen und auch Terrorherrschaften ist das Musterbeispiel dafür. Dass andererseits ein Konsens<br />
(„volonté générale“ nach Rousseau) über die Frage, was die Freiheit „wozu“ inhaltlich meint, zu erzielen ist, wird nicht<br />
möglich erscheinen. Sofort wird die kritische Frage gestellt werden müssen nach den „Grenzen der Freiheit“, die in der<br />
modernen Demokratie völlig formal <strong>als</strong> Verfassungs- und Rechtsloyalität definiert werden, [7]<br />
Ein philosophisches Konzept kann hier nur konkreter werden, wenn es auf Ziele hinarbeitet, bei denen auf „frei“ das<br />
„gleich“ abhebt.<br />
Mit diesen grundsätzlichen, durch persönliche Erfahrungen angereicherten Überlegungen öffnen sich aber weiterführende<br />
Problembereiche und Perspektiven für Ergänzungen:<br />
Beispiele für unterschiedliche Sichtweisen und definitorische Ansätze des Gleichheits- wie des Freiheitsbegriffes, insbesondere<br />
unter den Bedingungen der Nachkriegspolitik und damit auch der Nachkriegsdidaktik,<br />
Abgrenzung und Differenzierung zum Beispiel der US-amerikanischen, französischen, deutschen, polnischen oder auch<br />
sowjetischen Ansätze zur Verwendung des „Freiheits-“ und des „Gleichheitspostulats“ <strong>als</strong> (tages-)politisches Legitimationsmittel<br />
in zeitgeschichtlichen Kontexten auch und insbesondere unter dem Aspekt von spezifischer Funktionalisierung.<br />
Und die Fragestellung; Gibt es spezifische Ansätze in semiperipheren Figurationen zum Beispiel türkischen,<br />
muslimischen und – aus „westlicher“ Sicht – „orientalischen“ (zum Beispiel iranischen) historischen Zusammenhängen,<br />
die jeweils auf ‚ältere‘ Kulturen rekurrieren, aber gesellschaftshistorisch beziehungsweise zivilisationstheoretisch<br />
ableitbar sind? Das vor allem auch didaktische Ziel wäre, „westliche Denkansätze“ zu relativieren und zu ergänzen<br />
bzw. in weitere Zusammenhänge zu setzen!<br />
1 Bundeszentrale für Politische Bildung<br />
Anmerkungen<br />
2 „Demgegenüber wurden, zumindest implizit, bildungspolitische Konzepte zugrunde gelegt, die schlichtweg<br />
überholt sind, wenn sie auch in einer gewissen verbalen Akrobatik „modernisiert“ und verschleiert worden sind.<br />
Dazu gehören vor allem: - das „Prinzip: vom Nahen zum Fernen“ - der unreflektierte Raumbegriff (z.B. S.2) - die<br />
Idee des „räumlichen Kontinuums“. Alle drei Ansätze sind fachlich nicht mehr haltbar. An Stelle des Prinzips<br />
„Vom Nahen zum Fernen“ kann, lern- und wahrnehmungspsychologisch, nur der (selbst auch noch problematische)<br />
Gegensatz von „selbst erfahrener“ und „medienvermittelter Realität“ treten. Hier könnte eine erfahrungsorientierte<br />
Fachdidaktik ansetzen, müßte dann aber das Subjekt des Schülers ebenso wie die notwendige<br />
Medienkritik thematisch in das <strong>Unterricht</strong>s- und Vermittlungskonzept mit einbeziehen, was in dem völlig<br />
kognitiv-gegenständlichen RRL-Entwurf auch nicht in Ansätzen geschieht.“ Neue Rahmenrichtlinien in Niedersachsen:<br />
Stellungnahme zum Entwurf der Rahmenrichtlinien für die Klassen 7-10 des Gymnasiums – hier:<br />
Erdkunde. »politik unterricht aktuell«, Heft 3/1988 „Kritik der aktuellen Bildungspolitik“.<br />
http://www.pu-aktuell.de/pua1988/RRL88-2.htm<br />
3 Voigt, Gerhard, 1986: Industrialisierung in England und Algerien. Das Vergleichen von Entwicklungen. Praxis<br />
Geographie, Jahrgang 16, Heft 11, November 1986: 19-23<br />
4 vgl.: Voigt, Gerhard, 2001: Widerständigkeit <strong>als</strong> Gültigkeitsproblem der Politischen Bildung. Krisen und<br />
Konfliktfelder zwischen Universalisierungsanspruch und Nationfixierung. In: Claußen, Bernhard / Donner,<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 77
Wolfgang / Voigt, Gerhard, Hrsg., 2001: Krise der <strong>Politik</strong> – Politische Bildung in der Krise? Diskurse im Kontext<br />
von Globalisierung und Ost-West-Perspektiven. Materialien aus der Zusammenarbeit zwischen der Akademie für<br />
Wirtschaft, <strong>Politik</strong> und Kultur Mecklenburg-Vorpommern und dem Verband der <strong>Politik</strong>lehrenden. Demokratie<br />
und Aufklärung: Kritische Sozialwissenschaften und Politische Bildung im Diskurs – Materialien –, Band 1.<br />
Galda + Wilch Verlag. Glienicke/Berlin / Cambridge/Massachusetts: 207-234<br />
5 Wolf, Jürgen / Voigt, Gerhard, 1978: Soziale Ungleichheit. Leistungskurs Soziologie. [Nichtveröffentlichter<br />
Handreichungskurs]. Materialdienst 1/78. GEW Niedersachsen, Hannover<br />
6 vgl. dazu: Voigt, Gerhard, 2002: Anmerkungen zu Art.1, GG, in »politik unterricht aktuell« Heft 1/2002: 23-28<br />
[http://www.voigt-bismarckschule.de/publikationen/Artikel_1_GG.htm<br />
7 Vgl. John Rawls, Gerechtigkeit <strong>als</strong> Fairness. Ein Neuentwurf. Frankfurt am Main 2003<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 78
Lothar Nettelmann und Gerhard Voigt:<br />
Thesen zur „Wende“<br />
Probleme der Wahrnehmung, Bewertung und Bewältigung<br />
sozio-ökonomischer Transformationsprozesse [1]<br />
Die Veränderungen der sozio-ökonomischen Strukturen, der politischen Repräsentationsformen der Herrschafts- und<br />
Machtverhältnisse sowie der von den Bewohnern selbst wahrgenommenen Alltagswelten in den Ländern, die vierzig<br />
Jahre im Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW, COMECON) und im militärischen Bündnis der Warschauer Pakt<br />
Organisation (WPO) im Hegemonialbereich der UdSSR integriert waren und von diesem System geprägt wurden,<br />
lassen sich <strong>als</strong> „Transformation“ charakterisieren. Ein besonderes Problem für die Gesellschaft wie für die Sozialwissenschaften<br />
ist dabei die DDR, in der Ansätze einer »autochthonen Transformation« (vgl. dazu die Leipziger<br />
„Montagsdemonstrationen“) überlagert und letztlich abgebrochen wurden durch den Beitritt zur Bundesrepublik<br />
Deutschland nach Art. 37 GG, der die Angliederung und Angleichung an das bestehende sozio-ökonomische System<br />
der BRD notwendig zur Folge hatte.<br />
Transformationsprozesse sind vielschichtige Übergänge, die weder <strong>als</strong> vollständiges Ersetzen des Vorherigen durch das<br />
Neue, noch <strong>als</strong> kontinuierlicher Wandel hinreichend beschrieben werden können. Transformationen erfolgen einerseits<br />
in der gesellschaftlichen Realität <strong>als</strong> vielschichtiger und diskontinuierlicher Prozess der Ersetzung, des Entwickelns, der<br />
Übernahme und Neufunktionalisierung und des Überlagerns. Dies hat strukturelle Ähnlichkeit mit den Prozessen des<br />
Kulturkontaktes, der Akkulturation oder Transkulturation, die heute eine große Bedeutung in der kulturwissenschaftlichen<br />
Forschung gewonnen haben. Andererseits erfolgen Transformationen auch im gesellschaftlichen Bewusstsein<br />
<strong>als</strong> Umbewertung, Neudefinition oder Anathematisierung sich wandelnder Realitäten, aber auch <strong>als</strong> Dissonanzerfahrungen<br />
und dem Erleben von Brüchen in der eigenen Biographie. Die Definition des Eigenen und des Fremden wird<br />
in Frage gestellt und wird zum existentiellen Problem.<br />
Einige wichtige Aspekte dieser komplexe Mehrebenen-Problematik sollen thesenhaft <strong>als</strong> Diskursanstöße dargestellt<br />
werden. Die Untersuchung der komplexen Problematik kann nur durch Analyse der sozial-strukturellen Gegebenheiten<br />
vor 1990 erfolgen. Es gilt die gesellschaftlichen Veränderungen bezüglich der Spannbreite von psychosozialen bis<br />
sozial-strukturellen Bezügen in Wechselwirkung zu den ökonomischen Veränderungen im politischen Rahmen abzubilden.<br />
In gesellschaftstheoretischer und philosophisch-ethischer Hinsicht lassen sich wichtige Denkanstöße aus einer<br />
intensiveren Analyse der Transformationsprozesse sowohl in Deutschland wie in anderen Ländern Ost- und<br />
Südosteuropas ableiten. Es ist daher kein Zufall, dass die Notwendigkeit, die Transformation und ihre Folgen<br />
gesellschaftlich bewerten und einordnen zu müssen, zu einer Remoralisierung der politischen Diskurse geführt hat.<br />
Dies ist durchaus nicht unproblematisch, da dadurch die Gefahr einer Dominanz irrational-moralistischer Realitätsdeutungen<br />
und Weltbilder wächst. Wechselbeziehungen wie auch tendenzieller gegenseitiger Ausschluss von Gleichheit<br />
und Freiheit lassen sich anhand der Spannungen der Transformationsphase deutlich machen und diskutieren [2] .<br />
Die Problematik dieser Transformation wird besonders deutlich, wenn man sich die Widersprüchlichkeit der<br />
öffentlichen Diskurse über Ursachen, Charakter und Folgen der Veränderungen in Ostdeutschland vor Augen hält. Die<br />
Diskussion springt undifferenziert und unvermittelt zwischen der moralisierenden Diskursebene, die vor allem auch der<br />
Vermeidung einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem politischen und gesellschaftlichen System der DDR dient,<br />
und der Betonung ökonomischer Defizite und Strukturprobleme in den „Neuen Bundesländern“ hin und her. Gerade<br />
diese Beurteilungsunsicherheit verhindert eine distanzierte und rationale Analyse der Entwicklungspotentiale in Ostdeutschland<br />
und im weiteren Sinne auch in den übrigen Transformationsländern Ost- und Südosteuropas. Dabei wird<br />
oftm<strong>als</strong> verdrängt, dass die ökonomischen Strukturprobleme in Transformationsregionen nicht nur Folge von Fehlentwicklungen<br />
in den vorherigen ökonomisch-politischen Systemen sind, sondern Steuerungs- und Entwicklungsprobleme<br />
einer sich globalisierenden kapitalistischen Weltwirtschaft deutlicher hervortreten lassen <strong>als</strong> in den traditionellen<br />
industriellen Zentren der Weltökonomie [3] . Es daher kaum weiter, nur die äußerlichen Mechanismen neuer<br />
Investitionen, die Rolle der Treuhandgesellschaft, die Überforderung von Mitarbeitern, den Missbrauch staatlicher<br />
Subventionen bis hin zu verschiedenen Formen der Vereinigungskriminalität etc. aufzuzeigen oder die in der Alltagswahrnehmung<br />
<strong>als</strong> ‚Zerschlagung‘ großer Kombinate, dem ‚Plattmachen‘ ganzer Industriezweige etc. darzustellen.<br />
Die Wende der Jahre 1989/90 in Deutschland, die das Ende der DDR bedeutete, ist in einen längerfristigen globalen<br />
Prozess einzuordnen. Sie steht im Zusammenhang mit den Transformationsprozessen und dem politischen<br />
Systemwandel in der damaligen Sowjetunion und den übrigen RGW- und WPO-Staaten. Diese Transformation ist<br />
wiederum eingebunden in grundlegende Strukturänderungen in der Weltwirtschaft, die sich mit dem Begriff der<br />
„Globalisierung“ verbinden. Dadurch ergaben sich veränderte Interessenlagen der Großmächte, die Veränderungen im<br />
Ost-West-Verhältnis bewirkten, d.h. das Ende der Konfrontation im „Kalten Krieg“, das sich bereits in den OSZE-<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 79
Vereinbarungen abzeichnete. Die Dominanz der Kategorie der „Wende“ in der Beschreibung der Transformationsprozesse<br />
in Ostdeutschland wird nur verständlich in der zeitlichen Fixierung auf eine „Bruchstelle“, <strong>als</strong> die in<br />
Deutschland der Zeitpunkt der Vereinigung von BRD und DDR wahrgenommen wird, die aber in diesem Zusammenhang<br />
inhaltlich letztlich <strong>als</strong> „fiktiv“ anzusehen ist. In historischer Perspektive gilt dieses kritische Diktum mehr<br />
oder weniger wohl auch für Wahrnehmung der Transformationsprozesse in Osteuropa, die fokussiert wird vor allem auf<br />
die erstmalige Wahl nichtkommunistischer, „bürgerlicher“ Regierungen in den mit der Sowjetunion „verbrüderten“<br />
Staaten wie auch schließlich auf die zeitlich exakt zu terminierende formale Auflösung von RGW, WPO und schließlich<br />
der UdSSR selbst.<br />
Die ursächliche Verknüpfung und Gleichzeitigkeit dieser einschneidenden politischen Entscheidungen lässt sowohl in<br />
der Eigenwahrnehmung wie in der Weltöffentlichkeit die Vorstellung einer abrupten Wende entstehen, was für die gesellschaftlichen<br />
und sozio-ökonomischen Grundstrukturen durchaus nicht in der postulierten Weise zutrifft. Es ist auch<br />
zu prüfen, ob das Bild der „Wende“ machtpolitisch funktionalisiert wurde und damit eine bestimmte Interessenperspektive<br />
repräsentiert, inwieweit <strong>als</strong>o zum Beispiel die Gewohnheit, von einer „friedlichen Revolution“ zu sprechen,<br />
frühzeitige Instrumentalisierungsversuche der westdeutschen politischen Klasse darstellt.<br />
Doch sollte dies <strong>als</strong> Selbstverständnis der aktiv werdenden DDR-Opposition 1989/90 nicht <strong>als</strong> von geringer Bedeutung<br />
angesehen werden. Ein durchaus revolutionärer Impetus zielte zunächst keineswegs auf die „nationale Einheit“ sondern<br />
auf den demokratischen inneren, gesellschaftlich-politischen Wandel.<br />
Erst in westdeutscher Perspektive wird die „friedliche Revolution“ zu einem Beschwichtigungs-Etikett für den in<br />
zentralen Bereichen ausbleibenden gesellschaftlich-politischen Wandel. Es handelt sich dabei auch um den Versuch,<br />
durch Vereinnahmung dieses – zweifellos eminent bedeutenden – Vorgangs psychische Machtmittel gegenüber der<br />
politischen Klasse in der ehemaligen DDR in die eigene Hand zu bekommen, die in den langfristigen politischen<br />
Auseinandersetzungen mit dem politischen Gegner eingesetzt werden können. Für die Bevölkerung, deren Stimmung<br />
bald nach der Euphorie des Herbstes 1989, kurz nach dem 9. November 1989 in die Ahnung der Depression umschlägt,<br />
scheint dieser gewollte Wandel der Realitätssicht in psychischen Stabilisierungsversuchen zu bestehen. Diese wurde<br />
umso vordringlicher, <strong>als</strong> die Bürger der DDR wahrnahmen, dass die „Wende-Anforderung“ zur Anpassung und<br />
Erneuerung und zur „fundamentalen Umstellung“ der ökonomisch-politischen Umwelt allein ihnen zugemutet wurde,<br />
nicht aber, wie erhofft und gefordert, <strong>als</strong> Erneuerungsforderung und -chance von allen Bürgern der „neuen Bundesrepublik“,<br />
<strong>als</strong>o auch der der „alten Bundesländer“, verstanden worden ist. Es geht somit auch darum, dass an die Stelle der<br />
Vereinigung, wie sie im Grundgesetz der BRD mit dem Gebot einer Verfassungsdiskussion verbunden war, der Beitritt<br />
getreten war und die Forderung nach einem „gemeinsamen Neuanfang“ von der politischen Klasse der BRD von<br />
vornherein abgeblockt wurde.<br />
Während sich die ökonomischen Daten in den Neuen Bundesländern nach dem ökonomischen Zusammenbruch 1990/91<br />
langsam aber stetig wieder verbessern, sind die psycho-sozialen Begleitwirkungen, die subjektiven Realitätssichten der<br />
Bürger dieser Bundesländer nach wie vor problematisch und eher durch negative Zukunftsperspektiven gekennzeichnet.<br />
Allein aus den objektiven ökonomischen Veränderungen heraus lässt sich dies kaum erklären und findet auch keine<br />
entsprechenden Parallelen in den benachbarten Transformationsländern wie Ungarn, Polen oder Tschechien, in denen<br />
trotz aller objektiven Probleme durchaus eine zukunftsoffene und optimistische Stimmung vorherrscht. Dabei zeigt es<br />
sich, dass die Hauptrichtung der gesellschaftlich-ökonomischen Entwicklung in allen Transformationsländern durchaus<br />
nicht <strong>als</strong> abrupte Richtungsumkehr sondern eher <strong>als</strong> längst notwendig gewordene Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen<br />
und <strong>als</strong> Modernisierungsschub bewertet werden kann. Die typischen Probleme in den neuen Bundesländern<br />
liegen auf der Bewusstseinsebene, wo die Dissonanzerfahrung zwischen der bisherigen Realitätswahrnehmung<br />
und -deutung in der DDR und der euphemistisch-populistischen Selbstdarstellung der BRD durch die Erfahrung der<br />
Diskrepanz zwischen „westlichem Glücksversprechen“ und gesellschaftlicher Realität in der BRD vertieft und erweitert<br />
wird.<br />
Dies ist zu verstehen auch auf dem Hintergrund der permanenten Propaganda in der DDR nach der erzwungenen und<br />
nahezu hermetischen Abgrenzung gegenüber dem Westen Deutschlands nach dem 13. August 1961 – an dem einerseits<br />
der ökonomische Zusammenbruch mit physischen Gewaltmitteln zunächst verhindert, aber doch über die lange<br />
Stagnationsphase der Breschnew-Ära letztlich nur hinausgezögert wurde, andererseits aber eine notwendige und an veränderte<br />
Realitäten anpassende zivilisatorische Fortentwicklung, insbesondere die eines reflexiven gesellschaftlich-politisch<br />
wirkungsvollen Zivilisationsprozesses, wie sie der 68-er Umbruch in der BRD darstellte, verhindert wurde.<br />
Vergleichbare Modernisierungsschübe westlicher Industrie-Länder wurden in den RGW-Ländern nur in Ansätzen<br />
vollzogen. Der enge Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen und ökonomischen Modernisierungsprozessen wird<br />
gerade im Vergleich der Entwicklungen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR in den siebziger Jahren<br />
erkennbar. Der zivilisatorische Modernisierungsschub, der sich eher zu plakativ mit dem Etikett der 68-er Reformen<br />
kennzeichnen lässt und der zu tief greifenden und letztlich irreversiblen Erneuerungen im gesellschaftlichen<br />
Bewusstsein, dem Rechtssystem und in den Wertvorstellungen der Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik<br />
Deutschland manifestierte, hatte auch ökonomische Ursachen in der Erfahrung, dass das die Bundesrepublik Deutschland<br />
anfänglich legitimierende „Wirtschaftswunder“ seine strukturellen Entwicklungsgrenzen erreicht hatte. Folge war<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 80
daher sowohl eine Bildungs- und Qualifikationsinitiative [4] <strong>als</strong> auch eine grundlegende ökonomische Modernisierung<br />
der westdeutschen Wirtschaft [5] .<br />
Die mangelnde Fähigkeit der DDR in den siebziger und achtziger Jahren zur grundlegenden ökonomischen Modernisierung,<br />
bei der sie tendenziell noch von Polen und Ungarn in den Schatten gestellt wurde, hat daher nicht nur<br />
wirtschaftsstrukturelle und steuerungspolitisch-systemische Ursachen, sondern ist ebenso bedingt durch die immanente<br />
gesellschaftlich-politische Unfähigkeit zur inneren Reformen und die allgemeine Stagnation des öffentlichen Lebens,<br />
auf die sich der bekannte Ausspruch Gorbatschows zum 40. Jahrestag der DDR bezog.<br />
Die Organisation der Volkswirtschaft der DDR wurde nicht nach Kriterien wie Effizienz, Rationalisierung, Knappheits-<br />
Prinzip, technischer Qualitätsoptimierung strukturiert. Daran zeigte sich auch das Unvermögen der Wirtschaftswissenschaften<br />
der DDR, über Marxistische Apologetik hinaus die internationalen empirischen und theoretischen<br />
Entwicklungen der westlichen Volks- und Betriebswirtschaftslehre zu rezipieren und, gegebenenfalls auch kritisch, zu<br />
evaluieren und umzusetzen. Ausgenommen von diesen Modernisierungsrückständen war höchstens der von der UdSSR<br />
dominierte Rüstungssektor, der aber dennoch zu wenig selbst technologisch innovativ war sondern im Rahmen intensiver<br />
‚Blaupausen‘-Spionage und nachvollziehender Orientierung an westlichen Rüstungs- und Technologiestandards<br />
mögliches Investiv- und Qualifikations-Kapital in erheblichem Maße band und von der allgemeinen wirtschaftlichen<br />
Entwicklung abzog [6] . Doch auch dieser Sektor war durch seine politische Bevorzugung und Förderung nicht in der<br />
Lage, Strategien des Umgangs mit knappen Ressourcen zu erarbeiten [7] .<br />
Der Wechsel von extensiver Ausbeutung der Arbeitskraft zur intensiven und letztlich intelligenten Ausnutzung von<br />
human capital, wurde in der DDR wie in den anderen RGW-Staaten nicht erreicht. Er war durch Zementierung<br />
geltender Staatsdoktrinen blockiert und dadurch verhindert worden. So erfolgte mit dem Ende der DDR die<br />
„Demaskierung“ einer bislang in der Rangfolge der Industrie-Länder hoch eingeordneten Volkswirtschaft. Diese auch<br />
im Westen verbreitete Fehleinschätzung der ökonomischen Potentiale der DDR war vor allem auch bewirkt worden<br />
durch die nicht vergleichbaren statistischen Bewertungsmaßstäbe, durch manipulierte Statistiken, eine verschleierte<br />
Außenverschuldung (ca. 80 Mrd. DDR-Staatsschulden) und das zwar <strong>als</strong> positiv eingeschätzte, aber nur unter den<br />
spezifischen Bedingungen (scheinbar) wirtschaftlich funktionierende Binnensystem, das, wie die Ereignisse von 1989<br />
zeigen, strukturell instabil und nicht hinreichend legitimiert war.<br />
Auch in den Neuen Bundesländern ist das Aufeinanderstoßen antagonistischer wirtschaftlicher Paradigmen zu einem<br />
Entwicklungshemmnis geworden, was eben gerade nicht eine Auseinandersetzung von Sozialismus und Kapitalismus<br />
bedeutet, sondern sich auf die Bewertung der Produktionsfaktoren – Arbeit, Produktionskapital, Flächenverbrauch –<br />
sowie auf die Verwendung und rationelle wie auch verschwenderische Nutzung von Rohstoffen und Energie bezieht<br />
und die Konsequenzen aus dem Knappheitspostulat ziehen muss.<br />
Auch die im Selbstverständnis der DDR und teilweise noch in der politischen Klasse der Neuen Bundesländer positiv<br />
bewerteten Errungenschaften des Sozialismus im sozialen und gesellschaftlichen Bereich müssen heute kritisch gesehen<br />
werden, weil sie einerseits notwendige Modernisierungsprozesse verhindert haben und andererseits <strong>als</strong> funktionalisierte<br />
Machtmittel eher zur Stabilisierung der Herrschaftsverhältnisse <strong>als</strong> zur Verbesserung der realen Lebensbedingungen der<br />
Bewohner der DDR beigetragen haben. Der dominierende Versorgungsstaat griff – gewollt – tief in die tradierten<br />
gesellschaftlichen Strukturen ein, ohne letztlich das Ziel einer „neuen Gesellschaft“ tatsächlich erreichen zu können.<br />
Ebenso wie die scheinbar positive Frauen- und Jugendpolitik diente der Versorgungsstaat letztlich <strong>als</strong> Mittel<br />
kurzfristigen psycho-sozialen Ausgleichs. Das gesellschaftlich-politische System der DDR, so wird in brutaler Deutlichkeit<br />
klar, diente insgesamt der herbeizuführenden Ruhigstellung einer psychisch-politischen Repressionen unterworfenen<br />
DDR-Bevölkerung.<br />
Hier trifft sich die Krisen-Diagnose wieder auf die schon erörterten Modernisierungsdefizite gegenüber den in anderen<br />
Industrieländern seit den 70-er Jahren wichtig werdenden emanzipatorischen Strömungen, der Herausbildung selbst<br />
organisierter Bürgerinitiativen und den Bestrebungen zu Entwicklung einer Zivilgesellschaft [8] . Auch dieses sind wieder<br />
langfristige, sich auch an globalen Prozessen orientierende Anpassungs- und Modernisierungsnotwendigkeiten gewesen.<br />
In der DDR jedoch wirkte der Entwicklung differenzierenden politischen Bewusstseins der staatsdominierte<br />
Versorgungsstaat ebenso entgegen wie die Dominanz des Block- sowie Freund-Feind-Denkens. Das politische Selbstverständnis<br />
der DDR-Führung blieb tief in den staatsgesellschaftlichen Vorstellungen des 19. Jahrhunderts verhaftet<br />
und kämpfte längst obsolet gewordene politische Konflikte aus.<br />
Die Mechanismen der staatszentrierten Herrschaft in der DDR, in der Macht abgesichert wurde sowohl durch die<br />
Steuerung der Ökonomie und zugleich die Verfügung über die individuelle wirtschaftlich-finanzielle Machtquellen der<br />
Werktätigen, d.h. die Löhne und Renten, <strong>als</strong> auch mit restriktiven und repressiven Steuerungsinstrumenten z.B. bei der<br />
Wohnungsvergabe, der Arbeits- und Ausbildungsplatz-Steuerung, bis hin zur Zuordnung der Urlaubsorte, konnten zwar<br />
im Alltag der Werktätigen entlastend, pazifizierend im Sinne des „nicht selbst entscheiden Müssens“ wirken, erweisen<br />
sich aber ökonomisch <strong>als</strong> dysfunktional, erst recht nach der „Wende“ unter den Bedingungen einer freier Leistungskonkurrenz.<br />
Politische Steuerungen, die allesamt über Versprechen, Durchführen oder Versagen entsprechender Umsetzungen<br />
wirken, sind tradierte Machtmittel von Herrschaft.<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 81
Eine gewichtige Hypothek stellte die Abwanderung von leistungsbereiten und -fähigen mittelschichtenorientierten<br />
Binnenmigranten aus der SBZ/DDR seit dem Kriegsende dar. Bei der gesellschaftlichen Integration in das vereinte<br />
Deutschland stellten insbesondere die damit verbunden Defizite bei der Herausbildung einer ökonomisch oder<br />
intellektuell aktiven Mittelschicht <strong>als</strong> Träger gesellschaftlicher und ökonomischer Entwicklung ein Hemmnis und<br />
Problem dar. Dieser Prozess des „brain drain“ von Ost nach West findet unter den Bedingungen der Transformation in<br />
den Jahren nach der „Wende“ seine Fortsetzung. Ostdeutschlands erleidet nach der Vereinigung beider deutscher Staaten<br />
vor allem durch die ökonomische Sogwirkung des Einkommens- und Chancengefälles einen deutlichen Abfluss<br />
leistungsbereiter und besonders leistungsfähiger, oftm<strong>als</strong> Schlüsselfunktionen innehabender Arbeitskräfte.<br />
Das negative Gegenstück zu dieser Ost-West-(Binnen-)Migration in Deutschland ist der temporäre Zuzug von<br />
„Investoren“ – besser: Immobilienspekulanten und ‚Abschreibungs‘-Künstlern – aus wohlhabenden Kreisen Westdeutschlands<br />
und aus anderen bisher <strong>als</strong> kapitalistisch bezeichneten Ländern in die östlichen Bundesländer, die oftm<strong>als</strong><br />
vor allem an persönlichen Gewinnen durch kurzfristige Kapitalverwertung oder Vernichtung potentieller Konkurrenten<br />
interessiert waren. Das hatte gravierende ökonomische wie sozialpsychologische Wirkungen auf die – an den Traditionen<br />
der DDR-Werktätigen orientierte – Bevölkerung Ostdeutschlands, die meist mit Hilflosigkeit und Resignation<br />
reagierte. Durch diesen doppelten konfliktreichen Kontakt, der sich in den Migrationen ausdrückt, baut sich eine neue<br />
negative und aggressive Stereotypebene auf, die die alten Stereotypmuster überlagert, aber nicht restlos verdrängt, so<br />
dass wiederum intrapersonale Dissonanzerfahrungen zur Verunsicherung und zur aggressiven Abwehr des „Fremden“<br />
und „Neuen“ beitragen.<br />
Frauen haben in besonderem Maße die Folgen der Transformation getragen durch Verlust ihrer bezahlten Arbeitsplätze<br />
und der aus Erwerbstätigkeit entstandenen Identitäten. Zugleich hat die in der Transformationsphase erzwungene<br />
Modernisierung aber Kräfte freigesetzt, Chancen zu ergreifen und neue Tätigkeitsfelder zu besetzen.<br />
Die Situation – insbesondere qualifizierter Frauen in den Transformationsländern – entspricht einem tragischen Spannungsverhältnis.<br />
Viele Frauen können die Spannung zwischen ihrem ehem<strong>als</strong> hohen Leistungsanteil, ihrer Leistungsfähigkeit<br />
und -bereitschaft einerseits, verbunden mit geglaubten Emanzipationschancen durch den Sozialismus und die<br />
Einbindung in die Funktionalität von Herrschaftsausübung durch Systemstabilisierung andererseits nicht verarbeiten.<br />
Die Rolle von Frauen wurde in den RGW-Ländern niem<strong>als</strong> langfristig und prinzipiell definiert sondern erfolgte ad hoc<br />
durch propagandistisch begleitete Lenkungsentscheidungen, die sämtlich nicht verbunden waren mit originärem individuellen<br />
wie kollektiven Machtgewinn, wirklichem Machtzuwachs sowie Verfügungsgewalt über eine erhöhte<br />
finanzielle Basis durch Statussteigerung.<br />
Ihr Leistungswille kann nur in wenigen Ausnahmen in ihrer neuen ökonomisch herabgesetzten Situation umgesetzt<br />
werden und führt vielfach zu psychischen und sozialen Bewältigungsproblemen. Diese können auch nicht durch<br />
objektive Kriterien wie Einbeziehung in die Altersversorgung auf der Basis von Durchschnittseinkommen über die<br />
Arbeitslosenversicherung und andere Sozialversicherungssysteme kompensiert werden. Oftm<strong>als</strong> überlagert eine den<br />
erlernten und verinnerlichten Bewertungsmustern entstammende Alltagswahrnehmung die Transformationsproblematik<br />
und ist verbunden mit durchaus positiver Einschätzung der individuellen Entwicklung aber negativer Sicht der<br />
gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, einem Phänomen, das zunehmend auch charakteristisch wird für die Gesellschaftsbilder<br />
in den westlichen Bundesländern und <strong>als</strong> eine der Ursachen von „Entpolitisierung“ und „<strong>Politik</strong>verdrossenheit“<br />
anzusehen ist.<br />
Eine erhebliche Weichenstellung ist <strong>als</strong> politisch gewollt, nicht aber <strong>als</strong> Folge gesellschaftlicher Diskurse und<br />
parlamentarischer Entscheidungsprozesse erfolgt: die <strong>als</strong> ‚Geldumtausch‘ im Verhältnis 1 : 1 (bzw. 2 : 1) wahrgenommene,<br />
aber durch die Bundesregierung trotz erheblicher Warnungen von Wirtschafts- und Finanzexperten durchgesetzte<br />
‚Zwangs‘-aufwertung der DDR-Mark. Eine Chance auf einen längerfristigen gleitenden Übergang durch Aufrechterhaltung<br />
durchaus erfolgreicher Produktionssektoren war dadurch verhindert worden. Durch einen dem Markt überlassenen<br />
Wechselkurs hätten vermutlich erhebliche Verschwendungen von Investivkapital vermieden werden können.<br />
Diskutiert werden kann in diesem Zusammenhang die Polarität zwischen keynesianischen (nachfrageorientierten) und<br />
neoliberalen (angebotsorientierten) Ansätzen von Wirtschaftspolitik.<br />
Insgesamt reiht sich die Transformation von der DDR zum vereinigten Deutschland des Jahres 2000 ein in eine Vielzahl<br />
langfristiger und wesentlich ungesteuerter Veränderungen von Gesellschaften. Grundlegende Veränderungen der<br />
gesellschaftlichen Entwicklung sind nicht intendierten oder gezielten Entscheidungen der politischen Klasse zuzuordnen.<br />
Transformationsprozesse sind vielschichtige, z.T. diskontinuierliche, widersprüchliche, mit gegenläufigen<br />
Unterströmungen unterfütterte gesellschaftliche Phasen, die nur mit „Mehrebenenmodellen“ der Realität rational und<br />
wissenschaftlich beschrieben werden können. „Erfolge“ sind letztlich keine objektiven Entitäten, sondern Bewertungen<br />
auf der Bewusstseinsebene, die selbst dem Transformationsprozess unterworfen sind. Sie sind deshalb auch nicht<br />
personalisierbar. Als Schlüsselperson kann im konkreten Fall zwar – wenn, dann mit Einschränkungen – Michael<br />
Gorbatschow genannt werden, doch setzt diese Einschätzung eine gründlichere und differenzierte Betrachtung der<br />
Transformation der UdSSR voraus. Hier ist dann das historische Paradoxon an den Abschluss zu stellen, dass zwar Geschichte<br />
von und durch handelnde oder nicht handelnde Personen gemacht und von Personen erlitten und ertragen wird,<br />
dass aber die Reduktion auf das Handeln einzelner Personen die komplexen sozialpsychologischen Bedingtheiten, die<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 82
das Leben jeder Person bestimmen, nicht hinreichend einbezogen werden, so dass im Mittelpunkt einer Geschichtsbetrachtung,<br />
vor allem wenn es um historische Bruchstellen handelt, ein dialektisches Verhältnis personalen<br />
Handelns und Leidens und struktureller, prozessualer Bedingungen und Bedingtheiten stehen muss.<br />
Die wenn auch thesenhaft verkürzte Analyse der „Wende“ wirft somit eine Reihe von grundsätzlichen sozialwissenschaftlichen<br />
Problemen auf, die entweder <strong>als</strong> Urteils- oder <strong>als</strong> Frageperspektiven verstanden oder <strong>als</strong> Schichten<br />
eines Mehrebenenmodells die historisch-gesellschaftliche Realität in einen komplexen Zusammenhang gestellt werden<br />
können, was <strong>als</strong> Anstoß für eine vertiefende Beschäftigung mit dieser Problematik aufgefasst werden soll:<br />
Die „Wende“ ist in erster Linie ein Bewusstseinsphänomen, eine neue historiographische Kategorie [9] , die ein Bild der<br />
Realität konstruiert und repräsentiert.<br />
Transformationsprozesse sind uneindeutig und widersprüchlich; dominanten – „sichtbaren“ – Strömungen laufen<br />
„verdeckte“, aber nicht weniger wirksame, Unterströmungen zuwider; ihre Bewertung und Wahrnehmung <strong>als</strong> Realität<br />
erfolgt durch gesellschaftliche Diskurse.<br />
Die Frage einer historischen Notwendigkeit des „Wendeprozesses“ ist ein ex-post-Konstrukt, das zu einer Reorganisation<br />
des historischen Bildes der DDR wie der BRD aus der Perspektive gegenwärtiger Entwicklungen und<br />
Interessen führt.<br />
Der Topos der „verpassten Chance“ polarisiert West und Ost und auch die politische Klasse Deutschlands durch den<br />
Verweis darauf, dass die Deutsche Einheit nicht Neubeginn für alle, sondern „Wendezumutung“ nur für die einen war<br />
und der für die „Wiedervereinigung“ konzipierte Verfassungsauftrag weitgehend negiert wurde.<br />
Die Erfahrung, dass die Transformationsprozesse – in einem über die Nation hinausreichenden Kontext – materielle<br />
und kategoriale Geschichtsdeutungen auflösen, steht auch im Zusammenhang heutiger philosophischer Konzepte einer<br />
Geschichtsauffassung, die Realität in erster Linie <strong>als</strong> Bewusstseins-, Wahrnehmungs- und Diskursphänomene, daher <strong>als</strong><br />
„Konstrukt“ oder „Repräsentation“ versteht. Diese Auflösung banaler Sicherheit führt in der gesellschaftlichen Praxis<br />
zu einer Betonung des ethischen Dilemmas der „Wende“, dass die Kosten des Modernisierungsprozesses dem<br />
Gerechtigkeitspostulat zuwider laufend verteilt sind. Dies ist die nachvollziehbare Erklärung für die sozialwissenschaftlich<br />
zu beklagende „Remoralisierung“ der „Wende-Diskurse“, die einleitend schon angesprochen wurde.<br />
Anmerkungen:<br />
[1]<br />
[2]<br />
[3]<br />
[4]<br />
Eine erste Fassung dieser Thesen erscheint in »politik unterricht aktuell« Heft 1/2001, Hrsg. vom Verband der<br />
<strong>Politik</strong>lehrer (VdP).<br />
Es ist daher kein Zufall, wenn in anderen historischen Kontexten Transformationsprozesse im Zusammenhang mit<br />
der Entstehung und Herausformung der modernen Staatsgesellschaften gleichermaßen durch den Primat<br />
moralischer Diskurse zu kennzeichnen sind, was ein Beleg für die dominante gesellschaftliche Verunsicherung<br />
und den Verlust traditionaler Realitätsbewältigungsmuster zu verstehen ist. Historische Exempel finden sich in<br />
der Geschichte der Französischen Revolution (Wert-Diskussionen im „Wohlfahrtsausschuss“ wie auch die<br />
politische Legitimierung Robespierres), in den nationalistisch-moralisierenden Diskursen der „bürgerlichen<br />
Staatenbildung“ in Deutschland im 19. Jahrhundert wie auch in der Moralisierung der Öffentlichkeit in<br />
krisenhaften Schwellenländern wie der Türkei (Islamismus-Kontroverse) oder in der Islamischen Revolution in<br />
Iran. Vgl. dazu auch Voigt, Gerhard, 2002: Zur Begriffsbestimmung von „Staat“ und „Staatsgesellschaft“.<br />
Anmerkungen zur begrifflichen Differenzierung. In: Voigt, Gerhard, Hrsg., 2001: „Staatsgesellschaft“. Historischsozialwissenschaftliche<br />
Beiträge zur Diskussion von Entwicklungen, Problemen und Perspektiven. Schriftenreihe<br />
des UNESCO-Clubs für die UNESCO-Schule am Maschsee, Bismarckschule Hannover, e.V.<br />
Vgl. dazu die Diskussion über die Weltsystemtheorie nach Wallerstein [Wallerstein, Immanuel, 1974: The Modern<br />
World-System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century.<br />
New York, und folgende Bände, wie auch Wallerstein, Immanuel, 1995: Die Sozialwissenschaft ‚kaputtdenken‘.<br />
Die Grenzen der Paradigmen des 19. Jahrhunderts. Weinheim].<br />
Die Ergebnisse dieser Umorientierung des bundesdeutschen Bildungsumbruches werden vor dem Hintergrund<br />
neuer Transformationskrisen zum Ende des Jahrtausends zunehmend wieder in Frage gestellt. Doch was sich<br />
äußerlich <strong>als</strong> konservativer Rückschritt zu Bildungsvorstellungen der 50-er Jahre darstellen mag, ist im Kern die<br />
richtige Einsicht, dass ein erneuter bildungspolitischer Paradigmenwechsel notwendig geworden ist, der sich in<br />
den öffentlichen Diskursen noch nicht ausreichend konturiert aber in grundsätzlichen bildungspolitischen<br />
Initiativen evoziert wird. Vgl. dazu u.a. den Aufsatz von Bernhard Claußen: Problemorientierte Politische<br />
Bildung für Menschen würdiges Überleben durch materielle Demokratie, soziale Gerechtigkeit und ökologische<br />
Verantwortung: Überlegungen zu einer theoretischen Plattform, in: Claußen, Bernhard, u.a. (Hrsg.), 2001: Krise<br />
in der <strong>Politik</strong> – Politische Bildung in der Krise? Glienicke/Berlin und Cambridge/Mass: 465-504. Unter gleichem<br />
Titel auch veröffentlicht in »politik unterricht aktuell«, Heft 1/2000 / Supplement. – Weitere Überlegungen zu<br />
diesem notwendigen Paradigmenwechsel auch in Gerhard Voigt: Politische Bildung in der Gegenwartsepoche:<br />
Krisenbefunde <strong>als</strong> Grundlage und Paradigmenwechsel <strong>als</strong> Perspektive, in Claußen, ebenda: 331-462.<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 83
[5]<br />
[6]<br />
[7]<br />
[8]<br />
[9]<br />
Wesentliche Elemente dabei waren eine Neubestimmung des Verhältnisses von technischer Innovation und neue<br />
Evaluierung des Humankapit<strong>als</strong>, wie es sich in neuen Gewerkschaftsstrategien ebenso wie in den Gesetzen zur<br />
erweiterten Mitbestimmung ausdrücken ließ. Erst durch diese Modernisierung wurde die westdeutsche Wirtschaft<br />
vorbereitet auf die zunehmende Integration in die heutigen Globalisierungsprozesse. Die Schritte der europäischen<br />
Integration waren dabei ein „Übungsfeld“ für weltwirtschaftliche Anpassungsprozesse, die sich zunehmend auch<br />
auf die Anpassung der gesellschaftlichen Lebensverhältnisse an die neuen ökonomischen Herausforderungen<br />
erstrecken mussten.<br />
Es wäre sinnvoll, hier die kritische Auseinandersetzung mit dem „militärisch-ökonomischen Komplex“ in Ost und<br />
West in den siebziger und achtziger Jahren aufzuarbeiten und für eine zeitgeschichtliche Systemkritik fruchtbar zu<br />
machen.<br />
Die katastrophale ökonomische Lage z.B. der russischen Streitkräfte, die menschliche und politische Katastrophen<br />
nach sich zieht, ist eine unmittelbare Folge dieses Bewusstseinsdefizits und der allgemeinen Unfähigkeit vieler<br />
Transformationsländer, ökonomisches Denken nicht nur technokratisch sondern grundsätzlich <strong>als</strong> gesellschaftliche<br />
Rationalität im Umgang mit ökonomischen Realitäten zu verstehen.<br />
Vgl. dazu Bernhard Claußen: Zivilgesellschaft im Kontext von <strong>Politik</strong> und Bildung. Fachliche und didaktische<br />
Konturen einer sozialwissenschaftlichen Analyse zum Demokratisierungsprozess moderner Staatswesen, in:<br />
Historisch-sozialwissenschaftliche Beiträge zur Diskussion von Entwicklungen, Problemen und Perspektiven.<br />
Forum Politologie und Soziologie Band 9. Glienicke/Berlin und Cambridge/Mass.<br />
Dieser Begriff bezieht sich auf die aktuelle Diskussion in der Geschichtswissenschaft, in wie weit grundlegende<br />
Einteilungs- und Deutungskategorien für geschichtliche Ereignisse und Zeitabschnitte (z.B. „Epochen“) eine<br />
eigene tatsächliche Realität besitzen („Entitäten“ sind), oder ob sie <strong>als</strong> Konstrukte der Historiographie oder der<br />
Geschichtsphilosophie bestimmte Auffassungen von der Realität der Geschichte repräsentieren und damit gegebenenfalls<br />
Geschichte erst ex post entstehen lassen. So wie es die Frage ist, ob die „Renaissance“ <strong>als</strong> solche<br />
überhaupt eine sinnvolle Realität repräsentiert, oder ob sie erst durch die Historiker durch die Bezeichnung selbst<br />
„erschaffen“ worden ist, so stellt sich in unserem Zusammenhang nachdrücklich die Frage, ob es tatsächlich eine<br />
zeitgeschichtliche Realität gegeben hat oder gegeben hätte, auf die die Bezeichnung „Wende“ zweifelsfrei zutrifft,<br />
oder ob die Beschreibung der Ereignisse von 1989/90 mit der Kategorie „Wende“ zunächst erst das Bewusstsein<br />
und dann durch das an dieser Realitätsdeutung evozierte gesellschaftliche Handeln im Sinne einer „self-fulfilling<br />
prophecy“ Elemente dieser „Wende-Realität“ geschaffen hat. Hier gilt die sozialpsychologische Einsicht, dass<br />
menschliches Handeln nicht von der Realität bestimmt wird, sondern von dem, was Menschen <strong>als</strong> Realität<br />
ansehen. In so fern ist heute die „Wende“ eine Realität, aber nicht im Sinne einer historischen Realität, sondern<br />
im Sinne einer gesellschaftlichen Realität, mit der eine kritische Auseinandersetzung sinnvoll und notwendig ist.<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 84
Quellen:<br />
Gerhard Voigt: Perspektiven der Politischen Bildung in der Gegenwartsepoche. Krisenbefunde und Paradigmenwechsel<br />
in der Politischen Bildung Überarbeitete und sprachlich revidierte Veröffentlichung einer Manuskriptfassung von<br />
Voigt, Gerhard, 2001: Perspektiven der Politischen Bildung in der Gegenwartsepoche: didaktische und<br />
methodische Akzente für die Praxis <strong>als</strong> Beitrag zur Krisenbewältigung der <strong>Politik</strong>. In: Claußen, Bernhard /<br />
Donner, Wolfgang / Voigt, Gerhard, Hrsg., 2001: Krise der <strong>Politik</strong> – Politische Bildung in der Krise? Diskurse im<br />
Kontext von Globalisierung und Ost-West-Perspektiven. Materialien aus der Zusammenarbeit zwischen der<br />
Akademie für Wirtschaft, <strong>Politik</strong> und Kultur Mecklenburg-Vorpommern und dem Verband der <strong>Politik</strong>lehrenden.<br />
Demokratie und Aufklärung: Kritische Sozialwissenschaften und Politische Bildung im Diskurs – Materialien –,<br />
Band 1. Galda + Wilch Verlag. Glienicke/Berlin / Cambridge/Massachusetts: 331-462. Verwendung mit<br />
Genehmigung der Rechteinhaber. - Internetausgabe 11.07.2011 auf http://www.voigt-bismarckschule.de und<br />
http://www.pu-aktuell.de.<br />
Gerhard Voigt / Lothar Nettelmann: Gleichheit – Freiheit. Zur politischen und didaktischen Problematik kategorialer<br />
Scheingegensätze. Erstfassung: Arbeitspapier vom 26.08.1997 Veröffentlicht in politik unterricht aktuell, Heft<br />
1/1991. Hannover, 1996. Herausgeber: Verband der <strong>Politik</strong>lehrer e.V., Hannover<br />
Erweiterte Fassung eines Beitrages aus: Claußen, Bernhard / Zschieschang, Susann, Hrsg., 2002: <strong>Politik</strong> –<br />
Bildung – Gesellschaft. Studien zur exemplarischen Verhältnisbestimmung in sozialgeschichtlicher und<br />
zeitdiagnostischer Perspektive. Für Wolfgang Lobeda zum 70. Geburtstag. Demokratie und Aufklärung. Kritische<br />
Sozialwissenschaften und Politische Bildung im Diskurs – Materialien –. Band 2. Glienicke/Berlin /<br />
Cambridge/Massachusetts. Galda + Wilch Verlag: 629-646. – Verwendung mit Genehmigung der Rechteinhaber.<br />
– Internetausgabe 11.07.2011 auf http://www.voigt-bismarckschule.de<br />
Nettelmann, Lothar / Voigt, Gerhard: Thesen zur „Wende“. Probleme der Wahrnehmung, Bewertung und Bewältigung<br />
sozio-ökonomischer Transformationsprozesse. Eine erste Fassung dieser Thesen erscheint in »politik unterricht<br />
aktuell« Heft 1/2001, Hrsg. vom Verband der <strong>Politik</strong>lehrer (VdP).<br />
Neuausgabe <strong>als</strong> Sonderheft von <strong>Politik</strong> <strong>Unterricht</strong> <strong>Aktuell</strong> 2011 »Krise der <strong>Politik</strong> – Krise der Politischen<br />
Bildung«<br />
in der Internet-Version auf http://www.pu-aktuell.de<br />
Verantwortlich für diese Publikation: Gerhard Voigt, OStR i.R. (seit 2009).<br />
Veröffentlicht in politik unterricht aktuell, Sonderheft 2011. Hannover, 2012. Printausgabe für Bibliotheken –<br />
pua ISSN 0945-1544.<br />
Herausgeber: Verband der <strong>Politik</strong>lehrer e.V., Hannover. Vorsitzender: Gerhard Voigt, OStR i.R. (seit 2009),<br />
eMail: bismarckschule.voigt@gmx.de, http://www.voigt-bismarckschule.de.<br />
Internetausgabe http://pu-aktuell.de/pua2011-Krisenbefunde/p011_inx.htm 12.07.2011<br />
durchgesehene <strong>PDF</strong>-Edition 23.01.2012<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 85
Inhalt<br />
Gerhard Voigt: Perspektiven der Politischen Bildung ..................................................................................................... 1<br />
in der Gegenwartsepoche Krisenbefunde und Paradigmenwechsel in der Politischen Bildung ....................................... 1<br />
1. Das Bewusstsein, krisenhafte Umbrüche zu erleben .................................................................................... 1<br />
1.1 Das Ende der Gegenwart ........................................................................................................................................ 1<br />
1.2 Zur Psychologie der Krisenwahrnehmung ........................................................................................................... 1<br />
1.3 Krise, Realitätsdefinition und Wertordnung ........................................................................................................ 2<br />
1.4 Zur begrifflichen Bestimmung der Wahrnehmung des »Zerfalls der Gesellschaft« und des »Zerfalls der gültigen<br />
Wertnormen« ........................................................................................................................................................... 3<br />
1.5 Anmerkungen zu den gegenwärtigen Problemen der Theorie und Rezeption des Krisenbegriffs [14] ..................... 5<br />
2. Veränderungen der Situation des Politischen <strong>Unterricht</strong>es ............................................................................ 7<br />
2.1 Der Erfahrungshintergrund ................................................................................................................................. 7<br />
2.2 Gesellschaftliche Rahmenbedingungen ............................................................................................................... 8<br />
2.21 Phasen des Wandels der Zielparadigmen der Politischen Bildung ........................................................................... 8<br />
2.22 Veränderungen in der Schülerschaft ....................................................................................................................... 9<br />
2.23 Lehrersituation und Schulinstitution ..................................................................................................................... 12<br />
3. Notwendiger Paradigmenwechsel der <strong>Politik</strong>didaktik ................................................................................ 13<br />
3.1 Widerständigkeit statt auf Nationsmythen fixierte Affirmation ......................................................................... 13<br />
3.2 Diskursorientierte didaktische Konzepte ........................................................................................................... 14<br />
3.3 Das traditionelle Beharrungsvermögen im Selbstverständnis von Fachlehrerinnen und Fachlehrern ................. 17<br />
4. »Schlüsselprobleme« <strong>als</strong> gesellschaftliche Diskursfelder............................................................................ 18<br />
4.1 Probleme der curricularen Eignung des Konzeptes der »Schlüsselprobleme« .................................................... 18<br />
4.2 Zum Theorie-Praxis-Problem ............................................................................................................................ 21<br />
4.3 Diskurs »Gerechtigkeit, Ungleichheit, Wertewandel« [69] ................................................................................... 23<br />
4.4 Diskurs »Individualisierung, Gewalt, Soziabilität« ............................................................................................ 27<br />
4.5 Diskurs »Zivilisation, Gesellschaft, Staat« ........................................................................................................ 33<br />
4.51 Die Problematik eines »unübersichtlichen Diskurses« ................................................................................. 33<br />
4.52 Die aktuelle Bedeutung des Diskurses über Zivilisation und Höflichkeit ..................................................... 34<br />
4.521 Zivilisation und Alltagsverhalten – Das Alltägliche und das Besondere« ................................................... 34<br />
4.522 Didaktische Zwischenbemerkungen .......................................................................................................... 35<br />
4.523 Die Zivilisation im Staatenbildungsprozess: Ein problematisches Wahrnehmungsfeld .............................. 37<br />
4.53 Zur heutigen sozialgeschichtlichen Problematik der Soziogenese der „Höflichkeit“ .................................... 37<br />
4.54 Das Problem der Dezivilisierung ................................................................................................................. 41<br />
4.6 Diskurs »Universalisierung, Globalisierung, Ökonomisierung« ........................................................................ 43<br />
5. Anmerkungen zu den Konsequenzen für die <strong>Unterricht</strong>spraxis .................................................................... 45<br />
6. Anmerkungen zu den Konsequenzen für die Ausbildung und Qualifikation der <strong>Politik</strong>lehrerschaft .................... 50<br />
6.1 Modellvorstellungen für die universitäre Lehrerausbildung ............................................................................... 50<br />
6.2 Permanente Fort- und Weiterbildung ................................................................................................................ 53<br />
Literatur..................................................................................................................................................................... 56<br />
Anmerkungen ................................................................................................................................................... 62<br />
Gerhard Voigt / Lothar Nettelmann: Gleichheit – Freiheit ............................................................................................ 75<br />
Zur politischen und didaktischen Problematik kategorialer Scheingegensätze .................................................... 75<br />
Gleichheit ............................................................................................................................................ 76<br />
Freiheit................................................................................................................................................ 76<br />
Anmerkungen ....................................................................................................................................... 77<br />
Lothar Nettelmann und Gerhard Voigt: Thesen zur „Wende“ ....................................................................................... 79<br />
Probleme der Wahrnehmung, Bewertung und Bewältigung sozio-ökonomischer Transformationsprozesse ............. 79<br />
Anmerkungen: ...................................................................................................................................... 83<br />
Quellen: ....................................................................................................................................................................... 85<br />
Inhalt ........................................................................................................................................................................... 86<br />
politik unterricht aktuell 1/2011 Seite 86
politik unterricht aktuell Heft 1/2011<br />
Herausgeber: Gerhard Voigt<br />
Redaktion: Dr. Lothar Nettelmann<br />
Mitteilungen aus dem Verband der <strong>Politik</strong>lehrer e.V.<br />
» Krise der <strong>Politik</strong> – Krise der Politischen Bildung«<br />
Beiträge:<br />
Gerhard Voigt:<br />
Perspektiven der Politischen Bildung in der<br />
Gegenwartsepoche. Krisenbefunde und<br />
Paradigmenwechsel in der Politischen Bildung.<br />
Überarbeitete und sprachlich revidierte Veröffentlichung<br />
einer Manuskriptfassung<br />
Gerhard Voigt / Lothar Nettelmann:<br />
Gleichheit – Freiheit. Zur politischen und didaktischen<br />
Problematik kategorialer Scheingegensätze. Erstfassung:<br />
Arbeitspapier vom 26.08.1997<br />
Nettelmann, Lothar / Voigt, Gerhard:<br />
Thesen zur „Wende“. Probleme der Wahrnehmung,<br />
Bewertung und Bewältigung sozio-ökonomischer<br />
Transformationsprozesse.<br />
Hannover, 2012 ISSN 0945-1544 Internetpublikation / Print on demand