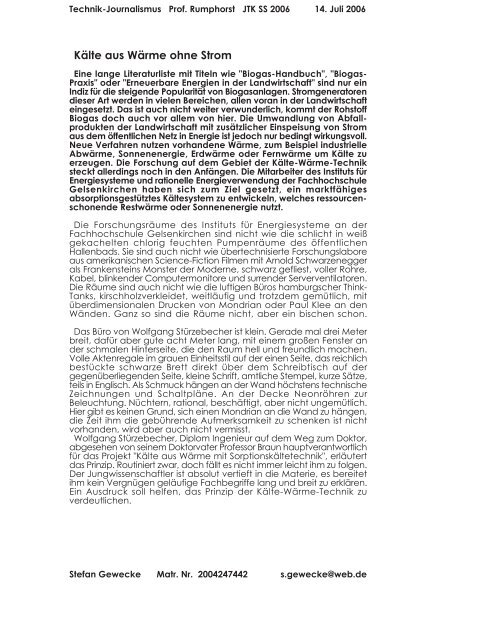Kälte aus Wärme ohne Strom - Gewecke, Stefan
Kälte aus Wärme ohne Strom - Gewecke, Stefan
Kälte aus Wärme ohne Strom - Gewecke, Stefan
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Technik-Journalismus Prof. Rumphorst JTK SS 2006 14. Juli 2006<br />
<strong>Kälte</strong> <strong>aus</strong> <strong>Wärme</strong> <strong>ohne</strong> <strong>Strom</strong><br />
Eine lange Literaturliste mit Titeln wie "Biogas-Handbuch", "Biogas-<br />
Praxis" oder "Erneuerbare Energien in der Landwirtschaft" sind nur ein<br />
Indiz für die steigende Popularität von Biogasanlagen. <strong>Strom</strong>generatoren<br />
dieser Art werden in vielen Bereichen, allen voran in der Landwirtschaft<br />
eingesetzt. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, kommt der Rohstoff<br />
Biogas doch auch vor allem von hier. Die Umwandlung von Abfallprodukten<br />
der Landwirtschaft mit zusätzlicher Einspeisung von <strong>Strom</strong><br />
<strong>aus</strong> dem öffentlichen Netz in Energie ist jedoch nur bedingt wirkungsvoll.<br />
Neue Verfahren nutzen vorhandene <strong>Wärme</strong>, zum Beispiel industrielle<br />
Abwärme, Sonnenenergie, Erdwärme oder Fernwärme um <strong>Kälte</strong> zu<br />
erzeugen. Die Forschung auf dem Gebiet der <strong>Kälte</strong>-<strong>Wärme</strong>-Technik<br />
steckt allerdings noch in den Anfängen. Die Mitarbeiter des Instituts für<br />
Energiesysteme und rationelle Energieverwendung der Fachhochschule<br />
Gelsenkirchen haben sich zum Ziel gesetzt, ein marktfähiges<br />
absorptionsgestütztes <strong>Kälte</strong>system zu entwickeln, welches ressourcenschonende<br />
Restwärme oder Sonnenenergie nutzt.<br />
Die Forschungsräume des Instituts für Energiesysteme an der<br />
Fachhochschule Gelsenkirchen sind nicht wie die schlicht in weiß<br />
gekachelten chlorig feuchten Pumpenräume des öffentlichen<br />
Hallenbads. Sie sind auch nicht wie übertechnisierte Forschungslabore<br />
<strong>aus</strong> amerikanischen Science-Fiction Filmen mit Arnold Schwarzenegger<br />
als Frankensteins Monster der Moderne, schwarz gefliest, voller Rohre,<br />
Kabel, blinkender Computermonitore und surrender Serverventilatoren.<br />
Die Räume sind auch nicht wie die luftigen Büros hamburgscher Think-<br />
Tanks, kirschholzverkleidet, weitläufig und trotzdem gemütlich, mit<br />
überdimensionalen Drucken von Mondrian oder Paul Klee an den<br />
Wänden. Ganz so sind die Räume nicht, aber ein bischen schon.<br />
Das Büro von Wolfgang Stürzebecher ist klein. Gerade mal drei Meter<br />
breit, dafür aber gute acht Meter lang, mit einem großen Fenster an<br />
der schmalen Hinterseite, die den Raum hell und freundlich machen.<br />
Volle Aktenregale im grauen Einheitsstil auf der einen Seite, das reichlich<br />
bestückte schwarze Brett direkt über dem Schreibtisch auf der<br />
gegenüberliegenden Seite, kleine Schrift, amtliche Stempel, kurze Sätze,<br />
teils in Englisch. Als Schmuck hängen an der Wand höchstens technische<br />
Zeichnungen und Schaltpläne. An der Decke Neonröhren zur<br />
Beleuchtung. Nüchtern, rational, beschäftigt, aber nicht ungemütlich.<br />
Hier gibt es keinen Grund, sich einen Mondrian an die Wand zu hängen,<br />
die Zeit ihm die gebührende Aufmerksamkeit zu schenken ist nicht<br />
vorhanden, wird aber auch nicht vermisst.<br />
Wolfgang Stürzebecher, Diplom Ingenieur auf dem Weg zum Doktor,<br />
abgesehen von seinem Doktorvater Professor Braun hauptverantwortlich<br />
für das Projekt "<strong>Kälte</strong> <strong>aus</strong> <strong>Wärme</strong> mit Sorptionskältetechnik", erläutert<br />
das Prinzip. Routiniert zwar, doch fällt es nicht immer leicht ihm zu folgen.<br />
Der Jungwissenschaftler ist absolut vertieft in die Materie, es bereitet<br />
ihm kein Vergnügen geläufige Fachbegriffe lang und breit zu erklären.<br />
Ein Ausdruck soll helfen, das Prinzip der <strong>Kälte</strong>-<strong>Wärme</strong>-Technik zu<br />
verdeutlichen.<br />
<strong>Stefan</strong> <strong>Gewecke</strong> Matr. Nr. 2004247442 s.gewecke@web.de
Technik-Journalismus Prof. Rumphorst JTK SS 2006 14. Juli 2006<br />
Eine DinA4-Seite, querformat, mit dicken Linien und jeder Menge "Ms"<br />
und "Zs". Das "M" steht als Symbol für den Kühler, die Außenseite des<br />
Systems. Gasförmiger Dampf wird eingeleitet und umstreicht ein<br />
Rohrgeflecht durch welches die um ein paar Grad kühlere Außenluft<br />
fließt. Der Dampf kondensiert. Die abgeführte <strong>Wärme</strong> wird als<br />
überschüssige Energie nach Außen abgeführt. Das Kühlmittel fließt in<br />
den Verdunster. Für ihn steht das "Z". Hier findet der umgekehrte Prozess<br />
statt: Der kühle, flüssige Stoff wird eingeleitet, durch ein getrenntes<br />
Rohrsystem kommt die warme Luft <strong>aus</strong> dem Kühlh<strong>aus</strong> hinzu, gibt ihre<br />
<strong>Wärme</strong> ab und verlässt den Verdunster gasförmig. Die dabei<br />
entstandene kühle Luft wird zurück ins Kühlh<strong>aus</strong> geleitet. Im Kreislauf<br />
hinter dem Verdampfer sitzt ein Kompressor, der das gasförmige<br />
Kühlmittel verdichtet und dabei stark erwärmt. Dieses warme Gas wird<br />
wieder in den Kühler geleitet, der Kreislauf ist geschlossen.<br />
Im Prinzip ist das ein großer Kühlschrank, und wie jeder Kühlschrank<br />
verbraucht er haufenweise Energie. Die Energie braucht vor allem der<br />
Kompressor, der das Gasgemisch verdichtet. Er ist es auch, der bei den<br />
heimischen Kühlschränken den Lärm verursacht. Diese Energie wird bei<br />
unseren Kühlschränken <strong>aus</strong> dem <strong>Strom</strong>netz genommen.<br />
Bei Biogasanlagen werden verschiedene Rohstoffe, wie Gülle,<br />
Klärschlamm, Fette oder Pflanzen in einen luftdicht verschlossenen<br />
Fermenter eingebracht. Dort entsteht durch Fäulnisprozesse das Biogas.<br />
Die Fermenter sind oft größer als 100 Kubikmeter. Das sind die großen<br />
schwarzen Kuppeln, die man in der Nähe von Bauernhöfen sieht, die<br />
eine Biogasanlange betreiben. Das Gas wird mit etwas Sauerstoff <strong>aus</strong><br />
der Luft angereichert und dient als Treibstoff für einen<br />
Verbrennungsmotor. Der produzierte <strong>Strom</strong> wird in das <strong>Strom</strong>netz<br />
eingespeist und kann ganz normal verwendet werden. Auch die <strong>Wärme</strong>,<br />
die der Verbrennungsmotor erzeugt, soll im günstigsten Fall nicht einfach<br />
an die Umwelt abgegeben werden, sondern zum Trocknen von Stroh<br />
als Futter für die Tiere und zum Heizen verwendet werden. Anlagen,<br />
die heutzutage im Einsatz sind generieren bei einer Effizienz von circa<br />
40 Prozent zwischen 30 Kilowatt bis zu fünf Megawatt <strong>Strom</strong>. Damit<br />
könnten zehn 4-Personenh<strong>aus</strong>halte oder eben der Kompressor eines<br />
Kühlh<strong>aus</strong>es von einem Bauernhof mit <strong>Strom</strong> versorgt werden.<br />
Wir verlassen das Büro des Doktoranden. Vor der Tür erwartet uns eine<br />
Dreiergruppe chinesischer Studentinnen, die auf der Suche nach<br />
Professor Braun sind. In nicht ganz akzentfreiem aber effizienten deutsch<br />
kommt die Frage im Chor: "Ist hiel Plofessol Blaun?" Nein, der ist gerade<br />
nicht da, auf Dienstreise. Es geht hinab in den Keller des Instituts, der<br />
Sorptionstechnik auf den Grund.<br />
Bei der Sorptionstechnik muss der Bereich zwischen Verdampfer und<br />
Kompressor genauer betrachtet werden, wir zoomen ein. An dieser<br />
Stelle befindet sich nämlich der Absorber. Der Absorber wird mit einem<br />
Gemisch <strong>aus</strong> Ammoniak und Wasser betrieben. Anfänglich ist das<br />
Ammoniak-Wasser-Gemisch eine sogenannte "Starke" Mischung. Der<br />
Ammoniakanteil liegt bei 45 Prozent. Das flüssige Gemisch wird mit<br />
<strong>Stefan</strong> <strong>Gewecke</strong> Matr. Nr. 2004247442 s.gewecke@web.de
Technik-Journalismus Prof. Rumphorst JTK SS 2006 14. Juli 2006<br />
einer kleinen Pumpe in den Desorber, eine Art Kocher, gepumpt. Hier<br />
wird von Außen <strong>Wärme</strong> zugefügt. Das kann Sonnenwärme, Fernwärme,<br />
Abwärme, Erdwärme oder irgendeine Art von <strong>Wärme</strong> sein, die zur<br />
Verfügung steht. Wichtig dabei ist, dass diese <strong>Wärme</strong> nicht erst extra<br />
produziert werden muss, sondern schon vorhandene <strong>Wärme</strong> genutzt<br />
wird. Die Temperatur sollte mindestens 90 Grad Celsius betragen. Hierbei<br />
wird das Ammoniak vom Wasser getrennt. Das Wasser bleibt flüssig,<br />
das Ammoniak ist nun gasförmig. Im angeschlossenen Kondensator<br />
wird das Ammoniak wieder verflüssigt, und gibt dabei seine <strong>Wärme</strong><br />
ab. Dieser Effekt wird in herkömmlichen Systemen durch den Kompressor<br />
erreicht. Die nun "schwache" Mischung <strong>aus</strong> Ammoniak und Wasser im<br />
Verhältnis 40 zu 60 Prozent fließt zurück in den Absorber. Dieser<br />
Energiekreislauf ist als eigenes System innerhalb des Kreislaufes von<br />
vorher zu betrachten. Sozusagen ein Kühlschrank im Kühlschrank. Der<br />
Vorteil hierbei ist aber, dass die kleine Pumpe, die die "starke" Ammoniak-<br />
Wasser-Mischung vorwärts bewegt, mit nur einem Zehntel der Energie<br />
betrieben werden muss, die der Kompressor in dem herkömmlichen<br />
System benötigt. Die antreibende Kraft dieses Systems ist die zusätzliche<br />
<strong>Wärme</strong> von Außen.<br />
Ein Prototyp der Absorptionskältemaschine existiert bereits. Sie wurde<br />
von Prof. Braun und dem Dresdener Institut für Luft- und <strong>Kälte</strong>technik<br />
realisiert. Geplant ist der Bau einer weiteren, leistungsfähigeren Maschine,<br />
wie so oft fehlen dafür momentan noch die Gelder. Die WestLB-Bank<br />
unterstützt das Projekt. Die deutsche Industrie verfolgt die Forschung<br />
mit Interesse, könnte sich die neue Technologie doch zu einem<br />
Exportschlager entwickeln. Ziel könnte ist es, vor allem für den<br />
südeuropäischen Markt <strong>Wärme</strong>-<strong>Kälte</strong>-Maschinen mit einer angestrebten<br />
Leistung von 25 Kilowatt zu bauen. Vor allem sonnenreiche Länder<br />
zeigen großes Interesse an der neuen Technik. Hier ist der Bedarf an<br />
Kühlung größer und die Primärenergie, <strong>Wärme</strong> ist reichlich vorhanden.<br />
Die neuen Maschinen können <strong>aus</strong> der Ferne per ISDN-Leitung oder<br />
über das Internet kontrolliert werden, wodurch wiederum Personal zu<br />
Überwachungs- und Wartungszwecken gespart werden kann.<br />
Das ist aber nicht der Traumjob, den sich Wolfgang Stürzebecher<br />
vorstellt. In seiner Unruhe spürt man den Forscherdrang. Er möchte<br />
Forschen und Entwickeln, die Technik verbessern und vorantreiben.<br />
Vielleicht als Doktor in der Geschäftsführung eines Betriebes für <strong>Kälte</strong>-<br />
<strong>Wärme</strong>-Maschinen. Momentan gilt es jedoch von dem kleinen Büro<br />
<strong>aus</strong> Geld aufzutreiben. Dazu muss jede Menge Papierkram erledigt,<br />
Anträge geschrieben, und Überzeugungsarbeit geleistet werden.<br />
Auf einmal ist das kleine Büro wieder nur ein Büro mit vielen<br />
Aktenordnern, Zetteln und leeren Anträgen die noch <strong>aus</strong>gefüllt oder<br />
<strong>aus</strong>formuliert werden müssen. R<strong>aus</strong> <strong>aus</strong> der <strong>Wärme</strong> der sparsamen und<br />
ressourcenschonenden Zukunft, rein in die kalte Realität.<br />
<strong>Stefan</strong> <strong>Gewecke</strong> Matr. Nr. 2004247442 s.gewecke@web.de