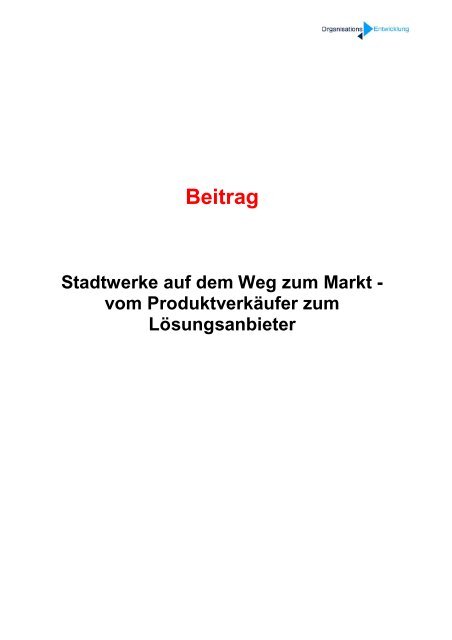Produktverkäufer zum Lösungsanbieter - Gerd-friese.de
Produktverkäufer zum Lösungsanbieter - Gerd-friese.de
Produktverkäufer zum Lösungsanbieter - Gerd-friese.de
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Beitrag<br />
Stadtwerke auf <strong>de</strong>m Weg <strong>zum</strong> Markt -<br />
vom <strong>Produktverkäufer</strong> <strong>zum</strong><br />
<strong>Lösungsanbieter</strong>
Stadtwerke auf <strong>de</strong>m Weg <strong>zum</strong> Markt –<br />
vom <strong>Produktverkäufer</strong> <strong>zum</strong> <strong>Lösungsanbieter</strong><br />
Kommt ein gestresster Mann zu Ihrem Stadtwerk und<br />
fragt vorsichtig im „Frontsi<strong>de</strong>-Office“ nach einem Antrag<br />
auf Baustromversorgung. Dieser wird ihm, verbun<strong>de</strong>n<br />
mit ein paar freundlichen Worten, umgehend ausgehändigt.<br />
Einen schönen Tag noch, wünscht <strong>de</strong>r<br />
„Frontsi<strong>de</strong>-Office-Mitarbeiter“ (FOM) und freut sich über<br />
<strong>de</strong>n unkomplizierten Kun<strong>de</strong>n.<br />
Wer selbst einmal ein Haus gebaut hat, <strong>de</strong>r<br />
weiß, dass dies ein sehr anspruchsvolles<br />
Abenteuer ist und eine Menge graue Haare<br />
bescheren kann. Ist man nicht dankbar<br />
über je<strong>de</strong> Hilfe, die man dabei bekommen<br />
kann?<br />
Warum also fragt <strong>de</strong>r FOM nicht gezielt nach<br />
weiteren Wünschen und Vorstellungen, nach vorhan<strong>de</strong>nen<br />
Sorgen und Nöten, wenn <strong>de</strong>r Kun<strong>de</strong><br />
schon direkt ins Haus kommt? Ein guter Serviceberater<br />
wür<strong>de</strong> das tun. Stellen Sie sich doch einmal<br />
die Überraschung vor, wenn Sie <strong>de</strong>m Kun<strong>de</strong>n<br />
anbieten, Teile o<strong>de</strong>r auch die gesamte<br />
Organisation <strong>de</strong>s Hausbaus einschließlich <strong>de</strong>r<br />
Lieferung von Energie und Energieträgern zu<br />
übernehmen!<br />
Wenn Sie jetzt anmerken, dass dieses Vorgehen in Ihrem Stadtwerk schon<br />
längst gängige Praxis ist, dann haben Sie unsere größte Hochachtung.<br />
Sie setzen das um, was wir als Kun<strong>de</strong>n schon lange von Ihnen erwartet<br />
haben!<br />
„Wir sind Dienstleister für die Bürger<br />
und die Wirtschaft <strong>de</strong>r Region“!<br />
© Dr. <strong>Gerd</strong> Friese 2010
Stadtwerke auf <strong>de</strong>m Weg <strong>zum</strong> Markt –<br />
vom <strong>Produktverkäufer</strong> <strong>zum</strong> <strong>Lösungsanbieter</strong><br />
TRENDENTWICKLUNG<br />
1. Die Ergebnisse <strong>de</strong>r Delphi-Befragung <strong>de</strong>r Accenture GmbH 2007<br />
Anmerkung: Entsprechend unseres Hauptthemas konzentrieren wir uns dabei auf die Inhalte, welche im direkten<br />
Zusammenhang mit <strong>de</strong>r Verän<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>s Marktes (Kaufverhalten <strong>de</strong>r Kun<strong>de</strong>n) und <strong>de</strong>n daraus resultieren<strong>de</strong>n Ansätzen zur<br />
Anpassung <strong>de</strong>r Marketingstrategie stehen.<br />
Zukunftserwartung II: Technologischer Paradigmenwechsel<br />
Energienahe Dienstleistungen<br />
Der Energieverbrauch pro Kopf wird<br />
zurückgehen und <strong>de</strong>r steigen<strong>de</strong> Anteil<br />
erneuerbarer Energien die konventionelle<br />
Erzeugung mehr und mehr verdrängen. Aus<br />
<strong>de</strong>m technologischen Paradigmenwechsel<br />
ergeben sich aber auch Marktchancen,<br />
insbeson<strong>de</strong>re im Bereich <strong>de</strong>r energienahen<br />
Dienstleistungen und <strong>de</strong>r <strong>de</strong>zentralen<br />
Energieerzeugung. Davon wer<strong>de</strong>n Stadtwerke,<br />
Regionalversorger und spezialisierte<br />
Anbieter stärker profitieren, als die großen<br />
Energiekonzerne. Im Gegenzug wer<strong>de</strong>n die<br />
Energiekonzerne <strong>zum</strong>in<strong>de</strong>st versuchen, <strong>de</strong>n Konsens <strong>zum</strong> Ausstieg aus <strong>de</strong>r Kernenergie zu<br />
än<strong>de</strong>rn.<br />
Zukunftserwartung III: Differenzierter Wettbewerb<br />
Kontinuierliche Intensivierung <strong>de</strong>s Wettbewerbs<br />
Aufgrund anhalten<strong>de</strong>r politischer Bemühungen und eines sich verän<strong>de</strong>rn<strong>de</strong>n<br />
Verbraucherverhaltens wird die jährliche Wechselrate <strong>de</strong>r Haushaltskun<strong>de</strong>n zu einem neuen<br />
Stromlieferanten von durchschnittlich ca. 1% zwischen <strong>de</strong>n Jahren 1999 und 2006<br />
kontinuierlich auf 5 bis 10% im Jahr 2015 ansteigen.<br />
Die Wechselbereitschaft von Haushaltskun<strong>de</strong>n wird auch<br />
künftig vor allem durch <strong>de</strong>n Preis bestimmt, allerdings<br />
wer<strong>de</strong>n an<strong>de</strong>re Faktoren, z. B. Servicequalität, Image und<br />
Vertriebskanal etwas an Be<strong>de</strong>utung zulegen.<br />
Der Großteil <strong>de</strong>r befragten Experten erwartet gleichbleiben<strong>de</strong><br />
o<strong>de</strong>r sinken<strong>de</strong> Margen im Strommarkt. Für <strong>de</strong>n<br />
Gasmarkt hingegen geht eine klare Mehrheit aufgrund <strong>de</strong>r<br />
Intensivierung <strong>de</strong>s Wettbewerbs von sinken<strong>de</strong>n Margen aus.<br />
Bun<strong>de</strong>sweit wer<strong>de</strong>n sich etwa fünf bis zehn Strommarken im<br />
Privatkun<strong>de</strong>nsegment etablieren können. Auf je<strong>de</strong>n Fall<br />
aber wird die wachsen<strong>de</strong> preisliche und ökologische Sensibilisierung <strong>de</strong>r Verbraucher das<br />
Verfolgen einer Einmarkenstrategie erschweren.<br />
Durchsetzung neuer Produkte<br />
10 bis 20% <strong>de</strong>r möglichen Haushaltskun<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n in Zukunft ein echtes Kombiprodukt<br />
„Strom und Gas“ nutzen. Der Marktanteil von reinen Öko-Strom-Produkten wird sich<br />
verfünffachen. Das Angebot an energienahen Dienstleistungen wird immer be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>r<br />
wer<strong>de</strong>n.<br />
© Dr. <strong>Gerd</strong> Friese 2010 1
DIE REAKTION<br />
1. Das rational orientierte Vorgehen <strong>de</strong>r Stadtwerke<br />
Energienahe Dienstleistungen galten bisher als Kostentreiber! Jedoch entwickeln sie sich<br />
zunehmend zu einem strategischen Wettbewerbsinstrument, das zur eigentlichen<br />
Differenzierung am Markt beiträgt und in naher Zukunft vielleicht die Rolle <strong>de</strong>s<br />
Hauptumsatzträgers übernimmt. Diese Erkenntnis setzt sich mehr und mehr durch.<br />
Diejenigen, die diese Strategien aber umsetzen sollen, stehen vor fast unlösbaren Aufgaben.<br />
Wie erkläre ich meinem Kun<strong>de</strong>n, dass die Dienstleistung, welche<br />
gestern noch kostenlos o<strong>de</strong>r im Produktpreis integriert war, nun<br />
plötzlich voll verrechnet wird? Wie erkläre ich meinen<br />
Mitarbeitern, dass Dienstleistungen ebenso wichtig sind, wie die<br />
Kernprodukte? Wieviel kostet mich eigentlich die Erbringung<br />
dieses o<strong>de</strong>r jenes Services? Dazu kommt die Komplexität eines<br />
professionellen Dienstleistungsmanagements. Es gilt sowohl<br />
Lösungsmanagement<br />
Der Kun<strong>de</strong>nnutzen sollte<br />
im Mittelpunkt stehen!<br />
kulturelle, organisatorische als auch technische Fragestellungen in integrierter Weise<br />
anzugehen.<br />
Kaum ein Stadtwerk nutzt heute schon das volle Potenzial einer dienstleistungsgestützten<br />
Marktbearbeitung. Vielmehr führen fehlen<strong>de</strong> Metho<strong>de</strong>n und Instrumente <strong>zum</strong> professionellen<br />
Ausbau <strong>de</strong>s Dienstleistungsmanagements im Sinne einer zielgerichteten Planung,<br />
Gestaltung sowie Kommerzialisierung zu einem unfokussierten und kostenintensiven<br />
„Dienstleistungsdschungel“! Trotz<strong>de</strong>m ist dieser Weg unumkehrbar. In Anlage 1 stellen wir<br />
Ihnen eine erfolgreich eingesetzte Verfahrensweise vor.<br />
2. Die emotional geprägten Erwartungen <strong>de</strong>r Kun<strong>de</strong>n<br />
Unsere Kultur nötigt uns, je<strong>de</strong> Minute <strong>de</strong>s Tages über unsere Wünsche nachzu<strong>de</strong>nken. Für<br />
die meisten von uns bleibt die Antwort ein Mysterium. Warum das so ist? Weil sich die<br />
Wünsche und Bedürfnisse <strong>de</strong>r Menschen in letzter Zeit immer schneller verän<strong>de</strong>rt haben. Sie<br />
haben sich auf eine an<strong>de</strong>re Ebene verlagert. Wir haben es nicht bemerkt, viel weniger noch<br />
sind wir darauf vorbereitet.<br />
Während wir gebannt auf die großen Verän<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>r Außenwelt schauen, hat sich<br />
die wahre Revolution in unserem Inneren abgespielt. Die be<strong>de</strong>utendste Verän<strong>de</strong>rung in<br />
diesem Zeitalter ist die Transformation <strong>de</strong>r Natur <strong>de</strong>s Menschen, die bei <strong>de</strong>r elementarsten<br />
aller Realitäten beginnt, <strong>de</strong>m menschlichen<br />
Überlebensinstinkt, <strong>de</strong>r Quelle aller Wünsche, Ängste und<br />
Lei<strong>de</strong>nschaften.<br />
Beziehungsmanagement<br />
Das Verhalten <strong>de</strong>s Menschen wird von einem Drang nach Die Menschen sehnen sich<br />
innerer Befriedigung beherrscht - einem neuen Grundbedürfnis.<br />
Obwohl es ein friedliches Bedürfnis ist, empfin<strong>de</strong>n<br />
nach Ruhe und Entlastung!<br />
wir es zunehmend als quälend. Es lässt uns keine Ruhe, <strong>de</strong>nn wie je<strong>de</strong>s elementare<br />
Bedürfnis schreit es nach Erlösung. Es reißt uns aus jenen kurzen, gedankenlosen<br />
Momenten im Bus, hinter <strong>de</strong>m Steuer, in <strong>de</strong>r Warteschlange - o<strong>de</strong>r bei einem unserer<br />
Streifzüge durch das endlose Angebot an käuflichen Dingen. Vieles weist darauf hin,<br />
dass es <strong>de</strong>n klassischen Grundbedürfnissen <strong>de</strong>n Rang <strong>de</strong>s stärksten Antriebs<br />
abgelaufen hat. Dieser Drang nach innerer Befriedigung führt zur Entstehung einer völlig<br />
neuen Struktur <strong>de</strong>s menschlichen Austausches, einem neuen Mo<strong>de</strong>ll <strong>de</strong>s Marktes und<br />
zwischenmenschlicher Beziehungen. (2) In Anlage 2 haben wir die Inhalte <strong>de</strong>m klassischen<br />
Vorgehen direkt gegenübergestellt.<br />
Literaturquellen:<br />
(1)<br />
„Zukunftserwartungen über die Entwicklung <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Energiewirtschaft mit Themenschwerpunkt Netze“<br />
Delphi-Befragung 2007 Accenture GmbH<br />
(2)<br />
Unter Nutzung „Melinda Davis, WA(H)RE SEHNSUCHT, Was wir wirklich kaufen wollen“ econ Verlag 2003<br />
© Dr. <strong>Gerd</strong> Friese 2010 2
Anlage 1 Stadtwerke<br />
Vom Produkt zur Lösung – die Unternehmenssicht<br />
Die meisten Unternehmen haben erkannt, dass ihre<br />
Kun<strong>de</strong>n eigentlich nicht an <strong>de</strong>n Eigenschaften ihrer<br />
Produkte interessiert sind, son<strong>de</strong>rn an <strong>de</strong>r Lösung<br />
ihrer ganz individuellen Probleme. Aber genau das ist<br />
das Problem!<br />
Beschreibung<br />
Marketing<br />
<strong>de</strong>r<br />
„Klassischen<br />
Inhalte“<br />
Ein Produkt ist ein Wirtschaftsgut, das in einem Wertschöpfungsprozess<br />
geschaffen wird. Das Produkt wird als ein Leistungspaket<br />
gesehen, mithilfe <strong>de</strong>ssen die umfassen<strong>de</strong> Befriedigung funktionaler<br />
Kun<strong>de</strong>nbedürfnisse erreicht wer<strong>de</strong>n soll.<br />
Eine Lösung ist die zwischen Anbieter und Kun<strong>de</strong> abgestimmte Antwort<br />
auf ein klar <strong>de</strong>finiertes „Kun<strong>de</strong>n“-Problem. Sie bietet eine messbare<br />
Verbesserung seiner aktuellen bzw. zukünftig zu erwarten<strong>de</strong>n Situation.<br />
Frage 1<br />
Wie <strong>de</strong>finieren wir uns als<br />
Unternehmen?<br />
Ansatz<br />
Vom Produktverkauf<br />
<strong>zum</strong><br />
Lösungsangebot<br />
1. Wie än<strong>de</strong>rt sich die Situation unserer Kun<strong>de</strong>n, nach<strong>de</strong>m sie bei uns<br />
gekauft haben?<br />
2. Welcher messbare Unterschied entsteht bei unseren Kun<strong>de</strong>n durch<br />
Nutzung unserer Produkte?<br />
3. Verän<strong>de</strong>rt sich seine Produktivität, wer<strong>de</strong>n seine Kosten gesenkt<br />
o<strong>de</strong>r verbessert sich z. B. sein Image in <strong>de</strong>r Öffentlichkeit?<br />
Frage 2<br />
Wie kommunizieren wir<br />
<strong>de</strong>n Nutzen?<br />
Intelligente<br />
Botschaften zu<br />
Kun<strong>de</strong>n und<br />
Lieferanten<br />
INTERN - Es muss sichergestellt wer<strong>de</strong>n, dass alle Unternehmensteile<br />
<strong>de</strong>n Kun<strong>de</strong>nnutzen im Blickfeld haben. Je<strong>de</strong>r einzelne Mitarbeiter<br />
sollte sich die Frage stellen (und beantworten), welchen Nutzen seine<br />
Tätigkeit für <strong>de</strong>n Kun<strong>de</strong>n hat!<br />
EXTERN - Marktkommunikation und verkäuferische Nutzensargumentation<br />
müssen i<strong>de</strong>ntisch und konsistent sein. In allen -<br />
Verkaufshilfen usw. wird stets auf <strong>de</strong>n Kun<strong>de</strong>n, die Lösungen und<br />
<strong>de</strong>ren Nutzen Bezug genommen.<br />
Frage 3<br />
Wie sieht das<br />
Geschäftsmo<strong>de</strong>ll aus?<br />
Verän<strong>de</strong>rung<br />
<strong>de</strong>r Akquisitonsund<br />
Vertriebsstrategie<br />
1. Welche Zielgruppe hat <strong>de</strong>n größten Bedarf für unsere Lösungen?<br />
2. Können die bestehen<strong>de</strong>n Kun<strong>de</strong>nbeziehungen dazu genutzt wer<strong>de</strong>n,<br />
durch <strong>de</strong>n Lösungsansatz ein neues Geschäft zu generieren?<br />
3. Verfügen wir über eine Han<strong>de</strong>lsstruktur, um <strong>de</strong>n komplexen<br />
Lösungsverkauf überhaupt managen zu können?<br />
4. Wie entwicklen wir unsere „Außendienstler“ zu erfolgreichen<br />
Lösungsverkäufern?<br />
Frage 4<br />
Wie stellen wir sicher,<br />
dass <strong>de</strong>r neue Ansatz<br />
auch gelebt wird?<br />
Transformation<br />
professionell<br />
managen<br />
FÜHRUNG - Die Geschäftsleitung muss <strong>de</strong>n Worten auch Taten<br />
folgen lassen. QUALIFIKATION - Man muss Mitarbeiter mit Erfahrung<br />
im Lösungsverkauf haben. ANREIZ - Prämien sollten sich am Nutzen<br />
orientieren! UNTERSTÜTZUNG - Sie brauchen ein CRM-System,<br />
welches Kun<strong>de</strong>nproblem und angewen<strong>de</strong>te Lösungen systematisch<br />
erfasst und bewertet. KULTUR - Wir sind Weltmeister darin, unsere<br />
Kun<strong>de</strong>n erfolgreicher zu machen!<br />
Zusammenfassung<br />
Marketing<br />
<strong>de</strong>r<br />
„Klassischen<br />
Inhalte“<br />
Produkte und Dienstleistungen sind nur ein Mittel <strong>zum</strong> Zweck, <strong>de</strong>n<br />
Geschäftsgegenstand <strong>de</strong>s Unternehmens erfolgreich im Sinne <strong>de</strong>r<br />
Gesellschafter umzusetzen. Sie können nicht besser sein, als es die<br />
gesetzten Rahmenbedingungen zulassen.<br />
Der Wan<strong>de</strong>l vom <strong>Produktverkäufer</strong> <strong>zum</strong> <strong>Lösungsanbieter</strong> ist nicht auf die<br />
Anpassung <strong>de</strong>r Vertriebsorganisation und das Trainieren von neuen<br />
Verkaufstechniken beschränkt. Es han<strong>de</strong>lt sich dabei um einen<br />
Verän<strong>de</strong>rungsprozess, welcher das gesamte Unternehmen erfasst.<br />
© Dr. <strong>Gerd</strong> Friese 2010 3
Anlage 2 Kun<strong>de</strong>n<br />
Vom Produkt zur Lösung – die Kun<strong>de</strong>nsicht<br />
Die meisten Menschen haben keine Ahnung, was sie<br />
wirklich wollen. Sie können nicht beschreiben, was<br />
sie treibt. Sie spüren nur tief in sich ein Verlangen<br />
dieses „ETWAS“ endlich zu fin<strong>de</strong>n, um innerlichen<br />
Frie<strong>de</strong>n zu erhalten.<br />
Beschreibung<br />
Marketing<br />
<strong>de</strong>r „Neuen<br />
Werte“<br />
In einer immer hektischeren Welt sehnt sich <strong>de</strong>r Verbraucher nach Ruhe<br />
und Entlastung. Es geht darum herauszufin<strong>de</strong>n, was in <strong>de</strong>n Köpfen<br />
und Herzen <strong>de</strong>r Menschen vor sich geht. Das wäre großartig für<br />
unser Leben, großartig für uns selbst und großartig fürs Geschäft.<br />
Wir brauchen das „unbezahlbare Insi<strong>de</strong>rwissen“. Nur so können wir die<br />
großen Verän<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>r Wünsche und Bedürfnisse <strong>de</strong>r Menschen<br />
erkennen, sie verstehen und erfolgreich darauf reagieren!<br />
Wunsch 1<br />
Geschichten statt<br />
„Infoflut“!<br />
Ansatz<br />
Wir erklären<br />
IHNEN die Welt<br />
so, dass SIE<br />
sich wie<strong>de</strong>r<br />
zurechtfin<strong>de</strong>n!<br />
Die Technologie ist <strong>de</strong>r Motor <strong>de</strong>s imaginären Lebens, <strong>de</strong>r uns<br />
gegen unseren Willen in eine an<strong>de</strong>re Realität beför<strong>de</strong>rt. Ihr ist es<br />
zu verdanken, dass unzählige Bil<strong>de</strong>r und Informationen rasend<br />
schnell auf uns nie<strong>de</strong>rprasseln. Es ist eine Invasion in das menschliche<br />
Gehirn. Unser Kopf ist zu einem Hauptbahnhof gewor<strong>de</strong>n,<br />
wo unzählige elektronische Züge verkehren und viele von uns<br />
<strong>de</strong>n Fahrplan schon lange nicht mehr verstehen.<br />
Wunsch 2<br />
Innere Ruhe statt<br />
„Krankhafte Hektik“!<br />
Wir helfen<br />
IHNEN, sich neu<br />
zu orientieren!<br />
Unsere bekannten, soli<strong>de</strong>n Grenzsteine sind verschwun<strong>de</strong>n. Die<br />
alten Konstanten wur<strong>de</strong>n aufgehoben. Das digitale Leben befreit uns<br />
aus <strong>de</strong>n Schranken von Raum und Zeit, doch manchmal empfin<strong>de</strong>n<br />
wir diese Freiheit als Stoß von einer Klippe. Wir fühlen uns überfor<strong>de</strong>rt<br />
in einer Welt, in <strong>de</strong>r selbst die markantesten Orientierungspunkte<br />
ihre Gültigkeit verlieren. Wo ist unser Zentrum, unser retten<strong>de</strong>r<br />
Hafen, unsere Heimatbasis?<br />
Wunsch 3<br />
Individuelle Anerkennung<br />
statt „Graue Masse“!<br />
Wir machen<br />
etwas<br />
Beson<strong>de</strong>res aus<br />
IHNEN!<br />
Image ist das Brot <strong>de</strong>r heutigen Gesellschaft. Luxus gilt als<br />
wesentlicher Bestandteil <strong>de</strong>s Lebens. Früher war <strong>de</strong>r Begriff Luxus<br />
eng mit <strong>de</strong>r klassischen Definition von Korrektheit verbun<strong>de</strong>n. Heute<br />
bringt eher das Neueste das ersehnte Prestige. Gestern war die<br />
„feine Gesellschaft“ <strong>de</strong>r Inbegriff von Prestige, heut geht es darum,<br />
„in“ zu sein. „Ich kaufe das Beste, also bin ich. Ich bin nicht<br />
unsichtbar. Ich gehöre zur Elite.“<br />
Wunsch 4<br />
Rundumversorgung statt<br />
„Unendliche Auswahl“!<br />
Keine Angst, wir<br />
erledigen alles<br />
für SIE!<br />
Die Stun<strong>de</strong> <strong>de</strong>r „Personal Agents“ ist dann gekommen, wenn<br />
sich Menschen heillos überfor<strong>de</strong>rt fühlen. Eine ganz neue<br />
Kategorie von Dienstleistungen wur<strong>de</strong> geschaffen: Jene<br />
persönlichen Berater, Vermittler und Vertreter, <strong>de</strong>nen wir dankbar<br />
eine lange Liste von belasten<strong>de</strong>n Aufgaben übertragen. Sie sind<br />
bereit, unsere persönlichsten Angelegenheiten komplett zu<br />
übernehmen.<br />
Zusammenfassung<br />
Marketing<br />
<strong>de</strong>r „Neuen<br />
Werte“<br />
Unter <strong>de</strong>n vielen Angeboten wählt <strong>de</strong>r Kun<strong>de</strong> heute jene aus, welche <strong>de</strong>r<br />
Befriedigung seiner neuen Grundbedürfnisse dienen. So entstehen<br />
Markttrends. Es wird jedoch klar, dass es nicht genügt, ein paar oberflächliche<br />
Verän<strong>de</strong>rungen an <strong>de</strong>r Marketingstrategie vorzunehmen. Der<br />
neue Instinkt <strong>de</strong>r Kun<strong>de</strong>n erfor<strong>de</strong>rt eine Transformation <strong>de</strong>s Marktes<br />
selbst. Die neue Bedürfniskultur zeichnet nicht nur ein neues Bild<br />
davon, was das Leben zu bieten hat, son<strong>de</strong>rn verlangt auch die<br />
Neu<strong>de</strong>finition einer geeigneten Gegenleistung.<br />
© Dr. <strong>Gerd</strong> Friese 2010 4
Literatur<br />
Agiles Projektmanagement<br />
Werkzeug zur strategischen<br />
Unternehmensentwicklung
Agiles Projektmanagement<br />
Werkzeug zur strategischen Unternehmensentwicklung<br />
Die Verwendung eines “Agilen Managementansatzes” ist immer dann<br />
sinnvoll, wenn man es mit <strong>de</strong>r Bewältigung nicht exakt planbarer<br />
Vorhaben o<strong>de</strong>r nicht vorhersehbarer Ereignisse zu tun hat.<br />
Einführung <strong>zum</strong> Thema<br />
Projektmanagement ist seit seinem Entstehen in <strong>de</strong>n 60er-Jahren von ingenieur- und<br />
systemtechnischen Vorgehensweisen geprägt. Projekte beginnen mit <strong>de</strong>r Ausarbeitung eines<br />
möglichst vollständigen Satzes von Anfor<strong>de</strong>rungen an das zu erarbeiten<strong>de</strong> Ergebnis, die bei<br />
Entwicklungsprojekten in umfangreichen Lastenheften dokumentiert wer<strong>de</strong>n. Daran<br />
schließen sich ein zunächst grober und dann immer weiter verfeinerter systemtechnischer<br />
Entwurf, die Entwicklungs-, Konstruktions- und Montagephase sowie schließlich die<br />
Erprobung und die Freigabe an. Diese, auch als Wasserfallmo<strong>de</strong>ll bekannte,<br />
Vorgehensweise hat aber in <strong>de</strong>r Praxis ihre Schwächen. Die zu Projektbeginn mit großem<br />
Aufwand ermittelten Anfor<strong>de</strong>rungen erweisen sich im weiteren Projektverlauf häufig als<br />
lückenhaft und instabil. Unternehmen, die in einem intensiven Wettbewerb am Markt stehen,<br />
benötigen flexible Mo<strong>de</strong>lle. Ansonsten sind die zur Entwicklung notwendigen Gewinnmargen<br />
nicht mehr zu erzielen. Das Wasserfallmo<strong>de</strong>ll ist auf die Bewältigung sich <strong>de</strong>rartiger schnell<br />
verän<strong>de</strong>rn<strong>de</strong>r Rahmenbedingungen nicht ausgelegt. Deshalb ist diese Methodik vor allem<br />
bei Projekten im Bereich <strong>de</strong>r strategischen Unternehmensentwicklung nicht einsetzbar.<br />
Historie<br />
Die ersten Ansätze zur Entwicklung und <strong>zum</strong> Einsatz flexibler Projektmanagementmetho<strong>de</strong>n<br />
kommen aus <strong>de</strong>m Bereich <strong>de</strong>r schlanken Automobilentwicklung. Dazu zählen beispielsweise<br />
das Simultaneous bzw. Concurrent Engineering, <strong>de</strong>r Target-Costing- bzw. Design-to-Cost-<br />
Ansatz o<strong>de</strong>r das <strong>de</strong>m Spiralmo<strong>de</strong>ll verwandte Stage-Gate-Mo<strong>de</strong>ll, wie sie in Japan bei<br />
Toyota und in Deutschland bei Porsche entwickelt und angewen<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong>n.<br />
Die Softwarebranche griff diese I<strong>de</strong>en <strong>zum</strong> flexiblen Projektmanagement wie<strong>de</strong>r auf und<br />
passte Sie auf ihre Bedürfnisse an. Der Grund dafür war einfach. Viele Kun<strong>de</strong>n waren<br />
schlicht weg überfor<strong>de</strong>rt, ihre Wünsche an ein neues System bereits zu Projektbeginn genau<br />
zu formulieren. Sie wussten nur ungefähr, was sie wollten. Diese angepassten<br />
Vorgehensweisen beruhten auf bekannten iterativen und inkrementellen Ablaufmo<strong>de</strong>llen, bei<br />
<strong>de</strong>nen ein Gesamtsystem in Teilsysteme zerlegt und stückweise Funktionalität hinzugefügt<br />
und verbessert wird. Der Begriff „Agil“ wur<strong>de</strong> jedoch erst durch die spektakulären<br />
For<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>r En<strong>de</strong> 1999 veröffentlichten Extreme-Programming-Metho<strong>de</strong> bekannt.<br />
SCRUM-Metho<strong>de</strong><br />
Der Ablauf agiler Projekte sei an dieser Stelle zunächst am Beispiel <strong>de</strong>r Scrum-Metho<strong>de</strong><br />
ver<strong>de</strong>utlicht. Scrum geht davon aus, dass Entwicklungsprozesse so komplex und dynamisch<br />
sind, dass sie sich im Voraus we<strong>de</strong>r im Ganzen noch in Teilabschnitten sicher planen lassen.<br />
Scrum arbeitet mit einer erfahrungsgeleiteten, empirischen Projektsteuerungsmetho<strong>de</strong>, die<br />
auf verbindliche Planvorgaben verzichtet. Scrum-Projekte wer<strong>de</strong>n dazu in einzelne<br />
Iterationen aufgeteilt. Der Begriff „Scrum“ (= Gedränge) kommt aus <strong>de</strong>m Rugby-Sport. Dort<br />
fin<strong>de</strong>t ein Scrum statt, wenn die Spieler eines Teams eng in einem Knäuel zusammenstehen,<br />
um abzusprechen, wie sie nach <strong>de</strong>m Einwurf möglichst schnell <strong>de</strong>n Ball gewinnen wollen.<br />
Diese Teamabstimmungsmetho<strong>de</strong> wird auf das Projektgeschehen übertragen.<br />
Anmerkung: Da diese Methodik international eingesetzt wird, sind grundsätzlich alle Erläuterungen in englischer<br />
Sprache. In <strong>de</strong>r nachfolgen<strong>de</strong>n Beschreibung <strong>de</strong>r Inhalte haben wir die Begrifflichkeiten versucht so anzupassen,<br />
dass sie ohne Probleme auch von einem bisher Außenstehen<strong>de</strong>n erfasst, interpretiert und benutzt wer<strong>de</strong>n<br />
können.<br />
1
Das Verfahren<br />
Einen bildhaften Überblick über das Verfahren (Summe mehrerer Teilprojekte) und die wichtigsten<br />
Elemente fin<strong>de</strong>n Sie in Anlage 1. Die Zusammenstellung <strong>de</strong>r einzelnen Elemente erfolgte so, dass<br />
<strong>de</strong>n SCRUM-Erkenntnissen weitestgehend Rechnung getragen wur<strong>de</strong>. Der Ablauf stellt sicher, dass<br />
mit einer erfahrungsgeleiteten, empirischen Projektsteuerungsmetho<strong>de</strong> gearbeitet wer<strong>de</strong>n kann, die<br />
auf verbindliche Planvorgaben verzichtet.<br />
Vision und Begeisterung<br />
Der Startpunkt eines je<strong>de</strong>n Projekts ist die Vision. Erst durch eine mitreißen<strong>de</strong><br />
I<strong>de</strong>e wird <strong>de</strong>r Selbstorganisation <strong>de</strong>s Teams Leben eingehaucht. Nur mit ihr hat<br />
das Team ein Ziel, auf das es hinarbeiten kann. Das Fin<strong>de</strong>n, Weitertragen und<br />
Verbreiten <strong>de</strong>r Vision ist Sache <strong>de</strong>s Projekteigners (engl. ProductOwner).<br />
Dabei besteht die Vision nicht aus Details zur technischen Umsetzung, son<strong>de</strong>rn<br />
aus <strong>de</strong>r I<strong>de</strong>e von etwas, von <strong>de</strong>m alle Beteiligten begeistert sind. Zu<strong>de</strong>m muss<br />
aus <strong>de</strong>r Vision klar wer<strong>de</strong>n, welchen Nutzenzugewinn <strong>de</strong>r auftragsgeben<strong>de</strong><br />
Kun<strong>de</strong>, die potenziellen Investoren und die eigene Firma haben.<br />
Arbeitsplanung<br />
Im Projekt-Logbuch (engl. Product Backlog) wer<strong>de</strong>n vor <strong>de</strong>m Start alle<br />
funktionalen und nicht funktionalen Anfor<strong>de</strong>rungen an das zu erreichen<strong>de</strong><br />
Ergebnis grob erfasst. Der Projekteigner zeichnet verantwortlich für die Inhalte,<br />
Priorisierungen <strong>de</strong>r Aufgaben und für die Verfügbarkeit <strong>de</strong>s Projekt-Logbuchs.<br />
Es ist niemals vollständig. Es ist lediglich als eine Ausgangsschätzung <strong>de</strong>r<br />
Anfor<strong>de</strong>rungen zu sehen. Entsprechend entwickelt es sich weiter, so wie sich<br />
auch das angestrebte Projektergebnis und die Umgebung weiterentwickeln.<br />
Das Projekt-Logbuch ist dynamisch; das Firmenmanagement än<strong>de</strong>rt es<br />
kontinuierlich, um zu bezeichnen, welche Anfor<strong>de</strong>rungen für ein gutes Ergebnis<br />
erfor<strong>de</strong>rlich sind, damit dieses Ergebnis zu einer höheren Wettbewerbsfähigkeit führt.<br />
Projektablauf<br />
Nach<strong>de</strong>m in <strong>de</strong>r strategischen Planungsphase ein Projekt-Logbuch erstellt wur<strong>de</strong> und somit<br />
ein grober Ablaufplan besteht, beginnt nun die Implementierungsphase. Innerhalb dieses<br />
Abschnitts wer<strong>de</strong>n alle Aktivitäten ausgeführt, die zur Umsetzung <strong>de</strong>r Anfor<strong>de</strong>rungen<br />
erfor<strong>de</strong>rlich sind. Das Gesamtprojekts wird in mehrere gleichlange Abschnitte, <strong>de</strong>n<br />
Teilprojekten, eingeteilt. In je<strong>de</strong>m dieser Teilprojekte wer<strong>de</strong>n ausgewählte Anfor<strong>de</strong>rungen<br />
abgearbeitet, so dass an <strong>de</strong>ssen En<strong>de</strong> ein nutzbares Ergebnis vom Team abgeliefert wer<strong>de</strong>n<br />
kann. Die beschriebene Dauer eines Teilprojekts von ca. 30 Tagen ist fix. Der daraus<br />
resultieren<strong>de</strong> straffe Zeitplan för<strong>de</strong>rt <strong>de</strong>n Blick auf das Wesentliche, verhin<strong>de</strong>rt Trö<strong>de</strong>leien<br />
und schafft mehr Effizienz bei <strong>de</strong>r Zielerreichung.<br />
Taktische Planung<br />
Bevor das Team jedoch die Arbeit aufnimmt, treffen sich Projekteigner, Coach (engl.<br />
ScrumMaster) und das Team <strong>zum</strong> Meeting. Dieser Workshop liegt im<br />
Verantwortungsbereich <strong>de</strong>s Projekteigners und bedarf einiger wichtiger<br />
Planungen im Voraus. Hierzu gehört neben <strong>de</strong>r Organisation von Termin und<br />
Räumlichkeit vor allem die I<strong>de</strong>ntifizierung <strong>de</strong>s Ziels <strong>de</strong>s kommen<strong>de</strong>n<br />
Arbeitsabschnitts. Dieses Ziel sollte so gewählt wer<strong>de</strong>n, dass es allen<br />
Beteiligten ein klares Verständnis über <strong>de</strong>n Inhalt <strong>de</strong>s kommen<strong>de</strong>n Teilprojekts<br />
gibt und sich mit <strong>de</strong>m Gesamtziel <strong>de</strong>s Projekts vereinbaren lässt. Nach<strong>de</strong>m das<br />
Ziel ausformuliert ist, muss <strong>de</strong>r Projekteigner die zur Erreichung <strong>de</strong>s Ziels<br />
passen<strong>de</strong>n Anfor<strong>de</strong>rungen für das nächste Teilprojekt aus <strong>de</strong>m Projekt-<br />
Logbuch auswählen und weiter <strong>de</strong>taillieren. Hierzu zählen die Anfor<strong>de</strong>rungen<br />
mit höchster Priorität. Wie viel wirklich vom Team innerhalb <strong>de</strong>s nächsten Teilprojekts<br />
bearbeitet wer<strong>de</strong>n kann, wird gemeinsam im Teilprojekt-Planungsmeeting entschie<strong>de</strong>n.<br />
2
Dieses Meeting ist aus mehreren Grün<strong>de</strong>n sehr wichtig:<br />
1. Das Team soll ein Verständnis für die anstehen<strong>de</strong>n Aufgaben bekommen.<br />
Gleichzeitig wird <strong>de</strong>m Team die Möglichkeit gegeben, Unklarheiten in einer<br />
Diskussion auszuräumen.<br />
2. Ein weiteres wichtiges Ziel ist die Auswahl <strong>de</strong>r Anfor<strong>de</strong>rungen, die das Team im<br />
kommen<strong>de</strong>n Teilprojekt bearbeitet. Hierfür berät das Team<br />
über die vom Projekteigner vorgestellten Anfor<strong>de</strong>rungen,<br />
versucht einerseits <strong>de</strong>ren Aufwän<strong>de</strong> und an<strong>de</strong>rerseits die<br />
eigenen Teamkapazitäten im kommen<strong>de</strong>n Teilprojekt<br />
abzuschätzen. Hiernach hat das Team i. d. R. genug<br />
Informationen, um in einem zweiten Schritt die<br />
Anfor<strong>de</strong>rungen auszuwählen, die es realistisch im<br />
Teilprojekt<br />
Planung<br />
Meeting 1<br />
Grobplanung<br />
Teilprojekt<br />
Planung<br />
Meeting 2<br />
Feinplanung<br />
kommen<strong>de</strong>n Teilprojekt umsetzen kann. Besteht über die Auswahl Einigkeit, so wer<strong>de</strong>n<br />
die selektierten Anfor<strong>de</strong>rungen in einer Liste schriftlich nie<strong>de</strong>rgelegt.<br />
3. Das dritte Ziel <strong>de</strong>s Meetings besteht aus <strong>de</strong>r Verpflichtung. Hiermit ist eine<br />
Verbindlichkeitserklärung seitens <strong>de</strong>s Teams gemeint, in <strong>de</strong>r die Mitglie<strong>de</strong>r<br />
versichern, ihr ganzes Engagement <strong>de</strong>r Erfüllung <strong>de</strong>s Ziels einzusetzen. Diese<br />
mündliche Erklärung verfolgt keinerlei juristische Ziele, son<strong>de</strong>rn soll das Team<br />
vielmehr zusätzlich motivieren, innerhalb <strong>de</strong>r gegebenen Zeitspanne möglichst alle<br />
Anfor<strong>de</strong>rungen umzusetzen.<br />
4. Der letzte wichtige Inhaltspunkt <strong>de</strong>s Meetings ist die Erarbeitung <strong>de</strong>s<br />
Teilprojekt-Logbuchs (engl.: Sprint Backlog). Auch dieses Dokument<br />
ist eine lebendige Liste, die im Laufe eines Sprints öfter überarbeitet<br />
wird. Bestandteil sind alle Aktivitäten, die zur Umsetzung <strong>de</strong>r<br />
Anfor<strong>de</strong>rungen erfor<strong>de</strong>rlich sind. Bei <strong>de</strong>r Ermittlung dieser Aktivitäten<br />
ist es oft erfor<strong>de</strong>rlich, dass sich die Workshop-Teilnehmer erste<br />
Gedanken über das En<strong>de</strong>rgebnis <strong>de</strong>s Gesamtprojekts machen.<br />
Umsetzung<br />
Nach<strong>de</strong>m das Teilprojekt geplant ist, beginnt die eigentliche Arbeit. Für diese Phase wer<strong>de</strong>n<br />
nur wenig Regeln vorgeschrieben und keinerlei Vorgehenspraktiken<br />
festgelegt, um so die Selbstorganisation <strong>de</strong>s Teams nicht einzuschränken. Im<br />
Gegenteil: Lediglich ein Meeting, das Tagesmeeting, wird regelmäßig<br />
abgehalten, um die Kommunikation innerhalb <strong>de</strong>s Teams zu för<strong>de</strong>rn. Dieses<br />
auf 15 Minuten beschränkte Treffen soll mit <strong>de</strong>r Unterstützung <strong>de</strong>s Coachs<br />
täglich zur gleichen Zeit und am gleichen Ort und direkt vor <strong>de</strong>m Taskboard<br />
abgehalten wer<strong>de</strong>n. Während <strong>de</strong>s Meetings beantworten die einzelnen<br />
Teammitglie<strong>de</strong>r kurz und knapp vor <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren die folgen<strong>de</strong>n drei Fragen:<br />
• Was habe ich seit <strong>de</strong>m letzten Tagesmeeting gemacht?<br />
• Was wer<strong>de</strong> ich bis <strong>zum</strong> nächsten Tagesmeeting machen?<br />
• Was hat mich hierbei behin<strong>de</strong>rt?<br />
Durch die Beantwortung <strong>de</strong>r ersten bei<strong>de</strong>n Fragen bekommt je<strong>de</strong>r einen<br />
Eindruck, wer an was arbeitet. Die dritte Frage ist beson<strong>de</strong>rs wichtig, <strong>de</strong>nn<br />
das Team soll über beste Voraussetzungen <strong>zum</strong> effektiven Arbeiten verfügen.<br />
Fehlt es beispielsweise an passen<strong>de</strong>r Hardware o<strong>de</strong>r wer<strong>de</strong>n Teammitglie<strong>de</strong>r<br />
für „wichtigere“ Aufgaben vom Management zeitweise vom Projekt<br />
abgezogen, so notiert sich <strong>de</strong>r Coach diese Probleme im Beson<strong>de</strong>rheiten-<br />
Logbuch (engl. Impediment Backlog). Diese arbeitet er außerhalb <strong>de</strong>s<br />
Tagesmeetings chronologisch ab und versucht so die Hin<strong>de</strong>rnisse aus <strong>de</strong>m<br />
Weg zu räumen.<br />
3
Neben <strong>de</strong>r Implementierung gehört es auch zu <strong>de</strong>n Aufgaben eines je<strong>de</strong>n Teammitglieds am<br />
En<strong>de</strong> eines Arbeitstages erledigte Aufgaben im Teilprojekt-Logbuch abzuhaken bzw. <strong>de</strong>n<br />
Restaufwand zu aktualisieren.<br />
Hierin liegt auch ein zusätzlicher Nutzen <strong>de</strong>s Teilprojekt-Logbuchs: Mit seiner<br />
Hilfe wer<strong>de</strong>n Arbeitsfortschritte und -organisation für alle Beteiligten im<br />
Burndown Chart transparent und übersichtlich dargestellt. Dieses<br />
zweidimensionale Liniendiagramm setzt die (IST-)Restarbeitszeit <strong>zum</strong><br />
aktuellen Zeitpunkt im Teilprojekt ins Verhältnis. Zusammen mit <strong>de</strong>r SOLL-<br />
Restaufwandskurve erhält so je<strong>de</strong>r Beteiligte eine Vorstellung davon, ob es<br />
zu zeitlichen Engpässen kommen kann. Der Einsatz <strong>de</strong>s Burndown Charts<br />
beschränkt sich aber nicht nur auf die Grenzen eines Teilprojekts. Mit seiner<br />
Hilfe kann ebenfalls die Zeitplanung <strong>de</strong>s gesamten Projekts überwacht wer<strong>de</strong>n.<br />
Retrospektive und Review<br />
Am En<strong>de</strong> eines je<strong>de</strong>n Teilprojekts wer<strong>de</strong>n zwei Meetings abgehalten: Das Teilprojekt-<br />
Review-Meeting, in <strong>de</strong>m die Ergebnisse <strong>de</strong>s Teilprojekts besprochen wer<strong>de</strong>n und das<br />
Teilprojekt-Retrospektive-Meeting, in <strong>de</strong>m die Zusammenarbeit im Team diskutiert wird.<br />
Bei<strong>de</strong> Treffen sollten auf <strong>de</strong>n letzten Tag <strong>de</strong>s Teilprojekts terminiert wer<strong>de</strong>n und können<br />
direkt hintereinan<strong>de</strong>r abgehalten wer<strong>de</strong>n.<br />
1. Teilprojekt-Retrospektive-Meeting<br />
Dieses Meeting basiert auf <strong>de</strong>r I<strong>de</strong>e, dass man durch Erfahrungen am<br />
Besten lernt. Es fin<strong>de</strong>t unmittelbar in Verbindung mit <strong>de</strong>m Teilprojekt-<br />
Review-Meeting statt. Hauptfiguren sind <strong>de</strong>r Coach als Mo<strong>de</strong>rator, die<br />
Teammitglie<strong>de</strong>r als Hauptbeteiligte und ggf. <strong>de</strong>r Projekteigner. Wie die<br />
meisten Meetings verfügt auch dieses Treffen über eine festgelegte<br />
Timebox von in diesem Fall zwei bis maximal drei Stun<strong>de</strong>n.<br />
Teilprojekt<br />
Retrospektive<br />
Der Ablauf <strong>de</strong>s Treffens sollte je nach Team individuell gewählt wer<strong>de</strong>n. Folgen<strong>de</strong>s<br />
Vorgehen hat sich bewährt:<br />
• Zur Einführung beschreibt je<strong>de</strong>r Teilnehmer in ein bis zwei Sätzen, wie er sich<br />
fühlt, um sich so auf das Retrospective einzulassen.<br />
• Als Nächstes müssen Daten über <strong>de</strong>n Ablauf <strong>de</strong>s aktuellen Teilprojekts<br />
gesammelt wer<strong>de</strong>n. Dieses kann beispielsweise mit Karteikarten geschehen:<br />
Es sollte je<strong>de</strong>s Teammitglied bis zu drei positive und bis zu drei<br />
negative Vorkommnisse <strong>de</strong>s Teilprojekts auf jeweils eine Karte<br />
schreiben. Je<strong>de</strong>s Teammitglied stellt seine Karteikarten kurz vor<br />
und pinnt sie an eine Stellwand. Der Coach gruppiert die<br />
einzelnen Karten nach ihrer inhaltlichen Thematik. Hierbei<br />
gewinnen die Beteiligten schon einen ersten Eindruck, welche<br />
Probleme beson<strong>de</strong>rs gravierend sind und behoben wer<strong>de</strong>n<br />
sollten.<br />
Lieferbares<br />
Ergebnis<br />
• Danach wer<strong>de</strong>n gemeinsam die Probleme besprochen und nach möglichen<br />
Lösungen gesucht. Hierbei gilt <strong>de</strong>r Grundsatz, dass ehrlich und respektvoll<br />
miteinan<strong>de</strong>r umgegangen wird. Beleidigen<strong>de</strong> Anschuldigungen haben hier<br />
ebenso wenig etwas verloren wie gegenseitige Schuldzuweisungen!<br />
I<strong>de</strong>ntifizierte Maßnahmen wer<strong>de</strong>n notiert und schnellstens behoben. Damit sie<br />
nicht in Vergessenheit geraten, wer<strong>de</strong>n sie auf <strong>de</strong>r kommen<strong>de</strong>n Besprechung<br />
zur neuen Planung <strong>de</strong>s nächsten Teilprojekts noch einmal angesprochen.<br />
4
2. Ziel <strong>de</strong>s Teilprojekt-Review-Meetings<br />
Es erfolgt die Abnahme <strong>de</strong>r Arbeitsfortschritte durch <strong>de</strong>n Projekteigner. Hierzu lädt<br />
<strong>de</strong>r Coach das Team, <strong>de</strong>n Projekteigner und ggf. weitere Stakehol<strong>de</strong>r ein. Das<br />
Treffen hat eine Timebox von etwa zwei bis vier Stun<strong>de</strong>n.<br />
Folgen<strong>de</strong>r Ablauf wird empfohlen:<br />
• Zuerst wer<strong>de</strong>n die <strong>de</strong>finierten Ziele und die damit<br />
zusammenhängen<strong>de</strong>n Anfor<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>s Projekt-Logbuchs<br />
kurz reflektiert, damit alle Beteiligten eine genaue Vorstellung<br />
über <strong>de</strong>n Inhalt <strong>de</strong>s letzten Teilprojekts haben.<br />
• Danach präsentieren die Teammitglie<strong>de</strong>r die erreichten<br />
Ergebnisse. Es gilt <strong>de</strong>r Grundsatz, dass keine aufwendigen und<br />
spektakulären Inszenierungen geboten wer<strong>de</strong>n. Lediglich die<br />
Ergebnisse sollen offen und ungeschönt vorgestellt wer<strong>de</strong>n,<br />
damit je<strong>de</strong>r einen realen Eindruck über die Erfolge <strong>de</strong>s<br />
Teilprojekts bekommen kann.<br />
• Im letzten Schritt entschei<strong>de</strong>t <strong>de</strong>r Projekteigner, ob die einzelnen<br />
Anfor<strong>de</strong>rungen vom Team erfüllt wur<strong>de</strong>n o<strong>de</strong>r nicht. Nur<br />
fehlerfreie und nutzbare Ergebnisse wer<strong>de</strong>n akzeptiert. Dieses<br />
Verfahren soll offen vor allen Beteiligten abgehalten wer<strong>de</strong>n,<br />
damit sich je<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n aktuellen Stand <strong>de</strong>s Projekts bewusst<br />
macht und keine falschen Eindrücke entstehen.<br />
Zusammenfassung<br />
Unter “Agilem Projektmanagement” verstehen wir ein pragmatisches und situationsangemessenes,<br />
also ein auf das Wesentliche konzentriertes Management von Projekten, bei<br />
<strong>de</strong>m Kun<strong>de</strong>nzufrie<strong>de</strong>nheit, motivierte Teams und effektives Risikomanagement im<br />
Mittelpunkt stehen.<br />
Zwei Managementprinzipien unterstützen dieses Vorgehen:<br />
1. Kun<strong>de</strong>nnutzen durch innovative Ergebnisse (Produkte):<br />
• Liefere Kun<strong>de</strong>nnutzen<br />
• Arbeite mit iterativen, anfor<strong>de</strong>rungsbasierten Vorgehensmo<strong>de</strong>llen.<br />
• Favorisiere technische Exzellenz.<br />
2. Kollaborativer Führungsstil:<br />
• Sei experimentierfreudig.<br />
• Bil<strong>de</strong> anpassungsfähige (selbst organisieren<strong>de</strong>, disziplinierte) Teams.<br />
• Vereinfache, wann immer möglich.<br />
Viele dieser Prinzipien sind aus <strong>de</strong>n Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r schlanken Produktion und <strong>de</strong>r schlanken<br />
Entwicklung in <strong>de</strong>r Automobilindustrie abgeleitet. Eines <strong>de</strong>r wichtigsten Prinzipien dort ist die<br />
systematische Reduzierung von Verschwendungen, die <strong>de</strong>m Kun<strong>de</strong>n keinen Nutzen liefern.<br />
Auch das Projektmanagement muss seine Projekte von Verschwendung befreien und sich<br />
auf die Lieferung <strong>de</strong>r vom Kun<strong>de</strong>n erwarteten Ergebnisse konzentrieren.<br />
5
Folgen<strong>de</strong>r Werkzeugkasten fin<strong>de</strong>t Anwendung:<br />
1. Inspiration (statt Initiierung)<br />
Bestimmen <strong>de</strong>r Produktvision und <strong>de</strong>s Lieferumfangs, I<strong>de</strong>ntifikation <strong>de</strong>r Stakehol<strong>de</strong>r<br />
und Teambildung<br />
2. Nach<strong>de</strong>nken (statt Planung)<br />
Entwicklung eines anfor<strong>de</strong>rungsorientierten Iterationsplans<br />
3. Ausprobieren (statt Ausführung)<br />
Ausliefern überprüfter Inhalte in kurzen Iterationszyklen bei begleiten<strong>de</strong>m<br />
kontinuierlichem Risikomanagement<br />
4. Anpassen (statt Steuerung)<br />
Review <strong>de</strong>r ausgelieferten Produkte, <strong>de</strong>r Projektsituation und <strong>de</strong>r Teamleistung;<br />
Anpassungsmaßnahmen, wenn notwendig<br />
5. Abschluss – Projekt abschließen, Erfahrung weiter geben und feiern!<br />
Nachbetrachtung<br />
Produktstrukturpläne, Meilensteinpläne, Stakehol<strong>de</strong>ranalysen, Reviews usw. kennt je<strong>de</strong>r<br />
Projektmanager. Aber diese Instrumente sind im agilen Projektmanagement an<strong>de</strong>rs<br />
implementiert als in klassischen Projekten. Im agilen Projektmanagement fin<strong>de</strong>t am Anfang<br />
eben keine <strong>de</strong>taillierte Projektstrukturplanung statt, son<strong>de</strong>rn lediglich eine grobe, <strong>de</strong>m<br />
Kenntnisstand angepasste Produktstrukturierung. Der Projektaufwand wird in<br />
Planungsspielen nur grob geschätzt. Netzpläne wer<strong>de</strong>n nicht erstellt, dafür aber Inhaltslisten<br />
und aus <strong>de</strong>m Kanban-System abgeleitete Karteikarten mit Inhaltsbeschreibungen an<br />
Pinnwän<strong>de</strong>n. Verteilte Teams koordinieren ihre Arbeiten über Sharepoint und Wikis statt<br />
über aufwendige Microsoft-Project-Server-Installationen. Es gibt kein Än<strong>de</strong>rungskontrollverfahren<br />
mit Än<strong>de</strong>rungsanträgen und Än<strong>de</strong>rungskontrollausschüssen. Än<strong>de</strong>rungen<br />
wer<strong>de</strong>n vielmehr über die vom Kun<strong>de</strong>n priorisierten Anfor<strong>de</strong>rungslisten am Beginn einer<br />
Iteration eingebracht. Risiken wer<strong>de</strong>n nicht über Checklisten i<strong>de</strong>ntifiziert und in Risikolisten<br />
festgehalten und quantifiziert. Das Risikomanagement erfolgt vielmehr organisch als<br />
inhärenter Bestandteil <strong>de</strong>r täglichen Teamsitzungen durch die Fragestellung nach <strong>de</strong>n<br />
zugrun<strong>de</strong> liegen<strong>de</strong>n Planungsannahmen und nach <strong>de</strong>n Be<strong>de</strong>nken <strong>de</strong>r Teammitglie<strong>de</strong>r. Im<br />
magischen Dreieck sind die Produktmerkmale nicht mehr die feste, son<strong>de</strong>rn die anpassbare<br />
Größe. Die Arbeitsverteilung erfolgt nicht mehr nach <strong>de</strong>m Push-Prinzip eines genau<br />
einzuhalten<strong>de</strong>n Plans, son<strong>de</strong>rn nach <strong>de</strong>m durch Kun<strong>de</strong>nanfor<strong>de</strong>rungen ausgelösten Pull-<br />
Prinzip Die Teammitglie<strong>de</strong>r entschei<strong>de</strong>n in diesem Rahmen eigenständig über ihre<br />
Vorgehensweise.<br />
Agiles Projektmanagement wird sich durchsetzen, weil es <strong>de</strong>n großen<br />
Vorteil hat, dass es <strong>de</strong>n natürlichen Handlungsstrukturen <strong>de</strong>s Menschen<br />
relativ nahe kommt!<br />
Formuliert unter Nutzung nachfolgen<strong>de</strong>r Literaturquellen:<br />
Siegfried Seibert; Agiles Projektmanagement; projektMANAGEMNT 1/2007<br />
Eric Dreyer; Agiles Projektmanagement mit SCRUM; Westfälische Wilhelms-Universität Münster<br />
Ken Schwaber: Agiles Projektmanagement mit Scrum. Microsoft Press 2007<br />
Ken Schwaber and Jeff Sutherland; SCRUM; 2008-2010<br />
Anlage 1 Agiles Projektmanagement – Artefakte, Rollen und Ablauf<br />
6
Angebot<br />
Agiles Projektmanagement<br />
Grundlagen (Rollen, Tools und Artefakte)<br />
Anwendung im Stadtwerk (Projekteigner, Coach und Team)<br />
Strategische Stadtwerksentwicklung<br />
Vom Vertrieb <strong>zum</strong> Han<strong>de</strong>l<br />
Teil 1 - Organisation/Planung<br />
Teil 2 - Etablierung eines prozessorientierten Han<strong>de</strong>ls
Faxantwort:<br />
OrganisationsEntwicklung<br />
Dr. <strong>Gerd</strong> Friese<br />
Ricarda-Huch-Straße 37<br />
Tel.: 0351 470 70 96<br />
Fax: 0321 211 77 051<br />
Mail: info@gerd-<strong>friese</strong>.<strong>de</strong><br />
01219 Dres<strong>de</strong>n<br />
Stadtwerke auf <strong>de</strong>m Weg <strong>zum</strong> Markt –<br />
vom <strong>Produktverkäufer</strong> <strong>zum</strong> <strong>Lösungsanbieter</strong><br />
Wir haben Interesse an einem Gespräch <strong>zum</strong> Thema:<br />
Agiles Projektmanagement<br />
Grundlagen ……………………………………………………<br />
(Rollen, Artefakte, Tools)<br />
<br />
Anwendung im Stadtwerk ……………..…………………..<br />
(Projekteigner, Coach, Team)<br />
<br />
Strategische Stadtwerksentwicklung<br />
Vom Vertrieb <strong>zum</strong> Han<strong>de</strong>l Teil 1 …………..……………….<br />
(Organisation/Planung)<br />
<br />
Vom Vertrieb <strong>zum</strong> Han<strong>de</strong>l Teil 2 …………..……………….<br />
(Etablierung eines prozessorientierten Han<strong>de</strong>ls)<br />
<br />
Bitte setzen Sie sich mit ………………………......…...<br />
(Name) . (Tel./Mail)<br />
……...….………………………… in Verbindung<br />
……………………………………………………<br />
Unterschrift + Firmenstempel<br />
……………………………………………………<br />
Datum: