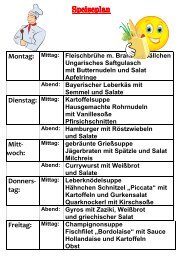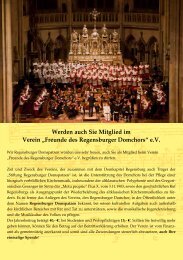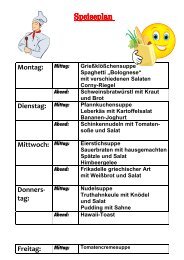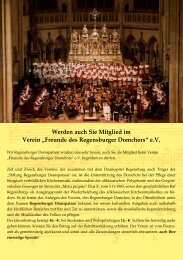siehe Angaben zum Konzert - Regensburger Domspatzen
siehe Angaben zum Konzert - Regensburger Domspatzen
siehe Angaben zum Konzert - Regensburger Domspatzen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Abendprogramm<br />
<strong>Regensburger</strong> <strong>Domspatzen</strong><br />
Concerto Köln<br />
<strong>Konzert</strong>meister: Markus Hoffmann<br />
Wolfgang Amadeus Mozart<br />
Requiem d-Moll<br />
KV 626<br />
Beethoven: 1. Symphonie C-Dur op. 21<br />
Dorothee Mields<br />
Sopran<br />
Dorothée Rabsch<br />
Alt<br />
Robert Buckland<br />
Tenor<br />
Joel Frederiksen<br />
Bass<br />
Leitung:<br />
Domkapellmeister Roland Büchner<br />
Donnerstag, 16. Mai 2013<br />
20.00 Uhr, Basilika St. Emmeram<br />
1
Dank und Hinweise<br />
Dieses Mozart-<strong>Konzert</strong>projekt der <strong>Regensburger</strong> <strong>Domspatzen</strong> wurde ermöglicht<br />
durch die besondere Unterstützung der LIGA Bank.<br />
Wir möchten aber an dieser Stelle auch den großzügigen Förderern danken, die<br />
im Hintergrund wirken und es mit ermöglichen, Projekte dieser Größenordnung<br />
durchzuführen.<br />
Das heutige <strong>Konzert</strong>programm erfährt seine zweite Aufführung am Freitag,<br />
17. Mai 2012, um 20 Uhr in der Basilika St. Emmeram zur Eröffnung der 29. Tage<br />
Alter Musik Regensburg. Dieses <strong>Konzert</strong> ist ausverkauft. Es wird live im Programm<br />
BR-Klassik des Bayerischen Rundfunks übertragen. Beginn: 20.05 Uhr.<br />
Das <strong>Konzert</strong>programm mit Mozarts „Requiem d-Moll“ und<br />
Mozarts „Prager Sinfonie“ (Nr. 38) kommt noch dreimal zur Aufführung<br />
mit folgender Besetzung: Yeree Suh (Sopran), Dorothée Rabsch (Alt),<br />
Robert Buckland (Tenor), Joachim Höchbauer (Bass) sowie Concerto Köln<br />
Freitag, 12. Juli 2013, 20.00 Uhr, Rheingau Musikfestival, Kloster Eberbach<br />
(ausverkauft)<br />
Samstag, 13. Juli 2013, 20.00 Uhr, Festival Europäische Kirchenmusik,<br />
Schwäbisch Gmünd, Heilig-Kreuz-Münster<br />
Freitag, 19. Juli 2013, 19.30 Uhr, Europäische Wochen Passau, Niederalteich,<br />
Basilika St. Mauritius<br />
Besuchen Sie uns auch im Internet:<br />
www.domspatzen.de<br />
www.facebook.com/regensburgerdomspatzen<br />
www.mittelbayerische.de/domspatzen<br />
Impressum:<br />
Verantwortlich und Veranstalter:<br />
Verein „Freunde des <strong>Regensburger</strong> Domchors“ e.V., Chormanagement, Christof Hartmann,<br />
Reichsstraße 22, 93055 Regensburg, T. 0941-7962-0, Handy: 0171-65 300 83, Fax: 0941-7962-263,<br />
E-Mail: chormanagement@domspatzen.de, www.domspatzen.de<br />
2
Beethoven: 1. Symphonie – Mozart: Requiem<br />
Ludwig van Beethoven 1. Symphonie C-Dur op. 21 (1800)<br />
(1770-1827)<br />
Adagio molto – Allegro con brio<br />
Andante cantabile con moto<br />
Menuetto (Allegro molto e vivace)<br />
Adagio – Allegro molto e vivace<br />
……………………………<br />
Wolfgang Amadeus Mozart Requiem d-Moll<br />
(1756-1791) für Soli, Chor und Orchester KV 626 (1791)<br />
(Mozarts Fragment mit den Ergänzungen<br />
von Joseph Eybler und Franz Xaver Süßmayr)<br />
I. Introitus<br />
II.<br />
III.<br />
IV.<br />
Requiem aeternam<br />
Kyrie<br />
Sequenz<br />
Dies irae – Tuba mirum – Rex tremendae –<br />
Recordare – Confutatis – Lacrimosa<br />
Offertorium<br />
Domine Jesu – Hostias<br />
V. Sanctus<br />
VI.<br />
Benedictus<br />
VII. Agnus Dei<br />
VIII. Communio<br />
Lux aeterna<br />
Wir danken der Meisterwerkstätte für Orgelbau Josef Maier, 88138 Hergensweiler,<br />
für die freundliche Bereitstellung der Truhenorgel.<br />
3
Zum Programm<br />
Beethovens erste Sinfonie wurde in seiner ersten eigenen Akademie am<br />
2. April 1800 im Hoftheater (Burgtheater) in Wien uraufgeführt. Neben einer<br />
Mozart-Sinfonie und Arien aus Haydns Schöpfung standen ein Klavierkonzert<br />
Beethovens (wahrscheinlich op. 15), sein Septett op. 20 und eben die 1. Sinfonie<br />
auf dem Programm. Evtl. komponierte Beethoven die Sinfonie sogar speziell im<br />
Hinblick auf dieses <strong>Konzert</strong>.<br />
Im Gegensatz zu vielen späteren Werken existieren zur 1. Sinfonie keinerlei<br />
handschriftliche Zeugnisse des Entstehungsprozesses, weder ein vollständiges<br />
Autograph noch Skizzen (wahrscheinlich ist ein ganzes Skizzenbuch aus dieser Zeit<br />
verloren gegangen). Bereits in seiner frühen Wiener Zeit, in den Jahren 1795 und<br />
1796, hatte Beethoven an einer Sinfonie in C-Dur gearbeitet, von der noch zahlreiche<br />
Skizzen zeugen. Dieser erste Anlauf verlief jedoch im Sande. Als Beethoven<br />
einige Jahre später erneut mit der Komposition einer C-Dur-Sinfonie begann, griff<br />
er - erstaunlich genug - noch nicht einmal auf das Material des ersten Versuchs<br />
zurück, sondern machte alles neu. Lediglich den Beginn des Rondothemas aus<br />
dem Finale übernahm er aus dem Vorläuferprojekt.<br />
Die Sinfonie sollte zunächst Beethovens erstem großen Gönner und Förderer gewidmet<br />
sein, seinem ersten Dienstherrn, Kurfürst Maximilian Franz, Fürsterzbischof<br />
von Köln. Der in Bonn residierende Bischof hatte das Potenzial seines Angestellten<br />
erkannt und ihn Ende 1792, mit einem Stipendium versehen, nach Wien <strong>zum</strong><br />
Studium bei Haydn geschickt. Bis 1794 bezog Beethoven in Wien regelmäßig ein<br />
Gehalt des Bonner Erzbischofs. Die Französischen Truppen im Rheinland säkularisierten<br />
den erzbischöflichen Hof und lösten Beethovens ehemalige Dienststelle<br />
auf, eine Rückkehr nach Bonn wurde damit obsolet. Beethoven war in Wien<br />
jedoch schon so erfolgreich, dass er der Unterstützung des Kurfürsten nicht<br />
mehr bedurfte. Seinem Gönner war er dennoch dankbar, die Widmung seines<br />
ersten großen Orchesterwerks für diesen daher naheliegend. Im Juni 1801 teilte<br />
Beethoven dem Verleger Franz Anton Hoffmeister in Leipzig die Titelaufschrift für<br />
die Originalausgabe mit. Der überraschende Tod von Max Franz am 27. Juli 1801<br />
machte diese Widmung jedoch hinfällig, so dass Beethoven sich schließlich für<br />
Baron van Swieten als Widmungsträger entschied. Die Erstausgabe der Sinfonie<br />
erschien wahrscheinlich im November 1801.<br />
4
Theologische Einführung <strong>zum</strong> Mozart-Requiem<br />
(Vortrag von Chortheologe Christian Hambsch für die Sänger<br />
der <strong>Regensburger</strong> <strong>Domspatzen</strong>, gehalten am 10. Mai 2013)<br />
Im Jahr 1791 nähert sich ein geheimnisvoller Bote der Wohnung von Wolfgang<br />
Amadeus Mozart. Jener Bote wird für einen anonymen Auftraggeber eine<br />
Totenmesse bestellen. Mozart willigt ein und erhält 25 Dukaten als Anzahlung.<br />
Weitere 25 Dukaten werden ihm bei Erhalt des vollständigen Werkes zugesagt.<br />
Heute wissen wir, dass jener unbekannte Bote ein Beauftragter des Grafen<br />
Franz von Walsegg war. Jener Graf, der auf Schloss Stuppach wohnte, hatte die<br />
eigenartige Angewohnheit, bei berühmten Komponisten Werke in Auftrag zu<br />
geben, diese für gewöhnlich abzuschreiben und als seine eigenen Kompositionen<br />
bei seinen <strong>Konzert</strong>en aufzuführen. So bestellte er das Requiem für seine Frau,<br />
die am 14.2.1791 verstorben war. Damit erklärt sich auch die strenge Diskretion<br />
Mozart gegenüber. Mozart erreichte jener Auftrag spätestens vor seiner Abreise<br />
nach Prag, wo am 6.9.1791 seine Oper „La clemenza di Tito“ aufgeführt wurde.<br />
Nach seiner Rückkehr war er vor allem mit der „Zauberflöte“ beschäftigt, die am<br />
30.9.1791 in Wien uraufgeführt wurde.<br />
Mozart begann mit dem Requiem spät – zu spät! Als Mozart den Auftrag <strong>zum</strong><br />
Requiem erhielt, erfreute er sich wohl noch guter Gesundheit, aber schon in Prag<br />
kränkelte er. Ahnt Mozart im Herbst 1791, dass er seine letzte Komposition beginnt<br />
und dieses Werk „seine eigene Totenmesse“ wird? Als er sich jedenfalls ernsthaft<br />
dem Requiem zuwendet, ist er schon gesundheitlich angeschlagen und je mehr<br />
die Komposition fortschreitet, schreitet auch der Krankheitsverlauf fort. Mozart soll<br />
über der Arbeit am Requiem vom Tod gesprochen und sogar behauptet haben,<br />
dass „er das Requiem für sich setze“. Mozart kann das Requiem nicht vollenden.<br />
Er stirbt am 5.12.1791. Der Introitus samt Kyrie sind niedergeschrieben. Fertig<br />
sind weitgehend auch die Vokalstimmen und der Generalbass vom Offertorium<br />
sowie von der Sequenz bis <strong>zum</strong> 8. Takt des Lacrimosa. In weiten Teilen ist die<br />
Instrumentierung angezeigt. Sanctus, Benedictus, Agnus Dei und die Communio<br />
fehlen. Ernstzunehmenden Quellen zufolge endet die ursprüngliche Partitur<br />
Mozarts am Ende des Hostias mit den Worten „quam olim da capo“. Dass Mozart<br />
nach Takt 8 im Lacrimosa verstorben sein soll, ist nichts weiter als eine Legende.<br />
Warum er nach dem 8.Takt im Lacrimosa unterbricht, kann musikalische Gründe<br />
haben. Das Lacrimosa endet, wie auch der Introitus und das Agnus Dei, mit den<br />
Worten „dona eis requiem“. Durch diese Worte inspiriert, wollte Mozart vielleicht<br />
engere musikalische Bezüge <strong>zum</strong> Introitus und <strong>zum</strong> Agnus Dei schaffen. Zudem<br />
wird vermutet, dass Mozart durch eine Amenfuge das Lacrimosa beschließen<br />
wollte. So stoppte er wahrscheinlich nach Takt 8, um sich diesen Überlegungen<br />
einem späteren Zeitpunkt zu widmen. Die Schwester von Konstanze schildert, wie<br />
Mozart in den letzten Augenblicken seines Lebens „mit dem Munde die Pauken<br />
in seinem Requiem ausdrücken wollte“.<br />
5
Nach seinem Tod wandte sich seine Witwe Konstanze mit der Bitte um<br />
Fertigstellung der Totenmesse vermutlich zuerst an Franz Jacob Freystädtler, den<br />
sie wohl für den erfahrendsten Schüler ihres Mannes hielt. Aus unbekanntem<br />
Grund gab er aber bald auf. Am 21.12.1791 quittiert Joseph Eybler, dass er das<br />
Requiem zur Vollendung anvertraut bekommen hat. Dieser begann mit der<br />
Fertigstellung, stellte diese aber ebenso wieder ein. Wie viele Personen an der<br />
Vollendung dieser Komposition beteiligt waren, ist unsicher. Sicher jedoch ist,<br />
dass diese schwierige Aufgabe Franz Xaver Süßmayr zufiel. Er, damals 25 Jahr<br />
alt, war Schüler von Mozart gewesen, hatte mit ihm zu Lebzeiten einige Teile<br />
der Totenmesse musiziert und hatte seinen Lehrer auf der Pragreise begleitet.<br />
Süßmayr war wohl über die Ideen des Meisters unterrichtet und hatte eventuell<br />
auch Skizzen, die bis heute verschollen sind. Solch eine Skizze nimmt man<br />
beispielsweise für das Benedictus an. Wir dürfen Süßmayr für seine Arbeit, die er<br />
sicherlich nach bestem Wissen und Können ausgeführt hat, dankbar sein, denn<br />
nur das fertiggestellte Requiem war in der Liturgie aufführbar! Vermutlich konnte<br />
er Konstanze das fertiggestellte Werk im Frühjahr 1792 überreichen, die es an den<br />
Auftraggeber weitergab. Dieser dirigierte das Requiem auch tatsächlich selbst im<br />
Jahr 1793 und noch einmal am Todestag seiner Frau am 14.2.1794. Konstanze<br />
hatte allerdings 2 Abschriften anfertigen lassen, von denen Graf Walsegg nichts<br />
wusste und über die er sicher nicht erfreut gewesen sein dürfte.<br />
Von Beginn an hat das Requiem seine Hörer in den Bann gezogen. Beethoven,<br />
selbst ein zukunftsweisender Komponist wird über das Requiem von Mozart<br />
sagen: „zu wild und furchtbar“. Beethoven wollte selbst eines „in versöhnendem<br />
Geiste“ schreiben. Schon zu Beginn führen die Bassethörner in F – eine neu<br />
entwickelte Klarinettenart – mit ihrem dunklen und geheimnisvollen Klang in die<br />
Tiefe des Geschehens.<br />
Aber was ist eine Totenmesse? Wie der Name schon sagt, ist eine Totenmesse<br />
die Hl. Messe für Verstorbene. Deshalb begegnen uns auch wesentliche Teile des<br />
Messordinariums wie das Kyrie, Sanctus, Benedictus und Agnus Dei, wobei früher<br />
im Agnus Dei Worte „miserere nobis“ durch „dona eis requiem“ und „dona nobis<br />
pacem“ durch „dona eis requiem sempiternam“ ersetzt worden waren. Schon<br />
der erste Satz im Introitus „Requiem aeternam dona eis, Domine“ – ewige Ruhe<br />
gib ihnen, Herr“ bildet das theologische Leitmotiv einer Totenmesse. Jenes Motiv<br />
wird im Lacrimosa, im Agnus Dei und in der Communio wieder aufgegriffen.<br />
Besonders spannend für euch dürfte aber die Sequenz sein. Eine Sequenz –<br />
lateinisch sequi (folgen) – folgt in der Liturgie dem Halleluja nach. Wir <strong>Domspatzen</strong><br />
kennen zwei bedeutsame Sequenzen: Am Pfingstsonntag folgt der Gesang „Veni<br />
Sancte Spiritus“ auf das Halleluja und am Ostersonntag begegnet uns nach dem<br />
Halleluja der Gesang „Victimae paschali laudes“. Das Dies irae wurde vom Konzil<br />
von Trient im 16. Jahrhundert als Sequenz für die Totenmesse vorgesehen und bis<br />
1970 blieb das Dies irae fester Bestandteil einer Totenmesse. Der Text des Dies<br />
irae ist vor allem durch das Buch des Propheten Zefanja (Zef 1,14-18) inspiriert<br />
und geht unter die Haut: „Dies irae, dies illa solvet saeclum in favilla!“ – „Jener<br />
6
Tag des Zorns, jener Tag, der das All in Staub verwandeln wird!“ „Wie groß wird<br />
das Zittern sein, wenn der Richter kommen wird?“ Diese Vision wird im Tuba<br />
mirum weitergeführt: „Die Posaune mit wunderlichem Laut wird erklingen durch<br />
das Gebiet der Gräber und wird alle vor den Thron zwingen…Was soll ich Armer<br />
dann sagen? Welchen Beschützer soll ich erbitten?“ Im Recordare wird uns die<br />
entscheidende Antwort gegeben, wer dieser Beschützer nur sein kann: Jesus –<br />
Gott selbst! „Redemisti crucem passus; tantus labor non sit cassus“ – „Du hast<br />
mich erlöst, gelitten am Kreuz; so viel Mühe sei nicht vergeblich…Du hast Maria<br />
erlöst und den Schächer erhört. Du hast auch mir Hoffnung gegeben“. Hier genau<br />
liegt die Wahrheit: Was hat Gott alles unternommen um uns zu zeigen, wie sehr<br />
er uns liebt? Seine Schöpfung aus Liebe, Seine Menschwerdung als Kind aus<br />
Liebe zu uns, Seinen Kindern. Sein Leiden für uns, Seine Auferstehung! Wieso<br />
sollte Seine liebevolle Zuwendung zu uns im Tod denn nun enden? Alles wäre<br />
dann umsonst! Wer dies annimmt, hat von dem faszinierenden Gott, welcher der<br />
Urgrund des Lebens ist, nur wenig verstanden. Gott ist kein Gott des Zorns und der<br />
Vergeltung! Er ist die Liebe! Wenn wir Seiner unendlichen Liebe begegnen, wird<br />
sie uns verwandeln und all unsere Schuld, unser Versagen wird zu Staub zerfallen.<br />
Mozart hat in seinem Schwanengesang als genialer Musiker diese bedeutsame<br />
Botschaft uns geschenkt: Sie begegnet im gesamten Werk! Schon im Introitus,<br />
im Rex tremendae, im Recordare. Sie begegnet uns schon früher: Im der Motette<br />
„Ave verum corpus“, die auf den 17.6.1791 datiert ist. Mozart hat in seinen<br />
letzten beiden kirchenmusikalischen Kompositionen den Übergang vom Tod <strong>zum</strong><br />
Leben mit unvergleichlichen Klängen gefunden. Sein musikalisches Testament<br />
lässt trotz aller Todesangst niemals die Hoffnung auf den barmherzigen Gott aus<br />
den Augen. Mozart, der sein Lebensende ahnte, hat offensichtlich gespürt, dass<br />
der Urgrund seines Lebens, jener Gott der Liebe, ihn niemals aufgibt – besonders<br />
nicht im Tod!<br />
Um Mozarts Botschaft zu vernehmen, lauschen wir ins Confutatis: „Confutatis<br />
maledictis“ – „wenn die Geschmähten <strong>zum</strong> Schweigen gebracht“, „flammis<br />
acribus addictis“ – „den heftigen Flammen ausgesetzt werden!“ Trotz<br />
ungeheuerlicher Todesangst, welche durch die dramatische Sprache der Musik<br />
in den Streichern und den Chorstimmen ausgedrückt wird, erfolgt ein plötzlicher<br />
Stimmungswechsel im „Voca me“: „Dann ruf mich mit den Gesegneten“ Der<br />
gnadenvolle Gott wird mich zu sich rufen. Noch einmal greift er im Confutatis die<br />
gewaltige Todesangst auf, aber im „Oro supplex“ siegt in Mozarts überirdischer<br />
Musik die Gewissheit, in Gott den besten Helfer für die Todesstunde zu haben:<br />
„Ich bitte dich demütig flehend und zugeneigt, das Herz zerrieben wie Asche,<br />
trage du Sorge für mein Ende“. Wer außer Gott kann uns Menschen vom Tod ins<br />
Leben führen?<br />
An jenem tränenreichen Tag, am letzten Tag unseres Lebens, an dem uns<br />
keine Macht dieser Erde mehr helfen kann, wird uns Seine Liebe retten und<br />
hinüberführen in Seine Herrlichkeit, in der Mozart schon auf uns wartet.<br />
7
Wolfgang Amadeus Mozart<br />
Requiem d-Moll<br />
für Soli, Chor und Orchester KV 626 (1791)<br />
I. Introitus Requiem (Chor, Alt)<br />
Requiem aeternam dona eis, Domine: et<br />
lux perpetua luceat eis. Te decet hymnus,<br />
Deus, in Sion, et tibi reddetur votum in<br />
Jerusalem: exaudi orationem meam, ad<br />
te omnis caro veniet. Requiem aeternam<br />
dona eis, Domine: et lux perpetua luceat<br />
eis.<br />
Herr, gib ihnen die ewige Ruhe, und das<br />
ewige Licht leuchte ihnen. O Gott, Dir gebührt<br />
ein Loblied in Sion, Dir erfülle man<br />
sein Gelübde in Jerusalem. Erhöre mein<br />
Gebet; zu dir kommt alles Fleisch. Herr,<br />
gib ihnen die ewige Ruhe, und das ewige<br />
Licht leuchte ihnen.<br />
II. Kyrie<br />
Kyrie eleison.<br />
Christe eleison.<br />
Kyrie eleison.<br />
Herr, erbarme Dich unser.<br />
Christus, erbarme Dich unser.<br />
Herr, erbarme Dich unser.<br />
(Chor)<br />
III. Sequenz 1. Dies irae (Chor)<br />
Dies irae, des illa,<br />
solvet saeclum in favilla,<br />
teste David cum Sibylla.<br />
Quantis tremor est futurus,<br />
quando judex est venturus,<br />
cuncta stricte discussurus!<br />
Tuba mirum spargens sonum<br />
per sepulcra regionum,<br />
coget omnes ante thronum.<br />
Mors stupebit et natura,<br />
cum resurget creatura,<br />
judicanti responsura.<br />
Liber scriptus proferetur,<br />
in quo totum continetur,<br />
unde mundus judicetur.<br />
Judex ergo cum sedebit,<br />
quidquid latet apparebit:<br />
nil inultum remanebit.<br />
Quid sum miser tunc dicturus?<br />
Quem patronum rogaturus,<br />
cum vix justus sit securus?<br />
Tag der Rache, Tag der Sünden, wird das<br />
Weltall sich entzünden, wie Sibyll und<br />
David künden.<br />
Welch ein Graus wird sein und Zagen,<br />
wenn der Richter kommt mit Fragen<br />
streng zu prüfen alle Klagen<br />
2. Tuba mirum (Solistenquartett)<br />
Laut wird die Posaune klingen,<br />
durch der Erde Gräber dringen,<br />
alle hin <strong>zum</strong> Throne zwingen.<br />
Schaudernd sehen Tod und Leben sich die<br />
Kreatur erheben,<br />
Rechenschaft dem Herrn zu geben.<br />
Und ein Buch wird aufgeschlagen,<br />
treu darin ist eingetragen<br />
jede Schuld aus Erdentagen.<br />
Sitzt der Richter dann zu richten,<br />
wird sich das Verborgne lichten;<br />
nichts kann vor der Strafe flüchten.<br />
Weh! Was werd ich Armer sagen?<br />
Welchen Anwalt mir erfragen,<br />
wenn Gerechte selbst verzagen?<br />
8
3. Rex tremendae (Chor)<br />
Rex tremendae majestatis,<br />
qui salvandos salvas gratis,<br />
salva me, fons pietatis.<br />
Recordare, Jesu pie,<br />
quod sum causa tuae viae:<br />
ne me perdas illa die.<br />
Quaerens me, sedisti lassus:<br />
redemisti Crucem passus:<br />
tantus labor non sit cassus.<br />
Iuste judex ultionis,<br />
donum fac remissionis<br />
ante diem rationis.<br />
Ingemisco tamquam reus:<br />
culpa rubet vultus meus:<br />
supplicanti parce, Deus.<br />
Qui Mariam absolvisti,<br />
et latronem exaudisti,<br />
mihi quoque spem dedisti.<br />
Preces meae non sunt dignae:<br />
sed tu bonus fac benigne,<br />
ne perenni cremer igne.<br />
Inter oves locum praesta,<br />
et ab haedis me sequestra,<br />
statuens in parte dextra.<br />
Confutatis maledictis,<br />
flammis acribus addictis:<br />
voca me cum benedictis.<br />
Oro supplex et acclinis,<br />
cor constritum quasi cinis:<br />
gere curam mel finis.<br />
Lacrymosa dies illa,<br />
qua resurget ex favilla<br />
judicandus homo reus.<br />
Huic ergo parce, Deus:<br />
pie Jesu Domine,<br />
dona eis requiem. Amen.<br />
König schrecklicher Gewalten, frei ist<br />
Deiner Gnade Schalten: Gnadenquell,<br />
lass Gnade walten.<br />
4. Recordare (Solistenquartett)<br />
Milder Jesus, wollst erwägen,<br />
dass Du kamest meinetwegen.<br />
Schleudre mir nicht Fluch entgegen.<br />
Bist mich suchend müd gegangen,<br />
mir <strong>zum</strong> Heil am Kreuz gehangen,<br />
mög dies Mühn <strong>zum</strong> Ziel gelangen.<br />
Richter Du gerechter Rache,<br />
Nachsicht üb in meiner Sache,<br />
eh’ ich <strong>zum</strong> Gericht erwache.<br />
Seufzend steh ich schuldbefangen,<br />
schamrot glühen meine Wangen,<br />
lass mein Bitten Gnad erlangen.<br />
Hast vergeben einst Marien,<br />
hast dem Schächer dann verziehen,<br />
hast auch Hoffnung mir verliehen.<br />
Wenig gilt vor Dir mein Flehen;<br />
doch aus Gnade lass geschehen,<br />
dass ich mög der Höll entgehen.<br />
Bei den Schafen gib mir Weide,<br />
vor der Böcke Schar mich scheide,<br />
stell mich auf die rechte Seite.<br />
5. Confutatis (Chor)<br />
Wird die Hölle ohne Schonung<br />
den Verdammten zur Belohnung,<br />
ruf mich zu der Sel’gen Wohnung.<br />
Schuldgebeugt zu Dir ich schreie,<br />
tief zerknirscht in Herzensreue,<br />
sel’ges Ende mir verleihe.<br />
6. Lacrimosa (Chor)<br />
Tag der Tränen, Tag der Wehen,<br />
da vom Grabe wird erstehen<br />
<strong>zum</strong> Gericht der Mensch voll Sünden.<br />
Lass ihn Gott, Erbarmen finden,<br />
milder Jesus, Herrscher Du,<br />
schenk den Toten ew’ge Ruh. Amen.<br />
9
IV. Offertorium 1. Domine Jesu (Chor, Solistenquartett)<br />
Domine Jesu Christe, Rex gloriae, libera<br />
animas omnium fidelium defunctorum<br />
de poenis inferni et de profundo lacu:<br />
libera eas de ore leonis, ne absorbeat<br />
eas tartarus, ne cadant in obscurum: sed<br />
signifer sanctus Michael repraesentet eas<br />
in lucem sanctam. Quam olim Abrahae<br />
promisisti et semini eius.<br />
Hostias et preces tibi, Domine, laudis<br />
offerimus: tu suscipe pro animabus illis,<br />
quarum hodie memoriam facimus:<br />
fac eas, Domine, de morte transire<br />
ad vitam.<br />
Quam olim Abrahae promisisti et semini<br />
eius.<br />
Herr Jesus Christus, König der Herrlichkeit,<br />
bewahre die Seelen aller verstorbenen<br />
Gläubigen vor den Qualen der Hölle und<br />
vor den Tiefen der Unterwelt. Bewahre<br />
sie vor dem Rachen des Löwen, dass die<br />
Hölle sie nicht verschlinge, dass sie nicht<br />
hinabstürzen in die Finsternis. Vielmehr<br />
geleite sie Sankt Michael, der Bannerträger,<br />
in das heilige Licht: Das du einstens<br />
dem Abraham verheißen und seinen<br />
Nachkommen.<br />
2. Hostias (Chor)<br />
Opfergaben und Gebete bringen wir <strong>zum</strong><br />
Lobe Dir dar, o Herr: nimm sie an für jene<br />
Seelen, deren wir heute gedenken. Herr,<br />
lass sie vom Tode hinübergehen <strong>zum</strong><br />
Leben.<br />
Das du einstens dem Abraham verheißen<br />
und seinen Nachkommen.<br />
V. Sanctus (Chor)<br />
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus<br />
Sabaoth. Pleni sunt coeli et terra gloria<br />
tua. Hosanna in excelsis.<br />
VI. Benedictus<br />
Benedictus qui venit in nomine Domini.<br />
Hosanna in excelsis.<br />
VII. Agnus Dei<br />
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:<br />
dona eis requiem.<br />
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:<br />
dona eis requiem sempiternam.<br />
Heilig, Heilig, Heilig, Herr, Gott der Heerscharen,<br />
Himmel und Erde sind erfüllt von<br />
Deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe!<br />
(Solistenquartett, Chor)<br />
Hochgelobt sei, der da kommt im Namen<br />
des Herrn! Hosanna in der Höhe.<br />
Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die<br />
Sünden der Welt: gib ihnen die Ruhe.<br />
Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die<br />
Sünden der Welt: gib ihnen die ewige<br />
Ruhe.<br />
(Chor)<br />
VIII. Communio Lux aeterna (Sopran, Chor)<br />
Lux aeterna luceat eis, Domine: cum<br />
Sanctis tuis in aeternum, qui pius es.<br />
Requiem aeternam dona eis, Domine:<br />
et lux perpetua luceat eis.<br />
Cum Sanctis tuis in aeternum:<br />
quia pius es.<br />
Das ewige Licht leuchte ihnen, o Herr, bei<br />
Deinen Heiligen in Ewigkeit: denn du bist<br />
mild, Herr, gib ihnen die ewige Ruhe, und<br />
das ewige Licht leuchte ihnen.<br />
Bei Deinen Heiligen in Ewigkeit:<br />
denn Du bist mild.<br />
10
Über das Requiem (KV 626), Mozarts berühmtestes geistliches Werk, ist in<br />
den letzten zweihundert Jahren sehr viel geschrieben worden. Eine Aura des<br />
Geheimnisvollen umgibt es aufgrund der Umstände seiner Entstehung und der<br />
Tatsache, dass es unvollendet blieb. Mittlerweile ist bekannt, dass Mozart im Laufe<br />
des Sommers 1791 den Auftrag zu seinem Requiem von Graf Walsegg -Stuppach<br />
(1763-1827) erhielt, einem Freimaurer wie er. Der Graf - ein leidenschaftlicher<br />
Musikliebhaber - veranstaltete gewöhnlich Privatkonzerte in seinem Schloss und<br />
wollte das Werk in Erinnerung an seine Frau aufführen lassen, die am 14. Februar<br />
1791 im Alter von 20 Jahren gestorben war. Walsegg-Stuppach hatte schon viele<br />
Werke bei anderen Komponisten in Auftrag gegeben (z. B. Flötenquartette bei<br />
Franz Anton Hoffmeister), und wenn er sie seinen Gästen vorspielen ließ, fragte<br />
er sie im Allgemeinen nach dem Autor. Zweifellos wollte er ebenso mit dem<br />
Requiem verfahren, und es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass er - wie<br />
behauptet wurde - das Werk als sein eigenes hat ausgeben wollen. Jedenfalls<br />
schrieb er es eigenhändig ab und dirigierte es selbst in Wiener-Neustadt am<br />
14. Dezember 1793. Vorher fand am 2. Januar desselben Jahres in Wien eine<br />
Aufführung von Baron van Swieten zugunsten von Constanze Mozart statt.<br />
Laut Quellenangaben schrieb Mozart das Requiem erst nach seiner Rückkehr aus<br />
Prag (wo er „La Clemenza di Tito“ hatte aufführen lassen) Mitte September 1791.<br />
Am 30. des Monats fand die Premiere der Zauberflöte statt, und in diese Zeit<br />
fällt auch die Entstehung des Klarinettenkonzerts. Mozart starb am 5. Dezember<br />
und hinterließ das Requiem unvollendet. Um es zu Ende zu bringen, wandte<br />
sich Constanze zunächst an den Komponisten Joseph Eybler (1765-1846), dann,<br />
als dieser ablehnte, an einen anderen Schüler Mozarts, Franz Xaver Süßmayr<br />
(1766-1803), der die Fassung schrieb, die gegenwärtig am häufigsten gespielt<br />
wird und auch im heutigen <strong>Konzert</strong> erklingt (Süßmayr „beendete“ ebenfalls das<br />
<strong>Konzert</strong> für Horn in D-Dur, KV 412, auch ein Werk von 1791). Süßmayr behauptete,<br />
das Sanctus, das Benedictus und das Agnus Dei des Requiems „vorbereitet“<br />
zu haben, die in Mozarts Autograph fehlen, aber zweifellos war sein Beitrag zu<br />
diesen Abschnitten weniger bedeutend, als man damals glaubte. Das Autograph<br />
beweist, dass Mozart vollständig den Introitus und im Wesentlichen das Kyrie<br />
schrieb (seine Instrumentierung wurde von Süßmayr vervollständigt) und dass<br />
er für die sechs Teile der Sequenz (abgesehen davon, dass das „Lacrimosa“ nach<br />
8 Takten abbricht) und die zwei Teile des Offertoriums alle Singstimmen sowie<br />
den Basso continuo notierte und wichtige <strong>Angaben</strong> zur Instrumentierung machte.<br />
11
Beim Komponieren seines Requiems hatte Mozart verschiedene Beispiele seiner<br />
österreichischen Kollegen vor Augen, das wichtigste davon war sicher das in c-<br />
Moll, das im Dezember 1771 (also zwanzig Jahre zuvor) von Michael Haydn für<br />
das Begräbnis von Sigismund von Schrattenbach, den Fürstbischof von Salzburg,<br />
geschrieben worden war (vielleicht hatte Michael Haydn es ursprünglich nach<br />
dem schweren Verlust seiner einzigen Tochter angefangen, die am 27. Januar<br />
1771 im Alter von einem Jahr gestorben war). Im Requiem von Mozart lässt sich<br />
in einigen Abschnitten derselbe Aufbau wie in dem von Michael Haydn feststellen,<br />
ebenso gibt es einige thematische Parallelen. In beiden Werken wird außerdem<br />
mit denselben Techniken genau derselbe Text vertont. Es fehlen bei beiden das<br />
Graduale, der Tractus und das Libera. Das Posaunensolo zu Beginn des „Tuba<br />
mirum“ (es ist von Mozart) steht durchaus auch in einer Tradition, und dasselbe<br />
gilt für die fugierte Bearbeitung des „Quam olim Abrahae“. Das Werk ist eine<br />
Synthese aus opernhaften, freimaurerischen und gelehrten Elementen. Es erhält<br />
seine düsteren Farben durch das Fehlen solcher Instrumente wie Flöte, Oboe<br />
und Horn zugunsten von Bassetthorn, Fagott, Trompete und Posaune (nicht zu<br />
vergessen Pauken und Streicher). Das „Kyrie“ ist eine Doppelfuge in d-Moll über<br />
einen Thementyp, der häufig von Bach und Händel, aber auch von Haydn und<br />
vielen anderen verwendet wurde: absteigender Quintensprung (hier Terz a-f),<br />
gefolgt von einer verminderten Septime (b-cis), als Rahmen für diese Quinte.<br />
Zu den freimaurerischen Elementen gehören die Bassetthörner, und es wurde<br />
schon häufig darauf verwiesen, dass das Bass-Solo des „Tuba mirum“ die Tonart<br />
der Person des Sarastro aus der Zauberflöte annehme und dass die dramatischen<br />
Akzente im „Dies irae“ und „Confutatis“ sehr den Wutschreien der Königin der<br />
Nacht und des Monostatos in derselben Oper ähnelten. Kürzlich wurde festgestellt,<br />
dass Mozart am Ende der 1780er Jahre mehrere geistliche Werke geplant und<br />
sogar angefangen habe (ohne sie zu beenden): Auch unter diesem Aspekt muss<br />
das Requiem betrachtet werden. Die Communio am Schluss greift den Introitus<br />
und das Kyrie wieder auf: Diese verhältnismäßig geläufige Lösung, die vielleicht<br />
von Süßmayr auf Mozarts Wunsch gewählt wurde, hat <strong>zum</strong>indest den Vorteil, am<br />
Schluss des Werks noch einmal authentischen Mozart erklingen zu lassen.<br />
12
Ausführende<br />
Die Sopranistin Dorothee Mields studierte in<br />
Bremen bei Elke Holzmann und in Stuttgart bei<br />
Julia Hamari. Nach Abschluss ihres Studiums<br />
arbeitete sie zunächst insbesondere mit<br />
den Dirigenten Ludger Rémy und Thomas<br />
Hengelbrock intensiv zusammen. Die faszinierende<br />
Musik des 17. und 18. Jahrhunderts<br />
bildete schon früh einen Schwerpunkt ihrer<br />
musikalischen Aktivitäten. Heute belegt eine<br />
stetig anwachsende Diskografie mit über 50<br />
<strong>zum</strong> Teil preisgekrönten Einspielungen ihre<br />
rege <strong>Konzert</strong>tätigkeit. Zahlreiche internationale<br />
Rundfunkstationen und CD-Labels produzieren<br />
mit ihr. Dorothee Mields ist ein gern gesehener<br />
Gast internationaler Festspiele, u. a. gastierte<br />
sie beim Bach-Fest Leipzig, beim Oude Muziek<br />
Festival Utrecht, beim Boston Early Music Festival, beim Festival van Vlaanderen,<br />
bei den Wiener Festwochen, den Händel-Festspielen Halle und Göttingen, den<br />
Musikfestspielen Potsdam und beim Tanglewood Festival. Bei den Tagen Alter<br />
Musik Regensburg gastiert sie nach 2009 (Mozart: c-Moll Messe) <strong>zum</strong> zweiten<br />
Mal. Dorothee Mields arbeitet regelmäßig mit dem Collegium Vocale Gent, dem<br />
Bach Collegium Japan, mit Dirigenten wie Ivor Bolton, Paul Goodwin, Martin<br />
Haselböck, Philippe Herreweghe, Masaaki Suzuki und Jos van Veldhoven.<br />
Die Altistin Dorothée Rabsch studierte in<br />
Detmold und Stuttgart bei Prof. Berthold<br />
Schmid und Prof. J. Hamari. Auf Einladung von<br />
Prof. Irwin Gage besuchte sie die Meisterklasse<br />
„Lied“ am Konservatorium Zürich, was ihr durch<br />
ein Zweijahresstipendium des Deutschen<br />
Akademischen Austauschdienstes ermöglicht<br />
wurde. Früh sammelte sie erste Erfahrungen<br />
im szenischen Bereich durch Zusammenarbeit<br />
mit den Regisseuren Ernst Poettgen und Beat<br />
Wyrsch. Von der Spielzeit 2002 bis 2006 war<br />
sie festes Ensemblemitglied am Landestheater<br />
Detmold. Im Frühjahr 2007 ist ihre erste CD<br />
„Traum der eignen Tage“ erschienen mit Liedern<br />
von Carl Loewe, Johanna Kinkel sowie Clara und<br />
Robert Schumann.<br />
13
Neben ihrer künstlerischen Tätigkeit war und ist Dorothée Rabsch auch die pädagogische<br />
Arbeit wichtig. So lehrte sie an der Domsingschule Paderborn, zeigte<br />
sich verantwortlich für die Ausbildung im Fach Singen/Sprechen des Erzbistums<br />
Paderborn, hatte Lehraufträge am Institut für Musik der Fachhochschule Osnabrück<br />
und an der Hochschule für Musik Detmold.<br />
Seit dem WS 2009/2010 unterrichtet sie an der Hochschule für Kath. Kirchenmusik<br />
und Musikpädagogik Regensburg. Bei den Tagen Alter Musik Regensburg gastiert<br />
sie nach 2012 (Schubert: As-Dur Messe) <strong>zum</strong> zweiten Mal.<br />
Der Tenor Robert Buckland erhielt seine<br />
erste musikalische Ausbildung bei den<br />
<strong>Regensburger</strong> <strong>Domspatzen</strong>. Als Knabenalt und<br />
junger Tenor konnte er in geistlicher und weltlicher<br />
Musik bereits reichhaltige Erfahrung in<br />
Aufführungspraxis und Stil sammeln. Bis heute<br />
ist er dem Ensemblesingen verbunden geblieben.<br />
So sang er neben seinem Gesangstudium<br />
in verschiedenen professionellen Chören und<br />
Ensembles. Unter anderem hat er mit dem<br />
Kammerchor Stuttgart, dem Huelgas Ensemble<br />
und der Nederlandse Bachvereniging zusammengearbeitet<br />
und ist bis heute Teil des jungen<br />
Ensembles Vox Luminis. Als Solist singt er regelmäßig<br />
den Evangelistenpart sowie die Arien der<br />
Passionen und des Weihnachtsoratoriums von<br />
J. S. Bach und verschiedene Kantaten von Bach, Stradella, Telemann und Fasch.<br />
Er arbeitete mit Dirigenten wie Frieder Bernius, Guy van Waas, Joshua Rifkin, Jos<br />
van Veldhoven, Jan Willem de Vriend, Peter van Heyghen und Pieter-Jan Leusink<br />
und Orchestern wie Concerto Köln, den Düsseldorfer Sinfonikern, Combattimento<br />
Consort Amsterdam und dem L’Orfeo-Barockorchester zusammen.<br />
Robert Buckland hat am Königlichen Konservatorium in Den Haag bei Barbara<br />
Pearson, Diane Forlano und Peter Kooij studiert. Außerdem wurde er in<br />
Aufführungspraxis von Michael Chance und Jill Feldman unterrichtet. Bei den<br />
Tagen Alter Musik Regensburg gastiert er nach 2009 (Mozart: c-Moll Messe) <strong>zum</strong><br />
zweiten Mal.<br />
14
Joel Frederiksen studierte Gesang und Laute<br />
in New York und Michigan, wo er sein Master’s<br />
Degree erwarb. Seitdem arbeitete er mit den<br />
führenden amerikanischen Ensembles für Alte<br />
Musik wie der Boston Camerata und dem<br />
Waverly Consort zusammen. Zeitgleich machte<br />
er als Opern- und Oratoriensänger auf sich<br />
aufmerksam. Engagements führten ihn vom<br />
renommierten Vancouver Summer Festival<br />
(Plutone in Monteverdis Orfeo) bis zu den<br />
Festivals von Hong Kong und Brisbane. Nach<br />
seinem erfolgreichen Debüt 1998 bei den<br />
Salzburger Festspielen in Kurt Weills Aufstieg<br />
und Fall der Stadt Mahagonny unter Dennis<br />
Russel-Davies ließ Joel Frederiksen sich in<br />
Europa nieder. Von München aus bereist er<br />
regelmäßig das In- und Ausland, um als Solist mit anerkannten Musikern der<br />
Alte-Musik-Szene aufzutreten. Daneben widmet sich Joel Frederiksen intensiv<br />
und mit eigenen Programmkonzepten seinem Spezialgebiet: dem Lautenlied der<br />
Renaissance und des Frühbarocks. Hierbei begleitet er sich selbst auf der Laute<br />
und der Erzlaute. Bereits 2007 erschien bei harmonia mundi die erste CD The<br />
Elfin Knight. 2008 ließ das Label aufgrund des großen Erfolgs mit O felice morire<br />
eine zweite, ebenso hochgelobte Einspielung folgen, die mit dem Preis der deutschen<br />
Schallplattenkritik ausgezeichnet wurde. 2011 veröffentlichte das Label<br />
Frederiksens amerikanisches Programm Rose of Sharon auf CD. 2012 brachte er<br />
mit Requiem for a Pink Moon eine Nick-Drake-Hommage bei harmonia mundi<br />
heraus. Für seine Aufnahme von Zielenskis Offertoria et communiones mit Emma<br />
Kirkby wurde Frederiksen im Mai 2011 in Paris mit dem Orphée d’Or, der renommierten<br />
Auszeichnung für die beste Vokalmusikeinspielung der französischen<br />
Academie du Disque Lyrique, ausgezeichnet.<br />
15
Seit mittlerweile mehr<br />
als 25 Jahren zählt das<br />
Concerto Köln zu den<br />
führenden Ensembles im<br />
Bereich der historischen<br />
Aufführungspraxis. Schon<br />
kurz nach seiner Gründung<br />
im Jahr 1985 waren<br />
Publikum und Kritik vom<br />
lebendigen Musizierstil<br />
des Ensembles begeistert<br />
– und seitdem ist Concerto<br />
Köln regelmäßiger Gast in renommierten <strong>Konzert</strong>sälen und bei großen Musikfestivals<br />
rund um den Globus. Zahlreiche Tourneen führten das Ensemble unter anderem unterstützt<br />
vom Goethe-Institut nach Nord- und Südamerika, in asiatische Länder wie<br />
China, Japan oder Südkorea sowie nach Israel und in die meisten Länder Europas.<br />
Seit Oktober 2009 besteht eine Partnerschaft mit dem High End-Audiospezialisten<br />
MBL, die sich in <strong>Konzert</strong>en, Messen und weiteren Kooperationen manifestiert. Die<br />
Partner einen gemeinsame Ziele und Werte: „Wir haben eine ähnliche Philosophie<br />
und Concerto Köln verfolgt auf musikalischer Ebene die gleichen Ziele wie wir auf<br />
technisch-musikalischer Ebene – durch handwerkliche Perfektion und Leidenschaft<br />
beim Zuhörer Emotionen zu wecken.“ (MBL) Concerto Köln spielte Aufnahmen für<br />
die Deutsche Grammophon, Virgin Classics, Harmonia Mundi, Teldec, Edel sowie<br />
Capriccio ein und kann eine Diskographie von mittlerweile mehr als 50 CDs vorweisen.<br />
Ein Großteil dieser CDs wurde mit bedeutenden Preisen wie dem Echo<br />
Klassik, dem Grammy Award, dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik, dem<br />
MIDEM Classic Award, dem Choc du Monde de la Musique, dem Diapason d’Année<br />
oder dem Diapason d´Or ausgezeichnet. Ein Markenzeichen des Ensembles ist die<br />
Wiederentdeckung von Komponisten, deren Musik im Schatten des Wirkens großer<br />
Namen stand. So hat Concerto Köln unter anderem zur Renaissance der Werke<br />
Joseph Martin Kraus’, Evaristo Felice dall’Abacos und besonders Henri-Joseph Rigels<br />
beigetragen. Die Einspielung mit seinen Sinfonien wurde 2009 unter anderem mit<br />
dem ECHO Klassik und 2010 mit dem MIDEM Classic Award ausgezeichnet. Das<br />
Ineinandergreifen von Forschung und Praxis ist für das Ensemble wichtig und<br />
nimmt einen großen Stellenwert in der musikalischen Arbeit ein. Die künstlerische<br />
Leitung liegt seit 2005 in den Händen von Flötist Martin Sandhoff. Neben Markus<br />
Hoffmann, dem <strong>Konzert</strong>meister aus eigenen Reihen, werden zu ausgewählten<br />
Projekten auch externe <strong>Konzert</strong>meister wie Shunske Sato oder Mayumi Hirasaki<br />
engagiert. Bei umfangreich besetzten Produktionen arbeitet Concerto Köln zudem<br />
mit Dirigenten wie Kent Nagano, Ivor Bolton, Daniel Harding, René Jacobs,<br />
Marcus Creed, Peter Dijkstra, Laurence Equilbey und Emmanuelle Haïm zusammen.<br />
Zu den weiteren künstlerischen Partnern zählen die Mezzo-Sopranistinnen Cecilia<br />
Bartoli, Vivica Genaux und Waltraud Meier, die Sopranistinnen Simone Kermes,<br />
16
Nuria Rial, Rosemary Joshua und Johannette Zomer, die Countertenöre Philippe<br />
Jaroussky, Max Emanuel Cencic, Andreas Scholl, Maarten Engeltjes und Carlos Mena,<br />
die Tenöre Werner Güra und Christoph Prégardien, die Pianisten Andreas Staier<br />
und Alexander Melnikov, die Schauspieler und Moderatoren Bruno Ganz, Harald<br />
Schmidt und Ulrich Tukur sowie das Ensemble Sarband, der Balthasar-Neumann-<br />
Chor, die Chöre des WDR, NDR und BR, das Collegium Vocale Gent, die <strong>Regensburger</strong><br />
<strong>Domspatzen</strong>, der RIAS-Kammerchor, Accentus und Arsys de Bourgogne. Concerto<br />
Köln hat seit 2005 seinen Sitz im Kölner Stadtteil Ehrenfeld, wo auf Initiative des<br />
Ensembles ein Zentrum für Alte Musik entstanden ist. Das Zentrum, mittlerweile in<br />
die Trägerschaft der Kölner Gesellschaft für Alte Musik e.V. übergeben, dokumentiert<br />
die Bedeutung Kölns als Hauptstadt der Alten Musik und gibt den Akteuren<br />
der Szene ein gemeinsames Dach. Förderer wie das Land Nordrhein-Westfalen,<br />
die Kunststiftung NRW, die Stadt Köln, der TÜV Rheinland, der Landschaftsverband<br />
Rheinland, die Bauwens Group und die RheinEnergieStiftung Kultur unterstützen<br />
diese Vision. Concerto Köln wurde von der Generaldirektion Bildung und Kultur der<br />
EU-Kommission <strong>zum</strong> kulturellen Botschafter der Europäischen Union ernannt.<br />
Als weltweit erstes Ensemble hat Concerto Köln ein Qualitätsmanagement nach<br />
ISO 9001 eingeführt und ist nun offizieller Träger der „TÜV Rheinland-Plakette“.<br />
Violine I<br />
Markus Hoffmann<br />
(<strong>Konzert</strong>meister)<br />
Stephan Sänger<br />
Frauke Pöhl<br />
Horst-Peter Steffen<br />
Chiharu Abe<br />
Gabriele Nussberger<br />
Violine II<br />
Jörg Buschhaus<br />
Antje Engel<br />
Joseph Tan<br />
Hedwig van der Linde<br />
Saskia Moerenhout<br />
Bettina von Dombois<br />
Viola<br />
Aino Hildebrandt<br />
Claudia Steeb<br />
Gabrielle Kancachian<br />
Sara Hubrich<br />
Johannes Platz<br />
Violoncello<br />
Jan Kunkel<br />
Ulrike Schaar<br />
Susanne Wahmhoff<br />
John Semon<br />
Kontrabass<br />
Mathias Beltinger<br />
Miriam Shalinsky<br />
Jörg Lühring<br />
Querflöte<br />
Martin Sandhoff<br />
Cordula Breuer<br />
Oboe<br />
Rodrigo Guttierez<br />
Jasu Moisio<br />
Klarinette/ Bassetthorn<br />
Vincenzo Casale<br />
Philippe Castejon<br />
Fagott<br />
Lorenzo Alpert<br />
Elena Bianchi<br />
Horn<br />
Andrew Hale<br />
Jörg Schulteß<br />
Trompete<br />
Henry Moderlak<br />
Andy Hammersley<br />
Posaune<br />
Raphael Vang<br />
Claire Mc Intyre<br />
Uwe Haase<br />
Pauken<br />
Stefan Gawlick<br />
Orgel<br />
Markus Märkl<br />
17
Hauptaufgabe der <strong>Regensburger</strong> <strong>Domspatzen</strong>,<br />
die auf eine über 1000-jährige Tradition zurückblicken<br />
können, ist der liturgische Dienst im<br />
<strong>Regensburger</strong> Dom. Auch die <strong>Konzert</strong>tätigkeit<br />
der <strong>Regensburger</strong> <strong>Domspatzen</strong> brachte dem<br />
Chor unter der Leitung von Roland Büchner im Inund<br />
Ausland beste Kritiken und höchstes Lob ein.<br />
Jüngste <strong>Konzert</strong>höhepunkte waren im Mai 2004<br />
die Aufführung des Oratoriums „Die Schöpfung“<br />
von Joseph Haydn im Rahmen der Tage Alter<br />
Musik (mit der Akademie für Alte Musik Berlin)<br />
und im Frühjahr 2005 die Johannes-Passion von<br />
J. S. Bach (mit dem L’Orfeo Barockorchester).<br />
Glanzvolle Höhepunkte im Herbst 2005 waren<br />
die <strong>Konzert</strong>e in Rom in Anwesenheit von<br />
Papst Benedikt XVI.: <strong>zum</strong> einen ein Galakonzert<br />
mit den Münchner Philharmonikern (Leitung: Christian Thielemann) in der<br />
Audienzhalle Paul VI. vor 7000 Zuhörern, <strong>zum</strong> anderen die CD-Präsentation<br />
„<strong>Konzert</strong> für Papst Benedikt XVI.“ in der Sixtinischen Kapelle. Diese CD zählt mit<br />
über 50.000 verkauften Exemplaren zu den Bestsellern im klassischen Bereich. Im<br />
Frühjahr 2006 sangen die <strong>Regensburger</strong> <strong>Domspatzen</strong> die Matthäus-Passion von<br />
J. S. Bach (mit Concerto Köln) in Regensburg und München. 2007 bestritten die<br />
<strong>Regensburger</strong> <strong>Domspatzen</strong> zusammen mit Concerto Köln das Eröffnungskonzert<br />
der Tage Alter Musik mit der Es-Dur Messe von Franz Schubert und 2008 sangen<br />
sie den „Elias“ von Mendelssohn mit der Akademie für Alte Musik Berlin. Anlässlich<br />
des 85. Geburtstages von Domkapellmeister em. Georg Ratzinger brachten die<br />
<strong>Regensburger</strong> <strong>Domspatzen</strong> zusammen mit dem L’Orfeo Barockorchester am 17.<br />
Januar 2009 Mozarts c-Moll Messe in der Sixtinischen Kapelle in Anwesenheit von<br />
Papst Benedikt XVI. zur Aufführung. Mit diesem Werk eröffneten sie auch 2009<br />
die Tage Alter Musik. 2010 stand Beethovens C-Dur Messe zusammen mit der<br />
Akademie für Alte Musik Berlin auf dem Programm des Eröffnungskonzerts. 2011<br />
begleitete Concerto Köln die <strong>Domspatzen</strong> beim Eröffnungskonzert der Tage Alter<br />
Musik mit Werken von J. S. Bach (u. a. Magnificat und Himmelfahrtsoratorium).<br />
Wiederum mit der Akademie für Alte Musik Berlin bestritten die <strong>Domspatzen</strong> 2012<br />
das Eröffnungskonzert mit Schuberts As-Dur Messe.<br />
Das eigene Musikgymnasium (Musisches Gymnasium, achtklassig) erleichtert die<br />
Abstimmung mit den musikalischen Aufgaben. Zur Schulausbildung gehört auch der<br />
kostenlose Unterricht an mindestens einem Instrument. Im Schuljahr 2012/2013<br />
besuchen 409 Schüler das Gymnasium, davon ca. 117 zusätzlich die Tagesbetreuung.<br />
Etwa die Hälfte der Buben und jungen Männer wohnt im angeschlossenen Internat.<br />
Für die Gestaltung der Freizeit stehen ein eigenes Hallenbad, eine Turnhalle, ein<br />
Sportplatz, ein Fitnessraum und mehrere Freizeiträume zur Verfügung. Buben der<br />
18
Grundschuljahrgänge 1 bis 4 können bei entsprechenden Voraussetzungen bereits<br />
Aufnahme in der Grundschule der <strong>Regensburger</strong> <strong>Domspatzen</strong> finden. Mit<br />
Beginn des Schuljahres 2013/14 findet der Unterrichtsbetrieb in einem Neubau<br />
auf dem <strong>Domspatzen</strong>-Gelände an der <strong>Regensburger</strong> Reichsstraße statt. Neben<br />
dem <strong>Konzert</strong>chor gibt es zwei Nachwuchschöre, denen ebenfalls Knaben- und<br />
Männerstimmen angehören und die ebenfalls den liturgischen Dienst im Dom<br />
sowie verschiedenste <strong>Konzert</strong>auftritte gestalten.<br />
Roland Büchner, geboren 1954 in Karlstadt/<br />
Main, studierte zunächst an der Fachakademie<br />
für kath. Kirchenmusik und Musikerziehung<br />
Regensburg und ging dann an die<br />
Musikhochschule München. Dort schloss er sein<br />
Studium mit der künstlerischen Staatsprüfung<br />
im Fach „Kath. Kirchenmusik“ und dem Diplom<br />
im <strong>Konzert</strong>fach Orgel ab. Seine Lehrer waren<br />
u. a. Franz Lehrndorfer, Gerhard Weinberger,<br />
Diethard Hellmann und Godehard Joppich.<br />
Von 1976 bis 1987 war Roland Büchner als<br />
Stiftskapellmeister in Altötting tätig und zugleich<br />
an der dortigen Berufsfachschule für Musik als<br />
Lehrer für Gregorianik und Chorleitung. Von 1987<br />
bis 1994 leitete Roland Büchner den <strong>Konzert</strong>chor<br />
der Fachakademie für kath. Kirchenmusik<br />
und Musikerziehung Regensburg (jetzt: Hochschule für kath. Kirchenmusik und<br />
Musikpädagogik) und war an diesem Institut hauptberuflich Dozent für Chorleitung<br />
und Orgel. 1994 wurde er <strong>zum</strong> Domkapellmeister und Leiter der <strong>Regensburger</strong><br />
<strong>Domspatzen</strong> als Nachfolger von Georg Ratzinger berufen, wo er an der Spitze der<br />
Institution für die Bereiche Chor, Musikgymnasium und Internat steht und diese als<br />
Domkapellmeister und Stiftungsvorstandsvorsitzender leitet. Für seine Verdienste<br />
um die <strong>Regensburger</strong> <strong>Domspatzen</strong> erhielt Domkapellmeister Roland Büchner 2004<br />
den Kulturpreis der Stadt Regensburg und im Jahr 2005 die St.-Wolfgangs-Medaille,<br />
die höchste Auszeichnung für Laien im Bistum Regensburg. Im Jahr 2009 wurde<br />
Roland Büchner Honorarprofessor an der <strong>Regensburger</strong> Kirchenmusikhochschule.<br />
Unter Domkapellmeister Roland Büchner konzertierte der Chor bereits dreimal in<br />
Japan (1998, 2000 und 2004) und unternahm Auslandstourneen nach Frankreich,<br />
Italien, Österreich, Ungarn, Schottland, auf die Philippinen und nach Südafrika.<br />
2011 folgte er im April/Mai mit seinen <strong>Domspatzen</strong> einer Einladung zu sechs<br />
<strong>Konzert</strong>en in Taiwan. Im November 2012 leitete er die jungen Sänger bei einer<br />
einwöchigen China-Reise.<br />
19