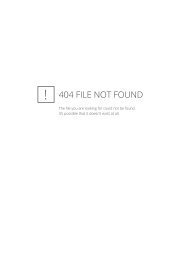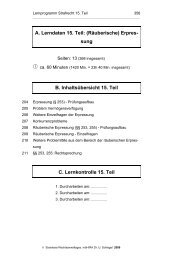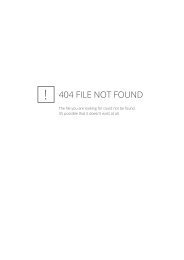A. Lerndaten 2. Teil: Vorsätzliches Bege- hungsdelikt B ...
A. Lerndaten 2. Teil: Vorsätzliches Bege- hungsdelikt B ...
A. Lerndaten 2. Teil: Vorsätzliches Bege- hungsdelikt B ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Lernprogramm Strafrecht <strong>2.</strong> <strong>Teil</strong><br />
11<br />
______________________________________________________________________________<br />
A. <strong>Lerndaten</strong> <strong>2.</strong> <strong>Teil</strong>: <strong>Vorsätzliches</strong> <strong>Bege</strong><strong>hungsdelikt</strong><br />
Seiten: 22 (32 insgesamt)<br />
! 80 Minuten (125 Min. = 2h 5 Min. insgesamt)<br />
B. Inhaltsübersicht <strong>2.</strong> <strong>Teil</strong><br />
8 Aufbau des vorsätzlichen <strong>Bege</strong><strong>hungsdelikt</strong>es<br />
9 Merkmale des Unrechtstatbestandes<br />
10 Fragen der Kausalität<br />
11 Die Lehre von den Voraussetzungen der objektiven Zurechnung<br />
12 Die Risikoerhöhungslehre<br />
13 Objektive Zurechnung: Risikoverringerung<br />
14 Objektive Bedingungen der Strafbarkeit<br />
15 Rechtswidrigkeit<br />
16 Schuldfähigkeit<br />
17 Spezielle Schuldmerkmale<br />
18 Erscheinungsformen des Tatbestandsvorsatzes<br />
19 Problem Alternativvorsatz<br />
20 Das Wissenselement des Tatbestandsvorsatzes<br />
21 RN bleibt unbesetzt<br />
C. Lernkontrolle<br />
1. Durcharbeiten am: ...............<br />
<strong>2.</strong> Durcharbeiten am: ...............<br />
3. Durcharbeiten am: ...............<br />
© Eisenbeis Rechtsanwaltsges. mbH/RA Dr. U. Schlegel 2006
Lernprogramm Strafrecht <strong>2.</strong> <strong>Teil</strong><br />
12<br />
______________________________________________________________________________<br />
<strong>2.</strong> <strong>Teil</strong>: Prüfung des vorsätzlichen <strong>Bege</strong><strong>hungsdelikt</strong>s<br />
8 Das vorsätzliche <strong>Bege</strong><strong>hungsdelikt</strong> (Prüfschema 1)<br />
υ Klausur - und Lernhinweis: Das nachfolgende Schema müssen Sie<br />
(mit Verstand) auswendig lernen!<br />
Vorsicht: Wie bei den meisten Schemata ist auch hier in der Klausur/Hausarbeit<br />
kein stures Abprüfen der einzelnen Punkte gefordert.<br />
Sie müssen bei jedem Straftatbestand überlegen, ob und wie weitgehend<br />
der Sachverhalt Anlass bietet, zu dem jeweiligen einen Prüfungspunkt<br />
umfassend Ausführungen zu machen!<br />
Prüfungsschema 1: Das vorsätzliche <strong>Bege</strong><strong>hungsdelikt</strong> (h.M.)<br />
I. Tatbestandsmäßigkeit<br />
(u.U. Vorprüfung Handlungsqualität - s.o. RN 7)<br />
1. Objektiver Tatbestand<br />
a) Besondere Merkmale des Handlungssubjekts<br />
b) Ausführungshandlung (einschließlich besondere <strong>Bege</strong>hungsweise<br />
und Tatmittel)<br />
c) Handlungsobjekt<br />
d) Eintritt, Verursachung und objektive Zurechnung des Erfolges bei<br />
Erfolgsdelikten<br />
<strong>2.</strong> Subjektiver Tatbestand<br />
a) Tatbestandsvorsatz<br />
b) Sonstige subj. Tatbestandsmerkmale (insbesondere Absichten)<br />
3. Tatbestandsannex (objektive Bedingungen der Strafbarkeit) - kein<br />
entsprechender Vorsatz notwendig!<br />
II. Rechtswidrigkeit – Rechtfertigungsgrund?<br />
III. Schuld<br />
1. Schuldfähigkeit<br />
© Eisenbeis Rechtsanwaltsges. mbH/RA Dr. U. Schlegel 2006
Lernprogramm Strafrecht <strong>2.</strong> <strong>Teil</strong><br />
13<br />
______________________________________________________________________________<br />
<strong>2.</strong> Spezielle Schuldmerkmale<br />
3. Persönliche Vorwerfbarkeit:<br />
a) Vorsatz-Schuldvorwurf (str.), nicht gegeben bei dem sog. Erlaubnistatbestandsirrtum<br />
(vgl. u. 2<strong>2.</strong> <strong>Teil</strong>, RN 282)<br />
b) Unrechtsbewusstsein - Verbotsirrtums (§ 17)?<br />
c) Entschuldigungsgründe (z.B. § 35)<br />
9 Merkmale des Unrechtstatbestandes (Unterscheidung)<br />
a) Deskriptive (= beschreibende) Merkmale = solche Merkmale, die durch<br />
einfache Beschreibung zum Ausdruck bringen, was sachlichgegenständlich<br />
zum tatbestandlichen Verbot oder Gebot gehört (z.B.<br />
"Sache", "beweglich" und „wegnehmen“ in § 242; s. auch u. RN 20).<br />
b) Normative (= wertausfüllungsbedürftige) Merkmale (z.B. „fremd“ und<br />
„Zueignungsabsicht“ in § 242)<br />
10 Fragen der Kausalität (s.o. RN 8 I 1 d - "Verursachung")<br />
a) Vorbemerkung: Wo das Strafgesetz neben der reinen Tathandlung<br />
auch einen bestimmten Erfolg voraussetzt, ist der objektive Tatbestand<br />
nur dann erfüllt, wenn<br />
(1.) zwischen der Handlung und dem Erfolg ein ursächlicher Zusammenhang<br />
(causa) besteht,<br />
(<strong>2.</strong>) dieser Erfolg objektiv voraussehbar und vermeidbar war und<br />
(3.) dem Verursacher der konkrete Erfolg als sein Werk zuzurechnen ist<br />
(letzteres wird nachfolgend unter RN 11 ff. - "objektive Zurechenbarkeit"<br />
- abgehandelt).<br />
© Eisenbeis Rechtsanwaltsges. mbH/RA Dr. U. Schlegel 2006
Lernprogramm Strafrecht <strong>2.</strong> <strong>Teil</strong><br />
14<br />
______________________________________________________________________________<br />
b) Grundsatz und Sonderfälle<br />
aa)<br />
Grundsatz: conditio-sine-qua-non-Formel:<br />
υ Ursache im Sinne des Strafrechts ist jede Bedingung eines Erfolges,<br />
die nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass der Erfolg in seiner<br />
konkreten Gestalt entfiele (Karteikarte 1 1 ).<br />
bb)<br />
Sonderfälle<br />
(1) Überholende Kausalität<br />
Beispiel: Vergifteter stirbt vor Wirksamwerden des Giftes an einem<br />
Verkehrsunfall<br />
Hier ist die Giftbeibringung nicht mehr ursächlich für den Tod - anders<br />
aber, wenn etwa ein Verkehrsunfall durch die einsetzende Giftwirkung<br />
verursacht wurde, denn es reicht, dass die Handlung des Täters eine<br />
(= mitursächliche) Bedingung für den Erfolg war oder dessen Eintritt<br />
beschleunigt hat.<br />
(2) Atypischer Kausalverlauf<br />
Für die Ursächlichkeit ist es ohne Bedeutung, wenn der Eintritt des<br />
Erfolges durch eine außergewöhnliche Konstitution des Verletzten begünstigt<br />
worden ist oder in sonstiger Weise auf einem atypischen Kausalverlauf<br />
beruht. Insbesondere wird der ursächliche Zusammenhang<br />
nicht durch ein mitwirkendes Verschulden des Verletzten oder dadurch<br />
unterbrochen, dass ein Dritter fahrlässig oder vorsätzlich in das Kausalgeschehen<br />
eingreift. Voraussetzung ist insoweit allein ein Fortwirken<br />
der früher gesetzten Bedingung bis zum Eintritt des Erfolges<br />
(nach a.A. - Adäquanztheorie - ist Ursache im Rechtssinne nur die tatbestandsadäquate<br />
Bedingung).<br />
1<br />
Schlegel, Definitionen des Rechts, Strafrecht, 7. Aufl. 2004<br />
© Eisenbeis Rechtsanwaltsges. mbH/RA Dr. U. Schlegel 2006
Lernprogramm Strafrecht <strong>2.</strong> <strong>Teil</strong><br />
15<br />
______________________________________________________________________________<br />
υ Achtung: Denkbar ist in diesen Fällen aber eine Unterbrechung des<br />
Zurechnungszusammenhangs - dazu s.u. RN 11 ff.<br />
BGH NStZ 2001, 29: Ursächlich bleibt das Täterverhalten selbst dann,<br />
wenn ein später handelnder Dritter durch ein auf dem selben Erfolg gerichtetes<br />
Tun vorsätzlich zu dessen Herbeiführung beiträgt, sofern er<br />
nur dabei an das Handeln des Täters anknüpft, dieses also die Bedingung<br />
des eigenen Eingreifens ist. Abweichungen vom vorgestellten<br />
Kausalverlauf sind rechtlich bedeutungslos, wenn sie sich innerhalb<br />
der Grenzen des nach allgemeiner Lebenserfahrung Voraussehbaren<br />
halten und keine andere Bewertung der Tat rechtfertigen.<br />
BGH NJW 2002, 1057: Bewirkt der Täter, der nach seiner Vorstellung<br />
vom Tatablauf den Taterfolg erst durch eine spätere Handlung herbeiführen<br />
will, diesen tatsächlich bereits durch eine frühere, so kommt eine<br />
Verurteilung wegen vorsätzlicher Herbeiführung des Taterfolges<br />
über die Rechtsfigur der unerheblichen Abweichung des tatsächlichen<br />
vom vorgestellten Kausalverlauf nur in Betracht, wenn der Täter bereits<br />
vor der Handlung, die den Taterfolg verursacht, die Schwelle zum Versuch<br />
überschritten hat oder sie zumindest mit dieser Handlung überschreitet.<br />
S. auch BGH NStZ 2002, 475, 476 (im dort entschiedenen<br />
Fall wird auf vollendete Tötung erkannt).<br />
(3) Unbeachtlichkeit von Reserveursachen<br />
Eine Giftbeibringung, die tatsächlich zum Tod geführt hat, bleibt auch<br />
dann ursächlich, wenn derselbe Erfolg zum gleichen Zeitpunkt infolge<br />
einer tatsächlich nicht wirksam gewordenen Reserveursache eingetreten<br />
wäre (Unbeachtlichkeit entgegen der conditio-sine-qua-non-<br />
Formel!).<br />
(4) Alternative Kausalität<br />
Von mehreren Bedingungen ist jede für sich allein ursächlich, wenn sie<br />
zwar alternativ, nicht aber kumulativ hinweggedacht werden kann, ohne<br />
dass der Erfolg entfiele (Karteikarte 2).<br />
BGHSt 39, 195: Stirbt das Opfer am Zusammentreffen der Verletzungsfolgen<br />
zweier Schüsse [abgegeben durch eine Person], von denen<br />
ein jeder auch allein zum Tod geführt hätte, so sind beide Schüsse<br />
ursächlich für den Erfolg. Wurde dabei nur der erste Schuss mit Tötungsvorsatz<br />
abgegeben, so tritt die im zweiten Schuss liegende fahrlässige<br />
Tötung als subsidiär zurück.<br />
© Eisenbeis Rechtsanwaltsges. mbH/RA Dr. U. Schlegel 2006
Lernprogramm Strafrecht <strong>2.</strong> <strong>Teil</strong><br />
16<br />
______________________________________________________________________________<br />
ABER: Haben zwei Täter unabhängig voneinander jeweils dem Opfer<br />
eine tödliche Dosis Gift beigebracht, so kann jeder der beiden nur dann<br />
wegen vollendeter Tötung bestraft werden, soweit die Wirkung der Gifte<br />
im gleichen Zeitpunkt eingetreten ist. Steht dagegen fest, dass ein<br />
Gift vor dem anderen gewirkt hat, so liegt eine vollendete und eine versuchte<br />
Tötung vor. Kann nicht festgestellt werden, welche Giftbeibringung<br />
tatsächlich für den Tod ursächlich war, so kann jeder Beteiligte<br />
nach dem Grundsatz "in dubio pro reo" nur wegen Versuchs bestraft<br />
werden!<br />
(5) Kumulative Kausalität = von mehreren Handlungen kann keine hinweggedacht<br />
werden, ohne dass der Erfolg entfiele<br />
BGHSt 37, 106, 131 [Ledersprayfall]: Ursächlichkeit ist zu bejahen,<br />
wenn zwei voneinander unabhängige Handlungen erst durch ihr Zusammenwirken<br />
zum Taterfolg führen.<br />
(6) Generelle Kausalität<br />
In den Fällen der Produkthaftung kann für die Ursächlichkeit zwischen<br />
der Beschaffenheit des Produkts und der Gesundheitsbeschädigung<br />
des Verbrauchers offen bleiben, welche Substanz den Schaden verursacht<br />
hat, solange andere in Betracht kommende Schadensursachen<br />
ausgeschlossen werden können (Karteikarte 2).<br />
BGHSt 37, 106 [Ledersprayfall]: Es genügt festzustellen, dass die -<br />
wenn auch nicht näher aufzuklärende - inhaltliche Beschaffenheit des<br />
Produkts schadensursächlich war.<br />
© Eisenbeis Rechtsanwaltsges. mbH/RA Dr. U. Schlegel 2006
Lernprogramm Strafrecht <strong>2.</strong> <strong>Teil</strong><br />
17<br />
______________________________________________________________________________<br />
Übersicht 3: Fragen der Erfolgsverursachung<br />
I. Grundsatz: Conditio-sine-qua-non-Formel<br />
II. Sonderfälle der Erfolgsverursachung:<br />
Überholende Kausalität (selbständige, „schnellere“<br />
Ursache) – grds. beachtlich<br />
Atypischer Kausalverlauf (unschädlich, wenn früher<br />
gesetzte Bedingung fortwirkt); u.U. ein Zurechnungsproblem<br />
(dazu s.u.)<br />
Reserveursachen (Unbeachtlichkeit)<br />
Doppelkausalität (grds. beide Bedingungen ursächlich,<br />
u.U. aber auch lediglich Versuchsstrafbarkeit)<br />
Generelle Kausalität (ausreichend)<br />
© Eisenbeis Rechtsanwaltsges. mbH/RA Dr. U. Schlegel 2006
Lernprogramm Strafrecht <strong>2.</strong> <strong>Teil</strong><br />
18<br />
______________________________________________________________________________<br />
11 Die Lehre von den Voraussetzungen der objektiven<br />
Zurechnung (Grundlagen)<br />
a) Vorbemerkungen: Die Lehre von den Voraussetzungen der objektiven<br />
Zurechnung begrenzt die strafrechtliche Haftung bei regelwidrigen<br />
Kausalverläufen und atypischen Schadensfolgen schon im Bereich des<br />
objektiven Unrechtstatbestandes (W/B, AT, RN 176 ff.).<br />
υ Achtung: Die Rechtsprechung hat eine Haftungsbegrenzung durch<br />
objektive Zurechnungskriterien bisher nur in Einzelfällen vorgenommen<br />
(z.B. in Fällen eigenverantwortlicher Selbstgefährdung - s.u. c)). Bei<br />
den Vorsatzdelikten verlegt sie die Lösung der Zurechnungsprobleme<br />
zumeist auf die Vorsatzebene (= Irrtum über den Kausalverlauf).<br />
b) Prüfungsreihenfolge: Prüfschema 2 (s. auch schon o. RN 10 a))<br />
Prüfschema 2: Erfolgsverursachung und -zurechnung<br />
1. Erfolg zumindest mitverursacht? (= Feststellung des ursächl.<br />
Zusammenhangs) - Äquivalenztheorie (s.o. RN 10 b) aa))<br />
<strong>2.</strong> Erfolg objektiv voraussehbar und vermeidbar? = obj.-nachträgl.<br />
Prognose unter Einbeziehung des besonderen Täterwissens<br />
3. Hat sich aufgrund eines tatbestandsadäquaten Kausalverlaufs<br />
im Schadenserfolg gerade diejenige Gefahr verwirklicht, die durch<br />
die Verletzungshandlung oder eine Überschreitung des erlaubten<br />
Risikos vom Täter geschaffen worden ist und deren Eintritt nach<br />
dem Schutzzweck der einschlägigen Norm vermieden werden sollte?<br />
= obj. Zurechnung (Karteikarte 5)<br />
c) An der objektiven Zurechnung fehlt es bei<br />
• mangelnder Risikoverwirklichung;<br />
• atypischen Schadensfolgen;<br />
• Geschehensabläufen außerhalb der Lebenserfahrung;<br />
• Schadenseintritt außerhalb des menschlichen Beherrschungsvermögens<br />
oder<br />
• außerhalb des Schutzbereichs der Norm;<br />
© Eisenbeis Rechtsanwaltsges. mbH/RA Dr. U. Schlegel 2006
Lernprogramm Strafrecht <strong>2.</strong> <strong>Teil</strong><br />
19<br />
______________________________________________________________________________<br />
• wo auch pflichtgemäßes Verhalten zum gleichen Erfolg geführt hätte<br />
(BGHSt 11, 1)<br />
BGHSt 11, 1 [sog. Radfahrer-Fall]: Als ursächlich für einen schädlichen<br />
Erfolg darf ein verkehrswidriges Verhalten nur dann angenommen<br />
werden, wenn sicher ist, dass es bei verkehrsgerechtem Verhalten<br />
nicht zu dem Erfolg gekommen wäre. Allerdings steht der Bejahung<br />
der Ursächlichkeit die bloße gedankliche Möglichkeit eines gleichen<br />
Erfolges nicht entgegen; vielmehr muss sich eine solche Möglichkeit<br />
auf Grund bestimmter Tatsachen so verdichten, dass sie die<br />
Überzeugung von der an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit<br />
des Gegenteils vernünftigerweise ausschließt.<br />
• u.U. bei Beteiligung Dritter an einer freiverantwortlichen Selbstschädigung<br />
oder Selbstgefährdung: Einschränkungen der Erfolgszurechnung<br />
aus dem Schutzzweck der Norm, dem Prinzip der Eigenverantwortlichkeit<br />
und aus der normativ gebotenen Abschichtung von Verantwortungsbereichen<br />
(vgl. W/B, AT, RN 187 ff.)<br />
d) Weiterführende Rechtsprechung zur objektiven Zurechnung<br />
BGHSt 32, 262 [Heroinspritzen-Fall ]: Eigenverantwortlich gewollte und<br />
verwirklichte Selbstgefährdungen unterfallen nicht dem Tatbestand eines<br />
Körperverletzungs- oder Tötungsdelikts, wenn das mit der Gefährdung<br />
bewusst eingegangene Risiko sich realisiert. Wer lediglich eine<br />
solche Selbstgefährdung veranlasst, ermöglicht oder fördert, macht<br />
sich insoweit nicht strafbar.<br />
BGH NJW 2000, 2286: Wer durch die Abgabe von Heroin die Selbstgefährdung<br />
eines Konsumenten ermöglicht, kann sich wegen eines<br />
Körperverletzungs-/Tötungsdelikts erst dann strafbar machen, wenn er<br />
kraft überlegenen Sachwissens das Risiko besser erfasst als der sich<br />
selbst Gefährdende.<br />
BayObLG NStZ 1997, 341 [straflose Veranlassung zur Selbstgefährdung<br />
oder fahrlässige Tötung bei Verordnung von Drogensubstitutionsmitteln<br />
durch Arzt]: Das Gericht äußert Zweifel an einem überlegenen<br />
Sachwissen des Arztes, das sich auf das Risiko des Todeseintritts<br />
beziehen müsse, da sich das Opfer möglicherweise in voller Kenntnis<br />
des Risikos und der Tragweite seiner Entscheidung in die Gefahrensituation<br />
begeben habe.<br />
S. aber auch BGHSt 37, 179: Der Schutzzweck des Betäubungsmittelstrafrechts<br />
verlangt eine Einschränkung des Prinzips der Selbstverantwortung<br />
und der Grundsätze zur bewussten Selbstgefährdung.<br />
BGH NStZ 1984, 452: Der Fall behandelt die Frage nach der Strafbarkeit<br />
des Unterlassens der Hinzuziehung eines Notarztes nach Eintritt<br />
© Eisenbeis Rechtsanwaltsges. mbH/RA Dr. U. Schlegel 2006
Lernprogramm Strafrecht <strong>2.</strong> <strong>Teil</strong><br />
20<br />
______________________________________________________________________________<br />
der Bewusstlosigkeit des Drogenkonsumenten. Der BGH vertritt hier<br />
die Auffassung, dass derjenige, der einem anderen Heroin überlassen<br />
hat, als Garant nach § 13 zu Rettungsmaßnahmen verpflichtet ist,<br />
wenn der eigenverantwortlich handelnde Drogensüchtige das Bewusstsein<br />
verliert und Gefahr für sein Leben besteht (sehr umstr.!)<br />
OLG Düsseldorf NStZ-RR 1997, 325 [Autosurfen]: Das Gericht geht<br />
auf die Frage der eigenverantwortlichen Selbstgefährdung nicht näher<br />
ein und behandelt lediglich die Frage nach dem Vorliegen der Voraussetzungen<br />
des § 228.<br />
BGHSt 39, 322 [Zur Zurechenbarkeit einer fahrlässigen Tötung bei<br />
Brandstiftung]: Unternimmt bei einer Brandstiftung ein Dritter Rettungshandlungen<br />
und kommt dabei zu Tode, so kann dieser Erfolg<br />
dem Täter der Brandstiftung als fahrlässige Tötung zugerechnet werden.<br />
Der BGH führt in den Entscheidungsgründen zur Frage der Zurechenbarkeit<br />
aus: "Einer Einschränkung des Grundsatzes der Straffreiheit<br />
wegen bewusster Selbstgefährdung des Opfers bedarf es insbesondere<br />
dann, wenn der Täter durch seine deliktische Handlung die naheliegende<br />
Möglichkeit einer bewussten Selbstgefährdung dadurch schafft,<br />
dass er ohne Mitwirkung und ohne Einverständnis des Opfers eine erhebliche<br />
Gefahr für ein Rechtsgut des Opfers oder ihm nahestehende<br />
Personen begründet und damit für dieses ein einsichtiges Motiv für gefährliche<br />
Rettungsmaßnahmen schafft."<br />
BGH NStZ 2001, 416, 417: „Im Übrigen will es der Senat aber dabei<br />
belassen, dass der Angekl. C die Folgen in ihrem Gewicht im Wesentlichen<br />
voraussehen konnte, weil aufgrund der von ihm erkannten<br />
Gefährlichkeit des Opfers die Annahme naheliegend war, dass sich<br />
dieser zur Wehr setzen würde und daraus eine Notwehrlage entstehen<br />
könnte. Zutreffend wäre freilich die Annahme gewesen, dass in solche<br />
Konstellationen dem Provokateur der Erfolg nicht objektiv zurechenbar<br />
ist, weil der Angreifer eigenverantwortlich handelt.“<br />
OLG Rostock, NStZ 2001, 199, 200: Die Zurechnung [hier: einer<br />
Brandstiftung] scheitert an dem Umstand, dass der Schaden von voll<br />
verantwortlichen fremden, mit direktem Vorsatz handelnden Tätern<br />
ausgeführt worden ist (der Zurechnung steht das „Verantwortungsprinzip“<br />
entgegen!).<br />
OLG Celle, StV 2002, 366 [fehlende Zurechnung bei Verweigerung<br />
des Verletzten, in Operation einzuwilligen?]: Das OLG Celle befasst<br />
sich mit der Frage einer Strafbarkeit nach § 22<strong>2.</strong> Das Opfer eines Unfalles<br />
im Straßenverkehr hatte sich mit Blick auf eine Mortalitätsrate<br />
von 5 – 15 % nicht mit einem operativen Eingriff einverstanden erklärt<br />
und war ca. 2 Monate nach dem Unfallereignis verstorben.<br />
Das OLG Celle bejaht die Vorhersehbarkeit des (konkreten) Todeseintritts.<br />
Für die Voraussehbarkeit komme es entscheidend darauf an,<br />
dass der tödliche Erfolg im Rahmen der möglichen Wirkungen einer<br />
verkehrswidrigen Handlung liege und sich innerhalb des durch die<br />
pflichtwidrige Erstverletzung geschaffenen Ausgangsrisikos bewege.<br />
Mit Blick auf die Zurechenbarkeit des (Todes-)Erfolges verneint das<br />
OLG einen möglichen Zurechnungsausschluss unter dem Gesichts-<br />
© Eisenbeis Rechtsanwaltsges. mbH/RA Dr. U. Schlegel 2006
Lernprogramm Strafrecht <strong>2.</strong> <strong>Teil</strong><br />
21<br />
______________________________________________________________________________<br />
punkt der bewussten Selbstgefährdung. Zwar sei das Opfer im vorliegend<br />
entschiedenen Falle durch das deliktische Verhalten des Täters<br />
zu einer sich selbst gefährdenden Handlung (Operationsverweigerung)<br />
veranlasst worden. Es bedürften die Grundsätze der Straffreiheit des<br />
Täters unter dem Blickwinkel bewusster Selbstschädigung des Opfers<br />
allerdings dann einer Einschränkung, wenn der Täter durch die deliktische<br />
Handlung die naheliegende Möglichkeit einer bewussten<br />
Selbstgefährdung dadurch schafft, dass er ohne Mitwirkung und<br />
ohne Einverständnis des Opfers eine erhebliche Gefahr für ein<br />
Rechtsgut des Opfers begründet und damit ein einsichtiges Motiv<br />
für sich anschließende gefährliche Maßnahmen des Opfers<br />
schafft. Obwohl das Opfer eigenverantwortlich die weitere Behandlung<br />
(Operation und damit verbundene Diagnose) abgelehnt hatte, sei dies<br />
– so das OLG – unter Berücksichtigung der Mortalitätsrate für die Operation<br />
nicht als „offenkundig unvernünftig“ anzusehen.<br />
12 Die Risikoerhöhungslehre<br />
υ Klausurhinweis: Der geschilderte Meinungsstreit darf in einer Examensklausur<br />
nicht allzu breit behandelt werden. Nach h.M. ist die Risikoerhöhungslehre<br />
mit Grundgedanken der Rechtsordnung unvereinbar<br />
und daher abzulehnen.<br />
Der Streit um die Risikoerhöhungslehre ist "einzubauen" bei der Prüfung<br />
der objektiven Zurechnung (s.o. Prüfungsschema 2, Prüfungspunkt<br />
3).<br />
a) Mindermeinung (Risikoerhöhungslehre): erblickt das maßgebliche<br />
Zurechnungskriterium darin, die Erfolgszurechnung ganz allgemein<br />
davon abhängig zu machen, ob sich ein vom Täter geschaffenes oder<br />
gesteigertes Risiko im Schadenserfolg realisiert - Bejahung der objektiven<br />
Zurechenbarkeit des Erfolges im Zweifelsfalle bereits dann, wenn<br />
die Wahrscheinlichkeit seines Eintritts bei pflichtgemäßem Täterverhalten<br />
geringer gewesen wäre.<br />
b) Kritik der h.M. (z.B. BGHSt 37, 106, 127 – zum Ursachenzusammenhang<br />
zwischen der Beschaffenheit eines Produkts und Gesundheitsbeeinträchtigungen<br />
seiner Verbraucher): Verstoß gegen den Grundsatz<br />
in dubio pro reo; Umdeutung von Verletzungsdelikten contra legem<br />
in konkrete Gefährdungsdelikte.<br />
© Eisenbeis Rechtsanwaltsges. mbH/RA Dr. U. Schlegel 2006
Lernprogramm Strafrecht <strong>2.</strong> <strong>Teil</strong><br />
22<br />
______________________________________________________________________________<br />
BGH, a.a.O.: „Ursächlichkeit liegt bei den (unechten) Unterlassungsdelikten<br />
vor, wenn bei Vornahme der pflichtgemäßen Handlung der tatbestandsmäßige<br />
Schadenserfolg ausgeblieben wäre, dieser also entfiele,<br />
wenn jene hinzugedacht würde (…). Der im Schrifttum weithin<br />
vertretenen Auffassung, es genüge bereits, dass die Vornahme der unterlassenen<br />
Handlung das Risiko des Erfolgseintritts (erheblich) vermindert<br />
hätte (dies entspricht der sog. Risikoerhöhungstheorie …), ist<br />
die Rechtsprechung bisher nicht gefolgt. Soweit sie [die Rechtsprechung]<br />
verlangt, dass durch die gebotene Handlung der Schadenserfolg<br />
›mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit‹ vermieden worden<br />
wäre (…), ist damit nicht gemeint, dass der Zusammenhang zwischen<br />
Ursache und Erfolg hier weniger eng zu sein brauche, als er<br />
sonst – bei der Ursächlichkeit positiven Tuns – vorausgesetzt wird;<br />
vielmehr liegt darin nur die überkommene Beschreibung des für die<br />
richterliche Überzeugung erforderlichen Beweismaßes.“<br />
13 Obj. Zurechnung: Kriterium Risikoverringerung<br />
Unterscheiden Sie bitte die folgenden Fallkonstellationen (s. W/B, AT,<br />
RN 193 ff.):<br />
a) 1. Fall: Bei einem bereits angelegten Kausalverlauf wird das Verletzungsrisiko<br />
für den Betroffenen oder der Umfang des drohenden<br />
Schadens gemindert durch Abschwächung nachteiliger Wirkungen<br />
ohne Begründung einer eigenständigen Gefahr - hier fehlt es an der<br />
objektiven Zurechnung: Dem "Täter" als "Risikoverringerer" darf der<br />
Verletzungserfolg (trotz der Mitursächlichkeit seines Eingreifens) schon<br />
objektiv nicht zugerechnet werden, weil sein Verhalten für den Betroffenen<br />
keine rechtlich missbilligte Gefahr geschaffen hat.<br />
b) <strong>2.</strong> Fall: Rettungswilliger begründet eine neue, eigenständige Gefahr,<br />
die sich in dem von ihm verursachten Verletzungserfolg widerspiegelt:<br />
• objektive Zurechnung (+)<br />
• u.U. Rechtfertigungsgrund (mutmaßliche Einwilligung, § 34)<br />
• u.U. fehlender Vorsatz - je nach Fallgestaltung<br />
© Eisenbeis Rechtsanwaltsges. mbH/RA Dr. U. Schlegel 2006
Lernprogramm Strafrecht <strong>2.</strong> <strong>Teil</strong><br />
23<br />
______________________________________________________________________________<br />
14 Obj. Bedingungen der Strafbarkeit (s.o. Prüfschema 1, I.<br />
3.)<br />
Abschließende Aufzählung (h.M.):<br />
• § 186 (Nichterweislichkeit)<br />
• § 231 (schwere Folge)<br />
• § 323 a (rechtswidrige Tat)<br />
• §§ 283 VI, 283 d IV (Zahlungseinstellung usw.)<br />
• § 113 III (Rechtmäßigkeit der Diensthandlung) - str.<br />
15 Rechtswidrigkeit (vgl. o. RN 8 II)<br />
Es ist wie folgt zu unterscheiden:<br />
a) Einwilligung i.w.S.<br />
• Einverständnis: wirkt tatbestandsausschließend (z.B. §§ 177, 239,<br />
249)<br />
• Einwilligung i.e.S.: wirkt rechtfertigend (z.B. § 303)<br />
υ Merke: Die Einwilligung als Einverständnis schließt schon den Tatbestand<br />
aus, wo dieser die Überwindung des Willens eines anderen<br />
voraussetzt.<br />
b) Sog. offene Tatbestände - diese erfordern eine gesonderte Prüfung<br />
der Rechtswidrigkeit: §§ 240 II, 253 II<br />
16 Schuldfähigkeit (vgl. o. RN 8 III 1)<br />
• 0 –13: § 19 StGB – Straffreiheit<br />
• 14 -17 : § 3 JGG (i.V.m. § 1 II JGG) = Jugendlicher<br />
• 18 – 20: § 105 JGG (i.V.m. § 1 II JGG) = Heranwachsender<br />
Daneben sind zu beachten: §§ 20, 21<br />
© Eisenbeis Rechtsanwaltsges. mbH/RA Dr. U. Schlegel 2006
Lernprogramm Strafrecht <strong>2.</strong> <strong>Teil</strong><br />
24<br />
______________________________________________________________________________<br />
17 Spezielle Schuldmerkmale (vgl. o. RN 8 III 2)<br />
a) Grundsätze<br />
• Ihre Eigenschaft besteht nach Auffassung der h.L. darin, dass sie unmittelbar<br />
und ausschließlich den in der Tat zum Ausdruck kommenden<br />
Gesinnungsunwert näher charakterisieren (z.B. "Böswilligkeit" in § 225<br />
I; "Rücksichtslosigkeit" in § 315 c); die Rechtsprechung sieht in den<br />
Schuldmerkmalen sog. subj. Unrechtselemente - zu den Konsequenzen<br />
für den Klausuraufbau s.u. b)!<br />
• Im <strong>Teil</strong>nahmebereich ist § 29 zu beachten!<br />
b) Klausuraufbau<br />
- Rspr.: Nach dem Vorsatz prüfen (innerhalb Tatentschluss)<br />
- h.L.: Nach der Schuldfähigkeit prüfen<br />
18 Erscheinungsformen des Tatbestandsvorsatzes<br />
a) Übersicht 4: Erscheinungsformen des Tatbestandsvorsatzes<br />
Tatbestandsvorsatz<br />
Absicht (d.d. 1.<br />
Grades)<br />
Direkter Vorsatz<br />
(d.d. <strong>2.</strong> Grades)<br />
Eventualvorsatz<br />
Erläuterungen zur Übersicht 4:<br />
• Absicht (= dolus directus 1. Grades): Wenn es dem Täter gerade darauf<br />
ankommt, den Eintritt des tatbestandlichen Erfolges herbeizuführen<br />
(zielgerichteter Erfolgswille).<br />
• Direkter Vorsatz (= d.d. <strong>2.</strong> Grades): Wenn der Täter weiß oder als sicher<br />
voraussieht, dass sein Handeln zur Verwirklichung des gesetzlichen<br />
Tatbestandes führt.<br />
© Eisenbeis Rechtsanwaltsges. mbH/RA Dr. U. Schlegel 2006
Lernprogramm Strafrecht <strong>2.</strong> <strong>Teil</strong><br />
25<br />
______________________________________________________________________________<br />
• Eventualvorsatz (= bedingter Vorsatz): Wenn der Täter es ernstlich<br />
für möglich hält und sich damit abfindet, dass sein Verhalten zur<br />
Verwirklichung des gesetzlichen Tatbestandes führt.<br />
b) Problem: Abgrenzung Eventualvorsatz und bewusste Fahrlässigkeit<br />
υ Klausurhinweis: Zahlreiche Examensklausuren verlangen von Ihnen<br />
eine exakte Begründung der jeweiligen Erscheinungsform des Tatbestandsvorsatzes,<br />
insbesondere soweit es die Formen Eventualvorsatz<br />
und bewusste Fahrlässigkeit betrifft. Bitte beachten Sie: Allein eine<br />
strikte Orientierung an den im Sachverhalt geschilderten Fallumständen<br />
garantiert eine zumindest vertretbare Begründung und sichert so<br />
den Klausurerfolg. Um Ihnen die Arbeit am Fall zu erleichtern, habe ist<br />
nachfolgend unter c) eine breit gefächerte Kasuistik aufgezeigt, deren<br />
Einzelheiten Sie keineswegs auswendig beherrschen müssen; Sie sollten<br />
aber auf diesem Weg ein Gefühl für die "richtige" Entscheidung im<br />
Einzelfall entwickeln lernen!<br />
aa)<br />
Nach Auffassung der Rspr. und der h.L. sind drei Elemente des Eventualvorsatzes<br />
zu berücksichtigen -<br />
Prüfungsschema 3: Vorliegen von Eventualvorsatz<br />
1. Erkennen der konkret drohenden Gefahr einer Rechtsgutsverletzung<br />
<strong>2.</strong> Ernstnehmen der Gefahr<br />
3. Abfinden mit dem Risiko der Tatbestandsverwirklichung ("billigen"/<br />
"billigendes in Kauf nehmen")<br />
Für die Rechtsprechung spricht man auch von der sog. Einwilligungs-<br />
oder Billigungstheorie (s. BGHSt 36, 1, 9 f. - bitte nachlesen!). Der<br />
Vorsatz verfügt danach über ein Wissens- u n d ein Willenselement.<br />
bb) Mindermeinungen: Möglichkeitstheorie, Wahrscheinlichkeitstheorie,<br />
Gleichgültigkeitstheorie (Auffassungen verzichten auf das Willenselement<br />
des Vorsatzes, vgl. W/B, AT, RN 217 f.)<br />
© Eisenbeis Rechtsanwaltsges. mbH/RA Dr. U. Schlegel 2006
Lernprogramm Strafrecht <strong>2.</strong> <strong>Teil</strong><br />
26<br />
______________________________________________________________________________<br />
c) Die Rechtsprechung in Einzelfällen<br />
υ Klausurhinweis: Rechtsprechungsfälle sind stets Beispielsfälle. Man<br />
darf nicht auf vermeintliche Ähnlichkeiten des Klausurfalles mit einer<br />
Rechtsprechungsentscheidung "hereinfallen"!<br />
(1) Grundprinzip: Möglichkeit des Erfolges erkennen und billigen<br />
ausreichend<br />
Messerstichfall (BGH MDR 1980, 812), Beilwurffall (BGH JZ 1981, 35):<br />
"Möglichkeit des Erfolgs erkennen und billigen" - Eventualvorsatz<br />
liegt vor, wenn der Täter den Eintritt des Erfolges als möglich und nicht<br />
ganz fernliegend erkennt und billigt.<br />
(2) Grundsatz: Vorsatz auch, wenn Erfolg unerwünscht<br />
BGHSt 7, 363 [Lederriemen-Fall]: Der Täter kann auch einen solchen<br />
Erfolg billigen, der ihm an sich unerwünscht ist.<br />
(3) Grundsatz: Hohe Hemmschwelle hindert u.U. Vorsatz<br />
Der BGH verneint bei Tötungsdelikten dolus eventualis mit Hinweis auf<br />
die hohe Hemmschwelle vor dem Tötungsvorsatz (s. aber auch u.<br />
(6)!) –<br />
BGH NStZ 1988, 361: Bei Tötungshandlungen ist der Schluss von der<br />
Lebensgefährlichkeit des Handelns auf bedingten Tötungsvorsatz<br />
grundsätzlich möglich. Da vor dem Tötungsvorsatz eine viel höhere<br />
Hemmschwelle steht als vor dem Gefährdungs- oder Verletzungsvorsatz<br />
bedarf dieser Schluss jedoch besonders sorgfältiger Prüfung.<br />
Denn auch bei objektiv gefährlichem Verhalten kann es im Einzelfall so<br />
liegen, dass der Täter die Gefahr der Tötung überhaupt nicht erkennt<br />
oder jedenfalls ernsthaft, nicht nur vage, darauf vertraut, ein solcher<br />
Erfolg werde nicht eintreten.<br />
BGH NStZ 2003, 259: Soweit die Vorinstanz von einem bedingten Tötungsvorsatz<br />
ausgegangen war, ist der BGH der Auffassung, dass die<br />
Ausführungen des Landgerichts zum Willenselement des bedingten<br />
Vorsatzes durchgreifenden rechtlichen Bedenken begegnen. Die Erkenntnis,<br />
dass der Transport eines bis zur Regungslosigkeit schwerverletzten,<br />
dringend ärztliche Hilfe bedürftigen Menschen unter den<br />
konkreten Umständen des Falles dessen Tod zur Folge haben kann,<br />
© Eisenbeis Rechtsanwaltsges. mbH/RA Dr. U. Schlegel 2006
Lernprogramm Strafrecht <strong>2.</strong> <strong>Teil</strong><br />
27<br />
______________________________________________________________________________<br />
ist nach Einschätzung des BGH nicht derart grundlegend, dass die Angeklagten<br />
nicht darauf vertrauen durften, dass der Geschädigte diese<br />
Handlung überleben werde; demzufolge sei nur der Vorwurf der (bewussten)<br />
Fahrlässigkeit begründet. Im Grenzbereich zur bewussten<br />
Fahrlässigkeit bedürfe jedoch die Feststellung des Willenselements einer<br />
umfassenden Gesamtschau aller objektiven und subjektiven Tatumstände.<br />
Erhöhte Anforderungen seien insbesondere dann zu stellen,<br />
wenn ein risikobehaftetes Handeln erkennbar auch von dem Ziel<br />
der Rettung eines von Dritten geschädigten Opfers bestimmt ist.<br />
BGH NStZ-RR 1996, 97 [Polizeisperren-Fall]: Der BGH führt aus, dass<br />
er bereits wiederholt auf die Erfahrung hingewiesen habe, dass es in<br />
den Fällen, in denen Kraftfahrer eine Polizeisperre durchbrechen, um<br />
zu fliehen, den bedrohten Polizeibeamten meist gelinge, sich außer<br />
Gefahr zu bringen, und dass die Täter im allgemeinen mit einer derartigen<br />
Reaktion der Beamten rechneten.<br />
BGH NStZ-RR 2000, 328: Bei äußerst gefährlichen Gewalthandlungen<br />
liegt es besonders nahe, dass der Täter auch mit der Möglichkeit, dass<br />
das Opfer zu Tode kommen könne rechnet und, weil er gleichwohl sein<br />
gefährliches Handeln beginnt oder fortsetzt, einen solchen Erfolg billigend<br />
in Kauf nimmt. Andererseits ist angesichts der hohen Hemmschwelle<br />
gegenüber einer Tötung immer die Möglichkeit in Betracht zu<br />
ziehen, dass der Täter die Gefahr der Tötung nicht erkennt oder darauf<br />
vertraut hat, ein solcher Erfolg werde nicht eintreten [hier: Tötungsvorsatz<br />
verneint trotz Zurücklassens des bewusstlosen Opfers auf freiem<br />
Feld bei niedrigen Außentemperaturen von 6° C]. Zum Kriterium „äußerste<br />
Gefährlichkeit s. auch u. (6).<br />
S. auch BGH NStZ 2001, 475, 476 [Stromschlag-Fall - bitte nachlesen!]<br />
S. aber LG Trier NStZ-RR 2001, 271: Für den Angehörigen einer Kultur,<br />
in der – unter bestimmten Voraussetzungen – die Tötung eines<br />
Menschen geradezu zum Gebot werden kann, ist die Hemmschwelle,<br />
den Tod eines Menschen als mögliche Folge einer als Strafe für erlittene<br />
Ehrkränkungen ausgeübten Gewalt in Kauf zu nehmen, niedriger<br />
anzusetzen, als für Angehörige eines anderen Kulturkreises.<br />
BGH NJW 2006, 386 [Tötungsvorsatz bei Misshandlungen, Fall Karolina]:<br />
Die offen zu Tage tretende Lebensgefährlichkeit einer Körperverletzung<br />
indiziert zwar wegen der grundsätzlich anzunehmenden höheren<br />
Hemmschwelle gegenüber der Tötung eines Menschen für sich<br />
genommen noch nicht zwingend ein Handeln mit bedingtem Tötungsvorsatz.<br />
Entsprechende Rückschlüsse auf die subjektive Tatkomponente<br />
kommen aber in Betracht, wenn das Opfer wiederholt in lebensbedrohender<br />
Weise hemmungslos und gleichwohl systematisch misshandelt<br />
wird.<br />
(4) Grundsatz: Keine Hemmschwelle bei Unterlassen<br />
BGH NJW 1992, 583 [Fahrerflucht-Fall]: Im Blick auf die besonders<br />
hohe Hemmschwelle vor dem Tötungsvorsatz gilt dies jedoch vornehmlich<br />
für gefährliche Gewalttätigkeiten ohne nachvollziehbares Tötungsmotiv.<br />
In Fällen des Unterlassens bestehen dagegen generell<br />
keine psychologisch vergleichbaren Hemmschwellen vor einem Tötungsvorsatz<br />
wie bei positivem Tun. Vor allem bei unterlassener Hilfe-<br />
© Eisenbeis Rechtsanwaltsges. mbH/RA Dr. U. Schlegel 2006
Lernprogramm Strafrecht <strong>2.</strong> <strong>Teil</strong><br />
28<br />
______________________________________________________________________________<br />
leistung nach schuldhaftem Vorverhalten greift dieses psychologische<br />
Moment wegen der typischen gegenläufigen Selbstschutzmotive nicht<br />
Platz. Für diese Fälle kommt eine bedingt vorsätzliche Tötung durch<br />
Unterlassen auch dann in Betracht, wenn dem Täter der Eintritt des<br />
Todes an sich unerwünscht ist, er ihn aber, um unerkannt zu bleiben<br />
und Unfallflucht begehen zu können, gleichwohl in dem Sinne gebilligt<br />
hat, dass er sich damit bewusst abgefunden hat.<br />
(5) Grundsatz: „Fürmöglichhalten“ nicht ausreichend<br />
BGH NStZ 1988, 175: Das "Inkaufnehmen" darf aber nicht aus dem<br />
bloßen "Fürmöglichhalten" hergeleitet werden.<br />
(6) Grundsatz: „Äußerste“ Gefährlichkeit als Indiz<br />
BGHSt 36, 1, 10 [AIDS-Fall]: Für den Nachweis bedingten Vorsatzes<br />
kann insbesondere an die vom Täter erkannte objektive Größe und<br />
Nähe der Gefahr angeknüpft werden [hier vereint].<br />
BGH NStZ 1994, 483 [Molotowcocktails auf Asylbewerberheim]: Bedingt<br />
vorsätzliches Handeln setzt voraus, dass der Täter den Eintritt<br />
des tatbestandlichen Erfolges als möglich und nicht ganz fernliegend<br />
erkennt, ferner dass er ihn billigt oder sich des erstrebten Zieles willen<br />
mit der Tatbestandsverwirklichung abfindet. Bei äußerst gefährlichen<br />
Gewalthandlungen liegt es nahe, dass der Täter mit der Möglichkeit<br />
eines tödlichen Ausgangs rechnet. Im Einzelfall ist es allerdings denkbar,<br />
dass er alle Umstände kennt, die sein Vorgehen zu einer das Leben<br />
gefährdenden Behandlung machen, sich - infolge einer psychischen<br />
Beeinträchtigung - aber gleichwohl nicht bewusst ist, dass sein<br />
Tun zum Tod des Opfers führen kann [im konkreten Fall bejaht der<br />
BGH bedingten Vorsatz!].<br />
BGH NStZ 1994, 584: Die Entscheidung darüber, ob der vorgestellte<br />
Ablauf des Geschehens einem tödlichen Ausgang so nahe ist, dass<br />
nur noch ein glücklicher Zufall diesen verhindern kann, das Vertrauen<br />
auf ein Ausbleiben des tödlichen Ausgangs mithin kaum vorstellbar ist,<br />
kann bei Brandanschlägen auf ein von Menschen bewohntes Gebäude<br />
nicht allgemein getroffen werden, sondern hängt von den Umständen<br />
des Einzelfalles ab.<br />
BGH NStZ 2006, 169: Äußerst gefährliche Gewalthandlungen (hier:<br />
Messerstiche in Brustkorb und Rumpf) legen bedingten Tötungsvorsatz<br />
derart nahe, dass der Tatrichter seine aus dem objektiven Tatgeschehen<br />
abgeleiteten Schlussfolgerungen auf den Tötungsvorsatz im Urteil<br />
nur dann näher begründen muss, wenn gegenläufige besondere Umstände<br />
(hier: erhebliche Alkoholisierung, affektive Erregung) hieran<br />
Zweifel wecken können.<br />
© Eisenbeis Rechtsanwaltsges. mbH/RA Dr. U. Schlegel 2006
Lernprogramm Strafrecht <strong>2.</strong> <strong>Teil</strong><br />
29<br />
______________________________________________________________________________<br />
Ebenso entscheidet BGH NStZ 1997, 434 [gegen Kopf und Körper<br />
eines Kindes angewendete Gewalt] und BGH NStZ 1999, 507 [Gashahn-Fall<br />
- bitte nachlesen!]. S. auch BGH NStZ 2001, 475, 476<br />
[Stromschlag-Fall]<br />
Wie sehr es auf den Einzelfall ankommt, unterstreichen die nachfolgenden<br />
Entscheidungen –<br />
BGH NStZ 2000, 165 [Döner]: Bei äußerst gefährlichen Gewalthandlungen<br />
liegt es nahe, dass der Täter mit der Möglichkeit eines tödlichen<br />
Ausgangs rechnet. Die Billigung des Todeserfolges bedarf jedoch wegen<br />
der hohen Hemmschwelle gegenüber der Tötung der sorgfältigen<br />
Prüfung unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles. Auch<br />
insoweit stellt die Lebensbedrohlichkeit gefährlicher Gewalthandlungen<br />
ein gewichtiges Indiz dar. Ferner sind die konkrete Angriffsweise, die<br />
psychische Verfassung des Täters bei der Tatbegehung sowie seine<br />
Motivation bei der Beweiswürdigung mit einzubeziehen.<br />
BGH NStZ 2000, 583 [SM-Fall]: Hält der Täter den Eintritt des tatbestandlichen<br />
Erfolges für möglich und setzt er sein Handeln dennoch<br />
fort, liegt es bei äußerst gefährlichem Tun [hier: Übergießen eines<br />
Menschen mit Benzin und „Spielen“ mit Feuerzeug] nahe, dass er den<br />
Eintritt des Erfolges billigend in Kauf nimmt [hier bejaht].<br />
BGH NStZ-RR 1997, 233 [Schaufel-Fall]: Die Tatsache, dass die Tat<br />
durch eine lebensgefährliche Gewalthandlung begangen wird, zwingt<br />
nicht zu dem Schluss, Tötungsvorsatz habe vorgelegen [hier: Täter<br />
versetzte Opfer mit einer schweren Schaufel Schläge, wobei er die<br />
Schaufel mit beiden Händen im hinteren Stielbereich hielt, einen<br />
Schlag in den Schulterbereich und danach in schneller Folge drei<br />
Schläge auf die Stirn- und Scheitelregion im behaarten Bereich ausführte].<br />
Entscheidend war die Bewertung des Vorgehens des Täters<br />
als situativspontane Eskalation einer harmlos begonnenen Auseinandersetzung,<br />
für die ein einsichtiges Tatmotiv fehlte.<br />
BGH NStZ 2001, 86 [u.a. zu der Frage des bedingten Vorsatzes bei<br />
möglicher Bewussteinsstörung zum Tatzeitpunkt]: Das LG hätte im<br />
Rahmen einer Gesamtabwägung wesentlicher Tatumstände solche<br />
stärker in Rechnung zu stellen gehabt, die gegen die Annahme sprechen,<br />
das Persönlichkeitsgefüge des Angeklagten sei so schwer erschüttert<br />
gewesen, dass eine tiefgreifende Bewusstseinsstörung eingetreten<br />
sei. Das gilt vor allem für die Gestaltung der eigentlichen Tat<br />
durch den Angeklagten. Er hat seiner vom LG übernommenen Tatschilderung<br />
zufolge nicht spontan gehandelt. Das Beibringen der<br />
Schlaftabletten mit Hilfe der Kaffeezubereitung stellte ein mehraktiges,<br />
länger hingezogenes Geschehen dar, das der Planung und Beherrschung<br />
des verhältnismäßig komplexen Ablaufs bedurfte. Das LG hat<br />
insoweit [zu § 224] sogar das gesetzliche Merkmal des hinterlistigen<br />
Überfalls bejaht, was voraussetzt, dass der Täter in einer auf Verdeckung<br />
seiner wahren Absichten berechneten Weise vorgeht.<br />
LG Rostock NStZ 1997, 391 verneint bedingten Tötungsvorsatz bei<br />
wuchtigem Werfen eines 20 kg schweren Gullydeckels aus Brusthöhe<br />
des Täters nach dem Kopf des Opfers(!).<br />
© Eisenbeis Rechtsanwaltsges. mbH/RA Dr. U. Schlegel 2006
Lernprogramm Strafrecht <strong>2.</strong> <strong>Teil</strong><br />
30<br />
______________________________________________________________________________<br />
BGH NStZ-RR 1997, 199: Wenn der Täter sein Opfer in so nachhaltiger<br />
und heftiger Weise immer wieder würgt und danach unter Einsatz<br />
eines zur Tötung geeigneten Werkzeugs massiv drosselt, kann er nicht<br />
darauf vertrauen, dass er das Opfer nur verletzt oder lediglich betäubt,<br />
sondern er nimmt hierbei zumindest billigend in Kauf, dieses auch zu<br />
töten.<br />
BGH NStZ-RR 1997, 35: Hat der Täter mehrfach auf sein Opfer [ungezielt]<br />
eingestochen, so ist die Annahme, er habe dabei zunächst mit<br />
Verletzungs-, dann aber mit Tötungsvorsatz gehandelt, wenig lebensnah.<br />
BGH NStZ-RR 2001, 369 [besonders gefährliche Gewalthandlungen<br />
gegenüber Kleinkind]: „Auch das voluntative Moment des bedingten<br />
Vorsatzes hat das LG letztlich ausreichend festgestellt. Das LG hat auf<br />
die In-Kauf-Nahme des Todeserfolges aus der offensichtlichen Lebensbedrohlichkeit<br />
der Handlung geschlossen. Dies ist hier aus<br />
Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Dem äußeren Tatgeschehen<br />
kam hier ein hoher Indizwert zu ...“<br />
BGH NStZ 2005, 92: Das Vertrauen auf ein Ausbleiben des tödlichen<br />
Erfolgs ist zu verneinen, wenn der vorgestellte Ablauf eines Geschehens<br />
einem tödlichen Ausgang so nah ist, dass nur noch ein glücklicher<br />
Zufall diesen verhindern kann.<br />
(7) Grundsatz: Mögliche Relevanz von Nachtatverhalten<br />
BGH NStZ 1999, 454 [Todesdrohungen nach der Tat]: Grundsätzlich<br />
ist es rechtlich möglich, wenn die Frage des Tötungsvorsatzes aus<br />
dem Nachtatverhalten des Angeklagten hergeleitet und auf dessen<br />
Äußerungen bei oder nach der Festnahme gestützt wird. Da es sich<br />
um spontane Äußerungen handelt, liegt es nicht fern, dass sie subjektive<br />
Seite des Tatgeschehen zutreffend widerspiegeln [bitte nachlesen!].<br />
BGH NStZ 2001, 86 [Schlaftabletten- und Kabel-Fall]: Möglicher<br />
Rückschluss auf Tötungsvorsatz durch anschließendes tatsächlich<br />
todbringendes Verhalten des Täters.<br />
© Eisenbeis Rechtsanwaltsges. mbH/RA Dr. U. Schlegel 2006
Lernprogramm Strafrecht <strong>2.</strong> <strong>Teil</strong><br />
31<br />
______________________________________________________________________________<br />
υ Merke: Eventualvorsatz liegt dann vor, wenn der Täter sich auch<br />
durch die naheliegende Möglichkeit des Erfolgseintritts nicht von der<br />
Tatausführung hat abhalten lassen und sein Verhalten den Schluss<br />
rechtfertigt, dass er sich um des von ihm erstrebten Zieles willen mit<br />
dem Risiko der Tatbestandsverwirklichung abgefunden hatte, also eher<br />
zur Hinnahme dieser Folge bereit war als zum Verzicht auf die Vornahme<br />
der Handlung. Bewusste Fahrlässigkeit ist hingegen dann<br />
anzunehmen, wenn der Täter fest darauf vertraut hat, dass "alles gut<br />
gehen" und dass es ihm gelingen werde, den drohenden Erfolgseintritt<br />
und die Verwirklichung des gesetzlichen Tatbestandes zu vermeiden<br />
(W/B, AT, RN 223). Bitte lesen Sie in diesem Zusammenhang bei W/B,<br />
a.a.O., RN 216 bis 225!<br />
19 Problem Alternativvorsatz<br />
Beispiel (nach W/B, AT, RN 231): Polizist P schießt auf den Straftäter<br />
S, der mit seinem Hund flüchtet. Dabei nimmt P in Kauf, den S<br />
(§§ 212, 211), mindestens aber dessen Hund zu töten (§ 303).<br />
a) Die h.M. will unter Bejahung von Idealkonkurrenz wegen aller konstruktiv<br />
erfassbaren Delikte bestrafen (= Tateinheit zwischen vollendeter<br />
und versuchter Vorsatztat bzw. dem Versuch beider Delikte).<br />
b) Nach W/B (a.a.O., RN 233 ff.) ist zu differenzieren:<br />
• Eintritt eines der beiden Erfolge: Bestrafung wegen des objektiv verwirklichten<br />
Delikts (Abgeltung der Versuchsstrafbarkeit des anderen<br />
Delikte bei Tatbeständen mit annähernd gleicher Schutzrichtung und<br />
Tatschwere);<br />
• Tateinheit, wenn anderes Delikt im Unrechtsgehalt wesentlich schwerer<br />
wiegt als die vollendete Vorsatztat oder bei höchstpersönlichen<br />
Rechtsgütern verschiedener Rechtsgutsträger);<br />
• Kein Delikt vollendet: Grds. ist wegen Versuchs des schwersten Delikts<br />
zu bestrafen (sonst Tateinheit).<br />
© Eisenbeis Rechtsanwaltsges. mbH/RA Dr. U. Schlegel 2006
Lernprogramm Strafrecht <strong>2.</strong> <strong>Teil</strong><br />
32<br />
______________________________________________________________________________<br />
20 Das Wissenselement des Tatbestandsvorsatzes (Details)<br />
a) Die Vorstellung des Täters muss umfassen<br />
• die konkrete Tat in ihren Grundzügen<br />
• die tatbestandsrelevanten Besonderheiten der Ausführungshandlung<br />
• den Eintritt des tatbestandlichen Erfolges<br />
• den Kausalverlauf in seinen wesentlichen Umrissen sowie<br />
• alle sonstigen Merkmale des objektiven Unrechtstatbestandes<br />
b) Nicht zu beziehen braucht sich der Vorsatz auf<br />
• die etwaig objektive Bedingung der Strafbarkeit<br />
• die Rechtswidrigkeit der Tat<br />
Achtung: Das Bewusstsein der Rechtswidrigkeit ist nach h.M. Bestandteil<br />
der Schuld (dazu später ausführlich).<br />
c) Bei den deskriptiven Merkmalen (s.o. RN 9) muss deren natürlicher<br />
Sinngehalt erfasst worden sein. Bei normativen Merkmalen (s.o. RN 9)<br />
muss der Täter den rechtlich-sozialen Bedeutungsgehalt des Tatumstandes<br />
nach Laienart richtig erfasst haben ("Parallelwertung in der<br />
Laiensphäre").<br />
Durchatmen! Sie haben nunmehr den zweiten <strong>Teil</strong> des Lernprogramms<br />
bearbeitet. Damit wollen wir zunächst den allgemeinen<br />
<strong>Teil</strong> des Strafrechts verlassen und uns einigen<br />
sehr klausurrelevanten Straftatbeständen des Besonderen<br />
<strong>Teil</strong>s zuwenden. Bevor Sie weiterarbeiten, lesen Sie bitte<br />
unbedingt noch einmal das Prüfungsschema 1 (Aufbau des<br />
vorsätzlichen <strong>Bege</strong><strong>hungsdelikt</strong>s - RN 8) durch.<br />
21 RN bleibt unbesetzt!<br />
© Eisenbeis Rechtsanwaltsges. mbH/RA Dr. U. Schlegel 2006