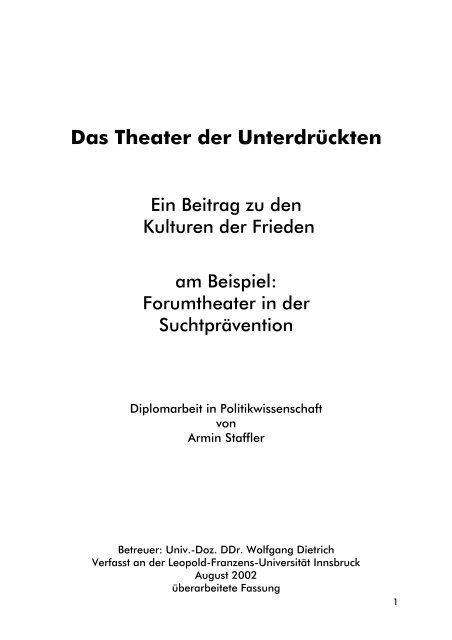1 Wie ich zum Theater der Unterdrückten kam oder ... - Armin Staffler
1 Wie ich zum Theater der Unterdrückten kam oder ... - Armin Staffler
1 Wie ich zum Theater der Unterdrückten kam oder ... - Armin Staffler
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Das <strong>Theater</strong> <strong>der</strong> <strong>Unterdrückten</strong><br />
Ein Beitrag zu den<br />
Kulturen <strong>der</strong> Frieden<br />
am Beispiel:<br />
Forumtheater in <strong>der</strong><br />
Suchtprävention<br />
Diplomarbeit in Politikwissenschaft<br />
von<br />
<strong>Armin</strong> <strong>Staffler</strong><br />
Betreuer: Univ.-Doz. DDr. Wolfgang Dietr<strong>ich</strong><br />
Verfasst an <strong>der</strong> Leopold-Franzens-Universität Innsbruck<br />
August 2002<br />
überarbeitete Fassung<br />
1
„Müßiger Leser! Ohne Eidschwur kannst du mir glauben, dass <strong>ich</strong><br />
wünschte, dieses Buch, als <strong>der</strong> Sohn meines Geistes, wäre das<br />
schönste, stattl<strong>ich</strong>ste und geistre<strong>ich</strong>ste, das s<strong>ich</strong> erdenken ließe.<br />
Allein <strong>ich</strong> konnte n<strong>ich</strong>t wi<strong>der</strong> das Gesetz <strong>der</strong> Natur aufkommen, in<br />
<strong>der</strong> ein jedes Ding seinesgle<strong>ich</strong>en erzeugt.“<br />
(Miguel de Cervantes Saavedra, Der sinnre<strong>ich</strong>e Junker Don Quijote<br />
von <strong>der</strong> Mancha, Vorrede)<br />
2
Inhaltsverze<strong>ich</strong>nis<br />
1 <strong>Wie</strong> <strong>ich</strong> <strong>zum</strong> <strong>Theater</strong> <strong>der</strong> <strong>Unterdrückten</strong> <strong>kam</strong> o<strong>der</strong> Warum diese Arbeit.........5<br />
2 Was ist <strong>Theater</strong>? ........................................................................................11<br />
2.1 human beings.....................................................................................15<br />
2.2 passion ...............................................................................................17<br />
2.3 platform..............................................................................................18<br />
2.3.1 Der ästhetische Raum...................................................................18<br />
3 Die Pädagogik ...........................................................................................21<br />
4 Das Dreieck <strong>der</strong> Gewalt nach Johan Galtung .............................................24<br />
5 Unterdrückung ..........................................................................................25<br />
6 Augusto Boal und das <strong>Theater</strong> <strong>der</strong> <strong>Unterdrückten</strong>.......................................32<br />
6.1 Teatro de Arena..................................................................................33<br />
6.2 Das Zeitungstheater............................................................................35<br />
6.2.1 Sieht so ein Mann aus? ................................................................37<br />
6.3 Statuentheater ....................................................................................39<br />
6.4 Von <strong>der</strong> Simultanen Dramaturgie <strong>zum</strong> Forumtheater...........................41<br />
6.5 Das Forumtheater ...............................................................................43<br />
6.5.1 Erarbeitungsphase........................................................................43<br />
6.5.2 Aufführungsphase ........................................................................45<br />
6.6 Das Uns<strong>ich</strong>tbare <strong>Theater</strong> .....................................................................55<br />
6.7 Die introspektiven Methoden...............................................................60<br />
6.7.1 Katharsis ......................................................................................61<br />
6.8 Legislatives <strong>Theater</strong>.............................................................................63<br />
7 Was ist Sucht? ...........................................................................................68<br />
7.1 Sucht und Konsum ..............................................................................70<br />
7.2 Sucht und Freiheit ...............................................................................73<br />
7.3 Sucht und Gewalt ...............................................................................75<br />
8 Suchtprävention.........................................................................................78<br />
8.1 Suchtprävention und <strong>Theater</strong>pädagogik ..............................................84<br />
8.2 Exkurs: Qualitätskriterien für präventive <strong>Theater</strong>arbeit.........................86<br />
9 Was hat das <strong>Theater</strong> <strong>der</strong> <strong>Unterdrückten</strong> mit Suchtprävention zu tun?..........89<br />
3
9.1 Methodenwahl....................................................................................93<br />
9.2 Zeitungstheater in <strong>der</strong> Suchtprävention ...............................................95<br />
9.2.1 Workshopmodell ..........................................................................96<br />
9.2.2 Praxis und Kommentar .................................................................98<br />
9.3 Forumtheater in <strong>der</strong> Suchtprävention ................................................100<br />
9.3.1 Forumtheater-Workshop „act it!“ mit <strong>der</strong> 4a <strong>der</strong> Hauptschule<br />
Gabelsbergerstraße/Innsbruck....................................................103<br />
9.3.2 Forumtheater-Workshop im Jugendzentrum Hopfgarten.............117<br />
10 Conclusio.............................................................................................121<br />
11 Anhang................................................................................................123<br />
11.1 Forumtheater am Schöpfwerk ........................................................123<br />
11.2 Fol<strong>der</strong> „act it!“ ...............................................................................124<br />
11.3 Infoblatt „act it!“ ............................................................................125<br />
11.4 Flyer zu “act it!” .............................................................................129<br />
12 Quellenverze<strong>ich</strong>nis ...............................................................................130<br />
12.1 Bibliographie .................................................................................130<br />
12.2 Zeitschriften und Broschüren..........................................................132<br />
12.3 an<strong>der</strong>e Quellen .............................................................................132<br />
12.4 Fotonachweis ................................................................................133<br />
4
1 <strong>Wie</strong> <strong>ich</strong> <strong>zum</strong> <strong>Theater</strong> <strong>der</strong> <strong>Unterdrückten</strong> <strong>kam</strong><br />
o<strong>der</strong> Warum diese Arbeit<br />
Im Juli 2002 jährt s<strong>ich</strong> <strong>zum</strong> siebten Mal meine erste Begegnung mit Formen und<br />
Methoden des <strong>Theater</strong>s <strong>der</strong> <strong>Unterdrückten</strong>. Im Rahmen eines mehrtägigen Workshops<br />
1 , <strong>der</strong> nur unter dem Titel „<strong>Theater</strong>“ angekündigt worden war, machte <strong>ich</strong><br />
Bekanntschaft mit einigen jungen Menschen, mit dem Workshopleiter Andreas<br />
Keckeis und mit den Ideen Augusto Boals. Die Wahl des Workshops fiel n<strong>ich</strong>t unvorbelastet<br />
anges<strong>ich</strong>ts meiner „theatralen“ Vergangenheit am Schultheatersektor<br />
mit Auftritten beim „Recontres Europeennes »Ecole et Creation«“, einem internationalen<br />
<strong>Theater</strong>festival <strong>der</strong> Jugend (1990, 1991) in Grenoble, und diversen<br />
Aufführungen in Innsbruck, sowie meinem Engagement beim Innsbrucker Laientheater<br />
<strong>der</strong> Leo-Bühne. Allerdings hatten die Inhalte des Workshops auf den ersten<br />
Blick wenig mit meinen bisherigen Erfahrungen gemein, da es s<strong>ich</strong> bei den<br />
Übungen, Spielen, Praktiken n<strong>ich</strong>t um die konventionellen Formen des <strong>Theater</strong>s<br />
handelte, und we<strong>der</strong> Proben noch eine Aufführung stattfanden. Alles, was<br />
meinem damaligen Vorstellungshorizont von <strong>Theater</strong> entsprach, war n<strong>ich</strong>t vorhanden.<br />
Es gab keine Texte, die auswendig gelernt werden mussten, es gab n<strong>ich</strong>t<br />
einmal ein Stück, es gab keine Kostüme o<strong>der</strong> Requisiten, es gab n<strong>ich</strong>t einmal eine<br />
Bühne, keinen Vorhang, es gab keine Regieanweisungen, weil es keinen Regisseur<br />
gab und wir hatten kein Publikum. Alles was wir hatten, waren wir selber. War das<br />
überhaupt <strong>Theater</strong> ?<br />
Wir spielten Maschinen- und Statuentheater, improvisierten aus unseren Familienalltagen<br />
heraus, schufen Vertrauen und Verständnis und gelangten im <strong>Theater</strong> zu<br />
Erlebnissen und Erfahrungen, die durch ihre Qualität einen beson<strong>der</strong>en Eindruck<br />
hinterließen. Am Ende hatten 12 Menschen aus Tschechien, <strong>der</strong> Slowakei,<br />
Ungarn, Polen, dem ehemaligen Jugoslawien, Deutschland und Österre<strong>ich</strong> mehr<br />
über einan<strong>der</strong> und vielle<strong>ich</strong>t auch s<strong>ich</strong> selbst erfahren als <strong>ich</strong> es mir auf einem<br />
1 Der Workshop fand während des „eurocamp 95“, einer Woche für junge Menschen aus Europa, die von <strong>der</strong><br />
Abteilung IV JUFF <strong>der</strong> Tiroler Landesregierung veranstaltet wurde, statt.<br />
5
an<strong>der</strong>en Weg vorstellen könnte. Die Sprache fiel weg, denn es hätte immer nur<br />
wenige gegeben, die einan<strong>der</strong> dadurch verstanden hätten. Was blieben waren<br />
Körper, Ges<strong>ich</strong>ter, Bewegungen, Haltungen, Geräusche, Phantasien und Gefühle,<br />
die s<strong>ich</strong>tbar und greifbar wurden. Es war <strong>Theater</strong> und das <strong>Theater</strong> war unsere<br />
Sprache. 2 Weiters blieb <strong>der</strong> Wunsch, mehr über dieses <strong>Theater</strong> <strong>der</strong> <strong>Unterdrückten</strong> 3<br />
zu erfahren, mehr noch: es immer und immer wie<strong>der</strong> selbst zu erfahren.<br />
Ich möchte hier einiges gle<strong>ich</strong> vorwegnehmen, um einerseits zu schil<strong>der</strong>n welche<br />
Momente dieses <strong>Theater</strong>workshops m<strong>ich</strong> beson<strong>der</strong>s beeindruckten und mir in Erinnerung<br />
blieben, womit s<strong>ich</strong> ein Teil <strong>der</strong> Frage aus <strong>der</strong> Überschrift von selbst<br />
erklären wird und an<strong>der</strong>erseits weil <strong>ich</strong> es für adäquater halte, die Techniken<br />
Boals anhand konkreter Erfahrungen zu beschreiben und zu erklären, weil im<br />
Erzählen vielle<strong>ich</strong>t noch am meisten von <strong>der</strong> Lebendigkeit, <strong>der</strong> Intensität, <strong>der</strong><br />
Authentizität übrig bleibt.<br />
Um den Ablauf des damaligen Workshops nachvollziehbar zu machen, soll zu<br />
Beginn die „Glasschlange“ alle mögl<strong>ich</strong>en Arten von Aufwärmübungen repräsentieren,<br />
weil sie wesentl<strong>ich</strong>e Elemente <strong>der</strong> Einstiegsphase enthält und mir im<br />
Zusammenspiel mit <strong>der</strong> damaligen Gruppe noch beson<strong>der</strong>s in Erinnerung verhaftet<br />
blieb, was n<strong>ich</strong>t zuletzt am uneingeschränkten Spaß an <strong>der</strong> Sache liegt.<br />
„Dieser Übung liegt die brasilianische Sage von <strong>der</strong> Glasschlange<br />
zugrunde: Sie kann zerstückelt werden, aber alle Einzelteile<br />
wachsen immer wie<strong>der</strong> zusammen. Alle Teilnehmer liegen mit<br />
2 „In jedem Fall handelt es s<strong>ich</strong> um <strong>Theater</strong>-Sprache. Wo immer du sie sprechen willst... - es bleibt eine Sprache,<br />
also sprechen wir diese Sprache!“ Augusto Boal zit. nach Neuroth, Simone: Augusto Boals »<strong>Theater</strong> <strong>der</strong><br />
<strong>Unterdrückten</strong>« in <strong>der</strong> pädagogischen Praxis. Weinheim, 1994, S. 87<br />
Wir nutzten das <strong>Theater</strong>, als eine Form impliziter Informationsübermittlung, als gemeinsames Kommunikationsmittel,<br />
um Eigenes mitzuteilen und An<strong>der</strong>es mitgeteilt zu bekommen. Auf diese Weise schufen wir atmosphärisch<br />
und konkret Frieden, Freiheit und Freundschaft. Über den Zusammenhang von Formen impliziter<br />
Informationsübermittlung (<strong>Theater</strong>, Musik, Malerei,...) und Frieden, Freiheit und Freundschaft, vgl. Dietr<strong>ich</strong>,<br />
Wolfgang: Kulturelle Gewalt als Mittel und Indikator von Herrschaft im Weltsystem, in: Zapotoczky,<br />
Klaus/Gruber, Petra (Hg.): Demokratie versus Globalisierung? Plädoyer für eine umwelt- und sozialverträgl<strong>ich</strong>e<br />
Weltordnung; Frankfurt, 1999, S. 166-184<br />
3 Im Folgenden werde <strong>ich</strong> „<strong>Theater</strong> <strong>der</strong> <strong>Unterdrückten</strong>“ mit „TO“ abkürzen. Diese international übl<strong>ich</strong>e<br />
Kurzform leitet s<strong>ich</strong> aus dem Portugiesischen „Teatro do Oprimido“ ab und ist auch Bestandteil im Namen<br />
vieler <strong>Theater</strong>pädagogischer Zentren, die s<strong>ich</strong> mit Methoden Augusto Boals beschäftigen. Als Vorbild dient das<br />
CTO RIO (Centro do Teatro do Oprimido do Rio de Janeiro)<br />
6
geschlossenen Augen auf dem Boden, <strong>der</strong> Kopf des einen jeweils<br />
auf dem Rücken des Vor<strong>der</strong>manns. Auf ein Ze<strong>ich</strong>en zerfällt die<br />
Schlange und die Teilnehmer kriechen mit geschlossenen Augen<br />
durch den Raum. Dann soll die Schlange wie<strong>der</strong> in ihrer<br />
ursprüngl<strong>ich</strong>en Gestalt auferstehen.“ 4<br />
(Das <strong>Wie</strong><strong>der</strong>zusammenfinden erfolgt über gegenseitiges Abtasten des Ges<strong>ich</strong>ts. Es<br />
darf n<strong>ich</strong>t gesprochen werden. Anm. A. <strong>Staffler</strong>)<br />
<strong>Wie</strong> bei vielen Übungen erfolgt durch den Wegfall des Gehör- und Ges<strong>ich</strong>tssinnes<br />
eine verstärkte Konzentration auf den oft vernachlässigten Tastsinn, Berührungen<br />
und Körperl<strong>ich</strong>keit nehmen in <strong>der</strong> Wahrnehmung eine verstärkte Stellung ein, wodurch<br />
s<strong>ich</strong> auch die Ausdrucksmögl<strong>ich</strong>keiten verän<strong>der</strong>n. Durch die liegende Haltung<br />
und kriechende Bewegung erfährt <strong>der</strong> eigene Körper eine ungewohnte Lage<br />
im Raum und nimmt diesen und seine Beziehung zu ihm dadurch auch ungewohnt<br />
wahr. Es liegt weiters in <strong>der</strong> Natur <strong>der</strong> Übung, körperl<strong>ich</strong>e Hemmschwellen zu<br />
überwinden, wozu auch das lustige, lustvolle am Spiel seinen Beitrag leistet. Zudem<br />
wirkt die Abfolge von Beieinan<strong>der</strong>, Auseinan<strong>der</strong> und wie<strong>der</strong> Beieinan<strong>der</strong> vertrauensbildend.<br />
Drei wesentl<strong>ich</strong>e Komponenten des (konventionellen) <strong>Theater</strong>s<br />
erleben hier eine vielsch<strong>ich</strong>tigere Betrachtung als dies im Normalfall erfolgt: das<br />
Eigene, das An<strong>der</strong>e, <strong>der</strong> Raum.<br />
<strong>Wie</strong> das TO an Themen herangeht, sie bearbeitet und bespielt, führten mir bereits<br />
die einfachen Formen und Methoden vor Augen, die <strong>ich</strong> damals am eigenen Leib<br />
kennen lernte. Den Begriff <strong>der</strong> Gewalt sollten wir, eigenen Erfahrungen nachempfunden,<br />
als Statue darstellen. Als Material dienten dabei sowohl die an<strong>der</strong>en,<br />
als auch <strong>der</strong> eigene Körper. Zur vorgegebenen Überschrift „Gewalt“ sollte je<strong>der</strong><br />
noch eine treffende Unterüberschrift für seine Statue finden. In Form einer Ausstellung<br />
präsentierten alle ihre Statuen, ohne den gewählten eigenen Titel zu<br />
nennen. Wir sahen Eltern, die ihre Kin<strong>der</strong> schlugen, Männer, die ihre Frauen<br />
4 Boal, Augusto: <strong>Theater</strong> <strong>der</strong> <strong>Unterdrückten</strong>. Übungen und Spiele für Schauspieler und N<strong>ich</strong>t-Schauspieler;<br />
Frankfurt am Main, 1989, S. 207<br />
7
verprügelten, Kin<strong>der</strong>, die ein an<strong>der</strong>es Kind n<strong>ich</strong>t mitspielen lassen wollten und verspotteten,<br />
aber auch einen Lehrer, <strong>der</strong> in seiner typischen Haltung für ein ganzes<br />
Schulsystem stand. Unterdrückung und Gewalt wurden plastisch und s<strong>ich</strong>tbar, so<br />
wie sie erlebt o<strong>der</strong> beobachtet worden waren, und so klar und deutl<strong>ich</strong> die gestellte<br />
Statue für den Bildhauer war, so sehr konnte auch je<strong>der</strong> an<strong>der</strong>e seine Gedanken,<br />
Erfahrungen, Gefühle und Interpretationen in sie hineinlegen und <strong>der</strong> Statue<br />
einen eigenen Titel und Inhalt geben. Durch die Unterschiedl<strong>ich</strong>keit <strong>der</strong> Personen,<br />
ergab s<strong>ich</strong> eine Vielzahl an verschiedenen Interpretationen und natürl<strong>ich</strong> eine<br />
bunte Palette an Statuen. Je<strong>der</strong> konnte Stellung beziehen. Aus dem Statischen<br />
heraus entwickelte s<strong>ich</strong> in weiterer Folge Bewegungen, die Gesch<strong>ich</strong>ten, die s<strong>ich</strong><br />
rund um die Statuen abspielten.<br />
„Macht“ stellte ein weiteres Handlungsfeld dar, das wir in den Raum stellten.<br />
Dabei ging es darum, ausgehend von einer mächtigen Haltung, die einer gewählt<br />
hatte, s<strong>ich</strong> selbst in noch mächtigerer Haltung dazu zu stellen. Die übrigen entschieden,<br />
ob eine mächtigere Position eingenommen wurde o<strong>der</strong> n<strong>ich</strong>t 5 . Gelang<br />
dies nach Meinung <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en n<strong>ich</strong>t, musste man das Bild wie<strong>der</strong> verlassen.<br />
Konnte man den Eindruck erwecken, man sei mächtiger, erhielten die übrigen<br />
TeilnehmerInnen den Auftrag, eine Haltung zu finden, die Macht über dieses Bild<br />
ausdrückt.<br />
Prägend in Erinnerung geblieben sind mir auch die Maschinen, die von uns zu den<br />
verschiedensten Themen gebaut wurden. Maschinentheater setzt s<strong>ich</strong> aus monotonen,<br />
rhythmischen Bewegungen und Geräuschen einzelner Personen zusammen,<br />
die bestimmte Aspekte eines Themas herausgreifen, auf den eigenen Körper<br />
übertragen und gemeinsam mit an<strong>der</strong>en eine Gesamtmaschine ergeben. Um eine<br />
Maschine zu bauen, beginnt jemand eine Bewegung und ein Geräusch zu etablieren<br />
und die an<strong>der</strong>en ergänzen diese nacheinan<strong>der</strong> mit ihren Bewegungen und<br />
Geräuschen. Monotonie und Rhythmus verstärken dabei die Aussagekraft, geben<br />
5 Margarete Meixner verwendete diese Behandlung <strong>der</strong> Macht als Aufwärmübung in einem Workshop <strong>zum</strong><br />
Thema Suchtprävention. Meixner, Margarete: „Gemeinsam und doch einsam“: Forumtheater in <strong>der</strong><br />
Suchtprävention in: Wrentschur, M<strong>ich</strong>ael / ARGE Forumtheater Österre<strong>ich</strong> (Hg): Forum <strong>Theater</strong> Österre<strong>ich</strong>;<br />
Praxis / Projekte / Gruppen; Graz, 1999, S. 23<br />
8
ihr durch Variationen aber auch bewusst unterschiedl<strong>ich</strong>e Färbungen. Die Vorgabe<br />
kann vielfältig und allgemein formuliert sein, o<strong>der</strong> auf ein spezielles Geschehen<br />
Bezug nehmen. Unsere Maschinen trugen die Namen <strong>der</strong> Staaten aus<br />
denen die Teilnehmer <strong>kam</strong>en, hießen also Slowakei o<strong>der</strong> Deutschland und<br />
warfen ein L<strong>ich</strong>t auf die dortige Situation, zeigten S<strong>ich</strong>tweisen <strong>der</strong> „Maschinenteile“<br />
auf „ihre“ Län<strong>der</strong>, beklemmen<strong>der</strong>, deutl<strong>ich</strong>er und verständl<strong>ich</strong>er als jedes<br />
Fernsehbild. Facettenre<strong>ich</strong>er agierte die Maschine durch Anweisungen, die ein<br />
schnelleres o<strong>der</strong> langsameres Tempo, liebevolle, zornige o<strong>der</strong> gle<strong>ich</strong>gültige<br />
Grundstimmung vorschrieben, wodurch s<strong>ich</strong> R<strong>ich</strong>tungswechsel in <strong>der</strong> Bedeutung<br />
ergaben. Blieb durch die Vorgabe bei diesen Maschinen eine Gruppe immer <strong>zum</strong><br />
Zuschauen verurteilt, konnten zu den Themen Liebe und Hass alle etwas beitragen.<br />
Die Liebesmaschine etwa umarmte, küsste, stre<strong>ich</strong>elte, fiel auf die Knie,<br />
bekreuzigte s<strong>ich</strong>, neckte, hatte Sex, teilte, stillte und machte dazu schmatzende,<br />
gurrende, glucksende, stöhnende, pfeifende, schreiende, piepsende Geräusche,<br />
dass es nur so eine Freude war.<br />
Im Laufe <strong>der</strong> Zeit und <strong>der</strong> zunehmenden Beschäftigung mit dem TO, sowohl in<br />
theoretischer als auch in praktischer Hins<strong>ich</strong>t, stellten s<strong>ich</strong> mir vor dem Hintergrund<br />
meines politikwissenschaftl<strong>ich</strong>en Studiums und den Interessensschwerpunkten,<br />
die <strong>ich</strong> dort verfolgte, Fragen über den Zusammenhang zwischen TO und<br />
<strong>der</strong> kritischen Friedensforschung nach Johan Galtung. Welchen Beitrag können<br />
die Methoden Augusto Boals zu einem Frieden leisten, <strong>der</strong><br />
„als die Fähigkeit definiert wird, Konflikte mit Empathie<br />
(=Bereitschaft und Fähigkeit, s<strong>ich</strong> in die Einstellung und Mentalität<br />
an<strong>der</strong>er Menschen einzufühlen), mit Gewaltlosigkeit und mit<br />
Kreativität zu bearbeiten(?)“ 6<br />
Bietet das TO eine Mögl<strong>ich</strong>keit, um unterschiedl<strong>ich</strong>e Formen und Ausprägungen<br />
<strong>der</strong> Unterdrückung und Gewalt zu begegnen und unter welchen Bedingungen<br />
erfolgt dies am effizientesten? Inwieweit spielt <strong>der</strong> Ursprung des TO in Latein-<br />
6 Galtung, Johan: Der Preis <strong>der</strong> Mo<strong>der</strong>nisierung. Stuktur und Kultur im Weltsystem, <strong>Wie</strong>n, 1999, S. 173<br />
9
amerika für dessen Funktionsgrad eine Rolle, wenn es in einem an<strong>der</strong>en gesellschaftl<strong>ich</strong>en,<br />
lokalen Kontext gespielt wird und worin liegen die für das TO<br />
relevanten Unterscheidungen? Die Blickweise auf diese Fragestellungen wird<br />
Großteils ein persönl<strong>ich</strong>er, erfahrungsbezogener sein und s<strong>ich</strong> dementsprechend<br />
auf die für m<strong>ich</strong> relevanten Bere<strong>ich</strong>e r<strong>ich</strong>ten. Daraus ergibt s<strong>ich</strong> auch, dass auf<br />
Grund meiner Praxis, <strong>der</strong> Einsatz des TO in <strong>der</strong> Suchtprävention eine spezielle<br />
Berücks<strong>ich</strong>tigung findet. Hier stellen s<strong>ich</strong> die Fragen inwieweit Sucht mit Unterdrückung<br />
und Gewalt zu tun hat und ob Sucht (auch) als eine Form von Gewalt<br />
gelten kann.<br />
Augusto Boal, <strong>Wie</strong>n, 1999<br />
10
2 Was ist <strong>Theater</strong>?<br />
Bereits zu Beginn stellte <strong>ich</strong> die Frage, ob das <strong>Theater</strong> <strong>der</strong> Unterdrücken denn dem<br />
Verständnis von <strong>Theater</strong> entspreche. Handelt es s<strong>ich</strong> dabei eigentl<strong>ich</strong> um <strong>Theater</strong>?<br />
Zur Klärung dieser Frage bedarf es einer Darstellung des Wesens des <strong>Theater</strong>s.<br />
„<strong>Theater</strong> (...) aus griech. théatron „Zuschauerraum, <strong>Theater</strong>“.<br />
Stammwort ist griech. théa „das Anschauen, die Schau; das<br />
Schauspiel“, das als Vor<strong>der</strong>glied in griech. theorós „Zuschauer“ ( ↑<br />
Theorie) erscheint.(...)“ 7<br />
Manfred Brauneck sieht in seiner allgemeinsten Bestimmung die Entfaltung des<br />
Wesens des <strong>Theater</strong>s in <strong>der</strong> Dialektik von Spielen und Zuschauen. 8 Allerdings<br />
erscheint mir gerade auch im deutschen Wort „Schauspiel“ die Zusammengehörigkeit<br />
von „Schauen“ und „Spielen“ als unabdingbar für das <strong>Theater</strong>. In <strong>der</strong><br />
Dialektik von Zuschauen und Spielen verhaftet, verwun<strong>der</strong>t es auch n<strong>ich</strong>t, wenn<br />
diese auf alle an<strong>der</strong>en Dialektiken zurück geführt wird o<strong>der</strong> zu diesen hinführt:<br />
Spiel und Ernst, Utopie und Wirkl<strong>ich</strong>keit, Rolle und Schauspieler 9 ; In <strong>der</strong> Konsequenz<br />
beinhaltet dies auch die Trennungen in Subjekt und Objekt, aktiv und<br />
passiv, Fiktion und Realität. Martin Jürgens führt den Gedanken dahingehend<br />
weiter, dass er die Rechtfertigung dieser Trennung in <strong>der</strong> Reflexion des <strong>Theater</strong>s<br />
über das <strong>Theater</strong>, also in einer internen S<strong>ich</strong>tweise im Gegensatz zu einer Betrachtung<br />
von außen, begründet findet. Dabei bedient er s<strong>ich</strong> eines Shakespeare-<br />
Zitates aus „As you like it“: 10<br />
7 Duden: Bd. 7. Etymologie. Herkunftswörterbuch <strong>der</strong> deutschen Sprache. Mannheim, Zür<strong>ich</strong>, <strong>Wie</strong>n, 1989<br />
8 Brauneck, Manfred: <strong>Theater</strong> im 20. Jahrhun<strong>der</strong>t. Reinbek bei Hamburg, 1989, S. 15 f. zit nach: Jürgens,<br />
Martin: <strong>Theater</strong> als Probehandeln o<strong>der</strong> Düpierungspraxis? Notizen zur <strong>Theater</strong>arbeit und zur Kritik des<br />
Konzepts von Augusto Boal. in: Ruping, Bernd (Hrsg.): Gebraucht das <strong>Theater</strong>. Die Vorschläge Augusto Boals:<br />
Erfahrungen, Varianten, Kritik. Lingen-Remscheid, 1991, S. 260<br />
9 Brauneck, Manfred: a.a.O., S. 16f zit. nach: Jürgens, Martin: a.a.O., S. 260<br />
10 Jürgens, Martin: a.a.O., S. 261; Jürgens verwendet eine deutsche Übersetzung (von E. Plessen.<br />
Bühnenfassung: Regie: P. Zadek; Reinbeck bei Hamburg, 1986, S. 100/102), während <strong>ich</strong> m<strong>ich</strong> am englischen<br />
Text einer zweisprachigen Ausgabe (Reclam) orientiere. Shakespeare, William: As you like it. Act II, Scene VII,<br />
140 ff<br />
11
“All the world´s a stage,<br />
And all the men and women merely players;<br />
They have their exits and their entrances,<br />
And one man in his time plays many parts,<br />
His Acts being seven ages. (...)“<br />
„All the world´s a stage“ wird von Jürgens als S<strong>ich</strong>tweise <strong>der</strong> gesamten Welt als<br />
Bühne interpretiert, auf <strong>der</strong> <strong>der</strong> Mensch einem Determinismus, gle<strong>ich</strong>sam einer<br />
Marionette, unterliegt, den er we<strong>der</strong> gut heißen, noch in <strong>der</strong> Realität erkennen<br />
kann. Also bringt er Hamlet ins Spiel, <strong>der</strong> nach seiner Ans<strong>ich</strong>t die Fiktion des<br />
<strong>Theater</strong>s ohne reale Folgen nützt, um an die Realität den Anspruch zu adressieren,<br />
die aufgezeigten Mögl<strong>ich</strong>keiten durch autonomes menschl<strong>ich</strong>es Handeln<br />
zu verwirkl<strong>ich</strong>en. Allerdings scheint Jürgens dabei zu übersehen, dass gerade in<br />
„Hamlet“ die Wahrheit im <strong>Theater</strong> liegt und keine Wählbarkeit des Handelns zulässt,<br />
weil bereits gehandelt wurde, s<strong>ich</strong> die Handlung gle<strong>ich</strong>sam wie<strong>der</strong>holt, n<strong>ich</strong>t<br />
als Kopie, son<strong>der</strong>n als wie<strong>der</strong>kehrendes Geschehen. <strong>Wie</strong>wohl das <strong>Theater</strong> ohne<br />
Realität n<strong>ich</strong>t sein kann, stehen sie in einem gle<strong>ich</strong>wertigen Zusammenhang. Das<br />
Verhältnis stellt s<strong>ich</strong> wie folgt dar:<br />
„Seid auch n<strong>ich</strong>t allzu zahm, laßt euer eigenes Urteil euren Meister<br />
sein: paßt die Gebärde dem Wort, das Wort <strong>der</strong> Gebärde an, wobei<br />
ihr son<strong>der</strong>l<strong>ich</strong> darauf achten müßt, niemals die Bescheidenheit <strong>der</strong><br />
Natur zu überschreiten. Denn alles was so übertrieben wird, ist dem<br />
Vorhaben des Schauspiels entgegen, dessen Zweck sowohl anfangs<br />
als jetzt, war und ist, <strong>der</strong> Natur gle<strong>ich</strong>sam den Spiegel vorzuhalten:<br />
(...)“ 11<br />
Die Aufgabe des Schauspielers hätte auch von Stanislawski 12 n<strong>ich</strong>t besser formu-<br />
11 Shakespeare, William: Hamlet. 3. Aufzug, 2. Szene<br />
12 Konstantin Sergejewitsch Stanislawski: *1863-†1938 Russischer <strong>Theater</strong>praktiker und –theoretiker, dessen<br />
zentrale Werke („Die Arbeit des Schauspielers an s<strong>ich</strong> selbst“, „Die Arbeit des Schauspielers an <strong>der</strong> Rolle“<br />
(unvollendet)) s<strong>ich</strong> auf „die innere Entwicklung des Schauspielers, die Echtheit seiner Gefühle und die<br />
Wahrhaftigkeit seiner inneren Handlungen konzentriert (...)“. Das System von Stanislawski strebt nach „(...) <strong>der</strong><br />
Erfüllung <strong>der</strong> Überaufgabe. Diese Überaufgabe zielt zunächst auf die Gesetze <strong>der</strong> Natur.“ aus: Rellstab, Felix:<br />
Stanislawski Buch, Wädenwil, 1992 Zitate: S. 12 und S. 9<br />
12
liert werden können. Die Natur soll we<strong>der</strong> vom Stück noch vom Schauspieler<br />
kopiert werden, n<strong>ich</strong>t nachgeahmt, son<strong>der</strong>n ledigl<strong>ich</strong> als Spiegelbild dargestellt<br />
werden. Während Boal s<strong>ich</strong> noch <strong>zum</strong> Ziel setzt, das Bild im Spiegel, er sieht es als<br />
Imagination, zurück in die Realität zu bringen 13 , sehe <strong>ich</strong> im Spiegel n<strong>ich</strong>ts an<strong>der</strong>es<br />
als die Realität, in ihrer <strong>Wie</strong><strong>der</strong>holung, die auch in <strong>der</strong> Realität n<strong>ich</strong>t an<strong>der</strong>s zu<br />
sehen ist. So wie <strong>ich</strong> „All the world´s a stage“ nie als „Die Welt ist wie eine Bühne“<br />
verstanden habe. Das <strong>Theater</strong> versteht s<strong>ich</strong> n<strong>ich</strong>t, um noch einmal mit Hamlet zu<br />
sprechen, als Verschleierung, Verfälschung, Übertreibung o<strong>der</strong> Abschwächung des<br />
Realen, son<strong>der</strong>n als schonungslose Entsprechung.<br />
„Die Schauspieler können n<strong>ich</strong>ts geheim halten, sie werden alles<br />
ausplau<strong>der</strong>n.“ 14<br />
Sie werden es n<strong>ich</strong>t nur ausplau<strong>der</strong>n, sie werden es vor allem auch vor Augen<br />
führen. Darin liegt das Wesen des <strong>Theater</strong>s.<br />
Egal welche Trennung zwischen <strong>Theater</strong> und Realität gezogen wird, ob zwischen<br />
Bühne und Zuschauerraum, zwischen Schauspieler und Rolle o<strong>der</strong> zwischen Text<br />
und Autor, sie unterliegt immer einem Willkürakt, den <strong>ich</strong> n<strong>ich</strong>t nachvollziehen<br />
kann. Meistens wird dabei die Seite des <strong>Theater</strong>s abqualifiziert, es handle s<strong>ich</strong><br />
schließl<strong>ich</strong> nur um Fiktion, es werde ja nur gespielt und im „wirkl<strong>ich</strong>en Leben“ sei<br />
ohnehin alles an<strong>der</strong>s.<br />
„Aber wir wissen sehr gut, dass Fiktion n<strong>ich</strong>t existiert, dass alles<br />
wahr ist. Das lässt s<strong>ich</strong> in noch größerem Ausmaß für das <strong>Theater</strong><br />
sagen, wo sogar die Lügen wahr sind. Die einzige Fiktion ist das<br />
Wort „Fiktion“.“ 15<br />
Die Realität des <strong>Theater</strong>s besteht gle<strong>ich</strong>wertig neben <strong>der</strong> Realität des Alltags.<br />
13 vgl. Boal, Augusto: legislative theatre; Using performance to make politics. London, NewYork, 1998,<br />
Titelseite; Im Englischen steht hier „true image of nature, of reality“ und „transformed image“<br />
14 Shakespeare, William: Hamlet. 3. Aufzug, 2. Szene<br />
15 Boal, Augusto: Der Regenbogen <strong>der</strong> Wünsche. Seelze (Velber), 1999, S. 35<br />
13
Es ist eine an<strong>der</strong>e Wirkl<strong>ich</strong>keit und wenn die Grenzen, die zwischen beiden gezogen<br />
werden, überwunden werden, kann ein Fließgle<strong>ich</strong>gew<strong>ich</strong>t entstehen, in<br />
dem beide ihre Wirkung entfalten können. Deshalb plädiere <strong>ich</strong> für die Weglassung<br />
je<strong>der</strong> Grenze.<br />
Boal stützt s<strong>ich</strong> in seinem Verständnis von <strong>Theater</strong> auf die Definition des<br />
spanischen Zeitgenossen William Shakespeares Lope de Vega 16 :<br />
“What is theatre? human beings, passion, platform” 17<br />
16 Vega, Felix Lope de V. Carpio, spanischer D<strong>ich</strong>ter, * 25.11. 1562 zu Madrid; + 27.8. 1635 Er betätigte s<strong>ich</strong><br />
als Lyriker und Verfasser religiöser Epen, schrieb mythologische D<strong>ich</strong>tungen, komische Ged<strong>ich</strong>te, Episteln,<br />
Novellen und Romane, doch war er vor allem Dramatiker und schuf die endgültige Form <strong>der</strong> spanischen<br />
comedia. Zu den Meisterwerken aus seiner Fe<strong>der</strong> zählt <strong>der</strong> lebensgesch<strong>ich</strong>tl<strong>ich</strong>e Dialogroman La Dorotea<br />
(1632). Von den rund 1800 Stücken, die V. verfaßt haben will, sind etwa 470 erhalten geblieben.<br />
http://www.bautz.de/bbkl/v/vega_f_l.shtml<br />
17 Lope de Vega zit. nach: Ruping, Bernd (Hrsg.): Gebraucht das <strong>Theater</strong>. a.a.O., 1991, S. 54<br />
14
2.1 human beings<br />
Zu Beginn steht die Bedingung, dass es s<strong>ich</strong> im <strong>Theater</strong> immer um mindestens<br />
zwei interagierende Personen handelt.<br />
„Selbst wenn etwa Hamlet allein auf <strong>der</strong> Bühne steht und seinen<br />
Monolog spr<strong>ich</strong>t, ist in seiner Haltung und dem Gestus seiner Worte<br />
<strong>der</strong> Antagonist gegenwärtig, schürt seine Passion und treibt so die<br />
Handlung voran.“ 18<br />
In einem an<strong>der</strong>en Beispiel 19 nennt Boal dies „the powerful presence of absence“.<br />
Dennoch bleibt die Frage offen, was den Menschen im <strong>Theater</strong> vom n<strong>ich</strong>t theatralischen<br />
Menschen unterscheidet, o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>s formuliert: Was befähigt den<br />
Menschen <strong>zum</strong> <strong>Theater</strong>? Dasselbe, das dem Prinzip des Spiegels unterliegt: die<br />
Fähigkeit des Beobachtens und Erkennens dessen, was zu sehen ist.<br />
„Darin liegt die Essenz des <strong>Theater</strong>s: im Menschen, <strong>der</strong> s<strong>ich</strong> selbst<br />
beobachtet.“ 20<br />
Zur Veranschaul<strong>ich</strong>ung erzählt Boal die alte chinesische Gesch<strong>ich</strong>te von Xua-Xua,<br />
einer vor-menschl<strong>ich</strong>en Frau, die über Schwangerschaft, die Beobachtung ihrer<br />
selbst, <strong>der</strong> Verän<strong>der</strong>ung, des Entspringens von jemand an<strong>der</strong>em aus dem eigenen<br />
Selbst und <strong>der</strong> Loslösung dieses an<strong>der</strong>en mit Hilfe eines Dritten (des Vaters), sowie<br />
<strong>der</strong> Leere, die diese Abnabelung hinterlässt, das <strong>Theater</strong> entdeckte. 21 Sie lernte<br />
dabei auch s<strong>ich</strong> selbst im An<strong>der</strong>en (ihrem Kind, das ihr zunächst noch identisch mit<br />
ihr erschien und erst allmähl<strong>ich</strong> <strong>zum</strong> An<strong>der</strong>en wurde) und das Verhältnis <strong>der</strong><br />
An<strong>der</strong>en untereinan<strong>der</strong> zu beobachten. Die daraus resultierenden Fragen<br />
18 Ruping, Bernd (Hrsg.): Gebraucht das <strong>Theater</strong>. a.a.O., 1991, S. 55<br />
19 Boal, August: legislative theatre. a.a.O., 1998, S. 49<br />
20 Boal, Augusto: Der Regenbogen <strong>der</strong> Wünsche. a.a.O., 1999, S. 24<br />
21 Ruping, Bernd (Hrsg.): Gebraucht das <strong>Theater</strong>. a.a.O., 1991, S. 53 – 59<br />
15
ezügl<strong>ich</strong> ihres eigenen vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Verhaltens<br />
in Verbindung mit den gemachten Beobachtungen eröffneten ihr die Realität des<br />
<strong>Theater</strong>s.<br />
Am Beginn des <strong>Theater</strong>s steht also die Verbindung von Handeln und Zuschauen in<br />
einer Person. In diesem Sinne kann Boal auch sagen, dass Menschen n<strong>ich</strong>t nur<br />
<strong>Theater</strong> machen, son<strong>der</strong>n auch <strong>Theater</strong> sind. 22 Erst im Laufe <strong>der</strong> Entwicklung<br />
wurden sie voneinan<strong>der</strong> getrennt. Die Handlung wurde auf die Bühne und die<br />
Beobachtung in den Zuschauerraum verbannt.<br />
22 Boal, Augusto: Der Regenbogen <strong>der</strong> Wünsche. a.a.O., 1999, S. 24<br />
16
2.2 passion<br />
Erst die Leidenschaft ergibt den Kontakt zu den an<strong>der</strong>en. Sie beze<strong>ich</strong>net den<br />
Charakter <strong>der</strong> Person und ihr Verhältnis zu Menschen, Dingen und Ideen. Durch<br />
sie ergeben s<strong>ich</strong> Konflikte, die in den Äußerungen unterschiedl<strong>ich</strong>er Wünsche,<br />
Begierden und Ziele angelegt sind und aus denen die Dramaturgie je<strong>der</strong> Handlung<br />
erwächst. Leidenschaft beze<strong>ich</strong>net im <strong>Theater</strong> wohl Gefühle, die ab einer<br />
gewissen Intensität auftreten und damit einer Beobachtung wert erscheinen. Ohne<br />
Leidenschaft bestünde kein Interesse am Zuschauen.<br />
Für Augusto Boal r<strong>ich</strong>tet s<strong>ich</strong> die Leidenschaft auf einen Wunsch, auf einen Willen,<br />
den es leidenschaftl<strong>ich</strong> zu vertreten gilt. Dazu braucht es den Mut glückl<strong>ich</strong> zu<br />
sein 23 , den Mut zu wissen, was man will. Es genügt n<strong>ich</strong>t, zu wissen, was man<br />
n<strong>ich</strong>t will. Wenn es im <strong>Theater</strong> keine unterschiedl<strong>ich</strong>en Wünsche, keine unterschiedl<strong>ich</strong>en<br />
Vorstellungen darüber gibt, was es heißt glückl<strong>ich</strong> zu sein, dann<br />
bleibt es eine inhaltsleere, uninteressante Hülle.<br />
23 „Coragem de ser feliz!“ wurde zu einem <strong>der</strong> Leitmotive in <strong>der</strong> Arbeit Augusto Boals.<br />
17
2.3 platform<br />
Die Einführung <strong>der</strong> Bühne als Merkmal, bedeutet bereits einen gravierenden<br />
Schritt in R<strong>ich</strong>tung einer Trennung in <strong>Theater</strong> und N<strong>ich</strong>t-<strong>Theater</strong>. Allerdings wissen<br />
wir ja bereits: All the world’s a stage. Dennoch erlangt <strong>der</strong> Gedanke an eine<br />
Bühne Bedeutung, weil durch ihn wie<strong>der</strong> Mögl<strong>ich</strong>keiten geschaffen werden, die<br />
dem Menschen ansonsten verschlossen erscheinen. Dabei lässt die Verwendung<br />
des Begriffs einer Plattform noch weit mehr Vorstellungsräume offen als das<br />
konventionelle Verständnis von einer Bühne. Allein die Einigung darüber, dass es<br />
s<strong>ich</strong> bei einem beliebigen Ort um eine Bühne handelt, re<strong>ich</strong>t aus, so wie die Zeit<br />
<strong>der</strong> Aufführung für den dargestellten Zeitraum ausre<strong>ich</strong>t. Der beze<strong>ich</strong>nete Raum<br />
erfährt durch seine Adaptierung für <strong>Theater</strong>zwecke eine wesentl<strong>ich</strong>e Erweiterung.<br />
Er wird <strong>zum</strong> „ästhetischen Raum“.<br />
2.3.1 Der ästhetische Raum<br />
Die Scheu vor <strong>der</strong> Ästhetik ist das erste Anze<strong>ich</strong>en von Ohnmacht! (Raskolnikow) 24<br />
„Ästhetik „Lehre vom Schönen“ (...), ist eine gelehrte Bildung zu<br />
griech. aisthetikós „wahrnehmend“. Es meinte zunächst die<br />
„Wissenschaft vom sinnl<strong>ich</strong> Wahrnehmbaren, von <strong>der</strong> sinnl<strong>ich</strong>en<br />
Erkenntnis“, (...)“ 25<br />
Die Ästhetik eröffnet dem <strong>Theater</strong> Wege Realität, über sie sinnl<strong>ich</strong>e Wahrnehmung<br />
zu zeigen, während sie es gle<strong>ich</strong>zeitig ermögl<strong>ich</strong>t, s<strong>ich</strong> über die Grenzen von Zeit<br />
und Raum hinweg zu setzen. Das <strong>Theater</strong> braucht s<strong>ich</strong> an keine Linearität o<strong>der</strong><br />
Evolution zu halten.<br />
Zum „ästhetischen Raum“ gehört allerdings auch die Wirkung des als Bühne ausgeschriebenen<br />
Raums auf den Bere<strong>ich</strong>, <strong>der</strong> seine Aufmerksamkeit auf ihn r<strong>ich</strong>tet.<br />
Damit wird ein Instrument zur Beobachtung des Geschehens geschaffen, das auf<br />
24 Dostojewski, Fjodor M.: Schuld und Sühne. 6. Teil, Kap. 7<br />
25 Duden: Bd. 7. Etymologie. a.a.O., 1989<br />
18
einem Übereinkommen und dem Zusammenhang zwischen allen Beteiligten<br />
beruht. Alle im <strong>Theater</strong> Befindl<strong>ich</strong>en einigen s<strong>ich</strong> über Ort, Zeit und Zeitraum <strong>der</strong><br />
Handlung. Im konventionellen <strong>Theater</strong> wird dabei auf eine strenge Trennung<br />
zwischen Zuschauer und Schauspieler geachtet, die mit Hilfe einiger Barrikaden<br />
(Podest, Kostümierung, Bühnensprache, etc.) verfestigt wird. Die Dehnbarkeit in<br />
Zeit und Raum rechtfertigt dabei nur scheinbar die konstruierten Trennungen in<br />
Schauspieler und Rolle o<strong>der</strong> Bühnenzeit und Realzeit.<br />
Neben seiner Dehnbarkeit in Zeit und Raum birgt <strong>der</strong> ästhetische Raum aber auch<br />
eine Eigenschaft in s<strong>ich</strong>, die Boal als „telemikroskopisch“ beze<strong>ich</strong>net. 26 Die Geschehnisse<br />
auf <strong>der</strong> Bühne werden näher beleuchtet, herangezoomt, vergrößert.<br />
Wenn durch Dehnbarkeit und Trennungen die Wahrnehmung erschwert, aber<br />
n<strong>ich</strong>t ausgeschlossen wird (wie in einem Zerrspiegel), so bringt die telemikroskopische<br />
Eigenschaft <strong>zum</strong> Ausgle<strong>ich</strong> eine Erle<strong>ich</strong>terung, weil sie die Aufmerksamkeit<br />
gezielt auf den Vorgang auf <strong>der</strong> Bühne lenkt.<br />
Die Ausschöpfung des ästhetischen Potentials beinhaltet auch die Aktivierung von<br />
Erinnerung, Assoziation, Phantasie und rührt an Emotionalem und Unbewusstem.<br />
Dies kann bis zur übergebührl<strong>ich</strong>en Irritation führen, denn<br />
„(d)as An<strong>der</strong>e am Ästhetischen, seine Wildheit, sein Hang <strong>zum</strong><br />
Chaotischen und Prozessualen muss erst abgeschätzt, seine<br />
Funktion, Bewegkraft zu sein, muss erst erkannt und erprobt<br />
werden. Was ein logischer Schluss o<strong>der</strong> ein Werturteil ist, hat man<br />
schnell herausgefunden. Aber was ist ein Bild, wo und wie bildet<br />
s<strong>ich</strong> die ahnungsvolle Gewissheit des Spürens.“ 27<br />
Im Sinne dieser Gewissheit kann Boal trotz mögl<strong>ich</strong>er Irritation über das <strong>Theater</strong><br />
sagen, dass es eine Form des Wissenserwerbs ist 28 , was es n<strong>ich</strong>t zuletzt seiner<br />
Ästhetik verdankt.<br />
26 vgl. Boal, Augusto: Der Regenbogen <strong>der</strong> Wünsche. a.a.O., 1999, S. 28 - 38<br />
27 Ruping, Bernd, u.a. (Hrsg.): Wi<strong>der</strong>wort und Wi<strong>der</strong>spruch. <strong>Theater</strong> zwischen Eigensinn und Anpassung.<br />
Situationen, Proben, Erfahrungen. Lingen, Hannover, 1991, S. 10<br />
28 Boal, Augusto: Der Regenbogen <strong>der</strong> Wünsche. a.a.O., 1999, S. 30<br />
19
Zusammenfassung:<br />
Im TO werden alle Merkmale des <strong>Theater</strong>s erfüllt: Es spielen Menschen, sie<br />
spielen mit Leidenschaft und ihnen wird eine Plattform gegeben auf <strong>der</strong> sie<br />
spielen. Im weiteren geht das TO aber über die Vorgaben des<br />
konventionellen <strong>Theater</strong>s hinaus und damit in wesentl<strong>ich</strong>en Dingen auch<br />
wie<strong>der</strong> auf den eigentl<strong>ich</strong>en Kern zurück. Als vorrangigstes Ziel nimmt<br />
s<strong>ich</strong> August Boal vor, die Trennung zwischen Schauspielern und Publikum<br />
wie<strong>der</strong> aufzuheben, nachdem die einen auf ein Podest gehoben wurden<br />
und die an<strong>der</strong>en <strong>zum</strong> Zuschauen verdammt wurden, um zu einem Beisammen<br />
von Handlung und Beobachtung, wie es bei Xua-Xua geschil<strong>der</strong>t<br />
wurde, zu kommen. Augusto Boal hat zwar somit das <strong>Theater</strong>, auch wie<br />
wir es kennen, n<strong>ich</strong>t neu erfunden, son<strong>der</strong>n er geht immer davon aus,<br />
denkt und führt es weiter und kehrt gle<strong>ich</strong>zeitig zu ihm zurück. Er ist unter<br />
an<strong>der</strong>em Soziologe, Politiker, Pädagoge und Autor, aber in erster Linie<br />
immer noch ein <strong>Theater</strong>mensch!<br />
20
3 Die Pädagogik<br />
“For me to exist Paolo Freire must exist” 29<br />
Die von Boal für seine Methoden gewählte Beze<strong>ich</strong>nung „<strong>Theater</strong> <strong>der</strong> <strong>Unterdrückten</strong>“<br />
lehnt s<strong>ich</strong> n<strong>ich</strong>t nur vom Namen, son<strong>der</strong>n auch von Inhalt und Intention her<br />
an Paolo Freires „Pädagogik <strong>der</strong> <strong>Unterdrückten</strong>“ 30 an. Diese beruht auf einem<br />
dialogischen Bildungskonzept, das es s<strong>ich</strong> zur Aufgabe gemacht hat, das Verhältnis<br />
zwischen Lehrer und Schüler maßgebl<strong>ich</strong> zu verän<strong>der</strong>n. Je<strong>der</strong> soll gle<strong>ich</strong>zeitig<br />
Lehrer und Schüler sein. Der Dialog spielt s<strong>ich</strong> aber nach wie vor zwischen einem<br />
Lehrenden und einem Lernenden ab, auch wenn beide beides sein dürfen. Eine<br />
von Boal erzählte Anekdote – sie spielt in einem psychiatrischen Krankenhaus in<br />
England – zeigt, was aus solch einem Dialog werden kann:<br />
„‘When one person is speaking on their own, that is a monologue,<br />
they are doing a monologue. So what is a dialogue?’“ More silence.<br />
The Joker (Spielleiter, Tim Wheeler, Anm. A. <strong>Staffler</strong>) resorted to<br />
visual aids: ‘A monologue is when one person, a single person, is<br />
talking his or her own ...’, and held up the index finger of his right<br />
hand. ‘One person only! So dialogue is ...? So what is a dialog ...? A<br />
dialog is when ...?’ And this time he held up two fingers. ‘I know, I<br />
know!’ answered one of the patients eagerly. ‘So, tell us. What is a<br />
dialogue?’ ‘It’s when there are two people talking on their own<br />
...’“ 31<br />
Trotz dieser vielle<strong>ich</strong>t n<strong>ich</strong>t unzutreffenden Beschreibung eines Dialogs beze<strong>ich</strong>net<br />
Boal sein <strong>Theater</strong> <strong>der</strong> <strong>Unterdrückten</strong> als Suche nach Dialogformen, n<strong>ich</strong>t zuletzt,<br />
weil er am Dialog als Lernform festhält.<br />
29 Boal, Augusto: legislative theatre. a.a.O., 1998, S. 129<br />
30 Freire, Paolo: Pädagogik <strong>der</strong> <strong>Unterdrückten</strong>. Stuttgart, Berlin, 1972<br />
31 Boal, Augusto: legislative theatre. a.a.O., 1998, S. 4<br />
21
„Ich habe einem Bauern gezeigt, wie man Pflug schreibt - und er<br />
hat mir beigebracht, wie man mit ihm umgeht. (ein argentinischer<br />
Alphabetisierer)“ 32<br />
Dieses Zitat bringt Boal immer dann, wenn er erklären will, wie er s<strong>ich</strong> Wissenserwerb<br />
vorstellt. Für m<strong>ich</strong> stellt s<strong>ich</strong> allerdings die Frage inwieweit dieses Beispiel<br />
n<strong>ich</strong>t gerade <strong>der</strong> schiefen Ebene Ausdruck verleiht, die es aufzuheben versucht.<br />
<strong>Wie</strong> schreibt man Pflug, o<strong>der</strong> plough, o<strong>der</strong> arado? <strong>Wie</strong> geht ein Alphabetisierer<br />
mit bäuerl<strong>ich</strong>em Gerät um? Denn, so scheint es mir, es bleibt <strong>der</strong> Ausgangspunkt,<br />
dass einer etwas lernen muss, während es für den an<strong>der</strong>en höchstens einen<br />
angenehmen Nebeneffekt darstellt. Das gilt so lange, solange ein (fremd)bestimmtes<br />
Wissen erlernt werden soll.<br />
Zweifellos zählt es zu den großen Verdiensten Paolo Freires, dass er einen Weg<br />
gefunden hat, um dem fremdbestimmten „Wissen“, dem westl<strong>ich</strong>-europäischen<br />
Paradigma von Bildung, in an<strong>der</strong>er Art und Weise zu begegnen als mit <strong>der</strong> „Kultur<br />
des Schweigens“ wie er es bei den Menschen in Südamerika beobachtet hat. Auf<br />
Unterdrückung reagierten sie apathisch und entsprachen in <strong>der</strong> Folge dem Bild,<br />
das s<strong>ich</strong> die Unterdrücker schon vorher von ihnen gemacht hatten: unterentwickelt,<br />
arm, unwissend. 33<br />
Dieser domestizierenden Pädagogik, wie Freire sie nennt, bringt er eine befreiende<br />
Pädagogik entgegen, die Wirkl<strong>ich</strong>keit verän<strong>der</strong>n soll. 34 Die Wirkl<strong>ich</strong>keit <strong>der</strong><br />
Menschen wurde durch Eroberung und Kolonialisierung massiv verän<strong>der</strong>t, aber sie<br />
haben die Mögl<strong>ich</strong>keit, aus ihrer Situation heraus Wege zu entdecken, wie<strong>der</strong>um<br />
Wirkl<strong>ich</strong>keit zu verän<strong>der</strong>n.<br />
Ein solcher Lern- und Verän<strong>der</strong>ungsprozess beginnt bei <strong>der</strong> Wertschätzung aller,<br />
weil alle in ihren Lebensbere<strong>ich</strong>en Experten sind, hängt in seinem Ergebnis<br />
32 Boal, Augusto: <strong>Theater</strong> <strong>der</strong> <strong>Unterdrückten</strong>. a.a.O., 1989, S. 17<br />
33 Lange, Ernst: Einführung in: Freire, Paolo: Pädagogik <strong>der</strong> <strong>Unterdrückten</strong>. a.a.O., 1972, S. 7ff<br />
34 Gipser, Dietlinde: Pädagogik <strong>der</strong> <strong>Unterdrückten</strong>, Die Befreiungspädagogik von Paolo Freire; working paper<br />
zu einem <strong>Theater</strong>pädagogik-Workshop, Innsbruck, 27.-31.03.1999<br />
22
wesentl<strong>ich</strong> von dem ab, was die Leute in ihn einbringen und zeigt nur Wirkung,<br />
wenn ein Sinn im Erlernten erkannt wird.<br />
„Paolo Freire invented a method, his method, our method, the<br />
method wh<strong>ich</strong> teaches the illiterate that they are perfectly literate in<br />
the languages of life, of work, of suffering, of struggle, (…)” 35<br />
Boal stellte seine Methoden zu Beginn des öfteren in den Dienst von Alphabetisierungsprojekten,<br />
wie dem staatl<strong>ich</strong>en Alphabetisierungsprojekt ALFIN in Peru,<br />
bei dem er das <strong>Theater</strong> unter an<strong>der</strong>em auch als Instrument zur Wissensvermittlung<br />
einsetzte. Ziel dieses Projektes war es, in <strong>der</strong> Muttersprache, in Spanisch und in<br />
an<strong>der</strong>en „Sprachen“ wie Fotografie, <strong>Theater</strong>, Film o<strong>der</strong> Zeitung zu alphabetisieren.<br />
36 Um mit theaterunerfahrenen Menschen <strong>Theater</strong> sprechen zu können,<br />
entwickelte Boal eine Vielzahl an Übungen, Spielen, Techniken und Methoden.<br />
Immer noch wird das TO aus einem falschen Verständnis und in Unkenntnis <strong>der</strong><br />
Verän<strong>der</strong>ungen, die es durchgemacht hat, von mo<strong>der</strong>nen Pädagogen „wie<strong>der</strong>“<br />
entdeckt und als Verpackung und Transportmittel benutzt, um Wissen zu vermitteln.<br />
Es genügt n<strong>ich</strong>t, die Positionen des Lehrers und des Schülers aufzuteilen,<br />
viel mehr gilt es, sie als Kategorien eines Machtverhältnisses gänzl<strong>ich</strong> hinter s<strong>ich</strong><br />
zu lassen. Es besteht die Tendenz, und darin liegt auch eine gewisse Gefahr, aus<br />
dem <strong>Theater</strong> <strong>der</strong> <strong>Unterdrückten</strong> ein <strong>Theater</strong> für Unterdrückte zu machen, das es in<br />
Form von Propaganda-, Revolutions- und Aktionstheater bereits zur Genüge gab<br />
und gibt und vom dem s<strong>ich</strong> Boal, nachdem er dessen Wirkungslosigkeit erlebt<br />
hatte 37 , distanzierte. Genau so verfehlt wäre <strong>Theater</strong> über Unterdrückte. Beide<br />
Ansätze definieren von außen, wer unterdrückt wird und bestimmen von vornherein<br />
die Art <strong>der</strong> Unterdrückung, wodurch sie letztendl<strong>ich</strong> noch reproduziert wird.<br />
35 Boal, Augusto: legislative theatre. a.a.O., 1998, S. 128<br />
36 Boal, Augusto: <strong>Theater</strong> <strong>der</strong> <strong>Unterdrückten</strong>. a.a.O., 1989, S. 42<br />
37 Boal, Augusto: Der Regenbogen <strong>der</strong> Wünsche. a.a.O., 1999, S. 15f<br />
23
4 Das Dreieck <strong>der</strong> Gewalt nach Johan Galtung 38<br />
Seinem Verständnis von Frieden legt Johan Galtung ein Konzept <strong>der</strong> Dreiteilung<br />
von Gewalt in direkte, strukturelle und kulturelle Gewalt zu Grunde.<br />
direkte Gewalt<br />
kulturelle Gewalt<br />
strukturelle Gewalt<br />
Die direkte Gewalt wird dabei s<strong>ich</strong>tbar, nährt s<strong>ich</strong> aus kultureller und struktureller<br />
Gewalt und verstärkt diese gle<strong>ich</strong>zeitig mit ihren Auswirkungen, wie Rachegelüsten<br />
auf <strong>der</strong> einen o<strong>der</strong> Machtrausch auf <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Seite. Das gesamte Dreieck<br />
befindet s<strong>ich</strong> demnach in einem Teufelskreis, in dem das eine ohne das<br />
an<strong>der</strong>e n<strong>ich</strong>t vorkommt und alle drei Formen <strong>der</strong> Gewalt miteinan<strong>der</strong> korrelieren.<br />
Die direkte Gewalt zeigt s<strong>ich</strong> le<strong>ich</strong>t ers<strong>ich</strong>tl<strong>ich</strong> in Toten, Verletzten (auch seelisch)<br />
und Zerstörung. Strukturelle Gewalt besteht in repressiven, ausbeuterischen und<br />
einengenden o<strong>der</strong> losen Verhältnissen und Systemen. Die kulturelle Gewalt<br />
verbirgt s<strong>ich</strong> meist hinter gefestigten Weltbil<strong>der</strong>n, die im Falle westl<strong>ich</strong>er - und<br />
damit dominieren<strong>der</strong> - Prägung unter an<strong>der</strong>em auf Patriarchat, Nationalismus<br />
und Kapitalismus beruhen.<br />
38 Galtung, Johan: Der Preis <strong>der</strong> Mo<strong>der</strong>nisierung. a.a.O., 1997; S. 171<br />
24
5 Unterdrückung<br />
“Un<strong>der</strong> Pressure<br />
It’s the terror of knowing<br />
What this world is about” 39<br />
(David Bowie and Queen)<br />
Vorzugeben zu wissen, was gut o<strong>der</strong> schlecht ist, fasst meiner Ans<strong>ich</strong>t nach alle<br />
mögl<strong>ich</strong>en Arten von Unterdrückung gut zusammen, <strong>zum</strong>al es dieses „Wissen“<br />
meist mit Gewalt durchzusetzen gilt.<br />
Augusto Boal begegnete zu Beginn seiner Biographie zwei ausschlaggebenden<br />
Ausprägungen dieser Unterdrückung, die von <strong>der</strong> Definitionsmacht über gut und<br />
schlecht, r<strong>ich</strong>tig und falsch geprägt ist und s<strong>ich</strong> im Besitz <strong>der</strong> - in diesem Fall -<br />
politischen und kulturellen Wahrheit wähnt. Zuerst <strong>der</strong> politischen Form, die ihn in<br />
späterer Folge ins Exil zwang und über <strong>der</strong>en Zusammenhang in Bezug auf die<br />
Entstehung des TO er sagt:<br />
„Das <strong>Theater</strong> <strong>der</strong> <strong>Unterdrückten</strong> und seine Formen (...) entstanden<br />
als Antwort auf die Repression in Lateinamerika, wo tägl<strong>ich</strong><br />
Menschen auf offener Straße nie<strong>der</strong>geknüppelt werden, wo die<br />
Organisationen <strong>der</strong> Arbeiter, Bauern, Studenten und Künstler<br />
systematisch zerschlagen, ihre Leiter verhaftet, gefoltert, ermordet<br />
o<strong>der</strong> ins Exil gezwungen werden.“ 40<br />
1.) direkte Unterdrückung: Die Erfahrung dieser Unterdrückung korrespondiert<br />
aus meiner S<strong>ich</strong>t in ihrer Beschreibung (Schläge, Folter, Schüsse, Verhaftung,<br />
Vertreibung) mit dem Verständnis direkter Gewalt nach Johan Galtung.<br />
Zum an<strong>der</strong>en wehrte s<strong>ich</strong> Boal gegen die kulturelle Unterdrückung <strong>der</strong> Euro-<br />
39 (P) 1988 by Queen Productions Ltd./Jones Music/ Mainman S. A. un<strong>der</strong> exclusive license to EMI Records<br />
Ltd.<br />
40 Boal, Augusto: <strong>Theater</strong> <strong>der</strong> <strong>Unterdrückten</strong>. a.a.O., 1989, S. 67<br />
25
päisierung <strong>der</strong> <strong>Theater</strong> Brasiliens. Als Beispiel mag das Teatro Brasileiro de<br />
Comédia (TBC) in São Paolo dienen, das es s<strong>ich</strong> <strong>zum</strong> Ziel setzte, europäische<br />
Kultur nach Brasilien zu holen. Neben <strong>der</strong> wirtschaftl<strong>ich</strong>en und politischen<br />
Anbie<strong>der</strong>ung an Nordamerika und Europa sollte auch die intellektuelle und<br />
kulturelle folgen, mit importierten Schauspielern, Regisseuren, Stücken und<br />
Aufführungen mit europäischem Akzent. 41<br />
2.) kulturelle Unterdrückung: An diesem Beispiel wird die Idee hinter dem<br />
Begriff <strong>der</strong> kulturellen Gewalt deutl<strong>ich</strong>.<br />
Das <strong>Theater</strong> weist für Boal allerdings zusätzl<strong>ich</strong> einen immanenten Unterdrückungsmechanismus<br />
auf: Die Unterdrückung des Zuschauers durch den Schauspieler<br />
(in zweiter Linie; in erster Linie wohl durch den Autor; Anm. A. <strong>Staffler</strong>), <strong>der</strong><br />
sein „Wissen“, seine Überlegenheit von <strong>der</strong> Bühne hinab transportiert, wo es auf<br />
die Passivität des Publikums trifft.<br />
Hier löst s<strong>ich</strong> Boal deutl<strong>ich</strong> von seinem theoretischen Vorgänger Brecht 42 , <strong>der</strong> zwar<br />
das politische, gesellschaftl<strong>ich</strong>e und verän<strong>der</strong>nde Potential des <strong>Theater</strong>s kannte,<br />
aber es in Form von Propagandatheater o<strong>der</strong> didaktischem <strong>Theater</strong> über einen<br />
kathartischen 43 Prozess, zu nutzen versuchte. Selbst bei den von Brecht konzipierten<br />
Lehrstücken („Der Jasager/Der Neinsager“, „Die Maßnahme“), die n<strong>ich</strong>t<br />
für die Bühne gedacht sind und den Zuschauer auffor<strong>der</strong>n, für s<strong>ich</strong> Lösungen zu<br />
finden, bleibt ein vorgegebener, unverän<strong>der</strong>barer Text erhalten, <strong>der</strong> nur verschiedene<br />
Interpretationen zulässt, auch wenn verschiedene Stufen <strong>der</strong> Beteiligung<br />
am Lehrstück, bis hin <strong>zum</strong> aktiven Übernehmen einer Rolle, mögl<strong>ich</strong> sind.<br />
Die Rolle des Zuschauers empfindet Boal als Beleidigung. Um dem Agierenden<br />
41 vgl. dazu Panfy, Daniela: „Com Coragem de ser feliz“. Augusto Boals Teatro Legislativo, <strong>Wie</strong>n, 1998 (Dipl)<br />
und Thorau, Henry: Augusto Boal o<strong>der</strong> Die Probe auf die Zukunft in: Boal, Augusto: <strong>Theater</strong> <strong>der</strong><br />
<strong>Unterdrückten</strong>. Übungen und Spiele für Schauspieler und N<strong>ich</strong>t-Schauspieler; Frankfurt am Main, 1989, S. 9<br />
42 Über das Verhältnis zwischen Boal und Brecht informieren vor allem die Interviews mit Henry Thorau, Bernd<br />
Ruping und Jürgen Weintz in: Boal, Augusto: <strong>Theater</strong> <strong>der</strong> <strong>Unterdrückten</strong>. a.a.O., 1989, S.157-168, <strong>der</strong>s.: Der<br />
Regenbogen <strong>der</strong> Wünsche. a.a.O., 1999, S. 158-167 und Ruping, Bernd (Hrg.): Gebraucht das <strong>Theater</strong>; a.a.O.,<br />
1991, S. 328-337<br />
Zum Brechtschen Lehrstück s.: Steinweg, Reiner: Lehrstück und episches <strong>Theater</strong>, Brechts Theorie und die<br />
theaterpädagogische Praxis, Frankfurt a. M., 1995<br />
43 <strong>zum</strong> Begriff <strong>der</strong> Katharsis siehe: Kap. 6.7.1<br />
26
(engl. actor) seinen Nimbus zu nehmen und dem Zuschauer (engl. spectator) seine<br />
Handlungsfähigkeit zurück zu geben, kreiert er den „spect-actor“ 44 .<br />
„»Zuschauer« - welch eine Beleidigung<br />
Der Zuschauer, das passive Wesen par excellence, ist weniger als ein<br />
Mensch. Es tut not, ihn wie<strong>der</strong> <strong>zum</strong> Menschen zu machen, ihm seine<br />
Handlungsfähigkeit zurückzugeben.“ 45<br />
Als Paradeunterdrückter muss er aus seiner Passivität befreit werden und in die<br />
Handlung eingreifen. Boals Ziel besteht darin, den<br />
„Zuschauer, das passive Wesen im <strong>Theater</strong> <strong>zum</strong> Subjekt zu machen,<br />
<strong>zum</strong> Akteur, <strong>zum</strong> Verän<strong>der</strong>er <strong>der</strong> dramatischen Handlung.“ 46<br />
Es ist <strong>der</strong> Verdienst Augusto Boals, die hierarchische Trennung zwischen Zuschauer<br />
und Schauspieler, die neben allen an<strong>der</strong>en eingangs von mir erwähnten<br />
Trennungen, für viele die Essenz des <strong>Theater</strong>s aus<strong>zum</strong>achen scheint, (wie<strong>der</strong>)<br />
aufgehoben zu haben.<br />
3.) strukurelle Unterdrückung: Die Struktur des <strong>Theater</strong>s wie es aus europäischer<br />
S<strong>ich</strong>t verstanden wird, dient mir als Beispiel für strukturelle Gewalt.<br />
Im Zuge seines Exils in Europa stieß Boal durchaus auf Unterdrückungsformen, die<br />
er aus Lateinamerika kannte, allerdings auch auf solche, mit denen er zu Beginn<br />
n<strong>ich</strong>ts anfangen konnte. Begriffe wie Leere, Kommunikationslosigkeit o<strong>der</strong> Einsamkeit<br />
erschienen ihm n<strong>ich</strong>t als konkrete Unterdrückung, bis er sie im Zusammenhang<br />
mit Selbstmordraten, Suchterkrankungen und an<strong>der</strong>en Wohlstandserscheinungen<br />
betrachtete. Boal akzeptierte diese Formen <strong>der</strong> Unterdrückung als<br />
44 Ich werde dieses Boalsche Vokabel in seiner englischen Fassung übernehmen, weil die deutsche Übersetzung<br />
„Zu-Schauspieler“ zu sehr holpert, wobei s<strong>ich</strong> bereits im Wort „Schauspieler“ <strong>der</strong> Zusammenhang erkennen<br />
ließe, das Wort allerdings schon an<strong>der</strong>weitig besetzt ist und damit n<strong>ich</strong>t <strong>der</strong> von Boal gewollten Bedeutung<br />
entspr<strong>ich</strong>t. Mit spectactor ist selbstverständl<strong>ich</strong> immer auch jede spectactress gemeint.<br />
45 Boal, Augusto: <strong>Theater</strong> <strong>der</strong> <strong>Unterdrückten</strong>. a.a.O., 1989, S. 66<br />
46 ebd. S. 43<br />
27
solche und beschloss mit den Techniken des TO ebenso dagegen anzukämpfen. 47<br />
Die Quellen <strong>der</strong> Unterdrückung wurden in diesen Fällen vielfach auch internalisiert,<br />
müssen also auch innerhalb des Menschen gesucht und bekämpft<br />
werden.<br />
4.) und 5.) internalisierte kulturelle und strukturelle Unterdrückung: Wenn<br />
Systeme und <strong>der</strong>en Inhalte, sowie kulturelle Normen verinnerl<strong>ich</strong>t wurden, muss<br />
s<strong>ich</strong> die Gewalt, die durch sie provoziert wird, n<strong>ich</strong>t unbedingt gegen an<strong>der</strong>e<br />
r<strong>ich</strong>ten, son<strong>der</strong>n kann s<strong>ich</strong> auch gegen die eigene Person wenden.<br />
Passivität und Akzeptanz gegenüber den Strukturen sind wesentl<strong>ich</strong>e Elemente, die<br />
<strong>zum</strong> Gelingen <strong>der</strong> Unterdrückung beitragen. Dies wird im Verhältnis des<br />
Menschen zu seinen generellen und kreativen Ausdrucksmögl<strong>ich</strong>keiten ers<strong>ich</strong>tl<strong>ich</strong>,<br />
die einer steigenden Anzahl an Einschränkungen unterliegen. Foucault spr<strong>ich</strong>t in<br />
seiner Machtanalyse von kontinuierl<strong>ich</strong>en Prozessen, die Körper unterwerfen,<br />
Gesten lenken und das Verhalten beherrschen. 48 Auch Boal geht davon aus, dass<br />
<strong>der</strong> Mensch im Laufe seines Lebens durch zunehmende Unterdrückung durch<br />
Gesellschaft, Familie, Schule und Arbeit körperl<strong>ich</strong> deformiert wird, sowie im<br />
Glauben Tänzer, Sänger, Maler, Schauspieler zu sein, gehin<strong>der</strong>t wird. Das TO<br />
bietet mit seinen Übungen und Methoden eine Mögl<strong>ich</strong>keit, dem Körper und<br />
seinem kreativen Potential, die Fähigkeit des Ausdrucks zurückzugeben. 49 Zum<br />
Aufwärmen und Sensibilisieren, das übrigens in je<strong>der</strong> Art von <strong>Theater</strong> einen<br />
w<strong>ich</strong>tigen Stellenwert einnehmen sollte, schlägt Boal deshalb Übungen vor, die<br />
auf Folgendes abzielen 50 :<br />
to look at what you see (anschauen was wir sehen)<br />
to listen to what you hear (anhören was wir hören)<br />
to feel what you touch (fühlen was wir berühren)<br />
dynamize several senses (alle Sinne entwickeln)<br />
47 Boal, Augusto: Der Regenbogen <strong>der</strong> Wünsche. a.a.O., 1999, S. 21<br />
48 Foucault, M<strong>ich</strong>ael: Dispositive <strong>der</strong> Macht. Berlin, 1978, S. 81<br />
49 vgl. Boal, Augusto: <strong>Theater</strong> <strong>der</strong> <strong>Unterdrückten</strong>. a.a.O., 1989, S. 46 und S. 69<br />
50 Diese Vorschläge stammen aus den Workshops, die <strong>ich</strong> bei Boal besucht habe. zuletzt protokolliert: 16.-18.<br />
April 2001, privates Protokoll<br />
28
Der Mensch sieht s<strong>ich</strong> demnach ständig mit Formen von Unterdrückungen konfrontiert,<br />
von außen und von innen. Bei den von innen wirkenden Formen muss<br />
zwischen während <strong>der</strong> Sozialisation erworbenen und grundgelegten Formen<br />
unterschieden werden.<br />
„Unsere Kultur ist ganz allgemein auf <strong>der</strong> Unterdrückung von<br />
Trieben aufgebaut.“ 51<br />
Vor allem <strong>der</strong> Aggression (Mord) und Sexualität (Inzest) gilt laut Freud das Hauptaugenmerk<br />
<strong>der</strong> Unterdrückung <strong>zum</strong> Zweck <strong>der</strong> Kulturarbeit. Diese Triebunterdrückungen<br />
wurden im Laufe <strong>der</strong> Phylogenese zu Kulturmerkmalen <strong>der</strong> Menschheit.<br />
Während <strong>der</strong> Ontogenese kommen zusätzl<strong>ich</strong>e Repressionen hinzu.<br />
„Es liegt in <strong>der</strong> R<strong>ich</strong>tung unserer Entwicklung, dass äußerer Zwang<br />
allmähl<strong>ich</strong> verinnerl<strong>ich</strong>t wird, indem eine beson<strong>der</strong>e seelische<br />
Instanz, das Über-Ich des Menschen, ihn unter seine Gebote<br />
aufnimmt. Jedes Kind führt uns den Vorgang einer solchen<br />
Umwandlung vor, wird erst durch sie moralisch und sozial. Diese<br />
Erstarkung des Über-Ichs ist ein höchst wertvoller psychologischer<br />
Kulturbesitz. Die Personen, bei denen er s<strong>ich</strong> vollzogen hat, werden<br />
von Kulturgegnern zu Kulturträgern.“ 52<br />
Die Verträgl<strong>ich</strong>keit dieser Unterdrückung variiert unter den Individuen und hängt<br />
von <strong>der</strong> Beschaffenheit ihres Triebhaushaltes und <strong>der</strong> Triebstärke ab. Je nach<br />
Intensität des Triebes kann eine erfolgre<strong>ich</strong>e Unterdrückung geleistet werden o<strong>der</strong><br />
eine Strategie für den Umgang mit ihm entwickelt werden, die entwe<strong>der</strong> die<br />
strafenden Konsequenzen des Auslebens erträgt, psychoneurotische Ersatzerscheinungen<br />
zu Tage för<strong>der</strong>t o<strong>der</strong> ihn als außergewöhnl<strong>ich</strong> zu nutzen versteht.<br />
51 Freud, Sigmund: Die >kulturelle< Sexualmoral und die mo<strong>der</strong>ne Nervosität in: <strong>der</strong>s.: Fragen <strong>der</strong> Gesellschaft<br />
/ Ursprünge <strong>der</strong> Religion. Studienausgabe Band IX, Frankfurt am Main, 1974, S. 18<br />
52 Freud, Sigmund: Die Zukunft einer Illusion in: <strong>der</strong>s.: Fragen <strong>der</strong> Gesellschaft / Ursprünge <strong>der</strong> Religion. a.a.O.,<br />
1974, S. 145<br />
29
„Wer Kraft seiner unbeugsamen Konstitution diese<br />
Triebunterdrückung n<strong>ich</strong>t mitmachen kann, steht <strong>der</strong> Gesellschaft<br />
als »Verbrecher«, als »outlaw« gegenüber, insofern n<strong>ich</strong>t seine<br />
soziale Position und seine hervorragenden Fähigkeiten ihm<br />
gestatten, s<strong>ich</strong> in ihr als großer Mann, als »Held« durchzusetzen.“ 53<br />
Allerdings bringt auch die Befriedigung <strong>der</strong> Triebe ihre Probleme mit s<strong>ich</strong>, denn<br />
„eine Kultur, (die) es n<strong>ich</strong>t darüber hinaus gebracht hat, dass die<br />
Befriedigung einer Anzahl von Teilnehmern die Unterdrückung einer<br />
an<strong>der</strong>en, vielle<strong>ich</strong>t <strong>der</strong> Mehrzahl, zur Voraussetzung hat, und dies ist<br />
bei allen gegenwärtigen Kulturen <strong>der</strong> Fall, so ist es begreifl<strong>ich</strong>, dass<br />
diese <strong>Unterdrückten</strong> eine intensive Feindseligkeit gegen die Kultur<br />
entwickeln, (...). Eine Verinnerl<strong>ich</strong>ung <strong>der</strong> Kulturverbote darf man<br />
bei den <strong>Unterdrückten</strong> n<strong>ich</strong>t erwarten, (...). Die Kulturfeindschaft<br />
dieser Klassen ist so offenkundig, dass man über sie die eher latente<br />
Feindseligkeiten <strong>der</strong> besser beteilten Gesellschaftssch<strong>ich</strong>ten<br />
übersehen hat.“ 54<br />
Zusammenfassung:<br />
Ich komme in meiner Analyse auf fünf Arten von Unterdrückung, von denen vier<br />
im TO berücks<strong>ich</strong>tigt werden und gegen die angespielt wird. Neben <strong>der</strong> Aufhebung<br />
<strong>der</strong> Unterdrückung <strong>der</strong> Zuschauer im <strong>Theater</strong> handelt es s<strong>ich</strong> hierbei um<br />
die direkten Formen <strong>der</strong> Unterdrückung und Gewalt physischer, verbaler und psychischer<br />
Ausprägung (Schläge, Schüsse, Beschimpfung, Beleidigung, Verleumdung,<br />
...), strukturelle Unterdrückung (Polizeigewalt, Ungerechtigkeit, Gesetzeslücken<br />
und -flut, Bildungssystem, ...) und kulturelle Unterdrückung (Sozialisation,<br />
Kapitalismus, Sexismus, Rassismus, Kunst, ...) sowie <strong>der</strong>en Internalisierung.<br />
53 Freud, Sigmund: Die >kulturelle< Sexualmoral und die mo<strong>der</strong>ne Nervosität in: <strong>der</strong>s.: Fragen <strong>der</strong> Gesellschaft<br />
/ Ursprünge <strong>der</strong> Religion. a.a.O., 1974, S. 18<br />
54 Freud, Sigmund: Die Zukunft einer Illusion in: <strong>der</strong>s.: Fragen <strong>der</strong> Gesellschaft / Ursprünge <strong>der</strong> Religion. a.a.O.,<br />
1974, S. 146<br />
30
Ich folge also in meiner Einteilung von Unterdrückung <strong>der</strong> Unterscheidung von<br />
Gewalt nach Johan Galtung in direkte, strukturelle und kulturelle Gewalt.<br />
Diese Analogie ergibt s<strong>ich</strong> für m<strong>ich</strong> in erster Linie durch die, unter <strong>der</strong> Vorgabe<br />
„Unterdrückung“, dargestellten Bil<strong>der</strong> und Szenen im TO, die neben <strong>der</strong> unmittelbaren<br />
Gewalt an<strong>der</strong>en gegenüber auch die Vorgesch<strong>ich</strong>ten und Hintergründe darstellen,<br />
von <strong>der</strong> ungle<strong>ich</strong>en Entlohnung zwischen Frauen und Männern bis zur im<br />
Eingangszitat beschriebenen Arroganz <strong>der</strong> vermeintl<strong>ich</strong>en geistigen Überlegenheit.<br />
Auch die in <strong>der</strong> Literatur Boals, Freires und an<strong>der</strong>er, beschriebenen Formen <strong>der</strong><br />
Unterdrückung spiegeln diese 3 Dimensionen von Gewalt wi<strong>der</strong>, wenn sie<br />
Bildungssysteme, Regierungsformen, Familienverhältnisse, Kulturbetriebe, Beziehungen,<br />
Arbeitssituationen, Gesellschaftszusammenhänge, Alltag und vieles<br />
mehr schil<strong>der</strong>n. In Folge wird s<strong>ich</strong> zeigen, ob das Verständnis von Unterdrückung<br />
im TO den Vorgaben <strong>der</strong> Konzeption von Johan Galtung gerecht wird und wie die<br />
entsprechenden Methoden des TO mit den Formen <strong>der</strong> Unterdrückung umgehen.<br />
Die fünfte, phylogenetisch verinnerl<strong>ich</strong>te, die Kultur tragende Form <strong>der</strong> Unterdrückung,<br />
bleibt in diesem Sinn im TO unberücks<strong>ich</strong>tigt, muss aber als Ursprung<br />
aller Unterdrückungsformen mitgedacht werden. Ein zusätzl<strong>ich</strong>es Spannungsfeld<br />
ergibt s<strong>ich</strong> aber sehr wohl im Bere<strong>ich</strong> zwischen Unterdrückung als Kulturarbeit und<br />
individueller Auflehnung dagegen.<br />
Boals Techniken haben alle <strong>zum</strong> Ziel, Wi<strong>der</strong>stand gegen Unterdrückung zu leisten,<br />
„sowohl gegen die Unterdrückung, die man s<strong>ich</strong> selbst zufügt, als<br />
auch gegen die Unterdrückung durch an<strong>der</strong>e, Menschen und<br />
Institutionen, intellektuell, körperl<strong>ich</strong> und emotional.“ 55 31<br />
55 Thorau, Henry: Augusto Boal o<strong>der</strong> Die Probe auf die Zukunft. in Boal, Augusto: <strong>Theater</strong> <strong>der</strong> <strong>Unterdrückten</strong>,<br />
a.a.O., 1989, S. 15
6 Augusto Boal und das <strong>Theater</strong> <strong>der</strong><br />
<strong>Unterdrückten</strong><br />
“(...) from the favelas of Rio to the rehearsal studios of the Royal Shakespeare<br />
Company.” 56<br />
Das <strong>Theater</strong> <strong>der</strong> <strong>Unterdrückten</strong> ist durch die untrennbare Verbindung mit <strong>der</strong><br />
Person Augusto Boals auch wesentl<strong>ich</strong> von seiner Biographie geprägt. Immer<br />
wie<strong>der</strong> hat s<strong>ich</strong> eine neue Methode aus einer persönl<strong>ich</strong>en Notwendigkeit heraus<br />
ergeben, um politischen Repressalien zu begegnen, um verän<strong>der</strong>te Rahmenbedingungen<br />
in Exillän<strong>der</strong>n und -gesellschaften ein- und aufarbeiten zu können.<br />
Methoden entstanden, gerieten in Vergessenheit, waren für den Moment passend<br />
o<strong>der</strong> bewährten s<strong>ich</strong> immer wie<strong>der</strong>. Darin wurzelt auch die Auffor<strong>der</strong>ung Boals,<br />
seine Methoden niemals als starres Regelwerk zu betrachten, son<strong>der</strong>n sie vielmehr<br />
den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen und sie durch eigene Ideen und Vorstellungen<br />
anzure<strong>ich</strong>ern.<br />
„Während meiner Arbeit dort (in Indien, Anm. A. <strong>Staffler</strong>) wurde mir<br />
wie<strong>der</strong> einmal klar, dass die hier beschriebenen Techniken immer in<br />
spezifischer Weise angewandt und überarbeitet werden müssen,<br />
damit sie für die Menschen, die sie anwenden wollen, nützl<strong>ich</strong> sind<br />
und n<strong>ich</strong>t umgekehrt.“ 57<br />
Im Folgenden sollen markante Stationen in <strong>der</strong> Entstehungsgesch<strong>ich</strong>te des TO<br />
nachgeze<strong>ich</strong>net, Techniken beschrieben und erläutert und durch Beispiele aus <strong>der</strong><br />
Literatur und meiner eigenen Praxis veranschaul<strong>ich</strong>t werden.<br />
56 Adrian Jackson über den (theatralischen) Lebensweg von Augusto Boal, in: Boal, Augusto: Hamlet and the<br />
Baker’s Son, My Life in Theatre and Politics, London, 2001, Umschlag<br />
57 Boal, Augusto: Der Regenbogen <strong>der</strong> Wünsche. a.a.O., 1999, S. 155<br />
32
6.1 Teatro de Arena<br />
Am 15. März 1931 wird Augusto Boal in Rio de Janeiro/Brasilien geboren und<br />
beginnt bereits in jungen Jahren mit dem Schreiben von <strong>Theater</strong>stücken. Sein<br />
Studium <strong>der</strong> Industriechemie führt ihn 1953 bis 1955 an die Columbia University/New<br />
York. Während dieser Zeit gewinnt er auch einen Preis für seinen Einakter<br />
„Martin Pescador“, den er, nebst zwei weiteren Stücken, auch selbst inszeniert.<br />
Nach seiner Rückkehr nach Brasilien wird er 1956 Direktor des Teatro de<br />
Arena in São Paolo, wo er zunächst noch den Konventionen folgt und Steinbecks<br />
„Of Mice And Men“ inszeniert, aber schon bald beginnt er mit seinen Dramaturgieseminaren<br />
und seiner Schauspielerwerkstatt einen Kontrastpunkt <strong>zum</strong><br />
staatl<strong>ich</strong>en <strong>Theater</strong> zu setzen. Als erstes verlernen die Schauspieler bei Boal die<br />
künstl<strong>ich</strong>e Sprechweise zu Gunsten <strong>der</strong> Sprache <strong>der</strong> Straße, wodurch auch die<br />
Erarbeitung <strong>der</strong> Stücke in eine an<strong>der</strong>e R<strong>ich</strong>tung geht. Henry Thorau beze<strong>ich</strong>net<br />
diese Zeit als die „fotorealistische Phase“ des Teatro de Arena. 58 Augusto Boal<br />
verstand seine <strong>Theater</strong>arbeit immer schon als in höchstem Maße politisch und<br />
formulierte seine Ziele 1959 auf folgende Weise:<br />
„Das ´Arena´ verfolgt eine klar definierte Linie: es inszeniert<br />
ausschließl<strong>ich</strong> brasilianische Texte. (...) Das Ziel ist die größere<br />
Integration des <strong>Theater</strong>s mit dem Volk. Was wir, <strong>ich</strong> und Leute aus<br />
dem Seminaro (einige, n<strong>ich</strong>t alle), machen werden, ist<br />
wahr(haftig)es politisches <strong>Theater</strong>. Wir werden die fundamentalen<br />
Themen und Probleme <strong>der</strong> Gesellschaft lehren. Wir wollen mit den<br />
ernstesten sozialen Problemen konfrontieren, in einer Art, die die<br />
größte Anzahl <strong>der</strong> Zuschauer anspr<strong>ich</strong>t.“ 59<br />
In <strong>der</strong> Folgezeit spielt Boal also hauptsächl<strong>ich</strong> brasilianische Autoren, auch eigene<br />
58 Panfy, Daniela: „Com Coragem de ser feliz“. a.a.O., 1998, S. 12 zit. nach Thorau, Henry: Augusto Boals<br />
<strong>Theater</strong> <strong>der</strong> <strong>Unterdrückten</strong> in Theorie und Praxis, Rheinfelden, 1982, S. 11<br />
59 Boal, Augusto: zit. nach und übersetzt von Panfy, Daniela: „Com Coragem de ser feliz“. a.a.O, 1998, S. 13<br />
zit. nach Thorau, Henry: Augusto Boals <strong>Theater</strong> <strong>der</strong> <strong>Unterdrückten</strong> in Theorie und Praxis. a.a.O., 1982, S. 12<br />
33
Stücke und einige Stücke von Brecht, dessen Einfluss s<strong>ich</strong> vor allem theoretisch<br />
nie<strong>der</strong>schlägt. In <strong>der</strong> Zeit ab 1963, als s<strong>ich</strong> die politische Situation drastisch verschlechtert,<br />
greift das Teatro de Arena auf Klassiker wie Molière (´Tartuffe´) und<br />
Lope de Vega (´El mejor alcalde, el Rey´) 60 zurück, die von <strong>der</strong> Zensur unangetastet<br />
bleiben, obwohl „(...) wir kein Jota des Originals zu verän<strong>der</strong>n (brauchten),<br />
um Molières Botschaft auf brasilianische Verhältnisse zu übertragen.“ 61 Ein<br />
weiteres Mittel um <strong>der</strong> Zensur zu entgehen, war das Verlassen <strong>der</strong> übl<strong>ich</strong>en<br />
Bühnen und das Spielen auf Marktplätzen, auf Lastwägen o<strong>der</strong> in Kirchen.<br />
Mit den ´Arena conta...´-Produktionen (Arena conta Zumbi (1965), Arena conta<br />
Bahia (1965), Arena conta Bolivar (1970), u.a.) 62 beginnt das Team um Augusto<br />
Boal (u.a. mit Gilberto Gil) mit Collagen, Politikerzitaten, Zeitungsausschnitten und<br />
Meinungsumfragen auf ungewöhnl<strong>ich</strong>e Art Stücke zu erarbeiten, um trotz historischer<br />
Themen stets aktuell zu bleiben, muss aber auf Grund des zweiten<br />
Putsches im Dezember 1968 zunehmend auf Tournee ins Ausland. In Brasilien<br />
selbst wird diese subversive <strong>Theater</strong>arbeit immer gefährl<strong>ich</strong>er, weshalb Boal nach<br />
neuen Wegen sucht. Er beginnt in Anlehnung an die Pädagogik <strong>der</strong> <strong>Unterdrückten</strong><br />
von Paolo Freire seine Ideen von einem <strong>Theater</strong> <strong>der</strong> <strong>Unterdrückten</strong> zu entwickeln.<br />
Als Augusto Boal 1971 verhaftet wird und für drei Monate ins Gefängnis kommt,<br />
wo er unter Folter verhört wird, muss er anschließend ins argentinische Exil nach<br />
Buenos Aires. Dort und beim bereits erwähnten Alphabetisierungsprojekt widmet<br />
er s<strong>ich</strong> <strong>der</strong> theoretischen und praktischen Weiterentwicklung seiner Idee von<br />
einem <strong>Theater</strong> <strong>der</strong> <strong>Unterdrückten</strong>.<br />
60 Der König ist die beste Gerechtigkeit (Übersetzung: A. <strong>Staffler</strong>)<br />
61 Boal, Augusto: <strong>Theater</strong> <strong>der</strong> <strong>Unterdrückten</strong>. a.a.O., 1989, S. 22<br />
62 ´Arena conta…´ Das Arena erzählt… (Übersetzung: Daniela Panfy) vgl. dazu: Panfy, Daniela: „Com<br />
Coragem de ser feliz“. a.a.O., 1998, S. 15f<br />
und Thorau, Henry: Augusto Boal o<strong>der</strong> Die Probe auf die Zukunft in: Boal, Augusto: <strong>Theater</strong> <strong>der</strong><br />
<strong>Unterdrückten</strong>. a.a.O., 1989, S. 13f<br />
34
6.2 Das Zeitungstheater<br />
„Hier ist <strong>der</strong> Gegensatz zwischen Künstler und Zuschauer aufgehoben. Hier wird<br />
das Volk <strong>zum</strong> erstenmal aktiv und kreativ.“ 63<br />
Das Zeitungstheater gilt als die erste Methode des <strong>Theater</strong>s <strong>der</strong> <strong>Unterdrückten</strong>.<br />
Boal schlägt elf Techniken vor, um Zeitungen gegen den Str<strong>ich</strong> zu lesen und die<br />
scheinbare Objektivität des Journalismus zu entlarven. Dabei geht es n<strong>ich</strong>t nur um<br />
die Inhalte <strong>der</strong> Texte, son<strong>der</strong>n auch um <strong>der</strong>en Platzierung innerhalb <strong>der</strong> Zeitung,<br />
das Layout, begleitendes Bildmaterial und die gesamte Blattlinie. In weiterer Folge<br />
können diese Techniken auf alles Gedruckte und alle an<strong>der</strong>en Medien angewandt<br />
werden.<br />
Die 11 Techniken des Zeitungstheaters 64<br />
1. Einfaches Lesen<br />
Der Text wird kommentarlos und aus dem Zusammenhang gerissen vorgelesen.<br />
2. Vervollständigendes Lesen<br />
Es werden an<strong>der</strong>e Quellen herangezogen und Hintergrundinformationen<br />
genützt, um unvollständige o<strong>der</strong> bewusst tendenziöse Meldungen zu ergänzen.<br />
3. Gekoppeltes Lesen<br />
S<strong>ich</strong> wi<strong>der</strong>sprechende, konträre o<strong>der</strong> gegenseitig aufhebende Meldungen<br />
werden unmittelbar hintereinan<strong>der</strong> mehrmals gelesen.<br />
4. Rhythmisches Lesen<br />
Die durch verschiedene Rhythmen o<strong>der</strong> Musikstile (Walzer, Marsch, Volksmusik,...)<br />
hervorgerufenen Assoziationen geben dem gelesenen Text eine<br />
an<strong>der</strong>e Bedeutung.<br />
63 Boal, August: <strong>Theater</strong> <strong>der</strong> <strong>Unterdrückten</strong>. a.a.O., 1989, S. 29<br />
64 ebd.: S. 30 – 34; (gekürzt und zusammengefasst, A. <strong>Staffler</strong>)<br />
35
5. Untermaltes Lesen<br />
Eingängige, einschlägige und bekannte Phrasen aus <strong>der</strong> Politik (Wahl<strong>kam</strong>pf,<br />
Regierungssendungen,...) werden als Untermalung für trockene<br />
Zeitungsmeldungen genutzt.<br />
6. Pantomimisches Lesen<br />
Die Meldung wird vorgelesen und durch eine konträre pantomimische<br />
Darstellung verdeutl<strong>ich</strong>t o<strong>der</strong> zur Gänze pantomimisch dargestellt .<br />
7. Improvisierendes Lesen<br />
Die Meldung wird in Szene gesetzt, wobei alle theatralischen Stilmittel und<br />
Techniken zu Hilfe genommen werden sollen.<br />
8. Historisches Lesen<br />
Heutige Ereignisse und Themen sollen in <strong>der</strong> Ber<strong>ich</strong>terstattung mit<br />
Ähnl<strong>ich</strong>em aus <strong>der</strong> Vergangenheit vergl<strong>ich</strong>en werden.<br />
9. Konkretisierendes Lesen<br />
Abgedroschene Floskeln, inhaltslose Phrasen und die „Informationsflut“<br />
verdecken den eigentl<strong>ich</strong>en Gehalt einer Nachr<strong>ich</strong>t, <strong>der</strong> szenisch herausgearbeitet<br />
wird.<br />
10. Pointiertes Lesen<br />
Ein Text o<strong>der</strong> eine Meldung wird in an<strong>der</strong>es Genre (Regenbogenpresse,<br />
Gebrauchsanweisung, Feuilleton,...) transkribiert.<br />
11. Kontext-Lesen<br />
Einzelschicksale und Details, wie sie in den Medien oft hochstilisiert werden,<br />
werden in einen größeren Zusammenhang gebracht.<br />
Alle Techniken können und sollen miteinan<strong>der</strong> kombiniert werden.<br />
Das Zeitungstheater bietet auch die offens<strong>ich</strong>tl<strong>ich</strong>ste Mögl<strong>ich</strong>keit, <strong>der</strong> strukturellen<br />
Gewalt in Form von Definitionen und Besetzung <strong>der</strong> Begriffe, Paroli zu bieten,<br />
obwohl dies auch mit den an<strong>der</strong>en Methoden erre<strong>ich</strong>t werden kann. Diese Technik<br />
eignet s<strong>ich</strong> gerade in unserer Medienlandschaft mit ihrer Informationsflut (sic!),<br />
36
Reizüberflutung und Betroffenheitsmaschinerie dazu, zu relativieren und wie<strong>der</strong><br />
einen angemessenen Bezug <strong>zum</strong> „Schwarz auf Weiß“-Realismus zu erlangen. 65<br />
Oft genügt es, nur eine Meldung <strong>der</strong> aktuellen Lage gegenüber zu stellen. Die in<br />
Zeitungen abgedruckte Menüabfolge eines Banketts zu Ehren des US-amerikanischen<br />
Botschafters in Zusammenhang mit dem Verbot des Verzehrs von Rindfleisch<br />
auf Grund einer Lebensmittelknappheit erzeugt ohne großen Aufwand<br />
immenses Aufsehen. 66<br />
Als Vorbereitung genügt es, einige Zeitungen und Zeitschriften quer zu lesen und<br />
(be)merkenswerte Artikel und Beiträge aller Stile heraus zu schneiden. Die persönl<strong>ich</strong><br />
als markant empfundenen Textpassagen, Phrasen o<strong>der</strong> einfach nur Schlagwörter<br />
werden dann auf verschiedene Arten, vorerst nur für s<strong>ich</strong> und am besten im<br />
Gehen, gelesen: als Nachr<strong>ich</strong>tenmeldung, als Predigt, in einem bestimmten<br />
Rhythmus, als Werbebotschaft, brüllend, geheimnisvoll. Der Phantasie sind keine<br />
Grenzen gesetzt. Im weiteren Verlauf treten die SpielerInnen über ihre Texte in<br />
Kontakt zu einan<strong>der</strong> und führen Dialoge, auch hierbei können sie in verschiedene<br />
Rollen schlüpfen. Beim Vergle<strong>ich</strong>en mit an<strong>der</strong>en fallen bald Ähnl<strong>ich</strong>keiten o<strong>der</strong><br />
Wi<strong>der</strong>sprüche auf, die s<strong>ich</strong> thematisch zusammenfassen lassen. Als Hilfestellung<br />
können dann die vorgeschlagenen Techniken des Zeitungstheaters dazu dienen,<br />
Szenen o<strong>der</strong> Collagen auf dem Hintergrund <strong>der</strong> Texte zu entwerfen.<br />
6.2.1 Sieht so ein Mann aus?<br />
Zeitungstheater erlaubt auch die Herangehensweise an Themen mit einem<br />
Augenzwinkern, weil gerade die Sprache <strong>der</strong> Zeitung und <strong>der</strong>en vielle<strong>ich</strong>t seltsam<br />
anmutende Vertrautheit die Lust und Freude am Spiel mit ihr weckt. Bei den in<br />
Zeitungen behandelten Themen bleibt es aber n<strong>ich</strong>t aus, dass <strong>der</strong> Ernst s<strong>ich</strong> im<br />
Laufe <strong>der</strong> Zeit unweigerl<strong>ich</strong> einstellt.<br />
65 vgl. dazu auch die Erfahrungen von Schmidt, Monika: Vom Zuspitzen <strong>der</strong> Wi<strong>der</strong>sprüche – das<br />
Zeitungstheater in: Ruping, Bernd (Hrdg.): Gebraucht das <strong>Theater</strong>; a.a.O., 1991, S. 94ff<br />
66 Boal, August: <strong>Theater</strong> <strong>der</strong> <strong>Unterdrückten</strong>. a.a.O., 1989, S. 30<br />
37
Bei meiner ersten Begegnung mit den Methoden des Zeitungstheaters wurde mir<br />
schnell klar, dass die gedruckten Worte bestimmte Bil<strong>der</strong> hervorrufen, die, werden<br />
sie erst einmal dargestellt, die Absurdität einer Meldung vor Augen führen und<br />
s<strong>ich</strong> bei eingehen<strong>der</strong> Beschäftigung mit Texten aus <strong>der</strong> Boulevard- aber auch <strong>der</strong><br />
Tagespresse die Frage stellt, welchen Informationsgehalt diese Meldungen überhaupt<br />
besitzen.<br />
Mit den Techniken des improvisierenden und des gekoppelten Lesens, bei denen<br />
Zeitungsmeldungen in verschiedenen Variationen szenisch dargestellt und<br />
wi<strong>der</strong>sprüchl<strong>ich</strong>e Inhalte miteinan<strong>der</strong> verbunden werden, entstand während eines<br />
Workshops für die TeilnehmerInnen am Lehrgang für politisches und soziales<br />
<strong>Theater</strong> eine Collage aus einer Glosse über die wissenschaftl<strong>ich</strong>e Erkenntnis, dass<br />
<strong>der</strong> Nean<strong>der</strong>taler n<strong>ich</strong>ts zu unserem heutigen Erbgut beitrug, einem Interview mit<br />
Joachim Fuchsberger, einem Ber<strong>ich</strong>t über einen amateurhaften Bankräuber und<br />
zwei skurrilen Randnotizen, die zusammen mit passen<strong>der</strong> musikalischer<br />
Untermalung (Beatles – Help!, M<strong>ich</strong>ael Jackson – Man in the Mirrow, EAV –<br />
Banküberfall) eine köstl<strong>ich</strong>e Parodie auf den mo<strong>der</strong>nen Mann ergab.<br />
Die Auseinan<strong>der</strong>setzung mit dem Thema „Mann“, den an ihn von <strong>der</strong> Gesellschaft<br />
adressierten Erwartungen und seine Rolle innerhalb einer Ehe boten re<strong>ich</strong>l<strong>ich</strong><br />
Material für alle mitwirkenden Männer und Frauen s<strong>ich</strong> mit privaten und gesellschaftl<strong>ich</strong>en<br />
Klischees auseinan<strong>der</strong> zu setzen und einer <strong>der</strong> zentralen Punkte dabei<br />
war s<strong>ich</strong>erl<strong>ich</strong> die Frage nach <strong>der</strong> männl<strong>ich</strong>en Gewalt. Was macht einen Pantoffelhelden<br />
<strong>zum</strong> Bankräuber, wie tief steckt <strong>der</strong> Nean<strong>der</strong>taler im männl<strong>ich</strong>en Unbewussten,<br />
wie gehen Frauen mit männl<strong>ich</strong>er (subtiler) Gewalt um? Mit Hilfe des<br />
Zeitungstheaters näherten wir uns diesen Fragen, unseren Einstellungen ihnen<br />
gegenüber und dem Hinterfragen <strong>der</strong> dazugehörigen, transportierten Zeitungsinhalte<br />
auf lustvolle Art und Weise an.<br />
38
6.3 Statuentheater 67<br />
Am Beginn des Statuentheaters stehen Übungen, die Bewusstsein für den eigenen<br />
und die Körper an<strong>der</strong>er schaffen sollen, und s<strong>ich</strong> somit als Start jegl<strong>ich</strong>er <strong>Theater</strong>arbeit<br />
eignen. Mir fiel immer wie<strong>der</strong> auf, dass es eines unmittelbaren Lerneffektes<br />
bedarf, um festzustellen welche Bewegungen an welchen Gelenken mögl<strong>ich</strong> sind<br />
und wo die Grenzen liegen. Manche sind verwun<strong>der</strong>t, wenn jemand umfällt nur<br />
weil ihm ein Bein weggezogen wird!<br />
In Partnerübungen wie dem Statuendialog beginnt einer <strong>der</strong> Partner sein Gegenüber<br />
zu formen wie eine Figur aus Ton. Dabei ist es w<strong>ich</strong>tig, auf verbale Kommunikation<br />
zu verz<strong>ich</strong>ten. Als mögl<strong>ich</strong>e Hilfe gibt es die Mögl<strong>ich</strong>keit <strong>zum</strong> Beispiel<br />
einen gewünschten Ges<strong>ich</strong>tsausdruck vor<strong>zum</strong>achen. Nach Fertigstellung <strong>der</strong><br />
Statue stellt s<strong>ich</strong> <strong>der</strong> Bildhauer in die selbe Position in die er seinen Partner gestellt<br />
hat und beide verharren kurz. Danach löst s<strong>ich</strong> die ursprüngl<strong>ich</strong>e Statue aus ihrem<br />
Freeze (Erstarrung) und modelliert die zweite Statue nach ihren Vorstellungen um.<br />
Aus dieser Abwechslung zwischen Bildhauer und Statue entsteht ein Dialog von<br />
Bil<strong>der</strong>n, <strong>der</strong> durch Körperhaltungen dargestellt wird.<br />
Das Ziel des Statuentheaters besteht darin, (wie<strong>der</strong>) in Bil<strong>der</strong>n denken zu lernen<br />
und die Bedeutung des Körpers, seiner Haltungen und Ausdrucksmögl<strong>ich</strong>keiten<br />
gewahr zu werden.<br />
Die Beteiligung im und am Statuentheater erfolgt auch in weiterer Folge körperl<strong>ich</strong><br />
und direkt, indem Begriffe, Fragen, Probleme mit beliebig vielen Statuen in<br />
den Raum gestellt werden, die anschließend auch verän<strong>der</strong>t werden können.<br />
Diese Bil<strong>der</strong> werden gemeinsam gestellt, betrachtet und benannt. Welche Aussage<br />
liegt in einer Haltung, in den Positionen zueinan<strong>der</strong>? Welchen Titel könnte diese<br />
Statue tragen? Welche Assoziationen tauchen dazu auf? Mit Hilfe solcher und<br />
an<strong>der</strong>er Fragen können die Statuen lebendig gemacht werden. Handelt es s<strong>ich</strong><br />
etwa um ein Realbild o<strong>der</strong> um ein Wunschbild? <strong>Wie</strong> sähe ein Übergang aus?<br />
67 Beschreibungen und Erklärungen dazu finden s<strong>ich</strong> u.a. bei Boal, Augusto: <strong>Theater</strong> <strong>der</strong> <strong>Unterdrückten</strong>, a.a.O.,<br />
1989, S. 71ff, S. 214, S. 241ff; In meinen Ausführungen folge <strong>ich</strong> aber mehr meinen eigenen Erfahrungen,<br />
wobei die beschriebenen Übungen und die Ideen dahinter n<strong>ich</strong>t von mir erfunden wurden.<br />
39
Welche Statue müsste verän<strong>der</strong>t werden, um die Gesamtaussage des Bildes zu<br />
verän<strong>der</strong>n? Welche Gedanken gehen <strong>der</strong> Statue zu ihrer Haltung durch den Kopf?<br />
Welchen Satz würde sie spontan sagen?<br />
Als eigene Form findet das Statuentheater meiner Erfahrung nach nur selten Anwendung.<br />
Hin und wie<strong>der</strong> taucht es als Freeze in einer Szene auf o<strong>der</strong> in Form<br />
einer lebenden Ausstellung zu einem Thema. Es entwickelte s<strong>ich</strong> aber zu einem<br />
unverz<strong>ich</strong>tbaren Schritt auf dem Weg hin zur Entwicklung einer Szene. Statuen<br />
stehen als Ausgangspunkt einer ganzen Gesch<strong>ich</strong>te. Oft lassen s<strong>ich</strong> jahrelange<br />
Gesch<strong>ich</strong>ten, die Verhältnisse, Beziehungen, Gefühle und Gedanken in einer<br />
eindrucksvollen Statue darstellen, ohne auch nur eine Silbe zu den tatsächl<strong>ich</strong>en<br />
Ereignissen zu verlieren. Den an<strong>der</strong>en bietet s<strong>ich</strong> so die Chance, aus dem eigenen<br />
Erfahrungsschatz heraus eine Vorstellung über die Bedeutung des Bildes zu entwickeln,<br />
die ebenso wahr und real ist wie die des Bildhauers. Über die Unterschiede<br />
in den Interpretationen lässt s<strong>ich</strong> vielle<strong>ich</strong>t aber gerade eine gemeinsame<br />
Tendenz in den Strukturen o<strong>der</strong> ein gemeinsames Muster erkennen, so dass die<br />
ursprüngl<strong>ich</strong> individuelle Gesch<strong>ich</strong>te für alle relevant wird. Aus dem Statischen<br />
lassen s<strong>ich</strong> durch einfache Anweisungen bereits kleine Szenen ableiten. Übergänge<br />
zu einem an<strong>der</strong>en Bild können in Slow Motion improvisiert werden, o<strong>der</strong><br />
man gibt je<strong>der</strong> Statue die Mögl<strong>ich</strong>keit s<strong>ich</strong> 3 Mal nach ihrem Wunsch zu verän<strong>der</strong>n,<br />
das ganze Bild kann auch in <strong>der</strong> Zeit vor- o<strong>der</strong> rückwärts laufen.<br />
Aus diesen kleinen Szenen entwickeln s<strong>ich</strong> dann schon meist umfangre<strong>ich</strong>e<br />
Szenerien, die als Basis für weitere Formen des TO dienen können. Ich schätze das<br />
Statuentheater, weil es prägnant, eindrucksvoll und ästhetisch Themen n<strong>ich</strong>t zur,<br />
son<strong>der</strong>n weg von <strong>der</strong> Sprache und auf den Punkt bringt!<br />
40
6.4 Von <strong>der</strong> Simultanen Dramaturgie <strong>zum</strong> Forumtheater<br />
„Simultane Dramaturgie bedeutet, dass <strong>der</strong> Zuschauer <strong>zum</strong> »Autor« wird und die<br />
Schauspieler seine Ideen unmittelbar in <strong>Theater</strong>szenen umsetzen.“ 68<br />
Boal schil<strong>der</strong>t die Methode <strong>der</strong> Simultanen Dramaturgie anhand <strong>der</strong> hinreißenden<br />
Gesch<strong>ich</strong>te einer Frau, die n<strong>ich</strong>t weiß wie sie ihrem Ehemann begegnen soll, <strong>der</strong><br />
sie betrügt. Die Szene wird so wie sie von <strong>der</strong> Frau erzählt wird von einer routinierten<br />
Truppe von SchauspielerInnen aus ihrem Verständnis heraus in Szene<br />
gesetzt. Die Frau zeigt s<strong>ich</strong> mit dem Ergebnis zufrieden und die Spielleitung bittet<br />
das Publikum um Lösungsvorschläge für die Szene, die in <strong>der</strong> ursprüngl<strong>ich</strong>en Version<br />
damit endet, dass <strong>der</strong> Ehemann davonläuft, was n<strong>ich</strong>t im Interesse seiner<br />
Frau ist. Die Gesch<strong>ich</strong>te wird mit allerlei Vorschlägen durchgespielt, die zwar allesamt<br />
eine Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Gesch<strong>ich</strong>te erwirken und auf eine gewisse Weise die<br />
Lösung des Konflikts erzielen, aber n<strong>ich</strong>t dem Wunsch <strong>der</strong> Erzählerin nach <strong>der</strong><br />
Rückkehr ihres Mannes entsprechen. Erst <strong>der</strong> Vorschlag einer als äußerst resolut<br />
beschriebenen Dame bringt einen Schwenk in die gewünschte R<strong>ich</strong>tung: Die betrogene<br />
Ehefrau solle mit ihrem Mann Klartext reden, ihm, falls er sie um Verzeihung<br />
bitte, liebevoll das Abendessen zubereiten und ihm anschließend verzeihen.<br />
Die Schauspielerin, die die Rolle <strong>der</strong> Ehefrau inne hatte, versuchte mehrere<br />
Male diesen Vorschlag zu spielen, doch zeigte s<strong>ich</strong> die Dame nie auch nur annähernd<br />
zufrieden mit <strong>der</strong> Umsetzung ihrer Idee. Schließl<strong>ich</strong> bat Boal sie selbst auf<br />
die Bühne, um ihre Vorstellung zu zeigen und zu geben.<br />
Daraus entstand eine unmittelbare Mitgestaltung und Beteiligung an einer Situation,<br />
die als Szene dargestellt wird, woraus s<strong>ich</strong> in <strong>der</strong> Konsequenz dann das<br />
Forumtheater, bei dem Personen ausgetauscht und alternative Handlungsmodelle<br />
ausprobiert werden können, entwickelte. Als Geburtsstunde des Forumtheaters<br />
beze<strong>ich</strong>net Boal 1995 rückblickend die Gesch<strong>ich</strong>te eben jener Frau, wie sie oben<br />
geschil<strong>der</strong>t wird.<br />
68 Boal, Augusto: <strong>Theater</strong> <strong>der</strong> <strong>Unterdrückten</strong>, a.a.O., 1989, S. 51<br />
41
Die Gesch<strong>ich</strong>te endete damit, dass die Dame ihren Vorschlag sehr konsequent in<br />
die Tat umsetzte. Sie nahm den Mann in den Schwitzkasten, redete „Klartext“,<br />
verzieh ihm anschließend und bereitete das Abendessen. 69 42<br />
69 Boal, Augusto: Der Regenbogen <strong>der</strong> Wünsche. a.a.O., 1999, S. 17ff
6.5 Das Forumtheater 70<br />
“The pleasure of doing can’t be replaced by the pleasure of watching!”<br />
(Augusto Boal)<br />
Im Forumtheater werden ausgehend von einer Konfliktszene, die für den Protagonisten<br />
ein schlechtes Ende nimmt, verschiedene Handlungsmodelle, die zu<br />
Lösungen führen könnten improvisiert. An die Stelle <strong>der</strong> Diskussion über<br />
Probleme, Themen und Inhalte tritt die aktive Beteiligung aller am Geschehen.<br />
6.5.1 Erarbeitungsphase<br />
Für jedes Forumtheater braucht es eine Ausgangsszene, in <strong>der</strong> ein Protagonist mit<br />
seinen Vorstellungen von <strong>der</strong> Realisierung seiner Wünsche und Ziele im Umgang<br />
mit Unterdrückung scheitert, im Publikum aber das Verlangen provoziert an seiner<br />
Statt in die Szene einzusteigen und auf an<strong>der</strong>em Weg das Angestrebte zu erre<strong>ich</strong>en.<br />
Protagonist Antagonist<br />
Wunsch/Wille Wunsch/Wille<br />
Ende<br />
Nie<strong>der</strong>lage<br />
Krise<br />
Für die Szene ist es von immenser Bedeutung, die Wünsche und Abs<strong>ich</strong>ten genau<br />
und deutl<strong>ich</strong> heraus zu arbeiten, wobei darin <strong>der</strong> Wunsch des Protagonisten etwas<br />
an <strong>der</strong> Situation zu verän<strong>der</strong>n, enthalten sein muss. Innerhalb einer homogenen<br />
Gruppe (Schulklasse, Organisation, Jugendzentrum,...) gibt es aller Wahrscheinl<strong>ich</strong>keit<br />
nach bereits gemeinsame Anliegen, die in Form eines Forumtheaters<br />
70 N<strong>ich</strong>t eigens gekennze<strong>ich</strong>nete Aussagen über das Forumtheater entlehne <strong>ich</strong> aus den bisher zitierten Werken<br />
und ergänze sie mit meinen eigenen Erfahrungen, die <strong>ich</strong> als Teilnehmer o<strong>der</strong> Leiter von Workshops sammeln<br />
durfte.<br />
43
diskutiert werden können. Selbst wenn eine/r eine Situation schil<strong>der</strong>t, stellt s<strong>ich</strong><br />
bei den übrigen ein hoher <strong>Wie</strong><strong>der</strong>erkennungseffekt ein. Bei heterogenen Gruppen<br />
muss man s<strong>ich</strong> auf die Suche nach einem Thema begeben, das für alle <strong>zum</strong>indest<br />
von gewisser Bedeutung ist. Ausgehend von einer individuellen Gesch<strong>ich</strong>te, bei<br />
<strong>der</strong> vielle<strong>ich</strong>t Solidarität und/o<strong>der</strong> Empathie entstehen, versuchen die TeilnehmerInnen<br />
analoge Bil<strong>der</strong> von eigenen Erlebnissen abzurufen, um auf eine<br />
Ebene struktureller Mechanismen zu gelangen, auf <strong>der</strong> n<strong>ich</strong>t mehr das Individuelle<br />
im Vor<strong>der</strong>grund steht, son<strong>der</strong>n eine gemeinsam entdeckte allgemeine Form <strong>der</strong><br />
Unterdrückung, die dann auch in einer modellhaften Szene gespielt werden kann.<br />
Dadurch geht es weniger um die Befreiung eines Einzelnen aus solidarischen<br />
Motiven, denn mehr um ein Durchbrechen unterdrücken<strong>der</strong> Strukturen. Boal<br />
nennt dies „analoge Induktion“ 71 , die auch von einem Gefühl <strong>der</strong> Empathie zu<br />
einem Gefühl <strong>der</strong> Sympathie führt, wodurch es wie<strong>der</strong> <strong>Theater</strong> <strong>der</strong> <strong>Unterdrückten</strong><br />
und n<strong>ich</strong>t <strong>Theater</strong> für Unterdrückte wird. Eine Gruppe die sowohl aus SchülerInnen<br />
als auch aus LehrerInnen besteht, kennt <strong>zum</strong> Beispiel die analogen Formen<br />
<strong>der</strong> Unterdrückung durch LehrerInnen und DirektorIn und einigt s<strong>ich</strong> auf eine<br />
Szene, die etwa im Bildungsmanagement angesiedelt ist.<br />
Der Weg zur Szene und die Recherche für <strong>der</strong>en Inhalt kann über die Improvisation<br />
von Erzähltem o<strong>der</strong> Statuentheater führen und sollte dabei auch all jene<br />
ästhetischen Elemente berücks<strong>ich</strong>tigen, die wir aus dem konventionellen <strong>Theater</strong><br />
kennen. Deshalb ist es auch mögl<strong>ich</strong>, mit bestehenden Stücken Forumtheater zu<br />
spielen. Augusto Boal erzählte mir beispielsweise von einer, seiner Meinung nach<br />
äußerst gelungenen, Forumtheaterbearbeitung <strong>der</strong> „Antigone“ von Sophokles in<br />
<strong>der</strong> Schweiz, bei <strong>der</strong> s<strong>ich</strong> die Gruppe für die Unterdrückung <strong>der</strong> Antigone durch<br />
Kreon und seine Repräsentanz des Gesetzes interessierte.<br />
Sobald die Szene steht, wird sie mit Hilfe verschiedener Probetechniken gefestigt<br />
und präzisiert, wobei beson<strong>der</strong>er Wert auf die Rollenarbeit gelegt werden sollte.<br />
Den SpielerInnen muss es mögl<strong>ich</strong> sein, aus ihrer Rolle heraus angemessen,<br />
schlüssig und konsequent zu agieren und zu reagieren, dazu gehört etwa <strong>der</strong><br />
71 Boal, Augusto: Der Regenbogen <strong>der</strong> Wünsche, a.a.O., 1999, S. 50f<br />
44
Entwurf einer Rollenbiografie und die Aneignung eines spezifischen Handlungsrepertoires.<br />
Bewährte Probetechniken sind hier etwa das Spielen in bestimmten<br />
Genres, in verschiedenen Gefühlszuständen und <strong>der</strong> Rollentausch, so dass jedeR<br />
einmal jede Rolle gespielt hat. Handlungen, Gesten, Tonfälle, alles was s<strong>ich</strong> in den<br />
Proben bewährt, soll beibehalten werden. Schlussendl<strong>ich</strong> braucht es auch hier<br />
eine Generalprobe, bevor das Forumtheater in die Aufführungsphase kommt.<br />
Weitere Probetechniken 72 :<br />
• Stop ’n Think: Den Gedanken an Wendepunkten freien Lauf lassen und<br />
laute innere Monologe führen.<br />
• Deaf (für Gehörlose spielen): Ohne Worte, dafür mit großen Gesten spielen.<br />
• Hannover Variation: Die Charaktere werden von Beobachtern aggressiv<br />
befragt, sie müssen s<strong>ich</strong> rechtfertigen.<br />
• Analyse – Motivation: Mit einer Grundstimmung (Liebe, Angst,...) spielen.<br />
• Analyse – Stil: als Western, Oper, Science fiction,...<br />
• Silence Action: Drauflos spielen und Vorschläge aus dem Publikum<br />
aufnehmen. (unter Wasser spielen, mit einem nervösen Tick spielen, ...)<br />
• Ceremony: Überhöhung, so spielen als wäre man ein Kaiser o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Papst<br />
bei einer Zeremonie.<br />
• Somatication: Verkörperl<strong>ich</strong>ung <strong>der</strong> Emotionen; (Wer s<strong>ich</strong> <strong>zum</strong> Speiben<br />
fühlt, soll speiben!)<br />
• Reconstruction of the crime: Alle Handlungen erklären und begründen, als<br />
müsste man s<strong>ich</strong> vor Ger<strong>ich</strong>t verteidigen.<br />
• Slow Motion: Auch mit sanfter Stimme sprechen.<br />
6.5.2 Aufführungsphase<br />
Es hängt von <strong>der</strong> Entscheidung <strong>der</strong> Gruppe ab, in welchem Rahmen die Aufführung<br />
stattfinden soll: privat o<strong>der</strong> öffentl<strong>ich</strong>, geschlossen o<strong>der</strong> auf <strong>der</strong> Straße.<br />
Generell ist eine Aufführung mit 10 Leuten ebenso mögl<strong>ich</strong> wie mit 200.<br />
72 Vorschläge August Boals bei seinem Workshop in Innsbruck, 16.-18. April 2001, persönl<strong>ich</strong>es Protokoll<br />
45
Der Joker und die Einführung<br />
Im Normalfall übernimmt <strong>der</strong> Leiter <strong>der</strong> Erarbeitungsphase während <strong>der</strong> Aufführung<br />
die Rolle des Jokers. Dieser Begriff leitet s<strong>ich</strong> von <strong>der</strong> gle<strong>ich</strong>namigen<br />
Spielkarte ab und beze<strong>ich</strong>net seine Multifunktionalität.<br />
„The Joker should be able to act as actor/actress, run a play of<br />
Forum Theatre, facilitate workshops and courses in TO, write<br />
and/or coordinate the collective production of theatrical texts,<br />
conseice the play’s aesthetic and be a master of ceremonies at<br />
the Forum Session, stimulating the dialogue between „spectactors“<br />
and the audience.“ 73<br />
Während einer Forumtheateraufführung agiert <strong>der</strong> Joker als Spielleiter und<br />
Mo<strong>der</strong>ator, <strong>der</strong> zu Beginn die Regeln des Forumtheaters erklärt und dann auch<br />
auf <strong>der</strong>en Einhaltung achtet und als Vermittler zwischen Bühne und Zuschauerraum<br />
fungiert. Dazu ist es von Anfang an nötig, die Anwesenden darauf einzustimmen,<br />
dass sie integraler Bestandteil <strong>der</strong> Aufführung (spectactor) sind und<br />
keine Zuschauer. Um die Hemmschwelle vor aktiver Beteiligung abzubauen,<br />
werden gemeinsame einfache Übungen durchgeführt, die Kontakt untereinan<strong>der</strong><br />
ermögl<strong>ich</strong>en und eine entspannte Atmosphäre schaffen sollen. Es hat s<strong>ich</strong> bewährt,<br />
dabei alle auch bewusst in den Bühnenraum zu lassen. Ich möchte hier<br />
eine Frage vorwegnehmen, die mir schon unzählige Male gestellt wurde und wohl<br />
auch noch oft gestellt werden wird: „Steigen die Leute in Österre<strong>ich</strong> überhaupt<br />
ein? In Südamerika, mit <strong>der</strong> dortigen Mentalität und dem Temperament <strong>der</strong><br />
Menschen mag das funktionieren, aber hier bei uns?“ Es funktioniert! In Schweden,<br />
in Brasilien und auch in Österre<strong>ich</strong>. Es funktioniert, wenn und weil die Leute<br />
in <strong>der</strong> Szene Probleme, Situationen, Konflikte wie<strong>der</strong>erkennen, bei denen sie<br />
vielle<strong>ich</strong>t schon öfters selbst den Wunsch verspürt hatten, etwas zu verän<strong>der</strong>n.<br />
73 Santos Bárbara: Who is the Joker? in : Un<strong>der</strong> Pressure, Year 2, Number 7, August 2001 S. 2<br />
(www.formaat.org)<br />
46
Forumphase<br />
Nach einer kurzen Ankündigung und <strong>der</strong> Vorstellung <strong>der</strong> SchauspielerInnen wird<br />
die Modellszene einmal vorgeführt. Im Anschluss daran kann eine kurze Diskussion<br />
und Reflexion <strong>zum</strong> Gesehenen angeregt werden. Nachdem das Stück ein<br />
zweites Mal begonnen wird, genügt ein einfaches „Stopp!“, um es jedem <strong>der</strong><br />
Anwesenden zu ermögl<strong>ich</strong>en, die Szene anzuhalten und einzusteigen, um seine<br />
Vorstellungen vom weiteren Verlauf <strong>der</strong> Gesch<strong>ich</strong>te vorzeigen und ausprobieren<br />
zu können. Erle<strong>ich</strong>tert wird ein Einstieg durch ein Requisit, das <strong>der</strong> Protagonist an<br />
den spectactor weiter gibt, <strong>der</strong> es bei seinem Ausstieg wie<strong>der</strong> ablegt, um aus <strong>der</strong><br />
Rolle zu schlüpfen. Applaus vereinfacht ebenfalls den Ein- und Ausstieg. Erst ab<br />
dem Moment, an dem jemand aktiv in das Geschehen eingreift, <strong>zum</strong> spectactor<br />
wird, gelangt eine Szene in die Forumphase. Ab diesem Zeitpunkt ist alles Mögl<strong>ich</strong>e<br />
und Unmögl<strong>ich</strong>e erlaubt, mit Ausnahme von direkter Gewalt. Gewaltlosigkeit<br />
gilt als oberstes Credo im Forumtheater und selbst wenn Gewalt als einziger Ausweg<br />
erschiene und in „freier Wildbahn“ wahrscheinl<strong>ich</strong> zur Anwendung käme,<br />
muss sie als „Lösung“ ausscheiden. Erstens um die SchauspielerInnen und die einsteigenden<br />
Personen zu schützen und zweitens, weil Gewalt eben niemals eine<br />
wirkl<strong>ich</strong>e Lösung sein kann. „Peace not passivity“ 74 lautet <strong>der</strong> Wahlspruch Augusto<br />
Boals, mit dem er allerdings auch davor warnen möchte, Gewaltlosigkeit und<br />
Friedfertigkeit mit Resignation und Passivität zu verwechseln. Gerade das <strong>Theater</strong><br />
for<strong>der</strong>t dazu heraus, mit aller Kreativität und Phantasie, mit allem Einfallsre<strong>ich</strong>tum,<br />
an die Lösung eines Problems heranzugehen, ohne es dabei an Kraft, Energie und<br />
Entschlossenheit fehlen zu lassen.<br />
„Wenn es keine vernünftige Lösung gibt, versucht eine<br />
unvernünftige. Werdet verrückt, und spielt den Narren, aber tut<br />
etwas!“ 75<br />
74 Augusto Boal signiert <strong>zum</strong> Beispiel all seine E-Mails mit diesem Motto.<br />
75 Boal, Augusto in: Ruping, Bernd: Tango, Sprünge und <strong>Theater</strong>: 15 Anläufe <strong>zum</strong> Vorwort; in: <strong>der</strong>s. (Hrsg.):<br />
Gebraucht das <strong>Theater</strong>. a.a.O., 1991, S. 12<br />
47
Motivationen für den Einstieg: Identifikation, Analogie, Solidarität<br />
Boal spr<strong>ich</strong>t von drei Mögl<strong>ich</strong>keiten, die den Wunsch nach einer Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong><br />
Szene und somit nach einem Einstieg provozieren können. Entwe<strong>der</strong> kennt <strong>der</strong><br />
Zuschauer die Problematik aus <strong>der</strong> eigenen Erfahrung, es erfolgt eine Identifikation<br />
und er kann die Motive des Protagonisten somit konkret nachvollziehen; dies<br />
ist <strong>der</strong> Fall, wenn vor und mit homogenen Gruppen gespielt wird o<strong>der</strong> es besteht<br />
eine Analogie zwischen <strong>der</strong> Unterdrückung, die <strong>der</strong> Protagonist dargestellt hat und<br />
<strong>der</strong> Unterdrückung, die <strong>der</strong> einsteigende Zuschauer aus seiner Erfahrung kennt.<br />
Boal führt hier als Beispiel an, dass es sehr wohl mögl<strong>ich</strong> ist, dass ein Weißer<br />
einen Schwarzen ersetzt, solange dieser n<strong>ich</strong>t als „Schwarzer“ unterdrückt wird,<br />
son<strong>der</strong>n in seiner Rolle als Arbeiter. Die dritte Mögl<strong>ich</strong>keit wäre zwar <strong>der</strong> Einstieg<br />
aus Solidarität, dies müsste aber ausdrückl<strong>ich</strong> dazu gesagt werden, weil s<strong>ich</strong><br />
dadurch die Ausgangslage <strong>der</strong> Unterdrückung grundlegend än<strong>der</strong>t. Dasselbe gilt<br />
für Kin<strong>der</strong>, die Erwachsene ersetzen möchten. Im Sinne obigen Beispiels entspr<strong>ich</strong>t<br />
es deshalb auch n<strong>ich</strong>t <strong>der</strong> Intention Boals, wenn eine Szene ausschließl<strong>ich</strong> aus<br />
Solidarität mit <strong>Unterdrückten</strong> entwickelt wird, ohne selbst Opfer dieser o<strong>der</strong> einer<br />
analogen Form von Unterrückung geworden zu sein.<br />
Die direkt Betroffenen erweisen s<strong>ich</strong> zudem als Experten in ihren Angelegenheiten.<br />
Dies zeigt s<strong>ich</strong> deutl<strong>ich</strong>, wenn eine Szene vor unterschiedl<strong>ich</strong>em Publikum gespielt<br />
wird und das eine Mal Betroffene und das an<strong>der</strong>e Mal Außenstehende ein und<br />
dieselbe Szene sehen und theatralisch diskutieren.<br />
Eine Forumtheateraufführung anlässl<strong>ich</strong> des Festivals <strong>der</strong> Visionen 1999 in <strong>Wie</strong>n<br />
soll dies anschaul<strong>ich</strong> werden lassen:<br />
Das Forumtheaterstück einer Gruppe im Rahmen des sozialökonomischen Projekts<br />
„Fix und Fertig“ mit dem Titel „Endstation U4“ wird von (ehemaligen) Drogenabhängigen<br />
gespielt. Laut Eigenbeschreibung handelt es „von einer Konfliktsituation<br />
zwischen <strong>der</strong> Exekutive und einer Unterstandslosen in einer U-Bahnstation.“<br />
76 Diesem Konflikt geht, quasi als Einleitung, eine Auseinan<strong>der</strong>setzung<br />
zwischen einem Straßenmusiker und einem Passanten voraus. Bei den Einstiegen,<br />
76 Gruber, Karin / Schaller, Angelika: Drogenarbeit und Forumtheater. in: Wrentschur, M<strong>ich</strong>ael / ARGE<br />
Forumtheater Österre<strong>ich</strong> (Hg): Forum <strong>Theater</strong> Österre<strong>ich</strong>. a.a.O., 1999, S. 28<br />
48
die während des Festivals erfolgten, wagte es keiner <strong>der</strong> spectactors – <strong>ich</strong> vermute<br />
unter ihnen we<strong>der</strong> Obdachlose, noch (ehemalige) Drogenabhängige – das<br />
Kommen <strong>der</strong> Exekutive abzuwarten. Alle stiegen nach einer kleinen verbalen Konfrontation<br />
mit dem Passanten wie<strong>der</strong> aus . Bei den Forumphasen vor „eigenem“<br />
Publikum, so wurde mir von Angelika Schaller beteuert, stand hingegen stets <strong>der</strong><br />
zentrale Konflikt mit <strong>der</strong> Exekutive im Mittelpunkt des Interesses und Geschehens.<br />
Was den ZuschauerInnen und spectactors des Festivals fehlte, war die konkrete<br />
Erfahrung im Umgang mit Polizei und selbst für eine empathische Solidaritätsbekundung<br />
schien diese Art <strong>der</strong> Unterdrückung zu bedrohl<strong>ich</strong>.<br />
Beim Einstieg in eine Szene ist <strong>der</strong> Wunsch des Protagonisten zu respektieren und<br />
beizubehalten. In diesem Zusammenhang kann es auch niemals genügen, nur zu<br />
wissen, was man n<strong>ich</strong>t will, vielmehr ist Kreativität „dem Eros verpfl<strong>ich</strong>tet“ und<br />
bedarf deshalb eines zielorientierten Wunsches, wogegen die s<strong>ich</strong> die alleinige<br />
Ablehnung dem Thanatos zuordnen lässt. 77 Hat <strong>der</strong> spectactor seiner Ans<strong>ich</strong>t nach<br />
alles versucht, darf er seinen Einstieg mit einem erneuten „Stopp!“ auch je<strong>der</strong>zeit<br />
selbst wie<strong>der</strong> für beendet erklären.<br />
Von <strong>der</strong> Empathie zur Sympathie<br />
Auf <strong>der</strong> einen Seite benötigen alle Beteiligten ein ausre<strong>ich</strong>endes Repertoire an<br />
<strong>Wie</strong><strong>der</strong>erkennungsmögl<strong>ich</strong>keiten, um adäquat kommunizieren zu können, auf <strong>der</strong><br />
an<strong>der</strong>en Seite stellt Boal die hohe Anfor<strong>der</strong>ung an den Protagonisten, im Zuschauer<br />
Sympathie zu evozieren und zwar ausdrückl<strong>ich</strong> im Gegensatz zu Empathie.<br />
78 Empathie beze<strong>ich</strong>nete zu Zeiten des griechischen <strong>Theater</strong>s die bedingungslose<br />
Identifizierung des Zuschauers mit <strong>der</strong> Figur unter Aufgabe seiner<br />
eigenen Persönl<strong>ich</strong>keit. Durch dieses „Hineinfühlen“ wird die Mögl<strong>ich</strong>keit einer<br />
eigenen S<strong>ich</strong>tweise auf die Situation unterbunden und das Ausschöpfen des<br />
eigenen Erfahrungsschatzes in Bezug auf an<strong>der</strong>e Verhaltensweisen verhin<strong>der</strong>t.<br />
Boal sprach mir gegenüber von „invasion of the character“. Im Falle des „Mit-<br />
77 Diese Gedanken stammen <strong>zum</strong> Teil aus einem persönl<strong>ich</strong>en Gespräch, das A. <strong>Staffler</strong> am 17. April 2001 mit<br />
Augusto Boal führte.<br />
78 Die folgenden Ausführungen stammen aus einem persönl<strong>ich</strong>en Gespräch, das A. <strong>Staffler</strong> am 17. April 2001<br />
mit Augusto Boal führte.<br />
49
fühlens“ bleibt eine Außens<strong>ich</strong>t mit dem Wunsch nach Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Situation<br />
erhalten. Während es im konventionellen <strong>Theater</strong> stets ein Ungle<strong>ich</strong>gew<strong>ich</strong>t in <strong>der</strong><br />
Wertigkeit zu Gunsten des Bühnenraums und <strong>der</strong> Künstler gibt, die Emotionen,<br />
Handlung, Bil<strong>der</strong>, Moral, etc. vorgeben, stehen im TO die Welt des Darstellers, die<br />
s<strong>ich</strong> durch die Entstehungsgesch<strong>ich</strong>te als Bild <strong>der</strong> Realität in <strong>der</strong> Realität des Bildes<br />
präsentiert und die Realität des Beobachters einan<strong>der</strong> ebenbürtig gegenüber. Wird<br />
<strong>der</strong> Beobachter <strong>zum</strong> spectactor, befindet er s<strong>ich</strong> gle<strong>ich</strong>zeitig in zwei verschiedenen<br />
Wirkl<strong>ich</strong>keiten.<br />
„Dieses Phänomen, zugle<strong>ich</strong> dem Bild <strong>der</strong> Realität und <strong>der</strong> Realität<br />
des Bildes anzugehören, nennen wir „Metaxis“.“ 79<br />
In diesem Zusammenhang möchte <strong>ich</strong> einen analogen Schluss ziehen: Empathie<br />
verhält s<strong>ich</strong> zu Sympathie wie Toleranz zu Respekt; 80 Toleranz wie Empathie sind<br />
nur als Einbahnstraßen einger<strong>ich</strong>tet und trennen zwischen Tolerantem und<br />
Toleriertem, wobei ersterer s<strong>ich</strong> immer überlegen wähnt, sowie zwischen „Hineinfühlendem“<br />
und „Hineingefühltem“, wobei ersterer seine Person außer Acht lässt.<br />
Respekt und Sympathie beschreiben hingegen ein atmosphärisches Verhältnis im<br />
Umgang miteinan<strong>der</strong>. Dieses Konzept lässt es zu, dass <strong>der</strong> Protagonist die Einstiege<br />
<strong>der</strong> spectactors als Mögl<strong>ich</strong>keiten im Spektrum eigener Verhaltensweisen<br />
erkennen und eventuell für s<strong>ich</strong> verwerten kann. Gle<strong>ich</strong>zeitig erhält <strong>der</strong> spectactor<br />
die Gelegenheit, seine Ideen auszuprobieren.<br />
Die Antagonisten<br />
Die Aufgabe <strong>der</strong> Antagonisten und übrigen Schauspieler besteht darin, die<br />
ursprüngl<strong>ich</strong>e Szene mögl<strong>ich</strong>st unverän<strong>der</strong>t ablaufen zu lassen ohne einen<br />
Justamentstandpunkt einzunehmen, son<strong>der</strong>n indem sie durchaus auf die Verän<strong>der</strong>ungen<br />
durch den neuen Protagonisten eingehen und adäquat und angemessen<br />
reagieren. Auch sie können die Improvisation, wenn sie s<strong>ich</strong> bedroht<br />
79 vgl. Boal, Augusto: Der Regenbogen <strong>der</strong> Wünsche, a.a.O.,1999, S. 49<br />
80 Über den Unterschied zwischen Toleranz und Respekt vgl. Dietr<strong>ich</strong>, Wolfgang; Kulturelle Gewalt als Mittel<br />
und Indikator von Herrschaft im Weltsystem, in: Zapotoczky, Klaus/Gruber, Petra (Hg.): Demokratie versus<br />
Globalisierung? a.a.O., 1999, S. 166-184<br />
50
fühlen, unterbrechen.<br />
Reflexionen<br />
Der Joker kann im Anschluss Fragen an die spectactors o<strong>der</strong> die übrigen Schauspieler,<br />
sowie die restl<strong>ich</strong>en Anwesenden r<strong>ich</strong>ten, um Verhalten, Verän<strong>der</strong>ungen<br />
zur Sprache zu bringen und die Motivationen dahinter zu klären. Dabei sollten die<br />
Antworten aus den jeweiligen Rollen heraus gegeben werden und auch die ausgetauschte<br />
Rolle kann ihre Meinung zu den gezeigten Varianten anbringen. Solange<br />
bei allen Beteiligten genug Energie vorhanden ist, können unterschiedl<strong>ich</strong>e<br />
Varianten ausprobiert werden. Vor Abschluss <strong>der</strong> Forumphase empfiehlt es s<strong>ich</strong>,<br />
dass <strong>der</strong> ursprüngl<strong>ich</strong>e Protagonist die Version – und sei es wie<strong>der</strong> eine an<strong>der</strong>e –,<br />
die ihm am meisten zusagt, nochmals spielt.<br />
Was ist eine Lösung?<br />
Ich habe schon des öfteren Forumtheateraufführungen erlebt, bei denen s<strong>ich</strong><br />
anschließend Leute darüber beschwerten, dass ihrer Ans<strong>ich</strong>t nach keine Lösung<br />
des Problems gezeigt wurde. Die Lösungen – o<strong>der</strong> nur die Ansätze dafür –<br />
passieren oft im Einzelnen und zeigen ihre Wirkung in <strong>der</strong> Realität des Alltags<br />
vielle<strong>ich</strong>t erst später. Aber abgesehen davon, dass es <strong>der</strong> Intention des Forumtheaters<br />
wi<strong>der</strong>sprechen würde, an<strong>der</strong>en Lösungen zu zeigen, biete <strong>ich</strong> diesen<br />
Menschen die mögl<strong>ich</strong>e Erkenntnis, dass vielle<strong>ich</strong>t die Ent-täuschung 81 über das<br />
N<strong>ich</strong>t-Gelingen einer Variante, die s<strong>ich</strong> in <strong>der</strong> verbalen Diskussion noch so<br />
wun<strong>der</strong>bar angehört hat, ebenso wertvoll sein kann. Von Seiten <strong>der</strong> spectactors<br />
hörte <strong>ich</strong> noch nie eine <strong>der</strong>artige Beschwerde, zwar zeigten sie s<strong>ich</strong> manchmal<br />
ent-täuscht, aber durchaus zufrieden.<br />
Darf nur <strong>der</strong> Protagonist ausgetauscht werden?<br />
Es ist die ursprüngl<strong>ich</strong>ste und pointierteste Variante des Forumtheaters, nur den<br />
81 „Ent-täuschung: Eine Täuschung wurde aufgehoben. Besseres kann einem n<strong>ich</strong>t passieren.“ Janosch: Das<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> Lebenskunst; München, 1995, S. 27<br />
51
Protagonisten ersetzen zu lassen 82 , um den Verlauf einer Gesch<strong>ich</strong>te abzuän<strong>der</strong>n.<br />
Dies resultiert aus Boals Einstellung, für die <strong>Unterdrückten</strong> Partei zu ergreifen, ihre<br />
Position zu stärken, sie zu einer aktiven Verän<strong>der</strong>ung ihrer Situation zu bewegen<br />
und seiner Ans<strong>ich</strong>t, dass n<strong>ich</strong>t davon ausgegangen werden kann, dass s<strong>ich</strong> „wie<br />
durch Zauberei“ die Unterdrücker verän<strong>der</strong>n.<br />
„Die <strong>Unterdrückten</strong> müssen zu Wort kommen. Nur sie selbst<br />
können ihre Unterdrückung zeigen. Sie müssen ihre eigenen<br />
Wege zur Freiheit entdecken, (...)“ 83<br />
Wenn ein Unterdrückter <strong>zum</strong> Künstler wird und seine Erfahrungen im Forumtheater<br />
darstellt, begibt er s<strong>ich</strong> in die Realität <strong>der</strong> Bil<strong>der</strong>, die er aus den Bil<strong>der</strong>n <strong>der</strong><br />
Realität geschaffen hat. In dieser Konstellation kommt <strong>der</strong> ästhetisierten Szene die<br />
selbe Bedeutung zu, wie <strong>der</strong> erlebten und nun gezeigten Situation. Damit wird das<br />
Forumtheater für den Protagonisten und die spectactor zur Probe auf die Wirkl<strong>ich</strong>keit<br />
in <strong>der</strong> Wirkl<strong>ich</strong>keit. Auch alle an<strong>der</strong>en an <strong>der</strong> Szene Beteiligten erleben, wie es<br />
ein Workshopteilnehmer einmal in <strong>der</strong> Reflexionsrunde so treffend formulierte,<br />
„die Entdeckung <strong>der</strong> eigenen Gesch<strong>ich</strong>ten in den Gesch<strong>ich</strong>ten <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en“.<br />
Vernakuläres <strong>Theater</strong><br />
Aus dem bisher gesagten ergibt s<strong>ich</strong> für m<strong>ich</strong> <strong>der</strong> Schluss, dass das Forumtheater<br />
eine vernakuläre 84 Qualität beinhaltet, weil sie aus dem Kontext einer konkreten<br />
82 Das System Boals hat im Laufe <strong>der</strong> Zeit vielfache Verän<strong>der</strong>ungen, Erweiterungen und Adaptierungen<br />
erfahren, die zu weit komplexeren Methoden führten. An dieser Stelle sei nur auf Marc Weinblatt und sein<br />
„Theatre of the Oppressor“ (Metaxis, The Theatre of the Oppressed Review/CTO-RIO, Vol. 1, Nr. 1, Rio de<br />
Janeiro, 2001, S. 58) und auf das „Headlines Theatre“ von David Diamond hingewiesen. David Diamond ist<br />
Direktor von „Headlines Theatre“ in Vancouver, Kanada. www.headlinestheatre.com<br />
Beide beschäftigen s<strong>ich</strong> mit dem Dilemma, dass s<strong>ich</strong> je<strong>der</strong> zu Recht unterdrückt fühlen darf, aber darüber sein<br />
eigenes Unterdrücken vergisst. Dem Unterdrücker wird zugestanden, selbst unterdrückt zu sein. Für den<br />
<strong>Unterdrückten</strong> kann aber auch die Rolle des Unterdrückers in Betracht kommen.<br />
83 Boal, Augusto: <strong>Theater</strong> <strong>der</strong> <strong>Unterdrückten</strong>, a.a.O., 1989, S. 68<br />
84 Zur Verwendung und Herleitung des Begriffs siehe: Ill<strong>ich</strong>, Ivan: Genus – Zu einer historischen Kritik <strong>der</strong><br />
Gle<strong>ich</strong>heit; Reinbek, 1983, S. 178; „Vernakulär / gemein: Vernakulär hat eine indogermanische Wurzel, die<br />
»Verwurzelung« und »Wohnsitz« bedeutet. (Es) beze<strong>ich</strong>net all das, was im Haus geboren, gesponnen,<br />
aufgezüchtet o<strong>der</strong> gemacht wurde, im Gegensatz zu dem, was nur durch Kauf erworben werden konnte.“<br />
Beson<strong>der</strong>s gefällt mir in diesem Zusammenhang die ebendort verwendete Formulierung: „auf dem eigenen Mist<br />
gewachsen“.<br />
52
Gemeinschaft entstanden ist und<br />
„auch nur innerhalb dieser Gemeinschaft ein zur<br />
intersubjektiven Kommunizierbarkeit notwendiges Codesystem<br />
vorfindet.“ 85<br />
Unter „vernakulär“ ist alles zu verstehen, was n<strong>ich</strong>t gekauft o<strong>der</strong> konsumiert wird,<br />
son<strong>der</strong>n „im Haus“ geboren, gesponnen, aufgezüchtet o<strong>der</strong> gemacht wird. Ich<br />
messe dieser Mögl<strong>ich</strong>keit, die das Forumtheater hier bietet, insofern eine sehr<br />
große Bedeutung zu, als es für die spectactors Raum schafft Eigenes hervorzubringen,<br />
n<strong>ich</strong>t zu konsumieren, an<strong>der</strong>em Eigenem mit Respekt und Sympathie zu<br />
begegnen.<br />
Ästhetik<br />
Der Inhalt und die Problematik <strong>der</strong> Szene muss visuell erkenntl<strong>ich</strong> werden, egal ob<br />
sie spontan improvisiert o<strong>der</strong> in einer vorangegangenen Erarbeitungsphase entstanden<br />
ist. Unwesentl<strong>ich</strong> ist es dabei, ob die Szene realistisch, symbolisch o<strong>der</strong><br />
expressionistisch gespielt wird, allerdings ergibt s<strong>ich</strong> für die Forumphase nur dann<br />
ein Sinn, wenn sie konkret und wahrhaftig bleibt und n<strong>ich</strong>t ins Absurde o<strong>der</strong><br />
Abstrakte abgleitet. Unabhängig vom gesprochenen Text müssen die Figuren<br />
charakterisiert und identifizierbar sein, weshalb das Rollentraining von großer<br />
Bedeutung ist. Auf das Wesen <strong>der</strong> Ästhetik sollte auch in <strong>der</strong> Forumphase Wert<br />
gelegt werden.<br />
Bei einer Forumtheateraufführung im Zuge des Besuchs von Augusto Boal in Innsbruck<br />
wurde ihm von 3 Leuten eine Simultanübersetzung <strong>der</strong> Szene und <strong>der</strong><br />
folgenden Einstiege angeboten, die er jedes Mal vehement ablehnte. Durch diese<br />
Ablehnung fühlten s<strong>ich</strong> die SchauspielerInnen beson<strong>der</strong>s angespornt ihrer Gestik<br />
und Mimik verstärkten Ausdruck zu verleihen, was ihnen, bestätigt durch Boals<br />
anschließendes Lob, auch gelang und auch bei den Einstiegen hob er jene hervor,<br />
85 Dietr<strong>ich</strong>, Wolfgang: Kulturelle Gewalt als Mittel und Indikator von Herrschaft im Weltsystem, in:<br />
Zapotoczky, Klaus/ Petra Gruber (Hg.): Demokratie versus Globalisierung? a.a.O., 1999, S. 166-184<br />
Wolfgang Dietr<strong>ich</strong> wendet in seinen Ausführungen den Begriff des Vernakulären auf die Musik an. Ich<br />
übernehme ihn analog fürs <strong>Theater</strong>, im Speziellen für das Forumtheater.<br />
53
die s<strong>ich</strong> des Körpers bedienten, um ihre Anliegen und Abs<strong>ich</strong>ten zu verdeutl<strong>ich</strong>ten.<br />
Forumtheater ist in erster Linie am ästhetischen Lernen interessiert.<br />
Abschluss und Feier<br />
Am Ende <strong>der</strong> Forumphase müssen alle aus ihren Rollen entlassen werden, was<br />
durch Applaus, Ablegen <strong>der</strong> Requisiten und eine abschließende gemeinsame<br />
Übung erfolgt. Ein geselliger Ausklang rundet jedes gelungene Forumtheater ab.<br />
Sollte dieser Rahmen n<strong>ich</strong>t ausre<strong>ich</strong>en, um über das Geschehene zu reflektieren,<br />
sollte ein Nachbesprechungstermin anberaumt werden, bei dem allfällige Fragen<br />
und Anmerkungen deponiert werden können.<br />
54
6.6 Das Uns<strong>ich</strong>tbare <strong>Theater</strong> 86<br />
Das Uns<strong>ich</strong>tbare <strong>Theater</strong> mag vielle<strong>ich</strong>t eine <strong>der</strong> spektakulärsten, bekanntesten<br />
Techniken Augusto Boals sein, mit S<strong>ich</strong>erheit ist sie aber auch eine <strong>der</strong> problematischsten.<br />
Häufig mit Straßentheater in Verbindung gebracht, bindet diese<br />
Methode Menschen in Szenen mit ein, ohne dass diese wissen, dass sie in einem<br />
<strong>Theater</strong> mitwirken. Dieses Geheimnis darf auch niemals gelüftet werden, außer es<br />
kommt zu einem Konflikt mit <strong>der</strong> Exekutive. Im allerbesten Fall bereitet eine<br />
Gruppe eine Szene bis zu einem bestimmten Punkt vor, die s<strong>ich</strong> mit s<strong>ich</strong>tbarer<br />
Unterdrückung im öffentl<strong>ich</strong>en Raum beschäftigt.<br />
Die Ausgangssituation wird schriftl<strong>ich</strong> fixiert und mögl<strong>ich</strong>e Reaktionen von PassantInnen<br />
werden durchgespielt. Bei <strong>der</strong> Aufführung teilt s<strong>ich</strong> die Gruppe und<br />
während <strong>der</strong> „innere Kreis“ (Zentrum) die Szene in Gang bringt, wodurch die<br />
Menschen unterschiedl<strong>ich</strong> zu reagieren beginnen, übernehmen die „äußeren<br />
Kreise“ eine Beschützer(Helfer)- und Beobachterfunktion, um die Spieler vor<br />
eventuellen Übergriffen zu bewahren und ihnen einen s<strong>ich</strong>eren „Abgang“ zu<br />
ermögl<strong>ich</strong>en. Der äußerste Kreis gibt im Anschluss an die Szene wertvolles Feedback<br />
über die Reaktionen und Interventionen <strong>der</strong> spectactors. Zusätzl<strong>ich</strong> können<br />
sie auch Personen in ein Gespräch <strong>zum</strong> gezeigten Thema verwickeln.<br />
Helferkreis: bringt Diskussionen<br />
in Gang,<br />
animiert, beschützt die<br />
SpielerInnen vor Übergriffen<br />
Zentrum: Protagonist(en) und<br />
Antagonist(en) inszenieren<br />
den Konflikt; Anwesende<br />
beginnen zu partizipieren<br />
Beobachterkreis: bleibt außerhalb<br />
des Geschehens und gibt<br />
detailliertes Feedback<br />
86 Boal, Augusto: <strong>Theater</strong> <strong>der</strong> <strong>Unterdrückten</strong>. a.a.O., 1989, S. 34ff u. 74ff<br />
55
Das Modell <strong>der</strong> 3 konzentrischen Kreise im Uns<strong>ich</strong>tbaren <strong>Theater</strong> stammt n<strong>ich</strong>t von<br />
Boal selbst, son<strong>der</strong>n von einem seiner Schüler: Henry Thorau 87 aus Berlin.<br />
Boal erzählt von wun<strong>der</strong>bar gelungenem Uns<strong>ich</strong>tbaren <strong>Theater</strong> über Sexismus in<br />
<strong>der</strong> Pariser Metró, über das Verhältnis von Lebensmittelpreisen zu Löhnen in<br />
Argentinien, über Rassismus in Schweden.<br />
Persönl<strong>ich</strong> bin <strong>ich</strong> ein gebranntes Kind, da in meinen bisherigen Erfahrungen mit<br />
dieser Methode, sie vom Leiter dazu benutzt wurde durch billigen Aktionismus im<br />
öffentl<strong>ich</strong>en Raum, Egos aufzupolieren und Leute aufs Korn zu nehmen, indem<br />
man sie verfolgen o<strong>der</strong> ihnen irgendwelche Lügen auftischen sollte. Auch<br />
KollegInnen ber<strong>ich</strong>teten mir von Workshops, die mit Uns<strong>ich</strong>tbarem <strong>Theater</strong><br />
arbeiten wollten, wo es aber in Vorbereitung und Durchführung an Sorgfalt <strong>der</strong><br />
Leitung mangelte.<br />
Über ihre Erfahrungen, Ans<strong>ich</strong>ten und Einstellungen <strong>zum</strong> Thema „Uns<strong>ich</strong>tbares<br />
<strong>Theater</strong>“ sprach <strong>ich</strong> mit Lisa Kolb 88 und Irmgard Bibermann 89 am 2. Juni 2002 in<br />
Innsbruck.<br />
A.S.: Lisa, worin liegt für d<strong>ich</strong> die Faszination am Uns<strong>ich</strong>tbaren <strong>Theater</strong> (i.d.F. UT)<br />
und was macht es gle<strong>ich</strong>zeitig auch so schwierig?<br />
L.K.: Das UT ist für m<strong>ich</strong> die spannendste, aufregendste <strong>Theater</strong>form überhaupt,<br />
n<strong>ich</strong>t nur auf das Boalsche <strong>Theater</strong> bezogen. Sie hat am meisten Thrill. Der Grund<br />
dafür liegt an <strong>der</strong> dünnen Grenze zwischen bewusst inszenierter Wirkl<strong>ich</strong>keit und<br />
alltägl<strong>ich</strong>er, aktueller Wirkl<strong>ich</strong>keit, die gerade passiert, an <strong>der</strong> s<strong>ich</strong> das UT bewegt.<br />
Es liegt auch an <strong>der</strong> Freiheit, Wirkl<strong>ich</strong>keit zu inszenieren und an<strong>der</strong>e in sie mit<br />
einzubeziehen, an <strong>der</strong> Angst dabei n<strong>ich</strong>t entdeckt zu werden und an <strong>der</strong> Erfahrung<br />
87 vgl. Thorau, Henry: Lokaltermin: „Uns<strong>ich</strong>tbares <strong>Theater</strong>“. Anmerkungen zu einer umstrittenen Methode<br />
Augusto Boals in: Ruping, Bernd: Gebraucht das <strong>Theater</strong>. a.a.O., 1991, S. 270-274<br />
88 Kolb, Lisa: DSA, freiberufl<strong>ich</strong>e <strong>Theater</strong>pädagogin, Trainerin, Körpertherapeutin, Leiterin eines Lehrgangs für<br />
Interkulturelles Lernen, beschäftigt s<strong>ich</strong> seit 20 Jahren mit den Formen des „<strong>Theater</strong>s <strong>der</strong> <strong>Unterdrückten</strong>“ nach<br />
Augusto Boal, Obfrau von „Forumtheater Österre<strong>ich</strong>“, Leitung des <strong>Theater</strong>pädagogiklehrgangs <strong>der</strong> AGB -<br />
Ausbildungsinstitut <strong>der</strong> Arbeitsgemeinschaft für Gruppenberatung in <strong>Wie</strong>n<br />
89 Bibermann, Irmgard: AHS-Lehrerin für Latein, Gesch<strong>ich</strong>te, Italienisch, Darstellendes Spiel; Ausbildung in<br />
Gestalt-, Spiel-, <strong>Theater</strong>pädagogik; Leiterin <strong>der</strong> Arge Darstellendes Spiel am Pädagogischen Institut des Landes<br />
Tirol, Leiterin von spectACT – Arge für politisches und soziales <strong>Theater</strong>, Lehrauftrag für Fachdidaktik am<br />
Institut für Gesch<strong>ich</strong>te / Universität Innsbruck<br />
56
auch im öffentl<strong>ich</strong>en Raum jemand an<strong>der</strong>er sein zu können. UT ist auch nie ganz<br />
planbar.<br />
I.B.: Es ist allerdings ein Problem, zu fürchten in einer Anti-Rolle entdeckt zu<br />
werden, <strong>zum</strong> Beispiel in einer Rolle, die über „Sozialschmarotzer“ schimpft.<br />
A.S.: Du hast diese Rolle gespielt?<br />
I.B.: Ja, im Bus. Eine In<strong>der</strong>in, die auch im Bus saß, fürchtete s<strong>ich</strong> vor mir. Ich hab<br />
meine Rolle trotzdem durchgespielt, <strong>der</strong> gesamte Bus stellte s<strong>ich</strong> gegen m<strong>ich</strong> und<br />
<strong>der</strong> Thrill war massiv spürbar.<br />
A.S.: Welche Probleme gab es für D<strong>ich</strong> in dieser Szene?<br />
I.B.: Im UT braucht es die maximale Solidarität <strong>der</strong> Gruppe. 2 Spieler haben es<br />
n<strong>ich</strong>t geschafft ihre Rollen zu spielen. Es war schwierig für m<strong>ich</strong>, allein zu sein.<br />
Aber in diesem Moment fühlte <strong>ich</strong> auch: UT ist echtes Wi<strong>der</strong>standstheater.<br />
A.S.: Was heißt Wi<strong>der</strong>stand? Wo beginnt er?<br />
I.B.: Es bedeutet Wi<strong>der</strong>stand, wenn gegenüber dem „Sozialschmarotzertum“<br />
Bewusstsein geschaffen wird. Es beginnt schon in <strong>der</strong> Vorbereitung, in <strong>der</strong><br />
Vereinbarung darüber, dieses Thema in <strong>der</strong> Öffentl<strong>ich</strong>keit zu spielen.<br />
L.K.: Man spürt auch den Wi<strong>der</strong>stand, wenn man über die eigenen Grenzen geht.<br />
Das braucht es im UT, und das geht nur, wenn die Gruppe strukturiert zusammen<br />
hält und untereinan<strong>der</strong> verbunden ist.<br />
A.S.: Das scheint mir eine wesentl<strong>ich</strong>e Bedingung für gelungenes UT. Was braucht<br />
es in <strong>der</strong> Vorbereitung eines UT? Wodurch entsteht gelungenes UT?<br />
L.K.: Im Vorfeld braucht es unbedingt ein Gruppenanliegen und es geht dabei um<br />
ein politisches Anliegen. Darin besteht <strong>der</strong> große Unterschied zur Provokation.<br />
Und die Szene muss innerhalb <strong>der</strong> Gruppe funktionieren, das heißt sie darf n<strong>ich</strong>t<br />
von mögl<strong>ich</strong>en Reaktionen von außerhalb abhängig sein und sie darf niemanden<br />
missbrauchen.<br />
I.B.: Die Beteiligten müssen wissen, wo ihre Grenzen sind, was sie s<strong>ich</strong> zutrauen<br />
können, in welchem Kreis sie agieren können. In den Proben muss dabei in die<br />
Vorstellung <strong>der</strong> Szenen hinein gegangen werden. Je näher <strong>ich</strong> am Zentrum einer<br />
UT-Szene bin, eine umso höhere Dosis Mut benötige <strong>ich</strong>. In <strong>der</strong> Szene darf <strong>ich</strong><br />
niemals privat werden, nie meine Rolle verlieren. Das UT soll aber keine Mutprobe<br />
sein, die s<strong>ich</strong> durch das <strong>Theater</strong> legitimiert fühlt. Es kann n<strong>ich</strong>t darum gehen, in<br />
57
einem Modegeschäft die Verkäuferin durch ausgefallenen Wünsche zur Verzweiflung<br />
zu bringen.<br />
A.S.: Wenn <strong>ich</strong> mir aber <strong>zum</strong> Beispiel die Arbeit von Norbert Knitsch mit PatientInnen<br />
einer Kin<strong>der</strong>- und Jugendpsychiatrie ansehe 90 , die durch das Verteilen von<br />
Blumen an Fremde o<strong>der</strong> eine selbstgestaltete Umfrage Selbstvertauen im Umgang<br />
mit Menschen tanken, dann sind das für m<strong>ich</strong> schöne Beispiele einer „Mutprobe“.<br />
In späterer Folge proben die Jugendl<strong>ich</strong>en auch in kleinen Szenen das Aushalten<br />
einer Konfliktsituation (z.B. Geldmangel im Eiscafé) und ein mögl<strong>ich</strong>es Repertoire<br />
an Strategien im Umgang damit. Hier wird allerdings unter an<strong>der</strong>en Bedingungen<br />
und mit an<strong>der</strong>en Zielen gearbeitet.<br />
I.B.: Dann finde <strong>ich</strong> das durchaus legitim.<br />
L.K.: Darin steckt die Mögl<strong>ich</strong>keit für die Jugendl<strong>ich</strong>en, zu sehen: Ich mache etwas<br />
und bekomme eine Reaktion. Ich habe etwas Ähnl<strong>ich</strong>es selbst einmal geleitet.<br />
A.S.: Zurück zu den Bedingungen für gelungenes UT!<br />
L.K.: Der Ort an dem gespielt werden soll, muss vorher sehr sorgfältig recherchiert<br />
werden. Welche Kellner haben wann Dienst? <strong>Wie</strong> lange dauert die Fahrt von einer<br />
Haltestelle zur nächsten? UT ist auch nur dann gelungen, wenn es uns<strong>ich</strong>tbar<br />
bleibt. Bei einer Enthüllung würde s<strong>ich</strong> die Reaktion <strong>der</strong> Leute ins Gegenteil verkehren,<br />
Zivilcourage würde dadurch verhin<strong>der</strong>t. Im Kunstbere<strong>ich</strong> hab <strong>ich</strong> bisher<br />
noch kein seriöses UT erlebt, immer nur Provokation, bei <strong>der</strong> die Zuschauer immer<br />
die Blöden waren. Egal welche Reaktion sie zeigten, sie waren immer die Blöden.<br />
<strong>Wie</strong> im kommerziellen <strong>Theater</strong>.<br />
I.B.: Das kommerzielle <strong>Theater</strong> gibt immer vor zu wissen, was läuft. Es kennt die<br />
Probleme, hat die passenden Lösungen und spielt mit erhobenem Zeigefinger.<br />
L.K.: Das UT ist ein Modell das alle Menschen ernst nimmt. Es möchte im öffentl<strong>ich</strong>en<br />
Raum Diskussionen anregen, ermutigen zu diskutieren und zu handeln.<br />
A.S.: Ist es erlaubt „Modell zu handeln“?<br />
L.K.: Es ist beides mögl<strong>ich</strong>. Henry Thorau, <strong>der</strong> UT <strong>zum</strong> Thema Gewalt in <strong>der</strong><br />
Berliner U-Bahn inszenierte, ließ einen seiner Schauspieler Modell handeln,<br />
wodurch s<strong>ich</strong> die Diskussion in Gang setzte. Wir spielten in <strong>Wie</strong>n eine Szene, bei<br />
90 Knitsch, Norbert: <strong>Theater</strong> <strong>der</strong> Stille, <strong>Theater</strong>pädagogik in <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>- und Jugendpsychiatrie, Leer, 2002, S.<br />
131ff<br />
58
<strong>der</strong> 2 Männer eine Frau verbal sexuell belästigten. Ein Mann <strong>der</strong> zufällig im<br />
Straßencafé saß, stand auf und fragte die Frau, ob sie s<strong>ich</strong> n<strong>ich</strong>t zu ihnen setzen<br />
wollte. Das war auch modellhaftes Handeln, allerdings n<strong>ich</strong>t geprobt.<br />
I.B.: In unserer Szene im Bus fand Solidarisierung mit <strong>der</strong> Spielerin statt, die s<strong>ich</strong><br />
mit Argumenten gegen die abfälligen Reden über die „Sozialschmarotzer“ wehrte.<br />
Sie wagte den ersten Schritt und stand dadurch Modell für die an<strong>der</strong>en Fahrgäste.<br />
Manchmal frage <strong>ich</strong> m<strong>ich</strong> allerdings, ob wir diese <strong>Theater</strong>form in Österre<strong>ich</strong> in<br />
einer Demokratie überhaupt brauchen?<br />
A.S.: Ich denke sehr wohl, aber <strong>ich</strong> wünsche mir mehr Sorgfalt in <strong>der</strong> Auswahl <strong>der</strong><br />
inszenierten Themen und in <strong>der</strong> Vor- und Nachbereitung <strong>der</strong> Szenen. Wenn <strong>ich</strong><br />
bedenke, was alles unter dem Titel „Uns<strong>ich</strong>tbares <strong>Theater</strong>“ verkauft wird!<br />
L.K.: Da gebe <strong>ich</strong> Dir recht, das UT ist auch einige von wenigen Methode, wo <strong>ich</strong><br />
für eine strikte Einhaltung <strong>der</strong> Regeln bin. Generell geht es für m<strong>ich</strong> aber darum,<br />
Mögl<strong>ich</strong>keiten n<strong>ich</strong>t zu reduzieren, son<strong>der</strong>n zu vermehren.<br />
A.S.: Worin liegen für Euch die Stärken des UT, was sind seine Ziele?<br />
L.K.: Meiner Ans<strong>ich</strong>t nach liegt die Kommunikation im öffentl<strong>ich</strong>en Raum im<br />
Argen. UT ermögl<strong>ich</strong>t die Erfahrung, im öffentl<strong>ich</strong> Raum mit Fremden reden. UT<br />
bietet dafür einen guten Grund. Das Gespräch, die Auseinan<strong>der</strong>setzung mit einem<br />
Konfliktthema, kann ein großer Gewinn sein.<br />
I.B.: Das UT ermögl<strong>ich</strong>t das Gefühl, ein positives Ende erleben zu dürfen. Es<br />
bedeutet Empowerment. Das hat viel mit Selbstwertstärkung zu tun. Manchmal<br />
fühle <strong>ich</strong> m<strong>ich</strong> wie in einem UT und weiß, meine Einmischung ist jetzt gefragt.<br />
Allein durch das Kennen <strong>der</strong> Methode habe <strong>ich</strong> gewusst, dass <strong>ich</strong> etwas tun muss.<br />
A.S.: Ich danke Euch für das Gespräch und wünsche noch viele positive Erlebnisse<br />
mit Uns<strong>ich</strong>tbarem <strong>Theater</strong>.<br />
Zusammenfassend scheint es mir nochmals w<strong>ich</strong>tig, zu betonen, dass UT nur dann<br />
Sinn macht, wenn eine Gruppe das gemeinsame Anliegen hat, s<strong>ich</strong> mit Unterdrückung<br />
im öffentl<strong>ich</strong>en Raum auseinan<strong>der</strong> zu setzen. Und Fälle in denen<br />
Menschen öffentl<strong>ich</strong> erniedrigt werden, gäbe es bei uns meiner Meinung nach<br />
genug.<br />
59
6.7 Die introspektiven Methoden<br />
Die konsequente Weiterentwicklung seiner Methoden und die Erfahrungen in<br />
Europa (vgl. Kap. 5) ließen Boal nach Mögl<strong>ich</strong>keiten innerhalb seines bisherigen<br />
Konzeptes eines <strong>Theater</strong>s <strong>der</strong> <strong>Unterdrückten</strong> suchen, mit Hilfe <strong>der</strong>er es herauszufinden<br />
galt, wie die Unterdrücker, er wählte für sie das ihm bekannte Bild des<br />
Polizisten, in das Denken gelangten und welche Wege es gäbe, sie von dort<br />
wie<strong>der</strong> zu vertreiben. 91 Er begab s<strong>ich</strong> damit auf ein Gebiet, bei dem s<strong>ich</strong> die Unterdrückung<br />
primär im Inneren des Menschen ereignet, die von mir eingangs<br />
beschriebenen internalisierten Formen. Diese können soweit gehen, bis die ursprüngl<strong>ich</strong><br />
strukturelle und/o<strong>der</strong> kulturelle Gewalt als Autoaggression 92 wie<strong>der</strong> zu<br />
Tage tritt.<br />
So wie alle an<strong>der</strong>en Unterdrückungen stehen auch diese im Weg, wenn es darum<br />
geht, s<strong>ich</strong> seine Wünsche zu erfüllen. Die zwei zentralen Techniken <strong>der</strong> introspektiven<br />
Methoden nähern s<strong>ich</strong> dem Konflikt von unterschiedl<strong>ich</strong>en Seiten. Die<br />
Methode „Polizist im Kopf“ 93 spürt internalisierte Instanzen auf, die einen Menschen<br />
daran hin<strong>der</strong>n, zu handeln wie er es möchte. Dabei wird auf konkrete Bil<strong>der</strong><br />
von Personen (Eltern, Lehrer, Vorgesetzte,...) des Protagonisten zurückgegriffen,<br />
die verkörpert durch spectactors greif- und s<strong>ich</strong>tbar werden. Im Zuge verschiedener<br />
Improvisationen werden Einblicke in die Blockaden und Hemmnisse des<br />
Protagonisten mögl<strong>ich</strong> und bis zu einem Gewissen Grad lässt s<strong>ich</strong> auf dieser<br />
Ebene bereits Wi<strong>der</strong>stand gegen die „Polizisten“ leisten.<br />
Im „Regenbogen <strong>der</strong> Wünsche“ zeigt s<strong>ich</strong> wie ambigue unsere Wünsche oft sind,<br />
und wie sie s<strong>ich</strong> manchmal gegenseitig blockieren und dadurch verhin<strong>der</strong>n, dass<br />
„etwas weitergeht“. Unangenehme Gefühle und unbefriedigende Situationen<br />
91 Boal, Augusto: Der Regenbogen <strong>der</strong> Wünsche, a.a.O., 1999, S. 21<br />
92 Gegen die eigene Person ger<strong>ich</strong>tete Aggression, welche auftritt, da ein Ausleben <strong>der</strong> Aggression gegen die<br />
eigentl<strong>ich</strong> verantwortl<strong>ich</strong>e Person aufgrund von verinnerl<strong>ich</strong>ten Tabus (z. B. den Eltern gegenüber) n<strong>ich</strong>t<br />
mögl<strong>ich</strong> ist, o<strong>der</strong> da die für den Konflikt verantwortl<strong>ich</strong>en Umstände vom Individuum n<strong>ich</strong>t erkannt werden.<br />
Dazuzuzählen sind abs<strong>ich</strong>tl<strong>ich</strong> hervorgerufene Körperverletzungen (Selbstverletzung - Schnitte, St<strong>ich</strong>e,<br />
Einritzungen), aber auch jegl<strong>ich</strong>e Formen des schweren Suchtmittelmissbrauchs. www.kontaktco.at/infothek/<br />
93 Boal, Augusto: Der Regenbogen <strong>der</strong> Wünsche, a.a.O., 1999, S. 116ff<br />
60
lassen s<strong>ich</strong> auf diese Weise klären. Handlungen, <strong>der</strong>en Ursachen einem selbst im<br />
Verborgenen blieben, werden im Spektrum des Regenbogens beleuchtet.<br />
Boal nennt diese Techniken therapeutisch, aber er sieht sie n<strong>ich</strong>t als Therapie, das<br />
heißt sie sind prinzipiell n<strong>ich</strong>t als Behandlungsmethoden gedacht, können aber<br />
eine heilende Wirkung entwickeln und deshalb als Teil einer Behandlung eingesetzt<br />
werden, so wie es auch geschieht. Am Ende dieser Methoden steht also<br />
wie<strong>der</strong>um das <strong>Theater</strong> im Vor<strong>der</strong>grund, mit dessen Hilfe innere Konflikte angegangen<br />
werden können. 94<br />
Inzwischen fanden diese Techniken auch den Weg, diesmal eben von Europa<br />
ausgehend, in die ganze Welt. Was mir aber noch beachtenswerter scheint: Sie<br />
fanden den Weg in das konventionelle <strong>Theater</strong>, um mit ihrer Hilfe Rollencharaktere<br />
herauszuarbeiten und zu verfeinern. Als bekanntestes Beispiel dafür gilt die<br />
Zusammenarbeit zwischen Augusto Boal und <strong>der</strong> Royal Shakespeare Company im<br />
Jahr 1998.<br />
6.7.1 Katharsis<br />
In <strong>der</strong> Literaturwissenschaft bedeutet Katharsis „Reinigung“ und meint die innere<br />
Läuterung als Wirkung des Trauerspiels. In <strong>der</strong> Psychologie versteht man darunter<br />
das S<strong>ich</strong>befreien. 95<br />
Die Idee hinter dem Konzept <strong>der</strong> Katharsis wie sie Aristoteles verstand, geht von<br />
<strong>der</strong> Annahme aus, dass ohne Läuterung das Aufbegehren <strong>der</strong> Menschen gegen<br />
Gesetze – seien es göttl<strong>ich</strong>e o<strong>der</strong> menschl<strong>ich</strong>e – so groß würde, dass ein Zusammenleben<br />
<strong>der</strong> Menschen unmögl<strong>ich</strong> wäre. An Hand von Beispielen, die die<br />
negativen Folgen des Wi<strong>der</strong>setzens gegen eine Ordnung zeigen, soll <strong>der</strong> Zuschauer<br />
durch Mitleiden am Schicksal des tragischen Helden von den eigenen<br />
Wünschen, Wi<strong>der</strong>stand zu leisten, gereinigt werden. Bis zu einem gewissen Grad<br />
erle<strong>ich</strong>tert dies ohne Zweifel ein Leben in Gemeinschaft.<br />
94 zwischen den Therapiemethoden des Psychodramas und dem <strong>Theater</strong> <strong>der</strong> <strong>Unterdrückten</strong> gibt es wiewohl<br />
Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede. Die theoretische Aufarbeitung dessen bietet: Feldhendler, Daniel:<br />
Psychodrama und <strong>Theater</strong> <strong>der</strong> <strong>Unterdrückten</strong>, Frankfurt a. M., 1992<br />
Praktische Einblicke gewährt: Knitsch, Norbert: <strong>Theater</strong> <strong>der</strong> Stille. a.a.O., 2002<br />
95 Duden: Die deutsche Rechtschreibung, Mannheim, Zür<strong>ich</strong>, <strong>Wie</strong>n, 1996<br />
61
Boal lehnt diese kathartische Wirkung des <strong>Theater</strong>s nach Aristoteles jedoch ab. 96<br />
Das Lernen auf Grund <strong>der</strong> Beobachtung <strong>der</strong> tragischen Figur führt seiner Ans<strong>ich</strong>t<br />
nach zu einer Entmachtung und Beruhigung des Zuschauers, die seinen Wunsch<br />
nach Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> eigenen Situation unterdrückt. Er geht auch über das S<strong>ich</strong>befreien<br />
von negativen, erstarrten Gefühlen, wie es Moreno im Psychodrama<br />
erre<strong>ich</strong>en will hinaus. Die Katharsis im TO provoziert Handlungen und Dynamisierung,<br />
die zur Befreiung von Blockaden (inneren und äußeren) führen, Blockaden,<br />
die Gefühle unterdrücken und Taten verhin<strong>der</strong>n, um glückl<strong>ich</strong> zu werden. Ihr<br />
Ziel ist es n<strong>ich</strong>t, Konflikte zu vermeiden, es steht vielmehr ihre kreative Bearbeitung<br />
an.<br />
Ich plädiere zusätzl<strong>ich</strong> noch dafür, den Lerneffekt in Bezug auf das Eigene durch<br />
ein rein visuelles Erlebnis im Gegensatz zu einem durch eine Handlung und<br />
Erfahrung erlebten, als äußerst gering zu (betr)achten und allgemein das Lernen<br />
aus Fehlern – beson<strong>der</strong>s, wenn sie von an<strong>der</strong>en begangen werden – in Frage zu<br />
stellen. Wir lernen n<strong>ich</strong>t nur, wenn wir etwas falsch gemacht haben, son<strong>der</strong>n vor<br />
allem, wenn wir es einmal r<strong>ich</strong>tig gemacht haben. 97 Aber auch hier liegt die<br />
Betonung auf „machen“.<br />
96 Boal, Augusto: Der Regenbogen <strong>der</strong> Wünsche, a.a.O., 1999, S. 70ff<br />
97 Knitsch, Norbert: <strong>Theater</strong> <strong>der</strong> Stille. a.a.O., 2002, S. 18<br />
62
6.8 Legislatives <strong>Theater</strong> 98<br />
“Many artists before me had been elected to legislative office (…), or to executive<br />
office. (…) For all that , I was clear that my case was different: I would not have to<br />
give up my previous theatrical activity to start a new life as a parlamentarian. The<br />
one would be the extension of the other: anyone who voted for me would know<br />
what they were doing – theatre and politics!” 99<br />
Im Jahre 1986 wird Augusto Boal eingeladen in Rio de Janeiro, in sogenannten<br />
CIEPS (Centros Integrados de Educação Popular; Volkskulturzentren), seine Ideen<br />
zu verwirkl<strong>ich</strong>en und so kehrt er nach Jahren des Exils wie<strong>der</strong> in seine Heimat<br />
zurück und kann es kaum erwarten, auszuprobieren, ob seine Methoden auch<br />
dort funktionieren würden. Sie funktionieren prächtig: 35 Kulturanimateure aus<br />
verschiedenen CIEPs arbeiteten zwei Monate mit Augusto Boal, entwickeln 5<br />
Forumtheaterstücke und spielen diese dreißig Mal mit bis zu 50 spectactors.<br />
Mangelnde kontinuierl<strong>ich</strong> Unterstützung bewegen Boal, wie<strong>der</strong> nach Europa zu<br />
gehen. Auf die Bitte einiger weniger ehemaliger WorkshopteilnehmerInnen, kehrt<br />
er 1989 erneut nach Rio de Janeiro zurück und gründet mit ihnen gemeinsam das<br />
CTO RIO (Centro do Teatro do Oprimido), das s<strong>ich</strong> finanziell mehr schlecht als<br />
recht über Wasser hält. Erst als die Gruppe beschließt, das CTO spektakulär<br />
während eines regionalen Wahl<strong>kam</strong>pfes zu Grabe zu tragen, öffnen s<strong>ich</strong> ungeahnte<br />
Mögl<strong>ich</strong>keiten. Die Partido dos Trabalhadores (PT, Arbeiterpartei), <strong>der</strong><br />
August Boal als Mitglied angehört, akzeptiert die „Theatralisierung“ ihrer Kampagne<br />
und schlägt sogar vor, ein Mitglied <strong>der</strong> Truppe als Vereador (Stadtrat) zu<br />
nennen. Von insgesamt 1400 Kandidaten erhält Augusto Boal einen <strong>der</strong> sechs<br />
Sitze (42 gibt es insgesamt) <strong>der</strong> PT im Stadtparlament von Rio de Janeiro und kann<br />
das gesamte CTO als Mitarbeiterstab anstellen. Damit ist n<strong>ich</strong>t nur <strong>der</strong> Fortbestand<br />
des CTO ges<strong>ich</strong>ert, son<strong>der</strong>n es zieht erstmals eine <strong>Theater</strong>gruppe<br />
98 vgl. dazu v.a. Panfy, Daniela: „Com Coragem de ser feliz“. a.a.O., 1998 (Dipl) und Boal, Augusto: legislative<br />
theatre. a.a.O., 1998<br />
99 Boal, Augusto: legislative theatre. a.a.O., 1998, S. 15. Wenn Augusto Boal von diesen Künstlern, von denen<br />
er s<strong>ich</strong> unterscheidet, erzählt, so nennt er unter an<strong>der</strong>en auch immer Ronald Reagan, den er als schlechten<br />
Schauspieler und noch schlechteren Politiker beze<strong>ich</strong>net und den Autor und Präsidenten Vaclav Havel. Der eine<br />
beendete seine künstlerische Laufbahn, ohne großes Bedauern auszulösen, <strong>der</strong> an<strong>der</strong>e hätte als Künstler<br />
vielle<strong>ich</strong>t mehr Talent gehabt.<br />
63
geschlossen in ein Rathaus ein und für das <strong>Theater</strong> <strong>der</strong> <strong>Unterdrückten</strong> beginnt<br />
eine neue Ära. Maßgebl<strong>ich</strong> unterstützt wird die Arbeit dabei von <strong>der</strong> CDDH<br />
(Comissão de Defesa dos Direitos Humanos; Kommission <strong>zum</strong> Schutz <strong>der</strong><br />
Menschenrechte), <strong>der</strong>en Präsident Boal später wird.<br />
Gesetze sind <strong>der</strong> formale Ausdruck von Wünschen. Es stellt s<strong>ich</strong> nur die Frage, um<br />
wessen Wünsche es s<strong>ich</strong> dabei handelt. Beim Legislativen <strong>Theater</strong> spielen homogene,<br />
bereits organisierte o<strong>der</strong> themenorientierte Gruppen (landlose Bauern,<br />
schwarze Studenten, Homosexuelle, Gewerkschafter, Kirchen, verprügelte Frauen,<br />
ein Haus für geistig Behin<strong>der</strong>te, ...) mit den Methoden des TO ihre Lebensrealität<br />
und ihre Wünsche nach Verän<strong>der</strong>ung. Viele Gemeindezentren pflegen dabei<br />
einen losen aber regelmäßigen Kontakt (Links) mit <strong>der</strong> Zentrale über anlassbedingte<br />
Treffen o<strong>der</strong> über eine Mailinglist, während s<strong>ich</strong> an<strong>der</strong>e Gruppen zu<br />
<strong>Theater</strong>gruppen (Nuclei) zusammenschließen und systematisch zu gewissen<br />
Themen arbeiten. Bei den Workshops o<strong>der</strong> Aufführungen, die in Gemeindezentren,<br />
den Räuml<strong>ich</strong>keiten <strong>der</strong> Organisation, bei kleineren und größeren<br />
Festivals o<strong>der</strong> auf <strong>der</strong> Straße (Chamber in the Square) stattfinden, werden Vorschläge<br />
und Feedback gesammelt, sowie zusammengefasst (Summaries) und von<br />
Anwälten in Gesetzesentwürfe umformuliert (Metabolising Cells). Folgendes<br />
Diagramm 100 soll die Struktur und den Aufbau nach dem Legislatives <strong>Theater</strong><br />
funktioniert verdeutl<strong>ich</strong>en:<br />
PT (Worker’s Party)<br />
CTO RIO<br />
Mandate<br />
Vereador<br />
Commission of Human<br />
Rights<br />
Central Directorate<br />
Internal Cabinet<br />
All internal work matters – legal and<br />
parliamentary business, press, office<br />
support<br />
The Chamber in the Square<br />
The interactive mailing list<br />
External Cabinet<br />
Jokers, dramaturgy, images,<br />
sound, laboratory<br />
The permanent company<br />
The mandate’s shows<br />
100 Boal, Augusto: Legislative Theatre. a.a.O., 1998, S. 39<br />
64
Nuclei and Links<br />
Constitution: a) by community; b) by theme; c) by both<br />
Activities: a) workshop; b) shows for the community itself; c) inter-community<br />
dialogues; d) festivals e) festival events<br />
Summaries<br />
The Metabolising Cell<br />
Projects of law; legal actions; direct interventions<br />
Auf diesem Weg sind über 30 Vorschläge im Stadtparlament von Rio de Janeiro<br />
zur Behandlung vorgelegt worden und 13 von ihnen wurden Gesetz. So <strong>kam</strong> es zu<br />
einem Zeugenschutzprogramm für Straßenkin<strong>der</strong>, ebenso wie zur verpfl<strong>ich</strong>tenden<br />
Einr<strong>ich</strong>tung geriatrischer Stationen in Krankenhäusern, städtebaul<strong>ich</strong>en Maßnahmen<br />
<strong>zum</strong> Schutz Sehbehin<strong>der</strong>ter, einem Anti-Diskriminierungsgesetz, das<br />
Motels verpfl<strong>ich</strong>tet bei hetero- wie homosexuellen Paaren den selben Preis zu<br />
verlangen, zur Verteilung von Müllsäcken an Straßenhändler und einigen an<strong>der</strong>en<br />
Gesetzen. 101<br />
Diese Art und Weise <strong>der</strong> Erarbeitung von Gesetzesvorschlägen bringt Boal den<br />
Ruf, er sei n<strong>ich</strong>t im Stande selbst Gesetze zu entwerfen. Er arbeitet deshalb ein<br />
Gesetz aus, das bei Fußgängerampeln ein akustisches Signal vorsieht, damit auch<br />
Sehbehin<strong>der</strong>te die Grünphase erkennen. In Schweden habe s<strong>ich</strong> dieses System<br />
bestens bewährt. Als die Sehbehin<strong>der</strong>ten davon erfahren, werfen sie Boal vor, er<br />
wolle sie umbringen. Boal versteht die Welt n<strong>ich</strong>t mehr, hat doch dieses Signal in<br />
Schweden viele Menschenleben gerettet. Die Sehbehin<strong>der</strong>ten erklären ihm den<br />
Unterschied zwischen Schweden und Rio: Schwedische Autofahrer bleiben bei Rot<br />
stehen!<br />
Er beschließt daraufhin, wie<strong>der</strong> die Experten, die Betroffenen, zeigen zu lassen,<br />
was sie s<strong>ich</strong> wünschen und wollen.<br />
Das Legislative <strong>Theater</strong> ist die konsequente Fortsetzung <strong>der</strong> bis dahin praktizierten<br />
Methoden, die auch immer wie<strong>der</strong> an ihre Grenzen stießen und nach wie vor<br />
stoßen, näml<strong>ich</strong> dann, wenn zur Bearbeitung eines Konflikts die gesetzl<strong>ich</strong>e<br />
101 Boal, Augusto: Legislative Theatre. a.a.O., S. 102f<br />
65
Grundlage fehlt. In den Fällen, mit denen das CTO RIO zu tun hatte, handelte es<br />
s<strong>ich</strong> meist um einen Mangel im bestehenden Gesetzeswerk. In Österre<strong>ich</strong> erlebte<br />
<strong>ich</strong> die Beschäftigung mit dem Problem <strong>der</strong> Überreglementierung.<br />
Beim Forumtheater Festival „Visionen zur Verän<strong>der</strong>ung“ 1999 in <strong>Wie</strong>n war <strong>ich</strong> Teil<br />
einer Gruppe, die unter <strong>der</strong> Leitung von Augusto Boal in Zusammenarbeit mit dem<br />
„Bassena“ (Stadtteilzentrum <strong>der</strong> Wohnsiedlung „Am Neuen Schöpfwerk“ 102 ) eine<br />
Forumtheaterszene erarbeitete, die vor <strong>der</strong> dortigen Schule aufgeführt wurde.<br />
Inhalt <strong>der</strong> Szene war das Spielverbot für Kin<strong>der</strong> und Jugendl<strong>ich</strong>e und die n<strong>ich</strong>t<br />
enden wollenden Einstiege von Kin<strong>der</strong>n, Jugendl<strong>ich</strong>en und Müttern zeigten, wie<br />
sehr mit diesem Thema <strong>der</strong> Nerv <strong>der</strong> BewohnerInnen dieser Siedlung getroffen<br />
wurde. Das „Bassena“ versprach in <strong>der</strong> Sache am Ball zu bleiben und die<br />
gezeigten Vorschläge aufzugreifen. 103 Im Rahmen des Festivals wurde die Szene<br />
unter an<strong>der</strong>en in <strong>der</strong> Anwesenheit von Dr. Caspar Einem, damals noch als<br />
Minister, Susanne Jerusalem, <strong>Wie</strong>ner Gemein<strong>der</strong>ätin <strong>der</strong> Grünen und an<strong>der</strong>en<br />
LokalpolitikerInnen gezeigt.<br />
oben: Szene „Forumtheater am Schöpfwerk“<br />
links: Gruppenfoto mit Augusto Boal<br />
102 In Österre<strong>ich</strong> erlangte diese Siedlung durch die Verfilmung des Kabarettprogramms „Muttertag“, mit Alfred<br />
Dorfer, Roland Düringer und vielen an<strong>der</strong>en Berühmtheit.<br />
103 Als direkte Folge entstand ein Radio-Feature für das „hauseigene“ Radio Schöpfwerk und ein Ber<strong>ich</strong>t im<br />
„Schöpfwerk Schimmel“. Der Artikel befindet s<strong>ich</strong> im Anhang.<br />
66
Weiters gab es Versuche, Politik und Legislatives <strong>Theater</strong> einan<strong>der</strong> näher zu<br />
bringen in München, Bradford und in den Nie<strong>der</strong>landen. In Brasilien haben<br />
inzwischen mehrere Städte (Porto Alegre, Minas Gerais, Bahia) diese Form <strong>der</strong><br />
Bürgerbeteiligung aufgegriffen und in Santo André hat die Stadtregierung ihre<br />
eigene TO-Gruppe gegründet.<br />
Augusto Boal mit seiner Gruppe vom Teatro Legislativo / CTO-RIO<br />
67
Im Folgenden möchte <strong>ich</strong> näher darauf eingehen, ob und wie s<strong>ich</strong> das TO in<br />
einem konkreten Bere<strong>ich</strong>, <strong>der</strong> Suchtprävention, anwenden lässt. Dazu wird es<br />
nötig sein, im Vorfeld die Begriffe Sucht und Suchtprävention zu klären und im<br />
Anschluss meine theoretischen Überlegungen und praktischen Erfahrungen zu<br />
schil<strong>der</strong>n.<br />
7 Was ist Sucht?<br />
Definitionen <strong>zum</strong> Begriff „Sucht“ gibt es bereits unzählige und aus den verschiedensten<br />
Motivationen und Denkr<strong>ich</strong>tungen heraus. Für die WHO (Weltgesundheitsorganisation)<br />
ist Sucht<br />
„ein Zustand periodischer o<strong>der</strong> chronischer Vergiftung,<br />
hervorgerufen durch den wie<strong>der</strong>holten Gebrauch einer<br />
natürl<strong>ich</strong>en o<strong>der</strong> synthetischen Droge und gekennze<strong>ich</strong>net<br />
durch 4 Kriterien:<br />
1. ein unbezwingbare Verlangen zur Einnahme und<br />
Beschaffung des Mittels<br />
2. eine Tendenz zur Dosissteigerung (Toleranzerhöhung)<br />
3. die psychische und meist auch physische Abhängigkeit von<br />
<strong>der</strong> Wirkung <strong>der</strong> Droge<br />
4. die Schädl<strong>ich</strong>keit für den einzelnen und/o<strong>der</strong> die<br />
Gesellschaft“<br />
Obwohl wesentl<strong>ich</strong>e Elemente des Suchtbegriffes dargelegt werden, bestimmen<br />
diese o<strong>der</strong> ähnl<strong>ich</strong>e zu kurz gegriffene Definitionen lei<strong>der</strong> noch immer den allgemeinen<br />
Diskurs und machen die Droge <strong>zum</strong> Problemmittelpunkt. Daraus resultiert<br />
die staatl<strong>ich</strong>e Politik dem Problem gegenüber, aber auch die „legalize it – Diskussion“<br />
blickt n<strong>ich</strong>t über diesen engen Horizont hinaus. Mein Verständnis lehnt s<strong>ich</strong><br />
an die S<strong>ich</strong>tweise von Sucht als einem Verhalten an, einer Ver-Haltung einer<br />
Sache, einer Tätigkeit, einer Gewohnheit gegenüber, die n<strong>ich</strong>t mehr <strong>der</strong> ursprüng-<br />
68
l<strong>ich</strong>en Haltung entspr<strong>ich</strong>t. Die Hessische Landesstelle gegen die Suchtgefahren<br />
e.V. spr<strong>ich</strong>t von Sucht<br />
„als zwanghaftem Verlangen nach bestimmten Substanzen<br />
o<strong>der</strong> Verhaltensweisen, die Missempfindungen vorübergehend<br />
lin<strong>der</strong>n und erwünschte Empfindungen auslösen. Die<br />
Substanzen o<strong>der</strong> Verhaltensweisen werden konsumiert bzw.<br />
beibehalten, obwohl negative Konsequenzen für die betroffene<br />
Person und für an<strong>der</strong>e damit verbunden sind.“ 104<br />
Sucht entsteht n<strong>ich</strong>t von heute auf morgen und die Ursachen lassen s<strong>ich</strong> n<strong>ich</strong>t auf<br />
einige wenige Punkte reduzieren. Sie finden s<strong>ich</strong> im Menschen, in seinem Milieu,<br />
im Mittel und in <strong>der</strong> Marktsituation. Sucht bedeutet auch immer mehr als Abhängigkeit,<br />
denn es bezieht alle Lebensumstände mit ein. Alles, was als Sucht<br />
endet, hat mit Genuss begonnen. Genießen zu können, ist ein Geschenk, und als<br />
solches ein wertvoller Bestandteil des Lebens. Der Prozess hin zur Sucht führt also<br />
gemeinhin über den Genuss, den Missbrauch, die Gewöhnung und über die Abhängigkeit.<br />
105 Ich möchte dem hinzufügen, dass hierbei die Grenzen natürl<strong>ich</strong> als<br />
fließend zu betrachten sind und für m<strong>ich</strong> <strong>der</strong> Konsum einen wesentl<strong>ich</strong>en Schritt<br />
vom Genuss hin <strong>zum</strong> Missbrauch darstellt, weil er einen Qualitätswechsel im<br />
Bezug zur Substanz o<strong>der</strong> <strong>zum</strong> Verhalten bedeutet.<br />
104 Seminarunterlagen „Lieber schlau als blau – Seminar zur Suchtprävention“ 14.02.-15.02.2002, Brixen,<br />
Seminarleitung: Dipl.Soz.päd. Guido Osthoff<br />
105 Leben hat viele Ges<strong>ich</strong>ter Sucht hat viele Ursachen, hrsg. von SFA – ISPA Schweizerische Fachstelle für<br />
Alkohol- und an<strong>der</strong>e Drogenprobleme, Zür<strong>ich</strong>, 1997, S. 28<br />
69
7.1 Sucht und Konsum<br />
Konsum macht Essen und Trinken zur Nahrungsaufnahme, <strong>zum</strong> Kalorienzählen,<br />
zur Nährwert- und Vitamintabelle 106 , während <strong>der</strong> Genuss 107 verloren geht.<br />
Ebenso werden rituelle, an Rhythmen und Personen(kreise) gebundene Handlungen<br />
(Rauchen, Berauschungen, ...), zu Konsumverhaltensweisen. 108 Selbst Verhaltensweisen<br />
an s<strong>ich</strong> können konsumiert werden und auch für Konflikte und<br />
Probleme werden oft nur noch konsumierbare Lösungen angeboten. Um etwas<br />
konsumieren zu können muss im Vorfeld die Verwandlung in Ware erfolgen, 109 es<br />
gibt folgl<strong>ich</strong> keinen Konsum in n<strong>ich</strong>t kapitalistischen Gesellschaften o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>s<br />
formuliert: In unserer Gesellschaft gibt es beinahe n<strong>ich</strong>ts mehr, das n<strong>ich</strong>t konsumiert<br />
werden könnte.<br />
Ich möchte hier n<strong>ich</strong>t auf die Verwandlung als Suchtmittel deklarierter Substanzen<br />
in Waren eingehen, die s<strong>ich</strong> beispielsweise an Kaffee, Alkoholika, Kokain o<strong>der</strong><br />
Hanf 110 zweifelsfrei nachweisen ließe. Im Bere<strong>ich</strong> <strong>der</strong> stoffgebundenen Süchte<br />
wurde <strong>der</strong> Zusammenhang zwischen Kommodifikation und <strong>der</strong> Suchtproblematik,<br />
<strong>zum</strong>indest aus <strong>der</strong> S<strong>ich</strong>t einiger, bereits erkannt.<br />
„Die Hauptursachen des heutigen Drogenproblems<br />
1. Das Herausreissen <strong>der</strong> Drogen aus dem rituell-religiösen<br />
Gebrauch und die Degradierung <strong>der</strong> Drogen zur Ware mit<br />
entsprechen<strong>der</strong> Vermarktung<br />
2. Die chemische »Veredelung« Konzentrationssteigerung <strong>der</strong><br />
Drogen<br />
106 vgl. dazu Kaller-Dietr<strong>ich</strong>, Martina: Macht über Mägen, Essen machen statt Knappheit verwalten, Haushalten<br />
in einem südmexikanischen Dorf, <strong>Wie</strong>n, 2002<br />
107 Fast bin <strong>ich</strong> hier versucht Genuss durch Genus zu ersetzen. „Ich behaupte, dass für die Entstehung des<br />
Kapitalismus (...) <strong>der</strong> Verlust von vernakulärem Genus eine entscheidende Bedingung ist.“ Ill<strong>ich</strong>, Ivan: Genus.<br />
a.a. O., 1983, S. 9ff.<br />
108 vgl. Was ihr wollt. Suchtprävention und <strong>Theater</strong>; Dokumentation einer Fachtagung; hrsg. von Aktion<br />
Jugendschutz, Landesarbeitsstelle Baden-Würtemberg, 1999, S. 16<br />
109 Zur Verwandlung aller Dinge in Waren siehe: Wallerstein, Immanuel: Der historische Kapitalismus, Berlin,<br />
1984, S. 9ff<br />
110 Einen sehr guten Einbl<strong>ich</strong> dazu gibt Fässler, Benjamin: Drogen zwischen Herrschaft und Herrl<strong>ich</strong>keit, Der<br />
Umgang mit Drogen als Spiegel <strong>der</strong> Gesellschaft, Solothurn, 1997 in den jeweiligen Kapiteln<br />
70
3. Die allgemeine Suchttendenz in unserer Gesellschaft<br />
4. Die Verteufelung und Illegalisierung <strong>der</strong> Drogen“ 111<br />
Vielmehr möchte <strong>ich</strong> zeigen, dass Verhaltensweisen in Waren verwandelt wurden<br />
und Sucht an s<strong>ich</strong> ohne den historischen Kapitalismus n<strong>ich</strong>t denkbar ist. An<strong>der</strong>s<br />
formuliert bedeutet dies die Aufgabe des vernakulären Rausches zu Gunsten einer<br />
kapitalistischen Sucht. Um also von einer Suchtgesellschaft sprechen zu können,<br />
wie es von unserer getan wird 112 , genügt es n<strong>ich</strong>t, dies an Hand einer quantitativ<br />
hohen Zahl von Süchtigen, <strong>der</strong> Anzahl illegaler und legaler Suchtmittel, sowie<br />
<strong>der</strong>en Allgegenwart zu belegen. Unsere Gesellschaft weist in s<strong>ich</strong> wesentl<strong>ich</strong>e<br />
Merkmale einer Sucht, eines Süchtigen auf:<br />
„wirres Denken, Unehrl<strong>ich</strong>keit, Verleugnung, Verdrängung,<br />
Gefühlsstarre, Abhängigkeit, Kontrollbedürfnis, etc.“ 113<br />
Als Basis dafür dient die Etablierung unserer Gesellschaft als Konsum- und<br />
Leistungsgesellschaft und dem damit einhergehenden Konsum- und Leistungsdruck.<br />
Wobei s<strong>ich</strong> Leistung und Erfolg schlussendl<strong>ich</strong> auch nur am daraus entstehenden<br />
materiellen Gewinn messen lassen. Unsere Gesellschaft und ihre<br />
Menschen bestimmen s<strong>ich</strong> über den Besitz von Waren, und diese Hab-Sucht ist<br />
grundlegend. 114 Nur was vorher in Besitz genommen wurde, kann anschließend<br />
konsumiert werden. In Besitz genommen wird dabei alles, und das unter <strong>der</strong><br />
Prämisse <strong>der</strong> Knappheit mögl<strong>ich</strong>st viel, jetzt und egoman. 115 Räuml<strong>ich</strong>e, zeitl<strong>ich</strong>e<br />
und personelle Grenzen des Genusses wurden und werden aufgehoben, schließl<strong>ich</strong><br />
musste und muss die Zahl <strong>der</strong> Konsumenten vergrößert werden. Wenn <strong>ich</strong><br />
Sucht und Kapital einan<strong>der</strong> gegenüber stelle, weisen beide ein vergle<strong>ich</strong>bares<br />
Schema <strong>der</strong> Akkumulation auf. Beide vermehren s<strong>ich</strong> selbst und leben von <strong>der</strong><br />
111 Fässler, Benjamin: Drogen zwischen Herrschaft und Herrl<strong>ich</strong>keit, a.a.O., 1997, S. 321<br />
112 3 Beispiele: Oberarzbacher, Helga/Dornauer, Kurt (Hg.): das strafbegehren <strong>der</strong> suchtgesellschaft, strafrecht<br />
und sucht, körper – chemie – gesellschaft, drogenpolitik. Innsbruck, 1999<br />
Fässler, Benjamin: Drogen zwischen Herrschaft und Herrl<strong>ich</strong>keit, a.a.O., 1997<br />
Kolitzus, Helmut: Die Liebe und <strong>der</strong> Suff..., Schicksalsgemeinschaft Suchtfamilie, München, 1999<br />
113 Wilson Schaef, Anne: Im Zeitalter <strong>der</strong> Sucht, München, 1991, (ohne Seitenangabe) zit. nach: Fässler,<br />
Benjamin: Drogen zwischen Herrschaft und Herrl<strong>ich</strong>keit, a.a.O., 1997, S. 282<br />
114 vgl. dazu Ill<strong>ich</strong>, Ivan: Genus. a.a.O., 1983, S. 138<br />
115 zur Knappheit vgl. ebd.: S. 145ff<br />
71
Toleranzerhöhung, um durch steigenden Konsum, den Konsum zu steigern, um<br />
die gle<strong>ich</strong>e Wirkung zu erzielen. In beiden Fällen wird Abhängigkeit erzeugt. Als<br />
Folge des immer wirkungsloser werdenden Zwangskonsums stellt s<strong>ich</strong> n<strong>ich</strong>t nur<br />
Frustration ein, die Sucht stellt s<strong>ich</strong> in eine Reihe mit an<strong>der</strong>en immanenten Sozialindikatoren<br />
die Ill<strong>ich</strong> im Begriff <strong>der</strong> Kontraproduktivität zusammen fasst. 116 In<br />
diesem Fall, wenn s<strong>ich</strong> ein Muss <strong>zum</strong> Verbrauch einstellt, geht auch jegl<strong>ich</strong>e<br />
positive Wirkung, jede Erfüllung und Befriedigung verloren. 117<br />
Ein Beispiel, wo die Verbindung zwischen Kapitalismus und stoffungebun<strong>der</strong> Sucht<br />
beson<strong>der</strong>s deutl<strong>ich</strong> zu Tage tritt, stellt die Arbeitssucht <strong>der</strong> workaholics dar. Es<br />
handelt s<strong>ich</strong> dabei n<strong>ich</strong>t mehr um die Arbeit, die <strong>der</strong> Warenproduktion dient, noch<br />
dazu in einer Dienstleistungsgesellschaft, son<strong>der</strong>n um die Arbeit, die selbst zur<br />
Ware wurde und somit in ein Konsumgut verwandelt wurde. So wie beim Alkohol<br />
bringt ein gewisses Übermaß vorerst Anerkennung. Wenn <strong>der</strong> Erfolg <strong>der</strong> Arbeit,<br />
<strong>der</strong> s<strong>ich</strong> ad definitionem durch den finanziellen Gewinn bestimmt, aber n<strong>ich</strong>t mehr<br />
ausre<strong>ich</strong>t, um befriedigt zu sein, muss es eben mehr Arbeit werden. Die Folgen<br />
dieser Sucht sind n<strong>ich</strong>t weniger dramatisch als bei an<strong>der</strong>en.<br />
116 Ill<strong>ich</strong>, Ivan: Genus. a.a.O., 1983, S. 16 und S. 143 Als weitere Sozialindikatoren nennt Ill<strong>ich</strong>: sozialen<br />
Zeitverlust durch Beschleunigung des Verkehrs, strukturell krankmachende Medizin, sozial-verdummende<br />
Zwangserziehung, die Bedeutung untergrabende Informationsflut des Nachr<strong>ich</strong>tenwesens, u.a.<br />
117 ebd.: S. 38<br />
72
7.2 Sucht und Freiheit<br />
Zwei Vorurteilen möchte <strong>ich</strong> an dieser Stelle entgegen treten. Zum Ersten werden<br />
Süchtige als willensschwach beze<strong>ich</strong>net, die s<strong>ich</strong> lieber selbst zerstören als zu<br />
leben, könnten sie s<strong>ich</strong> doch mit eigener Kraft und genügend Willen selbst<br />
befreien. Zum Zweiten, so höre <strong>ich</strong>, böte unsere Gesellschaft doch alle Freiheit,<br />
s<strong>ich</strong> ein erfülltes Leben zu schaffen, ohne auf dieses Teufelszeug zurückgreifen zu<br />
müssen. Beides stimmt n<strong>ich</strong>t. (Selbst)Destruktion und Neugier, und aus meiner<br />
S<strong>ich</strong>t auch die positive Erfahrung eines Rauschzustandes, sind zwar in <strong>der</strong> Suchtforschung<br />
von immensem Interesse, ihre Begründungen fußen aber<br />
„auf <strong>der</strong> – wohl falschen – und von vielen Disziplinen als<br />
fundamentaler menschl<strong>ich</strong>er Eigenschaft vorausgesetzten Freiheit<br />
des Wollens und Handelns.“ 118<br />
Die Freiheit, sofern es sie je gab, war eine <strong>der</strong> ersten Opfer des kapitalistischen<br />
Systems, denn sie wurde <strong>zum</strong> Besitz<br />
„ökonomischer Unabhängigkeit in Bezug auf an<strong>der</strong>e.“ 119<br />
Mit <strong>der</strong> zunehmenden Kommodifikation öffneten s<strong>ich</strong> <strong>der</strong> Sucht Tür und Tor, weg<br />
von <strong>der</strong> materiellen Eben <strong>der</strong> Substanzen, die restlos in Waren verwandelt<br />
wurden, hin zu den Handlungen und Betätigungen <strong>der</strong> Menschen. Bekannt ist<br />
vielle<strong>ich</strong>t die Jogging-Sucht, die s<strong>ich</strong> mit Hilfe von Lauf-Gurus und -Päpsten und<br />
<strong>der</strong> Sportbekleidungsindustrie entwickelte. Spielen wurde in Casinos, Wettbüros<br />
und im Glücksspiel kommerzialisiert. Dass Geschlechtsverkehr zunehmend auch<br />
nur noch einen Warencharakter hat, ist vielle<strong>ich</strong>t n<strong>ich</strong>t mehr unbekannt, aber<br />
auch hier sorgen zur Zeit das Internet, Swingerclubs und an<strong>der</strong>e Angebote für<br />
wachsenden Umsatz. Aus <strong>der</strong> Erholung wurde Wellness in sündteuren Hotelanlagen,<br />
aus <strong>der</strong> Bewegung wurde Fitness in einem Studio, aber von einer Erfüllung,<br />
118 Oberarzbacher, Helga/Dornauer, Kurt (Hg.): das strafbegehren <strong>der</strong> suchtgesellschaft. a.a.O., 1999, S. 9<br />
119 Ill<strong>ich</strong>, Ivan: Genus, a.a.O., S. 138<br />
73
einem Glücksgefühl nach gelungener Arbeit, erbrachter Leistung, entspannen<strong>der</strong><br />
Ruhe, wi<strong>der</strong>fahrener Liebe fehlt beinahe jede Spur. Kein Wun<strong>der</strong>, dass, in <strong>der</strong><br />
Hoffnung darauf, eine Dosissteigerung als mögl<strong>ich</strong>er Weg gesehen wird. Auch<br />
wenn es etymologisch n<strong>ich</strong>t stimmt: Sucht kommt von suchen! 120 74<br />
120 Sucht kommt von siechen, krank sein. „Sucht: „krankhafte Abhängigkeit; Manie“ (...) „Krankheit“ sind<br />
ablautende Bildungen zu dem unter ↑ siech behandelten Verb ´siechen´ „krank sein“.“ Duden: Bd. 7.<br />
Etymologie. a.a.O., 1989
7.3 Sucht und Gewalt<br />
Noch vor dem Beginn einer intensiven Beschäftigung mit dem Thema Sucht war<br />
<strong>ich</strong> <strong>der</strong> Ans<strong>ich</strong>t, dass es s<strong>ich</strong> hierbei um eine massive Form <strong>der</strong> Unterdrückung<br />
handle, die dem Menschen in vielfältiger Art und Weise Gewalt antue. Sucht stellt<br />
s<strong>ich</strong> immer als etwas Konfliktbehaftetes dar: Seien es innere Konflikte, die durch<br />
das Suchtmittel ursprüngl<strong>ich</strong> bekämpft hätten werden sollen, Gewissenskonflikte<br />
auf Grund des Konsums o<strong>der</strong> des Verhaltens, interpersonelle Konflikte durch die<br />
persönl<strong>ich</strong>keitsverän<strong>der</strong>nde Wirkung, gesellschaftl<strong>ich</strong>e und politische Konflikte<br />
durch Folgen o<strong>der</strong> die Frage des (gesetzl<strong>ich</strong>en) Umgangs mit Suchtmitteln und<br />
<strong>der</strong>en Gebrauchern. Sucht kann also a priori als ein dem Frieden abträgl<strong>ich</strong>es,<br />
gewalttätiges, unterdrückendes Phänomen beze<strong>ich</strong>net werden. Ich denke dabei<br />
n<strong>ich</strong>t in erster Linie an die s<strong>ich</strong>tbare, direkte Gewalt in diesem Zusammenhang,<br />
son<strong>der</strong>n vielmehr an die strukturelle und kulturelle Gewalt, die Sucht am Süchtigen,<br />
seinem sozialen Umfeld und <strong>der</strong> Gesellschaft verübt. Auch hier ist nur die<br />
Spitze des Eisberges s<strong>ich</strong>tbar!<br />
Johan Galtung listet s<strong>ich</strong>tbare und uns<strong>ich</strong>tbare Auswirkungen von Gewalt nach<br />
„Geschädigten“ auf 121 . Nimmt man Sucht als eine Form <strong>der</strong> Gewalt an, kann die<br />
Tabelle mit einigen Modifikationen eins zu eins übernommen werden. Ich ersetze<br />
und ergänze einige Begriffe Galtungs, die <strong>ich</strong> in Klammern setze, durch suchtspezifische<br />
Beispiele in kursiver Schrift und erlaube mir, wenige für m<strong>ich</strong> hier n<strong>ich</strong>t<br />
relevante Begriffe weg zu lassen. Die einschlägige Literatur gibt gern über quantifizierbare<br />
Auswirkungen in vielen Punkten (Tote, Folgekosten im Gesundheitswesen,<br />
Wirtschaftseinbußen, ...) Auskunft 122 , die <strong>ich</strong> an dieser Stelle bewusst n<strong>ich</strong>t<br />
anführen möchte, weil Zahlen und Statistiken gerade in Zusammenhang mit Sucht<br />
ohnehin zuviel Beachtung geschenkt wird. Zudem lässt s<strong>ich</strong> die zweite Spalte<br />
ohnehin n<strong>ich</strong>t quantifizieren und ihr soll hier aber mehr Beachtung zu Teil werden.<br />
121 Galtung, Johan: Der Preis <strong>der</strong> Mo<strong>der</strong>nisierung. a.a.O., 1999, S. 178<br />
122 z.B.: Bundesministerium für Inneres, Abteilung II/BK/8 Zentralstelle für die Bekämpfung <strong>der</strong><br />
Suchtmittelkriminalität, Jahresber<strong>ich</strong>t 2001, <strong>Wie</strong>n, 2002 o<strong>der</strong><br />
Handbuch Alkohol – Österre<strong>ich</strong>, Zahlen Daten Fakten Trends 2001, hrsg. v. Republik Österre<strong>ich</strong>,<br />
Bundesministerium für soziale S<strong>ich</strong>erheit und Generationen, <strong>Wie</strong>n, 2001<br />
75
S<strong>ich</strong>tbare und uns<strong>ich</strong>tbare Auswirkungen <strong>der</strong> Sucht (Gewalt)<br />
Raum<br />
Natur<br />
Mensch<br />
Gesellschaft<br />
Welt<br />
Zeit<br />
Kultur<br />
materielle, s<strong>ich</strong>tbare<br />
Auswirkungen<br />
Raubbau und<br />
Umweltverschmutzung;<br />
Schaden an <strong>der</strong> Vielfalt und<br />
an <strong>der</strong> Symbiose, Synthetisierung<br />
Anzahl <strong>der</strong> Getöteten<br />
Anzahl <strong>der</strong> Kranken<br />
(Verwundeten)<br />
Anzahl <strong>der</strong> Fehl- und<br />
Missgeburten<br />
(Vergewaltigungen)<br />
materieller Schaden,<br />
Bindung von Geldmitteln für<br />
Prävention, Folgekosten,...<br />
(Gebäude, Infrastruktur)<br />
<strong>der</strong> materielle Schaden<br />
Krieg um und gegen Drogen<br />
(Infrastruktur)<br />
Sucht als chronische<br />
Krankheit (verzögerte<br />
Gewalt) Co-Abhängigkeit<br />
(übertragene Gewalt)<br />
Einfluss auf das Erbgut<br />
(genetisch)<br />
irreversibler Schaden am<br />
menschl<strong>ich</strong>en Kulturerbe<br />
n<strong>ich</strong>tmaterielle,<br />
uns<strong>ich</strong>tbare<br />
Auswirkungen<br />
weniger Respekt für die<br />
n<strong>ich</strong>tmenschl<strong>ich</strong>e Natur;<br />
Verstärkung <strong>der</strong> Haltung<br />
„Mensch über <strong>der</strong> Natur“<br />
Trauerfälle, Traumata,<br />
Hassgefühle, Rachsucht,<br />
Siegessucht, Persönl<strong>ich</strong>keitswandel<br />
<strong>der</strong> strukturelle Schaden<br />
<strong>der</strong> kulturelle Schaden<br />
Zerstörung von Gemeinschaften<br />
und Traditionen<br />
<strong>der</strong> strukturelle Schaden<br />
<strong>der</strong> kulturelle Schaden<br />
Diskreditierung von Staaten<br />
Strukturtransfer<br />
Kulturtransfer<br />
Gewaltkultur von Trauma,<br />
Ruhm<br />
Verschlechterung <strong>der</strong><br />
Konfliktlösungskapazität<br />
N<strong>ich</strong>t zuletzt spr<strong>ich</strong>t ja auch Galtung in seiner Auflistung bei den n<strong>ich</strong>tmateriellen<br />
Auswirkungen von Gewalt auf den Menschen von Rach- und Siegessucht. Im<br />
Zusammenhang können Sucht und Gewalt nur als Auswirkung und Ursache des<br />
jeweils an<strong>der</strong>en gesehen werden, denn Gewalt und Unterdrückung för<strong>der</strong>n und<br />
begünstigen die Entstehung von Sucht und Sucht führt immer auch zu Gewalt.<br />
Zwei Punkte dieser Auflistung möchte <strong>ich</strong> an Hand von Beispielen verdeutl<strong>ich</strong>en.<br />
Die USA und zu einem Großteil Europa betreiben mit ihrem „war on drugs“ einen<br />
massiven Struktur- und Kulturtransfer ihrer Drogenpolitik über die UNO in alle<br />
Welt. Bolivien wird gezwungen, die jahrhun<strong>der</strong>tealte Kultur des Cocaanbaus zu<br />
zerstören, an<strong>der</strong>e Staaten werden gezwungen Hanf zu kriminalisieren und werden<br />
76
dafür mit Zigaretten und Alkohol überflutet. Gerade durch Alkohol und Zigaretten,<br />
die wirtschaftl<strong>ich</strong> fest in westl<strong>ich</strong>er Hand sind, gelang und gelingt es, <strong>der</strong> gesamten<br />
Welt gewinnbringend „unsere“ Süchte zu verkaufen. 123<br />
Ein weiterer Aspekt <strong>der</strong> in dieser Aufstellung ebenfalls zu Tage tritt, ist die Unterdrückung,<br />
die Suchtmitteln und den Verhaltenssüchten selbst wi<strong>der</strong>fährt. Dies betrifft<br />
sowohl das Verbot o<strong>der</strong> die gesellschaftl<strong>ich</strong>e Ächtung, als auch das Herauslösen<br />
aus einem natürl<strong>ich</strong>en Zusammenhang, wie einer jahreszeitl<strong>ich</strong>en Rhythmik<br />
o<strong>der</strong> eines lokal begrenzten und kulturell eingebundenen Gebrauchs und die<br />
synthetische Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Wirkstoffe, sowie die Art und Weise wie man s<strong>ich</strong><br />
etwas zu Gemüte führt. Cocatee Trinken ist etwas an<strong>der</strong>es als Kokain Schnupfen<br />
und durch den Wald laufen unterscheidet s<strong>ich</strong> substantiell vom Training in einem<br />
Fitnessstudio. Dass s<strong>ich</strong> dadurch die unterdrückende Wirkung im Sinne eines<br />
steigenden Suchtpotentials verstärkt, erscheint mir nur konsequent.<br />
Zusammenfassung:<br />
Unsere gesellschaftl<strong>ich</strong>en Rahmenbedingungen för<strong>der</strong>n und bedingen das Entstehen<br />
von Süchten, vor allem wenn <strong>der</strong> Stoff o<strong>der</strong> das Verhalten vollständig in<br />
den kapitalistischen Kreislauf eingebunden wurde. Je mehr s<strong>ich</strong> Bere<strong>ich</strong>e <strong>zum</strong><br />
passiven Konsum eignen, umso größer werden die darin enthaltenen Suchtpotentiale.<br />
Kapitalismus, Konsum und Sucht verringern gle<strong>ich</strong>ermaßen Eigenverantwortung,<br />
Kreativität, Gemeinschaftsgefühl und Freude am eigenen (Er-)Leben,<br />
legen dabei Kräfte, Potentiale und Talente lahm und för<strong>der</strong>n Aggression,<br />
Neid, Machbarkeitswahn und Isolation. Sucht ist sowohl die Krankheit eines einzelnen,<br />
wiewohl eine Seuche unserer gesamten Gesellschaft und hat ihre Ursachen<br />
in individueller Disposition und sozialen Bedingungen. Am wenigsten trägt<br />
das Mittel o<strong>der</strong> das Verhalten selbst zur Entwicklung einer Sucht bei. In diesem<br />
Kreislauf von Person, Gesellschaft und Suchtmittel/-verhalten kommen zwangsläufig<br />
mannigfaltige Formen von Gewalt und Unterdrückung direkter, struktureller<br />
und kultureller Art vor.<br />
123 Fässler, Benjamin: Drogen zwischen Herrschaft und Herrl<strong>ich</strong>keit, a.a.O., 1997, S. 320<br />
77
8 Suchtprävention<br />
Um auf eine mögl<strong>ich</strong>st lange Tradition und dadurch Legitimation verweisen zu<br />
können, spr<strong>ich</strong>t Gerald Koller davon, dass Suchtprävention bereits mit den Überlegungen<br />
zu einer angemessenen Haltung gegenüber Rauschmitteln begann. 124<br />
Allerdings können rituelle Rahmenbedingungen, Einschränkung des Personenkreises<br />
und zeitl<strong>ich</strong>e und natürl<strong>ich</strong>e Beschränkungen <strong>der</strong> Verfügbarkeit wohl kaum<br />
als bewusst gesetzte präventive Maßnahmen gesehen werden, <strong>zum</strong>al zwar <strong>der</strong><br />
Rausch bekannt war, aber die Sucht n<strong>ich</strong>t.<br />
„Bei uns gab es vor <strong>der</strong> Invasion <strong>der</strong> sogenannten zivilisierten<br />
Menschen keinen einzigen Alkoholiker! Alkohol gab es schon,<br />
aber erstens durfte ihn n<strong>ich</strong>t je<strong>der</strong> trinken und zweitens wurde er<br />
nur zu Zeremonien und bei Festen benützt, aber niemals in<br />
großen Mengen.“ 125<br />
Suchtprävention setzt erst ab dem Auftreten und Erkennen von Sucht als individueller<br />
Krankheit und gesellschaftl<strong>ich</strong>er Seuche ein. In professioneller Weise wird<br />
Suchprävention erst seit ungefähr 20 Jahren betrieben.<br />
Erste Versuche zur Eindämmung eines zunehmenden Suchtmittelkonsums, die<br />
allerdings n<strong>ich</strong>t als präventive Maßnahmen gewertet werden können, erschöpften<br />
s<strong>ich</strong>, als Reaktion auf die unbegrenzte Verfügbarkeit, im Verbot von Substanzen.<br />
Heute legale Drogen, wie Alkohol und Tabak 126 waren verboten, heute illegale<br />
wie Hanf waren hingegen erlaubt und anerkannt, wie<strong>der</strong> an<strong>der</strong>e sind Produkte<br />
124 vgl. Was ihr wollt. Suchtprävention und <strong>Theater</strong>; Dokumentation einer Fachtagung; hrsg. von Aktion<br />
Jugendschutz, Landesarbeitsstelle Baden-Würtemberg, 1999, S. 16; Gerald Koller ist Geschäftsführer des<br />
Verein VITAL und leitet das Österre<strong>ich</strong>ische Bildungsforum für för<strong>der</strong>nde und präventive Jugendarbeit. In<br />
diesem einen Punkt wi<strong>der</strong>spreche <strong>ich</strong> ihm. www.youthpromotion.at<br />
125 Gomora, Xokonoschtletl: Ans<strong>ich</strong>ten eines Wilden über die zivilisierten Menschen, ohne Ort und Jahr, S. 111<br />
126 Die Zeit <strong>der</strong> Prohibition in den USA und das Tabakverbot in Bayern, Sachsen und Zür<strong>ich</strong> sind nur Beispiele.<br />
s. sucht & drogen nüchtern betrachtet; hrsg. v. Österre<strong>ich</strong>ische Arbeitsgemeinschaft für Suchtvorbeugung; ohne<br />
Datum<br />
78
Begriffsklärungen<br />
Gesundheit ist mehr als nur die Abwesenheit von Krankheit. Gesundheit kann<br />
verstanden werden als ein Gefühl des Wohlbefindens. Dieses ergibt s<strong>ich</strong> aus einer<br />
dynamischen Ausgegl<strong>ich</strong>enheit <strong>der</strong> physischen und psychischen Aspekte des<br />
Menschen sowie seines Zusammenwirkens mit seiner natürl<strong>ich</strong>en und gesellschaftl<strong>ich</strong>en<br />
Umwelt. Gesundheit heißt somit auch, die Welt verstehen zu können,<br />
an ihr teilzuhaben und eine Bedeutung im Leben zu erkennen.<br />
Gesundheitsför<strong>der</strong>ung will Menschen in ihrer Lebensgestaltung bezügl<strong>ich</strong><br />
Gesundheit informieren und unterstützen. Sie hat ebenso die Aufgabe, individuelle<br />
und soziale Lebensbedingungen dahingehend zu beeinflussen, dass<br />
Gesundheit mögl<strong>ich</strong> ist. Gesundheitsför<strong>der</strong>ung befasst s<strong>ich</strong> also n<strong>ich</strong>t mit<br />
einzelnen Krankheiten, son<strong>der</strong>n orientiert s<strong>ich</strong> an Entstehungsbedingungen für<br />
Gesundheit und Wohlbefinden.<br />
Gemeindenahe Gesundheitsför<strong>der</strong>ung will das Interesse mögl<strong>ich</strong>st breiter<br />
Bevölkerungskreise für Gesundheitsfragen in ihrem Lebensraum wecken. Dabei<br />
sollen n<strong>ich</strong>t nur Einzelne darin unterstützt werden, Eigenverantwortung für Gesundheit<br />
zu übernehmen. Ebenso soll das Bewusstsein für die Mitverantwortung<br />
an <strong>der</strong> Gesundheit <strong>der</strong> Gemeinschaft gestärkt werden.<br />
Prävention hat <strong>zum</strong> Ziel, Menschen von Handlungsweisen abzuhalten, die sie<br />
o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>e gesundheitl<strong>ich</strong> beeinträchtigen können. Dazu müssen neben Informationen<br />
auch konkrete Hilfestellungen <strong>zum</strong> Erlernen von Fähigkeiten und<br />
Fertigkeiten angeboten werden, die den Mögl<strong>ich</strong>keiten <strong>der</strong> Beteiligten gerecht<br />
werden. Es geht in <strong>der</strong> Prävention n<strong>ich</strong>t darum, Menschen Gesundheit aufzuzwingen,<br />
son<strong>der</strong>n sie dazu zu motivieren, ihre Mögl<strong>ich</strong>keiten für Gesundheit<br />
wahrzunehmen. Psychologische Prävention befasst s<strong>ich</strong> mit unterschiedl<strong>ich</strong>en<br />
Themengebieten, denn die thematischen Entwicklungen in <strong>der</strong> Prävention sind<br />
genauso dynamisch wie die Verän<strong>der</strong>ungen in <strong>der</strong> Gesellschaft.<br />
Suchtprävention beschäftigt s<strong>ich</strong> mit den vielfältigen Erscheinungsformen von<br />
Sucht. Suchtprävention hat <strong>zum</strong> Ziel, den Missbrauch von Suchtmitteln und<br />
süchtige bzw. suchtähnl<strong>ich</strong>e Verhaltensweisen zu verhin<strong>der</strong>n. Wirksame Suchtprävention<br />
verknüpft häufig die Ansätze von Prävention und Gesundheitsför<strong>der</strong>ung.<br />
Primäre Suchtprävention r<strong>ich</strong>tet s<strong>ich</strong> an "Gesunde" und setzt an bei den<br />
Ressourcen und Ursachen. Es geht darum, frühzeitig Lebenskompetenzen als<br />
Schutzfaktoren gegen Sucht zu för<strong>der</strong>n und Risikofaktoren zu verringern. Weiters<br />
ist es ein Ziel, einen ausre<strong>ich</strong>enden Wissensstand zu Sucht, Suchtentstehung und<br />
Suchtmitteln zu gewährleisten. Primäre Suchtprävention ist eine pädagogische<br />
Aufgabenstellung und somit psycho-sozial und kommunikativ angelegt, das heißt<br />
es stehen n<strong>ich</strong>t die medizinischen o<strong>der</strong> juristischen Aspekte des Suchtmittelkonsums<br />
im Vor<strong>der</strong>grund, son<strong>der</strong>n die personalen und sozialen Aspekte.<br />
Sekundäre Suchtprävention r<strong>ich</strong>tet s<strong>ich</strong> an Personen in Krisen und setzt bei<br />
entstehenden Problemen an. Bei experimentellem Suchtmittelgebrauch sind mit<br />
den Betroffenen Probleme und Konsequenzen zu thematisieren; bei einem fort-<br />
80
geschrittenen Suchtmittelmissbrauch bzw. Suchtverhalten (Magersucht) sind geeignete<br />
beraterische und unter Umständen therapeutische Maßnahmen einzuleiten.<br />
Als Spezialgebiete <strong>der</strong> Prävention kommen in diesem Zusammenhang <strong>der</strong> Früherkennung<br />
und Intervention große Bedeutung zu. Hierbei wird versucht, Verhaltensweisen,<br />
die zu gesundheitl<strong>ich</strong>en Beeinträchtigungen führen können, mögl<strong>ich</strong>st<br />
frühzeitig zu erkennen und eine weitere Entwicklung in diese R<strong>ich</strong>tung zu verhin<strong>der</strong>n.<br />
Aktivitäten im Bere<strong>ich</strong> <strong>der</strong> Früherkennung sind deshalb auf Strukturen angewiesen,<br />
die es ermögl<strong>ich</strong>en, ein zielger<strong>ich</strong>tetes Handeln zu planen, umzusetzen<br />
und zu koordinieren. Früherkennung bezweckt, Menschen in schwierigen Lebenssituationen<br />
direkte Hilfe bei Krisen und Konflikten anzubieten.<br />
Tertiäre Suchtprävention r<strong>ich</strong>tet s<strong>ich</strong> an (Ex-)Süchtige und Angehörige und setzt<br />
bei <strong>der</strong> Not <strong>der</strong> Betroffenen an. Ziel ist es, Schaden zu min<strong>der</strong>n und die Sucht zu<br />
heilen. Zuständig für dieses Arbeitsfeld sind Beratungsstellen, Entzugs- und<br />
Therapieeinr<strong>ich</strong>tungen. Selbsthilfegruppen und Angebote zur Nachsorge runden<br />
das Netz <strong>der</strong> Suchtkrankenhilfe ab.<br />
Prävention und Gesundheitsför<strong>der</strong>ung sind gesamtgesellschaftl<strong>ich</strong>e Aufgaben.<br />
Sie können und dürfen n<strong>ich</strong>t ausschließl<strong>ich</strong> an Fachleute delegiert werden. Vielmehr<br />
ist ein aktives Mittun von mögl<strong>ich</strong>st allen nötig. Prävention und Gesundheitsför<strong>der</strong>ung<br />
können und sollen n<strong>ich</strong>t für Menschen angeordnet werden, son<strong>der</strong>n<br />
zusammen mit Menschen gestaltet und gelebt werden.<br />
7 Thesen zur Suchtprävention<br />
1. These<br />
N<strong>ich</strong>t die Suchtmittel sind das Problem, son<strong>der</strong>n unser Umgang mit Suchtmitteln.<br />
Grundsätzl<strong>ich</strong> gibt es kein Genuss- o<strong>der</strong> Heilmittel, das n<strong>ich</strong>t auch missbraucht<br />
werden kann, von dem wir n<strong>ich</strong>t auch abhängig werden können.<br />
2. These<br />
Eine Sucht entsteht n<strong>ich</strong>t von heute auf morgen, sie ist das Resultat einer jahrelangen<br />
Entwicklung. Niemand wird von einem Tag auf den an<strong>der</strong>en süchtig, und<br />
ebenso wenig wird man süchtig geboren. Jede Sucht beginnt harmlos, wächst, hat<br />
also seine Gesch<strong>ich</strong>te.<br />
3. These<br />
Also gibt es n<strong>ich</strong>t nur einen Grund für eine Sucht, die Ursachen sind komplexer.<br />
Bei einer Suchtentstehung spielen verschiedene Einflüsse und Faktoren zusammen.<br />
4. These<br />
Hinter einer Sucht steht oft die Unfähigkeit, mit Problemen und Konflikten in<br />
konstruktiver Weise umzugehen. Mit <strong>der</strong> Abs<strong>ich</strong>t <strong>der</strong> Selbsthilfe wird Zuflucht bei<br />
einem Verhalten gesucht, das schließl<strong>ich</strong> mehr Schaden verursacht als Erle<strong>ich</strong>terung<br />
bringt. Eine Sucht ist oft auch ein gescheiterter Selbstheilungsversuch.<br />
81
5. These<br />
Lösungen müssen dort gesucht werden, wo die Ursachen für das Suchtverhalten<br />
liegen: bei den Schwierigkeiten im Alltag, bei <strong>der</strong> Persönl<strong>ich</strong>keit eines Menschen,<br />
bei den Einflüssen aus Umwelt und Gesellschaft und bei den Suchtmitteln.<br />
6. These<br />
Dem Mangel an Lebensfreude und Lebenssinn ist mit <strong>der</strong> For<strong>der</strong>ung des Verz<strong>ich</strong>ts<br />
allein n<strong>ich</strong>t beizukommen. Wer keine echte Befriedigung erlebt, braucht und sucht<br />
Ersatzbefriedigung.<br />
7. These<br />
Suchtprävention lässt s<strong>ich</strong> n<strong>ich</strong>t durch eine einmalige Aktion erre<strong>ich</strong>en, sie ist ein<br />
langfristiges Bemühen. Suchtprävention soll erlebbar und mit den Betroffenen<br />
gemeinsam gestaltet werden. Sie ist auf Dauer angelegt. (Sporadische Aktivitäten<br />
o<strong>der</strong> bloße Appelle sind ungenügend.)<br />
Gerald Koller fasst die Aufgaben <strong>der</strong> Suchtvorbeugung folgen<strong>der</strong>maßen zusammen<br />
129 , die <strong>ich</strong> vor allem um kulturelle Maßnahmen erweitern möchte (kursiv):<br />
Allgemeine<br />
Gesundheitsför<strong>der</strong>ung<br />
Prävention von<br />
Suchtverhalten<br />
Prävention von<br />
Suchtmittelmissbrauch<br />
Individuelle<br />
Maßnahmen<br />
Selbstwertstärkung,<br />
soziale Kompetenzen,<br />
Solidarität<br />
Spezielle Konfliktkompetenzen<br />
(Gruppendruck),<br />
Ausbau <strong>der</strong> persönl<strong>ich</strong>en<br />
Genusskultur<br />
Information,<br />
Gespräch über<br />
Suchterfahrung<br />
Strukturelle<br />
Maßnahmen<br />
Schaffung lebensfreundl<strong>ich</strong>er<br />
Rahmenbedingungen<br />
(Arbeit,<br />
Wohnen, Umwelt)<br />
Zusammenhänge<br />
Sucht – Leistung<br />
Sucht – Tourismus<br />
klären<br />
Suchtmittelgesetz<br />
Jugendschutzgesetz<br />
Kulturelle<br />
Maßnahmen<br />
Respekt, Sympathie,<br />
Kreativität,<br />
Gewaltlosigkeit<br />
Zusammenhänge<br />
Sucht – Konsum/<br />
Kapitalismus<br />
Sucht – Hybris<br />
klären<br />
Rituale, Traditionen<br />
beleben, Genusskultur,<br />
keine Glorifizierung<br />
u. Transfer<br />
Zusammenfassung:<br />
Heute versteht s<strong>ich</strong> die Suchtprävention als „stoffl<strong>ich</strong> ungebundene“ Sammlung<br />
von Methoden zur Gesundheitsför<strong>der</strong>ung auf individueller, sozialer uns staatl<strong>ich</strong>er<br />
Ebene. Selbstwertstärkung, kreative Konfliktbewältigung, Stressbewältigung, aktives<br />
(Mit)Gestalten, positives Familien- und Arbeits-(Schul-, Kin<strong>der</strong>garten-)klima,<br />
Therapie statt Strafe, sind nur einige Ziele und Schlagwörter in diesem Zusammenhang.<br />
Die tendenzielle Aufklärung wurde durch Information ersetzt, die meist<br />
129 Was ihr wollt. Suchtprävention und <strong>Theater</strong>; Dokumentation einer Fachtagung; hrsg. von Aktion<br />
Jugendschutz, Landesarbeitsstelle Baden-Würtemberg, 1999, S. 19<br />
82
sogar nur mehr auf Wunsch weitergegeben wird. Letztendl<strong>ich</strong> bedeuten diese<br />
Herangehensweisen eine Reduktion direkter, struktureller und kultureller Gewalt,<br />
indem sie Gewaltlosigkeit s<strong>ich</strong> selbst und an<strong>der</strong>en gegenüber als wesentl<strong>ich</strong>en<br />
Schutzfaktor vor Suchtentstehung begreifen, Sympathie für und Respekt vor s<strong>ich</strong><br />
und an<strong>der</strong>en <strong>der</strong> Ausgrenzung und innerer Emigration vorziehen und (s<strong>ich</strong>) für<br />
Lebensfreude und Genuss stark machen. Es geht hierbei im Beson<strong>der</strong>en um die<br />
Verbesserung <strong>der</strong> Lebensqualität und ein Vorschlag dafür lautet:<br />
„Wir spielen selbst, treiben Sport, machen Musik, statt uns das alles<br />
immer nur anzusehen und anzuhören.“ 130<br />
In diesem Sinne müsste <strong>ich</strong> nur noch hinzufügen: Spielen wir <strong>Theater</strong>!<br />
130 Leben hat viele Ges<strong>ich</strong>ter Sucht hat viele Ursachen, hrsg. von SFA – ISPA Schweizerische Fachstelle für<br />
Alkohol- und an<strong>der</strong>e Drogenprobleme, Zür<strong>ich</strong>, 1997, S. 21<br />
83
8.1 Suchtprävention und <strong>Theater</strong>pädagogik 131<br />
Durch den weitgefassten Ansatz <strong>der</strong> Suchtprävention als Bündel von gesundheitsför<strong>der</strong>nden<br />
Maßnahmen, die vor allem das eigene und das Wohlbefinden in <strong>der</strong><br />
Gruppe (Familie, Klasse, Freundeskreis, ...) steigern wollen, sucht man dabei<br />
immer wie<strong>der</strong> nach neuen, kreativen Mögl<strong>ich</strong>keiten, an das Thema Sucht heranzugehen.<br />
Bei dieser Suche musste die Suchtprävention zwangsläufig Bekanntschaft<br />
mit dem <strong>Theater</strong> und <strong>der</strong> <strong>Theater</strong>pädagogik machen. Der schier unendl<strong>ich</strong>e<br />
Re<strong>ich</strong>tum des <strong>Theater</strong>s mit all seinen Facetten bietet <strong>der</strong> Suchtprävention eine<br />
kreative, lustvolle, lebensbejahende Herangehensweise an ihre Inhalte, Anliegen<br />
und Ziele. In den letzen Jahren hat s<strong>ich</strong> dadurch eine Fülle an Kooperationen<br />
zwischen <strong>der</strong> Suchtprävention und <strong>Theater</strong>schaffenden aus allen Bere<strong>ich</strong>en entwickelt.<br />
Beispiele aus Deutschland, <strong>der</strong> Schweiz und Österre<strong>ich</strong> re<strong>ich</strong>en vom<br />
Figurentheater, dem Tanztheater übers Rollenspiel bis zu konventionellen Produktionen.<br />
Was macht das <strong>Theater</strong> beson<strong>der</strong>s geeignet für die Verwendung in <strong>der</strong> Suchtprävention?<br />
Zunächst einmal gehe <strong>ich</strong> davon aus, dass <strong>Theater</strong> hier nur aktiv verstanden<br />
wird, es also wie alle an<strong>der</strong>en Aktivitäten schon allein aus diesem Grund<br />
einen präventiven Charakter aufweist. Zudem steht für m<strong>ich</strong> <strong>der</strong> gemeinschaftl<strong>ich</strong>e<br />
Aspekt mit viel Freude und Lust am Spiel im Vor<strong>der</strong>grund, <strong>der</strong> allen die Chance<br />
bietet, Kreativität und Talente zu entwickeln. Dabei sollte auf ein ausgewogenes<br />
Verhältnis, ohne Stars und „stumme Diener“, geachtet werden. Es geht im <strong>Theater</strong><br />
n<strong>ich</strong>t darum, s<strong>ich</strong> zu produzieren! Es wäre fatal, an dieser Stelle Leistungs- und<br />
Erwartungsdruck zu wie<strong>der</strong>holen. Von wesentl<strong>ich</strong>er Bedeutung bei jedem <strong>Theater</strong><br />
ist die Aufführung, die es erlaubt, Geleistetes zu präsentieren und dafür Anerkennung<br />
und Lob zu bekommen. Vor an<strong>der</strong>en aufzutreten, erzeugt Selbstwert, Selbsts<strong>ich</strong>erheit<br />
und ein gutes Gefühl.<br />
131 Dieses und folgende Kapitel enthalten Teile eines Artikels, <strong>der</strong> von mir in <strong>der</strong> Zeitschrift „erziehung heute“<br />
veröffentl<strong>ich</strong>t wurde. <strong>Staffler</strong>, <strong>Armin</strong>: Suchtprävention und <strong>Theater</strong>pädagogik in: erziehung heute, hrsg. v.<br />
Tiroler Bildungspoltische Arbeitsgemeinschaft, Innsbruck, Heft 4, 2000, S. 29 ff.<br />
84
Wenn jemand in eine an<strong>der</strong>e Rolle schlüpft, beginnt er s<strong>ich</strong> mit ihr zu identifizieren<br />
und das bedeutet im Grunde n<strong>ich</strong>ts an<strong>der</strong>es als ein <strong>Wie</strong><strong>der</strong>erkennen<br />
eigener Anteile in <strong>der</strong> Rolle. Es wird dadurch mögl<strong>ich</strong>, an<strong>der</strong>e zu erleben und<br />
dabei beson<strong>der</strong>e Erfahrungen zu machen, Gefühle zu entdecken und zu entwickeln<br />
und dabei viel über s<strong>ich</strong> selbst zu lernen. Es ist kein „so tun als ob“,<br />
son<strong>der</strong>n ein „so sein wie“, das intensives und lang anhaltendes Begreifen von<br />
Situationen, Verhältnissen, Beziehungen und Bedingungen bewirkt, eben weil<br />
alles greif-bar wird. Etwas zu begreifen, macht Mut und stärkt das Vertrauen in<br />
s<strong>ich</strong> und an<strong>der</strong>e. Daraus entsteht ein immer größer werdendes Repertoire an<br />
Haltungsmögl<strong>ich</strong>keiten aus dem s<strong>ich</strong> sowohl in <strong>der</strong> Realität des <strong>Theater</strong>s als auch<br />
in <strong>der</strong> Realität des Alltags schöpfen lässt.<br />
Durch das Aufgabenfeld von kontakt+co – Suchtpräventionsstelle im Jugendrotkreuz<br />
und meinen Ausbildungsstand konzentriert s<strong>ich</strong> unsere Arbeit auf die<br />
Primär- und Sekundärprävention und dort hauptsächl<strong>ich</strong> auf die Methoden<br />
Augusto Boals. Beispiele zeigen aber, dass selbst gespieltes <strong>Theater</strong> in all seinen<br />
Formen und ebenso in <strong>der</strong> Tertiärprävention 132 erfolgre<strong>ich</strong> anwendbar ist.<br />
132 Gruber, Karin / Schaller, Angelika: Drogenarbeit und Forumtheater in: Wrentschur, M<strong>ich</strong>ael / ARGE<br />
Forumtheater Österre<strong>ich</strong> (Hg): Forum <strong>Theater</strong> Österre<strong>ich</strong>. a.a.O., 1999, S. 27-29 und<br />
Was ihr wollt. Suchtprävention und <strong>Theater</strong>; Dokumentation einer Fachtagung; hrsg. von Aktion Jugendschutz,<br />
Landesarbeitsstelle Baden-Würtemberg, 1999, S. 10 u. S. 28ff u. S. 51<br />
85
8.2 Exkurs: Qualitätskriterien für präventive <strong>Theater</strong>arbeit 133<br />
<strong>Theater</strong> ist Kunst und entzieht s<strong>ich</strong> somit berechtigt pädagogischen Konzepten und<br />
Kriterien. Wird es jedoch theaterpädagogisch o<strong>der</strong> künstlerisch in pädagogischen<br />
Settings zur Erre<strong>ich</strong>ung präventiver Ziele eingesetzt, so müssen präventive und<br />
strukturelle Kriterien wie für alle Präventionsmaßnahmen gelten. Diese Kriterien<br />
sind:<br />
1. Einsatz altersgemäßer Inhalte, Methoden und Präsentationstechniken, die<br />
s<strong>ich</strong> mögl<strong>ich</strong>st aus <strong>der</strong> aktuellen Lebenssituation <strong>der</strong> Zielgruppe ergeben.<br />
2. Bei produktorientierter <strong>Theater</strong>arbeit (Aufführungen) ist auf das stimmige<br />
Verhältnis von Innenwirkung und beabs<strong>ich</strong>tigter Außenwirkung zu achten.<br />
3. Die Befindl<strong>ich</strong>keit aller Projektbeteiligten sollte während des gesamten Prozesses,<br />
auch nach Projektende, im Mittelpunkt stehen.<br />
4. Auf n<strong>ich</strong>tintendierte Wirkungen ist zu achten. Bereits in <strong>der</strong> Vorbereitung<br />
sollten mögl<strong>ich</strong>e n<strong>ich</strong>t geplante Problementwicklungen ins Kalkül gezogen<br />
werden und ein Setting geschaffen werden, in dem diese aufgefangen<br />
werden können:<br />
• Balance von kreativer und pädagogischer Arbeit;<br />
• Schutz <strong>der</strong> Intimsphäre (beim Thematisieren persönl<strong>ich</strong>er Problembere<strong>ich</strong>e<br />
z.B. durch die Arbeit mit Symbolen);<br />
• Entwicklung humorvoller Distanz, gerade auch durch die Projektleitung<br />
(Einsatz von Verfremdungstechniken);<br />
• Relativierung des pädagogischen o<strong>der</strong> künstlerischen Leistungsdrucks<br />
während des gesamten Projekts;<br />
5. <strong>Theater</strong>arbeit, die den Anspruch auf qualitative präventive Wirkung erhebt,<br />
muss die aktuell außer Streit stehenden präventiven Erkenntnisse in ihre<br />
Arbeit integrieren, insbeson<strong>der</strong>e sind dies:<br />
133 Erarbeitet wurden diese Qualitätskriterien von einer Gruppe von TeilnehmerInnen an <strong>der</strong> "Österre<strong>ich</strong>ischen<br />
Woche <strong>der</strong> Prävention" 1999 im Fachseminar „Bitte vor den Vorhang – Reflexionsseminar zur präventiven<br />
<strong>Theater</strong>arbeit“ des Österre<strong>ich</strong>ischen Bildungsforums zu dieser Tagung vom 29.-31. März 2000 in<br />
Salzburg/Elsbethen. in: praev.doc, Ber<strong>ich</strong>te des österre<strong>ich</strong>ischen Bildungsforums für för<strong>der</strong>nde und präventive<br />
Jugendarbeit, 2/2000, S. 24<br />
86
• die Nachbereitung bzw. Aufbereitung von Präsentationen mit dem Publikum;<br />
• Entwicklung nachhaltiger Umsetzungsmögl<strong>ich</strong>keiten des Erlebten (För<strong>der</strong>ung<br />
von Sinneswahrnehmung, des Gefühlsausdrucks, <strong>der</strong> sozialen Kompetenz<br />
und Achtsamkeit im Umgang mit persönl<strong>ich</strong>en Entwicklungsprozessen); Diese<br />
Arbeit ist von Pädagogen zu leisten, die mit <strong>der</strong> Zielgruppe – auch dem<br />
Publikum von präventiven <strong>Theater</strong>aufführungen – in dauerhaftem Kontakt<br />
stehen (LehrerInnen, JugendarbeiterInnen).<br />
• Ziel aller präventiven Maßnahmen ist die Steigerung <strong>der</strong> Lebensqualität<br />
durch die Entwicklung eines genussvollen Lebensstils.<br />
6. Entstehen im Rahmen eines präventiven Projekts Konflikte zwischen TeilnehmerInnen,<br />
so ist Vors<strong>ich</strong>t vor überschnellem Eingreifen geboten, um n<strong>ich</strong>t<br />
die Eigenbetroffenheit <strong>der</strong> ProjektleiterInnen auf Jugendl<strong>ich</strong>e zu projizieren<br />
und diesen Autonomiemögl<strong>ich</strong>keit zu nehmen. Es ist jedoch ein Setting zu<br />
schaffen, in dem die TeilnehmerInnen ihre Befindl<strong>ich</strong>keit äußern können (z.B.<br />
Stopp-Regeln).<br />
7. Das pädagogische Umfeld <strong>der</strong> Zielgruppe (LehrerInnen, JugendarbeiterInnen)<br />
ist durch eine Einführung in das Projekt einzubinden, um die konstruktive<br />
Begleitung zu gewährleisten.<br />
8. Durch langfristig angelegte Projekte wird Evaluation und Erfahrungsbildung<br />
aller Beteiligten erle<strong>ich</strong>tert und Qualitätsverbesserung kann direkt im Projektverlauf<br />
entstehen.<br />
9. <strong>Theater</strong> gibt keine Antworten, son<strong>der</strong>n stellt Fragen. Es bietet somit einen<br />
offenen Rahmen, <strong>der</strong> zu persönl<strong>ich</strong>er und gemeinsamer Auseinan<strong>der</strong>setzung<br />
anregt und neue S<strong>ich</strong>tweisen eröffnet. Somit sollten individuell differente<br />
Interpretationsmögl<strong>ich</strong>keiten zugelassen werden.<br />
10. <strong>Theater</strong> kann zuspitzen und aufwühlen – soll aber n<strong>ich</strong>t therapeutisieren,<br />
son<strong>der</strong>n Prozesse s<strong>ich</strong>tbar machen. Vor Beginn einer konkreten <strong>Theater</strong>arbeit<br />
mit Jugendl<strong>ich</strong>en ist es daher von größter Bedeutung, den gegebenen Zeitrahmen<br />
zu bedenken und aus diesem die Intensität <strong>der</strong> <strong>Theater</strong>arbeit abzuleiten.<br />
11. Der Prozess <strong>der</strong> präventiven <strong>Theater</strong>arbeit ist ein Wechselspiel aus kreativem<br />
Fluss und mit klarer Aufgabenverteilung. Danach kann künstlerische kreative<br />
Arbeit und <strong>der</strong> Zauber <strong>der</strong> Bühne s<strong>ich</strong> entwickeln. Damit diese unmittelbare<br />
87
Erfahrung zu einer nachhaltigen Erkenntnis organisatorischer Struktur: Der<br />
künstlerischen Vision folgt die Entwicklung eines Rahmenplans führen kann,<br />
braucht es Dokumentation von Seiten <strong>der</strong> Projektleitung, Rückmeldungen<br />
durch das Publikum und Reflexion <strong>der</strong> SpielerInnen.<br />
12. Die Bühne schafft für jene, die auf ihr stehen, Führung: Im Spiel handeln wir<br />
wirkl<strong>ich</strong>er und bewusster als im Alltag.<br />
13. <strong>Theater</strong> ist immer Arbeit mit Teilpersönl<strong>ich</strong>keiten und -wirkl<strong>ich</strong>keiten und<br />
bedarf eines verantwortl<strong>ich</strong>en Umgangs mit ihnen.<br />
14. Präventive <strong>Theater</strong>arbeit versteht s<strong>ich</strong> n<strong>ich</strong>t als Integrationsmaßnahme im<br />
Sinne einer Vereinnahmung von Menschen, son<strong>der</strong>n als Mögl<strong>ich</strong>keit zur<br />
Interaktion von gle<strong>ich</strong>berechtigten Partnern.<br />
88
9 Was hat das <strong>Theater</strong> <strong>der</strong> <strong>Unterdrückten</strong> mit<br />
Suchtprävention zu tun?<br />
Unterdrückung hat auch immer mit Druck zu tun, das heißt, es gilt für die Beteiligten<br />
den jeweiligen Druck unter dem sie stehen, sei es Gruppendruck, Leistungsdruck,<br />
Erwartungsdruck, Konsumdruck o<strong>der</strong> ein an<strong>der</strong>er, herauszufinden, zu benennen,<br />
darzustellen und ausgehend von konkreter eigener Erfahrung zu einem<br />
gemeinsamen Nenner zu finden, mit und an dem gearbeitet und gespielt werden<br />
kann. Der Blick des und auf den Einzelnen wird auf eine allgemeine Ebene erweitert<br />
und ausgeweitet.<br />
„Die kleinsten Zellen <strong>der</strong> Gesellschaft (...) und ebenso die kleinsten<br />
Ereignisse in unserem sozialen Leben (...) beinhalten alle<br />
moralischen und politischen Werte <strong>der</strong> Gesellschaft, all ihre<br />
Strukturen von Herrschaft, Macht und Unterdrückung.“ 134<br />
Bei Suchtprävention und TO handelt es s<strong>ich</strong> eben n<strong>ich</strong>t um eine individualistische<br />
Angelegenheiten, die strukturelle und gesellschaftl<strong>ich</strong>e Ebene wird immer berücks<strong>ich</strong>tigt.<br />
Das TO lässt niemanden allein, denn es ist n<strong>ich</strong>t (nur) sein/ihr Problem.<br />
Alleine kann auch n<strong>ich</strong>t <strong>Theater</strong> gespielt werden! Vor allem aber lässt es niemanden<br />
in <strong>der</strong> Rolle des Zuschauers und unterscheidet s<strong>ich</strong> dadurch immens von den<br />
übrigen und übl<strong>ich</strong>en Formen des <strong>Theater</strong>s.<br />
In <strong>der</strong> bereits zitierten Fachtagung <strong>zum</strong> Thema Suchtprävention und <strong>Theater</strong><br />
wurden verschiedene Formen <strong>der</strong> Beteiligung an einem Stück vorgeschlagen und<br />
ausprobiert: Vorbereitungen, Nachbereitungen, Diskussionen. Ein/e TeilnehmerIn<br />
brachte als Kritik ein, dass die Einbeziehung des Publikums entwe<strong>der</strong> ganz o<strong>der</strong><br />
134 Boal, Augusto: Der Regenbogen <strong>der</strong> Wünsche. a.a.O., 1999, S. 47. Den Vorgang, dass diese Werte und<br />
Strukturen auf gewaltsamen Weise bis in die kleinsten Einheiten, bis ins Private eindringen, nennt Boal<br />
„Osmose“<br />
89
gar n<strong>ich</strong>t erfolgen solle 135 , und Volker Ludwig 136 sagte in seinem Vortrag: „Nur ein<br />
einziges Mal ein <strong>Theater</strong>stück sehen, das bewirkt eigentl<strong>ich</strong> gar n<strong>ich</strong>ts.“ 137 Beide<br />
haben Recht. Die Einbeziehung soll ganz erfolgen und ein einziges Mal spielen<br />
brächte weit mehr. Des Weiteren wurde als wesentl<strong>ich</strong>es Kriterium für den suchtpräventiven<br />
Charakter <strong>der</strong> Stücke <strong>der</strong> Grad <strong>der</strong> Identifikation <strong>der</strong> SchülerInnen im<br />
Publikum heran gezogen und gle<strong>ich</strong>zeitig bemängelt. Am höchsten ist <strong>der</strong> Grad<br />
<strong>der</strong> Identifikation doch wohl, wenn <strong>ich</strong> selbst spiele!<br />
Das TO bietet keine fertigen Produkte o<strong>der</strong> Patentrezepte an. Es versteht s<strong>ich</strong> als<br />
Alternative zu je<strong>der</strong> Art von Konsum. Konsum zielt rein auf die Befriedigung von<br />
Bedürfnissen ab. Das <strong>Theater</strong> <strong>der</strong> <strong>Unterdrückten</strong> orientiert s<strong>ich</strong> n<strong>ich</strong>t an <strong>der</strong> Befriedigung<br />
von Bedürfnissen, son<strong>der</strong>n glaubt an die Erfüllung von Wünschen, an<br />
wahr gewordene Hoffnungen und Träume und die Fähigkeit aller, selbst etwas<br />
dazu beizutragen. Die gemachten Erfahrungen beinhalten auch immer ein Lernen<br />
über s<strong>ich</strong> selbst, über die eigenen Stärken und Schwächen und hilft Wünsche,<br />
Hoffnungen und Träume zu entdecken. Auch hier trifft das TO den Punkt <strong>der</strong><br />
Suchtprävention, wenn es darum geht, Stärken zu stärken, Schwächen zu<br />
schwächen und s<strong>ich</strong> selbst auszuprobieren und sein Leben zu gestalten. Das TO<br />
baut auf die kreativen Mögl<strong>ich</strong>keiten jedes Menschen, die Mögl<strong>ich</strong>keit aktiv zu<br />
werden und zu verän<strong>der</strong>n. Konsum, Sucht und Abhängigkeit legen Kräfte lahm,<br />
die wir zur Verän<strong>der</strong>ung brauchen. Das TO kann den Mut und die Kraft neu<br />
mobilisieren, es kann nie knapp werden, nie zu wenig geben, da es nie konsumiert,<br />
son<strong>der</strong>n nur selbst gespielt werden kann. Es ist ein <strong>Theater</strong> ohne Passivität,<br />
niemand bleibt unbeteiligt.<br />
Das TO spielt nie mit erhobenem Zeigefinger, behauptet we<strong>der</strong> die Ursachen noch<br />
die Wirkungen und schon gar n<strong>ich</strong>t die Lösungen zu kennen und sieht seine<br />
Aufgabe n<strong>ich</strong>t in <strong>der</strong> Vermittlung einer wie auch immer gearteten, vorgegebenen<br />
Botschaft. Je<strong>der</strong> erhält den Respekt und die Anerkennung, Experte für ihn betref-<br />
135 Was ihr wollt. Suchtprävention und <strong>Theater</strong>; Dokumentation einer Fachtagung; hrsg. von Aktion<br />
Jugendschutz, Landesarbeitsstelle Baden-Würtemberg, 1999, S. 45<br />
136 Leiter des GRIPS <strong>Theater</strong>s in Berlin. www.grips-theater.de<br />
137 Was ihr wollt. Suchtprävention und <strong>Theater</strong>; Dokumentation einer Fachtagung; hrsg. von Aktion<br />
Jugendschutz, Landesarbeitsstelle Baden-Würtemberg, 1999, S. 27<br />
90
fende Angelegenheiten zu sein. Die Jugendl<strong>ich</strong>en sehen s<strong>ich</strong> selbst auf <strong>der</strong> Bühne<br />
und n<strong>ich</strong>t jemanden mit moralischem Zeigefinger, was den Handlungen und<br />
Worten viel mehr Gew<strong>ich</strong>t verleiht. Die Wirkl<strong>ich</strong>keit des <strong>Theater</strong>s liegt ganz nahe<br />
an <strong>der</strong> Realität des Alltags, wodurch ein beinahe ungehin<strong>der</strong>ter Austausch, ein<br />
Fließgle<strong>ich</strong>gew<strong>ich</strong>t durch Diffusion, zwischen ihnen entsteht. Durch das Phänomen<br />
<strong>der</strong> Metaxis 138 wirken gemachte Erfahrungen, Einstellungen, Emotionen und<br />
Haltungen in beiden Wirkl<strong>ich</strong>keiten.<br />
Realität des Bildes<br />
Emotionen<br />
Erfahrungen<br />
Einstellungen<br />
Haltungen<br />
Realität des Alltags<br />
Einstellungen<br />
Emotionen<br />
Haltungen<br />
Erfahrungen<br />
Auf diese Weise können auch Strategien im Umgang mit Suchtmitteln und Verhaltensweisen<br />
übertragen werden.<br />
Das Spiel und die Arbeit orientieren s<strong>ich</strong> immer an den Ressourcen, n<strong>ich</strong>t an den<br />
Defiziten <strong>der</strong> SpielerInnen und an den Potentialen, n<strong>ich</strong>t den Risken <strong>der</strong><br />
Situationen und Strukturen, 139 so wie s<strong>ich</strong> die Suchtprävention n<strong>ich</strong>t an den<br />
Risiken, Problemfällen und Gefahren orientiert.<br />
Es kann und darf n<strong>ich</strong>t die Aufgabe des TO o<strong>der</strong> dessen Initiators und Anleiters<br />
sein, Gewalt über die Definition <strong>der</strong> Unterdrückung, die Diagnose und die<br />
Therapie auszuüben. Es spielt, wer Lust hat, wer will, wer wünscht, wer möchte!<br />
Die Spieler sind keine Konsumenten <strong>der</strong> Methode. 140 Immer wie<strong>der</strong> wird bei<br />
kontakt+co angefragt, ob n<strong>ich</strong>t ein Experte <strong>zum</strong> Thema ausgeliehen werden<br />
könne, <strong>der</strong> den SchülerInnen erklärt, was und wie gefährl<strong>ich</strong> Sucht sei. Jemand,<br />
<strong>der</strong> ihnen sagt, wie schädl<strong>ich</strong> ihr Verhalten sei, <strong>der</strong> ihre Probleme kennt, <strong>der</strong> ihnen<br />
aber auch sagt, was sie dagegen tun könnten, am besten in 2 Stunden. Dabei<br />
138 vgl. Kap 6.5 Forumtheater, 6.5.2 Aufführungsphase, Von <strong>der</strong> Empathie zur Sympathie<br />
139 vgl. Meixner, Margarete: Forumtheater in <strong>der</strong> Suchtprävention. in Wrentschur, M<strong>ich</strong>ael / ARGE<br />
Forumtheater Österre<strong>ich</strong> (Hg): Forum <strong>Theater</strong> Österre<strong>ich</strong>. a.a.O., 1999, S. 23 und<br />
Gruber, Karin / Schaller, Angelika: Drogenarbeit und Forumtheater. ebd.: S. 27<br />
140 Vor dieser Gefahr soll ausdrückl<strong>ich</strong> gewarnt werden! vgl. Ill<strong>ich</strong>, Ivan: Genus. a.a.O., 1983, S.51f und 187f<br />
91
läge allein in <strong>der</strong> Fragestellung: Was können wir als Klasse gemeinsam zu diesem<br />
Thema unternehmen? genug suchtpräventives Potential. Auch Suchtprävention<br />
kann n<strong>ich</strong>t konsumiert werden. TO und Suchtprävention liegen in <strong>der</strong> Hand und<br />
Verantwortung <strong>der</strong> Betroffenen.<br />
Für den Leiter/Joker einer TO-Gruppe <strong>zum</strong> Thema Suchtprävention ist es zwar von<br />
Vorteil, aber n<strong>ich</strong>t unbedingt notwendig, auf diesem Gebiet Experte zu sein.<br />
Meiner Erfahrung nach interessieren s<strong>ich</strong> Jugendl<strong>ich</strong>e wenig für wissenschaftl<strong>ich</strong>e<br />
Details, eher noch für das eigene Konsumverhalten und dann ist Offenheit<br />
angesagt.<br />
92
9.1 Methodenwahl<br />
Je nach Gruppe, Zeitrahmen und Thema eignen s<strong>ich</strong> unterschiedl<strong>ich</strong>e Methoden<br />
des TO. Das <strong>Theater</strong> <strong>der</strong> <strong>Unterdrückten</strong> versteht s<strong>ich</strong> als poetische Technik im<br />
Sinne von Werkzeug, Handwerk, Kunstfertigkeit und Kunst, das mit unterschiedl<strong>ich</strong>en<br />
Hebeln an verschiedensten Punkten ansetzt.<br />
“Je nach gewählter Methode steht <strong>der</strong> persönl<strong>ich</strong>e Konflikt des<br />
Protagonisten o<strong>der</strong> die Auslotung <strong>der</strong> sozialen Relevanz eines<br />
Problems im Vor<strong>der</strong>grund. Immer aber sollen die s<strong>ich</strong>tbar gewordenen,<br />
individuellen Ausgangspunkte aus <strong>der</strong> Perspektive <strong>der</strong><br />
gemeinsamen Erfahrung aller beleuchtet werden.” 141<br />
interspektive Methoden: 142<br />
Statuentheater, Zeitungstheater, Uns<strong>ich</strong>tbares <strong>Theater</strong>, Forumtheater, Legislatives<br />
<strong>Theater</strong>.<br />
Diese Formen eignen s<strong>ich</strong> für öffentl<strong>ich</strong>e Aufführungen, um einen erre<strong>ich</strong>ten Punkt<br />
im Prozess darzustellen und zu präsentieren. Es gibt deshalb auch kein Endprodukt<br />
zu sehen, son<strong>der</strong>n alle Anwesenden werden auf unterschiedl<strong>ich</strong>e Art und Weise in<br />
den Prozess miteinbezogen und verän<strong>der</strong>n dadurch den Fortlauf. Der<br />
Themenbezug erfolgt zwar über die konkrete Erfahrung eines Einzelnen, muss<br />
aber in seiner Konsequenz für die Gruppe/Gemeinschaft direkt o<strong>der</strong> analog nachvollziehbar<br />
sein. (z.B.: Gruppendruck, <strong>der</strong> <strong>zum</strong> Alkoholkonsum verleitet verläuft<br />
analog <strong>zum</strong> Gruppendruck bei Zigarettenkonsum) Meine Erfahrungen mit<br />
Zeitungstheater und Forumtheater werde <strong>ich</strong> in den folgenden Kapiteln schil<strong>der</strong>n.<br />
Interessant erschienen mir Projekte <strong>zum</strong> Thema „Alkohol im öffentl<strong>ich</strong>en Raum“<br />
mit Hilfe des Uns<strong>ich</strong>tbaren <strong>Theater</strong>s o<strong>der</strong> Szenen, die das Suchtmittel- o<strong>der</strong><br />
Jugendschutzgesetz behandeln, um Legislatives <strong>Theater</strong> zu machen.<br />
141 Weintz, Jürgen in: Boal, Augusto: Der Regenbogen <strong>der</strong> Wünsche. a.a.O., 1999, S. 10<br />
142 vgl. Kap. 6.2 bis 6.6<br />
93
introspektive und prospektive (untersuchende) Methoden: 143<br />
Regenbogen <strong>der</strong> Wünsche, Polizist im Kopf und an<strong>der</strong>e.<br />
Diese Methoden konzentrieren s<strong>ich</strong> auf die Persönl<strong>ich</strong>keit eines Einzelnen und sein<br />
Verhältnis zur Außenwelt. Die Gruppe/Gemeinschaft erklärt s<strong>ich</strong> für eine bestimmte<br />
Zeit und Situation bereit, s<strong>ich</strong> auf die Hauptperson mit Sympathie einzulassen,<br />
mit ihr und für sie zu spielen. Der Schritt nach außen erscheint n<strong>ich</strong>t sinnvoll.<br />
Innerhalb <strong>der</strong> Gruppe erfolgen allerdings eine Aufführung und ein Schritt auf<br />
eine gemeinsame kommunizierbare Ebene. Mit diesen Methoden habe <strong>ich</strong> im<br />
Bere<strong>ich</strong> <strong>der</strong> Suchtprävention noch keine Erfahrungen.<br />
An dieser Stelle noch einmal <strong>der</strong> Hinweis: Da keine Methode dogmatisch zu<br />
verstehen ist, können sie flexibel angewandt, miteinan<strong>der</strong> kombiniert o<strong>der</strong><br />
adaptiert werden. So wie das TO zur Verän<strong>der</strong>ung beiträgt, so durchläuft es auch<br />
selbst einen ständigen Wandel.<br />
143 vgl. Kap. 6.7<br />
94
9.2 Zeitungstheater in <strong>der</strong> Suchtprävention 144<br />
Vieles präsentiert s<strong>ich</strong> vor allem Jugendl<strong>ich</strong>en als unabän<strong>der</strong>bare Tatsache und als<br />
von ihnen n<strong>ich</strong>t beeinflussbar. Gerade die Welt des Journalismus und <strong>der</strong> Zeitungen<br />
überflutet uns mit scheinbar objektiven Informationen o<strong>der</strong> Meldungen, die<br />
eine eigene Stellungnahme dazu als n<strong>ich</strong>t mögl<strong>ich</strong> erscheinen lassen. Weil es s<strong>ich</strong><br />
beim Medium Zeitung um eine Einbahnstraße handelt (abgesehen von <strong>der</strong> stark<br />
begrenzten Mögl<strong>ich</strong>keit eines Leserbriefes), kommt die kritische Auseinan<strong>der</strong>setzung,<br />
die Hinterfragung, die Frage nach dem eigenen Bezug <strong>zum</strong> Geschriebenen<br />
zu kurz. Dabei ginge es gerade darum, selbst Stellung zu beziehen, einen<br />
Dialog in Gang zu setzen und n<strong>ich</strong>t alles Dargebotene einfach hinzunehmen.<br />
Im konkreten Fall einer themenorientierten Arbeit stellt s<strong>ich</strong> die Frage nach dem<br />
eigenen Verhältnis gegenüber Suchtverhalten, Abhängigkeiten, stoffl<strong>ich</strong>en und<br />
n<strong>ich</strong>tstoffl<strong>ich</strong>en Süchten, damit verbundenen Konflikten und Problemen und dem<br />
Umgang mit diesen Themen in den Medien. Durch die Arbeit und das Spiel in <strong>der</strong><br />
Gruppe bleibt die Frage jedoch n<strong>ich</strong>t am Einzelnen hängen, son<strong>der</strong>n wird als<br />
breitere, gesellschaftl<strong>ich</strong>e Problematik aufgezeigt. Gerade in Zeitungen werden<br />
die unterschiedl<strong>ich</strong>sten Meldungen und Meinungen <strong>zum</strong> Thema Sucht transportiert<br />
und je nach Tendenz <strong>der</strong> Zeitung unterschiedl<strong>ich</strong> bewertet: Ber<strong>ich</strong>te über Alkoholkonsum<br />
und Unfälle und Gewalttaten unter Alkoholeinfluss, Ber<strong>ich</strong>te über spektakuläre<br />
Rauschgiftfunde, Stellungnahmen von Politikern zu Fragen <strong>der</strong> Liberalisierung<br />
und des Alkoholkonsums im öffentl<strong>ich</strong>en Raum sowie Statistiken zu Drogentoten.<br />
Das Zeitungstheater bietet die Mögl<strong>ich</strong>keit eines kreativen, schöpferischen,<br />
lustigen und lustvollen Umgangs mit <strong>der</strong> Thematik und dadurch eine Alternative<br />
<strong>zum</strong> passiven Konsum <strong>der</strong> Medienlandschaft, <strong>der</strong> auch für den Alltag verän<strong>der</strong>te<br />
Lesegewohnheiten nach s<strong>ich</strong> zieht. Es kann sowohl ein persönl<strong>ich</strong>er Bezug zu den<br />
bearbeiteten Zeitungsausschnitten, als auch ein gesellschaftl<strong>ich</strong>er Zusammenhang<br />
<strong>der</strong> Thematik entdeckt werden.<br />
144 kontakt+co – Suchtprävention im Jugendrotkreuz entwickelte gemeinsam mit mir ein Konzept für den<br />
Einsatz von Zeitungstheater in <strong>der</strong> Suchtprävention an Tiroler Berufsschulen.<br />
95
9.2.1 Workshopmodell 145<br />
Rahmenbedingungen:<br />
Gruppengröße:<br />
Raum:<br />
Materialien:<br />
Zeit:<br />
von 10 bis 15 Jugendl<strong>ich</strong>en<br />
von ausre<strong>ich</strong>en<strong>der</strong> Größe, wenn mögl<strong>ich</strong> mehrere<br />
Räume zur Gruppenteilung<br />
Zeitungen verschiedener Ausr<strong>ich</strong>tung (Regenbogen-,<br />
Tages-, Wochen-, Partei-, Boulevardpresse, Zeitschriften,<br />
usw.); Alles, das mögl<strong>ich</strong>erweise als Requisit<br />
dienen könnte, Klei<strong>der</strong>, Instrumente, ...<br />
min. 4 Unterr<strong>ich</strong>tsstunden<br />
Ziel:<br />
Mit Hilfe des eigenen kreativen Potentials und den Vorgaben <strong>der</strong> Zeitungen entsteht<br />
ein Dialog mit dem ansonsten als Monolog konzipierten Medium Zeitung. Der<br />
scheinbar objektive Charakter und die manipulierenden Mechanismen des Journalismus<br />
sollen hinterfragt und bewusst gemacht werden. Mit Hilfe des <strong>Theater</strong>s<br />
werden sowohl die individuellen, als auch die sozialen Komponenten im Verhältnis<br />
zwischen Zeitung und Leser neu gemischt. Durch spontane und theatralische<br />
Reflexion des Textes entsteht eine neue Qualität im Umgang mit einem Medium, mit<br />
dem wir tägl<strong>ich</strong> konfrontiert werden.<br />
Ablauf:<br />
1. Phase: Sie dient dem Aufwärmen, Lockern, Ankommen, s<strong>ich</strong> Einlassen (auf<br />
s<strong>ich</strong>, die an<strong>der</strong>en, den Raum, die Methode). <strong>Theater</strong> soll als Sprache, die jedeR<br />
kann und versteht, erlebbar werden, <strong>der</strong> Körper als Kommunikationsmittel.<br />
Bewegungen (im Unterr<strong>ich</strong>tsfach „Deutsch und Kommunikation“!) sollen auf das<br />
Ungewohnte und Ungewöhnl<strong>ich</strong>e vorbereiten. Vorstellungen wird Raum<br />
gegeben. Nach einer kurzen Begrüßung und Erklärung <strong>zum</strong> Zeitungstheater<br />
beginne <strong>ich</strong> mit Vertrauens- und Aufwärmübungen:<br />
145 Workshop-Leitung: <strong>Armin</strong> <strong>Staffler</strong>, <strong>Theater</strong>pädagoge<br />
© by kontakt+co – Suchtprävention im Jugendrotkreuz, 2000<br />
96
• Ein Partner führt den an<strong>der</strong>en, <strong>der</strong> die Augen geschlossen hält, durch den<br />
Raum und lässt ihn/sie unterschiedl<strong>ich</strong>e Erfahrungen (Geschwindigkeit,<br />
Orientierung im Raum, Berühren von Dingen,...) machen.<br />
• Dschungel: Die Gruppe steht im Kreis. Der linke Nachbar macht ein Geräusch,<br />
das man s<strong>ich</strong> merkt. Selbst gibt man ein Geräusch von s<strong>ich</strong>, das s<strong>ich</strong><br />
<strong>der</strong> rechte Nachbar einprägt. JedeR im Kreis hat nun ein Geräusch gemacht<br />
und eines gehört. Im Anschluss löst s<strong>ich</strong> <strong>der</strong> Kreis auf und alle gehen mit<br />
geschlossenen Augen stumm durch den Raum. Nach einer gewissen Zeit<br />
machen alle ihre Geräusche und begeben s<strong>ich</strong> gle<strong>ich</strong>zeitig auf die Suche<br />
nach ihrem linken Nachbarn. Am Ende müsste <strong>der</strong> Kreis wie<strong>der</strong> zu Stande<br />
kommen.<br />
• Spiegeln: Ein Partner macht Bewegungen vor, <strong>der</strong> an<strong>der</strong>e spiegelt sie.<br />
• West Side Story: Zwei Gruppen stehen einan<strong>der</strong> gegenüber und treiben s<strong>ich</strong><br />
abwechselnd durch gemeinsame Geräusche und Bewegungen hin und her.<br />
• Bild <strong>der</strong> Stunde: Als Einzelner o<strong>der</strong> in <strong>der</strong> Gruppe begibt man s<strong>ich</strong> in Haltungen<br />
o<strong>der</strong> Bewegungsabläufe, die für die vorgegebene Zeit typisch ist. (Mo 8.30 Uhr,<br />
Sa 23.30 Uhr, Urlaub 15.30 Uhr, Silvester, ...)<br />
• Es werden Haltungen und ein entsprechen<strong>der</strong> Gang für die momentane Befindl<strong>ich</strong>keit<br />
gefunden. Für diese Haltung einen Satz finden und ihn ständig wie<strong>der</strong>holen<br />
(variieren) und den an<strong>der</strong>en damit begegnen.<br />
2. Phase: Die Zeitungen querlesen und Zeitungsnotizen nach Belieben (ansprechend,<br />
witzig, schockierend, betreffend,...) auswählen! Die Zeitung beginnt<br />
als Eindruck von Außen, dem gegenüber es gilt Stellung, zu beziehen. Es soll ein<br />
an<strong>der</strong>er Bezug <strong>zum</strong> Text entstehen, <strong>der</strong> Leser wird vom passiven Konsumenten<br />
<strong>zum</strong> aktiven Rezipienten. Die Verän<strong>der</strong>barkeit eines sonst als unverän<strong>der</strong>bar gesehenen<br />
Gegenstandes wird deutl<strong>ich</strong>.<br />
Die Zeitungsnotizen zitieren, rezitieren, ständig wie<strong>der</strong>holen und variieren und in<br />
verschiedenen Stimmungen (aggressiv, freundl<strong>ich</strong>, schleimig, verliebt,...), Haltungen<br />
(kriechend, stolzierend, nie<strong>der</strong>geschlagen, euphorisch,...) und Rollen (Prediger,<br />
Verkäufer, Sportreporter,...) lesen! Dabei bereits auf Assoziationen (Lesen mit<br />
szenischem Blick!) achten und die Konzentration auf wesentl<strong>ich</strong> erscheinende<br />
Passagen r<strong>ich</strong>ten! Einan<strong>der</strong> langsam mit diesen Sätzen begegnen, Gespräche nur<br />
97
mit dem Zeitungstext führen und frühere Vorgaben nach eigenem Ermessen einbauen!<br />
Es entsteht ein Dialog <strong>der</strong> Zeitungstexte, <strong>der</strong> Emotionen, <strong>der</strong> Haltungen.<br />
3. Phase: Nach Themenbere<strong>ich</strong>en und Interessen werden 2-3 Kleingruppen gebildet.<br />
In den Gruppen nach mögl<strong>ich</strong>en Verknüpfungen <strong>der</strong> Meldungen und<br />
Mögl<strong>ich</strong>keiten <strong>der</strong> szenischen Darstellung suchen! Zur Unterstützung werden die<br />
11 Techniken des Zeitungstheaters vorgestellt und erklärt. In kurzer Zeit eine<br />
Inszenierung erarbeiten (Blitzinszenierung)! Der Text aus <strong>der</strong> Zeitung dient dabei<br />
als Gerüst, um das herum <strong>der</strong> eigene Bezug aufgebaut wird.<br />
4. Phase: Die Gruppen präsentieren einan<strong>der</strong> in kurzen Aufführungen die Ergebnisse<br />
<strong>der</strong> Blitzinszenierung.<br />
5. Phase: In einer Feedbackrunde bringen alle ihre Meinungen, Fragen und<br />
Kommentare zu den Szenen an. Die Zusammenfassung und Schil<strong>der</strong>ung <strong>der</strong><br />
erlebten Eindrücke kann mit Hilfe <strong>der</strong> Sprache, theatralischer Mittel o<strong>der</strong> als<br />
Schlagzeile formuliert werden.<br />
Der Vorteil einer knapp begrenzten Zeitspanne liegt in <strong>der</strong> unauswe<strong>ich</strong>l<strong>ich</strong>en<br />
Dynamik und Spontaneität, mit <strong>der</strong> gearbeitet und gespielt werden muss. Am<br />
Schluss darf darüber gestaunt werden, was alles mögl<strong>ich</strong> wurde, obwohl zu<br />
Beginn vielle<strong>ich</strong>t noch n<strong>ich</strong>t einmal eine Vorstellung davon existierte, was<br />
Zeitungstheater sein könnte.<br />
9.2.2 Praxis und Kommentar<br />
Nach diesem Konzept führte <strong>ich</strong> einen Workshop in Zusammenarbeit mit<br />
kontakt+co im Rahmen des Faches DuK (Deutsch und Kommunikation) bei Frau<br />
Birgit Hamed als Pilotprojekt an <strong>der</strong> Berufsschule für holzverarbeitende Berufe in<br />
Absam durch.<br />
98
In einem Vorgespräch mit <strong>der</strong> Lehrperson Frau Birgit Hamed fragte <strong>ich</strong>, was die<br />
Schüler denn lesen würden. „N<strong>ich</strong>ts!“, war die Antwort. „Keine Jugendzeitschriften,<br />
kein Kleinformat, keine Gebrauchsanweisungen, n<strong>ich</strong>ts?“ „N<strong>ich</strong>ts!“<br />
Das Thema bei <strong>der</strong> Auswahl <strong>der</strong> Zeitungsausschnitte war frei, einzig ein gewisser<br />
persönl<strong>ich</strong>er Bezug sollte gegeben sein. Es ergaben s<strong>ich</strong> relativ rasch 3 Gruppen:<br />
Sport und Abenteuer (Collage aus Ber<strong>ich</strong>ten, Werbung und Veranstaltungsankündigungen):<br />
Die Szene zeigte Jugendl<strong>ich</strong>e, die s<strong>ich</strong> von einem Funsport-Event<br />
ins nächste stürzen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ob gewollt o<strong>der</strong> n<strong>ich</strong>t, es<br />
entstand <strong>der</strong> Eindruck einer Slapstick-Komödie, wodurch ein an<strong>der</strong>es L<strong>ich</strong>t auf die<br />
„coolen“ Trendsportarten fiel.<br />
Morbides (Unfallber<strong>ich</strong>te, Todesanzeigen, Kommentare zu Hinr<strong>ich</strong>tungen): Eine<br />
Hinr<strong>ich</strong>tungsszene, wie sie aus amerikanischen Filmen bekannt ist, wurde mit<br />
tragischen Unfallmeldungen und Nachrufen aus Todesanzeigen unterlegt und<br />
kommentiert. Die Szene wirkte zu Beginn äußerst beklemmend. Auf Anweisung<br />
sollte <strong>ich</strong> auf ein St<strong>ich</strong>wort das L<strong>ich</strong>t löschen. Diesen Moment nutzte die <strong>zum</strong> Tode<br />
Verurteilte zur Flucht und gab <strong>der</strong> Szene dadurch eine überraschende und<br />
befreiende Wende. M<strong>ich</strong> beeindruckte <strong>der</strong> ernsthafte, aber auch unverkrampfte<br />
Umgang mit diesem schwierigen Thema.<br />
Sexuelles (Anzeigen, Werbung, pseudomedizinische Artikel): Beson<strong>der</strong>s bei <strong>der</strong><br />
letzten Gruppe war es geradezu faszinierend, wie s<strong>ich</strong> aus einer schwer pubertierenden<br />
Herangehensweise ein ernsthaftes Hinterfragen eines Männerbildes<br />
entwickelte, das den Mann auf seine sexuelle Leistungsfähigkeit reduziert. Was die<br />
Szene zeigte, war eine in keinster Weise peinl<strong>ich</strong>e o<strong>der</strong> anzügl<strong>ich</strong>e, dafür umso<br />
erfrischend und befreiend wirkende, äußerst gelungene Persiflage auf einen<br />
bereits veruns<strong>ich</strong>erten Mann, <strong>der</strong> sein „Heil“ in selbstbeweihräuchernden Kontaktanzeigen,<br />
Viagra und einem dubiosen Naturheiler suchte.<br />
99
9.3 Forumtheater in <strong>der</strong> Suchtprävention<br />
Meine Erfahrungen mit Forumtheater in <strong>der</strong> Suchtprävention sollen das bisher<br />
Gesagte sowohl unterstre<strong>ich</strong>en als auch ergänzen und veranschaul<strong>ich</strong>en. Seit<br />
2000 arbeite <strong>ich</strong> in Kooperation mit kontakt+co – Suchtpräventionsstelle im<br />
Jugendrotkreuz an <strong>der</strong> Erstellung von Forumtheaterszenen mit Jugendl<strong>ich</strong>en <strong>zum</strong><br />
Thema Sucht. Dazu musste <strong>ich</strong> mir den aktuellen Wissensstand in <strong>der</strong> Suchtforschung<br />
aneignen und die Erkenntnisse im Bere<strong>ich</strong> <strong>der</strong> Suchtprävention meiner<br />
Arbeit zu Grunde legen.<br />
Warum die Wahl auf die Methode „Forumtheater“ fiel, hat <strong>zum</strong> Teil pragmatische<br />
Gründe. Zum einen wurde kontakt+co durch Ber<strong>ich</strong>te aus <strong>der</strong> Schweiz auf das<br />
Forumtheater aufmerksam und <strong>zum</strong> an<strong>der</strong>en hatte <strong>ich</strong> damit selbst schon die<br />
meiste Erfahrung gesammelt und traute mir deshalb zu, es auch in mir vorerst<br />
noch unbekannten Bere<strong>ich</strong>en einzusetzen.<br />
Die Schweiz dürfte die meiste Erfahrung mit Forumtheater in <strong>der</strong> Suchtprävention<br />
haben, verbunden mit <strong>der</strong> wohl längsten Tradition. Bedingt ist dies wohl durch die<br />
vorbildl<strong>ich</strong>e Sucht- und Präventionspolitik und das Engagement vieler SchauspielerInnen<br />
in diesem Bere<strong>ich</strong> . Zahlre<strong>ich</strong>e freie Gruppen organisieren in Zusammenarbeit<br />
mit Fachstellen 146 Forumtheateraufführungen für spezielle Zielgruppen (z.B.<br />
BerufsschülerInnen) und spielen von ihnen erarbeitete und recherchierte Szenen.<br />
Die Authentizität <strong>der</strong> Szenen beruht also auf Gesprächen und Diskussionen, die<br />
die SchauspielerInnen zuvor mit „betroffenen Experten“ führten.<br />
Identifikation<br />
Die Tendenz in Tirol geht dagegen eher in R<strong>ich</strong>tung einer direkten Einbindung<br />
Jugendl<strong>ich</strong>er sowohl in Entwicklung, als auch Produktion einer Forumtheaterszene.<br />
Diese Bedingung stellte <strong>ich</strong> von Beginn an, obwohl dahingehend bei kontakt+co<br />
146 z.B. die Gruppe vom „Forum <strong>Theater</strong> Zentrum Zür<strong>ich</strong>“ gemeinsam mit <strong>der</strong> „Fachstelle Suchtprävention<br />
Berufsbildung des Kantons Zür<strong>ich</strong>“ mit den Produktionen Sehn-Sucht 1 (1994/95) und Sehn-Sucht 2<br />
(1999/2000)<br />
100
zuerst teilweise Skepsis herrschte. Forumtheater entfaltet s<strong>ich</strong> erst, wenn für die<br />
Identifikation so wenig Barrieren wie mögl<strong>ich</strong> überwunden werden müssen, auch<br />
wenn dies vielle<strong>ich</strong>t Abstr<strong>ich</strong>e bei den schauspielerischen Ansprüchen bedeutet.<br />
Selbstwertstärkung<br />
Wesentl<strong>ich</strong>e suchtpräventive Wirkungen werden während <strong>der</strong> Erarbeitungsphase<br />
einer Forumtheaterszene erzielt und für die SpielerInnen bedeutet das Spielen <strong>der</strong><br />
eigenen Vorschläge eine beson<strong>der</strong>e Selbstwertstärkung. In <strong>der</strong> Aufführung erleben<br />
sie aber auch, dass sie kein Monopol auf eine Betrachtungsweise innehaben,<br />
treten einen Schritt zurück, werden wie<strong>der</strong> mehr <strong>zum</strong> Betrachter und können den<br />
Vorschlägen an<strong>der</strong>er mit Respekt und Bescheidenheit begegnen. Den spectactors,<br />
die n<strong>ich</strong>t an <strong>der</strong> Szene mitgearbeitet haben, eröffnet s<strong>ich</strong> die Mögl<strong>ich</strong>keit,<br />
Situationen nach ihrem Wunsch zu verän<strong>der</strong>n und zu gestalten. Der Schritt aus <strong>der</strong><br />
Passivität heraus und <strong>der</strong> Mut seine Vorstellungen zu geben und zu zeigen<br />
bedeutet bereits eine Stärkung <strong>der</strong> eigenen Position. Es wird mögl<strong>ich</strong> zu s<strong>ich</strong> und<br />
seinen Ideen zu stehen und s<strong>ich</strong> zu ihnen zu bewegen.<br />
Konfliktkompetenzen<br />
Es geht wie gesagt n<strong>ich</strong>t immer um die Lösung eines Konflikts, auch wenn s<strong>ich</strong> im<br />
Forumtheater oft Lösungen zeigen o<strong>der</strong> <strong>zum</strong>indest Ansätze dazu. Für die Konflikte<br />
bedeutet eine Bearbeitung durch das Forumtheater, dass sie viel von ihrem<br />
Schrecken verlieren, dass sie n<strong>ich</strong>t mehr ausweglos erscheinen, und dass Wege<br />
gefunden werden, s<strong>ich</strong> ihnen zu stellen, mit ihnen umzugehen und sie auszuhalten.<br />
In vielen Forumtheateraufführungen habe <strong>ich</strong> zudem erlebt wie s<strong>ich</strong><br />
Einzelne auf die Suche nach Verbündeten machten und dadurch erstens erfuhren,<br />
dass es welche gibt und zweitens um wie viel einfacher es wird, wenn s<strong>ich</strong> jemand<br />
solidarisch erklärt. Meine Mentorin Irmgard Bibermann sagte einmal während<br />
einer Aufführung: „Unterdrückt sein kann auch heißen, mögl<strong>ich</strong>e Verbündete n<strong>ich</strong>t<br />
zu sehen.“<br />
Zusammenhänge<br />
Forumtheater <strong>zum</strong> Thema Sucht ist gle<strong>ich</strong>zeitig Forumtheater zu den Themen<br />
Familie, Jugendzentrum, Gemeinde, Schule, Freundschaft, Generationen, Freizeit-<br />
101
gestaltung und allen an<strong>der</strong>en Bere<strong>ich</strong>en für die s<strong>ich</strong> Jugendl<strong>ich</strong>e interessieren und<br />
in denen sie leben. So wird auch klar, dass Sucht kein isoliertes Phänomen darstellt,<br />
son<strong>der</strong>n mit allen Bere<strong>ich</strong>en des Lebens in Zusammenhang steht.<br />
Ja/Nein<br />
In den Forumtheateraufführungen, die <strong>ich</strong> bisher geleitet habe, gibt es keine<br />
Verbote, außer dem des Gewaltverbots. Es darf geraucht, gekifft und getrunken<br />
werden, wenn dies <strong>der</strong> Realität <strong>der</strong> Jugendl<strong>ich</strong>en entspr<strong>ich</strong>t. So einfach es auch<br />
scheinen mag, einfach „Nein“ zu sagen, so sehr wi<strong>der</strong>spr<strong>ich</strong>t es in den meisten<br />
Fällen den Gegebenheiten. Interessant sind die Gründe und Motivationen, die<br />
hinter <strong>der</strong> Ablehnung o<strong>der</strong> eben dem Griff zur Zigarette o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Flasche stehen.<br />
So werden die Unterschiede zwischen Genuss, Missbrauch, Gewohnheit und Sucht<br />
deutl<strong>ich</strong>. Ziel <strong>der</strong> Prävention ist n<strong>ich</strong>t die Abstinenz, son<strong>der</strong>n ein s<strong>ich</strong> selbst und<br />
an<strong>der</strong>en gegenüber verantwortungsbewusster Umgang mit Genussmitteln.<br />
Lebensfreude<br />
Mir macht Forumtheater unglaubl<strong>ich</strong> viel Spaß und Freude. Aus den Beschreibungen<br />
und dem Feedback <strong>der</strong> Jugendl<strong>ich</strong>en spr<strong>ich</strong>t meiner Meinung nach mindestens<br />
ebenso viel Lust am Spielen und Arbeiten. Die Kreativität und Spontaneität<br />
bringen m<strong>ich</strong> immer wie<strong>der</strong> <strong>zum</strong> Lachen, und <strong>ich</strong> hoffe die Jugendl<strong>ich</strong>en genießen<br />
die Zeit in gle<strong>ich</strong>em Maße wie <strong>ich</strong>.<br />
„act it!“ nennt s<strong>ich</strong> das Angebot von kontakt+co, das vor allem in <strong>der</strong> Zusammenarbeit<br />
mit Jugendzentren und Schulen Forumtheater in <strong>der</strong> Suchtprävention <strong>zum</strong><br />
Einsatz bringt. Ein erster erfolgre<strong>ich</strong>er Versuch ging im JUZE Looping in Telfs<br />
(2001) über die Bühne. Es folgten ein Einsatz in <strong>der</strong> Hauptschule Gabelsbergerstraße<br />
(2001), sowie im Jugendzentrum „Treffpunkt“ in Hopfgarten i. B. (2001), an<br />
<strong>der</strong> Fachschule für Familienhelferinnen (2001/02) und in <strong>der</strong> Hauptschule Fritz<br />
Prior (2002) in Innsbruck. Die Erfahrungen und Eindrücke <strong>der</strong> Jugendl<strong>ich</strong>en,<br />
Lehrerinnen und Betreuerinnen von 2 Projekten finden s<strong>ich</strong> in den Projektbeschreibungen.<br />
102
9.3.1 Forumtheater-Workshop „act it!“ mit <strong>der</strong> 4a <strong>der</strong> Hauptschule<br />
Gabelsbergerstraße/Innsbruck<br />
(Projekttage 29.05. – 01.06.2001)<br />
Lehrperson: Brigitte Hofer<br />
22 Jugendl<strong>ich</strong>e im Alter von 14 – 15 Jahren<br />
WS-Leitung: <strong>Armin</strong> <strong>Staffler</strong><br />
Konzept: © by kontakt+co – Suchtprävention im Jugendrotkreuz, <strong>Armin</strong> <strong>Staffler</strong><br />
Finanzierung: kontakt+co – Suchtprävention im Jugendrotkreuz<br />
Ziel: Die 4a-Klasse <strong>der</strong> Hauptschule Gabelsbergerstraße in Innsbruck hat s<strong>ich</strong> für<br />
ihre 3 Projekttage das Thema „Sucht“ ausgewählt. In diesen drei Tagen sollen s<strong>ich</strong><br />
alle SchülerInnen mit diesem Thema in Hinblick auf die im Konzept „Forumtheater<br />
in <strong>der</strong> Suchtprävention“ formulierten Vorgaben auseinan<strong>der</strong> setzen.<br />
Vorbesprechung:<br />
Montag 28.05.01: die Klasse wird über den Verlauf des Projekts informiert und<br />
mit Übungen in die Methode eingeführt.<br />
Workshop:<br />
Dienstag 29.05.01 Mittwoch 30.05.01 Donnerstag 31.05.01<br />
Vormittag<br />
Aufwärmen, ein-<br />
Aufwärmen,<br />
Szenenprobe,<br />
9:00 – 12:30<br />
fache theatr. Übun-<br />
Statuentheater,<br />
Rollenfindung<br />
gen und Spiele,<br />
Konfliktbil<strong>der</strong>,<br />
Improvisation<br />
Themenbil<strong>der</strong><br />
Nachmittag<br />
Aufwärmen, ein-<br />
Szenenentwicklung<br />
14:00 – 16:00<br />
fache theatr. Übungen<br />
und Spiele,<br />
-<br />
themenorientiertes<br />
Spielen<br />
103
Aufführung:<br />
Am Freitag Vormittag, 01.06.2001, um 8:30 Uhr vor den 4ten Klassen.<br />
Nachbereitung und Evaluation:<br />
Welche Eindrücke wurden gesammelt, welche Erfahrungen gemacht, was war<br />
unerwartet, was wurde vorhergesehen, etc. Die Aufführung und <strong>der</strong> gesamte<br />
Workshop sollten in einer eigenen Stunde nachbesprochen werden. Auf Grund<br />
<strong>der</strong> Situation am Freitag nach <strong>der</strong> Aufführung sollte diese Zeit auch für „eine<br />
kleine Feier“ genützt werden.<br />
Aufgabe <strong>der</strong> Lehrperson:<br />
Fotografische und schriftl<strong>ich</strong>e Dokumentation des Prozesses, sowie Betreuung im<br />
Falle von Aufteilung in Gruppen.<br />
104
Vorbesprechung - Einführung in das Projekt<br />
Montag, 28. 5. 2001<br />
11.45 Uhr – 13.15 Uhr<br />
1. Vorstellen des Workshopleiters<br />
2. SchülerInnen formulieren ihre Erwartungen <strong>zum</strong> Projekt :<br />
Sammeln von Ideen und Gedanken<br />
3. Einstimmung auf den Workshop:<br />
• Aufwärmübungen mit dem Ziel, Schüler für das <strong>Theater</strong>spiel zu<br />
sensibilisieren, ihre Kreativität zu wecken und Erfahrungen mit Körper,<br />
Stimme und Gruppe zu machen .<br />
• Einführung in das Improvisationsspiel: Spielen von kurzen Szenen, die von<br />
den Zuschauern aktiv mitgestaltet werden.<br />
105
1. Projekttag<br />
Dienstag, 29.5.2001<br />
8.30 Uhr – 12.30 Uhr 14.00 Uhr – 17.00 Uhr<br />
8.30 Uhr – 12.30 Uhr<br />
1. Der Workshopleiter erklärt den Begriff FORUMTHEATER und formuliert<br />
die Zielvorstellungen für das Projekt:<br />
• Erarbeitung verschiedener <strong>Theater</strong>szenen<br />
• Präsentation <strong>der</strong> Szenen mit Einstiegs– und Mitspielmögl<strong>ich</strong>keit des<br />
Publikums<br />
2. Einstimmung auf die Arbeit mit Körper und Stimme mit Hilfe einfacher<br />
theatralischer Übungen und Spiele und Konzentrationsübungen:<br />
• Hypnotisieren: Die Nase eines Partners muss immer den gle<strong>ich</strong>en Abstand<br />
zur Handfläche des an<strong>der</strong>en halten. Abwechseln führen so die beiden<br />
einan<strong>der</strong> durch den Raum<br />
• Stille Post mit dem Körper: Eine Statue in sitzen<strong>der</strong> Position darf<br />
nacheinan<strong>der</strong> immer von einer Person vier Sekunden lang angeschaut<br />
werden. Anschließend setzt man s<strong>ich</strong> mögl<strong>ich</strong>st in <strong>der</strong> gle<strong>ich</strong>en Position auf<br />
den Platz, den die Ausgangsstatue verlassen hat. Am Ende werden<br />
Ausgangsstatue und Schlussstatue miteinan<strong>der</strong> vergl<strong>ich</strong>en.<br />
106
• Spiegeln: Einer macht Bewegungen vor, die <strong>der</strong> Partner spiegelt.<br />
• Dschungel: <strong>Wie</strong><strong>der</strong>erkennen des Partners auf Grund akustischer<br />
Äußerungen (vgl. Beschreibung in Kap. 9.2.2)<br />
• Impulskreis: Bewegungen und Geräusche werden erfunden und im Kreis<br />
weitergegeben. dabei können s<strong>ich</strong> die Geräusche und Bewegungen auch<br />
verän<strong>der</strong>n.<br />
ZIELE:<br />
• Schärfen <strong>der</strong> Sinne<br />
• Bewusstsein und Aufmerksamkeit schaffen für die eigenen Ausdrucksmögl<strong>ich</strong>keiten<br />
3. Reflexion:<br />
• Welche Schwierigkeiten sind aufgetreten?<br />
• Was fiel le<strong>ich</strong>t?<br />
• Welche Gefühle sind aufgekommen?<br />
Pause<br />
11.00 – 14.00<br />
4. Themenfindung – Themenorientiertes Spielen<br />
in Bezug auf die drei Lebensbere<strong>ich</strong>e FAMILIE, SCHULE, FREIZEIT<br />
107
Brainstorming mit Hilfe <strong>der</strong> körperl<strong>ich</strong>en Darstellung:<br />
• Bau einer „SCHULMASCHINE“ 147 :<br />
- Welche Tätigkeiten, Begriffe, Stimmungen, Gefühle drückt sie aus?<br />
(Langeweile, Freude, Lernen, Kummer, Streit, Spaß, Sorgen, Faulsein,<br />
Stress, Schwätzen, Schwänzen, wenig Freizeit, Schularbeiten,<br />
Frechsein,...)<br />
- Zuordnung einer positiven o<strong>der</strong> negativen Bewertung<br />
• Darstellung eines STRESS – und RELAXBILDES:<br />
- In welchen Situationen geht es hektisch zu und wie sieht es aus, wenn ihr<br />
euch entspannt?<br />
5. Reflexion <strong>zum</strong> Vormittag<br />
- Welche Übungen haben Spaß gemacht?<br />
- Was gefiel weniger?<br />
- Was erwartet ihr euch?<br />
- Was blieb vom Vormittag beson<strong>der</strong>s in Erinnerung?<br />
Mittagspause<br />
14.00Uhr – 17.00 Uhr<br />
6. Theatralische Übungen:<br />
• Spielen mit dem Objekt: Gegenstände werden von den Schülern nach<br />
Belieben verwendet. Sie sollen bewusst mit dem Körper in Berührung<br />
kommen, s<strong>ich</strong> durch die Phantasie verwandeln.<br />
147 Maschinentheater: vgl. Kap. 1<br />
108
• <strong>Theater</strong>übungen zu verschiedenen Rollenbil<strong>der</strong>n: JedeR zieht eine Karte mit<br />
einer bestimmten Rolle, die zunächst für s<strong>ich</strong> und ohne Worte dargestellt<br />
werden soll. Mit <strong>der</strong> Zeit treten sie in Kontakt und die einzelnen Figuren<br />
müssen s<strong>ich</strong> wortlos zu passenden Paaren zusammenfinden: Arzt– Patient,<br />
Ehefrau – Ehemann, ...<br />
7. Emotionales Improvisationsspiel:<br />
• In vier Fünfergruppen kann aus diesen sechs Emotionen gewählt werden.<br />
Sie sollen als Überschrift von kurzen Szenen dienen.<br />
SPASS WUT<br />
FAULHEIT SORGEN<br />
TRAUER FREUDE<br />
• Festlegen <strong>der</strong> dramaturgischen Rahmenbedingungen durch die Gruppe:<br />
- Wo spielt die Handlung?<br />
- Wer sind die Personen <strong>der</strong> Handlung?<br />
- Was passiert?<br />
• Im Anschluss an die Darstellung <strong>der</strong> Szenen erfolgt eine kurze Reflexion.<br />
- Welche Gefühle spielten in den Szenen noch mit?<br />
- Wer fühlte s<strong>ich</strong> wohl/unwohl in <strong>der</strong> Szene?<br />
109
8. Reflexion <strong>zum</strong> Tag im Plenum<br />
Nie<strong>der</strong>schrift im Projekttagebuch<br />
Projekttag am 29.05.2001<br />
8:30 –12:30<br />
Dieser Projekttag gefiel mir recht gut. Das führen mit <strong>der</strong> H and war das beste!<br />
Doch das Stille Post Spiel war auch n<strong>ich</strong>t schlecht. <strong>Armin</strong> ist recht nett. Das die<br />
Lehrer mitmachen fand <strong>ich</strong> beson<strong>der</strong>st gut.<br />
14:00 – 16:45<br />
Dieser Nachmittag war recht nett, da wir zu erst im Hof waren und danach im<br />
Musiksaal schauspielern. Jede Gruppe war gut beim schauspielern. Jede Gruppe<br />
hatte ihren Spaß. Unsere Gruppe hat das Thema etwas verfehlt. trotzdem<br />
be<strong>kam</strong>en alle unser Thema mit und wir hatten unseren Spaß. Die Gruppe von ...<br />
war super. Sie konnten wirkl<strong>ich</strong> gut spielen. Die Diskussionsrunden, die wir <strong>zum</strong><br />
Schluss immer machen sind meiner Meinung nach langweilig. Aber sonst hatte<br />
<strong>ich</strong> sehr viel Spaß!<br />
110
2. Projekttag<br />
Mittwoch, 30. Mai 2001<br />
8.30 Uhr - 12.30 Uhr 14.00 Uhr - 17.00Uhr<br />
8.30 Uhr – 12.30 Uhr<br />
1. Aufwärmübungen <strong>zum</strong> Erfahren von Körper, Stimme und Gruppe<br />
2. Szenenentwicklung<br />
• Bau einer „FAMILIENMASCHINE“ - Darstellung durch Bewegungen und<br />
Geräusche<br />
• SchülerInnen geben Gedankenimpulse<br />
zur Familie:<br />
ZEITVERTREIB<br />
LIEBE<br />
STREIT<br />
FREUDE<br />
GENERVT<br />
zur Freizeit:<br />
SPORT<br />
DISCO<br />
RAUCHEN<br />
SPASS<br />
MUSIK<br />
SPIEL<br />
FREUDE<br />
ANSTRENGEND<br />
SAUFEN<br />
ESSEN<br />
RAUCHEN<br />
STRESSFREI<br />
HAUSÜBUNG<br />
TELEFONIEREN<br />
• Der Workshopleiter schreibt folgende Begriffe, die im Laufe des 1.<br />
Projekttages von den Schülern genannt wurden, an die Tafel:<br />
111
MAGERSUCHT<br />
ALKOHOL<br />
ZIGARETTEN<br />
• Szenenentwicklung mit Hilfe von STATUENTHEATER:<br />
• Ordnungsrahmen: Drei Gruppen zu je 7 Schülern<br />
• Aufgabenstellung:<br />
Jede Gruppe ordnet s<strong>ich</strong> einem <strong>der</strong> drei Lebensbere<strong>ich</strong>e FAMILIE – FREIZEIT-<br />
SCHULE zu und verbindet damit einen Suchtbegriff. Ein Mitglied <strong>der</strong> Gruppe<br />
arrangiert das Standbild<br />
Pause<br />
• Präsentation <strong>der</strong> STANDBILDER durch die einzelnen Gruppen:<br />
Gruppe I:<br />
Gruppe II:<br />
Gruppe III:<br />
FAMILIE UND RAUCHEN<br />
FREIZEIT UND DROGEN<br />
SCHULE UND RAUCHEN<br />
• Reflexion zu den einzelnen Standbil<strong>der</strong>n:<br />
- <strong>Wie</strong> fühlen s<strong>ich</strong> die einzelnen Figuren in <strong>der</strong> Situation?<br />
- Was würden s<strong>ich</strong> einzelne Personen wünschen, damit sie s<strong>ich</strong> wohler<br />
fühlen?<br />
- Wer kommt in dem Bild schlecht weg?<br />
• Dynamisierung <strong>der</strong> Statuen:<br />
- Figuren werden „lebendig“ und spielen die Szene kurz an<br />
- Figuren bekommen Namen<br />
- Fixierung von Handlungsablauf und Dialogen<br />
112
- Festhalten inhaltl<strong>ich</strong>er Wünsche<br />
- Rollen bekommen Charakter<br />
Mittagspause<br />
14.00 Uhr – 17.00 Uhr<br />
3. Ausbau <strong>der</strong> Szenen und Weiterentwicklung des Inhaltes über ständige<br />
Aktion und Reflexion<br />
• Weiterentwicklung <strong>der</strong> Szenen vom Vormittag in den drei Gruppen<br />
• Präsentation <strong>der</strong> Szenen im Plenum<br />
• Reflexion durch das Publikum:<br />
- Was passiert in dem Stück?<br />
- Was könnte verbessert werden? – Än<strong>der</strong>ungsvorschläge<br />
- Beschreibung <strong>der</strong> einzelnen Typen<br />
• Spiel als Zeremonie:<br />
d. h. pompös, feierl<strong>ich</strong>, übertrieben spielen<br />
113
4. Reflexion des Tages im Plenum<br />
Nie<strong>der</strong>schrift im Projekttagebuch<br />
PROJEKTTAG, AM 30.05.01<br />
8:30 – 12: 30<br />
Heute war es super! Wir haben uns in 3 Gruppen geteilt und zwar in SCHULE /<br />
FAMILIE / frEIZEIT! Wir wählten Familie! Danach mussten wir uns einen<br />
Begriff <strong>zum</strong> Thema Suchtaussuchen. Wir nahmen Zigaretten. In unserer<br />
gruppe wurde n<strong>ich</strong>t gestritten. Wir hattensehr viel Spaß. Das Schauspielen hat<br />
mir sehr gut gefallen. Obwohl <strong>ich</strong> m<strong>ich</strong> noch n<strong>ich</strong>tso r<strong>ich</strong>tig traue vor <strong>der</strong><br />
Klasse zu stehen. Aber das wird s<strong>ich</strong> vielle<strong>ich</strong>t ja noch än<strong>der</strong>n.<br />
14:00 –16:45<br />
Dieser Nachmittag gefiel mir sehr gut. Das Schauspielen wird immer besser<br />
und lustiger. In unserer Gruppe haben wir untereinan<strong>der</strong> viel Spaß. Meine Rolle<br />
gefällt mir gut, aber die Jacke unter meinem Top ist viel zu warm. Aber sonst<br />
war es wirkl<strong>ich</strong> lustig.<br />
P.S: <strong>Armin</strong> ist recht nett!<br />
114
3. Projekttag<br />
Donnerstag. 31. Mai 2001<br />
8.30 Uhr – 14.00 Uhr<br />
Weiterentwicklung <strong>der</strong> Szenen<br />
1. Spielen <strong>der</strong> Szenen in den Gruppen<br />
Abbruch am Spannungshöhepunkt, wo <strong>der</strong> Wunsch <strong>der</strong> Hauptperson am<br />
deutl<strong>ich</strong>sten wird<br />
2. Vorspielen <strong>der</strong> Szenen im Plenum<br />
• Frage an die Zuschauer: Ab welchem Punkt hätte s<strong>ich</strong> die Szene an<strong>der</strong>s<br />
entwickeln müssen, damit sie ein an<strong>der</strong>es Ende nimmt?<br />
• Schauspieler werden durch Zuschauer ersetzt, sodass die Szenen einen<br />
an<strong>der</strong>en Verlauf nimmt.<br />
3. Reflexion des Vormittags<br />
115
4.Projekttag<br />
Freitag, 1. Juni 2001<br />
8.00 Uhr – 10.45 Uhr<br />
1. Vorbereitung auf die Aufführung: <strong>Wie</strong><strong>der</strong>holung <strong>der</strong> Szenen<br />
2. Präsentation <strong>der</strong> Szenen in Form eines Forumtheaters ( Einladung <strong>der</strong><br />
Parallelklasse)<br />
3. Premierenfeier mit einem kleinen Buffet<br />
116
9.3.2 Forumtheater-Workshop im Jugendzentrum Hopfgarten<br />
(28.09.2001 – 19.10.2001)<br />
Jugendleiterin bzw. Kontaktperson: Susanne Bjerler<br />
11 Jugendl<strong>ich</strong>e im Alter von 13-17 Jahren<br />
WS-Leitung: <strong>Armin</strong> <strong>Staffler</strong><br />
Konzept: kontakt+co – Suchtprävention im Jugendrotkreuz, <strong>Armin</strong> <strong>Staffler</strong><br />
Finanzierung: kontakt+co – Suchtprävention im Jugendrotkreuz<br />
Ziel: Das JUZE Hopfgarten entschied s<strong>ich</strong> mit seinen Jugendl<strong>ich</strong>en an das Thema<br />
Sucht mit an<strong>der</strong>en Methoden heranzugehen. Sowohl im individuellen Umfeld <strong>der</strong><br />
Jugendl<strong>ich</strong>en sind Zigaretten und Alkohol ein Thema, aber auch im JUZE selbst<br />
spielt die Problematik (Rauchverbot, Alkoholverbot) eine Rolle. Im Rahmen des<br />
Workshops und <strong>der</strong> Aufführung soll eine differenzierte und lösungsorientierte<br />
Herangehensweise an die konkrete Situation gefunden werden.<br />
Vorbesprechung:<br />
Freitag 28.09.2001: die Jugendl<strong>ich</strong>en werden über Organisatorisches und<br />
Methodisches informiert und melden s<strong>ich</strong> für das Projekt an.<br />
Workshop:<br />
Freitag 12.10.01 Samstag 13.10.01<br />
Nachmittag<br />
Aufwärmen, ein-<br />
Vormittag<br />
Aufwärmen,<br />
16:00 – 18:00<br />
fache theatr. Übun-<br />
9:00 – 12:00<br />
Konfliktbil<strong>der</strong>,<br />
gen und Spiele,<br />
Themenbil<strong>der</strong>,<br />
Improvisation<br />
Szenenentwicklung<br />
Abend<br />
Aufwärmen,<br />
Nachmittag<br />
Szenenentwicklung,<br />
19:30 – 22:00<br />
themenorientiertes<br />
13:30 – 15:30<br />
Rollenfindung<br />
Spielen, Statuentheater<br />
(Konflikte)<br />
Aufführung:<br />
117
Am Samstag Nachmittag, 13.10.2001, um 16:00 Uhr vor an<strong>der</strong>en Jugendl<strong>ich</strong>en<br />
und geladenen Gästen. Anschließend sollte mit allen Anwesenden „gefeiert“<br />
werden.<br />
Nachbereitung und Evaluation:<br />
Am Freitag,19.10.01, um 17:00 Uhr. Welche Eindrücke wurden gesammelt,<br />
welche Erfahrungen gemacht, was war unerwartet, was wurde vorhergesehen, etc.<br />
Die Aufführung und <strong>der</strong> gesamte Workshop sollten in einer eigenen Stunde<br />
nachbesprochen werden.<br />
Aufgabe <strong>der</strong> Jugendleiter: Mitmachen und motivieren.<br />
9.3.2.1 Let’s act it again! 148<br />
Die Suchtpräventionsstelle kontakt+co in Innsbruck sandte dem Jugend-Treffpunkt<br />
Hopfgarten ihre verschiedenen Angebote zu, und m<strong>ich</strong> als Jugendberaterin sprach<br />
ganz beson<strong>der</strong>s <strong>der</strong> <strong>Theater</strong>workshop <strong>zum</strong> Thema Sucht an.<br />
Ich hatte mit den Jugendl<strong>ich</strong>en schon einige Male, auf ihren Wunsch hin, Nikotin,<br />
Alkohol und Drogen in Diskussionsrunden behandelt und konnte dabei feststellen,<br />
dass viele junge Leute rein kognitiv wohl Argumente kennen, dann aber doch<br />
n<strong>ich</strong>t danach leben. Also erhoffte <strong>ich</strong> mir, dass ein <strong>Theater</strong>workshop eine an<strong>der</strong>e<br />
Ebene <strong>der</strong> Jugendl<strong>ich</strong>en ansprechen und bei ihnen in puncto Sucht etwas in<br />
Bewegung bringen könnte.<br />
Als <strong>ich</strong> das Projekt vorstellte, reagierten die Jugendl<strong>ich</strong>en erst mit Skepsis, Scheu<br />
und Abwehr. Beim Vorgespräch am 28.09.01 allerdings, bei dem noch Fragen von<br />
Gregor Hermann von <strong>der</strong> Suchtpräventionsstelle und dem <strong>Theater</strong>pädagogen<br />
<strong>Armin</strong> <strong>Staffler</strong> beantwortet werden konnten, meldeten s<strong>ich</strong> 20 Burschen und Mädchen<br />
fix an. Diese tauchten dann auch fast vollzählig auf, doch zogen s<strong>ich</strong> einige<br />
wie<strong>der</strong> zurück und letztendl<strong>ich</strong> nahmen 11 Jugendl<strong>ich</strong>e an dem Workshop teil.<br />
148 Susanne Bjerler, Betreuerin im Jugendzentrum „Treffpunkt“ in Hopfgarten i. B.<br />
118
Nach dem <strong>Armin</strong> <strong>der</strong> Gruppe das „Forumtheater“ erklärt hatte und <strong>der</strong> Zeitrahmen<br />
abgesteckt war, startete er mit le<strong>ich</strong>ten theatralischen Übungen und<br />
Spielen. Schon bald ging die anfängl<strong>ich</strong>e Nervosität und Angespanntheit bei den<br />
TeilnehmerInnen in Lockerheit und Spaß über.<br />
Immer wie<strong>der</strong> mussten Gruppen gebildet werden, damit <strong>zum</strong> Thema Sucht verschiedene<br />
<strong>Theater</strong>formen, wie z.B. Statuentheater, Konfliktbil<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Themenbil<strong>der</strong><br />
ausprobiert werden konnten. Ganz ohne erhobenen Zeigefinger o<strong>der</strong> o<strong>der</strong><br />
irgendwelcher hinweise erkannten die jungen TeilnehmerInnen klare Problematiken<br />
und fanden dazu eigene Lösungen. Auch wenn „Sucht“ n<strong>ich</strong>t wortwörtl<strong>ich</strong><br />
beim Namen genannt wurde, so drehte s<strong>ich</strong> alles um das Thema und mir wurde<br />
klar, dass genau hier meine erhoffte „an<strong>der</strong>e Ebene“ angesprochen wurde.<br />
Über Improvisationsübeungen konnten beide Gruppen sodann ein Thema für ihre<br />
jeweilige eigene Szene finden. Diese wurde im Spiel weiter entwickelt und schließl<strong>ich</strong><br />
als Szene geprobt. Obwohl die Freude und Lust am <strong>Theater</strong>spielen nun schon<br />
ganz groß war, <strong>kam</strong> doch ein wenig Lampenfieber wegen <strong>der</strong> Aufführung dazu.<br />
Dieses Lampenfieber allerdings zu überwinden, möchte <strong>ich</strong> eher als eine zusätzl<strong>ich</strong>e<br />
Ingredienz des Workshops beze<strong>ich</strong>nen, die das Ganze noch „schmackhafter<br />
und gelungener“ machte – ist es doch gerade bezügl<strong>ich</strong> Sucht äußerst w<strong>ich</strong>tig, zu<br />
s<strong>ich</strong> selbst zu stehen, auch wenn <strong>der</strong> Druck von außen steigt.<br />
Zur Aufführung wurden die Betreuerinnen des Treffpunkts, ein paar Freunde und<br />
auch Eltern eingeladen. Gregor <strong>kam</strong> <strong>zum</strong> Photographieren angereist, <strong>Armin</strong> übernahm<br />
die Mo<strong>der</strong>ation und eine Stunde später konnten wir alle auf ein sehr geglücktes<br />
Forumtheater zurücksehen, auf eine Aufführung, bei <strong>der</strong> „Workshopler“<br />
Zuschauer engagiertest teilnahmen und bei <strong>der</strong> s<strong>ich</strong> auch Lösungsvorschläge<br />
auftaten, von denen vorher niemand auch nur hätte träumen können!<br />
Das Nachgespräch am 19.10.01 rundete den Workshop mit gegenseitigem<br />
Feedback ab und dabei wurde beschlossen, dass wir uns alle in einem halben Jahr<br />
wie<strong>der</strong> zusammen setzen wollen, um nochmals zu reflektieren und zu überprüfen,<br />
was <strong>der</strong> Workshop jedem einzelnen gebracht hat.<br />
119
Der Workshop war ein toller Erfolg, die Rückmeldungen von den Teilnehmern<br />
waren nur positiv, und die Anfrage für ein nächstes Mal wurde einhellig<br />
ausgesprochen.<br />
Ich möchte m<strong>ich</strong> bei <strong>Armin</strong> für die grandiose Führung durch den Workshop, bei<br />
den Teilnehmern für ihr Engagement und auch ihre Disziplin und beim<br />
Sozialsprengel Hopfgarten für das Sponsern unserer Verpflegung herzl<strong>ich</strong>st<br />
bedanken!<br />
Ich freu m<strong>ich</strong> schon auf ein nächstes act it!<br />
Susanne Bjerler<br />
120
10 Conclusio<br />
Das <strong>Theater</strong> <strong>der</strong> <strong>Unterdrückten</strong> zeigt Wirkung. Ich habe es immer wie<strong>der</strong> bei mir<br />
selbst und an<strong>der</strong>en erlebt. Die Wirkung beruht meiner Ans<strong>ich</strong>t nach vor allem<br />
darauf, dass es die Menschen ernst nimmt und sie aktiv werden lässt.<br />
„Peace, not Passivity!”<br />
sei an dieser Stelle noch einmal wie<strong>der</strong>holt, denn mir gefällt diese Idee eines<br />
aktiven Friedens, <strong>der</strong> kreativ, spontan, gewaltlos, in Bewegung und sympathisch<br />
ist. Wenn auf diese Art und Weise Konflikte bearbeitet werden, werte <strong>ich</strong> dies als<br />
Beitrag zu Kulturen des Friedens. Dabei muss es n<strong>ich</strong>t zu einer Lösung des Konflikts<br />
kommen. Eine Kultur des Friedens hängt für m<strong>ich</strong> n<strong>ich</strong>t zuletzt mit kulturellen<br />
Ausdrucksformen zusammen, und die Kultur des <strong>Theater</strong>s ist eine, die mir persönl<strong>ich</strong><br />
sehr nahe steht. Genauso können aber auch die Kultur <strong>der</strong> Musik, die Kultur<br />
<strong>der</strong> Malerei, die Kultur <strong>der</strong> Bildhauerei, die Kultur des Gesprächs, die Kultur des<br />
Schreibens und viele an<strong>der</strong>e kreative Kulturen ihren Beitrag zu einem aktiven<br />
Frieden leisten.<br />
Süchte bedeuten immer Konflikte mit an<strong>der</strong>en, mit dem Gesetz, mit s<strong>ich</strong> selbst.<br />
Auch hier wäre es vermessen zu sagen, das <strong>Theater</strong> <strong>der</strong> <strong>Unterdrückten</strong> brächte<br />
Lösungen, aber es kann eingefahrene Situationen aufbrechen, so wie das Beispiel<br />
des Jugendzentrums Hopfgarten zeigt, wo Jugendleiterinnen und Jugendl<strong>ich</strong>e<br />
einan<strong>der</strong> wie<strong>der</strong> begegnen konnten. Gespräche über den Alkoholkonsum und<br />
alkoholisierte Jugendl<strong>ich</strong>e im Jugendzentrum waren n<strong>ich</strong>t mehr mögl<strong>ich</strong> o<strong>der</strong><br />
schon festgefahren. In den Szenen zeigten s<strong>ich</strong> aber sowohl die gegensätzl<strong>ich</strong>en<br />
als auch gemeinsamen Standpunkte, die vorher n<strong>ich</strong>t ers<strong>ich</strong>tl<strong>ich</strong> waren und<br />
danach als neue Anknüpfungspunkte genutzt werden konnten.<br />
Das <strong>Theater</strong> <strong>der</strong> <strong>Unterdrückten</strong> und die Suchtprävention selbst befinden s<strong>ich</strong><br />
immer in Bewegung und beide wissen, dass we<strong>der</strong> Unterdrückung noch Sucht<br />
jemals aufhören werden. Beide verstehen es aber auch, s<strong>ich</strong> n<strong>ich</strong>t zu ergeben.<br />
121
Ein Hinweis, den <strong>ich</strong> einer Kollegin, Gertrud Unterasinger, verdanke, sei <strong>zum</strong><br />
Schluss noch angefügt: Das <strong>Theater</strong> <strong>der</strong> <strong>Unterdrückten</strong> eignet s<strong>ich</strong> nach meiner<br />
Meinung von seinem Grundverständnis her n<strong>ich</strong>t son<strong>der</strong>l<strong>ich</strong> für eine schriftl<strong>ich</strong>e<br />
Darstellung. Ich könnte Ideen und Theorien als Statuen stellen, eine Szene über<br />
die Zeit des Schreibens improvisieren, mit all ihren Freuden, aber auch dem Druck<br />
zur Fertigstellung. Es bräuchte eben eine Plattform, Menschen, Leidenschaft. In<br />
diesem Fall ersetzt das Papier meine Plattform. Alle, die gedankl<strong>ich</strong> in diese Arbeit<br />
Eingang finden sind die Menschen, die es zur Darstellung gebraucht hat, ihnen sei<br />
an dieser Stelle auch von Herzen gedankt, und als Leidenschaft muss meine Begeisterung<br />
für das <strong>Theater</strong> <strong>der</strong> <strong>Unterdrückten</strong> genügen!<br />
122
11 Anhang<br />
11.1 Forumtheater am Schöpfwerk 149<br />
Am Schöpfwerk in 1120 <strong>Wie</strong>n, 21. Oktober 1999, im Rahmen des Forum <strong>Theater</strong><br />
Festivals „Visionen zur Verän<strong>der</strong>ung“.<br />
149 Schöpfwerkschimmel, hrsg. v. ARGE Schöpfwerk, Nr. 43, <strong>Wie</strong>n, 1999, S. 13<br />
123
11.2 Fol<strong>der</strong> „act it!“<br />
124
11.3 Infoblatt „act it!“<br />
125
126
127
128
11.4 Flyer zu “act it!”<br />
129
12 Quellenverze<strong>ich</strong>nis<br />
12.1 Bibliographie<br />
Boal, Augusto: Der Regenbogen <strong>der</strong> Wünsche, Seelze (Velber), 1999<br />
Boal, Augusto: Hamlet and the Baker’s Son, My Life in Theatre and Politics,<br />
London, 2001<br />
Boal, Augusto: Legislative Theatre. Using performance to make politics, London,<br />
NewYork, 1998<br />
Boal, Augusto: <strong>Theater</strong> <strong>der</strong> <strong>Unterdrückten</strong>. Übungen und Spiele für Schauspieler<br />
und N<strong>ich</strong>t-Schauspieler, Frankfurt am Main, 1989<br />
Bundesministerium für Inneres, Abteilung II/BK/8 Zentralstelle für die Bekämpfung<br />
<strong>der</strong> Suchtmittelkriminalität, Jahresber<strong>ich</strong>t 2001, <strong>Wie</strong>n, 2002<br />
Dietr<strong>ich</strong>, Wolfgang: Kulturelle Gewalt als Mittel und Indikator von Herrschaft im<br />
Weltsystem, in: Zapotoczky, Klaus/Gruber, Petra (Hg.): Demokratie versus<br />
Globalisierung? Plädoyer für eine umwelt- und sozialverträgl<strong>ich</strong>e Weltordnung,<br />
Frankfurt a. M., 1999<br />
Dostojewski, Fjodor M.: Schuld und Sühne, Übersetzung: R<strong>ich</strong>ard Hoffmann,<br />
Artemis & Winkler Verlag, Düsseldorf, Zür<strong>ich</strong>, 1996<br />
Fässler, Benjamin: Drogen zwischen Herrschaft und Herrl<strong>ich</strong>keit, Der Umgang mit<br />
Drogen als Spiegel <strong>der</strong> Gesellschaft, Solothurn, 1997<br />
Feldhendler, Daniel: Psychodrama und <strong>Theater</strong> <strong>der</strong> <strong>Unterdrückten</strong>, Frankfurt a.<br />
M., 1992<br />
Foucault, M<strong>ich</strong>ael: Dispositive <strong>der</strong> Macht, Berlin, 1978<br />
Freire, Paolo: Pädagogik <strong>der</strong> <strong>Unterdrückten</strong>, Stuttgart, Berlin, 1972<br />
Freud, Sigmund: Fragen <strong>der</strong> Gesellschaft / Ursprünge <strong>der</strong> Religion,<br />
Studienausgabe Band IX, Frankfurt am Main, 1974<br />
Galtung, Johan: Der Preis <strong>der</strong> Mo<strong>der</strong>nisierung. Stuktur und Kultur im Weltsystem,<br />
<strong>Wie</strong>n, 1999<br />
Gomora, Xokonoschtletl: Ans<strong>ich</strong>ten eines Wilden über die zivilisierten Menschen,<br />
ohne Ort und Jahr<br />
130
Handbuch Alkohol – Österre<strong>ich</strong>, Zahlen Daten Fakten Trends 2001, hrsg. v.<br />
Republik Österre<strong>ich</strong>, Bundesministerium für soziale S<strong>ich</strong>erheit und Generationen,<br />
<strong>Wie</strong>n, 2001<br />
Ill<strong>ich</strong>, Ivan: Genus – Zu einer historischen Kritik <strong>der</strong> Gle<strong>ich</strong>heit, Reinbek, 1983<br />
Janosch: Das Wörterbuch <strong>der</strong> Lebenskunst, München, 1995<br />
Kaller-Dietr<strong>ich</strong>, Martina: Macht über Mägen, Essen machen statt Knappheit<br />
verwalten, Haushalten in einem südmexikanischen Dorf, <strong>Wie</strong>n, 2002<br />
Knitsch, Norbert: <strong>Theater</strong> <strong>der</strong> Stille, <strong>Theater</strong>pädagogik in <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>- und<br />
Jugendpsychiatrie, Leer, 2002<br />
Kolitzus, Helmut: Die Liebe und <strong>der</strong> Suff..., Schicksalsgemeinschaft Suchtfamilie,<br />
München, 1999<br />
Neuroth, Simone: Augusto Boals »<strong>Theater</strong> <strong>der</strong> <strong>Unterdrückten</strong>« in <strong>der</strong><br />
pädagogischen Praxis, Weinheim, 1994<br />
Oberarzbacher, Helga/Dornauer, Kurt (Hg.): das strafbegehren <strong>der</strong><br />
suchtgesellschaft, strafrecht und sucht, körper – chemie – gesellschaft,<br />
drogenpolitik, Innsbruck, 1999<br />
Panfy, Daniela: „Com Coragem de ser feliz“. Augusto Boals Teatro Legislativo,<br />
<strong>Wie</strong>n, 1998 (Dipl.)<br />
Professionelle Suchtprävention in Österre<strong>ich</strong>: Leitbildentwicklung <strong>der</strong><br />
österre<strong>ich</strong>ischen Fachstellen für Suchtprävention, hrsg. v. Bundesministerium für<br />
soziale S<strong>ich</strong>erheit und Generationen, <strong>Wie</strong>n, 2002<br />
Rellstab, Felix: Stanislawski Buch, Wädenwil, 1992<br />
Ruping, Bernd (Hrsg.): Gebraucht das <strong>Theater</strong>. Die Vorschläge Augusto Boals:<br />
Erfahrungen, Varianten, Kritik, Lingen-Remscheid, 1991<br />
Ruping, Bernd, u.a. (Hrsg.): Wi<strong>der</strong>wort und Wi<strong>der</strong>spruch. <strong>Theater</strong> zwischen<br />
Eigensinn und Anpassung. Situationen, Proben, Erfahrungen, Lingen, Hannover,<br />
1991<br />
Shakespeare, William: Hamlet. Prinz von Dänemark, Übersetzung: Wilhelm<br />
Schlegel, Reclam, Stuttgart, 1990<br />
Steinweg, Reiner: Lehrstück und episches <strong>Theater</strong>, Brechts Theorie und die<br />
theaterpädagogische Praxis, Frankfurt a. M., 1995<br />
Wallerstein, Immanuel: Der historische Kapitalismus, Berlin, 1984<br />
131
Was ihr wollt. Suchtprävention und <strong>Theater</strong>; Dokumentation einer Fachtagung,<br />
hrsg. von Aktion Jugendschutz, Landesarbeitsstelle Baden-Würtemberg, 1999<br />
Wrentschur, M<strong>ich</strong>ael / ARGE Forumtheater Österre<strong>ich</strong> (Hg): Forum <strong>Theater</strong><br />
Österre<strong>ich</strong>; Praxis / Projekte / Gruppen, Graz, 1999<br />
12.2 Zeitschriften und Broschüren<br />
Leben hat viele Ges<strong>ich</strong>ter Sucht hat viele Ursachen, hrsg. von SFA – ISPA<br />
Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und an<strong>der</strong>e Drogenprobleme, Zür<strong>ich</strong>, 1997<br />
Metaxis, The Theatre of the Oppressed Review/CTO-RIO, Vol. 1, Nr. 1, Rio de<br />
Janeiro, 2001<br />
praev.doc, Ber<strong>ich</strong>te des österre<strong>ich</strong>ischen Bildungsforums für för<strong>der</strong>nde und<br />
präventive Jugendarbeit, 2/2000<br />
Santos Bárbara: Who is the Joker? in: Un<strong>der</strong> Pressure, Year 2, Number 7, August<br />
2001<br />
Schöpfwerkschimmel, hrsg. v. ARGE Schöpfwerk, Nr. 43, <strong>Wie</strong>n, 1999<br />
<strong>Staffler</strong>, <strong>Armin</strong>: Suchtprävention und <strong>Theater</strong>pädagogik in: erziehung heute, hrsg.<br />
v. Tiroler Bildungspoltische Arbeitsgemeinschaft, Innsbruck, Heft 4, 2000<br />
sucht & drogen nüchtern betrachtet; hrsg. v. Österre<strong>ich</strong>ische Arbeitsgemeinschaft<br />
für Suchtvorbeugung; ohne Datum<br />
12.3 an<strong>der</strong>e Quellen<br />
(P) 1988 by Queen Productions Ltd./Jones Music/ Mainman S. A. un<strong>der</strong> exclusive<br />
license to EMI Records Ltd.<br />
Duden: Bd. 7. Etymologie. Herkunftswörterbuch <strong>der</strong> deutschen Sprache,<br />
Mannheim, Zür<strong>ich</strong>, <strong>Wie</strong>n, 1989<br />
Duden: Bd.1. Die deutsche Rechtschreibung, Mannheim, Zür<strong>ich</strong>, <strong>Wie</strong>n, 1996<br />
Gipser, Dietlinde: Pädagogik <strong>der</strong> <strong>Unterdrückten</strong>, Die Befreiungspädagogik von<br />
Paolo Freire; working paper zu einem <strong>Theater</strong>pädagogik-Workshop, Innsbruck,<br />
27.-31.03.1999<br />
Interview mit Lisa Kolb und Irmgard Bibermann, 2. Juni 2002, Innsbruck<br />
132
Seminarunterlagen „Lieber schlau als blau – Seminar zur Suchtprävention“ 14.02.-<br />
15.02.2002, Brixen, Seminarleitung: Dipl.Soz.päd. Guido Osthoff<br />
<strong>Staffler</strong>, <strong>Armin</strong>: Protokoll des Workshops mit Augusto Boal, Innsbruck, 16.-18.<br />
April 2001<br />
www.bautz.de/bbkl/v/vega_f_l.shtml<br />
ww.ctorio.com.br<br />
www.formaat.org<br />
www.grips-theater.de<br />
www.kontaktco.at<br />
www.youthpromotion.at<br />
12.4 Fotonachweis<br />
Fotos S. 9 und 65 (oben): Mag. Ulli Klammer, privat<br />
Foto S. 65 (links): <strong>Armin</strong> <strong>Staffler</strong>, privat<br />
Foto S. 66: Metaxis, The Theatre of the Oppressed Review/CTO-RIO, Vol. 1, Nr. 1,<br />
Rio de Janeiro, 2001, S. 1<br />
Fotos Kap. 9.3.1: Brigitte Hofer, privat<br />
133