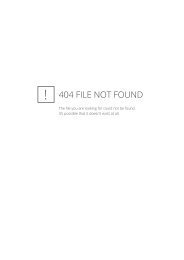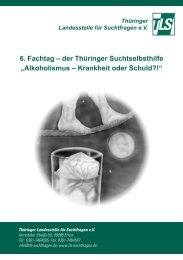Thesen mit Hintergrund.indd - TLS
Thesen mit Hintergrund.indd - TLS
Thesen mit Hintergrund.indd - TLS
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
THÜRINGER THESEN ZUR REHABILITATION<br />
Präambel<br />
Thüringer Arbeitskreis<br />
Rehabilitation und Gesundheit e.V.<br />
Der gesellschaftliche Wandel in den Industriestaaten hat sich nicht ohne Auswirkungen auf<br />
die Gesundheitssysteme vollzogen. Die geänderten Lebensbedingungen und die stetig<br />
steigende Lebenserwartung haben zu einer deutlichen Zunahme chronischer Erkrankungen<br />
geführt. Deren Entstehung und der Umgang <strong>mit</strong> den Krankheitsfolgen sind in starkem<br />
Maße von den sozialen Bedingungen der Betroffenen, von ihrer individuellen Lebensgestaltung,<br />
von Kompetenzen zur Krankheitsvermeidung bzw. -bewältigung und der Motivation<br />
des Einzelnen abhängig.<br />
Den sich daraus ergebenden Anforderungen an das Gesundheitssystem vermag der akutbzw.<br />
kurativmedizinische Versorgungsbereich (Behandlung durch niedergelassene Ärzte<br />
und in Krankenhäusern) nicht ausreichend gerecht zu werden. Deshalb hat sich in Deutschland<br />
innerhalb des Gesundheitssystems als dritte Säule ein spezialisiertes System der Rehabilitation<br />
<strong>mit</strong> spezifi schen Zielsetzungen, integrativen Konzepten und besonderen Organisationsformen<br />
entwickelt.<br />
Obgleich das Gesundheitswesen insgesamt sowohl kostenmäßig als auch gesundheitspolitisch<br />
vom ganzheitlichen Krankheits- und Behandlungsmodell als Grundlage der modernen<br />
Rehabilitation profi tiert, wird deren Stellenwert als unverzichtbarer Teil der Gesundheitsversorgung<br />
häufi g noch verkannt.<br />
Das Gutachten 2000/2001 des Sachverständigenrates für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen<br />
„Bedarfsgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit“, dessen Schwerpunkt auf der<br />
Versorgung chronischer Krankheiten liegt, sieht bei allen untersuchten Krankheitsgruppen<br />
einen erheblichen Bedarf zur Verbesserung der Versorgungskette, darüber hinaus in der<br />
Regel ein bedeutsames und nicht ausgeschöpftes Potenzial an Prävention und vor allem<br />
Rehabilitation.<br />
Der Sachverständigenrat sieht einerseits eine Unterversorgung bei der Rehabilitation, andererseits<br />
hebt er die Rehabilitation besonders hervor, indem er formuliert, dass die moderne<br />
Rehabilitation wie kaum ein anderer Behandlungsansatz die Chance auf eine umfassende<br />
und multidimensionale Behandlung chronisch Kranker eröffnet.<br />
Die „Thüringer <strong>Thesen</strong> zur Rehabilitation“ sollen auf möglichst breiter Basis einen öffentlichen<br />
Diskussionsprozess anstoßen, um zu erreichen, dass der Rehabilitation in Politik,<br />
Ärzteschaft und Öffentlichkeit die Bedeutung beigemessen wird, die ihr wegen ihres medizinischen<br />
und fi nanziellen Nutzens zukommt.<br />
Durch Umstrukturierungen im Gesundheitswesen unter Hervorhebung der Rehabilitation<br />
insbesondere bei der Behandlung chronischer Erkrankungen lassen sich gewaltige Einsparungen<br />
erzielen, und zwar nicht nur bei den Sozialleistungsträgern, sondern gesamtvolkswirtschaftlich.<br />
Diese Wirtschaftlichkeitsreserven gilt es im Interesse aller zu nutzen.<br />
THESE 1<br />
Das Gesundheitswesen bedarf eines Paradigmenwechsels. Chronische Erkrankungen<br />
nehmen stetig zu. Die Akutversorgung wird der Behandlung chronischer<br />
Erkrankungen allein nicht gerecht. Die Rehabilitation muss fester und gleichberechtigter<br />
Bestandteil in einer Versorgungskette werden.<br />
Das Krankheitspanorama hat sich in den letzten Jahrzehnten aus mehreren Gründen gewandelt.<br />
Durch geänderte Lebensbedingungen nehmen insbesondere zivilisatorisch bedingte<br />
Erkrankungen weiter zu. Auch schlägt sich die Veränderung der Alterspyramide in<br />
einer Zunahme der Krankheitsbilder des höheren Lebensalters nieder. In den fortschrittlichen<br />
Industrienationen leidet inzwischen die Hälfte der Bevölkerung an zumindest einer<br />
chro nischen Erkrankung. Die angemessene Versorgung chronisch Kranker stellt eine große<br />
Herausforderung für die Gesundheitssysteme dar.<br />
Die zahlreichen im Gutachten 2000/2001 des Sachverständigenrates für die Konzertierte<br />
Aktion im Gesundheitswesen „Bedarfsgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit“ aufgezeigten<br />
Beispiele für Über-, Fehl- und Unterversorgung stützen die These, dass das gegenwärtige<br />
Gesundheitssystem häufi g nur unzureichend an die Erfordernisse der Behandlung chronisch<br />
Kranker angepasst ist.<br />
Nachdruck der 2. überarbeiteten Aufl age, November 2004, 5.500 Exemplare – Verantwortlich im Sinne des Presserechts: Dr. Sandra Carius – E-Mail: info@targ.de
Diese Fehladaption ist maßgeblich auf die dem akutmedizinischen Paradigma verhafteten Strukturen der Gesundheitsversorgung<br />
sowie der Qualifikation und Sozialisation der Leistungserbringer zurückzuführen.<br />
Der einseitig kurativen Versorgung chronisch Kranker liegt das immer noch dominierende traditionelle Gedankenmodell<br />
eines Krankheitsverlaufs zu Grunde, wonach Gesundheitsförderung, Prävention, Kuration, Rehabilitation<br />
und Pflege zeitlich aufeinander folgende Maßnahmen darstellen. Die für komplexe chronische Erkrankungen sowie<br />
für chronisch kranke ältere Menschen typische Multimorbidität beinhaltet jedoch unterschiedliche Arten und Phasen<br />
von Kranksein und Behinderung nebeneinander, aber immer zugleich verbleibende oder erweiterungsfähige Potenziale<br />
selbstkompetenten Handelns und Helfens.<br />
Die gleichzeitige Präsenz mehrerer Gesundheitsstörungen in unterschiedlichen Stadien erfordert daher die gleichzeitige<br />
und gleichberechtigte Anwendung und Verzahnung von Maßnahmen der Gesundheitsförderung, Prävention,<br />
Kuration, Rehabilitation und Pflege.<br />
Ebenso wie die Prävention zählt die Rehabilitation zu den großen Unterversorgungsbereichen bei chronisch Kranken.<br />
Dabei eröffnet gerade die moderne Rehabilitation wie kaum ein anderer Behandlungsansatz die Chance auf<br />
eine umfassende und multidimensionale Versorgung chronisch Kranker. Sie fördert durch ihren ganzheitlichen Behandlungsansatz<br />
die individuellen Fähigkeiten und Möglichkeiten zur Krankheits- und Lebensbewältigung und zum<br />
selbstbestimmten Umgang <strong>mit</strong> Krankheiten. Die Betroffenen lernen sich so zu verhalten, dass weitere akute Krankheitszustände<br />
nach Möglichkeit nicht auftreten und chronische Störungen in ihren Auswirkungen so gut wie möglich<br />
begrenzt bzw. beherrscht werden.<br />
Rehabilitation sollte als essentieller Bestandteil der Versorgung chronisch Kranker keine Ermessensleistung, sondern<br />
Regelleistung sein.<br />
THESE 2<br />
Rehabilitation ist kostengünstiger als Akutversorgung, vorzeitige Rente und Pflege. Es bedarf einer<br />
Umsteuerung des Gesundheitssystems zur Ausbalancierung von Prävention, Kuration und Rehabilitation.<br />
Chronische Krankheiten verursachen den weitaus größten Teil der stetig wachsenden direkten Krankheitskosten<br />
und in noch höherem Maße die volkswirtschaftlichen Folgekosten. Eine wesentliche Ursache hierfür ist im Versorgungssystem<br />
zu sehen.<br />
Dessen dominante Denkfigur ist die kostenintensive Akutmedizin. Durch Vernachlässigung zukunftsorientierter Prävention<br />
wird einerseits wenig getan, um chronische Krankheiten zu verhindern. Andererseits fehlen Möglichkeiten,<br />
sie akutmedizinisch effektiv zu behandeln, sonst wären sie nicht chronisch. Als Konsequenz müssen medizinische<br />
und multidisziplinäre Hilfen im Bereich von Anpassung und Kompensation, also Leistungen zur Rehabilitation, deutlich<br />
mehr Aufmerksamkeit finden.<br />
Die direkten Kosten rehabilitativer Behandlung liegen ganz erheblich unter denen akutmedizinischer Krankenbehandlung.<br />
Außerdem trägt Rehabilitation maßgeblich zur Reduzierung indirekter Krankheitskosten bei. Rehabilitation<br />
vermeidet bzw. verringert Arbeitsunfähigkeitszeiten und vermindert dadurch auch die Inanspruchnahme anderer<br />
Sektoren des Gesundheitswesens. Durch Rehabilitation geht beispielsweise der Medikamentenverbrauch deutlich<br />
zurück, ebenso sinkt die Häufigkeit ambulanter und stationärer Krankenbehandlungen. Vorzeitige Rentenzahlungen<br />
sowie Pflegeleistungen werden durch Rehabilitation vermieden oder zumindest hinausgeschoben.<br />
Nach dem Gutachten 2000/2001 des Sachverständigenrates für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen „Bedarfsgerechtigkeit<br />
und Wirtschaftlichkeit“ besteht ein deutliches Missverhältnis zwischen Überversorgung im kurativen<br />
Bereich einerseits und Unterversorgung im Bereich der Prävention und Rehabilitation chronisch Kranker andererseits.<br />
Die derzeit in der kurativen Überversorgung gebundenen Mittel müssen dafür eingesetzt werden, die vielfältigen<br />
Formen von Unterversorgung in anderen Bereichen, insbesondere im Bereich von Prävention und Rehabilitation,<br />
auszugleichen. Da<strong>mit</strong> ist allerdings noch nicht beantwortet, wie die an anderer Stelle eingesparten Mittel zielgerichtet<br />
in andere Bereiche umgeleitet werden können und ob diese umgeleiteten Mittel ausreichen würden, die Unterversorgung<br />
in anderen Bereichen auszugleichen.<br />
Ein nachhaltiger Abbau von Über- und Fehlversorgung sowie eine angemessene neue Ausbalancierung von Prävention,<br />
Kuration und Rehabilitation in der Versorgung chronisch Kranker bedarf einer längerfristigen Umsteuerung<br />
des gesamten Gesundheitssystems durch eine mehrschrittige, in ihren Zielen aber beständig angelegte<br />
Gesundheitspolitik. Diese verlangt eine grundlegende Änderung von Strukturen, Anreizen, Wissen und Werten.
THESE 3<br />
Die Leistungsfähigkeit der Rehabilitation wird in Öffentlichkeit, Politik und Ärzteschaft unterschätzt.<br />
Deutschland kann zurückblicken auf eine lange Tradition im Kur- und Bäderwesen. Der Rehabilitation in Deutschland<br />
ist es bislang nur ansatzweise gelungen, in der öffentlichen Wahrnehmung die Vermengung von Kur und Rehabilitation<br />
aufzulösen. Hierzu trägt nicht unmaßgeblich auch die funktionale und räumliche Abtrennung der Rehabilitation<br />
von den übrigen Bereichen des Gesundheitswesens bei. In Politik und Öffentlichkeit, aber auch bei Ärzten<br />
und Patienten werden die in spezialisierten Rehabilitationseinrichtungen angebotenen hochwirksamen Maßnahmen<br />
der Rehabilitation immer noch <strong>mit</strong> der traditionellen Kur, aber auch <strong>mit</strong> Urlaub oder Wellness nahezu gleichgesetzt.<br />
Auch die bislang sehr geringe Repräsentanz der Rehabilitation innerhalb der medizinischen Fachgesellschaften ist<br />
als Ursache für Fehleinschätzungen der Rehabilitation zu nennen. Deshalb bedarf es neben spezifischer Rehabilitationsforschung<br />
gemeinsamer Projekte der Rehabilitationsmedizin <strong>mit</strong> der Akutmedizin. Solche sind für die Akzeptanz<br />
der Rehabilitation immens wichtig.<br />
Neben dem wissenschaftlichen Diskurs zwischen Kuration und Rehabilitation muss auch der praktische Diskurs <strong>mit</strong><br />
niedergelassenen Ärzten und Krankenhäusern intensiviert werden, um die tatsächlichen Leistungspotentiale der Rehabilitation<br />
in der Ärzteschaft und da<strong>mit</strong> auch öffentlich und politisch bekannt zu machen. Die Gesundheitspolitik hat<br />
bis heute die gesundheitsökonomische Bedeutung der Rehabilitation im Wesentlichen verkannt und entsprechende<br />
Untersuchungen von Fachleuten allenfalls zur Kenntnis genommen. <strong>Hintergrund</strong> dieser Politik ist offensichtlich die<br />
Vermeidung konfliktträchtiger Auseinandersetzungen <strong>mit</strong> den großen Interessenverbänden im Gesundheitswesen,<br />
insbesondere denen der Akutversorgung und der Pharmaindustrie.<br />
Es bedarf einer weitreichenden Neuorientierung der Gesundheitspolitik. Hierzu bedarf es insbesondere auch einer<br />
Lobby für die Rehabilitation. Eine Lobby für die Rehabilitation zu finden erfordert auch ein Umdenken bei den Rehabilitationsträgern<br />
und Leistungsanbietern. Entbürokratisierung und Flexibilisierung sind gefragt. Aufgrund der historischen<br />
Entwicklung der Rehabilitation in Deutschland wurde das Versorgungsangebot jahrzehntelang durch starre<br />
administrative Vorgaben bestimmt.<br />
Insgesamt ist das gegenwärtige Versorgungsspektrum in der Rehabilitation relativ begrenzt. Der teilweise noch<br />
bestehende Mangel an krankheitsphasenspezifischen, zielgruppenorientierten und hinsichtlich des Versorgungsaufwandes<br />
abgestuften Behandlungsangeboten ist zu beheben. Ambulante Leistungen zur medizinischen Rehabilitation<br />
gewinnen neben stationären Leistungen immer mehr an Bedeutung. Die begonnene flächendeckende<br />
Etablierung ambulanter Rehabilitationsstrukturen ist konsequent fortzusetzen.<br />
THESE 4<br />
Dem niedergelassenen Arzt kommt aus der Verantwortung für den Patienten eine Schlüsselrolle bei der<br />
Einleitung rehabilitativer Behandlung zu. Ihm sollte eine deutlich aktivere Rolle im Rehabilitationsgeschehen<br />
zugewiesen werden.<br />
Eine Einbindung des niedergelassenen Arztes in den gesamten Rehabilitationsablauf wird bereits seit vielen Jahren<br />
gefordert, ohne dass dieses Ziel in ausreichendem Maße erreicht wäre. Dabei geht es zum einen um die Anregung<br />
der Rehabilitation durch den niedergelassenen Arzt und so<strong>mit</strong> darum, wie durch seine intensivere Mitwirkung<br />
die wirklich rehabilitationsbedürftigen Patienten frühzeitig, nämlich zum Zeitpunkt der günstigsten Erfolgsaussicht,<br />
erreicht werden können. Zum anderen geht es darum, die Schnittstellen zur Behandlung vor und nach der Rehabilitation<br />
zu verringern. Die Bedeutung des niedergelassenen Arztes für die Einleitung der Rehabilitation ergibt sich<br />
daraus, dass er den Patienten sowie dessen familiäre, berufliche und soziale Situation in der Regel gut kennt. Sein<br />
Urteil sollte deshalb bei der Anregung der Rehabilitation ins Gewicht fallen und auch für den Ablauf der Rehabilitation<br />
von Bedeutung sein.<br />
Nach dem Gutachten 2000/2001 des Sachverständigenrates für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen „Bedarfsgerechtigkeit<br />
und Wirtschaftlichkeit“ haben niedergelassene Ärzte insgesamt eine positive Einstellung zur Rehabilitation,<br />
fühlen sich aber seitens der Rehabilitationsträger unzureichend über die Bewilligungskriterien, die Entscheidungsverfahren<br />
und deren Begründungen informiert. Nicht alle von den niedergelassenen Ärzten empfohlenen<br />
Rehabilitationsleistungen werden tatsächlich durchgeführt. Dies deutet darauf hin, dass die Gründe für die Unterinanspruchnahme<br />
der Rehabilitation nicht allein bei den niedergelassenen Ärzten zu suchen sind.<br />
Dem niedergelassenen Arzt sollte eine deutlich aktivere Rolle als bisher im Rehabilitationsgeschehen zugeschrieben<br />
werden. Von ihm angeregte rehabilitative Behandlungen sollten möglichst in die Rehabilitation einfließen, eine<br />
von ihm festgestellte Eilbedürftigkeit sollte Anlass für ein beschleunigtes Verfahren sein und eine abweichende<br />
oder ablehnende Entscheidung sollte zu einem direkten Gespräch <strong>mit</strong> ihm führen. Entsprechend der Forderung<br />
des Sachverständigenrates sollte eine indikationsspezifische Rehabilitation auf der Grundlage und im Rahmen von<br />
Indikationsrichtlinien bei allen Rehabilitationsträgern eine verordnungsfähige Leistung werden.
THESE 5<br />
Rehabilitation muss fester Bestandteil der ärztlichen Aus- und Fortbildung werden. Ärzte müssen in geeigneter<br />
Weise in die Rehabilitationsforschung einbezogen und über die Ergebnisse informiert werden.<br />
Die ärztliche Ausbildung findet an Universitätskliniken statt, wo Rehabilitation in der Regel kaum betrieben und allenfalls<br />
ansatzweise gelehrt wird. Auch die medizinischen Lehrbücher der einzelnen Fachgebiete behandeln die Rehabilitation<br />
kaum. Der Medizinstudent kommt deshalb im Verlauf seines Studiums praktisch nirgendwo näher <strong>mit</strong> der<br />
Rehabilitation in Berührung. Dies setzt sich in der Ausbildung nach dem Studium fort.<br />
Die Weiterbildung in einer Rehabilitationsklinik ist <strong>mit</strong> sehr wenigen Ausnahmen nicht Bestandteil der Facharztausbildung.<br />
Daraus resultiert, dass der ganz überwiegende Teil der niedergelassenen Ärzte und der in Kliniken tätigen<br />
Assistenz- und Fachärzte im Rahmen ihrer Ausbildung nicht <strong>mit</strong> Rehabilitationsmedizin in Berührung kommt<br />
und zum größten Teil niemals eine Rehabilitationsklinik betreten hat. Dieser Zustand ist in keiner Weise dem Stellenwert<br />
angemessen, den Rehabilitation heute hat bzw. noch bekommen sollte.<br />
Zu fordern ist, dass die Ausbildung nicht nur in universitären und sonstigen akutmedizinischen Zentren stattfindet,<br />
sondern ergänzt wird durch Pflichtveranstaltungen (Seminare, Praktika, Weiterbildungsabschnitte) in solchen<br />
Rehabilitationskliniken, die von wissenschaftlich qualifizierten Ärzten geleitet sind und die Funktionen eines akademischen<br />
Lehrfachkrankenhauses wahrnehmen. Hierfür bedarf es größtenteils geänderter Studien- und Weiterbildungsordnungen.<br />
THESE 6<br />
Rehabilitation erhält Leistungsfähigkeit im Erwerbsleben, schützt betriebliche Investitionen und sichert<br />
Arbeitsplätze.<br />
Arbeitgeber investieren enorme Summen für die berufliche Qualifizierung ihrer Beschäftigten. Qualifikation und Erfahrungen<br />
der Beschäftigten sind wichtige Produktivitätsfaktoren der Betriebe. Die Leistungsfähigkeit der Beschäftigten<br />
– sie sind das so genannte Humankapital der Betriebe – wird durch Rehabilitation erhalten. Immense Investitionen<br />
werden geschützt, wenn qualifizierte und erfahrene Beschäftigte durch Rehabilitation den Betrieben weiterhin<br />
zur Verfügung stehen. Rehabilitation sichert Betrieben Know-how und Kompetenz, gesundheitlich beeinträchtigten<br />
Beschäftigten sichert sie Arbeitsplätze.<br />
Zu oft noch wird Rehabilitation von Arbeitgebern als unwillkommene Unterbrechung der Arbeitsleistung ihrer Beschäftigten<br />
gesehen und <strong>mit</strong> Erholungsmaßnahmen verglichen. Tatsächlich findet aber Rehabilitation heute ganz<br />
überwiegend bei Beschäftigten statt, deren Leistungsfähigkeit erheblich beeinträchtigt ist und die deshalb bereits<br />
wiederholt oder über einen längeren Zeitraum im Betrieb wegen Arbeitsunfähigkeit ausgefallen sind.<br />
Auch das Modell der verlängerten Lebensarbeitszeit bedarf der Flankierung durch gezielte Nutzung der Rehabilitation.<br />
Gerade in den Altersgruppen ab dem fünften Lebensjahrzehnt zeigt sich von jeher ein erhöhter Rehabilitationsbedarf.<br />
Durch frühzeitig eingeleitete Rehabilitation werden Arbeitsunfähigkeitszeiten verhindert oder zumindest<br />
erheblich verringert.<br />
Bei steigender Lebenserwartung der Bevölkerung sinkt in Deutschland stetig die Bevölkerungszahl. Immer mehr<br />
älteren Menschen stehen immer weniger junge Menschen gegenüber. Dieser demographische Wandel in Deutschland<br />
wird nicht ohne Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt bleiben. Er wird wegen des Nachwuchskräftemangels in<br />
überschaubarer Zeit dazu führen, dass eine erhöhte Nachfrage auch oder gerade nach langjährig erfahrenen älteren<br />
Arbeitskräften entsteht.<br />
Ist heute in mehr als der Hälfte aller Betriebe niemand mehr beschäftigt, der älter als sechzig Jahre ist, wird sich<br />
dieses Bild in nicht ferner Zukunft deutlich wandeln. Die Gesellschaft und speziell die Arbeitswelt werden es sich<br />
nicht mehr leisten können, ältere Menschen zu ignorieren und auf deren Erfahrungen zu verzichten. Die jugendkonzentrierte<br />
Beschäftigungspolitik kann nicht weiter aufrecht erhalten bleiben.<br />
Bereits heute sollte deshalb durch Prävention sowie rechtzeitige und zielgerichtete Rehabilitation Chronifizierungstendenzen<br />
von Krankheiten entgegengewirkt und dadurch <strong>mit</strong> hoher „Renditeaussicht“ in die Leistungs- bzw. Erwerbsfähigkeit<br />
auch künftig dringend benötigter Arbeitskräfte investiert werden. Prävention und Rehabilitation bedürfen<br />
gesteigerter Akzeptanz bei Arbeitgebern.<br />
Thüringer Arbeitskreis Rehabilitation und Gesundheit e. V.<br />
Kranichfelder Straße 3<br />
99097 Erfurt<br />
Internet: www.targ.de<br />
E-Mail: info@targ.de<br />
Vorstand:<br />
Doz. Dr. med. habil. Rainer Lundershausen (Vorsitzender), Norbert Prusko (Stellv.<br />
Vorsitzender), Dr. Werner Hempel (Schatzmeister), Dr. Sandra Carius (Schriftführerin),<br />
Dr. Wolfgang Schuh (Beisitzer), Michael Domrös (Beisitzer), Otto Böttcher (Beisitzer)