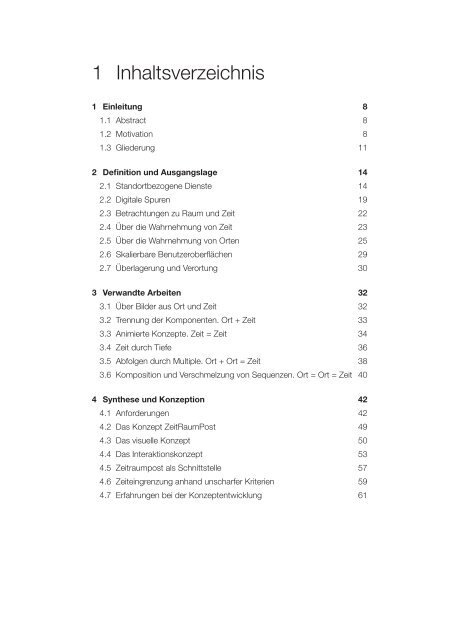Diplomarbeit als pdf
Diplomarbeit als pdf
Diplomarbeit als pdf
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
1 Inhaltsverzeichnis<br />
1 Einleitung 8<br />
1.1 Abstract 8<br />
1.2 Motivation 8<br />
1.3 Gliederung 11<br />
2 Definition und Ausgangslage 14<br />
2.1 Standortbezogene Dienste 14<br />
2.2 Digitale Spuren 19<br />
2.3 Betrachtungen zu Raum und Zeit 22<br />
2.4 Über die Wahrnehmung von Zeit 23<br />
2.5 Über die Wahrnehmung von Orten 25<br />
2.6 Skalierbare Benutzeroberflächen 29<br />
2.7 Überlagerung und Verortung 30<br />
3 Verwandte Arbeiten 32<br />
3.1 Über Bilder aus Ort und Zeit 32<br />
3.2 Trennung der Komponenten. Ort + Zeit 33<br />
3.3 Animierte Konzepte. Zeit = Zeit 34<br />
3.4 Zeit durch Tiefe 36<br />
3.5 Abfolgen durch Multiple. Ort + Ort = Zeit 38<br />
3.6 Komposition und Verschmelzung von Sequenzen. Ort = Ort = Zeit 40<br />
4 Synthese und Konzeption 42<br />
4.1 Anforderungen 42<br />
4.2 Das Konzept ZeitRaumPost 49<br />
4.3 Das visuelle Konzept 50<br />
4.4 Das Interaktionskonzept 53<br />
4.5 Zeitraumpost <strong>als</strong> Schnittstelle 57<br />
4.6 Zeiteingrenzung anhand unscharfer Kriterien 59<br />
4.7 Erfahrungen bei der Konzeptentwicklung 61
5 Umsetzung 64<br />
5.1 Grundlage 64<br />
5.2 Extraktion digitaler Spuren 64<br />
5.3 Entwicklungsschritte 65<br />
5.4 Algorithmen zur Implantation von Zeit 67<br />
5.5 Algorithmen zur Formalisierung des Raums 69<br />
5.6 Demonstrator 73<br />
6 Zusammenfassung 80<br />
6.1 Überblick 80<br />
6.2 Fazit 82<br />
6.3 Ausblick 83<br />
7 Anhang 86
–<br />
7
1 Einleitung<br />
1.1 Abstract<br />
Viele täglich entstehende persönliche Daten, etwa Browserhistorien,<br />
Kommunikationsprotokolle aus Chat & Email, Fotos, Notizen, Projektstände<br />
und Aufgabenlisten haben einen starken Zeitbezug und lassen<br />
sich chronologisch ordnen. Da Zeit <strong>als</strong> abstraktes ,Ding‘ jedoch nicht<br />
erkannt werden kann, muss sie an eine wahrnehmbare ,Erscheinung‘<br />
gebunden werden [vgl. Baumgartner 94].<br />
ZeitRaumPost bindet Zeit an Orte und visualisiert Zeiträume durch Ortswechsel.<br />
Anders <strong>als</strong> gegenwärtig verbreitete Ansätze der Informationsvisualisierung<br />
und der Zeitgeographie (vgl. [Hägerstrand 70]), welche<br />
Zeit einer Karte <strong>als</strong> dritte Dimension oder durch Animation hinzufügen,<br />
kombiniert dieser Ansatz Zeit und geographische Information in einem<br />
interaktiven zweidimensional ruhenden Bild.<br />
Ziel dieser Arbeit ist es, die dabei entstehenden Muster auf räumliche<br />
und zeitliche Vergleichsfähigkeit zu untersuchen und in demonstratorische<br />
Anwendungsszenarien einzubinden.<br />
1.2 Motivation<br />
Die Frage nach der Darstellbarkeit von Zeit wirft per se viele weitere<br />
Fragen auf. Zeit <strong>als</strong> physikalische Größe gilt <strong>als</strong> abstrakt, ihre Beschreibung<br />
durch ein gerichtetes, eindimensionales System mit äquidistanten<br />
Abständen <strong>als</strong> fragwürdig und die biologische und kognitionspsychologische<br />
Funktionsweise ihrer Rezeption <strong>als</strong> offen. Der Chirurg Nidal Toman<br />
bemerkt: „Obwohl der Mensch über kein spezifisches Sinnesorgan<br />
verfügt, das ihm Auskunft über diejenige Zeit gibt, die man <strong>als</strong> physikalische<br />
oder Newton’sche Zeit (Weltzeit) bezeichnet, ist dennoch unbestritten,<br />
dass der Mensch über einen Zeitsinn verfügt, der es ihm ermöglicht,<br />
die Dauer von Ereignissen, die Intervalle und die zeitliche Sequenz<br />
von Ereignissen, die ihm die Sinnesorgane vermitteln, wahrzunehmen<br />
und in Erinnerung zu behalten ([Toman 04]).“<br />
8
Einleitung – Motivation<br />
Doch welche Aspekte von zeitbeschreibenden Ereignissen stimulieren<br />
den Zeitsinn? Wie kann etwas aussehen, das „ohne wirklichen Gegenstand<br />
dennoch wirklich“ 1 ist? Welche Erscheinungsformen können die<br />
Zeit zum wahrnehmbaren Gegenstand werden lassen? Wie werden diese<br />
erinnert und wie lässt sich ein derartiges Konstrukt verbildlichen und für<br />
den Entwurf von Benutzeroberflächen nutzen?<br />
Skizzierung eines Beispielszenarios<br />
Zur Verdeutlichung der Thematik sei ein verallgemeinerbarer beispielhafter<br />
Problemfall skizziert. Ein junger freier Journalist arbeitet für<br />
verschiedene wöchentlich und monatlich erscheinende Zeitungen und<br />
Zeitschriften. Für diese verfasst er Artikel, Kolumnen und Kommentare,<br />
er schreibt Beiträge für ein Onlineportal, pflegt einen persönlichen Blog<br />
und hält in unregelmäßigen Abständen Vorträge. Derzeit recherchiert er<br />
unter anderem zu den Auswirkungen des demographischen Wandels<br />
auf Fahrradmanufakturen. Dazu reist er häufig durch Deutschland um<br />
Originaltöne einzufangen, Szenegrößen zu interviewen, die Entwicklung<br />
ausgewählter Manufakturen zu verfolgen, Trends auf Radsportereignissen<br />
zu beobachten oder um in Bibliotheken und Stadtarchiven zu<br />
recherchieren. Manchmal fährt er ins Ausland um Zulieferer aufzusuchen,<br />
Rechercheergebnisse mit ausländischen Kollegen abzugleichen oder<br />
am Mittelmeer Urlaub zu machen und Erlebtes niederzuschreiben. Die<br />
Ergebnisse dieser Recherche sollen am Ende des Jahres <strong>als</strong> mehrseitiger<br />
Artikel an eine Fachzeitschrift verkauft werden, vorher aber auch für<br />
kleine Beiträge lokaler Onlineportale und für Katalogwerbetexte genutzt<br />
werden. Es wird deutlich, dass eine abgelegte Notiz unter Umständen<br />
zwar a priori einen dezidierten Verwendungszweck besitzt, aber tatsächlich<br />
in verschiedensten thematisch divergierenden Szenarien abgerufen<br />
wird, denen die ursprüngliche Zweckbestimmung nicht per se bekannt<br />
ist.<br />
Um seine Freunde und Familie auf dem Laufenden über seinen aktuellen<br />
Aufenthaltsort und seine persönlichen Eindrücke zu halten, nutzt er<br />
ausgiebig standortbezogene Dienste sozialer Netzwerke. Notizen hält er<br />
unterwegs meist in digitaler Form fest und nutzt einen Synchronisierungsdienst<br />
wie Evernote um geräte- und ortsunabhängig Notizen<br />
erstellen, bearbeiten und lesen zu können. Je nach Situation und verfügbaren<br />
Arbeitsutensilien schießt er ein Foto, tippt oder spricht er kurze<br />
Notizen ins Telefon, verfasst detaillierte Aufzeichnungen auf einem Tablet<br />
oder schreibt ganze Sätze in ein Notebook.<br />
1 Kant 98, S. 108.<br />
Evernote<br />
Software mit Dienst zum Speichern,<br />
Verwalten und Synchronisieren<br />
von Notizen mit Unterstützung<br />
vielfältiger Endgeräte<br />
Tablet<br />
Kurzform für Tablet-PC. Tragbarer<br />
Computer zur Bedienung mit<br />
Finger oder Stift, seit 2010 durch<br />
Einführung des iPads wieder<br />
beachtete Produktokategorie<br />
9
Coworking Space<br />
Offene Bürogemeinschaft. Stellt<br />
technische Infrastruktur und organisiert<br />
Veranstaltungen. Beliebt<br />
bei Startups und Freiberuflern.<br />
Information Retrieval<br />
Technik zur computergestützten<br />
Extraktion komplexer<br />
Inhalte, etwa aus Bildern.<br />
Zu bestimmten Zeitpunkten formuliert der Journalist auf den Notizen<br />
basierende Artikel, etwa wenn der Redaktionsschluss einer der Zeitungen<br />
naht oder um gegen Ende der Woche seine Erlebnisse in einem Blog-<br />
Eintrag zu reflektieren. Am Monatsende verfasst er einen Kommentar für<br />
einen seiner Kunden, und nach besonders einprägsamen Situationen<br />
schreibt er seine Kolumne. Für diese Aufgaben besitzt der Journalist<br />
einen Arbeitsplatz in einem Coworking-Space. Dort kann er auf sein<br />
Archiv und die notwendige Infrastruktur zurückgreifen, sich mit Kollegen<br />
kritisch austauschen und sich auf das Schreiben seiner Artikel konzentrieren.<br />
Informationsadressierung<br />
Von besonderer Bedeutung für die vorliegende wissenschaftliche Arbeit<br />
ist die Frage, wie der Journalist sich in seinen Notizen orientiert und wie<br />
er beim Schreiben die gesuchten Informationen findet; kurz, mit welchen<br />
Fragen er gesuchte Informationen bisher adressiert hat, welche Nachteile<br />
sich dabei offenbaren und wie diesen begegnet werden kann.<br />
Zum einen ist ein Zugang über den textbasierten Inhalt denkbar. Die<br />
Fragen könnten lauten: „Ich suche die Aufzeichnungen zum Austausch<br />
mit dem Geschäftsführer der Manufaktur A“ oder „Ich suche die Wachstumszahlen<br />
des Zulieferers B“. Antworten auf Fragen dieser Kategorie<br />
finden sich im Regelfall mithilfe einer Volltextsuche. Doch wie verhält es<br />
sich, wenn der Geschäftsführer im Wochenrhythmus befragt wurde und<br />
zu viele Protokolle mit ähnlichem Inhalt existieren, die Wachstumszahlen<br />
<strong>als</strong> Foto ohne treffenden Dateinamen gespeichert wurden, ein Hintergrundgeräusch<br />
gesucht wird, das in einer tschechischen Fabrik aufgenommen<br />
wurde oder einfach alle Notizen gewünscht sind, die kurz nach<br />
einem der letzten Treffen mit Kollege B im Lokal C entstanden? Auch<br />
wenn die textuelle Fragekategorie durch moderne Information Retrieval<br />
Methoden stark erweitert werden kann, zeigt sich dennoch in der Breite<br />
potenzieller Frageformulierungen die Notwendigkeit, ihr eine unterstützende<br />
Kategorie zur Seite zu stellen.<br />
Informationsbeschreibung über äußere Eigenschaften<br />
Da die Ausrichtung der Fragen auf das Inhaltliche in den zuletzt aufgeworfenen<br />
Beispielformulierungen keine erschöpfenden Antworten liefern<br />
kann, liegt es nahe, eine Ausrichtung auf die beschreibenden Eigenschaften,<br />
auf das Äußerliche hinzuzuziehen: die Information des Inhalts<br />
um Informationen der äußeren Beschreibung zu erweitern. Beschreibungen,<br />
die über den äußeren Umstand der Informationsentstehung<br />
10
Einleitung – Gliederung<br />
Auskunft geben, etwa den Zeitpunkt der Niederschrift. Somit entsteht<br />
eine Kategorie, die es dem Journalisten ermöglicht, Notizen mit Fragen<br />
der Form „erstellt zum Zeitpunkt t1,“ „ erstellt zwischen Zeitpunkt t1 und<br />
t2“ oder „erstellt nach Zeitpunkt t2“ zu adressieren.<br />
Kausale Verhältnis von Ort und Zeit<br />
Unter dieser Ausgangslage stellt sich wieder die eingangs formulierte<br />
Frage nach der Wahrnehmung, Erinnerung und Verbildlichung von Zeit.<br />
Im Laufe dieser <strong>Diplomarbeit</strong> wird gezeigt, dass ein kausales Verhältnis<br />
zwischen Zeit und Ort existiert, welches im skizzierten Beispiel ermöglicht,<br />
Fragen der äußeren Kategorie folgendermaßen zu konkretisieren:<br />
„erstellt nach Treffen in A“, „gespeichert vor Reise nach B“, „überarbeitet<br />
während längerem Aufenthalt in C“ oder „aufgenommen bei Pause von<br />
regelmäßigen Recherchen in D“.<br />
Das soeben beschriebene Beispiel wird die Arbeit begleiten, um die<br />
Thematik greifbar und verständlich zu gestalten. Dennoch sei darauf<br />
hingewiesen, dass das Konzept ZeitRaumPost keineswegs auf einen<br />
derartigen Anwendungsfall zu beschränken ist, sondern sich vielmehr<br />
<strong>als</strong> allgemein gültiger Ansatz versteht, der seinen Nutzerkreis im Kontext<br />
eines Arbeitslebens sucht, das zum Beispiel von Holm Friebe und Sascha<br />
Lobo in dem Buch Wir nennen es Arbeit [Friebe 06] oder durch Schlagworte<br />
wie Open Innovation, Bar Camps, digitaler Boheme, Coworking<br />
und Entrepreneurship beschrieben wird.<br />
1.3 Gliederung<br />
Das Kapitel 2 steckt die Betrachtungsdomäne ab, indem es der Untersuchung<br />
zugrunde liegende Themengebiete und Begriffe herleitet und<br />
definiert. So analysiert Kapitel 2.1 die Entwicklung und Bedeutung von<br />
standortbezogenen Diensten, vor allem in sozialen Netzwerken. Den<br />
dabei entstehenden Spuren von Ortsinformationen widmet sich Kapitel<br />
2.2 und stellt eine Typisierung von Spuren auf. Basierend auf der Begriffsklärung<br />
zu Ort, Raum und Zeit im Kapitel 2.3, beschreiben die Kapitel 2.4<br />
und 2.5 soziologische und kognitionspsychologische Erkenntnisse zur<br />
Wahrnehmung von Zeit und Raum. Unter praktischen Gesichtspunkten<br />
weist Kapitel 2.7 abschließend auf den Ansatz skalierbarer Benutzeroberflächen<br />
hin.<br />
11
Verwandte Arbeiten werden im Kapitel 3 vorgestellt, wobei die klassische<br />
Trennung von Ort und Zeit in verschiedene Bildelemente im Kapitel 3.2<br />
thematisiert wird, um im darauf folgenden Kapitel 3.3 Beispiele mit einer<br />
Zeitdarstellung beruhend auf Repetition vorzustellen. Kapitel 3.3 befasst<br />
sich mit den durch die Technik ermöglichten Abbildungen von erlebter<br />
Zeit auf animierte Zeit und Kapitel 3.4 präsentiert resümierend Ansätze<br />
der komplexen Verwebung von Ort und Zeit in einen integrierten bildnerischen<br />
Gesamtzusammenhang.<br />
Schlussfolgerungen der Betrachtungen aus den Kapiteln 2 und 3 zieht<br />
Kapitel 4. Aus den in Kapitel 4.1 synthetisierten Anforderungen wird im<br />
Kapitel 4.2 das Konzept ZeitRaumPost erarbeitet, wobei Betrachtungsschwerpunkte<br />
auf das visuelle Konzept und das Interaktionskonzept<br />
gelegt werden.<br />
Die Umsetzung des Demonstrators erläutert Kapitel 5. Dabei wird nach<br />
allgemeinen technologischen Überlegungen aus dem Kapitel 5.1 die<br />
Webschnittstelle zur Datenabfrage der standortbezogenen Dienste in<br />
Kapitel 5.2 beschrieben, woraufhin die Entwicklung vom Mock-up bis<br />
zum Demonstrator und die genutzten Technologien aufgezeigt werden.<br />
Die eingesetzten Darstellungsalgorithmen werden in den darauf folgenden<br />
Abschnitten dargestellt, indem Kapitel 5.3 auf die Implantation von Zeit<br />
und Kapitel 5.4 auf die Formalisierung des Raumes eingehen.<br />
Abschließend erfolgt in Kapitel 6.1 die Auswertung und Zusammenfassung<br />
der Arbeit, deren mitunter zuvor schon aufgeworfenen Möglichkeiten<br />
der Weiterentwicklung Kapitel 6.2 aufgreift und vertieft.<br />
12
Einleitung – Gliederung<br />
13
2 Definition und Ausgangslage<br />
2.1 Standortbezogene Dienste<br />
Point of Interest<br />
georeferenzierte Sehenswürdigkeit<br />
oder Ort von allgem. Interesse(<br />
Bank, Tankstelle, Restaurant, …)<br />
soziale Netzwerke<br />
Dienste, in denen virtuelle<br />
Gemeinschaften gemeinsam<br />
Inhalte erstellen und untereinander<br />
kommunizieren<br />
Unter standortbezogenen Diensten (häufig mit dem englischen Begriff<br />
,Location Based Services‘ bezeichnet) werden Dienste verstanden, die<br />
dem Nutzer abhängig vom aktuellen Aufenthaltsort bestimmte Informationen<br />
bieten. Dazu gehören unter anderem Navigationssysteme, die auf<br />
nahegelegene Orte von Interesse (engl.: Point of Interest) verweisen,<br />
Lösungen zur mobilen Arbeitszeiterfassung oder automatisierte Mautsysteme.<br />
In letzter Zeit wurden standortbezogene Dienste zunehmend<br />
mit der Funktionalität von sozialen Netzwerken und Microblogs verknüpft.<br />
Trotz begrifflicher Unschärfe werden diese Hybriddienste entgegen der<br />
englischen Bezeichnung ,location based social networks‘ auf deutsch<br />
weitgehend vereinfacht <strong>als</strong> standortbezogene Dienste bezeichnet, wenngleich<br />
Soziale Netzwerke mit standortbezogenen Diensten korrekt ist. Da<br />
für diese Betrachtung nur letzte Gattung relevant ist, wird in dieser Arbeit<br />
diese Vereinfachung übernommen.<br />
Nutzergruppen<br />
Carlo Ratti stellt in dem Paper ,Mobile Landscapes: Using Location<br />
Data from Cell Phones for Urban Analysis‘ [Ratti et al. 07] drei Kreise<br />
von Vorteilsnehmern standortbezogener Dienste auf: Individuelle Nutzer,<br />
Nutzergruppen und Dritte 2 . Für individuelle Nutzer ergeben sich Vorteile<br />
nach Ratti bei der „(a) Navigationsunterstützung […] etwa <strong>als</strong> mobiler<br />
Reiseführer mit fortlaufend an des Nutzers Ortswechsel angepasstem<br />
Inhalt“ 3 , <strong>als</strong> „(b) lokalisiertes Branchenbuch […] ,Wo ist das nächstgelegene<br />
vegetarische Restaurant?‘“ 4 und in „(c) bildungsbasierten Diensten<br />
[…] mit Anwendungen zum Vereinfachen des Bereisens historischer<br />
Stätten“ 5 . Sofern eine Gruppe von Nutzern auf standortbezogene Dienste<br />
zugreifen kann, ersinnt Ratti Szenerien für „(d) verteilte Chats und das<br />
2 Ratti et al 07, S. 5-6. Im englischen Original <strong>als</strong> ,Individual users as beneficiaries‘,<br />
,Groups of users as beneficiaries‘ und ,Third parties as beneficiaries‘ bezeichnet<br />
3 ebenda, S. 5. Im englischen Original: ,Navigation aids […] for example, a mobile guide<br />
with content continuously keyed to a user’s changing location‘<br />
4 ebenda. Im englischen Original: ,Geographically distributed yellow pages […] “Where is<br />
the nearest vegetarian restaurant?”‘<br />
5 ebenda. Im englischen Original: ,Educational services […] applications to ease the touring<br />
of historic sitesand other community-based environments‘<br />
14
Definition und Ausgangslage – Standortbezogene Dienste<br />
Auffinden von Freunden […] oder Leuten mit ähnlichen Profilen, welche<br />
die nähere Umgebung betreten oder sich in dieser bewegen“ 6 , „(e) ortsbezogene<br />
Spiele […], die die geographische Position der verschiedenen<br />
Nutzer berücksichtigen und auf Telefonen gespielt werden können“ 7<br />
und „(f) Verkehrs-Dienste [, die] Informationen hinsichtlich einer Gruppe<br />
von Nutzern mit Verkehrsaufzeichnungen koppelt, um Hinweise über<br />
Ballungen und Vorschläge für alternative Routen ausliefern zu können“ 8 .<br />
Er stellt „(g) Digitale Wandteppiche […], ein virtuelles Schaufenster [mit<br />
vom Nutzer hinzugefügten Nachrichten, Kommentaren und Fotos], das<br />
die Stadt überlagert“ 9 vor sowie „(h) koordinierte Aktionen [… bei denen],<br />
Nutzergruppen sich an sich ändernde Gegebenheiten anpassen können<br />
– etwa Protestierende während öffentlicher Demonstrationen“ 10 . Für die<br />
Gruppe der Dritten <strong>als</strong> Vorteilsnehmer sieht Ratti vor allem die Erfüllung<br />
sicherheitsrelevanter, kommerzieller und sozial-analytischer Interessen.<br />
Neben „(i) öffentliche Sicherheit und Schutz [… , wobei] der Ort des<br />
Anrufes von Notfalldiensten wie 110 und 112 genutzt werden kann“ 11 ,<br />
„(j) Familienschutz […] zum Auffinden von jugendlichen Söhnen, alten<br />
Menschen und behinderten Angehörigen“ 12 und „(k) Katastrophenhilfe<br />
[…, zur] Verteilung von Warnmeldungen abhängig von der geographischen<br />
Position“ 13 werden „(l) Geschäftssicherheit und Effizienz“ 14 , „(m)<br />
werbende und informative Dienste“ 15 und „(n) ortsabhängige Abrechnungen“<br />
angepriesen, die sensible Themen wie Nachverfolgung von<br />
Angestellten, mobile Arbeitszeiterfassung und profilbasierte ortsbezo-<br />
6 ebenda. Im englischen Original: ,Distributed chats and friend tracking […] or people<br />
with similar profiles, entering and moving in their region of proximity‘<br />
7 ebenda. Im englischen Original: ,Location-based gaming […] that take into account the<br />
geographic position of different users can be played on cell phones‘<br />
8 ebenda. Im englischen Original: ,Traffic services. Information concerning the position of<br />
a group of users can be interfaced with traffic monitoring in order to deliver news about<br />
congestion and suggestions for alternative routes‘<br />
9 ebenda S. 6. Im englischen Original: ,Digital tapistries […] a virtual showcase overlaid<br />
onto the city, where virtual messages are posted‘<br />
10 ebenda. Im englischen Original: ,Coordinated actions. Groups of users can coordinate<br />
and adapt to changing environmental conditions – such as protesters during public demonstrations‘<br />
11 ebenda. Im englischen Original: ,Public safety and security […] call location can be<br />
used for emergency services such as e_911 and e_112‘<br />
12 ebenda. Im englischen Original: ,Family security […] keep track of teenage sons, elderly<br />
people, disabled members‘<br />
13 ebenda. Im englischen Original: ,Emergency relief […] broadcast alerts that vary with<br />
geographic location‘<br />
14 ebenda. Im englischen Original: ,Business safety and efficiency‘<br />
15 ebenda. Im englischen Original: ,Commercial and information services‘<br />
15
gene Sonderangebote 16 berühren. Für die „(o) Abbildung des urbanen<br />
Systems“ sieht Ratti durch die Verfügbarkeit umfassender, anonymer,<br />
ortsbezogener Datenmengen erstm<strong>als</strong> die Möglichkeit der „Visualisierung<br />
,lebender Städte‘, komplexer Systeme deren Dynamik durch die<br />
Aktivitäten und Raumbewegungen der Leute beschrieben ist“ 17 , woraus<br />
er „mächtige Werkzeuge zum Verstehen und Kontrollieren vieler in<br />
urbanen Gegenden auftretender Phänomene“ 18 extrahiert.<br />
Soziale Netzwerke und standortbezogene Dienste<br />
Erste kommerziellen Anfänge<br />
wagten im Jahr 2000 die Studenten<br />
Dennis Crowley und Alex Rainert<br />
mit einem Dienst namens dodgeball,<br />
der in einigen US-amerikanischen<br />
Städten verfügbar war und<br />
mittlerweile von Google aufgekauft<br />
und in dessen Produkt Latitude<br />
aufgegangen ist. Crowley gründete<br />
2009 nach seinem Abgang von<br />
Google zusammen mit Naveen<br />
Selvadurai foursquare, der heute<br />
mit 5 Millionen Nutzern (vgl. [@fs<br />
penetration]) vor vergleichbaren<br />
Angeboten von brightkite, loopt<br />
und Gowalla (siehe [@brightkite], [@<br />
Abb. 1: Nutzerzahlen gängiger geosozialer loopt], [@gowalla]) den populärsten<br />
Netzwerke<br />
standortbezogenen Dienst darstellt.<br />
Seit 2010 bieten auch verbreitete<br />
soziale Netzwerke wie Twitter (190 Millionen Nutzer, vergleiche [@twitter<br />
16 ebenda. Im englischen Original <strong>als</strong> ,employee tracking‘, ,delivering leisure‘ und ,based<br />
on his/her profile […] the user could receive highlights about points of interest or special<br />
de<strong>als</strong> at commercial establishments within a radius of proximity‘ bezeichnet<br />
17 ebenda, S. 7. Im englischen Original: ,visualize ‘living cities’, complex systems whose<br />
dynamics are described based on people’s activities and movements in space‘<br />
18 ebenda. Im englischen Original: ,powerful tool to understand and control many phenomena<br />
occurring in urban areas‘<br />
16
Definition und Ausgangslage – Standortbezogene Dienste<br />
penetration]) und Facebook (500 Millionen Nutzer, vergleiche [@fb penetration])<br />
die Möglichkeit, eine publizierte Statusmeldung mit einem<br />
Standort zu verknüpfen. Relevante Kernaspekte der standortbezogenen<br />
Dienste bilden<br />
- Venues,<br />
- Check-in,<br />
- Shout und<br />
- Friends<br />
(vgl. [Humphreys08]).<br />
Venues bezeichnen ganz allgemein physische Orte, etwa Arbeitsstätten,<br />
Häuser, Wohnungen, Geschäfte, Cafés, Bildungseinrichtungen, Attraktionen<br />
oder Parks, an denen sich Nutzer standortbezogener Dienste<br />
aufhalten können. Venues werden sowohl durch einen menschenlesbaren<br />
Titel, <strong>als</strong> auch durch konkrete GPS-Koordinaten beschrieben,<br />
wobei sie unterschiedlich feine Granularität besitzen und verschachtelt<br />
sein können. In einer Venue Bibliothek können auch die Venues Bibliothekscafé,<br />
Bibliotheksrestaurant und ein zweiter Lesesaal enthalten sein.<br />
Diese Venues können mitunter dieselben GPS-Koordinaten besitzen,<br />
beziffern aber die vom Nutzer aktive Entscheidung, denjenigen Titel<br />
auszuwählen, welcher seiner Wahrnehmung zufolge am besten zutrifft.<br />
Ist dem standortbezogenen Dienst ein Ort unbekannt oder entspricht die<br />
Beschreibung nicht dem Mitteilungswerten, können vom Nutzer neue<br />
Venues erstellt werden. Wenn sich ein Nutzer in einer Venue befindet<br />
und dieses mitteilen möchte, kann er dort einen Check-in vollziehen.<br />
Namensgebend für diesen Vorgang sind vergleichbare Verfahren bei der<br />
Abfertigung eines Reisenden, etwa im Flughafen, oder dem Speichern<br />
in einer Versionsverwaltung. Der Check-in ist dadurch gekennzeichnet,<br />
dass die persönliche Ortshistorie einen neuen Eintrag mit detaillierten<br />
Angaben zum aktuellen Datum, der Uhrzeit und der Venue enthält. Dieser<br />
Eintrag wird per Broadcast an die Allgemeinheit oder eine eingegrenzte<br />
Zielgruppe versandt. Möchte der Nutzer neben Angaben zur Venue noch<br />
weitere Informationen veröffentlichen, etwa wie lange er sich voraussichtlich<br />
an einem Ort befinden wird oder welches Buch er entdeckt hat<br />
und für besonders empfehlenswert hält, kann der Check-in um entsprechenden<br />
Microcontent angereichert werden. Diese Kombination wird <strong>als</strong><br />
Shout bezeichnet; er befindet sich an einem bestimmten Ort und ruft.<br />
17
Als Freunde (meist im englischen ,friend‘, auch ,follower‘) einer Person<br />
werden die Nutzer bezeichnet, die Teil der eingegrenzten Zielgruppe<br />
sind, die über Check-ins aktiv informiert werden. Werden Check-ins oder<br />
ganze Historien <strong>als</strong> privat deklariert, erhalten nur diese exklusive Einsicht.<br />
Neben dem eigenen<br />
Mitteilungswunsch<br />
werden Nutzer von<br />
standortbezogenen<br />
Diensten zur aktiven<br />
Nutzung durch spielerische<br />
Ansätze und<br />
Abb. 2: Foursquare Badges Last Degree und Pizzaiolo<br />
Prämiensysteme motiviert.<br />
So vergibt Foursquare<br />
Abzeichen (engl.<br />
,Badges’, siehe auch<br />
[Badges]) bei Check-ins, die mehrfach an dem gleichen Ort oder an<br />
einem herausragenden Ort stattfinden, etwa das ,Pizzaiolo‘-Abzeichen<br />
für 25 Check-ins in Pizzerien oder das ,Last Degree‘-Abzeichen für einen<br />
Check-in am Nordpol (siehe Abb. 2). Der Nutzer, der in den vergangenen<br />
60 Tagen am häufigsten in einer bestimmten Venue eingecheckt hat, wird<br />
dort zum Mayor (deutsch: ,Bürgermeister‘) erklärt und zeigt dies jedem<br />
mit seinem Portrait auf der Venue-Beschreibung.<br />
Die virale Werbewirkung von Kampagnen unter Nutzung standortbezogener<br />
Dienste ruft vermehrt Unternehmen hervor, deren Filialen besondere<br />
Angebote für den Mayor oder auch für einfache Check-ins offerieren.<br />
Die US-amerikanische Café-Kette Starbucks bietet in den USA<br />
landesweit wechselnde Preisnachlässe auf Kaffee für diejenigen an, die<br />
in einer ihrer Filialen Mayor sind (siehe [@Starbucks]). Der Bekleidungshändler<br />
GAP verschenkte am 5. November 2010 an Nutzer des Dienstes<br />
Facebook Places insgesamt 10.000 Jeans, wenn diese mit dem eben<br />
gestarteten standortbezogenen Dienst von Facebook in einer GAP Filiale<br />
eincheckten (vgl. [@Facebook Jeans]).<br />
Geolocation-API<br />
Schnittstelle, die dem Browser<br />
Zugriff auf den Standort<br />
des Nutzers ermöglicht<br />
Mashup<br />
Erstellung neuer, medialer Inhalte<br />
durch Verknüpfung vorhandener<br />
Dienste und Informationen<br />
Anwendung und Vezahnung<br />
Nutzen lassen sich standortbezogene Dienste sozialer Netzwerke per<br />
Webinterface in aktuellen Browsern, die das Geolocation-API unterstützen.<br />
Des Weiteren existieren von den genannten Anbietern Applikationen<br />
für mobile Endgeräte, die einen größeren Funktionsumfang und<br />
komfortablere Nutzerführung <strong>als</strong> Webinterfaces bieten. Zwischen den<br />
Anbietern sind verschiedene Mashups entstanden. So müssen Personen<br />
18
Definition und Ausgangslage – Digitale Spuren<br />
nicht zwangsläufig ein neues Konto anlegen, sondern können zur Anmeldung<br />
bei Foursquare auf die Registrierungsinformationen von Facebook<br />
zugreifen; Microcontent von brightkite kann an das eigene Twitterkonto<br />
weitergeleitet und derart einer weiteren Zielgruppe zugänglich gemacht<br />
werden. Die so entstehende Subsumierung ermöglicht eine schnelle<br />
Entwicklung und ein breites Einsatzfeld für standortbezogene Dienste,<br />
da es die Einschränkungen einzelner Insellösungen lockert.<br />
Aus datenschutzrechtlicher Sicht stellen sich Fragen an den Umgang<br />
und die Zurschaustellung derartiger personenbezogenen Daten, wie sie<br />
etwa von Jerome Dobson und Peter Fisher in dem Beitrag Geoslavery<br />
[Dobson03] thematisiert werden.<br />
2.2 Digitale Spuren<br />
„knuper, knuper, kneischen,<br />
wer knupert an meinem Häuschen?“ 19<br />
heisst es in dem 1812 erstmalig in Schriftform erschienenen Märchen<br />
Hänsel und Gretel [Grimm 12]. Zwei Kinder, die im Wald ausgesetzt<br />
werden sollen, hinterlassen auf ihrem Weg eine Spur aus Brotkrumen,<br />
um den Weg nach Hause zu finden. Doch während in dieser Geschichte<br />
die Brotkrumen von Vögeln aufgefressen werden, was die Orientierung<br />
erfolglos werden lässt, erfreuen sich deren heutige Namensvetter<br />
Breadcrumbs einer zunehmend erfolgreichen Verbreitung. In der Interface-Gestaltung<br />
bezeichnet die Brotkrumen-Navigation (meist englisch<br />
,breadcrumbs navigation‘ genannt) eine Textzeile, welche die Tiefe der<br />
Durchdringung des Applikationskontextes beschreibt. Im Umfeld standortbezogener<br />
Dienste beschreiben ,digital breadcrumbs‘ eine Ansammlung<br />
meist nebenläufig generierter digitaler Informationsspuren.<br />
Entstehung und Klassifikation von digitalen Spuren<br />
Diese Informationen, hier <strong>als</strong> digitale Spuren bezeichnet, können auf<br />
unterschiedliche Art entstehen. Seien es auf den Moment bezogene<br />
absichtlich abgelegte Informationen bei der Nutzung reaktiver standortbezogener<br />
Dienste mit digitalen mobilen Endgeräten oder seien es<br />
beiläufig generierte Protokolle bei der Durchführung elektronischer<br />
Buchungen und Transaktionen. So vielseitig und unüberschaubar ihre<br />
Quellen und Entstehungsmöglichkeiten ausfallen, so breit gestaltet sich<br />
19 Grimm 12, S. 54<br />
19
die Staffelung der Qualitätskategorien, auf die sie abbilden. Für diese<br />
Arbeit lässt sich der Betrachtungskreis auf Spuren beschränken, die bei<br />
beliebiger Entstehungsart einen Ortsbezug besitzen. Die Entstehungsoffenheit<br />
durch Nichteingrenzung erweist sich <strong>als</strong> unumgänglich, sofern<br />
der Ansatz ein in dem Sinne offener ist, dass er Raum für die Adaptionen<br />
seiner Grundidee in andere Anwendungsszenerien anbietet und<br />
sich nicht durch eine zu eng gefasste Domäne künstlich einschränken<br />
darf. Jedoch erfordert diese Beliebigkeit auch eine gesonderte Betrachtung<br />
hinsichtlich der Einordnungsmöglichkeiten und Verwertbarkeit der<br />
digitalen Spuren. Zunächst ergibt sich die Frage nach der Bedeutung<br />
des Ortes für den Spuren Hinterlassenden. Auf welche Bezugsqualität<br />
von Person zu Ort lässt die Natur der Spuren schließen? Die Qualitäten<br />
sollen <strong>als</strong><br />
- Spuren mit aktivem Ortsbezug,<br />
- Spuren mit passivem Ortsbezug und<br />
- Spuren mit potenziellem Ortsbezug<br />
bezeichnet werden. Weiter ergibt sich neben dieser qualitativen Frage<br />
auch eine Frage quantitativer Natur, die auf die Akkuratesse bezüglich<br />
der Orts- und Zeitinformation zielt. Sie fragt zunächst nach der Genauigkeit<br />
hinsichtlich der Rastereinheiten der Zeit- und Ortsbeschreibung, um<br />
sich weitergehend mit der Relevanz dieser Genauigkeit für die Ort-Zeit-<br />
Rezeption zu befassen.<br />
Passiver Ortsbezug<br />
Spuren etwa, die ein digitales Flugticket hinterlassen kann, das Informationen<br />
zu Orten und Uhrzeiten von Start-, Lande- und Eincheckvorgängen<br />
enthält, sind in ihrer Auflösung zwar sehr genau, erlauben aber<br />
keine Rückschlüsse auf die Aufmerksamkeit und die Auseinandersetzung<br />
des Reisenden mit dem jeweiligen Ort. Dieser wird schnell von Ort<br />
zu Ort gebracht, wird aufgefordert, in einem von Beliebigkeit geprägten<br />
Verweilambiente zu warten, wodurch ihn vermutlich eine passive Ortsvergegenwärtigung<br />
prägt. Auch Daten, die ein automatisiertes Mautsystem,<br />
etwa das von Toll Collect (siehe [@toll collect]) speichert, bieten<br />
einen hohen Auflösungsgrad hinsichtlich dem Zeitpunkt und der Position<br />
eines Lastkraftwagens, erlauben aber ebenso wenig Rückschlüsse auf<br />
die Ortswahrnehmung des Kraftfahrers. Derart gesammelte Informationen<br />
gehören den Spuren mit passivem Ortsbezug an.<br />
20
Aktiver Ortsbezug<br />
Definition und Ausgangslage – Digitale Spuren<br />
Standortbezogene Dienste sozialer Netzwerke werden <strong>als</strong> reaktive<br />
Dienste bezeichnet. Anders <strong>als</strong> bei proaktiven Diensten, die auf beliebige<br />
Ereignisse – etwa dem Erreichen einer bestimmten Gegend oder dem<br />
Eintreten einer Uhrzeit – reagieren, müssen reaktive Dienste explizit vom<br />
Nutzer angefordert werden. Sie reagieren einzig auf den Nutzer. Da die<br />
Verwendung sozialer Netzwerke mit standortbezogenen Diensten aus der<br />
Motivation heraus entsteht, den eigenen Verbleib mitzuteilen, kann somit<br />
von einer aktiven Auseinandersetzung mit dem Ort ausgegangen werden.<br />
Der Nutzer teilt bewusst mit, dass er sich an einem Ort mit einem Namen<br />
befindet. Diese Bewusstseinsvoraussetzung schmälert die zu erwartende<br />
Akkuratesse hinsichtlich der Ort-Zeit Information. Zum einen ist<br />
die namentliche Beschreibung eines Ortes weniger genau <strong>als</strong> die Angabe<br />
in geographischen Koordinaten 20 . Zum anderen entspricht der Zeitpunkt<br />
der Mitteilung durch den Handlungsaufwand nicht zwangsläufig dem der<br />
Vergegenwärtigung, so dass eine zeitliche Nähe angenommen, eine zeitliche<br />
Genauigkeit jedoch ausgeschlossen werden kann. Derartige Spuren<br />
seien <strong>als</strong> Spuren mit aktivem Ortsbezug bezeichnet.<br />
potenzieller Ortsbezug<br />
Eine Mischform dieser beiden Qualitäten bilden die Spuren mit passivem<br />
Ortsbezug. Aktuelle Fotokameras und Fotohandys besitzen digitale<br />
Uhren und mitunter GPS-Empfänger, so dass aufgenommene Bilder<br />
mit EXIF-Daten zum Ort und Zeitpunkt der Aufnahme versehen werden<br />
können. Bei Landschafts- und Architekturfotografie wird der Fotograf<br />
absichtlich sein Motiv wählen, er entscheidet aktiv dass er den Eiffelturm<br />
oder den Blick vom Schönfelder Hochland festhalten wird. Gleiches gilt<br />
für Aufnahmen von Dingen vor entsprechenden Motiven. Ist das Foto<br />
jedoch nur auf eine Person, ein Licht- und Schattenspiel, eine Wolkenkonstellation<br />
bezogen, kann nicht mehr davon ausgegangen werden,<br />
dass diese Spur aus einem aktiven Bekenntnis zum Ort entstanden ist.<br />
Der Ort ist vielmehr Nebenprodukt. Derartige Spuren sollen im Folgenden<br />
<strong>als</strong> Spuren mit potenziellem Ortsbezug bezeichnet werden.<br />
20 „Bibliothek TU Dresden“ beschreibt eine Fläche von knapp 100 x 100 m aus. GPS erhobene<br />
Informationen einen auf unter 10 m genauen Punkt.<br />
21
2.3 Betrachtungen zu Raum und Zeit<br />
Im Zusammenhang mit dem Begriff Zeit wird häufig der Begriff des<br />
Raumes verwendet. Umgangssprachlich beschreibt das „Hier und Jetzt“<br />
die absolute Vergegenwärtigung, das Raum-Zeit-Kontinuum entspringt<br />
der Relativitätstheorie und schildert das Bestreben, die drei erfahrbaren<br />
physischen Dimensionen des Raums um eine zeitliche Dimension<br />
zu erweitern. Das Raumverständnis beruht hierbei auf dem mathematischen<br />
euklidischen Raum. Er bildet auch die Grundlage für weitere<br />
mathematische Raumkonstrukte, etwa den normierten oder den affinen<br />
Raum, und wurde bis zur Verfeinerung des physikalischen Raumbegriffs<br />
aufgrund der ihm innewohnenden physikalischen Tragweite umfassend<br />
<strong>als</strong> Anschauungsraum bezeichnet. Da dieser mathematische Ur-Raum<br />
zunächst durch seine n Dimensionen definiert ist, wird er schlicht anhand<br />
dieser beschrieben: n<br />
Raum und Ort<br />
Doch der Begriff Raum ist so vielseitig wie unscharf. Der mathematisch-physikalischen<br />
Sichtweise stellt sich etwa die architektonische<br />
Anschauung gegenüber. Dort gehört die Definition und Gliederung eines<br />
Raumes zu den grundlegenden Aufgaben des Entwerfens (vgl. [Löw 07]<br />
und [Krusche 08]).<br />
Für den Verlauf dieser Arbeit muss somit geklärt werden, wo in dem heterogenen<br />
Feld des Raum-Begriffes die relevanteste Bedeutung verortet<br />
ist, zumal sich die Frage stellt, welcher Maßstab dem Begriff Raum zugeordnet<br />
werden kann. Ist der Raum das kleinste Element, das sich an<br />
einem Ort befindet, das Zimmer <strong>als</strong> Arbeitsraum, der Begegnungsraum<br />
vor dem Kaffeeautomaten oder gar der Innenraum eines beweglichen<br />
Autos? Oder ist der Raum Synonym für die Menge aller Elemente, der<br />
Raum, der alle weiteren Betrachtungen umschließt?<br />
Wenn im Fortlauf dieser Arbeit der Begriff Raum genutzt wird, ist der<br />
Ort gemeint, dem neben der geographischen Beschreibung weitere<br />
kontextabhängige, sinnliche Qualitäten zugeschrieben werden.<br />
Zeit wird in der Mathematik mit t beschrieben, hat eine zunehmende,<br />
vorgeschriebene Richtung und entstammt dem althochdeutschen ,zît‘,<br />
welches ,Abgeteiltes‘ bedeutet (vgl. [Duden 03]). Doch was zerteilt Zeit<br />
und wie kann Zeit selbst unterteilt werden?<br />
22
Naturzeit, Erlebniszeit und Personenzeit<br />
Definition und Ausgangslage – Über die Wahrnehmung von Zeit<br />
Hans Michael Baumgartner beschreibt in seinem Beitrag zum Buch<br />
Zeit und Zeiterfahrung [Baumgartner 94] drei fundamentale Typen von<br />
Zeiterfahrung. Unter der Naturzeit versteht er die physikalisch-objektive<br />
Beschreibung von Zeit, die durch den Rhythmus der Natur, etwa durch<br />
die circadianen Tages- und Jahresrhythmen, die Rhythmen der Jahreszeiten<br />
oder Jahreswechseln vorgegeben wird: „Sie ist messbar, wobei sie<br />
nicht an sich selber, sondern an Bewegungen gemessen wird, die konstant<br />
sind bzw. in gewissem Sinne konstante Perioden haben“ 21 . Er nennt<br />
das Prinzip der Uhr die Bedingung zur Messung der Naturzeit, welche<br />
exakte Naturwissenschaft erst ermögliche. Sich auf Kants Kritik der<br />
reinen Vernunft stützend bemerkt er jedoch, „daß [der Naturzeit] nicht<br />
eigentlich objektive Realität zukommt, sondern nur eine Realität empirischer<br />
Art“ 22 .<br />
Demgegenüber positioniert Baumgartner die Erlebniszeit <strong>als</strong> subjektive<br />
„Perspektive der Zeit des erlebenden Bewußtseins [… und ] der Zeit<br />
einer handelnden Person“ 23 . Aus dieser Erlebniszeit wiederum entstehe<br />
Personenzeit, die „aus der Erfahrung des Sich-entscheiden-Müssens<br />
und des faktischen Sich-Entscheidens“ 24 erwächst, worin Baumgartner<br />
die Entstehung von qualitativer Zeitbestimmung erkennt, denn „Entscheidungen<br />
bilden die markanten Punkte, die die Geschichtlichkeit des<br />
Subjekts konstituieren“ 25 .<br />
2.4 Über die Wahrnehmung von Zeit<br />
„Tatsache ist, dass wir Zeit messen können, doch das gibt keine Garantie, dass<br />
wir verstehen, was Zeit ist oder ob es angemessen ist sie metrisch zu erfassen.“ 26<br />
So schreibt Umberto Eco in der Einleitung zu dem Buch The Story of Time<br />
und fragt, wie aus dem harten metrischen System ein sich permanent<br />
wandelndes Gefüge aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft extrahiert<br />
werden kann. Sich auf ein Zitat Aristoteles‘ „Die Zeit ist das, worin<br />
21 Baumgartner 94, S. 192<br />
22 ebenda, S. 192<br />
23 ebenda, S. 194<br />
24 ebenda, S. 194<br />
25 ebenda, S. 194<br />
26 Eco 99, S. 11. Im englischen Original: ,The fact is that we can measure time, but this<br />
gives us no guarantee that we understand what time is or whether it is proper to measure<br />
it metrically.‘<br />
23
sich Ereignisse abspielen“ [Aristoteles 87] stützend und aufbauend auf der<br />
bereits in der Einleitung angedeuteten Tatsache, dass „der Mensch kein<br />
Sinnesorgan zur Messung der physikalischen Zeit“ 27 besitze, schlussfolgert<br />
die Kunsthistorikerin Ursula Maria Probst: „Psychologisch lässt sich<br />
Zeit <strong>als</strong> eine Dimension der Wahrnehmung des Erlebens beschreiben,<br />
das an Ereignisse gekoppelt ist“ 28 . Sie beschreibt ein Konstrukt namens<br />
Gehirnuhr, deren ausgesandte Impulse zur Repräsentation von Dauer<br />
genutzt würden. Pulsgeber und Zähler arbeiten nach einem bestimmten<br />
Takt, das Speichern der Impulse, welche die „Empfindung der Geschwindigkeit<br />
des Zeitablaufs“ 29 steuert, sei aufmerksamkeitsbasiert. „Von<br />
einer Tätigkeit abschweifen“ 30 führe dazu, dass „subjektiv die Zeitdauer<br />
<strong>als</strong> kürzer eingeschätzt [wird], <strong>als</strong> in der Situation, in der wir uns auf die<br />
Zeit konzentrieren“ 31 . Anders ausgedrückt lässt sich Probst auch derart<br />
zusammenfassen, dass die Auseinandersetzung mit neuen Situationen,<br />
die <strong>als</strong> Abschweifen von verinnerlichten Strukturen zu verstehen ist, zu<br />
einer Vielzahl wahrzunehmender Ereignisse führt, und dass sich Zeitverarbeitung<br />
und Geschwindigkeitsempfindung nach der Aufmerksamkeit<br />
hinsichtlich Zeit und Ereignis richtet.<br />
Ereignisse<br />
Etymologisch betrachtet entstammt das Wort Ereignis – ein Ding, das<br />
sich ereignet – dem mittelhochdeutschen ,(er)öugen‘, welches ,vor Augen<br />
stellen‘ bedeutet (siehe [Duden 03]). Abhängig von der Person, der etwas<br />
vor Augen geführt wird, nehmen Ereignisse verschiedene Formen an, so<br />
dass unterschiedliche von Situation und Persönlichkeit geprägte Details<br />
gesehen, verarbeitet und erinnert werden. So erlebt ein Angestellter im<br />
Außendienst, der viel Zeit im Auto verbringt, häufig mit dem Verkehr<br />
verknüpfte Ereignisse. Ein Musikliebhaber verbindet Ereignisse hingegen<br />
häufiger mit dem Hören von Geräuschen und Klängen und ein Botaniker<br />
mit Wetterbedingungen und Pflanzenwuchs. Gemein ist diesen sehr<br />
unterschiedlichen Ereignistypen jedoch ein jeweils assoziierter Ort. Der<br />
Stau des Außendienst-Angestellten ereignete sich auf einem bestimmten<br />
Streckenabschnitt, die Klänge wurde in einem bestimmen Rahmen und<br />
Raum gehört, die Pflanzen auf einem bestimmten Beet gepflanzt.<br />
27 Probst 09, S. 13<br />
28 ebenda<br />
29 ebenda<br />
30 ebenda<br />
31 ebenda<br />
24
Definition und Ausgangslage – Über die Wahrnehmung von Orten<br />
Wird die zuvor aufgestellte kausale Kette wieder aufgenommen, lässt<br />
sich feststellen, dass das Zeitkonstrukt, welches durch Erlebniszeit und<br />
individuelle Zeit beschrieben wird, aus Ereignissen besteht, welche an<br />
einem Ort stattfanden und in der Errinerung mit diesem verknüpft sind.<br />
2.5 Über die Wahrnehmung von Orten<br />
Auf der Suche nach einer „Umwelt, die nicht nur gut geordnet, sondern<br />
auch mit Poesie und Symbolgehalt gefüllt ist“ 32 , legte der Städtebauer<br />
Kevin A. Lynch mit dem Buch Das Bild der Stadt [Lynch 89] einen der<br />
Grundsteine für einen Forschungszweig, der im sozialgeographischen<br />
Kontext <strong>als</strong> Wahrnehmungsgeographie bezeichnet wird und sich der<br />
Untersuchung der Perzeption von Raum widmet. 33<br />
allgemeine Vorstellungen von Raum<br />
Lynch untersucht gestützt durch Feldstudien die mentale Repräsentation<br />
geographischer Räume und Landschaften. Diese sind „das strategische<br />
Hilfsmittel [, die] Vorstellung von der Umgebung in dem allgemein geistigen<br />
Bild, das sich eine Person von der äußeren Welt der Erscheinung<br />
macht“ 34 . Die diesbezügliche Einprägsamkeit von Umgebung wird von<br />
Lynch auch <strong>als</strong> „– in einem höheren Sinn – Greifbarkeit“ 35 verstanden:<br />
„Gegenstände [, die] sich den Sinnen klar umrissen und intensiv<br />
darstellen“ 36 werden – in einem höheren Sinn – greifbar. Bedeutsam<br />
für den Einzelnen werden Elemente aus der Umwelt, indem sie von<br />
diesem ausgesucht und zusammengefügt werden, wodurch „das Bild<br />
einer gegebenen Wirklichkeit für verschiedene Wahrnehmende je ein<br />
ganz verschiedenes sein“ 37 kann. Die sich daraus ergebende Annahme,<br />
mit einer stark fragmentierten Beschreibung konfrontiert zu sein, relativiert<br />
Lynch jedoch umgehend, da durch eine Einteilung der Betrachter<br />
in möglichst gleichmäßige Gruppen, basierend auf den Variablen Alter,<br />
Geschlecht, Erziehung, Beschäftigung, Temperament und Bekanntschaft<br />
mit dem Gegenstand, die „Bedeutsamkeitswahrscheinlichkeit“ 38 präzise<br />
vorhergesagt werden könne. Diese ,Gruppenvorstellungen‘ werden im<br />
32 Lynch 89, S. 141<br />
33 Ähnliche Ansätze verfolgte auch der Geograph Torsten Hägerstrand, vergleiche [Hägerstrand<br />
70] und Kapitel 3.4 – Zeit durch Tiefe.<br />
34 ebenda, S. 13<br />
35 ebenda, S. 20<br />
36 ebenda<br />
37 ebenda<br />
38 ebenda<br />
25
folgenden zu dem Konzept der ,allgemeinen Vorstellungen‘ generalisiert,<br />
die „in den Wechselbeziehungen einer einzigen physischen Realität, einer<br />
gemeinsamen Kultur und einer die Grundlage bildenden physiologischen<br />
Natur in Erscheinung treten“ 39 können.<br />
Lynch stellt die fünf „wesentlichen Vorstellungselemente“ 40 Wege, Grenzlinien,<br />
Bereiche, Brennpunkte und Merk-/ Wahrzeichen auf, so dass „die<br />
Welt […] rings um eine Anzahl von Brennpunkten angeordnet […, sie] in<br />
benannte Bezirke zerstückelt oder durch in Erinnerung behaltene Strecken<br />
zusammengefügt werden“ 41 könne. Diese Elemente sind wie folgt<br />
definiert:<br />
1. Wege: „Wege sind die Kanäle, durch die sich der Beobachter gewohnheitsmäßig,<br />
gelegentlich oder möglicherweise bewegt. Es kann sich<br />
dabei um Straßen, Spazierwege, Verbindungswege, Wasserwege,<br />
Eisenbahnen handeln. Für viele Leute stellen diese Wege die vorherrschenden<br />
Elemente in ihrem Umgebungsbild dar. […] Längs dieser<br />
Bewegungslinien sind – auf sie bezüglich – die anderen Umgebungselemente<br />
angeordnet.“ 42<br />
2. Grenzlinien: „Grenzlinien oder Ränder sind diejenigen Linearelemente,<br />
die vom Beobachter nicht <strong>als</strong> Wege benutzt oder gewertet werden. […]<br />
Sie stellen eher seitliche Richtmarken <strong>als</strong> Koordinatenachsen dar [ ,<br />
die ] für viele Leute […] nicht so eine wesentliche Rolle spielen, wie die<br />
Wege.“ 43<br />
3. Bereiche: „Bereiche sind die mittleren bis großen Abschnitte einer<br />
Stadt – und zwar werden sie <strong>als</strong> zweidimensionale Gebiete [… wahrgenommen,<br />
wobei ] jedes aufgrund seines irgendwie individuellen<br />
Charakters erkennbar ist. Von innen stets zu identifizieren, werden sie<br />
auch von außen <strong>als</strong> Referenz benutzt […]. Die meisten Leute gliedern<br />
ihre Stadt auf diese Weise – mit dem Unterschied, daß hier Wege, dort<br />
Bereiche die vorherrschenden Elemente sind.“ 44<br />
4. Brennpunkte: „Brennpunkte sind die strategischen Punkte einer<br />
Stadt, die einem Beobachter zugänglich sind; sie sind intensiv genutzte<br />
Zentralpunkte, Ziel und Ausgangspunkt seiner Wanderungen. In der<br />
Hauptachse können sie <strong>als</strong> Knotenpunkte gelten, <strong>als</strong> Verkehrsunterbrechungen,<br />
<strong>als</strong> Kreuzungen oder Treffpunkte der Straßen […]. Viele<br />
39 ebenda<br />
40 ebenda, S. 175<br />
41 ebenda, S. 18<br />
42 ebenda, S. 60 - 61<br />
43 ebenda, S. 61<br />
44 ebenda<br />
26
Definition und Ausgangslage – Über die Wahrnehmung von Orten<br />
Brennpunkte sind Knoten- und Konzentrationspunkte zugleich. Der<br />
Begriff ,Knotenpunkt‘ ist eng mit dem Begriff ,Weg‘ verknüpft, da in<br />
einem solchen Punkt Wege zusammenlaufen […]. Sie stehen auch in<br />
Zusammenhang mit dem Begriff ,Bereich‘, da sie deren Mittelpunkte,<br />
ihre Polarisationszentren bilden. […] Mitunter nehmen sie in dem Bild<br />
sogar eine vorherrschende Stellung ein.“ 45<br />
5. Merk- oder Wahrzeichen: „Merkzeichen stellen eine andere Art von<br />
optischen Bezugspunkten dar. – In sie kann der Beobachter nicht<br />
eintreten, sie sind äußere Merkmale. […] Ihre Benutzung fordert das<br />
Aussondern eines einzelnen Elementes aus einer Unmenge von<br />
Möglichkeiten. […] Zu solchen Merkzeichen gehören einzelne Türme,<br />
goldene Kuppeln, einzelstehende Repräsentationsbauten.“ 46<br />
Es fällt auf, dass, anders <strong>als</strong> zunächst vermutet, das mentale Abbild der<br />
Umwelt nicht vordergründig auf Merkzeichen basiert, sondern auf Wegen<br />
und Bereichen. Die Bedeutung der Wege unterstreicht Lynch durch eine<br />
Testreihe, bei der Probanden verschiedene Image genannte Planskizzen<br />
zeichneten. „Ziemlich häufig wurde das Image entlang gewohnter Bewegungslinien<br />
und von diesen ausgehend entwickelt“ 47 , während nur „in<br />
seltenen Fällen […] der Ausgangspunkt eine Gruppe einander benachbarter<br />
Gebäude“ 48 war. „So ging der Zeichner z.B. zweigartig von einem<br />
Ausgangspunkt aus oder begann mit einer Grundlinie […]. Wieder andere,<br />
besonders in Los Angeles, fingen mit der zugrunde liegenden Struktur<br />
(dem Straßenraster) an und fügten das Detail hinzu“ 49 .<br />
Die Tatsache, dass Merkzeichen aus einer Unmenge von Möglichkeiten<br />
auszuwählen sind, stellt in Frage, ob die Bedeutsamkeit für deren Auswahl<br />
tatsächlich einer Gruppenvorstellung, respektive allgemeinen Vorstellung<br />
entsprechen kann, oder ob es sich dabei vielmehr um individuelle und<br />
situative Entscheidungsmechanismen handelt. Die Klärung dieser Frage<br />
wäre auch für die Berücksichtigung von Merkstellen in generischen<br />
Kontexten von Interesse.<br />
45 ebenda<br />
46 ebenda, S. 62<br />
47 ebenda, S. 106<br />
48 ebenda<br />
49 ebenda<br />
27
Verbildlichung <strong>als</strong> kognitive Karte<br />
Kognitive Karten bringen das mentale Abbild dieser wesentlichen Vorstellungselemente<br />
in ein Bild (vgl. [Barkowsky 02]: „räumliches Wissen im<br />
Geist wird in Psychologie, Anthropologie und Geographie metaphorisch<br />
gewöhnlich <strong>als</strong> kognitive Karte bezeichnet. Ursprünglich <strong>als</strong> Analogie zu<br />
äußeren kartenartigen Abbildung gedacht, wurde die Metapher mehr und<br />
mehr in einem figürlichen Sinn verstanden.“ 50 ), wobei „zahlreiche empirische<br />
Untersuchungen der Kognitionspsychologie deutlich machten, dass<br />
die Kartenmetapher für mentale Abbildungen von räumlichem Wissen<br />
nicht wörtlich übersetzt werden darf. Anstatt kohärent, wahrheitsgetreu<br />
und vollständig zu sein, müssen mentale Abbildungen von räumlichem<br />
Wissen <strong>als</strong> fragmentiert, verzerrt und unvollständig betrachtet werden.“ 51<br />
Barkowsky konstatiert, dass diese Verzerrungen einem System folgen,<br />
welches sich durch<br />
- Winkelvereinfachung,<br />
- Linienbegradigung,<br />
- Objektverschiebung und<br />
- hierarchische Gruppierung<br />
beschreiben lasse. Er erklärt, dass „Winkel zwischen linearen Merkmalen<br />
mental verändert werden, um in idealisierte Formen zu passen (Linien<br />
werden begradigt, Winkel annähernd an rechte Winkel idealisiert)“ 52 und<br />
um dieses zu erreichen, würden „Objekte versetzt und rotiert so dass<br />
sie eine schematische Konfiguration formieren.“ 53 , wobei die Bezugssysteme<br />
„nicht eine einfache homogene Struktur formen, sondern auf hier-<br />
50 Barkowsky 02, S. 1. Im englischen Original: “spatial knowledge in mind is usually referred<br />
to metaphorically as cognitive mpas in psychology, anthropology, and geography.<br />
Initially meant as an analogy to external map-like representations, the metaphor became<br />
more and more understood in a figurative sense“<br />
51 ebenda, S. 2. Im englischen Original: „Numerous empirical investigations in cognitive<br />
psychology have revealed, that the map metaphor for mental representations of spatial<br />
knowledge must not be interpreted in a literal sense. Instead of being coherent, veridical,<br />
and complete, mental representations of spatial knowledge must be conceived as<br />
fragmentary, distorted and incomplete.“<br />
52 ebenda. Im englischen Original: „[…] angles between linear features are mentally modified<br />
to fit more ideal forms (lines are straightened, angles are idealised toward right angles)“<br />
53 ebenda. Im englischen Original: „objects are displaced and rotated to form more schematic<br />
configurations“<br />
28
Definition und Ausgangslage – Skalierbare Benutzeroberflächen<br />
archische Art und Weise organisiert sind (zum Beispiel wird die räumliche<br />
Beziehung zwischen einem Gebäude in Stadt A und einem Gebäude in<br />
Stadt B durch die räumliche Beziehung zwischen den beiden Städten<br />
vorgegeben)“ 54 .<br />
2.6 Skalierbare Benutzeroberflächen<br />
Eine Möglichkeit, Ben Schneidermans Credo „Overview first, zoom and<br />
filter, then details-on-demand“ 55 umzusetzen, ist die Nutzung von skalierbaren<br />
Benutzeroberflächen (meist englisch ,Zoomable User Interface‘,<br />
kurz ZUI genannt). Während klassische Benutzeroberflächen verschiedene<br />
Ansichten auf dieselbe Information durch Schnitte trennen, ermöglichen<br />
ZUIs das Anpassen der dargestellten Information durch Eintauchen.<br />
Semantische Skalierung<br />
Mittels semantischer Skalierung kann das Verhältnis zwischen Übersicht<br />
und Detailgrad der dargestellten Informationen durch Anpassung<br />
der Betrachternähe gesteuert werden. In der Übersicht stellt jedes ZUI-<br />
Objekt eine kleine abstrahierte Informationseinheit dar, während das<br />
Eintauchen die nähere Betrachtung darunterliegender Details offeriert.<br />
Fischaugen Zoom<br />
Die Fischaugen-Zoom-Technik stellt eine weitere Möglichkeit zur Navigation<br />
in skalierbaren Benutzeroberflächen dar. Anders <strong>als</strong> der semantische<br />
Zoom, der den gesamten Betrachtungsbereich skaliert, vergrößert<br />
der Fischaugen-Zoom ähnlich der namengebenden Kameraobjektive<br />
nur einen kleinen Bereich rings um das Betrachtungszentrum. Zu den<br />
Rändern der Fischaugendarstellung wird das Bild derart verzerrt – <strong>als</strong>o<br />
auch verkleinert–, dass ein nahtloses Anknüpfen an nicht transformierte<br />
Interfacebereiche möglich ist (vergleiche auch [Schaffer 96]).<br />
Da die Koppelung von Nähe an Detail und Abstand an Übersicht der<br />
gängigen Erfahrung und somit der Erwartungshaltung von Nutzern<br />
entspricht, gelten ZUIs <strong>als</strong> besonders leicht erlern- und bedienbar und<br />
performant bei der Lösung interaktiver Probleme (vgl. [Benderson 95]).<br />
54 ebenda. Im englischen Original: „mental representations of spatial knowledge do not<br />
form a single homogenous structure, but are organized in a hierarchical manner. (for<br />
example the spatial relationship between a building in city A and a building in city B is<br />
given by the spatial relationship between the two cities“<br />
55 Shneiderman 03, S. 376<br />
29
Benderson ermittelte in Untersuchungen eine hohe Performanz bei dem<br />
Lösen vorgegebener Aufgaben. Die daraus resultierende niedere Hemmschwelle<br />
und die assoziative Gewissheit der Rückmeldung empfehlen<br />
skalierbare Benutzeroberflächen für Szenarien mit explorativem<br />
Charakter, deren dargestellte Information und potenzielle Interaktion in<br />
einem sich gegenseitig adaptierenden Verhältnis stehen.<br />
Da skalierbare Benutzeroberflächen sich vorwiegend durch das Zooming<br />
und die direkte Rückmeldung auszeichnen und Multitouch-Gesten auf<br />
direkt manipulierbaren Interfaces effektive Ergebnisse erzielen, werden<br />
skalierbare Benutzeroberflächen häufig mit Multitouch-Interaktion<br />
gekoppelt (vergleiche [Marinos 10])<br />
2.7 Überlagerung und Verortung<br />
Sollen Zeit und Raum in einen gemeinsamen Kontext gebracht werden,<br />
so dass der Raum zur beschreibenden Komponente einer Ausformulierung<br />
von Zeit entwickelt werden kann, stellt sich auch die Frage nach<br />
dem Motivationsgrund. Der Raum wird zur Zeit und verwebt die räumliche<br />
Physis mit zeitlichen Gerichtetheit in einem integrierten Ganzen,<br />
doch mit welcher Absicht?<br />
Indem etwas derart Allgegenwärtiges und dennoch Flüchtiges wie die<br />
Zeit in dem Maße formulierbar wird, dass sie auf kognitionspsychologischem<br />
Fundament still stehend greifbar wird, eröffnet sie eine eigene<br />
Wertemenge, die <strong>als</strong> Abbildungszielbereich genutzt werden kann. Erfolgt<br />
die Ausgestaltung der Zeit in dem Bewusstsein ein Zielbereich zu sein,<br />
bietet sie Verankerungsmöglichkeiten für Objekte, die sich nicht nur mit<br />
einer Raumbeschreibung, sondern auch für Objekte, die sich mit einer<br />
Zeitbeschreibung adressieren lassen. Ein Objekt, welches über eine zeitliche<br />
Komponente verfügt, kann folglich in einer übergreifenden Raum-<br />
Zeit Systematik verortet werden.<br />
Ortsbezug digitaler Informationen<br />
Bilder von Digitalkameras können einen Ortsbezug inhaltlicher Art haben,<br />
indem sie etwa den Eiffelturm abbilden. Sie können aber auch einen<br />
beschreibenden Ortsbezug haben, indem sie um EXIF-Daten angereichert<br />
werden, welche die geographische Position maschinenlesbar mit<br />
dem Bild speichert. Eine digitale Notiz hingegen, sofern sie sich nicht<br />
dezidiert mit einem lokalen oder räumlichen Thema befasst, hat im Regelfall<br />
über die Ereignisbedingungen hinaus keinen räumlichen Bezug (vgl.<br />
30
Definition und Ausgangslage – Überlagerung und Verortung<br />
Kapitel 2.2 – Digitale Spuren). Dadurch, dass die Notiz jedoch über einen<br />
Zeitaspekt verfügt, kann die kausale Kette aus Kapitel 2.4 eingebracht<br />
werden und ihre Zeitinformation mit einer Rauminformation verknüpft<br />
werden, die auf der persönlichen Ortshistorie des Verfassers beruht.<br />
Dadurch fällt bei identischem Information-Zeit-Tupel die hinzugefügte<br />
Ortskomponente je nach Verfasser unterschiedlich aus.<br />
Raum durch Zeit<br />
Da digitale Informationen immer einen Zeitbezug besitzen, lässt sich<br />
feststellen: Indem die raumlose Information in einem Raumkontext<br />
verortet werden kann, kann die raumbasierte Zeitformulierung mit einer<br />
beliebigen Information überlagert werden. Und anders herum, kann der<br />
Nutzer auch eine beliebige raumlose Information in einer raumbasierten<br />
Zeitformulierung wiederfinden.<br />
{Beispiel???}<br />
31
3 Verwandte Arbeiten<br />
3.1 Über Bilder aus Ort und Zeit<br />
Die Spezifikation des Feldes, in dem verwandte Arbeiten zu suchen sind,<br />
wirft die Notwendigkeit auf, die Verwandtschaft und somit die Vergleichskomponenten<br />
zu definieren. Besonders spannend erweist sich dabei,<br />
die Betrachtung auf jene Felder zu lenken, in denen entweder versucht<br />
wurde, Zeit und Raum in einen bildnerischen Kontext zu bringen, oder in<br />
denen der Ansatz gewagt wurde, durch Dehnung der Ebene die Abbildungssmöglichkeiten<br />
zu erweitern.<br />
Verallgemeinernd lässt sich die Auswahl auf Formulierungen kartografischer<br />
Natur eingrenzen. Dort finden sich viele Ansätze, die auf den auch<br />
von Jacques Bertin formulierten Abbildungsvorschriften basieren und<br />
je eine Informationsgröße auf eine visuelle Variable projizieren. Somit<br />
kann sich die Darstellungsarbeit auf Erkenntnisse stützen, welche etwa<br />
die Eigenschaften Position, Größe, Helligkeit, Muster, Farbe, Richtung<br />
und Form zielgerichtet zur Vermittlung von Assoziativität, Selektivität,<br />
Ordnung und Quantität einsetzen (vgl. [Bertin 74]). In diesem Geist existieren<br />
viele Arbeiten unter Nutzung von Heatmaps über Scatterplots bis<br />
hin zu Sparklines. Doch gerade im Umfeld der experimentellen Kartographie<br />
und nicht zuletzt unter Ausnutzung von Animationstechniken und<br />
interaktiven dreidimensionalen Darstellungsmöglichkeiten zeigen sich<br />
Ansätze, welche die klassischen Methoden erweitern und neue Anwendungsfelder<br />
erschließen. Diese Ansätze sind nicht zwangsläufig auf die<br />
Nutzung moderner Rechentechnik angewiesen; ein Blick etwa in die<br />
Analysen Tuftes (vgl. Kapitel Kapitel 3.5 – Abfolgen durch Multiple. Ort<br />
+ Ort = Zeit und Kapitel Kapitel 3.6 – Komposition und Verschmelzung<br />
von Sequenzen. Ort = Ort = Zeit) offenbart eine lange Tradition bei der<br />
Entwicklung situativ integrierender Implantationen.<br />
Im folgenden wird zunächst der gängige Ansatz geschildert, Ort und<br />
Zeit in verschiedenen Teilbereichen des Gesamtschaubildes zu trennen.<br />
Daraufhin werden Arbeiten vorgestellt, die sich mit der visuellen Abbildung<br />
von Erlebniszeit in dargestellte Zeit auseinandersetzen. Aus den<br />
32
Verwandte Arbeiten – Trennung der Komponenten. Ort + Zeit<br />
Regionalwissenschaften entspringt der Ansatz, Zeit durch die Nutzung<br />
von Tiefe darzustellen. Den Abschluss des Kapitels bildet eine Betrachtung<br />
von Arbeiten, die sich Wiederholungen und deren Verwebung zu<br />
Nutzen machen, um eine zeitliche Dimension aufzuspannen.<br />
3.2 Trennung der Komponenten. Ort + Zeit<br />
Eine verbreitete Vorgehensweise zur Darstellung von Informationen im<br />
Ort-Zeit-Kontext ist die Trennung der Komponenten Ort und Zeit in zwei<br />
separate visuelle Elemente.<br />
Abb. 3:<br />
Visualisierung von weltweitem Waffenhandel mittels ARMSFLOW<br />
Das Projekt Armsflow [@armsflow] vom Stockholm International Peace<br />
Research Institute setzt sich mit dem weltweiten Waffenhandel im Verlauf<br />
des letzten halben Jahrhunderts auseinander (siehe Abb. 3). Eine webbasierte<br />
interaktive Informationsgrafik bietet Aufschluss über die Waffengeschäfte<br />
zwischen den einzelnen Ländern. Der große Hauptbereich der<br />
Grafik besteht aus einer schematischen Weltkarte. Diese ist mit Kurven<br />
überlagert, welche die jeweils miteinander handelnden Länder verbinden<br />
und deren Breite das Handelsvolumen zwischen den beiden widerspiegelt.<br />
Dieser Grafik ist ein weiter unten liegender Bereich angegliedert, der<br />
aus einer horizontalen Aufreihung von Kreisen besteht. Jeder einzelne<br />
Kreis symbolisiert ein Jahr, sein Durchmesser beziffert das Gesamt-<br />
33
volumen an Waffengeschäften im entsprechenden Zeitraum. In dieser<br />
Ausgangsansicht lässt sich aus der Karte ablesen, welche Länder im<br />
aktuell fokussierten Jahr mit besonders vielen, besonders wenigen oder<br />
gar keinen Waffen gehandelt haben. Aus der Kreisaufreihung der Zeitleiste<br />
wird ersichtlich, in welchen Epochen die Welt von starkem oder<br />
weniger starkem Waffenhandel betroffen war. Als Interaktionsangebot<br />
stehen dem Nutzer Möglichkeiten zur Fokussierung auf ein einzelnes<br />
Land oder ein einzelnes Jahr zur Verfügung. Durch das Anklicken eines<br />
Kreises in der Zeitleiste stellt die Weltkarte nur die Waffenverkäufe des<br />
dem Kreis zugeordneten Jahres dar, durch das Anklicken eines Landes<br />
nur den Waffenhandel unter dessen Beteiligung. Durch Nacheinanderausführung<br />
der beiden unterschiedlichen Fokussierungsarten kann der<br />
Darstellungskontext auf ein bestimmtes Land in einem bestimmten Jahr<br />
eingegrenzt werden. Dieser Ansatz ermöglicht ein gezieltes Eintauchen in<br />
die zugrunde liegenden Informationen und stellt anschauliche und leicht<br />
durchdringbare Suchergebnisse bereit. Sollen komplexe Zusammenhänge<br />
in der globalen Entwicklung erkannt und verglichen werden – etwa<br />
die Entwicklung des Waffenverkaufs des Sowjetblocks während und<br />
nach dem Ende des Kalten Krieges – sind aufgrund der eingeschränkten<br />
zeitlichen Vergleichbarkeit viele Interaktionsschritte vonnöten, was auch<br />
einen nicht zielgerichteten stöbernden Zugang erschwert.<br />
3.3 Animierte Konzepte. Zeit = Zeit<br />
Abb. 4: Screenshots aus Multiplicity, The Road Map. Israelischer<br />
Reisender<br />
Das Projekt ,The Road<br />
Map‘ der Mailänder<br />
Agentur für Territorialforschung<br />
Multiplicity<br />
thematisiert die unterschiedlichen<br />
Lebensbedingungen<br />
von Israelis<br />
und Palästinensern.<br />
In einer Videoinstallation<br />
mit zwei Leinwänden und vier Fernsehern laufen Ausschnitte der<br />
Reise eines Israeli, der von Kiriat Arba nach Kudmin, und eines Palästinensers,<br />
der von Hebron nach Nablus fährt. Start und Ziel der beiden<br />
Reisen liegen auf dem gleichen Breitengrad und in unmittelbarer Nähe<br />
zueinander, je eine Leinwand ist einem Reisenden gewidmet. Während<br />
34
Verwandte Arbeiten – Animierte Konzepte. Zeit = Zeit<br />
der Israeli das Ziel in einer Stunde und fünf Minuten auf direktem Weg<br />
auch durch Sonderzonen erreicht, benötigt der Palästinenser fünf<br />
Stunden und 20 Minuten, wobei er viele Umwege und wechselnde<br />
Verkehrsmittel nutzen muss (via [Thompson] 08, S. 70-71).<br />
Das Mashup<br />
Weeplaces [@<br />
weeplaces] visualisiert<br />
den zeitlichen Ablauf<br />
der Check-ins von<br />
Nutzern der standortbezogenen<br />
Dienste<br />
Abb. 5: Weeplaces. Der aktuell dargestellte Check-in befindet<br />
Foursquare, Facebook<br />
Places und Gowalla.<br />
Auf einer abstrahierten<br />
sich am dicken Ende des gelben Strahls. Die Verjün-<br />
Karte heben kleine<br />
gung des Strahls hebt den zeitlichen Abstand hervor<br />
blaue Kreise diejenigen<br />
Orte hervor, an denen der Nutzer eingecheckt hat. Sofern er dieses an<br />
einem Ort öfter getan hat, weist eine Ziffer im vergrößerten Kreis auf die<br />
genaue Anzahl hin. Verbunden werden die Kreise in chronologischer<br />
Reihenfolge durch eine animierte, gelbe Linie, wobei die Linienbreite über<br />
die vergangene Zeit seit dem Ortswechsel informiert. Ergänzt wird das<br />
Schaubild durch ein Liniendiagramm, aus dem die Anzahl der Check-ins<br />
eines jeweiligen Tages hervorgehen (siehe Abb. 5).<br />
The Road Map und Weeplaces haben bei allen konzeptionellen und<br />
thematischen Unterschieden gemeinsam, dass sie zu der Kategorie von<br />
Visualisierungen gehören, die Erlebniszeit auf dargestellte Zeit abbilden.<br />
Die Videoinstallation entwickelt den Reisepfad auf der Karte abwechselnd<br />
mit Videoeinspielungen in geraffter Reisegeschwindigkeit und<br />
ermöglicht somit einen direkten Vergleich des Reisefortschritts und<br />
der emotional behafteten Reiseumstände beider Parteien. Weeplaces<br />
lässt die Linien-Enden mit fortlaufender Zeit pfeilartig von Check-in zu<br />
Check-in springen. So bekommt der Betrachter durch schnelle, dynamisch<br />
anmutende Ortswechsel Bewegungsmuster und vom Nutzer<br />
stark frequentierte Gegenden vermittelt. Durch das Liniendiagramm am<br />
unteren Bildrand, welches <strong>als</strong> Zeitleiste fungiert und die Einschränkung<br />
des zu betrachtenden Zeitraums ermöglicht, nimmt Weeplaces hybride<br />
Anleihen bei den im vorausgegangen Abschnitt vorgestellten Arbeiten,<br />
die auf einer Trennung von Zeit und Ort basieren.<br />
35
{http://www.zeit.de/datenschutz/malte-spitz-vorratsdaten<br />
Tilly???}<br />
3.4 Zeit durch Tiefe<br />
Abb. 6: Space-Time Path nach Hägerstrand<br />
Einen anderen Weg schlägt Torsten<br />
Hägerstrand mit dem Aufsatz What<br />
about people in regional<br />
science [Hägerstrand 70] ein. Auf<br />
der Suche nach einer Möglichkeit,<br />
die „Lebensbedingungen in<br />
verschiedenen Teilen des Landes<br />
[Schweden] zu vergleichen und<br />
Wege zu entdecken, diese Bedingungen<br />
bezogen auf Zugang zu<br />
Arbeit, Bildung, Gesundheitswesen,<br />
kulturelle Ressourcen und<br />
Erholung anzupassen,“ 56 und mit<br />
dem „Gefühl, dass Regionalwissenschaften<br />
[…] eine zu starke Ausrichtung auf Studien mit rein ökonomischen<br />
Gesichtspunkten haben, die andere Positionen missachten,<br />
welche eine lebenswerte Welt ausmachen“ 57 , konstatiert er, dass die<br />
„Spezialisierung von Forschung, Technologie und Verwaltung ein vereinendes<br />
Gegengewicht“ brauche. Dazu schlägt Hägerstrand ein Rahmenmodell<br />
zur Untersuchung von Möglichkeiten und Einschränkungen<br />
menschlicher Aktivitäten im integrierten Raum-Zeit-System vor, das auf<br />
den Visualisierungsformen Raum-Zeit-Pfad und dem Raum-Zeit-Prisma 58<br />
beruht.<br />
Der Raum-Zeit Pfad stellt die Ortshistorie eines Menschen dar, indem<br />
er seine geographische Aufenthaltsposition auf die x- und y- Koordinaten<br />
des Darstellungssystems abbildet, während der Zeitpunkt des<br />
Aufenthalts in die z-Achse projiziert wird. Der so entstehende dreidimen-<br />
56 Hägerstrand 89, S. 1. Im englischen Original: ,to compare living conditions in various<br />
parts of the country and find out ways of equalising these conditions with respect to<br />
access to jobs, education, health care, cultural resources and recreation‘<br />
57 ebenda. Im englischen Original: ,feeling, that regional science […] had too strong a bias<br />
towards studies of the purely economic landscape, neglecting other items which make<br />
up a livable world‘<br />
58 im englischen Original <strong>als</strong> space-time path und space-time prism bezeichnet<br />
36
Verwandte Arbeiten – Zeit durch Tiefe<br />
sionale Pfad ermöglicht eine lückenlose und gleichzeitige Darstellung<br />
sämtlicher aufgesuchter Orte in zeitlichem Kontext. Das Verweilen ergibt<br />
somit vertikale Linien über den entsprechenden Orten, die durch schräge<br />
Ortswechsel-Linien miteinander verbunden sind. Aus dem Gefälle der<br />
Ortswechsel-Linien lässt sich die Geschwindigkeit des Ortswechsels<br />
ablesen.<br />
Das Raum-Zeit Prisma erweitert den Raum-Zeit Pfad um einen Interpretationsspielraum.<br />
Anstatt eine gerade Linie zwischen zwei Aufenthaltsorten<br />
einzuzeichnen, wird der Unschärfe der Information Rechnung<br />
getragen, indem jeder Ortswechsel durch ein Prisma dargestellt wird,<br />
das ein eigenes orthogonales Raum-Zeit Koordinatensystem enthält.<br />
Somit lassen sich aus dem Innenraum des Prismas sämtliche potenziellen<br />
Reiseverläufe ablesen.<br />
37
3.5 Abfolgen durch Multiple. Ort + Ort = Zeit<br />
Abb. 7: ,The Horse in Motion‘ von Eadweard Muybridge, 1878.<br />
„Multiple Bilder legen Wiederholung und Änderung, Muster und Überraschung<br />
offen – die grundlegenden Elemente der Idee von Information. Multiple schildern<br />
direkt Vergleiche, die Essenz statistischen Denkens.<br />
Multiple erweitern die Dimension des Flachlands von Papier und Bildschirmen,<br />
der Sicht Tiefe gebend durch Ordnen von Feldern und Informationsstücken.<br />
Multiple erstellen visuelle Listen von Objekten und Aktivitäten, Nomina und<br />
Verben, die dem Nutzer helfen zu analysieren, zu vergleichen, zu differenzieren,<br />
zu entscheiden […].<br />
Multiple repräsentieren und erzählen Sequenzen von Bewegung.<br />
Multiple verstärken, intensivieren und verfestigen den Sinngehalt von<br />
Bildern.“ 59<br />
59 Tufte 97, S. 105. Im englischen Original: ,Multiple images reveal repetition and change,<br />
pattern and surprise – the defining elements in the idea of information. Multiples directly<br />
depict comparisons, the essence of statistical thinking. Multiples enhance the<br />
dimensionality of the flatlands of paper and computer screenm giving depth to vision<br />
by arranging panels and slices of information. Multiples create visual lists of objects and<br />
activities, nouns and verbs, helping viewers to analyze, compare, differentiate, decide<br />
[…]. Multiples represent and narrate sequences of motion. Multiples amplify, intensify<br />
and reinforce the meaning of images.‘<br />
38
Verwandte Arbeiten – Abfolgen durch Multiple. Ort + Ort = Zeit<br />
Mit diesem Credo eröffnet der Informationswissenschaftler Edwart R.<br />
Tufte die Untersuchungen zu Multiples in Space and Time denen er sich<br />
in dem Buch Visual Explanations widmet. Drei Beispiele zu Hilfe nehmend<br />
analysiert er, wie durch die Konstruktion von Bildsequenzen Zeit in das<br />
statische Bild implantiert werden kann, und konstatiert, dass „basierend<br />
auf der Verbindung durch Parallelität, gut gefertigte Multiple hoch auflösende<br />
Ansichten auf komplexes Material liefern“ 60 könnten. Tufte zeigt,<br />
dass bereits Aufzeichnungen von Christiaan Huygens aus dem Jahr 1659<br />
zur Untersuchung der Bewegung des Saturns und seiner Satelliten auf<br />
Multiplen beruhten (vgl. [Tufte 97], S. 106).<br />
Am Beispiel des Bildes The Horse in Motion wird gezeigt, dass zur<br />
Darstellung von Bewegung in stillen Bildern Zeit durch Fläche in ihrer<br />
segmentierenden Dimension ersetzt werden kann, da sich Änderungen<br />
zwischen angrenzenden Bildfragmenten abschätzen ließen. Der Benutzer<br />
müsse dafür zwischen den Bildfragmenten interpolieren, so dass die<br />
Lücken mental geschlossen würden. Allerdings wird auch festgestellt,<br />
dass eine derartige Darstellung von Bewegung, respektive Zeit, Probleme<br />
bei der Abbildung von Rhythmen habe, da weder Dauer noch ein<br />
konkreter Bewegungsfluss dargestellt würden.<br />
Organisieren lassen sich Multiple nach Tufte entsprechend der Darstellungsabsicht<br />
auf Rastern, mithilfe von Annotationen, überlappend oder<br />
<strong>als</strong> narrative Sequenz. Dabei wird empfohlen, den Darstellungsapparat<br />
visuell möglichst reduziert zu gestalten, so dass sich die eigentliche<br />
Information in dem verfügbaren Platz ausbreiten kann.<br />
60 ebenda, S. 112. Im englischen Original: ,Relying on the links of parallelism, well-crafted<br />
multiples provide high resolution views of complex material.‘<br />
39
3.6 Komposition und Verschmelzung von Sequenzen.<br />
Ort = Ort = Zeit<br />
Abb. 8:<br />
1965.<br />
,Men and Insects‘ von L. Hugh Newman,<br />
Als noch konsequenter<br />
auf das Aktivitätsanliegen<br />
Tuftes eingehend,<br />
dass sich durch<br />
Ausnutzung der Fläche<br />
die „Daten sowohl<br />
über den Raum (in zwei<br />
oder drei Dimensionen)<br />
<strong>als</strong> auch über die Zeit<br />
bewegen“ 61 und dass<br />
„multivariate Komplexität<br />
fast unmerklich in die grafische Architektur integriert werden kann,<br />
so behutsam und unauffällig, dass Betrachtende kaum bemerken, dass<br />
sie in eine Welt mit vier oder fünf Dimensionen schauen“ 62 , erweisen sich<br />
Sequenzen, die derart komponiert sind, dass sie in einem gesamtbildnerischen<br />
Zusammenhang verschmelzen. Von Tufte „narrative Grafiken von<br />
Raum und Zeit“ 63 genannt, zeichnen sie sich durch eine Lösung vom<br />
Diktat der Trennung darzustellender Informationskomponenten in<br />
disjunkte visuelle Variablen aus, um ihren Schwerpunkt im Erzählerischen<br />
und im ästhetisch begründeten Gesamten zu suchen. Als Beispiel führt<br />
Tufte unter anderem die figurative Karte an, die sich Napoleons Marsch<br />
nach Moskau annimmt (siehe Abb. 9), und eine Darstellung vom Lebenszyklus<br />
des japanischen Käfers (siehe Abb. 8).<br />
Die Anordnung der einzelnen Stationen des Käferlebens, von der Entwicklung<br />
der Puppe und Larve über das Schlüpfen bis hin zum Legen der Eier,<br />
erinnern an die Sequenzen aus Kapitel 3.5. Anders <strong>als</strong> in den dortigen<br />
Beispielen existieren hier jedoch keine harten Schnitte zwischen den<br />
Sequenzsegmenten. Aus der Verbindung der verschiedenen Erdtiefen<br />
der Puppenposition ergibt sich ein Tunnel, der in der Realität so nicht<br />
existiert, aber die Metaphorik des Weges beschreibt. Die in der Bildmitte<br />
61 Tufte 83, S. 40. Im englischen Original: ,the data are moving over space (in two or three<br />
dimensions) as well as over time‘<br />
62 ebenda. Im englischen Original: ,multivariate complexity can be subtly integrated into<br />
graphical architecture, integrated so gently and unobtrusively that viewers are hardly<br />
aware that they are looking into a world of four or five dimensions‘<br />
63 ebenda. Im englischen Original: ,Narrative Graphics of Space and Time‘<br />
40
Verwandte Arbeiten – Komposition und Verschmelzung von Sequenzen. Ort = Ort = Zeit<br />
positionierte Pflanze ist derart gestaltet, dass bei natürlichem Aussehen<br />
die Position von Blättern und Frucht einem bestimmten Zeitraum zugeordnet<br />
werden kann und einen Hinweis auf das saison- und wachstumsbedingte<br />
Ernährungsverhalten suggeriert.<br />
Abb. 9: Figurative Karte zu den Verlusten französischer Soldaten von Charles Joseph Minard<br />
(1781 - 1870)<br />
Nicht auf Repetition basierend, aber im integrierenden Sinne komplexer,<br />
gestaltet sich das Beispiel von Napoleons Feldzug. Hier werden die Informationen<br />
Truppenstärke, Truppenposition, Marschrichtung, Angriff/<br />
Rückzug, Zeit, Temperatur in einem Gesamtbild zusammengefasst,<br />
wobei die Eigenschaften Kartenposition, Farbe, Richtung, Größe und<br />
Text derart verwoben werden, dass das Bild mit 5 bildnerischen Variablen<br />
6 Informationsdimensionen abbildet.<br />
41
4 Synthese und Konzeption<br />
4.1 Anforderungen<br />
Das Ziel dieser <strong>Diplomarbeit</strong> besteht in der Entwicklung einer interaktiven<br />
generischen Visualisierung. Sie soll dem Betrachter ermöglichen,<br />
erlebte Zeit zu rekapitulieren und sich in dieser zu orientieren, so dass<br />
er Zeiträume und einzelne Ereignisse adressieren kann, ohne sich an ein<br />
konkretes Datum, etwa der Form 31.06.2010, erinnern zu müssen. Der<br />
Zeitbegriff, der diesem Ansatz zugrunde liegt, kann unter Berufung auf<br />
Baumgartner und Probst <strong>als</strong> individuelle Erlebniszeit bezeichnet werden<br />
(vgl. Kapitel 2.3 – Betrachtungen zu Raum und Zeit). Wird das Beispiel<br />
aus Kapitel 1.2 veranschaulichend zu Hilfe genommen, ist eine Darstellungsform<br />
gesucht, die den Journalisten bei der Suche nach gespeicherten<br />
Notizen unterstützt. Dabei soll er nicht gezwungen sein, nur über<br />
inhaltliche Kriterien suchen zu müssen. Vielmehr soll er die zusätzliche<br />
Möglichkeit erhalten, Informationen durch Eingrenzung ihrer Entstehungs-<br />
und Bearbeitungszeiträume aufzuspüren. Diese Zeiträume sollen<br />
nicht durch abstrakte, physikalische Naturzeit, sondern durch Erlebnisse<br />
beschrieben werden, die anhand des Ortes adressiert werden können,<br />
an dem sie stattfanden.<br />
Damit die Visualisierung Fragen wie „erstellt nach Treffen in Hotel A“,<br />
„gespeichert vor Reise nach B“, „überarbeitet während längerem Aufenthalt<br />
in C“ oder „aufgezeichnet bei Pause von regelmäßigen Recherchen<br />
in D“ (vgl. Kapitel 1.2 – Motivation) beantworten kann, sollen zunächst<br />
Anforderungen aufgestellt werden, deren Grundlage die Synthese der<br />
allgemeinen Untersuchungen aus Kapitel 2 und 3 bildet.<br />
Lineares Zeitverständnis<br />
In Kapitel 2.4 wurde das Konzept der Gehirnuhr vorgestellt. Die Gehirnuhr<br />
sendet fortlaufend Impulse aus, wobei die Impuls-Intensität abhängig<br />
von der Wahrnehmung äußerer Einflüsse und somit auch direkt abhängig<br />
von der Aufmerksamkeit ist. Diese Impulse werden inkrementell ausgesandt;<br />
der aktuelle Impuls folgt immer nur dem letzten, ohne dass dabei<br />
ein Querverweis auf eine zyklische Struktur, etwa auf einen Impuls vor<br />
24 Stunden, entstehen kann. Ein Winter kehrt wieder, ein Tag beginnt<br />
regelmäßig von neuem. Doch eine derart beschriebene Zeit nennt Baum-<br />
42
Synthese und Konzeption – Anforderungen<br />
gartner Naturzeit, welche keine direkte Verbindung zur Erlebniszeit hat<br />
(vgl. Kapitel 2.3 – Betrachtungen zu Raum und Zeit). Zwar erlebt der<br />
Mensch diese naturgegebenen, wiederkehrenden Rhythmen; maßgeblich<br />
für seine Wahrnehmung von Zeiträumen und Zeitpunkten zeichnet<br />
jedoch die linear zielgerichtete Gegebenheit, dass er am Anfang seines<br />
Lebens geboren wird, an dessen Ende stirbt, und währenddessen<br />
sukzessive älter wird. Um eingangs gestellten Fragen ein auf der Erlebniszeit<br />
und der Gehirnuhr basierendes visuelles Konstrukt zur Seite zu<br />
stellen, bedarf es somit einer Visualisierungstechnik, die auf einem linearen<br />
Zeitverständnis basiert.<br />
Spuren mit aktivem Ortsbezug.<br />
Wird die kausale Kette aus Kapitel 1.2 und 2.4 wieder aufgenommen,<br />
liegt es nahe, die Visualisierung auf Orten basieren zu lassen, die<br />
bewusst wahrgenommen werden. Kapitel 2.1 stellte die zunehmende<br />
Verbreitung von standortbezogenen Diensten in gängigen digitalen sozialen<br />
Netzwerken vor. Es zeigt sich, dass derartige Dienste einen reaktiven<br />
Charakter besitzen, <strong>als</strong>o Orte anhand einer menschenlesbaren Beschreibung<br />
aktiv und bewusst vom Nutzer gewählt werden müssen. Aufgrund<br />
der allgemeinen Verfügbarkeit und zunehmenden Verbreitung von standortbasierten<br />
Diensten, sollen diese exemplarisch zur Gewinnung von<br />
Spuren mit aktivem Ortsbezug (vgl. Kapitel 2.2 – Digitale Spuren) genutzt<br />
werden.<br />
Kognitive Karten<br />
Kapitel 2.5 (‚Über die Wahrnehmung von Orten‘) zeigte, dass das rezipierte<br />
Abbild von Orten durch Linienbegradigung, Winkelvereinfachung,<br />
Objektverschiebung und hierarchische Gruppierung charakterisiert ist<br />
und vorwiegend durch das Erleben von Wegen, Grenzlinien, Bereichen,<br />
Brennpunkten und Merkzeichen konstruiert wird. Es stellt sich heraus,<br />
dass Wegen und Brennpunkten die meiste Aufmerksamkeit zukommt;<br />
und dass Grenzlinien, Bereiche und Merkzeichen stark von der individuellen<br />
Wahrnehmung von Umwelt abhängen, so dass zu deren Extraktion<br />
aus abstrakten geographischen Informationen zunächst weitere umfassende<br />
Untersuchungen angestellt werden müssen.<br />
43
Abb. 10: The London Underground. Fahrplan von Harry Beck, 1933<br />
Brennpunkte stellen per Definition Knoten und Konzentrationspunkte<br />
dar, die Ziel und Ausgangspunkt von Wanderungen sind und somit <strong>als</strong><br />
Venue, beziehungsweise <strong>als</strong> Grundlage für einen potenziellen Check-in<br />
dienen. Zwischen Ziel und Ausgangspunkt, zwischen zwei Check-ins,<br />
befindet sich der Weg, der zurückgelegt werden muss, um vom ersten<br />
zum zweiten Brennpunkt zu gelangen. Check-ins und Wege werden<br />
mittels kognitiver Karten <strong>als</strong> Brennpunkte und Bewegungslinien erinnert,<br />
indem sie begradigt, unter Umständen verzerrt und in einen hierarchischen<br />
Subkontext eingeordnet werden. Diese Erkenntnisse finden sich<br />
bereits vor dem Entstehen von Lynchs Theorie in Harry Becks U-Bahn-<br />
Plan für die Londoner Tube wieder. Das Stadtbild, das die Grundlage für<br />
die Plan bildet, ist dahingehend verzerrt, dass die Brennpunkt gewordenen<br />
Haltestellen gleichmäßiger <strong>als</strong> in der Realität verteilt sind, und<br />
die Weg gewordenen U-Bahn-Linien sich auf Geraden befinden, die in<br />
Winkeln von 45°, 90°, 135° oder 180° aufeinander treffen. Weiter sind die<br />
unterschiedlichen U-Bahn-Linien farblich voneinander abgegrenzt (siehe<br />
Abb. 10).<br />
44
Gleichzeitigkeit<br />
Synthese und Konzeption – Anforderungen<br />
Aus der Tatsache, dass die mentale Rekonstruktion von Zeit sich<br />
maßgeblich durch das Einordnen eines Zeitpunkts in das Jetzt, das<br />
Davor und das Danach ergibt (vgl. Kapitel 2.4 – Über die Wahrnehmung<br />
von Zeit), entsteht zunächst die Forderung nach gleichzeitiger Betrachtbarkeit<br />
unterschiedlicher Zeitpunkte, im Folgenden <strong>als</strong> die Forderung<br />
nach Gleichzeitigkeit bezeichnet.<br />
A<br />
B<br />
B C<br />
Abb. 11: perspektivische und isometrische<br />
Darstellung von Ortsewechseln zwischen<br />
drei Brennpunkten<br />
A<br />
C<br />
Da Gleichzeitigkeit zum einen die<br />
Betrachtungsmöglichkeit von Orten<br />
zu beliebigen Zeitpunkten erfordert,<br />
ist eine Abbildung der erlebten<br />
Zeit auf das gestalterische Medium<br />
Zeit (vgl. Kapitel 3.3 – Animierte<br />
Konzepte. Zeit = Zeit) ausgeschlossen,<br />
da sie keine Vergleichsmöglichkeiten<br />
unterschiedlicher<br />
Zeitabschnitte ermöglicht. Da<br />
Gleichzeitigkeit sich auch auf die<br />
Betrachtungsmöglichkeiten beliebiger<br />
Orte bezieht, erweist sich die<br />
Verwendung einer dreidimensionalen<br />
Darstellung, wie von Hägerstrand<br />
entwickelt, (vgl. Kapitel 3.4<br />
– Zeit durch Tiefe) <strong>als</strong> problematisch,<br />
da dessen Abbild entweder<br />
parallel projiziert werden oder<br />
fluchten müsste. Fluchtet sie, so<br />
entsteht mit zunehmendem Abstand des Betrachters zum Bild ein visuell<br />
schwer zu durchdringendes Gebilde (siehe Abb. 11 oben). Wird sie<br />
parallel projiziert, so verkommen die Informationen auf der globalen<br />
Tiefenachse (z-Achse) zu einem schwer wahrnehmbaren Abstraktum<br />
(siehe Abb. 11 unten). Somit ist gleichzeitige Betrachtung unterschiedlicher<br />
Orte nicht gewährleistet, und der Verlust an Überblick und ein ständiges<br />
Drehen sind die Folge. Auch die Trennung von Zeit und Raum in<br />
verschiedene Komponenten (vgl. Kapitel 3.2 – Trennung der Komponenten.<br />
Ort + Zeit) kann nur entweder die Raum- oder die Zeit-Komponente<br />
gleichzeitig darstellen. Entweder werden Informationen nur in<br />
Relation zur Zeit oder nur zu den verknüpften Orten dargestellt – jedoch<br />
nicht gleichzeitig.<br />
45
Muster<br />
Um die Charakteristika der gleichzeitig betrachteten Zeitpunkte voneinander<br />
abgrenzen und miteinander in Beziehung setzen zu können, ergibt<br />
sich weiter die Notwendigkeit, Muster zu schaffen, welche die Eigenart<br />
sowohl eines einzelnen Zeitpunkts <strong>als</strong> auch eines Zeitraums widerspiegeln<br />
können. So wird mit dem Musterpotential die Forderung nach einer<br />
möglichst umfassenden Übersetzbarkeit von Mustern, die sich aus den<br />
Typen unternommener Reisen ergeben, in grafische Muster beschrieben.<br />
Exemplarisch sollen die Typen<br />
- Pendeln,<br />
- Unterbrechung des Pendelns,<br />
- einfache Ausflüge,<br />
- Rundreisen und<br />
- außergewöhnliche Ortswechsel<br />
definiert und konkretisiert werden. Das Pendeln beschreibt sich wiederholende,<br />
alternierende Paare von Ortswechseln zu annähernd gleichen<br />
Tageszeiten, etwa zwischen Arbeitsplatz und privater Wohnung. Dessen<br />
Unterbrechung besitzt eine gleichwertige Darstellungsnotwendigkeit:<br />
Regelmäßigkeit und Unregelmäßigkeit bedingen sich hier, da die Unterbrechung<br />
nur Regelmäßiges unterbrechen kann und das Regelmäßige<br />
nur durch Unterbrechung eingegrenzt und gefasst werden kann. Die<br />
Unterbrechung kann durch einfaches Auslassen des Pendelns, etwa in<br />
Folge einer Krankheit, oder durch ein alternatives Ziel, etwa bei einer<br />
Geschäfts- oder Urlaubsreise, entstehen.<br />
Abb. 12: Musterpotential aus Reisetypen. Pendeln, Unterbrechung, Rundreise, Ausflug,<br />
außergewöhnlicher Ortswechsel<br />
Einfache Ausflüge bestehen aus Wechseln zu vorwiegend berechenbaren<br />
Zeitpunkten an unterschiedliche Orte, etwa Wochenendausflüge oder<br />
Sommerurlaube. Rundreisen zeichnen sich dadurch aus, dass deren<br />
einzelne Stationen gegenüber dem Gesamtkontext der Reise eine räum-<br />
46
Synthese und Konzeption – Anforderungen<br />
liche Nähe besitzen und dass der geografische Endpunkt einer Rundreise<br />
dem Anfangspunkt entspricht. Außergewöhnliche Ortswechsel<br />
beschreiben Wechsel zu Orten, die entweder aus bekannten Zeitrastern<br />
ausbrechen oder bislang unbekannte, ferne Ziele definieren.<br />
Da eine Auflistung zu Musterpotential, durch die Abhängigkeit vom<br />
Charakter der beobachteten Person, weder <strong>als</strong> vollständig noch in ihren<br />
Kategorien <strong>als</strong> disjunkt gelten kann, muss das Musterpotential in einem<br />
generischen Ansatz gesucht werden, dessen Abbildung einer möglichst<br />
genügsamen und erweiterbaren Vorschrift entspricht. Die Formalisierung<br />
darf nur so strikt ausfallen, dass ein größtmögliches Maß an Offenheit die<br />
Darstellung weiterer, bis dato noch undefinierter oder vermischter Reisetypen<br />
zulässt.<br />
Komposition von Multiplen<br />
Im Kapitel 3.5 wurden Multiplen in sequenzieller Anordnung narrative<br />
Eigenschaften zugesprochen. Sie sollen aufgrund ihrer Fähigkeit, Muster<br />
zu generieren, Überraschungen offen zu legen und Vergleichbarkeit<br />
herzustellen, die Grundlage dieses Konzepts darstellen. Anders <strong>als</strong> in<br />
den Ordnungstypen, die sich in den vorgestellten verwandten Arbeiten<br />
wieder finden, sollen in dieser Arbeit Multiple nicht auf einem starren<br />
Raster mithilfe von Annotationen oder Transparenzüberlagerung geordnet<br />
werden. Um der Darstellungsproblematik von Multiplen bei Rhythmus<br />
und verstrichener Zeit zwischen Sequenzsegmenten zu begegnen, soll<br />
der Ansatz dahingehend überdacht werden, dass die Multiplenordnung<br />
auf einer Gesamtkomposition beruht, die vom Betrachter aktiv beeinflussbar<br />
ist, und welche die verstrichene Zeit durch die Nutzung von<br />
Distanz erfahrbar macht (vgl. Kapitel 3.6 – Komposition und Verschmelzung<br />
von Sequenzen. Ort = Ort = Zeit).<br />
Interaktion durch Eintauchen<br />
Das Suchen von Informationen, das Abgleichen von Mustern, das<br />
Vergleichen von Zeiträumen und das Eingrenzen von Betrachtungsregionen<br />
besteht aus Fokussieroperationen auf geographischen Räumen<br />
und Zeiträumen. Da derartiges Fokussieren in einem Explorationskontext<br />
verortet ist, der auf Mechanismen des Eintauchens und Zurücktretens<br />
basiert, soll das Konzept des Interaktionsdesigns aus den Prinzipien von<br />
skalierbaren Nutzeroberflächen entwickelt werden.<br />
47
Zielbereich <strong>als</strong> Grundlage für Überlagerung<br />
Aus der konzeptionellen Gegebenheit nicht Mittel zum Zweck, sondern<br />
Teil eines interaktiven, gestalterischen Ganzen zu sein, ergeben sich<br />
die Ansprüche der Zielbereichsgestaltung (vgl. Kapitel 2.7 – Überlagerung<br />
und Verortung). Es leitet sich die fundamentale Forderung nach<br />
der Berücksichtigung visueller und interaktiver Ressourcen ab. Da die<br />
Gestaltung nicht ausschließlich der Verbildlichung von Zeit und Raum,<br />
sondern in entscheidendem Maß der Schaffung eines Zielbereichs dient,<br />
in die eine weitere Information hinein projiziert wird, muss dieser überlagerten<br />
Information genügend Platz zur Ausbreitung zugesprochen<br />
werden. Die Ausnutzung sämtlicher visueller Variablen für die Raum-Zeit<br />
Darstellung mag die Vermittlung des Zielbereichs <strong>als</strong> solchen optimieren.<br />
Sie lässt jedoch wenig Gestaltungsraum für die Abbildung der eigentlich<br />
zu adressierenden überlagerten Information.<br />
Gleiche Betrachtungen gelten für die Konzeption von Bedienelementen<br />
und Interaktionstechniken. So stellt sich die Frage, ob Orte oder überlagerte<br />
Inhalte durch ein Suchfeld eingegrenzt werden sollen; ob über<br />
eine Auswahlliste verfügbare Monate oder zu überlagernde Medientypen<br />
selektiert werden. Und es muss geklärt werden, wie viele Antworten<br />
tragbar sind, die den Kompromiss in beiden suchen.<br />
Zusammenfassend<br />
Es gilt, eine lineare Zeitdarstellung zu entwickeln, die sich an den Prinzipien<br />
der skalierbaren Benutzeroberflächen orientiert, und deren Domäne<br />
aus den Spuren standortbezogener Dienste mit aktivem Ortsbezug generiert<br />
wird. Sie soll Bereiche, Brennpunkte und Wege nach den Erkenntnissen<br />
von kognitiven Karten darstellen und sich an der Darstellungsform<br />
der U-Bahn-Karte Becks orientieren. Mittels zeitlicher und räumlicher<br />
Gleichzeitigkeit sollen Vergleiche ermöglicht und Muster von Reisetypen<br />
adäquat widerspiegelt werden. Das theoretisches Grundkonzept soll<br />
durch Anlehnung an Multiple entwickelt werden, die <strong>als</strong> Gesamtkomposition<br />
Rhythmen aufzeigen können und Zeitspannen erfahrbar machen. Die<br />
Nutzung gestalterischer Ressourcen soll in dem Bewusstsein erfolgen,<br />
eine Abbildungsdomäne zu schaffen, die durch verortete Informationen<br />
überlagert wird.<br />
{Schrittweise Erläuterung}<br />
48
4.2 Das Konzept ZeitRaumPost<br />
Synthese und Konzeption – Das Konzept ZeitRaumPost<br />
Zur Entwicklung des Konzepts ZeitRaumPost sei zunächst das in der<br />
Einleitung skizzierte Beispiel wieder aufgenommen. Angenommen, der<br />
Geschäftsführer wurde im Wochenrhythmus befragt, so dass im Wochenrhythmus<br />
Notizen erstellt wurden. Gesucht sind ganz bestimmte Äußerungen<br />
zum Thema Kooperation. Da Kooperation für den Geschäftsführer<br />
ein besonders wichtiges Thema ist, wurde es bei fast jedem<br />
Treffen aufgeworfen, so dass die meisten Notizen mindestens einen<br />
entsprechenden Eintrag enthalten. Relevant sind für den Journalisten<br />
aber nur die Äusserungen jenes bestimmten Tages, an dem der Interviewpartner<br />
in einer besonderen Verfassung war, wodurch die Eingrenzung<br />
auf sehr unscharfen Kriterien basiert. Er kann entweder sukzessive alle<br />
Notizen, welche die Volltextsuche zu Kooperation liefert, durcharbeiten<br />
oder mithilfe seines Kalenders versuchen, den Zeitraum durch assoziative<br />
Verknüpfung mit zeitnahen anderen Ereignissen zu erschließen. Im<br />
ersten Fall ergibt sich ein Aufwand von n Arbeitsschritten, wobei n der<br />
Anzahl durchzuarbeitender Notizen entspricht. Im zweiten Fall entstehen<br />
die fünf Arbeitsschritte: Kalender aufsuchen, Kalender durchstöbern,<br />
Zeitraum extrahieren, Notizen mittels Zeitraum eingrenzen, verbleibende<br />
n Notizen durchsuchen.<br />
Zusammenfassung getrennter Arbeitsschritte<br />
Die einzelnen Arbeitsschritte des zweiten geschilderten Falls sollen in<br />
dieser Arbeit vereint und mit der gesuchten Information in eine integrierte<br />
Gesamtdarstellung verwoben werden. Da eine lineare ortsbasierte<br />
Zeitdarstellung gesucht ist, die auf einer zweidimensionalen, ruhenden<br />
Komposition von Multiplen basiert (vgl. Kapitel 4.1 – Anforderungen),<br />
wird die Zeit zusammen mit der geographischen formalisierten Ortsinformation<br />
gleichzeitig in der Ebene dargestellt.<br />
Seismograph, Ziehen und Spreizen<br />
Ähnlich der Arbeitsweise von Seismographen, welche die Stärke von<br />
Erschütterungen auf einem durch die vorgegebene Ziehrichtung einer<br />
Papierrolle entstehenden Zeitverlauf auftragen, wird in ZeitRaumPost die<br />
Zeit mittels einer zu definierenden Richtung implantiert, die sich durch<br />
die Nutzerinteraktion ergibt und aufgrund ihrer Komplexität <strong>als</strong> Spreizrichtung<br />
bezeichnet wird. Die Interaktionsgestaltung der Benutzeroberfläche<br />
folgt den Prinzipien des Zoomable User Interfaces (vgl. Kapitel 2.6<br />
– Skalierbare Benutzeroberflächen). Durch Eintauchen in das Bild kann<br />
der Nutzer sowohl den räumlichen <strong>als</strong> auch den zeitlichen Betrachtungs-<br />
49
fokus bestimmen. Mittels einer Skalierung kann das Bild zunächst auf<br />
den zu betrachtenden geographischen Raum eingegrenzt werden. Dabei<br />
erscheinen mit zunehmenden Skalierungsgrad mehr Details, so dass<br />
aus einem Brennpunkt, der mehrere Orte gruppiert, sukzessive weitere<br />
Brennpunkte der einzelnen Orte entweichen. Durch Spreizung des Bilds<br />
kann der Nutzer die Zeit in die Darstellung implantieren. Dabei sorgen<br />
zum einen Darstellungsalgorithmen und die direkte Beeinflussbarkeit<br />
der Spreizrichtung durch den Nutzer für eine optimierte Darstellung und<br />
Minimierung von Überschneidungen.<br />
Quelle für Spuren mit aktiven Ortsbezug<br />
Spuren mit aktivem Ortsbezug werden aus der Schnittstelle des Sozialen<br />
Netzwerks foursquare ausgelesen (vgl. Kapitel 2.1 – Standortbezogene<br />
Dienste & Kapitel 2.2 – Digitale Spuren). Dieser stellt einen RSS-Feed zur<br />
Verfügung, so dass die gesamte persönliche Historie von Ort-Zeit-Tupeln<br />
ausgelesen und verarbeitet werden kann.<br />
{Schrittweise erläuterung}<br />
4.3 Das visuelle Konzept<br />
Um die Erkenntnisse zur Wahrnehmung von Orten zu berücksichtigen,<br />
verbindet das visuelle Konzept von ZeitRaumPost die Grundkomponenten<br />
von kognitiven Karten mit den Erfordernissen einer Raum-Zeit-<br />
Visualisierung. Es gilt zum einen auf der räumlichen Vereinfachung<br />
von Brennpunkten und deren Verbindung aufzubauen, die mit Verzerrung<br />
und hierarchischer Gruppierung einhergeht. Zum anderen werden<br />
die dynamischen Aspekte des Vergehens von Zeit und des Verweilens<br />
implantiert, die durch eine Verankerung von konkreter Zeitbeschreibung<br />
durch Datumsinformationen gestützt und gegliedert werden. Es wird ein<br />
Bezugssystem hinterlegt, das die Gesamtdarstellung rahmend fasst und<br />
eine überlagerte Ebene definiert, welche die Verortung zeitvarianter Informationen<br />
im Raum-Zeit-Kontext ermöglicht.<br />
50
Synthese und Konzeption – Das visuelle Konzept<br />
Das visuelle Konzept von ZeitRaumPost basiert somit auf den sechs<br />
Elementen:<br />
- Brennpunkte,<br />
- Ortswechsel,<br />
- Verweildauer,<br />
- Datumsraster,<br />
- Schlieren und<br />
- überlagerte zeitvariante Information.<br />
Brennpunkte <strong>als</strong> interaktive Anker<br />
Abb. 13: Brennpunkt normal (links) und<br />
selektiert (rechts)<br />
Fakultät<br />
Brennpunkte werden <strong>als</strong> Kreise<br />
dargestellt, deren Abbildungsposition<br />
sich aus der Formalisierung<br />
der geographischen Position und<br />
der zeitlichen Verschiebung entlang<br />
der Spreizrichtung errechnet (vgl.<br />
auch Kapitel 2.5 – Über die Wahrnehmung<br />
von Orten und Kapitel 5.5<br />
– Algorithmen zur Formalisierung<br />
des Raums). Der Kreisdurchmesser beschreibt die Neuheit des jeweiligen<br />
Brennpunkts. Ist ein Ort noch nie oder lange nicht mehr aufgesucht<br />
worden, wird der Kreis groß dargestellt, mit zunehmender Frequentierung<br />
nimmt die Größe des Kreises ab. Sie sind farbkodiert, so dass im<br />
Zeitverlauf wiederauftretende Brennpunkte visuell gruppiert werden.<br />
Wird ein Brennpunkt berührt, werden die Kreise aller Brennpunkte mit<br />
gleichem Ortsbezug grafisch erweitert. Den Kreisen wird oben rechts<br />
eine abgerundete Ecke hinzugefügt, so dass der Kreis zu einer stilisierten<br />
Sprechblase wird und sich auf der rechten Seite eine flache Kante ergibt.<br />
Diese wird <strong>als</strong> visueller Anschluss zur Typografie des daneben erscheinenden<br />
Ortsnamen genutzt (siehe Abb. 13).<br />
Ortswechsel an relativen, formalisierten Positionen<br />
t1<br />
t2<br />
Abb. 14: relative formalisierte Position.<br />
Verschiebung formalisierter Brennpunkte<br />
entlang horizontaler Spreizrichtung t<br />
Ortswechsel zeigen die räumlichen<br />
Abstände zwischen zwei Brennpunkten.<br />
Sie werden <strong>als</strong> durchgezogene<br />
Linie abgebildet, die von<br />
der relativen geographischen Position<br />
des letzten zur relativen forma-<br />
51
lisierten Position des aktuellen Brennpunkts führt. Die relative formalisierte<br />
Position wird aus der Verschiebung des formalisierten geographischen<br />
Bezugssystems entlang der zeitlichen Spreizrichtung errechnet<br />
(siehe Abb. 14).<br />
Abbildung des Verweilens<br />
Abb. 15: lokale Anpassung der vorgegebenen<br />
Spreizrichtung<br />
Die Verweildauer wird durch gestrichelte<br />
Linien dargestellt, die vom<br />
letzten Brennpunkt bis zum<br />
nächsten Ortswechselbeginn<br />
verlaufen und somit die Lücken<br />
schließen, die durch die Spreizung<br />
entlang der Spreizrichtung<br />
entstehen. Der Abstand der Strichel-Segmente<br />
entspricht einer<br />
von der Zoomstufe abhängigen konkreten Zeiteinheit. Die Linien der<br />
Verweildauer sind gerade, wenn die Ortswechsel vor und nach dem<br />
Verweilen in eine andere Richtung zeigen <strong>als</strong> die vorgegebene Spreizrichtung.<br />
Wenn die Richtung eines Ortswechsels derart der Spreizrichtung<br />
entspricht, dass die Darstellung von Ortswechsel und Verweildauer aufeinander<br />
liegen, erfolgt eine lokale Anpassung der Verweillinie, so dass sie<br />
eine Kurve beschreibt, die sich an der vorgegebenen Spreizrichtung<br />
orientiert, die Anfangs- und Endtangenten jedoch im rechten Winkel zur<br />
jeweiligen Ortswechselrichtung positioniert. So kann der Abstand<br />
zwischen den Ortswechseln bei lokaler Anpassung des von der Spreizrichtung<br />
definierten Bezugssysystems maximiert werden (siehe Abb. 15).<br />
Die Berechnung der Kurven erfolgt durch einen doppelt-orthogonalen<br />
oder hybriden Algorithmus (vgl. Kapitel 5.4 – Algorithmen zur Implantation<br />
von Zeit).<br />
Komposition von Multiplen<br />
Die gemeinsame Darstellung von Verweildauer und Ortswechseln setzt<br />
zwei Kernforderungen der Synthese um. Zum einen zeigt sich, dass die<br />
aufgereihte Darstellung von Ortswechseln dem Konzept von Multiplen<br />
in sequentieller Ordnung entspricht (vgl. Kapitel 3.5 – Abfolgen durch<br />
Multiple. Ort + Ort = Zeit). Dadurch, dass deren Abstände nicht auf einer<br />
vorgegebenen äquidistanten Schrittweite basieren, sondern der zeitlichen<br />
Distanz entsprechen und durch Spreizung vom Nutzer direkt beeinflusst<br />
und optimiert werden können (vgl. Kapitel 4.4 – Das Interaktionskonzept),<br />
entsteht eine Komposition, die Auskunft über verstrichene Zeit<br />
und zugrunde liegende Rhythmen gibt (vgl. Kapitel 3.5 – Abfolgen durch<br />
52
Synthese und Konzeption – Das Interaktionskonzept<br />
Multiple. Ort + Ort = Zeit & Kapitel 3.6 – Komposition und Verschmelzung<br />
von Sequenzen. Ort = Ort = Zeit). Zum anderen trägt diese Darstellungsform<br />
der Forderung nach einer linearen Zeitdarstellung (vgl. Kapitel 2.3<br />
– Betrachtungen zu Raum und Zeit) Rechnung. Es entsteht ein durchgehendes<br />
lineares Band, dessen Anfang in der Vergangenheit und dessen<br />
Ende in der Gegenwart liegt.<br />
Da die Verweildauer konkrete Zeiträume beschreibt, die von Seiten des<br />
Programms sekundengenau adressiert werden können und somit Verortungen<br />
der Form „zwischen Brennpunkt A und B“, „kurz nach Brennpunkt<br />
B“ oder „kurz vor Brennpunkt C“ vorgenommen werden können,<br />
kann diese mit zeitvarianten Informationen überlagert werden. Dazu<br />
werden kleine Symbole genutzt, die sich auf der gestrichelten Linie an<br />
dem entsprechenden Zeitpunkt befinden und auf die überlagerte Information<br />
hinweisen (vgl. Kapitel 2.7 – Überlagerung und Verortung).<br />
Bezugssytem durch rahmende Schlieren<br />
Um die Spreizrichtung visuell zu unterstreichen und lokal angepasste<br />
Spreizrichtungen und Verweillinien zu verdeutlichen, wird die Darstellung<br />
durch Schlieren hinterlegt, welche die Abbildungen der Brennpunkte,<br />
Ortswechsel und Verweildauer rahmen. In Analogie zu dem hypothetischen<br />
Seismographen können Schlieren wörtlich verstanden werden.<br />
Wie eine Schleifspur liegen sie unter der eigentlichen Linienzeichnung<br />
und entspringen einem fixen Element der Aufzeichnungsmechanik, das<br />
Schleifspuren hinterlässt. Sollte die Schwerkraft oder zu starke Erschütterung<br />
den Bandlauf beeinflussen, lässt sich dennoch aus den Schlieren<br />
das eigentliche Bezugssystem der Aufzeichnung ableiten. In der vorliegenden<br />
Arbeit lassen sich die lokalen Anpassungen der Spreizrichtung<br />
mit der Änderung des Bandlaufes vergleichen, so dass die Schlieren ein<br />
Bezugssystem für die visuellen Elemente darstellen, welches die durch<br />
lokale Spreizrichtungsmodifikationen entstandenen Positionsabweichungen<br />
der Elemente optisch korrigiert.<br />
4.4 Das Interaktionskonzept<br />
Der Demonstrator kann auf klassischen Computern mit der Maus oder<br />
auf Multi-Touch-Systemen mittels Fingerberührung gesteuert werden.<br />
Die mit dem Multi-Touch-Konzept einhergehende Gestensteuerung bietet<br />
jedoch aufgrund der direkten Interaktionsmöglichkeiten eine unmittelbarere<br />
Rückmeldung der Datenmanipulation (vgl. Kapitel 2.6 – Skalierbare<br />
53
Benutzeroberflächen). Das Interaktionsdesign fußt auf zwei Interaktionstechniken<br />
zur Darstellungsmanipulation, die sowohl geographisches <strong>als</strong><br />
auch zeitliches Eintauchen in die Abbildung ermöglichen. Das geographische<br />
Eintauchen wird im Kontext skalierbarer Benutzeroberflächen<br />
<strong>als</strong> semantisches Zooming bezeichnet, das zeitliche Eintauchen sei in<br />
Anlehnung daran <strong>als</strong> semantische Spreizung betitelt. Für die Spreizung<br />
wird eine vom Nutzer vorgegebene Spreizrichtung und Spreizintensität<br />
benötigt.<br />
Geographisches Eintauchen<br />
Abb. 16: Funktionsweise semantischer Zoom. Orange hervorgehoben<br />
sind neu erscheinende Brennpunkte, die zuvor<br />
<strong>als</strong> Teil einer Gruppierung ausgeblendet wurden.<br />
Durch geographisches<br />
Eintauchen wird der<br />
Detailgrad an dargestellten<br />
Ortsinformationen<br />
angepasst.<br />
Mehrere Brennpunkte,<br />
die in der distanzierten<br />
Übersichtdarstellung<br />
zu einem einzelnen Brennpunkt gruppiert werden, können durch Verringerung<br />
der virtuellen Betrachterdistanz in kleinere Gruppen oder atomare<br />
Einheiten aufgeschlüsselt werden. Sie geben somit in sukzessiven<br />
Schritten detailliertere Informationen zu Ortswechseln innerhalb einer<br />
Region, einer Stadt oder eines Stadtviertels preis. Anders <strong>als</strong> bei einem<br />
geometrischen Zoom werden die Bildelemente jedoch nicht linear mit<br />
der Zoomstufe skaliert. Brennpunktkreise behalten ihre Größe, Linien von<br />
Verweildauer und Ortswechsel ihre Breite. Der Zoom schiebt die Brennpunkte<br />
entsprechend der Zoomstärke und des Zoomzentrums auseinander.<br />
Da dies die Größe der Interfaceelemente nicht ändert, entsteht<br />
dazwischen Freiraum, der für Detaildarstellungen genutzt wird (siehe<br />
Abb. 16).<br />
Zeitliches Eintauchen<br />
Abb. 17: Funktionsweise semantische Spreizung bei horizontaler<br />
Spreizrichtung. Die Verweildauer zwischen den<br />
Ortswechseln wird durch eine gestrichelte Linie abgebildet<br />
und ist orange hervorgehoben.<br />
Zeitliches Eintauchen<br />
ermöglicht die Implantation<br />
von Zeit in die<br />
Darstellung. Zeit manifestiert<br />
sich vordergründig<br />
durch die<br />
Abbildung von Verweildauer,<br />
welche durch<br />
i n t e r a k t i v e s<br />
54
Synthese und Konzeption – Das Interaktionskonzept<br />
Auf spreizen hervorgehoben und zurückgenommen wird. Zwecks geographischer<br />
Übersicht kann der Eintauchgrad minimiert werden, so dass der<br />
Darstellung des Verweilens weniger Platz zukommt. Zeit tritt in der Visualisierung<br />
zunehmend in den Hintergrund, und gleiche Geographische<br />
Orte gewinnen an Nähe.<br />
Durch Erhöhung des Spreizgrades entfernen sich geographisch nahe<br />
gelegene Orte voneinander, die Verschiebungsrichtung ergibt sich aus<br />
der vorgegebenen Spreizrichtung. Bei diesem Vorgang tritt die Genauigkeit<br />
der Information Ort zurück, und neben der Information Zeit, respektive<br />
Verweildauer, kommen die zuvor vorwiegend verdeckten visuellen<br />
Informationen Richtung und Muster zum Vorschein. Das Rotieren der<br />
Spreizung führt zur Anpassung der vorgegebenen Spreizrichtung. Die<br />
Verweilgerade dreht sich mit der Rotation, die geographisch definierten<br />
Ortswechsel verschieben sich entsprechend der Verweilgeradenänderung,<br />
ohne selbst gedreht zu werden (siehe Abb. 15).<br />
In Kombination können zeitliches und geographisches Eintauchen<br />
stufenlos jede Darstellungsform zwischen und in den beiden Extremen<br />
erzeugen: auf der einen Seite kann die reine, formalisierte, geografische<br />
Ortsdarstellung ähnlich einer Landkarte entstehen, auf der anderen Seite<br />
die reine Verweildarstellung ähnlich einem Zeitstrahl.<br />
Interaktionsausführung<br />
Der Leitgedanke zur Ausführungsgestaltung dieser Interaktionstechniken<br />
basiert auf dem Komplexitätsgrad der topologischen Veränderung durch<br />
die Interaktion. Das räumliche Eintauchen mittels semantischen Zooms<br />
verschiebt mitunter Brennpunkte jenseits der geometrischen Zoomparameter,<br />
um sie zu gruppieren oder aufzufächern. Dabei wird die Gesamtansicht<br />
skaliert, die zugrunde liegende Topologie ändert sich jedoch nicht;<br />
das geometrische Wesen bleibt in seinen wesentlichen Grundzügen<br />
erhalten, die übergeordnete Bildskalierung verläuft in alle Richtungen<br />
gleichmäßig. Beim zeitlichen Eintauchen hingegen zeigt sich, dass die<br />
semantische Spreizung sehr wohl die Topologie verändert. Den beiden<br />
geographischen Dimensionen schließt sich durch Spreizung und Wiederholung<br />
eine zeitliche Dimension an. Entlang der vorgegebenen Spreizrichtung<br />
wird die Zeit in das Bild gebracht, die Orte entfernen oder nähern<br />
sich einander entsprechend einer komplexen Implantationsvorschrift,<br />
das geografische Wesen der Abbildung wird verzerrt. Die Implantationsvorschrift<br />
berücksichtigt, verglichen mit dem semantischen Zoom, nicht<br />
55
Pinch-Geste<br />
Gestenausführung an Multi-<br />
Touch-Schnittstellen, bei der sich<br />
zwei Finger oder Fingergruppen<br />
annähern oder entfernen<br />
bloß das Ausführungszentrum und die Ausführungsintensität, sondern<br />
für jeden Brennpunkt auch die verstrichene Zeit. Im direkten Vergleich<br />
kann somit die Komplexität des semantischen Zooms <strong>als</strong> geringer denn<br />
die Komplexität des semantischen Spreizens bezeichnet werden.<br />
Auf Multi-Touch-Systemen ist die Nutzung von Pinch-Gesten zum<br />
Steuern von einfachen Transformationsoperationen gängige Praxis.<br />
Diese Geste kann durch Veränderung der Fingerdistanz, parallele<br />
Verschiebung der Finger und Drehen des durch die Finger aufgespannten<br />
Feldes drei verschiedene Interaktionsparameter steuern. Die einzelnen<br />
Parameter lassen sich wie in der anschließenden Auflistung (siehe Tabelle<br />
1) dargestellt, folgendermaßen auf die Eintauchoperationen anwenden:<br />
Parameter Pinch-Geste<br />
aus Berührungspunkten räumliches Eintauchen zeitliches Eintauchen<br />
Veränderung Distanz Anpassung Zoomstufe Anpassung Spreizintensität<br />
parallele Verschiebung Translation Translation<br />
Drehung Rotation Gesamtansicht Anpassung Spreizrichtung<br />
Tabelle 1: Mapping der Pinch-Gesten-Parameter auf Parameter der Interfacemanipulation<br />
Die Pinch-Geste kann einhändig oder beidhändig ausgeführt werden. Bei<br />
der einhändigen Ausführung beschreibt die Bewegung zweier Finger der<br />
gleichen Hand – meist Daumen und Zeigefinger – die Transformation. Bei<br />
der beidhändigen Ausführung ergeben sich Transformationsparameter<br />
durch die Bewegung beider Hände, wobei je Hand ein Finger oder eine<br />
Fingergruppe die Oberfläche berühren. So kann die Anzahl der ausführenden<br />
Finger in verschiedene Komplexitätsstufen gestaffelt werden. Die<br />
geschieht analog zur Realität, in der ein Blatt Papier mit zwei Fingern<br />
gegriffen werden kann, während das Fassen eines Papierstapels oder<br />
etwa eines Kartoffelsacks aufwendigere Greifoperationen mit mindestens<br />
einer Hand und mehreren beteiligten Fingern erfordert.<br />
56
Synthese und Konzeption – Zeitraumpost <strong>als</strong> Schnittstelle<br />
Werden die Komplexitätsstufen der topologischen Veränderung auf die<br />
Komplexitätsstufen der Pinch-Geste abgebildet, so ergibt sich folgende<br />
Belegung:<br />
- Der semantische Zoom, der das geographische Eintauchen in die<br />
Darstellung ermöglicht, wird über eine einhändige oder beidhändige<br />
Pinch-Geste mit insgesamt zwei ausführenden Fingern gesteuert.<br />
- Die semantische Spreizung, die das zeitliche Eintauchen in die Darstellung<br />
ermöglicht, wird über eine beidhändige Pinch-Geste mit insgesamt<br />
mindestens vier ausführenden Fingern gesteuert.<br />
Dadurch, dass der Nutzer mit einer einfachen Pinch-Geste unmittelbar<br />
das zeitliche Eintauchen steuern kann und sowohl die Darstellungsrichtung<br />
<strong>als</strong> auch die Darstellungsgewichtung der Zeit wortwörtlich im Handumdrehen<br />
vollzieht, wird aus der Spreizrichtung eine gespreizte Richtung,<br />
die nicht vorgegeben ist, sondern gegeben wird.<br />
{Tabelle komplexität, sem. Zoom, sem. Spreizung}<br />
4.5 Zeitraumpost <strong>als</strong> Schnittstelle<br />
Da diese Visualisierung nicht <strong>als</strong> alleinstehende Informationsgrafik,<br />
sondern <strong>als</strong> Schnittstelle konzipiert ist, welche die Überlagerung des<br />
Bildes mit verorteten Informationen ermöglicht, muss die aufgeworfene<br />
Forderung nach einer zurückhaltenden Gestaltung und ausgewogenen<br />
Verteilung visueller und interaktiver Ressourcen, berücksichtigt werden<br />
(vgl. Kapitel 2.7 – Überlagerung und Verortung).<br />
Explizite Interaktionselemente<br />
Es gilt somit keine Entlastung des Schaubilds vorzunehmen, sofern<br />
dieses das Hinzufügen weiterer explizit definierter Bedienelemente impliziert.<br />
Es erweist sich <strong>als</strong> einfach, etwa die Funktionalität zur Einschränkung<br />
der betrachteten Orte mittels Auswahllisten zu offerieren, oder eine<br />
miniaturisierte Übersichtsdarstellung hinzuzufügen, die Rückschluss<br />
über die Tiefe und Position des semantischen Zooms bezogen auf das<br />
Gesamtbild gibt. Doch jede Hinzufügung hat auch eine Abnahme der in<br />
den Interaktionsraum projizierten Data-Ink-Ratio (vgl. [Tufte 83]) zur Folge;<br />
eine relative Abwertung der tatsächlich wichtigen Information durch<br />
Zunahme potenziell wichtiger Informationen. Neu entstehende Fragen<br />
oder Fragen in neuen Kontexten nicht mit alten Antworten zu begegnen,<br />
57
sondern Lösungen zu Detailproblemen aus dem Gesamtkonzept heraus<br />
zu entwickeln, wobei das Konzept im Sinne eines objekthaften Ganzen<br />
zu verstehen ist, dessen Offenheit sich stetig dahingehend anpasst, dass<br />
entstehende Herausforderungen integrieret werden können.<br />
Implizite Interaktionshinweise durch konzeptionelle Konsequenz<br />
Die Maxime einer gut gestalteten Tür lautet, dass sie ihre Funktionsweise<br />
implizit vermittelt. So erklärst sie etwa durch die Gestaltung von Griffen<br />
und Aufhängung die Schiebe- oder Ziehrichtung von selbst, ohne dazu<br />
explizite, schriftliche Hinweise zu benötigen (vgl. [Norman 88]). So gilt<br />
auch für die Gestaltung dieser interaktiven Anwendung der Anspruch,<br />
dass die Funktionalität aus der Konsequenz des Konzepts erschließbar<br />
ist.<br />
Die Kritik, dass ein unbedarfter Benutzer nicht ad hoc die implizite Funktionalitätsbeschreibung<br />
begreifen kann und dass ein Schriftzug oder ein<br />
vertrautes Bedien-Element den Erstzugang erleichtern kann, ist berechtigt.<br />
Doch bei dem Versuch, einen Anwenderkreis und ein Anwendungsszenario<br />
zu skizzieren, zeigt sich auch, dass so, wie die implizite Vermittlung<br />
der Öffnungsrichtung jener Tür Kenntnisse über konstruktionstechnische<br />
Details und die Bereitschaft, den Türknauf <strong>als</strong> kommunizierendes<br />
Medium zu begreifen, voraussetzt, auch die interaktive Nutzeroberfläche<br />
auf einen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann, der dem Individuum<br />
weitläufig in seiner Rolle <strong>als</strong> digital Native (vgl. [Prensky 01]) zugesprochen<br />
wird.<br />
Unbewusste Informationsverarbeitung<br />
Der Nutzen einer Darstellung, die auf impliziter Interaktionsvermittlung<br />
beruht, kann kognitionspsychologisch beschrieben werden. Anders <strong>als</strong><br />
explizite Interaktionshinweise, die aktiv gelesen werden müssen und eine<br />
bewusste Wahrnehmung erfordern, ermöglichen implizite Interaktionshinweise<br />
eine unbewusste Informationsverarbeitung. Die Encyclopedia<br />
of Cognitive Science attestiert der unbewussten Verarbeitung, dass sie<br />
automatisch, verdeckt, stillschweigend 64 , und „dass sie ohne Anstrengung<br />
(automatisch) und parallel (simultan) über verschiedene sensorische<br />
Modalitäten auftreten kann“ 65 (vgl. [Snow 03]).<br />
64 im englischen Original <strong>als</strong> “unconscious”, “automatic”, “covert”, “tacit” bezeichnet.<br />
65 Snow 03, S. 1. im englischen Original: ,to occur without effort (automatically) and in<br />
parallel (simultaneously) across different sensory modalities, and to have a large processing<br />
capacity‘<br />
58
Synthese und Konzeption – Zeiteingrenzung anhand unscharfer Kriterien<br />
4.6 Zeiteingrenzung anhand unscharfer Kriterien<br />
Der in dem Beispiel der Einleitung vorgestellte Journalist (siehe Kapitel<br />
Kapitel 1.2 – Motivation) sucht einen Arbeitsablauf, um auf seine berufsbezogenen<br />
Notizen effektiv zugreifen zu können, ohne dass gesonderter<br />
Verwaltungsaufwand entsteht. Das in dieser <strong>Diplomarbeit</strong> entwickelte<br />
interaktive Visualisierungskonzept ermöglicht ihm ein im Folgenden<br />
skizziertes Vorgehen. Angenommen, der Journalist benötigt von allen<br />
Aufzeichnungen, die während der wöchentlichen Interviews mit dem<br />
Geschäftsführer einer bestimmten Manufaktur entstanden, einen besonderen<br />
Satz an Notizen und Schaubildern. Er weiß jedoch nicht mehr<br />
genau, welche konkreten Aussagen fielen, erinnert aber, dass ein kurz<br />
zuvor getroffener Vertragsabschluss der Manufaktur den Interviewpartner<br />
zu ungewöhnlichen Aussagen hat verleiten lassen. Die Stimmung<br />
war während des Gesprächs besonders ausgelassen, die Einblicke<br />
außergewöhnlich intim und die Wortwahl des Geschäftsführers derart<br />
euphorisch, dass sie Sätze eine gute Grundlage für spannende Zitate<br />
bilden. Eine ad-hoc Eingrenzung des Zeitraums deutet auf den Herbst<br />
oder Winter des letzten Jahres hin, da das Interview in einem Café stattfand<br />
und nicht, wie in den warmen Monaten üblich, in einem Separé der<br />
Produktionsstätten. Die Tatsache, dass es sich um das vergangene Jahr<br />
handelt, bringt die Einschränkung mit sich, dass die Erinnerung an das<br />
konkrete Datum nicht mehr vorhanden ist und eingrenzende Umstände<br />
nur fragmentarisch rekapituliert werden können. Jedoch erinnert der<br />
Journalist noch einzelne, prägnante Situationen. So etwa, dass sich der<br />
Geschäftsführer vor dem Interview sehr interessiert zeigte, <strong>als</strong> der Journalist<br />
ihm von dem kurz zuvor besuchten Symposium zu „Mobilität und<br />
Alter“ berichtete. Auch erinnert er, dass die Wortgewalt des Interviews<br />
ihn noch bei einer Wochenendwanderung in den nahegelegenen Bergen<br />
beschäftigte und er bei einem späteren Urlaub mit Freunden auf die<br />
Bedeutung des Geschäftsabschlusses der Manufaktur zu sprechen kam.<br />
getrennte Arbeitsschritte<br />
Das Erstellungsdatum der gesuchten Informationen lässt sich demnach<br />
derart eingrenzen, dass es in einem Zeitraum zwischen dem Symposium<br />
und der Wochenendwanderung liegt, welche vor dem Urlaub stattfand.<br />
Ein <strong>als</strong> klassisch zu bezeichnendes Vorgehen bestünde darin, dass der<br />
Reporter seinen Kalender nutzt und potenzielle Daten für Symposium,<br />
Wanderung und Urlaub mit den Einträgen abgleicht. Die so ermittelte<br />
Zeitspanne gleicht er dann mit den Datumsangaben seiner Notizverwaltung<br />
ab. Sofern der Umfang des verbleibenden Informationssatzes es<br />
59
zulässt, werden die gesuchten Informationen extrahiert. Ist die Komplexität<br />
weiterhin zu groß, wird das Datum weiter eingegrenzt, indem die<br />
Schritte Rekapitulation, Durchstöbern des Kalenders, Extraktion des<br />
kalendarischen Zeitraums, Abgleich mit Daten der Notizverwaltung<br />
wiederholt werden.<br />
integrierter Arbeitsablauf<br />
Ein Vorgehen unter Anwendung des in dieser <strong>Diplomarbeit</strong> entwickelten<br />
Konzepts ermöglicht hingegen die Zusammenfassung dieser einzelnen<br />
Arbeitsschritte in eine integrierte Problemlösung, welche die Informationsadressierung<br />
und das Moment des Kalenderbasierten Stöberns zu<br />
einem Gesamten verschmilzt. Der Journalist sieht zunächst eine formalisierte<br />
Karte, die alle zuletzt aufgesuchten Orte durch Kreise und vollzogenen<br />
Ortswechsel durch Linien darstellt. Zwecks eröffnender Orientierung,<br />
lässt er sich durch Berührung der Kreise die zugehörigen Ortsnamen<br />
anzeigen. Mittels Gestenbasierter Interaktion taucht er darauf hin<br />
in die Darstellung ein. Durch eine einfache Pinch-Geste, die zwei Finger<br />
nutzt, wird zunächst der geographische Betrachtungsraum eingegrenzt,<br />
wobei der Detailgehalt der Ortsinformationen steigt. Sofern dieser spezifiziert<br />
ist und irrelevante Orte ausgeblendet sind, bringt der Journalist<br />
die Zeit in die Darstellung. Indem er eine Pinch Geste mit zwei Händen<br />
und mehreren Fingern ausführt, spreizt er das Bild, so dass Verweildauer,<br />
Bewegungsmuster und überlagerte Informationen erscheinen.<br />
beispielhafte Anwendung<br />
Vorausgesetzt, der Journalist wohnt im Osten des Landes, die Interviews<br />
fanden in der Landesmitte und das Symposium südlich davon statt, kann<br />
geographisch in die Visualisierung eingetaucht werden, so dass nur der<br />
relevante südliche bis östliche Landesbereich sichtbar bleibt. Reisen im<br />
Norden, Westen und entfernten Osten verschwinden aus der Abbildung<br />
und werden durch ausgehende Linien angedeutet. Im Folgenden wird<br />
durch zeitliches Eintauchen die Darstellung derart aufgespreizt, dass sie<br />
das Bewegungsverhalten innerhalb dieser Orte wiedergibt. Der Journalist<br />
kann die Darstellung im Folgenden so weit verschieben und spreizen,<br />
dass nur der Winter und Herbst des vergangenen Jahres sichtbar sind.<br />
Er kann das wöchentliche Pendeln zur Manufaktur in der Landesmitte<br />
und alle weiteren in der fokussierten Zeitspanne und dem betrachteten<br />
geographischen Raum unternommenen Ortswechsel erkennen, so auch<br />
die Reise zum Symposium, die Wochendausflüge in die Berge und den<br />
Südurlaub.<br />
60
Synthese und Konzeption – Erfahrungen bei der Konzeptentwicklung<br />
Da die Notizen die Darstellung des Verweilens überlagern, kann er auf<br />
diese unmittelbar zugreifen. Relevant sind jene, die sich nach der Symposiumsreise<br />
– Ortswechsel Richtung sichtbaren Süden –, vor dem Urlaub<br />
– Ortswechsel über den unteren Bildrand hinaus –, beziehungsweise vor<br />
dem Wochenendsausflug – kleiner Ortswechsel Richtung Osten in der<br />
Nähe des Wohnorts, vor dem Urlaub – befinden.<br />
Im direkten Vergleich zeigt sich gegenüber der <strong>als</strong> klassisch bezeichneten<br />
Herangehensweise zum einen eine Abnahme des Arbeitsaufwands durch<br />
die Vereinigung getrennter Arbeitsschritte in einen integrierten Arbeitsablauf.<br />
Zum anderen ergeben sich aus der Visualisierung Hinweise auf<br />
zunächst vergessene, aber potenziell relevante Ereignisse. Aufgrund<br />
der eingeschränkten Darstellungsform von Kalendern, die vorwiegend<br />
große Textmengen enthalten, können derartige Ereignisse nicht ausreichend<br />
prägnant vermittelt werden. Durch einen Hinweis, wie er bei der<br />
Ortswechselbetrachtung entstehen kann, ist es jedoch möglich in das<br />
Gedächtnis des Betrachtenden zu gelangen und weitere Einschränkungskriterien<br />
offen zu legen.<br />
{Bild für das Beispiel}<br />
4.7 Erfahrungen bei der Konzeptentwicklung<br />
Herausforderungen zeigen sich vor allem in dem Spannungsfeld, das<br />
zwischen der Vermittlung möglicher Anwendungsszenarien und deren<br />
Nachvollziehbarkeit durch Dritte entsteht. Bei dem Erleben von Ereignissen,<br />
bei der Empfindung und der Rekonstruktion von Zeit handelt<br />
es sich um sehr persönliche Anliegen, die in ihrer Vollständigkeit von<br />
einer Person weitestgehend alleine erfahren werden und sich somit nur<br />
partiell teilen lassen. Aufgesuchte Orte, vorgenommene Ortswechsel und<br />
Erlebnisse können erzählt, jedoch nicht mit allen Facetten wiedergeben<br />
werden, die ihnen Bedeutsamkeit verleihen und sie in der Erinnerung<br />
verankern.<br />
Die zur Anwendung des ZeitRaumPost-Konzepts empfohlene Vollständigkeit<br />
digitaler Spuren mit aktivem Ortsbezug kann trotz rasanter<br />
Verbreitung entsprechender Dienste derzeit selten vorausgesetzt<br />
werden. Dieses erschwert die Schaffung einer Diskussionsgrundlage,<br />
da potenzielle Gesprächspartner durch fremde Daten auf ein fremdes<br />
Leben starren, das den notwendigen persönlichen Bezug zwischen dem<br />
aktuell Sichtbaren und dem Erlebten nicht herstellen kann. Auch weicht<br />
61
das Arbeitsleben der Betrachtenden mitunter von der in Kapitel 1 definierten<br />
Arbeitswelt ab, deren allgemeine Risikobereitschaft und Spontaneität<br />
einen offenen und bewussten Umgang mit Mobilität und häufige<br />
Ortswechsel involviert.<br />
{Demonstrator: Wie aussehen? Abgrenzung. Anliegen ist Verknüpfung.<br />
Zurücknehemen. Interaktion. Testbar machen. Reine Stills schwierig<br />
einzuschätzen.<br />
}<br />
62
Synthese und Konzeption – Erfahrungen bei der Konzeptentwicklung<br />
63
5 Umsetzung<br />
5.1 Grundlage<br />
Processing<br />
Auf Animationen und Grafik<br />
spezialisierte Programmiersprache<br />
auf Basis von Java<br />
Model View ViewModel<br />
Vom Model View Presenter abgeleitetes<br />
Entwurfsmuster mit<br />
breiter Anwendung in WPF<br />
Um das theoretische Konzept hinter ZeitRaumPost in eine greif- und<br />
testbare Form zu bringen, entstanden mehrere Prototypen. Die ersten<br />
basierten auf der Programmiersprache Processing und dienten vorwiegend<br />
dem Entwickeln und Testen verschiedener Darstellungsalgorithmen.<br />
Der Demonstrator ist in C# entwickelt, wobei das Grafik-Framework WPF<br />
genutzt wurde. Die Verknüpfung zwischen den aufbereiteten Daten und<br />
deren Darstellung wurde unter Anwendung des Model View ViewModel<br />
(MVVM) mit zugehörigem Data Binding umgesetzt. Als Hardware kommt<br />
ein Multi-Touch-Tisch zum Einsatz, dessen Berührungsereignisse mittels<br />
Windows 7 Surface-SDK vom Betriebssystem an den Demonstrator<br />
weitergeleitet werden.<br />
5.2 Extraktion digitaler Spuren<br />
Die digitalen Spuren mit aktivem Ortsbezug werden von dem sozialen<br />
Netzwerk mit standortbezogenen Diensten Foursquare bezogen. Dieses<br />
bietet dazu eine Schnittstelle an, die auf dem xml-basierten RSS-Standard<br />
aufsetzt. Ein Check-In sieht folgendermaßen aus:<br />
<br />
@ Flughafen München (MUC) - Terminal 1<br />
Flughafen München (MUC) - Terminal 1<br />
http://foursquare.com/venue/1492420<br />
Sun, 17 Oct 10 09:51:05 +0000<br />
urNuBa30Pi33xIrQuMCQWg==<br />
48.35433834673654 11.783695220947266<br />
<br />
64
Umsetzung – Entwicklungsschritte<br />
Mithilfe des Sprachkonstrukts LINQ werden diese Information in eine<br />
interne Datenstruktur umgewandelt und zwischengespeichert.<br />
return<br />
from x in doc.Descendants(„channel“).Descendants(„item“)<br />
orderby DateTime.Parse(x.Element(„pubDate“).Value<br />
ascending<br />
select new RSSItem()<br />
{<br />
}<br />
Title = x.Element(„title“).Value,<br />
Message = x.Element(„description“).Value,<br />
Url = x.Element(„link“).Value,<br />
PublOn = DateTime.Parse(x.Element(„pubDate“).Value),<br />
Geo = Point.Parse(x.Element(geoRSS + „point“).Value)<br />
LINQ<br />
Komponente des .net-Frameworks<br />
zur Abfrage und Manipulation<br />
von Datenquellen<br />
Gepflegt werden die Daten über das Webinterface von Foursquare und<br />
über die iPhone Foursquare-App. Die Geo-Informationen, die Foursquare<br />
zum Vorschlagen nahe gelegener Orte benötigt, entstammen entweder<br />
der Sendemast-Triangulierung, dem GPS-Sensor oder der WLAN-Ortung<br />
(vgl. [Ratti 07] & [Mountain 01]). Der Name des Ortes, an dem der Checkin<br />
ausgeführt wird, wird jedes Mal basierend auf den automatisch generierten<br />
Vorschlägen vom Nutzer selbst gewählt.<br />
5.3 Entwicklungsschritte<br />
Die ersten Entwicklungsschritte basierten auf Landkarten, Transparentpapier<br />
und verschiedenen Stiften. Der Frage folgend „Wie kann die Zeit<br />
in die Orte der Landkarte einfließen?“ entstanden Skizzen, bei denen<br />
Ortswechsel auf das die Landkarte überlagernde Transparentpapier<br />
eingezeichnet wurden. Dabei wurde der Faktor Zeit ähnlich der Funktionsweise<br />
eines Seismographen durch Ziehen des Papiers eingebracht,<br />
wobei verschiedene Spreizrichtungen, Ziehkurven und Ziehgeschwindigkeiten<br />
getestet wurden.<br />
Darauf bauten erste Processing-Sketches auf, die dem Zweck dienten,<br />
mathematische Grundlagen für die Darstellungsalgorithmen zu entwickeln<br />
und zu testen. Durch die Fokussierung von Processing auf das<br />
Entwickeln visueller Arbeiten (vgl. [Fry 07]) und die daraus resultierende<br />
einfache Bedienung ist es möglich, auf unmittelbare Weise erste<br />
Eindrücke über das visuelle Eigenleben der angestrebten generischen<br />
65
Informationsvisualisierung zu gewinnen, Parameter potenzieller Darstellungsalgorithmen<br />
aufzustellen oder auszutauschen und mögliche<br />
Grenzen der Annahmen zu erkennen. Da die notwendige Ausprägung<br />
sowohl jener Parameter, welche die Größe und Richtung der Gesamtdarstellung<br />
beeinflussen, <strong>als</strong> auch derer, die das Verhältnis zwischen den<br />
Kenngrößen Ort und Zeit beschreiben, stark situativ variiert und sich<br />
schwer ein Optimalwert definieren lässt, zeigt sich, dass diese Ausprägung<br />
unmittelbar vom Nutzer beeinflussbar sein muss.<br />
Stage<br />
System.Windows.FrameworkElement<br />
1..1<br />
1..*<br />
Spot Abidance Change Schlieren DateGrid<br />
View Package<br />
System.Collections.ObjectModel.ObservableCollection<br />
Spot-<br />
Collection<br />
Abidance-<br />
Collection<br />
Change-<br />
Collection<br />
Schlieren-<br />
Collection<br />
ViewModel Package<br />
Abb. 18: Klassendiagramm mit feingliedrigem MVVM-Entwurfsmuster<br />
66
Umsetzung – Algorithmen zur Implantation von Zeit<br />
Dieses führt zur Entwicklung des Demonstrators auf Basis von C# und<br />
WPF, welche gegenüber den Processing-Sketches neben einem entwicklungstechnischen<br />
Mehraufwand auch die Festlegung auf die Windows-<br />
Plattform bedeutet. Dafür ermöglicht die Programmiersprache C# einen<br />
ereignisbasierten Programmfluss und das Framework WPF mit der<br />
Beschreibungssprache XAML die Handhabung flexibler Interaktionsmöglichkeiten<br />
(vgl. [Petzold 06]).<br />
Um diese Flexibilität auszureizen, basiert die Softwarearchitektur auf dem<br />
Model View ViewModel Paradigma. Jedes visuelle Element entspricht<br />
einem eigenen Objekt, das von System.Windows.FrameworkElement<br />
erbt und per Data Binding mit den ViewModel-Elementen einer ObservableCollection<br />
kommuniziert (siehe Abb. 18).<br />
WPF<br />
Windows Presentation Foundation<br />
– Grafik-Framework<br />
mit XML basierter Oberflächenbeschreibung,<br />
trennt Geschäftslogik<br />
von Präsentation<br />
5.4 Algorithmen zur Implantation von Zeit<br />
Im Rahmen dieser Arbeit wurden zwei Kategorien an visuellen Darstellungsalgorithmen<br />
entwickelt, die sich der Implantation von Zeit- und<br />
Ortsinformation in ein Gesamtbild widmen. Die Grundidee besteht darin,<br />
die Orte entsprechend dem Zeitpunkt des Aufsuchens auseinander zu<br />
ziehen und die dortige Verweildauer durch eine Linie zu kennzeichnen,<br />
so dass die gemeinsame Darstellung von Ortswechsel und Verweildauer<br />
ein durchgezogenes Band ergibt (vgl. Kapitel 4.2 – Das Konzept Zeit-<br />
RaumPost).<br />
Die erste Kategorie widmet sich der Anpassung der Spreizrichtung. Allen<br />
Spreizrichtungsalgorithmen ist gemein, dass die an die Spreizrichtung<br />
gekoppelte linienhafte Darstellung der Verweildauer in der schematischen<br />
Repräsentation des letzten Ortes beginnt und am Anfang des<br />
schematischen, nächsten Ortswechsels endet. Die Distanz eines Ziehschritts<br />
entspricht der in diesem Schritt vergangenen Zeit.<br />
Der gerade Ziehalgorithmus benötigt einen vorgegebenen Parameter<br />
für die einfache Spreizrichtung und ordnet alle Ortsbesuche entlang<br />
einer Ziehgeraden, die in die einfache Spreizrichtung zeigt, so dass die<br />
Verweildauer <strong>als</strong> Gerade dargestellt wird. Verläuft die einfache Spreizrichtung<br />
horizontal, so wird jeder Besuch des Ortes A auf gleicher Höhe<br />
eingezeichnet, während die horizontale Verschiebung die vergangene<br />
Zeit beschreibt. Besitzt die einfache Spreizrichtung einen Winkel von 45°<br />
gegenüber der Horizontalen, so wird die Spreizrichtung um 45° gedreht,<br />
ohne dass die Richtung der Ortswechsel rotiert.<br />
67
kubische Bézierkurve<br />
Kurve, die durch vier Kontrollpunkte<br />
beschrieben wird:<br />
Start- und Zielpunkt der<br />
Kurve, zwei Stützpunkte.<br />
Der doppelt-orthogonale Ziehalgorithmus besitzt einen Parameter für die<br />
übergeordnete Spreizrichtung, wobei die Gesamtspreizrichtung aus den<br />
einzelnen Ziehschritten errechnet wird. Aus den Normalen zweier aufeinanderfolgender<br />
Ortswechsel, die den kleinsten Winkel zur übergeordneten<br />
Spreizrichtung aufweisen, wird der eingeschlossene Ziehschritt<br />
errechnet, indem die normierte Summe dieser Normalen mit der Zeit<br />
zwischen den beiden Ortswechseln skalar multipliziert wird. Die Verweildauer<br />
wird <strong>als</strong> kubische Bézierkurve dargestellt, deren Kontrollpunkte in<br />
dem so entstehenden Schnittpunkt der Normalen liegen. Der untransformierte<br />
letzte Ortswechsel sei durch P 01<br />
- P 00<br />
, der nächste untransformierte<br />
Ortswechsel durch P 11<br />
- P 10<br />
(wobei P 01<br />
= P 10<br />
) und die durch den<br />
Ziehalgorithmus transformierten Ortswechsel entsprechend P‘ 01<br />
- P’ 00<br />
und P‘ 11<br />
- P‘ 10<br />
beschrieben. Ferner seien die Normale des letzten Ortswechsels<br />
mit geringstem Winkel zur übergeordneten Spreizrichtung <strong>als</strong><br />
n 0<br />
, die Normale des nächsten Ortswechsels mit geringstem Winkel zur<br />
übergeordneten Spreizrichtung <strong>als</strong> n 1<br />
, die Kontrollpunkte <strong>als</strong> CP 1<br />
und CP 2<br />
,<br />
die übergeordnete Spreizrichtung <strong>als</strong> z ü<br />
, die der einzelne Ziehschritt <strong>als</strong><br />
z s<br />
der und die vergangene Zeit zwischen den beiden Ortswechseln <strong>als</strong> t 1<br />
definiert. Dann liegt der Beginn der Verweilkurve in P‘ 01<br />
und das Ende in<br />
P’ 10<br />
, und es gilt:<br />
P’ 10<br />
= P’ 01<br />
+ z s<br />
wobei<br />
z s<br />
= norm( n 0<br />
+ n 1<br />
) * t 1<br />
und<br />
P 1<br />
= CP 2<br />
= P’ 01<br />
+ n 0<br />
/ length( n 0<br />
+ n 1<br />
) * t 1<br />
66<br />
Der hybride Ziehalgorithmus besteht aus einer Kombination des geraden<br />
und des doppelt-orthogonalen Ziehalgorithmus. Er benötigt Parameter<br />
für die übergeordnete Spreizrichtung und den Orthogonalanteil. Der<br />
Parameter für die übergeordnete Spreizrichtung entspricht dem gleichnamigen<br />
Parameter des doppelt-orthogonalen Ziehalgorithmus beziehungsweise<br />
der einfachen Spreizrichtung des geraden Ziehalgorithmus.<br />
Der Orthogonalanteil beschreibt das Einflussverhältnis von doppeltorthogonalem<br />
und geraden Ziehalgorithmus auf die Spreizrichtung<br />
derart, dass ein Orthogonalanteil von 0 einen gerade Ziehalgorithmus<br />
und ein Orthogonalanteil von 1 einen doppelt-orthogonalen Ziehalgorithmus<br />
zur Folge hat. Die Verweildauer wird auch bei diesem Ansatz <strong>als</strong><br />
kubische Bézierkurve dargestellt. Auch hier gelte die Variablenbenennung<br />
des doppelt-orthogonalen Ziehalgorithmus, wobei der Orthogonalanteil<br />
<strong>als</strong> A o<br />
bezeichnet sei. Es liegt der Beginn der Verweilkurve in P‘ 01<br />
und das<br />
Ende in P’ 10<br />
, uns es gilt:<br />
66 length berechnet die Länge eines Vektors <strong>als</strong> Skalar, norm normiert einen Vektor, so<br />
dass seine Länge 1 beträgt.<br />
68
Umsetzung – Algorithmen zur Formalisierung des Raums<br />
P’ 10<br />
= P’ 01<br />
+ z s<br />
, wobei<br />
z s<br />
= ( A o<br />
* norm(n 0<br />
- n 1<br />
) - ( 1 - A o<br />
) * z ü<br />
) * t 1<br />
und<br />
CP 1<br />
= P’ 01<br />
+ A o<br />
* n 0<br />
/ length( n 0<br />
+ n 1<br />
) * t 1<br />
und<br />
CP 2<br />
= P’ 10<br />
- A o<br />
* n 1<br />
/ length( n 0<br />
+ n 1<br />
) * t 1<br />
{Schaubild Algorithmen!!!!}<br />
5.5 Algorithmen zur Formalisierung des Raums<br />
Die zweite Kategorie von Darstellungsalgorithmen widmet sich der<br />
Formalisierung darzustellender Orte. Es gilt, Brennpunkte und Ortswechsel<br />
nach den Erkenntnissen über kognitive Karten (vgl. Kapitel 2.5<br />
– Über die Wahrnehmung von Orten) zu gestalten. Dabei ist zu beachten,<br />
dass je nach semantischer Zoomstufe die Anzahl und Granularität der zu<br />
optimierenden Details variiert.<br />
Ist die Zoomstufe der zu berechnenden Ansicht festgelegt und die<br />
daraus resultierende Anzahl an zu berücksichtigenden Orten und Ortswechseln<br />
definiert, wird deren Position optimiert. Hierzu findet eine<br />
Abwandlung des von Jonathan M. Stott und Peter Rodgers entwickelten<br />
Multikriterien-Ansatzes Anwendung (vgl. [Stott 01]). Der Ansatz Stotts<br />
und Rodgers‘ basiert auf einem heuristischen Bergsteigeralgorithmus,<br />
der aus einer geografisch korrekten Darstellung von U-Bahn-Linien und<br />
-Haltestellen eine abstrahierte Visualisierung entwickelt, die den Prinzipien<br />
Becks ähnelt (vgl. Kapitel 4.1 – Anforderungen). Dazu werden fünf<br />
ästhetische Metriken definiert: die Kantenschnitt-Metrik, die 4-gonalitäts-Metrik,<br />
die Kantenlängen-Metrik, die Winkelauflösungs-Metrik und<br />
die Gerade-Linien-Metrik 67 . Da die Metriken unterschiedliche Relevanz<br />
besitzen, werden sie mit einer numerischen Gewichtung versehen, die<br />
mit dem errechneten Ergebnis der Metrik multipliziert wird. In mehreren<br />
übergeordneten Iterationsschritten senkt der Algorithmus die anhand<br />
der Metriken kalkulierten Kosten, so dass sich die Darstellung schrittweise<br />
einer optimierten Ansicht annähert. Als Abbruchbedingung kann<br />
entweder das Erreichen eines Kostenminimums oder eine vorgegebene<br />
Anzahl an übergeordneten Schleifendurchläufen dienen. Der Algorithmus<br />
sieht vor, zunächst alle Knoten (Haltestellen) auf den nächstgelegenen<br />
Kreuzungspunkten eines zugrunde liegenden Rasters zu positionieren,<br />
wobei die Größe einer Rasterzelle sich aus der Länge der kürzesten<br />
67 eigene Übersetzung. Im englischen Original <strong>als</strong> ‚Edge Crossings Metric‘, ‚4-gonality<br />
Metric‘, ‚Edge Length Metric‘ ‚Angular Resolution Metric‘ und ‚Line Straightness Metric‘<br />
bezeichnet.<br />
69
Nomenklatur<br />
Im folgenden werden Kanten<br />
mit e bezeichnet. Sie verlaufen<br />
durch die Punkte u & v. Die<br />
Summe aller Kanten lautet E,<br />
die Summe aller Knoten V.<br />
Strecke zwischen zwei Haltestellen ergibt. In einer untergeordneten<br />
Schleife werden anschließend für jeden einzelnen Knoten die Kosten der<br />
Positionierung an den acht benachbarten Rasterkreuzungen mit denen<br />
der aktuellen Position verglichen. Der Knoten wird an die günstigste<br />
Kreuzung verschoben.<br />
Die Kosten der Kantenschnitt-Metrik werden aus der Anzahl von Schnitten<br />
berechnet, die durch die anliegenden Kanten des verschobenen Knotens<br />
entstehen. Jeder Schnitt einer anliegenden Kante mit einer anderen<br />
Kante verteuert das Resultat, so dass die Anzahl der Schnitte reduziert<br />
wird. Es können neue Schnitte entstehen, sofern dabei mindestens zwei<br />
alte Schnitte entfernt werden.<br />
<br />
<br />
u1, v1 ∈ E u2, v2 ∈ E<br />
intersect u1, v1, u2, v2<br />
intersect u1, v1, u2, v2 ⩵<br />
Der Schnitt der 0 wenn Gerade det v1 u1e1 v2 von u2 Punkt 0 u1 nach v1 mit der Gerade e2 von<br />
0 wenn detu2 u1 intersect u2 v2 u1, detv1, v1 u2, u1 v2<br />
u2 0<br />
Punkt u2 nach v2 wird mittels<br />
u1, 0 wenn v1 ∈ Edet u2, u2 v2 ∈E<br />
u1 u2 v2 det v1 u1 v2 u2 1<br />
0 wenn det v1 u1 u2 u1 det v1 u1 v2 u2 0<br />
0 wenn det v1 u1 u2 u1 det v1 u1 v2 u2 1<br />
intersect u1, v1, u2, v2 ⩵<br />
1 sonst<br />
0 wenn det v1 u1 v2 u2 0<br />
0 wenn det u2 u1 u2 v2 det v1 u1 v2 u2 0<br />
0 wenn det u2 u1 u2 v2 det v1 u1 v2 u2 1<br />
u.y v.y<br />
0 wenn Sin4det ⋆ ArcTan v1 u1 u2 u1 det v1 u1 v2 u2 0<br />
u, v ∈ E<br />
u.x v.x<br />
0 wenn det v1 u1 u2 u1 det v1 u1 v2 u2 1<br />
1 sonst<br />
e<br />
<br />
<br />
e ∈ E g intersect u.y u1, v.y v1, u2, v2<br />
Sin4 ⋆ ArcTan <br />
u1, v1 ∈ E u2, v2 ∈ E<br />
u, v ∈ E<br />
u.x v.x<br />
berechnet 68 . Die Funktion intersect() gibt 1 zurück, wenn sich beide<br />
Geraden schneiden, sonst 0.<br />
intersect u1, v1, Θ e1, u2, e2 v2 ⩵<br />
v ∈ V e1, e2 ∈ E,<br />
0e1 & e wenn e2 Kantenpaar det v1 u1 v2 u2 0<br />
auf v<br />
0 wenn det u2 u1 u2 v2 det v1 u1 v2 u2 0<br />
e ∈ E g<br />
0 wenn det u2 u1 u2 v2 det v1 u1 v2 u2 1<br />
Die 4-gonalitäts-Metrik berechnet Kosten aus dem Winkelabstand sämtlicher<br />
an den betrachteten Knoten anliegenden Kanten zur nächstgelegenen<br />
Horizontalen, Vertikalen oder 45°-Diagonalen. Die mathematische<br />
Beschreibung für alle relevanten Kanten e mit den Punkten u und v lautet:<br />
0 wenn det v1 u1 u2 u1 det v1 u1 v2 u2 0<br />
angleGreater90 eActual, eOriginal<br />
eActual 0 wenn ∈ E det v1 Θu1e1, u2 e2<br />
u1 det v1 u1 v2 u2 1<br />
v 1∈ V sonst e1, e2 ∈ E,<br />
e1 & e2 Kantenpaar<br />
auf v<br />
0 wenn 90 angleBetween e1, e2 90<br />
angleGreater90 e1, e2u.y ⩵ r v.y wenn r ⩵ angleBetween e1, e2 90<br />
Sin4 ⋆ ArcTan <br />
angleGreater90reActual, wenn r ⩵ angleBetween eOriginal e1, e2 90<br />
u, v ∈ E<br />
u.x v.x<br />
eActual ∈ E<br />
e<br />
v2 v1<br />
v1 angleGreater90 V v2 ∈ V<br />
e1, e2 ⩵<br />
e ∈ E g<br />
0 wenn 90 angleBetween e1, e2 90<br />
r wenn r ⩵ angleBetween e1, e2 90<br />
r wenn r ⩵ angleBetween e1, e2 90<br />
Θ e1, e2<br />
68 det(v) berechnet die Determinante des Vektors v<br />
v ∈ V e1, e2 ∈ E,<br />
e1 & e2 Kantenpaar<br />
auf v<br />
v2 v1<br />
v1 ∈ V v2 ∈ V<br />
<br />
eActual ∈ E<br />
angleGreater90 eActual, eOriginal<br />
70<br />
angleGreater90 e1, e2 ⩵<br />
0 wenn 90 angleBetween e1, e2 90<br />
r wenn r ⩵ angleBetween e1, e2 90<br />
r wenn r ⩵ angleBetween e1, e2 90<br />
v2 v1<br />
v1 ∈ V v2 ∈ V
intersect u1, v1, u2, v2<br />
u1, v1 ∈ E u2, v2 ∈ E<br />
intersect u1, v1, u2, v2 ⩵<br />
0 wenn det v1 u1 v2 u2 0<br />
0 wenn det u2 u1 u2 v2 det v1 u1 v2 u2 0<br />
0 wenn det u2 u1 u2 v2 det v1 u1 v2 u2 1<br />
Umsetzung – Algorithmen zur Formalisierung des Raums<br />
Um lange Geradensegmente 0 wenn det v1 u1 u2 u1 zusammenzuziehen, det v1 u1 v2 u2 0 widmet sich die<br />
0 wenn det v1 u1 u2 u1 det v1 u1 v2 u2 1<br />
Kantenlängen-Metrik der Reduktion des Abstands von benachbarten<br />
1 sonst<br />
Knoten. Dazu werden die Längen aller an den untersuchten Knoten anliegenden<br />
Kanten summiert und zwecks Normierung durch die Rasterzellengröße<br />
u.y v.y<br />
Sin4 ⋆ ArcTan <br />
geteilt.<br />
u, v ∈ E<br />
u.x v.x<br />
e<br />
<br />
e ∈ E g<br />
<br />
<br />
Θ e1, e2<br />
Die Winkelauflösungs-Metrik v ∈ V e1, e2 ∈ E, berechnet die Distanz zwischen den anliegenden<br />
Kanten eines Knotens und deren Richtung bei einer gleichmä-<br />
e1 & e2 Kantenpaar<br />
auf v<br />
ßigen Verteilung. Da diese jedoch schwer steuerbare Ergebnisse erzielt<br />
angleGreater90 eActual, eOriginal<br />
und mit der 4-gonalitäts-Metrik interferiert, wird sie sowohl bei Stott <strong>als</strong><br />
eActual ∈ E intersect u1, v1, u2, v2<br />
u1, v1 ∈ E u2, v2 ∈ E<br />
auch in dieser Arbeit nicht berücksichtigt.<br />
Die Gerade-Linien-Metrik 0 wenn 90 angleBetween e1, e2 90<br />
intersect u1, v1, u2, berechnet v2 ⩵ Kosten aus der Abweichung aller<br />
angleGreater90 e1, e2 ⩵ r wenn r ⩵ angleBetween e1, e2 90<br />
Kantenpaare des 0 wenn untersuchten det v1 u1 v2 u2 rKnotens wenn 0 r ⩵ angleBetween von einer e1, geraden e2 90 Linie. Kantenpaare<br />
zeichnen sich dadurch aus, dass sie aus einer eingehenden und<br />
0 wenn det u2 u1 u2 v2 det v1 u1 v2 u2 0<br />
0 wenn det u2 u1 u2 v2 det v1 u1 v2 u2 1<br />
einer ausgehenden Kante bestehen, die in der Sortierung des Darstel-<br />
0 wenn det v1 u1 u2 u1 det v1 u1 v2 u2 0<br />
lungskontextes<br />
0 wenn direkt<br />
v2 det v1 v1 u1 u2 u1 det v1 u1 v2 u2 1<br />
aufeinander folgen. Kantenpaare einer U-Bahnv1<br />
∈ V1 v2sonst<br />
∈ V<br />
Station bestehen aus den angrenzenden Abschnitten einer U-Bahn-Linie,<br />
Paare eines Brennpunkts bestehen aus den Ortswechseln zwischen den<br />
u.y v.y<br />
Sin4 ⋆ ArcTan <br />
drei aufeinander folgenden Check-ins, bei denen der zweite Check-in an<br />
u, v ∈ E<br />
u.x v.x<br />
dem betrachteten Brennpunkt stattfindet. Die Gerade-Linien-Metrik wird<br />
errechnet, indem () die Abweichung zweier Richtungsvektoren von<br />
e<br />
einer durchgehenden Gerade errechnet:<br />
e ∈ E<br />
g<br />
<br />
v ∈ V<br />
<br />
e1, e2 ∈ E,<br />
e1 & e2 Kantenpaar<br />
auf v<br />
Θ e1, e2<br />
angleGreater90 eActual, eOriginal<br />
Erweitert werden die Kriterien Stotts und Rodgers‘ um Metriken zur<br />
eActual ∈ E<br />
Berücksichtigung der Richtungserhaltung und des Mindestabstands. Da<br />
Tests zeigten, dass Kanten mitunter gravierende Richtungsänderungen<br />
0 wenn 90 angleBetween e1, e2 90<br />
angleGreater90 e1, e2 ⩵<br />
erfuhren, wurde eine Metrik entwickelt,<br />
r wenn r ⩵ angleBetween<br />
die die<br />
e1,<br />
Kosten<br />
e2 90<br />
erhöht, je stärker<br />
r wenn r ⩵ angleBetween e1, e2 90<br />
sich die Neuausrichtung einer Kante von der ursprünglichen Richtung<br />
unterscheidet, wobei ein Toleranzbereich von 90° definiert wurde. Die<br />
Funktion angleBetween() errechnet den Winkel zwischen zwei Vektoren,<br />
v2 v1<br />
v1 ∈ V v2 ∈ V<br />
so dass die Richtungserhaltungs-Metrik durch<br />
71
mit<br />
0 wenn det u2 u1 u2 v2 det v1 u1 v2 u2 0<br />
u.y v.y<br />
e<br />
Sin4 ⋆ ArcTan <br />
0 wenn det u2 u1 u2 v2 det v1 u1 v2 u2 1<br />
u,<br />
e ∈ E g v ∈ E<br />
u.x v.x<br />
0 wenn det v1 u1 u2 u1 det v1 u1 v2 u2 0<br />
1 sonst<br />
e Θ e1, e2<br />
v ∈ V e1, e2 ∈ E,<br />
ee1 ∈& Ee2gKantenpaar<br />
auf v<br />
<br />
u.y v.y<br />
Sin4 ⋆ ArcTan <br />
u, v ∈ E<br />
u.x v.x<br />
Θ e1, e2<br />
angleGreater90 eActual, eOriginal<br />
v ∈ V e1, e2 ∈ E,<br />
eActual ∈e1 E & e2 Kantenpaar<br />
auf v<br />
e<br />
<br />
e ∈ E g<br />
0 wenn 90 angleBetween e1, e2 90<br />
angleGreater90 eActual, eOriginal<br />
angleGreater90 e1, e2 ⩵ r wenn r ⩵ angleBetween e1, e2 90<br />
eActual ∈ E<br />
r wenn r ⩵ angleBetween e1, e2 90<br />
Θ e1, e2<br />
v ∈ V e1, e2 ∈ E,<br />
e1 & e2 Kantenpaar<br />
auf v<br />
angleGreater90 e1, e2 ⩵<br />
v2 v1<br />
v1 ∈ V v2 ∈ V<br />
<br />
errechnet werden kann.<br />
0 wenn det v1 u1 v2 u2 0<br />
0 wenn det v1 u1 u2 u1 det v1 u1 v2 u2 1<br />
eActual ∈ E<br />
<br />
v1 ∈ V v2 ∈ V<br />
v2 v1<br />
0 wenn 90 angleBetween e1, e2 90<br />
r wenn r ⩵ angleBetween e1, e2 90<br />
r wenn r ⩵ angleBetween e1, e2 90<br />
angleGreater90 eActual, eOriginal<br />
0 wenn 90 angleBetween e1, e2 90<br />
Der Mindestabstand angleGreater90verhindert e1, e2 ⩵ r wenn ein r ⩵Überlappen angleBetween e1, oder e2 90 zu nahes Zusammenrücken<br />
benachbarter Knoten. Er wird<br />
r wenn r ⩵ angleBetween e1, e2 90<br />
mittels<br />
v2 v1<br />
v1 ∈ V v2 ∈ V<br />
berechnet.<br />
Da die Berechnung der Metriken bei einer großen Anzahl von Knoten sehr<br />
zeitintensiv ausfällt und etwa die Komplexität der Kantenschnittmetrik<br />
quadratisch ansteigt, empfehlen Stott und Rodgers einen Optimierungsschritt.<br />
In einer Vorverarbeitungsphase sollen alle Knoten herausgefiltert<br />
werden, die einen Grad von 2 haben, <strong>als</strong>o diejenigen, die über genau<br />
ein Kantenpaar verfügen. Die Metrikberechnungen können dann auf die<br />
verbleibenden Knoten reduziert werden, was die Berechnungsschritte<br />
deutlich reduziert. Am Ende werden die Knoten mit dem Grad 2 in gleichmäßigen<br />
Abständen auf ihren nun geraden Ursprungskanten verteilt.<br />
Dieses setzt jedoch die der U-Bahn eigene „Charakteristik mit langen<br />
Reihen von Stationen, die von einer zentralen Gegend abstrahlen“ 69<br />
voraus. Da diese in dieser Arbeit nicht gegeben ist, kann die vorgeschlagene<br />
Optimierungstechnik nicht angewandt werden. Da es sich hierbei<br />
jedoch um ein skalierbares Nutzerinterface handelt, welches entweder<br />
eine komplexe Detailansicht oder eine vereinfachte Übersicht darstellt,<br />
können die Berechnungen durch Knoten- und Kantenzusammenfassung<br />
vereinfacht werden. Wird hineingezoomt, ist nur ein Detailausschnitt des<br />
Rasters berechnungsrelevant und kann somit feiner aufgelöst werden.<br />
Wird hinausgezoomt, sollen die Details zwecks Übersicht zusammen-<br />
69 Stott 01, S. 2. Im englischen Original: ,Metro maps tend to have a certain characteristic<br />
of long lines of stations radiating from a central area‘<br />
72
Umsetzung – Demonstrator<br />
gefasst werden, so dass das Raster vergröbert wird. Knoten, die dabei<br />
in demselben Rasterpunkt landen, brauchen nicht mehr einzeln in die<br />
Berechnungen einzufließen, sondern nur deren Vereinigung. Kanten, die<br />
dadurch die gleichen Anfangs- und Endknoten erhalten, können ebenso<br />
zusammengefasst werden, wodurch das Ergebnis der Berechnung einer<br />
zusammengefassten Kante lediglich mit dessen Kindanzahl multipliziert<br />
werden braucht.<br />
Um eine Darstellung des formalisierten Raumes bei Interaktionen in Echtzeit<br />
zu gewährleisten, werden in einem Vorverarbeitungsschritt zunächst<br />
für vier Zoomstufen die Positionen und Zusammenfassungen der Brennpunkte<br />
vorberechnet und zwischengespeichert. Die Zoomstufen sind<br />
so gewählt, dass die erste Stufe die gesamte Darstellung anzeigt und<br />
die letzte Stufe keine gruppierten Brennpunkte mehr enthält. Wird beim<br />
geographischen Eintauchen in die Darstellung eine dieser Zoomstufen<br />
überschritten, basiert die räumliche Darstellung auf der zwischengespeicherten<br />
Formalisierung.<br />
{!!! Schaubild Formalisierungsalgorithmus}<br />
5.6 Demonstrator<br />
Die Kombination von WPF, ObservableCollection und einer derart fein<br />
gegliederten View-Architektur (vgl. Kapitel 5.3 – Entwicklungsschritte)<br />
bietet eine gute Codeübersicht und ermöglicht das einfache Austauschen<br />
der Objekte. Jedoch führt die nicht benötigte Funktionalität jeder<br />
Instanz der System.Windows.FrameworkElement Klasse zu einem<br />
erheblichen Overhead, der bei einer schnell erreichten Anzahl von 200<br />
darzustellender Check-ins 797 View-Objekte generiert – 200 Brennpunkte,<br />
199 Ortswechsel, 199 Verweildauern und Schlieren aus 199<br />
Elementen –, die eine flüssige Darstellung bei Interaktionen unmöglich<br />
macht. Weiter machte sich eine grundlegende Eigenschaft der ObservableCollection<br />
negativ bemerkbar. Da die ObservableCollection kein<br />
Locking unterstützt (vgl. [@Petzold09]), leitet sie die Änderungen an die<br />
von ihr referenzierten Elemente einzeln weiter. Jedoch werden bei Zoom-<br />
Operationen in der Regel alle ViewModel-Elemente modifiziert, so dass<br />
die Anzahl der View-Neuberechnungen pro Interaktionsschritt der Anzahl<br />
der ViewModel-Elemente entspricht.<br />
Locking<br />
exklusives Zugriffssperre einer<br />
Ressource, so sie von<br />
keinem anderen Prozess<br />
gelesen werden kann<br />
73
Der Demonstrator ist dahingehend umkonzipiert, dass nur je ein System.<br />
Windows.FrameworkElement zur Darstellung aller Brennpunkte, aller<br />
Ortswechsel, aller Verweildauern und aller Schlieren existiert, wobei die<br />
einzelnen visuellen Elemente durch schlanke Kinderobjekte repräsentiert<br />
werden. Diese Kapselung löst die Overhead-Problematik. Um dem<br />
fehlenden Locking der ObservableCollection zu begegnen, wurde die<br />
Klasse LockableObservableCollection erstellt, in der ein Notification-<br />
Lock implementiert wurde (siehe Abb. 19).<br />
Die Funktionsweise der View, die zunächst sämtliche Ableitungen vom<br />
FrameworkElement in einem System.Windows.Controls.ItemsControl<br />
instanziierte und somit eine große Anzahl gekapselter interaktive,<br />
visueller Objekte erzeugte, wurde analog zu Petzolds Vorgehen modifiziert.<br />
Das ItemsControl wurde durch eigene Renderer ersetzt, die<br />
vom FrameworkElement erben. Diese erstellen für die einzelnen visuellen<br />
Elemente jedoch keine FrameworkElement Objekte mehr, sondern<br />
gruppieren in sich selbst die zur Kommunikation mit der WPF-Ebene und<br />
zum Reagieren auf Interaktion notwendige Funktionalität. Die grafischen<br />
Objekte brauchen somit nur noch von der System.Windows.Media.<br />
DrawingVisual Klasse zu erben, die weitaus einfacher und schlanker <strong>als</strong><br />
ein FrameworkElement konzipiert ist und das Neuzeichnen der View bei<br />
Änderungen des ViewModels erheblich beschleunigt (vgl. [@Petzold09]).<br />
74
Umsetzung – Demonstrator<br />
Stage<br />
System.Windows.FrameworkElement<br />
1..1<br />
1..1<br />
Spot<br />
Abidance Change Schlieren DateGrid<br />
Render Package<br />
System.Collections.ObjectModel.ObservableCollection<br />
LockableObservableCollection<br />
- Lock : Boolean<br />
- forceNotification<br />
Spot-<br />
Collection<br />
Abidance-<br />
Collection<br />
Change-<br />
Collection<br />
Schlieren-<br />
Collection<br />
ViewModel Package<br />
Abb. 19: Klassendiagramm des Demonstrators<br />
Um das ViewModel mit Daten zu versorgen wird Gebrauch vom Sprachkonstrukt<br />
LINQ gemacht. Dieses ermöglicht eine übersichtliche Codedarstellung,<br />
einhergehend mit einer guten Quelltext-Lesbarkeit. Da sich<br />
LINQ des Theorems der deklarativen Programmierung bedient, bei der<br />
die Beschreibung des Problems im Vordergrund steht und der Lösungsweg<br />
automatisch ermittelt wird, lässt sich gegenüber der imperativen<br />
75
Programmierung die Funktionalität aus komplexen und häufig unübersichtlich<br />
verschachtelten Schleifen in einem einzigen Ausdruck zusammenfassen.<br />
Folgendes Beispiel zeigt eine einfache Listenoperation, bei<br />
der alle Elemente, deren Eigenschaft Number größer <strong>als</strong> 5 ist, von einer<br />
gesonderten Liste referenziert werden, zunächst <strong>als</strong> Pseudocode im<br />
imperativen Programmierstil<br />
var elemGreatFive;<br />
for( var i = 0; i< list.Length; i++)<br />
{<br />
}<br />
var item = list[i];<br />
if( item.Number > 5 )<br />
{<br />
}<br />
elemGreatFive.Add(item)<br />
und unter Verwendung von LINQ im deklarativen Stil<br />
var elemGreatFive = list.Select( item => item.Number > 5);<br />
Entwickelt wurde der Demonstrator vorwiegend auf handelsüblichen<br />
Windows-basierten Computern ohne Multi-Touch-Fähigkeit. Zum Implementieren<br />
und Testen der Multi-Touch-basierten Zoom-Interaktionstechniken<br />
wurde eine Abstraktionsebene geschaffen, die zunächst über<br />
das Mausrad angesprochen wurde. Die verschiedenen Zoom-Arten<br />
(vgl. Kapitel 4.2 – Das Konzept ZeitRaumPost) wurden mittels Mausrad-<br />
Tastendruck-Kombinationen simuliert. Durch diese Abstraktion war es<br />
möglich, die Interaktionstechniken zu optimieren, auch ohne ständig an<br />
einem Multi-Touch-Tisch arbeiten zu müssen. Abschließend wurde die<br />
Abstraktionsebene durch ein weiteres Modul angesprochen, welches die<br />
im .net-SDK für Windows 7 integrierten Ereignisse UIElement.Touch-<br />
DownEvent, UIElement.TouchMoveEvent und UIElement.TouchUpEvent<br />
an die Interaktionsroutinen weiterleitet. Diese Ereignisse teilen nicht<br />
nur über das TouchDownEvent und das TouchUpEvent mit, dass eine<br />
Bildschirmberührung mit dem Finger stattgefunden hat, sondern weisen<br />
jedem Berührungspunkt auch eine Identifikationseigenschaft zu. Derart<br />
kann neben der einfachen Information des Stattfindens einer Berührung<br />
mittels TouchMoveEvent auch die Information ausgelesen werden,<br />
welcher Berührungspunkt, <strong>als</strong>o welcher Finger, sich wohin bewegt hat<br />
(vgl. [MacDonald 10], S. 149 ff.).<br />
76
Umsetzung – Demonstrator<br />
Da sich bei einer Pinch-Geste zwei Finger, beziehungsweise zwei Fingerpaare,<br />
aufeinander zubewegen oder voneinander entfernen, lässt sich<br />
aus der relativen Veränderung der Berührungen zueinander umgehend<br />
eine Transformationsmatrix errechnen, die Auskunft über die Skalierung,<br />
das Transformationszentrum, die Rotation und die Translation gibt. Diese<br />
Transformationsmatrix kann an die Abstraktionsebene zur Interaktionssteuerung<br />
weitergereicht und unmittelbar auf das Schaubild angewandt<br />
werden. Anders <strong>als</strong> bei der mausradbasierten Zoomtechnik ist hierbei<br />
kein Mapping von Drehstärke auf Skalierverhalten notwendig, welches<br />
ein abstraktes Moment der Beliebigkeit mit sich bringt, so dass die visuelle<br />
Rückmeldung unmittelbar und unverfälscht stattfindet.<br />
ViewModel Package<br />
Zur Umsetzung des<br />
Formalisierungsalgorithmus<br />
2<br />
Node<br />
Edge<br />
wurde eine<br />
D a t e n s t r u k t u r<br />
1..*<br />
geschaffen, die den<br />
visuellen Elementen<br />
Node (Brennpunkt)<br />
und Edge (Ortswechsel)<br />
noch in<br />
Anlehnung an den<br />
synonym für derartige<br />
BNode<br />
2<br />
BEdge Graphenalgorithmen<br />
verwendete Ausdruck<br />
1..*<br />
Beautifyer eine Klasse<br />
Beautified Package<br />
BEdge und BNode<br />
zuordnet (siehe Abb.<br />
Abb. 20: Datenstruktur für Raumformalisierung<br />
20). Die Klassen Node<br />
und Edge enthalten<br />
Informationen zu den geografisch korrekten Ortspositionen und einen<br />
Verweis auf die BNode beziehungsweise BEdge. BNodes enthalten die<br />
durch Formalisierung errechnete Darstellungsposition. Die Formalisierung<br />
führt in Abhängigkeit der zoombedingten Rasterweite dazu, dass<br />
unterschiedliche Brennpunkte mit räumlicher Nähe zu regionalen Brennpunkten<br />
zusammengefasst werden. Diese zusammengefassten Brennpunkte<br />
bestehen aus einer BNode, die auf die ursprünglichen Nodes<br />
verweist. Die durch die Zusammenfassung von Brennpunkten entstehenden<br />
Ortswechselüberlagerungen werden analog dazu von den<br />
BEdges beschrieben, die ebenso die originalen Edges referenzieren. In<br />
Abbildung Abb. 20 ist die Beziehung zwischen BNode und BEdge gestri-<br />
1..1<br />
1..*<br />
1..1<br />
1..*<br />
77
chelt dargestellt, da es keine explizite Verbindung zwischen den Klassen<br />
gibt. Jedoch lassen sich die BEdge-Objekte einer BNode durch die<br />
BEdge der Edges der referenzierten Nodes einer BNode und umgekehrt<br />
durch Hintereinanderausführung ermitteln.<br />
Die gegenseitige Referenzierung von Edges und BEdges, beziehungsweise<br />
von Nodes und BNodes, ist notwendig, um die Formalisierung<br />
korrekt errechnen und dessen Resultat in der Darstellung nutzen zu<br />
können. Der Multikriterien-Ansatz muss die Abstraktion für jede einzelne<br />
Zoomstufe jeweils neu berechnen und benötigt daher zum Erstellen der<br />
BNodes und BEdges die Originalpositionen der Nodes und Edges. In den<br />
einzelnen Iterationsschritten, welche die Positionen der existierenden<br />
BNodes anpassen, muss zur korrekten Gewichtung der Metrikberechnungen<br />
die Anzahl der der Gruppierung zugrunde liegenden Nodes<br />
eingebracht werden, was einen Verweis von der BNode auf die Node<br />
und von der BEdge auf die Edge erforderlich macht. Die semantische<br />
Spreizung der Zeitimplantation errechnet für jede Node einen Translationsfaktor,<br />
der auf die formalisierte Position der BNode anzuwenden ist.<br />
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit der Rückreferenzierung von Node<br />
auf BNode und von Edge auf BEdge.<br />
78
Umsetzung – Demonstrator<br />
79
6 Zusammenfassung<br />
6.1 Überblick<br />
Die Motivation zu dieser Arbeit beruht auf zwei Beobachtungen. Zum<br />
einen fällt auf, dass in alltäglichen computergestützten Arbeitsabläufen<br />
umfassende Informationsmengen entstehen, deren Organisation, Verwaltung<br />
und Adressierung eine zeitintensive Herausforderung an den Nutzer<br />
darstellt. Zum anderen zeigt sich, dass mit zunehmender Durchdringung<br />
des Alltags durch virtuelle Dienstleistungen vermehrt digitale Spuren<br />
entstehen. Diese Spuren hinterlässt ein Nutzer während verschiedener<br />
Aktivitäten unwissentlich oder in einem Bewusstsein, das sich alleine<br />
auf den Entstehungskontext beschränkt. Er begreift diese jedoch nicht<br />
<strong>als</strong> Datenhistorie, die <strong>als</strong> Orientierungshilfe in digitalen Informationsbeständen<br />
dienen kann. Plakativ lässt sich formulieren, dass diese Spuren<br />
einfach da sind.<br />
Erlebniszeit durch kognitive Karten<br />
Es wurde die Rezeption von Zeit analysiert. Dabei stellte sich heraus,<br />
dass Zeit maßgeblich über den Ort des Erlebens wahrgenommen wird,<br />
und dass sich Zeit und Raum gegenseitig bedingen und unterstützen.<br />
Ferner wurde gezeigt, dass Menschen geographische Ortsbezüge<br />
anhand kognitiver Karten erinnern, die sich durch systematische Vereinfachungen<br />
auszeichnen und vorwiegend auf Wege und Brennpunkte<br />
reduziert sind. Analysen zur Darstellbarkeit von Zeit in ruhenden Bildern<br />
zeigten die Nutzung von Multiplen auf, deren sequentielle Komposition<br />
Bewegungsabläufe sowie Zeitverläufe in ein Gesamtbild mit weiteren<br />
Informationsgrößen integrieren kann.<br />
Demonstratorische Konzeptanwendung<br />
Aufbauend auf diesen Erkenntnissen entstand ein Demonstrator, der<br />
auf der Nutzung von Zeit <strong>als</strong> a priori verfügbares Organisationskriterium<br />
großer Informationsmengen basiert. Zeit wird dabei nicht ausschließlich<br />
über naturzeitliche Datumsinformationen, sondern im Sinne von Erlebniszeit<br />
kommuniziert. Aus der Absicht, die Darstellung <strong>als</strong> Grundlage<br />
für zeitlich verortete Informationen zu Nutzen, ergab sich die Forderung<br />
nach einer zurückhaltenden, linearen Zeitvisualisierung. Dem Zurückhal-<br />
80
Zusammenfassung – Überblick<br />
tungsanspruch wurde durch Verzicht auf explizit hinzugefügte Interaktionselemente<br />
Rechnung getragen, der Forderung nach Linearität durch<br />
die Verbildlichung eines visuellen Bandes, das sich fortlaufend durch das<br />
Verweilen und die Ortswechsel zieht.<br />
Die Darstellung von Orten samt zugehöriger Ortswechsel basiert auf<br />
einem Formalisierungsalgorithmus, der die geographische Darstellung<br />
entsprechend den Erkenntnissen zu kognitiven Karten optimiert. Dabei<br />
entsteht eine verzerrte Abbildung geographischer Positionen, welche<br />
der Darstellung zu Übersichtlichkeit und Aufgeräumtheit verhilft. Aus der<br />
Entscheidung für ein Design, das direkte Interaktion mit den Elementen<br />
der Raum-Zeit-Darstellung auf Basis eines Zoomable User Interfaces<br />
offeriert, entstanden zwei Interaktionstechniken, anhand derer zeitlich<br />
und räumlich in das Interface eingetaucht werden kann. Das räumliche<br />
Eintauchen ermöglicht mittels semantischen Zoomings, das Setzen eines<br />
geographischen Fokus um räumliche Details hervortreten zu lassen oder<br />
zwecks Übersicht auszublenden. Das zeitliche Eintauchen, <strong>als</strong> semantische<br />
Spreizung bezeichnet, ermöglicht die Implantation von Zeit in das<br />
geographische Abbild. Die einzelnen dargestellten Ortswechsel nehmen<br />
dabei die Rolle von Multiplen ein, deren Komposition über die Spreizintensität<br />
und -richtung definiert und manipuliert werden kann.<br />
Interaktionsausführung<br />
Um physiologische Ausführungstechniken auf virtuelle Interaktionstechniken<br />
mappen zu können, wurde ein Komplexitätskriterium herausgearbeitet.<br />
Auf der Interaktionsseite beschreibt es die Manipulationskomplexität<br />
und die Auswirkung auf die Darstellungstopologie, auf der<br />
Ausführungsseite den physiologischen Handlungsaufwand. Anhand<br />
dieses Kriteriums kann der semantische Zoom <strong>als</strong> einfacher denn die<br />
semantische Spreizung beschrieben werden, wodurch das geographische<br />
Eintauchen mit einer zwei Finger basierten Pinch-Geste und das<br />
zeitliche Aufspreizen mit einer komplexeren Fingergruppen Pinch-Geste<br />
gesteuert wird.<br />
81
6.2 Fazit<br />
Serendipität<br />
Zufälliges Auffinden von ursprünglich<br />
nicht Gesuchtem<br />
durch Findigkeit und intelligente<br />
Schlussfolgerungen.<br />
Das Konzept der Informationsverortung in einem Raum-Zeit-Kontext, der<br />
auf existierenden digitalen Spuren mit aktivem Ortsbezug fußt, wurde<br />
mithilfe eines Demonstrators exemplarisch umgesetzt und erforscht. Es<br />
offenbarte sich neben unvorhersehbaren Herausforderungen und potenziellen<br />
Weiterentwicklungsmöglichkeiten vor allem ein Ansatz, bei dem<br />
sowohl die Spezifikation einer Anwendungsdomäne <strong>als</strong> auch die konkrete<br />
Anwendung von Serendipitätseffekten geprägt ist. Die Domäne entspringt<br />
einem Rahmen, der bislang mangels definierter Alternativen <strong>als</strong> gesättigt<br />
betrachtet wird. Die konkrete Anwendung unterstützt die Orientierung in<br />
der Zeit durch das Darstellen zunächst unbeachteter Ereignisse, deren<br />
Entdeckung den Aufbau der Erinnerung unterstützt.<br />
Als problematisch erwies sich die Nutzung des Demonstrators durch<br />
Dritte. Da der gegebene Rahmen eine Konzentration auf eine exemplarische<br />
Schnittstelle zum Beziehen digitaler Spuren mit aktivem Ortsbezug<br />
erforderte, konnten Spuren für beliebige Anwender mitunter nicht<br />
die benötigte Informationsdichte erzeugen. So diente der reale Beispielsatz<br />
des Verfassers dieser Arbeit <strong>als</strong> Visualisierungsgrundlage für die<br />
Betrachtung aller Testpersonen. Jedoch zeigte sich, dass beim Beobachten<br />
einer fremden Welt durch fremde Daten der notwendige emotionale<br />
Bezug fehlt, um für die Nachvollziehbarkeit benötigte Assoziationen<br />
hervorzurufen.<br />
Es zeigte sich, dass die vom Nutzer „im Handumdrehen“ steuerbare<br />
algorithmische Darstellung, die den linearen, ortsbasierten Zeitverlauf<br />
generiert, visuelle Muster konstruiert. Diese visuellen Muster vermögen<br />
es, zugrunde liegende Bewegungsmuster zu transportieren. Die Überlagerung<br />
der interaktiven Erlebniszeitdarstellung mit zu durchsuchenden<br />
Informationen offenbart, dass das Zusammenfassen der Zeitraumeingrenzung<br />
anhand beschreibender Faktoren und der Informationsauswahl<br />
in einem vereinten pendelnden Arbeitsablauf nicht nur die Orientierungsarbeit<br />
vereinfacht, sondern auch Synergieeffekte durch die schrittweise<br />
Konstruktion eines erinnerten Ganzen generiert.<br />
82
Zusammenfassung – Ausblick<br />
6.3 Ausblick<br />
Potential für weitere Entwicklungen ergibt sich zum einen in den Teildisziplinen,<br />
aus denen diese Arbeit entwickelt wird. Die Beschreibung und<br />
Implantation von Zeit, die Formalisierung des Raums und die beschriebenen<br />
Interaktionstechniken, generieren in dem Betrachtungskontext<br />
dieser Arbeit Fragen, deren Beantwortung weitergehende Untersuchungen<br />
erfordert. Auch die in diesem Konzept entwickelte Verknüpfung<br />
der Teildisziplinen zu einem Gesamtkomplex eröffnet Forschungsaspekte,<br />
die es zu vertiefen gilt.<br />
Weiterführende Betrachtungen zur Wahrnehmung von Zeit<br />
In Kapitel 2.4 offenbaren sich Herausforderungen bei der Suche nach<br />
weiteren geeigneten Eigenschaften zur Beschreibung von Zeit, jenseits<br />
des zunächst berücksichtigten Ortes <strong>als</strong> kleinstem gemeinsamen Nenner.<br />
Eine Untersuchung von Ereignissen hinsichtlich der Reichweite und<br />
Aussagekraft ihrer Beschreibungsmöglichkeiten kann weitere Kategorien<br />
erschließen, die der Subjektivität des Einzelnen bei der Wahrnehmung<br />
von Zeit Rechnung tragen. Denkbar sind Kategorien, die unter anderem<br />
Merkwürdigkeiten aus der Natur, der Gesellschaft, Politik, Wirtschaft,<br />
Wissenschaft oder Kultur einbringen.<br />
Evaluation der Zeitimplantation<br />
Bezüglich der Implantation von Zeit lassen sich Abstraktionsmöglichkeiten<br />
hinsichtlich der in dieser Arbeit gewählten linearen Abbildung von<br />
diskreter Zeit auf Verweildauer weiter hinterfragen. Die gewählte lineare<br />
Abbildung ermöglichte die Loslösung von der Frage, wie schnell Zeit<br />
empfunden wird, und schafft die Voraussetzung für eine unverfälschte<br />
Überlagerung mit zeitlich verorteten Informationen. Hinsichtlich der in<br />
Kapitel 5.4 entwickelten Algorithmen zur Implantation von Zeit bietet sich<br />
eine Evaluierung an, die untersucht, wie das Verhältnis zwischen darstellerischer<br />
Verfremdung mit lokaler Übersichtszunahme auf der einen Seite<br />
und Interaktion folgender Stringenz mit lokalen Übersichtsabstrichen<br />
auf der anderen Seite, hinsichtlich einer zu definierenden Optimierung<br />
ausgestaltet werden kann.<br />
Kognitive Karten im interaktiven Kontext<br />
Die Formalisierung des Raumes zwecks Anpassung an die mentale<br />
Repräsentation bietet Weiterentwicklungsmöglichkeiten technischer und<br />
theoretischer Natur, die auf der Generik des Untersuchungsgegenstandes<br />
beruhen. Bei der Nutzung von Multikriterienansätzen (vgl. auch [Davidson<br />
96]) und heuristischen Algorithmen, zeigen sich Schwierigkeiten bei den<br />
83
Abbruchbedingungen, der Berechnungskomplexität großer Informationsmengen<br />
und bei der Parametergewichtung. In einem weiteren Schritt<br />
bietet sich an, die Formalisierung auf das visuelle Gesamtkonstrukt<br />
einschließlich Zeitimplantation anzuwenden. Dabei sind Herausforderungen<br />
vor allem im Umgang mit direkter Manipulationsrückmeldung zu<br />
erwarten. Die Steuerung der Darstellungsformalisierung über Metriken<br />
führt dazu, dass das Optimierungsproblem für das einzelne Bild gelöst<br />
wird. Interaktive Grafiken bringen jedoch eine nicht in aller Konsequenz<br />
vorausbestimmbare Menge an Bildern mit sich, weshalb eine Vorschrift<br />
zur Verallgemeinerung der Formalisierung gefunden werden muss. Ihre<br />
Lösung muss hinreichend adaptiv ausfallen, um bei einer feingliedrigen<br />
Interaktionsrückmeldung, etwa den einzelnen Bildern einer animierten,<br />
kontinuierlichen, semantischen Zoom- oder Spreizoperation, das<br />
Ergebnis der Optimierung konsequent mitzuskalieren.<br />
Die Applikation von gängigen Fischaugen-Interaktionstechniken (vgl.<br />
XXX) auf das erarbeitete Konzept vermag interessante Perspektiven zu<br />
eröffnen, die sich sowohl auf das temporäre Eintauchen in die geografische<br />
<strong>als</strong> auch die zeitliche Darstellungskomponente beziehen, ohne die<br />
Übersicht aufzugeben.<br />
Anwendung bei Gruppen von Menschen<br />
Aus der Berücksichtigung Hägerstrands Anliegen (vgl. Kapitel 3.4 – Zeit<br />
durch Tiefe) ergeben sich weitere relevante Anknüpfpunkte. Wie verhält<br />
sich dieser Ansatz, wenn er auf eine Gruppe von Menschen ausgeweitet<br />
wird, so dass nicht die Historie eines einzelnen, sondern die Historie<br />
eines Kollektivs dargestellt und untereinander in Verhältnis gesetzt wird?<br />
Fragen der Überlappung, der Konkurrenz und des Verortungsbezugs<br />
sind in ausformulierten Szenarien zu analysieren.<br />
Der Vorteil einer derartigen Erweiterung läge weniger in einer Untersuchung<br />
städtebaulicher Eigenarten und Lebensqualität, wie sie Hägerstrand<br />
motiviert. Vielmehr könnte sie bei Hilfestellungen zur zeitlichen<br />
Orientierung von Ergebnissen einer Teamarbeit, eines Freundeskreises<br />
oder einer Familie von Interesse sein. Sie könnte die Beschreibung von<br />
Zeit, die Beschreibungsmöglichkeiten von Ereignissen um einen wichtigen<br />
Faktor erweitern, den der Mitmenschen.<br />
84
Zusammenfassung – Ausblick<br />
85
7 Anhang<br />
A Glossar<br />
API<br />
Bar Camp<br />
Broadcast<br />
Coworking Space<br />
C#<br />
Data Binding<br />
digitale Boheme<br />
Dodgeball<br />
86
Anhang – Ausblick<br />
DNG<br />
DNG (Digital Negative) ist ein offenes Format der Firma Adobe, welches<br />
das Ziel der Vereinheitlichung von RAW-Dateien verfolgt. Siehe [@<br />
DNG09].<br />
Entrepreneurship<br />
Evernote<br />
Exif<br />
Exif (Exchangeable Image File Format) ist eine Spezifikation zur Erweiterung<br />
von Bilddateien von Digitalkameras um Metadaten, siehe [@Exif02].<br />
Diese befinden sich im Kopfbereich der Datei und können neben technischen<br />
Angaben zu Kamera und Bild auch Datums und GPS-Informationen<br />
enthalten. Da Exif nur TIFF, JPEG und RIFF WAV <strong>als</strong> Container unterstützt,<br />
aber keines der gängigen RAW-Formate, gibt es viele proprietäre<br />
Konkurrenzspezifikationen. Einen Ansatz zur Vereinheitlichung der RAW-<br />
Formate und deren Metadaten bietet das DNG Format.<br />
Facebook<br />
Facebook Places<br />
Framework<br />
87
Google Latitude<br />
Information Retrieval<br />
JPEG<br />
JPEG-Dateien, die um Exif-Metadaten angereichert wurden, sind auch<br />
<strong>als</strong> JFIF Dateien geläufig (vgl. [@JFIF92]).<br />
kubische Bézierkurve<br />
LINQ<br />
Lock<br />
Mashup<br />
Microblog<br />
Der Begriff ist angelehnt an den des Microcontent. Microblogs unterscheiden<br />
sich von gewöhnlichen Blogs vor allem dadurch, dass die<br />
einzelnen Einträge über wenige Zeichen verfügen und nicht oder nur<br />
rudimentär formatiert werden können. Zu den populäre Microblogging-<br />
Platformen zählen Twitter und Tumblr, aber auch Statusmeldungen aus<br />
Sozialen Netzwerken wie Facebook, MySpace, XING.<br />
Microblogs sind auch unter dem Begriff tumblelogs bekannt.<br />
88
Anhang – Ausblick<br />
Microcontent<br />
Ursprünglich bezeichnete Microcontent nach Definition von Jakob Nielsen<br />
kleine Wortgruppen, etwa Textüberschriften oder Betreffzeilen von<br />
Emails, die Leseanreize schaffen, unmittelbar Aufschluss über den Kontext<br />
liefern und und auch ohne letzteren noch sinnvoll erscheinen.<br />
Gegenwärtig wird der Begriff vorwiegend im Sinne des Bloggers Anil<br />
Bash verwendet, der Microcontent durch eine primäre Idee, eine einzige<br />
URL/Permalink, und eine Formatierung für mobile webbasierte Endgeräte<br />
beschreibt. Siehe [@Bash02].<br />
Weitere verbreitete Bezeichnungen für Microcontent lauten chunk und<br />
snippet.<br />
Model View ViewModel<br />
-> View<br />
Multi-Touch<br />
Open Innovation<br />
Overhead<br />
Point of Interest (POI)<br />
Pinch-Geste<br />
Fingerspreiz<br />
89
Processing<br />
RAW<br />
RIFF WAV<br />
RSS<br />
Sendemast-Triangulierung<br />
Sketch<br />
Soziale Netzwerke<br />
Tablet<br />
kurzform für Tablet-PC.<br />
TIFF<br />
90
Anhang – Ausblick<br />
Twitter<br />
View<br />
WLAN-Ortung<br />
WPF<br />
B Literaturverzeichnis<br />
Aristoteles 87<br />
Barkowsky 02<br />
Baumgartner 94<br />
Benderson 95<br />
Aristoteles, Zekl H. G. (Hg): ,Physik. Vorlesung<br />
über Natur. Erster Halbband (Bücher I-IV)‘. Hamburg:<br />
Meiner Verlag, 1987.<br />
Barkowsky T.: ,Mental representation and processing<br />
of geographic knowledge: a computational<br />
approach‘. Berlin / Heidelberg: Springer,<br />
2002.<br />
Baumgartner H. M.: ,Zeit und Zeiterfahrung’ in<br />
Baumgartner H. M. (Hg): ,Zeitbegriffe und Zeiterfahrung’.<br />
Freiburg / München: Verlag Karl Alber,<br />
1994. S. 189 - 217.<br />
Furnas G. W., Bederson B. B.: ,Space-scale diagrams:<br />
understanding multiscale interfaces’. In<br />
CHI ’95: Proceedings of the SIGCHI conference<br />
on Human factors in computing systems. New<br />
York, USA: ACM Press, 1995. S. 234 - 241.<br />
91
Bertin 74<br />
Davidson 96<br />
Dobson 03<br />
Bertin J.: ,Graphische Semiologie. Diagramme,<br />
Netze, Karten’. Berlin, New York: de Gruyter,<br />
1974.<br />
Davidson R., Harel D.: ,Drawing graphs nicely<br />
using simulated annealing‘. In ,ACM Transactions<br />
on Graphics. Volume 15 Issue 4‘. New<br />
York: 1996.<br />
Dobson J. E., Fisher P. F.: ,Geoslavery’. In IEEE<br />
Technology and Society Magazine, Volume 22,<br />
Issue 1. Kansas USA: 2003. S. 47 - 52.<br />
Duden 03 Kunzel-Razum K. (Hg), Scholze-Stubenrecht W.<br />
(Hg), Wermke M. (Hg): ,Duden deutsches Universalwörterbuch’.<br />
5. überarbeitete Auflage.<br />
Mannheim / Leipzig / Wien / Zürich: Dudenverlag,<br />
2003.<br />
Eco 99<br />
Friebe 06<br />
Fry 07<br />
Grimm 12<br />
Hägerstrand 70<br />
Eco U.: ,Times‘. In Kirsten Lippincott (Hg.): ,The<br />
Story of Time‘. London: Merrell Holberton Publishers,<br />
1999, S. 10-15.<br />
Friebe H., Lobo S.: ,Wir nennen es Arbeit: Die<br />
digitale Boheme oder: Intelligentes Leben jenseits<br />
der Festanstellung’. München: Wilhelm<br />
Heyne Verlag, 2006.<br />
Fry B., Reas C.: ,Processing: A Programming<br />
Handbook for Visual Designers and Artists’.<br />
Cambridge / London: MIT Press, 2007.<br />
Grimm J., Grimm W.: ,Hänsel und Gretel‘ in ,Kinder-<br />
und Hausmärchen‘. Berlin: Re<strong>als</strong>chulbuchhandlung,<br />
1812. S. 49 - 58.<br />
Hägerstrand T.: ,What about People in Regional<br />
Science‘. In: ,Papers in Regional Science.<br />
Regional Science Association Papers, Vol. 24‘,<br />
Nummer 1. Berlin / Heidelberg: Springer 1970.<br />
92
Anhang – Ausblick<br />
A Abbildungsverzeichnis<br />
Abb. 1:<br />
Abb. 2:<br />
Abb. 3:<br />
Abb. 4:<br />
Abb. 5:<br />
Nutzerzahlen gängiger geosozialer Netzwerke<br />
S. 14<br />
Foursquare Badges Last Degree und Pizzaiolo<br />
S. 16<br />
Visualisierung von weltweitem Waffenhandel<br />
mittels ARMSFLOW S. 32<br />
Screenshots aus Multiplicity, The Road Map.<br />
Israelischer Reisender S. 34<br />
Weeplaces. Der aktuell dargestellte Checkin<br />
befindet sich am dicken Ende des gelben<br />
Strahls. Die Verjüngung des Strahls hebt den<br />
zeitlichen Abstand hervor S. 34<br />
Abb. 6: Space-Time Path nach Hägerstrand S. 36<br />
Abb. 7:<br />
Abb. 8:<br />
Abb. 9:<br />
Abb. 10:<br />
Abb. 11:<br />
,The Horse in Motion‘ von Eadweard Muybridge,<br />
1878. S. 38<br />
,Men and Insects‘ von L. Hugh Newman,<br />
1965. S. 40<br />
Figurative Karte zu den Verlusten französischer<br />
Soldaten von Charles Joseph Minard (1781 -<br />
1870) S. 41<br />
The London Underground. Fahrplan von Harry<br />
Beck,1933 S. 44<br />
perspektivische und isometrische Darstellung<br />
von Ortsewechseln zwischen drei Brennpunkten<br />
S. 45<br />
93
Abb. 12:<br />
Abb. 13:<br />
Abb. 14:<br />
Abb. 15:<br />
Abb. 16:<br />
Abb. 17:<br />
Abb. 18:<br />
Musterpotential aus Reisetypen. Pendeln, Unterbrechung,<br />
Rundreise, Ausflug, außergewöhnlicher<br />
Ortswechsel S. 46<br />
Brennpunkt normal (links) und selektiert<br />
(rechts) S. 51<br />
relative formalisierte Position. Verschiebung<br />
formalisierter Brennpunkte entlang horizontaler<br />
Spreizrichtung t S. 52<br />
lokale Anpassung der vorgegebenen Spreizrichtung<br />
S. 52<br />
Funktionsweise semantischer Zoom. Durch<br />
Eintauchen neu erscheinende Brennpunkte<br />
sind orange hervorgehoben. S. 54<br />
Funktionsweise semantische Spreizung bei horizontaler<br />
Spreizrichtung. Die Verweildauer zwischen<br />
den Ortswechseln ist orange hervorgehoben.<br />
S. 54<br />
Klassendiagramm mit feingliedrigem MVVM-<br />
Entwurfsmuster S. 65<br />
Abb. 19: Klassendiagramm des Demonstrators S. 74<br />
Abb. 20: Datenstruktur für Raumformalisierung S. 76<br />
94
Anhang – Ausblick<br />
Hägerstand 89<br />
Humphreys 08<br />
Kant 98<br />
Krusche 08<br />
Löw 07<br />
Lynch 89<br />
Marinos 10<br />
MacDonald 10<br />
Mountain 01<br />
Hägerstrand T.: ,Reflections on „What about<br />
People in Regional Science“‘. In ,Papers of the<br />
Regional Science Association, Vol. 66‘ 1989, S.<br />
1-6.<br />
Humphreys L.: ,Mobile Social Networks and<br />
Social Practice: A Case Study of Dodgeball’. In<br />
Journal of Computer-Mediated Communication,<br />
13. Blackwell Publishing Inc, 2008. S. 341 - 360.<br />
Kant I.: ,Kritik der reinen Vernunft’. Hamburg:<br />
Meiner Verlag: 1998<br />
Krusche J.(Hg): Der Raum der Stadt: Raumtheorien<br />
zwischen Architektur, Soziologie, Kunst und<br />
Philosophie in Japan und im Westen. Marburg:<br />
Jonas Verlag: 2008.<br />
Löw M., Steets S., Stoetzer S. (2007): Einführung<br />
in die Stadt- und Raumsoziologie. Stuttgart,<br />
UTB: 2007.<br />
Lynch K.: ,Das Bild der Stadt’ (1960). 2. Auflage,<br />
Braunschweig: Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft,<br />
1989.<br />
Marinos D., Geiger C., Schwirten T., Göbel S.:<br />
‚Multitouch navigation in zoomable user interfaces<br />
for large diagrams‘. In ‚ITS 10. ACM International<br />
Conference on Interactive Tabletops<br />
and Surfaces‘. New York: ACM, 2010.<br />
MacDonald M.: ,Pro WPF in C# 2010: Windows<br />
Presentation Foundation in .NET 4.0‘. New York:<br />
Springer, 2010.<br />
Mountain D., Raper J.: ,Modelling human spatio-temporal<br />
behaviour: A challenge for location-based<br />
services‘. London, Dept Information<br />
Science, City University, 2001.<br />
95
Norman 88<br />
Petzold 06<br />
Prensky 01<br />
Probst 09<br />
Ratti et al. 07<br />
Schaffer 96<br />
Shneiderman 03<br />
Snow 03<br />
Stott 04<br />
Norman D. A.: ,The Design of Everyday Things‘.<br />
New York: Basic Books, 1988<br />
Petzold C.: ,Anwendung = Code + Markup’. Unterschleißheim:<br />
Microsoft Press Deutschland,<br />
2006.<br />
Prensky M.: ,Digital Natives, Digital Immigrants‘.<br />
In: ,On The Horizon, Vol. 9 No. 5‘. MCB University<br />
Press, 2001. S. 1 - 6.<br />
Probst U. M.: ,zeitraumzeit - space[of]time‘. In<br />
Pamperl B. (Hg), Höller B. (Hg): ,zeitraumzeit‘.<br />
Wien: FOLIO, 2009.<br />
Ratti C., Pulselli R. M., Williams S., Frenchman<br />
D.: ,Mobile Landscapes: using location<br />
data from cell-phones for urban analysis‘. Cambridge:<br />
Sensable City Laboratory, 2007.<br />
Schaffer, D., Zuo, Z., Greenberg, S., Bartram, L.,<br />
Dill, J., Dubs, S., Roseman, M.: ‚Navigating Hierarchically<br />
Clustered Networks Through Fisheye<br />
and Full-Zoom Methods‘. In ACM Transactions<br />
on Computer-Human Interaction 3(2), 1996. S.<br />
162 - 188.<br />
Shneiderman B., Bederson B. B.: ,The craft of<br />
information visualization’. San Francisco: Morgan<br />
Kaufmann, 2003.<br />
Snow J. C., Mattingley J. B.: ,Perception, Unconscious‘.<br />
In Nadel L. (Hg): ,Encyclopedia of<br />
Cognitive Science‘. John Wiley & Sons, 2003.<br />
Stott J. M., Rodgers P.: ,Metro Map Layout<br />
Using Multicriteria Optimization‘. In ,Proceedings<br />
of the Eighth International Conference on<br />
Information Visualisaion‘. IEEE, 2004. S. 355 -<br />
362.<br />
96
Anhang – Ausblick<br />
Thompson 08<br />
Toman 04<br />
Tufte 83<br />
Tufte 97<br />
Yu 10<br />
Thompson N. (Hg): ,Experimental Geography.<br />
radical approaches to landscape, cartography,<br />
and urbansim‘. New York: Independent Curators<br />
International, 2008.<br />
Nidal Toman: ,Subjektives Zeitempfinden und<br />
Autonomes Nervensystem’. Dissertation. Charité<br />
– Universitätsmedizin Berlin, 2004.<br />
Tufte E. R.: ,The Visual Display of Quantitative<br />
Information‘. University of Michigan: Graphics<br />
Press, 1983.<br />
Tufte E. R.: ,Visual explanations: images and<br />
quantities, evidence and narrative‘. University of<br />
Michigan: Graphics Press, 1997.<br />
Yu H., Shih-Lung S.: ,Revisiting Hägerstrand‘s<br />
Time-Geographic Framework for Individual Activities<br />
in the Age of Instant Access‘. Oklahoma<br />
State University / University of Tennessee, 2010.<br />
97
C Webseitenverzeichnis<br />
@armsflow<br />
@Bash02<br />
@Beck<br />
@brightkite<br />
@DNG09<br />
@Exif02<br />
Internetpräsenz des Projekts Armsflow vom<br />
Stockholm International Peace Research Institute<br />
(SIPRI): www.armsflow.org/, Stand<br />
01.01.2010.<br />
Introducing the microcontent client: dashes.<br />
com/anil/2002/11/introducing-microcontent-client.html<br />
Stand 01.01.2010.<br />
Transport of London Site über Harry Beck,<br />
www.tfl.gov.uk/corporate/projectsandschemes/2443.aspx,<br />
Stand 01.01.2010.<br />
Internetpräsenz des standortbezogenen Dienstes<br />
brightkite: www.brightkite.com/, Stand<br />
01.01.2010.<br />
DNG Spezifikation Version 1.3.0.0: www.adobe.<br />
com/products/dng/<strong>pdf</strong>s/dng_spec.<strong>pdf</strong>, Stand<br />
01.01.2010.<br />
Exif Spezifikation Version 2.2: www.exif.org/<br />
Exif2-2.PDF, Stand 01.01.2010.<br />
@Facebook Jeans Facebook Seite zur Verschenkaktion von<br />
10.000 Jeans: www.facebook.com/event.<br />
php?eid=159056334132258, Stand 01.01.2010.<br />
@fb penetration<br />
@fs penetration<br />
Blogeintrag von Facebook zur eigenen Marktdurchdringung<br />
blog.facebook.com/blog.<br />
php?post=409753352130, Stand 01.01.2010.<br />
Artikel zur Marktdurchdringung von Foursquare<br />
bei vator news vator.tv/news/2010-12-08-dennis-crowley-on-creating-a-solid-product,<br />
Stand<br />
01.10.2010.<br />
98
Anhang – Ausblick<br />
@Gowalla<br />
@JFIF92<br />
@loopt<br />
@Petzold09<br />
Internetpräsenz des standortbezogenen Dienstes<br />
Gowalla: www.gowalla.com/, Stand<br />
01.01.2010.<br />
JFIF Spezifikation Version 1.02: www.jpeg.org/<br />
public/jfif.<strong>pdf</strong>, Stand 01.01.2010.<br />
Internetpräsenz des standortbezogenen Dienstes<br />
loopt www.loopt.com/, Stand 01.01.2010.<br />
Petzold C.: ,Writing More Efficient ItemsControls‘.<br />
In ,MSDN Magazine‘. msdn.microsoft.<br />
com/en-us/magazine/dd483292.aspx, Stand<br />
01.01.2010.<br />
@Starbucks Presseartikel zu Kooperation zwischen<br />
Foursquare und Starbucks www.mashable.<br />
com/2010/05/17/starbucks-foursquare-mayorspeci<strong>als</strong>/,<br />
Stand 01.01.2010.<br />
@toll collect<br />
@twitter penetration<br />
@weeplaces<br />
Internetpräsenz der Firma Toll Collect: www.tollcollect.de,<br />
Stand 01.01.2010<br />
Artikel zur Marktdurchdringung von Foursquare<br />
bei vator news techcrunch.com/2010/06/08/<br />
twitter-190-million-users/, Stand 01.10.2010.<br />
Internetpräsenz des Mashups Weeplaces: www.<br />
weeplaces.com/, Stand 01.01.2010.<br />
99
100
Anhang – Ausblick<br />
D Tabellenverzeichnis<br />
101
E Quelltexte<br />
102
–<br />
103
104
–<br />
105
106