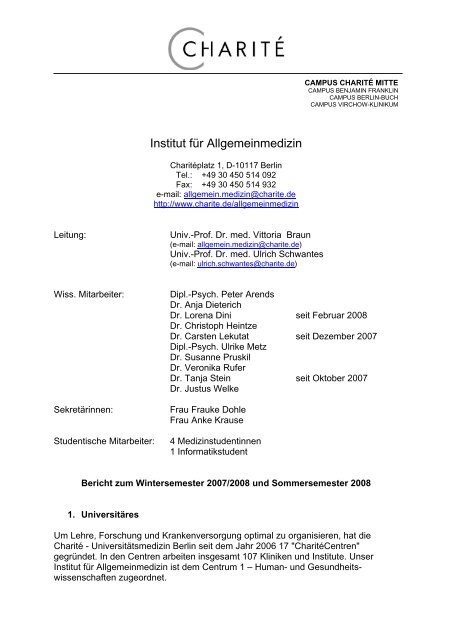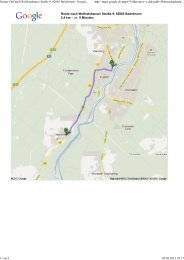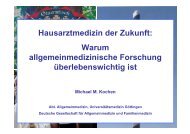Berlin - GHA
Berlin - GHA
Berlin - GHA
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
CAMPUS CHARITÉ MITTE<br />
CAMPUS BENJAMIN FRANKLIN<br />
CAMPUS BERLIN-BUCH<br />
CAMPUS VIRCHOW-KLINIKUM<br />
Institut für Allgemeinmedizin<br />
Charitéplatz 1, D-10117 <strong>Berlin</strong><br />
Tel.: +49 30 450 514 092<br />
Fax: +49 30 450 514 932<br />
e-mail: allgemein.medizin@charite.de<br />
http://www.charite.de/allgemeinmedizin<br />
Leitung:<br />
Univ.-Prof. Dr. med. Vittoria Braun<br />
(e-mail: allgemein.medizin@charite.de)<br />
Univ.-Prof. Dr. med. Ulrich Schwantes<br />
(e-mail: ulrich.schwantes@charite.de)<br />
Wiss. Mitarbeiter:<br />
Sekretärinnen:<br />
Studentische Mitarbeiter:<br />
Dipl.-Psych. Peter Arends<br />
Dr. Anja Dieterich<br />
Dr. Lorena Dini seit Februar 2008<br />
Dr. Christoph Heintze<br />
Dr. Carsten Lekutat seit Dezember 2007<br />
Dipl.-Psych. Ulrike Metz<br />
Dr. Susanne Pruskil<br />
Dr. Veronika Rufer<br />
Dr. Tanja Stein seit Oktober 2007<br />
Dr. Justus Welke<br />
Frau Frauke Dohle<br />
Frau Anke Krause<br />
4 Medizinstudentinnen<br />
1 Informatikstudent<br />
Bericht zum Wintersemester 2007/2008 und Sommersemester 2008<br />
1. Universitäres<br />
Um Lehre, Forschung und Krankenversorgung optimal zu organisieren, hat die<br />
Charité - Universitätsmedizin <strong>Berlin</strong> seit dem Jahr 2006 17 "CharitéCentren"<br />
gegründet. In den Centren arbeiten insgesamt 107 Kliniken und Institute. Unser<br />
Institut für Allgemeinmedizin ist dem Centrum 1 – Human- und Gesundheitswissenschaften<br />
zugeordnet.
Herr Prof. Ulrich Schwantes beendete seine Tätigkeit zum 30.09.2008. Für seinen<br />
10-jährigen Einsatz sei ihm unser besonderer Dank ausgesprochen. Seit dem<br />
1.10.2008 obliegt die Leitung Frau Prof. Vittoria Braun. Im Oktober 2008 wurde die<br />
zweite Hälfte des allgemeinmedizinischen Lehrstuhls ausgeschrieben.<br />
2<br />
2. Lehre<br />
a) Vorlesungen<br />
Die Vorlesungen im Bereich Allgemeinmedizin finden im 5. klinischen Semester mit 2<br />
Doppelstunden pro Woche statt. Seit dem Sommersemester 2008 werden pro<br />
Semester 7 Vorlesungen als Präsenzvorlesungen gehalten und 6 Vorlesungen<br />
werden online über die Lernplattform „blackboard“ vermittelt. Die Studierenden<br />
können hierzu in moderierten Diskussionsforen mit den Lehrkräften interaktiv in<br />
Verbindung treten. Von Beginn an versuchen wir durch eine Vielzahl von<br />
Fallbeispielen, Patientenvideos und Patientenvorstellungen, Studenten aktiv in die<br />
Vorlesungsarbeit einzubeziehen. So wird ihnen beispielsweise die Lösung<br />
schwieriger Fälle von einer Woche zur anderen aufgegeben, die sie dann zu Beginn<br />
der nächsten Vorlesung in den ersten fünf Minuten vortragen können. Erfolgreiche<br />
Stundenten werden mit Theaterkarten belohnt oder zum gemeinsamen Essen<br />
eingeladen.<br />
Folgende Lehrschwerpunkte werden angeboten:<br />
- Aufgaben des Facharztes für Allgemeinmedizin und Darstellung der<br />
besonderen Rolle der Familienmedizin<br />
- Gesundheitsförderung, Prävention, Betreuung chronisch Kranker<br />
- Diagnostik und Therapie bei häufigen Beratungsanlässen<br />
- Psychosomatische Grundversorgung<br />
- Notfälle in der allgemeinmedizinischen Praxis<br />
- Versorgung Suchtkranker<br />
- Sexuelle Störungen in der allgemeinmedizinischen Sprechstunde<br />
- Aufgaben der Rehabilitation in der Allgemeinmedizin<br />
- Geriatrische Patienten<br />
- Betreuung von Sterbenden, Schmerztherapie von Tumorpatienten<br />
- Niederlassung als Allgemeinarzt, der Arzt als Unternehmer – rechtliche<br />
Probleme<br />
Die Vorlesungen sind abwechslungsreich durch Einsatz verschiedener didaktischer<br />
Mittel. Sie werden überwiegend gut bis sehr gut evaluiert.<br />
b) Blockpraktikum<br />
Zur Realisierung stehen nahezu 100 <strong>Berlin</strong>er und Brandenburger Allgemeinärzte zur<br />
Verfügung, die die Studenten eine Woche in ihren Praxen aufnehmen. Die<br />
Studierenden erhalten ein Begleitheft für das Praktikum, in dem Termine, Lernziele<br />
und Definitionen aufgeführt sind. Sie finden die Möglichkeit, die eigenen Fähigkeiten<br />
einzuschätzen und den Lehrarzt auf bestehende Defizite hinzuweisen. Am<br />
Wochenende erfolgt eine klinische Prüfung (Mini-Clinical Examination), die vom<br />
Lehrarzt benotet wird. Zusätzlich verfassen die Studierenden einen Arztbericht zu<br />
einem selbst untersuchten Patienten. Die Lehrärzte werden an jeweils zwei<br />
Fortbildungsabenden pro Jahr zu didaktischem Vorgehen und medizinischen<br />
Themen eingeladen.
3<br />
c) Fakultative Seminare<br />
In jedem Semester bieten wir den Studierenden fakultative Seminare zu<br />
verschiedenen sehr praxisbezogenen Themen an. Hierzu gehören der Kurs „Notfälle<br />
in der Allgemeinarztpraxis“, Rezeptierkurs mit Fällen aus der Praxis,<br />
Allgemeinärztliche Patientenführung in der Praxis, Vorstellung einer<br />
suchtmedizinische Grundversorgung in einer spezialisierten Allgemeinarztpraxis, der<br />
Umgang mit HIV und STD in der hausärztlichen Praxis als auch je ein Seminar zur<br />
Palliativmedizin und zur Ethik in der Medizin.<br />
d) Innovative Lehrprojekte im Regelstudiengang<br />
Der Interdisziplinäre Untersuchungskurs einschließlich Ärztlicher<br />
Gesprächsführung Teil 1<br />
Dieser Kurs, der im 1. klinischen Semester als Pflichtveranstaltung angeboten wird,<br />
wurde durch das Prodekanat für Lehre erheblich geändert. Es werden nunmehr die<br />
überwiegenden Unterrichtsstunden für Untersuchungen am Krankenbett verwandt.<br />
Die ärztliche Gesprächsführung (unter Einbeziehung von Simulationspatienten und<br />
anschließendem Feedback für die Studierenden) wurde auf sechs<br />
Unterrichtseinheiten reduziert. Die verantwortliche Leitung liegt nicht mehr beim<br />
Institut für Allgemeinmedizin. Seit dem Wintersemester 07/08 sind wieder<br />
wissenschaftliche Mitarbeiter aus unserem Institut als Dozenten für den Kurs tätig.<br />
Unterricht am Krankenbett (UaK) Allgemeinmedizin:<br />
Kurs „Ärztliche Gesprächsführung Teil 2 – Überbringen schlechter<br />
Nachrichten“<br />
ist eine Pflichtveranstaltung im Rahmen des Kurses Allgemeinmedizin im 5.<br />
klinischen Semester. Dieser Kurs wurde ab dem SoSe 2002 im Institut entwickelt und<br />
etabliert, seit dem SoSe 2004 findet er im Rahmen der Stunden für den UaK der<br />
Allgemeinmedizin statt. Seitdem wird der Kurs für alle Studierenden (CCM, CVK und<br />
CBF) gemeinsam angeboten, vorher nahmen nur die Studierenden des CCM teil. In<br />
Kleingruppen mit 6 Studierenden wird an Hand typischer Gesprächskonstellationen<br />
der Umgang mit schwierigen Gesprächssituationen trainiert:<br />
Inhalte:<br />
Schlechte Nachrichten zu überbringen oder ein Aufklärungsgespräch zu führen, sind<br />
schwierige Aufgaben im ärztlichen Alltag. Weitgehend unabhängig von der<br />
gewählten Fachrichtung sind Medizinstudierende spätestens im PJ oder im<br />
Berufseinstieg mit komplexen Gesprächssituationen konfrontiert. Die Art und Weise,<br />
wie Ärztinnen und Ärzte mit diesen Situationen umgehen, hat entscheidende<br />
Auswirkungen auf die Krankheitsbewältigung von Patienten und Angehörigen. Die<br />
Reflexion und Übung solcher Gespräche dient der Verbesserung kommunikativer<br />
und sozialer Kompetenzen und der Burn-Out-Prophylaxe. Folgende Themen sind<br />
Gegenstand des Kurses:<br />
- Überbringen einer infausten Diagnose (z.B. Krebs, Multiorganversagen,<br />
chronische Erkrankungen, dauerhafte Funktionseinschränkung, geistige und<br />
körperliche Behinderung von Neugeborenen)<br />
- Angehörigengespräche (z.B. Überbringen einer Todesnachricht)
4<br />
- Informationsvermittlung / Angehörigengespräche am Telefon<br />
- Vor- und Nachbereitung schwieriger Gespräche<br />
- Reflexionsangebot über medizinethische Fragen am Lebensende und über<br />
das ärztliche Rollenverständnis<br />
- Reflexion des eigenen, beruflichen Empathieverständnisses in der und durch<br />
die Patientenperspektive<br />
- Erfahrungsaustausch mit klinisch erfahrenen Ärztinnen, Ärzten und<br />
Patientenvertretern (Selbsthilfegruppen)<br />
Methoden/Didaktik:<br />
Wesentliche didaktische Methode des Kurses ist das Simulieren schwieriger<br />
Gespräche in strukturierten Rollenspielen, um ein erfahrungsgeleitetes Lernen zu<br />
ermöglichen. Alle Studierenden erhalten die Möglichkeit, sich praktisch sowohl von<br />
der ärztlichen als auch von der Patientenseite mit verschiedenen<br />
Gesprächssituationen auseinanderzusetzen. Als theoretische Grundlage wird den<br />
Studierenden das „Six Step Protocol“ (nach Buckman, 1992 1 ) bzw. das erweiterte<br />
„SPIKES-Protocol“ (nach Baile, Buckman et al., 2000 2 ) vermittelt.<br />
Dozierende:<br />
Die Moderation der Kleingruppen wird einerseits von studentischen TutorInnen und<br />
jungen ÄrztInnen durchgeführt, die den Kurs bereits absolviert und zusätzlich ein<br />
mehrtägiges Training zu den Kursinhalten und zur Leitung von Gruppen erhalten<br />
haben. Durch den ähnlichen Ausbildungsstand der Gruppenleitung wird ein aktiver<br />
gemeinsamer Suchprozess der Gruppe nach der „richtigen“ Gesprächsstrategie im<br />
jeweiligen Fallbeispiel unterstützt. Aus Kostengründen sind seit dem Sommersemester<br />
2008 zusätzlich wissenschaftliche MitarbeiterInnen des Instituts für<br />
Allgemeinmedizin mit der Lehre in diesem Kurs betraut.<br />
Während der Kurslaufzeit steht stets ein/e erfahrene/r wissenschaftliche/r<br />
Mitarbeiter/in des Instituts per Telefonbereitschaft unterstützend zur Verfügung.<br />
Neben einer zentralen Einführung in den Inhalt und das Konzept des Kurses für die<br />
Studierenden wird von einem wissenschaftlichen Mitarbeiter zudem am Kursende<br />
eine Nachbesprechung für alle Dozierenden des Kurses im Sinne der<br />
Qualitätssicherung realisiert. Sie wird auch anhand von Kurs begleitenden<br />
Supervisionen und Fortbildungen für alle Dozierenden gewährleistet.<br />
- Fakultatives Zusatzangebot im Rahmen des Kurses<br />
„Gesprächsrunde mit klinischen Experten“<br />
Jeweils im Anschluss an den ersten Kursnachmittag findet als fakultatives Angebot<br />
ein Gespräch mit erfahrenen Klinikern und Patienten aus Selbsthilfegruppen statt.<br />
Die Kursteilnehmer/innen sind eingeladen, Fragen zum Thema zu stellen und eigene<br />
Erfahrungen zu diskutieren.<br />
Die Evaluationsergebnisse des Kurses zeigen über sämtliche Semester konsistent<br />
eine gute bis sehr gute Akzeptanz.<br />
e) Lehre im Reformstudiengang<br />
1<br />
Buckman R. Breaking Bad News: A Guide for Health Care Professionals. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1992<br />
2<br />
Baile, W.F., Buckman R et al. SPIKES – A Six-Step Protocol for Delivering Bad News: Application to the Patient with Cancer.<br />
The Oncologist. 2000; 5: 302-311.
5<br />
Berufsfelderkundung:<br />
Den Studierenden wird durch die Besuche verschiedener Stationen ein Überblick<br />
über das ärztliche Berufsfeld geboten. Hierzu gehören 5 Pflichttermine im ersten<br />
Semester und die Verpflichtung zu 4 weiteren Terminen in Eigenregie der<br />
Studierenden bis zum Ende des 5. Semesters.<br />
Angebotene Einrichtungen: Evangelisches Geriatriezentrum <strong>Berlin</strong> (Unfallklinikum<br />
<strong>Berlin</strong>), Vereinigung „Ärzte ohne Grenzen“, Reha-Klinik Seehof (Abteilung für<br />
Verhaltenstherapie und Psychosomatik), Krankenhaus Havelhöhe - Palliativstation.<br />
Praxistag:<br />
Pflichtveranstaltung vom 2. – 5. Semester. Die Studierenden hospitieren 5 Stunden<br />
pro Woche in einer fest zugeteilten Lehrpraxis. Dafür stehen ca. 160 Praxen mit<br />
überwiegend primärärztlichem Tätigkeitsfeld bereit. Die Studierenden müssen im<br />
Laufe eines jeden Semesters eine schriftliche Epikrise (Praxisbericht) anfertigen. Für<br />
die Lehrärzte werden 4 Fortbildungsveranstaltungen pro Jahr mit medizinischen und<br />
didaktischen Inhalten angeboten.<br />
Interaktion:<br />
Pflichtveranstaltung über 10 Semester mit 4 Unterrichtseinheiten pro Woche. Für die<br />
Veranstaltung wurde ein detailliertes Curriculum entwickelt. Schwerpunkte liegen auf<br />
dem Training in Kommunikation und ärztlicher Gesprächsführung sowie in der<br />
Reflexion der ärztlichen Grundhaltung. Der Einsatz von Simulationspatienten nimmt<br />
einen breiten Raum ein. Die Interaktionsdozenten werden fortlaufend durch<br />
Schulungen weiterqualifiziert.<br />
3. Forschung<br />
Unser Institut betreut derzeit folgende Projekte:<br />
a) Innovative Umsetzungsstrategien zur Implementierung der Leitlinie<br />
„Chronische Herzinsuffizienz“ in einem Medizinischen Versorgungszentrum<br />
Projektleiterin: Prof. Dr. Vittoria Braun<br />
Das Projekt wurde als prospektive Verlaufsstudie mit Prä- und Postmessungen an<br />
zwei Studienorten realisiert. Allgemeinärzte aus einem Medizinischen<br />
Versorgungszentrum und niedergelassene Hausärzte <strong>Berlin</strong>s wurden bei Defiziten in<br />
der medikamentösen Behandlung herzinsuffizienter PatientInnen via Computer<br />
erinnert, ihre Therapie zu überdenken. Beide Gruppen rekrutierten alle PatientInnen<br />
(40 bis 90 Jahre) mit Herzinsuffizienz (NYHA I-IV), die während eines<br />
Beobachtungsjahres die Sprechstunde aufsuchten. Um den Effekt verbesserten<br />
ärztlichen Handelns zu überprüfen, finden bei den eingeschlossenen<br />
herzinsuffizienten Patienten quantitative Befragungen zu deren Lebensqualität und<br />
Zufriedenheit statt. Zusätzlich werden alle Hausärzte derzeit sowohl über ihre<br />
Erfahrungen mit der Anwendung von Recall-Systemen als auch zu ihrer<br />
Berufszufriedenheit anhand leitfadengestützter Interviews qualitativ befragt. Das<br />
Projekt lief über einen Zeitraum von 24 Monaten (Fördersumme: 90.000 Euro), es<br />
begann am 1. September 2006 und endete im August 2008. Der Abschlussbericht<br />
wurde ohne Einwände von der BÄK anerkannt.
6<br />
b) Collaboratory Social Anthropology & Lifesciences<br />
Projektleiter: Dr. med. Christoph Heintze MPH<br />
Im Rahmen einer Ausschreibung des BMBF zum Thema „Geisteswissenschaften im<br />
gesellschaftlichen Dialog“, die sich u.a. auf den Wandel des Menschenbildes im<br />
Kontext der modernen Naturwissenschaften (inkl. Medizin und Prävention) bezieht,<br />
wurde gemeinsam mit der Kollaboration „Social Anthropology & Lifesciences“ der<br />
Humboldt-Universität und zwei weiteren Partnern ein Verbundantrag eingereicht, der<br />
zwischenzeitlich angenommen worden ist (Finanzvolumen des Antrages: 1,1 Mio €,<br />
verteilt auf drei Jahre). Unser Teilprojekt „Medizinische Prävention in der<br />
Hausarztpraxis: Die Gesundheitsuntersuchung bei Übergewichtigen“ wird in <strong>Berlin</strong>er<br />
Hausarztpraxen mit unterschiedlichen Sozialindizes durchgeführt.<br />
Innerhalb des Projektes wurden Promotionsthemen vergeben. Das Projektteam<br />
organisiert gemeinsam mit den DoktorandInnen regelmäßige Treffen zum Thema<br />
„Qualitative Methoden“.<br />
c) „Evaluation des AGnES- (Arztentlastende Gemeindenahe E-Healthgestützte<br />
Systemische Intervention) Projektes in Mecklenburg-<br />
Vorpommern“<br />
Projektleiterin: Prof. Dr. Vittoria Braun<br />
Der gesundheitssystemische Wandel hat in Deutschland in den letzten Jahren vor<br />
allem in strukturschwachen Regionen zu einer höheren Belastung der Hausärzte<br />
geführt. Das altersbedingte Ausscheiden von Kollegen und mangelndes Nachziehen<br />
junger Ärzte führt zu Versorgungsdefiziten und macht eine baldige Lösungsfindung<br />
der Entscheidungsträger erforderlich. In diesem Rahmen wurde in Mecklenburg-<br />
Vorpommern das Projekt AGnES von der Kassenärztlichen Vereinigung in drei<br />
Regionen eingeführt. Das Institut für Allgemeinmedizin der Charité –<br />
Universitätsmedizin <strong>Berlin</strong> wurde von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und<br />
der Kassenärztlichen Vereinigung Mecklenburg-Vorpommerns mit der unabhängigen<br />
Evaluation des Projektes beauftragt. Ziel ist die Optimierung der hausärztlichen<br />
Versorgung. Als Ergebnisse werden die Einschätzung zur Delegierbarkeit ärztlicher<br />
Leistungen an Arzthelferinnen, Hinweise zur Verbesserung der Betreuung von<br />
chronisch Kranken im Hausbesuch und die Optimierung der Berufszufriedenheit<br />
erwartet.<br />
Das mit 60.000 EUR geförderte Projekt startete am 1.02.2008. Es gelang bisher eine<br />
erfolgreiche Befragung aller Hausärzte Mecklenburg-Vorpommerns, die sich zu 50%<br />
an der Befragung beteiligten und ein hochinteressantes Stimmungsbild vermittelten.<br />
Zur Zeit wird eine fallbezogene Vergleichsstudie bei multimorbiden Patienten<br />
durchgeführt, die im Hausbesuch betreut werden.
7<br />
d) „Verbund: „Chronischer Rückenschmerz“: Risikoadaptierte Patienteninformationen<br />
und –schulung bei nichtspezifischen Rückenschmerzen in<br />
der Allgemeinarztpraxis unter den Bedingungen einer Großstadt<br />
Projektleiter: Prof. Dr. Ulrich Schwantes<br />
Das BMBF-geförderte Projekt, zu dessen Durchführung eine<br />
Kooperationsvereinbarung mit der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald<br />
abgeschlossen wurde, verfolgt das Ziel, für Patienten mit Rückenproblemen in der<br />
Allgemeinarztpraxis modellhaft eine Struktur risikoadaptierter Informations-,<br />
Beratungs- und Schulungsangebote zu implementieren. Dieses Angebot fokussiert<br />
primär auf die individuelle psychosoziale Risikobelastung der Patienten, um<br />
individuelle Gesundheitskompetenzen im Umgang mit Rückenproblemen und eine<br />
aktive Partizipation an der Therapie zu fördern. Umgesetzt wird das Modellprojekt als<br />
cluster-randomisierte klinische Studie mit einer Interventions- und einer<br />
Kontrollgruppe an zwei Standorten (<strong>Berlin</strong>, Göttingen).<br />
Das mit 83.700 EUR geförderte Projekt startete im April 2008 und wird im März 2011<br />
enden.<br />
e) „Patientenerfahrung als Empowerment, Deutsche Version der Website<br />
DIPEx (dDIPEx) mit Aufbau der Module Diabetes und chronischer Schmerz<br />
– Teil Diabetes“<br />
Projektleiter: Prof. Dr. Ulrich Schwantes<br />
Ziel dieses in Kooperation mit dem Institut für Psychologie der Universität Freiburg<br />
betreuten Projektes ist es, über eine freie Website eine deutsche Datenbank<br />
(dDIPEx) mit Erzählungen von PatientInnen über ihre Krankheitserfahrungen<br />
aufzubauen und zu evaluieren. Der Aufbau erfolgt in Kooperation mit der<br />
Arbeitsgruppe DIPEx der Universität Oxford (www.dipex.org). Sie vermittelt<br />
Betroffenen, Angehörigen und medizinisch Tätigen Erfahrungen zum Leben mit der<br />
Krankheit, zu Therapien und Unterstützungsmöglichkeiten. Als erstes werden die<br />
Module Schmerz und Diabetes erstellt, weitere sind geplant.<br />
Das für unser Institut vom BMBF mit 68.300 EUR geförderte Projekt startete am<br />
1.04.2008 und wird am 31.03.2011 enden.<br />
f) weitere Kooperationen mit Forschungsprojekten:<br />
- Kooperation mit dem Institut für Sozialmedizin im Rahmen eines<br />
Forschungsprojektes zur Unterstützung pflegender Angehöriger<br />
g) Forschung in der Lehre<br />
- Projekt eLearning im Rahmen des Praktikums „Praxistag“ im Reformstudiengang<br />
– ein online-Konzept zur Qualitätssicherung und Unterstützung der Lehrärzte des<br />
Reformstudienganges<br />
- Projekt zum Ärztlichen Gesprächsführungskurs „Breaking Bad News“: Evaluation<br />
möglicher Veränderungsprozesse des Empathieverständnisses durch die<br />
Übernahme der Patientenrolle im Kurs
8<br />
h) Dissertationen<br />
Zur Zeit werden 18 Promotionen in unserem Institut betreut. Ca. 3-4 mal jährlich<br />
finden Promovendenseminare statt, in denen methodisch Fragen diskutiert und erste<br />
Ergebnisse präsentiert werden.<br />
BetreuerInnen:<br />
Prof. Dr. V. Braun, Prof. Dr. U. Schwantes,<br />
Dr. C. Heintze,<br />
Dr. J. Welke<br />
4. Mitgliedschaften<br />
Prof. Dr. Vittoria Braun:<br />
- 2. Vorsitzende der Vereinigung der Hochschullehrer und<br />
Lehrbeauftragten<br />
- Mitglied der Ständigen Kooperationsgruppe für Versorgungsforschung<br />
der Bundesärztekammer<br />
- Vorstandsmitglied der Deutschen Akademie für Allgemeinmedizin der<br />
BÄK<br />
- Vorstandsmitglied der <strong>Berlin</strong>er Ärztekammer<br />
- Mitglied des Kuratoriums der European Academy of Teachers in General<br />
Practice (EURACT)<br />
- Mitglied der Sektion Weiter- und Fortbildung der DEGAM<br />
- Mitglied des Ausschusses Allgemeinmedizin der <strong>Berlin</strong>er Ärztekammer<br />
- Mitglied der Deutschen Hypertoniegesellschaft<br />
Prof. Dr. Ulrich Schwantes:<br />
- Mitglied der DEGAM und der <strong>GHA</strong><br />
- Mitglied des DKPM (Deutsches Kollegium für Psychosomatische<br />
Medizin)<br />
- Mitglied in der DGGG (Deutsche Gesellschaft für Gerontologie und<br />
Geriatrie)<br />
- Mitglied der GMA (Deutsche Gesellschaft für medizinische Ausbildung)<br />
- Mitglied in der AMEE (Association for Medical Education in Europe)<br />
- Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des Angermünder Instituts für<br />
Suchttherapie und Suchtmedizin<br />
- Mitglied des Studienausschusses Reformstudiengang<br />
- Mitglied des Curriculum-Komitees für den Reformstudiengang<br />
- Mitglied der <strong>Berlin</strong>-Brandenburgischen Suchtakademie<br />
- Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des Institutes für Transkulturelle<br />
Gesundheitswissenschaften, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt/Oder<br />
5. Sonstiges<br />
Das Institut ist im Internet unter der Homepage<br />
http://www.charite.de/allgemeinmedizin zu erreichen.
9<br />
6. Veröffentlichungen<br />
Buchbeiträge – 2007/2008<br />
Becker F, Nusko G, Welke J, Hahn EG, Mansmann U.<br />
Follow-up after colorectal polypectomy: a benefit-risk analysis of German<br />
surveillance recommendations.<br />
Int J Colorectal Dis 2007<br />
Braun V:<br />
Kapitel: Merkmale Hausärztlicher Betreuung, Selbstheilung und Salutogenese,<br />
Herzrhythmusstörungen; Arterielle Hypertonie.<br />
In: Facharztprüfung Allgemeinmedizin – in Fällen, Fragen und Antworten.<br />
Urban & Fischer Verlag München 2008: 5; 33; 227-232; 246-255<br />
Originalarbeiten 2007/2008<br />
Braun K P, May M, Grassmel, Y, Führer S, Hoschke B, Braun V:<br />
Die Rolle des Hausarztes bei der Initiierung der Diagnostik des<br />
Prostatakarzinoms<br />
in: Aktuel Urol 2008; 39: 141-146, Georg Thieme Verlag KG<br />
Ausgewählte Artikel in wissenschaftlichen Zeitschriften – 2007/2008 –<br />
Braun V, Busch J, Babitsch B, Dohnke B, Begenau J, Dören M, Regitz-Sagrosek V,<br />
Fuchs J:<br />
Integration geschlechtsspezifischer Inhalte in die Lehre der Charité –<br />
Universitätsmedizin <strong>Berlin</strong><br />
GMS Z Med Ausbild. 2007; 24(3): Doc149<br />
Dieterich, A:<br />
The modern patient - Threat or promise? Physicians' perspectives on patients’<br />
changing attributes. In: Patient Education and Counseling 67, 279-285, 2007<br />
Dieterich, A:<br />
Arzt-Patient-Beziehung im Wandel: Eigenverantwortlich, informiert,<br />
anspruchsvoll Deutsches Ärzteblatt 104, Ausgabe 37 vom 14.09.2007, Seite<br />
A-2489 / B-2200 / C-2132, 2007<br />
Heintze C, Velasco M, Kroeger A:<br />
Reply to comment on: What do community-based dengue control programmes<br />
achieve? A systematic review of published evaluations<br />
Transaction of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene 2007, 101:<br />
621-623<br />
Heintze C, Velasco M, Kroeger A:<br />
What do community-based dengue control programmes achieve? A<br />
systematic review of published evaluations.<br />
Transaction of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene 2007, 101:<br />
317-325
10<br />
Heintze C, Braun V:<br />
Medizin in der Praxis: Akuter Husten – eine tägliche Herausforderung<br />
Der Hausarzt 2007 2: 17-21<br />
Rau R, Hoffmann K, Metz U, Richter P G, Rösler U, Stephan U:<br />
Gesundheitsrisiken bei Unternehmern<br />
Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie 2008; 52 (N.F.26) 3, 115-<br />
125<br />
Steinaecker K, Welke J, Bühring M, Stange R. 2007b. Pilotuntersuchung zu<br />
atemtherapeutischem Gruppenunterricht bei Patienten mit Asthma bronchiale.<br />
Forschende Komplementärmedizin / Research in Complementary Medicine<br />
14(2):86-91<br />
Ausgewählte Vorträge – 2007/2008 –<br />
Braun V:<br />
Salutogene Ressourcen im täglichen Umfeld<br />
Weiterbildungsveranstaltung, Geschäftsstelle des Berufsverbandes der<br />
Allgemeinärzte in <strong>Berlin</strong> und Brandenburg-Hausärzteverband e.V., <strong>Berlin</strong>,<br />
25.01.2007<br />
Braun V:<br />
Unterschiedliche Symptomatiken bei Frauen und Männern und differenzierte<br />
Herangehensweise in der hausärztlichen Praxis<br />
im Rahmen der Ringvorlesung „Geschlechtsspezifische Aspekte in der<br />
medizinischen Diagnostik und Therapie“ Ärztekammer <strong>Berlin</strong>, 29.05.2007 und<br />
in der Lehrveranstaltung Wahlfach „Genderbezogene Medizin“ Does gender<br />
matter?, Charité Campus Mitte, 15.11.2007<br />
Braun V:<br />
Aufgabenschwerpunkte des Institutes für Allgemeinmedizin<br />
Zentrumstag des CharitéCentrums 01 am 28.06.2007<br />
Heintze C, Henkel J, Wiesner J, Schwantes U, Bahrs O, Metz U:<br />
Prevention in primary care: doctor-patient communication about<br />
cardiovascular risks with obese clients<br />
EACH (European Association of Communication in Healthcare), 2.-5.<br />
September 2008, Oslo<br />
Metz U:<br />
Overweight and Obese patients – Challenge for primary health care providers<br />
Internationaler Kongress der Psychologen, <strong>Berlin</strong>, 23.07.2008<br />
Metz U, Dieterich A, Heintze C:<br />
Triangulation supports a comprehensive understanding of patients´ view of<br />
their obesity<br />
Internationaler Kongress der Psychologen, <strong>Berlin</strong>, 23.07.2008<br />
Schwantes U:<br />
Das Patientengespräch im Schadensfall<br />
Deutsches Ärzteforum 20.-22. Juni 2007, <strong>Berlin</strong><br />
Schwantes U:<br />
Schwierige Patienten im Krankenhaus: Wie achten wir ihre Würde,<br />
25. Medizinethischer Workshop, <strong>Berlin</strong>-Tempelhof, St. Joseph Krankenhaus,<br />
3.11.2007
11<br />
Ausgewählte Poster/Abstracts und Workshops – 2007/2008 –<br />
Arends P, Zschocke E, Pruskil S, Schwantes U:<br />
Experiencing Empathy? - Small Group Role Play Tutorials on “Breaking Bad<br />
News“<br />
Poster für die EACH (European Association of Communication in Healthcare),<br />
2.-5. September 2008, Oslo<br />
Bagci-Kaikis N, Rufer V, Welke J, Heintze C, Braun V:<br />
Innovative Umsetzungsstrategien zur Implementierung der Leitlinie<br />
„chronische Herzinsuffizienz“<br />
41. Kongress der DEGAM, <strong>Berlin</strong>, 20.-22.09.2007<br />
Dieterich A:<br />
Prüfung kommunikativer und sozialer Kompetenzen im Medizinstudium<br />
bundesweiter Workshop in Caputh bei Potsdam, 23.-25.09.2007<br />
Freund T, Lekutat C, Braun V, Schwantes U:<br />
Chronically ill patients pay more out-of-pocket payment for preventive<br />
measures<br />
WONCA Europe 2007 Conference, Paris, 17.-20. Oktober 2007<br />
Hagen L, Heintze C, Braun V, Metz U:<br />
Risikoberatung in der Hausarztpraxis: Eine Charakterisierung übergewichtiger<br />
Patienten<br />
6. Kongress für Versorgungsforschung und 2. Nationaler Präventionskongress,<br />
24.-27.10.2007, Dresden<br />
Metz U, Brinck A, Hahn D, Schwantes U, Heintze C<br />
Prevention in primary care: How do doctor’s attitudes influence<br />
consultancies with overweight and obese patients?<br />
Poster für die EACH (European Association of Communication in Healthcare),<br />
2.-5. September 2008, Oslo<br />
Metz U, Brinck A, Hahn D, Schwantes U, Heintze C<br />
Prevention in primary care: Doctor’s intentions in counselling overweight<br />
patients<br />
Poster für den Internationalen Kongress der Psychologen,<br />
20.-25. Juli 2008, <strong>Berlin</strong><br />
Rufer V, Beuermann K, Schwantes U, Welke J<br />
Allgemeinmedizin im Wandel! Eine Befragung von Studierenden der<br />
Humanmedizin über den Berufswunsch „Allgemeinmedizin“ und vergleichende<br />
Betrachtungen mit einer ähnlichen Umfrage aus dem Jahr 1988<br />
Poster zum <strong>GHA</strong>-Kongress, 18.09.2008, Greifswald<br />
Welke J, Beuermann K, Rufer V, Schwantes U<br />
Blockpraktikum Allgemeinmedizin: Ansehen steigt, Motivation bleibt<br />
unverändert<br />
Poster zum 42. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin<br />
und Familienmedizin (DEGAM), 25.-27.9-2008, <strong>Berlin</strong><br />
Wiesner J, Metz U, Dieterich A, Schwantes U, Heintze C:<br />
Welche Ursachen schreiben PatientInnen ihrem Übergewicht zu?<br />
Eine qualitative Analyse hausärztlicher Beratungsgespräche übergewichtiger<br />
PatientInnen bei der Gesundheitsuntersuchung<br />
6. Kongress für Versorgungsforschung und 2. Nationaler<br />
Präventionskongress, 24.-27.10.2007, Dresden