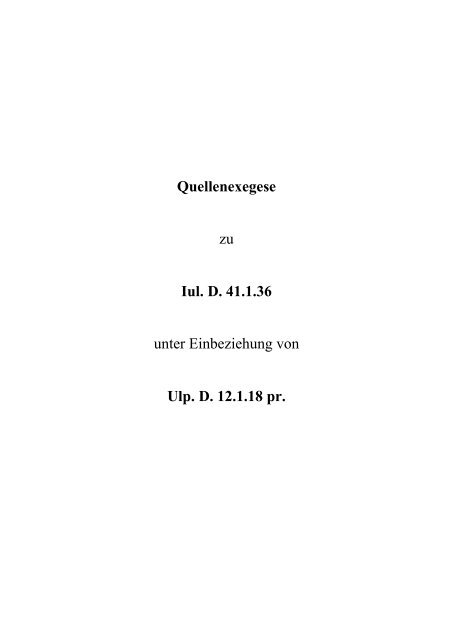Quellenexegese zu Iul. D. 41.1.36 und Ulp. D. 12.1.18 pr
Quellenexegese zu Iul. D. 41.1.36 und Ulp. D. 12.1.18 pr
Quellenexegese zu Iul. D. 41.1.36 und Ulp. D. 12.1.18 pr
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Quellenexegese</strong><br />
<strong>zu</strong><br />
<strong>Iul</strong>. D. <strong>41.1.36</strong><br />
unter Einbeziehung von<br />
<strong>Ulp</strong>. D. <strong>12.1.18</strong> <strong>pr</strong>.
- II -<br />
Gliederung:<br />
I. Quellentexte ................................................................................................................... 1<br />
1. D. <strong>41.1.36</strong> .................................................................................................................. 1<br />
2. D. <strong>12.1.18</strong> <strong>pr</strong>. ............................................................................................................. 1<br />
II. Überset<strong>zu</strong>ng .................................................................................................................. 1<br />
1. D. <strong>41.1.36</strong> .................................................................................................................. 1<br />
2. D. <strong>12.1.18</strong> <strong>pr</strong>. ............................................................................................................. 2<br />
III. Bemerkungen <strong>zu</strong> den Inskriptionen ............................................................................. 2<br />
1. Die Autoren der Quellentexte ................................................................................... 2<br />
a) Salvius <strong>Iul</strong>ianus ..................................................................................................... 2<br />
b) Domitius <strong>Ulp</strong>ianus ................................................................................................ 3<br />
2. Die Urs<strong>pr</strong>ungswerke der Digestenstellen .................................................................. 4<br />
IV. Paraphrase ................................................................................................................... 6<br />
V. Inter<strong>pr</strong>etation ................................................................................................................ 7<br />
1. traditio, iusta causa traditionis <strong>und</strong> consensus .......................................................... 8<br />
2. Julians Arbeitshypothese <strong>und</strong> ihre Begründung ....................................................... 11<br />
a) Der Gr<strong>und</strong>stücksfall ............................................................................................. 12<br />
b) Der Bargeldfall ..................................................................................................... 14<br />
aa) Scheindissens ................................................................................................. 15<br />
bb) Unbeachtlicher Kausaldissens ...................................................................... 19<br />
c) Schlussfolgerungen .............................................................................................. 21<br />
3. Zu möglichen Interpolationen .................................................................................. 22<br />
4. Ergebnis .................................................................................................................... 24<br />
VI. Vergleich mit dem geltenden Recht ........................................................................... 24
- III -<br />
Verzeichnis der verwendeten Literatur:<br />
Backhaus, Ralph<br />
In maiore minus inest<br />
ZSS 100, S. 136 – 184<br />
Banti, Luisa<br />
Traditio<br />
RE 2. Reihe, 6. Band (1937), Sp. 1875 ff.<br />
Baumgartner, Adolf Salvius <strong>Iul</strong>ianus (Salvius Nr. 14)<br />
RE 2. Reihe, 1. Band (1920), Sp. 2024 ff.<br />
Beseler, Gerhard<br />
Beiträge <strong>zu</strong>r Kritik der römischen Rechtsquellen<br />
Drittes Heft<br />
Tübingen, 1913<br />
ders.<br />
Miscellanea<br />
ZSS 45, S. 188 – 265<br />
Bretone, Mario<br />
Geschichte des römischen Rechts von den Anfängen bis <strong>zu</strong><br />
Justinian<br />
2. Auflage 1998, München<br />
Bürge, Alfons<br />
Römisches Privatrecht – Rechtsdenken <strong>und</strong> gesellschaftliche<br />
Verankerung<br />
Darmstadt, 1999<br />
B<strong>und</strong>, Elmar<br />
Untersuchungen <strong>zu</strong>r Methode Julians<br />
Köln, Graz, 1965<br />
Dulckeit, Gerhard (Begr.)<br />
Schwarz, Fritz (Begr.)<br />
Waldstein, Wolfgang<br />
Römische Rechtsgeschichte<br />
9. Auflage 1995, München
- IV -<br />
Erman, Walter (Begr.)<br />
Bürgerliches Gesetzbuch – Handkommentar<br />
Band II (§§ 812 – 2385)<br />
11. Auflage 2004, Köln<br />
zit.: Erman-Bearbeiter<br />
Fitting, Hermann<br />
Alter <strong>und</strong> Folge der Schriften römischer Juristen von<br />
Hadrian bis Alexander<br />
2. Auflage 1908, Halle an der Saale<br />
Fuchs, Johannes Georg<br />
Iusta causa traditionis in der Romanistischen Wissenschaft<br />
Basel, 1952<br />
zit.: Fuchs, Iusta causa traditionis<br />
Hausmaninger, Herbert<br />
Selb, Walter (Begr.)<br />
Römisches Privatrecht<br />
9. Auflage 2001, Wien, Köln, Weimar<br />
Hiltbrunner, Otto<br />
Kleines Lexikon der Antike<br />
2. Auflage 1950, München<br />
Honsell, Heinrich<br />
Römisches Recht<br />
5. Auflage 2002, Berlin et al.<br />
Honsell, Heinrich<br />
Mayer-Maly, Theo<br />
Selb, Walter<br />
Römisches Recht<br />
(aufgr<strong>und</strong> des Werkes von Paul Jörs, Wolfgang Kunkel <strong>und</strong><br />
Leopold Wenger)<br />
4. Auflage 1987, Berlin et al.<br />
Hupka, Josef<br />
Der dissensus in causa <strong>und</strong> die moderne Textkritik.<br />
ZSS 52, S. 1 – 30<br />
Jörs, Paul Domitius <strong>Ulp</strong>ianus (Domitius Nr. 88)<br />
RE 5. Band (1903), Sp. 1435 ff.
- V -<br />
ders.<br />
Geschichte <strong>und</strong> System des römischen Privatrechts<br />
Berlin, 1927<br />
zit.: Jörs, Geschichte <strong>und</strong> System<br />
Jörs, Paul<br />
Kunkel, Wolfgang<br />
Wenger, Leopold<br />
Römisches Privatrecht<br />
3. Auflage 1949, Berlin et al.<br />
Karlowa, Otto<br />
Römische Rechtsgeschichte<br />
Erster Band: Staatsrecht <strong>und</strong> Rechtsquellen<br />
Leipzig, 1885<br />
Kaser, Max<br />
Das Geld im römischen Sachenrecht<br />
TR 29, S. 169 – 229<br />
ders.<br />
Das römische Privatrecht – Erster Abschnitt<br />
Das altrömische, das vorklassische <strong>und</strong> klassische Recht<br />
München, 1955<br />
zit.: Kaser, Das römische Privatrecht I<br />
ders.<br />
Zur „Iusta Causa Traditionis“<br />
Bull. 1961, S. 61 – 97<br />
Kaser, Max<br />
Knütel, Rolf<br />
Römisches Privatrecht<br />
17. Auflage 2003, München<br />
Kunkel, Wolfgang<br />
Herkunft <strong>und</strong> soziale Stellung der römischen Juristen<br />
2. Auflage 1967, Graz, Wien, Köln<br />
Lenel, Otto<br />
Palingenesia Iuris Civilis<br />
Volumen Prius<br />
Leipzig, 1889
- VI -<br />
ders.<br />
Palingenesia Iuris Civilis<br />
Volumen Alterum<br />
Leipzig, 1889<br />
ders.<br />
Quellenforschungen in den Edictcommentaren.<br />
ZSS 3, S. 177 – 197<br />
Mayer-Maly, Theo<br />
Römisches Recht<br />
2. Auflage 1999, Wien, New York<br />
Oertmann, Paul<br />
Die Fiducia im römischen Privatrecht<br />
Berlin, 1890<br />
Palandt, Otto (Begr.)<br />
Bürgerliches Gesetzbuch<br />
64. Auflage 2005, München<br />
zit.: Palandt-Bearbeiter<br />
Pernice, Alfred<br />
<strong>Ulp</strong>ian als Schriftsteller<br />
gedruckte Fassung eines nicht näher bezeichneten Vortrages<br />
Pflüger, Heinrich Hackfeld<br />
Zur Lehre vom Erwerbe des Eigentums nach römischem Recht<br />
München <strong>und</strong> Leipzig, 1937<br />
v. Savigny, Friedrich Carl System des heutigen Römischen Rechts<br />
Vierter Band<br />
Berlin, 1841<br />
Schreiber, Klaus<br />
Sachenrecht<br />
4. Auflage 2003, Stuttgart et al.<br />
Schreiber, Klaus<br />
Kreutz, Klaus<br />
Der Abstraktionsgr<strong>und</strong>satz – Eine Einführung<br />
Jura 1989, S. 617 – 622
- VII -<br />
Söllner, Alfred<br />
Einführung in die römische Rechtsgeschichte<br />
5. Auflage 1996, München<br />
Westermann, Harm Peter<br />
BGB-Sachenrecht<br />
10. Auflage 2002, Heidelberg<br />
Motive <strong>zu</strong> dem Entwurfe eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich<br />
Band III, Sachenrecht Nachdruck (1983) der Amtlichen Ausgabe von 1888, Berlin <strong>und</strong> Leipzig<br />
zit.: Motive III
- 1 -<br />
I. Quellentexte<br />
1. D. <strong>41.1.36</strong><br />
<strong>Iul</strong>ianus libro tertio decimo digestorum Cum in corpus quidem<br />
quod traditur consentiamus, in causis vero dissentiamus, non<br />
animadverto, cur inefficax sit traditio, veluti si ego credam me ex<br />
testamento tibi obligatum esse, ut f<strong>und</strong>um tradam, tu existimes ex<br />
stipulatu tibi eum deberi. nam et si pecuniam numeratam tibi<br />
tradam donandi gratia, tu eam quasi creditam accipias, constat<br />
<strong>pr</strong>o<strong>pr</strong>ietatem ad te transire nec impedimento esse, quod circa<br />
causam dandi atque accipiendi dissenserimus.<br />
2. D. <strong>12.1.18</strong> <strong>pr</strong>.<br />
<strong>Ulp</strong>ianus libro septimo disputationum Si ego pecuniam tibi quasi<br />
donaturus dedero, tu quasi mutuam accipias, <strong>Iul</strong>ianus scribit<br />
donationem non esse: sed an mutua sit, videndum. et puto nec<br />
mutuam esse magisque nummos accipientis non fieri, cum alia<br />
opinione acceperit. quare si eos consumpserit, licet condictione<br />
teneatur, tamen doli exceptione uti poterit, quia sec<strong>und</strong>um<br />
voluntatem dantis nummi sunt consumpti.<br />
II. Überset<strong>zu</strong>ng<br />
1. D. <strong>41.1.36</strong><br />
Julian im dreizehnten Buch seiner Digesten Wenn wir uns über<br />
den Gegenstand, der übergeben wird, geeinigt haben, in Be<strong>zu</strong>g auf<br />
den Gr<strong>und</strong> tatsächlich unterschiedlicher Meinung sind,<br />
begreife ich nicht, warum die Übereignung unwirksam sein sollte.<br />
Nimm das Beispiel, dass ich mich aufgr<strong>und</strong> eines Testamentes dir<br />
verpflichtet glaube, ein Gr<strong>und</strong>stück <strong>zu</strong> übergeben, während du<br />
denkst, es werde dir aufgr<strong>und</strong> einer Stipulation gegeben. Denn auch<br />
wenn ich dir bares Geld gebe, um es dir <strong>zu</strong> schenken, du es <br />
als Darlehen annimmst, steht fest, dass das Eigentum auf dich<br />
übergeht <strong>und</strong> dass es nicht hinderlich ist, wenn wir in Be<strong>zu</strong>g auf<br />
den Gr<strong>und</strong> des Gebens <strong>und</strong> Annehmens unterschiedlicher Meinung<br />
sind.
- 2 -<br />
2. D. <strong>12.1.18</strong> <strong>pr</strong>.<br />
<strong>Ulp</strong>ian im siebten Buch seiner Disputationen Wenn ich dir in der<br />
Absicht <strong>zu</strong> schenken Geld gebe, du aber in dem Bewusstsein<br />
nimmst, es sei ein Darlehen, so, schreibt Julian, sei es keine<br />
Schenkung. Aber ob es ein Darlehen ist, wollen wir sehen. Doch<br />
ich glaube, dass es auch kein Darlehen ist, ebensowenig wie die<br />
Münzen Eigentum des Empfängers werden, weil er in<br />
anderer Meinung annahm. Deshalb ist es statthaft, mit der<br />
Kondiktion <strong>zu</strong> verpflichten, wenn er sie ausgegeben haben sollte,<br />
gleichwohl kann er sich der Arglisteinrede bedienen, weil er die<br />
Münzen ents<strong>pr</strong>echend dem Willen des Gebers ausgab.<br />
III. Bemerkungen <strong>zu</strong> den Inskriptionen<br />
1. Die Autoren der Quellentexte<br />
a) Salvius <strong>Iul</strong>ianus<br />
Julian stammte aus der nordafrikanischen Stadt Hadrumetum 1 .<br />
Weder sein Geburts- noch sein Sterbejahr sind genau festgestellt,<br />
sicher ist nur, dass er ein hohes Lebensalter erreichte 2 . Wenn man<br />
seine Geburt auf das Ende des 1. Jahrh<strong>und</strong>erts datiert 3 , könnte er<br />
die beginnende Alleinherrschaft des Commodus (180) noch<br />
miterlebt haben.<br />
Bezüglich seiner Familie kann, abgesehen von der Behauptung, er<br />
sei ein Großvater des Kaisers Didius <strong>Iul</strong>ianus gewesen 4 , nichts<br />
berichtet werden.<br />
Julian selbst bezeichnet sich als Schüler des Iavolenus Priscus 5 <strong>und</strong><br />
war gemeinsam mit anderen Juristen Vorstand der sabinianischen<br />
Rechtsschule 6 , in der neben einer literarischen Betätigung auch die<br />
Lehre <strong>und</strong> die juristische Diskussion gepflegt wurden 7 . Sein wohl<br />
1 Kunkel, Herkunft <strong>und</strong> soziale Stellung, S. 158 f. .<br />
2 Baumgartner, RE II, 1, 2, Sp. 2024 (Salvius Nr. 14).<br />
3 So B<strong>und</strong>, Untersuchungen <strong>zu</strong>r Methode Julians, S. 2.<br />
4 Kunkel, Herkunft <strong>und</strong> soziale Stellung, S. 160 f. .<br />
5 <strong>Iul</strong>. D. 40.2.5.<br />
6 Baumgartner, RE II, 1, 2, Sp. 2024 (Salvius Nr. 14).<br />
7 Bretone, Geschichte des römischen Rechts, S. 180 f.; Bürge,<br />
Rechtsdenken <strong>und</strong> gesellschaftliche Verankerung, S. 109.
- 3 -<br />
namhaftester Schüler war Volusius Maecianus, der später Lehrer<br />
Marc Aurels wurde 8 .<br />
In der Zeit zwischen 150 <strong>und</strong> 167 bekleidete Julian verschiedene<br />
Ämter in Niedergermanien, Spanien <strong>und</strong> schließlich Afrika 9 . Aus<br />
seiner literarischen Tätigkeit ist vor allem das 90 Bücher<br />
umfassende Digestenwerk <strong>zu</strong> nennen, das für viele spätere Autoren<br />
– darunter auch <strong>Ulp</strong>ian – nach Form <strong>und</strong> Inhalt beispielgebend<br />
wurde 10 .<br />
Ein weiterer Beleg für Julians herausgehobene Stellung unter den<br />
römischen Juristen ist der Umstand, dass er von Hadrian um 130<br />
mit der Redaktion <strong>und</strong> der endgültigen Abfassung des edictum<br />
perpetuum betraut wurde, also ein besonders erfahrener Jurist<br />
gewesen sein muss.<br />
Für die Lösung dieser Aufgabe wurde er im Jahre 148 mit dem<br />
Konsulat belohnt 11 .<br />
Insgesamt erreicht die klassische römische Juris<strong>pr</strong>udenz mit Julian<br />
ihren Höhepunkt 12 .<br />
b) Domitius <strong>Ulp</strong>ianus<br />
<strong>Ulp</strong>ian stammt nach eigenem Bek<strong>und</strong>en aus Tyros in Phönikien,<br />
eine Handelsstadt, deren Vorzüge er in warmen Worten <strong>und</strong> nicht<br />
ohne Stolz <strong>pr</strong>eist 13 .<br />
Das Jahr seiner Geburt ist unbekannt. Die Mitglieder seiner Familie<br />
besaßen seit etwa der Mitte des 1. Jahrh<strong>und</strong>erts das römische<br />
Bürgerrecht 14 , der Vater soll für seine alles Römische strikt<br />
ablehnende Haltung bekannt gewesen sein 15 .<br />
<strong>Ulp</strong>ian brachte es gleichwohl in Rom <strong>zu</strong> einem sehr beträchtlichen<br />
Vermögen <strong>und</strong> wurde Mitglied der römischen Oberschicht 16 .<br />
8 Dulckeit / Schwarz / Waldstein, Römische Rechtsgeschichte, S. 261.<br />
9 B<strong>und</strong>, Untersuchungen <strong>zu</strong>r Methode Julians, S. 3.<br />
10 Vgl. Baumgartner, RE II, 1, 2, Sp. 2024 f. (Salvius Nr. 14).<br />
11 B<strong>und</strong>, Untersuchungen <strong>zu</strong>r Methode Julians, S. 3.<br />
12 Söllner, Einführung in die römische Rechtsgeschichte, S. 109.<br />
13 <strong>Ulp</strong>. D. 50.15. 1 <strong>pr</strong>.: „splendidissima Tyriorum colonia“.<br />
14 Kunkel, Herkunft <strong>und</strong> soziale Stellung, S. 253 f. .<br />
15 Ders., a.a.O., S. 249.<br />
16 Ders., a.a.O., S. 252.
- 4 -<br />
Gegen Anfang des 2. Jahrh<strong>und</strong>erts wurde <strong>Ulp</strong>ian Assessor bei<br />
Aemilius Papinianus 17 . Erheblichen Einfluss auf die Geschicke des<br />
Imperium Romanum erlangte er, als er im Jahre 222<br />
Prätorianer<strong>pr</strong>äfekt wurde 18 . Seine Erfahrung in der Verwaltung <strong>und</strong><br />
seine umfassenden Rechtskenntnisse ließen ihn in dieser Position<br />
gleichsam <strong>zu</strong>m Stellvertreter des Kaisers Severus Alexander<br />
avancieren 19 . Aufgr<strong>und</strong> strenger Disziplinierungsmaßnahmen geriet<br />
<strong>Ulp</strong>ian <strong>zu</strong>sehends in Feindschaft <strong>zu</strong> den ihm unterstellten<br />
Prätorianern 20 , während einer nächtlichen Meuterei im Jahre 228<br />
fand er den Tod 21 .<br />
<strong>Ulp</strong>ian war trotz der viel Aufmerksamkeit erfordernden <strong>pr</strong>aktischen<br />
Tätigkeit auch literarisch äußerst <strong>pr</strong>oduktiv 22 : Neben einem<br />
Kommentarwerk <strong>zu</strong>m Ius Civile verfasste er weitere Kommentare,<br />
Elementar- <strong>und</strong> Lehrbücher – <strong>zu</strong> denen auch die Disputationen<br />
zählen – sowie Monographien. Die Digesten des Justinian bestehen<br />
<strong>zu</strong> einem beträchtlichen Teil aus Fragmenten, die auf ihn<br />
<strong>zu</strong>rückgehen. <strong>Ulp</strong>ian selbst nutzte die Schriften des Julian für seine<br />
literarische Tätigkeit ausgiebig <strong>und</strong> als Hauptquelle 23 .<br />
Gelegentlich ist bemerkt worden, <strong>Ulp</strong>ian habe es an einer<br />
sorgfältigen <strong>und</strong> gründlichen Arbeitsweise mangeln lassen <strong>und</strong> sein<br />
Werk weise wenig Originelles auf 24 . Diese Gesichtspunkte können<br />
aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sein großes Verdienst<br />
ist, in einer Zeit, als der Rechtsstoff bereits ausuferte, sich um<br />
Sammlung <strong>und</strong> Ordnung des Wesentlichen bemüht <strong>zu</strong> haben 25 .<br />
2. Die Urs<strong>pr</strong>ungswerke der Digestenstellen<br />
Die Inskription von D. <strong>41.1.36</strong> weist als das Urs<strong>pr</strong>ungswerk dieser<br />
Quelle das dreizehnte Buch der 90 Bücher umfassenden juliani-<br />
17 Jörs, RE 5, Sp. 1436 (Domitius Nr. 88).<br />
18 Kunkel, Herkunft <strong>und</strong> soziale Stellung, S. 246.<br />
19 Jörs, RE 5, Sp. 1437 (Domitius Nr. 88).<br />
20 Ders., RE 5, Sp. 1438 (Domitius Nr. 88).<br />
21 Hiltbrunner, Kleines Lexikon der Antike, S. 522.<br />
22 Dulckeit / Schwarz / Waldstein, Römische Rechtsgeschichte, S. 267.<br />
23 Jörs, RE 5, Sp. 1488 (Domitius Nr. 88).<br />
24 Vgl. vor allem Pernice, <strong>Ulp</strong>ian als Schriftsteller, S. 10 f., 26 f., 35.<br />
25 Dulckeit / Schwarz / Waldstein, Römische Rechtsgeschichte, S. 265, 267.
- 5 -<br />
schen Digesten aus. Sie sollen zwischen 150 <strong>und</strong> 160 entstanden<br />
sein 26 . Typisch für diese Art der Literaturgattung ist eine ausges<strong>pr</strong>ochen<br />
kasuistische Ausrichtung anhand welcher das dogmatische<br />
System des geltenden Rechtes <strong>pr</strong>axisgerecht dargestellt<br />
werden sollte 27 . Dass sich Julian bei der Abfassung jedenfalls der<br />
Werke des Q. Mucius, des Labeos, des Sabinus <strong>und</strong> des Pomponius<br />
bediente, geht aus verschiedenen Zitaten hervor 28 .<br />
Der urs<strong>pr</strong>üngliche Kontext des dreizehnten Buches konnte mit<br />
Hilfe von vierzehn Einzelfragmenten rekonstruiert werden 29 . Sie<br />
behandeln vorwiegend Rechtsfragen, die sich im Zusammenhang<br />
mit verschiedenen Rechtsgeschäften – Verwahrung, Pfand, Auftrag<br />
sowie Kauf – stellen <strong>und</strong> berücksichtigen auch Gesichtspunkte der<br />
jeweiligen gerichtlichen Durchset<strong>zu</strong>ng. Das <strong>zu</strong> bearbeitende<br />
Fragment ist dem Schluss des Buches <strong>zu</strong>geordnet worden.<br />
Die Quelle D. <strong>12.1.18</strong> <strong>pr</strong>. stammt aus dem siebten Buch der<br />
Disputationen, die <strong>Ulp</strong>ian unter Caracalla, also etwa um 212,<br />
verfasste 30 . Dieser Literaturtypus wurde auch als Questiones<br />
bezeichnet <strong>und</strong> verfolgte, wie der Name andeutet, vornehmlich<br />
<strong>pr</strong>aktisch-didaktische Zwecke ohne den Ans<strong>pr</strong>uch einer systematischen<br />
Durchdringung des Stoffes 31 .<br />
<strong>Ulp</strong>ian griff insbesondere auf die julianischen Digesten <strong>zu</strong>rück, als<br />
er die Disputationen schrieb, verwandte aber auch Schriften des<br />
Celsus <strong>und</strong> des Marcellus 32 .<br />
Das erste dem siebten Buch der Disputationen <strong>zu</strong>geordnete<br />
Fragment befasst sich mit den Einreden, die dem Beklagten in<br />
einem Prozess <strong>zu</strong>r Verfügung stehen sowie mit der gr<strong>und</strong>sätzlichen<br />
Verteilung der Beweislast, wenn eine Einrede erhoben wird 33 .<br />
26 B<strong>und</strong>, Untersuchungen <strong>zu</strong>r Methode Julians, S. 4.<br />
27 Karlowa, Rechtsgeschichte I, S. 708.<br />
28 Fitting, Alter <strong>und</strong> Folge der Schriften römischer Juristen, S. 29.<br />
29 Vgl. den Rekonstruktionsversuch von Lenel, Palingenesia I, Sp. 352 ff. .<br />
30 Jörs, RE 5, Sp. 1446 (Domitius Nr. 88).<br />
31 Honsell / Mayer-Maly / Selb, Römisches Recht, S. 28.<br />
32 Fitting, Alter <strong>und</strong> Folge der Schriften römischer Juristen, S. 118.<br />
33 Vgl. Lenel, Palingenesia II, Sp. 410 ff. .
- 6 -<br />
Es folgen sodann Differenzierungen, die Einreden aus einem<br />
gerichtlichen Vergleich (Fragment 122) <strong>und</strong> aus einem Kaufvertrag<br />
(Fragmente 123 ff.) betreffen.<br />
Das Fragment 126 ents<strong>pr</strong>icht D. <strong>12.1.18</strong> <strong>pr</strong>. <strong>und</strong> passt sich in den<br />
Kontext der Reste des siebten Buches ein, weil es unter anderem<br />
von der Arglisteinrede handelt. Die nachfolgenden Fragmente<br />
betreffen die Stipulation.<br />
IV. Paraphrase<br />
Die Quelle D. <strong>41.1.36</strong> besteht äußerlich aus zwei separaten Sätzen.<br />
Der erste Satz („Cum in corpus … deberi.“) liefert <strong>zu</strong>nächst<br />
Informationen bezüglich der an der <strong>zu</strong> erörternden Rechtsfrage<br />
beteiligten Personen. Involviert sind ego <strong>und</strong> tu, wobei es sich bei<br />
ego um Julian selbst handeln dürfte. Dies legt jedenfalls die<br />
Formulierung „non animadverto“ nahe, die eine erste Verbindung<br />
zwischen den Tatsachen des Sachverhaltes <strong>und</strong> seiner rechtlichen<br />
Würdigung – die ja durch Julian erfolgt – herstellt. Wer tu ist, lässt<br />
das Fragment offen. Möglicherweise handelt es sich um eine reale<br />
Person, die Julian um einen Rat ersucht, vielleicht auch um eine<br />
fiktive Person.<br />
Die Situation stellt sich so dar, dass ego <strong>und</strong> tu miteinander ein<br />
Geschäft geschlossen haben. Sie haben sich auf einen Gegenstand<br />
verständigt, der übereignet, „tradiert“ wird. Wer der Erwerber <strong>und</strong><br />
wer der Veräußerer ist, wird an dieser Stelle noch nicht deutlich.<br />
Diese Information bringt erst der mit „veluti“ eingeleitete zweite<br />
Halbsatz. In ihm wird die recht abstrakte Ausgangsituation anhand<br />
eines Beispieles näher konkretisiert. Gegenstand des Geschäftes ist<br />
nun ein Gr<strong>und</strong>stück, das von ego als Veräußerer auf tu als Erwerber<br />
übergehen soll.<br />
Bei Abschluss des Geschäftes waren ego <strong>und</strong> tu jedoch unterschiedlicher<br />
Meinung über den Gr<strong>und</strong> des Geschäftes. Während<br />
ego dachte, er sei aufgr<strong>und</strong> eines Testamentes <strong>zu</strong>r Übereignung<br />
verpflichtet, glaubte tu, die Verpflichtung rühre aus einem<br />
Schuldvers<strong>pr</strong>echen her.
- 7 -<br />
Es stellt sich deshalb die Frage, ob tu das Gr<strong>und</strong>stück trotz des<br />
Dissenses über den Gr<strong>und</strong> <strong>zu</strong> Eigentum erlangt habe, oder ob nicht<br />
die Übereignung unwirksam sei.<br />
Julian hält die Übereignung für wirksam <strong>und</strong> begründet seine<br />
Entscheidung im zweiten Satz des Fragmentes. Als Argumentationsbasis<br />
dient ihm ein Parallelfall, in dem Bargeld übereignet<br />
wird. Auch in diesem Fall kommt es <strong>zu</strong> einem Dissens über den<br />
Gr<strong>und</strong>. Der Empfänger glaubt, das Geld werde darlehenshalber<br />
gewährt, der Geber geht von einer Schenkung aus. Hier steht für<br />
Julian fest, dass der Dissens den Eigentumsübergang nicht verhindert.<br />
<strong>Ulp</strong>ian knüpft in D. <strong>12.1.18</strong> <strong>pr</strong>. unter namentlicher Erwähnung<br />
Julians direkt an dessen Bargeldfall an. Erneut geht es um die<br />
Konstellation, wo der Geber (wiederum ego) glaubt, er schenke das<br />
Geld, wohingegen der Empfänger (tu) von einem Darlehen ausgeht.<br />
<strong>Ulp</strong>ian schreibt sodann, Julian vertrete in diesem Fall die Auffassung,<br />
dass eine Schenkung nicht vorliege – eine Auffassung, der<br />
er sich offensichtlich anschließt – <strong>und</strong> wirft die Frage auf, ob denn<br />
ein Darlehen <strong>zu</strong>stande gekommen sei. Die Antwort auf diese Frage<br />
wird im zweiten Satz („et puto …“) gegeben. Sie lautet dahingehend,<br />
dass der Dissens über den Gr<strong>und</strong> sowohl einem Zustandekommen<br />
des Darlehens als auch dem Eigentumserwerb beim<br />
Empfänger („nummos accipientis non fieri“) entgegenstehe.<br />
Der dritte Satz des Fragmentes behandelt das Gegenrecht des<br />
Empfängers, der einem Herausgabeverlangen des Gebers ausgesetzt<br />
ist. Falls er das empfangene Geld ausgeben hat, kann er sich mit der<br />
Arglisteinrede wehren, weil er mit dem Geld nur das tat, was auch<br />
dem urs<strong>pr</strong>ünglichen Willen des Gebers ents<strong>pr</strong>ach.<br />
V. Inter<strong>pr</strong>etation<br />
Julian behandelt in D. <strong>41.1.36</strong> zwei Fälle, die aufgr<strong>und</strong> einer<br />
Gemeinsamkeit miteinander verb<strong>und</strong>en sind: Sowohl im Gr<strong>und</strong>stücksfall<br />
als auch im Bargeldfall geht es darum, dass eine Sache<br />
vom Geber <strong>zu</strong>m Empfänger gelangen soll, wofür Julian die Wen-
- 8 -<br />
dung <strong>pr</strong>o<strong>pr</strong>ietas transit (vgl. den zweiten Satz der Stelle) benutzt.<br />
Diese <strong>pr</strong>o<strong>pr</strong>ietas bezeichnet nach dem Verständnis der klassischen<br />
Juris<strong>pr</strong>udenz eine unbegrenzte <strong>und</strong> ausschließliche Rechtsherrschaft<br />
über eine Sache 34 , also eine Rechtsfigur, die dem heutigen Eigentumsbegriff<br />
verwandt ist 35 . Beide Fälle sind demgemäß so gebildet,<br />
dass das Eigentum an dem Gr<strong>und</strong>stück bzw. dem Bargeld von ego<br />
auf tu übertragen werden soll. Julian benennt auch das Instrument,<br />
mit dem der Geber <strong>und</strong> der Empfänger dies erreichen wollen: Sie<br />
bedienen sich der traditio, die bereits im Einleitungssatz<br />
ausdrücklich erwähnt wird <strong>und</strong> in dem Fragment noch drei weitere<br />
Male in den von dem Verb tradere abgeleiteten Formen traditur<br />
<strong>und</strong> tradam begegnet.<br />
1. traditio, iusta causa traditionis <strong>und</strong> consensus<br />
Im römischen Privatrecht ist die traditio eine von drei Möglichkeiten,<br />
dem Empfänger im Wege des derivativen Erwerbs Eigentum<br />
<strong>zu</strong> verschaffen 36 . Sie war urs<strong>pr</strong>ünglich ein Übereignungsgeschäft<br />
des Alltages, entwickelte sich dann jedoch <strong>zu</strong> dem dominierenden<br />
Instrument der Eigentumsverschaffung 37 .<br />
Vorliegend scheint es so, als sei am Erfolg der Eigentumsübertragung<br />
<strong>zu</strong> zweifeln. Dies kommt in der indirekten Frage „cur<br />
inefficax sit traditio“ – wörtlich: warum die traditio unwirksam sein<br />
sollte – <strong>zu</strong>m Ausdruck. Damit ist die Frage nach den Vorausset<strong>zu</strong>ngen<br />
einer wirksamen traditio aufgeworfen.<br />
Gaius 2.20: itaque si tibi vestem vel aurum vel<br />
argentum tradidero sive ex venditionis causa sive ex<br />
donationis sive quavis alia ex causa, statim tua fit ea<br />
res, si modo ego eius dominus sim.<br />
34 Honsell, Römisches Recht, S. 56.<br />
35 Kaser / Knütel, Römisches Privatrecht, S. 137.<br />
36 Honsell / Mayer-Maly / Selb, Römisches Recht, S. 155; Jörs / Kunkel /<br />
Wenger, Römisches Recht, S. 126; Kaser / Knütel, Römisches Privatrecht,<br />
S. 148 ff., insbesondere 151.<br />
37 Kaser, Das römische Privatrecht I, S. 351.
- 9 -<br />
Neben der körperlichen Übergabe der Sache ist danach insbesondere<br />
Vorausset<strong>zu</strong>ng, dass der Veräußerer tatsächlich ihr<br />
Eigentümer ist 38 . Diese Vorausset<strong>zu</strong>ngen sind in den von Julian<br />
gebildeten Fällen erfüllt, weil sich die Übergabe aus dem<br />
Sachverhalt ergibt <strong>und</strong> die Eigentümerstellung des ego <strong>pr</strong>oblemlos<br />
unterstellt werden kann, anderenfalls hätte Julian hier<strong>zu</strong> nicht<br />
schweigen dürfen.<br />
Der Gr<strong>und</strong> für das mögliche Scheitern der Eigentumsverschaffung<br />
muss sich somit aus einem anderen Umstand ergeben. Wie bei<br />
Gaius 2.20 anklingt, hängt die Wirksamkeit der traditio <strong>zu</strong>sätzlich<br />
vom Vorliegen einer bestimmten causa ab, welche in der Literatur<br />
allgemein als iusta causa traditionis oder auch iustus titulus<br />
bezeichnet wird 39 .<br />
Nach dem Verständnis der römischen Juristen bezeichnet die iusta<br />
causa traditionis das Vorliegen eines von der Rechtsordnung<br />
gebilligten Gr<strong>und</strong>es für eine Vermögensverschiebung 40 . Präziser<br />
gesagt kann die traditio nur dann wirksam Eigentum verschaffen,<br />
wenn ein rechtsgeschäftlicher Tatbestand, der einen Eigentumserwerbsgr<strong>und</strong><br />
beinhaltet 41 , <strong>zu</strong>r Sachübergabe hin<strong>zu</strong>tritt.<br />
Paul. D. 41.1.31: numquam nuda traditio transfert<br />
dominium, sed ita, si venditio aut aliqua iusta causa<br />
<strong>pr</strong>aecesserit, <strong>pr</strong>opter quam traditio sequeretur.<br />
Anerkannte Erwerbsgründe in diesem Sinne können sein 42 die<br />
causa emptionis, die causa dotis, die causa donationis, die causa<br />
credendi oder – wie Gaius 2.20 nach Art einer Generalklausel<br />
formuliert – irgendeine andere causa.<br />
38 <strong>Ulp</strong>. D. 50.17.54; 41.1.20 <strong>pr</strong>. .<br />
39 Vgl. Hausmaniger / Selb, Römisches Privatrecht, S. 152; Honsell,<br />
Römisches Recht, S. 58 f.; Kaser, Bull. 1961, 61 (63).<br />
40 Honsell / Mayer-Maly / Selb, Römisches Recht, S. 157 f.; Kaser,<br />
Bull. 1961, 61 (94); Mayer-Maly, Römisches Privatrecht, S. 75.<br />
41 Jörs / Kunkel / Wenger, Römisches Recht, S. 127.<br />
42 Vgl. Honsell / Mayer-Maly / Selb, Römisches Recht, S. 158.
- 10 -<br />
Da es sich bei den causae um Rechtsgeschäfte handelt, hängt ihr<br />
Zustandekommen gr<strong>und</strong>sätzlich von einer Einigung der beteiligten<br />
Parteien, dem consensus ab 43 . Anders gewendet steht das Vorliegen<br />
eines Dissenses der wirksamen Einigung entgegen, der dissensus<br />
bewirkt die „Unvollständigkeit“ des Geschäftes:<br />
<strong>Ulp</strong>. D. 18.1.9 <strong>pr</strong>.: in venditionibus et emptionibus<br />
consensum debere intercedere palam est: ceterum sive<br />
in ipsa emptione dissentient sive in <strong>pr</strong>etio sive in quo<br />
alio, emptio imperfecta est.<br />
Pomp. D. 44.7.57: in omnibus negotiis (...) si error<br />
aliquis intervenit, ut aliud sentiat puta qui emit aut qui<br />
conducit, aliud qui cum his contrahit, nihil valet quod<br />
acti sit.<br />
Eine Unwirksamkeit kann sich hiernach insbesondere aus einem<br />
Dissens über das jeweilige Geschäft selbst, die Art <strong>und</strong> Höhe der<br />
Gegenleistung oder aus einem anderen Gesichtspunkt ergeben.<br />
Allerdings liegt ein relevanter Dissens nur dann vor, wenn eines der<br />
wesentlichen Vertragselemente, ein essentialium negotii betroffen<br />
ist 44 .<br />
In den von Julian gebildeten Fällen verhält es sich so, dass ego als<br />
causa der Hingabe ein Testament annimmt, während tu von einem<br />
Schuldvers<strong>pr</strong>echen ausgeht (Gr<strong>und</strong>stücksfall), bzw. dass ego<br />
schenken <strong>und</strong> tu ein Darlehen aufnehmen will (Bargeldfall). Ein<br />
Dissens besteht also in beiden Konstellationen jeweils über den<br />
Gr<strong>und</strong> der Vermögens<strong>zu</strong>wendung, über die causa. Diese Art des<br />
Dissenses wird als error in negotio bezeichnet 45 .<br />
43 Hausmaninger / Selb, Römisches Privatrecht, S. 152; so auch Honsell,<br />
Römisches Recht, S. 42, 45; Kaser, Bull. 1961, 61 (68).<br />
44 Kaser / Knütel, Römisches Privatrecht, S. 73.<br />
45 Hausmaninger / Selb, Römisches Privatrecht, S. 234; Honsell,<br />
Römisches Recht, S. 45.
- 11 -<br />
Weil aber unter Verallgemeinerung von <strong>Ulp</strong>ian D. 18.1.9 <strong>pr</strong>. („ipsa<br />
emptione dissentient […] emptio imperfecta est“) der Geschäftstypus<br />
selbst vom Konsens der Parteien umfasst sein muss, stellt<br />
sich auch der error in negotio zwangsläufig als ein relevanter<br />
Dissens dar, der <strong>zu</strong>r Unwirksamkeit der Einigung führt 46 . Danach<br />
scheint es so, als hätten ego <strong>und</strong> tu sich weder im Gr<strong>und</strong>stücksfall<br />
noch im Bargeldfall wirksam über eine causa verständigt.<br />
2. Julians Arbeitshypothese <strong>und</strong> ihre Begründung<br />
Die Schlussfolgerung hieraus müsste sein, dass tu, weil es an der<br />
Vorausset<strong>zu</strong>ng der iusta causa des Übereignungstatbestandes fehlt,<br />
kein Eigentum an dem Gr<strong>und</strong>stück bzw. dem Bargeld erlangt hat.<br />
Gleichwohl behauptet Julian das Gegenteil <strong>und</strong> unterstreicht seine<br />
Auffassung noch in zweifacher Hinsicht mit „non animadverto“<br />
<strong>und</strong> mit „constat“. Wie kann man dies erklären?<br />
Eine Antwort lässt sich möglicherweise aus der näheren Untersuchung<br />
der beiden Fälle unter Berücksichtigung der Struktur des<br />
Fragmentes gewinnen:<br />
Der Einleitungssatz formuliert <strong>zu</strong>nächst einmal die Fragestellung,<br />
die Julian behandeln will, nämlich ob bei einem Dissens hinsichtlich<br />
der causa der Erwerber im Wege der traditio wirksam<br />
Eigentum erlangt. So betrachtet erfüllt dieser Satz dieselbe<br />
Funktion wie der Obersatz in einem rechtswissenschaftlichen<br />
Gutachten. Zugleich ist in ihm aber auch implizit das Ergebnis der<br />
Prüfung enthalten, weil Julian ausdrückt, er könne nicht einsehen,<br />
warum die Übereignung unwirksam sein sollte. Zur Unterstüt<strong>zu</strong>ng<br />
zieht er sodann die beiden genannten Beispielsfälle heran. Diese<br />
werden durch die Wendungen „veluti“ (wörtlich: wie wenn) <strong>und</strong><br />
„nam et si“ (nämlich auch wenn) eingeleitet, was den Eindruck<br />
einer Gleichwertigkeit erweckt <strong>und</strong> nahe legt, sie als spezielle<br />
Aus<strong>pr</strong>ägungen desselben allgemeineren Gedankens auf<strong>zu</strong>fassen.<br />
Demgemäß hängt die Validität von Julians Arbeitshypothese – trotz<br />
46 <strong>Ulp</strong>. D. <strong>12.1.18</strong> <strong>pr</strong>.; Pomp. D. 44.7.57; Honsell, Römisches Recht, S. 45;<br />
Kaser / Knütel, Römisches Privatrecht, S. 73.
- 12 -<br />
Kausaldissenses wird Eigentum wirksam erworben – von der<br />
Schlüssigkeit <strong>und</strong> der Tragfähigkeit der beiden Beispielsfälle ab,<br />
die so gesehen nicht nur der Veranschaulichung dienen, sondern<br />
auch gleichzeitig die Begründung für den Obersatz liefern.<br />
a) Der Gr<strong>und</strong>stücksfall<br />
Der Gr<strong>und</strong>stücksfall ist so gebildet, dass ego als causa der<br />
Übereignung eine Verpflichtung aus testamento, tu eine Verpflichtung<br />
des ego aus stipulatu annimmt. Hier fragt sich <strong>zu</strong>nächst,<br />
was es bedeutet, wenn ego sich aus testamento verpflichtet glaubt.<br />
Das römische Recht kennt neben einer gesetzlichen – die so<br />
genannte Intestaterbfolge – auch die Möglichkeit einer gewillkürten<br />
Erbfolge 47 . Diese kann vom Erblasser testamento, also mit einem<br />
Testament bestimmt werden 48 . Mit wirksamer Errichtung <strong>und</strong><br />
Vorliegen der notwendigen Gr<strong>und</strong>bestandteile des Testamentes<br />
(caput et f<strong>und</strong>amentum testamenti) fällt die Erbschaft, wenn der<br />
Erblasser stirbt, gr<strong>und</strong>sätzlich dem eingesetzten Erben im Wege der<br />
Gesamtnachfolge <strong>zu</strong> 49 .<br />
Darüberhinaus ist es möglich, dass der Erblasser einzelne<br />
Gegenstände aus seinem Vermögen testamentarisch einer dritten<br />
Person <strong>zu</strong> Lasten des Gesamtnachfolgers von Todes wegen <strong>zu</strong>wendet<br />
50 . Ein solches legatum (Vermächtnis) tritt vorwiegend in<br />
zwei Gestaltungen auf: Als legatum per vindicationem ist es mit der<br />
Wirkung ausgestattet, dass der Bedachte unmittelbar ohne weiteren<br />
Erwerbsakt Eigentümer der vermachten Sache wird 51 . Als legatum<br />
per damnationem erzeugt es hingegen lediglich eine obligatio<br />
(Verpflichtung) des beschwerten Erben, die vermachte Sache an<br />
den Bedachten <strong>zu</strong> leisten 52 . Wenn Julian schreibt „credam me ex<br />
testamento tibi obligatum esse“, hat er offenk<strong>und</strong>ig die letztere<br />
47 Honsell, Römisches Recht, S. 194; Kaser / Knütel, Römisches Privatrecht,<br />
S. 404 f.; Mayer-Maly, Römisches Recht, S. 188 f. .<br />
48 Gai. 2.229; Hausmaninger / Selb, Römisches Privatrecht, S. 330.<br />
49 Kaser / Knütel, Römisches Privatrecht, S. 417 f. .<br />
50 Vgl. Gai. 2.192 seq.; Honsell, Römisches Recht, S. 202.<br />
51 Gai. 2.193 seq.; Honsell / Mayer-Maly / Selb, Römisches Recht, S. 485.<br />
52 Gai. 2.201 seq.; Hausmaninger / Selb, Römisches Privatrecht, S. 360.
- 13 -<br />
Konstellation, also ein Damnationslegat im Sinn, das ego für die<br />
causa hält.<br />
Tu glaubt demgegenüber, das Gr<strong>und</strong>stück werde ex stipulatu geschuldet.<br />
Der Begriff stipulatus bezeichnet inhaltlich die Stipulation,<br />
es geht also um eine Verpflichtung ex stipulatione.<br />
Die Stipulation zählt <strong>zu</strong> den Verbalverträgen 53 . Sie kommt <strong>zu</strong>stande<br />
durch einen formalisierten mündlichen Dialog zwischen dem<br />
künftigen Gläubiger <strong>und</strong> dem künftigen Schuldner 54 <strong>und</strong> begründet<br />
die Verpflichtung des Schuldners das Vers<strong>pr</strong>ochene <strong>zu</strong> leisten,<br />
wobei der Inhalt der Leistungspflicht gr<strong>und</strong>sätzlich beliebig gewählt<br />
werden kann 55 .<br />
Die vorliegende Konstellation – als causa wird einerseits ein Damnationslegat,<br />
andererseits eine Stipulation angenommen – nimmt<br />
allerdings eine Sonderstellung ein: Wenn es um die Erfüllung von<br />
Vermächtnis- <strong>und</strong> Stipulationsschulden geht, besteht die causa des<br />
Übereignungstatbestandes gerade nicht in dem Damnationslegat<br />
oder der Stipulation, sondern in der Einigung über die schuldbefreiende<br />
Wirkung der Leistung, der causa solvendi 56 . Diese<br />
Besonderheit erklärt sich wohl mit der altrömischen Vorstellung<br />
von der persönlichen Geb<strong>und</strong>enheit des Schuldners, die nur durch<br />
einen besonderen Formalakt, die solutio wieder aufgehoben werden<br />
kann 57 .<br />
Warum diese Vorstellung speziell bei Vermächtnis- <strong>und</strong><br />
Stipulationsschulden, nicht jedoch bei Schulden aus Kauf, Darlehen<br />
oder Schenkung nachwirkt, ist nicht abschließend geklärt.<br />
Jedenfalls erhellt dies, warum Julian schlussfolgert, dass tu das<br />
Gr<strong>und</strong>stück <strong>zu</strong> Eigentum erlangt hat. Da es nach der Lehre von der<br />
causa solvendi lediglich darauf ankommt, dass ego <strong>und</strong> tu sich über<br />
die schuldbefreiende Wirkung der Gr<strong>und</strong>stückshingabe verständigt<br />
53 Gai. 3.89, 92; <strong>Ulp</strong>. D. 45.1.1 <strong>pr</strong>. .<br />
54 Gai. 3.92, 93; <strong>Ulp</strong>. D. 45.1.1.2 .<br />
55 <strong>Ulp</strong>. D. 45.1.75.7 .<br />
56 Hausmaninger / Selb, Römisches Privatrecht, S. 152; Honsell / Mayer-Maly /<br />
Selb, Römisches Recht, S. 158; Kaser, Bull. 1961, 61 (70).
- 14 -<br />
haben, ist der im übrigen zwischen ihnen bestehende Dissens<br />
unbeachtlich. Folglich kommt es <strong>zu</strong> einer wirksamen traditio.<br />
Mit dieser Auffassung bewegt sich Julian auf dem Boden der ganz<br />
herrschenden Meinung unter den römischen Juristen <strong>und</strong> in der<br />
römischrechtlichen Literatur 58 . Fest<strong>zu</strong>halten ist an dieser Stelle,<br />
dass Julian als ersten Pfeiler der Begründung seiner Arbeitshypothese<br />
eine Sonderkonstellation auswählt, in der die causa des<br />
Übereignungstatbestandes gegenüber den vorausliegenden Verpflichtungsgeschäften<br />
eine Verselbständigung 59 erfahren hat.<br />
b) Der Bargeldfall<br />
Nach Julian hat tu auch im Bargeldfall Eigentum wirksam<br />
erworben. Während jedoch im ersten Satz des Fragmentes auf einen<br />
zwischen den Parteien bestehenden Dissens ausdrücklich hingewiesen<br />
wird – dies geschieht mit den Antinomien „consentiamus“<br />
<strong>und</strong> „dissentiamus“ (scil. in causis) einerseits sowie „ex<br />
testamento“ <strong>und</strong> „ex stipulatu“ andererseits – ist das Vorliegen<br />
eines Dissenses im zweiten Satz weniger offensichtlich. Erkennbar<br />
wird <strong>zu</strong>nächst nur, dass die jeweiligen Vorstellungen von ego, der<br />
das Bargeld schenken will, <strong>und</strong> tu, der ein Darlehen aufnehmen<br />
will, nicht deckungsgleich sind. Dass Julian auch hier einen Dissens<br />
annimmt, lässt sich aber aus dem letzten Wort des Fragmentes<br />
(„dissenserimus“) ablesen. Dies wirft die Frage auf, wie er trotz<br />
dieses Hindernisses einen wirksamen Eigentumsübergang konstruieren<br />
kann.<br />
Abstrakt gesehen kommen zwei Lösungswege in Betracht:<br />
Entweder ist der Dissens nur ein scheinbarer, der eine Verständigung<br />
von ego <strong>und</strong> tu über die causa nicht hinreichend <strong>zu</strong><br />
stören vermag, oder aber es handelt sich um einen Kausaldissens,<br />
57 Vgl. die Erklärungsversuche bei Jörs / Kunkel / Wenger, Römisches Recht,<br />
S. 128 sowie Honsell, Römisches Recht, S. 61.<br />
58 So Kaser, Bull. 1961, 61 (70 <strong>und</strong> insbesondere 71); vgl. auch Paul. D. 41.3.48;<br />
Hermog. D. 41.3.46; Hausmaninger / Selb, Römisches Privatrecht, S. 152;<br />
Honsell / Mayer-Maly / Selb, Römisches Recht, S. 158.<br />
59 Honsell, Römisches Recht, S. 61; ähnlich Jörs / Kunkel / Wenger, Römisches<br />
Recht, S. 128.
- 15 -<br />
der ähnlich wie im Bargeldfall aus irgendeinem Gr<strong>und</strong> unbeachtlich<br />
ist.<br />
aa) Scheindissens<br />
Wenn nach Julians Vorstellung der Dissens lediglich ein scheinbarer<br />
ist, müsste eine Konstruktion erdacht werden können, die <strong>zu</strong><br />
einer wirksamen causa führt. In Betracht kommen wiederum zwei<br />
Möglichkeiten, entweder haben sich ego <strong>und</strong> tu auf eine Schenkung<br />
verständigt oder aber auf ein Darlehen.<br />
Den allgemeinen Regeln folgend, hängt die wirksame Verständigung<br />
über eine Schenkung von dem Konsens der Beteiligten<br />
in der Gestalt des gemeinsamen animus donandi 60 ab. Speziell in<br />
einer Dissenssituation, wo der Geber nicht animo donandi, sondern<br />
animo credendi handelt, lässt sich aber jedenfalls ein Minimalkonsens<br />
des Inhaltes, dass der Empfänger die übergebene Sache <strong>zu</strong><br />
Eigentum erlangen soll, ermitteln 61 . Denn dies ist sowohl bei der<br />
Schenkung als auch beim Darlehen die tatsächliche Folge, welche<br />
die Beteiligten herbeiführen wollen 62 .<br />
Denkbar ist es weiterhin, eine Schenkung mit der Erwägung <strong>zu</strong><br />
konstruieren, dass bei der Ermittelung des animus donandi vorwiegend<br />
auf die Person des Schenkenden ab<strong>zu</strong>stellen sei 63 . Dies erscheint<br />
deshalb gerechtfertigt, weil die Vermögensverschiebung gerade<br />
vom Schenkenden ausgeht <strong>und</strong> in seiner Person der Nachteil<br />
der Vermögensminderung ohne Kompensation eintritt. Allerdings<br />
lässt sich darauf entgegnen, dass niemandem ein unwillkommenes<br />
Geschenk aufgedrängt werden darf – vgl. <strong>Ulp</strong>. D. 39.5.19.2 „non<br />
60 Paul. D. 44.7.3.1; Hausmaninger / Selb, Römisches Privatrecht, S. 264;<br />
Honsell, Römisches Recht, S. 158; Honsell / Mayer-Maly / Selb, Römisches<br />
Recht, S. 345; Kaser / Knütel, Römisches Privatrecht, S. 298.<br />
61 Kaser / Knütel, Römisches Privatrecht, S. 152, die dies als „kleinsten<br />
gemeinsamen Nenner“ bezeichnen.<br />
62 Hausmaninger / Selb, Römisches Privatrecht, S. 152; Kaser / Knütel,<br />
Römisches Privatrecht, S. 152.<br />
63 Vgl. Fuchs, Iusta causa traditionis, S. 120 f., der dies als „unilaterale Theorie“<br />
bezeichnet.
- 16 -<br />
potest liberalitas nolenti adquiri“ – was diesem Ansatz jedenfalls<br />
den Beigeschmack einer Widers<strong>pr</strong>üchlichkeit gibt.<br />
Darauf, dass Julian dem Willen des Schenkers Vorrang einräumen<br />
will, könnte eine andere Digestenstelle hindeuten:<br />
<strong>Iul</strong>. D. 39.5.1 <strong>pr</strong>.: (...) dat aliquis ea mente, ut statim<br />
velit accipientis fieri nec ullo casu ad se reverti (...)<br />
haec <strong>pr</strong>o<strong>pr</strong>ie donatio appellatur.<br />
Hier kommt die besondere Bedeutung der Willensrichtung<br />
(„mente“) des Schenkers darin <strong>zu</strong>m Ausdruck, dass gerade durch<br />
sie das <strong>zu</strong>standegebracht wird, was man als Schenkung bezeichnet.<br />
Ob Julian in D. <strong>41.1.36</strong> tatsächlich eine wirksame Schenkung<br />
konstruieren will, erscheint allerdings zweifelhaft. Die Stelle selbst<br />
bietet nämlich keine Anzeichen dafür, dass Julian diese Möglichkeit<br />
überhaupt in Betracht zieht: Der zweite Satz behandelt ausschließlich<br />
die Frage des Eigentumsüberganges, woraus keine unmittelbaren<br />
Rückschlüsse auf die Konstruktion der causa gezogen<br />
werden können, <strong>und</strong> im ersten Satz kommt die Schenkung gar nicht<br />
vor.<br />
Indes ist Julian nicht der einzige römische Jurist, der sich dem<br />
Bargeldfall widmet. Er wird auch von <strong>Ulp</strong>ian behandelt <strong>und</strong> zwar in<br />
D. <strong>12.1.18</strong> <strong>pr</strong>., wo er bis auf kleine Nuancen in der Wortwahl identisch<br />
widergegeben ist.<br />
<strong>Ulp</strong>. D. <strong>12.1.18</strong> <strong>pr</strong>.: si ego pecuniam tibi quasi<br />
donaturus dedero, tu quasi mutuam accipias, <strong>Iul</strong>ianus<br />
scribit donationem non esse (...)<br />
<strong>Ulp</strong>ian weist hier nicht nur auf Julian hin, sondern referiert auch<br />
dessen Schlussfolgerung. Weil das Julian-Fragment aber keinerlei<br />
direkte Aussage <strong>zu</strong>r Schenkung trifft, überrascht es, wenn <strong>Ulp</strong>ian
- 17 -<br />
feststellt, Julian schreibe, eine Schenkung sei nicht <strong>zu</strong>standegekommen.<br />
In diesem Kontext fällt an der Wortwahl <strong>Ulp</strong>ians auf,<br />
dass es nicht etwa <strong>Iul</strong>ianus dicet, sentit oder aestimat heißt, sondern<br />
ausdrücklich auf eine schriftliche Stellungnahme hingewiesen wird.<br />
Erklären ließe sich dies <strong>zu</strong>nächst entweder mit der Existenz einer<br />
weiteren Äußerung Julians <strong>zu</strong> demselben Thema oder mit einem<br />
Irrtum, dem <strong>Ulp</strong>ian erlegen ist. Beides ist aber nicht sehr überzeugend:<br />
Dass Julian denselben Fall in seinen Werken mehrmals<br />
aufgreift <strong>und</strong> einen so zentralen Aspekt nach Belieben ans<strong>pr</strong>icht<br />
oder verschweigt, ist unwahrscheinlich. Und auch wenn <strong>Ulp</strong>ians<br />
Arbeitsweise möglicherweise als unsorgfältig charakterisiert werden<br />
kann, so deutet doch seine konkrete Wortwahl auf eine Textstelle<br />
hin, die er genau vor Augen, vielleicht sogar auf dem Papier<br />
vor sich hat.<br />
Der Widers<strong>pr</strong>uch lässt sich auflösen, wenn man davon ausgeht, das<br />
Julian-Fragment sei unvollständig überliefert oder nachklassisch<br />
bearbeitet <strong>und</strong> habe urs<strong>pr</strong>ünglich die Schlussfolgerung „donatio non<br />
est“ oder „nulla donatio est“ enthalten 64 .<br />
Damit ist <strong>zu</strong>gleich klargestellt, dass Julian die causa nicht im Wege<br />
einer wirksamen Schenkung konstruiert.<br />
Es bleibt aber die Konstruktion über das Darlehen. In der Tat lässt<br />
sich <strong>Ulp</strong>ian, wenn er schreibt „sed an mutua sit, videndum“ – mit<br />
der Betonung auf „videndum“ – so begreifen, dass er an Erwägungen<br />
<strong>zu</strong>m Darlehen, die er bei Julian vorgef<strong>und</strong>en hat, seinerseits<br />
anknüpfen möchte.<br />
Julians Gedankengang könnte etwa folgendermaßen aussehen 65 :<br />
Der Geber <strong>und</strong> der Empfänger des Geldes haben jedenfalls einen<br />
Konsens bezüglich des Eigentumsüberganges erzielt. Darüberhinaus<br />
ist der Geber damit einverstanden, die Münzen niemals <strong>zu</strong>-<br />
64 Beseler, Beiträge <strong>zu</strong>r Kritik der römischen Rechtsquellen, Heft 3, S. 57; Fuchs,<br />
Iusta causa traditionis, S. 131; Pflüger, Zur Lehre vom Erwerbe des Eigentums<br />
nach römischem Recht, S. 19; so im Erg. auch Backhaus, ZSS 100, 136 (165).<br />
65 Vgl. auch Kaser / Knütel, Römisches Privatrecht, S. 152 f. .
- 18 -<br />
rück<strong>zu</strong>erhalten 66 , weil er schenken will. Wenn nun aber der Empfänger<br />
von einem Darlehen ausgeht, beinhaltet dies sein Einverständnis<br />
bezüglich der späteren Rückgewähr eines der hingegebenen<br />
Summe ents<strong>pr</strong>echenden Geldbetrages 67 . Für den Geber ist<br />
dies naturgemäß günstig, weil seine wirtschaftliche Position<br />
dadurch nicht verschlechtert wird. In seinem Willen <strong>zu</strong> schenken ist<br />
deshalb als ein Minus der Wille inkorporiert, hilfsweise auch ein<br />
Darlehen gewähren <strong>zu</strong> wollen. Da insoweit die Vorstellungen von<br />
Geber <strong>und</strong> Empfänger deckungsgleich sind, liegt ein consensus<br />
bezüglich einer causa credendi vor, der die traditio wirksam werden<br />
lässt.<br />
Diese Argumentationstechnik beruht auf dem Gedanken des in<br />
maiore minus inest 68 <strong>und</strong> erfreut sich unter den Juristen der<br />
klassischen Juris<strong>pr</strong>udenz einer gewissen Beliebtheit 69 .<br />
Anwendungsfälle sind namentlich im Bereich von Dissenssituationen<br />
beim Abschluss von Rechtsgeschäften nachweisbar 70 ,<br />
also in Konstellationen <strong>zu</strong> denen auch die hier behandelte zählt.<br />
Es fragt sich allerdings, ob die Annahme, animus donandi <strong>und</strong><br />
animus credendi würden sich <strong>zu</strong>einander verhalten wie maior <strong>zu</strong><br />
minus, tatsächlich haltbar ist. <strong>Ulp</strong>ian jedenfalls betrachtet den<br />
animus credendi als ein aliud, wenn er schreibt, dass auch kein<br />
Darlehen <strong>zu</strong>standegekommen sei. Wo hier der genaue Grenzverlauf<br />
liegt, kann indes nur mit einer wertenden Einzelfallbetrachtung<br />
entschieden werden 71 .<br />
Zu einer Bewertung als aliud gelangt man insbesondere, wenn man<br />
den qualitativen Unterschied, der das Darlehen von der Schenkung<br />
trennt, betont 72 . Immerhin steht <strong>Ulp</strong>ian mit seiner Auffassung auch<br />
nicht alleine da, sie wird namentlich von Paulus in D. 44.7.3.1<br />
66 Vgl. <strong>Iul</strong>. D. 39.5.1 <strong>pr</strong>.: „nec ullo casu ad se reverti“.<br />
67 Paul. D. 12.1.2. <strong>pr</strong>., 2; Hausmaninger / Selb, Römisches Privatrecht, S. 213.<br />
68 Kaser / Knütel, Römisches Privatrecht, S. 152 f.; vgl. auch Lab. D. 32.29.1;<br />
Paul. D. 50.17.110 <strong>pr</strong>.; Pomp. D. 19.2.52 .<br />
69 Backhaus, ZSS 100, 136 (138, 180 f.).<br />
70 Vgl. dens., a.a.O. (145 ff.).<br />
71 Ders., a.a.O. (139).<br />
72 So Fuchs, Iusta causa traditionis, S. 134.
- 19 -<br />
geteilt, wo dieser in einem gleichgelagerten Fall die Entstehung<br />
einer vertraglichen Obligation verneint.<br />
Diese Gesichtspunkte vermögen aber nicht darüber hinweg <strong>zu</strong><br />
täuschen, dass das Julian-Fragment keine Anhaltspunkte dafür<br />
bietet, ob sein Verfasser wirklich mit dem Gedanken des in maiore<br />
minus inest operieren will. Vielmehr bietet der Quellentext selbst<br />
ein anderes Verständnis an: Wenn Julian schreibt, es sei kein<br />
Hindernis, dass ein Dissens vorliege („nec impedimento esse, quod<br />
[...] dissenserimus“), so legt doch gerade diese Formulierung es<br />
nahe, ihn beim Wort <strong>zu</strong> nehmen <strong>und</strong> aus ihr ab<strong>zu</strong>leiten, dass im<br />
konkreten Fall ein Dissens auch wirklich besteht, die Beteiligten<br />
sich also weder auf eine Schenkung, noch auf ein Darlehen<br />
verständigt haben. Hierfür s<strong>pr</strong>echen auch die beiden Be<strong>zu</strong>gspunkte<br />
„causam dandi“ <strong>und</strong> (scil. causam) „accipiendi“ des „dissenserimus“;<br />
wollte man nämlich meinen, Julian konstruiere ein wirksames<br />
Darlehen, so wären diese Worte sinnlos, ja gerade<strong>zu</strong> falsch,<br />
weil es consentiamus heißen müsste.<br />
So betrachtet handelt es sich bei „sed (...) videndum“ nicht mehr<br />
um eine Referenz, die sich auf Julian bezieht, sondern um einen<br />
von <strong>Ulp</strong>ian in die Diskussion eingeführten, neuen Gesichtspunkt.<br />
Richtigerweise liegt die Betonung deshalb auf „mutua“ <strong>und</strong> hinter<br />
„videndum“ ist ein est <strong>zu</strong> ergänzen 73 .<br />
bb) Unbeachtlicher Kausaldissens<br />
Die letzte verbleibende Erklärungsmöglichkeit für den Erfolg der<br />
traditio trotz des Kausaldissenses ist, dass dieser nach der Vorstellung<br />
Julians unbeachtlich sein muss.<br />
Diese Erklärung ergibt sich teilweise aus dem Aufbau des Fragmentes<br />
selbst. Der Bargeldfall fungiert neben dem Gr<strong>und</strong>stücksfall<br />
als zweiter Pfeiler der Begründung für Julians Arbeitshypothese<br />
(vgl. oben S. 11 f.). Den ersten Pfeiler bildet der Gr<strong>und</strong>stücksfall, in<br />
dem die iusta causa traditionis eine Verselbständigung erfahren hat<br />
73 Beseler, ZSS 45, 188 (221).
- 20 -<br />
<strong>und</strong> nicht im vorausliegenden Kausalgeschäft – Damnationslegat<br />
oder Stipulation – <strong>zu</strong> suchen ist, sondern in einer eigenständigen<br />
Erfüllungsabrede, dem titulus <strong>pr</strong>o soluto 74 .<br />
Die durch „veluti“ <strong>und</strong> „nam et si“ ausgedrückte Gleichordnung der<br />
beiden Pfeiler legt es nahe, Julians Lösung des Bargeldfalles mit<br />
Hilfe eines Transfers <strong>zu</strong> konstruieren: Ab<strong>zu</strong>stellen ist demnach<br />
auch hier auf die Einigung über den schuldbefreienden Charakter<br />
der Leistung. Die Übereignung des Bargeldes gelingt demgemäß,<br />
weil ego <strong>und</strong> tu darin übereinstimmen, dass das Geld ex causa<br />
solvendi Eigentum des tu werden soll. Der im übrigen zwischen<br />
ihnen bestehende Dissens vermag den Eigentumsübergang ents<strong>pr</strong>echend<br />
der Lösung des Gr<strong>und</strong>stücksfalles nicht <strong>zu</strong> verhindern<br />
<strong>und</strong> ist daher unbeachtlich 75 .<br />
Darauf, dass Julian den Eigentumsübergang auf diese Weise<br />
konstruiert, weist auch die das Fragment abschließende Formulierung<br />
„nec impedimento esse, (...) causam dandi atque accipiendi<br />
dissenserimus“ hin. Causa dandi <strong>und</strong> causa accipiendi stellen hier<br />
durch Abstrahierung gewonnene Oberbegriffe für alle anerkannten<br />
causae dar, Julians Schlussfolgerung, ein sie betreffender Dissens<br />
sei für den Eigentumsübergang kein Hindernis, kann widers<strong>pr</strong>uchsfrei<br />
nur dahingehend verstanden werden, dass es ihm auf einen<br />
Kausalkonsens nicht ankommt.<br />
So betrachtet zeigt sich eine Korrelation zwischen dem Einleitungs<strong>und</strong><br />
dem Schlusssatz des Fragmentes, weil beide mit demselben<br />
Abstraktionsgrad („in causis vero dissentiamus“ einerseits, „causam<br />
dandi atque accipiendi dissenserimus“ andererseits) den Kausaldissens<br />
behandeln <strong>und</strong> einen Rahmen für die wesentlich konkreteren<br />
Erwägungen <strong>zu</strong>m Gr<strong>und</strong>stücks- <strong>und</strong> Bargeldfall bilden – eine<br />
Darstellungsform, deren Ästhetik nicht <strong>zu</strong> leugnen ist.<br />
Zweifel an diesem Verständnis des Fragmentes ergeben sich, weil<br />
die römischen Juristen, <strong>und</strong> unter ihnen insbesondere <strong>Ulp</strong>ian in<br />
D. <strong>12.1.18</strong> <strong>pr</strong>., ganz überwiegend an dem Erfordernis eines<br />
74 Vgl. Jörs / Kunkel / Wenger, Römisches Recht, S. 127 f. (Fn. 11 f.).
- 21 -<br />
Kausalkonsenses festhalten 76 , was jede abweichende Auffassung<br />
als eine „Kühnheit“ 77 erscheinen lassen könnte.<br />
Doch ist Julian nicht dafür bekannt, dass er sich scheut, andere<br />
Wege <strong>zu</strong> gehen als die Mehrzahl seiner Kollegen, was am Beispiel<br />
seiner Position <strong>zu</strong>m Putativtitel bei der Ersit<strong>zu</strong>ng belegt werden<br />
kann: Die Ersit<strong>zu</strong>ng hängt nach römischem Recht unter anderem<br />
vom Vorliegen einer iusta causa usucapionis ab 78 . In diesem Zusammenhang<br />
besteht darüber Streit, ob eine nur vermeintlich<br />
bestehende iusta causa (sogenannter Putativtitel) für den Eigentumserwerb<br />
ausreichen kann 79 . Wie Afrikan bezeugt 80 , lässt Julian<br />
eine Ersit<strong>zu</strong>ng in dieser Konstellation <strong>zu</strong>, worauf Celsus ihm nicht<br />
ohne Härte antwortet 81 .<br />
Der Streit um den Putativtitel bei der usucapio ist mit der<br />
Problematik um den Kausaldissens bei der traditio deshalb<br />
vergleichbar, weil in beiden Fällen der Erwerber ein tatsächlich<br />
nicht bestehendes Rechtsverhältnis für die causa hält. Wenn aber<br />
Julian bei der Ersit<strong>zu</strong>ng, die gegen den Willen des bisherigen<br />
Eigentümers stattfindet, eine abgeschwächte Form der causa<br />
ausreichen lässt, so erscheint es konsequent an<strong>zu</strong>nehmen, dass er<br />
bei der Übereignung vermittels traditio hierauf gänzlich verzichten<br />
will, wenn sich der Veräußerer <strong>und</strong> der Erwerber jedenfalls über<br />
den Eigentumsübergang an sich geeinigt haben.<br />
c) Schlussfolgerungen<br />
Der Aufbau des Julian-Fragmentes, der Duktus der Argumentation<br />
<strong>und</strong> der Vergleich mit einer Entscheidung in der Ersit<strong>zu</strong>ngskonstellation<br />
führen <strong>zu</strong> der Schlussfolgerung, dass Julian die causa<br />
75 So auch Mayer-Maly, Römisches Recht, S. 75.<br />
76 Honsell / Mayer-Maly / Selb, Römisches Recht, S. 159.<br />
77 Mayer-Maly, Römisches Recht, S. 75; etwas weniger drastisch Honsell /<br />
Mayer-Maly / Selb, Römisches Recht, S. 159: „starkes Abweichen“.<br />
78 Hausmaninger / Selb, Römisches Privatrecht, S. 155; Honsell,<br />
Römisches Recht, S. 64.<br />
79 Honsell / Mayer-Maly / Selb, Römisches Recht, S. 177 f. .<br />
80 Afr. D. 41.4.11. <strong>pr</strong>.; vgl. auch Mayer-Maly, Römisches Recht, S. 79<br />
81 Referierend: <strong>Ulp</strong>. D. 41.3.27: „errare eos ait (...)“.
- 22 -<br />
des Übereignungstatbestandes nicht in einem vorausliegenden Verpflichtungsgeschäft,<br />
sondern in einer selbständigen Erfüllungsabrede,<br />
dem titulus <strong>pr</strong>o solutione sieht.<br />
Infolgedessen ist die Eigentumsverschaffung immer dann wirksam,<br />
wenn der Veräußerer <strong>und</strong> der Erwerber bei der Übergabe der Sache<br />
einvernehmlich davon ausgehen, dies geschehe <strong>zu</strong>r Erfüllung<br />
irgendeiner, möglicherweise nicht einmal bestehenden 82 Schuld.<br />
Der Sache nach bedeutet dies, dass die wirksame Einigung über<br />
eine bestimmte causa kein Merkmal des Übereignungstatbestandes<br />
mehr ist.<br />
3. Zu möglichen Interpolationen<br />
Das Julian-Fragment steht in mancherlei Hinsicht unter dem Verdacht<br />
nachklassischer Bearbeitungen 83 . Der Aspekt des gestrichenen<br />
„donatio non est“ wurde bereits oben (S. 17) erörtert.<br />
Eine weitere Interpolationsvermutung betrifft den Begriff traditio.<br />
Hier spielt der Umstand eine Rolle, dass während der Arbeiten an<br />
den justinianischen Digesten die Kompilatoren, wo sie in den<br />
Quellen das Wort mancipatio vorfanden, an seine Stelle die traditio<br />
setzten 84 .<br />
Demgemäß wird in der Literatur die Auffassung vertreten, das<br />
Urs<strong>pr</strong>ungsfragment handele jedenfalls im ersten Satz nicht von der<br />
traditio, sondern von der mancipatio 85 , einem Übereignungstatbestand,<br />
der unzweifelhaft keine iusta causa <strong>zu</strong>r Vorausset<strong>zu</strong>ng<br />
hat 86 .<br />
Zur Unterstüt<strong>zu</strong>ng dieser Position wird auf den unterschiedlichen<br />
Anwendungsbereich der traditio einerseits <strong>und</strong> der mancipatio<br />
andererseits hingewiesen: Insbesondere Gr<strong>und</strong>stücke als res mancipi<br />
könnten nur im Wege der mancipatio wirksam übertragen<br />
82 Jörs / Kunkel / Wenger, Römisches Recht, S. 128 (Fn. 13).<br />
83 Vgl. vor allem Hupka, ZSS 52, 1 (6 f.).<br />
84 Banti, RE II, 6, 2, Sp. 1892 (Traditio).<br />
85 Jörs, Geschichte <strong>und</strong> System, S. 86 (Fn. 3); vorsichtiger Lenel, ZSS 3,<br />
177 (179); Oertmann, Die Fiducia im römischen Privatrecht, S. 29.<br />
86 Honsell / Mayer-Maly / Selb, Römisches Recht, S. 156; Kaser / Knütel,<br />
Römisches Privatrecht, S. 150; vgl. auch Beseler, ZSS 45, 188 (222).
- 23 -<br />
werden 87 . Allerdings gibt es auch Gr<strong>und</strong>stücke, an denen anerkanntermaßen<br />
mit einer traditio Eigentum verschafft werden kann,<br />
nämlich die außerhalb des italischen Kernlandes gelegenen sogenannten<br />
Provinzialgr<strong>und</strong>stücke 88 . Der Schluss auf eine Streichung<br />
der mancipatio ist deshalb nicht zwingend, genausogut könnte es<br />
sein, dass mit dem Gr<strong>und</strong>stück ein f<strong>und</strong>us <strong>pr</strong>ovincialis gemeint<br />
ist 89 .<br />
Für die Schlussfolgerungen <strong>zu</strong> 2. c) ist dies ohne Bedeutung, weil<br />
der Gr<strong>und</strong>stücksfall erst Recht, wenn die Übereignung mittels der<br />
abstrakten mancipatio erfolgt, eine Sonderkonstellation darstellt, in<br />
der es auf einen Kausalkonsens nicht ankommt. Im zweiten Satz<br />
muss auch der Urs<strong>pr</strong>ungstext von einer traditio handeln, weil<br />
Bargeld <strong>zu</strong> den der mancipatio nicht <strong>zu</strong>gänglichen res nec mancipi<br />
90 zählt.<br />
Zweifel werden ferner bezüglich des Eingangssatzes („Cum in<br />
corpus [...] traditio“) <strong>und</strong> des Schlusses der Stelle („constat [...]<br />
dissenserimus“) geäußert. Die vorgebrachten Argumente sind<br />
stilistischer Natur <strong>und</strong> begründen die Unechtheit mit einem für<br />
Julian unüblichen S<strong>pr</strong>achgebrauch 91 sowie mit der These, dass<br />
<strong>Ulp</strong>ian sich wohl beugen müsste 92 , wenn Julian tatsächlich derart<br />
energisch („constat“) für einen wirksamen Eigentumserwerb<br />
streiten wollte. Es ist allerdings fraglich, ob diese Argumente es<br />
rechtfertigen, nahe<strong>zu</strong> das gesamte Fragment, jedenfalls aber seine<br />
sinngebenden Bestandteile für unecht <strong>zu</strong> erklären. Da alle<br />
Versuche, das Fragment stattdessen mit anderen Inhalten auf<strong>zu</strong>füllen,<br />
reine Spekulationen geblieben sind <strong>und</strong> andererseits mit dem<br />
87 Lenel, ZSS 3, 177 (179);<br />
88 Hausmaninger / Selb, Römisches Privatrecht, S. 151; Kaser,<br />
Das römische Privatrecht I, S. 351.<br />
89 Beseler, ZSS 45, 188 (222); Hupka, ZSS 52, 1 (6 f.); Mayer-Maly,<br />
Römisches Recht, S. 75.<br />
90 Vgl. Gai. 2.81; Kaser / Knütel, Römisches Privatrecht, S. 120, 151.<br />
91 Beseler, ZSS 45, 188 (221 f.).<br />
92 Ders., Beiträge <strong>zu</strong>r Kritik der römischen Rechtsquellen, Heft 3, S. 57; Pflüger,<br />
Zur Lehre vom Erwerbe des Eigentums nach römischem Recht, S. 20; ähnlich<br />
Kaser, TR 29, 169 (226).
- 24 -<br />
überlieferten Fragment ein Text vorliegt, der einen schlüssigen<br />
Gedankengang aufweist, ist richtigerweise an diesem fest<strong>zu</strong>halten<br />
93 .<br />
4. Ergebnis<br />
Der Eigentumserwerb des tu im Gr<strong>und</strong>stücksfall ist unstreitig.<br />
Im Bargeldfall gelangt Julian mittels einer Übertragung der Lösung<br />
des Gr<strong>und</strong>stücksfalles ebenfalls <strong>zu</strong>m wirksamen Eigentumserwerb<br />
des tu.<br />
<strong>Ulp</strong>ian ist anderer Auffassung <strong>und</strong> verneint einen Eigentumserwerb<br />
unter Hinweis auf den bestehenden Kausaldissens. Da er aber die<br />
exceptio doli gibt, ist tu, unter der Vorausset<strong>zu</strong>ng, dass er das Geld<br />
ausgegeben hat, auch nach seiner Lösung nicht <strong>zu</strong>r Rückgabe<br />
verpflichtet.<br />
VI. Vergleich mit dem geltenden Recht<br />
Für die Lösung nach dem geltenden Recht ist <strong>zu</strong>nächst zwischen<br />
Mobilien <strong>und</strong> Immobilien <strong>zu</strong> differenzieren:<br />
Das Eigentum an beweglichen Sachen wird gem. § 929 S. 1 BGB<br />
übertragen, wenn der Eigentümer dem Erwerber die Sache übergibt<br />
<strong>und</strong> beide über den Eigentumsübergang einig sind. Nach dem<br />
Wortlaut muss die Einigung nur beinhalten, dass das Eigentum an<br />
einer bestimmten Sache vom Eigentümer auf den Erwerber<br />
übergehen soll. Warum die Eigentumsübertragung stattfindet, ist<br />
bedeutungslos.<br />
Dem<strong>zu</strong>folge wird die Einigung als ein dingliches Rechtsgeschäft<br />
bezeichnet, das getrennt von der <strong>zu</strong>gr<strong>und</strong>eliegenden Verpflichtung<br />
betrachtet werden muss <strong>und</strong> in seinem Bestand von diesem nicht<br />
abhängt 94 . Letzteres wird als Abstraktions<strong>pr</strong>inzip bezeichnet 95 <strong>und</strong><br />
im BGB bereits dadurch deutlich gemacht, dass die Verpflichtungen<br />
in einem ganz anderen systematischen Kontext (Buch 2,<br />
93 Hupka, ZSS 52, 1 (18, 30).<br />
94 Palandt-Bassenge, § 929, Rnr. 2; Einf. v. § 854, Rnrn. 11, 16;<br />
Schreiber, Sachenrecht, Rnrn. 27, 153.<br />
95 Vgl. statt vieler Schreiber / Kreutz, Jura 1989, 617 ff. .
- 25 -<br />
Schuldverhältnissse) als der Eigentumserwerb (Buch 3, Sachenrecht)<br />
behandelt werden.<br />
Die Rechtsfolge des § 929 S. 1 BGB tritt somit ein, ohne dass die<br />
Beteiligten sich auf irgendein Kausalgeschäft, dessen Erfüllung sie<br />
herbeiführen wollen, verständigt haben. Die Übergabe des Bargeldes<br />
von ego an tu bei gleichzeitigem Einigsein über den Eigentumsübergang<br />
lässt tu dieses <strong>zu</strong> Eigentum erlangen.<br />
Für die Übertragung des Eigentums an Gr<strong>und</strong>stücken sind die<br />
§§ 873, 925 BGB einschlägig. Nach § 873 Abs. 1 iVm. § 925<br />
Abs. 1 S. 1 BGB ist wiederum eine Einigung über die Rechtsänderung<br />
<strong>und</strong> – anstelle der Übergabe – die Eintragung in das<br />
Gr<strong>und</strong>buch erforderlich. § 873 Abs. 1 BGB ist dem § 929 S. 1 BGB<br />
nachgebildet, die Einigung wird in § 925 Abs. 1 S. 1 BGB als Auflassung<br />
bezeichnet, gehorcht aber ansonsten denselben Regeln 96 .<br />
Infolgedessen ist auch hier die Wirksamkeit eines Kausalgeschäftes<br />
kein Tatbestandsmerkmal. Tu ist, wenn man seine Eintragung in<br />
das Gr<strong>und</strong>buch unterstellt, Eigentümer des Gr<strong>und</strong>stückes geworden.<br />
Ein Herausgabeans<strong>pr</strong>uch des ego gem. § 985 BGB scheitert daher<br />
in beiden Fällen; dass ego von tu möglicherweise Rückübereignung<br />
des Geldes bzw. des Gr<strong>und</strong>stückes gem. § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1<br />
BGB verlangen kann, ändert an dem wirksamen Eigentumserwerb<br />
nichts. Dieses Ergebnis ents<strong>pr</strong>icht dem Willen des Gesetzgebers<br />
<strong>und</strong> spiegelt die Erwägung wider, dass über die Eigentumsverhältnisse<br />
an Sachen im Interesse des Rechtsverkehrs die<br />
größtmögliche Klarheit herrschen soll 97 .<br />
Wegweisend 98 für diese gesetzgeberische Bewertung war F. C. von<br />
Savigny, der aus <strong>Iul</strong>. D. <strong>41.1.36</strong> den Gedanken entwickelte, dass der<br />
zwischen dem Veräußerer <strong>und</strong> dem Erwerber bestehende Konsens<br />
96 Erman-Lorenz, § 873, Rnrn. 1, 12; Schreiber, Sachenrecht, Rnr. 345;<br />
Westermann, BGB-Sachenrecht, Rnrn. 313 ff. .<br />
97 Vgl. Motive III, S. 6 ff. , so insbesondere S. 7.<br />
98 Honsell / Mayer-Maly / Selb, Römisches Recht, S. 160; Kaser / Knütel,<br />
Römisches Privatrecht, S. 153; Schreiber / Kreutz, Jura 1989, 617 (622).
- 26 -<br />
über den Eigentumsübergang (<strong>zu</strong>sammen mit der Sachübergabe)<br />
<strong>zu</strong>m Erwerb führen solle 99 .<br />
Dass die gesetzgeberische Bewertung selbstverständlich anders<br />
ausfallen kann, zeigt ein Blick nach Österreich <strong>und</strong> in die<br />
Schweiz 100 : § 380 ABGB bzw. Art. 714 Abs. 1, 922 ZGB machen<br />
den wirksamen Eigentumserwerb von einem Titel abhängig, stellen<br />
also eine kausale Verknüpfung her <strong>und</strong> folgen insofern <strong>Ulp</strong>ian.<br />
99 v. Savigny, System des heutigen Römischen Rechts, Band 4, S. 160.<br />
100 Vgl. Honsell, Römisches Recht, S. 59; Mayer-Maly, Römisches Recht, S. 72.