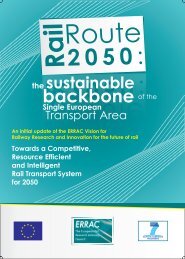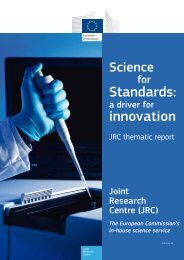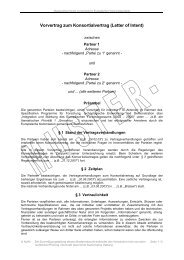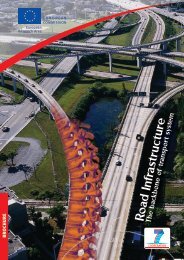KoWi - Forschungsbrief
KoWi - Forschungsbrief
KoWi - Forschungsbrief
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>KoWi</strong> - <strong>Forschungsbrief</strong><br />
Kooperationsstelle EU<br />
der Wissenschaftsorganisationen<br />
Marie Curie Actions in „Horizon 2020“<br />
Nr. 14 2012<br />
Beitrag<br />
Europa braucht kluge Köpfe<br />
Marie Curie-Maßnahmen als Teil von „Horizon 2020“<br />
Von Androulla Vassiliou, EU-Kommissarin für Bildung, Kultur, Mehrsprachigkeit und Jugend<br />
Editorial<br />
Liebe Leserin,<br />
lieber Leser,<br />
© European Union 2011<br />
Androulla Vassiliou<br />
Alle Akteure in Bildung und Forschung<br />
sind sich bewusst, dass Europa für die<br />
klügsten Köpfe aus der ganzen Welt attraktiv<br />
bleiben muss, um seine globale<br />
Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern<br />
und den größtmöglichen Nutzen aus den<br />
Chancen der globalisierten Wirtschaft zu<br />
ziehen. Dies ist auch das Kernanliegen<br />
der Wachstumsagenda der Europäischen<br />
Kommission und ihrer Forschungsstrategie<br />
„Horizon 2020“.<br />
Die Frage lautet jetzt, wie wir unsere<br />
Ziele am besten erreichen können. Ich<br />
glaube, dass Investitionen in Bildung,<br />
Forschung und Innovation von zentraler<br />
Bedeutung für die Sicherung des künftigen<br />
Wirtschaftswachstums sind.<br />
Europa und seine Bürgerinnen und Bürger<br />
durchleben gegenwärtig harte Zeiten.<br />
Es stehen Entscheidungen an, die unsere<br />
Zukunft prägen werden. Aber auch während<br />
dieser Krise und vor allem auf deren<br />
Höhepunkt dürfen wir die langfristigen<br />
Ziele nicht aus den Augen verlieren. Die<br />
Investitionen von heute sind die Saat für<br />
das Wachstum von morgen.<br />
Unser Ziel ist es, eine Million neue Forschungsarbeitsplätze<br />
in der EU zu schaffen<br />
und auf diese Weise bis zum Ende<br />
des Jahrzehnts unser Forschungsinvestitionsziel<br />
von 3 % des EU-Bruttoinlandsprodukts<br />
(öffentliche und private Investitionen<br />
kombiniert) zu erreichen.<br />
Ehrgeiziges Förderprogramm<br />
„Horizon 2020“ beschreibt die Vision<br />
der Europäischen Kommission – und die<br />
Mittel, die wir benötigen, um diese Vision<br />
Realität werden zu lassen. Unser im<br />
November vorgelegter Vorschlag wird<br />
zurzeit von den Mitgliedstaaten und dem<br />
Europäischen Parlament erörtert. Wir gehen<br />
davon aus, dass er so rechtzeitig angenommen<br />
wird, dass wir unser neues<br />
Forschungs- und Innovationsprogramm<br />
Anfang 2014 starten können.<br />
„Horizon 2020“ ist ein Bündel von Maßnahmen,<br />
mit denen Forschung, Innovation<br />
und Wettbewerb in Europa gefördert<br />
werden sollen. Es vereint alle unsere bestehenden<br />
Finanzierungsregelungen in<br />
den Bereichen Forschung und Innovation<br />
in einem einzigen Programm. Es ist<br />
umfassend und ehrgeizig, doch zugleich<br />
notwendig und realistisch.<br />
Positive Ergebnisse fortschreiben<br />
Es baut auf den positiven Ergebnissen<br />
auf, die wir bereits erzielt haben. Die<br />
Marie Curie-Maßnahmen, die ebenso<br />
wie das Europäische Innovations- und<br />
Technologieinstitut (EIT) in meinen Zuständigkeitsbereich<br />
fallen, sind seit 1996<br />
ein ganz wesentlicher Baustein der EU-<br />
Forschungsfinanzierung. Im Rahmen von<br />
Marie Curie wurden bisher über 60.000<br />
Forscherinnen und Forscher in Europa<br />
gefördert.<br />
die Marie Curie Actions gehören zu<br />
den renommiertesten Programmen<br />
der europäischen Forschungsförderung.<br />
Seit fast 20 Jahren sind sie fester<br />
Bestandteil der EU-Forschungsrahmenprogramme<br />
und unterstützen<br />
wissenschaftliche Mobilität, Karriereentwicklung<br />
und die Internationalisierung<br />
der Nachwuchsförderung<br />
in Europa. Wissenschaftlerinnen und<br />
Wissenschaftler, die über Marie Curie<br />
gefördert werden, verfügen über internationale<br />
Netzwerke und haben eine<br />
Ausbildung erhalten, die sie auf eine<br />
Tätigkeit in Wissenschaft und Wirtschaft<br />
vorbereitet.<br />
Die Europäische Kommission hat kürzlich<br />
ihre Vorstellungen zur zukünftigen<br />
Ausrichtung der Marie Curie Actions<br />
im Zeitraum 2014-2020 („Horizon<br />
2020“) vorgelegt. Der vorliegende <strong>Forschungsbrief</strong><br />
möchte die Vorschläge<br />
der Europäischen Kommission darlegen<br />
und Stimmen von der Nutzerseite,<br />
d.h. aus Hochschule, außeruniversitärer<br />
Forschung und der Industrie,<br />
vorstellen.<br />
Die ersten Ausschreibungen im „Marie<br />
Skłodowska-Curie“-Programm werden<br />
voraussichtlich gegen Ende des Jahres<br />
2013 veröffentlicht. Weiterhin werden<br />
unter „Horizon 2020“ Ausbildungsnetzwerke<br />
zur strukturierten Doktorandenförderung,<br />
individuelle Projektvorhaben<br />
für Postdoktorandinnen<br />
und Postdoktoranden sowie Personalaustauschprogramme<br />
gefördert. Das<br />
Marie Curie-Team der <strong>KoWi</strong> in Bonn<br />
und Brüssel berät Sie gerne zu Fragen<br />
rund um Marie Curie.<br />
Das <strong>KoWi</strong>-Marie Curie-Team
<strong>KoWi</strong> - <strong>Forschungsbrief</strong> Nr. 14 2012<br />
Beitrag<br />
Über die Hälfte der Projekte, die im Zuge<br />
des laufenden Forschungsrahmenprogramms<br />
finanziell unterstützt werden,<br />
betreffen die Erforschung großer gesellschaftlicher<br />
Fragen im Zusammenhang<br />
mit (unter anderem) Gesundheit, Klimawandel<br />
und Energie. 10.000 Doktoranden<br />
profitieren bereits von einer Förderung<br />
durch Marie Curie.<br />
Aktive Teilnahme der Industrie<br />
Ziel war und ist es, die Industrie mittels<br />
Aktionen, die sich an – insbesondere<br />
kleine und mittlere – Unternehmen<br />
wenden, aktiv einzubeziehen. An Marie<br />
Curie-Projekten sind über Einzelstipendien<br />
oder Netzwerke viele renommierte<br />
Einrichtungen beteiligt, darunter die Max-<br />
Planck-Institute in Deutschland und die<br />
Europäische Organisation für Kernforschung<br />
(CERN).<br />
Diese Projekte reichen von der Zusammenarbeit<br />
führender Partner aus dem<br />
Hochschulbereich und der Industrie in<br />
grundlegenden Gesundheitsfragen bis<br />
hin zur Anwendung fortschrittlicher Mikroelektronik<br />
und Echtzeit-Datenverarbeitungstechnologie<br />
beim größten Teilchenbeschleuniger<br />
der Welt, dem Large<br />
Hadron Collider von CERN.<br />
Bekanntheit steigern<br />
Unser Ziel ist es, die Wirkung und Bekanntheit<br />
des Marie Curie-Programms im<br />
Rahmen von „Horizon 2020“ zu steigern.<br />
In ihrem Vorschlag sieht die Kommission<br />
eine Straffung des Programms und vier<br />
große Zielgruppen für die finanzielle Unterstützung<br />
vor:<br />
• Nachwuchswissenschaftler/innen: Die<br />
Mittel werden für junge Forscherinnen<br />
und Forscher bereitgestellt, damit sie<br />
eine ausgezeichnete Ausbildung erhalten,<br />
die ihre Fähigkeiten fördert, eine<br />
bessere Nutzung ihrer Forschungsergebnisse<br />
ermöglicht und zur Innovation<br />
beiträgt; insbesondere Doktorate in der<br />
Industrie sollen unterstützt werden.<br />
• Erfahrene Forschende (promoviert oder<br />
mit gleichwertigem Abschluss): Erfahrene<br />
Forschende erhalten mehr Möglichkeiten,<br />
das Land, den Sektor und<br />
den Fachbereich zu wechseln.<br />
• Austausch von Personal: Unterstützt<br />
wird der Austausch von Forschungsund<br />
Innovationspersonal zwischen<br />
dem öffentlichen und dem privaten<br />
Sektor sowie zwischen EU- und Nicht-<br />
EU-Ländern.<br />
• Kofinanzierungsmechanismus: Die Möglichkeiten<br />
der Kofinanzierung regionaler,<br />
nationaler und internationaler Mobilitätsprogramme<br />
für die Ausbildung von<br />
Forschende und den Austausch von Personal<br />
werden ausgeweitet.<br />
Das Programm wird in „Marie-Skło dow ska-<br />
Curie-Maßnahmen“ umbenannt, um den<br />
polnischen Wurzeln der mit dem Nobelpreis<br />
ausgezeichneten Wissenschaftlerin<br />
Rechnung zu tragen.<br />
Talente anlocken<br />
Die Ziele bleiben unverändert: die größten<br />
Talente aus Europa und der Welt anlocken<br />
und die Beschäftigungsfähigkeit<br />
von Forschende im öffentlichen wie im<br />
privaten Sektor verbessern. Es werden<br />
weiterhin alle Forschungsbereiche abgedeckt.<br />
Die Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen<br />
werden zum wichtigsten EU-<br />
Programm für die Förderung einer exzellenten<br />
Doktorandenausbildung. Mit<br />
den vorgeschlagenen Programmmitteln<br />
in Höhe von 5,7 Mrd. EUR sollen<br />
in den Jahren 2014-2020 insgesamt<br />
65.000 Forscherinnen und Forscher unterstützt<br />
werden; 40 % der Gelder würden in<br />
die Doktorandenausbildung fließen. Die<br />
Unternehmen (KMU und andere sozioökonomische<br />
Akteure) werden weiterhin<br />
nachdrücklich zur Teilnahme eingeladen.<br />
Ausblick<br />
Zusammen mit „Horizon 2020“ und –<br />
parallel dazu – mit unserem neuen Programm<br />
für die allgemeine und berufliche<br />
Bildung „Erasmus für alle“ werden die<br />
Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen<br />
eine zentrale Rolle bei der Bewältigung<br />
der gesellschaftlichen und wissenschaftlichen<br />
Herausforderungen spielen und den<br />
europäischen Bürgerinnen und Bürgern<br />
dabei helfen, besser zu leben.<br />
Info-Box<br />
• 1.117 deutsche Gasteinrichtungen<br />
haben sich an Marie Curie Actions<br />
beteiligt<br />
• 909 deutsche Wissenschaftler/innen<br />
wurden gefördert<br />
• 1.234 Wissenschaftler/innen sind an<br />
deutsche Gasteinrichtungen gekommen<br />
(Quelle: EU-Kommission)<br />
Marie-Skłodowska-<br />
Curie-Actions in<br />
„Horizon 2020“<br />
• Laufzeit: 2014-2020<br />
• Budgetvorschlag: 5,752 Mrd. EUR<br />
Aktionsfelder<br />
• Strukturierte Doktorandenausbildung<br />
(„exzellente Erstausbildung“)<br />
mit länder- und sektorenübergreifender<br />
Mobilität<br />
• Fellowships für grenz- und sektorenübergreifende<br />
Mobilität für erfahrene<br />
Wissenschaftler/innen (Postdoktorand/innen)<br />
• Personalaustausch von qualifiziertem<br />
Forschungspersonal zwischen<br />
Ländern und Sektoren<br />
• Kofinanzierung von nationalen,<br />
regionalen und internationalen<br />
Programmen, die Mobilität von Forschenden<br />
ermöglichen<br />
Deutschland in FP7 (2007-2011)<br />
• 296,5 Mio. EUR wurden an deutsche<br />
Gasteinrichtungen vergeben<br />
„Horizon 2020“: Überblick und<br />
Dokumente<br />
http://ec.europa.eu/research/<br />
horizon2020<br />
Marie Curie Webportal<br />
http://ec.europa.eu/research/<br />
mariecurieactions<br />
Marie Curie in „Horizon 2020“<br />
http://www.kowi.de/mc2020<br />
NKS Mobilität in der Alexander von<br />
Humboldt-Stiftung<br />
http://www.humboldt-foundation.<br />
de/nks/startseite.html
<strong>KoWi</strong> - <strong>Forschungsbrief</strong> Nr. 14 2012<br />
Interview<br />
Die Nachfrage ist ungebrochen<br />
Prof. Dr. Klaus Hulek,<br />
Vizepräsident für Forschung der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover<br />
Welchen Stellenwert hat die Marie<br />
Curie-Förderung an der Leibniz<br />
Universität Hannover?<br />
Wir halten die Beteiligung an den Mobilitätsmaßnahmen<br />
für äußerst wichtig, denn<br />
die Möglichkeit des internationalen Austauschs<br />
auf hohem wissenschaftlichem<br />
Niveau, die die Marie Curie-Projekte<br />
bieten, ist in Europa einmalig. Für die<br />
Universität bietet sich damit die Möglichkeit,<br />
sich europaweit mit wissenschaftlich<br />
ausgewiesenen Partnern zu vernetzen<br />
und so u.a. internationale strukturierte<br />
Promotionsprogramme aufzulegen. Für<br />
promovierte Wissenschaftlerinnen und<br />
Wissenschaftler ist es mit der Individualförderung<br />
zudem in jedem Stadium<br />
ihrer wissenschaftlichen Karriere möglich,<br />
ihre Expertise an den in ihrer Thematik<br />
besten europäischen Universitäten und<br />
Forschungseinrichtungen zu erweitern<br />
und auszubauen. So kommen umgekehrt<br />
auch hervorragende Forschende aus anderen<br />
Ländern über Marie Curie an die<br />
Universität.<br />
Wie sehen Sie die verpflichtende Einbindung<br />
von Industrie in einigen Förderlinien?<br />
An der Leibniz Universität ist ein breites<br />
Fächerspektrum vertreten. Vor diesem<br />
Hintergrund meinen wir, dass die Einbindung<br />
von Industrie in Marie Curie-<br />
Netzwerken nach Fächern differenziert<br />
umgesetzt werden sollte. In Fachgebieten,<br />
die angewandt forschen, stellt die<br />
Einbindung von Industrie einen klaren<br />
Pluspunkt für die Ausbildung der Nachwuchsforschenden<br />
dar. Die Einbindung<br />
spiegelt in diesen Fächern das Spektrum<br />
der zukünftigen Karriereperspektiven<br />
wieder und unterstützt die „Employability“<br />
der Wissenschaftlerinnen und<br />
Wissenschaftler. Auch Maßnahmen wie<br />
z.B. IAPP-Netzwerke begrüßen wir, da<br />
sie intersektorale Mobilität ermöglichen,<br />
© Leibniz Universität Hannover, Kommunikation und Marketing<br />
Prof. Dr. Klaus Hulek<br />
die in dieser Form sonst an der Hochschule<br />
selten stattfindet. Dennoch sollte<br />
es nach unserer Meinung auch in Themenbereichen,<br />
in denen eine Industrieanbindung<br />
nicht sinnvoll ist, in Zukunft<br />
weiterhin die Möglichkeit geben, Marie<br />
Curie-Netzwerke zu beantragen. Bei<br />
Anträgen aus den Geistes- und Sozialwissenschaften<br />
sollte man auch die Option<br />
in Erwägung ziehen, statt Industrie<br />
andere gesellschaftlich wichtige Akteure<br />
in die Netzwerke einzubinden.<br />
Wie beurteilen Sie die vorge schlagene<br />
Mittelausstattung für das Marie-Curie-<br />
Programm in „Horizon 2020“?<br />
Die internationale Mobilität, insbesondere<br />
der Nachwuchswissenschaftlerinnen<br />
und -wissenschaftler, die durch<br />
das Marie Curie-Programm ermöglicht<br />
wird, bildet häufig den Grundstein für<br />
eine nachhaltige europäische Vernetzung<br />
und ist damit ein entscheidender<br />
Baustein für die Verwirklichung des Europäischen<br />
Forschungsraums. Das zurzeit<br />
für „Horizon 2020“ vorgesehene<br />
Budget von ca. 5,8 Mrd. Euro für sieben<br />
Jahre stellt gegenüber dem Marie-Curie-<br />
Budget für das Jahr 2013 (950 Mio. Euro)<br />
leider einen Mittelrückgang dar. Für uns<br />
ist das das falsche Signal. Wir würden<br />
uns eine Mittelausstattung wünschen,<br />
die die Bedeutung des Programms für<br />
Europa widerspiegelt und deshalb keinesfalls<br />
unter der Fortschreibung des<br />
Budgets 2013 liegen sollte.<br />
Was kann getan werden, um die<br />
Attraktivität des Marie Curie- Programms<br />
für Hochschulen ab 2014 noch zu<br />
erhöhen?<br />
Das Marie Curie-Programm ist für Hochschulen<br />
sehr attraktiv, es ist in seiner<br />
Entwicklung durch die Forschungsrahmenprogramme<br />
eine Erfolgsgeschichte.<br />
Das ist auch daran zu erkennen, dass<br />
die Erfolgsquoten selbst für hervorragend<br />
begutachtete Anträge sehr niedrig<br />
ist. Z.B. liegt die Erfolgsquote für<br />
ITN-Anträge zurzeit bei unter 10%, was<br />
auf die starke Nachfrage nach europäischen<br />
Projekten der strukturierten Doktorandenausbildung<br />
hinweist. Gleichzeitig<br />
birgt diese geringe Bewilligungsquote<br />
die Gefahr, dass sich auch gute<br />
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler<br />
aus dieser Programmlinie zurückziehen.<br />
Dies spricht für eine bessere finanzielle<br />
Ausstattung, um die Attraktivität<br />
des Marie Curie-Programms zu erhöhen.<br />
Zudem ist es für die Hochschulen<br />
wichtig, dass die Instrumente des Marie<br />
Curie-Programms früh zeitig bekannt gemacht<br />
werden. Nur so können sich die<br />
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler<br />
strategisch frühzeitig auf eine Antragstellung<br />
vorbereiten und damit konkurrenzfähige<br />
und erfolgreiche Anträge<br />
schreiben. Auch eine hohe Kontinuität<br />
in der Ausgestaltung der Instrumente,<br />
sowohl bezüglich der Antragstellung<br />
als auch der Projektdurchführung, ist<br />
für die Hochschulen wünschenswert.
<strong>KoWi</strong> - <strong>Forschungsbrief</strong> Nr. 14 2012<br />
Beitrag<br />
© privat<br />
Marie Curie braucht mehr Flexibilität<br />
Prof. Dr. Michael Kramer,<br />
Direktor, Max-Planck-Institut für Radioastronomie, Bonn<br />
Prof. Dr. Michael Kramer<br />
Das Marie Curie-Programm bietet seit<br />
mehreren Forschungsrahmenprogrammen<br />
hervorragende Bedingungen, um exzellente<br />
europäische und internationale Forschende<br />
nach Europa zu holen bzw. in<br />
Europa zu halten. Zusätzlich können wir<br />
mit den Marie Curie Outgoing Fellowships<br />
hervorragende Mitarbeiter zu Forschungsund<br />
Weiterbildungszwecken an exzellente<br />
Institute außerhalb Europas mit der Garantie<br />
schicken, dass sie nach spätestens zwei<br />
Jahren wieder zu uns zurückkommen. Ich<br />
persönlich habe lange in England gearbeitet<br />
und schätze an Marie Curie auch<br />
die programmatische Sicherheit: die Regeln<br />
sind in ganz Europa gleich, die Bezahlung<br />
ist gut und es sind Wissenschaftler aller Nationalitäten<br />
gleichermaßen willkommen.<br />
Die Struktur der International Max Planck<br />
Research School (IMPRS) ist wie geschaffen<br />
für eine Verknüpfung mit einer MC Training<br />
Site. In früheren Rahmenprogrammen<br />
haben meine Kollegen Marie Curie sehr<br />
intensiv genutzt, um unser Trainingsangebot<br />
mit dem europäischer Kolleginnen<br />
und Kollegen zu verknüpfen. Durch diese<br />
Synergien konnte das Angebot unserer<br />
IMPRS erweitert werden, die Studierende<br />
mussten sich automatisch vernetzen und<br />
wir konnten auf einen bestehenden Pool<br />
von hervorragend ausgebildeten Wissenschaftlern<br />
zurückgreifen.<br />
Nun in FP7 würden wir unsere IMPRS<br />
wieder europäisch vernetzen, aber das<br />
Muss der Industriebeteiligung ist für uns als<br />
grundlagenorientiertes Forschungsinstitut<br />
im wissenschaftlichen Programm schwer<br />
abbildbar. Es sind zumeist eher Randaspekte<br />
bzw. Serviceleistungen, bei denen<br />
wir Industrie benötigen, für das eigentliche<br />
wissenschaftliche Programm gibt es in unserem<br />
Forschungsgebiet in der Regel keine<br />
direkten Kooperationsmöglichkeiten mit<br />
der Industrie. Dies trifft allerdings nicht generell<br />
auf grundlagenorientierte Forschung<br />
zu. In der MPG gibt es durchaus Institute,<br />
die einen engen wissenschaftlichen Kontakt<br />
mit der Industrie haben.<br />
Viele meiner Kollegen nehmen inzwischen<br />
Abstand von den eigentlich hervorragenden<br />
institutionellen Marie Curie-Förderlinien,<br />
da der Aufwand, um a) ein Projekt<br />
zu definieren, das auch eine Teilnahme<br />
von Industrie ermöglicht und b) ein oder<br />
mehrere Unternehmen zu finden und zur<br />
Teilnahme zu bewegen, den Bewilligungschancen<br />
und den Doktorandenstellen pro<br />
Institut ungleich gegenüber steht. Bei den<br />
aktuellen Bewilligungsquoten muss in der<br />
Regel mit einer zweiten Beantragungsrunde<br />
gerechnet werden, eine Zeit, die in<br />
vielen Fällen zum Verlust der beteiligten<br />
Unternehmen führt, zumeist aufgrund einer<br />
Veränderung der strategischen Ausrichtung.<br />
Eine größere Flexibilität in der Programmausgestaltung<br />
wäre hier aus meiner<br />
Sicht mehr als überfällig.<br />
Die MPG verfolgt Marie Curie seit mehreren<br />
Forschungsrahmenprogrammen.<br />
Viele meiner Kolleginnen und Kollegen<br />
wünschten sich, dass dieses Programm<br />
wieder zu seiner in vielerlei Hinsicht<br />
hervorragenden Gestaltung unter Direktor<br />
Mitsos in FP6 zurückkehrte, in dem<br />
die unterschiedlichen Weiterbildungsund<br />
Kooperationsnotwendigkeiten für<br />
alle wissenschaftlichen Stufen abgebildet<br />
waren: von der Doktorandenausbildung<br />
über die Postdoc-Weiterqualifizierung<br />
bis hin zu einem wissenschaftlichen<br />
Austausch auf Professoren-Ebene.<br />
Auf meiner persönlichen Wunschliste<br />
stehen:<br />
• Wiedereinführung der Marie Curie-<br />
Chairs: Das würde mir ermöglichen, v.a.<br />
Kollegen aus Drittstaaten für mehrere kurze<br />
oder für einen langen Aufenthalt von<br />
3-5 Jahren zwecks wissenschaftlichen<br />
Austauschs und zum Aufbau neuer Partnerschaften<br />
zu uns ans MPI zu holen.<br />
• Verlängerung der Fellowships auf 3 Jahre:<br />
Gerade im experimentellen Bereich ist die<br />
Dauer eines zweijährigen Fellowships zu<br />
kurz, um die Früchte der wissenschaftlichen<br />
Experimente zu ernten. Die Ergebnisse<br />
der Arbeit kommen meist gegen<br />
Ende des Fellowships heraus, so dass ein<br />
bis zwei Jahre benötigt würden, um sie<br />
auszuwerten und zu veröffentlichen.<br />
• Mehr Flexibilität bei der Wahl der Partner<br />
bei institutionellen Projekten: Damit<br />
der Europäische Forschungsraum im<br />
internationalen Wettbewerb nicht den<br />
Anschluss verliert, ist es notwendig, in<br />
allen Forschungsgebieten eine Vernetzung<br />
herzustellen. Die Beteiligung von<br />
Industrie als Projektpartner sollte hierbei<br />
nicht Bedingung sein.<br />
• Weniger Cofund-Programme: Die Vorteile<br />
des Marie Curie-Programms werden<br />
durch die Cofund-Programme ausgehebelt:<br />
zu viele Regelwerke, keine einheitliche<br />
Bezahlung mehr, zu viele unterschiedliche<br />
Programme.<br />
• Einführung einer Dual Career-Variante:<br />
Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass<br />
für immer mehr Forschende neben wissenschaftlicher<br />
Exzellenz und hervorragenden<br />
Arbeitsbedingungen auch eine<br />
große Rolle spielt, dass der Lebenspartner<br />
eine Arbeitsmöglichkeit findet. Das<br />
Marie Curie-Programm sollte daher den<br />
Antragstellern die Möglichkeit eröffnen,<br />
für zwei Forschende gemeinsam einen<br />
Antrag einzureichen.
<strong>KoWi</strong> - <strong>Forschungsbrief</strong> Nr. 14 2012<br />
Interview<br />
© privat<br />
Erfolgsquote von Anträgen erhöhen<br />
Thomas Goergen,<br />
Bayer Technology Services GmbH, Leiter Bayer Working Group Public Funding<br />
Thomas Goergen<br />
Bayer ist an zahlreichen Marie Curie-<br />
Projekten beteiligt. Wie sehen Ihre<br />
Erfahrungen aus?<br />
Im Bereich der Marie Curie-Maßnahmen<br />
interessieren uns hauptsächlich Partnerschaften<br />
zwischen Bayer und Hochschulen<br />
zur Förderung der Mobilität und des<br />
Wissensaustauschs durch Forschungspartnerschaften.<br />
Hierzu nutzen wir die<br />
„Industry-Academia Partnerships and Pathways“<br />
(IAPP) und häufig auch die „Initial<br />
Training Networks“ (ITN).<br />
Zunächst waren einige Anfangshürden<br />
zu überwinden, um das geeignete Setup<br />
zur Einstellung der Fellows zu schaffen,<br />
da hier bei Bayer solche Modelle bislang<br />
nicht abgebildet wurden. Seitdem<br />
ein angepasstes internes Regelwerk und<br />
die dazugehörigen Prozesse etabliert<br />
sind, läuft die Einstellung der Fellows<br />
rund. Bei der Durchführung der Projekte<br />
zeigt sich darüber hinaus, dass die anzusetzenden<br />
pauschalen Zuschüsse für<br />
Fellows, die experimentelle Arbeiten<br />
im industriellen Umfeld durchführen,<br />
deutlich zu gering sind. Damit relativiert<br />
sich allerdings der Anreiz der 100%-Förderung<br />
für die industriellen Partner - es<br />
handelt sich mitnichten um eine Vollfinanzierung.<br />
Mit ihrem Gehalt sind unsere<br />
Marie Curie-Fellows im Übrigen<br />
sehr zufrieden. Ich muss sagen, dass<br />
die Ansätze für Personalkosten bei den<br />
„Early Stage Researchers“ deutlich höher<br />
sind als die üblichen Gehälter von<br />
Doktoranden an deutschen Hochschulen<br />
nach TVöD.<br />
Worin sehen Sie den Mehrwert, den<br />
Industrie und öffentliche Forschung aus<br />
der Zusammenarbeit im Rahmen von<br />
Marie Curie-Projekten erzielen?<br />
Marie Curie-Projekte nutzen wir unter<br />
anderem als ein Mittel, um die Diversität<br />
in unserer Organisation weiter zu erhöhen.<br />
Es ist offensichtlich, dass unser Rekrutierungsprozess<br />
durch das Programm<br />
deutlich unterstützt wird. Über das Instrument<br />
der Entsendungen lernen wir<br />
zudem weitere Persönlichkeiten in unseren<br />
Labors vor Ort kennen. Allerdings<br />
mussten wir feststellen, dass es sich teils<br />
schwierig gestaltete, geeignete Kandidaten<br />
zu finden. Andererseits lernen<br />
wir auch in vielerlei Hinsicht von den<br />
temporären Marie Curie-Kolleginnen<br />
und -Kollegen.<br />
Sind die „European Industrial Doctorates“<br />
ein tragfähiges Model, um Doktoranden<br />
industrienäher auszubilden?<br />
Nach allgemeiner Auffassung genießen<br />
Industriepromotionen in Deutschland<br />
keinen allzu guten Ruf, das gilt sowohl<br />
in Bezug auf künftige Arbeitgeber als<br />
auch für Universitäten. Aus dem Blickwinkel<br />
unseres Unternehmens können<br />
wir das aber nicht bestätigen. Sicherlich<br />
sind derartige Promotionen industrienäher<br />
und möglicherweise weniger<br />
stark grundlagenorientiert als an der<br />
Hochschule. Hinsichtlich der Promotionszeiten<br />
und -ergebnisse sollte es für<br />
die Promovierenden aus unserer Sicht<br />
aber keinen Unterschied machen. Die<br />
Förderlinie könnte helfen, die Akzeptanz<br />
von Industriepromotionen zu steigern.<br />
Dafür ist eine sehr gute fachliche Qualifikation<br />
der Promovierenden sowie<br />
eine gute Kooperation zwischen Hochschule<br />
und dem industriellen Partner<br />
zwingende Voraussetzung.<br />
Sehen Sie Punkte, die verbessert werden<br />
könnten, um die Beteiligung am<br />
Marie Curie-Programm für die Industrie<br />
attraktiver zu gestalten?<br />
Das Programm weiter für Postdoktoranden<br />
zu öffnen und stärker finanziell<br />
zu unterstützen, wäre eine sinnvolle<br />
Maßnahme. Dies könnte insbesondere<br />
auch vor dem Hintergrund der hohen<br />
Arbeitslosigkeit hochqualifizierter junger<br />
Menschen in südeuropäischen Ländern<br />
einen Mehrwert für Europa bieten.<br />
Zudem könnte man einen Mechanismus<br />
etablieren, der die erfolgreichsten<br />
ITN-Projekte weiterführt: Nachdem<br />
die Doktoranden ausgebildet wurden,<br />
könnten in einer direkt anschließenden<br />
nächsten Förderphase die entwickelten<br />
Konzepte gleich im industriellen Umfeld<br />
ausprobiert oder umgesetzt werden.<br />
Dies würde den Praxisnutzen für beide<br />
Seiten zusätzlich erhöhen.<br />
Die Anwendung der „European Charter<br />
for Researchers“ sollte mit Rücksicht auf<br />
die Grenzen der Anwendbarkeit der dort<br />
enthaltenen Forderungen in der industriellen<br />
Praxis sehr behutsam gehandhabt<br />
werden.<br />
Last but not least muss aus meiner Sicht<br />
dringend die durchschnittliche Erfolgsquote<br />
von Anträgen erhöht werden: In<br />
der aktuellen Ausschreibungsrunde der<br />
„Initial Training Networks“ können von<br />
über 1.000 Anträgen nur etwa 100 Projekte<br />
gefördert werden. Das erzeugt bei<br />
den 900 abgelehnten Konsortien Frust<br />
und ist auch volkswirtschaftlich wenig<br />
sinnvoll. Die Europäische Kommission<br />
sollte darüber nachdenken, wie man die<br />
Anzahl der Anträge und das zur Verfügung<br />
stehende Budget in ein angemessenes<br />
Verhältnis bringen kann.
<strong>KoWi</strong> - <strong>Forschungsbrief</strong> Nr. 14 2012<br />
Interview<br />
Bitte Marie Curie nicht kürzen<br />
Dr. Heike Graßmann,<br />
Administrative Geschäftsführerin, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ)<br />
© André Künzelmann / UFZ<br />
Dr. Heike Graßmann<br />
Welchen Stellenwert hat die Marie<br />
Curie-Förderung bei Ihnen am<br />
Helmholtz-Zentrum?<br />
Das Marie Curie-Programm ist für das<br />
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung<br />
(UFZ) eines der wichtigsten Förderprogramme<br />
überhaupt. Es hat für uns eine<br />
sehr große Bedeutung, weil Umweltprobleme<br />
nicht an Grenzen halt machen und<br />
die Forschung dazu sollte dies ebenfalls<br />
nicht tun. Als Helmholtz-Zentrum arbeiten<br />
wir sehr interdisziplinär und schätzen<br />
deshalb besonders, dass dieses Förderprogramm<br />
themenoffen ist, denn nicht<br />
jede gute Idee passt immer in eine der<br />
klassischen Schubladen.<br />
In den letzten Jahren haben sich vor allem<br />
zwei Fördermöglichkeiten als sehr interessant<br />
herausgestellt: Die Initial Training<br />
Networks (ITN) sind inzwischen ein wichtiges<br />
Element, die Qualität der Doktorandenausbildung<br />
zu verbessern. Als UFZ<br />
koordinieren wir drei dieser Netzwerke<br />
(CREAM, CSI-ENVIRONMENT und EDA-<br />
EMERGE), die ein breites Spektrum abbilden,<br />
da nicht nur universitäre und au-<br />
ßeruniversitäre Forschungseinrichtungen<br />
beteilligt sind, sondern auch Behörden<br />
und Industriepartner. Die jungen Wissenschaftlerinnen<br />
und Wissenschaftler<br />
können so Erfahrungen sammeln, die<br />
sie in einer klassischen Ausbildung nie<br />
machen könnten – zumal das Niveau<br />
und das Engagement der beteiligten Partner<br />
exzellent sind. Und einen weiteren<br />
wichtigen Aspekt für die künftige Karriere<br />
haben diese ITNs ebenfalls noch:<br />
Die Nachwuchswissenschaftler/innen<br />
bekommen nicht nur die Karrierewege<br />
in verschiedenen Branchen aufgezeigt,<br />
sondern kennen nach drei Jahren auch<br />
die wichtigsten Leute auf ihrem Gebiet<br />
und sind dadurch bestens vernetzt. Mindestens<br />
genauso wichtig wie die ITNs<br />
sind auch die Fellowships für Postdoktorandinnen<br />
und Postdoktoranden, die<br />
es Gastwissenschaftlern ermöglichen,<br />
zwei Jahre ans UFZ zu kommen oder<br />
unseren Forschenden die Möglichkeit<br />
geben, wichtige Forschungsinstitute im<br />
Ausland zu besuchen. Das Marie Curie-<br />
Förderprogramm ist also nicht nur eine<br />
große Unterstützung für den Nachwuchs,<br />
es hat uns auch sehr geholfen, internationaler<br />
zu werden.<br />
Welchen Mehrwert ziehen Sie aus den<br />
Kooperationen mit der Industrie bzw.<br />
mit Drittstaaten?<br />
Hier sind unsere Erfahrungen gemischt.<br />
Bei den vorhin erwähnten Initial Training<br />
Networks sind Partner aus der Industrie<br />
stets eine große Bereicherung,<br />
da die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler<br />
nicht nur Praxisluft schnuppern<br />
können, sondern auch sehen, wie<br />
ihre Forschung genutzt wird, was ungemein<br />
motivieren kann. Was im großen<br />
Netzwerk sehr gut funktioniert, ist z.B.<br />
bei den Industry- Academia Partnerships<br />
and Pathways (IAPP) mitunter problematisch.<br />
Wenn der Wissenstransfer nur<br />
in eine Richtung verläuft − vom akademischen<br />
Partner zum Industriepartner −<br />
und nicht auch umgedreht, dann profitiert<br />
nur eine Seite davon und die Forschenden<br />
haben wenig davon. Unserer Meinung<br />
nach passt IAPP nicht wirklich in ein<br />
Nachwuchsförderprogramm und wäre in<br />
einem Wirtschaftsförderprogramm besser<br />
aufgehoben.<br />
Wo sehen Sie noch Entwicklungspotentiale<br />
für das Marie Curie-Programm ab<br />
2014?<br />
Aus unserer Sicht sollte es unbedingt erhalten<br />
werden, weil es das einzige Programm<br />
für Nachwuchsförderung in dieser Art ist<br />
und sehr große Chancen für exzellente Forschung<br />
und Ausbildung bietet. Für „Marie<br />
Curie in Horizon 2020“ würden wir anregen,<br />
sich noch mehr auf die Nachwuchsförderung<br />
durch Individualstipendien und<br />
Trainingsnetzwerke zu konzentrieren, die<br />
Industrieförderung dagegen verstärkt in anderen<br />
Programmen fortzusetzen. Eine Bereicherung<br />
für die europäische Forschung<br />
könnte es auch sein, wenn künftig unter den<br />
Drittstaaten auch Industriestaaten sein dürften.<br />
Kooperationen mit solchen Partnern wie<br />
zum Beispiel aus den USA würden den Forschenden<br />
in Europa zu Gute kommen. Alles<br />
in Allem: Bitte Marie Curie nicht kürzen.<br />
Wir alle brauchen exzellent qualifizierten<br />
Nachwuchs, für den dieses Programm eine<br />
ganz wichtige Unterstützung ist.<br />
Impressum<br />
Herausgeber<br />
Kooperationsstelle EU<br />
der Wissenschaftsorganisationen<br />
www.kowi.de<br />
Redaktion<br />
Uwe David<br />
Victoria Llobet<br />
Elena Martins<br />
Grafik und Layout<br />
www.axeptdesign.de