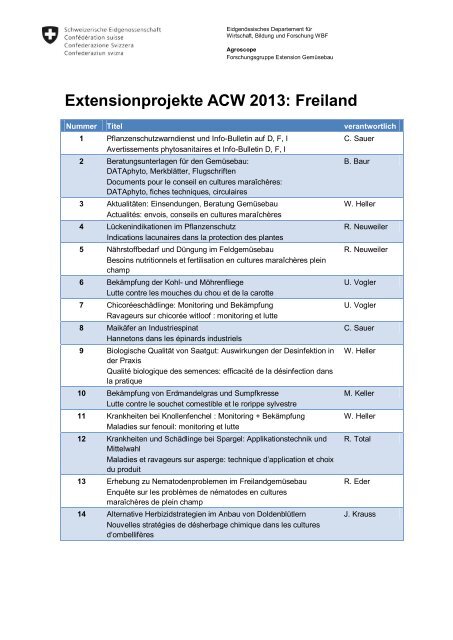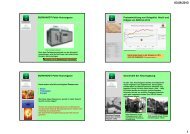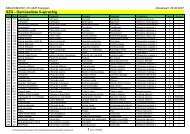Extensionprojekte ACW 2013: Freiland - Agroscope
Extensionprojekte ACW 2013: Freiland - Agroscope
Extensionprojekte ACW 2013: Freiland - Agroscope
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Eidgenössisches Departement für<br />
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF<br />
<strong>Agroscope</strong><br />
Forschungsgruppe Extension Gemüsebau<br />
<strong>Extensionprojekte</strong> <strong>ACW</strong> <strong>2013</strong>: <strong>Freiland</strong><br />
Nummer Titel verantwortlich<br />
1 Pflanzenschutzwarndienst und Info-Bulletin auf D, F, I<br />
Avertissements phytosanitaires et Info-Bulletin D, F, I<br />
2 Beratungsunterlagen für den Gemüsebau:<br />
DATAphyto, Merkblätter, Flugschriften<br />
Documents pour le conseil en cultures maraîchères:<br />
DATAphyto, fiches techniques, circulaires<br />
3 Aktualitäten: Einsendungen, Beratung Gemüsebau<br />
Actualités: envois, conseils en cultures maraîchères<br />
4 Lückenindikationen im Pflanzenschutz<br />
Indications lacunaires dans la protection des plantes<br />
5 Nährstoffbedarf und Düngung im Feldgemüsebau<br />
Besoins nutritionnels et fertilisation en cultures maraîchères plein<br />
champ<br />
6 Bekämpfung der Kohl- und Möhrenfliege<br />
Lutte contre les mouches du chou et de la carotte<br />
7 Chicoréeschädlinge: Monitoring und Bekämpfung<br />
Ravageurs sur chicorée witloof : monitoring et lutte<br />
8 Maikäfer an Industriespinat<br />
Hannetons dans les épinards industriels<br />
9 Biologische Qualität von Saatgut: Auswirkungen der Desinfektion in<br />
der Praxis<br />
Qualité biologique des semences: efficacité de la désinfection dans<br />
la pratique<br />
10 Bekämpfung von Erdmandelgras und Sumpfkresse<br />
Lutte contre le souchet comestible et le rorippe sylvestre<br />
11 Krankheiten bei Knollenfenchel : Monitoring + Bekämpfung<br />
Maladies sur fenouil: monitoring et lutte<br />
12 Krankheiten und Schädlinge bei Spargel: Applikationstechnik und<br />
Mittelwahl<br />
Maladies et ravageurs sur asperge: technique d’application et choix<br />
du produit<br />
13 Erhebung zu Nematodenproblemen im <strong>Freiland</strong>gemüsebau<br />
Enquête sur les problèmes de nématodes en cultures<br />
maraîchères de plein champ<br />
14 Alternative Herbizidstrategien im Anbau von Doldenblütlern<br />
Nouvelles stratégies de désherbage chimique dans les cultures<br />
d‘ombellifères<br />
C. Sauer<br />
B. Baur<br />
W. Heller<br />
R. Neuweiler<br />
R. Neuweiler<br />
U. Vogler<br />
U. Vogler<br />
C. Sauer<br />
W. Heller<br />
M. Keller<br />
W. Heller<br />
R. Total<br />
R. Eder<br />
J. Krauss
Eidgenössisches Departement für<br />
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF<br />
<strong>Agroscope</strong><br />
Kontaktperson : Sauer Cornelia<br />
Wädenswil<br />
Projektnummer: <strong>2013</strong> / 1 Projektdauer Projektbeginn Projektende<br />
permanent<br />
Pflanzenschutzwarndienst und Info-Bulletin auf D, F, I<br />
Problemstellung<br />
Der Gemüsebauwarndienst wird in Zeiten des Klimawandels immer wichtiger. Es verschiebt sich die<br />
Hauptaktivität bestimmter Schadorganismen zeitlich innerhalb der Sai son, einzelne Arten dehnen sich<br />
auf neue Kulturen aus und es etablieren sich vermehrt wärmeliebendere Schaderreger bei uns.<br />
Ziele <strong>2013</strong><br />
Das Informationsangebot soll in der Romandie und im Tessin durch Feldbeobachtungen und Fallenkontrollen<br />
aufrecht erhalten und nach Möglichkeit weiter ausgebaut werden. <strong>Agroscope</strong> schult und<br />
unterstützt die Partner bei der Überwachung und Bestimmung von Schaderregern. Damit wird die<br />
Erhaltung eines akutellen Netzwerkes angestrebt.<br />
Die Bulletins liefern während der Anbausaison wöchentlich Informationen zum aktuellen Stand der<br />
Schädlings- und Krankheitssituation in den Kulturen, insbesondere zum Erstauftreten von Schlüssel -<br />
organismen in den drei Landesteilen. Regelmässige Informationen über Änderungen bei der<br />
Zulassungssituation von Pflanzenschutzmitteln sind integriert.<br />
Bisher in Projekt erarbeitet (falls mehrjähriges Projekt)<br />
Basis für die Arbeiten <strong>2013</strong> sind die Gemüsebau Infos des Jahres 2012. Das Monitoring des<br />
Möhrenblattflohs wird fortgesetzt. Neu wird in der Deutschschweiz die Spargelfliege überwacht.<br />
Schätzung Arbeitszeiten <strong>2013</strong> (in Arbeitstagen aller Projekt Mitarbeitenden): 180<br />
Externe Zusammenarbeit:<br />
Kantonale Fachstellen für Gemüsebau und weitere Partner, FiBL, 2 -3 Gemüsebaubetriebe im Raum<br />
Zürich-Aargau (Feldkontrollen durch <strong>Agroscope</strong>), Betriebe im Tessin und in der Romandie<br />
Bemerkungen zum Arbeitsvorgang:<br />
Die Gemüsebauinfo erscheint vorausssichtlich im üblichen Rhythmus mit bewährtem Informationsgehalt.<br />
Der Arbeitsaufwand ergibt sich durch die Ausweitung der Überwachung auf drei Landesteile<br />
und die Übersetzungsarbeiten, die zur Hälfte durch das <strong>Agroscope</strong>-Team intern geleistet werden.<br />
<strong>Extensionprojekte</strong> <strong>2013</strong> Gemüsebau <strong>Freiland</strong>
Eidgenössisches Departement für<br />
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF<br />
<strong>Agroscope</strong><br />
Kontaktperson : Baur Brigitte<br />
Wädenswil<br />
Projektnummer: <strong>2013</strong> / 2 Projektdauer Projektbeginn Projektende<br />
permanent<br />
Beratungsunterlagen für den Gemüsebau:<br />
DATAphyto, Merkblätter, Flugschriften<br />
Problemstellung<br />
<strong>ACW</strong> publiziert regelmässig Empfehlungen und Beratungsunterlagen in Form von Merkblättern und<br />
Broschüren. Sie werden an Veranstaltungen in Papierform, ansonsten als pdf auf der Website von<br />
<strong>Agroscope</strong> zur Verfügung gestellt. Diese Informationen werden von Gemüseproduzenten, Beratern<br />
und Ausbildnern verwendet.<br />
Die Bewilligungssituation für die Pflanzenschutzmittel im Gemüsebau verändert sich laufend. Deshalb<br />
ist es wichtig, dass der Praxis aktuelle Informationen zu diesem Thema zur Verfügung stehen.<br />
DATAphyto (www.dataphyto.agroscope.ch), die Datenbank für Pflanzenschutzmittel im Gemüsebau,<br />
bietet die Möglichkeit, sich über die aktuelle Bewilligungsituation ins Bild zu setzen. Sowohl online-<br />
Suchen als auch der Ausdruck der jeweils aktuellen Bewilligungssituation für einzelne Gemüsearten<br />
ist möglich.<br />
Ziele <strong>2013</strong><br />
Der Gemüsebaupraxis stehen weiterhin aktuelle Beratungsunterlagen zur Verfügung, wenn immer<br />
möglich in deutsch und französisch, teilweise auch in italienisch. Die existierenden Pflanzenschutzempfehlungen<br />
für Herbizide werden aktualisiert. Geplant sind neue Informationsschriften zu Themen<br />
wie Dreschstaubschäden auf Salat, Bekämpfung von Erdmandelgras, Schwefel- und Phosphordüngung<br />
und Mäusebekämpfung.<br />
Mindestens 2mal jährlich wird in „der Gemüsebau“ auf neue und aktuelle Beratungsunterlagen hingewiesen.<br />
DATAphyto wird laufend aktualisiert (Erfassung neuer, Löschung zurückgezogener und Anpassung<br />
bestehender Bewilligungen). Daneben wird in der GBI periodisch über Änderungen in der Bewilligungssituation<br />
informiert.<br />
Bisher in Projekt erarbeitet (falls mehrjähriges Projekt)<br />
DATAphyto ist als praxisorientierte Informationsquelle für den Pflanzenschutzmitteleinsatz im<br />
Gemüsebau etabliert.<br />
Unter http://www.gemuesebau.agroscope.ch resp. http://www.cultures-maraicheres.agroscope.ch werden die<br />
Beratungsunterlagen für Gemüsebauern übersichtlich angeboten. Entsprechend der Bedürfnisse der<br />
Praxis wurden laufend neue Informationsschriften herausgegeben und in der GBI und in „Der<br />
Gemüsebau“ darauf aufmerksam gemacht.<br />
Schätzung Arbeitszeiten <strong>2013</strong> (in Arbeitstagen aller Projekt Mitarbeitenden): 80<br />
<strong>Extensionprojekte</strong> <strong>2013</strong> Gemüsebau <strong>Freiland</strong>
Eidgenössisches Departement für<br />
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF<br />
<strong>Agroscope</strong><br />
Kontaktperson : Heller Werner<br />
Wädenswil<br />
Projektnummer: <strong>2013</strong> / 3 Projektdauer Projektbeginn Projektende<br />
permanent<br />
Aktualitäten: Einsendungen, Beratung Gemüsebau<br />
Problemstellung<br />
Berater und Produzenten sind darauf angewiesen, auftretende Schaderreger und Pathogene zuverlässig<br />
erkennen zu können, um die Rahmenbedingungen der PSM-Gesetzgebung nicht zu verletzen.<br />
Wenn die Eigendiagnose nicht möglich ist, namentlich bei seltenen oder neuen Schaderregern, muss<br />
die Möglichkeit bestehen, eine unabhängige, zuverlässige Diagnose erstellen zu lassen.<br />
Korrekterweise nehmen Produzenten oder Berater bei Problemen zuerst mit den regionalen oder<br />
kantonalen Fachstellen Kontakt auf. Bei Bedarf empfehlen diese, Material zur Diagnose an die<br />
<strong>Agroscope</strong> <strong>ACW</strong> zu senden, oder sie tun dies gleich selbst.<br />
Ziele <strong>2013</strong><br />
1. Die Schweizer Gemüsebranche erhält beim Auftreten von unbekannten Schaderregern frist -<br />
gerecht Diagnosen und Empfehlungen zur Lösung der Probleme.<br />
2. Entsprechend der notwendigen Diagnosemethoden werden in mindestens 80% der Fälle innerhalb<br />
von 24 bis 48 Stunden nach dem Eingang von Mustern an der <strong>ACW</strong> die Untersuchungsberichte<br />
inkl. Interpretation an die Einsender übermittelt.<br />
3. Probleme, Diagnosen, Einsender und Aufwand werden bei <strong>ACW</strong> datenbankmässig erfasst und so<br />
ausgewertet, dass Rückschlüsse auf wichtige neu auftretende Probleme gezogen werden können.<br />
4. Das Monitoring der Verbreitung des Echten Mehltaus von Paprika (Leveillula taurica) in<br />
Zusammenarbeit mit den regionalen Beratungsstellen wird weitergeführt. Der Pilz ist in der<br />
Schweiz bereits aufgetreten. Er kann neben Paprika auch Tomaten befallen. Die Verantwortung<br />
für dieses Monitoring liegt bei <strong>ACW</strong> Conthey.<br />
Bisher in Projekt erarbeitet (falls mehrjähriges Projekt)<br />
Die Diagnostik-Dienstleistung des Extension-Teams Gemüsebau und der Fachleute in Conthey wird<br />
jährlich in über 200 Fällen beansprucht. Erkenntnisse aus der Diagnostik über das Auftreten von<br />
Schlüsselschädlingen oder -krankheiten fliessen in den Warndienst ein.<br />
Schätzung Arbeitszeiten <strong>2013</strong> (in Arbeitstagen aller Projekt Mitarbeitenden): 85<br />
Externe Zusammenarbeit:<br />
Kantonale und regionale Fachstellen Gemüsebau, Firmenberatung<br />
Bemerkungen zum Arbeitsvorgang:<br />
Diagnosen zu Schaderregern bei den Fruchtgemüsekulturen im Gewächshaus werden im <strong>ACW</strong><br />
Zentrum Conthey erstellt,Clavibacter Diagnosen im Speziallabor in Wädenswil.<br />
<strong>Extensionprojekte</strong> <strong>2013</strong> Gemüsebau <strong>Freiland</strong>
Eidgenössisches Departement für<br />
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF<br />
<strong>Agroscope</strong><br />
Kontaktperson : Neuweiler Reto<br />
Wädenswil<br />
Projektnummer: <strong>2013</strong> / 4 Projektdauer Projektbeginn Projektende<br />
permanent<br />
Lückenindikationen im Pflanzenschutz<br />
Problemstellung<br />
Bei einigen Gemüsearten fehlen nach wie vor bewilligte Pflanzenschutzmittel zur Entschärfung von<br />
auftretenden Pflanzenschutzproblemen. Für Kleinkulturen (minor crops) sieht die Pflanzenschutzmittelverordnung<br />
grundsätzlich ein erleichtertes Zulassungsverfahren vor, falls in der EU eine<br />
entsprechende Bewilligung bereits besteht und das betreffende Pflanzenschutzmittel in der Schweiz<br />
bei anderen Kulturen zugelassen ist. <strong>ACW</strong> trägt bei Bedarf mit eigenen Resultaten aus den mit den<br />
zuständigen Firmen abgesprochenen Versuchen aktiv zur Schliessung von Indikationslücken bei.<br />
Im Rahmen der Umfrage 2012 des Forum Forschung Gemüse wurden wieder diverse Pflanzenschutzprobleme<br />
zusammengetragen. Die Zusammenlegung ähnlich gelagerter Anträge ergibt für <strong>2013</strong> 54<br />
bearbeitbare Indikationslücken. Bei 29 kann auf rein administrativem Wege auf eine Lösung<br />
hingearbeitet werden. In 25 Fällen sind ergänzende Wirksamkeitsversuche erforderlich, wovon in 17<br />
Fällen zusätzlich noch Rückstandsstudien erarbeitet werden müssten.<br />
Ziele <strong>2013</strong><br />
1.) Bei Lücken, die sich rein administrativ schliessen lassen, werden zuhanden des VSGP<br />
Informationen und Unterlagen zur aktuellen Situation im In- und Ausland beschafft. Der VSGP<br />
kontaktiert die betreffenden Schweizer Firmen und versucht diese zur Einreichung der Bewilligungsgesuche<br />
zu motivieren.<br />
2.) Zu den von <strong>ACW</strong> in eigenen Versuchen bearbeiteten Indikationslücken werden dem BLW bzw. den<br />
betreffenden PSM-Firmen die ausformulierten Anträge sowie die Versuchsberichte zur Verfügung<br />
gestellt.<br />
3.) Zu Lücken, bei denen die Wirksamkeit bereits abgeklärt ist, jedoch noch Rückstandsstudien<br />
erforderlich sind, wird eine Abschätzung der damit verbundenen Kosten vorgenommen. Bei Lückenindikationen,<br />
die von der SAGÖL als prioritär eingestuft werden, können die erforderlichen<br />
Rückstandsanalysen ab <strong>2013</strong> neu aus dem vom VSGP geäufneten Fonds mitfinanziert werden.<br />
4.)Wo auch noch Versuchsdaten zur Wirkung erforderlich sind, wird abgeklärt, wie weit diese von<br />
ausländischen Versuchsanlegern übernommen werden können. Im übrigen sind bei hoch priorisierten<br />
Lückenindikationen <strong>ACW</strong>-eigene Wirksamkeitsversuche anzulegen. Es werden prioritär Wirkstoffe<br />
geprüft, bei denen sich der Kostenaufwand für Rückstandsanalysen in Grenzen hält.<br />
Es handelt sich um einen kontinuierlichen Prozess, der im Einzelfall unter Umständen eine mehrjäh -<br />
rige Bearbeitung erfordert. 2012 konnten 10 Indikationslücken erfolgreich geschlossen werden. In 9<br />
Fällen erfolgten die notwendigen Abklärungen und Absprachen mit den Produkteinhaberfirmen, so<br />
dass diese ein Bewilligungsgesuch einreichen konnten.<br />
Schätzung Arbeitszeiten <strong>2013</strong> (in Arbeitstagen aller Projekt Mitarbeitenden): 180<br />
Externe Zusammenarbeit:<br />
BLW (Sektion Pflanzenschutzmittel)<br />
Arbeitskreis Lückenindikationen Deutschland (I. Koch, DLR Rheinpfalz)<br />
Bemerkungen zum Arbeitsvorgang:<br />
Zu verschiedenen offenen Pflanzenschutzproblemen, die eine vertiefte Bearbeitung erfordern werden,<br />
wurden eigenstädnige <strong>Extensionprojekte</strong> ausformuliert.<br />
<strong>Extensionprojekte</strong> <strong>2013</strong> Gemüsebau <strong>Freiland</strong>
Eidgenössisches Departement für<br />
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF<br />
<strong>Agroscope</strong><br />
Kontaktperson : Neuweiler Reto<br />
Wädenswil<br />
Projektnummer: <strong>2013</strong> / 5 Projektdauer Projektbeginn Projektende<br />
permanent<br />
Nährstoffbedarf und Düngung im Feldgemüsebau<br />
Problemstellung<br />
a.) Im Gemüsebau steht der Komposteinsatz zur Verbesserung der Bodenstruktur und zur Fördung<br />
von allfälligen Antagonisten gegen bodenbürtige Krankheitserreger zur Diskussion. In den beiden<br />
2011 von <strong>ACW</strong> am Standort Wädenswil angelegten Langzeitversuchen zu diesem Thema sollen <strong>2013</strong><br />
auf den entsprechenden Flächen erstmals gemüsebauliche Versuchskulturen zur Beurteilung der<br />
Wirkung des wiederholten Komposteinsatzes nachgebaut werden.<br />
b.) Bei schwefelbedürftigen Gemüsearten treten insbesondere im Frühanbau häufig Mangelsymptome<br />
auf. Auch Phosphor ist bei nasskalten Bodenbedingung bei einzelnen Gemüsearten in ungenügendem<br />
Masse pflanzenverfügbar, obwohl in den meisten Böden beachtliche P -Reserven vorhanden sind.<br />
c.) Der erwerbsmässige Anbau von Knoblauch hat in der Schweiz flächenmässig zugenommen. Aus<br />
diesem Grund stellt sich im Zuammenhang mit Suisse-Bilanz die Frage nach der einzusetzenden<br />
Düngernorm. Im Anbau von Salaten für die Convenience-Produktion werden deutlich höhere Erträge<br />
erzielt, als sie den bestehden Düngungsrichtlinien zugrunde liegen. Es ist abzuklären, ob für Salatkulturen<br />
mit hoher Ertragsleistung eine Anpassung der Düngungsnorm vertretbar ist.<br />
Ziele <strong>2013</strong><br />
a.) Am Beispiel von Zwiebeln und Kohlarten wird untersucht, wie weit sich der wiederholte Einsatz<br />
von gut verrottetem Kompost positiv auf die Kulturentwicklung und vorbeugend gegen das Auftreten<br />
von bodenbürtigen Krankheitserregern auswirkt. Der dafür betriebene Aufwand wird in Grenzen<br />
gehalten.<br />
b.) Für die Gemüsebaupraxis soll auf der Basis der Versuchserfahrungen von <strong>ACW</strong> ein Merkblatt zu m<br />
Thema Schwefel- und Phosphordüngung erstellt werden, welches Massnahmen zur Optimierung der<br />
Versorgung von Gemüsekulturen mit diesen Nährstoffen aufzeigt.<br />
c.) Bei Knoblauch werden Tastversuche zur Grobabklärung der Nährstoffbedürfnisse angelegt.<br />
Aufgrund der von <strong>ACW</strong> gesammelten Fachliteratur und von ausländischen Düngungsempfehlungen<br />
entscheidet das Bundesamt für Landwirtschaft, ob eine Anpassung der N-Norm für Salatkulturen mit<br />
erhöhten Ertragsleistungen realistisch ist.<br />
Bisher in Projekt erarbeitet (falls mehrjähriges Projekt)<br />
Bisher bei Salat durchgeführte Untersuchungen zur N-Düngung zeigen, dass je nach Salattyp bei<br />
höheren, über die bestehende Düngungsnorm hinaus gehende N-Stufen tendenziell höhere<br />
Frischerträge erzielt werden. Dabei nimmt das Risiko des Auftretens von Innenbrand zu.<br />
Schätzung Arbeitszeiten <strong>2013</strong> (in Arbeitstagen aller Projekt Mitarbeitenden): 40<br />
Externe Zusammenarbeit:<br />
VSGP, diverse kantonale Fachstellen<br />
Bemerkungen zum Arbeitsvorgang:<br />
Der für dieses Projekt erbrachte Arbeitsaufwand wird <strong>2013</strong> zugunsten von <strong>Extensionprojekte</strong>n mit<br />
erhöhter Praxisrelevanz (Bsp. Lückenindikationen) bewusst in Grenz en gehalten.<br />
<strong>Extensionprojekte</strong> <strong>2013</strong> Gemüsebau <strong>Freiland</strong>
Eidgenössisches Departement für<br />
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF<br />
<strong>Agroscope</strong><br />
Kontaktperson : Vogler Ute<br />
<strong>ACW</strong> Wädenswil<br />
Projektnummer: <strong>2013</strong> / 6 Projektdauer Projektbeginn Projektende<br />
2005 offen<br />
Bekämpfung der Kohl- und Möhrenfliege<br />
Problemstellung<br />
Die auf Grund ihres Entwicklungszyklus schwer bekämpfbaren Schädlinge Kohlfliege Delia radicum<br />
und Möhrenfliege Psila rosae gehören im Schweizer Gemüsebau zu den wichtigsten Schädlingen.<br />
Durch Änderungen in der Bewilligungssituation von Insektiziden sind diverse Wirkstoffe weggefallen,<br />
die bisher in der Bekämpfung eingesetzt werden konnten. Die Möglichkeit verschiedene Wirkstoffe in<br />
Versuchen zu testen, wird geprüft.<br />
Ziele <strong>2013</strong><br />
1. Kohlfliege: In rauhblättrigen Kohlarten wie Chinakohl sollen Wirkstoffe zur Blattapplikation im<br />
Kampf gegen die Kohlfliege getestet werden. Die Versuche werden im Rahmen einer Bachelorarbeit<br />
durchgeführt. Die Ergebnisse sollen wegweisend sein für weitere mögliche Feldversuche<br />
und, je nach Möglichkeit und Realisierbarkeit, den Bewilligungsprozess unterstützen.<br />
Möglichkeiten zur administrativen Schliessung allfälliger Indikationslücken zur Bekämpfung der<br />
Kohlfliege werden geprüft.<br />
2. Möhrenfliege: Abklärungen von weiteren Möglichkeiten zur Bekämpfung der Möhrenfliege.<br />
Möglichkeiten zur administrativen Schliessung allfälliger Indikationslücken zur Bekämpfung der<br />
Möhrenfliege werden geprüft.<br />
Bisher in Projekt erarbeitet (falls mehrjähriges Projekt)<br />
2012 wurde der aktuelle Kenntnisstand aus Versuchstätigkeit und Literaturrecherche zu Kohl - und<br />
Möhrenfliege zusammengefasst und schriftlich in der GBI publiziert und an Tagungen kommuniziert .<br />
Schätzung Arbeitszeiten <strong>2013</strong> (in Arbeitstagen aller Projekt Mitarbeitenden): 80<br />
Externe Zusammenarbeit:<br />
Versorgung mit Kohlfliegenpuppen zur künstlichen Infektion durch das Julius Kühn Institut<br />
(Deutschland) / Dr. Martin Hommes.<br />
<strong>Extensionprojekte</strong> <strong>2013</strong> Gemüsebau <strong>Freiland</strong>
Eidgenössisches Departement für<br />
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF<br />
<strong>Agroscope</strong><br />
Kontaktperson : Vogler Ute<br />
Wädenswil<br />
Projektnummer: <strong>2013</strong> / 7 Projektdauer Projektbeginn Projektende<br />
<strong>2013</strong><br />
Chicoréeschädlinge: Monitoring und Bekämpfung<br />
Problemstellung<br />
Auftreten verschiedener Arthropoden in der Chicoréekultur und auf dem Erntegut.<br />
1. In der Chicorée-Treiberei treten sowohl in der Deutsch- wie auch in der Westschweiz bodenbürtige<br />
Raubmilben an den Chicorée-Zapfen auf.<br />
2. In der Chicorée-Wurzelproduktion treten in der deutschen Schweiz vermehrt Chicorée-Minierfliegen<br />
auf.<br />
Aktuell gibt es weder für bodenbürtige Raubmilben auf den Chicorée-Zapfen in der Treiberei, noch für<br />
Chicoréeminierfliegen im Feld bei der Wurzelproduktion geeignete und bewilligte Bekämpfungs -<br />
massnahmen.<br />
Ziele <strong>2013</strong><br />
1. Chicorée in der Treiberei / bodenbürtige Raubmilben auf Chicorée-Zapfen: In Absprache mit<br />
Produzenten und den kantonalen Fachstellen für Gemüsebau werden Wirksamkeitsversuche und<br />
Rückstandsanalysen durchgeführt.<br />
2. Chicorée-Wurzelproduktion / Chicoréeminierfliege: In der deutschen Schweiz wird ein Monitoringnetz<br />
aufgebaut, basierend auf den Erfahrungen in der Westschweiz. Abklärung möglicher<br />
Bekämpfungsmassnahmen.<br />
Bisher in Projekt erarbeitet (falls mehrjähriges Projekt)<br />
1. Mit den Produzenten wurde die Problematik und die aktuelle Situation diskutiert. 2011/12 wurden<br />
die Milben durch C. Linder (<strong>ACW</strong>, Changins) identifiziert. Es erfolgten Feldbegehungen und<br />
Probennahmen im Feld, um den Ausgangsbefall und die Herkunft der bodenbürtigen Raubmilben<br />
abzuklären.<br />
Schätzung Arbeitszeiten <strong>2013</strong> (in Arbeitstagen aller Projekt Mitarbeitenden): 40<br />
(ohne Berücksichtigung der Leistung der Mitarbeiter der kant. Fachstellen für Gemüsebau und <strong>ACW</strong>-<br />
Changins)<br />
Zusammenarbeit<br />
Zusammenarbeit mit Serge Fischer und Einbezug weiterer Kollegen von <strong>ACW</strong> .<br />
Zusammenarbeit mit den kantonalen Fachstellen für Gemüsebau Thurgau (Arenenberg) und OTM (Kt. VD) sowie<br />
mit von den kantonalen Fachstellen für Gemüsebau empfohlenen Betrieben.<br />
<strong>Extensionprojekte</strong> <strong>2013</strong> Gemüsebau <strong>Freiland</strong>
Eidgenössisches Departement für<br />
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF<br />
<strong>Agroscope</strong><br />
Kontaktperson : Sauer Cornelia<br />
<strong>ACW</strong> Wädenswil<br />
Projektnummer: <strong>2013</strong> / 8 Projektdauer Projektbeginn Projektende<br />
3 Jahre 2011 <strong>2013</strong><br />
Maikäfer an Industriespinat<br />
Problemstellung<br />
Maikäfer halten sich im Spinat auf. Sie werden mit dem Erntegut in die Fabrik transportiert. In der<br />
Verarbeitung können sie ungenügend lokalisiert und entfernt werden. Dies führt zu Fremdbesatz im<br />
Endprodukt und zu Kundenreklamationen.<br />
Ziele <strong>2013</strong><br />
Weiterführen des Projektes über die Dauer der Käfergeneration.<br />
Warnprognosen entwickeln.<br />
Käfer von Spinatkulturen fernhalten oder aus dem Erntegut entfernen .<br />
Schätzung Arbeitszeiten <strong>2013</strong> (in Arbeitstagen aller Projekt Mitarbeitenden): 40<br />
Externe Zusammenarbeit:<br />
Firmen der SCFA, Produzentenvereinigung/ Fachstelle St. Galler Rheintal<br />
<strong>Extensionprojekte</strong> <strong>2013</strong> Gemüsebau <strong>Freiland</strong>
Eidgenössisches Departement für<br />
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF<br />
<strong>Agroscope</strong><br />
Kontaktperson : Heller Werner<br />
Wädenswil<br />
Projektnummer: <strong>2013</strong> / 9 Projektdauer Projektbeginn Projektende<br />
5 Jahre 2009 <strong>2013</strong><br />
Biologische Qualität von Saatgut:<br />
Auswirkungen der Desinfektion in der Praxis<br />
Problemstellung<br />
Es ist bekannt, dass die biologische Qualität von Gemüse-Saatgut den Anforderungen der Praxis oft<br />
nicht genügt. Immer wieder treten grosse Verluste verursacht durch samenbürtige Krankheitserreger<br />
auf. Sie müssen mit hohem Aufwand an Arbeit, Applikationstechnik und Pflanzenschutzmitteln<br />
bekämpft werden, um eine qualitativ und quantitativ genügende Produktion zu sichern. In der Swiss -<br />
Garantie Produktion und vor allem auch in der Bio-Produktion kommt der Pathogen-Freiheit des<br />
Saatgutes höchste Priorität zu.<br />
Ziele <strong>2013</strong><br />
1. Prüfung der Desinfektion von Gemüsesaatgut mit belüftetem Dampf unter Gewächshausbedingungen<br />
an Petersilie und Fenchel, wobei der Falsche Mehltau (Plasmopara spp.) bei beiden<br />
Kulturen im Zentrum des Interesses steht.<br />
2. <strong>Agroscope</strong>-Feldversuch mit desinfiziertem und nicht desinfiziertem Zwiebelsaatgut ausgesuchter<br />
Sorten.<br />
3. An den Tagen der Offenen Tür <strong>2013</strong> von <strong>Agroscope</strong> soll die Desinfektion von Küchenkräuter-<br />
Samen demonstriert werden. Die Demonstration der Wirkung in vitro und in vivo ist vorgesehen .<br />
Fälle von verseuchten Saatgutposten aus der Praxis und daraus resultierende Schäden sollen<br />
dokumentiert und an die Saatgutlieferanten geleitet werden, um Druck zu erzeugen, damit in der<br />
Saatgutproduktion bessere Qualitätsstandards eingeführt werden.<br />
Bisher in Projekt erarbeitet (falls mehrjähriges Projekt)<br />
Untersuchungen bei Saatgut von Karotten, Nüsslisalat und Basilikum haben gezeigt, dass bei<br />
unbehandelten Samen durch eine Desinfektion mit belüftetem Dampf die Verseuchung durch<br />
Pathogene um über 99 % reduziert werden kann. Es wurden optimale Desinfektionsbedingungen für<br />
Saatgut von Karotten, Spinat, Kresse, Zwiebeln, Spargel, Lauch, Basilikum, Krautstiel und Nüsslisalat<br />
mit belüftetem Dampf entwickelt und erfolgreich in der Feldprüfung getestet. Der Desinfektionserfolg<br />
bei Spinat und Krautstiel war stark sortenabhängig.<br />
Schätzung Arbeitszeiten <strong>2013</strong> (in Arbeitstagen aller Projekt Mitarbeitenden): 80<br />
Externe Zusammenarbeit:<br />
Sativa, Hilcona, Samen Schweizer<br />
Bemerkungen zum Arbeitsvorgang:<br />
Die Desinfektion des Saatgutes wird von <strong>ACW</strong> durchgeführt und dokumentiert. Der Anbau der<br />
Kulturen erfolgt durch <strong>ACW</strong> im <strong>Freiland</strong> und im Gewächshaus.<br />
<strong>Extensionprojekte</strong> <strong>2013</strong> Gemüsebau <strong>Freiland</strong>
Eidgenössisches Departement für<br />
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF<br />
<strong>Agroscope</strong><br />
Kontaktperson : Keller Martina<br />
Wädenswil<br />
Projektnummer: <strong>2013</strong> / 10 Projektdauer Projektbeginn Projektende<br />
langfristig 2011 offen<br />
Bekämpfung von Erdmandelgras und Sumpfkresse<br />
Problemstellung<br />
Das Erdmandelgras hat sich in jüngster Zeit auch auf Flächen, auf denen Gemüsekulturen im Frucht -<br />
wechsel mit Ackerfrüchten angebaut werden, weiter ausgebreitet. Die Früherkennung und vollständige<br />
Eliminierung von neuen Primärherden sind von grosser Bedeutung, damit dieses Problemunkraut<br />
nicht ausser Kontrolle gerät.<br />
Eine direkte Bekämpfung ist in Gemüsekulturen aufgrund ihrer geringen Konkurrenzkraft und des<br />
Fehlens von ausreichend wirksamen, kulturverträglichen Herbiziden kaum realistisch. Nach den<br />
bisherigen Erfahrungen ist eine Sanierung von befallenen Flächen bei häufigerem Anbau der relativ<br />
herbizidtoleranten Kultur Mais bzw. durch das vorübergehende Brachlegen der Flächen am ehesten<br />
möglich. Verschiedene im Maisanbau bereits bewilligte Herbizide weisen eine recht gute Wirkung<br />
gegen das Erdmandelgras auf. Dabei ist entscheidend, dass der Herbzideinsatz in frühen<br />
Entwicklungsstadien des Erdmandelgrases und im Split-Verfahren erfolgt. Ziel ist nicht nur eine<br />
ausreichende Unkrautkontrolle im Mais, sondern vor allem die Unterbindung der Knöllchenbildung des<br />
Ermandelgrases.<br />
In Versuchen von <strong>Agroscope</strong> wurde eine Wirkstoffkombination gefunden, welche Sumpfkressebestände<br />
nachhaltig bekämpft. Es muss auf eine entsprechende Bewilligung hin gearbeitet werden.<br />
Ziele <strong>2013</strong><br />
Beratungsunterlagen zur Erkennung, Verhinderung der Ausbreitung und Bekämpfung des Erdmandel -<br />
grases sollen möglichst breit gestreut werden. Die aktuellen Versuchserfahrungen zur Bekämpfung<br />
werden in Form von Praxisbeiträgen in landwirtschaftlichen und gemüsebaulichen Zeitschriften<br />
bekannt gemacht.<br />
In weiteren Versuchen sollen die erfolgreichsten Bekämpfungsmassnahmen in Mais der Versuchsjahre<br />
2011 und 2012 optimiert werden mit dem Endziel eine Strategie zur Sanierung von stark<br />
befallenen Flächen zu erarbeiten.<br />
Prüfung von weiteren, in der Schweiz noch neuen Herbiziden auf ihre Wirksamkeit gegenüber dem<br />
Erdmandelgras. Dabei soll auf die offizielle Bewilligung von zusätzlichen wirksamen Herbiziden hin<br />
gearbeitet werden.<br />
Fortführung der Versuche mit Bodendämpfung zur Entseuchung von Flächen mit Primärherden.<br />
Neubewilligung eines gegen die Sumpfkresse wirksamen Herbizides für gemüsebauliche Bracheflächen.<br />
Ergänzende Untersuchungen zur Beantwortung der Frage des Nachbaus.<br />
Bisher in Projekt erarbeitet (falls mehrjähriges Projekt)<br />
Merkblatt zur Erkennung, Verhinderung der Ausbreitung und Bekämpfung des Erdmandelgrases.<br />
Zahlreiche Praxisbeiträge in Fachzeitschriften. Zweijährige Versuchserfahrungen zur Sanierung von<br />
stark mit Erdmandelgras befallenen Flächen. Einjährige Versuchserfahrung zur Bekämpfung von<br />
Primärherden mit Bodendämpfung.<br />
Die Wirksamkeit von verschiedenen Herbiziden gegen die Waldsumpfkresse wurde geprüft.<br />
Schätzung Arbeitszeiten <strong>2013</strong> (in Arbeitstagen aller Projekt Mitarbeitenden): 85<br />
Externe Zusammenarbeit:<br />
Enge Zusammenarbeit mit den Fachleuten der Fachgruppe „Herbologie im Feldbau“ von <strong>ACW</strong> (Judith<br />
Wirth und Christian Bohren) sowie mit diversen kantonalen Fachstellen und Agridea.<br />
<strong>Extensionprojekte</strong> <strong>2013</strong> Gemüsebau <strong>Freiland</strong>
Eidgenössisches Departement für<br />
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF<br />
<strong>Agroscope</strong><br />
Kontaktperson : Heller Werner<br />
Wädenswil<br />
Projektnummer: <strong>2013</strong> / 11 Projektdauer Projektbeginn Projektende<br />
1 Jahr <strong>2013</strong> 2014<br />
Krankheiten bei Knollenfenchel: Monitoring und Bekämpfung<br />
Problemstellung<br />
Bis vor relativ kurzer Zeit konnte in der Schweiz Fenchel ohne Fungizide produziert werden, die Kultur<br />
galt als unproblematisch. 2005/06 wurden erstmals in grösserem Stil Krankheiten an unverletzten<br />
oberirdischen Teilen von Fenchel festgestellt: Ramularia spp und Plasmopara spp..<br />
Azoxystrobin wurde damals zur Bekämpfung der beiden Krankheiten zugelassen. Der Wirkstoff baut<br />
nach der Applikation sehr schnell ab, muss protektiv appliziert werden und wirkt nicht systemisch.<br />
Weitere Wirkstoffe wären in der Praxis sehr willkommen.<br />
Ziele <strong>2013</strong><br />
Bisher konnte Plasmopara auf Fenchelsamen nicht nachgewiesen werden. Gemäss Literatur ist die<br />
samenbürtige Übertragung des Falschen Mehltaus bei Petersilie bekannt.<br />
Untersuchung von Samen glatter und krauser Petersilien-Sorten um die samenbürtige Übertragung<br />
von Falschen Mehltau (Plasmopara umbelliferarum) bei Petersilie und die Möglichkeit der<br />
Übertragung der Krankheit von Petersilie auf Fenchel zu belegen.<br />
In einem zweiten Schritt soll untersucht werden, ob durch eine Desinfektion der kontaminierten<br />
Petersilien-Samen mit belüftetem Dampf die Übertragung der Krankheit auf beide Kulturen verhindert<br />
werden kann.<br />
Ein Feldversuch zur Prüfung ausgesuchter Fungizide mit systemischer Wirkung zur Bekämpfung des<br />
Falschen Mehltaus bei Fenchel ist vorgesehen.<br />
Bisher in Projekt erarbeitet (falls mehrjähriges Projekt)<br />
Seit 2006 treten die Krankheiten sporadisch hin und wieder auf. 2012 konnte die Übertragung des<br />
Falschen Mehltaus von Petersilie auf Fenchel in benachbartem Anbau im Feld beobachtet werden.<br />
Gemäss unseren Nachforschungen ist der Falsche Mehltau des Fenchels in Europa ausserhalb der<br />
Schweiz und der Pfalz praktisch nicht bekannt.<br />
Schätzung Arbeitszeiten <strong>2013</strong> (in Arbeitstagen aller Projekt Mitarbeitenden): 60<br />
<strong>Extensionprojekte</strong> <strong>2013</strong> Gemüsebau <strong>Freiland</strong>
Eidgenössisches Departement für<br />
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF<br />
<strong>Agroscope</strong><br />
Kontaktperson : Total René<br />
Wädenswil<br />
Projektnummer: <strong>2013</strong> / 12 Projektdauer Projektbeginn Projektende<br />
<strong>2013</strong><br />
Krankheiten und Schädlinge bei Spargel: Applikationstechnik und Mittelwahl<br />
Problemstellung<br />
Spargelkulturen können mit konventioneller Applikationstechnik oft nicht ausreichend gegen Pilz -<br />
krankheiten geschützt werden. In voll entwickelten Beständen gelangt häufig zu wenig Spritzbrühe ins<br />
Bestandesinnere, so dass die Pflanzenteile im unteren Bereich nicht genügend benetzt werden. Eine<br />
verbesserte Applikationstechnik könnte wesentlich zu einer gesteigerten Wirkung von Pflanzenschutzbehandlungen<br />
beitragen. Zur Diskussion steht die Dropleg-Spritztechnik sowie allenfalls der Einsatz<br />
geeigneter luftunterstützter Geräte. Dauerkulturen wie Spargeln werden oft auch von ausdauernden<br />
Problemunkräutern besiedelt. Die spezielle Situation der Spargelkultur macht eine Bekämpfung von<br />
Spätverunkrautung fast unmöglich (hoher, dichter Krautbestand)!<br />
Die Auswahl von bewilligten wirksamen Fungiziden zur Bekämpfung von Blattkrankheiten ist im<br />
Schweizer Spargelanbau eng. Auch gegen den Hauptschädling „Spargelfliege“ stehen nur noch<br />
begrenzt wirksame Insektizide zur Verfügung.<br />
Ziele <strong>2013</strong><br />
a.) Wirkungsverbesserung der eingesetzten Fungizide, Wirkungsgrade über 80% werden angestrebt.<br />
Die Unterblattspritztechnik könnte massgeblich zur Verhinderung einer Spätverunkrautung<br />
beitragen. Auf diese Weise könnten auch Problemunkräut er besser unter Kontrolle gehalten<br />
werden.<br />
b.) Im Rahmen des Projektes Lückenindikationen wird abgeklärt, welche Pflanzenschutzmittel zur<br />
Verbesserung der Bewilligungssituation imSpargelanbau in Frage kommen. Nach Möglichkeit<br />
werden prüfenswerte Mittel bei den vorgesehenen applikationstechnischen Untersuchungen<br />
mitberücksichtigt.<br />
c.) Aufbau und Unterhalt eines Monitoringnetzwerk zur Überwachung der Spargelfliege durch U.<br />
Vogler.<br />
Bisher in Projekt erarbeitet (falls mehrjähriges Projekt)<br />
Erfahrungen aus anderen Kulturen mit Droplegtechnik liegen bereits vor. Diese zeigen, dass vor allem<br />
in dichten Beständen oder hohen Kulturen wie Rosenkohl, Mais und Sonnenblumen gute<br />
Anlagerungswerte auch in den unteren Bereichen der Pflanze möglich sind. Daraus lässt sich<br />
schliessen, dass in der Spargelkultur ähnliche Resultate möglich sein sollten. Erste gute Erfahrungen<br />
in Spargeln wurden bereits 2012 in Vorversuchen gemacht.<br />
Schätzung Arbeitszeiten <strong>2013</strong> (in Arbeitstagen aller Projekt Mitarbeitenden):<br />
80 + Tage J. Rüegg<br />
Bemerkungen zum Arbeitsvorgang:<br />
Praxisversuche in Spargelkulturen auf geeigneten Betrieben. Droplegtechnik auf konventionellen<br />
Spritzbalken montiert, evtl. auch Einsatz einer selbstfahrenden Spritze eines Lohnunternehmers, der<br />
mit dieser Technik ausgerüstet ist.<br />
<strong>Extensionprojekte</strong> <strong>2013</strong> Gemüsebau <strong>Freiland</strong>
Eidgenössisches Departement für<br />
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF<br />
<strong>Agroscope</strong><br />
Kontaktperson : Eder Reinhard (Nematologie)<br />
Wädenswil<br />
Projektnummer: <strong>2013</strong> / 13 Projektdauer Projektbeginn Projektende<br />
2 Jahre 2012 <strong>2013</strong><br />
Erhebung zu Nematodenproblemen im <strong>Freiland</strong>gemüsebau<br />
Problemstellung<br />
In Gemüsekulturen im <strong>Freiland</strong> treten immer wieder Schäden durch Nematoden (z.B. Pratylenchus<br />
spp. oder Meloidogyne hapla) auf. Tendenz laut Beobachtungen in der Praxis steigend.<br />
Ziele <strong>2013</strong><br />
Ausmass der Nematodenprobleme im Gemüsebau feststellen (Bestandesaufnahme in einzelnen<br />
ausgewählten Regionen).<br />
Bisher in Projekt erarbeitet (falls mehrjähriges Projekt)<br />
Die Erhebung 2012 wurde in drei Kantonen (VD, GE und BE) zusamm en mit der kantonalen Beratung<br />
durchgeführt. Insgesamt wurden neun Flächen auf sieben Betrieb intensiv beprobt und 23 Boden -<br />
proben untersucht.Hauptsächlich wurden Nematoden der Gattungen Pratylenchus spp. und<br />
Ditylenchus spp. gefunden. In mehreren Flächen wurde Pratylenchus spp. und Meloidogyne hapla<br />
festgestellt.<br />
Schätzung Arbeitszeiten <strong>2013</strong> (in Arbeitstagen aller Projekt Mitarbeitenden): 10<br />
Externe Zusammenarbeit:<br />
Kantonale Fachstellen (Bestandesaufnahme der Schäden) , Produzenten<br />
Bemerkungen zum Arbeitsvorgang:<br />
Die Arbeiten finden im Rahmen des AP12-13 im Projekt „Kompetenzzentrum für Nematologie“ statt.<br />
<strong>Extensionprojekte</strong> <strong>2013</strong> Gemüsebau <strong>Freiland</strong>
Eidgenössisches Departement für<br />
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF<br />
<strong>Agroscope</strong><br />
Kontaktperson : Krauss Jürgen<br />
Wädenswil<br />
Projektnummer: <strong>2013</strong> / 14 Projektdauer Projektbeginn Projektende<br />
<strong>2013</strong><br />
Alternative Herbizidstrategien im Anbau von Doldenblütlern<br />
Problemstellung<br />
In Deutschland ist der Wirkstoff Linuron (Afalon) seit dem Jahr 2003 nicht mehr zugelassen. Seither<br />
ist der Einsatz nur noch mit Sondergenehmigung möglich.<br />
Dadurch, dass der Wirkstoff europaweit von einer kleineren Firma vertrieben wird, ist nicht damit zu<br />
rechnen, dass es eine Folgezulassung geben wird. Weiterhin bestehen für eine Grundzulassung in<br />
der EU noch Lücken bezüglich der Ökotoxikologie (neue Wasserrahmenrichtlinie).<br />
Auch in den anderen Mitgliedsstaaten der EU wird der Wirkstoff bis Ende 2015 verboten sein.<br />
Deshalb ist es dringend notwendig, Alternativlösungen für die verschiedenen Kulturen zu suchen, da<br />
nicht davon ausgegangen werden kann, dass der W irkstoff speziell für die Schweiz hergestellt werden<br />
wird. Entsprechende Anträge wurden in das Projekt Lückenindikationen eingegeben.<br />
Ziele <strong>2013</strong><br />
Finden von Alternativlösungen und -strategien zum Wirkstoff Linuron für Doldenblütler (Karotten,<br />
Fenchel, Knollensellerie, Petersilie) sowie Nüsslisalat. Dies ist besonders wichtig für humusreiche<br />
Böden und Moosböden, da hier die Basisherbizide wie z.B. Stomp gravierende Lücken aufweisen.<br />
Information an Fachtagungen über erste Versuchsergebnisse.<br />
Bisher in Projekt erarbeitet (falls mehrjähriges Projekt)<br />
Arbeitsbesprechungen mit dem Arbeitskreis Lückenindikation (D) und intensiver Austausch der<br />
Versuchsergebnisse.<br />
Schätzung Arbeitszeiten <strong>2013</strong> (in Arbeitstagen aller Projekt Mitarbeitenden): 50<br />
<strong>Extensionprojekte</strong> <strong>2013</strong> Gemüsebau <strong>Freiland</strong>