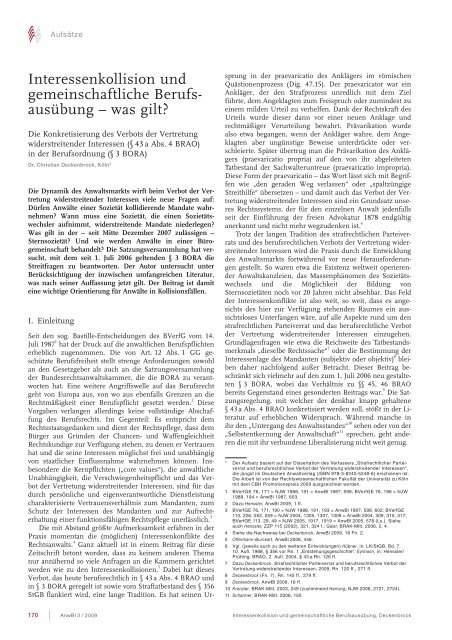Interessenkollision und gemeinschaftliche Berufsausübung
Interessenkollision und gemeinschaftliche Berufsausübung
Interessenkollision und gemeinschaftliche Berufsausübung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Interessenkollision</strong> <strong>und</strong><br />
<strong>gemeinschaftliche</strong> <strong>Berufsausübung</strong><br />
– was gilt?<br />
Die Konkretisierung des Verbots der Vertretung<br />
widerstreitender Interessen (§ 43 a Abs. 4 BRAO)<br />
in der Berufsordnung (§ 3 BORA)<br />
Dr. Christian Deckenbrock, Köln*<br />
Die Dynamik des Anwaltsmarkts wirft beim Verbot der Vertretung<br />
widerstreitender Interessen viele neue Fragen auf:<br />
Dürfen Anwälte einer Sozietät kollidierende Mandate wahrnehmen?<br />
Wann muss eine Sozietät, die einen Sozietätswechsler<br />
aufnimmt, widerstreitende Mandate niederlegen?<br />
Was gilt in der – seit Mitte Dezember 2007 zulässigen –<br />
Sternsozietät? Und wie werden Anwälte in einer Bürogemeinschaft<br />
behandelt? Die Satzungsversammlung hat versucht,<br />
mit dem seit 1. Juli 2006 geltenden § 3 BORA die<br />
Streitfragen zu beantworten. Der Autor untersucht unter<br />
Berücksichtigung der inzwischen umfangreichen Literatur,<br />
was nach seiner Auffassung jetzt gilt. Der Beitrag ist damit<br />
eine wichtige Orientierung für Anwälte in Kollisionsfällen.<br />
I. Einleitung<br />
Seit den sog. Bastille-Entscheidungen des BVerfG vom 14.<br />
Juli 1987 1 hat der Druck auf die anwaltlichen Berufspflichten<br />
erheblich zugenommen. Die von Art. 12 Abs. 1 GG geschützte<br />
Berufsfreiheit stellt strenge Anforderungen sowohl<br />
an den Gesetzgeber als auch an die Satzungsversammlung<br />
der B<strong>und</strong>esrechtsanwaltskammer, die die BORA zu verantworten<br />
hat. Eine weitere Angriffswelle auf das Berufsrecht<br />
geht von Europa aus, von wo aus ebenfalls Grenzen an die<br />
Rechtmäßigkeit einer Berufspflicht gesetzt werden. 2<br />
Diese<br />
Vorgaben verlangen allerdings keine vollständige Abschaffung<br />
des Berufsrechts. Im Gegenteil: Es entspricht dem<br />
Rechtsstaatsgedanken <strong>und</strong> dient der Rechtspflege, dass dem<br />
Bürger aus Gründen der Chancen- <strong>und</strong> Waffengleichheit<br />
Rechtsk<strong>und</strong>ige zur Verfügung stehen, zu denen er Vertrauen<br />
hat <strong>und</strong> die seine Interessen möglichst frei <strong>und</strong> unabhängig<br />
von staatlicher Einflussnahme wahrnehmen können. Insbesondere<br />
die Kernpflichten („core values“), die anwaltliche<br />
Unabhängigkeit, die Verschwiegenheitspflicht <strong>und</strong> das Verbot<br />
der Vertretung widerstreitender Interessen, sind für das<br />
durch persönliche <strong>und</strong> eigenverantwortliche Dienstleistung<br />
charakterisierte Vertrauensverhältnis zum Mandanten, zum<br />
Schutz der Interessen des Mandanten <strong>und</strong> zur Aufrechterhaltung<br />
einer funktionsfähigen Rechtspflege unerlässlich. 3<br />
Die mit Abstand größte Aufmerksamkeit erfahren in der<br />
Praxis momentan die (möglichen) Interessenkonflikte des<br />
Rechtsanwalts. 4<br />
Ganz aktuell ist in einem Beitrag für diese<br />
Zeitschrift betont worden, dass zu keinem anderen Thema<br />
nur annähernd so viele Anfragen an die Kammern gerichtet<br />
werden wie zu den <strong>Interessenkollision</strong>en. 5 Dabei hat dieses<br />
Verbot, das heute berufsrechtlich in § 43 a Abs. 4 BRAO <strong>und</strong><br />
in § 3 BORA geregelt ist sowie vom Straftatbestand des § 356<br />
StGB flankiert wird, eine lange Tradition. Es hat seinen Ursprung<br />
in der praevaricatio des Anklägers im römischen<br />
Quästionenprozess (Dig. 47.15). Der praevaricator war ein<br />
Ankläger, der den Strafprozess unredlich mit dem Ziel<br />
führte, dem Angeklagten zum Freispruch oder zumindest zu<br />
einem milden Urteil zu verhelfen. Dank der Rechtskraft des<br />
Urteils wurde dieser dann vor einer neuen Anklage <strong>und</strong><br />
rechtmäßiger Verurteilung bewahrt. Prävarikation wurde<br />
also etwa begangen, wenn der Ankläger wahre, dem Angeklagten<br />
aber ungünstige Beweise unterdrückte oder verschleierte.<br />
Später übertrug man die Prävarikation des Anklägers<br />
(praevaricatio propria) auf den von ihr abgeleiteten<br />
Tatbestand der Sachwalteruntreue (praevaricatio impropria).<br />
Diese Form der praevaricatio – das Wort lässt sich mit Begriffen<br />
wie „den geraden Weg verlassen“ oder „spaltzüngige<br />
Streithilfe“ übersetzen – <strong>und</strong> damit auch das Verbot der Vertretung<br />
widerstreitender Interessen sind ein Gr<strong>und</strong>satz unseres<br />
Rechtssystems, der für den einzelnen Anwalt jedenfalls<br />
seit der Einführung der freien Advokatur 1878 endgültig<br />
anerkannt <strong>und</strong> nicht mehr wegzudenken ist. 6<br />
Trotz der langen Tradition des strafrechtlichen Parteiverrats<br />
<strong>und</strong> des berufsrechtlichen Verbots der Vertretung widerstreitender<br />
Interessen wird die Praxis durch die Entwicklung<br />
des Anwaltsmarkts fortwährend vor neue Herausforderungen<br />
gestellt. So waren etwa die Existenz weltweit operierender<br />
Anwaltskanzleien, das Massenphänomen des Sozietätswechsels<br />
<strong>und</strong> die Möglichkeit der Bildung von<br />
Sternsozietäten noch vor 20 Jahren nicht absehbar. Das Feld<br />
der Interessenkonflikte ist also weit, so weit, dass es angesichts<br />
des hier zur Verfügung stehenden Raumes ein aussichtsloses<br />
Unterfangen wäre, auf alle Aspekte r<strong>und</strong> um den<br />
strafrechtlichen Parteiverrat <strong>und</strong> das berufsrechtliche Verbot<br />
der Vertretung widerstreitender Interessen einzugehen.<br />
Gr<strong>und</strong>lagenfragen wie etwa die Reichweite des Tatbestandsmerkmals<br />
„dieselbe Rechtssache“ 7 oder die Bestimmung der<br />
Interessenlage des Mandanten (subjektiv oder objektiv) 8 bleiben<br />
daher nachfolgend außer Betracht. Dieser Beitrag beschränkt<br />
sich vielmehr auf den zum 1. Juli 2006 neu gestalteten<br />
§ 3 BORA, wobei das Verhältnis zu §§ 45, 46 BRAO<br />
bereits Gegenstand eines gesonderten Beitrags war. 9 Die Satzungsregelung,<br />
mit welcher der denkbar knapp gehaltene<br />
§ 43 a Abs. 4 BRAO konkretisiert werden soll, stößt in der Literatur<br />
auf erheblichen Widerspruch. Während manche in<br />
ihr den „Untergang des Anwaltsstandes“ 10 sehen oder von der<br />
„Selbstentkernung der Anwaltschaft“ 11 sprechen, geht anderen<br />
die mit ihr verb<strong>und</strong>ene Liberalisierung nicht weit genug.<br />
MN Aufsätze * Der Aufsatz basiert auf der Dissertation des Verfassers „Strafrechtlicher Parteiverrat<br />
<strong>und</strong> berufsrechtliches Verbot der Vertretung widerstreitender Interessen“,<br />
die jüngst im Deutschen Anwaltverlag (ISBN 978-3-8240-5248-6) erschienen ist.<br />
Die Arbeit ist von der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln<br />
mit dem CBH Promotionspreis 2009 ausgzeichnet worden.<br />
1 BVerfGE 76, 171 = NJW 1988, 191 = AnwBl 1987, 598; BVerfGE 76, 196 = NJW<br />
1988, 194 = AnwBl 1987, 603.<br />
2 Dazu Henssler, AnwBl 2009, 1 ff.<br />
3 BVerfGE 76, 171, 190 = NJW 1988, 191, 193 = AnwBl 1987, 598, 602; BVerfGE<br />
110, 226, 252, 259 = NJW 2004, 1305, 1307, 1309 = AnwBl 2004, 309, 315, 317;<br />
BVerfGE 113, 29, 49 = NJW 2005, 1917, 1919 = AnwBl 2005, 578 (Ls.). Siehe<br />
auch Henssler, ZZP 115 (2002), 321, 324 f.; Gaier, BRAK-Mitt. 2006, 2, 4.<br />
4 Siehe die Nachweise bei Deckenbrock, AnwBl 2009, 16 Fn. 2.<br />
5 Offermann-Burckart, AnwBl 2008, 446.<br />
6 Vgl. (jeweils auch zu den weiteren Entwicklungen) Hübner, in: LK/StGB, Bd. 7,<br />
10. Aufl. 1988, § 356 vor Rn. 1 „Entstehungsgeschichte“; Eylmann, in: Henssler/<br />
Prütting, BRAO, 2. Aufl. 2004, § 43 a Rn. 126 ff.<br />
7 Dazu Deckenbrock, Strafrechtlicher Parteiverrat <strong>und</strong> berufsrechtliches Verbot der<br />
Vertretung widerstreitender Interessen, 2009, Rn. 120 ff., 271 ff.<br />
8 Deckenbrock (Fn. 7), Rn. 145 ff., 279 ff.<br />
9 Deckenbrock, AnwBl 2009, 16 ff.<br />
10 Krenzler, BRAK-Mitt. 2003, 249 (zustimmend Hartung, NJW 2006, 2721, 2724).<br />
11 Scharmer, BRAK-Mitt. 2006, 150.<br />
170 AnwBl 3 / 2009 <strong>Interessenkollision</strong> <strong>und</strong> <strong>gemeinschaftliche</strong> <strong>Berufsausübung</strong>, Deckenbrock
MN Aufsätze 12 Deckenbrock (Fn. 7), Rn. 287.<br />
II. Die persönliche Disqualifikation des Anwalts<br />
(§ 3 Abs. 1 BORA)<br />
Das in § 3 Abs. 1 BORA geregelte Tätigkeitsverbot weist im<br />
ersten Halbsatz keine Besonderheiten gegenüber der Regelung<br />
des § 43 a Abs. 4 BRAO auf. Die Tatbestandsmerkmale<br />
„Rechtsanwalt“, „in derselben Rechtssache“, „im widerstreitenden<br />
Interesse“ <strong>und</strong> „bereits beraten oder vertreten hat“<br />
sind schon § 43 a Abs. 4 BRAO zu entnehmen. 12<br />
Die Satzungsversammlung<br />
hat damit die ihr in § 59 b Abs. 2 Nr. 1 e)<br />
BRAO eingeräumte Befugnis einer Konkretisierung nicht<br />
wahrgenommen, sondern hat sich auf die Wiederholung<br />
der gesetzlichen Regelung beschränkt, ohne ausfüllungsbedürftige<br />
Tatbestandsmerkmale wie etwa den Interessenwiderstreit<br />
inhaltlich näher zu bestimmen. 13<br />
Immerhin ist der Wortlaut des § 3 Abs. 1 BORA gelungener<br />
als der des § 43 a Abs. 4 BRAO. So heißt es anstelle<br />
des in § 43 a Abs. 4 BRAO verwandten „vertreten“ in § 3<br />
Abs. 1 BORA „beraten oder vertreten“, was der Bedeutung<br />
des Tatbestandsmerkmals gerechter wird. Klargestellt wird<br />
zudem, dass das Verbot auch greift, wenn die Beratung oder<br />
Vertretung des anderen Interesses nicht gleichzeitig, sondern<br />
sukzessive erfolgt. Ebenfalls zu begrüßen ist der – bei<br />
§ 43 a Abs. 4 BRAO noch fehlende – ausdrückliche Hinweis<br />
darauf, dass dem Anwalt nur „in derselben Rechtssache“ die<br />
Vertretung widerstreitender Interessen untersagt ist. Neben<br />
dieser Klarstellungsfunktion kommt § 3 Abs. 1 BORA insbesondere<br />
eine Verweisungsfunktion zu, indem er als<br />
Anknüpfungspunkt für § 3 Abs. 2 <strong>und</strong> 3 BORA dient. 14<br />
III. Fälle <strong>gemeinschaftliche</strong>r <strong>Berufsausübung</strong><br />
(§ 3 Abs. 2 BORA)<br />
1. Regelungskompetenz der Satzungsversammlung<br />
§ 3 Abs. 2 BORA a. F. hatte – zu Recht, wie der Sozietätswechsler-Beschluss<br />
des BVerfG 15 schließlich bestätigte – eine<br />
heftige Debatte über seine Verfassungsmäßigkeit entfacht.<br />
Ein wesentlicher Aspekt dieser Diskussion war die formelle<br />
Verfassungsmäßigkeit der Satzungsnorm. Teile der Rechtsprechung<br />
<strong>und</strong> eine Reihe von Autoren hatten diese mit dem<br />
Hinweis verneint, § 43 a Abs. 4 BRAO sei eine auf den Einzelanwalt<br />
zugeschnittene Norm. 16<br />
Da § 59 b Abs. 2 BRAO<br />
eine Regelungskompetenz nur „im Rahmen der Vorschriften<br />
dieses Gesetzes“ gewähre, sei der Satzungsversammlung die<br />
Statuierung neuer Berufspflichten nicht möglich. Der Satzungsgeber<br />
dürfe sich nicht in Widerspruch zu den Freiräumen<br />
setzen, die der Gesetzgeber nicht angetastet habe. 17 Die<br />
Satzungsversammlung als Anwaltsparlament müsse zudem<br />
den Vorgaben der Wesentlichkeitstheorie Folge leisten. Hiernach<br />
bedürften alle wesentlichen Eingriffe in die Berufsfreiheit<br />
einer ausreichend bestimmten gesetzlichen Gr<strong>und</strong>lage. 18<br />
Es sei unbestritten, dass Tätigkeitsverbote eines Rechtsanwalts<br />
<strong>und</strong> damit auch das Verbot der Vertretung widerstreitender<br />
Interessen stets zu den wesentlichen – statusbildenden<br />
– Eingriffen gehörten. 19 § 3 Abs. 2 BORA führe sogar<br />
zu einer „lawinengleichen Vervielfachung“ von Tätigkeitsverboten.<br />
20<br />
Das BVerfG hat – etwas überraschend – zur Diskussion<br />
um die formelle Verfassungsmäßigkeit des § 3 Abs. 2 BORA<br />
a. F. keine Stellung bezogen, sondern die Nichtigkeit der<br />
Norm allein auf materielle Erwägungen gestützt. Kleine-Cosack<br />
hat daraus geschlossen, die formellen verfassungsrechtlichen<br />
Bedenken stellten sich auch bei der Neufassung des<br />
§ 3 Abs. 2 BORA. 21 Diese Sichtweise geht jedoch von der<br />
nicht mehr vetretbaren Prämisse aus, dass sich § 43 a Abs. 4<br />
BRAO lediglich an den Einzelanwalt richtet. Der Senat hat<br />
dagegen betont, dass es Aufgabe der Fachgerichte sei, die<br />
momentan bestehende gesetzliche Lücke im Wege richterlicher<br />
Rechtsfortbildung zu schließen. Dem stehe der in<br />
Art. 20 Abs. 3 GG angeordnete Vorrang des Gesetzes nicht<br />
entgegen. Das BVerfG vertritt damit die Auffassung, dass<br />
aus § 43 a Abs. 4 BRAO trotz Fehlens einer ausdrücklichen,<br />
§§ 45 Abs. 3, 46 Abs. 3 BRAO vergleichbaren Sozietätsklausel<br />
eine Erstreckung auf Fälle <strong>gemeinschaftliche</strong>r <strong>Berufsausübung</strong><br />
abgeleitet werden kann. 22<br />
Damit ist der Debatte<br />
über die formelle Verfassungsmäßigkeit des § 3 Abs. 2<br />
BORA ihre Gr<strong>und</strong>lage entzogen worden. Das BVerfG hat sie<br />
durch beredtes Schweigen beendet. 23<br />
2. Gr<strong>und</strong>sätzliche Erstreckung des Verbots<br />
in § 3 Abs. 2 S. 1 BORA<br />
Wendet man sich § 3 Abs. 2 BORA auf materiell-rechtlicher<br />
Ebene zu, findet man folgendes Regelungssystem vor: Nach<br />
§ 3 Abs. 2 S. 1 BORA wird das den Einzelanwalt treffende<br />
Verbot auf „alle mit ihm in derselben <strong>Berufsausübung</strong>s-<br />
[oder Büro]gemeinschaft gleich welcher Rechts- oder Organisationsform<br />
verb<strong>und</strong>enen Rechtsanwälte“ erstreckt (zur<br />
Bürogemeinschaft IV. 3.). Von dieser Ausdehnung werden<br />
damit nicht nur die in einer als Gesellschaft bürgerlichen<br />
Rechts organisierten Sozietät, sondern auch alle in einer<br />
Partnerschaftsgesellschaft, Anwalts-GmbH, Anwalts-AG <strong>und</strong><br />
in einer in Deutschland tätigen ausländischen Anwaltskanzlei<br />
24 verb<strong>und</strong>enen Berufsträger erfasst – unabhängig davon,<br />
ob sie Partner, Angestellte oder freie Mitarbeiter sind. 25 Die<br />
Scheinsozietät ist ebenfalls eine <strong>Berufsausübung</strong>sgemeinschaft<br />
i. S. d. § 3 Abs. 2 S. 1 BORA. 26<br />
Anknüpfungspunkt für die Erstreckung des Verbots ist<br />
Abs. 1. Bei der Prüfung der Voraussetzungen des Tätigkeitsverbots<br />
ist daher in einem ersten Schritt zu beurteilen, ob<br />
13 Vgl. auch Schramm, Das Verbot der Vertretung widerstreitender Interessen, 2004,<br />
S. 98.<br />
14 Kleine-Cosack, BRAO, 5. Aufl. 2008, § 3 BORA Rn. 5.<br />
15 BVerfGE 108, 150 = NJW 2003, 2520 = AnwBl 2003, 521.<br />
16 Siehe nur AGH Stuttgart, Beschluss vom 9.11.1999 – AGH 21/99 (II) (n. v.); AnwG<br />
Köln, AnwBl 2000, 200, 201; Kütemann, <strong>Interessenkollision</strong> des Anwalts, 2002,<br />
S. 83 ff.; Wirtz, Die Regelungskompetenz der Satzungsversammlung, 2004,<br />
S. 205 ff., 213; Kleine-Cosack, AnwBl 1998, 417, 420 f.; Kilian, WM 2000, 1366,<br />
1376; Henssler, NJW 2001, 1521, 1528; Schlosser, NJW 2002, 1376, 1380 f.; a. A.<br />
Eylmann (Fn. 6), § 3 BORA Rn. 6; Prütting, AnwBl 1999, 361, 363.<br />
17 Henssler, ZIP 1998, 2121, 2124.<br />
18 BVerfGE 33, 125, 157 ff. = NJW 1972, 1504, 1506 ff.; BVerfGE 36, 212, 216 f. =<br />
NJW 1974, 232; BVerfGE 76, 171, 185 = NJW 1988, 191 f. = AnwBl 1987, 598,<br />
601.<br />
19 Siehe nur Kleine-Cosack, AnwBl 1998, 417, 420 f.; Henssler, NJW 2001, 1521,<br />
1528.<br />
20 Vgl. etwa Kilian, BB 2003, 2189, 2190.<br />
21 Kleine-Cosack, AnwBl 2003, 539, 546; ders., AnwBl 2006, 13, 18.<br />
22 BVerfGE 108, 150, 159 f. = NJW 2003, 2520 = AnwBl 2003, 521, 523; BVerfGK 8,<br />
239, 241 f. = NJW 2006, 2469 = AnwBl 2006, 580.<br />
23 Vgl. den vom Ausschuss 4 der Satzungsversammlung gebilligten Begründungstext<br />
zu § 3 BORA (SV-Mat. 12/2006), BRAK-Mitt. 2006, 213 f. sowie Feuerich, in: Feuerich/Weyland,<br />
BRAO, 7. Aufl. 2008, § 3 BORA Rn. 7 f.; Harting, Berufspflichten<br />
des Strafverteidigers <strong>und</strong> Sanktionierung pflichtwidrigen Verhaltens, 2008,<br />
S. 177 f.; a. A. Kilian, BB 2003, 2189, 2192.<br />
24 Zum Problem der sog. double deontology siehe etwa Henssler, AnwBl 2004, 458,<br />
462 f.<br />
25 Siehe nur Feuerich (Fn. 23), § 3 BORA Rn. 11.<br />
26 So auch Kleine-Cosack (Fn. 14), § 3 BORA Rn. 8 <strong>und</strong> Feuerich (Fn. 23), § 3 BORA<br />
Rn. 11, der sich damit allerdings in Widerspruch zu seinen Ausführungen bei<br />
§ 43 a Rn. 66 setzt. Ausführlich Deckenbrock (Fn. 7), Rn. 510 ff.<br />
<strong>Interessenkollision</strong> <strong>und</strong> <strong>gemeinschaftliche</strong> <strong>Berufsausübung</strong>, Deckenbrock AnwBl 3 / 2009 171
MN Aufsätze 27 Kleine-Cosack (Fn. 14), § 43 a Rn. 96.<br />
überhaupt einem Einzelanwalt die Mandatsübernahme untersagt<br />
wäre. Bei der Subsumtion unter die Tatbestandsmerkmale<br />
„dieselbe Rechtssache“, „<strong>Interessenkollision</strong>“ <strong>und</strong> „vertreten“<br />
spielt es keine Rolle, ob ein <strong>und</strong> derselbe Anwalt oder<br />
zwei verschiedene Anwälte einer Sozietät die widerstreitenden<br />
Mandate betreuen. Die bei Kleine-Cosack anklingende<br />
Überlegung, dass § 3 BORA ein bewegliches System der Tatbestandsmerkmale<br />
enthalte, 27<br />
überzeugt nicht: Der Norm<br />
lässt sich nicht entnehmen, dass alle Tatbestandsmerkmale<br />
in einer Art Gesamtabwägung zu beurteilen sind.<br />
3. Ausnahme: Einverständnis der betroffenen Mandanten<br />
§ 3 Abs. 2 S. 2 BORA sieht von der gr<strong>und</strong>sätzlichen Erstreckung<br />
des Tätigkeitsverbots eine Ausnahme vor, „wenn sich<br />
im Einzelfall die betroffenen Mandanten in den widerstreitenden<br />
Mandaten nach umfassender Information mit der<br />
Vertretung ausdrücklich einverstanden erklärt haben <strong>und</strong> Belange<br />
der Rechtspflege nicht entgegenstehen“. Da sich diese<br />
Ausnahme nur auf Abs. 2, nicht aber auf Abs. 1 bezieht, verdeutlicht<br />
die Systematik der Norm, dass das Einverständnis<br />
nur in Sozietätskonstellationen von Bedeutung ist. Gegenüber<br />
einem Einzelanwalt können die Mandanten nicht in eine<br />
Vertretung widerstreitender Interessen einwilligen.<br />
a) Gesetzeswidrigkeit des Einverständnisvorbehalts?<br />
Mit der Neufassung des § 3 Abs. 2 BORA ist die Satzungsversammlung<br />
über die Vorgaben des BVerfG hinausgegangen,<br />
das sich ausdrücklich nur zum Fall des nicht vorbefassten<br />
Sozietätswechslers geäußert hat. Hartung hält diese erweiterte<br />
Dispositionsbefugnis der Mandanten für gesetzeswidrig.<br />
Er begründet seine Sichtweise damit, dass „die Satzungsversammlung<br />
aus § 59 b Abs. 2 Nr. 1e) BRAO“ nicht „die<br />
Ermächtigung ableiten“ könne, „die gesetzliche Regelung<br />
des § 43 a Abs. 4 BRAO lockern oder aufheben zu können“.<br />
Unter den in § 3 Abs. 2 S. 2 BORA genannten Voraussetzungen<br />
wäre es einem Anwalt gestattet, gegen das gesetzliche<br />
Verbot des § 43 a Abs. 4 BRAO zu verstoßen, mithin eine<br />
„verbotene Vertretung widerstreitender Interessen“ durchzuführen.<br />
28<br />
Sein Fazit: „Solange der B<strong>und</strong>esgesetzgeber § 43 a<br />
Abs. 4 BRAO nicht dahin einschränkt, dass unter bestimmten<br />
Voraussetzungen widerstreitende Interessen wahrgenommen<br />
<strong>und</strong> vertreten werden dürfen, verbleibt es mithin<br />
bei der uneingeschränkten Geltung des § 43 a Abs. 4<br />
BRAO.“ 29<br />
Hartungs Argumentation ist widersprüchlich: So stellt er<br />
anfangs heraus, § 43 a Abs. 4 BRAO richte sich allein an den<br />
Einzelanwalt <strong>und</strong> werde nur über die Satzungsregelung des<br />
§ 3 Abs. 2 BORA auf Sozietätsmitglieder erstreckt. Im weiteren<br />
Verlauf seiner Ausführungen vertritt er dann plötzlich<br />
die These, dass § 43 a Abs. 4 BRAO durch § 3 Abs. 2 S. 2<br />
BORA eingeschränkt werde. Hartung übersieht zum einen,<br />
dass in § 43 a Abs. 4 BRAO bereits unmittelbar eine personelle<br />
Erstreckung angelegt ist (III. 1.). Zum anderen meint<br />
er, der Norm sei zwingend zu entnehmen, dass das Verbot<br />
der Vertretung widerstreitender Interessen nicht dispositiv<br />
sei. Insoweit erkennt er nicht, dass der Fall eines in seiner<br />
Person gegensätzliche Interessen wahrnehmenden Rechtsanwalts<br />
mit der Konstellation der Vertretung widerstreitender<br />
Interessen durch verschiedene Anwälte einer Sozietät<br />
nicht eins zu eins vergleichbar ist. Von einer Gesetzeswidrigkeit<br />
des § 3 Abs. 2 S. 2 BORA wegen unzulässiger Einschränkung<br />
von § 43 a Abs. 4 BRAO kann somit keine Rede sein. 30<br />
b) Anforderungen an das Einverständnis<br />
§ 3 Abs. 2 S. 2 BORA konkretisiert die Anforderungen an<br />
ein wirksames Einverständnis <strong>und</strong> verlangt, dass „sich im<br />
Einzelfall die betroffenen Mandanten in den widerstreitenden<br />
Mandaten nach umfassender Information mit der Vertretung<br />
ausdrücklich einverstanden erklärt haben“.<br />
Eine solch umfassende Information <strong>und</strong> Aufklärung sollte<br />
sich auf die Sach- <strong>und</strong> Rechtslage beziehen. 31<br />
Der Hinweis<br />
auf die Rechtslage sollte die Feststellung beinhalten, dass einer<br />
Sozietät im Gr<strong>und</strong>satz die Wahrnehmung konfligierender<br />
Mandate nicht gestattet ist <strong>und</strong> nur das nun in Rede stehende<br />
Einverständnis ausnahmsweise ein Tätigkeitsverbot<br />
vermeiden kann. Welche Informationen darüber hinaus offenbart<br />
werden müssen, ist eine Frage des Einzelfalls. Entscheidend<br />
ist, welches Wissen der Mandant für ein verantwortungsvolles<br />
<strong>und</strong> freies Urteil benötigt. Mitunter kann das<br />
Aufzeigen abstrakter Gefahren ausreichend sein: So mag bei<br />
einer Konkurrentenklage der Hinweis genügen, dass die eine<br />
Position nur zulasten der anderen durchgesetzt werden<br />
kann. Zu berücksichtigen ist auch, welchem Umfeld der<br />
Mandant entstammt. Gegenüber einem Verbraucher können<br />
weit höhere Anforderungen bestehen als gegenüber einem<br />
Unternehmen mit eigener Rechtsabteilung. 32 Die Aufklärung<br />
muss darüber informieren, welche Maßnahmen zur Sicherung<br />
der Vertraulichkeit von der Sozietät (dazu noch III.<br />
3. c.) ergriffen werden, um den Fluss sensiblen Wissens innerhalb<br />
der <strong>Berufsausübung</strong>sgemeinschaft zu verhindern.<br />
Denn nur so kann der Rechtsuchende beurteilen, ob er seiner<br />
Sozietät trotz der Doppelmandatierung vertrauen kann.<br />
Information <strong>und</strong> Einverständnis müssen sich stets auf<br />
den Einzelfall beziehen. Keinesfalls zulässig sind Blankozustimmungen,<br />
bei denen ein Mandant schon vor dem Auftreten<br />
eines Interessenkonflikts pauschal darin einwilligt,<br />
dass im Fall des Falls von anderen Sozietätsanwälten gegensätzliche<br />
Interessen vertreten werden dürfen. Eine Einzelfallaufklärung<br />
kann ersichtlich nicht zu einem Zeitpunkt erfolgen,<br />
zu dem die Umstände des Einzelfalls noch nicht<br />
bekannt sind. Aus dem Erfordernis eines ausdrücklichen Einverständnisses<br />
folgt, dass ein Tätigwerden auf Basis einer<br />
konkludenten Einwilligung ausscheidet. 33 Erst recht ist eine<br />
mutmaßliche Einwilligung <strong>und</strong>enkbar. 34<br />
Die Annahme des<br />
widerstreitenden Mandats ist zudem erst nach Erteilung des<br />
ausdrücklichen Einverständnisses möglich, weil der einmal<br />
erfolgte Berufsrechtsverstoß nicht ex post beseitigt werden<br />
kann. Damit kann weder während noch nach Abschluss des<br />
zweiten Mandats ein Einverständnis eingeholt werden. 35<br />
Nicht erforderlich ist dagegen die Schrift- oder Textform der<br />
Einverständniserklärung. Anders als frühere Entwurfs-<br />
28 Hartung, in: Hartung/Römermann, BORA, 4. Aufl. 2008, § 3 Rn. 106; ebenso ders.,<br />
NJW 2006, 2721, 2722; ders., AnwBl 2007, 752.<br />
29 Hartung (Fn. 28), § 3 Rn. 107.<br />
30 Ebenfalls einen Widerspruch in Hartungs Argumentation sehen Feuerich (Fn. 23),<br />
§ 3 BORA Rn. 8, 12, 34; Kilian, in: Koch/Kilian, Anwaltliches Berufsrecht, 2007, B<br />
Rn. 644; Maier-Reimer, NJW 2006, 3601, 3603 Fn. 38 <strong>und</strong> wohl auch Busse, NJW<br />
2007, 497. Ohne klare Stellungnahme Römermann, AnwBl 2006, 831, 832.<br />
31 Scharmer, BRAK-Mitt. 2006, 150, 152 meint offenbar, dass die Belehrung nicht von<br />
der Kanzlei durchgeführt werden müsse, sondern die Zustimmungserklärung auch<br />
vom Gegner beigebracht werden könne.<br />
32 Vgl. Westerwelle, NJW 2003, 2958, 2960.<br />
33 Feuerich (Fn. 23), § 3 BORA Rn. 18.<br />
34 Anders dagegen Richter, in: Hense/Ulrich, WPO, 2008, § 53 Rn. 17 für den Wirtschaftsprüfer.<br />
35 A. A. Hartung (Fn. 28), § 3 Rn. 148 = NJW 2006, 2721, 2726 ohne Begründung.<br />
Feuerich (Fn. 23), § 3 BORA Rn. 17; Kilian (Fn. 30), B Rn. 652 <strong>und</strong> Kleine-Cosack,<br />
AnwBl 2006, 13, 16 halten ein Einverständnis im Laufe der Mandatsarbeit, nicht<br />
jedoch nach Abschluss des Mandats für ausreichend.<br />
172 AnwBl 3 / 2009 <strong>Interessenkollision</strong> <strong>und</strong> <strong>gemeinschaftliche</strong> <strong>Berufsausübung</strong>, Deckenbrock
MN Aufsätze 36 Siehe aber Purrucker, BRAK-Mitt. 2007, 150, 152.<br />
fassungen verlangt § 3 Abs. 2 S. 3 BORA nur noch, dass sie<br />
– wie die Information – in Textform erfolgen soll. 36 Die Satzungsversammlung<br />
hat davon abgesehen, zwingend Textform<br />
zu fordern, damit reine Formverstöße bei materiell bedenkenfreier<br />
Beratung oder Vertretung keine Sanktionen<br />
auslösen. 37<br />
Allerdings empfiehlt sich schon angesichts des<br />
Beweislastrisikos die Einhaltung der Schrift- oder Textform.<br />
Unklar ist, ob die Mandanten an das einmal erklärte Einverständnis<br />
geb<strong>und</strong>en sind. Unzweifelhaft bleibt es jeder<br />
Partei unbenommen, das eigene Mandat über eine Kündigung<br />
(§ 627 BGB) sofort zu beenden. Kann aber auch die Sozietät<br />
über einen Widerruf der Zustimmung zur Niederlegung<br />
des anderen Mandats gezwungen werden? In der<br />
Literatur wird fast durchweg die Auffassung vertreten, dass<br />
ein Widerruf jederzeit möglich sein müsse, 38<br />
ja sogar noch<br />
nicht einmal einzelvertraglich ausgeschlossen werden könne.<br />
Wo derart sensible Werte wie anwaltliche Treue <strong>und</strong> –<br />
vielfach höchstpersönliches – Vertrauen zur Disposition<br />
stünden, müsse dem Mandanten jederzeit der Weg zurück<br />
offenstehen. 39 Der vom Berufsrechtsausschuss der Satzungsversammlung<br />
gebilligte Begründungstext zu § 3 Abs. 2<br />
BORA geht ebenfalls von einer freien Widerrufbarkeit des<br />
Einverständnisses aus. Breche in einem Strafverfahren gegen<br />
mehrere Beschuldigte die ursprünglich gleichgerichtete Verteidigungsstrategie<br />
mit parallelen Interessen auf <strong>und</strong> verteidige<br />
sich der eine Beschuldigte zulasten des anderen,<br />
stünden Belange der Rechtspflege der Fortführung beider<br />
Mandate entgegen. 40<br />
Dieser Begründungstext macht deutlich, dass von der Satzungsversammlung<br />
die beiden Fragen, wann ein Interessenwiderstreit<br />
vorliegt <strong>und</strong> inwieweit bei vorhandener <strong>Interessenkollision</strong><br />
ein Einverständnis der betroffenen Mandanten<br />
relevant ist, miteinander vermengt werden. Selbstverständlich<br />
ist eine Änderung der Mandanteninteressen, durch die<br />
eine ursprüngliche Interessengleichheit in einen Interessenkonflikt<br />
verwandelt wird, beachtlich <strong>und</strong> begründet für die<br />
Sozietät die Pflicht zur Niederlegung beider Mandate, falls<br />
die betroffenen Klienten nun nicht in die Konfliktvertretung<br />
einwilligen. Dies folgt aus dem Umstand, dass erst mit der<br />
Änderung der Interessenlage der Anwendungsbereich des<br />
§ 43 a Abs. 4 BRAO i. V. m. § 3 BORA eröffnet wird. Vorher,<br />
im Stadium der Interessengleichheit, ist ein Einverständnis<br />
der beiden Parteien nicht einmal erforderlich. 41<br />
Anders zu beurteilen ist die Situation, in der das Einverständnis<br />
der Mandanten die Wahrnehmung gegensätzlicher<br />
Interessen durch verschiedene Anwälte einer Sozietät ermöglicht.<br />
Richtigerweise darf eine solche Zustimmung dann<br />
nicht widerruflich sein, wenn sie auf einer ordnungsgemäßen<br />
Aufklärung beruht. Andernfalls hinge die Möglichkeit,<br />
das Mandat für die andere Partei bis zum Ende fortzuführen,<br />
von der Laune des Gegners ab. Im Interesse der Rechtssicherheit<br />
für den jeweils anderen Mandanten muss es daher<br />
hingenommen werden, dass das Einverständnis nicht frei widerruflich<br />
ist. Eine abweichende Sichtweise ist lediglich angebracht,<br />
wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass die<br />
Kanzlei ihre Mandanten falsch oder unzureichend aufgeklärt<br />
hat. In diesem Fall fehlt es bereits an einem wirksamen Einverständnis,<br />
sodass § 43 a Abs. 4 BRAO i. V. m. § 3 BORA<br />
den Anwälten einer Sozietät untersagt, konfligierende Mandate<br />
fortzuführen. Gleiches gilt, wenn sich die Maßnahmen,<br />
die zur Sicherung der Vertraulichkeit ergriffen worden sind,<br />
als lückenhaft erweisen. Ab dem Zeitpunkt, in dem der eigentlich<br />
zu unterbindende Informationsfluss erfolgt ist, steht<br />
der Mandatsfortführung das fehlende, weil nicht unter diesen<br />
Umständen erteilte Einverständnis entgegen. Diese Einschränkungen<br />
schützen die Interessen der Rechtsuchenden<br />
ausreichend. 42<br />
c) Folgen des erteilten Einverständnisses für die<br />
Verschwiegenheitspflicht<br />
Beauftragt ein Mandant eine Sozietät, willigt er gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
zugleich stillschweigend in die Weitergabe vertraulicher Informationen<br />
unter den Sozietätsmitgliedern ein. 43<br />
Eine solche<br />
Erlaubnis, die sich auch auf die Offenbarung von vertraulichen<br />
Informationen an später eintretende Anwälte<br />
erstreckt, 44<br />
kann allerdings nicht unterstellt werden, wenn<br />
der Mandant mit der Wahrnehmung kollidierender Interessen<br />
durch die Sozietät einverstanden ist. 45 Die mit der konkreten<br />
Mandatsbearbeitung betrauten Anwälte müssen in<br />
diesem Fall gegenüber anderen Berufsträgern der Kanzlei<br />
Verschwiegenheit wahren. Dies bedeutet nicht nur, dass den<br />
in der Sozietät tätigen Anwälten straf- <strong>und</strong> berufsrechtliche<br />
Sanktionen im Fall der Verletzung der Schweigepflicht drohen,<br />
sondern auch, dass vonseiten der Kanzlei bzw. ihrer Anwälte<br />
aktiv Maßnahmen zur Vermeidung einer Verletzung<br />
ergriffen werden müssen. Werden keine ausreichenden Mechanismen<br />
zum Schutz der geheimhaltungsbedürftigen Informationen<br />
geschaffen, liegt zumindest eine fahrlässige<br />
Verschwiegenheitspflichtverletzung vor. 46<br />
Denn die pflichtwidrige<br />
Weitergabe der vertraulichen Informationen kann<br />
nicht nur durch eine mündliche oder schriftliche Äußerung<br />
erfolgen, sondern bereits dadurch, dass einem anderen die<br />
Möglichkeit der Kenntniserlangung geboten wird. 47<br />
Wenn<br />
die Zusammenarbeit in der Sozietät so organisiert ist, dass<br />
die Gefahr einer Verschwiegenheitspflichtverletzung nicht<br />
hinreichend sicher gebannt werden kann, darf ein kollidierendes<br />
Mandat erst gar nicht angenommen werden. 48 Solche<br />
die Schweigepflicht sichernden Maßnahmen können sog.<br />
chinese walls sein, die aus der Finanzwelt <strong>und</strong> dem angloamerikanischen<br />
Rechtskreis bekannt sind. 49<br />
d) Alternative zum Einverständnis<br />
Die Einholung des Einverständnisses der betroffenen Mandanten<br />
ist nach dem eindeutigen Wortlaut <strong>und</strong> der klaren<br />
Systematik des § 3 Abs. 2 S. 2 BORA die einzige Möglichkeit<br />
für die Sozietät, die Erstreckung des Tätigkeitsverbots zu vermeiden.<br />
Kilian <strong>und</strong> Kleine-Cosack bezweifeln, dass ein alleini-<br />
37 SV-Mat. 12/2006, BRAK-Mitt. 2006, 213, 214.<br />
38 Kilian (Fn. 30), B Rn. 652; Harting (Fn. 23), S. 181; Kleine-Cosack, AnwBl 2006, 13,<br />
17 (anders aber nun ders. [Fn. 14], § 3 BORA Rn. 48 f.). Ebenso Erb, Parteiverrat<br />
– Rechtsgut <strong>und</strong> Einwilligung im Tatbestand des § 356 StGB, 2005, S. 213 f. (zu<br />
§ 356 StGB); Grunewald, AnwBl 2005, 437, 440; dies., ZEV 2006, 386, 388 <strong>und</strong><br />
Offermann-Burckart, ZEV 2007, 151, 153, die jedoch eine Einwilligung sogar im Hinblick<br />
auf den Einzelanwalt für relevant halten.<br />
39 Erb (Fn. 38), S. 214 (zu § 356 StGB).<br />
40 SV-Mat. 12/2006, BRAK-Mitt. 2006, 213, 215.<br />
41 Dazu ausführlich Deckenbrock (Fn. 7), Rn. 170 f.<br />
42 Siehe aber Sahan, AnwBl 2008, 698, 702, der für dasselbe Ergebnis auf die „Belange<br />
der Rechtspflege“ zurückgreift.<br />
43 BGH NJW 1995, 2915, 2916; BGHZ 148, 97, 102 = NJW 2001, 2462, 2463 =<br />
AnwBl 2001, 571.<br />
44 BGH NJW 1991, 1225; BGHZ 124, 47 = NJW 1994, 257; BGHZ 148, 97, 102 =<br />
NJW 2001, 2462, 2463 = AnwBl 2001, 571.<br />
45 A. A. Kleine-Cosack (Fn. 14), § 43 a Rn. 55.<br />
46 Vgl. Eylmann (Fn. 6), § 43 a Rn. 56; Kilian (Fn. 30), B Rn. 707; Schramm (Fn. 13),<br />
S. 113.<br />
47 Kilian (Fn. 30), B Rn. 707.<br />
48 Ähnlich Steuber, RIW 2002, 590, 593.<br />
49 Zu den Voraussetzungen siehe Deckenbrock (Fn. 7), Rn. 519, 729 ff. sowie Kilian,<br />
WM 2000, 1366, 1372 ff.<br />
<strong>Interessenkollision</strong> <strong>und</strong> <strong>gemeinschaftliche</strong> <strong>Berufsausübung</strong>, Deckenbrock AnwBl 3 / 2009 173
MN Aufsätze<br />
ges Abstellen auf das Einverständnis einer verfassungsrechtlichen<br />
Überprüfung standhält. 50 Vielmehr müsse eine Sozietätserstreckung<br />
auch dann ausscheiden, wenn ein schutzwürdiges<br />
Vertrauen des Mandanten nicht erkennbar sei, die<br />
Versagung des Einverständnisses rechtsmissbräuchlich sei<br />
oder die Interessen der betroffenen Rechtsanwälte <strong>und</strong> deren<br />
Mandanten überwögen. 51<br />
Das BVerfG hat allerdings einen<br />
„Rechtssatz des Inhalts, dass das Verbot der Vertretung widerstreitender<br />
Interessen auch für die mit einem Rechtsanwalt<br />
in einer Sozietät verb<strong>und</strong>enen Kollegen gilt, wenn die<br />
Mandanten mit der weiteren Tätigkeit des Sozius nicht einverstanden<br />
sind“, als mit Art. 12 Abs. 1 GG vereinbar angesehen.<br />
52<br />
Die Erstreckung des Tätigkeitsverbots kann daher<br />
nicht anderweitig, etwa durch die Installierung von chinese<br />
walls vermieden werden. Die Errichtung solcher vertraulichkeitssichernder<br />
Maßnahmen kann allenfalls dazu beitragen,<br />
dass der Mandant sein Einverständnis erteilt.<br />
4. Rückausnahme: Entgegenstehende Belange der<br />
Rechtspflege<br />
a) Ursprung der Einschränkung<br />
Das BVerfG hat in seinen zwei Entscheidungen zur sozietätsweiten<br />
Geltung des § 43 a Abs. 4 BRAO zwar maßgeblich<br />
darauf abgestellt, ob die betroffenen Mandanten in die Wahrnehmung<br />
gegensätzlicher Interessen durch Sozietätsanwälte<br />
eingewilligt haben. In den Beschlüssen klingt jedoch an,<br />
dass es das Einverständnis nicht für das allein entscheidende<br />
Kriterium hält. So bestehe trotz erteilten Einverständnisses<br />
im Interesse der Rechtspflege Anlass zum Eingreifen, wenn<br />
hierfür sonstige Indizien sprächen, die den Mandanten verborgen<br />
geblieben oder von ihnen unzutreffend eingeschätzt<br />
worden seien. Die Rechtsanwaltskammern seien insoweit berechtigt<br />
<strong>und</strong> verpflichtet, allen Hinweisen nachzugehen. 53<br />
Belange der Rechtspflege könnten daher die Nichtannahme<br />
des Mandats bzw. dessen Beendigung erfordern. Eine derartige<br />
objektive Betrachtung ergänze das subjektive Vertrauenselement<br />
des Einverständnisses. 54<br />
b) Meinungsstand<br />
Eine konkrete Aussage, wann „Belange der Rechtspflege“<br />
trotz Einverständnisses ein Tätigkeitsverbot begründen<br />
können, ist der Rechtsprechung des BVerfG nicht zu entnehmen.<br />
Auch die meisten Stellungnahmen der Literatur zeugen<br />
von Ratlosigkeit. 55<br />
Selbst in dem vom Ausschuss 4 der Satzungsversammlung<br />
gebilligten Begründungstext zu § 3 BORA werden mehr<br />
Fragen aufgeworfen als Lösungsansätze vorgestellt: Belange<br />
der Rechtspflege, die eine unabhängige, verschwiegene <strong>und</strong><br />
geradlinige Wahrnehmung der Mandanteninteressen durch<br />
den Rechtsanwalt voraussetzten, könnten nicht nur im gerichtlichen<br />
Verfahren, sondern auch im außergerichtlichen<br />
Bereich einer Wahrnehmung widerstreitender Interessen<br />
durch unterschiedliche Rechtsanwälte derselben <strong>Berufsausübung</strong>sgemeinschaft<br />
entgegenstehen, wenngleich sie<br />
dort in der Regel gr<strong>und</strong>sätzlich ein geringeres Gewicht hätten.<br />
Maßgeblich sei zudem die Frage, inwieweit ein ungewollter<br />
Fluss geheimhaltungsbedürftiger Informationen<br />
denkbar sei. Ob Belange der Rechtspflege widerstreitenden<br />
Beratungsmandaten in der Sozietät entgegenstünden, hänge<br />
daher davon ab, ob die getroffenen Vorkehrungen zur Wahrung<br />
der Vertraulichkeit effektiv seien. 56 Hieraus folge in der<br />
Regel eine räumliche Trennung der Mandatsbearbeiter: „Ist<br />
beispielsweise innerhalb einer <strong>Berufsausübung</strong>sgemeinschaft<br />
am gleichen Ort die Gefahr groß, dass der Berater<br />
oder Vertreter des Gegners gewollt oder ungewollt geheimhaltungsbedürftige<br />
Informationen des Gegners erlangt, etwa<br />
beim abendlichen Blick in die Faxeingänge, könnte dies allein<br />
schon trotz vorliegender Einverständniserklärungen der<br />
Beratung oder Vertretung entgegenstehen. Umgekehrt bedeutet<br />
dies, dass Belange der Rechtspflege in der Regel nicht<br />
entgegenstehen, wenn widerstreitende Beratungsmandate<br />
von räumlich verschiedenen Büros derselben <strong>Berufsausübung</strong>sgemeinschaft<br />
geführt werden <strong>und</strong> überzeugende faktische<br />
Vorkehrungen zur Wahrung der Vertraulichkeit (sog.<br />
chinese walls) getroffen worden sind, sei es aus freien<br />
Stücken, sei es, weil die Mandanten davon ihre Zustimmungserklärungen<br />
abhängig gemacht haben. Ein widerstreitendes<br />
Beratungsmandat kann dann also mit Blick auf die<br />
Belange der Rechtspflege zwischen den Büros derselben <strong>Berufsausübung</strong>sgemeinschaft<br />
in Hamburg <strong>und</strong> München<br />
geführt werden, nicht aber innerhalb der Münchner oder<br />
Hamburger Kanzlei.“ 57<br />
Andere Stimmen gehen über das Erfordernis einer räumlichen<br />
Trennung der Mandatsbearbeiter hinaus <strong>und</strong> leiten<br />
aus den „Belangen der Rechtspflege“ sogar ab, dass eine Vertretung<br />
widerstreitender Mandate durch verschiedene Sozietätsanwälte<br />
generell nicht in Betracht komme, sondern nur<br />
im Fall des Sozietätswechsels. 58<br />
c) Konturlosigkeit des Merkmals „Belange der Rechtspflege“<br />
Diese Stellungnahmen zeigen die aus der Unbestimmtheit<br />
des Rechtsbegriffs folgenden Auslegungsschwierigkeiten.<br />
Letztlich werden alle Aspekte, die von Rechtsprechung <strong>und</strong><br />
Literatur im Zusammenhang mit den „Belangen der Rechtspflege“<br />
genannt werden, bereits bei der Wirksamkeit des Einverständnisses<br />
berücksichtigt. Wenn alle Beteiligten nach der<br />
notwendigen Aufklärung mit der Vertretung widerstreitender<br />
Interessen durch verschiedene Sozietätsmitglieder einverstanden<br />
sind, folgt schon aus dem erteilten Einverständnis<br />
selbst die Pflicht zur Errichtung von chinese walls (III. 3. c.).<br />
Ebenso wenig erfordern etwaige Belange der Rechtspflege,<br />
dass die gerichtliche Vertretung oder die Vertretung in<br />
Schiedsverfahren von verschiedenen Anwälten einer Sozietät<br />
oder gar von unterschiedlichen Büros übernommen werden<br />
müssen. Der Rechtsanwalt ist im forensischen <strong>und</strong> beratenden<br />
Bereich gleichermaßen Organ der Rechtspflege. 59<br />
50 Kleine-Cosack (Fn. 14), § 3 BORA Rn. 15, 45 ff.; Kilian (Fn. 30), B Rn. 648; ders.,<br />
BB 2003, 2189, 2193.<br />
51 Kleine-Cosack (Fn. 14), § 3 BORA Rn. 47.<br />
52 BVerfGK 8, 239, 242 = NJW 2006, 2469 = AnwBl 2006, 580.<br />
53 BVerfGE 108, 150, 164 = NJW 2003, 2520, 2522 = AnwBl 2003, 521, 524.<br />
54 BVerfGK 8, 239, 243 = NJW 2006, 2469, 2470 = AnwBl 2006, 580, 581.<br />
55 Etwa bei Kilian (Fn. 30), B Rn. 651; Dahns, NJW-Spezial 2005, 573; Grunewald,<br />
ZEV 2006, 386, 388; Kleine-Cosack, AnwBl 2006, 13, 17; Offermann-Burckart, ZEV<br />
2007, 151, 155; Quaas, NJW 2008, 1697, 1698; Scharmer, BRAK-Mitt. 2006, 150,<br />
154.<br />
56 SV-Mat. 12/2006, BRAK-Mitt. 2006, 213, 215. Ähnlich Feuerich (Fn. 23), § 3 BORA<br />
Rn. 23 ff.; Kilian (Fn. 30), B Rn. 651; Maier-Reimer, NJW 2006, 3601, 3603; Saenger/Riße,<br />
MDR 2006, 1386, 1387.<br />
57 SV-Mat. 12/2006, BRAK-Mitt. 2006, 213, 214 f.; zustimmend Feuerich (Fn. 23), § 3<br />
BORA Rn. 26. Vor dem Inkrafttreten des neu gefassten § 3 BORA wurde im<br />
Schrifttum zur Reichweite des § 43 a Abs. 4 BRAO eine so differenzierende<br />
Lösung vertreten, vgl. Henssler, NJW 2001, 1521, 1525 f. Auch das BVerfG hatte in<br />
der Sozietätswechsler-Entscheidung die Bedeutung einer räumlichen Trennung<br />
der Mandatsbearbeitung aufgegriffen <strong>und</strong> hervorgehoben, BVerfGE 108, 150, 163<br />
= NJW 2003, 2520, 2521 = AnwBl 2003, 521, 524.<br />
58 So AGH München, NJW-RR 2005, 1225, 1226; Purrucker, BRAK-Mitt. 2007, 150,<br />
152. Ähnlich Groß, in: Münchener Anwaltshandbuch Familienrecht, 2. Aufl. 2008,<br />
§ 2 Rn. 46; Hartung, AnwBl 2007, 752.<br />
59 Ebenso Schramm (Fn. 13), S. 232.<br />
174 AnwBl 3 / 2009 <strong>Interessenkollision</strong> <strong>und</strong> <strong>gemeinschaftliche</strong> <strong>Berufsausübung</strong>, Deckenbrock
MN Aufsätze 60 So ausdrücklich BVerfGE 108, 150, 162 f. = NJW 2003, 2520, 2521 = AnwBl 2003,<br />
Die These, dass eine Vertretung widerstreitender Mandate<br />
durch verschiedene Sozietätsanwälte generell unzulässig<br />
sei, ist nicht mit der Systematik des § 3 BORA in Einklang<br />
zu bringen. Bei einem derartigen Verständnis hätte es nicht<br />
einer generellen Ausnahmeregelung in § 3 Abs. 2 S. 2 BORA<br />
bedurft, sondern ausgereicht, für den Fall des Sozietätswechsels<br />
in § 3 Abs. 3 BORA eine Ausnahme zu schaffen. Auch<br />
eine unterschiedliche Behandlung von örtlichen <strong>und</strong> überörtlichen<br />
Sozietäten lässt sich § 3 Abs. 2 BORA nicht entnehmen.<br />
Sind die Mandanten mit der Interessenvertretung einverstanden,<br />
so ist nach dem Wortlaut der Norm eine<br />
Mehrfachvertretung konfligierender Mandate auch dann zulässig,<br />
wenn die mit den Mandaten befassten Anwälte an<br />
demselben Kanzleistandort tätig sind. Hätte die Satzungsversammlung<br />
eine derart generelle Differenzierung vorsehen<br />
wollen, hätte sie diese unproblematisch in § 3 Abs. 2 S. 2<br />
BORA festschreiben können. Im Gr<strong>und</strong>satz erlaubt das geltende<br />
Recht daher eine Vertretung widerstreitender Interessen<br />
sogar durch die beiden Anwälte einer Zweiersozietät.<br />
Inhaltlich ist die Beurteilung des Ausschusses allerdings<br />
insoweit zutreffend, als die nicht ausreichende Sicherung<br />
der Verschwiegenheitspflicht dazu führen kann, dass die Sozietät<br />
von einer Doppelvertretung Abstand nehmen muss.<br />
Selbst wenn die Sozietätsanwälte Gefahren für das anwaltliche<br />
Berufsgeheimnis nicht sehen, kann die lokale Trennung<br />
der verschiedenen Mandatsbearbeiter maßgeblich dazu<br />
beitragen, dass die betroffenen Mandanten überhaupt zur<br />
Zustimmung bereit sind. Sie ist aber kein berufsrechtliches<br />
„Muss“. Unzulässig wäre es, einen berufsrechtswidrigen<br />
Wissenstransfer aufgr<strong>und</strong> der fehlenden lokalen Trennung<br />
zu unterstellen. Es ist vielmehr gr<strong>und</strong>sätzlich davon auszugehen,<br />
dass die sozietätsverb<strong>und</strong>enen Anwälte ihren Berufspflichten<br />
nachkommen. 60<br />
Die vom Ausschuss 4 nach § 11 der Geschäftsordnung<br />
der Satzungsversammlung 61 erarbeitete Begründung zu § 3<br />
BORA ist zudem rechtlich völlig unverbindlich. Sie bringt<br />
nicht den Willen des Satzungsgebers zum Ausdruck. Deutlich<br />
wird dies bereits daran, dass die Begründung erst nach<br />
Inkrafttreten der Norm erstellt worden ist. Anders als die Begründung<br />
von Gesetzesentwürfen standen diese Ausführungen<br />
den Mitgliedern der Satzungsversammlung bei der Beschlussfassung<br />
nicht zur Verfügung. Die „Begründung“ ist<br />
auch im Nachhinein von der Satzungsversammlung nicht<br />
gebilligt worden, sondern bleibt eine Stellungnahme eines<br />
Ausschusses, dessen Mitglieder nur einen kleinen Teil der<br />
Versammlung ausmachen, die der Neufassung des § 3<br />
BORA letztlich zugestimmt hat. Des fehlenden rechtlichen<br />
Charakters der „Begründung“ scheint sich die Satzungsversammlung<br />
selbst bewusst gewesen zu sein, ist sie doch nicht<br />
als „amtliche Mitteilung“, sondern unter der Rubrik „Aufsätze“<br />
in den BRAK-Mitteilungen veröffentlicht worden. 62<br />
IV. Sonderfälle<br />
1. Sozietätswechsler<br />
Die Satzungsversammlung hat – anders als in der vom<br />
BVerfG für nichtig erklärten Vorgängerfassung – den Fall<br />
des Sozietätswechslers in einem eigenständigen Absatz geregelt.<br />
Nach § 3 Abs. 3 BORA gelten „die Absätze 1 <strong>und</strong> 2 ...<br />
auch für den Fall, dass der Rechtsanwalt von einer <strong>Berufsausübung</strong>s-<br />
[oder Büro]gemeinschaft zu einer anderen <strong>Berufsausübung</strong>s-<br />
[oder Büro]gemeinschaft wechselt“. Die<br />
Norm stellt klar, dass der Wechsler selbst in derselben<br />
Rechtssache keine widerstreitenden Interessen vertreten<br />
darf, <strong>und</strong> zwar unabhängig davon, ob er persönlich in der alten<br />
Kanzlei mit dem Mandat befasst war (§ 3 Abs. 1 BORA)<br />
oder nicht (§ 3 Abs. 2 BORA).<br />
In der Literatur ist die Neuregelung darüber hinaus überwiegend<br />
so interpretiert worden, dass eine Sozietät, die einen<br />
nicht vorbefassten Anwalt in ihre Reihen aufnimmt, bei<br />
fehlender Zustimmung der Mandanten zur Mandatsniederlegung<br />
verpflichtet ist. 63 Ähnliches liest man in dem vom Ausschuss<br />
4 der Satzungsversammlung erarbeiteten Begründungstext<br />
zu § 3 BORA. Dort heißt es: „Vorstehendes (d. h.<br />
ein Tätigkeitsverbot aufseiten der aufnehmenden Kanzlei) gilt<br />
sowohl für den Kanzleiwechsler, der in dem die <strong>Interessenkollision</strong><br />
auslösenden Mandat in der abgebenden Kanzlei selbst<br />
beraten oder vertreten hat, als auch für den nach Absatz 2<br />
Satz 1 bloß mitverpflichteten Kanzleiwechsler, der das Mandat<br />
in der abgebenden Kanzlei nicht bearbeitet hat. Auch er<br />
kann aus dem Mandat geheimhaltungsbedürftige Informationen<br />
erlangt haben, die er aus Sicht des Mandanten nunmehr<br />
in die Kanzlei des Gegners mitnimmt.“ Einige Zeilen weiter<br />
wird die gr<strong>und</strong>sätzliche Erstreckung auf die in der neuen Sozietät<br />
mit dem gewechselten Anwalt verb<strong>und</strong>enen Berufsträger<br />
jedoch eingeschränkt: „Auslöser eines Tätigkeitsverbots<br />
kann andererseits aber stets nur die konkrete nahe liegende<br />
Möglichkeit der Erlangung geheimhaltungsbedürftiger Informationen<br />
sein. Wird das die <strong>Interessenkollision</strong> auslösende<br />
Mandat beispielsweise zwischen zwei großen überörtlichen<br />
Sozietäten <strong>und</strong> dort den Büros in Hamburg (Sozietät I)<br />
geführt, so steht dem Kanzleiwechsel eines Berufsträgers aus<br />
dem Berliner Büro der Sozietät II in das Hamburger Büro der<br />
Sozietät I § 3 Abs. 3 BORA nicht entgegen.“ 64<br />
Der Wortlaut des § 3 Abs. 3 BORA gibt eine solche Differenzierung,<br />
wie sie die „Begründung“ vorstellt, nicht her. 65<br />
Ebenso wenig kann ihm eine Erstreckung des Tätigkeitsverbots<br />
von einem nicht vorbefassten Anwalt auf die Neussozien<br />
entnommen werden. War der Sozietätswechsler mit der<br />
Sache nicht befasst, unterliegt er für die konkrete Rechtssache<br />
nicht dem Verbot des § 3 Abs. 1 BORA, darf aber<br />
dennoch aufgr<strong>und</strong> der in § 3 Abs. 2 BORA vorgesehenen Erstreckung<br />
– vorbehaltlich der beiderseitigen Mandantenzustimmung<br />
– nicht persönlich tätig werden. Dieses Verbot<br />
endet auch nicht mit seinem Wechsel in eine andere Kanzlei,<br />
wie aus § 3 Abs. 3 BORA folgt. Seine Kollegen in der neuen<br />
Sozietät „infiziert“ er jedoch nicht mit einem Tätigkeitsverbot,<br />
da für sie nicht die Voraussetzungen des § 3 Abs. 2<br />
BORA erfüllt sind. Sie sind nicht mit einem Anwalt verb<strong>und</strong>en,<br />
der in derselben Rechtssache im widerstreitenden Interesse<br />
beraten oder vertreten <strong>und</strong> damit die Voraussetzungen<br />
des § 3 Abs. 1 BORA verwirklicht hat. 66<br />
521, 524.<br />
61 Er lautet: „Dem Beschluss zur Änderung der Berufsordnung oder Fachanwaltsordnung<br />
soll mit Übermittlung an das B<strong>und</strong>esministerium der Justiz nach § 191 e<br />
BRAO eine vom Vorsitzenden in Abstimmung mit dem Antragsteller verfasste Begründung<br />
beigefügt werden.“<br />
62 Ähnlich Kleine-Cosack (Fn. 14), § 3 BORA Rn. 1; Maier-Reimer, NJW 2006, 3601,<br />
3604; Römermann, AnwBl 2006, 831.<br />
63 Etwa von Feuerich (Fn. 23), § 3 BORA Rn. 32; Hartung (Fn. 28), § 3 Rn. 132 ff. =<br />
NJW 2006, 2721, 2725 f.; Saenger/Riße, MDR 2006, 1385, 1388 <strong>und</strong> wohl auch<br />
Quaas, NJW 2008, 1697, 1699.<br />
64 SV-Mat. 12/2006, BRAK-Mitt. 2006, 213, 215 (Klammer hinzugefügt); dem folgend<br />
Feuerich (Fn. 23), § 3 BORA Rn. 32; Saenger/Riße, MDR 2006, 1385, 1388.<br />
65 Siehe auch Kilian (Fn. 30), B Rn. 660; Maier-Reimer, NJW 2006, 3601, 3604.<br />
66 Ebenso Kleine-Cosack (Fn. 14), § 3 BORA Rn. 27, 40; Kilian (Fn. 30), B Rn. 660;<br />
Maier-Reimer, NJW 2006, 3601, 3604.<br />
<strong>Interessenkollision</strong> <strong>und</strong> <strong>gemeinschaftliche</strong> <strong>Berufsausübung</strong>, Deckenbrock AnwBl 3 / 2009 175
MN Aufsätze<br />
Wer § 3 Abs. 3 BORA eine weiter gehende Bedeutung zumessen<br />
möchte, verkennt den Rechtscharakter der Norm.<br />
Die Regelung bezweckt nicht, Sonderverbotstatbestände für<br />
den Sozietätswechsler zu schaffen, sondern will verhindern,<br />
dass ein Anwalt durch den Wechsel von jeglichem Tätigkeitsverbot<br />
befreit wird. Mit anderen Worten: § 3 Abs. 2 BORA<br />
begründet ein Tätigkeitsverbot für Anwälte, die mit einem<br />
unmittelbar nach § 3 Abs. 1 BORA disqualifizierten Anwalt<br />
in derselben <strong>Berufsausübung</strong>sgemeinschaft verb<strong>und</strong>en sind,<br />
nur so lange, wie diese Verbindung besteht. Die Erstreckungsnorm<br />
erfasst bereits ausweislich ihres Wortlauts nicht<br />
den Fall einer ehemaligen Verbindung. 67 Dafür hätte es der<br />
Aufnahme der Worte „oder verb<strong>und</strong>en gewesenen“ in den<br />
Tatbestand des § 3 Abs. 2 S. 1 BORA bedurft. Diese Lücke<br />
soll vielmehr mit § 3 Abs. 3 BORA überw<strong>und</strong>en werden, der<br />
insoweit in Form einer bloßen Verweisung § 3 Abs. 1 <strong>und</strong> 2<br />
BORA für anwendbar erklärt. Dies bedeutet, dass ein Anwalt<br />
nach seinem Ausscheiden aus einer Sozietät an das über § 3<br />
Abs. 2 BORA begründete Tätigkeitsverbot geb<strong>und</strong>en bleibt<br />
<strong>und</strong> selbst in derselben Rechtssache in seiner neuen Sozietät<br />
nicht im widerstreitenden Interesse tätig werden darf.<br />
Nicht ganz eindeutig ist die Satzungsregelung jedoch im<br />
Hinblick auf die Folgen eines Sozietätswechsels für die „alte“<br />
Sozietät, wenn der ausscheidende Anwalt das betreffende<br />
Mandat mitnimmt. Steht ihr dann eine Vertretung der Gegenseite<br />
offen? Für ein solches „Freiwerden“ der Sozietät<br />
spricht eine wörtliche Anwendung der Regelung des § 3<br />
Abs. 2 S. 1 BORA, die „das Verbot des Abs. 1“ auf alle Anwälte<br />
der Sozietät erstreckt. Sind indes der oder die Mandatsbearbeiter<br />
aus der Sozietät ausgeschieden, scheint es an einer<br />
Anknüpfung für die personelle Erstreckung des Verbots<br />
der Vertretung widerstreitender Interessen zu fehlen. Richtigerweise<br />
folgt aber aus § 3 Abs. 3 BORA, dass die in der Sozietät<br />
verbliebenen Anwälte nicht tätig werden dürfen. Wenn<br />
es dort heißt, dass „die Absätze 1 <strong>und</strong> 2 ... auch für den Fall“<br />
gelten, „dass der Rechtsanwalt von einer <strong>Berufsausübung</strong>s-<br />
[oder Büro]gemeinschaft zu einer anderen <strong>Berufsausübung</strong>s-<br />
[oder Büro]gemeinschaft wechselt“, ist damit nicht nur gemeint,<br />
dass dem vorbefassten Sozietätswechsler ein Tätigwerden<br />
im widerstreitenden Interesse versagt bleibt. Auch für<br />
die übrigen Anwälte soll sich durch den Wechsel keine neue<br />
Rechtslage ergeben. Ein anderes Ergebnis stünde im Widerspruch<br />
zu dem Fall des nicht vorbefassten Sozietätswechslers,<br />
der in seiner neuen Kanzlei nicht in kollidierende Mandate<br />
eingeb<strong>und</strong>en werden darf.<br />
2. Sternsozietät<br />
Wendet man die Regelung des § 3 BORA auf die seit der<br />
Aufhebung des Verbots der Sternsozietät 68 denkbaren neuen<br />
Sachverhalte an, muss bedacht werden, dass der Satzungsgeber<br />
zum Zeitpunkt der Neufassung des Verbots der Vertretung<br />
widerstreitender Interessen diese Fälle noch gar nicht<br />
regeln konnte. Auf eine Anpassung, wie sie der Gesetzgeber<br />
für das notarielle Mitwirkungsverbot (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 7<br />
BeurkG) vorgenommen hat, 69 ist bislang verzichtet worden.<br />
Dennoch erstreckt sich ein den Sternsozius nach § 3 Abs. 1<br />
BORA persönlich treffendes Tätigkeitsverbot auf alle mit ihm<br />
zur <strong>gemeinschaftliche</strong>n <strong>Berufsausübung</strong> verb<strong>und</strong>enen Berufsträger.<br />
Dieses Ergebnis folgt bereits aus einem Vergleich<br />
mit dem Fall des vorbefassten Sozietätswechslers, dessen<br />
Wechsel für die ihn aufnehmende Sozietät über § 3 Abs. 3<br />
BORA gr<strong>und</strong>sätzlich eine Pflicht zur Niederlegung nach sich<br />
zieht (IV. 1.). Wenn in dieser Konstellation die aufnehmende<br />
Kanzlei zur Mandatsniederlegung verpflichtet wird, muss<br />
das Gleiche erst recht gelten, wenn die vorbefassten Anwälte<br />
sogar weiterhin das konfligierende Mandat betreuen. 70<br />
Nicht einschlägig ist die Sozietätsklausel des § 3 Abs. 2<br />
S. 1 BORA dagegen, wenn der socius multiplex auf keiner<br />
Seite in das Mandat eingeb<strong>und</strong>en wird. Abs. 2 dehnt das Tätigkeitsverbot,<br />
das sich aus Abs. 1 ergibt <strong>und</strong> an den vorbefassten<br />
Anwalt richtet, auf alle mit ihm in derselben <strong>Berufsausübung</strong>sgemeinschaft<br />
verb<strong>und</strong>enen Rechtsanwälte<br />
aus. Unterliegt der Mehrfachsozius dagegen einem nur mittelbar<br />
über § 3 Abs. 2 S. 1 BORA begründeten Tätigkeitsverbot,<br />
kann dieses nicht mithilfe einer neuerlichen Anwendung<br />
der Norm auf seine Kollegen in anderen Sozietäten<br />
erstreckt werden. Dem insoweit eindeutigen Wortlaut des § 3<br />
Abs. 2 S. 1 BORA lässt sich ein solches Verbot nicht entnehmen,<br />
da dieser ausschließlich an „das Verbot des Abs. 1“<br />
anknüpft. Außerdem stützt die Norm nur eine Verbotserstreckung<br />
auf mit dem vorbefassten Rechtsanwalt in derselben<br />
<strong>Berufsausübung</strong>sgemeinschaft verb<strong>und</strong>ene Anwälte. Durch<br />
den „Zusammenschluss“ mehrerer Sozietäten zu einer<br />
„Sternsozietät“ behalten diese ihre rechtliche Selbständigkeit.<br />
Es handelt sich zwar um einen „organisierten Zusammenschluss“<br />
von Rechtsanwälten, nicht aber um eine gemeinsame<br />
<strong>Berufsausübung</strong>, die durch die gemeinsame Entgegennahme<br />
von Aufträgen <strong>und</strong> Entgelt gekennzeichnet ist. 71<br />
Erst recht können mittelbare Verknüpfungen kein Tätigkeitsverbot<br />
nach sich ziehen. Verbindungen zwischen Sozietäten,<br />
die mittelbar dadurch erfolgen, dass ein Sozius als Mitglied<br />
einer zweiten Sozietät über andere (nicht mit dem<br />
Sachbearbeiter der ersten Kanzlei verb<strong>und</strong>ene) Personen mit<br />
einer dritten Sozietät beruflich verb<strong>und</strong>en ist, sind damit bedeutungslos.<br />
72<br />
3. Bürogemeinschafter<br />
§ 3 Abs. 2 S. 1 BORA dehnt das Tätigkeitsverbot auch auf<br />
den Bürogemeinschafter aus. Entsprechendes ordnet § 3<br />
Abs. 3 BORA für den Wechsel von oder zu einer Bürogemeinschaft<br />
an. Diese Ausdehnung bedeutet nicht nur einen<br />
Systembruch, sondern ist darüber hinaus verfassungswidrig.<br />
73<br />
Durch das Verbot der Vertretung widerstreitender<br />
Interessen soll in erster Linie verhindert werden, dass ein<br />
Anwalt zum Interessenvertreter verschiedener Mandanten<br />
mit konträren Zielen wird. Während bei der Sozietät der<br />
Rechtsuchende gerade die personellen Resourcen der gesamten<br />
Gesellschaft nutzen möchte, steht er zum Bürogemeinschafter<br />
in keiner vertraglichen Beziehung, mit der Folge,<br />
dass er ihn nicht als seinen Interessenvertreter <strong>und</strong> in seinem<br />
Lager stehend betrachtet.<br />
67 Das räumen auch Saenger/Riße, MDR 2006, 1385, 1388 trotz ihrer im Ergebnis anderen<br />
Auffassung ein.<br />
68 Siehe § 59 a, e BRAO n. F., geändert mit Wirkung zum 18.12.2007 durch Art. 4<br />
Nr. 3 <strong>und</strong> 4 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechtsberatungsrechts vom<br />
12.12.2007, BGBl. I, S. 2840, 2848 f. Die Parallelregelung des § 31 BORA ist am<br />
18.1.2008 von der Satzungsversammlung der B<strong>und</strong>esrechtsanwaltskammer mit<br />
Wirkung zum 1.7.2008 aufgehoben worden, BRAK-Mitt. 2008, 65.<br />
69 Dazu Deckenbrock (Fn. 7), Rn. 606 f.; Henssler/Kilian, in: Festschrift für Hartung,<br />
2008, S. 65 ff.<br />
70 Henssler/Deckenbrock, DB 2008, 41, 47; im Ergebnis ebenso Quaas, NJW 2008,<br />
1697, 1699 f.<br />
71 Quaas, NJW 2008, 1697, 1699.<br />
72 Henssler/Deckenbrock, DB 2008, 41, 47.<br />
73 Kilian (Fn. 30), B Rn. 646; ders., AnwBl 2008, 707, 708. A. A. OLG Bremen,<br />
FamRZ 2008, 1544; Feuerich (Fn. 23), § 3 BORA Rn. 8, 11; Hartung (Fn. 28), § 3<br />
Rn. 104 = NJW 2006, 2721, 2724 sowie offenbar auch Harting (Fn. 23), S. 183;<br />
Maier-Reimer, NJW 2006, 3601, 3602; Saenger/Riße, MDR 2006, 1385, 1386; Sahan,<br />
AnwBl 2008, 698, 699, die jeweils nicht auf die Problematik der Einbeziehung der<br />
Bürogemeinschaft in § 3 Abs. 2 BORA eingehen. Ausführlich hierzu Deckenbrock,<br />
NJW 2008, 3529, 3531 ff.<br />
176 AnwBl 3 / 2009 <strong>Interessenkollision</strong> <strong>und</strong> <strong>gemeinschaftliche</strong> <strong>Berufsausübung</strong>, Deckenbrock
MN Aufsätze<br />
Auch die Auffassung, die Einbeziehung des Bürogemeinschafters<br />
sei angesichts der bestehenden Gefahren für die<br />
Verschwiegenheitspflicht notwendig, 74 überzeugt nicht.<br />
Diese Sichtweise qualifiziert das Verbot der Vertretung widerstreitender<br />
Interessen unzulässigerweise als Auffangtatbestand<br />
für Verstöße gegen die anwaltliche Schweigepflicht.<br />
Eine Konkretisierung des Verbots, wie sie die Satzungsversammlung<br />
nach § 59 b Abs. 2 Nr. 1 e) BRAO vornehmen<br />
wollte, liegt hierin nicht. Die Missachtung der Verschwiegenheitspflicht<br />
führt nicht dazu, dass ein Anwalt, der dieses Wissen<br />
zu Unrecht erlangt hat, nun (im Nachhinein) zum Interessenvertreter<br />
der Partei wird, deren Geheimnisse<br />
„verraten“ worden sind. Im Gegenteil: Gerade in der Erweiterung<br />
des Verbots auf den Bürogemeinschafter liegt eine<br />
Schwächung der Verschwiegenheitspflicht. Will ein Anwalt<br />
die Anforderungen des § 3 Abs. 2 S. 1 BORA erfüllen, muss<br />
er vor Mandatsannahme prüfen, ob sein Bürogemeinschaftspartner<br />
ein kollidierendes Mandat betreut (hat). Der Bürogemeinschafter<br />
wird damit zur Preisgabe von Informationen<br />
verpflichtet, die der – an sich vorrangigen (vgl. § 3 Abs. 5<br />
BORA) – Verschwiegenheitspflicht unterfallen.<br />
4. Kooperationspartner<br />
§ 3 Abs. 2 S. 1 BORA beinhaltet keine Erstreckung des Verbots<br />
der Vertretung widerstreitender Interessen auf den Kooperationspartner.<br />
Die Gegenauffassung, der zufolge die Kooperation<br />
nach Wortlaut, Systematik, Sinn <strong>und</strong> Zweck der<br />
Norm als <strong>Berufsausübung</strong>sgemeinschaft gelten soll, 75<br />
überzeugt<br />
angesichts der Rechtsnatur der als Innengesellschaft<br />
einzuordnenden Kooperation nicht. 76 Aus § 33 Abs. 1 BORA<br />
kann sich ebenfalls nichts anderes ergeben. Die Norm bestimmt,<br />
dass die Vorschriften der anwaltlichen Berufsordnung,<br />
die Rechte <strong>und</strong> Pflichten des Rechtsanwalts im Hinblick<br />
auf die Sozietät in Form der beruflichen<br />
Zusammenarbeit vorsehen, sinngemäß für alle anderen<br />
Rechtsformen der beruflichen Zusammenarbeit gelten. In<br />
der Literatur wird hieraus zwar der Schluss gezogen, § 33<br />
Abs. 1 BORA dehne den Anwendungsbereich der für die Sozietät<br />
geltenden Vorschriften auf die Kooperation aus. 77 Diese<br />
These wird indes dem berufsrechtlichen Regelungssystem<br />
nicht gerecht: Richtigerweise fallen alle Formen der beruflichen<br />
Zusammenarbeit außerhalb von <strong>Berufsausübung</strong>sgesellschaften<br />
nicht unter § 33 Abs. 1 BORA. Der Begriff der<br />
„beruflichen Zusammenarbeit“ bezieht sich offensichtlich<br />
auf § 59 a BRAO. Auch in dieser Vorschrift sind trotz der im<br />
Hinblick auf das Erfordernis der Vergesellschaftung nicht<br />
eindeutigen Wortwahl („berufliche Zusammenarbeit“) nur<br />
<strong>Berufsausübung</strong>sgesellschaften gemeint. Zuspruch erfährt<br />
diese Sichtweise durch die ausdrückliche Anordnung einer<br />
nur entsprechenden Geltung des § 59 a Abs. 1 <strong>und</strong> 2 BRAO<br />
für die nicht zu den <strong>Berufsausübung</strong>sgesellschaften zählende<br />
Bürogemeinschaft in § 59 a Abs. 3 BRAO. Dementsprechend<br />
74 So etwa SV-Mat. 12/2006, BRAK-Mitt. 2006, 213, 214; Eylmann (Fn. 6), § 3 BORA Rn. 12 f.<br />
75 Hartung (Fn. 28), § 3 Rn. 102; ders., NJW 2006, 2721, 2724; Feuerich (Fn. 23), § 3<br />
BORA Rn. 11 (für verfestigte Kooperationen); Quaas, NJW 2008, 1697, 1698.<br />
76 Dazu ausführlich Henssler/Deckenbrock, DB 2007, 447 ff.<br />
77 Feuerich (Fn. 23), § 33 BORA Rn. 2; Römermann, in: Hartung/Römermann (Fn. 28),<br />
§ 33 Rn. 21 f.; Hartung, in: Henssler/Prütting (Fn. 6), § 59 a Rn. 128; Quaas, NJW<br />
2008, 1697, 1700 (nach dem § 33 Abs. 1 BORA sogar eine Erstreckung auf die<br />
„Sternsozietät“ sicherstellt).<br />
78 Aus der Tatsache, dass in § 30 S. 1 BORA die Bürogemeinschaft, nicht aber die Kooperation<br />
erwähnt ist, folgt, dass auch § 30 BORA nicht geeignet ist, (mittelbar) die Erstreckung<br />
der anwaltlichen Pflichten auf den Kooperationspartner zu erreichen.<br />
79 So bereits Henssler, in: Henssler/Prütting (Fn. 6), § 33 BORA Rn. 6; Henssler/<br />
Deckenbrock, DB 2007, 447, 450.<br />
ist in § 3 Abs. 2 BORA die Anwendbarkeit der entsprechenden<br />
Berufspflicht auf die Bürogemeinschaft als reine Innengesellschaft<br />
ausdrücklich vorgesehen. 78 Dies wäre bei einem<br />
weiten Verständnis des § 33 Abs. 1 BORA entbehrlich. 79<br />
V. Zusammenfassung<br />
9 Erstens: § 3 Abs. 1, 1. Hs. BORA geht über § 43 a Abs. 4<br />
BRAO nicht hinaus. Die Satzungsbestimmung hat in erster<br />
Linie klarstellende Funktion. Daneben dient sie als Anknüpfungstatbestand<br />
für die in § 3 Abs. 2 <strong>und</strong> 3 BORA vorgesehene<br />
sozietätsweite Erstreckung.<br />
9 Zweitens: Das Einverständnis der Mandanten ist nur<br />
erheblich, wenn die widerstreitenden Mandate von verschiedenen<br />
Anwälten einer Sozietät wahrgenommen werden sollen.<br />
Wird es erteilt, folgt aus ihm die Pflicht der Sozietät <strong>und</strong><br />
der in ihr organisierten Anwälte, jeglichen Wissensfluss<br />
zwischen den die widerstreitenden Mandate betreuenden<br />
Berufsträgern zu unterbinden. Erfolgt dennoch ein Informationstransfer,<br />
kann dieser als Verschwiegenheitspflichtverletzung<br />
sanktioniert werden. Aufgr<strong>und</strong> dieser neuen<br />
Tatsachenlage berechtigen die zuvor erteilten Einverständniserklärungen<br />
nicht mehr zur Fortführung der konfligierenden<br />
Mandate. „Belange der Rechtspflege“ erfordern demgegenüber<br />
keine weiter gehenden Einschränkungen der<br />
Zulässigkeit einer Mehrfachvertretung.<br />
9 Drittens: Sowohl der vorbefasste als auch der bislang<br />
nicht mit der Sache betraute Sozietätswechsler sind persönlich<br />
daran gehindert, für ihre neue <strong>Berufsausübung</strong>sgemeinschaft<br />
Tätigkeiten für ein kollidierendes Mandat wahrzunehmen.<br />
Während das den vorbefassten Kanzleiwechsler<br />
treffende Tätigkeitsverbot auf alle Berufsträger der den Anwalt<br />
aufnehmenden Sozietät durchschlägt, kann ein widerstreitendes<br />
Mandat beim Eintritt eines vorher nicht mit der<br />
Angelegenheit befassten Anwalts auch ohne Zustimmung<br />
der betroffenen Parteien fortgeführt werden.<br />
9 Viertens: Ist ein Rechtsanwalt Mitglied in mehreren Sozietäten<br />
(Sternsozius), darf er ohne Zustimmung der betroffenen<br />
Mandanten auf keiner Seite in widerstreitende Mandate<br />
eingeb<strong>und</strong>en werden. Ohne eine solche Vorbefassung<br />
findet eine Erstreckung des den Sternsozius lediglich mittelbar<br />
treffenden Tätigkeitsverbots auf alle mit ihm irgendwie<br />
verb<strong>und</strong>enen Berufsträger nicht statt. Über einen nicht vorbefassten<br />
Sternsozius werden verschiedene Kanzleien nicht<br />
zu einer „<strong>Interessenkollision</strong>seinheit“ vereinigt.<br />
9 Fünftens: Die Einbeziehung des Bürogemeinschafters in<br />
§ 3 Abs. 2 BORA ist verfassungswidrig. Die Norm ist nicht<br />
von der Kompetenz der Satzungsversammlung gedeckt, soweit<br />
sie allein die Gefahr einer Verschwiegenheitspflichtverletzung<br />
sanktioniert. Der Kooperationspartner wird bereits<br />
vom Wortlaut des § 3 Abs. 2 S. 1 BORA nicht erfasst.<br />
Dr. Christian Deckenbrock, Köln<br />
Der Autor ist Akademischer Rat am Institut für Arbeits- <strong>und</strong><br />
Wirtschaftsrecht der Universität zu Köln (Geschäftsführender<br />
Direktor Prof. Dr. Martin Henssler).<br />
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse<br />
autor@anwaltsblatt.de.<br />
<strong>Interessenkollision</strong> <strong>und</strong> <strong>gemeinschaftliche</strong> <strong>Berufsausübung</strong>, Deckenbrock AnwBl 3 / 2009 177