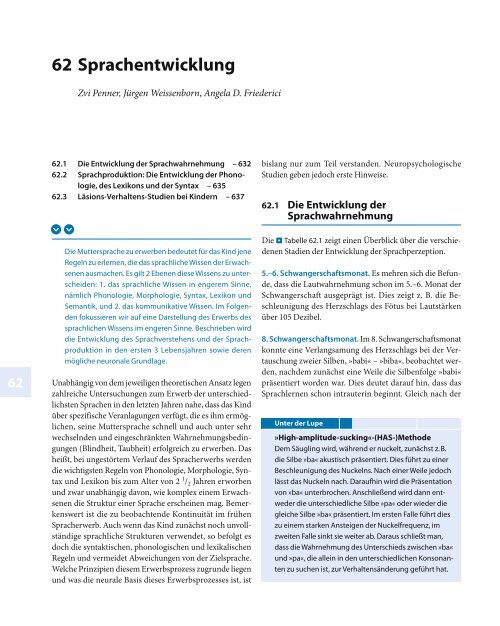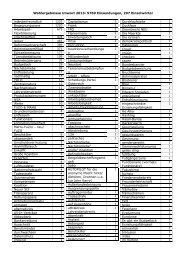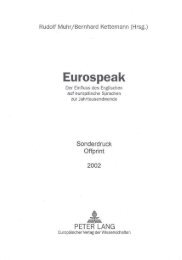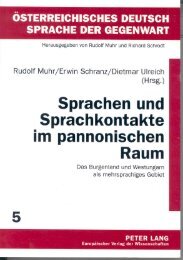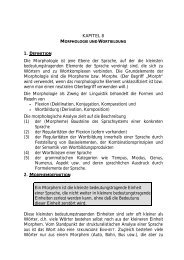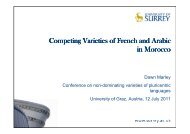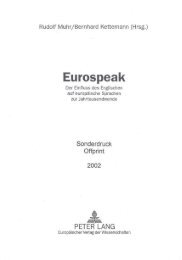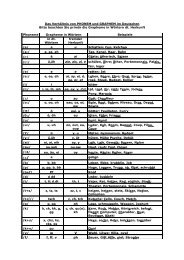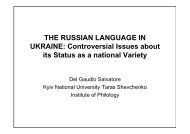16. Sprachentwicklung
16. Sprachentwicklung
16. Sprachentwicklung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
62 <strong>Sprachentwicklung</strong><br />
Zvi Penner, Jürgen Weissenborn, Angela D. Friederici<br />
62<br />
62.1 Die Entwicklung der Sprachwahrnehmung – 632<br />
62.2 Sprachproduktion: Die Entwicklung der Phonologie,<br />
des Lexikons und der Syntax – 635<br />
62.3 Läsions-Verhaltens-Studien bei Kindern – 637<br />
))<br />
Die Muttersprache zu erwerben bedeutet für das Kind jene<br />
Regeln zu erlernen, die das sprach liche Wissen der Erwachsenen<br />
ausmachen. Es gilt 2 Ebenen diese Wissens zu unterscheiden:<br />
1. das sprachliche Wissen in engerem Sinne,<br />
nämlich Phonologie, Morphologie, Syntax, Lexikon und<br />
Semantik, und 2. das kommunikative Wissen. Im Folgenden<br />
fokussieren wir auf eine Darstellung des Erwerbs des<br />
sprachlichen Wissens im engeren Sinne. Beschrieben wird<br />
die Entwicklung des Sprachverstehens und der Sprachproduktion<br />
in den ersten 3 Lebensjahren sowie deren<br />
mögliche neuronale Grundlage.<br />
Unabhängig von dem jeweiligen theoretischen Ansatz legen<br />
zahlreiche Untersuchungen zum Erwerb der unterschiedlichsten<br />
Sprachen in den letzten Jahren nahe, dass das Kind<br />
über spezifische Veranlagungen verfügt, die es ihm ermöglichen,<br />
seine Muttersprache schnell und auch unter sehr<br />
wechselnden und eingeschränkten Wahrnehmungsbedingungen<br />
(Blindheit, Taubheit) erfolgreich zu erwerben. Das<br />
heißt, bei ungestörtem Verlauf des Spracherwerbs werden<br />
die wichtigsten Regeln von Phonologie, Morphologie, Syntax<br />
und Lexikon bis zum Alter von 2 1 / 2 Jahren erworben<br />
und zwar unabhängig davon, wie komplex einem Erwachsenen<br />
die Struktur einer Sprache erscheinen mag. Bemerkenswert<br />
ist die zu beobachtende Kontinuität im frühen<br />
Spracherwerb. Auch wenn das Kind zunächst noch unvollständige<br />
sprachliche Strukturen verwendet, so befolgt es<br />
doch die syntaktischen, phonologischen und lexikalischen<br />
Regeln und vermeidet Abweichungen von der Zielsprache.<br />
Welche Prinzipien diesem Erwerbsprozess zugrunde liegen<br />
und was die neurale Basis dieses Erwerbsprozesses ist, ist<br />
bislang nur zum Teil verstanden. Neuropsychologische<br />
Studien geben jedoch erste Hinweise.<br />
62.1 Die Entwicklung der<br />
Sprachwahrnehmung<br />
Die . Tabelle 62.1 zeigt einen Überblick über die verschiedenen<br />
Stadien der Entwicklung der Sprachperzeption.<br />
5.–6. Schwangerschaftsmonat. Es mehren sich die Befunde,<br />
dass die Lautwahrnehmung schon im 5.–6. Monat der<br />
Schwangerschaft ausgeprägt ist. Dies zeigt z. B. die Beschleunigung<br />
des Herzschlags des Fötus bei Lautstärken<br />
über 105 De zibel.<br />
8. Schwangerschaftsmonat. Im 8. Schwangerschaftsmonat<br />
konnte eine Verlangsamung des Herzschlags bei der Vertauschung<br />
zweier Silben, »babi« – »biba«, beobachtet werden,<br />
nachdem zunächst eine Weile die Silbenfolge »babi«<br />
präsentiert worden war. Dies deutet darauf hin, dass das<br />
Sprachlernen schon intrauterin beginnt. Gleich nach der<br />
Unter der Lupe<br />
»High-amplitude-sucking«-(HAS-)Methode<br />
Dem Säugling wird, während er nuckelt, zunächst z.B.<br />
die Silbe »ba« akustisch präsentiert. Dies führt zu einer<br />
Beschleunigung des Nuckelns. Nach einer Weile jedoch<br />
lässt das Nuckeln nach. Daraufhin wird die Präsentation<br />
von »ba« unterbrochen. Anschließend wird dann entweder<br />
die unterschied liche Silbe »pa« oder wieder die<br />
gleiche Silbe »ba« präsentiert. Im ersten Falle führt dies<br />
zu einem starken Ansteigen der Nuckelfrequenz, im<br />
zweiten Falle sinkt sie weiter ab. Daraus schließt man,<br />
dass die Wahrnehmung des Unterschieds zwischen »ba«<br />
und »pa«, die allein in den unterschiedlichen Konsonanten<br />
zu suchen ist, zur Verhaltensänderung geführt hat.
62.1 · Die Entwicklung der Sprachwahrnehmung<br />
633<br />
62<br />
. Tabelle 62.1. Überblick über die Entwicklung der Sprachperzeption<br />
Alter<br />
Fähigkeit<br />
5.-6. Schwangerschaftsmonat Lautwahrnehmung<br />
8. Schwangerschaftsmonat Lautunterscheidung<br />
0.–3. Monat a) Erkennen der mütterlichen Stimme<br />
b) Kategoriale, universelle Lautunterscheidung<br />
c) Erkennen des vorherrschenden Betonungsmusters der Zielsprache<br />
4.–6. Monat a) Erkennen des eigenen Namens im Redefluss<br />
b) Verstehen von Papa und Mama<br />
c) Präferenz für zielsprachliche Laute<br />
d) Präferenz für das trochäische Betonungsmuster des Deutschen<br />
e) Erkennen von Satzgrenzen aufgrund prosodisch-rhythmischer Merkmale wie Intonation und Pausen<br />
7.–8. Monat a) Erkennen von Wörtern mit dem vorherrschenden zielsprachlichen Betonungsmuster, d. h. im<br />
Deutschen betont-unbetont, z. B. Eímer<br />
b) Erkennen einsilbiger, unbetonter Funktionswörter wie Artikel (das) und Präpositionen (von)<br />
9.–12. Monat a) Erkennen von syntaktischen Grenzen innerhalb eines Satzes, z. B. Der starke Mann / trägt den<br />
großen Koffer<br />
b) Verlieren der Fähigkeit, alle Laute zu unterscheiden. Es werden nur noch Laute unterschieden, die zur<br />
Differenzierung von Wörtern in der Zielsprache dienen<br />
c) Erkennen von Wörtern mit atypischem Rhythmusmuster wie Alárm<br />
d) Erkennen der Regeln für die Kombination von Konsonanten in der Zielsprache<br />
14. Monat Erkennen, dass »She kisses the ball ‚ kisses the ball’« eine syntaktische Einheit bildet<br />
17. Monat Erkennen von Wortstellungsregeln, wie z. B., dass im Englischen das Subjekt dem Objekt vorangeht<br />
Geburt erkennt und präferiert der Säugling die mütterliche<br />
Stimme. Ebenfalls in den ersten Tagen und Wochen nach<br />
der Geburt ist das Neugeborene in der Lage, Laute wie »b«<br />
und »p« in den Silben »ba« und »pa« zu diskriminieren.<br />
Das heißt, praktisch von Anfang an verfügt das Kind über<br />
die Fähigkeit zur kategorialen Lautwahrnehmung. Dies<br />
wurde mit Hilfe der »High-amplitude-sucking«-Methode<br />
(HAS) festgestellt (7 Unter der Lupe).<br />
0.–3. Monat. Mit Hilfe der gleichen Technik sowie mittels<br />
elek tro enzep halo graphischer Untersuchungen (EEG) hat<br />
man auch nachweisen können, dass die Kinder offensichtlich<br />
von Geburt an in der Lage sind, rhythmisch-intonatorische<br />
Regelmäßigkeiten der Sprache, wie die Abfolge von<br />
betonten und unbetonten Silben zu erkennen und damit<br />
auch schon imstande sind, den sprachrhythmischen Typus<br />
ihrer Muttersprache zu erkennen. Dies lässt auch die Annahme<br />
plausibel erscheinen, dass rhythmische Informationen,<br />
etwa die prosodische Prominenz innerhalb einer<br />
syntak tischen Phrase vom Kind schon sehr früh zur Erkennung<br />
der wichtigsten Wortstellungsregeln der Muttersprache<br />
benutzt werden können, d.h., etwa um herauszufinden,<br />
ob das Objekt dem Hauptverb vorausgeht oder<br />
folgt: man vgl. Deutsch »Hans hat Kuchen gegessen« mit<br />
Englisch »John has eaten cake« (für einen Überblick über<br />
die Entwicklung der Sprachwahrnehmung vgl. Höhle u.<br />
Weissenborn 1999; Jusczyk 1997).<br />
4.–6. Monat. Zwischen dem 4. und 6. Lebensmonat lässt<br />
sich schon eine klare Präferenz für zielsprachliche Laute<br />
(»Segmente«) feststellen. So haben EEG-Untersuchungen<br />
ergeben, dass finnisch lernende Kinder die Vokale ihrer<br />
Muttersprache von denen des eng verwandten Estnischen<br />
unterscheiden können. Es wird generell angenommen,<br />
dass Kinder ihre universelle Diskriminierungsfähigkeit<br />
von Segmenten im Alter von ca. 12 Monaten verlieren und<br />
nur noch sprachspezifische Unterschiede diskriminieren.<br />
So sind z.B. japanische Säuglinge sehr wohl in der Lage<br />
zwischen »l« und »r« zu unterscheiden, während dies<br />
12 Mo nate alte Kinder nicht mehr können. Dies bedeutet,<br />
dass die lautlichen Diskriminierungsfähigkeiten der<br />
Kinder anfänglich universell sind, sich im Laufe der Entwicklung<br />
jedoch mehr und mehr auf die muttersprachlichen<br />
Gegebenheiten verengen. In diesem Falle besteht<br />
also Lernen im Verlust bzw. dem Verlernen früherer Fähigkeiten.
634<br />
Kapitel 62 · <strong>Sprachentwicklung</strong><br />
62<br />
Etwa mit 4 Monaten erkennt das Kind seinen Namen<br />
im Redefluss. Wenige Wochen später versteht es auch<br />
»Mama« und »Papa«. Wenn auch das Kind sonst noch<br />
keine weiteren Wörter erkennen kann, zeigt doch das frühe<br />
Erkennen des eigenen Namens und der zweisilbigen<br />
Verwandtschaftsbegriffe, dass Kinder besonders sensibel<br />
sein müssen für die lautlichen Eigenschaften dieser<br />
Wörter.<br />
Im Alter von 6 Monaten können Kinder anhand von<br />
prosodisch-rhythmischen Eigenschaften von Äußerungen,<br />
wie Intonation (Tonhöhenverlauf), Betonung (Energieverlauf),<br />
Vokallänge und Pausen, Satzgrenzen identifizieren.<br />
Wenig später, mit 9 Monaten, sind sie in der Lage, aufgrund<br />
von prosodischen Eigenschaften die Hauptkonstituenten<br />
von Sätzen, z.B. das Subjekt einerseits und das Verb mit<br />
dem direkten Objekt andererseits, zu identifizieren. So<br />
ziehen Kinder dieses Alters etwa einen Satz wie »Der starke<br />
Mann # trägt den großen Koffer« mit einer Pause (#) nach<br />
dem Subjekt, dem gleichen Satz mit einer unnatürlichen<br />
Pause nach dem Verb »Der starke Mann trägt # den großen<br />
Koffer«, die die prosodisch-syntaktische Einheit Verb +<br />
Objekt zerstört, vor.<br />
7.–8. Monat. Mit 7–8 Monaten sind die Kinder generell, in<br />
der Lage unter Ausnutzung der vorherrschenden Wortbetonungsmuster<br />
der Zielsprache, wie der Abfolge einer betonten<br />
und unbetonten Silbe (»Trochäus«) im Deutschen,<br />
z.B. »Éimer«, Wortgrenzen zu identifizieren und somit<br />
Äußerungen in einzelne Wörter zu zerlegen. Die Worterkennung<br />
ist zunächst allerdings auf trochäische Einheiten<br />
beschränkt. Abfolgen von einer unbetonten und einer betonten<br />
Silbe (»Jambus«), z.B. »Alárm«, werden noch nicht<br />
als Einheit erkannt.<br />
Die rapide Entwicklung der Segmentierungsfähigkeiten<br />
des Kindes ermöglicht nun eine schnelle Zunahme des<br />
Wortverstehens, da das Kind dadurch in die Lage versetzt<br />
wird, sein konzeptuelles Wissen, d.h. konzeptuelle Einheiten<br />
mit spezifischen lautlichen Einheiten zu verbinden.<br />
Gegen den 10. Monat umfasst so der rezeptive Wortschatz<br />
des Kindes etwa 60 Wörter. Diese Abbildung von perzeptuell-konzeptuellen<br />
Repräsentationen des Kindes auf lautliche<br />
Einheiten unterliegt dabei offensichtlich bestimmten<br />
Beschränkungen, die sicherstellen, dass das Kind nicht,<br />
wenn es zum ersten Mal in Gegenwart eines Hasen das<br />
Wort »Hase« hört, meint, es würde sich z.B. nur auf die<br />
Ohren beziehen. Vielmehr ist es so, dass es die Lautfolge<br />
regelmäßig auf den ganzen Ge gen stand bezieht. Man<br />
spricht deshalb in diesem Zusammenhang von der »Ganzheitannahme«<br />
(»whole object constraint«) (vgl. Markman<br />
1994).<br />
! Sprachwahrnehmung beginnt bereits vor der Geburt<br />
(intrauterin) und das Kleinkind erwirbt bis zum<br />
9. Lebensmo nat das Lautvokabular und die Betonungsmuster<br />
seiner Sprache.<br />
Es gibt Hinweise darauf, dass das erste Lebensjahr für den<br />
Spracherwerb von kritischer Bedeutung ist. So zeigten<br />
Untersuchungen der Hörbahnreizleitung mit Brainstem<br />
Evoked Response Audiometry (BERA) im 6. Lebensmonat,<br />
dass Kinder mit verlangsamter Reizleitung ein erhöhtes<br />
Risiko für eine verzögerte <strong>Sprachentwicklung</strong> mit 24 Monaten<br />
aufwiesen, obwohl sich mit 14 Monaten die Reizleitung<br />
normalisiert hatte (vgl. hierzu Penner et al. eingereicht).<br />
9.–12. Monat. Mit 9–12 Monaten erweitert sich das Wissen<br />
des Kindes über die Lautstruktur der Muttersprache in<br />
2 zentralen Bereichen. Einerseits berücksichtigt das Kind in<br />
dieser Phase nur noch Laute, die für die Unterscheidung<br />
von Wörtern in seiner Muttersprache wichtig sind und verlernt<br />
die universelle Diskriminierungsfähigkeit von Lauten.<br />
Andererseits geht das Kind bei der Worterkennung über<br />
die rein rhythmischen Segmentierungsstrategien hinaus<br />
und benutzt nun für diese Aufgabe auch andere Informationsquellen,<br />
so unter anderem die segmentale Struktur<br />
des Wortes, d.h. die darin vorkommenden Konsonanten<br />
und Vokale sowie auch die sprachspe zifischen Kombinationsregeln<br />
für Konsonanten, etwa dass »dl-« im Wortanlaut<br />
im Deutschen nicht vorkommen kann. Diese Entwicklung<br />
erleichtert dem Kind die Analyse von unbetontem Sprachmaterial<br />
im Gehörten. Sie hat zur Folge, dass das Kind nun<br />
auch Wörter mit atypischem Betonungsmuster, wie unbetont<br />
– betont, vgl. »Alárm« im sprachlichen Input identifizieren<br />
kann.<br />
Darüber hinaus legen weitere Untersuchungen nahe,<br />
dass das Erkennen von Wörtern schon viel früher als zunächst<br />
vermutet, nicht auf die sog. Inhaltswörter wie Substantive,<br />
Verben und Adjektive beschränkt ist, die normalerweise<br />
betont sind, sondern dass z.B. deutsche Kinder<br />
schon im Alter von 7 Monaten unbetonte Wörter, sog.<br />
Funktionswörter, wie Artikel und Präpositionen im Lautstrom<br />
identifizieren können. Dies ist um so erstaunlicher,<br />
als man bisher angenommen hatte, dass das Fehlen dieser<br />
Wörter in den ersten kindlichen Äußerungen, vgl. »Ball<br />
Kiste holen« (= »(den) Ball (aus der) Kiste holen«), gerade<br />
darauf zurückzuführen sei, dass die Kinder diese Wörter<br />
aufgrund ihrer Unbetontheit anfänglich im Redefluss nicht
62.2 · Sprachproduktion: Die Entwicklung der Phonologie, des Lexikons und der Syntax<br />
635<br />
62<br />
wahrnehmen können. Dies bedeutet zwar, dass wir eine Erklärung<br />
für das anfängliche Fehlen in der kindlichen<br />
Sprachproduktion finden müssen. Andererseits hilft es jedoch<br />
zu verstehen, wie das Kind schon so früh und praktisch<br />
fehlerlos die grammatischen Regeln der Elternsprache<br />
erwerben kann. Funktionswörter zeigen nämlich charakteristische,<br />
sehr eingeschränkte Kombinationsmöglichkeiten<br />
mit anderen Wörtern und nehmen eine feste Stellung im<br />
Satz ein. Diese Eigenschaften können dem Kind, sobald es<br />
Funktionswörter wahrnimmt, dabei helfen, etwas über die<br />
grammatische Struktur der Sprache, die es hört, herauszufinden.<br />
So signalisiert ein Artikel, dass das, was darauf folgt,<br />
ein nominaler Ausdruck, (z.B. ein Substantiv), sein muss<br />
und Konjunktionen zeigen die Grenzen und die Art von<br />
Sätzen (Nebensatz ge genüber Hauptsatz) an (vgl. hierzu<br />
Höhle u. Weissenborn 2000, 2003; Höhle et al. 2004).<br />
Kinder sind in der Einwortphase u.a. schon sensibel<br />
für die Konstituentenstruktur von Sätzen und die Wortstellung.<br />
Die entsprechenden Untersuchungen wurden mit<br />
der sog. Blickpräferenzmethode (7 Unter der Lupe) durchgeführt<br />
(vgl. zum Folgenden Hirsh-Pasek u. Golinkoff<br />
1996).<br />
14. Monat. Diese Untersuchungen zeigen, dass 14 Monate<br />
alte Kinder von 2 Bildern, von denen das eine eine Frau<br />
zeigt, die einen Ball küsst, und das andere eine Frau, die<br />
Schlüssel küsst, das erstere präferieren, wenn der sprachliche<br />
Stimulus lautete: »Look, she is kissing the ball«. Die<br />
korrekte Interpretation dieses Satzes setzt voraus, dass das<br />
Kind die Verbalphrase »is kissing the ball« als Einheit analysiert<br />
hat. Die korrekte Zuordnung von Satz und Bild ist<br />
nicht aufgrund des Ver stehens des Wortes »ball« allein<br />
möglich, da ein Ball auch auf dem nicht passenden Bild<br />
abgebildet ist.<br />
17. Monat. In einem weiteren Experiment mit der gleichen<br />
Methode wurde das Verständnis von 17 Monate alten Kindern<br />
für die Wortstellungsregeln des Englischen getestet.<br />
Auch diese Kinder befanden sich mehr heitlich noch in der<br />
Einwortphase. Getestet wurde das Verständnis von Sätzen<br />
wie »See? Big Bird (BB) is washing Cookie Monster (CM)«<br />
(BB and CM sind Charaktere aus der Fernsehserie Sesamstraße),<br />
wobei dem Kind gleichzeitig 2 Bilder präsentiert<br />
wurden, auf denen einmal BB CM wäscht und einmal<br />
CM BB.<br />
Auch hier präferierten die Kinder das korrekte Bild, was<br />
darauf hinweist, dass sie in diesem Alter schon mit den<br />
Wortstellungsregeln des Englischen vertraut sind.<br />
Unter der Lupe<br />
Blickpräferenzmethode<br />
Bei der Blickpräferenzmethode werden dem Kind gleichzeitig<br />
mit dem sprachlichen Testmaterial 2 unterschiedliche<br />
Bilder/Handlungen auf 2 Fernsehschirmen angeboten.<br />
Eines dieser Bilder stimmt mit der Bedeutung des<br />
sprachlichen Materials überein, während das andere Bild<br />
inhaltlich nicht dazu passt. Gemessen wird, wie lange das<br />
Kind jeweils jedes einzelne der Bilder fixiert, wobei davon<br />
ausgegangen wird, dass das Kind das zum sprachlichen<br />
Teststimulus passende Bild länger fixiert als das nicht<br />
passende, wenn es in der Lage ist, den sprachlichen Stimulus<br />
korrekt zu analysieren und zu interpretieren.<br />
Mit 22–24 Monaten verfügt das Kind also schon über<br />
ein umfangreiches rezeptives Sprachwissen in allen grammatischen<br />
Bereichen. Dabei ist es vor allem die anfängliche<br />
Sensibilität des sprachlernenden Kindes für die rhythmisch-prosodischen<br />
Eigenschaften, sowie für die funktionalen<br />
Einheiten (»Funktionswörter«) von Sprache, auf der<br />
die erstaunlich schnelle Entwicklung der sprachlichen Fähigkeiten<br />
während der ersten beiden Lebensjahre beruht<br />
(vgl. auch Weissenborn 2000).<br />
! Im Alter von 22 Monaten verfügt das Kind bereits<br />
über ein umfangreiches rezeptives grammatisches<br />
Wissen.<br />
62.2 Sprachproduktion:<br />
Die Entwicklung der Phonologie,<br />
des Lexikons und der Syntax<br />
Parallel zur extrem frühen Entwicklung der Sprachwahrnehmung<br />
mehrt sich die Evidenz auch für eine starke Kontinuität<br />
in der Sprachproduktion. Schon in den Schreivokalisationen<br />
in den ersten Lebensmonaten sind wichtige<br />
Regelmäßigkeiten der Lautgebung erkennbar (Wermke et<br />
al. 1996). Dies betrifft in erster Linie die Kontrolle der<br />
Grundfrequenz und der Lautlänge sowie die Entwicklung<br />
der sog. Stabilitätsparameter (»pitch perturbation quotient«).<br />
Besonders relevant für den Erwerb der zielsprachlichen<br />
Pho nologie scheinen in der Schreiphase die Relation<br />
zwischen dem Verlauf (z.B. Energiekurve) und der Länge<br />
der einzelnen Melodiebögen sowie das Prominenzverhältnis<br />
(»Rhythmus«) zwischen den einzelnen Melodiebögen<br />
innerhalb einer Schreiäußerung zu sein. Neue Untersu-
636<br />
Kapitel 62 · <strong>Sprachentwicklung</strong><br />
62<br />
chungen zu beiden Faktoren legen die Vermutung nahe,<br />
dass das Schreirepertoire Vorläufer der prosodischen Einheiten<br />
»Silbe« und »trochäischer« Fuß enthält.<br />
Auf die Schreiphase folgt die Lallphase (»babbling«),<br />
die sich primär durch die Etablierung der zielsprachlichen<br />
Silbenbildung auszeichnet und gewöhnlich die Zeit vom<br />
6.–12. Lebensmonat umfasst. Im Mittelpunkt der Lallphase<br />
steht das »kanonische Lallen«, das sich durch die Bildung<br />
von Silben charakterisiert, die bezüglich der Parameter<br />
Formantenübergangsdauer, Silbenlänge, Grundfrequenz<br />
und Intensität zielsprachlich konform sind (Oller 1986). In<br />
der Phase des kanonischen Lallens werden 2 Stadien unterschieden,<br />
nämlich das reduplizierende und das bunte Lallen.<br />
Das reduplizierende Lallen (7.–10. Monat) zeichnet<br />
sich durch die Wiederholung derselben Silbe aus (z.B.<br />
[dada]). Im Stadium des bunten Lallens (10.–12. Monat)<br />
werden hingegen mehrsilbige Lautketten mit unterschiedlichen<br />
Konsonanten produziert (z.B. [daba]). In dieser<br />
Phase ist der segmentale Bestand an das spezifische Lautinventar<br />
der Muttersprache angepasst.<br />
In Anbetracht der hohen Sensitivität bezüglich der<br />
rhythmischen Regularitäten der Zielsprache in der 2. Hälfte<br />
des 1. Lebensjahres stellt sich die Frage, welche prosodischen<br />
Parameter die Kinder schon während der Lallphase<br />
korrekt setzen (Jusczyk 1997). Eine Pilotstudie von Penner<br />
u. Fischer (2000) zeigt, dass mehr als 80% aller kanonischen<br />
Lalläußerungen mit den sprachspezifischen Regeln der zielsprachlichen<br />
Wortprosodie übereinstimmen. Dies betrifft<br />
in erster Linie die Parameter des Minimalwortformats sowie<br />
der Prominenz auf Fuß- und Wortebene. Feinere prosodische<br />
Regeln werden hingegen erst später in der lexikalischen<br />
Phase erworben (mit ca. 2 1 / 2 Jahren). Diese Lücken<br />
im Regel system führen dazu, dass die Sprachproduktion<br />
nach Sprechbeginn (mit 12 Monaten) sowohl segmentalen<br />
als auch prosodischen Restrik tionen unterliegt. Diese Beschränkungen<br />
sind für die typischen segmentalen und prosodischen<br />
Prozesse wie beispielsweise Harmoni sierung<br />
(»bop« statt »Brot«) oder Silbenauslassung (»nane« statt<br />
»Banane«) verantwortlich, die den frühen Wortschatz kennzeichnen.<br />
! Auf die anfängliche Schreiphase folgt die Lallphase,<br />
in der Laute und Lautkombinationen produziert werden.<br />
Zwischen dem 6. und 12. Monat werden bereits<br />
die Wortbetonungsmuster der Zielsprache systematisch<br />
produziert.<br />
Untersuchungen zur Wortschatzentwicklung (Fenson et al.<br />
1993) belegen die erstaunliche Effizienz der Kinder im<br />
Erwerb des Lexikons. Die Befunde lassen sich folgenden<br />
Stadien zuordnen:<br />
1. 11.–13. Monat: Produktion der ersten Wörter;<br />
2. <strong>16.</strong> Monat: 50–75 Items;<br />
3. 18.–24. Monat: Wortschatzexplosion (»vocabulary<br />
spurt« – 186–436 Items);<br />
4. 6 Jahre: (14.000 Items).<br />
Dies bedeutet, dass Kinder nach der Wortschatz explosion<br />
durchschnittlich 9–10 neue Items pro Tag lernen. Um diese<br />
erstaunliche Lernleistung, die das Kind trotz notorischer<br />
Mehrdeutigkeit des Eingangs erbringt, erklären zu können,<br />
ist eine Reihe von Modellen entwickelt worden, die dem<br />
sprachlernenden Kind bestimmte Strategien zuschreiben.<br />
In diesem Zusammenhang spricht man primär von »Präferenzen«<br />
(»biases« oder »assumptions« bei Markman<br />
1994 oder Landau 1994), die die Aufmerksamkeit des<br />
Kindes auf eine kleine Untermenge von eindeutigen Objektmerkmalen<br />
(z.B. Objektganzheit oder Form bei ri giden<br />
Objekten) beschränken und somit den induktiven Suchraum<br />
einengen. Aufgrund dieser anfänglichen Beschränkungen<br />
entstehen die typischen Übergeneralisierungen<br />
des frühen Wortschatzes wie z.B. »Ball« als Bezeichnung<br />
aller kugelförmigen Ge genstände. Irreversible, falsche Verallgemeinerungen<br />
(wie beispielsweise »Pferd« für »Gras«)<br />
werden hingegen durch diese Lernprinzipien ausgeschlossen.<br />
Zu Beginn des Verblexikonerwerbs steht die sog. »Ereignisstruktur«<br />
im Mittelpunkt des Lernprozesses. In<br />
diesem Bereich lernt das Kind, welchen Ereignistypus ein<br />
gegebenes Verb bezeichnet: [Zustand], [Vorgang ohne<br />
Endzustand], [Vorgang mit Endzustand] etc. Die anderen<br />
Bedeutungskomponenten des Verbs, nämlich die Kern -<br />
bedeutung und die Argumentselektion, werden erst<br />
später für den Erwerbsprozess aktuell. Untersuchungen<br />
in diesem Bereich (Penner et al. 1998; Schulz et al. 2001)<br />
legen die Vermutung nahe, dass die Kinder schon ca. im<br />
13. Monat über eine explizite Repräsentation der Ereignisstruktur<br />
verfügen. Dabei lässt sich das Kind von einer<br />
starken Prä ferenz für komplexe, end zustandsorientierte<br />
Verben wie »auf machen«, »weg machen« oder (das Licht)<br />
»anmachen« »leiten«. Aus beiden semantischen Bestandteilen<br />
solcher resulta tiven Ereignisse [Endzustand und<br />
Vorgang] kon zentrieren sich die Kinder anfänglich auf<br />
den Endzustand als das prominentere Teilereignis, der als<br />
isoliertes Präfix ausbuchstabiert wird (z.B. »auf« für das<br />
Zielwort »auf machen«). Die Realisierung des untergeordneten<br />
Teiler eignisses erfolgt erst, wenn das Kind die
62.3 · Läsions-Verhaltens-Studien bei Kindern<br />
637<br />
62<br />
Reprä sentation des Endzustandes semantisch korrekt etabliert<br />
hat.<br />
! Zwischen dem 18. und 24. Monat kommt es zu einer<br />
massiven Erweiterung des Wortschatzes.<br />
Der Syntaxerwerb umfasst verschiedene Phasen. Für den<br />
Erwerb der Satzstrukturebene unterscheiden wir bis zum<br />
3. Lebensjahr 2 Hauptstadien:<br />
1. Erwerb der Wortstellung, d.h. der Regeln der Subjektund<br />
Objektplatzierung und Endposition des flektierten<br />
Verbs (Penner et al. 2000).<br />
2. Erwerb der funktionalen »Satzschale«, d.h. der Verb-<br />
Zweit-Regel in deklarativen und Fragesät zen sowie der<br />
Grundregel der Nebensatzbildung (Clahsen 1988).<br />
Analog verläuft der Erwerb der Nominalphrase mit dem<br />
Artikel als »funktionaler Schale« (Penner u. Weissenborn<br />
1996). Auf dem im Alter 2 1 / 2 Jah ren etablierten syntaktischen<br />
Wissen aufbauend vervollständigt das Kind bis zur<br />
Einschulung die Syn tax- Semantik-Schnittstelle. In diesen<br />
Bereich ge hö ren vor allem die Mechanismen der »logischen<br />
Form« wie beispielsweise die Diskurssemantik, durch die<br />
die Referenz eines Nomens determiniert wird und die<br />
Skopusregeln, die die Geltungsbereiche von Operatoren<br />
bestimmen (Fragepronomina, Quantoren etc.).<br />
Der Syntaxerwerb zeichnet sich durch seine Kontinuität<br />
aus. Wie Weissenborn (1994) argumentiert, ist die Syntaxentwicklung<br />
eine durch sukzessive Merkmalsspezifizierung<br />
gesteuerte inkrementelle Erweiterung der Struktur,<br />
die der sog. »local well formedness condition« unterliegt.<br />
Dieses Prinzip ver langt, dass jede Interimsrepräsentation<br />
der syntaktischen Struktur in der nächst höheren Phase in<br />
wohlgeformter Weise enthalten ist. Auf diese Weise entstehen<br />
im Verlauf des Syntaxerwerbs keine Interimsrepräsentationen,<br />
die zielsprachlich-inkonsistente Merkmalsspezifizierungen<br />
enthalten.<br />
! Syntaktische Regeln werden kontinuierlich bis zum<br />
3. Lebensjahr erworben.<br />
62.3 Läsions-Verhaltens-Studien<br />
bei Kindern<br />
Läsions-Verhaltens-Studien bei Kindern mit frühen unilateralen<br />
Läsionen zeigen überraschenderweise kaum Unterschiede<br />
zwischen jenen mit linkshemisphärischen Läsionen<br />
und jenen mit rechtshemis phärischen Läsionen. Kinder<br />
mit früher linkshemisphärischer Läsion erlernen häufig<br />
Sprache bis zu einem fast normalen Performanzkriterium,<br />
was da rauf hinweist, dass die linke Hemisphäre in der<br />
frühen <strong>Sprachentwicklung</strong> noch nicht jene Dominanz hat,<br />
die bei Erwachsenen festzustellen ist. Auch zeigt sich, dass<br />
Kinder mit linkshemisphärischen anterioren und linkshemisphärischen<br />
posterioren Läsionen sich nicht in der<br />
gleichen Art und Weise in ihrem sprachlichen Verhalten<br />
unterscheiden, wie wir dies bei Erwachsenen beobachten<br />
können.<br />
Bezüglich der interhemisphärischen Organisation bzw.<br />
Reorganisation der Sprache ergeben die Läsionsstudien für<br />
die <strong>Sprachentwicklung</strong> jedoch kein ganz einheitliches Bild<br />
bezüglich der frühen In volvierung von linker und rechter<br />
Hemisphäre ab. Woods und Kollegen (Woods 1980; Woods<br />
u. Carey 1979; Woods u. Teuber 1978) fanden, dass Störungen<br />
von Sprach- und Sprechfunktionen nach linkshemisphärischer<br />
Läsion größer waren als nach rechtshemisphärischer<br />
Läsion. Dennis und Kollegen (Dennis 1980; Dennis u.<br />
Whitaker 1976) berichteten über Kinder mit durch Tumore<br />
bedingten Hemisphäreektomien der linken oder der rechten<br />
Seite. Sie fanden, dass Kinder nach Entfernung der linken<br />
Hemisphäre in grammatischen und phonologischen<br />
Tests hinter der Performanz einer Kontrollgruppe zurückblieben,<br />
während ein vergleichbares Muster bei Kindern mit<br />
Entfernung der rechten Hemisphäre nicht beobachtet wurde.<br />
Riva und Kollegen (Riva 1995) stellten fest, dass Kinder<br />
mit linkshemisphärischer Läsion vor allem bezüglich grammatischer<br />
Aspekte während des Sprachverstehens größere<br />
Störungen zeigen, links hemisphärische und rechtshemisphärische<br />
Läsionen jedoch das expressive und rezeptive<br />
Vokabular in gleicher Weise beeinträchtigen. Aram und<br />
Mitarbeiter (1986, 1987) fanden, dass Kinder mit linkshemisphärischen<br />
Läsionen in ihrer Performanz schlechter<br />
als Kontrollpersonen waren und zwar in einer Reihe von<br />
verschiedenen Tests, die sowohl grammatisches Sprachverstehen,<br />
Produktion, phonologische Dis krimination,<br />
Benennungsfähigkeit und lexikalische Zugriffsfähigkeit<br />
testeten. Ein ähnlicher Unterschied wurde für die rechtshemisphärisch<br />
geschädigten Kinder in Bezug auf ihre Kontrollgruppe<br />
nicht gefunden. Bates und Kollegen (Thal et al.<br />
1991; Bates et al. 1997) untersuchten Kleinkinder mit unilateralen<br />
Hirnläsionen und beobachteten, dass linkshemisphärische<br />
Läsionen vor allem <strong>Sprachentwicklung</strong>sstörungen<br />
im Bereich der expressiven Grammatik und des<br />
Vokabulars zur Folge hatten. Rechtshemisphärische Läsionen<br />
führten dagegen zu <strong>Sprachentwicklung</strong>sverzögerungen<br />
im rezeptiven Bereich und im Bereich der kommunikativen<br />
Gesten.
638<br />
Kapitel 62 · <strong>Sprachentwicklung</strong><br />
62<br />
Die uneinheitlichen Ergebnisse der aufgeführten Studien<br />
können durch eine Reihe verschiedener Faktoren bedingt<br />
sein. Wesentliche Faktoren hierbei sind:<br />
1. die Ätiologie der Schädigung,<br />
2. die Größe der Hirnläsion und<br />
3. der Zeitpunkt der Hirnschädigung.<br />
Alle diese Faktoren variieren bei den verschiedenen Studien<br />
und dies erschwert einen direkten Vergleich zwischen<br />
ihnen.<br />
! Die bei Erwachsenen feststellbare Sprachdominanz<br />
der linken Hemisphäre scheint im frühen Kindesalter<br />
weniger ausgeprägt.<br />
Die Frage nach der intrahemisphärischen Organisation<br />
bzw. Reorganisation, also der Frage, inwieweit Läsionen in<br />
anterioren und posterioren Arealen zu unterschiedlichen<br />
Sprachstörungsmustern führen, lässt sich anhand von einigen<br />
systematischen Übersichtsartikeln diskutieren. In einem<br />
Überblick von insgesamt 36 in der Literatur berichteten<br />
Fällen kindlicher Aphasie zeigt sich ein interessantes<br />
Muster (Friederici 1994). Betrachtet man diejenigen 14 Fälle<br />
von kindlicher Aphasie, die jünger als 8 Jahre waren, so<br />
hatten 6 von 14 eine linkshemisphärische Läsion ohne<br />
Einschluss anteriorer Areale. Keines der Kinder mit Läsion<br />
vor dem Alter von 8 Jahren zeigte eine flüssige Aphasie<br />
(Wernicke-Aphasie oder amnestische Aphasie) und zwar<br />
unabhängig von dem Ort der Läsion. Eine Ausnahme bildete<br />
der Fall eines 5-jäh rigen Jungen, der eine flüssige Aphasie<br />
hatte, die als phonemischer Jargon beschrieben wurde<br />
(Visch-Brink u. van de Sandt-Koendermann 1984). Posteriore<br />
Läsionen im Alter von 3–8 Jahren führen nicht wie in<br />
späteren Lebensjahren zu einer Wernicke-Aphasie, sondern<br />
zu nichtflüssigen Aphasieformen. Dies deutet darauf hin,<br />
dass ein selektiv erhaltener anteriorer Anteil der linken Hemisphäre<br />
bis zum Alter von ca. 8 Jahren noch nicht in der<br />
Lage ist, syntaktische Prozeduren automatisch und unabhängig,<br />
d.h. ohne den Rückgriff auf grammatisches Wissen,<br />
das im Tem porallappen lokalisiert werden kann, zu verwenden.<br />
Erwachsene und ältere Kinder mit Läsionen im<br />
posterioren Anteil der linken Hemisphäre und gleich zeitig<br />
intakten anterioren Anteilen scheinen im Ge gensatz dazu<br />
in der Lage zu sein, syntaktische Prozeduren zur Basis ihrer<br />
Sprachproduktion zu machen. Die Folge ist eine flüssige,<br />
phonologisch und pro sodisch korrekte, wenngleich oft paragrammatische<br />
und inhaltsleere Spontansprache. Diese<br />
Ergebnisse weisen auf eine funktionale intrahemisphäre<br />
Reorganisation der Sprache im Gehirn während des Spracherwerbs<br />
hin (s. auch Basso et al. 1985, 1987a; Basso u.<br />
Scarpa 1990).<br />
Insgesamt legen die Daten der frühkindlichen Hirnschädigung<br />
von pränatal bis 6 Monaten (Thal et al. 1991)<br />
und den Aphasiestudien im Alter zwischen 3 und 8 Jahren<br />
folgendes Muster der Reorganisation nahe (Friederici<br />
1994): Es scheint als sei die rechte Hemisphäre gerade während<br />
der frühen Periode der <strong>Sprachentwicklung</strong>, d. h. im<br />
1. Lebensjahr, von besonderer Bedeutung. Kleinkinder mit<br />
früher rechtshemisphärischer Läsion im Alter vor 9 Monaten<br />
zeigen im Laufe ihrer späteren <strong>Sprachentwicklung</strong><br />
eher Probleme im Sprachverstehen als Kinder mit linkshemisphärischen<br />
Läsionen. Innerhalb der linken Hemisphäre<br />
scheinen vor allem Läsionen im posterioren Kortex<br />
zu Problemen beim Spracherwerb zu führen. Interessant<br />
ist, dass Kinder mit Läsionen in diesem Bereich Funktionswörter,<br />
die für die Erstellung syntaktischer Strukturen notwendig<br />
sind, we niger häufig verwenden, als Kinder mit<br />
Läsionen im anterioren Bereich der linken Hemisphäre.<br />
Dieses Ergebnismuster steht im Gegensatz zu der bei<br />
Erwachsenen beobachteten Relation zwischen Ort der<br />
Hirnläsion und behavioralem Defizit. Die Daten deuten<br />
darauf hin, dass bis zum Alter von etwa 1 Jahr die rechte<br />
Hemisphäre von besonderer Bedeutung für die <strong>Sprachentwicklung</strong><br />
ist, während danach die linke Hemisphäre von<br />
stärkerer Bedeutung ist als die rechte (vgl. auch Locke<br />
1994). Insbesondere die poste rioren Anteile der linken Hemisphäre<br />
unterstützen dann zunächst den Spracherwerb.<br />
Erst nach dem Alter von 5 Jahren scheinen links anteriore<br />
Gebiete für die Verarbeitung von Informationen ins Spiel<br />
zu kommen.<br />
! Läsionsstudien deuten darauf hin, dass im frühen<br />
Kindesalter sowohl die rechte Hemisphäre als auch<br />
der posteriore Kortex der linken Hemisphäre eine<br />
wichtige Rolle bei der Sprachverarbeitung spielt.
62.3 · Läsions-Verhaltens-Studien bei Kindern<br />
639<br />
62<br />
Zusammenfassung<br />
Noch ist das Bild einer möglichen Organisation und Reorganisation<br />
der Sprachfunktionen im sich entwickelnden<br />
Gehirn ungenau. Die vorhandenen Daten ermöglichen jedoch<br />
die Formulierung einiger Hypothesen.<br />
Es scheint, als sei die rechte Hemisphäre für die frühe<br />
Phase der <strong>Sprachentwicklung</strong> besonders relevant. Bei<br />
Kleinkindern mit frühkindlichen unilateralen Läsionen<br />
haben rechtshemisphärische Läsionen einen größeren negativen<br />
Einfluss auf den Verlauf des Spracherwerbs als<br />
linkshemisphärische Läsionen. Während der ersten 2 Monate<br />
lernen Säuglinge die prosodischen Aspekte ihrer<br />
Muttersprache zu identifizieren, mit 9 Monaten haben sie<br />
bereits ihr Wissen über prosodische Phrasierungsregeln<br />
ihrer Sprache. Diese Informationen werden beim Erwachsenen<br />
eher rechtshemisphärisch ver arbeitet und es ist zu<br />
vermuten, dass dies auch bei Kleinkindern so ist. Prosodische<br />
Aspekte auf der Silben- und Wortebene könnten beim<br />
Kleinkind ebenfalls zunächst rechtshemisphärisch verarbeitet<br />
werden und erst zu dem Zeitpunkt, an dem diese Information<br />
lexikalisch gebunden ist, zu vornehmlich linkshemisphärischen<br />
Aktivationen führen. Phonemische Information<br />
wird dagegen zunächst bilateral und später primär linkshemisphärisch<br />
verarbeitet.<br />
Die linke Hemisphäre gewinnt an Relevanz während<br />
des Erwerbs von Wörtern mit ihren morpho logischen Strukturen<br />
und Bedeutungen sowie mit dem Erwerb der Syntax.<br />
Hier scheinen zunächst links temporale Regionen von größter<br />
Wichtigkeit. Erst zu einem späteren Zeitpunkt kommen<br />
links frontale Regionen, vor allem für schnelle syntaktische<br />
Prozesse ins Spiel.