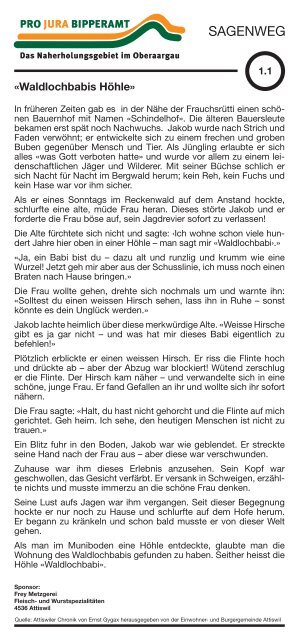Tafeln des Sagenwegs
Tafeln des Sagenwegs
Tafeln des Sagenwegs
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
SAGENWEG<br />
«Waldlochbabis Höhle»<br />
1.1<br />
In früheren Zeiten gab es in der Nähe der Frauchsrütti einen schönen<br />
Bauernhof mit Namen «Schindelhof». Die älteren Bauersleute<br />
bekamen erst spät noch Nachwuchs. Jakob wurde nach Strich und<br />
Faden verwöhnt; er entwickelte sich zu einem frechen und groben<br />
Buben gegenüber Mensch und Tier. Als Jüngling erlaubte er sich<br />
alles «was Gott verboten hatte» und wurde vor allem zu einem leidenschaftlichen<br />
Jäger und Wilderer. Mit seiner Büchse schlich er<br />
sich Nacht für Nacht im Bergwald herum; kein Reh, kein Fuchs und<br />
kein Hase war vor ihm sicher.<br />
Als er eines Sonntags im Reckenwald auf dem Anstand hockte,<br />
schlurfte eine alte, müde Frau heran. Dieses störte Jakob und er<br />
forderte die Frau böse auf, sein Jagdrevier sofort zu verlassen!<br />
Die Alte fürchtete sich nicht und sagte: ‹Ich wohne schon viele hundert<br />
Jahre hier oben in einer Höhle – man sagt mir «Waldlochbabi›.»<br />
«Ja, ein Babi bist du – dazu alt und runzlig und krumm wie eine<br />
Wurzel! Jetzt geh mir aber aus der Schusslinie, ich muss noch einen<br />
Braten nach Hause bringen.»<br />
Die Frau wollte gehen, drehte sich nochmals um und warnte ihn:<br />
«Solltest du einen weissen Hirsch sehen, lass ihn in Ruhe – sonst<br />
könnte es dein Unglück werden.»<br />
Jakob lachte heimlich über diese merkwürdige Alte. «Weisse Hirsche<br />
gibt es ja gar nicht – und was hat mir dieses Babi eigentlich zu<br />
befehlen!»<br />
Plötzlich erblickte er einen weissen Hirsch. Er riss die Flinte hoch<br />
und drückte ab – aber der Abzug war blockiert! Wütend zerschlug<br />
er die Flinte. Der Hirsch kam näher – und verwandelte sich in eine<br />
schöne, junge Frau. Er fand Gefallen an ihr und wollte sich ihr sofort<br />
nähern.<br />
Die Frau sagte: «Halt, du hast nicht gehorcht und die Flinte auf mich<br />
gerichtet. Geh heim. Ich sehe, den heutigen Menschen ist nicht zu<br />
trauen.»<br />
Ein Blitz fuhr in den Boden, Jakob war wie geblendet. Er streckte<br />
seine Hand nach der Frau aus – aber diese war verschwunden.<br />
Zuhause war ihm dieses Erlebnis anzusehen. Sein Kopf war<br />
geschwollen, das Gesicht verfärbt. Er versank in Schweigen, erzählte<br />
nichts und musste immerzu an die schöne Frau denken.<br />
Seine Lust aufs Jagen war ihm vergangen. Seit dieser Begegnung<br />
hockte er nur noch zu Hause und schlurfte auf dem Hofe herum.<br />
Er begann zu kränkeln und schon bald musste er von dieser Welt<br />
gehen.<br />
Als man im Muniboden eine Höhle entdeckte, glaubte man die<br />
Wohnung <strong>des</strong> Waldlochbabis gefunden zu haben. Seither heisst die<br />
Höhle «Waldlochbabi».<br />
Sponsor:<br />
Frey Metzgerei<br />
Fleisch- und Wurstspezialitäten<br />
4536 Attiswil<br />
Quelle: Attiswiler Chronik von Ernst Gygax herausgegeben von der Einwohner- und Burgergemeinde Attiswil
SAGENWEG<br />
«Waldlochbabis Drachen im Chällerflüeli»<br />
1.2<br />
Im Waldloch, im Attiswiler Berg, hauste einst das Waldlochbabi mit seinem<br />
bösen Hund. In dieser Höhle wohnte vor uralter Zeit ein Drache.<br />
Dieses Untier holte den Attiswilern nicht nur fette Gänse, Geissen<br />
und Schafe von den Weiden, nein es jagte auch nach Kindern. Auf<br />
junge Mädchen hatte es besonders Lust. In der Finsternis schlich es<br />
ins Dorf und passte an den Hausecken den Menschen ab.<br />
Die vermögenden Bauern liessen am Ende der Dachtraufe einen<br />
Drachenkopf als Wasserspeier installieren; dieses blecherne Ebenbild<br />
hatte die Aufgabe, das aufsässige Untier von Haus und Heim zu<br />
vertreiben.<br />
Das Waldlochbabi fand aber in seiner Höhle keine Ruhe. Eines Tages<br />
segelte sein Geist schnurstracks gegen das Drachenloch im<br />
Attiswiler Berg. Der Bewohner wollte aber sein Daheim nicht teilen<br />
und wehrte sich mit Zähnen, Klauen und Zacken gegen den Eindringling.<br />
Doch Babis Hund ging ihm an die Gurgel und Babi traf ihn<br />
mit seinem Stock auf die empfindliche Nase. Das Ungeheur ergab<br />
sich und machte sich geschlagen davon Richtung Reckenacher. Es<br />
wusste dort im Chällerflüeli eine Höhle. Hier pflegte es seine Wunden,<br />
erholte sich langsam und sann auf Rache.<br />
Doch bevor es wieder sein Unwesen treiben konnte, erschütterte<br />
ein Erdbeben die Jurahöhen und ein riesiger Felsbrocken fiel vor<br />
die Drachenhöhle. Heulend und schnaubend versuchte der Eingeschlossene<br />
die mächtigen Steinbrocken zu bewegen, diese rutschten<br />
jedoch keinen Zentimeter beiseite.<br />
Der Drache war und blieb eingesperrt!<br />
Niemand freute sich über diese glückliche Fügung mehr als die geplagten<br />
Leute von Attiswil, Farnern und Rumisberg. Jetzt durften<br />
die Kinder wieder ohne Angst auf den Gassen spielen und in den<br />
Wäldern nach Beeren suchen.<br />
Das Chällerflüeli erreicht man, von der Nordseite <strong>des</strong> Reckenachers<br />
herkommend, wenn man den «Schleipf» hinaufgeht. Der Eingang<br />
zum Drachenloch ist – gottlob – immer noch durch einen Felsbrocken<br />
verschlossen. Aus der Tiefe weht es auch bei der grössten<br />
Sommerhitze kalt und modrig herauf. Diese Kälte kommt vom Drachen,<br />
der hier im Finstern hockt und heult, weil er sich nicht befreien<br />
kann.<br />
Sponsor:<br />
Coiffure Elisabeth Ryf<br />
Dorfstrasse 10<br />
4536 Attiswil<br />
Quelle: «Flueblüemli und Aarechisle», Elisabeth Pfluger, Solothurn
SAGENWEG<br />
«Der Heiltrank vom Lindemätteli»<br />
1.3<br />
Die erste Weidhütte in der Attiswiler Teuffelen stand früher ordentlich<br />
weiter hinten. Durch einen Erdrutsch wurde sie zugedeckt; am<br />
heutigen Standort baute man eine neue Sennhütte auf.<br />
Vor Jahren bekamen die Geissen eine böse Seuche. Kein Hausmittel<br />
half dagegen.<br />
In seiner Not schickte der Senn seinen Geissbuben, um den Kräutermann<br />
zu holen. Ueli lief ins Dorf hinunter und der Kräuterdoktor<br />
brach einige Lindenzweige ab und sagte ihm, die Meisterfrau solle<br />
daraus einen Trank kochen und das zusätzlich mitgegebene Pulver<br />
beimischen.<br />
Der Geissbub eilte wieder den steilen Weg den Berg hinauf. Nichts<br />
auf der Welt war Ueli lieber als seine Geissen, <strong>des</strong>halb lief er so<br />
rasch er konnte.<br />
Auf dem Reckenacher erreichte er heftig atmend die Höhe; mit<br />
einem Male wurde ihm schwarz vor den Augen und er fiel ohnmächtig<br />
hin.<br />
Inzwischen wartete man auf der Teuffelen sehnsüchtig auf die Rückkehr<br />
<strong>des</strong> Buben; als es dunkelte, ging ihm der Senn entgegen. Mitten<br />
auf dem Weg fand er den toten Ueli. In den Händen hielt dieser<br />
die Lindenzweige und die Dose mit dem Pulver. Der Senn trug ihn in<br />
die Sennhütte. Die Meisterin kochte eilends den Trank. Die Geissen<br />
erholten sich rasch und wurden bald gesund.<br />
Die Sennenfrau sagte: «Der brave Ueli soll nicht vergebens gestorben<br />
sein. Auf diesem Heilmittel war doch ein eigener Segen gelegen.»<br />
Der Senn steckte alle fünf Lindenzweige bei jenem Mätteli in den<br />
Boden, wo er den Geissbuben gefunden hatte. Dabei bemerkte er:<br />
«Dies soll zum Andenken an unsern braven und treuen Ueli geschehen.»<br />
Fünf prächtige Linden wuchsen empor. Drei davon stehen noch heute<br />
auf dem Lindemätteli.<br />
Den Attiswilern sind sie lieb und wert. Deshalb feiern sie je<strong>des</strong> Jahr<br />
an einem Sommersonntag das Lindemättelifest.<br />
Sponsor:<br />
Gebr. F. + H. Bandi<br />
Landmaschinen<br />
4537 Attiswil<br />
Quelle: «Flueblüemli und Aarechisle», Elisabeth Pfluger, Solothurn
SAGENWEG<br />
«Ein Goldgrüblein in der Teuffelen»<br />
1.4<br />
In Attiswil stand einst in der Räbhalde, auf der Westseite vom Chänzihöfli,<br />
ein altes Strohhüttlein. Der Räbholdelipp, welcher hier mit<br />
zwei Geissen wohnte, schaute gut zu seinem Heimetli, sodass es<br />
immer aussah «wie putzt und gschläcket».<br />
Jeden Nachmittag verschwand Lipp in den Berg hinauf, und kehrte<br />
erst vor dem Einnachten wieder zurück. Es hiess, er habe im Wald<br />
oben ein Goldgrüblein entdeckt, das er nun in aller Heimlichkeit ausbeute.<br />
Einst kam er in der Morgenfrühe ins Dorf hinunter, schwer beladen<br />
mit einem gefüllten Rucksack, verschwand im Berner Schachen und<br />
liess sich von der Fähre über die Aare setzen. Erst spät kehrte er mit<br />
einem leeren Sack am Rücken zurück.<br />
Holdelipp kannte in Burgdorf einen Händler oder Goldschmied, welcher<br />
ihm den Schatz abkaufte. Dieser Käufer war aber ein bodenlos<br />
schlechter Mensch, der unbedingt den Fundort kennen wollte.<br />
Holdelipp bewahrte das Geheimnis für sich.<br />
Daher heuerte der Händler zwei Vaganten an, welche die Goldgrube<br />
ausfindig machen sollten. Heimlich verfolgten sie Lipp auf<br />
seinem Gang, verloren ihn aber beim Lindemätteli aus den Augen.<br />
Als sie ihn überall vergebens gesucht hatten, beschlossen sie, ihm<br />
bei der Rückkehr abzupassen. Lipp traf am Goletenweg auf die zwei<br />
Vaganten, die ihm mit Erschlagen drohten, wenn er ihnen den Fundort<br />
nicht sofort zeige. Holdelipp versuchte voller Angst zu verhandeln<br />
und versprach ihnen Goldketten. Die Grobiane schlugen ihn<br />
jedoch nieder, bis er zusammenbrach. Alles Schütteln und Anbrüllen<br />
nützte nichts, Lipp blieb bewusstlos liegen. Da hörten die Vaganten<br />
ein wüten<strong>des</strong> Hundegebell, das immer näher kam. Kopflos rannten<br />
sie davon, einer fiel in der Finsternis am Mälcherweg in den Bach<br />
und ertrank, sein Kumpan konnte im Berner Schachen über die Aare<br />
entfliehen.<br />
Auf dem Rottannenhof bellte der Hund weiterhin wie wild, sodass<br />
die Besitzer in den Wald hinauf stiegen. Dort fanden sie den übel<br />
zugerichteten Räbholdelipp, welcher mit letzter Anstrengung vom<br />
Vorgang erzählen und dem Rottannenbauern sein Geheimnis vom<br />
Goldgrüblein anvertrauen wollte. Es war ihm aber nicht vergönnt,<br />
den Satz zu beenden, in den Armen <strong>des</strong> Bauern überkam ihn erneut<br />
eine Schwäche und er starb.<br />
Das Geheimnis nahm Holdelipp mit ins Grab. Viele Attiswiler haben<br />
seither in der Teuffelen nach dem Goldschatz gesucht.<br />
Aber die Teuffelenweid ist gross! Gefunden hat das Gold noch<br />
niemand.<br />
Sponsor:<br />
HOFSTETTER AG FLUMENTHAL<br />
Heizungen, Tankrevisionen<br />
4534 Flumenthal + 4536 Attiswil<br />
Quelle: «Flueblüemli und Aarechisle», Elisabeth Pfluger, Solothurn
SAGENWEG<br />
«Ein Teufelsvertrag beim Höchchrütz»<br />
1.5<br />
Das «Höch Chrüz» ist ein prächtiger Aussichtspunkt, wo der Fussweg<br />
zum Hofbergli und zur Schmiedenmatt abzweigt. Hier auf Attiswiler<br />
Boden, nahe an der Grenze zu Günsberg stand einst ein Kreuz.<br />
Mit diesem Kreuz ist folgende Sage verbunden:<br />
In der heutigen Teuffelen Alpweide – früher Flüeweid genannt – wuchs<br />
das kräftigste Gras und die besten Kräuter. Die Geissen und Rinder<br />
wurden satt und rund. Auf Haus und Hof lag der Segen Gottes;<br />
ihm wollte man dafür mit dem Erstellen eines Kreuzes hoch oben<br />
auf den Flühen danken. Bald wurde dieser Platz ein beliebter Ort<br />
für Attiswiler, Rumisberger und Farnerer, aber auch von Bewohnern<br />
vom Leberberg.<br />
Auf die Flüeweid wurde ein neuer Senn verpflichtet, für den nichts<br />
als Geld zählte: «Geld regiert die Welt» war sein Wahlspruch.<br />
Um an Macht und Geld zu kommen, machte er mit dem Teufel einen<br />
Vertrag. Er setzte seine Seele ein gegen 7 Säcke Golddukaten, auszuzahlen<br />
an jenem Tag, an dem das Attiswilerkreuz fallen würde.<br />
Die gute Sennenfrau ahnte, dass ihr geldgieriger Mann etwas plante,<br />
er sprach davon in seinen Träumen. An einem nebligen Herbstmorgen<br />
machte er sich zu den Flühen auf. Gegen Mittag war im Dorf ein<br />
grosses Donnern zu vernehmen, zu sehen war nichts. Erst anderntags<br />
wagten sich mutige Männer hinauf, fanden unter dem gefällten<br />
«Höch Chrüz» den toten Senn mit der Säge in den verkrampften<br />
Fingern.<br />
Das also war <strong>des</strong> Teufels Dank für diesen Frevel, wozu er den Senn<br />
angestiftet hatte.<br />
Die Männer wurden von Grausen gepackt und mieden lange den<br />
ehemaligen Standort <strong>des</strong> Kreuzes.<br />
Seit diesem Frevel wich auch der Segen von der Flüeweid; es gab<br />
Erdrutsche, die Tiere bekamen Seuchen und starben. Die Attiswiler<br />
waren erbost und meinten: «Der Teufel regiert dort oben. Man sollte<br />
die Weide besser Teufelsweid nennen.»<br />
Es kamen wieder gute Jahre. Aber der Namen Teufelsweid, oder<br />
kurz gesagt «Teuffelen» ist geblieben. Ein neues Kreuz wollten die<br />
Attiswiler nicht mehr errichten.<br />
Nur der Name «Höch Chrüz» ist für diesen schönen Flecken Erde<br />
bis heute erhalten geblieben.<br />
Sponsor:<br />
Tomax GmbH<br />
Mech. Werkstatt u. Instandhaltung<br />
4537 Wiedlisbach<br />
Quelle: «Flueblüemli und Aarechisle», Elisabeth Pfluger, Solothurn
SAGENWEG<br />
«Der Pestfriedhof»<br />
bei der vorderen Schmiedenmatt<br />
1.6<br />
Unter der vorderen Schmiedenmatt, kurz nach der Abzweigung<br />
gegen Herbetswil und dem Horngraben, gibt es ein ebenes Bödeli.<br />
Diesem sagt man das Chilchhöfli.<br />
Das Land gehört zur vorderen Schmiedenmatt, liegt aber auf Solothurner<br />
Boden, in der Gemeinde Herbetswil.<br />
Die alten Leute aus den Bergdörfern erzählten, dass man hier, als in<br />
früheren Zeiten der «schwarze Tod» umgegangen sei, einen Pest-<br />
Friedhof angelegt habe.<br />
Es wurde den Bergdörfern auf regierungsrätlichen Beschluss verboten,<br />
ihre an der Pest Verstorbenen wegen der Ansteckungsgefahr<br />
auf den Kilchhöfen zu bestatten.<br />
Für Farnern, Rumisberg und Wolfisberg war somit der Friedhof von<br />
Oberbipp gesperrt. Es hiess, dass man ganz abseits einen Pestfriedhof<br />
anlegen müsse. So hob man denn auf der Schmiedenmatt<br />
eine Grube aus und bestreute sie mit ungelöschtem Kalk.<br />
Dort wurden dann in bösen Zeiten die Toten begraben.<br />
Deswegen heisst dieses Bödeli noch heute das Chilchhöfli.<br />
Sponsor:<br />
Erich Uebelhardt<br />
Rennservice<br />
Solothurnstrasse 19<br />
4702 Oensingen<br />
Quelle: «Flueblüemli und Aarechisle», Elisabeth Pfluger, Solothurn
SAGENWEG<br />
«Die Bettlerküche»<br />
1.7<br />
Will man von Farnern zur Schmiedenmatt hinauf, so gelangt man<br />
auf der Höhe vor dem Durchbruch auf ein ebenes Plätzchen. Diesem<br />
sagt man heute «Bättlerchuchi».<br />
Die richtige Bettlerküche liegt aber am alten Weg oberhalb von diesem<br />
Felsentor. Berggänger, die den Jura bestens kennen, behaupten,<br />
dies sei der schönste Platz der Welt! Man geniesst eine Rundsicht<br />
wie selten irgendwo und es wachsen Pflanzen, die es sonst<br />
weit und breit zu suchen gilt. Also ein besonderer Ort.<br />
Als Erklärung der Bezeichnung «Bettlerküche» liegen zwei Versionen<br />
vor:<br />
Auf dem Uebergang vom Kanton Bern in den Kanton Solothurn<br />
lagerten sich gerne fahrende Kessel- und Schirmflicker, machten<br />
hier Rast und erlabten sich an ihren erbettelten oder gestohlenen<br />
Sachen. Man hörte sie nicht selten bis ins Dorf hinunter singen,<br />
lachen und jolen. Das aufsteigende Räuchlein <strong>des</strong> Lagerfeuers zeigte<br />
der Dorfbevölkerung, dass die «Bettler kochten».<br />
Jagten dann die Berner Landjäger das Gesindel fort, lagerten sie<br />
sich mit Kind und Kegel auf der Solothurner Seite, beim Hofbergli,<br />
bis sie auch von dort wieder verscheucht wurden und auf den angestammten<br />
Platz auf die Bettlerküche zurückkehrten!<br />
Andere Erzähler meinen, der Name Bättlerchuchi stamme aus der<br />
Zeit, als die mausarmen Welschenrohrer im 19. Jahrhundert ins<br />
Bipperamt kamen um zu betteln. Auf dem Heimweg hätten sie hier<br />
im Durchbruch gerastet, sich an einem Feuer gewärmt und etwas<br />
aus dem Bettelsack zu sich genommen, bevor sie den Weg ins<br />
Rosinlital wieder unter die Füsse nahmen.<br />
Es wird vermutet, dass schon die Römer diesen Übergang als Saumpfad<br />
benutzt haben, da hier römische Münzen gefunden wurden.<br />
Sponsor:<br />
Maya + Peter Probst-Mühlberg<br />
Tannackerstr. 2<br />
4539 Farnern<br />
Quelle: «Flueblüemli und Aarechisle», Elisabeth Pfluger, Solothurn
SAGENWEG<br />
«Der Geisterjäger an der Grenzbuche»<br />
1.8<br />
Um die Wende zum 20. Jahrhundert wanderten zwei Bauern aus<br />
Farnern eines Sonntags zusammen auf die Buchmatt ob Wolfisberg.<br />
Einer von den beiden, Brunnmattsämi, war geistersichtig, das<br />
heisst, er verfügte über besondere Gaben: er konnte Wasservorkommen<br />
ausfindig machen und bei Unglück im Stall musste er überall<br />
mit Rat und Tat zu Hilfe eilen. Er war eben an einem Allerseelentag,<br />
am 2. November 1855 zur Welt gekommen.<br />
Am späten Nachmittag, als sich die Beiden auf dem Heimweg<br />
befanden, warnte Brunnmattsämi seinen Freund Gottfried: «Wir werden<br />
nun beim Grenzgatter einem Jäger mit zwei Hunden begegnen.<br />
Sage ja kein Wort zu ihm, denn er ist ein Geist!»<br />
Kurz darauf tauchte wirklich der besagte Mann auf, mit einer Flinte<br />
über der Achsel und zwei Jagdhunden. Der Jäger starrte gerade<br />
aus, als ob die zwei Männer Luft wären; er entbot den Bauern keinen<br />
Gruss und marschierte mitten auf dem Weg, als ob er weit und<br />
breit der Einzige wäre.<br />
Brunnmattsämi und Gottfried wichen ihm aus, getrauten sich dann<br />
aber zurück zu schauen: der Jäger und seine Hunde waren verschwunden,<br />
wie wenn sie der Boden verschluckt hätte.<br />
Der geistersichtige Sämi war jenem Jäger hier schon oft begegnet<br />
und er wusste auch, wer dieser war.<br />
Den Namen verriet er aber nie. Er meinte, dass man jemanden, der<br />
wegen einer ungesühnten Untat die ewige Ruhe noch nicht gefunden<br />
hat, nicht der Neugier der Leute aussetzen sollte.<br />
Sponsor:<br />
Einwohnergemeinde Wiedlisbach<br />
4537 Wiedlisbach<br />
Quelle: «Flueblüemli und Aarechisle», Elisabeth Pfluger, Solothurn
SAGENWEG<br />
«Stinia hoo» beim Ankehubel<br />
1.9<br />
Auf dem Berghof Buchmatt ob Wolfisberg wurde seit Menschengedenken<br />
eine Hirterei betrieben.<br />
Vor vielen Jahren lebte ein besonders flottes Ehepaar auf der Buchmatt.<br />
Beide waren arbeitsam und lebten in Frieden zusammen. Doch<br />
dann begann der Hirt nach andern Frauen zu schauen, besonders<br />
eine junge, hübsche Rumisbergerin hatte es ihm angetan. Diese<br />
wollte aber nichts von ihm wissen und gab zu verstehen: «Du hast<br />
ja eine Frau – und zwar eine brave, gute, wie sie nicht so bald zu<br />
finden ist! Trag Sorge zu deiner Stinia!»<br />
Böse, voll vor Verlangen nach der jungen Rumisbergerin, ging der<br />
Senn mit vernebelten Sinnen nach Hause. Tage darauf fand man<br />
Stinia tot am Fusse der Randfluh liegen. Beim Eintreiben der Rinder<br />
hätte sie wahrscheinlich einen Fehltritt getan und sei über die Fluh<br />
gefallen, liess der Senn vernehmen.<br />
Alle im Berg schüttelten darob die Köpfe; man munkelte: «Hat sie<br />
wohl einer anderen Platz machen müssen?»<br />
Kaum war Stinia begraben, klopfte der Hirt erneut bei der Rumisbergerin<br />
an, die ihn abwies und ihm vorhielt, dass man überall über<br />
den mysteriösen To<strong>des</strong>fall rede – er solle sich nur mal umsehen und<br />
umhören!<br />
Jetzt fiel auch ihm auf, dass ihm die Menschen aus dem Wege<br />
gingen.<br />
Beweisen konnte ihm die Tat niemand, dass man aber so etwas von<br />
ihm vermutete, traf den Mann schwer. Er verschloss sich seiner Umwelt,<br />
versank in seinem Elend und begann übermässig zu trinken.<br />
Wie gerne hätte er jetzt seine Stinia zurückgehabt. Abends wankte<br />
er über die Weide zur Randfluh und rief immer wieder: «Stinia hoo!<br />
Stinia hoo!»<br />
Der gestrafte Mann starb nach einigen Wochen an Schuld und<br />
Schande. Man legte ihn neben Stinia ins Grab.<br />
Eine neue Sennenfamilie zog in der Buchmatt ein. Abend für Abend<br />
sahen sie ein Lichtlein gegen die Randfluh wanken und eine hohle<br />
Stimme rufen «Stinia hooooo».<br />
Es gibt heute noch Leute mit einem besonderen Gespür, die den<br />
unglücklichen Buchmattsenn nach seiner Stinia rufen hören.<br />
Besonders wenn das Wetter ändert und der Luterbacherluft oben<br />
hineinfährt oder im Winter, wenn der Bisluft so recht bläst, heisst es:<br />
«Stinia wäscht, es gibt schönes Wetter!»<br />
Sponsor:<br />
Einwohnergemeinde Wolfisberg<br />
4704 Wolfisberg<br />
Quelle: «Flueblüemli und Aarechisle», Elisabeth Pfluger, Solothurn
SAGENWEG<br />
«Der Buchmattschatz»<br />
1.10<br />
Grosses Verlangen und Lust auf den Buchmattschatz zeigten die<br />
alten Rumisberger und Wolfisberger in früheren Zeiten. Jedoch<br />
konnte niemand genau sagen, wer diesen Schatz versteckt hat und<br />
noch weniger konnte man erfahren, wo man ihn überhaupt suchen<br />
müsste.<br />
Mit den Jahren wurde immer mehr vermutet und behauptet. Aber<br />
trotz allem Grübeln und hin und her Rätseln wurde dieser Schatz<br />
nicht gefunden.<br />
Es kursierten verschiedene Geschichten:<br />
Wolfisberger behaupteten, irgendwo auf den Flühen beim Hellchöpfli<br />
könnte man ihn finden. Ein Geist müsse den Schatz hüten, wäre aber<br />
glücklich, wenn ihn jemand holen und ihn damit erlösen würde.<br />
Dieser Geist wäre aber nur zwischen Weihnachten und Dreikönigstag<br />
anzutreffen. In der Geisterstunde müsste er mit den drei höchsten<br />
Namen angesprochen und gefragt werden: «Wie kann man<br />
der armen Seele helfen?». Mit dieser Frage wäre der Buchmattgeist<br />
erlöst und der Schatz freigelegt, man könnte ihn nur noch nach<br />
Hause tragen.<br />
In der Randfluh, in Stinis Lauch, gibt es eine Höhle, in welcher die<br />
Burschen der drei Bergdörfer schon oft nach dem Schatz gesucht<br />
haben. Sie liessen sich abseilen, fanden nur Tropfsteine aber keinen<br />
Goldschatz.<br />
Andere vermuteten, der Goldschatz sei im Umkreis <strong>des</strong> Sennhauses<br />
vergraben; nur wenig tief unter dem Boden, im Schnittpunkt von drei<br />
alten Buchen. Schon viele haben dort gelocht. Aber man sollte eben<br />
ohne Absicht daherkommen und einfach darauf stossen – sonst ist<br />
alles vergebene Liebesmühe.<br />
Sponsor:<br />
Bösiger Gemüsekulturen AG<br />
4704 Niederbipp<br />
Quelle: «Flueblüemli und Aarechisle», Elisabeth Pfluger, Solothurn
SAGENWEG<br />
«Sieben Kaiserliche fehlen»<br />
1.11<br />
Nach der Völkerschlacht von 1813 bei Leipzig marschierte ein Teil der<br />
kaiserlichen Armee durch die Schweiz, um daraufhin in Frankreich<br />
Napoleon in die Zange zu nehmen. Diese «Kaiserlichen» führten sich<br />
zum Teil in der Schweiz schlimmer auf als zuvor die Franzosen!<br />
Um Weihnachten 1813 wurden all diese Soldaten – Serben, Kroaten,<br />
Tschechen, Ungaren, Polen und Russen – auf die Haushalte der<br />
Dörfer verteilt, und man musste sie gratis und franko verköstigen<br />
und ihnen Unterkunft anbieten.<br />
Unter diesen Soldaten hatte es einige ganz aufsässige und ungehobelte<br />
Kostgänger. Sie meinten, auch Frauen und Töchter der Bauern<br />
gehörten zu den Annehmlichkeiten – dabei hatten sie aber nicht<br />
mit den Männern und Jünglingen von Wolfisberg gerechnet. Diese<br />
zeigten ihnen, wer Meister im Hause ist!<br />
Als am andern Morgen zum Appell geblasen wurde, fehlten sieben<br />
«Kaiserliche».<br />
Man wartete eine gewisse Zeit, aber die sieben Fehlenden rückten<br />
nicht ein. Die Wolfisberger zuckten die Achseln, man konnte und<br />
wollte nichts erklären.<br />
Der Hauptmann ahnte wohl etwas, wollte sich aber mit der Dorfbevölkerung<br />
auf keinen Kleinkrieg einlassen. Wohl oder übel blies man<br />
zum Abmarsch und die Wolfisberger konnten wieder auf atmen.<br />
Als einige Jahre später im Waulergraben ein alter Birnbaum gefällt<br />
wurde, kamen unter seinen Wurzeln Schädel, Knochen und Uniformknöpfe<br />
zu Tage.<br />
Die Wolfisberger hatten zur Kriegszeit alle Stillschweigen über dieses<br />
Vorkommnis bewahrt und niemandem etwas davon verraten.<br />
Man deckte wieder alles zu; die Sache war verjährt – nur eine alte,<br />
schauerliche Geschichte durfte endlich ohne Bangen weitererzählt<br />
werden.<br />
Sponsor:<br />
Ulrich Leuenberger<br />
Waldengässli 10<br />
4704 Wolfisberg<br />
(dr Bärgler )<br />
Quelle: «Flueblüemli und Aarechisle», Elisabeth Pfluger, Solothurn
SAGENWEG<br />
«Die Dame von Oggehüsere»<br />
1.12<br />
Im Gemeindegebiet von «Oggehüsere», oberhalb von Niederbipp<br />
lebte vor vielen Jahren ein Mädchen, welchem man nachsagte, dass<br />
es den «sechsten Sinn» habe. Es sah und spürte Dinge, von welchen<br />
andere Leute nichts merkten.<br />
Es war eine Gabe, die Gutes auslöste, aber auch ihre Kehrseiten<br />
hatte.<br />
Als Lineli eines Nachmittags ins Dorf hinunter spazierte, begegnete<br />
ihm eine wunderschöne Dame. Diese trug ein prächtiges,<br />
blauseidenes Kleid. Die blonden Haare und die klarblauen Augen<br />
erinnerten das Mädchen an ein Bild, welches es einst von einer Edelfrau<br />
gesehen hatte.<br />
Ganz ehrfürchtig und freundlich wollte Lineli die Dame grüssen und<br />
sagte <strong>des</strong>halb: «Einen guten Tag gebe Euch Gott.»<br />
Bei diesen Worten leuchteten die Augen der blaugekleideten Frau<br />
glückselig auf. Darauf verschwand sie ohne nur ein Wort zu sagen<br />
vor den Augen <strong>des</strong> erstaunten Mädchens. Es aber wusste: «Mit<br />
meinen guten Wünschen habe ich sie erlöst!»<br />
Es wurde ihm leicht und froh ums Herz. Zuhause erzählte es von<br />
der Begegnung. Trotz allem Raten und Nachdenken fanden sie nie<br />
heraus, ob die verwunschene Dame eine Edelfrau der Erlinsburg<br />
oder eine Landvögtin gewesen war.<br />
Niemand kannte eine Begebenheit, die dazu geführt haben könnte,<br />
dass diese schöne Edelfrau bis zur Begegnung mit Lineli unerlöst<br />
umherirren musste.<br />
Für alle blieb es ein Geheimnis.<br />
Sponsor:<br />
Einwohnergemeinde<br />
4704 Niederbipp<br />
Quelle: «Flueblüemli und Aarechisle», Elisabeth Pfluger, Solothurn
SAGENWEG<br />
«Hans Roth – der Retter von Solothurn»<br />
2.1<br />
1382 erwies Hans Roth von Rumisberg der Stadt Solothurn einen<br />
grossen Dienst.<br />
Auf Schloss Bipp regierte ein junger Graf, Rudolf von Kyburg. Er war<br />
verschuldet und sann daher darüber nach, wie er die reiche Stadt<br />
Solothurn einnehmen könnte.<br />
Mit einigen Kameraden beriet er sich über einen möglichen Überfall.<br />
Hans von Stein, wohnhaft an der Ringmauer in Solothurn, wollte<br />
ihm behilflich sein, indem er in einer finstern Nacht Strickleitern<br />
über die Stadtmauern hinunterlassen würde. Am Abend vor Sankt<br />
Martinstag war es soweit. Im Gasthof «Schlüssel» besprachen die<br />
Verbündeten Einzelheiten, achteten aber nicht darauf, dass hinter<br />
dem Kachelofen ein Bauer hockte, Hans Roth aus Rumisberg. Dieser<br />
spitzte seine Ohren, als er von einer Verschwörung hörte. Plötzlich<br />
wurde er entdeckt und man wollte ihn sogleich erstechen.<br />
Hans Roth musste schwören, dass er keiner lebendigen Seele<br />
davon erzählen würde. Darauf liessen sie ihn springen. Er wollte es<br />
wagen, die Solothurner zu warnen. Da frisch gefallener Schnee lag,<br />
band er seine Holzpantoffeln verkehrt herum an; so schien es, als sei<br />
einer von Solothurn nach Wiedlisbach gegangen. Um Mitternacht<br />
gelangte er vors verriegelte Baseltor; einem Wächter durfte er nicht<br />
rufen, sonst hätte er seinen Schwur gebrochen. Darum wandte er<br />
sich an die Steinfigur am Tor: «Du heiliger St. Urs, höre! Die Kyburger<br />
kommen, sie wollen die Stadt überfallen. Von Wiedlisbach her<br />
sind sie schon unterwegs!»<br />
Der Torwächter hörte die laute Rede, schlug Alarm, ganz Solothurn<br />
erwachte und bewaffnete alle Türme, Tore und Wehrgänge. Die<br />
Kyburger vernahmen bereits vor den Toren der Stadt das Sturmgeläute<br />
und merkten, dass sie verraten worden waren. Wütend zündeten<br />
sie vor der Stadt Bauernhäuser an; ein Stosstrupp der Solothurner<br />
jagte die Frevler in die Flucht.<br />
Der brave Hans Roth von Rumisberg aber, welcher sein eigenes<br />
Leben aufs Spiel gesetzt hatte, kam zu hohen Ehren. Zum Dank<br />
liess ihm die Stadt ein Kleid machen in den Stan<strong>des</strong>farben rot und<br />
weiss; zudem erhielt er einen Ehrensold.<br />
Noch heute erhält der Älteste seiner Nachkommen die Gaben. Bei<br />
allen Festanlässen und Feiern <strong>des</strong> Stan<strong>des</strong> Solothurn ist Hans Roth<br />
als Ehrengast dabei.<br />
So ist dafür gesorgt, dass sein gescheiter und mutiger Ahnvater von<br />
Rumisberg nicht in Vergessenheit gerät.<br />
Sponsor:<br />
Einwohnergemeinde<br />
4539 Rumisberg<br />
Quelle: «Flueblüemli und Aarechisle», Elisabeth Pfluger, Solothurn
SAGENWEG<br />
«Die roten Hunde vom Haltenacher»<br />
2.2<br />
In Rumisberg stand bis etwa 1940 zuoberst an der Haltengasse ein<br />
Bauernhof, der «Haltenacherhof». Davon erzählte man sich viele<br />
ungeheuerliche und unerklärliche Dinge.<br />
Manchem, welcher über diesen Fussweg nach Farnern oder in die<br />
Schoren wollte, begegneten <strong>des</strong> Abends zwei rote Hunde, die mitten<br />
im Weg standen und den Wanderer nicht passieren liessen. Es<br />
blieb nichts anderes übrig, als zurück zu weichen und das Ziel mit<br />
einem weiten Umweg anzugehen.<br />
Auch an klaren Tagen war es in diesem Haus ungeheuerlich. Dienstmägde<br />
und Knechte verliessen jeweils diesen Arbeitsplatz nach<br />
kurzer Zeit. Sie erzählten, bei einer Wetteränderung stöhne und<br />
ächze das ganze Haus, und ein Jammern sei von zuoberst bis in<br />
den Keller zu hören, dass es einem heiss und kalt über den Rücken<br />
fahre!<br />
Als der Besitz wechselte, warnte man den neuen Eigentümer wegen<br />
der Geister im Hause. Er aber meinte, den roten Hunden werde er<br />
schon den Meister zeigen und das Gejammer und Geseufze komme<br />
von einem unterirdischen Wasserlauf, der zeitweise eingetrocknet<br />
sei. Wenn dann neues Wasser nachlaufe, gebe es diese unheimlichen<br />
Laute.<br />
Wie auch immer: unheimlich war es je<strong>des</strong> Mal, wenn man daran<br />
vorbeikam!<br />
Im August 1940 ist der Haltenacherhof abgebrannt. Niemand hatte<br />
mehr den Mut, den Bauernhof neu aufzubauen.<br />
Auch die roten Hunde sind seither niemandem mehr begegnet – wer<br />
weiss, vielleicht schlummern sie irgendwo, um plötzlich wieder aufzutauchen<br />
und die friedlichen Wanderer zu erschrecken!<br />
Sponsor:<br />
Heidi + René Lanz<br />
Haltengasse 1<br />
4539 Rumisberg<br />
Quelle: «Flueblüemli und Aarechisle», Elisabeth Pfluger, Solothurn
SAGENWEG<br />
«Hexe in der Kuhgasse»<br />
2.3<br />
Früher ging es in der Gegend um den Haltenacher in Rumisberg<br />
oft nicht mit rechten Dingen zu und her. An der Haltenacherstrasse<br />
stellten sich die roten Hunde dem Wanderer in den Weg und etwas<br />
weiter oben, bei der Abzweigung in die Kuhgasse sollen Hexen ihr<br />
Unwesen getrieben haben.<br />
Bei der Eiche, deren Äste weit in die Farnererstrasse hinausragen,<br />
musste ein böses Weib umhergeistern, weil es zu Lebzeiten mit verlogenem<br />
Gerede die Leute hintereinander gebracht hat.<br />
In der Dämmerung und in klaren Nächten sah man sie hier als<br />
abschrecken<strong>des</strong> Beispiel an den Pranger, das heisst an die Eiche,<br />
gestellt.<br />
Ein Bauer, welcher mit seinem Ross und Wagen Mehl in der Mühle<br />
Oberbipp abholte, fuhr der Strasse entlang nach Farnern. Man<br />
warnte ihn, etwa hundert Meter vor der Eiche abzusteigen und das<br />
Ross am Halfter zu führen, da es sonst scheuen und über den Weg<br />
hinausspringen könnte.<br />
Nur mit gutem Zureden, Flattieren und Tätscheln war es möglich,<br />
das brave Ross an der verhexten Eiche vorbei zu führen! Ein Ungeheuer<br />
oder eine verhexte Frau konnte der Fuhrmann aber nirgends<br />
wahrnehmen.<br />
In der heutigen Zeit, wo nur noch selten jemand mit einem Pferd an<br />
der Eiche vorbeikommt, ist nichts mehr von der verhexten Stelle zu<br />
verspüren.<br />
Ist das Weib mit dem Lästermaul endlich erlöst worden oder sind<br />
wir nicht mehr fähig, solche «ungeheuerlichen» Dinge und Orte zu<br />
fühlen?<br />
Sponsor:<br />
René Flury<br />
Kuhgasse<br />
4539 Rumisberg<br />
Familie Wisler<br />
Kuhgasse 18<br />
4539 Rumisberg<br />
Quelle: «Flueblüemli und Aarechisle», Elisabeth Pfluger, Solothurn
SAGENWEG<br />
«Die Muuserhöhle»<br />
2.4<br />
In den Bergdörfern <strong>des</strong> Bipperamtes pflegte man zu einem Kind,<br />
welches zu Geld nicht Sorge tragen konnte, zu sagen: «So kann<br />
das nicht weitergehen – sonst müssen wir beim Muuserhans neue<br />
Fünfliber machen lassen!»<br />
Dieser schlaue Muuserhans muss um 1800 gelebt haben. Man<br />
erzählte sich, dass er einen Präge-Stock zur Anfertigung von Fünffränklern<br />
besass. Missgünstige Menschen haben ihn verraten. Die<br />
Regierung nahm ihm die Prägevorrichtung weg und steckte den<br />
Muuserhans ins Gefängnis.<br />
Seine Frau und die Kinder hatten den Ernährer verloren und nagten<br />
am Hungertuche.<br />
Jahre später erwarben die Nachkommen ein kleines Heimetli oberhalb<br />
<strong>des</strong> Kaltenbrunnens in Rumisberg. Die drei Männer haushalteten<br />
und werkelten zusammen, so gut es eben ging, aber sie hatten<br />
auch viel Streit untereinander.<br />
So zog es der Jüngste vor, in eine Höhle an der Hintereggstrasse zu<br />
ziehen. Bevor man in die «Foore» kommt, zweigen von der Strasse<br />
Tritte gegen zwei Felsbrocken ab, die einen Hohlraum bilden.<br />
Darunter richtete Köbi sein Logis ein, in welchem er den Sommer<br />
über hauste. Er schnitt Reisig und fertigte Besen an, die er in der<br />
Umgebung verkaufte. Was er sonst zum Leben benötigte, lieferte<br />
ihm der Wald.<br />
Im Winter arbeitete und wohnte Muuser-Köbi bei einem Bauern. Aber<br />
sobald es warm wurde, zog es ihn wieder in seine Felsenwohnung.<br />
Seither heissen diese beiden Felsen, die zusammen ein Dach<br />
bilden, «Muuserhöhli».<br />
Sponsor:<br />
Landor AG<br />
Quelle: «Flueblüemli und Aarechisle», Elisabeth Pfluger, Solothurn
SAGENWEG<br />
«Waldlochbabis Grab» Moosgasse<br />
3.1<br />
Im Attiswiler-Berg befindet sich die Höhle <strong>des</strong> Waldlochbabis. Man<br />
erreicht diese vom Muniboden her gegen den Bach hinunter. Von<br />
diesem Waldlochbabi erzählen die Attiswiler eine ungeheuerliche<br />
Geschichte:<br />
Vor mehr als zweihundert Jahren regierte auf einem der währschaften<br />
Attiswiler Bauernhöfe ein hartherziges Weibervolk, mit<br />
Namen «Babi». Dieses war eingebildet, war hartherzig und kein armseliger<br />
Mensch bekam von ihm je ein Almosen. Babi selber lebte<br />
aber im Überfluss und gönnte sich viele überflüssige Dinge.<br />
Es wurde immer geiziger. Ein böser Hofhund sorgte dafür, dass sich<br />
in Hungerjahren keine armen Bettler zum Hause wagten. Abends<br />
zählte Babi die vielen Taler. Bei dieser Tätigkeit erlitt es einen Hirnschlag.<br />
Man fand es kalt und tot in seinen Dukaten liegen. «Der<br />
Geiz-Teufel hat es geholt» wurde gemunkelt.<br />
Im Grab auf dem Friedhof in Oberbipp fand Babis Seele aber keine<br />
Ruhe. Man hörte aus der Gruft ein Schnaufen und Ächzen, sodass<br />
sich mancher nicht mehr über den Friedhof zu gehen getraute.<br />
Am Gründonnerstag sah der Siegrist wie etwas Graues aus dem<br />
Grab kroch, in die Luft stieg und davon flog. Der erschrockene<br />
Kirchendiener beschrieb das Wesen als mordsgrossen Taubenvogel<br />
ohne Flügel!<br />
Seither wohnt Babis Seele im Waldloch oben und hütet dort seine<br />
Schätze.<br />
Ein junger, lediger Bursche könnte Babi vom Fluch erlösen. In<br />
der Weihnachtswoche oder am Karfreitag müsste er ins Waldloch<br />
hinaufsteigen, ihm die Hand geben und es lieb anschauen. Aber<br />
er dürfte dies nicht wegen <strong>des</strong> Gel<strong>des</strong> tun, sondern aus lauter<br />
Erbarmen mit der armen Seele.<br />
Bis heute hat dieses Kunststück noch kein Bursche zustande<br />
gebracht.<br />
Babi wartet noch immer, und der böse Hofhund streckt seinen versteinerten<br />
Kopf zur Höhle hinaus.<br />
Wenn Nebelschwaden vom Waldloch her wehen und über den Berg<br />
streichen, sagen die Attiswiler: «S’Waldlochbabi küechelt – das<br />
Wetter wird schlecht!»<br />
Sponsor:<br />
Eugen Mägli-Weber<br />
Stierenweidstrasse 30<br />
4538 Oberbipp<br />
Quelle: «Flueblüemli und Aarechisle», Elisabeth Pfluger, Solothurn
SAGENWEG<br />
«Ein merkwürdiges Geistertier»<br />
3.2<br />
Die alten Oberbipper erzählen, dass es in der untersten Kurve von<br />
der Schlossstrasse nicht ganz geheuer sei.<br />
In früheren Zeiten beging ein Landvogt einmal ein grausames<br />
Unrecht, das er jedoch bestritt. Ein Unschuldiger musste an seiner<br />
Stelle eine harte Strafe erleiden.<br />
Der Landvogt aber nahm seine Schuld mit ins Grab. Weil er zu Lebzeiten<br />
nie zu seinem Unrecht gestanden hatte, fand er im Jenseits<br />
keine ewige Ruhe.<br />
Als Geist musste er <strong>des</strong>halb in gewissen Nächten in jener Gegend<br />
herumfahren, wo er sich versündigt hatte und das grosse Unrecht<br />
geschehen war.<br />
Manche Oberbipper, die nachts auf der Schlossstrasse marschierten,<br />
sahen in der Nähe eine merkwürdige Gestalt heranschleichen.<br />
Sie konnten diese jedoch nie recht beschreiben. Einige sagten, sie<br />
sähe einem Hund oder Kalb ähnlich, andere wieder erkannten eher<br />
einen Schafbock oder ein Muneli.<br />
Gewisse Leute hörten <strong>des</strong> Nachts nur ein Rattern und Klirren, als<br />
ob Ketten über den Boden geschleift würden. Fuhrleute sagten, ihre<br />
Zugrosse am Wagen seien darob arg erschrocken und im Galopp<br />
davon gerannt – sogar mit angezogener Bremsmechanik.<br />
Seit mehr als fünfzig Jahren hat das merkwürdige Tier im untersten<br />
Schlossrank niemand mehr wahrgenommen.<br />
Es hat alles eben «seine Zeit».<br />
Die Oberbipper vermuten, dass der besagte Landvogt in der Zwischenzeit<br />
erlöst worden sei.<br />
Wer weiss allerdings mit Sicherheit, ob nicht eines Tages wieder ein<br />
absonderliches Tier auftauchen könnte – diesmal aber im oberen<br />
Schlossrank.<br />
Darum aufgepasst, es könnte jedermann begegnen!<br />
Sponsor:<br />
Restaurant Rössli<br />
Elisabeth Affolter-Schärer<br />
Rössliweg 1<br />
4538 Oberbipp<br />
Quelle: «Flueblüemli und Aarechisle», Elisabeth Pfluger, Solothurn
SAGENWEG<br />
«Der Grenzhund»<br />
3.3<br />
Der Blaukreuzchor in Wiedlisbach wurde durch den Oberbipper<br />
Hans Anderegg (Beckejoggeli Hans genannt) geleitet. Im Sommer<br />
und im Winter musste er jede Woche einmal den Weg nach Wiedlisbach<br />
und zurück unter die Füsse nehmen.<br />
Der Nachhauseweg bereitete ihm jeweils eine grosse Überwindung.<br />
Es wurde eben gemunkelt, dass beim Ausmarchen der Grenze zwischen<br />
Oberbipp und Wiedlisbach etwas nicht mit rechten Dingen<br />
zugegangen sei! Der Schuldige, welcher damals das March falsch<br />
setzte, müsse seither zur Strafe als «greebelige» Grenzhund umherirren.<br />
Alle Jahre sah Hans diesen Grenzhund drei bis vier Mal. Vom Einisbüel<br />
herauf kam er, überquerte die Strasse am Marchstein vorbei<br />
und verschwand der Grenze entlang gegen die Widmi hinauf.<br />
Beckjoggeli Hans kannte das Tier – aber gleichwohl überlief ihn<br />
je<strong>des</strong> Mal eine Hühnerhaut und es standen ihm die Haare zu Berge!<br />
Er liebte Hunde – aber der Grausen vor diesem mächtigen Hund<br />
schüttelte ihn bei jedem Zusammentreffen!<br />
Sponsor:<br />
Einwohnergemeinde<br />
4537 Wiedlisbach<br />
Quelle: «Flueblüemli und Aarechisle», Elisabeth Pfluger, Solothurn
SAGENWEG<br />
«Die Bipper Lärmkanone»<br />
3.4<br />
Im Jahre 1834 ereignete sich in Attiswil ein Grossbrand, weil die<br />
andern Gemeinden nicht rechtzeitig alarmiert werden konnten. Der<br />
Amtsstatthalter verlangte <strong>des</strong>halb vom Kanton eine sogenannte<br />
Lärm-Kanone; das Bipperamt erhielt eine «Maritz-Vierpfünder» mit<br />
der Jahrzahl 1764; diese wurde für die Feuerwehren schussbereit in<br />
der Oberbipper Schlossruine aufgestellt.<br />
1845 bahnte sich in der Innerschweiz ein Glaubenskrieg an. Der<br />
Wangener Leutnant Rikli wollte sich dem Freischarenzug mit einigen<br />
Gleichgesinnten anschliessen.<br />
Dazu benötigten sie eine Kanone – also holte man sich in Oberbipp<br />
die Lärmkanone.<br />
Der Amtsstatthalter konnte dies aber nicht dulden und befahl Rudolf<br />
Rikli, diese sofort wieder an ihren Platz zu stellen, sonst setze es<br />
eine hohe Strafe ab.<br />
Unwillig wurde dem Befehl Folge geleistet. Als die Kanone auf ihrem<br />
Platz stand, sagte Rikli: «So, Befehl ausgeführt. Nachts wird das<br />
gute Stück aber wieder geholt!»<br />
Tags darauf standen Kanone, übriges Kriegsmaterial und etwa tausend<br />
Freischärler (liberale Solothurner, Berner und Luzerner) auf<br />
dem Sammelplatz Huttwil bereit.<br />
Bei einem Hinterhalt in Malters wurde den tapferen Kämpfern die<br />
Lärmkanone und alles andere abgenommen und dreihundertsiebzig<br />
Mann gefangen genommen.<br />
Die Luzerner schenkten die erbeutete Kanone ihren Verbündeten,<br />
den Schwyzern. Der Stand Schwyz behielt sie in ihrem Zeughaus,<br />
bis diese nach dem Sonderbundskrieg vom November 1847 zurückgeben<br />
werden musste.<br />
In einem Triumphzug führten die Wangener das Renommierstück<br />
ins Zeughaus von Wangen zurück.<br />
Die Bipperämter aber wollten die Lärmkanone wieder an ihrem alten<br />
Ort aufstellen.<br />
Dabei stiessen sie jedoch beim Amtshauptort Wangen auf taube<br />
Ohren.<br />
Erst im Jahre 1908 konnten ihnen die Wiedlisbacher die Kanone<br />
entwenden. Seither steht sie im Museum Kornhaus in Wiedlisbach<br />
und kann dort bestaunt werden.<br />
Sponsor:<br />
Einwohnergemeinde<br />
4537 Wiedlisbach<br />
Quelle: «Flueblüemli und Aarechisle», Elisabeth Pfluger, Solothurn
SAGENWEG<br />
«Im Zweikampf gefallen»<br />
3.5<br />
Am 25. Januar 1659 ist in der Nähe von Solothurn, bei den «Weihern»<br />
im Riedholz , ein Zweikampf ausgetragen worden, welcher zu<br />
grossem Gerede Anlass gegeben hat. Noch heute gibt es in unserer<br />
Gegend Mahnmale daran:<br />
Im Lan<strong>des</strong>museum in Zürich hängt ein Oelbild mit der Wiedergabe<br />
<strong>des</strong> traurigen Ereignisses; im Kornhausmuseum in Wiedlisbach ist<br />
eine Fotografie <strong>des</strong> Bil<strong>des</strong> zu sehen.<br />
Der damals erschossene Major Imthurn wurde in Oberbipp begraben.<br />
Sein Grabstein ist noch heute hinten in der Oberbipper Kirche<br />
aufgestellt.<br />
Am Ort <strong>des</strong> Duells in Riedholz steht ein Steinkreuz mit einer<br />
Gedenktafel.<br />
Diese Geschichte hat sich folgendermassen zugetragen:<br />
In der Schweiz gehörte es sich in noblen Bürgerfamilien, dass sich<br />
die Söhne am französischen Königshofe ihre Sporen abverdienten.<br />
Solothurn war damals der Mittelpunkt dieser Vermittlung von Militärdiensten<br />
samt den Geldgeschäften. Der französische Ambassador<br />
hatte seine Residenz in diesem Städtli.<br />
Im Januar <strong>des</strong> Jahres 1659 übernachteten zwei Schaffhauser Offiziere<br />
auf ihrem Heimweg in Solothurn. Nach etlichen Gläsern «Landeroner»<br />
bekamen die beiden Streit. Hauptmann Ziegler hatte schon<br />
lange bemerkt, dass ihm der Major Imthurn gerne seine gut geführte<br />
Kompanie ausspannen möchte; dazu lästerte Ziegler über die üblen<br />
Machenschaften im Offizierskader mit der Verteilung Schmuckstücken,<br />
die König Ludwig anstelle <strong>des</strong> fehlenden Sol<strong>des</strong> dem Kader<br />
überlassen hatte.<br />
Major Imthurn wusste daraufhin keine passende Antwort und liess<br />
sich in seiner Wut dazu verleiten, den Hauptmann zum Zweikampf<br />
heraus zu fordern!<br />
Am nächsten Tag ritten die zwei Offiziere mit ihrem Sekundanten ins<br />
Riedholz. Trotzdem sich Hauptmann Ziegler zuerst weigerte, wurde<br />
der Zweikampf schlussendlich mit Pistolen ausgetragen. Es fielen<br />
vier Schüsse – Major Imthurn stürzte zu Tode getroffen vom Pferd.<br />
Der Sekundant <strong>des</strong> Hauptmanns, sein Diener Jakob Gugerli starb<br />
drei Tage später an seiner Schussverletzung in der «Krone» in Solothurn.<br />
Daraufhin gab es einen grossen Prozess, denn im Kanton Solothurn<br />
waren zu dieser Zeit Duelle verboten! Beide Familien Ziegler und<br />
Imthurn mussten hohe Geldstrafen an den Kanton bezahlen.<br />
Sponsor:<br />
Ballerini + Känzig<br />
Maler- u. Tapezierergeschäft<br />
Fassadenrenovationen<br />
4534 Flumenthal<br />
4538 Oberbipp<br />
Andreas Schaad<br />
Schreiner / Zimmermann<br />
Rössliweg 12<br />
4538 Oberbipp<br />
Quelle: «Flueblüemli und Aarechisle», Elisabeth Pfluger, Solothurn
SAGENWEG<br />
«Eine weisse Frau im Gugger»<br />
3.6<br />
Früher wurde, als man meistens noch zu Fuss unterwegs war,<br />
der kürzere Weg über den Gugger von Rumisberg nach Farnern<br />
benutzt. Durch die Hasengasse kommend, nach den letzten Häusern<br />
von Rumisberg führt ein steiler Weg auf das Terrassengelände<br />
von Farnern.<br />
Tagsüber geschieht hier nichts Aussergewöhnliches. Aber nachts<br />
sollte sich jeder Fussgänger vor der weissen Frau in Acht nehmen,<br />
die hier umher irrt und die Leute mit ihrem plötzlichen Auftauchen<br />
erschreckt.<br />
Es kann sein, dass der Wanderer bei besonderen Witterungsverhältnissen<br />
oberhalb der Waldlücke bei einer Kluft auf eine Frau trifft.<br />
Diese steht jeweils stumm da und schaut mit verwundertem, verwirrtem<br />
Blick auf den Berggänger.<br />
Alle, die dieser Frau begegnet sind, bekamen es mit der Angst zu<br />
tun und machten sich eilends davon. Sie erzählten, dass sie beim<br />
Zurückschauen ein sehnsüchtiges Nachblicken der weissen Frau<br />
bemerkt hätten. Aber keiner getraute sich zurückzukehren und<br />
damit die Erscheinung zu erlösen.<br />
Daraufhin sei die Geistergestalt ganz langsam in den Boden hinein<br />
versunken.<br />
Ungläubige behaupten, aus dieser Kluft steige bei grosser Kälte ein<br />
Nebel auf. Die weisse Frau sei in Wahrheit nur ein Nebelschwaden.<br />
Wer die Erscheinung je gesehen hat, beharrt aber auf der Begegnung<br />
mit einer Frau, die etwas sagen oder fragen möchte. Solange<br />
aber niemand den Mut aufbringt, sich zu stellen, weiss man nicht,<br />
was die Frau bedrückt und wie man sie erlösen könnte.<br />
Sponsor:<br />
Brigitta Trösch<br />
Fluhgässli 5<br />
4539 Farnern<br />
Quelle: «Flueblüemli und Aarechisle», Elisabeth Pfluger, Solothurn
SAGENWEG<br />
«Der Brunnmattschatz»<br />
3.7<br />
In früheren Zeiten verehrte ein König unseres Lan<strong>des</strong> den Wald,<br />
besonders aber einen bestimmten Baum, nämlich die Esche.<br />
Man sagte, die Esche sei der «Weltbaum», mit ihren drei Wurzeln<br />
stark verankert mit den drei Elementen Wasser, Erde und Luft.<br />
Als jener König mit all seinen Soldaten die Lan<strong>des</strong>grenzen verteidigen<br />
musste und er merkte, dass er alles verlieren könnte, vergrub<br />
er sein ganzes Vermögen an einem abgelegenen Ort unter einer<br />
Esche.<br />
Der König kehrte nie an den Ort <strong>des</strong> Versteckes zurück; er verlor<br />
im Kampf sein Leben. Niemand kannte den Ort <strong>des</strong> königlichen<br />
Schatzes.<br />
Die Sage erzählt, dass sich dieser Ort auf der Brunnmatt ob Farnern<br />
befindet.<br />
Viele haben nach der Eisenkiste gesucht – aber unter welcher der<br />
Eschen sollte man suchen? Es gab ja so viele davon!<br />
Der richtige Zeitpunkt – Tag und Stunde – war unbekannt. So ist bis<br />
heute niemand fündig geworden.<br />
Esche (fraxinus excelsior)<br />
Bis 35m hoher Baum mit kugeliger Krone. Blüten erscheinen im<br />
April/Mai vor den Blättern. Diese sind unpaarig gefiedert mit 9 –13<br />
Teilblättchen. Frucht geflügelt mit kleinem Samen. Vorkommen in<br />
feuchten Gebieten. Das Holz der Esche ist sehr elastisch und widerstandsfähig.<br />
Oelbaumgewächs.<br />
Sponsor:<br />
Marianne + Wolfgang von Burg<br />
Husmattweg 19<br />
4539 Farnern<br />
Quelle: «Flueblüemli und Aarechisle», Elisabeth Pfluger, Solothurn
SAGENWEG<br />
«Gips und Salz» beim Luchernhof<br />
3.8<br />
Gold und Silber kommen in unsern Juraböden kaum irgendwo vor.<br />
Hingegen gibt es weniger kostbare Bodenschätze, nämlich Gips<br />
(früher Jips genannt) und Salz.<br />
Dem ganzen Berg nach zieht sich auf einer gewissen Höhe eine<br />
Gipsader durch. In Günsberg und Rumisberg wurden diese Adern<br />
angestochen und ausgebeutet. In der Schoren ob Rumisberg gab<br />
es eine verarbeitende Gipsfabrikation, eine Gipsmühle, welche im<br />
Jahre 1963 stillgelegt wurde.<br />
In der Lucheren, zwischen Rumisberg und Farnern gelegen, gibt es<br />
im Boden ein grosses Salzlager. Ungefähr 1850 wollte man dieses<br />
nutzen, dafür wurde ein tiefes Bohrloch gegraben und schon bald<br />
stiess man auf ein grosses Salzvorkommen.<br />
Davon hörten die «Salzkönige» von Rheinfelden; diese Tatsache<br />
passte ihnen nicht in den Kram – man wollte die alleinigen Salz-<br />
Lieferanten bleiben. Es wurden Spione ausgeschickt; die Rumisberger<br />
wunderten sich, dass Fremde auftauchten, herumfragten und<br />
die Gegend um die Lucheren aufsuchten (Werkspionage sagt man<br />
heute).<br />
Als dann eines Morgens die Arbeiter in der Lucheren zum Dienst<br />
antreten wollten, war das Bohrloch eingefallen, alles war zugeschüttet.<br />
Der Bohrer in der Tiefe und die Leitern waren unter dem<br />
Schutt begraben.<br />
Dieses war nicht von selbst geschehen – dies war Menschenwerk!<br />
Man vermutete dabei die Leute aus dem Fricktal, die den Bernern<br />
die Ausbeute nicht gegönnt hatten. Die Täter waren aber verschwunden,<br />
beweisen konnte man ihnen nichts.<br />
Die Rumisberger verspürten daraufhin wenig Lust, nochmals von<br />
vorne zu beginnen; auch von der Berner Regierung war keine Hilfe<br />
zu erwarten.<br />
Darum ist das Salzlager in der Lucheren heute noch im Boden.<br />
Sponsor:<br />
Brigitte + Christian Kopp<br />
Weissacherweg 7<br />
4539 Rumisberg<br />
Quelle: «Flueblüemli und Aarechisle», Elisabeth Pfluger, Solothurn
Sehenswertes<br />
Freistein bei der Kirche<br />
A.1<br />
Der Freistein ist ein sogenannter Menhir (bretonisch: men = Stein,<br />
hir = lang; kultischer von Menschenhand gesetzter Stein, stammt<br />
aus dem Neolithikum).<br />
Bei Nachgrabungen 1855 wurde festgestellt, dass der Stein ebenso<br />
tief im Boden steckt, wie er diesen überragt; die Gesamtlänge beträgt<br />
demnach 3.60 Meter.<br />
Die gemachten Funde, Bruchstücke von Gefässen und Feuersteininstrumenten,<br />
wurden als Weihgaben an eine Gottheit gedeutet.<br />
Aus einer uralten Kultstätte wäre demnach in späterer Zeit eine Freistätte<br />
geworden, was in Uebereinstimmung steht mit der Tatsache,<br />
dass sich Asyle vielerorts bei Kirchen und Klöstern befanden, welche<br />
ihrerseits nicht selten auf der Stelle heidnischer Kultübung errichtet<br />
wurden.<br />
Somit ist dieser Stein sowohl in frühgeschichtlicher wie in rechtsgeschichtlicher<br />
Hinsicht ein äusserst interessantes Denkmal, wie sie<br />
heute in unserem Land nur selten mehr anzutreffen sind.<br />
Neuere Grabungen im Jahre 1963 brachten steinzeitliche und<br />
römische Keramikfragmente zu Tage.<br />
Die religiöse Bedeutung hätte sich (nach dem Urteil von Prof.<br />
O. Tschumi) in veränderter Form erhalten, indem der Menhir als<br />
«Freistein» im Ansehen blieb: durch die Berührung mit dem Stein<br />
sei der Verfolgte gleichsam unter göttlichen Schutz gestellt und der<br />
irdischen Gerechtigkeit entzogen worden.<br />
Der «Freistein» wäre demnach selbst eine Freistätte geworden.<br />
Leider fehlen urkundliche Belege für diese Freistätte. Eines darf<br />
aber als sicher angenommen werden: der Menhir wäre wohl längst<br />
– wie so viele seinesgleichen – dem Landbau zum Opfer gefallen,<br />
wenn ihn nicht seine, im Volksbewusstsein verankerte Bedeutung<br />
als Freistein davor bewahrt hätte.<br />
Es berichtet die Sage, dass ein Vogt vom Schloss Bipp, der dieses<br />
Gebot missachtete und einen Flüchtigen beim Freistein niederstach,<br />
innerhalb eines Jahres nach schwerem Siechtum starb; seither kommt<br />
er in wilden Frühlingsnächten zurück an die Stätte seiner Tat.<br />
Als einziges Exemplar seiner Art im Kanton Bern blieb der Freistein<br />
dank seiner Bedeutung vor der Zerstörung verschont und steht<br />
heute unter staatlichem Schutz.<br />
Sponsor:<br />
Rolf Bitterli<br />
Velos – Motos<br />
4537 Wiedlisbach<br />
Quelle: «Attiswil – kleine Dorfchronik»
Sehenswertes<br />
Entstehung der «Farnerer-Terrasse»<br />
A.2<br />
Die Gesteine unseres Kettenjuras – vorwiegend Kalk und Mergel<br />
– entstanden in der Jura- und Triaszeit, wobei für die Triaszeit<br />
zudem Gips und Steinsalz bezeichnend sind als älteste Bildungen<br />
<strong>des</strong> Oberaargaus.<br />
Nachfolgend wird beschrieben, wie und weshalb ein Auftreten<br />
solch tief liegender Gesteine als Spezialität <strong>des</strong> Bipper Juras<br />
zustande kam.<br />
Im Gegensatz zu den steilen, waldreichen Ketten der Nachbarschaft<br />
ist diese Ketten-Flanke aufgelöst in Wellen, Kuppen, Tälchen und<br />
Terrassen.<br />
Unsere Gegend war verschiedene Male unter dem Rhonegletscher<br />
begraben. Der heutige Ausbau in den Kiesgruben ist sein liegen gebliebenes<br />
Geschiebe.<br />
Während der zweiten Eiszeit (Riss-Eiszeit vor 200'000 Jahren) hat der<br />
bis zu 800 m dicke Eisstrom die darunter liegende Molasseschicht<br />
stark bearbeitet und zwischen Günsberg und Niederbipp eine trogartige<br />
Mulde ausgehobelt.<br />
Nach dem Abschmelzen <strong>des</strong> Gletschers ist der überhängende<br />
Jurakamm abgesackt, weil ihm jetzt die Stütze aus dem Molassesandstein<br />
fehlte. Durch einen Urfluss wurde der stützende Hangfuss<br />
abgetragen. Dadurch gerieten gewaltige Gesteins-Massen<br />
der Scheitelpartie auf ihrer Tonunterlage ins Gleiten, rutschten und<br />
sackten zum Jurasüdfuss ab (<strong>des</strong>halb «Sackung»), wo sie die alte<br />
Flussrinne überdeckten.<br />
Diese Bewegungen dauerten Jahrtausende.<br />
Der Bipper Jura weist einen in diesem Ausmass einmaligen Bau auf:<br />
Die Abrissnischen hoch in der Bergkette sind heute noch gut erkennbar.<br />
Es sind langgezogene Fluhränder, die sich vom Hofbergli<br />
bis zur Randfluh hinziehen.<br />
Am Jurasüdfuss entstanden folgerichtig auf den geschützt erhobenen<br />
Schuttkegeln der Hangbäche und damit an ihrer Wasserkraft<br />
die Gemeinden Attiswil, Wiedlisbach, Oberbipp und Niederbipp .<br />
Der Sturz- und Sackungsschutt, in Wellen gelegt, gab Anlass zu den<br />
schönen Terrassen und Tälchen, die den Menschen die Besiedelung<br />
der Juraflanke überhaupt ermöglichten: Farnern, Rumisberg,<br />
Wolfisberg, Walden. Tonige Gesteine, aus der Tiefe hochgepresst,<br />
tragen zur Fruchtbarkeit <strong>des</strong> Bodens bei. Aus den gleichen Gründen<br />
ist die Südflanke recht wasserreich.<br />
Oben auf der Kette ergaben die entblössten Mergel-Horizonte die<br />
saftigen Weidehochtäler von Buechmatt, Hinteregg, Schmiedenmatt,<br />
Hofbergli und Teuffelen.<br />
Sponsor:<br />
Einwohnergemeinde<br />
4539 Farnern<br />
(Zeichnung aus Attiswiler Chronik)
Sehenswertes<br />
Das Buchistöckli – Geschichte einer<br />
vielseitigen Verwendung<br />
A.3<br />
Das Buchistöckli wurde vermutlich im 16. Jahrhundert als Waschhaus<br />
und zur Herstellung von Pottasche erbaut. Beim Verbrennen<br />
von reinen Buchscheitern – daher auch der Name «Buchistöckli» –<br />
entstand eine hellgrau-weisse Asche, welche mit Wasser vermischt<br />
zu einer Lauge angerührt wurde. Den aufgekochten Sud brauchte<br />
man als Waschmittel.<br />
Zur Bleichung wurden die Wäschestücke an der Sonne getrocknet.<br />
Mit der Herstellung der modernen Waschmittel um 1800 verschwand<br />
die Buchenholz-Verbrennung. Geblieben ist jedoch der Name.<br />
Nach einem Brand wurde das Buchistöckli 1823 wieder aufgebaut<br />
und zeitweise als Schulhaus und als Vereinslokal genutzt.<br />
Einer der zwei massiv erbauten Räume im Erdgeschoss diente bis<br />
1983 als Schlachtraum für die ortsansässigen Metzger und als Militärküche<br />
während den Truppenverlegungen. Der andere mit dem vergitterten<br />
Fenster wurde als Gefängnis und später als Verkaufsraum<br />
eines auswärtigen Metzgers verwendet.<br />
Das Obergeschoss bewohnte bis 1967 eine siebenköpfige Familie.<br />
1892 ging das Buchistöckli von der Burgergemeinde an die Einwohnergemeinde<br />
über.<br />
Seit 1976 wird das Buchistöckli durch den «Verein Pro Ortsbild- und<br />
Landschaftsschutz Oberbipp (POLO)» verwaltet und wird für Ausstellungen<br />
und andere Aktivitäten genutzt.<br />
Sponsor:<br />
Leuenberger / Auinger<br />
Mermoud<br />
Oltenstrasse 1<br />
4538 Oberbipp
Sehenswertes<br />
Ein Natur- und Umweltschützer<br />
der ersten Stunde<br />
A.7<br />
Lange bevor es «Mode und Jedermanns Anliegen» wurde, wachte<br />
einer besonders gut über die einheimische Flora und Fauna: Walter<br />
Tschumi (*16.12.1910), genannt Vögeli-Walter aus Wiedlisbach.<br />
Ihm haben wir die vielen schönen und kunstvoll gemalten <strong>Tafeln</strong> in<br />
unser Wäldern und Auen zu verdanken.<br />
1929 wurde in Wiedlisbach beim damaligen Oberförster Ernst<br />
Tschumi der Naturschutzverein Wiedlisbach und Umgebung (NSVW)<br />
gegründet. Das Motto <strong>des</strong> Vereins lautete: «Zum Heil der Natur».<br />
Zum ersten Präsidenten wurde der damals 19-jährige Walter Tschumi<br />
gewählt. Er blieb dies bis zu seinem Tode am 12.12.1983.<br />
Er war ein Natur- und Umweltschützer der ersten Stunde; als noch niemand<br />
daran dachte, Hecken oder Hochstammbäume zu schützen,<br />
setzte sich Walter Tschumi für diesen wichtigen Lebensraum der<br />
Kleintiere ein.<br />
Obwohl Tschumi die Schöpfung als vollkommen ansah, ärgerte er<br />
sich über die Spatzen, da diese andere Vögel in ihrem Lebensraum<br />
bedrängten. Deshalb bat er um Erlaubnis zum Spatzenabschuss,<br />
da diese «auf den umliegenden Culturen öfters grossen Schaden<br />
betreiben, das Futter nützlicher Vögel vertilgen, die Nisthöhlen überflüssig<br />
besetzen und besudeln, ein richtiges Hurenleben treiben und<br />
Stroh in Kasten tragen, die sie überhaupt nie bewohnen».<br />
Man nannte ihn «Vögeli-Walter», weil er sich besonders vehement<br />
für die Vogelwelt einsetzte; jahrelang zog er mit seinem betriebseigenen<br />
Gefährt – einem Leiterwägeli – durch die Gegend mit Kleintier-<br />
und Vogelfutter.<br />
Sponsor:<br />
Einwohnergemeinde<br />
4537 Wiedlisbach<br />
Quelle: Jubiläumsschrift «75 Jahre Naturschutzverein Wiedlisbach und Umgebung 1929-2004», Gottlieb Holzer, Wiedlisbach
Sehenswertes<br />
Hedda Koppé-Haus<br />
«Gotthelfs Glungge-Bäuerin»<br />
B.2<br />
In diesem Haus an der Dorfstrasse in Farnern verbrachte die bekannte<br />
Schweizer Schauspielerin Hedda Koppé ihren Lebensabend.<br />
In unserem Lande ist Hedda Koppé vor allem als «Glunggenbäuerin»<br />
aus den Gotthelf-Filmen (1954) bekannt geworden.<br />
Für die Rolle der warmherzigen Base holte Franz Schnyder eine<br />
Schauspielerin vor die Kamera, deren Karriere längst abgeschlossen<br />
schien. Doch die Gotthelf-Verfilmungen machten Hedda Koppé<br />
mit sechzig Jahren nochmals populär. Doch ihr Leben war nicht nur<br />
das der Glunggenbäuerin.<br />
Sie wurde am 7.12.1896 als Hedwig Kopp, mit Heimatort Wiedlisbach,<br />
geboren. Da sie sich als junge Lehrerin überfordert sah und die<br />
künstlerisch geprägte Erziehung und das Blut zum Theater drängten,<br />
nahm sie Schauspielunterricht.<br />
Ihre Engagements führten sie auf Bühnen von Deutschland,<br />
St. Gallen, Wien; aus politischen Gründen reiste sie nach Amerika,<br />
wo sie sogar am Broadway in New York spielte. In Kanada ändert<br />
sie ihren «deutschklingenden» Namen in Hedda Koppé um.<br />
Vor Ausbruch <strong>des</strong> 2. Weltkrieges kehrte sie in die Schweiz zurück.<br />
Hier musste sie erfahren, dass sie als einst gefeierter Star nicht<br />
wahrgenommen wurde und sich mit gelegentlichen Engagements<br />
und Cabarets-Auftritten zufrieden geben musste. Anlässlich der<br />
700-Jahrfeier von Wiedlisbach lernt sie ihren Heimatort und damit<br />
die Gegend besser kennen.<br />
Durch Zufall kam dann die Berufung als Glunggenbäuerin für die<br />
Gotthelffilme. 1958 erhielt sie dafür den Filmpreis der Stadt Zürich.<br />
Als Sechzigjährige wurde sie in der Schweiz nun endlich bekannt.<br />
Sie wohnte abwechslungsweise in Zürich oder im Ferienhaus in<br />
Farnern mit «ihren» unzähligen fremden Katzen. Im November 1968<br />
feierte sie zusammen mit der Dorfbevölkerung ihr fünfzigjähriges<br />
Bühnenjubiläum und wurde von den Behörden als prominente Mitbürgerin<br />
geehrt.<br />
Wer erleben konnte, wie die gehbehinderte alte Dame auf die Bühne<br />
stieg und wie sie mit natürlicher Lebhaftigkeit und sprühender Laune<br />
Müsterchen erzählte, rezitierte und Anekdoten von damals erzählte,<br />
wird diese Begegnung nicht mehr vergessen.<br />
Noch mit 90 Jahren träumte sie davon, endlich in Dürrenmatts<br />
«Besuch der alten Dame» spielen zu dürfen. Es blieb ein Traum. Am<br />
20. April 1990 starb Hedda Koppé in Zürich.<br />
In Farnern wird sie nicht nur als Glunggenbäuerin, sondern auch als<br />
liebenswerte, gesprächsbereite und gesellige Nachbarin und Dorfbewohnerin<br />
in Erinnerung bleiben.<br />
Sponsor:<br />
Christine + Peter Tanner-Gygax<br />
Gemein<strong>des</strong>chreiberin Farnern<br />
3400 Burgdorf<br />
Quelle: «Oberaargauer Jahrbuch», 1992
Sehenswertes<br />
Das Zehntenhaus<br />
B.3<br />
Das bis vor dem Umbau im Jahre 2000 als Bauernhaus genutzte<br />
Gebäude mit Wohnhaus und Ökonomie-Teil diente zur Zeit <strong>des</strong><br />
Landvogtes im 16. Jahrhundert als Haus zum Einlagern der Steuerabgaben.<br />
Jeder Bürger im Verwaltungsbezirk hatte einen Zehntel seines<br />
erwirtschafteten Gutes, meistens Lebensmittel, Getreide, Fleisch,<br />
Eier, Wein aber auch Geld (Taler) an bestimmten Tagen im Jahr dem<br />
Landvogt abzugeben. Bis am 11. November <strong>des</strong> jeweiligen Jahres<br />
mussten die Steuern beglichen sein.<br />
Der Zehntel war einer der ältesten schon in Babylon und der griechisch-römischen<br />
Antike bekannte Form der Besteuerung.<br />
In Frankreich wurde der «Zehnt» von der Synode in Mâcon 585<br />
n.Chr. als Kirchenabgabe institutionalisiert und ab dem 9. Jahrhundert<br />
auch von weltlichen Herren (als Grundherren der Eigenkirche)<br />
eingezogen.<br />
Über den Zehnten – als ergiebigste Abgabe – entzündeten sich im<br />
Mittelalter zahlreiche langwierige Auseinandersetzungen zwischen<br />
Staat und Kirche.<br />
Im Zuge der Französischen Revolution, der Bauernbefreiung und<br />
der Trennung von Kirche und Staat wurde der Zehnten zu regional<br />
unterschiedlichen Zeiten abgeschafft.<br />
Sponsor:<br />
Burgemeister / Zwahlen<br />
Obisgasse 7<br />
4538 Oberbipp<br />
Quelle: «Oberaargauer Jahrbuch», 1992
Sehenswertes<br />
Gipsi – Ehemalige Gipsfabrik Rumisberg<br />
B.5<br />
Unsere Gegend war verschiedene Male unter Gletschereis begraben.<br />
Die Kiesausbeute in unsern Gruben, die erratischen Blöcke<br />
(Findlinge), die Versteinerungen und die Gips- und Salzvorkommen<br />
sind Hinterlassenschaften dieser Zeiten.<br />
Nach dem Abschmelzen <strong>des</strong> Gletschers ist der überhängende Jurakamm<br />
abgesackt; dadurch gerieten gewaltige Gesteinsmassen ins<br />
Rutschen und lagerten sich am Jurasüdfuss ab. Diese Bewegungen<br />
dauerten Jahrtausende. Der Bipper Jura weist <strong>des</strong>halb eine einmalige<br />
Formation auf.<br />
In der Jurafaltung befindet sich auch eine Gips- und Steinsalz-<br />
Schicht. Um 1850 wurde in der Luchern mittels eines 170 Meter<br />
tiefen Bohrlochs nach Salz gesucht; das Vorkommen war jedoch zu<br />
gering, um den Bau einer Saline zu rechtfertigen.<br />
Hingegen errichtete man im Gebiet Schoren eine Gipsmühle, welche<br />
später zu einer Gipsfabrik umgebaut wurde.<br />
1946 erstellte die Firma Gebrüder Corbetti eine Werkhalle zur Herstellung<br />
von Gips und Gipswaren (Schilfbretter).<br />
1958 erwarb die Firma Meyer & Cie das Gipswerk Rumisberg.<br />
Bis 1962 entstanden Anbauten für Büro, Aufenthalt, Werkstatt und<br />
Lager. Die Firma Promonta Platten AG, Egnach, installierte eine neue<br />
Produktionsanlage zur Herstellung von Vollgipsplatten. Im Wettbewerb<br />
mit einem grossen Anbieter in derselben Branche musste das<br />
Gipswerk aus wirtschaftlichen Gründen 1963 eingestellt werden.<br />
Heute wird die Liegenschaft teils gewerblich, teils für festliche<br />
Anlässe genutzt.<br />
Beim Abbau arbeitete man einschichtig; es wurde gesprengt, grob<br />
sortiert und das Material mit Schaufeln auf die Wagen aufgeladen,<br />
die dann auf Schienen zum Steinbrecher gefahren wurden. Eine<br />
Mühle verkleinerte die Gipssteine; danach gelangte die Masse in<br />
einen Kocher, wo ihr das Wasser entzogen wurde und feines Gipsmehl<br />
zurückblieb. Man verkaufte den Gips im Sack oder als Gipsplatten.<br />
Aerzte schätzten das Material als reinen Medizinalgips.<br />
Sponsor:<br />
Meyer + Co.<br />
Gipswerk Rumisberg<br />
Quelle: «Oberaargauer Jahrbuch», 1992
Sehenswertes<br />
Oberbipper Kirche –<br />
archäologische Grabungen<br />
C.3<br />
Archäologische Grabungen haben 1959 gezeigt, dass unter der<br />
Kirche von Oberbipp Teile eines römischen Herrenhauses liegen. Es<br />
gehörte zu einem Gutshof <strong>des</strong> 2./3. Jahrhunderts, der sich vermutlich<br />
weit ins Tal hinaus erstreckte.<br />
Um 600 n. Chr. begann man, in Teilen der römischen Gebäude Gräber<br />
anzulegen. Vermutlich gehören sie zu einer «Phantomkirche»,<br />
einer Kirche, die archäologisch kaum fassbar ist, weil man für sie<br />
hauptsächlich römische Mauern weiter verwendete.<br />
Im 8. Jahrhundert wurde die erste Kirche von einer dreischiffigen<br />
Basilika abgelöst. Im 11./12. Jahrhundert folgte ein kompletter Neubau,<br />
deutlich grösser, aber mit ähnlichem Grundriss. Im späteren<br />
15. Jahrhundert wurde der Turm errichtet. 1686 schliesslich entstand<br />
die heutige Kirche als geräumiger Predigtsaal.<br />
Die archäologischen Reste können in einem 2004/05 durch den<br />
Archäologischen Dienst <strong>des</strong> Kantons Berns installierten Rundgang<br />
besichtigt werden.<br />
Anmeldung für Gruppenführungen unter Tel. 032 636 31 58.<br />
Weitere Informationen liegen in der Kirche auf.<br />
Bauabfolge der Gebäude unter der Kirche Oberbipp<br />
Links: römische Mauerzüge und frühmittelalterliche Gräber.<br />
Schäg schraffiert der Bereich der ersten «Phantomkirche»<br />
Mitte: die karolingische dreischiffige Basilika (8. Jahrhundert)<br />
Rechts: die romanische Basilika (11./12. Jahrhundert)<br />
Sponsor:<br />
Fam. U. Bürki<br />
Obisgasse 6<br />
4538 Oberbipp<br />
Quelle: Archäologischer-Dienst, Bern; Familie Marti-Grädel, Oberbipp
Sehenswertes<br />
Dolinen auf der Hinteregg<br />
C.5<br />
Die sogenannten DOLINEN sind Verwitterungstrichter, entstanden<br />
durch Höhlen, unterirdische Bäche und Stromquellen.<br />
Sie treten in allen Kalklandschaften der Erde auf, bei uns vorwiegend<br />
im Jura und in den Kalk-Voralpen.<br />
Bezeichnend für eine Kalklandschaft ist die unterirdische Entwässerung.<br />
Durch Spalten und Kluftfugen im Gestein dringt kohlesäurehaltiges<br />
Wasser in die Tiefe und löst das Karbonat auf.<br />
Dabei entstehen unterirdische Hohlräume. Die sichtbaren Kennzeichen<br />
dieses Vorgangs sind Mulden, Dolinen, Einsturzschächte und<br />
Löcher aller Art.<br />
Der Begriff «Karst» stammt aus Jugoslawien, wo die entstandenen<br />
Erscheinungen besonders schön ausgebildet sind.<br />
Auf den Höhen zwischen Schwengimatt und Schmiedenmatt sind<br />
Dolinen zu beobachten, deren Versickerungswasser die Kalkschicht<br />
teils bis zu den Quellen <strong>des</strong> Bergfusses durchdringt.<br />
Sponsor:<br />
Alpgenossenschaft Hinteregg<br />
Quelle: Dr. Valentin Binggeli, «Geografie <strong>des</strong> Oberaargaus»
Sehenswertes<br />
Grabmal für die Ewigkeit<br />
D.3<br />
Auf der Gelän<strong>des</strong>tufe, auf der heute die Stierenweid und der Burgerwald<br />
liegen, wurden in urgeschichtlicher Zeit zahlreiche Grabhügel<br />
angelegt. Dies ist seit langem bekannt; wissenschaftlich untersucht<br />
ist bisher aber keiner.<br />
Viele der Grabhügel sind im Laufe der Jahrhunderte durch Erosion<br />
oder die landwirtschaftliche Nutzung verschwunden. Andere sind<br />
bis auf ihren schützenden Steinkern abgetragen.<br />
In verschiedenen urgeschichtlichen Epochen wurden die Toten in<br />
Grabhügeln bestattet. In solchen Hügeln können einzelne Personen,<br />
aber auch ganze Gruppen wie in einem Familiengrab beigesetzt sein.<br />
Es kamen sowohl Körper- als auch Urnenbestattungen vor.<br />
Die Gegend entlang <strong>des</strong> Jura-Südfusses war ursprünglich sehr reich<br />
an Grabhügeln. Erhalten blieben sie aber nur in Wäldern, wo sie<br />
besser geschützt sind als im freien Feld. Etliche sind archäologisch<br />
untersucht, etwa die Grabhügelnekropole von Subingen-Erdbeereinschlag<br />
oder auch ein einzelner Hügel im Rütihofwald zwischen<br />
Niederbipp und Oberbipp. Aus ihnen stammen Funde, die in die<br />
ältere Eisenzeit (Hallstattzeit, ca. 800-450 v. Chr.) datieren.<br />
Urgeschichtliche Grahügel galten noch lange als Orte der Verehrung.<br />
So gibt es zum Beispiel Grabhügel in der Unterhard bei Langenthal<br />
oder im Rüchihölzli bei Bannwil, die in der Römerzeit und im frühen<br />
Mittelalter wieder als Bestattungsplatz dienten.<br />
Totenprozession in einem eisenzeitlichen Grabhügelfeld.<br />
Ähnliche Szenen könnten sich vor über 2500 Jahren auch auf<br />
der Stierenweid abgespielt haben.<br />
Eiserne Prunkwaffe, so<br />
genannter Antennendolch,<br />
aus einem Männergrab<br />
von Langenthal-Unterhard.<br />
Sponsor:<br />
Landi Bipp-Gäu Tal AG<br />
Oltenstrasse 25<br />
4538 Oberbipp<br />
<br />
BippGäuThal AG<br />
Quelle: Archäologischer-Dienst, Bern; Familie Marti-Grädel, Oberbipp
Sehenswertes<br />
Römischer Gutshof<br />
E.3<br />
Nach alter Sage sollen im unruhigen Osthang <strong>des</strong> Anteren-Tälchens<br />
die Ruinen eines Klösterchens stecken.<br />
Bereits 1901 stellte man Mauerzüge fest. 1926/27 folgten Grabungen.<br />
Die dabei zutage geförderten Hohl- und Leistenziegel zeigten, dass<br />
die Mauern in die Römerzeit gehörten.<br />
Der Grundriss, der<br />
sich nicht mehr exakt<br />
rekonstruieren<br />
lässt, besteht aus<br />
einem «Wohntrakt»<br />
von etwa 24 m Länge<br />
und 11 m Breite. Die<br />
Wohnräume wurden<br />
durch zwei schmale<br />
Korridore erschlossen,<br />
die sich zu<br />
einem fast 3 m breiten,<br />
offenbar später<br />
angebauten Vorraum<br />
öffneten. Dieser Vorraum erstreckte sich über die gesamte Länge<br />
<strong>des</strong> Gebäu<strong>des</strong>. Er besass, nach dem Fund eines Schwellsteins zu<br />
schliessen, ein Tor, das sich zum Tal hin öffnete.<br />
An der Südwestseite <strong>des</strong> Gebäu<strong>des</strong> befand sich eine Badeanlage.<br />
Der erste Raum enthielt das Heisswasserbecken. Er war mit Bodenund<br />
Wandheizung ausgestattet. Daran schloss ein mässig temperierter<br />
Raum an, der mit einem Kalksteinplattenboden und Wandmalereien<br />
prächtig ausgestattet war. Schliesslich folgte das halbrunde<br />
Kaltwasserbecken. Es war offenbar mit Marmorplatten belegt, die<br />
Wände waren rot verputzt.<br />
Die Funde sind spärlich: Reste einer Amphore, einer grossen Schale<br />
zum Zerreiben von Gewürzen sowie etwas Keramik datieren ins<br />
2./3. Jahrhundert n. Chr.<br />
Bodenund<br />
Wandheizung<br />
Römisches Dach<br />
mit Hohl- und Leistenziegel<br />
Sponsor :<br />
Anton Müller-Schwab<br />
Buchlistrasse 47<br />
4704 Niederbipp<br />
Quelle: Archäologischer-Dienst, Bern; Familie Marti-Grädel, Oberbipp<br />
Tel. 032 633 14 46<br />
Fax 032 633 11 16<br />
MÜLLER<br />
TRANSPORTE<br />
NIEDERBIPP AG<br />
4704 Niederbipp
Sehenswertes<br />
Ein Natur- und Umweltschützer<br />
der ersten Stunde<br />
E.5<br />
1929 wurde in Wiedlisbach der «Naturschutzverein Wiedlisbach und<br />
Umgebung» (NSVW) gegründet.<br />
Zu den Gründungsmitgliedern gehörte der 19-jährige Walter Tschumi;<br />
er wurde gleich zum Präsidenten gewählt und blieb dies bis zu<br />
seinem Tode (12.12.1983).<br />
Als Sohn <strong>des</strong> Oberförsters und Enkelsohn eines Landwirtes waren<br />
ihm die Anliegen von Feld, Wald und Tierreich von Kindsbeinen an<br />
vertraut.<br />
Als Präsident setzte sich Walter Tschumi zeitlebens für den Naturschutz<br />
ein, sei es für die Vogelwelt, die Winterfütterung oder während<br />
der Zeit der kleinen und grossen Projekte für die Rettung der<br />
Feuchtgebiete, Erhaltung von Bachläufen und Hecken, Gestaltung<br />
von Strassenbauten, Mitarbeit bei Güterzusammenlegungen etc.<br />
In vielen Dingen war er seiner Zeit voraus, zum Beispiel für die Bewilligungspflicht<br />
für das Fällen von Obstbäumen. Er pflegte zudem<br />
regen schriftlichen Verkehr – gespickt mit vielen Fremdwörtern und<br />
lateinischen Ausdrücken – mit Aemtern, Behörden und der Zentralstelle<br />
für schweizerischen Vogelschutz.<br />
Allen Leuten war er als «Vögeli-Walter» bekannt. Er vertrieb zeitlebens<br />
Kleintier- und Vogelfutter und brachte dieses zu Fuss mit dem<br />
Leiterwägeli zu seiner Kundschaft. Dabei beobachtete er seine Umwelt<br />
und wusste immer, wo sein Einsatz nötig wurde.<br />
Er wurde von vielen als Sonderling belächelt, hat aber als wahrer<br />
Don Quichotte oft, aber nicht immer vergebens, gegen Windmühlen<br />
gekämpft.<br />
Von seinen Anliegen zeugen noch heute Holz- und Metalltafeln, auf<br />
welchen die Menschheit in einer besonderen und eigenen Manier<br />
zum Sorgetragen aufgefordert wird.<br />
Sponsor:<br />
Einwohnergemeinde<br />
4537 Wiedlisbach<br />
Quelle: Jubiläumsschrift «75 Jahre Naturschutzverein Wiedlisbach und Umgebung 1929-12004», Gottlieb Holzer, Wiedlisbach
Sehenswertes<br />
Der Mühleweiher<br />
F.3<br />
Die Idylle lädt ein zum Verweilen.<br />
Das ganze Areal ist heute in Privat-Besitz mit all den Wasservögeln<br />
und Fischen.<br />
Das umgeleitete Bachwasser fliesst in den Weiher und wird bei<br />
geringen Wassermengen aufgestaut. Mittels Schieber wird das Wasser<br />
mit grosser Kraft auf das Wasserrad gelassen, welches einen<br />
Mühlenstein betreibt.<br />
In einer zweiten Stufe bachabwärts, an der Sägegasse nutzt man<br />
die Wasserkraft zum Betreiben eines Sägewerks.<br />
Die Wasserreserve dient noch heute den Wehrdiensten zur Feuerbekämpfung.<br />
Die abgesperrten Zonen dürfen nicht betreten werden.<br />
Sponsor:<br />
Garage Carrosserie AG<br />
4538 Oberbipp<br />
032 636 12 22<br />
Nutzfahrzeuge GmbH<br />
4538 Oberbipp<br />
032 636 12 22
Sehenswertes<br />
«Bärner Stein»<br />
Gletscherfindling im Burchwald<br />
G.1<br />
Unsere Gegend war verschiedene Male unter Gletschereis begraben.<br />
Was heute als Grien in den Kiesgruben ausgebeutet wird, ist<br />
liegen gebliebenes Geschiebe <strong>des</strong> Rhonegletschers.<br />
Während der zweiten Eiszeit (Riss-Eiszeit vor 200'000 Jahren) hat der<br />
bis 800 Meter dicke Eisstrom die darunterliegende Molasseschicht<br />
stark bearbeitet und zwischen Günsberg und Niederbipp eine trogartige<br />
Mulde ausgehobelt. Nach dem Abschmelzen <strong>des</strong> Gletschers<br />
ist dann der überhängende Jurakamm, welchem die Stütze aus dem<br />
Molasse-Sandstein fehlte, abgesackt (sog. Senkung von Wiedlisbach).<br />
Weit augenfälliger als die Kiesdeponien sind die Findlinge (Erratiker).<br />
Diese erratischen Blöcke bestehen meistens aus hartem Granit<br />
oder Gneis und stammen aus den Walliser Alpen. Auf dem Rücken<br />
<strong>des</strong> Rhonegletschers sind sie in der letzten Eiszeit (Würm-Eiszeit,<br />
vor etwa 30'000 Jahren) bis in unsere Gegend gewandert.<br />
Der oberste Findling liegt auf 800 m.ü.M., sodass man auf eine<br />
ungefähre Eisdicke von 300 m schliessen kann. Die Endmoräne <strong>des</strong><br />
Rhonegletschers befand sich bei Wiedlisbach-Oberbipp-Längwald-<br />
Wangen an der Aare.<br />
Östlich von Solothurn über Riedholz, Alpfelenhöfe, Eichholz, Dettenbühl<br />
und Oberbipper-Stierenberg zieht sich die linke Seitenmoräne<br />
bis hin in den Längwald südöstlich von Niederbipp. Zahlreiche<br />
erratische Blöcke zeugen davon.<br />
Der grosse Block im oberen Burchwald wurde erstmals 1896 als<br />
schutzwürdig erwähnt und dann von der «Naturforschenden Gesellschaft<br />
Kt. Bern» von der Burgergemeinde Attiswil abgekauft und<br />
dem Naturhistorischen Museum in Bern zum Geschenk gemacht.<br />
Er besteht aus Mont-Blanc-Granit, wie auch der Freistein bei der<br />
Kirche Attiswil.<br />
Seine Grösse wird mit 200 m3 angegeben, von denen nur etwa<br />
50 m 3 sichtbar sind. Früher war dieser harte Stein ein gesuchtes<br />
Baumaterial; so wurde dieser Block stark dezimiert, was die zahlreichen<br />
Sprenglöcher beweisen.<br />
Am 14. Juni 1940 wurde der Block unter dem Namen «Bernstein»<br />
vom Regierungsrat <strong>des</strong> Kantons Bern unter Naturschutz gestellt und<br />
in die Reihe der geschützten Natur-Denkmäler aufgenommen. Bei<br />
der Bevölkerung heisst er «Bärnerstei».<br />
Sponsor:<br />
Styner Bruno<br />
Lebensmittel<br />
4536 Attiswil<br />
Quelle: «Attiswiler Chronik», 1988. Herausgegeben von der Einwohner- und Burgergemeinde Attiswil
Sehenswertes<br />
Schloss Bipp<br />
G.3<br />
Die Anfänge der mittelalterlichen Burg Bipp liegen im Dunkeln. Die<br />
Bezeichnung «Pippa burgoni» in einer Urkunde König Konrads von<br />
Burgund von 968 könnte sich auf die Anlage beziehen. Dort wird<br />
auch eine «capella» eine Burgkapelle, erwähnt. Die heute noch<br />
erhaltenen oder in alten Abbildungen fassbaren Gebäudeteile datieren<br />
frühestens ins 13. Jahrhundert.<br />
1268 stellte Graf Hermann von Froburg auf Schloss Bipp eine Urkunde<br />
aus. Die Herrschaft umfasste damals das Städtchen Wiedlisbach,<br />
die Dörfer Attiswil und Oberbipp sowie die Berggemeinden Farnern<br />
und Rumisberg. Nach dem Untergang der Froburger wechselte die<br />
Herrschaft mehrmals den Besitz und wurde verpfändet. 1406 kam<br />
sie an Bern und Solothurn, 1463 mit der Teilung <strong>des</strong> Buchsgaus<br />
schliesslich an Bern allein. Bis 1798 diente die Feste als bernischer<br />
Landvogteisitz. Beim Herannahen der französischen Truppen wurde<br />
sie verwüstet. Danach missbrauchte man sie als Steinbruch.<br />
Beschreibungen existieren erst aus der Landvogteizeit.<br />
Die Burganlage befindet sich heute in Privatbesitz.<br />
Ansicht <strong>des</strong> Landvogteisitzes um 1670 von<br />
Albrecht Kauw. Teile der Umfassungsmauer,<br />
<strong>des</strong> Wohntraktes und insbesondere <strong>des</strong><br />
markanten Rundturms sind heute noch<br />
erhalten. Das Zwiebeltürmchen in der Mitte<br />
dürfte den Standort der Burgerkapelle<br />
markieren.<br />
Sponsor:<br />
DER RICHTIGE PARTNER<br />
in Elektrofragen + Serviceleistungen<br />
Die heutige Anlage aus der Vogelschau-<br />
Perspektive.<br />
(Foto Archäologischer Dienst <strong>des</strong> Kantons Bern,<br />
Patrick Nagy).<br />
Tel. 032 636 10 10 • FAX 032 636 10 12<br />
Quelle: Archäologischer-Dienst, Bern; Familie Marti-Grädel, Oberbipp
Sehenswertes<br />
Felssturzgebiet in der Teuffelen<br />
L.1<br />
Am 31. Mai 1983, zwischen 14.30 und 15 Uhr kam im Bezirk «Kleinmätteli»,<br />
oberhalb der Teuffelenhütte eine grosse Erdmasse unter<br />
Krachen und Getöse in Bewegung.<br />
Gegen 1 Million Kubikmeter Weid- und Waldboden lösten sich auf<br />
einer Breite von 200 Metern, rutschten im Schritttempo in die Tiefe<br />
und zerstörten rund 20 Jucharten Wald und Land.<br />
Tannen und Buchen wurden durch die Gewalt der Erdbewegung wie<br />
Zündhölzer geknickt.<br />
Eine Menge bereits gerüstetes Brennholz und das Fallholz wurden<br />
durch Geröll und Schutt zugedeckt.<br />
Bereits einige Tage zuvor hatten kleine Erdrutsche in diesem Gebiet<br />
für Aufsehen gesorgt. Sanierungsarbeiten waren in Angriff genommen<br />
worden.<br />
Eine Wasserfassung war von der Burgergemeinde Attiswil in Auftrag<br />
gegeben und erstellt worden; damit wurde eine Quelle mit einer Leistung<br />
von über 100 Liter pro Minute erschlossen.<br />
Nach dem Rutsch erwartete jedermann, dass das Wasservorkommen<br />
irgendwo wieder erscheinen würde; dieses und die Quellfassung<br />
konnten zu diesem Zeitpunkt nicht mehr gefunden werden.<br />
Die Region am Jurasüdfuss gilt bei Experten als extrem labil. Bereits<br />
früher waren Rutsche in diesem Gebiet zu verzeichnen, allerdings<br />
nie mit einer vergleichbaren Auswirkung wie im Mai 1983.<br />
Ingenieure haben die geologischen Besonderheiten untersucht, vor<br />
allem die Läufe <strong>des</strong> Grund- und Quellwassers und allfällige, vorzunehmende<br />
Massnahmen.<br />
Sponsor:<br />
Getränkehandel Wybrunne<br />
Jurastrasse 6<br />
4536 Attiswil<br />
Quelle: Attiswiler Chronik
Besonderheiten<br />
Oberbipp<br />
R.3<br />
Oberbipper Schopfgugger, hielässig!<br />
Auf einer Schulreise Anfangs <strong>des</strong> 20. Jahrhunderts fuhr man bei<br />
Berken über die «Fahr» (mit der Fähre über die Aare).<br />
Alle hatten Angst! Steffenjoggis Boudi (Leist) rief in seiner grossen<br />
Not: «Wenn ich hier versaufe, schlagen sie mich zuhause z’Tod!»<br />
Wenn die Frösche im Erlimoos «ruggen» (quaken) heisst es in<br />
Oberbipp:<br />
«Der Frauenchor ist am Üben!»<br />
Standen in Oberbipp eine Gruppe Leute beisammen, verleitete es<br />
manchen oft dazu auszurufen:<br />
«Oha, im Dettenbühl haben sie Ausgang!»<br />
(Im Pflegeheim Dettenbühl, Wiedlisbach, wohnten Behinderte, die<br />
ab und zu die umliegenden Dörfer aufsuchten).<br />
Hatte es Nebel im Graben hinter dem Schloss, hiess es in<br />
Oberbipp:<br />
«Der Joggeli tubaket», das Wetter wird sich ändern.<br />
In Oberbipp gibt es zwei Seilereien (Zurlinden und Bürki), <strong>des</strong>halb<br />
sagte man im Gäu einem Hälslig «es Bipper Gwehr» (ein Bipper<br />
Gewehr).<br />
Sponsor:<br />
Haudenschild AG<br />
Bauen mit Holz<br />
Gässli 10<br />
4704 Niederbipp<br />
Quelle: «Flueblüemli und Aarechisle», Elisabeth Pfluger, Solothurn
Besonderheiten<br />
Das Bipperamt<br />
S.3<br />
1641 leistete das Bipperamt Widerstand gegen die vom Landvogt<br />
erhobene Wehrsteuer.<br />
Landvogt Burkhart Fischer schrieb in seine Bücher:<br />
Niederbipp alle gehorsam niemand ungehorsam<br />
Attiswil 43 gehorsam 30 ungehorsam<br />
Wiedlisbach 28 gehorsam 31 ungehorsam<br />
Oberbipp 3 gehorsam 59 ungehorsam<br />
Berggemeinden 2 gehorsam 29 ungehorsam<br />
1788 schrieb Landvogt Stettler über das Bipperamt:<br />
Die Einwohner sind ihrer Obrigkeit von Herzen und mit willigstem<br />
Gehorsam zugetan und treu. Sie lieben ihr Vaterland und vorzüglich<br />
ihren Grund und Boden.<br />
Jeder, auch der Ärmste, will ein Stück davon besitzen, welches ihm<br />
einen kärglichen Unterhalt gewährt.<br />
Trunkenbolde sind nicht häufig. Ausser an den Steigerungen geniessen<br />
sie den Wein im Übermass. Hingegen hat seit etlichen<br />
Jahren auch hier, bei den Frauen das schädliche Kaffeetrinken eingerissen.<br />
Die Männer sind wohlgebildet, mittelgross, abgehärtet und stark.<br />
Bei den gefährlichsten und rauesten Arbeiten sind sie unverdrossen<br />
und beherzt. Ihr Geist ist mehr nachahmend als erfinderisch und<br />
tätig.<br />
Für fremde Kriegsdienste sind sie vorzüglich geschaffen, lassen sich<br />
aber selten dazu verleiten. Lieber leiden sie Mangel, wenn sie nur<br />
in ihrem Dorf, in ihrer eigenen Hütte leben können und ein kleines<br />
Stück Land besitzen, welches ihnen einen kärglichen Unterhalt<br />
gewährt.<br />
Sie sind unordentlich in allem. Alles liegt in und aussert den Häusern<br />
durcheinander.<br />
Selten scheiten sie das Holz bis sie es verbrennen wollen. Die<br />
schlechtesten Zäune umgeben Ihre Besitzungen.<br />
Sie sind leichtsinnig, eigennützig und geldgierig – dabei sind sie willig,<br />
getreu und mutig.<br />
Sponsor:<br />
Daniel Obi-Müller<br />
Randfluhweg 4<br />
4538 Oberbipp<br />
Quelle: «Flueblüemli und Aarechisle», Elisabeth Pfluger, Solothurn
Besonderheiten<br />
Getrei<strong>des</strong>peicher «Spicher»<br />
T.3<br />
Der zum Bauerngut der Familie L. und B. Schaad-Frei gehörende<br />
Spicher wurde im Jahre 1737 als Nebengebäude zur Erweiterung<br />
<strong>des</strong> Betriebes erbaut.<br />
Genutzt wurde der Speicher zum Einbringen und Überwintern der<br />
Ernte: Getreide, Obst und Gedörrtes. In speziellen Vorrichtungen<br />
wurde auch luftgetrocknetes oder geräuchertes Fleisch sowie<br />
Wurstware gelagert.<br />
Die Saat zum Bestellen der Äcker im Frühjahr wurde vorbereitet und<br />
zum Vorkeimen angetrieben.<br />
Heute finden darin in der nasskalten Jahreszeit landwirtschaftliche<br />
Geräte und Werkzeuge einen trockenen Platz.<br />
Fachleute <strong>des</strong> Kanton Bern und <strong>des</strong> Schweizer Heimatschutzes<br />
erklärten den Speicher als schützenswertes Objekt und eines der<br />
schönsten Exemplare im Oberaargau.<br />
Sponsor:<br />
Helmut Staudacher<br />
Landtechnik und Reparaturwerkstatt<br />
Untergasse 21, 4538 Oberbipp<br />
Tel. 032 636 29 19, Fax 032 636 14 70<br />
www. staudacher-landtechnik.ch<br />
Quelle: Archäologischer-Dienst, Bern; Familie Marti-Grädel, Oberbipp