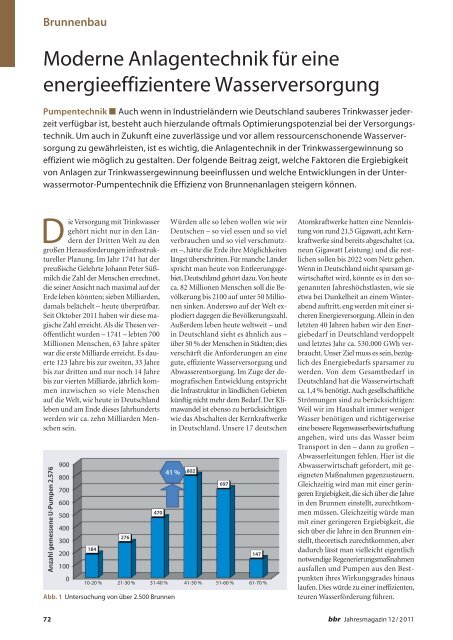Brunnenbau - Wilo EMU Anlagenbau
Brunnenbau - Wilo EMU Anlagenbau
Brunnenbau - Wilo EMU Anlagenbau
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Brunnenbau</strong><br />
Moderne Anlagentechnik für eine<br />
energieeffizientere Wasserversorgung<br />
Pumpentechnik n Auch wenn in Industrieländern wie Deutschland sauberes Trinkwasser jederzeit<br />
verfügbar ist, besteht auch hierzulande oftmals Optimierungspotenzial bei der Versorgungstechnik.<br />
Um auch in Zukunft eine zuverlässige und vor allem ressourcenschonende Wasserversorgung<br />
zu gewährleisten, ist es wichtig, die Anlagentechnik in der Trinkwasser gewinnung so<br />
effizient wie möglich zu gestalten. Der folgende Beitrag zeigt, welche Faktoren die Ergiebigkeit<br />
von Anlagen zur Trinkwassergewinnung beeinflussen und welche Entwicklungen in der Unterwassermotor-Pumpentechnik<br />
die Effizienz von Brunnenanlagen steigern können.<br />
Die Versorgung mit Trinkwasser<br />
gehört nicht nur in den Ländern<br />
der Dritten Welt zu den<br />
großen Herausforderungen infrastruktureller<br />
Planung. Im Jahr 1741 hat der<br />
preußische Gelehrte Johann Peter Süßmilch<br />
die Zahl der Menschen errechnet,<br />
die seiner Ansicht nach maximal auf der<br />
Erde leben könnten; sieben Milliarden,<br />
damals belächelt – heute überprüfbar.<br />
Seit Oktober 2011 haben wir diese magische<br />
Zahl erreicht. Als die Thesen veröffentlicht<br />
wurden – 1741 – lebten 700<br />
Millionen Menschen, 63 Jahre später<br />
war die erste Milliarde erreicht. Es dauerte<br />
123 Jahre bis zur zweiten, 33 Jahre<br />
bis zur dritten und nur noch 14 Jahre<br />
bis zur vierten Milliarde, jährlich kommen<br />
inzwischen so viele Menschen<br />
auf die Welt, wie heute in Deutschland<br />
leben und am Ende dieses Jahrhunderts<br />
werden wir ca. zehn Milliarden Menschen<br />
sein.<br />
Anzahl gemessene U-Pumpen 2.576<br />
900<br />
800<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
184<br />
10-20 %<br />
276<br />
21-30 %<br />
470<br />
31-40 %<br />
Abb. 1 Untersuchung von über 2.500 Brunnen<br />
Würden alle so leben wollen wie wir<br />
Deu tschen – so viel essen und so viel<br />
ver brauchen und so viel verschmutzen<br />
–, hätte die Erde ihre Möglichkeiten<br />
längst überschritten. Für manche Länder<br />
spricht man heute von Entleerungsgebiet,<br />
Deutschland gehört dazu. Von heute<br />
ca. 82 Millionen Menschen soll die Bevölkerung<br />
bis 2100 auf unter 50 Millionen<br />
sinken. Anderswo auf der Welt explodiert<br />
dagegen die Bevölkerungszahl.<br />
Außerdem leben heute weltweit – und<br />
in Deutschland sieht es ähnlich aus –<br />
über 50 % der Menschen in Städten; dies<br />
verschärft die Anforderungen an eine<br />
gute, effiziente Wasserversorgung und<br />
Abwasserentsorgung. Im Zuge der demografischen<br />
Entwicklung entspricht<br />
die Infrastruktur in ländlichen Gebieten<br />
künftig nicht mehr dem Bedarf. Der Klimawandel<br />
ist ebenso zu berücksichtigen<br />
wie das Abschalten der Kernkraftwerke<br />
in Deutschland. Unsere 17 deutschen<br />
41 %<br />
802<br />
41-50 %<br />
697<br />
147<br />
51-60 % 61-70 %<br />
Atomkraftwerke hatten eine Nennleistung<br />
von rund 21,5 Gigawatt, acht Kernkraftwerke<br />
sind bereits abgeschaltet (ca.<br />
neun Gigawatt Leistung) und die restlichen<br />
sollen bis 2022 vom Netz gehen.<br />
Wenn in Deutschland nicht sparsam gewirtschaftet<br />
wird, könnte es in den sogenannten<br />
Jahreshöchstlasten, wie sie<br />
etwa bei Dunkelheit an einem Winterabend<br />
auftritt, eng werden mit einer sicheren<br />
Energieversorgung. Allein in den<br />
letzten 40 Jahren haben wir den Energiebedarf<br />
in Deutschland verdoppelt<br />
und letztes Jahr ca. 530.000 GWh verbraucht.<br />
Unser Ziel muss es sein, bezüglich<br />
des Energiebedarfs sparsamer zu<br />
werden. Von dem Gesamt bedarf in<br />
Deutschland hat die Wasserwirtschaft<br />
ca. 1,4 % benötigt. Auch gesellschaftliche<br />
Strömungen sind zu berücksichtigen:<br />
Weil wir im Haushalt immer weniger<br />
Wasser benötigen und richtigerweise<br />
eine bessere Regen wasserbewirtschaftung<br />
angehen, wird uns das Wasser beim<br />
Transport in den – dann zu großen –<br />
Abwasserleitungen fehlen. Hier ist die<br />
Abwasserwirtschaft gefordert, mit geeigneten<br />
Maßnahmen gegenzusteuern.<br />
Gleichzeitig wird man mit einer geringeren<br />
Ergiebigkeit, die sich über die Jahre<br />
in den Brunnen einstellt, zurechtkommen<br />
müssen. Gleichzeitig würde man<br />
mit einer geringeren Ergiebigkeit, die<br />
sich über die Jahre in den Brunnen einstellt,<br />
theoretisch zurechtkommen, aber<br />
dadurch lässt man vielleicht eigentlich<br />
notwendige Regenerierungsmaßnahmen<br />
ausfallen und Pumpen aus den Bestpunkten<br />
ihres Wirkungsgrades hinaus<br />
laufen. Dies würde zu einer ineffi zienten,<br />
teuren Wasserförderung führen.<br />
72 Jahresmagazin 12/ 2011
Regenwasser:<br />
wenig Mineralien<br />
aber viel Sauerstoff,<br />
realtiv sauer und<br />
aggressiv<br />
0.50 Mutterboden<br />
9.50<br />
12.00<br />
Sand<br />
Sandstein,<br />
teilw. verwittert,<br />
grobkörnig<br />
junges Wasser:<br />
Aquifer<br />
sauerstoffreich,<br />
mineralienarm, m,<br />
aggressiv<br />
23.00<br />
25.00<br />
35.00<br />
36.00<br />
47.00<br />
Eisen + Mangan<br />
Wasser löst die Metalle<br />
Schluffig, tonig,<br />
schwach sandig, steinig<br />
(Lehm)<br />
Tonstein, sehr fest, dicht<br />
Trennschicht<br />
Sandstein, klüftig<br />
mittel- bis grobkörnig<br />
Ton, fest<br />
Sandstein, schwach<br />
klüftig, teils brüchig<br />
mittelkörnig<br />
altes Wasser:<br />
sauerstoffarm,<br />
reduziert,<br />
mineralreich<br />
Ton, sehr zäh, plastisch<br />
Unterschiedliche Grundwasserleiter<br />
AQUIFER<br />
Brunnenstube<br />
9.30<br />
Versuche einer Effizienzsteigerung und<br />
Regenerierung einer vorhandenen Anlage<br />
scheitern oftmals daran, dass die<br />
Gesamtzusammenhänge aller Einflussgrößen<br />
auf den Betrieb einer Brunnenanlage<br />
nicht hinreichend bekannt sind.<br />
Damit die technische Planung und Realisierung<br />
effizienterer und langlebigerer<br />
Brunnenanlagen gelingt, ist es erforderlich,<br />
das System in seiner Gesamtheit zu<br />
erfassen.<br />
Optimierungsbedarf<br />
im Pumpenbestand<br />
Eine Untersuchung von über 2.500<br />
Brunnenanlagen, die über mehrere Jahre<br />
im Auftrag der Pumpenwirtschaft<br />
in Deutschland durchgeführt wurde,<br />
Oberwasserabdichtung<br />
abdichtung<br />
Nitrat u.<br />
Umwelteinflüsse<br />
Dämmer<br />
Filterrohr<br />
Vollrohre in der<br />
Trennschicht<br />
da kostengünstiger<br />
Abb. 2 Unterschiedliche Grundwasserleiter (Aquifere)<br />
Grundwasseraustausch<br />
austausch<br />
Grundwassertourismus<br />
GW 1 GW 2 GW 3<br />
11.80<br />
Messstellen<br />
21.10<br />
6.70<br />
ergab, dass der durchschnittliche Gesamtwirkungsgrad<br />
von Pumpen in der<br />
Trink wasserförderung bei lediglich<br />
41 % liegt. Würden alle Pumpen im Optimum<br />
laufen, könnte ein Gesamtwirkungsgrad<br />
von über 70 % erreicht werden<br />
(Abb. 1).<br />
In den rund 25.000 Vertikalfilter- und<br />
360 Horizontalbrunnen, die deutschlandweit<br />
die Trinkwasserversorgung<br />
sichern, sowie zahlreichen weiteren<br />
Brunnen, die zur Grundwasserabsenkung,<br />
Versickerung, Betriebswasser-,<br />
Feuerlösch- oder Notwassergewinnung<br />
genutzt werden, sind zusammen etwa<br />
40.000 Unterwassermotor-Pumpen im<br />
Einsatz. Angesichts der Ergebnisse der<br />
o. g. Studie wird deutlich, dass hier noch<br />
erhebliches Energiesparpotenzial besteht,<br />
indem man den Gesamtwirkungsgrad<br />
der eingesetzten Pumpentechnik<br />
verbessert.<br />
Wirkungsgradverluste<br />
durch Brunnenalterung<br />
Dabei sind die Gründe für die nur mäßigen<br />
Wirkungsgrade von Unterwassermotor-Pumpen<br />
in der Wassergewinnung<br />
vielfältig. Einer der Hauptfaktoren<br />
für unterdurchschnittliche Wirkungsgrade<br />
und Förderraten ist die Brunnenalterung.<br />
Mit der Zeit kommt es zur Anbzw.<br />
Ablagerung von Stoffen an den Anlagenkomponenten<br />
eines Brunnens als<br />
Folge chemischer Ausfällung, mechanischer<br />
Einschwemmung oder biologischer<br />
Stoffwechselprodukte. Ursache<br />
dafür sind physikalische, chemische und<br />
biologische Prozesse. Sie können zu einer<br />
Versandung, Versinterung und Verockerung,<br />
aber auch zur Korrosion der Brunnenkomponenten<br />
wie den Unterwassermotor-Pumpen<br />
führen.<br />
Am häufigsten kommt es zu einer biologischen<br />
Verockerung, der Bildung von<br />
Eisenmanganoxid. Man findet dieses im<br />
Innenbereich des Filterrohres, in den<br />
Filterschlitzen und im Porenraum der<br />
Kiesschüttung, sodass sich während des<br />
Brunnenbetriebs nach und nach der Zulauf<br />
verändert. In der Folge beeinträchtigt<br />
dies den Wirkungsgrad der eingesetzten<br />
Pumpentechnik und die Er -<br />
giebigkeit des Brunnens, sodass eine<br />
Brunnenregenerierung und Optimierung<br />
des Pumpenbestands erforderlich<br />
sein kann. Durch das Zusetzen von z. B.<br />
Filterstrecke und Steigleitung können<br />
selbst korrekt ausgelegte und funktionierende<br />
Pumpen nicht mehr im Bestpunkt<br />
arbeiten. Die Pumpen laufen in<br />
den Teillastbereich und arbeiten dadurch<br />
länger bei schlechterem Wirkungsgrad<br />
mit erheblichen Auswirkungen auf die<br />
Betriebskosten.<br />
Dass es zu diesen Verockerungen kommt,<br />
liegt oft daran, dass sich durch die Verfilterung<br />
von unterschiedlichen Aqui -<br />
feren das frische Wasser aus oberen<br />
Stockwerken, welches sauerstoffhaltig<br />
ist, mit dem Wasser aus unteren Stockwerken,<br />
welches mineralhaltig ist, austauscht.<br />
Treffen sich das sauerstoffhaltige<br />
Wasser mit dem Mangan und dem Eisen,<br />
Jahresmagazin 12/ 2011 73
<strong>Brunnenbau</strong><br />
entstehen, vereinfacht gesagt, diese Verockerungen<br />
(Abb. 2).<br />
Für die Bestimmung des Betriebswasserspiegels,<br />
der zur Berechnung der statischen<br />
Höhe notwendig ist, gilt es, viele<br />
Parameter zu überprüfen. Bezüglich verschiedener<br />
Faktoren und über die Jahre<br />
verändert sich der Absenkungstrichter;<br />
somit addiert sich die Gesamtabsenkung<br />
aus der Absenkung im Aquifer, dem Einfluss<br />
der Bohraureole, der Filterkiesschüttung<br />
und der Filterschlitze. Diese<br />
Parameter ändern sich also im Laufe der<br />
Zeit.<br />
Abb. 3 Unterschiedliche Kiesschüttungen/Glaskugeln;<br />
Links: Zunehmende Verockerung<br />
in den Porenräumen der Kiesschüttung<br />
Brunnenregenerierung zeitlich<br />
richtig abstimmen<br />
Ein hoher Stellenwert bei allen Regenerierungsverfahren<br />
kommt dem rich -<br />
tigen Zeitpunkt zu, denn entsprechende<br />
Maßnahmen sollten initiiert werden,<br />
noch bevor eine signifikante Verminderung<br />
bei der Ergiebigkeit eines Brunnens<br />
feststellbar ist. Spätestens bei Leistungsrückgängen<br />
von über 15 % gegenüber<br />
dem Neubauzustand ist dringender<br />
Handlungsbedarf gegeben, um die Energiekosten<br />
für den Brunnenbetrieb nicht<br />
ausufern zu lassen und die Betriebsfähigkeit<br />
des Gesamtsystems nicht zu gefährden.<br />
Daher ist unter anderem eine<br />
regelmäßige Brunnenüberwachung zu<br />
empfehlen, z. B. durch kameratechnische<br />
Erfassung oder sogenannte Pumpversuche.<br />
Solche Verfahren können zur Klärung<br />
der Frage herangezogen werden,<br />
ob eine Brunnenregenerierung erforderlich<br />
ist. Wichtige Beurteilungskriterien<br />
dabei sind unter anderem die hydraulische<br />
Leistungsfähigkeit der Pumpe,<br />
der Filtereintrittswiderstand, der<br />
Restsandgehalt und die Rohwasserbeschaffenheit.<br />
Abb. 4 Verockertes Laufrad<br />
Mithilfe fest installierter Überwachungstechnik<br />
lassen sich Daten zum Brunnenzustand<br />
auch regelmäßig erfassen.<br />
Eine geeignete Lösung hierfür stellt der<br />
Einsatz von Peilrohren zur Messung der<br />
Wasserspiegellage im Ringraum der<br />
Brunnen und zur Überwachung des Zuflusswiderstandes<br />
(Delta-H-Wert) dar.<br />
Um Letzteren zu ermitteln, empfiehlt<br />
sich der Einsatz jeweils zweier Peilrohre<br />
pro Brunnenschacht. Eines sollte mit<br />
Rohrschellen direkt an der Steigleitung<br />
befestigt, ein zweites in die Ringraumverfüllung<br />
eingebracht werden. Eine<br />
74 Jahresmagazin 12/ 2011
Abb. 5 Links verockertes, rechts neues Saugsieb<br />
weitere bewährte Technologie zur Brunnenüberwachung<br />
sind sogenannte<br />
Druckaufnehmer. Diese können individuell<br />
für das Brunnensystem konfiguriert<br />
werden und z. B. den Ruhe- sowie<br />
den Betriebswasserspiegel erfassen<br />
und somit auch als Trockenlaufschutz<br />
der Pumpe fungieren. Die so erfassten<br />
Daten lassen sich mittels Datenlogger<br />
speichern, um Langzeitbeobachtungen<br />
zu ermöglichen. Zeigen entsprechende<br />
Überwachungssysteme Veränderungen<br />
an und kommt es zu Abweichungen bei<br />
den Förderraten der Pumpe, ist dies ein<br />
deutlicher Indikator dafür, dass die<br />
Brunnenanlage nicht optimal arbeitet<br />
und gegebenenfalls eine Regenerierungsmaßnahme<br />
erforderlich ist.<br />
Zusammenhänge von Filterarten<br />
und Verockerung<br />
Einen grundlegenden Einfluss auf die<br />
Anfälligkeit von Brunnenanlagen für<br />
An- und Ablagerungen hat die Wahl des<br />
Filterkieses. Üblicherweise werden zur<br />
Ringraumverfüllung Quarzsande und<br />
Kiese gemäß DIN 4924 verwendet. Je<br />
nach Qualität des Filterkieses kann dieser<br />
einen mehr oder weniger großen Anteil<br />
von Unterkorn aufweisen. Dabei handelt<br />
es sich um Partikel, die kleiner als die<br />
gewünschte Körnung des Filterkieses<br />
sind. Diese werden strömungsbedingt<br />
in Richtung Brunnenverrohrung gespült,<br />
wodurch die Filterschlitze zuset -<br />
zen (mechanische Kolmation). Die<br />
Hocheffiziente Lösungen<br />
in allen Anwendungen.<br />
Water Management von <strong>Wilo</strong>.<br />
<strong>Wilo</strong>PumpenundSystemefürWaterManagementsetzenweltweitMaßstäbehinsichtlichHocheffizienzundtechnischerLeistung.<br />
Dank unseres langjährigen Know-hows und unserer herausragenden Planungsunterstützung erhalten Sie jederzeit optimale<br />
Lösungen für alle Ihre Anwendungen: in der Wasserversorgung, Druckerhöhung, Abwasserentsorgung und Abwasserbehandlung.<br />
Alles aus einer Hand – und auf Herz und Nieren getestet. Kompetent? Wir nennen das Pumpen Intelligenz.<br />
www.wilo.de
<strong>Brunnenbau</strong><br />
Durchlässigkeit der Filterstrecke wird<br />
dadurch negativ beeinträchtigt, die veränderten<br />
Strömungsverhältnisse führen<br />
zu einer schnelleren Verockerung der<br />
Filter strecke.<br />
Eine optimale und gleichbleibende Körnung<br />
lässt sich demgegenüber mit Glaskugeln<br />
erzielen, weshalb sich deren Einsatz<br />
in der Praxis immer mehr durchsetzt.<br />
Durch Glaskugeln erreicht man<br />
einen gleichmäßigen Porenzwischenraum<br />
mit glatten Oberflächen. Da es<br />
hier keine Verstopfung der Wasserwege<br />
durch Unterkorn gibt, weist die Filterstrecke<br />
über einen längeren Zeitraum<br />
hinweg eine geringere Anfälligkeit für<br />
Verockerungen auf (Abb. 3). Die statische<br />
Förderhöhe bleibt länger konstant,<br />
die Pumpe kann prinzipiell längere Zeit<br />
im Bestpunkt arbeiten. Damit ist eine<br />
komplizierte und aufwendige Brunnenregenerierung<br />
in den bis zu 300 m tiefen<br />
Anlagen seltener erforderlich, was eine<br />
deutliche Kosteneinsparung zur Folge<br />
hat. Erspart man sich durch den Einsatz<br />
von Glaskugeln im Laufe eines Brunnenlebens<br />
eine Regenerierung, haben<br />
sich in der Regel die Mehrkosten für<br />
Glaskugeln amortisiert.<br />
Wirkungsgradverluste<br />
durch Verockerung<br />
Die besseren hydraulischen Eigenschaften<br />
der Glaskugelschüttungen führen<br />
jedoch auch dazu, dass das im Wasser<br />
gelöste Manganoxid leichter zur<br />
Pumpe gelangt und sich dort vermehrt<br />
ablagert. Besonders Laufräder und Leitgehäuse<br />
sind davon betroffen. So treten<br />
hydraulische Leistungseinbußen durch<br />
Fehl anströmung auf und das Förder -<br />
volumen verringert sich. In Abbildung<br />
4 sind die dadurch auftretenden<br />
Kavita tionserscheinungen deutlich zu<br />
sehen. Auch das Zusetzen des Saug -<br />
siebes kann dazu beitragen, dass nicht<br />
mehr ausreichend Wasser in die Pumpe<br />
fließt (Abb. 5). Die möglichen Folgen:<br />
Kavitationserscheinungen, unruhiger<br />
Lauf der Maschine, Verlassen des guten<br />
Betriebspunktes, höhere Belastungen<br />
auf Dichtungen und Lager und letzt -<br />
lich deutlich kürzere Standzeit des<br />
Aggregats.<br />
Aufgrund des verschlechterten Pumpenwirkungsgrades<br />
nimmt der spezifische<br />
Stromverbrauch deutlich zu. Die<br />
aufgenommene Leistung des Motors<br />
muss neben der im Laufrad an die<br />
Flüssigkeit übertragene Energie, der so -<br />
genannten Schaufelleistung, die Leistungsverluste<br />
kompensieren, die durch<br />
Flüssigkeitsreibung an den äußeren<br />
Ober flächen des Laufrades entstehen.<br />
Es ist wichtig, die Strömungsverhältnisse<br />
in der Pumpe zu verstehen, damit vom<br />
geförderten Volumenstrom, der ersten<br />
Stufe, ein optimaler Zustrom in die weiteren<br />
Stufen gewährleistet ist. Hier gilt<br />
es auf den Spalt zwischen Laufrad und<br />
Spaltring zu achten (Abb. 6), aber auch<br />
darauf, dass die Pumpen nicht im Teillast-<br />
oder Überlastbereich arbeiten, dass<br />
dadurch entstehende Rezirkulationsströmungen<br />
den Volumenstrom beeinflussen,<br />
was zu Druckimpulsen im Laufrad<br />
führt.<br />
Abb. 6 Rezirkulationsströmung<br />
Beschichtung als Schutz<br />
für Pumpen<br />
Eine wirtschaftliche Maßnahme gegen<br />
die Verockerung kann die Beschichtung<br />
der Pumpe sein. Moderne Beschichtungen<br />
sind nicht nur zur Ertüchtigung bereits<br />
beschädigter Pumpen geeignet, sondern<br />
dienen auch dem präventiven<br />
Schutz der Aggregate. Die Beschichtung<br />
„Ceram“ beispielsweise bietet einen wirkungsvollen<br />
Schutz vor korrosiven oder<br />
abrasiven Einflüssen der zu fördernden<br />
Medien. Pumpengehäuse sowie Laufräder,<br />
die mit dem Zwei-Komponenten-Korrosionsschutz<br />
mit Aluminiumoxidanteilen<br />
beschichtet sind, weisen<br />
eine erheblich verlängerte Standzeit auf.<br />
Durch ihre hohe Oberflächenspannung<br />
ist die Beschichtung deutlich glatter als<br />
die Oberfläche von Neubauteilen. Damit<br />
sind beschichtete Pumpen auch weniger<br />
anfällig für Ablagerungen von Eisenmanganoxid.<br />
Das Ergebnis sind verringerte<br />
Strömungswiderstände und -verluste,<br />
der Wirkungsgrad der Pumpe<br />
steigt im Vergleich zu einem unbeschichteten<br />
Aggregat. Über den gesamten Lebenszyklus<br />
ergibt sich hieraus zusätzlich<br />
eine erheblich verbesserte Gesamtwirtschaftlichkeit.<br />
Durch ihre besonderen<br />
Eigenschaften trägt diese Beschichtung<br />
sogar dazu bei, den Pumpenwirkungsgrad<br />
neuer Aggregate zu verbessern. In<br />
einer Versuchsreihe des Herstellers konnten<br />
durch Messungen vor und nach der<br />
Applikation Wirkungsgradsteigerungen<br />
von rund zwei Prozent pro Pumpe festgestellt<br />
werden. Die Kosten für die Beschichtung<br />
amortisieren sich daher meist<br />
binnen kürzester Zeit. Möglich ist die<br />
Anwendung des Beschichtungsverfahrens<br />
bei allen Pumpen ab acht Zoll. In<br />
der Variante „Ceram CT“ erfüllt die Beschichtung<br />
die Anforderungen der<br />
„KTW-Leitlinie“ des Umweltbundesamtes<br />
und eignet sich daher ideal für<br />
den Einsatz im Trinkwasserbereich.<br />
Im Ausland sind bereits Teflonbeschichtungen<br />
im Einsatz, welche bezüglich<br />
Absetzen von Ablagerungen noch effektiver<br />
sind. In Deutschland sind diese<br />
Beschichtungen aber nicht KTW-zu -<br />
gelassen, sondern nur für den Lebensmittelbereich.<br />
Teflonbeschichtung wird<br />
im Abwasserbereich als Innenbeschichtung<br />
bei Pumpen, z. b. in MAP-Prozessen,<br />
seit ca. fünf Jahren erfolgreich eingesetzt.<br />
Steigleitung im Brunnen und<br />
erdverlegte Rohrleitungen<br />
Neben der Pumpe ist die Steigleitung<br />
zu beachten und die anschließende Erdverlegung.<br />
Neue Steigleitungen werden<br />
heute sehr oft als ZSM-Leitungen ausgeführt<br />
(zugfeste Steckmuffenverbindung).<br />
Kommen Steigleitungen mit<br />
Flanschverbindungen zum Einsatz, wer-<br />
76 Jahresmagazin 12/ 2011
Neue Steigleitung Verockerte Steigleitung Alte Erdrohrverlegung<br />
Abb. 7 Steigleitung und Erdrohrverlegung<br />
den die Flansche sehr oft ausgefräst, um<br />
die Kabel bei kleinen Brunnen eng an<br />
der Steigleitung befestigen zu können.<br />
Aber auch in diesen Leitungen kommt<br />
es zum Absetzen von Verockerungen,<br />
welche schnell eine 100er-Leitung zu<br />
einer 80er-Leitung verkleinern können<br />
(Abb. 7). Die dadurch veränderten<br />
hydraulischen Verhältnisse lassen die<br />
dynamische Kennlinie auch dynamischer<br />
werden und der Schnittpunkt der<br />
Anlagenkennlinie mit dem Schnittpunkt<br />
der Q-H-Linie wandert nach<br />
links. Die Pumpen verlassen den Bestpunkt.<br />
In vielen Anlagen ist dies über<br />
vorhandene Frequenzumformer teilweise<br />
zu kompensieren, auf den Betrieb<br />
mit Frequenzumformer wird in diesem<br />
Beitrag nicht näher eingegangen.<br />
Sorgfältige Auslegung reduziert<br />
Folgekosten<br />
Ein Faktor, der hinsichtlich der Effizienz<br />
von Brunnenanlagen nicht zu unterschätzen<br />
ist, ist die richtige Auslegung<br />
der Pumpentechnik beim Neubau des<br />
Brunnens oder auch beim Austausch<br />
des Pumpenbestandes. Hier liegt es zunächst<br />
im Interesse der Betreiber, dass<br />
die eingeplanten Pumpen nicht zu groß<br />
dimensioniert werden. Wo dies in der<br />
Praxis der Fall ist, arbeiten die Pumpen<br />
nicht im optimalen Betriebspunkt<br />
und verbrauchen damit unnötig viel<br />
Energie.<br />
Eine sorgfältige Auslegung ist in der<br />
Regel unkompliziert. Mithilfe von Pumpenauswahlprogrammen<br />
lassen sich die<br />
richtig dimensionierten Pumpen anhand<br />
der Betriebsparameter der Brunnenanlage<br />
schnell ermitteln. Hier besteht<br />
darüber hinaus auch die Möglichkeit<br />
zur Durchführung einer Amortisationsrechnung<br />
nach betriebswirtschaftlichen<br />
Maßstäben. Für die Betreiber bestehender<br />
Wassergewinnungsanlagen ist es zudem<br />
empfehlenswert, den Pumpenbestand<br />
präventiv daraufhin zu kontrollieren,<br />
ob die eingesetzten Pumpen<br />
wirtschaftlich arbeiten. Ist dies nicht der<br />
Fall, kann sogar ein vorfristiger Austausch<br />
des Pumpenbestandes eine sinnvolle<br />
Investition sein.<br />
Berechnungsbeispiel einer<br />
durchgeführten Optimierung<br />
Aggregatsdaten:<br />
Pumpe: K 126-2 (2 stufige Pumpe)<br />
Unterwassermotor: NU 801T-260<br />
(Motor mit reiner Trinkwasserfüllung)<br />
Q: 56 l/s<br />
H: 67 m<br />
Eta Pumpe: 78,3 %<br />
P 2 : 47,5 kW<br />
P 1 : 55 kW<br />
Eta Gesamt: 68 %<br />
Laufzeit: 20 h/Tag<br />
Zeitraum: 10 Jahre<br />
Preis pro kWh: 15 ct<br />
Es wurde eine Regenerierung der gesamten<br />
Anlage durchgeführt. Zum Einsatz<br />
gebracht wurde eine neue Pumpe<br />
mit Ceram CT-Beschichtung und mit<br />
einem größer ausgelegten Kabelquerschnitt<br />
(Kabellänge 95 m, Mehrpreis<br />
580 Euro für das Kabel). Die Energieeinsparung<br />
durch das größer ausgelegte<br />
Kabel beträgt 735 Euro/Jahr, das Kabel<br />
hatte sich also bereits im ersten Jahr<br />
amortisiert. Die aufgebrachte Ceram<br />
Jahresmagazin 12/ 2011 77
<strong>Brunnenbau</strong><br />
1.000.000<br />
900.000<br />
800.000<br />
700.000<br />
894.620 €<br />
Einsparung<br />
296.750 €<br />
Einsparung<br />
315.360 €<br />
Kosten in €<br />
600.000<br />
500.000<br />
400.000<br />
597.870 €<br />
579.260 €<br />
300.000<br />
200.000<br />
100.000<br />
Abb. 8 Verlauf<br />
der Energiekosten<br />
im Laufe<br />
von zehn Jahren<br />
0<br />
16.700 €<br />
Neupreis<br />
Aggregat<br />
Energiekosten bei<br />
eta Gesamt 45 %<br />
Energiekosten bei<br />
eta Gesamt 68 %<br />
6.770 €<br />
Energiekosten<br />
Kabel<br />
Energiekosten mit<br />
Beschichtung eta<br />
Gesamt 69,5 %<br />
CT-Beschichtung kostete 850 Euro und<br />
bringt eine jährliche Einsparung von<br />
1.860 Euro; somit erfolgte die Amortisation<br />
in unter sechs Monaten. Die Pumpe<br />
selbst hatte einen Preis von 16.700<br />
Euro, die Gesamtkosten der kompletten<br />
Überarbeitung lagen bei ca. 65.000 Euro.<br />
Die theoretische Einsparung beläuft sich<br />
auf 315.360 Euro, ausgelegt auf zehn<br />
Jahre. Von diesem Betrag sind die entstanden<br />
Überarbeitungskosten und<br />
Neuanschaffungen abzuziehen. Es ist<br />
zudem zu beachten, dass es sich um einen<br />
rein theoretischen Wert handelt, da<br />
sich die Gesamtanlage im Laufe der Zeit<br />
wieder verschlechtert und die Pumpen<br />
wieder aus ihren Bestpunkten heraus<br />
fahren. Dass aber unter dem Strich ein<br />
großes Plus übrig bleibt, ist hier ersichtlich<br />
und eine Überarbeitung der Anlage<br />
war dringend notwendig (Abb. 8).<br />
Entscheidungsgrundlage<br />
Lebenszykluskosten-Analyse<br />
Im Vergleich zu den Anschaffungskosten,<br />
die einen verhältnismäßig geringen<br />
Anteil an den sogenannten Lebenszykluskosten<br />
(Life-Cycle-Costs oder LCC)<br />
einer Pumpe ausmachen – im Trinkwasserbereich<br />
beispielsweise im Durchschnitt<br />
lediglich 5 % –, schlagen die<br />
Energiekosten mit 84 % und die Instandhaltungskosten<br />
mit 10 % deutlich<br />
stärker zu Buche. Betreibt man also<br />
falsch dimensionierte, beschädigte oder<br />
schlecht laufende Pumpen weiter, können<br />
sich die Mehrkosten binnen kürzester<br />
Zeit auf ein nicht zu tolerierendes<br />
Maß summieren.<br />
Das in den USA entwickelte LCC-Verfahren<br />
wurde vom Herstellerverband<br />
Europump und dem herstellerübergreifenden<br />
Hydraulic Institute für die Berechnung<br />
und Auslegung von Pumpen<br />
und Pumpensystemen nutzbar gemacht.<br />
Es kann sowohl bei Neuanlagen als auch<br />
zur Optimierung von Bestandsanlagen<br />
eingesetzt werden. Bezogen auf den Lebenszyklus<br />
einer Pumpe werden dabei<br />
verschiedene Kostenblöcke ermittelt.<br />
Bei Pumpen für die Wasserversorgung<br />
sollte eine LCC-orientierte Planung<br />
besonders auf die Verringerung der Leistungsaufnahme<br />
und auf die Verlängerung<br />
der Pumpenlebensdauer aus ge -<br />
richtet sein, da hier die größten Einsparpotenziale<br />
bestehen. So rechnet sich der<br />
etwas größere Planungsaufwand, indem<br />
über den gesamten Lebenszyklus ein<br />
kostengünstiger und somit besonders<br />
wirtschaftlicher Betrieb der Anlage erreicht<br />
wird.<br />
Fazit<br />
Brunnen zählen zum wichtigsten Anlagevermögen<br />
von Unternehmen aus dem<br />
Bereich der Wasserversorgung. Für die<br />
Betreiber von Wassergewinnungsanlagen<br />
ist es äußerst wichtig, dass die Ergiebigkeit<br />
der Anlage und die Wirtschaftlichkeit<br />
der Anlagentechnik möglichst<br />
lange erhalten bleiben. Bei Neubau und<br />
Betrieb eines Brunnens gilt es daher immer,<br />
das Gesamtsystem im Blick zu haben.<br />
Einzelne Maßnahmen im Rahmen<br />
von Beschaffung oder Regenerierung<br />
können sich – ohne die Zusammenhänge<br />
aller Anlagenkomponenten zu überblicken<br />
– im schlechtesten Fall als Fehlinvestition<br />
erweisen. Von der Filterstrecke<br />
über die Diagnosetechnik bis hin zu<br />
den Pumpen und ihrer Regelung sollten<br />
im Idealfall alle Anlagenkomponenten<br />
optimal auf den Einsatzbereich abgestimmt<br />
sein. Ein erhöhter Planungsaufwand<br />
rechnet sich daher fast immer.<br />
Nicht geringe Investitionskosten, sondern<br />
die Betrachtung der Gesamtkosten<br />
über die Lebensdauer der Anlagentechnik,<br />
die Lebenszykluskosten (LCC), sollten<br />
die Basis für Entscheidungen bei<br />
Neubau und Erneuerung sein.<br />
Bildquelle: WILO SE<br />
Autor:<br />
Mario Hübner<br />
WILO SE<br />
Nortkirchenstr. 100<br />
44263 Dortmund<br />
Tel.: 0231 4102-0<br />
Fax: 0231 4102-7575<br />
E-Mail: wilo@wilo.com<br />
Internet: www.wilo.de<br />
78 Jahresmagazin 12/ 2011