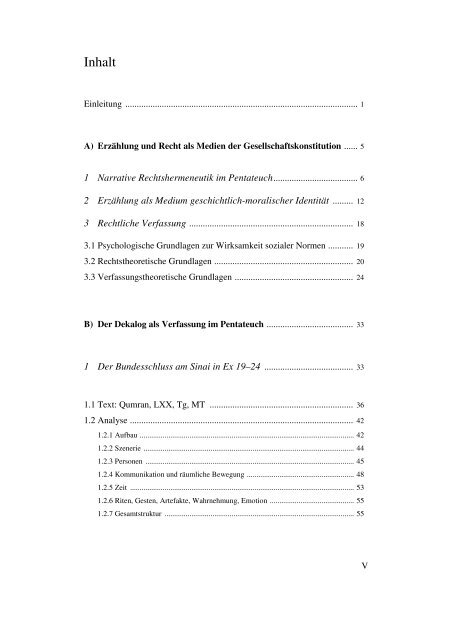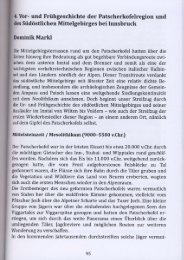Inhaltsverzeichnis - Dominik Markl SJ
Inhaltsverzeichnis - Dominik Markl SJ
Inhaltsverzeichnis - Dominik Markl SJ
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Inhalt<br />
Einleitung ...................................................................................................... 1<br />
A) Erzählung und Recht als Medien der Gesellschaftskonstitution ...... 5<br />
1 Narrative Rechtshermeneutik im Pentateuch..................................... 6<br />
2 Erzählung als Medium geschichtlich-moralischer Identität ......... 12<br />
3 Rechtliche Verfassung ........................................................................ 18<br />
3.1 Psychologische Grundlagen zur Wirksamkeit sozialer Normen ........... 19<br />
3.2 Rechtstheoretische Grundlagen ............................................................. 20<br />
3.3 Verfassungstheoretische Grundlagen .................................................... 24<br />
B) Der Dekalog als Verfassung im Pentateuch ...................................... 33<br />
1 Der Bundesschluss am Sinai in Ex 19–24 ....................................... 33<br />
1.1 Text: Qumran, LXX, Tg, MT ............................................................... 36<br />
1.2 Analyse .................................................................................................. 42<br />
1.2.1 Aufbau ................................................................................................................ 42<br />
1.2.2 Szenerie .............................................................................................................. 44<br />
1.2.3 Personen ............................................................................................................. 45<br />
1.2.4 Kommunikation und räumliche Bewegung ........................................................ 48<br />
1.2.5 Zeit ..................................................................................................................... 53<br />
1.2.6 Riten, Gesten, Artefakte, Wahrnehmung, Emotion ............................................ 55<br />
1.2.7 Gesamtstruktur ................................................................................................... 55<br />
V
1.3 Auslegung ............................................................................................. 58<br />
1.3.1 Die Vorbereitung auf den Dekalog in Ex 19,1–20,1 .......................................... 60<br />
a) 19,1–8d – Ankunft, Bundesangebot und Zusage ........................................... 60<br />
19,3–6 – das Bundesangebot ......................................................................... 63<br />
19,7–8d – die Zustimmung des Volkes ......................................................... 72<br />
b) 19,8e–15 – die Vorbereitung der Theophanie ................................................ 74<br />
c) 19,16–25 – JHWHs Erscheinen und Sorge .................................................... 81<br />
d) 20,1 – die Redeeinleitung des Dekalogs ........................................................ 90<br />
1.3.2 Der Dekalog in Ex 20,2–17 ................................................................................ 92<br />
a) 20,2–7 – Die Bundesbeziehung als Fundament der Gesellschaft ................... 97<br />
20,2 – Die Präambel als Bundeswort ............................................................. 98<br />
20,3–7 – Fremdgötter-, Bilder- und Namensmissbrauchsverbot ................. 103<br />
b) 20,8–12 – Sabbat- und Elterngebot............................................................... 112<br />
c) 20,13–17 – Verbote im weiteren sozialen Umfeld ....................................... 119<br />
1.3.3 Die Vollendung von Theophanie und Bund in 20,18–31,18 ............................ 123<br />
a) 20,18–22 – die Bitte des Volkes um Vermittlung ........................................ 123<br />
EXKURS I Warum Israel den Dekalog am Sinai verstanden hat ........................................... 129<br />
EXKURS II Bundesangebot und Bundesbuchrede als Inklusion des Dekalogs ........................ 131<br />
b) 24,1–31,18 – Vertiefung des Bundes ........................................................... 134<br />
24,1–11 – Bundesbestätigung und -feier ..................................................... 136<br />
EXKURS III Die Verbindung von ‚Bund’ und ‚Priestertum’ in 19,3–6; 24,6–8 ........................ 143<br />
EXKURS IV tyrb trk im AT und der Bundesschluss in Ex 19–24 ......................................... 146<br />
24,12–18 – Moses Aufstieg ......................................................................... 155<br />
25,1–2; 31,18 – Beginn und Ende der Heiligtumsbestimmungen ............... 159<br />
1.4 Die literarische Einbettung des Dekalogs in Ex 19,1–20,22 ............... 160<br />
1.5 Pragmatik ............................................................................................ 163<br />
1.5.1 Der Dekalog als Verfassung im Sinaibund ....................................................... 163<br />
1.5.2 Theophanie als Pädagogik moralischer Identität .............................................. 169<br />
1.5.3 Narrative Rechtshermeneutik ........................................................................... 172<br />
VI
2 Die Aktualisierung des Horebbundes in Dtn 5 ............................. 174<br />
2.1 Text ..................................................................................................... 176<br />
2.2 Analyse ................................................................................................ 179<br />
2.2.1 Szenerie ............................................................................................................ 181<br />
2.2.2 Struktur ............................................................................................................. 181<br />
2.2.3 Verhältnis zu Ex 19–31 .................................................................................... 184<br />
2.2.4 Zeit – rhetorische Aktualisierung ..................................................................... 186<br />
2.2.5 Personen ........................................................................................................... 187<br />
EXKURS V Mose als Redner und Erzähler im Deuteronomium ............................................ 188<br />
2.2.6 Wahrnehmung, Kommunikation, Emotion ...................................................... 194<br />
2.2.7 Pragmatische Ausrichtung und rhetorische Dynamik ...................................... 196<br />
2.3 Auslegung ........................................................................................... 196<br />
2.3.1 Die Eröffnung von Paränese und Horeb-Reminiszenz in Dtn 5,1–5 ................ 197<br />
EXKURS VI Horebbund und Moabbund als Eckpfeiler des Dtn ............................................. 198<br />
2.3.2 Der Dekalog in Dtn 5,6–21 .............................................................................. 209<br />
2.3.3 Der Abschluss von Horeb-Reminiszenz und Paränese in Dtn 5,22–33 ............ 217<br />
a) Analyse: Leitworte; Ex 20,18–22; Parallelität der Reden; Dtn 18,16f ......... 218<br />
b) 5,22–23 – das Theophanieszenario .............................................................. 223<br />
c) 5,24–27 – die Rede des Volkes .................................................................... 226<br />
d) 5,28–31 – die Reaktion Gottes ..................................................................... 235<br />
EXKURS VII Dtn 5,23–31 als Kontrastpassage zu Dtn 1,19–46 .............................................. 242<br />
e) 5,32–33 – der paränetische Abschluss ......................................................... 245<br />
2.4 Die literarische Einbettung des Dekalogs in Dtn 5 ............................. 246<br />
2.5 Pragmatik ............................................................................................ 248<br />
2.5.1 Paradigmatische Aktualisierung des Bundes .................................................... 248<br />
2.5.2 Vertiefte moralische Identität – Reflexion der Theophanieerfahrung .............. 251<br />
2.5.3 Narrative Rechtshermeneutik ........................................................................... 252<br />
2.5.4 Rhetorische Rechtsdidaktik .............................................................................. 253<br />
VII
3 Die Dekaloge im Rahmen des Pentateuch ..................................... 255<br />
3.1 Die literarische Einbettung der Dekalogfassungen im Pentateuch ..... 255<br />
3.2 Der Pentateuch als gesellschaftskonstituierender Textkomplex ......... 257<br />
3.2.1 Aspekte zum gesamten Pentateuch .................................................................. 258<br />
3.2.2 Schwerpunkte der einzelnen Bücher ................................................................ 262<br />
3.3.3 Auswertung: Polyvalente narrative Rechtshermeneutik ................................... 268<br />
3.3 Der Dekalog im Rahmen einer Rechtshermeneutik des Pentateuch ... 270<br />
C) Die Verfassungskraft des Dekalogs ................................................. 275<br />
1 Im Judentum ...................................................................................... 275<br />
2 Im Christentum .................................................................................. 278<br />
3 In der ‚offenen Gesellschaft’ ........................................................... 283<br />
Abkürzungen ............................................................................................. 289<br />
Übersetzung von Ex 19,1–20,22; 24 ......................................................... 290<br />
Übersetzung von Dtn 5 ............................................................................. 294<br />
Literatur ..................................................................................................... 296<br />
I. Geschichts- und Erzähltheorie; Literatur- und Sprachwissenschaft .......................... 297<br />
II. Rechts- und Verfassungstheorie; Soziologie ............................................................. 301<br />
III. Bibelwissenschaftliche und weitere theologische Literatur ...................................... 306<br />
Schriftstellenindex .................................................................................... 337<br />
VIII
Vorwort<br />
„Der Dekalog ragt wie ein hoher Gipfel sowohl aus dem Massiv des Pentateuchkontextes<br />
als auch aus den Höhenzügen der Theologiegeschichte heraus.“<br />
* Und wie ein solcher Berggipfel raubt er dem ruhenden Betrachter den<br />
Atem, fordert er die äußersten Kräfte des geistigen Alpinisten und weckt<br />
seine Schönheit Tränen im Musiker.<br />
Trotzdem gelten die ‚Zehn Gebote’ in nicht wenigen Kreisen unserer<br />
Breiten als Abklatsch moralischer Klischees, die für heutige Verhältnisse<br />
nichts mehr zu sagen hätten; teils wegen ihrer verkürzten Vermittlung, teils<br />
aufgrund des Fehlens ernsthafter Auseinandersetzung, teils aus dem unerhörten<br />
Anspruch, den diese Worte erheben. **<br />
Wohl in Vergessenheit geraten ist, dass kein Geringerer als der ‚Führer’ des<br />
‚Dritten Reiches’ ausdrücklich gegen ‚die sogenannten zehn Gebote’ ***<br />
kämpfte – und unter diesem Gesichtspunkt wäre sein Programm zu rekonstruieren.<br />
Dies allein wäre Grund genug, sich ihrer heute erneut umsichtig zu<br />
besinnen.<br />
In der vorliegenden Arbeit möchte ich darlegen, dass die Idee der Konstitution<br />
menschlicher Gemeinschaft, wie sie in den fünf Büchern Mose entwickelt<br />
wird, nicht zum Staub der Geschichte gehört, sondern zur Seele<br />
jüdischer und christlicher Gesellschaften. Nur wenn diese Seele lebendig<br />
bleibt, leistet sie einen Beitrag zu einer lebenswerten Weltgesellschaft.<br />
Die Untersuchung ist in ihrem Kern eine exegetische Interpretation für die<br />
Verfassung des Gottesvolkes zentraler biblischer Texte (B); in ihrem Rahmen<br />
aber setzt sie sich systematisch mit Fragen gegenwärtiger Gesellschaftsverfassung<br />
auseinander (v. a. A 2–3 und C 3). Sie möchte daher auch einen<br />
Beitrag zum gesellschaftspolitischen Diskurs leisten und in Dialog mit jenen<br />
Denkern treten, die sich konstruktiv um ein gutes Zusammenleben in der<br />
heutigen Gesellschaft bemühen.<br />
Ausgelöst wurden die vorliegenden Überlegungen durch viele Menschen:<br />
Mitbrüder des Jesuitenordens, die mir die Aufgabe dieser Auseinandersetzung<br />
gestellt und ermöglicht haben – besonders möchte ich P. Eduard Huber<br />
<strong>SJ</strong> nennen, der am 13. Juni 2006 verstorben ist; Freunde, die an das Gelingen<br />
menschlicher Gemeinschaft glauben lassen; unter ihnen seien die Familien<br />
Praxmarer und Gomille genannt; und meine Familie, wo dieses Vertrauen ins<br />
Leben gerufen wurde. Aus Dankbarkeit dafür ist die Arbeit meiner Mutter<br />
Lisbeth, meinem Vater Dieter und meinem Bruder Stefan <strong>Markl</strong> gewidmet.<br />
* SCHENKER, Monotheismus 187.<br />
** SALES, Gebote, bes. 34: Die Rezeption sei so problematisch, „weil jedes dieser Worte,<br />
wenn es einfachhin gesagt wird, für den, an den es sich richtet, ein Urteilsspruch ist.“ Dieser<br />
„zwingt, Stellung zu nehmen, vor Gott und allen anderen Menschen zu sich selbst und zum<br />
eigenen Dasein zu stehen.“<br />
*** Nach H. Rauschning, vgl. MANN, Gesetz 198–202; zit. bei CRÜSEMANN, Zehnwort 62. –<br />
Zum pseudoreligiösen Anspruch des Nationalsozialismus im „dritten Reich“ vgl. BÄRSCH,<br />
Nationalsozialismus.<br />
IX
Viele Anliegen, die hier zum Ausdruck kommen, sind im Studienjahr an<br />
der Benediktinerabtei Hagia Maria Sion 2000/01 in Jerusalem bestärkt<br />
worden; sie verbinden mich mit allen damaligen Kolleginnen und Kollegen.<br />
Beständig hat in den beiden Jahren in Innsbruck die Lebendigkeit der Kinder<br />
von Bukarest und Chişinău in mir nachgewirkt – in der Arbeit mit Dr. Dr.<br />
h.c. Georg Sporschill <strong>SJ</strong> ist diese Erfahrung prägend geworden.<br />
Wissenschaftlich und freundschaftlich begleiteten mich besonders Dr.<br />
Christoph Amor, Dr. Niko Bilić <strong>SJ</strong>, Dr. Daniel Burgos, Dr. Klaudia<br />
Engljähringer, Univ.-Prof. Dr. Monika Fink, Dr. Martin Lang, Dr. Claude<br />
Paganini, Dr. Simone Paganini und Dr. habil. Volkmar Premstaller <strong>SJ</strong>.<br />
Herzensfreude und Motivation zum Weiterdenken waren mir während der<br />
vergangenen beiden Jahre die Jugendlichen der Marianischen Kongregationen<br />
von Innsbruck und Hall i. T., besonders in der Zusammenarbeit mit Mag.<br />
Markus Inama <strong>SJ</strong>, Cyril Gehrer, Philipp Oberlohr und Christina Manzl.<br />
Die vorliegende Arbeit wurde 2006 an der Katholisch-Theologischen Fakultät<br />
der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck als Dissertation angenommen<br />
und für den Druck leicht überarbeitet. Prof. Dr. Georg Fischer <strong>SJ</strong> hat als<br />
Mitbruder und Vater im Geiste ihre Entstehung mit löwengleicher Kraft und<br />
mit der Aufmerksamkeit eines hörenden Herzens begleitet. Das ernsthafte<br />
Arbeiten und Diskutieren, aber auch die Schitouren und die Lieder auf den<br />
Gipfeln Tirols haben die gemeinsame Zeit unvergesslich werden lassen.<br />
Dank für sein rasch und akkurat ausgeführtes Zweitgutachten gebührt Prof.<br />
Dr. Friedrich Reiterer (Salzburg). Frau Prof. Dr. Anna Gamper hat mich mit<br />
außergewöhnlicher Freundlichkeit bei den anstehenden verfassungstheoretischen<br />
Fragestellungen beraten. Für die kritische Durchsicht der entsprechenden<br />
Teile bin ich auch Prof. Dr. Norbert Brieskorn <strong>SJ</strong> verbunden.<br />
Prof. em. Dr. Erich Zenger danke ich als Herausgeber für die vertrauensvolle<br />
Aufnahme der Arbeit in „Herders Biblische Studien“, Dr. Peter Suchla<br />
für sein zuvorkommendes Lektorat und Frau Dipl.-Theol. Christina Schubert<br />
für ihre Hilfe bei der formalen Gestaltung der Druckfassung. Johannes<br />
Moussoulides, Mag. Albert Holzknecht, Paul Baumgartner und Sebastian<br />
Lenart leisteten wertvolle Korrekturarbeit.<br />
Der Universität Innsbruck sei für die Gewährung eines „Doktoratsstipendiums<br />
aus der Nachwuchsförderung 2005“ gedankt. Der Kulturabteilung des<br />
Landes Tirol und der Österreichischen Provinz des Jesuitenordens gilt Dank<br />
für die erbrachten Druckkostenzuschüsse.<br />
Kann dieses Buch auch nur einen Funken jener Liebe und Leidenschaft vermitteln,<br />
die hinter den kommentierten Texten lodert, so möchte es doch<br />
nichts anderes, als sie in neuen Hörenden zu wecken.<br />
Wien, Epiphanie 2007<br />
<strong>Dominik</strong> <strong>Markl</strong> <strong>SJ</strong><br />
X