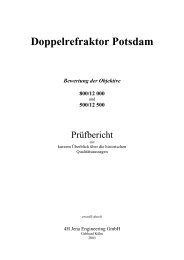Dreidimensionale Modelle kühler Sternatmosphären - AIP
Dreidimensionale Modelle kühler Sternatmosphären - AIP
Dreidimensionale Modelle kühler Sternatmosphären - AIP
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Örtliche Linienprofile<br />
Eindimensionales Modell<br />
Gemitteltes dreidimensionales Modell<br />
Örtliche Linienprofile<br />
Eindimensionales Modell<br />
Gemitteltes dreidimensionales Modell<br />
2.0<br />
2.0<br />
Intensität<br />
1.5<br />
1.0<br />
Intensität<br />
1.5<br />
1.0<br />
0.5<br />
0.5<br />
0.0<br />
–15 –10 –5 0 5 10 15<br />
V [km/s]<br />
0.0<br />
–15 –10 –5 0 5 10 15<br />
V [km/s]<br />
<br />
Abb. 3: Detailansicht der Spektrallinie<br />
des neutralen Eisens (FeI)<br />
bei 525.0 nm. Neben den einzelnen<br />
Linienprofilen für unterschiedliche<br />
Positionen auf der<br />
Oberfläche (schwarz), ist das horizontal<br />
gemittelte Profil (grün)<br />
sowie das mit Hilfe der eindimensionalen<br />
mittleren Atmosphäre<br />
erhaltene Linienprofil (rot) zu<br />
sehen. Die Wellenlängenskala<br />
ist hier durch die entsprechende<br />
Dopplergeschwindigkeit ausgedrückt<br />
(ΔV = 0 entspricht der<br />
Laborwellenlänge).<br />
Wäre dieser Befund von allgemeiner<br />
Gültigkeit, würde er die klassische, auf<br />
eindimensionalen <strong>Modelle</strong>n basierende,<br />
Methode der Spektralanalyse rechtfertigen.<br />
Tatsächlich hängt jedoch das Maß<br />
der Übereinstimmung zwischen den eindimensionalen<br />
und den dreidimensionalen<br />
Profilen von der Temperaturempfindlichkeit<br />
der betrachteten Spektrallinie ab.<br />
Würde man etwa die Titan-Häufigkeit<br />
der Sonne aus der TiI-Linie bei der Wellenlänge<br />
von 542.63 Nanometer bestimmen,<br />
erhielte man aus der eindimensionalen<br />
Analyse einen um 60 Prozent zu<br />
hohen Wert.<br />
Konvektion<br />
in metallarmen Halo-Sternen<br />
Sterne im Halo des Milchstraßensystems<br />
haben meist einen deutlich geringeren<br />
Metallgehalt als die Sonne; sie gehören<br />
zu den ältesten bekannten stellaren Objekten<br />
unserer Galaxis. Da sie aus der<br />
Frühphase der Milchstraßenentwicklung<br />
stammen, ist die genaue Kenntnis<br />
ihrer chemischen Zusammensetzung<br />
von besonderer Bedeutung für das Verständnis<br />
der Entstehung der Elemente<br />
und der chemischen Entwicklung von<br />
Galaxien. Der Lithiumgehalt dieser Objekte<br />
lässt sogar Rückschlüsse auf die<br />
physikalischen Bedingungen während<br />
des Urknalls zu. Bereits ältere <strong>Modelle</strong><br />
haben gezeigt, dass die Konvektion in<br />
den Oberflächenschichten metallarmer<br />
Halo-Sterne vom Spektraltyp F kräftiger<br />
als in der Sonne ist und höher in die<br />
Atmosphäre hineinreicht. Demzufolge<br />
erwartet man, in den Spektren solcher<br />
Sterne deutliche »Fingerabdrücke« konvektiver<br />
Strömungen zu sehen. Im Prinzip<br />
sieht das Granulationsmuster ähnlich<br />
aus wie auf der Sonne. Ausgedehnte helle<br />
Gebiete aufsteigenden heißen Gases werden<br />
durch ein Netzwerk schmaler dunkler<br />
Kanäle voneinander getrennt, in denen<br />
kühles Gas ins Sterninnere absinkt.<br />
Das Beispiel in Abb. 4 demonstriert<br />
einen wichtigen Effekt, der für die Sonne<br />
weniger stark ausgeprägt ist: Das räumlich<br />
gemittelte dreidimensionale Linienprofil<br />
(grün) ist erheblich stärker als das<br />
eindimensionale Linienprofil (rot), welches<br />
von der repräsentativen eindimensionalen<br />
Modellatmosphäre emittiert<br />
wird. Letztere gibt zwar den Tiefenverlauf<br />
der mittleren Temperatur des hydrodynamischen<br />
dreidimensionalen Modells<br />
richtig wieder, kann aber die horizontalen<br />
Inhomogenitäten grundsätzlich nicht<br />
erfassen.<br />
Der Unterschied der beiden Linienprofile<br />
zeigt also selektiv die spektroskopischen<br />
Auswirkungen der horizontalen<br />
Temperaturschwankungen. Offensichtlich<br />
bewirken diese Fluktuationen eine<br />
systematische Verstärkung der Spektrallinien.<br />
Standard-Spektralanalysen vernachlässigen<br />
diesen Effekt, was in dem<br />
hier betrachteten extremen Fall dazu<br />
führt, dass die Eisenhäufigkeit um nahezu<br />
einen Faktor 5 überschätzt wird, wenn<br />
man sie aus dieser einen Linie bestimmt.<br />
Eine zusätzliche Fehlerquelle ist, dass die<br />
eindimensionalen Modellatmosphären<br />
bei metallarmen Sternen systematisch<br />
<br />
Abb. 4: Darstellung der synthetischen<br />
Linienprofile analog zu<br />
Abb. 3. Bemerkenswert ist der<br />
große Unterschied der Linienstärke<br />
zwischen dem eindimensionalen<br />
Fall (rot) und dem dreidimensionalen<br />
Fall (grün).<br />
zu hohe Temperaturen der oberen Photosphäre<br />
liefern. Die Annahme des Strahlungsgleichgewichts<br />
ist hier keine gute<br />
Näherung. Insgesamt können die systematischen<br />
Fehler zu Elementhäufigkeiten<br />
führen, die um den Faktor 7 falsch sind.<br />
Fehler dieser Größenordnung sind für<br />
die Sternspektroskopie unakzeptabel.<br />
Im Fall von Eisen kann man das Problem<br />
umgehen, indem man die Analyse statt<br />
mit Linien des neutralen Eisens (FeI) mit<br />
Linien des ionisierten Eisens (FeII) durchführt,<br />
die weniger temperaturempfindlich<br />
sind. So etwas ist jedoch nicht für<br />
alle Elemente möglich. Für die wichtige<br />
Bestimmung der Lithiumhäufigkeit ist<br />
man zum Beispiel auf die bekannte LiI-<br />
Linie bei einer Wellenlänge von 670.7 Nanometer<br />
angewiesen, die ähnlich anfällig<br />
ist wie die oben diskutierte FeI-Linie. Die<br />
Entstehung der LiI-Linie ist allerdings<br />
komplizierter, da diese Atome nicht im<br />
lokalen thermodynamischen Gleichgewicht<br />
sind. Die Berücksichtigung dieser<br />
Effekte erfordert aufwendige Rechnungen,<br />
die derzeit noch in Arbeit sind.<br />
MATTHIAS STEFFEN<br />
Literaturhinweis<br />
B. Freytag, M. Steffen, B. Dorch:<br />
»Spots on the Surface of Betelgeuse.<br />
Results from New 3D Stellar<br />
Convection Models«, Astron.<br />
Nachrichten 323 3/4, 213–219<br />
[2002].<br />
STERNE UND WELTRAUM November 2004<br />
23