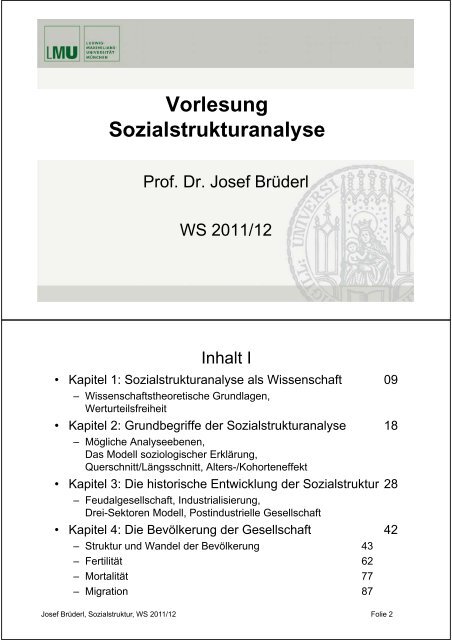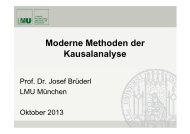Vorlesung Sozialstrukturanalyse - Lehrstuhl Brüderl
Vorlesung Sozialstrukturanalyse - Lehrstuhl Brüderl
Vorlesung Sozialstrukturanalyse - Lehrstuhl Brüderl
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Vorlesung</strong><br />
<strong>Sozialstrukturanalyse</strong><br />
Prof. Dr. Josef <strong>Brüderl</strong><br />
WS 2011/12<br />
Inhalt I<br />
• Kapitel 1: <strong>Sozialstrukturanalyse</strong> als Wissenschaft 09<br />
– Wissenschaftstheoretische Grundlagen,<br />
Werturteilsfreiheit<br />
• Kapitel 2: Grundbegriffe der <strong>Sozialstrukturanalyse</strong> 18<br />
– Mögliche Analyseebenen,<br />
Das Modell soziologischer Erklärung,<br />
Querschnitt/Längsschnitt, Alters-/Kohorteneffekt<br />
• Kapitel 3: Die historische Entwicklung der Sozialstruktur 28<br />
– Feudalgesellschaft, Industrialisierung,<br />
Drei-Sektoren Modell, Postindustrielle Gesellschaft<br />
• Kapitel 4: Die Bevölkerung der Gesellschaft 42<br />
– Struktur und Wandel der Bevölkerung 43<br />
– Fertilität 62<br />
– Mortalität 77<br />
– Migration 87<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 2
Inhalt II<br />
• Kapitel 5: Private Lebensformen 101<br />
– Verteilung und Wandel der Lebensformen 102<br />
– Partnerwahl, Heirat, Scheidung 115<br />
• Kapitel 6: Soziale Ungleichheit 132<br />
– Grundlegendes 134<br />
– Dimensionen und Ursachen sozialer Ungleichheit 139<br />
- Bildung 140<br />
- Beschäftigung und Beruf 155<br />
- Einkommen und Vermögen 162<br />
- Gesundheit 174<br />
- Soziale Beziehungen 177<br />
- Die Kumulation sozialer Ungleichheit 178<br />
– Theorien sozialer Ungleichheit 179<br />
– Strukturen sozialer Ungleichheit 183<br />
– Soziale Mobilität 189<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 3<br />
Was ist <strong>Sozialstrukturanalyse</strong>?<br />
• Analyse sozialer Strukturen<br />
– Aufbau der deutschen Gesellschaft<br />
– Internationaler Vergleich<br />
• Analyse sozialer Prozesse<br />
– Wandel der deutschen Gesellschaft (sozialer Wandel)<br />
– Historischer Vergleich<br />
Statt einer länglichen Definition:<br />
Was macht <strong>Sozialstrukturanalyse</strong> konkret?<br />
• Verteilung von Sozialkategorien und deren Wandel<br />
– Alter, Bildung, Erwerbstätigkeit, Einkommen, …<br />
• Unterschiede zwischen Gruppen (soziale Ungleichheit)<br />
– Männer/Frauen, soziale Herkunft, ethnische Herkunft<br />
• Zusammenhänge der Sozialkategorien<br />
– Armut und Bildung, Bildungsexpansion und Frauenerwerbstätigkeit<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 4
• Faktenwissen<br />
Lernziele<br />
– Kenntnisse zur Sozialstruktur Deutschlands<br />
• Analysekompetenz<br />
– „Die Kompetenz, soziale Strukturen und Prozesse moderner<br />
Gesellschaften zu analysieren“ (Anlage 1 zur PO BA Soziologie)<br />
• Kritische Beurteilung<br />
– Fakten zur Sozialstruktur werden oft in der Forschung bzw. der<br />
Öffentlichkeit präsentiert<br />
– Häufig beruhend auf problematischen Methoden<br />
– Sie sollen zumindest ein Gespür dafür bekommen, welche Fakten<br />
vertrauenswürdig sind und welche nicht<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 5<br />
Kritische Beurteilung ist wichtig!<br />
• Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen<br />
und Jugend (2005) berichtet:<br />
– Zukunft Familie: Ergebnisse aus dem 7. Familienbericht<br />
„Deutsche Akademikerinnen nehmen sich nach<br />
Ausbildungsabschluss und Berufseinstieg etwa<br />
5 Jahre Zeit, um sich für oder gegen Kinder zu<br />
entscheiden.<br />
Das macht bei einer Lebenserwartung von fast 100<br />
Jahren für Frauen des Jahrgangs 1970 einen<br />
Lebensanteil von 2 % aus!“<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 6
Organisatorisches und Programm<br />
• s. die verteilte Veranstaltungsbeschreibung<br />
der <strong>Vorlesung</strong> „<strong>Sozialstrukturanalyse</strong>“<br />
• Aktuelle Infos: Sozialstruktur-Homepage<br />
– Gehen Sie auf die <strong>Lehrstuhl</strong>-Homepage<br />
www.ls3.soziologie.uni-muenchen.de<br />
– wählen sie > LEHRE<br />
– und dann > <strong>Vorlesung</strong> Sozialstruktur<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 7<br />
Hinweise für Hausarbeiten und Referate<br />
• Ausführliche Hinweise zum Verfassen von Hausarbeiten<br />
bzw. dem Halten von Referaten finden Sie hier:<br />
– Gehen Sie auf die <strong>Lehrstuhl</strong>-Homepage<br />
www.ls3.soziologie.uni-muenchen.de<br />
– wählen sie > INFORMATIONEN FÜR STUDIERENDE<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 8
KAPITEL 1<br />
<strong>Sozialstrukturanalyse</strong> als Wissenschaft<br />
Josef <strong>Brüderl</strong><br />
<strong>Vorlesung</strong> <strong>Sozialstrukturanalyse</strong><br />
<strong>Sozialstrukturanalyse</strong><br />
• <strong>Sozialstrukturanalyse</strong> ist eine empirische Wissenschaft<br />
– Wissen über soziale Strukturen und Prozesse wird mit empirischen<br />
Methoden erlangt<br />
– Sie ist eine Erfahrungswissenschaft<br />
– Und folgt dem Leitbild des Empirismus<br />
• Alternativen<br />
– Erkennen durch Autorität (Scholastik)<br />
- Uni Paris 13. Jhd.: Gefriert Öl in einer kalten Winternacht?<br />
Antwort: Was schreibt Aristoteles dazu?<br />
- Klassiker-Exegese<br />
– Erkennen durch Vernunft (Rationalismus)<br />
- „Lehnstuhl“-Soziologie<br />
- Welt als Konstruktion des Geistes (Konstruktivismus)<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 10
Ziele empirischer <strong>Sozialstrukturanalyse</strong><br />
• Beschreibung (Deskription)<br />
Deskriptive Studien, wenn man genaue Beschreibung sozialer<br />
Strukturen und Prozesse beabsichtigt.<br />
Sozialberichterstattung in einer komplexen Welt.<br />
• Erklärung<br />
Verstehen von Zusammenhängen und Prozessen.<br />
Theorien werden empirisch überprüft.<br />
• Politikberatung<br />
Empirisch fundierte Beschreibungen und Erklärungen sind<br />
(sollten) die Grundlage politischer Entscheidungen sein.<br />
- Kenntnis über den Ist-Zustand<br />
- Verständnis der Zusammenhänge und Prozesse<br />
- Vorstellung über den Soll-Zustand (politisches Ziel)<br />
- Entwicklung einer politischen Maßnahme, um vom Ist-Zustand zum<br />
Soll-Zustand zu kommen<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 11<br />
Was ist die wissenschaftliche Methode?<br />
• Anstatt einer längeren Einführung in die<br />
Wissenschaftstheorie, der Kern:<br />
• Konsequentes Anzweifeln aller Ergebnisse<br />
(aus: Richtlinien der LMU München zur Selbstkontrolle in der Wissenschaft)<br />
• Ergebnisse werden erst akzeptiert, wenn sie unabhängig<br />
wiederholt (repliziert) werden konnten<br />
• Wissenschaft, die aufhört zu zweifeln, die glaubt im Besitz<br />
der Wahrheit zu sein, wird Glaube bzw. Ideologie<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 12
• Analytische Sätze<br />
Satzarten<br />
– Wahr bzw. falsch unabhängig vom Zustand der Welt<br />
- Definitionen, Tautologien, Kontradiktionen<br />
– Tautologien und Kontradiktionen liefern keinen Erkenntnisgewinn, deshalb<br />
in den Erfahrungswissenschaften unbrauchbar<br />
• Normative Sätze<br />
– Werturteile, Normen, Soll-Sätze<br />
– Haben keinen empirischen Gehalt und können deshalb durch empirische<br />
Forschung nicht begründet werden. Also auch sie sind für die<br />
Erfahrungswissenschaften nicht brauchbar.<br />
• Empirische Sätze<br />
– Stellen Behauptungen über prinzipiell beobachtbare Sachverhalte auf, die<br />
wahr oder falsch sein können<br />
„Wenn jemand heiratet, dann steigt seine Zufriedenheit“<br />
„Je höher der Anteil der Katholiken, desto mehr % für die CDU“<br />
– Die logische und empirische Überprüfung der Gültigkeit (Wahrheit)<br />
empirischer Sätze ist die Hauptaufgabe der Erfahrungswissenschaften<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 13<br />
Werturteilsfreiheit<br />
• Max Weber im Verein für Socialpolitik 1909:<br />
Wissenschaft muss wertfrei sein!<br />
• Wertbeladene Wissenschaft<br />
– Ist empirisch nicht begründbar<br />
– Führt häufig zu falschen Ergebnissen<br />
- Durch selektive Wahrnehmung (Bestätigungsbias)<br />
- Durch Manipulation/Fälschung<br />
-> Konsequenz: Wissenschaftler sollten bei ihrer Arbeit ihre Werte so gut<br />
es geht ausblenden<br />
-> Konsequenz: normative Sätze und wertbeladene Begriffe haben nichts<br />
verloren in wissenschaftlichen Arbeiten<br />
-> Konsequenz: Offenlegung von Methoden, Daten und Analysen<br />
(Möglichkeit der Replikation). Prinzip: intersubjektive Nachprüfbarkeit<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 14
Alltagswissen und Sozialforschung<br />
• Jeder Mensch ist ein „Sozialstrukturforscher“<br />
– Aber: geleitet von seinen Werten (Vorurteile)<br />
– Statt systematischer Beobachtung stützt er sich auf selektive<br />
Wahrnehmung<br />
• Selektive Wahrnehmung<br />
– Nur vorurteilskonforme Fälle werden registriert<br />
– Folge ist eine selektive Stichprobe, die das Vorurteil stützt<br />
– Folge ist, dass sich Vorurteile kaum widerlegen lassen<br />
• Selektive Wahrnehmung ist der größte „Feind“ der<br />
Wissenschaft<br />
• Selektive Wahrnehmung ist „menschlich“<br />
– Selbstbildbewahrung<br />
– Vermeidung kognitiver Dissonanzen<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 15<br />
Folgerungen für die <strong>Sozialstrukturanalyse</strong><br />
• <strong>Sozialstrukturanalyse</strong> sollte stets<br />
– kritisch gegenüber den Fakten sein (methodenkritisch)<br />
– wertfrei sein<br />
• Diese Forderung halten viele Forscher nicht ein<br />
– <strong>Sozialstrukturanalyse</strong>n oft wertgeleitet<br />
- Armutsbericht vom paritätischen Wohlfahrtsverband<br />
– Selbst viele Sozialstrukturlehrbücher sind weder methodenkritisch<br />
noch wertfrei<br />
– Z.B.: Hradil, S. (2006) Die Sozialstruktur Deutschlands<br />
im internationalen Vergleich.<br />
- „Unberücksichtigt bleiben insbesondere methodische Fragen.“ (S. 11)<br />
- „Im Grunde wird in diesem Buch also danach gefragt, ‚wie weit‘ die<br />
Modernisierung in den den einzelnen Ländern ‚fortgeschritten‘ ist.“<br />
(S. 12)<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 16
Lehrbücher der <strong>Sozialstrukturanalyse</strong><br />
• Diese VL stützt sich deshalb auf zwei eher unbekannte<br />
Lehrbücher, die aber den Vorzug haben<br />
– methodenkritisch zu sein<br />
– und empirische und normative Aussagen trennen<br />
• Klein, Thomas (2005) <strong>Sozialstrukturanalyse</strong>. Rowohlt.<br />
– Abgekürzt: „K“<br />
• Huinink, Johannes und Torsten Schröder (2008)<br />
Sozialstruktur Deutschlands. UVK.<br />
– Abgekürzt: „HS“<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 17<br />
KAPITEL 2<br />
Grundbegriffe der <strong>Sozialstrukturanalyse</strong><br />
Josef <strong>Brüderl</strong><br />
<strong>Vorlesung</strong> <strong>Sozialstrukturanalyse</strong>
• Mikroebene<br />
Mögliche Analyseebenen<br />
– Analyse der Merkmale von Individuen<br />
• Mesoebene<br />
– Analyse der Merkmale von Haushalten, Organisationen, etc.<br />
• Makroebene<br />
– Analyse der Merkmale von Gesellschaften<br />
- Analyse sozialer Strukturen (synonym: kollektiver Phänomene)<br />
• <strong>Sozialstrukturanalyse</strong> beschäftigt sich primär mit der<br />
Makroebene<br />
– Man will soziale Strukturen beschreiben und erklären<br />
– Man will die Veränderung sozialer Strukturen beschreiben und<br />
erklären<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 19<br />
Achte auf die Analyseebene!<br />
• Oft macht man Analysen auf der Mesoebene des<br />
Haushalts<br />
– Daraus darf man nicht ohne weiteres auf Individuen schließen!<br />
– Dies wird aber oft in den Medien (und auch der Literatur) gemacht:<br />
„Tickende Zeitbombe<br />
Traurig, aber wahr: In den deutschen Großstädten lebt schon fast<br />
jeder Zweite allein. … Hamburg ist die Single-Hochburg<br />
Deutschlands. Nach jüngsten Zahlen vom April 1998 lebt fast jeder<br />
zweite Hamburger (48 Prozent) allein.“ (Spiegel-online, 1999)<br />
– Die Daten wurden auf Haushaltsebene analysiert (nächste Folie)<br />
- Tatsächlich sind 48% der HH Single-Haushalte<br />
– Aber auf Personenebene ist der Anteil der Singles deutlich kleiner<br />
- Nur 26% der Hamburger leben in einem Single-Haushalt<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 20
Haushaltsgrößenverteilung<br />
Quelle: Thomas Klein: <strong>Sozialstrukturanalyse</strong>, S. 23 (Tab. 1.2.2)<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 21<br />
Erklärung<br />
• Erklärungen sind Antworten auf „Warum-Fragen“<br />
• Durkheims „Regeln der soziologischen Methode“ (1895)<br />
– „Soziales soll mit Sozialem erklärt werden“<br />
- Makro-Makro Erklärung<br />
– Beispiel einer Makro-Makro Erklärung:<br />
„Die Frauenerwerbsquote ist in den letzten Jahrzehnten<br />
angestiegen, weil im Rahmen der Bildungsexpansion das<br />
Bildungsniveau der Frauen angestiegen ist“<br />
Bildungsexpansion<br />
• Makro-Makro Erklärungen sind unvollständig<br />
+<br />
Frauenerwerbsquote<br />
– Wieso soll mehr Bildung mehr Erwerbstätigkeit bewirken?<br />
– Es fehlt ein Mikromodell der individuellen Handlungen<br />
(Handlungstheorie)<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 22
Das Modell soziologischer Erklärung<br />
• Deshalb heute:<br />
Mikrofundierung soziologischer Erklärung<br />
– Makro-Mikro-Makro Erklärung<br />
– Synonyme nach den „Erfindern“: Coleman-Wanne, Esser-Modell<br />
– Differenzierter bei: HS, Kap. 3.1<br />
Makro<br />
Soziale Struktur 1 Soziale Struktur 2<br />
Brückenhypothese<br />
Aggregation<br />
Mikro<br />
Opportunitätsstruktur<br />
und Präferenzen<br />
des Individuums<br />
Handlungstheorie<br />
Individuelles<br />
Handeln<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 23<br />
Bildungsexpansion und Frauenerwerbstätigkeit<br />
• Makro-Mikro-Makro Erklärung<br />
– Brückenhypothese: hier Hintergrundwissen aus vielen empirischen Studien<br />
– Handlungstheorie: den Zusammenhang zwischen Bildung und Erwerbsarbeit<br />
hat insbesondere die Humankapitaltheorie (Gary S. Becker) herausgearbeitet<br />
– Aggregation: hier einfach eine statistische Definition<br />
Makro<br />
Bildungsexpansion<br />
Frauenerwerbsquote<br />
Hintergrundwissen<br />
+<br />
+<br />
Statistische<br />
Aggregation<br />
Mikro<br />
Bildungsniveau<br />
Karriereorientierung<br />
+<br />
Humankapitaltheorie<br />
Erwerbsarbeit<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 24
Querschnitt- und Längsschnitt<br />
• Querschnittbetrachtung<br />
– Zeitpunktbezogenes Bild sozialer Strukturen<br />
- Zeitraumbezogenes Bild sozialer Strukturen (Periodenbetrachtung)<br />
– Vorteil: die meisten Daten fallen querschnittlich an<br />
– Nachteile: immer unvollständig, oft irreführend<br />
• Längsschnittbetrachtung<br />
– Makroebene<br />
- Zeitreihen geben den sozialen Wandel wider (Trends)<br />
– Mikroebene<br />
- Paneldaten erlauben die Untersuchung individueller Dynamik<br />
• Längsschnittanalyse auf Mikroebene ist am informativsten<br />
– Lebenslaufanalyse als die „Krone“ der Sozialforschung<br />
- Zeitreihe: 10% Armutsquote über die Jahre konstant in einem Land<br />
- 10% der Personen sind ihr ganzes Leben arm, oder alle Personen sind<br />
10% ihrer Lebenszeit arm? Paneldaten können die Antwort liefern!<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 25<br />
Alters- und Kohorteneffekt<br />
• Erst eine Längsschnittanalyse erlaubt es, Alters- und<br />
Kohorteneffekte zu trennen<br />
– Alterseffekt<br />
- Durch das Altern ändert sich ein Merkmal des Individuums<br />
- Bsp.: Gewicht, Einkommen, politische Einstellung<br />
– Kohorteneffekt<br />
- (Geburts-) Kohorten unterscheiden sich in einem Merkmal<br />
- Bsp.: Gewicht, Einkommen, politische Einstellung<br />
– Mittels Paneldaten kann man feststellen, ob man mit dem Alter<br />
- schwerer wird, immer mehr verdient und konservativer wird<br />
– Daneben: Periodeneffekt<br />
- Ein Merkmal wird durch ein historisches Ereignis beeinflusst<br />
- Bsp.: Konjunkturzyklus-Effekt, Gesetzesänderung<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 26
Die Konzeption dieser <strong>Vorlesung</strong><br />
• Die wichtigsten Fakten<br />
– Beschränkung, um nicht den Überblick zu verlieren<br />
– Methodenkritisch, damit die Fakten möglichst richtig sind<br />
– Längsschnittperspektive, wo möglich<br />
– Graphiken zur Präsentation der Daten<br />
• Erklärungen der Prozesse<br />
– Makro-Mikro-Makro Erklärung<br />
• Implikationen und Konsequenzen<br />
– Werturteilsfrei<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 27<br />
KAPITEL 3<br />
Die historische Entwicklung der Sozialstruktur<br />
Josef <strong>Brüderl</strong><br />
<strong>Vorlesung</strong> <strong>Sozialstrukturanalyse</strong>
Frühgeschichte<br />
• Jäger- und Sammlergesellschaften<br />
– Kleine verwandtschaftliche Clans (20-40 Personen)<br />
– Soziale Ungleichheit gering<br />
• Entstehung agrarischer Gesellschaften<br />
– Neolithische Revolution (ca. 10.000 v. Chr.)<br />
– Seßhaftwerdung und Stammesbildung<br />
– Erfindung von Ackerbau und Weidewirtschaft<br />
- Damit wird Kapitalbildung (caput = Haupt) möglich<br />
- Vererbung von Kapital (Land und Vieh) wird möglich<br />
- Beginn sozialer Differenzierung und Ungleichheit<br />
• Staatenbildung<br />
– In Mesopotamien (ca. 5.000 v. Chr.)<br />
– Herausbildung nicht arbeitender Herrschaftsschichten (Adel, Klerus)<br />
- Entstehung der Feudalgesellschaft<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 29<br />
Statusaufbau der Feudalgesellschaft<br />
Soziale Schichtung im Sinne von<br />
„Höher/Niedriger“ (Status).<br />
Flächen proportional zum Anteil.<br />
Quelle: Bolte/Hradil, 1984, Soziale Ungleichheit, S. 84<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 30
Ständegesellschaft<br />
• „Weiterentwicklung“ der Feudalgesellschaft<br />
– Adel, Klerus, Bauern, unterbäuerliche Schichten (Arme,<br />
Nichtsesshafte)<br />
– Neu: Bürger (Kaufleute und Handwerker)<br />
• Stand<br />
– Durch Tradition, Sitte und Recht festgelegte soziale Gruppierungen<br />
– „Standesgemäßer“ Lebensstil<br />
– Standeszugehörigkeit durch Geburt festgelegt<br />
• Keine Klare Abgrenzung zur Feudalgesellschaft<br />
– Kaufleute und Handwerker gab es immer!<br />
– In ländlich geprägten Kulturen: Feudalgesellschaft<br />
– In städtisch geprägten Kulturen: Ständegesellschaft<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 31<br />
Der Prozess der Industrialisierung<br />
• Die ideelle Revolution<br />
– Englischer Empirismus: die Entzauberung der Welt (Wissenschaft)<br />
– Französische Aufklärung: Naturrechte des Individuums (Gleichheit)<br />
– Englischer Liberalismus: freie Entfaltung der Marktkräfte (Freiheit)<br />
• Die technische Revolution<br />
– 1769: Dampfmaschine (James Watt)<br />
– 1840: Stickstoffdüngung (Justus von Liebig)<br />
• Hatten eine industrielle Revolution zur Folge<br />
– Freie Märkte<br />
– Produktion durch Maschinen<br />
– In arbeitsteilig organisierten Großbetrieben (Fabriken)<br />
– Nach unternehmerischem Rationalitätsprinzip geführt<br />
Enorme Steigerung der Produktivität<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 32
Entstehung der Industriegesellschaft<br />
• Wohlstandssteigerung<br />
– Seit der Antike nur marginal, ab ca. 1870 merkbar<br />
• Bevölkerungswachstum<br />
– Massenwanderung in die industriellen Zentren<br />
– Die rasante Urbanisierung führte zu „Slums“<br />
• Von der Stände- zur Klassengesellschaft?<br />
– Klassen definiert über Besitz an Produktionsmitteln (Kapital)<br />
- Bei Marx: Kapitalisten, Kleinbürger, Proletarier<br />
- In dieser Reinform hat die Klassengesellschaft nie existiert:<br />
alte Stände existierten fort (Adel), das Bildungsbürgertum kam hinzu (Beamte,<br />
freie Berufe), Manager (Angestellte) passen überhaupt nicht in das Schema,<br />
schließlich wurden Arbeiter gar Kapitalisten (Aktionäre)<br />
• Bildungsexpansion<br />
– Verschwinden des Analphabetismus, ab ca. 1880 zu 100% Schulbesuch<br />
• Strukturwandel der Familie<br />
– Ganzes Haus: Wohn- und Arbeitsort identisch (erweiterte Großfamilie)<br />
– Trennung von Wohn- und Arbeitsort, hin zur Kernfamilie<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 33<br />
Steigerung des Wohlstandes<br />
(in Deutschland)<br />
Quelle: Miegel et al., 1983, Die verkannte Revolution<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 34
Bevölkerungswachstum<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 35<br />
Drei-Sektoren Modell<br />
• Jean Fourastié (1949): drei Sektoren<br />
– Primärer Sektor: Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei<br />
– Sekundärer Sektor: Industrie, Handwerk, Bergbau<br />
– Tertiärer Sektor: Dienstleistungen<br />
• Je nachdem welcher Sektor dominiert:<br />
– Primärer Sektor: Agrargesellschaft<br />
– Sekundärer Sektor: Industriegesellschaft<br />
– Tertiärer Sektor: Dienstleistungsgesellschaft<br />
• Entstehung der Dienstleistungsgesellschaft<br />
– Produktivität im primären/sekundären Sektor steigt so weit, dass<br />
die Mehrheit der Erwerbstätigen Dienstleistungen erbringen kann<br />
– Bei den Dienstleistungen gibt es aber nur geringe<br />
Produktivitätssteigerung<br />
- Kein „Ende der Arbeit“<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 36
Von der Agrar- zur Dienstleistungsgesellschaft<br />
• Anteil an der Wertschöpfung in Deutschland 1850 bis 2004<br />
– Ab 1890 Industriegesellschaft<br />
– Ab 1975 Dienstleistungsgesellschaft<br />
Quelle: Geißler, Sozialstruktur Deutschlands, S. 25<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 37<br />
Von der Agrar- zur Dienstleistungsgesellschaft<br />
• Anteil an der Beschäftigung in Deutschland 1850 bis 2004<br />
– Ab 1890 Industriegesellschaft<br />
– Ab 1975 Dienstleistungsgesellschaft<br />
Quelle: Geißler, Sozialstruktur Deutschlands, S. 26<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 38
Postindustrielle Gesellschaft?<br />
• Verschiedene Gesellschaftsmodelle werden propagiert<br />
– Dienstleistungsgesellschaft<br />
– Wissensgesellschaft<br />
- „Wissen“ wird der entscheidende Produktionsfaktor<br />
- IT als Schlüsseltechnologie (Informationsgesellschaft)<br />
– Risikogesellschaft<br />
- Entgrenzung technischer Risiken (Atomenergie)<br />
– Erlebnisgesellschaft<br />
- Zunahme der Freizeit mit entsprechender Freizeitindustrie<br />
– Single-Gesellschaft<br />
- Vereinzelung der Menschen<br />
– Weltgesellschaft<br />
- Nationale Grenzen verlieren im Zuge der Globalisierung an Bedeutung<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 39<br />
Kritik der Gesellschaftsmodelle<br />
• Meist auf fragwürdiger empirischer Basis<br />
– Oft bloße feuilletonistische Zeitdiagnose<br />
– Trends werden oft linear fortgeschrieben<br />
• Handelt es sich wirklich um einschneidende<br />
Veränderungen der Sozialstruktur?<br />
Oder leben wir nach wie vor in einer (modernen)<br />
Industriegesellschaft?<br />
– Einzelne Änderungen werden überstilisiert<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 40
Modernisierung?<br />
• (Westliche) Industriegesellschaften werden oft mit dem<br />
Attribut „modern“ belegt. Merkmale:<br />
– Marktwirtschaft und wirtschaftlicher Wohlstand<br />
– Menschenrechte und Rechtsstaat<br />
– Freie Meinungsäußerung und Demokratie<br />
– Individuelle Freiheit und Zivilisierung der Affekte<br />
• Oft verbunden mit Bewertungen oder Forderungen<br />
– „Modern“ ist „besser“, oder gar „am besten“<br />
– Alle Gesellschaften sollten sich „modernisieren“<br />
Als normative Aussagen wissenschaftlich nicht begründbar<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 41<br />
KAPITEL 4<br />
Die Bevölkerung der Gesellschaft<br />
Josef <strong>Brüderl</strong><br />
<strong>Vorlesung</strong> <strong>Sozialstrukturanalyse</strong>
Bevölkerung<br />
• Die Bevölkerung ist die Basis der Gesellschaft<br />
– Wissenschaftl. Disziplinen: Demographie, Bevölkerungssoziologie<br />
• Wohnbevölkerung in Deutschland (2009)<br />
– 82 Mio.<br />
– Bevölkerungsstruktur<br />
- 51% Frauen („Sex Ratio“ = 0,96; 96 Männer auf 100 Frauen)<br />
- Ca. 9% Ausländeranteil<br />
– Bevölkerungsdichte: 230 Einwohner pro km²<br />
• Demographische Grundgleichung<br />
– Bev t = Bev t-1 + Geburten – Sterbefälle + Zuzüge – Fortzüge<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 43<br />
Die Entwicklung der Bevölkerung in D<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 44
Bilanz der Geburten und Sterbefälle<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 45<br />
Bilanz der Zu- und Fortzüge<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 46
Gesamtbilanz in Ostdeutschland<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 47<br />
Exkurs: Wie viele Deutsche gibt es wirklich?<br />
• Die tatsächliche Bevölkerungszahl ist unklar<br />
– UN Empfehlung: Volkszählung alle 10 Jahre<br />
– Letzte Volkszählung in BRD 1987 (DDR 1981)<br />
- Und die war sehr ungenau wegen Boykott vieler Bürger<br />
– Seitdem Fortschreibung anhand der Einwohnermelderegister<br />
- Melderegister sind ungenau, in manchen Städten 20% „Karteileichen“<br />
– Vermutlich ist die Einwohnerzahl um einige Mio. überschätzt<br />
- Evtl. ungerechtfertigte Steueraufteilung<br />
- Evtl. ungleiches Stimmengewicht bei Wahlen<br />
• Zensus 2011<br />
– Keine „echte“ Volkszählung, sondern „registergestützt“<br />
- Melderegister, Arbeitnehmerregister der BA<br />
- Gebäude und Wohnungszählung<br />
- 10% Stichprobe ( Korrektur der Register)<br />
– Die Register sind fehlerbehaftet, ob Korrektur gelingt ist unklar<br />
- Aber auch eine Vollerhebung produziert Fehler<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 48
Entwicklung der Weltbevölkerung<br />
Quelle: BiB, 2008, Broschüre Bevölkerung<br />
• 1500: ca. 450 Mio. (bis ca. 1900 sind dies Schätzungen)<br />
– Bis 1800 geringes Wachstum (ca. 0,2% pro Jahr)<br />
– Dann beschleunigt sich das Wachstum (auf bis 2,1% pro Jahr, 1970)<br />
– Dann begann es zu sinken auf 1,2% 2009<br />
• Demographisches Momentum<br />
– Trotz sinkender Geburtenziffern wird Weltbevölkerung weiter wachsen<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 49<br />
Wie viele Menschen verträgt die Erde?<br />
• Vorsicht: oft wertbeladene Diskussion!<br />
– Bevölkerungsexplosion, Paul Ehrlich (1968) The Population Bomb<br />
• Zwei Standpunkte<br />
– Bevölkerungspessimisten<br />
- Geringes Wirtschaftswachstum (da die meisten Investitionen in Kinder)<br />
– Bevölkerungsoptimisten<br />
- Hohes Wirtschaftswachstum (da viel Innovation und Nachfrage)<br />
• Bisher scheint eher die optimistische Sichtweise zuzutreffen<br />
– Thomas Malthus (1798) sagte Hungerkrisen voraus<br />
- Widerlegt durch Agrarrevolution<br />
- Seit 1950 Zunahme der pro Kopf Nahrungsmittel um 20%<br />
– Ehrlichs (1968) Teufelskreis: Fertilität Armut Fertilität<br />
- Das Gegenteil passierte, wachsende Bevölkerungen erleben einen<br />
Wirtschaftsaufschwung, der zu niedrigerer Fertilität führt<br />
• Aber: Grenzen des Wachstums?<br />
– Wachstum basiert auf nicht-nachwachsenden Rohstoffen<br />
– Ökosystem könnte kippen (Klimawandel)<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 50
Altersstruktur der Bevölkerung<br />
• Makroeffekt der demographischen Prozesse<br />
der letzten 100 Jahre<br />
– Geburten, Sterbefälle und Wanderungen<br />
• Drei Grundtypen der Altersstruktur<br />
– Wachsende Bevölkerung (Pyramide)<br />
- Es werden mehr Kinder geboren, als für die<br />
Reproduktion erforderlich<br />
- Bei geringer Säuglingssterblichkeit,<br />
sonst „Pagodenform“<br />
– Stationäre Bevölkerung (Bienenstock, Glocke)<br />
- Jeder Jahrgang reproduziert sich gerade selbst<br />
- Bevölkerungszahl bleibt gleich<br />
– Schrumpfende Bevölkerung (Pilz, Urne)<br />
- Es werden weniger Kinder geboren, als für die<br />
Reproduktion erforderlich<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 51<br />
Altersstruktur der Bevölkerung Deutschlands 1910<br />
Quelle: Thomas Klein: <strong>Sozialstrukturanalyse</strong>, S. 45<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 52
Altersstruktur der<br />
Bevölkerung<br />
Deutschlands 2009<br />
• Das wechselvolle 20.<br />
Jhd. spiegelt sich in der<br />
Altersstruktur wider!<br />
• Typ<br />
– Tannenbaum (wg. Baby-<br />
Boom) auf dem Weg zur<br />
Urne<br />
• Sex-Ratio bei Geburt<br />
– 1,05<br />
– 105 Buben auf 100 Mädls<br />
Effekte der Altersstruktur<br />
• „Echo-Effekte“ eine Generation später<br />
– Baby-Boomer erzeugten ca. 1990 einen zweiten (kleineren) Boom<br />
• Effekt der Kohortengröße<br />
– Stark besetzte Kohorten (Baby-Boomer) haben in Schule,<br />
Ausbildung und Arbeitsmarkt „crowding“ Probleme<br />
- Schrumpfende Kohorten haben Vorteile<br />
– Easterlin (1973) Hypothese<br />
- Kleine Kohorten profitieren auf dem Arbeitsmarkt und können sich<br />
wieder mehr Kinder leisten (Folge: Baby Boom), und vice versa<br />
- Allerdings empirisch falsch<br />
• Partnermarktungleichgewichte<br />
– Bereits bei Geburt Männerüberschuss<br />
– Altersabstand bei Paaren: Frau im Schnitt 2-3 Jahre jünger<br />
– Bei schrumpfender Bevölkerung gibt es deshalb noch mal weniger<br />
Frauen in den relevanten Altersjahrgängen („marriage squeeze“)<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 54
Alterung der<br />
Gesellschaft<br />
• Altersstruktur 2060<br />
– Anhaltend niedrige<br />
Geburtenrate<br />
– Steigende<br />
Lebenserwartung<br />
– 100 -200 Tsd.<br />
Immigration<br />
„perfekte“ Urne<br />
Weniger Junge,<br />
mehr Alte<br />
Unterstützungsquotienten<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 56
Folgen der Alterung<br />
• Zahl der verfügbaren Arbeitskräfte wird sinken und<br />
Alterung der verfügbaren Erwerbspersonen<br />
– Ältere sind weniger innovativ und mobil<br />
Alterung bremst technischen und wirtschaftlichen Fortschritt<br />
• Anstieg des Altenquotienten gefährdet Finanzierbarkeit der<br />
Sozialsysteme<br />
– Leistungen der Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung an die<br />
Alten werden von den gegenwärtig Erwerbstätigen finanziert<br />
- Dies gilt nicht nur für umlagefinanzierte sondern auch für<br />
kapitalgedeckte Systeme! („Kapital kann man nicht essen“)<br />
– Steigt die Produktivität synchron mit dem Altenquotient,<br />
dann bleibt alles wie es ist<br />
– Steigt die Produktivität langsamer, dann<br />
- Anstieg der Beiträge und/oder<br />
- Senkung der Sozialleistungen (Anstieg des Rentenalters)<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 57<br />
• Eine „exotische“<br />
Konsequenz<br />
– Anstieg des CO²<br />
Ausstoßes durch die<br />
Alterung<br />
– Bei weiterer Alterung<br />
evtl. leichter Rückgang<br />
Folgen der Alterung<br />
Quelle: E. Zagheni (2011) Dem. Forschung, 8 (3).<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 58
Bewertung der Folgerung der Alterung<br />
• Achtung: wissenschaftlich nicht begründbar!<br />
– Üblicherweise wird die Alterung als problematisch bewertet<br />
- Oft aus einem mehr oder wenig chauvinistischem Standpunkt<br />
– Man kann sie aber auch optimistischer sehen<br />
• Ein optimistischer Blick auf die Alterung<br />
– D ist ein dicht besiedeltes Land<br />
- Ökologisch ist ein Bevölkerungsrückgang von Vorteil<br />
– Eine schrumpfende Bevölkerung benötigt weniger Arbeitskräfte<br />
- Der Rückgang der verfügbaren Erwerbspersonen ist kein Problem<br />
– Der Rückgang der Wirtschafts- und Innovationskraft eröffnet den<br />
noch „jungen“, aber nicht-entwickelten Weltregionen neue Chancen<br />
- Dies ist eine positive Seite der zunehmenden Globalisierung<br />
- Der Wohlstand in D wird sinken, dafür in ärmeren Regionen steigen<br />
– Durch längere Lebensarbeitszeit gelingt auch eine solidarische (?)<br />
Finanzierung der Sozialversicherungen<br />
- „Überlange“ Studienzeiten und viel Frühverrentung der 70er bis 90er<br />
Jahre (Reaktion auf die „Baby Boomer“) wird abgebaut<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 59<br />
Modell des demographischen Übergangs<br />
Quelle: Rostocker Zentrum (2005) „Deutschland im Demografischen Wandel“<br />
• Frank Notestein (1945); ursprünglich nur drei Phasen<br />
• Postulat: Rückgang der Sterblichkeit verursacht Rückgang der Fertilität<br />
• Das ist zu einfach (s. Abschnitt „Fertilität“)<br />
• Auf die Phase 5 folgt der 2. demographische Übergang (schrumpfende Bev.)<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 60
Die demographischen Übergänge in Deutschland<br />
Quelle: BiB, 2004, Broschüre Bevölkerung<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 61<br />
KAPITEL 4: Bevölkerung<br />
Abschnitt: Fertilität<br />
Josef <strong>Brüderl</strong><br />
<strong>Vorlesung</strong> <strong>Sozialstrukturanalyse</strong>
Fertilität: Die Veränderung der Geburtenrate<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 63<br />
Fertilität: Die Veränderung der Geburtenrate<br />
• Zusammengefasste Geburtenziffer (total fertility rate, TFR)<br />
– Perioden-Kennziffer:<br />
Summe der altersspezifischen Geburtenziffern eines Jahres<br />
– Durchschnittliche Kinderzahl einer fiktiven Frauenkohorte,<br />
wenn sie sich so verhielte, wie die Frauen des aktuellen Jahres<br />
• Der Geburtenrückgang<br />
– Einige leicht erklärbare Periodeneffekte<br />
- Die beiden Weltkriege mit anschließenden Nachholeffekten<br />
- Die Weltwirtschaftskrise Anfang der 1930er<br />
- Die Baby-Booms im Dritten-Reich und um 1960<br />
– Persistenter Geburtenrückgang (Erklärung folgt)<br />
- 1. Demographischer Übergang Anfang des 20. Jhd.: von 5 auf 2<br />
- 2. Demographischer Übergang in den 1970ern: von 2 auf 1,4<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 64
Die Veränderung der endgültigen Kinderzahl<br />
• TFR ist eine Perioden-Kennziffer<br />
– Reagiert auf „Tempo-Effekte“: Wenn sich z.B. das Alter bei Geburt<br />
erhöht, wird die „wahre“ Geburtenziffer unterschätzt<br />
– In den meisten Industrienationen stieg das Geburtsalter abrupt an<br />
(s. nächste Folie) TFR fällt, obwohl evtl. nur Timing-Änderung<br />
– TFR ist ein „unbrauchbare“ Kennziffer, die in die Irre führen kann<br />
• Besser ist die Kohorten-Kennziffer „endgültige Kinderzahl“<br />
(completed fertility rate, CFR)<br />
– Summe der altersspezifischen Geburtenziffern einer Kohorte bis 45<br />
– Durchschnittliche Kinderzahl, die die Kohorte tatsächlich bekommen<br />
hat<br />
– Nachteil: Erst bekannt, wenn Kohorte 45 ist<br />
– Wichtigste Ergebnisse (s. übernächste Folie)<br />
- 1. Demographischer Übergang : von 5 auf 2<br />
- 2. Demographischer Übergang : von 2 auf 1,6<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 65<br />
Timing der Geburten in Deutschland<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 66
Die Veränderung der endgültigen Kinderzahl<br />
• Kinderlosigkeit heute hoch: ca. 21 % bleiben ohne Kinder<br />
• Geburten höherer Parität heute selten: ca. 15% haben 3+ Kinder<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 67<br />
Kohortenfertilität in Europa<br />
Quelle: Rostocker Zentrum (2005) „Deutschland im Demografischen Wandel“<br />
TFR links, CFR rechts. Man beachte, wie irreführend die TFR oft ist!<br />
z.B. im Falle Polens: TFR = 1,2; CFR = 2,2<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 68
West-Ost Vergleich<br />
• Entwicklung TFR<br />
– Bis 1970 recht ähnlich (trotz Mauer!)<br />
– Baby-Boom 1975-1990 („Honecker-Berg“)<br />
– Geburteneinbruch 1990 („Wende-Schock“)<br />
• Entwicklung CFR<br />
– „Honecker-Berg“ ist real, nicht nur Timing-Effekt (Erklärung folgt)<br />
– „Wende-Schock“ nur Periodeneffekt, vermutlich Anpassung an West-Verhalten<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 69<br />
Eine familienökonomische Handlungstheorie:<br />
Nutzen und Kosten von Kindern<br />
• Systematik von Harvey Leibenstein (1957)<br />
– Nutzen<br />
- Konsumnutzen<br />
- Affektiver Nutzen von Kindern (Kinderliebe)<br />
- Einkommensnutzen<br />
- Wert von Kindern als Arbeitskraft<br />
- Versicherungsnutzen<br />
- Alterssicherung durch die eigenen Kinder<br />
– Kosten<br />
- Direkte Kosten<br />
- Monetäre Kosten für Nahrung, Kleidung, Ausbildung, etc.<br />
- Opportunitätskosten<br />
- für Frau: Einschränkung der Erwerbstätigkeit<br />
- für Frau und Mann: Kinder kosten Zeit (Konsum- und<br />
Freizeitverzicht)<br />
[„Konkurrenz der Genüsse“, Lujo Brentano 1909]<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 70
Erklärungen der Trends<br />
• 1. demographischer Übergang<br />
– Von der Agrargesellschaft zur Industriegesellschaft<br />
- Bauern wurden zu Arbeitern und Angestellten<br />
- Einführung von Sozialversicherung, insb. Rentenversicherung<br />
– Der Nutzen von Kindern sank, weil Arbeits- und Versicherungsnutzen<br />
aufgrund der strukturellen Änderungen zurückgingen<br />
– Analoge Erklärung: Türkische Migrantinnen in Deutschland<br />
• 2. demographischer Übergang<br />
– Von der Industriegesellschaft zur Dienstleistungs-, Freizeit-,<br />
Konsumgesellschaft<br />
- Frauen haben auch „tolle“ Jobs<br />
- Männer und Frauen haben Konsum- und Freizeitmöglichkeiten<br />
– Die Opportunitätskosten steigen<br />
- Frauen: Kinder nur schwer mit Karriere vereinbar<br />
- Männer und Frauen: Kinder schränken die Konsum- und<br />
Freizeitmöglichkeiten stark ein<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 71<br />
Die Struktur des Arguments<br />
Makro<br />
Steigender Wohlstand<br />
Geburtenrückgang<br />
Plausibilitäts<br />
Argument<br />
Aggregation<br />
Mikro<br />
Steigende<br />
Opportunitätskosten<br />
Leibenstein Modell<br />
Weniger Kinder<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 72
Was kann das Leibenstein-Modell noch erklären?<br />
• Den niedrigen Kinderwunsch von Männern<br />
– Kinderwunsch Männer: 26% wollen keine Kinder (PPAS 2003)<br />
– Erklärung: Auch Männer haben heute hohe Opportunitätskosten<br />
• Den Honecker-Berg in der DDR<br />
– Pronatalistische Sozialpolitik (1971/76): Ausbau des Kinder-<br />
Betreuungssystem, Bevorzugung bei Wohnungsvergabe<br />
- Betreuung: Opportunitätskosten niedriger höhere CFR<br />
- Wohnungsvergabe: materielle Anreize früheres Timing<br />
• Sozial differentielle Fertilität (s. nächste Folie)<br />
– Sozial besser Gestellte haben heute weniger Kinder (früher anders!)<br />
– Erklärung: höhere Opportunitätskosten (Konkurrenz der Genüsse)<br />
- Offensichtlich sind direkte Kosten nicht der Grund für niedrige Fertilität!<br />
• Diese Fakten kann das Modell wohl nicht erklären (Kultur?)<br />
– Hartnäckige West-Ost Unterschiede insbesondere bei der<br />
Nichtehelichen-Quote (s. übernächste Folie)<br />
– Länderunterschiede: Das Land ohne jegliche pronatalistische<br />
Familienpolitik (USA) hat hohe Geburtenziffern<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 73<br />
• Frauen mit höherer<br />
Bildung sind häufiger<br />
kinderlos<br />
– Opportunitätskosten<br />
steigen mit Bildung<br />
• In Ostdeutschland ist<br />
kein Zusammenhang<br />
zu sehen!<br />
– Opportunitätskosten<br />
gering durch<br />
Kinderbetreuung<br />
– Oder weil keine<br />
attraktiven Jobs?<br />
Sozial differentielle Fertilität<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 74
Nichteheliche Geburten<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 75<br />
Familienpolitik<br />
• Die Deutschen sollten wieder mehr Kinder bekommen?<br />
– Normative Forderung: wissenschaftlich nicht begründbar<br />
– Alles eine Frage des persönlichen Standpunktes<br />
- Nationalist: Deutschland sollte nicht schrumpfen/altern<br />
- Öko: Die Umweltbelastung ist durch weniger Bevölkerung geringer<br />
• Wissenschaft kann allerdings die Wirksamkeit von<br />
Maßnahmen – gegeben ein Ziel – beurteilen<br />
– Elterngeld<br />
- Finanzielle Anreize sind heutzutage wohl eher nicht wirksam<br />
– Kinderkrippenausbau<br />
- Senkt Opportunitätskosten von Frauen und sollte zielführend sein<br />
- Aber: Opportunitätskosten der Männer unverändert<br />
- Aber: in einer 24/7 Ökonomie (Karriere-Jobs) hilft Krippe auch nicht<br />
- Der „Turbo-Kapitalismus“ „frisst seine Kinder“<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 76
KAPITEL 4: Bevölkerung<br />
Abschnitt: Mortalität<br />
Josef <strong>Brüderl</strong><br />
<strong>Vorlesung</strong> <strong>Sozialstrukturanalyse</strong><br />
Mortalität: Sterbewahrscheinlichkeit<br />
• Sterbewahrscheinlichkeit<br />
verläuft<br />
U-förmig<br />
– Whs. im nächsten<br />
Jahr zu sterben<br />
– Logarithmierte Skala!<br />
– Säuglingssterblichkeit<br />
heute 0,4 %<br />
– „Motorradgipfel“ ab 18<br />
• Mortalität sinkt mit<br />
Kalenderzeit<br />
• Frauen haben<br />
geringere Mortalität<br />
(s. Abb. beim BiB)<br />
– „Motorradgipfel“<br />
weniger ausgeprägt<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 78
Lebenserwartung<br />
• Aus den Sterbewahrscheinlichkeiten (q t ) ergibt sich die<br />
Überlebenswahrscheinlichkeit (l x ) bis Alter x<br />
x<br />
1<br />
t0<br />
l x<br />
(1 q t<br />
)<br />
• l x nach Alter aufgetragen: Überlebenskurve<br />
– s. nächste Folie: „Rektangularisierung“ der Überlebenskurve<br />
– Whs. mind. 50 zu werden heute: 97% (Frauen), 95% (Männer)<br />
- Hohe Planbarkeit des Lebens (keine „Risikogesellschaft“!)<br />
• Lebenserwartung e x (erwartete, noch zu lebende Jahre)<br />
– e 0 (Lebenserwartung bei Geburt): Fläche unter Überlebenskurve<br />
– e x (fernere Lebenserwartung im Alter x): Fläche unter<br />
Überlebenskurve rechts von x, geteilt durch l x<br />
• q x , l x und e x : Sterbetafel<br />
– Edmund Halley (1693) für Breslau<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 79<br />
Rektangularisierung der Überlebenskurven<br />
Quelle: Rostocker Zentrum (2007) „Deutschland im Demografischen Wandel“<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 80
Trend: steigende Lebenserwartung<br />
Lebenserwartung deutscher Männer<br />
(bis 1932 D, danach Westdeutschland)<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
1871 1881 1891 1901 1910 1924 1932 1949 1960 1970 1980 1990 2000<br />
Lebenserwartung bei Geburt<br />
Säuglingssterblichkeit (pro 100)<br />
Lebenserwartung nach 1. Lebensjahr<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 81<br />
Lebenserwartung: Achtung Irrtum!<br />
• Lebenserwartung bei Geburt<br />
– 1871: Jungen 36, Mädchen 39<br />
– 2007: Jungen 77, Mädchen 82<br />
• Achtung: Lebenserwartung ist ein Mittelwert<br />
– 1871 bimodale Verteilung der Sterbefälle<br />
- 40% starben vor 10, 40% nach 60 (s. näherungsweise nächste Folie)<br />
- Die Lebenserwartung führt hier in die Irre!!<br />
(Allgemein: bei bimodalen Verteilungen sind Mittelwerte nicht sinnvoll)<br />
- Es ist falsch, zu denken, 1871 wurde der mittlere Deutsche nur 36<br />
- Richtig: Wer 10 Jahre alt wurde, hatte gute Chancen, noch 60 zu<br />
werden. Es gab also auch früher viele alte Menschen!<br />
– Heute unimodale Verteilung der Sterbefälle<br />
- Lebenserwartung als Maßzahl sinnvoll<br />
• Achtung: Sterbetafel beruht auf Periodendaten (3 Jahre)<br />
– Bei sinkender Mortalität wird die Lebenserwartung unterschätzt<br />
– Kohorten-Lebenserwartung 2000 geborener Kinder<br />
- 50% werden ihren 100. Geburtstag erleben! (Prognose RZ)<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 82
Altersstruktur der Sterbefälle<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 83<br />
Gründe für steigende Lebenserwartung<br />
• Anstieg ab Ende des 19. Jahrhunderts: ca. 40 Jahre<br />
– Hauptgrund: Reduktion der Säuglings- und Kindersterblichkeit<br />
(bis etwa 1950)<br />
- Bessere Ernährung, bessere Hygiene (Hauptfaktor)<br />
– Medizinisch-technischer Fortschritt (seit Mitte 20. Jhd.)<br />
• Epidemiologischer Übergang<br />
– Früher starben hauptsächlich Kinder an Infektionen,<br />
heute Ältere an Herzinfarkt, Krebs und Alzheimer<br />
Todesursachen<br />
Anteil in %<br />
Quelle: BiB, 2008, Broschüre Bevölkerung<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 84
Länderunterschiede<br />
Quelle: Rostocker Zentrum (2007)<br />
„Deutschland im Demografischen<br />
Wandel“<br />
• Ausnahmen vom globalen Anstieg der Lebenserwartung<br />
– Afrika wegen AIDS<br />
– In Osteuropa sank die Lebenserwartung ab ca. 1970<br />
- Ungesündere Lebensweise (Wodka, Thüringer Rostbratwurst)<br />
- Schlechtere medizinische Versorgung<br />
- „Gute Risiken“ starben im 2. Weltkrieg<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 85<br />
Die Segnungen der Wiedervereinigung<br />
Quelle: Rostocker Zentrum (2007)<br />
„Deutschland im Demografischen<br />
Wandel“<br />
• In der DDR stagnierte die Lebenserwartung seit 1975!<br />
– Aufwendige medizinische Versorgung der Alten zu teuer<br />
– Selektive Migration „guter Risiken“ in den Westen („healthy migrant effect“)<br />
– Seit der Wiedervereinigung findet eine Angleichung statt<br />
- Die Ossis haben 6 Lebensjahre gewonnen!<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 86
KAPITEL 4: Bevölkerung<br />
Abschnitt: Migration<br />
Josef <strong>Brüderl</strong><br />
<strong>Vorlesung</strong> <strong>Sozialstrukturanalyse</strong><br />
Außenwanderung<br />
Quelle: BiB, 2008,<br />
Broschüre Bevölkerung<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 88
Die deutsche Migrationsgeschichte<br />
• Vertriebene nach dem 2. Weltkrieg<br />
– 1944 - 50 ca. 8 Millionen in die Westzone/BRD, 4 Mio. in DDR<br />
• DDR-Flüchtlinge bis zum Mauerbau 1961<br />
– 1949 - 61 ca. 3 Millionen (aber auch ca. 500 Tsd. nach DDR)<br />
• „Gastarbeiter“ bis Anwerbestopp 1973<br />
– 1961 – 74 ca. 14 Millionen kamen, 11 Millionen gingen wieder<br />
– Danach überwiegend Familiennachzug: Saldo insg. ca. 8 Mio.<br />
• „Wohlstandsmigration“ ab ca. 1990<br />
– Deutschland wird Einwanderungsland: ca. 600 Tsd. pro Jahr<br />
- EU-Bürger (ca. 50%), Asylsuchende, „Green-Card“<br />
– Aber auch Fortzug in etwa gleicher Höhe<br />
• Migration von Deutschen<br />
– Emigration nach Übersee nach dem 2. Weltkrieg (ca. 2 Mio.)<br />
– Immigration von Spätaussiedlern seit Zusammenbruch UdSSR<br />
- Bisher ca. 4 Millionen<br />
– Steigender Trend bei Fortzügen Deutscher (ca. 200 Tsd. pro Jahr)<br />
- „Auswanderungsland“ oder Folge der Globalisierung?<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 89<br />
• Umfang<br />
Binnenwanderung<br />
– Etwa 5% verlassen jährlich ihre<br />
Gemeinde<br />
– Etwa 1,5% ihr Bundesland<br />
• Trends der Binnenwanderung<br />
– Ost nach West<br />
- Saldo seit 1991 ca. -1,5 Mio.<br />
- Inzwischen aber auch viele<br />
Zuzüge<br />
– Nord nach Süd<br />
- Saldo Bayern seit 1991<br />
ca. 600 Tsd.<br />
– Urbanisierung<br />
- Vom Land in die Stadt<br />
– Suburbanisierung<br />
- Aus der Stadt ins Umland<br />
Binnenwanderungssaldo 2006-08<br />
(je 1000 Einwohner)<br />
Quelle: Rostocker Zentrum (2011)<br />
„Deutschland im Demografischen Wandel“<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 90
Ausländeranteil<br />
• Ausländeranteil<br />
– Heute ca. 9%<br />
- Ost 2%, West 10%,<br />
Stadtstaaten 14%<br />
– Sinkt, da<br />
- Zuwanderungssaldo<br />
fast Null<br />
- Zunehmende<br />
Einbürgerung<br />
• Migrationshintergrund<br />
– Definition:<br />
Ausländer<br />
+<br />
Deutsche<br />
Mit eigener Zuwanderung<br />
Oder Zuwanderung mind.<br />
eines Elternteils<br />
– Heute ca. 20%<br />
- Bei den unter<br />
5-Jährigen ca. ein<br />
Drittel<br />
Quelle: BiB, 2008, Broschüre Bevölkerung<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 91<br />
Theorien der Migration<br />
• Gravitationsmodell der Migration<br />
– Die Häufigkeit der Migration sinkt mit der Entfernung<br />
– Makrogesetz: es fehlt eine Erklärung<br />
• Mikromodell: Migration folgt den Arbeitsmarktchancen<br />
– P(Migration A→B) = f(W B –W A , p(W B ))<br />
- W B –W A : Lohngefälle; p(W B ): Whs. in B Job zu finden<br />
– Dieses Modell kann im Großen und Ganzen die beobachtbaren<br />
Migrationsströme erklären<br />
– Zusätzlich: „Push-Faktoren“ (Krieg, Verfolgung, etc.)<br />
• Warum wandern dennoch nur Wenige?<br />
– Arbeitsmarktchancen individuell unterschiedlich<br />
- Oft gibt es gar Migrationsströme in beide Richtungen<br />
– Hohe Migrationskosten für die meisten<br />
- Aufgabe Status Quo (materiell und sozial), Reisekosten<br />
– Hohe Unsicherheit über Chancen am Zielort<br />
- Risikofreudige wandern eher<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 92
Internationale Migrationsströme<br />
Sind gut mit dem Mikromodell erklärbar<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 93<br />
Einige empirische Phänomene<br />
• Warum eher kurze Distanzen?<br />
– Zunehmende Kosten und Unsicherheit<br />
– „Intervening opportunities“ bei großen Distanzen (über Land)<br />
• Warum gibt es bevorzugte Zielorte?<br />
– Hohe Unsicherheit über Zielort kann durch „Migrationspioniere“<br />
abgebaut werden<br />
– Folge: Kettenmigration über soziale Netzwerk<br />
• Warum wandern eher Junge (s. nächste Folie)?<br />
– Junge (Männer) sind risikofreudiger<br />
– Geringeres materielles und soziales Kapital, das zurückgelassen<br />
werden müsste<br />
– Humankapitalinvestitionen lohnen eher am Beginn des<br />
Erwerbslebens<br />
- Verlust des spezifischen Humankapitals am Herkunftsort<br />
- Aufbau neuen Humankapitals am Zielort (Sprache, Kultur, etc.)<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 94
Migranten sind jung und männlich<br />
Quelle: Rostocker Zentrum (2007) „Deutschland im Demografischen Wandel“<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 95<br />
Folgen der Migration<br />
• Demographische Folgen (bei positivem Wanderungssaldo)<br />
– Abbremsen des Bevölkerungsrückgangs<br />
- + 500 Tsd. pro Jahr, dann gäbe es keinen Rückgang<br />
– „Verjüngung“ der Zielländer, aber „Vergreisung“ der Herkunftsländer<br />
(s. nächste Folie)<br />
• Wirtschaftliche Folgen: hängt vom Bedarf ab<br />
– Zuwanderung bei Arbeitskräftemangel fördert das Wachstum<br />
- Bremst es im Herkunftsland, falls Hochqualifizierte abwandern<br />
(„brain drain“)<br />
– Zuwanderung bei schlechter Konjunktur führt leicht zu „Migration in<br />
die Sozialhilfe“ (s. übernächste Folie)<br />
• Sozialstrukturelle Folgen<br />
– Zuwanderung Geringqualifizierter (Unterschichtung): Fahrstuhleffekt<br />
- Ethnische Ungleichheit durch selektive Migration<br />
– Zuwanderung Hochqualifizierter (Überschichtung):<br />
Verdrängungswettbewerb<br />
– Evtl. Integrationsprobleme im Zielland<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 96
Verjüngung der Altersstruktur<br />
Quelle: BiB, 2008, Broschüre Bevölkerung<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 97<br />
Wanderung und Beschäftigung<br />
Quelle: Klein, <strong>Sozialstrukturanalyse</strong>, S. 126<br />
Quelle: Thomas Klein: <strong>Sozialstrukturanalyse</strong>, S. 126 (Abb. 2.5.3)<br />
• Achtung: dies ist ein Makrozusammenhang<br />
– Es ist nicht sicher, dass dieser Zusammenhang auch auf der Mikroebene existiert!<br />
– Aber es ist plausibel: Bis 1975 Gastarbeiter als Arbeitskräfte, um 1980<br />
Familiennachzug, um 1990 viele Asylsuchende und Spätaussiedler<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 98
Bewertung der Migration<br />
• Achtung: wissenschaftlich nicht begründbar<br />
• Leitbilder<br />
– Christliches (liberales) Weltbild<br />
- Der reiche Westen soll den Armen und Verfolgten helfen<br />
– Wirtschaftliche Interessen<br />
- Deutschland braucht junge Arbeitskräfte<br />
– Fremdenfeindlichkeit<br />
- Anthropologische Konstante: der Mensch fühlt sich vom „Fremden“<br />
bedroht zumindest unwohl<br />
- Ethnische Homogenität wird deshalb bevorzugt<br />
• Aufnahmepolitiken<br />
– Abwehr: Beschränkung Asylrecht und keine Aufnahmequoten<br />
– Assimilation: Annahme deutscher Sprache und Kultur<br />
– Multikulturell: sprachliche Assimilation und Akzeptanz der<br />
Grundwerte, aber keine kulturelle Assimilation fordern<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 99<br />
Sarrazin-Debatte<br />
• Deutschland schafft sich ab?<br />
– Die besser Gebildeten haben weniger<br />
Kinder (s. Folie 76)<br />
- Deshalb wird D dümmer<br />
– Muslimische Migranten haben höhere<br />
Fertilität (s. rechts)<br />
- Deshalb wird D in 2100 mehrheitlich<br />
muslimisch sein<br />
• Diese Fakten sind nicht zu bestreiten<br />
– Aber die Prognosen sind übertrieben<br />
- Bisher kein Indiz für fallende Intelligenz<br />
- TFT von Türkinnen ist unter 2,1!<br />
Integrationsbereitschaft wird geleugnet<br />
– Und über die Bewertung kann man<br />
sowieso diskutieren<br />
- Sarrazin nimmt einen chauvinistischen<br />
Standpunkt ein<br />
- Man kann aber auch einen<br />
weltbürgerlichen Standpunkt<br />
einnehmen, dann ist D nicht so wichtig<br />
Quelle: Rostocker Zentrum (2011)<br />
„Deutschland im Demografischen Wandel“<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 100
KAPITEL 5<br />
Private Lebensformen<br />
Josef <strong>Brüderl</strong><br />
<strong>Vorlesung</strong> <strong>Sozialstrukturanalyse</strong><br />
Geschichte der Familie<br />
• Agrargesellschaft: „Ganzes Haus“<br />
– Drei-Generationen, plus Geschwister, plus Gesinde<br />
– Aber auch: viele Menschen ohne Familie, Stieffamilien<br />
• Erster Demographischer Übergang<br />
– Rückgang der Fertilität, Schrumpfung der Familien<br />
• Golden Age of Marriage<br />
– Höhepunkt der Institutionalisierung der Kernfamilie in den 1950ern<br />
- 95% heirateten, 90% bekamen Kinder, nur 10% Scheidungen, 90% der<br />
Kinder unter 6 wachsen mit beiden Eltern auf, nur 5% unehelich<br />
– Institution der „Normalfamilie“: Heirat Anfang/Mitte 20, 2 Kinder<br />
• Zweiter Demographischer Übergang<br />
– Rapider weiterer demographischen Wandel seit den 1970ern<br />
– Weiterer Geburtenrückgang, zunehmende Vielfalt der Lebensformen<br />
• Zerfall der Familie?<br />
– Frage ist unpräzise und normativ<br />
– Besser: Findet eine Deinstitutionalisierung der Normalfamilie statt?<br />
- Abnahme der Häufigkeit, Destandardisierung der Lebensverläufe, etc.?<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 102
Veränderung der Struktur der Haushalte<br />
• Von der Großfamilie, zur Kernfamilie, zum Single<br />
• Gegenwärtig (2005) ca. 40 Mio. HH<br />
– Durchschnittliche Größe 2,11<br />
– Ein-Personen HH: 38% (europäische Spitze)<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 103<br />
• (Privater) Haushalt<br />
Lebensformen<br />
– Personen, die zusammenleben und gemeinsam wirtschaften<br />
• Lebensform<br />
– Beziehungsmuster des alltäglichen Zusammenlebens<br />
– Verschiedene Unterscheidungsmerkmale möglich:<br />
- Haushaltsgröße<br />
- Ein- bzw. Mehr-Personen Haushalte<br />
- Familienstand<br />
- Ledig, verheiratet (verpartnert), geschieden, verwitwet<br />
- Institutionalisierungsgrad des Zusammenlebens<br />
- Partnerlos, Living-Apart-Together (LAT), Nichteheliche<br />
Lebensgemeinschaft (NEL), Lebenspartnerschaft, Ehe<br />
- Vorhandensein von Kindern<br />
- Partnerlos/Lebensgemeinschaft ohne Kinder, Familie<br />
- Zahl der Generationen<br />
- Ein-, Zwei-, Drei-Generationen Haushalt<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 104
Wandel der Lebensformen<br />
• Lebensformkonzept Statistisches Bundesamt<br />
– Ehe ja/nein, Kinder ja/nein<br />
– 6 Lebensformen: Alleinstehende oder Alleinerziehende,<br />
NEL mit oder ohne Kinder, Ehepaare mit oder ohne Kinder<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 105<br />
Wandel der Lebensformen<br />
• Trends für Westdeutschland (Huinink/Schröder, S. 88)<br />
– Rückgang der traditionellen Familie (Ehe mit Kindern)<br />
- 1972: 71%, 2003: 52% (36-55 Jährige)<br />
– Mehr Alleinlebende (auch bei den Jungen!)<br />
- 1972: 8%, 2003: 20% (18-35 Jährige)<br />
– Mehr NEL<br />
- 1972:
Pluralisierung der Lebensformen?<br />
• Ulrich Beck (1983): Individualisierung<br />
– Unpräzise Begrifflichkeit<br />
- Wachsende Optionsvielfalt und damit Entscheidungsmöglichkeiten<br />
- Weniger soziale und normative Einbindung des Einzelnen<br />
– Statt Fakten: Beispiele (feuilletonistische Zeitdiagnose)<br />
– Statt Theorie: Trend Behauptungen (z.B. Individualisierungsschub)<br />
• Eine Folge der Individualisierung<br />
– Pluralisierung der Lebensformen<br />
– Auch hier: unpräzise Begrifflichkeit, Beispiele statt Fakten<br />
• Präzisierung: Was ist Pluralisierung?<br />
– Zunahme der Vielfalt der Lebensformen. Zwei Varianten:<br />
- Auftauchen historisch neuer Lebensformen (strukturelle Vielfalt)<br />
- Zunehmende Heterogenität der Lebensformen (distributive Vielfalt)<br />
- Messung mit qualitativer Varianz (Entropiemaß):<br />
Maximale Pluralisierung bei Gleichverteilung auf Lebensformen<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 107<br />
Strukturelle Pluralisierung: neue Lebensformen?<br />
• Zwei-Karriere Partnerschaften<br />
– Ohne Kinder, „Double Income no Kids“ (DINKS)<br />
- Oft als LAT (bei großen Distanzen: „Commuter-Partnerschaften“)<br />
• Scheidungsfamilie<br />
– Familie über zwei Haushalte verteilt<br />
• Entkoppelung von biologischer und sozialer Elternschaft<br />
– Adoptivfamilien (auch früher häufig)<br />
– Stieffamilien (auch früher häufig)<br />
– Komplexe Stieffamilien (Patchwork-Familie, s. nächste Folie)<br />
– Inseminationsfamilien<br />
- Mann nicht biologisch, aber sozialer Vater<br />
• Gleichgeschlechtliche Paare<br />
– Auch mit Kindern (Regenbogenfamilien)<br />
• Datenlage schlecht, deshalb quantitatives Ausmaß unklar<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 108
Die Patchwork-Familie<br />
Quelle: Maxeiner/Kuhl (2010)<br />
Alles Familie. Klett.<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 109<br />
Distributive Pluralisierung: steigende Heterogenität?<br />
• Meist mit amtlichen Daten<br />
– Wagner (2008) findet mit Mikrozensus<br />
- Leichter Anstieg der Entropie von 1972 (0,69) auf 2000 (0,71)<br />
- Eher schwacher Trend!<br />
– Probleme<br />
- Nur „amtliche“ Lebensformen (8)<br />
- Analyseebene Haushalte<br />
- Querschnittsvergleich: dominiert von älteren Kohorten<br />
• Mit Umfragedaten differenzierter möglich<br />
– Wagner (2008) findet mit ALLBUS<br />
- Nun 26 Lebensformen (Familienstand, Kind, Erwerbstätigkeit)<br />
- Anstieg der Entropie von 1980 (0,72) auf 2005 (0,79)<br />
- Monotoner (schwacher) Trend!<br />
– Problem<br />
- Querschnittsvergleich: dominiert von älteren Kohorten<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 110
Zunehmende Vielfalt der Lebensverläufe?<br />
• Nicht nur querschnittliche Verteilung der Lebensformen<br />
– Interessanter und wichtiger ist, ob auch bei individuellen<br />
Lebensverläufen die Vielfalt zunimmt<br />
• Dazu nötig: Umfrage-Längsschnittdaten<br />
– Familiensurveys 1988, 2000<br />
– Beziehungs- und Familienpanel (pairfam)<br />
• Distributive Pluralisierung? (s. nächste Folie)<br />
– Familiensurvey 2000<br />
- Westdeutschland, Geburtskohorten 1944-82<br />
- Vergleich der typischen Lebensläufe (bis 35) von Geburtskohorten<br />
– Ergebnis: die distributive Vielfalt (Entropie) ist angestiegen<br />
- Aber kein monotoner Trend!<br />
- Durch die zunehmende Dominanz der „Ledigen“ Abnahme am Ende<br />
– Probleme<br />
- Eingeschränkte Zahl an Lebensformen (keine LAT, keine Kinder)<br />
- Lebensverläufe nur bis zum Alter 35<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 111<br />
Verteilung der Lebenslauftypen über die Kohorten<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
2,0<br />
1,8<br />
70%<br />
1,6<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
44-49 50-53 54-57 58-61 62-65<br />
Entropiemaß<br />
1,4<br />
1,2<br />
1,0<br />
0,8<br />
0,6<br />
0,4<br />
0,2<br />
0,0<br />
44-49 50-53 54-57 58-61 62-65<br />
Geburtskohorte<br />
Geburtskohorte<br />
überwiegend ledig<br />
ledig mit kurzen NELs<br />
längere NEL<br />
voreheliche NEL<br />
Heirat mit 20 Heirat mit 25<br />
Heirat mit 30<br />
nacheheliche Lebensformen<br />
Quelle: <strong>Brüderl</strong> (2004) Die Pluralisierung<br />
partnerschaftlicher Lebensformen in<br />
Westdeutschland und Europa. Aus<br />
Politik und Zeitgeschichte B 19: 3-10.<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 112
Erklärungen des Wandels der Lebensformen I<br />
• Funktionalismus: Theorie funktionaler Differenzierung<br />
– Lebensformen sind ein Teilsystem der Gesellschaft<br />
- Sie haben Funktionen: Integration (Sozialisation) und Reproduktion<br />
- Es herrschen die Lebensformen vor, die am besten die Bestandserhaltung<br />
des Systems Gesellschaft sichern<br />
– Agrargesellschaft<br />
- Produktion und Reproduktion vereint<br />
- Das „Ganze Haus“ war am besten für die agrarische Produktionsweise<br />
– Industriegesellschaft<br />
- Durkheims Kontraktionsgesetz: es kommt zu funktionaler Differenzierung<br />
(Trennung von Produktion und Reproduktion), weshalb sich die<br />
„Großfamilie“ reduziert auf die Kernfamilie<br />
– Dienstleistungsgesellschaft (Turbo-Kapitalismus)<br />
- Weiter steigende Flexibilitäts- und Mobilitätszumutungen erfordern eine<br />
weitere Differenzierung/Reduktion der Familie: NEL, DINK, LAT, Single<br />
• Kritik<br />
– Erklärung immer nur „ex-post“, funktionale Äquivalente aus dem Blick<br />
– Makroansatz: Menschen als „Marionetten“ des Systems<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 113<br />
Erklärungen des Wandels der Lebensformen II<br />
• Individualisierungstheorie<br />
– Durch zunehmende Individualisierung kommt es zur Pluralisierung<br />
– Die „Theorie“ ist so unpräzise, dass unklar ist, was gemeint ist<br />
- Funktionalistisches Argument: Anforderung des modernen Kapitalismus<br />
- Problematisches Makro-Argument (s.o.)<br />
- Wertewandel Argument: Individualisierung als Wertewandel<br />
- Informationsgehalt gering: Die Leute wollen nicht mehr heiraten<br />
- Unvollständig: Warum haben sich die Werte geändert?<br />
- Kaum überprüfbar: Was sind das genau für Werte?<br />
- Sozialstrukturelle Erklärung: Die Umstände haben sich geändert<br />
- Prinzipiell ein Makro-Mikro-Makro Argument<br />
- Aber die Handlungstheorie, die hier verwendet wird, ist nicht explizit<br />
• Skizze einer Makro-Mikro-Makro Erklärung<br />
– Steigender Wohlstand: Wohnraum und soziale Absicherung<br />
– Steigende Arbeitsmarktintegration<br />
– Abnehmende normative Verbindlichkeit (endogen?)<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 114
KAPITEL 5: Private Lebensformen<br />
Abschnitt: Partnerwahl, Heirat, Scheidung<br />
Josef <strong>Brüderl</strong><br />
<strong>Vorlesung</strong> <strong>Sozialstrukturanalyse</strong><br />
Partnerwahl: Wer mit wem?<br />
• Liebe ist unberechenbar, dennoch gibt es Regelmäßigkeiten<br />
– „Gleich und Gleich gesellt sich gern“ (Homogamie)<br />
oder<br />
– „Gegensätze ziehen sich an“ (Heterogamie)<br />
• Ergebnisse der Familienforschung<br />
– Altersabstand: Männer im Schnitt 3 Jahre älter<br />
– Meist aber Homogamie: Größe, Attraktivität, Persönlichkeit, etc.<br />
– Konfession<br />
- Früher homogam (90%), heute abnehmende Homogamie (eher bei 50%)<br />
– Bildung<br />
- Früher oft heterogam (Aufwärtsheirat der Frauen), heute eher homogam<br />
– Nationalität<br />
- Binationale Ehen zunehmend (heute ca. 10%)<br />
- Männer: Polinnen, Asiatinnen, Frauen: Jugoslawen, Türken<br />
• Folgen der Homogamie<br />
– Verstärkt soziale Ungleichheit; Stärkt die Konfessionen;<br />
Schwächt die Integration von Migranten<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 116
Erklärungen der Homogamie<br />
• Familienökonomische Erklärung<br />
– Wähle den besten verfügbaren (!) Partner<br />
– Vollkommener Partnermarkt (Wettbewerb bei voller Information)<br />
• Verhaltensmaxime abhängig von Art des Merkmals<br />
– „The more the better“: Maximierungsprinzip (Bsp. Attraktivität)<br />
- Verteilung M und F gleich: perfekte Homogamie<br />
- Verteilung M und F unterschiedlich: nur perfekte Korrelation (a)<br />
– Gleich und Gleich am Besten: Homogamieprinzip (Bsp. kulturelle Herkunft)<br />
- Verteilung M und F gleich: perfekte Homogamie<br />
- Verteilung M und F unterschiedlich: Partnermarktungleichgewicht (b)<br />
Quelle: Thomas Klein:<br />
<strong>Sozialstrukturanalyse</strong>, S. 197<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 117<br />
Erklärungen der Homogamie<br />
• Meeting-and-Mating These<br />
– „Who does not meet, does not mate“<br />
- Menschen, die sich treffen, bilden eher ein Paar<br />
- Treffpunkte (Foki) sind sozial strukturiert (nach Bildung, Herkunft,<br />
Religion, Ethnizität, etc.)<br />
- Foki: Arbeitsplätze, Schulen, Clubs, Vereine, Wohngebiete, etc.<br />
- Deshalb sind Partnerschaften eher homogam<br />
– Nicht Präferenzen (familienök. Ansatz), sondern Gelegenheitsstrukturen<br />
erzeugen Homogamie<br />
• Bedeutung des Internet-Partnermarktes<br />
– Sozial nicht strukturiert<br />
weniger Homogamie<br />
– Bessere Transparenz des Partnermarktes<br />
– Matching-Algorithmen der Partneragenturen<br />
mehr Homogamie<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 118
• Die Sex-Ratio ist<br />
eine bedeutsame<br />
Randbedingung des<br />
Partnermarktes<br />
– Im Osten deutlicher<br />
Männerüberschuss<br />
– Im Großraum<br />
München deutlicher<br />
Frauenüberschuss<br />
Quelle: Kröhnert, van Olst<br />
und Klingholz (2005: 13)<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 119<br />
Veränderungen beim Heiratsverhalten<br />
• Vorverlagerung und häufigeres Heiraten bis in die 1960er<br />
– „Golden Age of Marriage“<br />
– Rückgang des Erstheiratsalters<br />
- 1970: Frauen 23, Männer 26<br />
– Dauerhafte Ledigenquote sinkt<br />
- Kohorte 1950: Frauen 5%, Männer 10%<br />
• Rückgang der Heiratsneigung seit ca. 1970<br />
– Anstieg des Erstheiratsalters<br />
- Heute: Frauen 29, Männer 32<br />
– Dauerhafte Ledigenquote steigt<br />
- Prognosen Kohorte 1970: Frauen 25%, Männer 33%<br />
• Rapider Wandel in Ostdeutschland<br />
– Frühes und häufiges Heiraten in DDR (Wohnungen!)<br />
- Erstheiratsalter: Frauen 21, Männer 23<br />
– Seit der Wende rapide Angleichung an das Westverhalten<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 120
Altersspezifische Erstheiratsraten<br />
1980<br />
1910<br />
1950<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 121<br />
Erst-Heiratstafel<br />
Quelle: Statistisches Bundesamt, Datenreport 2004<br />
Daten: ALLBUS 1980-2000 (kumuliert)<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 122
Rapider Wandel in Ostdeutschland<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 123<br />
Erstheiratsalter in Deutschland<br />
Mittleres Heiratsalter zuvor Lediger (vor 1945 Deutsches Reich)<br />
32<br />
31<br />
30<br />
29<br />
28<br />
Männer BRD<br />
Frauen BRD<br />
Männer DDR<br />
Frauen DDR<br />
27<br />
26<br />
25<br />
24<br />
23<br />
22<br />
21<br />
20<br />
1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000<br />
Eigene Darstellung Quelle: Rothenbacher, The European Population, 2004<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 124
Erklärung des Rückgangs der Heiratsneigung<br />
• Handlungstheorie der Lebensformwahl: Familienökonomie<br />
– Paarbildung: warum LAT?<br />
- Anthropologische Naturkonstante (kein Rückgang, s. Folie davor)<br />
– Haushaltsbildung: warum NEL?<br />
- Kostenersparnis aus Produktionsgemeinschaft<br />
- Nutzen aus Interaktionsverdichtung<br />
- Man spart Kosten der Organisation der Zweisamkeit<br />
- Aber: Verlust an Flexibilität<br />
– Heiraten: warum Ehe?<br />
- Vorteile der Arbeitsteilung realisierbar (Spezialisierungsgewinne), da<br />
die Hausfrau (-mann) über Unterhaltsregelungen abgesichert ist<br />
- Aber: hohe Trennungskosten<br />
• Warum weg von der Ehe, hin zur NEL?<br />
– Arbeitsteilung wird unprofitabel (rechtliche Absicherung unnötig)<br />
- Zunahme qualifizierter Frauenerwerbstätigkeit<br />
- Rückgang der Fertilität<br />
– Anstieg der Scheidungsraten: höhere Kosten der Ehe<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 125<br />
Anteil mit Partner (%)<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
Zunehmende Partnerlosigkeit?<br />
Bindungsquoten westdeutscher Frauen<br />
Kohorte 1991-93<br />
Kohorte 1981-83<br />
Kohorte 1971-73<br />
Quelle:<br />
1) Eigene<br />
Auswertungen,<br />
Beziehungs- und<br />
Familienpanel<br />
(pairfam), Welle 1,<br />
2008<br />
2) Klein S. 172<br />
Kohorten 1940 –<br />
1970, Männer und<br />
Frauen<br />
10<br />
0<br />
10 15 20 25 30 35<br />
Alter<br />
• Bei Klein (S. 150): Rückgang des Zusammenlebens (NEL+Ehe)<br />
• Hier alle Partnerschaften incl. LAT: Bis Kohorte 1970 abnehmende<br />
Partnerlosigkeit, danach kein Trend erkennbar<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 126
Trends in der Beziehungsstabilität<br />
• Seit 100 Jahren steigt die Scheidungsrate<br />
– Bis ins 19. Jhd. kaum Scheidungen (waren auch nicht legal)<br />
– Seit ca. 1900 monotoner Anstieg<br />
– Unterbrochen von Periodeneffekten<br />
- 1. und 2. WW mit anschließendem Nachholeffekt (Kriegsheimkehrer)<br />
- 1977: Umstellung vom „Verursacherprinzip“ auf das „Zerrüttungsprinzip“<br />
in der BRD (Trennungsjahr)<br />
- 1990: Umstellung im Osten auf das Westrecht, danach Anpassung an<br />
Westverhalten<br />
– Seit 2002 Abnahme der rohen Ehescheidungsziffer (s. F 130)<br />
- Kompositionseffekt: weniger Ehen in der Bevölkerung<br />
- Aber: auch der Anstieg der Scheidungsrate kam zum Stillstand (s. F 131)<br />
– Prognose: ca. 40% der Ehen werden geschieden (s. F 132)<br />
• In der DDR höhere Scheidungsraten<br />
• Ähnlicher Trend (auf höherem Niveau) bei NEL<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 127<br />
Der langfristige Trend bei den Scheidungen<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 128
Scheidungsraten<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 129<br />
Anteil der geschiedenen Ehen<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 130
Erklärung des Anstiegs der Scheidungsraten<br />
• Standarderklärungen<br />
– Anstieg der Lebenserwartung<br />
- Ist Quatsch: Fehlinterpretation der Lebenserwartung (s.o.)<br />
– Zunehmende Emotionalisierung von Partnerschaften<br />
- Die Gefühle waren früher auch nicht stabiler<br />
– Wegfall ökonomischer Funktionen (s. Folgendes)<br />
• Familienökonomische Handlungstheorie<br />
– Scheidung, wenn Alternativen besser (Single, neuer Partner)<br />
– Die Alternative „Single“ war früher unmöglich<br />
- Außerhalb eines Familienverbundes war Überleben schwierig<br />
– Alternative „neuer Partner“ war sozial geächtet<br />
- Hohe Kosten einer Trennung/Scheidung<br />
– Selbstverstärkende Prozesse (Scheidungsspirale)<br />
- Hohe Scheidungszahlen vergrößern den Partnermarkt für Ältere<br />
- Hohe Scheidungszahlen verringern die Stigmatisierung<br />
- Hohe Scheidungszahlen verringern „Investitionen“<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 131<br />
KAPITEL 6<br />
Soziale Ungleichheit<br />
Josef <strong>Brüderl</strong><br />
<strong>Vorlesung</strong> <strong>Sozialstrukturanalyse</strong>
Gliederung<br />
• Grundlegendes (HS 5.1)<br />
• Dimensionen und Ursachen sozialer Ungleichheit<br />
(HS 5.2, 5.3.1, 5.3.2) (K 4)<br />
– Bildung<br />
– Beschäftigung und Beruf<br />
– Einkommen und Vermögen<br />
– Gesundheit<br />
– Soziale Beziehungen<br />
– Die Kumulation sozialer Ungleichheit<br />
• Theorien sozialer Ungleichheit (HS 5.3.3)<br />
• Strukturen sozialer Ungleichheit (HS 5.4)<br />
• Soziale Mobilität (HS 5.5, K 4)<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 133<br />
Soziale Ungleichheit<br />
• Grundlegende menschliche Bedürfnisse (Adam Smith)<br />
– Physisches Wohlbefinden<br />
– Soziales Wohlbefinden (soziale Anerkennung)<br />
• Wohlbefinden wird erzeugt durch „Zwischengüter“<br />
– Gesundheit, Wohnbedingungen, Vermögen, soziale Beziehungen<br />
– Sekundär: Bildung, Beruf, Einkommen<br />
- Die sekundären Zwischengüter sind historisch und gesellschaftlich<br />
bedingt!<br />
• Soziale Ungleichheit<br />
– Mehr/Bessere Zwischengüter erzeugen mehr Wohlbefinden<br />
- Deshalb streben die meisten Menschen nach einem Mehr/Besser<br />
– Soziale Ungleichheit ist definiert als:<br />
Ein Mehr/Weniger, Besser/Schlechter bei den Zwischengütern<br />
- Folge: Menschen, die wenig von den Zwischengütern haben, können<br />
nur geringes physisches und soziales Wohlbefinden erreichen<br />
- Der Begriff ist „wertfrei“ gemeint! Ob vorhandene Ungleichheit „gerecht“<br />
oder „ungerecht“ ist, ist eine andere Frage (s.u.)<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 134
Soziale Unterschiede<br />
• Nicht alle Unterschiede zwischen Menschen definieren<br />
gleich soziale Ungleichheit<br />
– Nur Unterschiede auf mehr oder weniger direkt für das<br />
Wohlbefinden relevanten Merkmalen (Zwischengüter) sind<br />
ungleichheitsrelevant<br />
– Andere Merkmale (Klassifikationsmerkmale) definieren nur soziale<br />
Unterschiede<br />
- Herkunft (sozial/regional)<br />
- Physische Unterschiede (Alter, Geschlecht, Ethnizität, Gewicht,<br />
Kompetenzen)<br />
- Kulturelle Unterschiede (Lebensstile, Einstellungen)<br />
• Soziale Unterschiede<br />
– Unterschiede auf Klassifikationsmerkmalen<br />
– Jedoch kann mit Klassifikationsmerkmalen ein Mehr oder Weniger<br />
bei den Zwischengütern (also Ungleichheit) verbunden sein<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 135<br />
Die drei zentralen Fragen<br />
• Das Ausmaß der sozialen Ungleichheit?<br />
– Wie groß ist die Ungleichheit?<br />
- Dimensionen sozialer Ungleichheit<br />
- In dieser <strong>Vorlesung</strong>: Bildung, Beschäftigung / Beruf, Einkommen /<br />
Vermögen, Gesundheit, soziale Beziehungen<br />
• Die Ursachen der sozialen Ungleichheit?<br />
– Welche Zusammenhänge gibt es zwischen den<br />
Klassifikationsmerkmalen und sozialer Ungleichheit?<br />
- Korrelate sozialer Ungleichheit<br />
- Z.B.: Ungleichheit von Mann und Frau, ethnische Ungleichheit,<br />
Effekte der sozialen/regionalen Herkunft<br />
– Wie entsteht aus sozialen Unterschieden soziale Ungleichheit?<br />
- Ungleichheitsgenerierende Mechanismen<br />
- Dies ist die Forschungsfrage des SFB 882 an der Uni Bielefeld<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 136
Was ist soziale Gerechtigkeit?<br />
• Achtung: hier geht es um normative Positionen!<br />
• Drei Dimensionen sozialer Gerechtigkeit<br />
– Startbedingungen<br />
- Ungleich: von Natur (Anlagen) / Herkunft (Erbe) gegeben (natürliche<br />
Ungl.)<br />
- Gleich: Staat soll die Startbedingungen angleichen<br />
(Startchancengleichheit)<br />
– Ungleichheitserzeugende Mechanismen (procedural justice)<br />
- Ungerecht: „gebiast“ im Sinne der Starken/Schwachen (Privilegien)<br />
- Gerecht: ohne Bias (Verfahrensgerechtigkeit)<br />
– Das Ergebnis (distributive justice)<br />
- Leistungsprinzip: Ungleichheit aufgrund unterschiedlicher individueller<br />
Leistung ist legitim („Jedem nach seiner Leistung“)<br />
- Insb. Leistungen im Bildungssystem und im Beruf legitimieren<br />
Ungleichheit<br />
- Staat soll die Marktergebnisse nicht korrigieren<br />
(Leistungsgerechtigkeit)<br />
- Gleichheitsprinzip: Menschen sind gleich, deshalb ist jede Form von<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 137<br />
Ungleichheit illegitim („Jedem das Gleiche / nach seinen Bedürfnissen“)<br />
Der moderne Sozialstaat<br />
• Alle 4 „Gerechtigkeiten“ finden sich im modernen Sozialstaat<br />
– Leistungsgerechtigkeit<br />
- Ungleichheiten als Folge des Leistungsprinzips sind legitim (der freie<br />
Markt)<br />
– Verfahrensgerechtigkeit<br />
- Niemand darf im Prozess der Leistungserbringung durch leistungsfremde<br />
Elemente behindert werden (Antidiskriminierungsgesetze, Quotierungen)<br />
– Startchancengleichheit<br />
- Unterschiede in den Startbedingungen sind zu minimieren<br />
(Vorschule, Erbschaftssteuer)<br />
– Ergebnisgerechtigkeit<br />
- Sind die Ergebnisse zu ungleich, soll der Staat umverteilen<br />
(progressive Besteuerung, Sozialhilfe)<br />
- Oft sogar als Gleichheitsprinzip (Gleichstellung der Geschlechter)<br />
• Dabei gibt es durchaus Zielkonflikte<br />
– Ergebnisgerechtigkeit reduziert die Leistungsgerechtigkeit<br />
– Die Sozialstaaten unterscheiden sich an diesem Zielkonflikt<br />
- Leistungsgerechtigkeit wichtiger: liberale Wohlfahrtsstaaten<br />
- Ergebnisgerechtigkeit wichtiger: sozialdemokratische Wohlfahrtsstaaten<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 138
KAPITEL 6: Soziale Ungleichheit<br />
Abschnitt: Dimensionen und Ursachen<br />
sozialer Ungleichheit<br />
– Bildung<br />
– Beschäftigung und Beruf<br />
– Einkommen und Vermögen<br />
– Gesundheit<br />
– Soziale Beziehungen<br />
– Die Kumulation sozialer Ungleichheit<br />
Josef <strong>Brüderl</strong><br />
<strong>Vorlesung</strong> <strong>Sozialstrukturanalyse</strong><br />
Bildung<br />
• Zentrale Ressource in einer „Wissensgesellschaft“<br />
– Bildung ist „Humankapital“ (Gary S. Becker)<br />
- Schulische und berufliche Bildung steigert die Produktivität<br />
- Der Erwerb von Bildung erfordert Investitionen (finanzielle<br />
Aufwendungen und physische Anstrengungen)<br />
- Der Ertrag von mehr Bildung sind ein besserer Job / höherer Lohn<br />
- Gegeben seine Kompetenzen und Restriktionen optimiert jeder<br />
Mensch den Umfang seiner Investitionen in Humankapital<br />
– Bildung ist „Kulturelles Kapital“ (Pierre Bourdieu)<br />
- Bildung verbessert die Möglichkeiten der gesellschaftlichen<br />
Partizipation<br />
• In meritokratischen Gesellschaften hat Bildung eine<br />
Schlüsselfunktion im Prozess der Statuszuweisung<br />
– Bildung hat eine „Sortierfunktion“ (M. Spence, L. Thurow)<br />
- Bildung dient nicht dem Erlernen produktivitätssteigernden Wissens<br />
- Bildungszertifikate sind „Signale“ bzgl. der unbekannten Produktivität<br />
eines Menschen und dienen deshalb der Sortierung auf die<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, verfügbaren WS 2011/12 Arbeitsplätze (Arbeitskräftewarteschlange) Folie 140
Die Bildungsexpansion<br />
• Ausbau der weiterführenden Schulen/Hochschulen ab 1970<br />
– Wandel der Berufsstruktur hin zu wissensintensiven Tätigkeiten<br />
– Geringe Bildungsbeteiligung im internationalen Vergleich<br />
- Georg Picht (1964) Die deutsche Bildungskatastrophe<br />
– Abbau der Bildungsungleichheit<br />
- Sprichwörtlich: Das katholische Arbeitermädchen vom Lande<br />
Höchster Bildungsabschluss westdeutscher Frauen<br />
Quelle: Thomas Klein:<br />
<strong>Sozialstrukturanalyse</strong>, S. 235<br />
Mikrozensus 2000<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 141<br />
• Vor dem 2. Weltkrieg<br />
Die Bildungsexpansion<br />
– 80% Volksschule, bei Männern oft mit beruflicher Ausbildung<br />
– Höhere Bildung die Ausnahme<br />
• Ab 1950: Expansion der beruflichen Ausbildung<br />
– Vor allem bei den Frauen<br />
• Ab 1970: Expansion Sekundarstufe II und Hochschule<br />
– Anteil nur mit Hauptschule sank von 80% (1950) auf unter 30%<br />
– 2008: 45% eines Altersjahrgangs mit (Fach-)Abitur (in BY nur<br />
35%!)<br />
– 2008: 26% mit Hochschulabschluss (Absolventenquote)<br />
- Prognose/Ziel: 40%<br />
• „Hartnäckiger“ Anteil ohne berufliche Bildung<br />
– Auch heute noch ca. 10% (insb. bei Migrationshintergrund)<br />
– Schlagworte: „Bildungsverweigerer“, „Bildungsarmut“<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 142
Bildungsungleichheit: Geschlecht<br />
• Früher (1950) hatten die Frauen weniger Bildung<br />
– 2/3 Frauen ohne berufliche Ausbildung, nur 1/3 der Männer<br />
– Nur ein Viertel der Abiturienten waren Frauen<br />
• Inzwischen haben die Frauen die Männer überholt<br />
- Abiturientenquote 2008: Männer 41%, Frauen 49%<br />
- Absolventenquote 2008: Männer 25%, Frauen 28%<br />
- Fächerwahl an der Hochschule ist noch ungleich (horizontale<br />
Ungleichheit)<br />
- 50% der Männer studieren Natur-/Ingenieurwiss., 20% der Frauen<br />
- Bei den Frauen dominieren die Geisteswissenschaften<br />
- Auch in der beruflichen Ausbildung gibt es horizontale Ungleichheiten<br />
- Männer: Gewerbe/Handwerk, Frauen: Büro/Dienstleistungen<br />
• Nur bei der post-tertiären Bildung führen noch die Männer<br />
– Frauenanteile 2006: Absolventen 51%, Promotionen 41%,<br />
Habilitation 22%, Professur 15% (HS, S. 147)<br />
– Aber die Frauenanteile steigen auch hier kontinuierlich, so dass<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, zumindest Sozialstruktur, WS eine 2011/12 Angleichung wahrscheinlich ist<br />
Folie 143<br />
Bildungsungleichheit: Geschlecht<br />
• Was sind die Mechanismen hinter diesen Ungleichheiten?<br />
– Früher gab es explizite Barrieren für Frauen<br />
- Bis vor hundert Jahren durften Frauen nicht auf die Uni<br />
- Die meisten Frauen waren Bäuerinnen/Mägde und Bildung „lohnte“<br />
nicht<br />
– Heute sind diese Barrieren verschwunden<br />
- Die Frauen haben auf allen Ebenen aufgeholt<br />
- Inzwischen haben sie bei vielen Abschlüssen sogar die Männer überholt<br />
- Die im Bildungssystem nötige Disziplin scheint eher „weiblich“ zu<br />
sein („Die Jungen-Katastrophe“)<br />
– Gibt es noch Barrieren im post-tertiären Bildungssystem?<br />
- Aus der Unterrepräsentanz der Frauen bei Habil/Professur wird häufig<br />
abgeleitet, dass es hier noch Barrieren/Diskriminierung gibt<br />
- Das ist aber ein Fehlschluss: Bestandszahlen (insbesondere bei der<br />
Professur) sind ein Resultat auch lange zurückliegender Prozesse<br />
- Die Übergangszahlen (Whs. eine Professur zu bekommen, wenn man<br />
sich bewirbt) sind heute für Frauen höher! (Diskriminierung der Männer!)<br />
- Die „Barriere“ ist, dass es sich bei der Professorenlaufbahn um einen<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, hoch-riskanten WS 2011/12 Prozess handelt. Frauen scheinen dieses Risiko zu Folie 144
Bildungsungleichheit: Ethnizität<br />
• Abiturientenquote (2000)<br />
– Migrantenkinder: 16,5%<br />
– Deutsche Kinder: 31,2%<br />
• Kompetenzen<br />
– Migrantenkinder (auch der<br />
2. Generation) erzielen<br />
bei PISA geringere Werte<br />
– Auch in<br />
Naturwissenschaft<br />
– Es können also nicht nur<br />
sprachliche Probleme<br />
sein<br />
• Differenziertere Analysen<br />
– Wenn man für Schicht<br />
kontrolliert, bleibt keine<br />
Ungleichheit<br />
– Nur bei den türkischen<br />
Kindern bleibt die<br />
geringere<br />
Bildungsbeteiligung<br />
– Grund: unklar!<br />
Quelle: Rostocker Zentrum (2011)<br />
„Deutschland im Demografischen Wandel“<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 145<br />
Bildungsungleichheit: Herkunft<br />
• Kinder höherer/bildungsnaher Herkunft haben mehr Bildung<br />
– Chancenverhältnis (Odds-Ratio) Akademiker/Nicht-Akademiker = 5,21<br />
– Achtung: häufig falsch interpretiert!<br />
- Die Whs. aufs Gymnasium zu gehen ist nicht 5-mal, sondern nur 1,8-mal so hoch!!<br />
[=<br />
<br />
<br />
<br />
]<br />
Quelle: Rostocker Zentrum (2011)<br />
„Deutschland im Demografischen Wandel“<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 146
Bildungsungleichheit: Herkunft<br />
• Was sind die Mechanismen hinter diesen Ungleichheiten?<br />
Daten: England 2002<br />
Übergang zur Sekundarstufe II<br />
von 16-jährigen<br />
Whs. Übergang:<br />
• Sal. 77%<br />
• Int. 55%<br />
• Work. 40%<br />
Odds-Ratio S/W = 5<br />
Quelle: Erikson et al.<br />
(2005) On class<br />
differentials in<br />
educational attainment.<br />
PNAS<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 147<br />
Bildungsungleichheit: Herkunft<br />
• Die Mechanismen hinter dem Effekt der Herkunft<br />
– Modell von Raymond Boudon (1974)<br />
- Primärer Effekt: Kinder höherer Schichten haben höhere Kompetenzen<br />
- Es gibt Kompetenzvererbung von Eltern auf Kinder<br />
- Die Möglichkeiten des frühkindlichen Kompetenzerwerbs sind in<br />
Elternhäusern höherer Schichten besser<br />
- Sekundärer Effekt: Eltern/Kinder aus höheren Schichten entscheiden<br />
sich bei gleicher Kompetenz eher für den Besuch einer höheren<br />
Schule<br />
- Lehrer geben Kindern höherer Schichten bessere Zensuren<br />
- Rationale Entscheidung: Humankapitalkalkül,<br />
Statuserhaltungsmotiv.<br />
• Ergebnisse von Erikson et al.<br />
– Primärer Effekt: deutliche Schichtunterschiede in den<br />
Kompetenzen<br />
– Sekundärer Effekt: insbesondere in der Mitte des<br />
Kompetenzranges haben Kinder höherer Schicht höhere<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, Übergangsraten WS 2011/12 Folie 148
Bildungsungleichheit eine „Benachteiligung“?<br />
• Achtung: Auf den folgenden Folien normative Diskussion!<br />
• Häufig wird im Zusammenhang mit Bildungsungleichheit<br />
von „Benachteiligung“ gesprochen<br />
– Die Frauen sind benachteiligt (also sind heute die Männer<br />
benachteiligt?), die Arbeiterkinder sind benachteiligt,<br />
die Migranten sind benachteiligt, etc.<br />
- Z.B. bei HS in Kap. 5.3.1 ständig, ebenso bei Klein Kap. 4.1.2.2<br />
– Das ist offensichtlich wertend, nur in welchem Sinne?<br />
- Will man damit sagen, dass irgendwelche „bösen Mächte“ (die Lehrer,<br />
die Männer, die Herrschenden, …?) diese Gruppe diskriminieren?<br />
- Oder will man damit nur die Ungleichheit skandalisieren?<br />
- Oder will man damit nur die geringere Bildungsbeteiligung benennen?<br />
– Vermutlich haben die meisten Autoren über diese Begrifflichkeit gar<br />
nicht richtig nachgedacht (typischer Soziologen-Sprech)<br />
– Fazit: diese Begrifflichkeit sollte man vermeiden!<br />
- Statt „die Bildungsbenachteiligung von Männern“,<br />
besser „die geringere Bildungsbeteiligung von Männern“<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 149<br />
„Chancengleichheit“ im Bildungssystem<br />
• „Chancengleichheit“ ist ein sehr vieldeutiger Begriff<br />
– Chancengleichheit i.S. von „Chancengerechtigkeit“<br />
- Unrealistische Forderung in Bezug auf die angeborenen Kompetenzen<br />
- Ungleiche Sozialisationsbedingungen im Elternhaus können<br />
ausgeglichen werden durch möglichst frühe Beschulung (s.u.)<br />
– Chancengleichheit i.S. von „Verfahrensgerechtigkeit“<br />
- Lehrer sollten in ihren Leistungsbeurteilungen unbeeinflusst von<br />
leistungsfremden Merkmalen der Schüler sein<br />
– Chancengleichheit i.S. von „Leistungsgerechtigkeit“<br />
- Das Bildungssystem soll die Schüler nach ihrer Leistung sortieren<br />
- Es ist dabei auf Verfahrensgerechtigkeit zu achten<br />
– Chancengleichheit i.S. von „Ergebnisgerechtigkeit“<br />
- Häufig als „proportionale Chancengleichheit“ operationalisiert<br />
- Z.B. Abiturientenquote jeder Gruppe soll gleich sein<br />
• Fazit: Der Begriff „Chancengleichheit“ ist unpräzise,<br />
vieldeutig und deshalb wenig hilfreich<br />
– Wenn man ihn dennoch verwendet, präzisieren, was gemeint ist<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 150
Hat die Bildungsexpansion die Chancengleichheit erhöht?<br />
• „Chancengleichheit“ soll hier verstanden werden als<br />
„proportionale Chancengleichheit“<br />
– Operationalisiert als: Odds-Ratio = 1 (Chancengleichheit)<br />
• Bzgl. Geschlecht, Stadt/Land, Ethnizität: Antwort ist „ja“<br />
– S. Klein S. 261f<br />
• Soziale Herkunft<br />
– In der Literatur heftig umstritten: Manche Autoren finden konstante<br />
Ungleichheit („persistent inequality“) andere abnehmende<br />
– Bsp. Studierendenanteil in Abhängigkeit von Beruf (Folie 148)<br />
Odds- Ratios 1985 2005<br />
Beamte/Arbeiter 40/60 / 10/90 = 6 60/40 / 20/80 = 6<br />
Angestellte/Arbeiter 30/70 / 10/90 = 3,86 40/60 / 20/80 = 2,67<br />
- Ergebnis offensichtlich von den betrachteten Gruppen abhängig!<br />
- Und: ist die proportionale Chancengleichheit überhaupt ein sinnvoller<br />
Maßstab, wenn angeborene Kompetenzen unterschiedlich sind (s.u.)?<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 151<br />
Soziale Gerechtigkeit im Bildungssystem<br />
• Das meritokratische Prinzip<br />
– Im Bildungssystem soll Leistungsgerechtigkeit dominieren<br />
– Angeborene Kompetenzunterschiede führen dann zu Ungleichheit<br />
• Sind Unterschiede zwischen Gruppen ungerecht?<br />
– Gleiche Kompetenzen zwischen den Gruppen: „ja“<br />
– Ungleiche Kompetenzen zwischen Gruppen: Bsp. soziale Herkunft<br />
- Odds-Ratio (Gymnasium) = 5 (s. Folie 148)<br />
- Hier (wie so oft) ohne Kontrolle der Kompetenzen<br />
- Mit Kontrolle der Kompetenzen wird die Odds-Ratio deutlich<br />
kleiner, da es Kompetenzunterschiede zwischen den Schichten<br />
gibt<br />
- Ist der primäre Effekt ungerecht? Nein, da in einer meritokratischen<br />
Gesellschaft unvermeidlich.<br />
- Ist der sekundäre Effekt ungerecht? Nein, da individuelle Entscheidung<br />
- Im Gegenteil: in einer funktionierenden meritokratischen Gesellschaft<br />
müssen die Odds-Ratios > 1 sein (primärer Effekt)<br />
- Die hohen Odds-Ratios Deutschlands sind also nicht Indiz für<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, soziale WS 2011/12 Ungerechtigkeit sondern für eine gut funktionierende Folie 152<br />
Meritokratie!
Investing in Our Young People<br />
• Reduktion primärer Effekte durch frühe Beschulung?<br />
– Die deutsche Kinderkrippe<br />
- Es gibt Studien, die zeigen, dass Kinder, die in eine Krippe gehen,<br />
später eher das Gymnasium besuchen<br />
- Aber dies ist eine „Scheinkorrelation“, da eher Kinder aus höheren<br />
Schichten eine Kinderkrippe besuchen<br />
- Kontrolliert man richtig, so zeigt sich kein Effekt<br />
- Andererseits scheint sie aber auch nicht groß zu schaden (nur<br />
wenn sehr früh (unter einem Jahr) und sehr lang (10+ Stunden))<br />
– Besondere Betreuung von Unterschicht-Kindern<br />
- Insbesondere bei Kindern aus unteren Schichten scheint<br />
hervorragende Betreuung (im Sinne einer Vorschule) zu helfen<br />
- Perry Preschool Experiment<br />
- Treatment im Alter 3-5: schwarze Unterschicht-Kinder, Vormittags<br />
Preschool, Nachmittags Besuch von Erziehern<br />
- Outcome: bessere Schulleistungen, bessere Jobs, weniger<br />
Kriminalität<br />
- „Rate of Return“ sehr hoch (höher als bei Programmen für<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 153<br />
Jugendliche!)<br />
Investing in Our Young People<br />
Quelle:<br />
Cunha/Heckman<br />
(2006) Investing in<br />
Our Young People.<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 154
Beschäftigung und Beruf<br />
• Die Einbindung in den Arbeitsmarkt ist heute für die<br />
meisten Menschen ein wichtiges Ziel (Arbeitsgesellschaft)<br />
– Arbeit ist zwar ein notwendiges Übel<br />
- Physisches und soziales Wohlbefinden davon abhängig<br />
– Immer öfter aber: Arbeit dient der Selbstverwirklichung<br />
– Arbeit ist heute die zentrale Dimension sozialer Ungleichheit<br />
• Der ausgeübte Beruf prägt die soziale Position<br />
– Zugang stark an Bildungszertifikate (Humankapital) gebunden<br />
- In Deutschland durch die berufliche Ausbildung und das<br />
Laufbahnsystem im öffentlichen Dienst besonders enge Koppelung<br />
- Insbesondere daraus ergibt sich die Bedeutung von<br />
Bildungsungleichheit<br />
– Physisches Wohlbefinden stark vom Beruf abhängig<br />
- Arbeitsbedingungen, Arbeitsplatzsicherheit, Alterssicherung,<br />
Einkommen<br />
– Soziales Wohlbefinden stark vom Beruf abhängig<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, - Berufsprestige, WS 2011/12 soziale Beziehungen<br />
Folie 155<br />
Erwerbsbeteiligung<br />
• ILO-Definitionen der Erwerbsbeteiligung<br />
Quelle: Rostocker Zentrum (2011)<br />
„Deutschland im Demografischen Wandel“<br />
– Verschiedene Quoten geben Auskunft über die Erwerbsbeteiligung<br />
- Erwerbsquote: Erwerbspersonen / Erwerbsbevölkerung 66%<br />
- Erwerbstätigenquote:<br />
Erwerbstätige / Erwerbsbevölkerung 61%<br />
- Erwerbslosenquote: Erwerbslose / Erwerbspersonen 7,7%<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 156
Arbeitslosigkeit<br />
• Arbeitslosigkeit ist eins der großen „sozialen Probleme“<br />
– Reduziert physisches, soziales und psychisches Wohlbefinden<br />
• Die BA hat ihre eigene Definition von Arbeitslosigkeit<br />
- Alle Erwerbslosen, die bei der BA arbeitslos gemeldet sind<br />
- Geringfügige Beschäftigung erlaubt (
Berufliche Stellung nach Geschlecht<br />
Männer<br />
Frauen<br />
• Arbeiter<br />
– Deutlicher<br />
Rückgang<br />
– Mehr Männer<br />
• Angestellte<br />
– Ausweitung<br />
insb. bei<br />
Frauen<br />
• Beamte<br />
– Ausweitung<br />
1970 (10% der<br />
Männer)<br />
• Selbständige<br />
– Rückgang bis<br />
1980 (parallel<br />
mithelf. Fam.<br />
angehörige)<br />
– Anstieg<br />
seitdem<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Quelle: Thomas Klein: <strong>Sozialstrukturanalyse</strong>, S. 286 Folie 159<br />
Erwerbstätigenquote von Männern und Frauen<br />
Quelle: Thomas Klein: <strong>Sozialstrukturanalyse</strong>, S. 307<br />
• Männer: deutlicher Rückgang in allen Altersbereichen<br />
– Längere Ausbildung, frühere Verrentung, höhere Arbeitslosigkeit<br />
• Frauen: deutlicher Anstieg im mittleren Alter<br />
– Trotz der längeren Ausbildung und der frühen Verrentung<br />
– Verbesserte Karriereperspektiven: Aufschub Familiengründung, erwerbstätige<br />
Mütter<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 160
Vereinbarkeit von Beruf und Familie<br />
Westdeutschland<br />
2005<br />
Ostdeutschland<br />
• Im Westen dominiert nach wie vor das „Ernährermodell“<br />
– Allerdings oft begrenzt auf sehr kleine Kinder (unter 3 Jahren)<br />
• Im Osten deutlich höhere Müttererwerbsquoten (mehr Vollzeit)<br />
– Gingen nach der Wende nicht auf Westniveau zurück<br />
– Bedingt durch den hohen Versorgungsgrad mit Krippen<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 161<br />
Einkommen und Vermögen<br />
• Einkommen ermöglicht unmittelbar die Erhöhung des<br />
physischen Wohlbefindens<br />
– Einkommensarten<br />
- Erwerbseinkommen<br />
- Aus nicht-selbständiger Arbeit<br />
- Aus Unternehmertätigkeit<br />
- Besitzeinkommen<br />
- Einkommen aus Vermögen: Vermietung, Zinsen, Dividenden<br />
- Transfereinkommen<br />
- Öffentliche Quelle: Kindergeld, Arbeitslosengeld, Sozialhilfe,<br />
Rente, etc.<br />
- Nicht-öffentliche Quelle: Unterhaltszahlung, Betriebsrente<br />
– Welche Analyseeinheit? Person oder Haushalt?<br />
- Persönliches Einkommen versus Haushaltseinkommen<br />
– Was ist für den Konsum verfügbar? Netto vom Brutto<br />
- Nettoeinkommen: Das Bruttoeinkommen<br />
- Minus: (direkte) Steuern und Sozialbeiträge<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, - Plus: WS Transfereinkommen<br />
2011/12 Folie 162
Äquivalenzeinkommen<br />
• Der Einkommensbegriff für Ungleichheitsanalysen<br />
– Haushaltsnettoeinkommen (idealerweise plus Besitzeinkommen)<br />
– Bedarfsgewichtung erforderlich<br />
- Versuch die ökonomischen Vorteile von größeren Haushalten abzubilden<br />
- Verschiedene solche „Äquivalenzskalen“ sind im Gebrauch<br />
Alte OECD-Skala Neue OECD-Skala<br />
1. Erwachsener 1 1<br />
Weitere Erwachsene 0,7 0,5<br />
Kinder unter 16 0,5 0,3<br />
- Beispiel: HH mit 3000 Euro netto, zwei Erwachsene, drei Kinder<br />
Bedarfsgewicht Äquivalenzeinkommen<br />
Pro-Kopf 5 600<br />
Alte OECD-Skala 1 + 0,7 + 3•0,5 = 3,2 938<br />
Neue OECD-Skala 1 + 0,5 + 3•0,3 = 2,4 1.250<br />
- Interpretation: Ein-Personen-HH mit 1.250 € hätte gleichen Wohlstand<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 163<br />
Einkommensungleichheit: die Lorenzkurve<br />
(Netto)Äquivalenzeinkommen Westdeutschland<br />
• Versch. Möglichkeiten der<br />
Darstellung von<br />
Einkommensungleichheit<br />
– Betrachtung der<br />
Einkommensverteilung<br />
- Z.B. HS Abb. 5.1<br />
– Anteile am gesamten<br />
Einkommen für bestimmte<br />
Bevölkerungsanteile<br />
- Quintil-, Dezilanteile<br />
- Tabellenform (K Tab. 4.3.1)<br />
- Unteres Dezil: 4%<br />
- Oberes Dezil: 22%<br />
- Kumuliert: Lorenzkurve<br />
- Je weiter die Kurve<br />
von der<br />
Gleichverteilungsdiago<br />
nale abweicht, desto<br />
Quelle: Klein, <strong>Sozialstrukturanalyse</strong>, S. 345<br />
größer ist die<br />
Ungleichheit<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 164
Vermögensungleichheit<br />
Lorenzkurven Nettovermögensverteilung, D 2003<br />
Quelle: Thomas Klein: <strong>Sozialstrukturanalyse</strong>, S. 357<br />
• Arten<br />
– Geldvermögen<br />
– Immobilien<br />
– Betriebsvermögen<br />
• Nettovermögen<br />
– Bruttovermögen<br />
minus<br />
Schulden<br />
• Deutschland 2003<br />
– West: 148 Tsd.<br />
– Ost: 59 Tsd.<br />
• Trend<br />
– Starker Anstieg<br />
• Ungleichheit<br />
– Höher wie beim<br />
Einkommen<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 165<br />
Maßzahl: Der Gini-Koeffizient<br />
• Der Gini-Koeffizient (G) ist definiert als<br />
– Fläche zwischen Gleichverteilungsdiagonale und Lorenzkurve<br />
dividiert durch<br />
Gesamtfläche unter der Gleichverteilungsdiagonale<br />
– Formel: z.B. bei Klein S. 345<br />
– G=0: Gleichverteilung<br />
– G=1: maximale Ungleichheit<br />
• Einkommen: West-Ost Unterschiede (2003)<br />
– West: G = 0,27<br />
– Ost: G = 0,23 (1990: G=0,19)<br />
• Internationaler Vergleich: D im Mittelfeld (2010: 0,30)<br />
– Geringer: skandinavische Länder (ca. 0,25)<br />
– Höher: Italien (0,34), GB (0,34), USA (0,38), Türkei (0,41)<br />
• Vermögensungleichheit 2003<br />
– West: G = 0,66 (1993: 0,63); Ost: G = 0,67 (1993: 0,72)<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 166
Hat die Ungleichheit in D zugenommen?<br />
Quelle: Thomas Klein: <strong>Sozialstrukturanalyse</strong>, S. 373<br />
• Entwicklung des Gini-Koeffizienten für das Nettoäquivalenzeinkommen<br />
– Die Ungleichheit steigt (leicht)<br />
– Im Osten ist die Ungleichheit niedriger, aber steilerer Anstieg (Angleichung?)<br />
• Die Ungleichheit der Markt(Brutto)äquivalenzeinkommen ist viel größer<br />
– Staatliche Umverteilung zugunsten von mehr Ergebnisgerechtigkeit wirkt<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 167<br />
Exkurs: Ungleichheitstrends im SOEP<br />
Quelle:<br />
SOEPnewsletter,<br />
93, 2011<br />
• Surveys sind die wichtigsten Datenquellen für Analysen zur<br />
Einkommensungleichheit und –armut (oft genutzt das SOEP)<br />
– Methodische Probleme von Surveys können die Ergebnisse beeinflussen<br />
– Z.B. Non-Response einzelner Haushaltsmitglieder (PUNR)<br />
- Deshalb ab 2008 neues Imputationsverfahren (auch rückwirkend)<br />
- Folge: geringere Ungleichheit, geringere Armutsquoten<br />
- Im Mai 2011 großer Aufruhr in der Öffentlichkeit („Panne“)<br />
- Dies ist jedoch keine „Panne“, sondern der wissenschaftliche Fortschritt<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 168
• Armutsdefinition<br />
Armut<br />
– Menschen, die nicht über genügend Mittel zum physischen<br />
Überleben verfügen, sind arm (physisches Existenzminimum)<br />
– Menschen sind arm, die über so geringe materielle, kulturelle und<br />
soziale Mittel verfügen, dass sie von der Lebensweise<br />
ausgeschlossen sind, die in dem Mitgliedsstaat, in dem sie leben,<br />
annehmbar ist (EU, 1984) (sozio-kulturelles Existenzminimum)<br />
– Meist wird aber nur die Dimension „Einkommen“ betrachtet<br />
• (Absolute) Armut<br />
– Bei globalen Analysen wird auf das physische Ex.min. abgestellt<br />
- Laut Weltbank: 1,25 US $ pro Tag (also etwa 1 €)<br />
- 2001: 21% der Weltbevölkerung sind arm<br />
– In D berechnet Destatis ein sozio-kulturelles Existenzminimum<br />
- 2008: 7140 € im Jahr, also etwa 600 € im Monat, oder 20 € Tag<br />
- Alternativ: Hartz-IV-Schwelle (ca. 700 €)<br />
- Anteil der Hartz-IV-Empfänger: 7,5% (Dez. 2011)<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 169<br />
Relative Armut<br />
• Armut als relative Benachteiligung in Bezug auf das mittlere<br />
Wohlstandsniveau in einer Gesellschaft<br />
– Arm ist, wer weniger als einen bestimmten Anteil<br />
des Median-Netto-Äquivalenzeinkommens hat<br />
- Weniger als 60%: armutsgefährdet<br />
- Weniger als 50%: relativ arm<br />
- Weniger als 40%: arm<br />
– Meist wird die 60%-Quote berichtet<br />
Armutsschwellen<br />
für 2010<br />
Median 1.380 €<br />
60% 830 €<br />
50% 690 €<br />
40% 550 €<br />
Durchschnittseinkommen:<br />
1600 Euro (Median)<br />
50% des Durchschnitts:<br />
800 Euro<br />
Anteil der Armen in der<br />
Bevölkerung<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 170
Relative Armut<br />
• Trend: Armutsgefährdung gestiegen<br />
1990 1995 2000 2005 2010<br />
60%-Quote 11,3 11,4 11,3 14,7 14,5<br />
1990-2000: SOEP (HS, S. 124)<br />
2005-2010: Mikrozensus (Destatis)<br />
• Probleme der relativen Armutsmessung<br />
– Relative Quoten sind eher ein Maß der Ungleichheit<br />
relative Armut lässt sich nur verringern, wenn die<br />
Einkommensverteilung gleicher wird<br />
– Armutsparadoxon I<br />
- Ein allgemeiner Wohlstandsanstieg (z.B. alle 10% mehr) verringert die<br />
relative Armut nicht<br />
– Armutsparadoxon II<br />
- Absolut ärmere Gesellschaften mit relativ gleicher<br />
Einkommensverteilung haben geringere relative Armut<br />
- Z.B. gibt es in Tschechien weniger Arme (2008: 9%), als in D (2008:<br />
15%)<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 171<br />
Komplexere Armutskonzepte<br />
Armut<br />
materielle<br />
soziale<br />
Gesundheit<br />
Bildung<br />
Einkommen<br />
Wohnistuation<br />
Ausstattung<br />
soziale Kontakte<br />
chronische<br />
Krankheiten<br />
Ausbildungsniveau<br />
arm ist, wer...<br />
arm ist wer...<br />
arm ist wer...<br />
arm ist wer...<br />
• Einkommensarmut ist nur eine Dimension von Armut<br />
– Deshalb wir manchmal versucht, weitere Dimensionen einzubeziehen<br />
– Allerdings ist dann eine komplexe Indexbildung erforderlich<br />
• Versorgungsbezogene Armut (Klein, S. 358 ff)<br />
– Die bisherigen Ansätze konzentrieren sich auf die „Ressourcenarmut“<br />
– Entscheidend ist letztendlich aber die Versorgung mit für das<br />
Wohlbefinden wichtigen Gütern und Dienstleistungen<br />
– Aber schwierig festzulegende Armutsgrenzen (z.B. mind. 3000<br />
Kalorien)<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 172
Einkommensunterschiede nach Geschlecht<br />
• Frauen verdienen in D ca. 75% des Männer-Einkommens<br />
– Diese „Lohnlücke“ wird häufig als Lohndiskriminierung interpretiert<br />
- Verletzung des Prinzips „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“<br />
– Das ist aber eine Fehlinterpretation: denn Frauen arbeiten häufiger<br />
Teilzeit und in Berufen/Branchen mit geringerem Lohn<br />
(Segregation)<br />
- 1. Ursache der Lohnlücke: „Frauenberufe“ werden geringer entlohnt<br />
– Kontrolliert man für diese Unterschiede, so bleibt noch eine<br />
„Lohnlücke“ von ca. 10% in der „Job-Zelle“ (Hinz/Gartner 2005)<br />
- 2. Ursache: direkte Lohndiskriminierung in der „Job-Zelle“<br />
– Diese Lohnlücke ist aber zu einem großen Teil darauf zurückzuführen,<br />
dass Männer eher auf den oberen Hierarchieebenen sind<br />
- 3. Ursache: Frauen werden bei Beförderungen diskriminiert<br />
- 4. Ursache: Frauen streben seltener nach höheren<br />
Hierarchiepositionen<br />
– Es gibt empirische Evidenz für alle vier Ursachen. In welchem<br />
Ausmaß sie zur „Lohnlücke“ beitragen, ist noch unklar<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 173<br />
Gesundheit<br />
• Auch Gesundheit ist ungleich verteilt<br />
– Schlechtere Gesundheit manifestiert sich in höherer Mortalität /<br />
kürzerer Lebenserwartung (Ungleichheit der „finalen“ Art)<br />
– Ursachen ungleicher Gesundheit<br />
- Es gibt biologische Unterschiede zwischen den Menschen<br />
- Aber auch zahlreiche soziale „Korrelate“<br />
- Gebildete Menschen leben länger<br />
- Reiche Menschen leben länger<br />
- Verheiratete Menschen leben länger<br />
– Mechanismen<br />
- Ungleicher Zugang zu medizinischer Versorgung: in D eher kein<br />
Problem<br />
- Ungleiche Belastungen („exposure“)<br />
- Durch ungesünderen Lebensstil und ungesündere<br />
Lebensbedingungen<br />
- Selektion der Gesünderen in bessere soziale Positionen<br />
- „Barrieren“ für kränkliche Menschen auf dem Weg nach „oben“<br />
- Exposure und Selektion tragen je zu 50% bei (Conti/Heckman/Urzua,<br />
2010, AER (PaP))<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 174
Quelle: P. Bernau (2011)<br />
Sieben Gründe, warum<br />
Arme früher sterben.<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 FAZ-net. Folie 175<br />
Frauen leben länger<br />
Quelle: Rostocker Zentrum (2011)<br />
„Deutschland im Demografischen<br />
Wandel“; Luy (2003)<br />
• Männer leben ca. 5 Jahre<br />
kürzer<br />
– Männer sind das „final“<br />
benachteiligte Geschlecht!<br />
– Es gibt biologische Ursachen<br />
(genetisch, hormonell)<br />
– Wichtiger jedoch sind „soziale“<br />
Ursachen<br />
- Männer: mehr (Arbeits-)Unfälle,<br />
mehr Stress, mehr Selbstmord,<br />
schlechteres<br />
Gesundheitsverhalten<br />
– Beweis: Mönche leben fast so<br />
lange wie Nonnen<br />
– Jedoch der Überlebensvorteil<br />
der Frauen reduziert sich<br />
- Mehr Rauchen<br />
- Höhere Erwerbstätigkeit: mehr<br />
Arbeitsstress<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 176
Soziale Beziehungen<br />
• Beziehungen zu anderen Menschen sind „soziales Kapital“<br />
– Um Beziehungen anzubahnen und aufrecht zu erhalten bedarf es<br />
eines Aufwandes (Investitionen) (selbst in der Familie)<br />
– Dafür erhält man durch Beziehungen soziales Wohlbefinden<br />
(Anerkennung) und auch Ressourcen (Informationen, Güter,<br />
Handlungsmöglichkeiten („Vitamin B“))<br />
– Altruismus (Familienbeziehungen) und Reziprozität sind<br />
Handlungsmotive<br />
• Soziale Beziehungen sind ungleich verteilt<br />
– Die soziale Position des Elternhauses bestimmt die Menge an<br />
aktivierbaren Ressourcen (Effekte der sozialen Herkunft)<br />
– Ärmere Menschen haben weniger über die Familie hinausgehende<br />
soziale Beziehungen und können damit auf weniger soziales<br />
Kapital zurückgreifen<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 177<br />
Die Kumulation sozialer Ungleichheit<br />
• Wie hoch ist die Korrelation der Dimensionen?<br />
– Statusinkonsistenz: geringe Korrelation<br />
- Bsp.: der reiche Unternehmer mit nur Hauptschule<br />
– Statuskonsistenz: hohe Korrelation<br />
- Bsp.: Frau Dr. aus gutem Hause mit reichem Ehemann<br />
• In den meisten Gesellschaften sind die Korrelationen hoch<br />
Statuskonsistenz; Kumulation sozialer Ungleichheit<br />
– Matthäus-Prinzip:<br />
„Denn wer hat, dem wird gegeben, und er wird im Überfluss haben;<br />
wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er<br />
hat“<br />
- Bsp.: Kinder aus höheren Schichten erreichen eher höhere Bildung,<br />
besseren Beruf und höheres Einkommen und heiraten homogam<br />
– Manchmal aber auch „Kompensationsprinzip“: Nachteile auf einer<br />
Dimension werden durch Vorteile auf einer anderen ausgeglichen<br />
- Bsp.: höhere Löhne für schlechte Arbeitsbedingungen<br />
(kompensierende Lohndifferentiale)<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 178
KAPITEL 6: Soziale Ungleichheit<br />
Abschnitt: Theorien sozialer Ungleichheit<br />
Josef <strong>Brüderl</strong><br />
<strong>Vorlesung</strong> <strong>Sozialstrukturanalyse</strong><br />
Theorien sozialer Ungleichheit<br />
• Auch bisher schon öfter Theorie: „Mechanismen“<br />
– Die hier vorgestellten Theorien haben einen allgemeineren<br />
Erklärungsanspruch<br />
– Um es gleich vorwegzunehmen: dieser allgemeine Erklärungsanspruch<br />
kann nicht eingelöst werden. Deshalb favorisieren heute<br />
viele Sozialforscher Erklärungen mittels spezifischer Mechanismen<br />
• Marxistische Theorie (Marx/Engels, ca. 1860)<br />
– Ungleichheit entsteht durch Besitz bzw. nicht-Besitz von<br />
Produktionsmitteln (Kapitalisten, Proletarier)<br />
- Die Proletarier werden von den Kapitalisten ausgebeutet<br />
- Alle Dimensionen der Ungleichheit dadurch geprägt<br />
- Sogar das Bewusstsein ist klassenspezifisch<br />
– Kritik: völlig verkürzter Ansatz<br />
- Die 90% nicht-Besitzenden unterscheiden sich erheblich<br />
- Nicht nur ökonomisches, auch soziales und kulturelles Kapital<br />
begründet Ungleichheit (Pierre Bourdieu, 1982)<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 180
Funktionalistische Theorie<br />
• Grundlegende Argumentation (Davis/Moore, 1945)<br />
– (Berufliche) Positionen unterscheiden sich nach ihrer Wichtigkeit<br />
für das System (die Gesellschaft)<br />
– Auf den wichtigsten Positionen sollen die talentiertesten/<br />
bestausgebildeten Personen sein<br />
– Talent ist knapp und gute Ausbildung erfordert Anstrengungen<br />
– Um die Besten dazu zu motivieren, diese Anstrengungen auf sich<br />
zu nehmen, müssen die Belohnungen (Lohn und soziale<br />
Anerkennung) auf den wichtigen Positionen hoch sein<br />
– Ungleichheit ist somit eine funktionale Notwendigkeit<br />
• Kritik<br />
– Grundlegendes Problem: funktionale Äquivalente können nicht<br />
ausgeschlossen werden (nicht nur Ungleichheit kann die<br />
Menschen motivieren)<br />
– Reiner Makroansatz: das „System“ handelt hier<br />
– Die Wichtigkeit kann nicht a-priori bestimmt werden, sondern nur<br />
ex-post durch die höhere Belohnung<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 181<br />
Markttheoretischer Ansatz<br />
• Grundlegende Argumentation (zuerst: Adam Smith 1776)<br />
– Die Belohnung einer Position richtet sich nach dem Verhältnis von<br />
Angebot und Nachfrage auf dem Markt<br />
– Belohnung kann auch immateriell oder symbolisch sein<br />
- Gute Arbeitsbedingungen, Ansehen, Ruhm<br />
– Soziale Ungleichheit resultiert aus unterschiedlichen „Marktwerten“<br />
- Auch die Bildungsinvestitionen richten sich danach (Humankapital)<br />
• Kritik<br />
– Institutionelle Regelungen können das Marktergebnis verzerren<br />
- Zugangsbarrieren können ein Monopol und damit hohe Renten<br />
schaffen<br />
- „Kartellbildung“ kann zu hohen Renten führen (Bsp. Managergehälter)<br />
– Der freie Markt ist im Bereich Bildung und Berufe eher die<br />
Ausnahme. Hier gibt es historisch bedingte Pfadabhängigkeiten.<br />
– Die Effekte unterschiedlicher Startbedingungen (soziale Herkunft)<br />
werden eher unterbelichtet<br />
– Die Effekte sozialer Beziehungen sind ebenfalls unterbelichtet<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 182
KAPITEL 6: Soziale Ungleichheit<br />
Abschnitt: Strukturen sozialer<br />
Ungleichheit<br />
Josef <strong>Brüderl</strong><br />
<strong>Vorlesung</strong> <strong>Sozialstrukturanalyse</strong><br />
Klassen und Schichten<br />
• Soziologen teilen die Bevölkerung gern in Gruppen ein, die<br />
von unten nach oben hierarchisch geordnet sind<br />
– Man spricht von „Schichten“ (oder „Klassen“)<br />
- Die Unterscheidung ist unklar. Am ehesten noch: Wenn nach<br />
ökonomischen Kriterien geschichtet wird, dann spricht man von<br />
„Klassen“. Mit dem Begriff „Klassen“ will man auch betonen, dass es<br />
Konflikte zwischen den Gruppen gibt.<br />
– Innerhalb der Schichten ist die Lebenslage der Menschen ähnlich<br />
- Mitglieder einer Schicht haben auf den Ungleichheitsdimensionen eine<br />
ähnliche Position<br />
- Ihre Lebenschancen sind durch die Schichtmitgliedschaft bestimmt<br />
- Die Schicht beeinflusst Denken und Interessen und somit das<br />
Verhalten<br />
- Es entwickelt sich ein Bewusstsein für die Soziallage<br />
(Klassenbewusstsein bei Marx, Klassen-Habitus bei Bourdieu)<br />
– Schichtmodelle müssen folgenden Bedingungen genügen<br />
- Homogenität: innerhalb der Schichten kaum Varianz der Lebenslage<br />
- Unterscheidbarkeit: zwischen den Schichten viel Varianz der<br />
Lebenslage<br />
- Hierarchie: die Schichten lassen sich eindeutig ordnen<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 184
Schicht- und Klassenmodelle<br />
• Schichtmodelle heute eher selten<br />
– Klassisch (Scheuch/Daheim, 1961): Bildung, Einkommen und<br />
Beruf wird zu Schichten verrechnet<br />
- Das macht man heute nur noch selten. Die drei Dimensionen werden<br />
besser einzeln in Analysen berücksichtigt<br />
– Subjektive Schichteinstufung: Unter-, Mittel-, Oberschicht<br />
• Klassenmodelle<br />
– Marx: einziges Kriterium ist Produktionsmittelbesitz<br />
- Proletarier, Kleinbürger, Kapitalisten<br />
– Wright: Produktionsmittelbesitz, Organisationsmacht, Qualifikation<br />
- 3 Besitzer Klassen, 9 Nicht-Besitzer<br />
– Erikson, Goldthorpe, Portocarero (EGP-Klassen, 1979)<br />
- Arbeitgeber, Selbständige, Arbeitnehmer (noch differenziert nach<br />
Qualifikation und Position in der betrieblichen Hierarchie)<br />
- 10 Klassen (zusammenfassbar in 7, 5, oder 3)<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 185<br />
Kritik der Schichtmodelle<br />
• Innerhalb der Schichten ist die Varianz der Lebenslagen<br />
inzwischen zu groß. Eine hierarchische Ordnung ist auch<br />
nicht mehr sinnvoll.<br />
– Lebenslagenkonzept: man muss genauer auf die Lebenslagen der<br />
Menschen abstellen sehr differenzierte, nicht-hierarchische<br />
soziale Lagen<br />
– Milieus: man muss anhand der Lebensstile gruppieren<br />
– Individualisierung (Beck, 1983): jede Form der Gruppierung in<br />
modernen Gesellschaften ist zum Scheitern verurteilt<br />
• Vorgehen in Ungleichheitsanalysen heute<br />
– Die meisten Autoren verwenden keine Schicht- oder<br />
Klassenmodelle, sondern die einzelnen Dimensionen: Bildung,<br />
Einkommen, berufliche Stellung, Prestige, hierarchische Position<br />
– Wenn doch, dann wird am häufigsten das EGP-Schema eingesetzt<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 186
Bildungs-Skalen<br />
CASMIN<br />
• 1a: kein Abschluss<br />
• 1b: Hauptschulabschluss ohne<br />
berufliche Ausbildung<br />
• 1c: Hauptschulabschluss und<br />
berufliche Ausbildung<br />
• 2b: Mittlere Reife ohne berufliche<br />
Ausbildung<br />
• 2a: Mittlere Reife und berufliche<br />
Ausbildung<br />
• 2c_gen: Fachhochschulreife/Abitur<br />
ohne berufliche Ausbildung<br />
• 2c_voc: Fachhochschulreife/Abitur<br />
und berufliche Ausbildung<br />
• 3a: Fachhochschulabschluss<br />
• 3b: Hochschulabschluss<br />
ISCED<br />
• Level 0: pre-primary education<br />
(Vorschule)<br />
• Level 1: primary education<br />
(Grundschule)<br />
• Level 2: secondary education first<br />
stage (Hauptschule, Realschule)<br />
• Level 3: secondary education<br />
second stage (Abitur,<br />
Berufsausbildung)<br />
• Level 4: post secondary education<br />
(z.B. Fachoberschulen)<br />
• Level 5: tertiary education first<br />
stage (FH- und Uni-Abschlüsse)<br />
• Level 6: tertiary education second<br />
stage (Forschungsqualifikation)<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 187<br />
Berufsprestige<br />
• SIOPS: Standard International Occupational Prestige Scale<br />
– Grundlage: Umfragedaten aus 50 Ländern für über 500 Berufe.<br />
– Minimum: 14 Maximum: 78<br />
• ISEI: International Socio-Economic Index of occ. status<br />
– Basiert auf Bildung und Einkommen. Daten von 70 Tsd. Männern.<br />
– Minimum: 10 Maximum: 90<br />
Beispiele: SIOPS ISEI<br />
Apotheker: 64 81<br />
Ärzte: 78 88<br />
Statistiker: 55 71<br />
Lagerverwalter: 30 35<br />
Soziologen: 68 72<br />
Richter: 76 90<br />
Parlamentarier: 64 73<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 188
KAPITEL 6: Soziale Ungleichheit<br />
Abschnitt: Soziale Mobilität<br />
Josef <strong>Brüderl</strong><br />
<strong>Vorlesung</strong> <strong>Sozialstrukturanalyse</strong><br />
Soziale Mobilität<br />
• Veränderung auf Dimensionen der sozialen Ungleichheit<br />
– Bildungs-, Berufs-, Einkommensmobilität<br />
– Intragenerationale Mobilität<br />
- Veränderung im Lebenslauf eines Menschen<br />
- Bsp.: beruflicher Aufstieg<br />
– Intergenerationale Mobilität<br />
- Veränderung zwischen den Generationen<br />
- Bsp.: Bildung der Eltern und Bildung der Kinder<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 190
Status-Attainment-Modell<br />
• Wie kommt man zu seinem sozio-ökonomischen Status?<br />
– Klassiker:<br />
Blau / Duncan (1967) „The American Occupational Structure“<br />
– Durch Vererbung? (Ständegesellschaft)<br />
- Bildung und Beruf des Vaters (V)<br />
– Oder durch eigene Leistung? (Meritokratie)<br />
- Bildung und Beruf Sohn (S)<br />
• Ergebnisse (s. nächste Folie)<br />
– Die Pfeile bedeuten, dass es einen gerichteten Effekt gibt<br />
– Die Zahlen geben Richtung und Stärke des Effektes an<br />
– Bildung V hat starken Effekt (.31) auf Bildung S (Bildungsvererbung)<br />
– Beruf V hat schwächeren Effekt (.22) als Bildung S (.44) auf den<br />
Einstiegsberuf S (eigene Leistung wichtiger als Herkunft)<br />
– Effekt Beruf V ist noch schwächer (.12) auf den Zielberuf<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 191<br />
Status-Attainment-Modell: Blau/Duncan 1967<br />
Quelle: Blau/Duncan 1967:<br />
170, entnommen (und<br />
Übersetzung) aus Groß<br />
2008: 128.<br />
Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 192