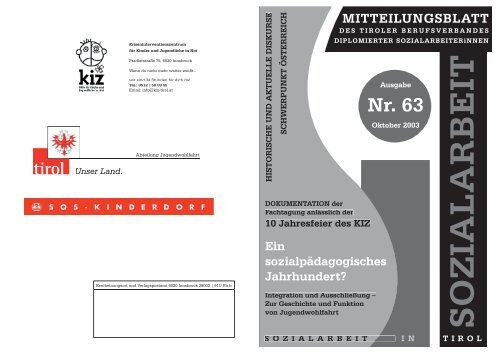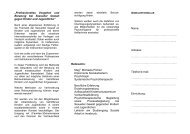Tagungsdokumentation - KIZ
Tagungsdokumentation - KIZ
Tagungsdokumentation - KIZ
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Unser Land.<br />
Kriseninterventionszentrum<br />
für Kinder und Jugendliche in Not<br />
Pradlerstraße 75, 6020 Innsbruck<br />
Wenn du nicht mehr weiter weißt...<br />
wir sind 24 Stunden für dich da!<br />
Tel.: 0512 / 58 00 59<br />
Email: info@kiz-tirol.at<br />
Abteilung Jugendwohlfahrt<br />
Erscheinungsort und Verlagspostamt 6020 Innsbruck 26003 | 91U P.b.b.<br />
HISTORISCHE UND AKTUELLE DISKURSE<br />
SCHWERPUNKT ÖSTERREICH<br />
DOKUMENTATION der<br />
Fachtagung anlässlich der<br />
10 Jahresfeier des <strong>KIZ</strong><br />
Ein<br />
sozialpädagogisches<br />
Jahrhundert?<br />
Integration und Ausschließung –<br />
Zur Geschichte und Funktion<br />
von Jugendwohlfahrt<br />
MITTEILUNGSBLATT<br />
D E S T I R O L E R B E R U F S V E R B A N D E S<br />
DIPLOMIERTER SOZIALARBEITERiNNEN<br />
Ausgabe<br />
Nr. 63<br />
Oktober 2003<br />
SOZIALARBEIT<br />
S O Z I A L A R B E I T I N T I R O L
Tagungsprogramm<br />
Tagungsprogramm der Fachtagung anlässlich der 10 Jahresfeier des <strong>KIZ</strong><br />
04inhalt<br />
Einleitung 05<br />
„Ein sozialpädagogisches Jahrhundert ?<br />
Integration und Ausschließung Zur Geschichte und Funktion von Jugendwohlfahrt“<br />
historische und aktuelle diskurse<br />
04inhalt 05inhalt<br />
Martin Guse 06<br />
„Wir hatten noch gar nicht angefangen zu leben“ Eröffnungsbeitrag zur Ausstellung<br />
Manfred Kappeler 16<br />
Im Zeichen der „Hilfe“ Wiedersprüche und Ambivalenzen der Sozialen Arbeit<br />
erläutert an Beispielen aus Geschichte und Gegenwart<br />
Michael Lindenberg 31<br />
Von der Heimreform zur Heimrestauration:<br />
Das Beispiel der geschlossenen Unterbringung in den Jugendhilfe<br />
Helga Cremer-Schäfer 39<br />
Die „gefährliche und gefährdete Jugend“.<br />
Über öffentliche Debatten und was wir zu beachten haben,<br />
wenn sie gerade nicht stattfinden.<br />
Impressum<br />
SIT - Mitteilungsblatt des<br />
Tiroler Berufsverbandes Diplomierter SozialarbeiterInnen.<br />
Medieninhaber, Herausgeber, Redaktion:<br />
Tiroler Berufsverband Diplomierter SozialarbeiterInnen,<br />
6021 Innsbruck, Postfach 775<br />
Satz, Layout: ALMEX print&web design<br />
6330 Kufstein (Alexander Horejs),<br />
www.almex.at<br />
Herstellung: artis-Betriebe<br />
Erscheinungsort und Verlagspostamt:<br />
6020 Innsbruck<br />
Claudia Wallner 53<br />
Mädchenarbeit im Wandel sozialer Arbeit<br />
Andreas Schaarschuch 64<br />
Soziale Dienstleistung im Sozialstaat<br />
schwerpunkt österreich<br />
Josef Scheipl 73<br />
Jugendwohlfahrt in Österreich<br />
Historische Entwicklungslinien, aktuelle Zielsetzungen<br />
Hermann Putzhuber 83<br />
JU-Quest: ExpertInnenbefragungen zu Entwicklungen in der<br />
Jugendwohlfahrt Projektpräsentation<br />
SIT . Nr.63 . 03
tagungsprogramm<br />
Mittwoch, 9.04.2003<br />
Historische und aktuelle Diskurse<br />
9:00 Begrüßung, Eröffnungsworte<br />
LR Christa Gangl, Landesrätin für Soziales<br />
und Jugendwohlfahrt<br />
HR Dr. Manfred Weber, Amt der Tiroler Landesregierung,<br />
Abt. Jugendwohlfahrt<br />
Dr. Christian Posch, SOS-Kinderdorf, Fachbereich<br />
Pädagogik<br />
Dr. Brigitte Hackenberg, Obfrau des <strong>KIZ</strong><br />
9.30 Manfred Kappeler, TU-Berlin, Institut für<br />
Sozialpädagogik<br />
Im Zeichen der “Hilfe” - Widersprüche und<br />
Ambivalenzen der Sozialen<br />
Arbeit erläutert an Beispielen aus Geschichte<br />
und Gegenwart<br />
Anschließend Möglichkeit für Fragen<br />
10.30 Pause<br />
11.00 Michael Lindenberg, Evang. FH für Sozialpädagogik<br />
Rauhes Haus, Hamburg<br />
Revolte im Erziehungsheim, Bambule oder<br />
Qualitätssicherung?<br />
Zur Entwicklung und Funktion von<br />
Jugendhilfe/Jugendwohlfahrt<br />
zwischen Integration und Ausschließung<br />
Anschließend Möglichkeit für Fragen<br />
12.30 Mittagspause<br />
Nachmittag Schwerpunkt Österreich<br />
14.00 Josef Scheipl, UNI Graz,<br />
Erziehungswissenschaften<br />
Jugendwohlfahrt in Österreich. Historische<br />
Entwicklungslinien, aktuelle Zielsetzungen<br />
Anschließend Möglichkeit für Fragen<br />
15.00 Pause<br />
15.10 Hermann Putzhuber, SOS Kinderdorf,<br />
Soz.-Päd. Institut<br />
Präsentation: JU-QUEST-ExpertInnenbefragung<br />
zu Entwicklungen<br />
in der österreichischen Jungendwohlfahrt<br />
15.30 Pause<br />
ab 16.00 in der Osteria – Eintritt frei<br />
Erzählcafe: Aufbruch in der Jugendsozialarbeit<br />
während der 70er-Jahre<br />
In den 70ern hat sich in der Sozialarbeit mit<br />
Jugendlichen viel getan. Neue Einrichtungen<br />
sind entstanden, etablierte haben sich gewandelt.<br />
Die Teil-nehmerInnen diskutieren unter<br />
Einbeziehung des Publikums über damals und<br />
die Folgen des Aufbruchs.<br />
04<br />
. Nr.63 . SIT<br />
Donnerstag 10.4.2003<br />
Aktuelle Diskurse<br />
9.15 Begrüßung und Tagesüberblick<br />
9.30 Helga Cremer-Schäfer, UNI Frankfurt, Erziehungswissenschaften<br />
Gefährliche und gefährdete Jugend?<br />
Anschließend Möglichkeit für Fragen<br />
10.30 Pause<br />
11.00 Claudia Wallner, Referentin für Mädchenarbeit<br />
und Mädchenpolitik in Münster<br />
Mädchenarbeit im Wandel Sozialer Arbeit<br />
Anschließend Möglichkeit für Fragen<br />
12.30 Mittagspause<br />
14.00 Andreas Schaarschuch, UNI Wuppertal,<br />
Erziehungswissenschaften<br />
Soziale Dienstleistungen im Sozialstaat?<br />
Anschließend Möglichkeit für Fragen<br />
15.00 Pause<br />
15.30 Moderiertes ExpertInnengespräch<br />
Helga Cremer-Schäfer, Manfred Kappeler, Michael<br />
Lindenberg, Andreas Schaarschuch, Josef<br />
Scheipl, Claudia Wallner.<br />
Die Vortragenden der Tagung diskutieren<br />
Möglichkeiten und<br />
Zukunftsperspektiven. Publikumsbeteiligung<br />
erwünscht.<br />
17.00 Abschluss<br />
Zusätzlich zu dieser Tagung findet die Ausstellung<br />
“Wir hatten noch gar nicht angefangen zu<br />
leben”<br />
über die Jugendkonzentrationslager in Moringen<br />
(Jungen) und<br />
in der Uckermark (Mädchen), Deutschland<br />
statt.<br />
Eröffnet wird diese Ausstellung am Dienstag<br />
den 8.4.03 um 19.30 Uhr im Foyer des Haus der<br />
Begegnung (Innsbruck) mit einem einleitenden<br />
Vortrag von Martin Guse.<br />
Die Wanderausstellung bleibt 3 Wochen im<br />
Haus der Begegnung, Eintritt frei.<br />
Nähere Infos unter www.martinguse.de<br />
„ Ein sozialpädagogisches Jahrhundert ?<br />
Integration und Ausschließung<br />
Zur Geschichte und Funktion von Jugendwohlfahrt“<br />
Soziale Arbeit in westlichen Wohlfahrtsstaaten<br />
erfüllt ihren gesellschaftspolitischen Auftrag,<br />
indem sie das vorhandene materielle Sicherungssystem,<br />
das Gesundheitswesen, das<br />
Erziehungssystem und den staatlichen Justizapparat<br />
ergänzt oder teilweise ersetzt und<br />
diejenigen, die darin zu KlientInnen werden,<br />
resozialisiert, rehabilitiert und reintegriert.<br />
Wie es einerseits Tatsache ist, dass jeglichen<br />
Integrationsversuchen die Ausgrenzung bestimmter<br />
Personengruppen immanent ist und<br />
es ebenso geschieht, dass manche nicht oder<br />
nicht in der Form integriert werden wollen,<br />
wie es für sie vorgesehen wäre, bedarf es einer<br />
Auseinandersetzung damit, dass Soziale<br />
Arbeit nicht nur Grenzen „verwaltet“, sondern<br />
sie auch selbst schafft, verschiebt und neu<br />
zieht. Da im Rahmen der Jugendwohlfahrt Soziale<br />
Arbeit häufig nur statisch von Institutionen<br />
– Familie, Schule, Staat - aus gedacht wird,<br />
bleibt sie oft blind gegenüber deren politischen,<br />
kulturellen, ideologischen, moralischen und<br />
ökonomischen Voraussetzungen, was bewirkt,<br />
daß Jugendliche, die durch diese Institutionen<br />
in ihrer psychischen und physischen Integrität<br />
gefährdet werden, nur als Teenager betrachtet<br />
werden können, die das soziale System in<br />
seinem Funktionieren gefährden und somit in<br />
weiterer Folge behandelt werden müssen. Erziehungsverhältnisse<br />
wirken auf Soziale Arbeit,<br />
indem sie bestimmte Handlungsmöglichkeiten<br />
zulassen und andere ausschließen, die einen<br />
privilegieren, die anderen marginalisieren. Auf<br />
Mädchen/Frauen und Jungen/Männern wirken<br />
sich diese gewalt-tätigen Verhältnisse unterschiedlich<br />
diskriminierend aus.<br />
Die Fachtagung nahm zum einen diese jugendlichen<br />
Männer und Frauen als diejenigen, auf<br />
die Soziale Arbeit in Form der Jugendwohlfahrt<br />
ausgerichtet ist, ins Blickfeld und zum zweiten<br />
die Entwicklung von Institutionen, die sich helfend,<br />
strafend, disziplinierend, kontrollierend<br />
und begleitend mit Jugend (lichen) befassen.<br />
Die einzelnen Vorträge von ExpertInnen aus<br />
dem Schnittfeld Wissenschaft und sozialpädagogischer<br />
Praxis und die abschließende<br />
gemeinsame (Podiums-) Diskussion dieser<br />
haben aus unterschiedlichen Perspektiven das<br />
Spannungsfeld von Integration und Ausschlie-<br />
ßung, in dem sich Jugendwohlfahrt bewegt,<br />
beleuchtet und mögliche Wege und Unwege<br />
für die Zukunft angedacht.<br />
Ergänzt wurden die Vorträge durch ein Erzähl-<br />
cafe mit dem Titel „ Aufbruch in der Jugendso-<br />
zialarbeit während der 70er Jahre“, an dem 18<br />
Personen, die auf unterschiedliche Weise mit<br />
der sozialen Jugendarbeit in Innsbruck/Tirol<br />
verbunden sind, teilnahmen. Mit diesem Erzählcafe<br />
sollte ein strukturierter Rahmen geboten<br />
werden, der über ein nostalgieschwangeres<br />
VeteranInnentreffen hinausreichte und zugleich<br />
die Ernsthaftigkeit eines wissenschaft-<br />
lichen Oral-History-Projekts unterwanderte.<br />
Es ging um das persönlich Erlebte, die eigene<br />
Biografie, die in Geschichten wiedergegeben<br />
wurde, die wiederum in der Jugendarbeit in<br />
Tirol Geschichte geschrieben haben.<br />
Umrahmt wurde die Tagung durch die Ausstel-<br />
lung „Wir hatten noch gar nicht angefangen zu<br />
leben“ – über die Jugendkonzentrationslager<br />
in Moringen und in der Uckermark (Deutsch-<br />
land), die auch verdeutlichte, daß dabei vor<br />
allem Jugendämter und Erziehungsheime die<br />
Möglichkeit nutzten, missliebige Jugendliche<br />
aus der Heimerziehung auszusondern und sie<br />
der Verfolgung und Inhaftierung auszuliefern.<br />
Der Eröffnungsvortrag von Martin Guse widmet<br />
sich diesem Thema.<br />
Das Team des Kriseninterventionszentrums<br />
für Kinder und Jugendliche (<strong>KIZ</strong>) bedankt sich<br />
bei allen Vortragenden, den TeilnehmerInnen<br />
am Erzählcafe, den Moderatoren, Sponsoren,<br />
OrganisatorInnen und UnterstützerInnen, die<br />
zum Gelingen dieser Tagung beigetragen haben,<br />
und so dem <strong>KIZ</strong> anläßlich seiner 10- Jah-<br />
resfeier ihre Wertschätzung erwiesen haben.<br />
SIT . Nr.63 .<br />
einleitung<br />
05
historische und aktuelle diskurse<br />
Martin Guse<br />
„Wir hatten noch gar nicht angefangen zu leben“<br />
Eröffnungsbeitrag zur Ausstellung<br />
Sehr geehrte Damen und Herren!<br />
„Wir hatten noch gar nicht angefangen zu le-<br />
ben“ heißt die Ausstellung, die wir im Rahmen<br />
dieser Feierstunde eröffnen. Für die Dauer von<br />
drei Wochen – d.h. bis zum 02.05.2003 wird sie<br />
hier im Haus der Begegnung der Öffentlichkeit<br />
in Innsbruck und der näheren Umgebung prä-<br />
sentiert. Dass sie eingebettet ist in das Pro-<br />
gramm der Fachtagung unter dem Titel „Ein<br />
sozialpädagogisches Jahrhundert? – Integra-<br />
tion und Ausschließung – Zur Geschichte und<br />
Funktion von Jugendwohlfahrt“ ist für mich als<br />
Urheber und Autor der Ausstellung von ganz<br />
besonderer Bedeutung! Das hiesige Krisenin-<br />
terventionszentrum für Kinder und Jugend-<br />
liche begeht sein 10-jähriges Bestehen und<br />
will im Verlauf der Tagung für einen kritischen<br />
Blick auf sozialarbeiterisches Handeln in Ver-<br />
gangenheit, Gegenwart und Zukunft sensibili-<br />
sieren. Das <strong>KIZ</strong> wählte deshalb bewusst diese<br />
Präsentation zur Geschichte der sozialen Ver-<br />
folgung im Nationalsozialismus, um die histori-<br />
schen und aktuellen Diskurse der Fachtagung<br />
zu ergänzen. Den rührigen Organisator/innen<br />
des <strong>KIZ</strong> und dem Haus der Begegnung danke<br />
ich besonders herzlich für die Präsentation der<br />
Ausstellung, für die ausgezeichnete Zusam-<br />
menarbeit bei der Vorbereitung des Vorhabens<br />
und für die Einladung zu dieser Eröffnungsver-<br />
anstaltung.<br />
Das <strong>KIZ</strong> geht ausdrücklich auch den ergän-<br />
zenden Weg der Auseinandersetzung mit der<br />
NS-Vergangenheit, den Weg der Reflexion und<br />
der Selbstvergewisserung eines Berufsstandes<br />
hinsichtlich der jüngeren deutschen Geschich-<br />
te. Und das Haus will mit der Präsentations-<br />
dauer auch fachfremde Besucherinnen und<br />
Besucher der unterschiedlichen Generationen<br />
an durchaus aktualisierbare Bezüge von Diskri-<br />
minierung und Verfolgung heranführen.<br />
„Wir hatten noch gar nicht angefangen zu le-<br />
ben“ thematisiert die historischen Gescheh-<br />
nisse in zwei bis vor wenigen Jahren noch<br />
unbekannten, „vergessenen“ Lagern des<br />
NS-Staates, den Jugend-Konzentrationslagern<br />
Moringen und Uckermark. Diese Ausstellung<br />
soll in ihrer Zielsetzung exemplarisch veranschaulichen,<br />
dass sich das NS-Terrorsystem<br />
mit unterschiedlichsten Mitteln und Methoden<br />
– auch mit denen der Sozialarbeit – und innerhalb<br />
kürzester Zeit gegen jedes erdenkliche<br />
Ziel richten konnte. Sie soll aufzeigen, dass das<br />
System der Vernichtung und Versklavung nicht<br />
nur weit weg – in den großen Todeslagern<br />
– stattfand, sondern flächendeckend, überall<br />
und in unzähligen Strukturen.<br />
Reinhard Heydrich - der „Chef der Sicherheitspolizei<br />
und des SD“ - erhob Ende 1939 erstmals<br />
die Forderung nach speziellen Lagern zur<br />
Internierung sog. „verwahrloster“ und auffälliger<br />
Jugendlicher. 1 Die Ideen dazu waren im<br />
Reichskriminalpolizeiamt (RKPA) entwickelt<br />
worden. Dementsprechend wurden in der<br />
Sitzung des Reichsverteidigungsrates vom<br />
01.02.1940 unter Görings Vorsitz die Fragen<br />
der „Jugendbetreuung“ unter dem Einfluss<br />
des Krieges diskutiert. Man hielt eine zunehmende<br />
„Verwilderung“ der Jugend und ein<br />
Ansteigen der Jugendkriminalität für wahrscheinlich.<br />
Heinrich Himmler - der „Reichsführer-SS“<br />
– unterstützte Heydrichs Forderung<br />
ausdrücklich. 2 In der genannten Sitzung beauftragte<br />
der Reichsverteidigungsrat das RKPA in<br />
Berlin, sog. „Jugendschutzlager“ zu errichten.<br />
In einem letztlich mehrjährigen Kompetenzgerangel<br />
mit der Justiz, die zunächst noch eine<br />
schärfere Abgrenzung der für die Haft in Frage<br />
kommenden Jugendlichen anmahnte und zudem<br />
für ein eindeutiges Mitspracherecht bei<br />
deren Inhaftierung in diesen Lagern plädierte,<br />
setzte sich letztlich der Polizeiapparat durch.<br />
Noch bevor dieser Streit beigelegt war: Ohne<br />
richterliche Anordnung, sondern durch bloße<br />
Verwaltungsanweisungen – die Runderlasse<br />
verschiedenster NS-Behörden – bzw. durch<br />
Schutzhaftbefehle der Gestapo, wurden bis<br />
zum Kriegsende knapp 1.400 Jungen im Lager<br />
Moringen und schätzungsweise über 1.000<br />
Mädchen und junge Frauen im Lager Uckermark<br />
inhaftiert.<br />
Die Motivation Himmlers, die Einrichtung der<br />
Jugend-KZs zu forcieren, resultierte offensichtlich<br />
aus seiner Meinung, dass „...die Einrichtungen<br />
der Fürsorgeerziehung nicht zum Ziele<br />
führen.“ 3 Mit dieser Aussage leitete Himmler<br />
das vorläufige Ende einer langjährigen Debatte<br />
über die Erziehbarkeit oder vermeintliche<br />
„Unerziehbarkeit“ von Zöglingen innerhalb der<br />
staatlichen Ersatzerziehung ein.<br />
Mit dem Reichsjugendwohlfahrtsgesetz<br />
(RJWG) vom 05.07.1922 4 war erstmals eine<br />
reichseinheitliche Regelung dieser öffentlichen<br />
Erziehung getroffen worden. Der § 73<br />
dieses Gesetzes sah die Schaffung einer sog.<br />
„Bewahrung“ für diejenigen Jugendlichen vor,<br />
die in den Erziehungsheimen auffällig wurden,<br />
Schwierigkeiten bereiteten und als „unerziehbar“<br />
eingestuft wurden. Ein entsprechendes<br />
Gesetz wurde aber weder in der Weimarer<br />
Republik noch im nationalsozialistischen<br />
Deutschland realisiert, obwohl es in den Kreisen<br />
der Fürsorgeverbände lebhaft diskutiert<br />
wurde. Die Überführung sog. schwer- oder<br />
„unerziehbarer“ Jugendlicher aus der Fürsorgeerziehung<br />
in „Bewahranstalten“, die keine<br />
erzieherische Einflussnahme, sondern die bloße<br />
Verwertung der Arbeitskraft sicherstellen<br />
sollten, scheiterten in der Weimarer Republik.<br />
Sie scheiterten letztlich an der fehlenden eindeutigen<br />
Definition des Begriffes der „Verwahrlosung“,<br />
am ungeklärten Einweisungsverfahren<br />
und an der ungesicherten Finanzierung.<br />
In den Diskussionen um das „Bewahrungsgesetz“<br />
waren zunehmend Worthülsen wie<br />
„Nörgler“, „geistig stark Unterwertige“ oder<br />
„Stimmungsgestörte“ bei der Beurteilung des<br />
Klientels in den Vordergrund getreten. Dieser<br />
Paradigmenwechsel war in Wohlfahrtspflege<br />
und Jugendhilfe seit Jahrzehnten von Biologen,<br />
Fürsorgern und Medizinern entscheidend<br />
beeinflusst worden waren: Hin zur Idealisierung<br />
des „gesunden, edlen, leistungsfähigen“<br />
Menschen, dem im sozialdarwinistischen Prinzip<br />
der „unedle, belastete und nicht leistungsfähige“<br />
Mensch gegenüberstand. Das folgende<br />
Zitat eines Fürsorgefachmannes aus dem Jahr<br />
1926 veranschaulicht solche Gedankengänge:<br />
„Mit allem Nachdruck muß die baldige Verabschiedung<br />
eines Reichsbewahrungs-gesetzes<br />
für asoziale Personen als Korrelat der Fürsorgeerziehung<br />
gefordert werden. Erst dann können<br />
die für die Fürsorgeerziehung als unerziehbar<br />
in Betracht kommenden Fälle asozialen Ver-<br />
haltens einer in ihrem eigenen Interesse und historische im Interesse der Allgemeinheit notwendigen<br />
Bewahrung überwiesen werden. (...) Ohne das<br />
Bewahrungsgesetz treiben wir mit der ganzen<br />
Fürsorgeerziehung eine gefährliche Gegenaus-<br />
lese in rassenhygienischer Beziehung. Wir schä-<br />
digen bewußt das kommende Geschlecht, wenn<br />
wir diese geistig minderwertigen, dem Verbre-<br />
chertum, dem Betteln, der Landstreicherei oder<br />
Gewerbsunzucht mit absoluter Sicherheit an-<br />
heimfallenden Elemente bis zum 21. Lebensjahr<br />
unter Aufwendung großer Mittel in glänzend<br />
eingerichteten Anstalten bewahren und behü-<br />
ten, um sie dann am Tage der Großjährigkeit<br />
ihrem Schicksal zu überlassen und ihnen die<br />
Möglichkeit geben, ihr grausam verzerrtes Erb-<br />
bild in immer weiteren Individuen und Genera-<br />
tionen wiederaufleben zu lassen.“ 5<br />
Zu diesem Komplex der „Rassenhygiene und<br />
Eugenik“ innerhalb der Sozialen Arbeit hat<br />
Prof. Dr. Manfred Kappeler aus Berlin intensiv<br />
recherchiert, er wird uns dazu im Verlauf der<br />
Tagung sicherlich noch manchen Aspekt näher<br />
vorstellen.<br />
Durch Notverordnungen zur Kostenersparnis<br />
der öffentlichen Haushalte kam es in den Win-<br />
termonaten der Jahre 1932/33 zu unzähligen<br />
Heimentlassungen Jugendlicher, die das 19.<br />
Lebensjahr vollendet hatten, ohne dass der<br />
Gesetzgeber alternative Unterstützungsmög-<br />
lichkeiten in seine Überlegungen einbezogen<br />
hatte. Zahllose Mädchen und Jungen sahen<br />
sich ohne weitere Betreuung einer ungewis-<br />
sen Zukunft ausgeliefert. In Fürsorgekreisen<br />
verschärften sich die Tendenzen, erzieherische<br />
Schwierigkeiten im Heimalltag den Betroffe-<br />
nen selbst anzulasten und dabei mit den Ter-<br />
mini „Unerziehbarkeit“ und „minderwertige<br />
Erbanlagen“ zu operieren. 6<br />
Im nationalsozialistischen Deutschland wurde<br />
das Bewahrungsgesetz v.a. auch in Fürsorge-<br />
kreisen weiterhin gefordert. Auf Länderebene<br />
kam es zur Teilrealisierung durch eigene „Be-<br />
wahranstalten“, so in Hamburg, Berlin, Baden<br />
und der Rheinprovinz. Die rechtlichen Bestim-<br />
mungen zur Regelung der Fürsorgeerziehung<br />
blieben im Nationalsozialismus formal beste-<br />
hen, erfuhren aber durch die Neuausrichtung<br />
nach dem Führerprinzip und dem nazistischen<br />
Staatsrassismus eine erhebliche Aushöhlung<br />
06 . Nr.63 . SIT<br />
SIT . Nr.63 . 07<br />
historische und aktuelle diskurse
und Deformation. Die Ausgrenzung und Aus-<br />
sonderung von sog. „erblich Minderwertigen“<br />
wurde vorangetrieben. Erbbiologische Prak-<br />
tiken traten immer mehr in den Mittelpunkt<br />
bei der Beurteilung jugendlicher Heiminsas-<br />
sen. Auf der Grundlage des „Gesetzes zur<br />
Verhütung erbkranken Nachwuchses“ vom<br />
14.07.1933 7 kam es im Erziehungsalltag der<br />
Heime zu zahllosen Sterilisierungen Jugend-<br />
licher. Verschiedene Pädagogen und Erzie-<br />
hungswissenschaftler forderten verstärkt sog.<br />
Sonderbehandlungen für vermeintlich „erbge-<br />
schädigte“ und „rassefremde“ Heimbewohner<br />
oder diejenigen, die in der „Anstaltsgemein-<br />
schaft“ auffällig geworden waren.<br />
diskurseund Deformation. diskursesonderung historische und aktuelle diskurse<br />
Die allzu häufig widerstandslose Übernahme<br />
der sozialrassistischen NS-Programmatik und<br />
die Aufspaltung des Klientels in „gemein-<br />
schaftsfähige“ und „gemeinschaftsfremde“<br />
Personen führte zur zunehmenden Radikalisie-<br />
rung innerhalb der deutschen Fürsorge, wobei<br />
etliche ihrer Vertreter/innen die Einrichtung<br />
der Jugendlager in Moringen und Uckermark<br />
als zweckmäßigen Ersatz für das seit langen<br />
Jahren durch die Fürsorgeinstanzen einge-<br />
forderte „Bewahrungsgesetz“ ansahen. Voll-<br />
kommen eindeutig drückten sich dabei zum<br />
Beispiel die örtlichen Vertreter der NS-Volks-<br />
wohlfahrt in Hamburg anlässlich einer Sitzung<br />
zu Jugendfragen vom 02.02.1940 aus, indem<br />
sie (Zitat) „...die Einrichtung der vom Reich vo<br />
rgesehenen...Konzentrationslager für Jugendli-<br />
che...“ ausdrücklich empfahlen. 8<br />
Zur rechtlichen Scheinlegitimierung der beiden<br />
Lager gaben die unterschiedlichen Ministerien<br />
allgemeine Runderlasse heraus, die die Haft<br />
der Jugendlichen formal regelten. Es waren<br />
zunächst die Jugend- und Landesjugendämter<br />
sowie die Kriminalpolizei, die vom Reichskri-<br />
minalpolizeiamt ein Vorschlagsrecht zur In-<br />
haftierung auffälliger Jugendlicher in den sog.<br />
„Jugendschutzlagern“ erhielten. Runderlasse<br />
mit unklaren und vielseitig interpretierbaren<br />
Formulierungen und Richtlinien ließen breiten<br />
Spielraum, missliebiges Verhalten Jugendli-<br />
cher zu ahnden, so dass in den folgenden Jah-<br />
ren neben Kriminalpolizei und Jugendämtern<br />
auch die Vormundschaftsrichter, die Gefäng-<br />
nisse, Justizstellen oder die jeweilige HJ-Ge-<br />
bietsführung die Haft im Jugend-KZ formal be-<br />
antragen konnten. Vor allem Erziehungsheime<br />
und Jugendämter machten in der Folge - wenn<br />
auch regional sehr unterschiedlich – regen Gebrauch<br />
von den Haftanträgen, um sich auffälliger<br />
und missliebiger Jugendlicher entledigen<br />
zu können. Nach einem Bericht des RKPA aus<br />
dem Jahr 1944 waren über 50 % der betroffenen<br />
Jugendlichen vor ihrer Haft in Moringen<br />
und Uckermark in Fürsorgeerziehungsanstalten<br />
aufgewachsen. 9<br />
In den mir vorliegenden Anträgen der Heime<br />
und Jugend- bzw. Landesjugendämter auf<br />
Unterbringung von Mädchen und Jungen in<br />
den Jugendlagern fällt besonders die radikale<br />
Reduzierung der darin getroffenen Aussagen<br />
auf negativ besetzte Verhaltensweisen oder<br />
Eigenschaften der Betroffenen auf. Dabei wurde<br />
häufig die Auflistung von Verfehlungen<br />
und vermeintlichen Charakterschwächen für<br />
die Argumentationskette geschickt benutzt,<br />
um über diesen Weg der Stigmatisierung und<br />
Kriminalisierung die jeweils „notwendige“<br />
Unterbringung im Jugend-KZ dringlich und<br />
revisionssicher zu untermauern. Kennzeichnend<br />
sind die Verwendung von dehnbaren<br />
Worthülsen bei der Verhaltensbeschreibung<br />
und die kategorische Abstempelung der Jugendlichen<br />
zu „Arbeitsscheuen“, „geborenen<br />
Verbrechern“ und „Volksschädlingen“. Die Einweisungsgründe<br />
verweisen eher auf erzieherische<br />
Bankrotterklärungen bei der Beurteilung<br />
der sog. „Zöglinge“. So regte ein Mitarbeiter<br />
des Landesjugendamtes Kattowitz in seinem<br />
Antrag vom 28.07.1944 zum Beispiel die Jugend-KZ-Haft<br />
an, da die „pubertätskritische<br />
Trotzhaltung“ des betroffenen Jungen „mit den<br />
Mitteln der Fürsorgeerziehung nicht gebrochen<br />
werden kann“. 10<br />
Zwangsläufig waren von der Haft im Jugend-<br />
KZ vor allem solche Jugendliche betroffen,<br />
die sich unter dem Einfluss des Krieges der<br />
zunehmenden Reglementierung sämtlicher<br />
Lebensbereiche zu entziehen versuchten und<br />
dadurch mit den Norm- und Wertvorstellungen<br />
des NS-Staates in Konflikt gerieten. So gelangten<br />
die Fälle zunehmender „Arbeitsverweigerung“<br />
(„Blaumachen“), des „Umherstreunens“,<br />
der Diebstähle und eines freizügigeren Sexuallebens<br />
als „volksschädigendes Verhalten“<br />
in das Blickfeld von Polizei und SS. Unter dem<br />
Einfluss der Kriegsgeschehnisse und der damit<br />
einhergehenden Militarisierung des gesamten<br />
Lebens- und Arbeitsumfeldes reagierte die<br />
staatliche Autorität zunehmend auch auf solche<br />
„inneren Feinde“. Dabei wurde die normative<br />
Bestimmung der Begriffe „Asozialität“ und<br />
„Kriminalität“ erheblich ausgedehnt.<br />
Nichtanpassung, Verweigerung, sog. „Unerziehbarkeit“<br />
(definiert durch Diebstähle oder<br />
mehrfache Entweichungen aus einem Erziehungsheim)<br />
mit der Aussonderung der Betroffenen<br />
aus der staatlichen Ersatzerziehung,<br />
nicht staatskonformes oder unerwünschtes<br />
Sexualverhalten, der Glaube als Zeuge Jehovas<br />
oder Jude, konkrete Opposition und Widerstand<br />
gegenüber dem NS-Staat – jeder 10.<br />
Häftling wurde aus diesem Grund interniert<br />
– oder der Wunsch nach einer freien und individuellen<br />
Lebensgestaltung - wie ihn die<br />
jungen Anhänger der englisch-amerikanischen<br />
Swing- und Jazzmusik zu verwirklichen suchten<br />
-, aus einer Vielzahl von Gründen wurden<br />
Mädchen und Jungen im Alter von 13 bis 25<br />
Jahren in den Jugend-KZ Moringen und Uckermark<br />
inhaftiert. In zwei Ausnahmefällen gar<br />
10 jährige.<br />
Vor dem Hintergrund der Tagungsthematik<br />
möchte ich Ihren Blick heute besonders auf solche<br />
Häftlinge lenken, die auf Veranlassung der<br />
Jugendfürsorge in die Haft gerieten.<br />
Da waren zum Beispiel zahlreiche jugendliche<br />
Trebegänger, der im Verlauf ihrer „Fluchten“<br />
aus den jeweiligen Fürsorgeanstalten kleinere<br />
Diebstähle begangen hatte.<br />
Der am 05.05.1928 geborene Kasimir T. aus Kattowitz<br />
lebte wegen mehrerer Diebstähle, unregelmäßigen<br />
Schulbesuches und häufigen Entweichens<br />
aus dem Elternhaus in Erziehungsheimen.<br />
In den unterschiedlichen Heimen wurde<br />
er in der Folgezeit sehr ungünstig beurteilt.<br />
Dort floh er mehrfach, wobei er von Freunden<br />
und Verwandten unterstützt wurde, die mit Lebensmitteln<br />
und Unterkünften aushalfen. Polizei<br />
und Jugendamt konnten ihm keinerlei neue<br />
Straftaten nachweisen. Doch Kasimir T. wurde<br />
mit der Begründung „Gefahr im Verzuge“ und<br />
wegen des bloßen Verdachtes, sich Partisanen<br />
angeschlossen zu haben, verhaftet und am<br />
19.09.1944 nach Moringen verschleppt, wo er<br />
die Lagernummer 1263 erhielt. Er starb im Juni<br />
1945 in Moringen, also nach der Befreiung des<br />
Lagers. Die angegebene Todesursache lautete: historische Lungen-TBC und Herzschwäche. Sein Grab be-<br />
findet sich auf dem Moringer Friedhof. 11<br />
Der 1921 geborene XY kam im Alter von 16<br />
Jahren in ein Fürsorgeerziehungsheim. Dort<br />
entwich er für mehrere Monate, bis die Polizei<br />
ihn wieder aufgriff. Auf dem „Trebegang“ hatte<br />
er sich vermutlich durch Diebstähle und kleine-<br />
re Straftaten ernährt. Der Jugendliche wurde<br />
deshalb zu 10monatiger Gefängnishaft verur-<br />
teilt. Nach der Strafverbüßung überstellte ihn<br />
das Jugendamt in das Landeserziehungsheim<br />
Marienthron bei Neustettin. Bereits nach we-<br />
nigen Wochen lehnte die dortige Heimleitung<br />
die weitere Betreuung des Jungen kategorisch<br />
ab. In der Akte hieß es dazu: „Hier versuch-<br />
te er wieder andere Zöglinge zu strafbaren<br />
Handlungen zu verleiten. Die Anstaltsleitung<br />
ist nicht mehr in der Lage, XY durch fürsorge-<br />
rische Maßnahmen zu erziehen.“ Diese päd-<br />
agogische Bankrotterklärung endete mit den<br />
Worten: „Eine straffe Erziehung in einem Kon-<br />
zentrationslager würde ihn vielleicht noch auf<br />
die rechte Bahn bringen.“ 12 Die Heimeinrich-<br />
tung begrüßte also die KZ-Haft unter SS-Regie<br />
mit dem Mittel der Zwangsarbeit ausdrücklich<br />
als adäquates „Erziehungsmittel“. Heim und<br />
Jugendamt forcierten die Haft, die im Jahr<br />
1940 in Moringen vollzogen wurde. Im Lager<br />
erkrankte der Junge 3 Jahre später an Lungen-<br />
tuberkulose. Es ist mir nicht bekannt, ob er La-<br />
gerhaft und TBC-Erkrankung überlebt hat. 13<br />
Die größte Häftlingsgruppe im Lager Ucker-<br />
mark bildeten die jungen Frauen, denen in der<br />
Fürsorgeerziehung neben weiteren Auffällig-<br />
keiten vor allem ein Fehlverhalten im Bereich<br />
ihres Sexuallebens attestiert wurde. Die Beur-<br />
teilungskategorie „sexuelle Verwahrlosung“<br />
- seit Jahrzehnten die zentrale Thematik in<br />
der Arbeit der deutschen Fürsorge gegenü-<br />
ber Mädchen - geriet im Nationalsozialismus<br />
in Symbiose mit dem Selektionskriterium der<br />
„Unerziehbarkeit“ zur tödlichen Bedrohung<br />
für die betroffenen Mädchen. Den ideologisch<br />
vorgegebenen Geschlechterrollen und dem<br />
Ideal der „deutschen Hausfrau und Mutter“<br />
nicht entsprechend, wurden Prostitution und<br />
wechselnde Sexualpartnerschaften von Mäd-<br />
chen nunmehr als „moralischer Schwachsinn“<br />
definiert. Außereheliche und selbst bestimmte<br />
08 . Nr.63 . SIT<br />
SIT . Nr.63 . 09<br />
historische und aktuelle diskurse
diskurseSexualität historische und aktuelle diskurse<br />
Sexualität einerseits negierend, andererseits<br />
etwaig notwendig werdende fürsorgerische<br />
Hilfen ausschließend, boten Fürsorge und na-<br />
zistischer Verfolgungsapparat ihre gesamten<br />
Ermittlungstechniken zur Aufdeckung sexuell<br />
abweichenden Verhaltens auf und offenbar-<br />
ten gleichzeitig eine perfide Doppelmoral, die<br />
allein das weibliche Verhalten zum Verfol-<br />
gungsgegenstand machte und die Rolle der<br />
männlichen Geschlechtspartner gleichwohl<br />
außer acht ließ. So beantragte beispiels-wei-<br />
se das Jugendamt Ratibor am 14.09.1944 die<br />
Inhaftierung von Franziska B., 1924 geboren,<br />
in Uckermark. Am 09.02.1943 aus der Fürsor-<br />
geerziehung entlassen, hatte die Jugendliche<br />
eine Arbeitsstelle als Hausangestellte kurz-<br />
fristig verlassen. Nach dem Verlust drei wei-<br />
terer Arbeitsstellen und einer Vorstrafe wegen<br />
Diebstahls fiel die junge Frau dem Jugendamt<br />
wegen einer Geschlechts-erkrankung auf. Die<br />
weiteren Ermittlungen ergaben, „...dass Fran-<br />
ziska B. wechs-elnden Männerverkehr hat. Die<br />
Hauswirtin meldet, dass zu verschiedenen<br />
Tagesstunden immer wieder andere Soldaten<br />
und auch Zivilpersonen die Minderjährige<br />
besuchen.“ 14 Der Antrag auf Unterbringung<br />
in Uckermark wurde folgendermaßen begrün-<br />
det: „... sodass die Minderjährige eine grosse<br />
sittliche Gefahr für ihre Umwelt bedeutet, und<br />
zumal auch Wehrmachtsangehörige bei ihr aus<br />
und ein gehen auch eine Gefährdung und Schä-<br />
digung der Wehrmacht vorliegt.“<br />
In der NS-Diktion wurden diese Mädchen und<br />
Jungen – wie ihre Mithäftlinge – als „Ras-<br />
sefremde“, „Gemeinschaftsfremde“, „erbge-<br />
schädigte Asoziale und Kriminelle“ diffamiert.<br />
Zu rechtlosen Nummern im Lageralltag abge-<br />
stempelt - ihres Namens und ihrer Identität<br />
beraubt - waren sie der Willkür und dem Terror<br />
der SS sowie der bedingungslosen Ausnutzung<br />
ihrer Arbeitskraft bei völlig unzureichender<br />
Verpflegung ausgeliefert. Bei mangelhafter<br />
medizinischer Versorgung entschied zudem<br />
ein sog. „Wissenschaftler“ – der Kriminalbio-<br />
loge Dr. Dr. Robert Ritter – mit fragwürdigsten<br />
Untersuchungsmethoden über Leben und Tod<br />
der jungen Menschen. Die Häftlinge beider<br />
Jugend-KZ wurden schwer misshandelt und<br />
durch Zwangsarbeit ausgebeutet. Sie mussten<br />
als teilweise noch Pubertierende lernen, mit<br />
dem ständigen Gedanken an Tod und Überleben<br />
konfrontiert zu sein. Sie haben Gleichaltrige<br />
neben sich sterben - ja elend verrecken<br />
- sehen.<br />
Mit der Befreiung im April bzw. Mai 1945 war<br />
deshalb für viele der überlebenden Mädchen<br />
und Jungen der Gedanke an Genugtuung,<br />
an Wiedergutmachung für geschehenes Unrecht<br />
verbunden. Doch diese Hoffnungen zerschlugen<br />
sich nahezu vollständig. Der schnell<br />
einsetzende Prozess der Verdrängung, des<br />
Verschweigens und der Verharmlosung in beiden<br />
deutschen Staaten - flankiert von den Bedingungen<br />
des sog. „kalten Krieges“ und vom<br />
Verbleib zahlloser NS-Täter in ihren Positionen<br />
- ließ die Häftlinge der Jugend-KZs zu vergessenen<br />
Opfern des nazistischen Polizeistaates<br />
werden. In Renten- und Entschädigungsfragen<br />
werden die meisten der damals Jugendlichen<br />
bis heute diskriminiert und ausgegrenzt. Rentenzahlungen<br />
für die Haftzeit bleiben aus,<br />
Ansprüche auf solche Leistungen werden<br />
schlicht geleugnet. Auch hinsichtlich der Entschädigungszahlungen<br />
nach dem dafür vorgesehenen<br />
Bundesgesetz bleibt festzuhalten:<br />
Nahezu alle Häftlinge der Jugend-KZs fielen<br />
und fallen durch die Maschen dieses Gesetzes,<br />
das in seiner Wirkung für sie zutiefst ungerecht<br />
ist. Politisch, rassisch oder religiös Verfolgter<br />
gewesen zu sein: Dies haben die Betroffenen<br />
nachzuweisen. Die aus sozialen Gründen verfolgten<br />
Kinder, Frauen und Männer sind von<br />
solchen Zahlungen ausgeschlossen. Auch die<br />
Firmen, die von der Zwangsarbeit der jungen<br />
Menschen pro fitierten, sahen sich bis vor wenigen<br />
Monaten nicht verpflichtet, Ausgleichszahlungen<br />
zu leisten. Vielleicht gelingt es den<br />
ehemaligen Häftlingen nun – nachdem fast 60<br />
Jahre verstrichen sind - über die bereit stehenden<br />
Geldmittel für ehemalige Zwangsarbeiterinnen<br />
und Zwangsarbeiter des NS-Regimes<br />
eine symbolische Zahlung zu erhalten.<br />
Sehr geehrte Damen und Herren!<br />
Die Idee, die Lebenswege und Haftbedingungen<br />
dieser jungen Menschen in einer Ausstellung<br />
nachzuzeichnen, resultierte aus dem Gedanken,<br />
das bis dato Unbekannte, Verdrängte<br />
einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen<br />
zu wollen. Zum einen sollte den vergessenen<br />
Opfern erstmalig Gehör verschafft werden.<br />
Andererseits sollte versucht werden, die Nach-<br />
und Folgewirkungen des Nationalsozialismus<br />
exemplarisch aufzuzeigen und Fragen nach<br />
etwaigen gesellschaftlichen Kontinuitäten<br />
bei der heutigen Begegnung mit Andersdenkenden<br />
und Außenseitern aufzuwerfen. Die<br />
Konzeption sah vor, vor allem Jugendliche an<br />
diese Thematik heranzuführen, um über die<br />
alterspezifische Verknüpfung zu ihrer eigenen<br />
Lebenswelt Interesse zu wecken.<br />
Die Ausstellung „Wir hatten noch gar nicht angefangen<br />
zu leben“ ist natürlich ein Versuch!<br />
Ein Versuch, aus historischen Zusammenhängen<br />
im Sinne des „Lernens aus der Vergangenheit“<br />
für die Mechanismen der Ausgrenzung,<br />
Diskriminierung und Verfolgung zu sensibilisieren.<br />
Sie soll auch über die Beteiligung und<br />
Verstrickung der Fürsorge – der sozialen Arbeit<br />
– in das nazistische System der Beobachtung,<br />
Stigmatisierung, Denunziation und Verfolgung<br />
informieren.<br />
Dabei könnten wir zum Selbstschutz verleitet<br />
werden, indem wir uns mit der Distanz eines<br />
halben Jahrhunderts gegenseitig versichern,<br />
dass wir unsere Lehren allemal gezogen hätten<br />
- mit der gleichzeitig implizierten Selbstversicherung:<br />
„Ich hätte niemals mitgemacht!“<br />
Doch der Versuch, die komplexen Zusammenhänge<br />
der NS- Machtstrukturen und der beteiligten<br />
Akteure zu erkennen, verlangt geradezu,<br />
dass wir solchen allzu schnellen – und auch falschen<br />
– Rückschlüssen nicht erliegen. Manfred<br />
Kappeler verweist mit seinem umfangreichen<br />
und überaus wichtigen Werk „Der schreckliche<br />
Traum vom vollkommenen Menschen“ 15 darauf:<br />
Wir müssen die Verantwortlichkeiten und<br />
Verstrickungen vor allem auch dort betrachten<br />
und erklären können, wo sie im scheinbar<br />
Harmlosen, im alltäglichen Handeln der Beteiligten<br />
verborgen sind. Und wir müssen nach<br />
möglichen Ähnlichkeiten in unseren eigenen<br />
alltäglichen Denk formen und Einschätzungen<br />
fragen. Wir haben uns zu vergegenwärtigen,<br />
dass Geschichte keine Aneinanderreihung<br />
von abgeschlossenen Ereignissen ist, sondern<br />
ihr jeweiliges „Vorher“ und „Nachher“ hat.<br />
So handelten auch die NS-Behörden vor dem<br />
Hintergrund einer langjährigen Tradition von<br />
erb- und rassenhygienischen Vorstellungen.<br />
Die NS-Ideologie war vom Gedankengut des<br />
19. Jahrhunderts und den gesellschaftlichen<br />
Die direkte und indirekte Teilhaberschaft von<br />
Vertretern der deutschen Fürsorge –<br />
der Heime, Jugendämter und Landesjugend-<br />
ämter – an den Einweisungen in die beiden<br />
sog. „Jugendschutzlager“ sowie die nachge-<br />
wiesene Mitwirkung der Fürsorgeinstanzen<br />
an den Verfolgungsmaßnahmen gegenüber<br />
jüdischen Kindern, gegenüber jungen Sinti<br />
und jungen Zeugen Jehovas, gegenüber den<br />
als „asozial“ abqualifizierten Frauen, Männern<br />
und Kindern, sind überdeutliche Belege, dass<br />
die Berufssparte der Sozialarbeit/Fürsorge ei-<br />
nen wesentlichen „Beitrag“ zur Ausmerzepo-<br />
litik der Nationalsozialisten geleistet hat. Mit<br />
der Hinwendung zur rigorosen Aufspaltung der<br />
Klientel in förderungswürdige „gemeinschafts-<br />
fähige Volksgenossen“ und auszusondernde<br />
„Gemeinschaftsfremde“ entsprachen etliche<br />
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der deut-<br />
schen Fürsorge den ihnen vom faschistischen<br />
System zugewiesenen Aufgaben allzu bereit-<br />
willig. Sie verweigerten den Betroffenen mit<br />
10 . Nr.63 . SIT<br />
SIT . Nr.63 . 11<br />
Grundpositionen der Weimarer Republik historische maßgeblich beeinflusst und geprägt. Sie war<br />
weder neu, noch Erfindung eines einzelnen<br />
„Führers“.<br />
Die weit vor 1933 bereits vorangetriebene<br />
Ausgrenzung der „Auffälligen“, der weniger<br />
Leistungsfähigen, der „Schwächeren“ in der<br />
Gesellschaft hat das Aussondern und Morden<br />
nach der Machtübertragung an die Nationalso-<br />
zialisten erleichtert und ermöglicht. Solcher-<br />
maßen in der Gesellschaft angelegten Haltun-<br />
gen und Einstellungen bildeten also auch die<br />
Grundlage für die Entstehung und Ausformung<br />
der Jugend-KZs, waren die Basis dafür, dass<br />
Polizei, Fürsorger, Lehr herren, Nachbarn die<br />
ihnen anvertrauten Jugendlichen überwach-<br />
ten, ihr Verhalten, ihren Lebensstil – auch ihre<br />
„Fehltritte“ – denunzierten, sie als Menschen<br />
abstempelten und sie in die Lager – aus ihrem<br />
eigenen Blickfeld fort – abschoben! Diese Men-<br />
schen bereiteten den Weg für Zwangsarbeit<br />
und KZ-Haft, die wiederum von Menschen<br />
- vom diensteifrigen Beamten bis zum sadis-<br />
tischen Schläger – vollzogen wurde. Dabei<br />
waren unzählige Menschen „nur“ indirekt be-<br />
teiligt, agierten nicht als „Monstren“ oder mo-<br />
ralisch besonders verwerflich. Doch sie haben<br />
teilgenommen, waren verstrickt in das System<br />
und wurden somit zu Komplizen des Terrors.<br />
historische und aktuelle diskurse
dem Hinweis auf „Rassefremdheit“ oder „min-<br />
derwertige Erbanlagen“ konkrete Unterstüt-<br />
zungsleistungen und fürsorgerische Hilfen. In<br />
Behörden, Jugendämtern und Erziehungshei-<br />
men wurden sie zu Handlangern faschistischer<br />
Anpassungs- und Disziplinierungsmethoden,<br />
wobei man Jugendliche, die man nicht zu<br />
„brechen“ vermochte, in die totale Institution<br />
„Jugendschutzlager“ abschob und somit auch<br />
die Lagerhaft unter SS-Gewalt als opportunes<br />
„Erziehungsmittel“ anerkannte.<br />
diskursedem Hinweis historische und aktuelle diskurse<br />
Zu den Fragen der Kontinuität und Diskontinu-<br />
ität in der Sozialarbeit muss erwähnt werden,<br />
das die beiden Jugend-KZ im ersten Nach-<br />
kriegsjahrzehnt zum Gegenstand der Diskussi-<br />
onen um eine nun erneut angestrebte „Bewah-<br />
rung“ Jugendlicher in speziellen Einrichtungen<br />
wurden. An solchen Überlegungen waren vor<br />
allem auch solche Beamte beteiligt, die bereits<br />
während des Naziregimes für die Ausgestal-<br />
tung der Haft in Moringen und Uckermark<br />
verantwortlich zeichneten - wie zum Beispiel<br />
Friedericke Wieking, als ehemalige Leiterin<br />
der Weiblichen Kriminalpolizei beim RKPA. Sie<br />
negierte, wie die ehemaligen Aufseher/innen<br />
in den entsprechenden Nachkriegsprozessen<br />
gegen die Einsatzkräfte der Lager, gezielt den<br />
tatsächlichen Charakter der Lagerhaft und die<br />
Lebensumstände der betroffenen Mädchen<br />
und Jungen. Vor dem Hintergrund professio-<br />
neller Kontinuitäten im Bereich der Justiz und<br />
der Polizei – Ministerial- und Justizbeamte gin-<br />
gen weitgehend nahtlos in die neuen bundes-<br />
republikanischen Dienststellen über – fallen<br />
besonders die Publikationen zu Fragen des<br />
Jugendstrafrechts auf, in denen Bedeutung<br />
und Ausgestaltung der „Jugendschutzlager“<br />
im NS-Staat völlig verzerrt dargestellt und als<br />
Ausgangsbasis für die Bestrebungen einer<br />
sog. „Sicherungsverwahrung für Jugendliche“<br />
herangezogen wurden. 16 Man dachte also in<br />
Fürsorge-kreisen wieder laut über die Aus-<br />
grenzung „schwererziehbarer“ Minderjähriger<br />
aus der Fürsorgeerziehung nach und entwick-<br />
elte neue Konzepte für deren Ghettoisierung<br />
und weitere „Behandlung“. Diese Aspekte<br />
verweisen darauf, dass es mit dem Datum<br />
des 8. Mai 1945 auch für die Sozialarbeit/<br />
Sozialpädagogik keine „Stunde Null“ gegeben<br />
hat, sondern dass die historische Entwicklung<br />
des bundesrepublikanischen Sozialstaates<br />
auch vor dem Hintergrund personeller Kontinuitäten<br />
und der Langlebigkeit tradierter<br />
sozialer Normen, über die Jahrhundertwende,<br />
über „Weimar“ und den „NS-Staat“ hinweg,<br />
betrachtet und analysiert werden muss.<br />
Sehr geehrte Damen und Herren!<br />
Die Häftlinge der Jugend-KZ wurden aus den<br />
unterschiedlichsten Gründen Opfer der Verfolgung.<br />
Sie fanden keine Fürsprecher, die für sie<br />
eintraten. Sie waren Kinder, junge Menschen!<br />
Wenn die Formel „Lernen aus der Vergangenheit”<br />
in unseren Ländern überhaupt noch<br />
Gültigkeit haben soll, so ist von uns eine<br />
genaue Einschätzung heutiger sozialer und<br />
politischer Positionen und Rahmenbedingungen<br />
gefordert. Dabei verschlechtert sich in<br />
Folge knapper Haushaltsmittel die Grundlage<br />
für gesellschaftlich so dringend notwendige<br />
Aufgaben. Vor dem Hintergrund der Ausstellungsthematik<br />
möchte ich dabei nur auf die<br />
erheblichen Einschnitte in der Sozial- und Jugendarbeit<br />
verweisen. In meiner beruflichen<br />
Praxis als Sozialpädagoge an einer Schule<br />
für Erziehungshilfe begegne ich zunehmend<br />
Haushalts bedingten Kürzungen. Der Ruf nach<br />
immer schärferen Maßnahmen zur Lösung finanzieller<br />
Probleme ist unüberhörbar. Und in<br />
einigen Medien und in Teilen der Öffentlichkeit<br />
und Politik werden soziale Leistungen zum Gegenstand<br />
erhitzter Debatten, werden Asylbewerber,<br />
Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger<br />
als sog. „Schmarotzer in der sozialen Hängematte”<br />
oder „Drückeberger” abqualifiziert.<br />
Werden „auffällige” Jugendliche – sie selbst,<br />
ihre Gangs und Cliquen – auffallend häufig<br />
allein mit schlechten Charaktereigenschaften<br />
dargestellt. Einerseits fehlen die Geldmittel<br />
für nötige pädagogische Interventionen<br />
oder präventive Maßnahmen, andererseits<br />
verstärken sich Diskussionen um Strafrechtsverschärfungen<br />
und weitere sanktionierende<br />
Maßnahmen gegenüber jungen Menschen.<br />
Und wie ich vor ca. 3 Jahren in meiner Tageszeitung<br />
las, glaubte ein Kommunalpolitiker<br />
aus dem Landkreis Nienburg/Weser in Niedersachsen<br />
allen Ernstes, mit „Arbeitslagern im<br />
Moor” ein adäquates Mittel zur Disziplinierung<br />
und Lenkung von gewaltbereiten oder auffälligen<br />
Jugendlichen entdeckt zu haben.<br />
Lassen Sie mich eine provokative Frage stellen:<br />
Wie weit sind wir in der heutigen finanziellen<br />
Situation von den Klassifizierungen des Sozialdarwinismus<br />
überhaupt noch entfernt? Wer<br />
gilt Ihnen und mir heute als „förderungswürdig”,<br />
wer gilt uns als „Ballastexistenz”? In<br />
einer zunehmend allseits neoliberal ausgerichteten<br />
Gesellschaft, in der dem wirtschaftlichen<br />
Nützlichkeitskalkül offensichtlich eine größere<br />
Bedeutung zukommt als der Bewahrung und<br />
weiteren Ausgestaltung sozialer Standards!<br />
Im weiteren Zurückdrängen sozialer Pflichtaufgaben<br />
wird die Kluft zwischen den „Machern”<br />
und den „Ohnmächtigen” wissentlich und willentlich<br />
vergrößert. Gleichzeitig gärt damit der<br />
Nährboden für Verunsicherung, Sozialneid und<br />
die alten/neuen “Sündenbocktheorien”, die<br />
sowohl an den Stammtischen als auch in den<br />
rechtsextremen Ideologiezirkeln Anhängerinnen<br />
und Anhänger finden.<br />
Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund wird<br />
auch der Leidensweg der in Moringen und<br />
Uckermark inhaftierten Jugendlichen immer<br />
„aktuell” bleiben. Denn wir haben uns zu fragen,<br />
inwieweit heutigen Formen der Diskriminierung<br />
und Ausgrenzung in unserem Land<br />
vergleichbare Motive, Ursachen und gesellschaftliche<br />
Rahmenbedingungen zu Grunde<br />
liegen, wie vor über 60 Jahren.<br />
In dem Sinne einer solchen Spurensuche<br />
wünsche ich der Tagung des <strong>KIZ</strong> einen guten<br />
Verlauf sowie anregende Vorträge und Diskussionen.<br />
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit!<br />
Ausgewählte Lesehinweise zur Thematik<br />
„Jugend-KZ“:<br />
Weitere Informationen über die Geschichte der<br />
Jugendkonzentrationslager auch im Internet<br />
unter:<br />
www.martinguse.de<br />
Ayass, Wolfgang: „Asoziale“ im Nationalsozialismus“,<br />
Stuttgart 1995<br />
Guse, Martin/Kohrs, Andreas: Die „Bewahrung“<br />
Jugendlicher im NS-Staat – Ausgrenzung<br />
und Internierung am Beispiel der Jugendkonzentrationslager<br />
Moringen und Uckermark,<br />
(Diplomarbeit, masch.) Hildesheim 1985<br />
Guse, Martin/Kohrs, Andreas/Vahsen, Fried-<br />
helm: Das Jugendschutzlager Moringen Fried-historische – Ein<br />
Jugendkonzentrationslager, in: Otto, H.-U./<br />
Sünker, H. (Hrsg.), Soziale Arbeit und Faschis-<br />
mus, Bielefeld 1986, S. 321 – 344<br />
Guse, Martin/Kohrs, Andreas: Zur Entpädago-<br />
gisierung der Jugendfürsorge in den Jahren<br />
1922 – 1945, in: Otto, H.-U./Sünker, H. (Hrsg.)<br />
Soziale Arbeit und Faschismus, Frankfurt/Main<br />
1989, S. 228 – 249<br />
Guse, Martin: „Wir hatten noch gar nicht angefangen<br />
zu leben“. Zur Entstehung einer<br />
Wanderausstellung, in: Faulenbach, B./Jelich,<br />
H.-J. (Hrsg.) Reaktionäre Modernität und Völkermord.<br />
Probleme des Umgangs mit der NS-<br />
Zeit in Museen, Ausstellungen und Gedenkstätten,<br />
Essen 1994, S. 181 – 188<br />
Guse, Martin: „Wir hatten noch gar nicht an-<br />
gefangen zu leben“ – Eine Ausstellung zu den<br />
Jugend-Konzentrationslagern Moringen und<br />
Uckermark 1940 – 1945“ - Katalog zur Ausstel-<br />
lung, Liebenau/Moringen 1992 (4. Auflage,<br />
Moringen/Liebenau 2001; Bezugsadresse:<br />
Guse Bildungsprojekte, Postfach 12 27, FRG-<br />
31615 Liebenau)<br />
Guse, Martin: „Der Kleine, der hat sehr leiden<br />
müssen...“ Zeugen Jehovas im Jugend-KZ<br />
Moringen, in: Hesse, Hans (Hrsg.), „Am mu-<br />
tigsten waren immer wieder die Zeugen Jeho-<br />
vas“. Verfolgung und Widerstand der Zeugen<br />
Jehovas im Nationalsozialismus, Bremen 1998;<br />
S. 102 - 120<br />
Guse, Martin: „Alles war darauf gerichtet, den<br />
eigenen Willen und das Selbstbewusstsein zu<br />
vernichten“ – Zur Inhaftierung von Mädchen<br />
und jungen Frauen im Jugend-KZ Uckermark<br />
1942 – 1945, in: Knab, E./Nickolai, W./Scheiwe,<br />
N. (Hrsg.), „Für die Zukunft lernen“, (hrsg.<br />
vom Bundesverband katholischer Einrichtun-<br />
gen und Dienste der Erziehungshilfen e.V.);<br />
Freiburg i. Br. 2000, S. 32 – 61<br />
Hepp, Michael: Vorhof zur Hölle. Mädchen im<br />
„Jugendschutzlager“ Uckermark; in: Ebbing-<br />
haus, A., Opfer und Täterinnen. Frauen des<br />
Nationalsozialismus, Nördlingen 1987, S. 191<br />
– 216<br />
12 . Nr.63 . SIT<br />
SIT . Nr.63 . 13<br />
historische und aktuelle diskurse
diskurseKappeler, historische und aktuelle diskurse<br />
Kappeler, Manfred, Der schreckliche Traum<br />
vom vollkommenen Menschen. Rassenhygiene<br />
und Eugenik in der Sozialen Arbeit, Marburg<br />
2000<br />
Kuhlmann, Carola: „Erbkrank oder erziehbar?“<br />
– Jugendhilfe als Vorsorge und Aussonderung<br />
in der Fürsorgeerziehung in Westfalen von<br />
1933 – 1945, Weinheim und München 1989<br />
Limbächer, Katja/Merten, Maike/Pfefferle, Bet-<br />
tina: Das Mädchenkonzentrationslager Ucker-<br />
mark, Münster 2000<br />
Otto, Hans-Uwe/Sünker, Heinz (Hrsg.): Soziale<br />
Arbeit und Faschismus, Frankfurt/Main 1989<br />
Peukert, Detlev: Volksgenossen und Gemein-<br />
schaftsfremde – Anpassung, Ausmerze und<br />
Aufbegehren unten dem Nationalsozialismus,<br />
Köln 1982<br />
Schrapper, Christian: Hans Muthesius, Müns-<br />
ter 1993<br />
Wagner, Patrick: Volksgemeinschaft ohne Ver-<br />
brecher – Konzeptionen und Praxis der Krimi-<br />
nalpolizei in der Zeit der Weimarer Republik<br />
und des Nationalsozialismus, Hamburg 1996<br />
Auszug aus der Gehaltliste für die Lager Ravensbrück und Uckermark<br />
(Quelle: Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück)<br />
Martin Guse<br />
Ausstellungskonzepte und Vertrieb<br />
Lange Strasse 29 D-31618 Liebenau<br />
www.martinguse.de e-mail: info@martinguse.de<br />
Innenhof des Jugend-KZ Moringen (Quelle: Niedersächsisches Landeskrankenhaus Moringen)<br />
Arbeitskommando „Schneiderei“ im KZ Ravensbrück. Hier wurden auch die jugendliche Häftlinge des Lagers Uckermark eingesetzt.<br />
(Quelle: Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück)<br />
1<br />
Bundesarchiv (BA) Berlin R 22/1189, Bl. 25 - 30<br />
2<br />
Gesamter Vorgang ebenfalls in: BA R 22/1189. An der<br />
Sitzung nahmen u.a. teil: die Reichsminister Goebbels,<br />
Frick, Lammers, Kerrl und Rust, diverse Staatssekretäre<br />
der unterschiedlichen Ministerien, der Stabsführer der<br />
Reichsjugendführung, Lauterbacher sowie Himmler<br />
und Heydrich aus dem Polizeiapparat. Zum Verlauf der<br />
Sitzung und zur Vorgeschichte sehr interessant: Muth,<br />
Heinrich, Das „Jugendschutzlager“ Moringen; in: Dachauer<br />
Hefte 5, Die vergessenen Lager, Dachau 1989, S. 223<br />
– 252<br />
3<br />
BA R22/1189<br />
4<br />
Reichsgesetzblatt (RGBl.), Jg. 1922, Teil I, 633 ff.<br />
5<br />
Vossen, Die FE der über Achtzehnjährigen, Berlin 1925,<br />
S. 104<br />
6<br />
Zum Hintergrund und zur Ausformung der damaligen<br />
Situation in der Fürsorgeerziehung vgl.: Harvey, Elizabeth,<br />
Die Jugendfürsorge in der Endphase der Weimarer<br />
Republik - Das Beispiel der Fürsorgeerziehung, S. 198-<br />
227; sowie Guse, Martin/Kohrs, Andreas, Zur Entpädagogisierung<br />
der Jugendfürsorge in den Jahren 1922<br />
- 1945, S. 228-249; beide Beiträge in: Otto, H.-U./Sünker,<br />
H., Soziale Arbeit und Faschismus, Frankfurt/Main 1989<br />
7<br />
RGBl., Teil 1, Nr. 86, S. 529 – 531<br />
8<br />
zitiert nach Hepp, Michael, Vorhof zur Hölle. Mädchen<br />
im „Jugendschutzlager“ Uckermark; in: Ebbinghaus,<br />
Angelika (Hrsg.), Opfer und Täterinnen, Nördlingen<br />
1987, S. 196<br />
9<br />
Werner, Paul, Die Einweisung in die polizeilichen Jugendschutzlager,<br />
in: Deutsches Jugendrecht, Heft 4,<br />
Berlin 1944, S. 103<br />
10<br />
Akte zum Jugendlichen N.S. in: Archiwum Panstwo-<br />
wego w. Katowicach, Prov. Verw.. Kat.; Nr. 5508<br />
11 Vgl. Akte zum Jugendlichen Kasimir T. in: Archiwum<br />
Panstwowego w. Katowicach, Prov. Verw.. Kat.; Nr. 5557;<br />
sowie: Quellen: Lagerbuch Moringen beim Internationa-<br />
len Suchdienst Arolsen; Totenliste im Moringer-Magist-<br />
rats-Archiv; Begräbnisregister im Moringer-Magistrats-<br />
Archiv; sowie Sterberegister, in: HSTA Hannover Nds.<br />
721 Göttingen Acc 93/79<br />
12 Vgl. die Anordnung der „polizeilichen Vorbeugungs-<br />
haft“ vom 11.01.1940 gegenüber dem 1921 geborenen<br />
Häftling des Jugend-KZs Moringen; Akte in: Archiv des<br />
Westfälischen Instituts für Regionalgeschichte Münster,<br />
ohne Signatur<br />
13<br />
ebd.<br />
14 Akte zu Franziska B. in: Archiwum Panstwowego w<br />
Katowicach, Prov. Verw. Kat. 6739, S. 2<br />
15 Kappeler, Manfred, Der schreckliche Traum vom voll-<br />
kommenen Menschen. Rassenhygiene und Eugenik in<br />
der Sozialen Arbeit, Marburg 2000<br />
16 Vgl. hierzu u.a.: G. Leonhard, Die vorbeugende Ver-<br />
brechensbekämpfung im nationalsozialistischen Staat<br />
und ihre Lehren für die Zukunft, Neckargemünd 1952;<br />
W. Lüders, Die Jugend-Bewahrung - eine Lösung des<br />
Problems der Behandlung minderjähriger Schwerster-<br />
ziehbarer, in: Monatsschrift für Kriminologie und Straf-<br />
rechtsreform, 42. Jhrg., Berlin/Köln 1959, S. 156 - 166;<br />
H. Petersen, Die Jugendbewahrung, Göttingen 1959; F.<br />
Schaffstein, Jugendstrafrecht, S. 53; F. Wieking, Die Ent-<br />
wicklung der weiblichen Kriminalpolizei in Deutschland<br />
von den Anfängen bis zur Gegenwart, Lübeck 1958<br />
14 . Nr.63 . SIT<br />
SIT . Nr.63 . 15<br />
historische und aktuelle diskurse
Hilfe – ein Hauptwort der Sozialen Arbeit,<br />
vielleicht das<br />
Hauptwort, von dem sich das<br />
Selbstverständnis dieses „helfenden Berufs“<br />
ableitet. die großen Gesetze, die das sozialar-<br />
beiterische Handeln, seine Organisationsfor-<br />
men und Institutionen in Deutschland rechtlich<br />
regeln, tragen dieses Wort im Titel: Kinder- und<br />
Jugendhilfegesetz,<br />
Bundessozialhilfegesetz.<br />
Fast alle Praxisbereiche definieren sich über<br />
„Hilfe“: Jugendhilfe, Sozialhilfe, Drogenhilfe,<br />
Suchtkrankenhilfe, Altenhilfe, Bewährungs-<br />
hilfe, Jugendgerichtshilfe, Gesundheitshilfe,<br />
Hilfen zur Erziehung, Hilfen für Menschen mit<br />
Behinderungen, Hilfen in besonderen Lebens-<br />
lagen usw., usw. Und alle diese Hilfen sollen<br />
sich realisieren in der Gestalt von „helfenden<br />
Beziehungen“.<br />
Eine der in der Frühzeit der Sozialen Arbeit<br />
bedeutenden Zeitschriften, die von 1895 bis<br />
1943 erschien und unter anderem von Gertrud<br />
Bäumer, neben Alice Salomon meines Erach-<br />
tens die wichtigste Person der „Gründerzeit“<br />
unseres Berufs, herausgegeben wurde, hieß<br />
„Die Hilfe“, und auch der Verlag, in dem sie<br />
erschien, hatte diesen Titel. Käthe Kollwitz<br />
stellte den Publikationen dieses Verlags ihre,<br />
das proletarische Massenelend beklagenden,<br />
Grafiken zur Verfügung.<br />
In der Etymologie hat das Wort vom Althoch-<br />
deutschen bis heute eine Konnotation des<br />
Guten und Edlen, des Menschenfreundlichen<br />
und der Nächstenliebe. Es bedeutet: Unter-<br />
stützung, Beistand zur Rettung, zum Über-<br />
gang aus einer schlechteren Lage in eine<br />
bessere, Befreiung aus üblen Umständen. Der<br />
Helfer/die Helferin sind Beistand und Rettung<br />
Gewährende. Die Hilfeleistung<br />
wird als eine<br />
eilende, freiwillige, mitleidendliche Handlung<br />
beschrieben und ein Hilfloser ist der Mensch,<br />
der Hilfe entbehren muß und der sich nicht<br />
selbst helfen kann. Paulus erinnert uns im<br />
Hebräer-Brief daran, daß jeder Mensch in eine<br />
Lage kommen kann, in der er Hilfe benötigt:<br />
„Auf daß wir Barmherzigkeit empfangen und<br />
historische und aktuelle diskurse<br />
Manfred Kappeler<br />
Im Zeichen der „Hilfe“<br />
Wiedersprüche und Ambivalenzen der Sozialen Arbeit erläutert an Beispielen<br />
aus Geschichte und Gegenwart<br />
Gnade finden, auf die Zeit, wenn uns Hilfe not<br />
sein wird“ und Schiller bringt die Skepsis darüber<br />
zum Ausdruck, ob wir, wenn es nötig ist,<br />
auch wirklich Hilfe bekommen werden. „Ja, Du<br />
bist gut und hilfreich, dienest allen, und wenn<br />
Du selbst in Not kommst hilft Dir keiner“. Daß<br />
„Hilfe“ nicht so eindeutig gut ist, wie die Wortgeschichte<br />
es uns nahe legt, zeigen Sprichwörter<br />
und Sentenzen, in denen „Hilfe“ als eine<br />
Bedrohung erscheint, „Wehedem, der Hilfe<br />
braucht!“ oder „Hilf Dir selbst – sonst wird Dir<br />
geholfen“ und „Dem ist nicht mehr zu helfen“,<br />
und auch die Drohung „Ich werde Dir helfen“<br />
im Sinne von „Ich werde Dir Beine machen“,<br />
um jemanden zu veranlassen, etwas zu tun<br />
oder nicht zu tun. In dem in der Sozialen Arbeit<br />
geläufigen Begriff „Hilfsmaßnahme“ – fast<br />
alle Hilfe wird in der Form von „Maßnahmen“<br />
gewährt – kommt ebenfalls der Januskopf von<br />
„Hilfe“ als Unterstützung und Kontrolle in Einem<br />
zum Vorschein: Jemanden „maßnehmen“<br />
heißt, ihn autoritär von oben herab, aus einer<br />
Machtposition heraus zu beurteilen, zu messen<br />
eben, an Kriterien, über die der „Maßnehmende“<br />
verfügt. Er hat die Definitionsgewalt über<br />
Inhalte, Gestalt und Ausmaß der Hilfe, kann sie<br />
gewähren oder verweigern. Eine „Maßnahme“<br />
ist ein obrigkeitlicher Akt, der den der Hilfe bedürftigen<br />
zum Objekt der Fremdbestimmung<br />
macht. Das meiste dessen, was unter dem erhabenen<br />
Titel „helfende Beziehung“ geschieht,<br />
hat noch immer diesen Charakter. Auf den paternalistischen<br />
Gestus von „Hilfen“ reagierte<br />
Immanuel Kant, indem er „Barmherzigkeit“ als<br />
„beleidigende Art des Wohltuens“ ablehnte<br />
und alternativ ein zu „tätigem und vernünftigem<br />
Wohlwollen“ förderliches Mit-Leiden<br />
vorschlug. Nietzsche hält die Barmherzigkeit<br />
für einen schädigenden pathologischen Effekt.<br />
Sie sei „weichlicher Egoismus“, vermehre die<br />
Leiden in der Welt und entehre die Leidenden.<br />
Seinen Zarathustra läßt er sagen: „Wahrlich ich<br />
mag sie nicht, die Barmherzigen, die selig sind<br />
in ihrem Mitleiden: Zu sehr gebricht es ihnen<br />
an Scham.“ Er meint damit die selbstgewisse<br />
bornierte Aufdringlichkeit von Helfenden, die<br />
die mit Scham verbundene Hilflosigkeit, Not<br />
und Armut des Bedürftigen schamlos mißachten,<br />
indem sie ihm mit ihren ach so gut gemeinten<br />
Hilfe-Angeboten „auf den Leib rücken“ und<br />
erzürnt sind, wenn der so Bedrängte zurückweicht<br />
und die angebotene Hilfe ablehnt.<br />
Barmherzigkeit ist nur dann eine Tugend, wenn<br />
sie Ausdruck der Nächstenliebe ist. Ihr Leitspruch<br />
lautet: Hilfe hat kein Warum. Im alten<br />
Testament heißt es: Jahwe will Barmherzigkeit<br />
unter den Menschen: Daß jeder etwas zu essen<br />
hat, für den Mitmenschen gesorgt wird, daß er<br />
am Leben bleibt und nicht ausgeliefert wird!<br />
Dieses Verständnis von Hilfe ist von einem Gottesbild<br />
inspiriert, in dem der Allmächtige bedingungslos,<br />
das heißt unabhängig von allem<br />
Verdienst, den Menschen annimmt. Sich-Erbarmen<br />
in diesem theologischen Sinne bedeutet<br />
das erwartungslose und bedingungslose Sich-<br />
Entgegenkommen in den zwischenmenschlichen<br />
Beziehungen. Auf der Empfängerseite<br />
von Hilfe bedarf es keines „positiven Wertes“,<br />
keines „Anspruchs“: Ausschlaggebend<br />
für das helfende Handeln ist allein die Not<br />
des anderen, das Resultat einer Zerstörung,<br />
marginalisierende Lebensbedingungen und<br />
schließlich der drohende Tod. In dieser radikalen<br />
Auffassung von Helfen als voraussetzungsloser<br />
Nächstenliebe gibt es keine Spaltung<br />
von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit: Die<br />
Gerechtigkeit gibt rein distributiv einem jeden<br />
was er verdient hat (angeblich). In diesem Verhältnis<br />
wird Barmherzigkeit zur nachsichtigen<br />
Milde herabgewürdigt, die bereitwilliger wird,<br />
wenn der „Bedürftige“ sich bemüht, die an ihn<br />
gestellten Anforderungen zu erfüllen. Die sich<br />
so verstehende „Hilfe“ richtet an den „gefallenen<br />
Menschen“ die Forderung nach Umkehr<br />
und erst, wenn er Bereitschaft zur Besserung<br />
signalisiert, wird ihm geholfen. Wenn Barmherzigkeit<br />
und Gerechtigkeit voneinander geschieden<br />
werden, wird die Erhaltung von Gesetz<br />
und Ordnung zum Grundmuster von Hilfe.<br />
Das zeigt die gegenwärtige Debatte um den<br />
„Umbau“ des Sozialstaats: Die Einführung von<br />
sogenannten Niedrig-Lohngruppen verbunden<br />
mit dem „Lohnabstandsgebot“ der Sozialhilfe,<br />
der Vorwurf von „Arbeitsunwilligkeit“ gegenüber<br />
EmpfängerInnen von Arbeitslosengeld/<br />
Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe verbunden mit<br />
16 . Nr.63 . SIT<br />
SIT . Nr.63 . 17<br />
der Drohung, diese Leistungen zu kürzen, spie-<br />
geln diese Auffassung von „Gerechtigkeit“<br />
spie-historische im<br />
Zusammenhang mit Hilfe wider. Handlungen,<br />
die diese Ordnung verletzen, können als „Feh-<br />
ler“ im Einzelfall schon mal verziehen werden,<br />
aber der Erhalt der Ordnung darf durch die ra-<br />
dikale Nächstenliebe nicht gefährdet werden.<br />
Die „Hilfe“ darf allenfalls Mängel kompensie-<br />
ren, und wenn die Mittel reichen, auch „Lö-<br />
cher stopfen“. Das biblische Grundmuster von<br />
Barmherzigkeit ist demgegenüber radikal-re-<br />
volutionär: Den Notleidenden muß immer Recht<br />
verschafft werden, die Hilfe ist durch seine Not<br />
und durch nichts anderes gerechtfertigt. Dar-<br />
aus resultiert eine Sozialethik, in deren Mittel-<br />
punkt der Mensch als der „Nächste“ steht. Der<br />
Nächste ist der, der Hilfe braucht und von dem<br />
man kein Gegengeschenk erwarten kann. Ihm<br />
gegenüber ist keine Güterabwägung statthaft,<br />
denn in der ihm gebotenen Hilfe realisiert sich<br />
die jedem Menschen zukommende Würde. Hil-<br />
fe so verstanden, kann keine sozialen, religiö-<br />
sen oder rassischen Schranken anerkennen. In<br />
der Ethik des Alten Testaments wird der Frem-<br />
de, der im Lande lebt, ausdrücklich der ge-<br />
genseitigen Achtung und Fürsorge unterstellt<br />
und in den Geltungsbereich des Liebesgebots<br />
einbezogen. In der „Theologischen Realen-<br />
zyklopädie“ (TRE), Berlin 1994 wird über die<br />
Reichweite von Hilfe nachgedacht. Es sei zwar<br />
ethisch und philosophisch richtig, zuerst den<br />
situationsethischen Standpunkt im Nahbereich<br />
einzunehmen, bevor man ihn mit weiter aus-<br />
greifenden Taten der Hilfe überschreitet. Die<br />
Entwicklung der Weltlage erfordere heute aber<br />
eine Erweiterung der Auffassung von „Nah<br />
und Fern“. Heute können wir von unserem er-<br />
reichten historischen Standort aus auch noch<br />
die „Fernsten“ als „Nächste“, als unsere Hilfe<br />
beanspruchende Menschen erkennen. Diese<br />
„Horizonterweiterungen“ verlangen eine Per-<br />
spektive „globaler Mitmenschlichkeit“. „Mit-<br />
mensch ist zwar zunächst der Nächste, der mir<br />
im wörtlichen Sinne nahe ist, so daß mich sein<br />
Anspruch unmittelbar und konkret betroffen<br />
machen kann (TRE, Stichwort: Nächster) und<br />
dem ich konkrete Hilfe leisten kann, aber die<br />
BewohnerInnen der Erde „sind einander im<br />
globalen Sinne Nächste geworden“. Mitmensch<br />
ist heute jeder, der Menschenantlitz trägt und<br />
prinzipiell mein Nächster“ werden kann (eben-<br />
da). Diese Sichtweise, die sich im Kontext des<br />
historische und aktuelle diskurse
sich in der Moderne allmählich durchsetzen-<br />
den sozialen und rechtlichen Gleichheitspostu-<br />
lats entwickelt hat, wird aber tagtäglich durch<br />
die „Horizonte“ totalitärer, patriarchaler und<br />
kapitalistischer Ordnungen eingeschränkt und<br />
an ihrer Realisierung gehindert. Die univer-<br />
salen Menschenrechte verlangen heute, daß<br />
jeder, der sie benötigt, die ihm angemessene<br />
„Hilfe“ zur Realisierung seiner Personalität<br />
bekommt. In der TRE heißt es dazu: „Das be-<br />
deutet auch, jeden der Hilfe zu solcher Selbst-<br />
verwirklichung braucht, in seinem Anderssein,<br />
in seiner Besonderheit anzuerkennen und zu<br />
fördern.“ Die politische und soziale Universali-<br />
tät dieser Auffassung vom Nächsten beinhaltet<br />
eine „verpflichtende Zuordnung von Menschen<br />
zueinander, jenseits von subjektiver Sympathie<br />
und Antipathie. Der Fremde wird zu meinem<br />
Nächsten umgeschaffen! Bei aller Bedeutung<br />
des konkreten Begegnungscharakters erstreckt<br />
sich die Dimension der Nächstenschaft von der<br />
mikrosozialen bis zur universalen Mitmensch-<br />
lichkeit“. (TRE a.a.o.)<br />
Liebe Kolleginnen und Kollegen,„Hilfe” beruht<br />
in der Sozialen Arbeit weitgehend auf der<br />
beanspruchten und praktizierten Definitions-<br />
macht der Professionellen und der durch sie<br />
repräsentierten Institutionen über die Leiden<br />
und das Wohlergehen der Menschen, die auf<br />
„Hilfe” angewiesen sind und sie wollen, aber<br />
auch der Menschen, die als „Hilfebedürftige”<br />
definiert werden, sich selbst aber nicht so se-<br />
hen und die „Hilfe” auch nicht wollen. Diese<br />
Definitionsmacht kommt ohne klassifizierendes<br />
Denken nicht aus. Es reproduziert und trans-<br />
portiert die hegemonialen Zuschreibungen, die<br />
normativen Erwartungen an das individuelle<br />
Handeln und die aus diesen – meist verborge-<br />
nen – Maßstäben hergeleiteten Beurteilungen,<br />
Wertungen über das „Gelingen“ oder „Schei-<br />
tern“ individueller Existenz.<br />
Die TheologInnen und SozialethikerInnen Ul-<br />
rike Suhr und Hans-Jürgen Benedict an der<br />
Hamburger Evangelischen Fachhochschule<br />
für Soziale Arbeit reflektieren in einer Dialog-<br />
Predigt zum fünfundzwanzigsten Jubiläum<br />
der Fachhochschule meines Erachtens genau<br />
dieses Paradigma der Sozialen Arbeit, das ich<br />
als die „Zumessung“ des den sogenannten<br />
KlientInnen als „angemessen“ zugestandenen<br />
„Wohlseins“ in Inhalt und Ausmaß bezeichnen<br />
möchte.<br />
diskursesich in historische und aktuelle diskurse<br />
Die Jesus salbende Frau in Bethanien (Markus<br />
14, 3-9) durchbricht mit ihrem non-konformistischen<br />
Handeln nicht nur die aus der symbolischen<br />
Ordnung der Zweigeschlechtigkeit resultierenden<br />
Rollenzuschreibungen an Frauen<br />
in patriarchalen Gesellschaften, sie mißachtet<br />
mit ihrer nicht dosierten Gabe an Christus den<br />
Nicht-Seßhaften, den Menschen ohne Obdach,<br />
das schon erwähnte Lohn-Abstandsgebot der<br />
Sozialhilfe, das die selbsternannten „Modernisierer“<br />
des Sozialstaats gegenwärtig wieder<br />
einmal verschärfen wollen. Niedriglohngruppen<br />
fordern sie und die Absenkung der Sozialhilfe,<br />
um zu diesen Hungerlöhnen den Abstand<br />
zu halten und es interessiert sie nicht, daß § 1<br />
BSGH die Mittel zur Gestaltung eines „menschenwürdigen<br />
Lebens“ verspricht. Sie beanspruchen<br />
die Definitionsmacht darüber, was<br />
menschenwürdiges Leben heute sein darf.<br />
Ulrike Suhr nennt in der Dialog-Predigt über die<br />
„salbende Frau“ die Wirkungen dieser Definitionsmacht<br />
die „kalkulierende, kostenbewußte<br />
Begrenzung und Zerstörung von Lebensmöglichkeiten“<br />
und fordert uns auf, dagegen sozialarbeiterisch-diakonisch<br />
zu protestieren. Wir<br />
sollen in Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit<br />
dieses „Zumessungs-Paradigma“ in der Theorie<br />
de-konstruieren und im Handeln außer Kraft<br />
setzen, die Mischung aus „Mildtätigkeit und<br />
Strenge“, die sparsame Mildtätigkeit und die<br />
auf Ordnung bestehende Strenge aus unserem<br />
beruflichen Selbst-Verständnis verabschieden,<br />
damit wir fähig werden, „zu einem Handeln<br />
jenseits aller Konventionen“ und zum „Protest<br />
gegen das Diktat der Berechnung“ (Ulrike<br />
Suhr). In der diese Dialog-Predigt abschließenden<br />
Sentenz sagt Hans-Jürgen Benedict:<br />
„Daß die Armen auch ein Recht zu leben haben,<br />
wird schwerlich jemand bestreiten (obwohl<br />
auch das immer wieder geschieht). Aber daß<br />
es ihnen gut gehen soll oder sogar vorzüglich,<br />
das darf nicht sein. Der Arme soll spüren, daß<br />
er schuldhaft etwas versäumt hat. Immer noch<br />
ist Soziale Arbeit/Diakonie mit ihren knappen<br />
Mitteln Vermittlerin dieser Botschaft: Wenn ich<br />
Dir Armen etwas gebe, mußt Du Dich ändern.<br />
Nicht die Verhältnisse müssen sich ändern<br />
(Arme soll es nicht geben) nein, zuerst Du und<br />
deswegen darf es Dir nicht gut gehen.“<br />
Liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Sozialen<br />
Arbeit, bei „öffentlichen“ und „freien“ Trägen,<br />
in Initiativen und Projekten, wird immer wieder<br />
versucht, den strukturellen Widerspruch der<br />
Sozialen Arbeit von „Hilfe und Unterstützung“,<br />
und von „Kontrolle/Disziplinierung“ aufzulösen,<br />
indem auch Unterdrückung, Kontrolle und<br />
Disziplinierung als „Hilfe“ definiert werden.<br />
Diese ideologische Um-Interpretation, notwendige<br />
Legitimation fragwürdigen Handelns mit<br />
dem Ziel der Aufrechterhaltung „beruflicher<br />
Identität“, begegnet uns alltäglich in vielen<br />
Bereichen der Sozialen Arbeit: in der Drogenhilfe,<br />
der Strafrechtspflege, der Psychiatrie, in<br />
wirtschaftlichen Hilfen, der Arbeit mit alten<br />
Menschen und selbst noch in ihrem freiesten<br />
Bereich, der Kinder- und Jugendarbeit nach<br />
§ 11 KJHG. In den Spuren Wicherns und Pestalozzis<br />
und der vielen anderen „Väter und Mütter“<br />
der Sozialen Arbeit werden Strategien der<br />
„Normalisierung“ und wird das Normative, auf<br />
das sie sich beziehen, mit der Begrifflichkeit<br />
von „Abweichung“ und „Anpassung“ definiert<br />
und im beliebten Gefahren- und Gefährdungsjargon<br />
des Präventionsparadigmas als Schutz,<br />
als Unterstützung, als Hilfe ausgegeben. Von<br />
den Anfängen bis heute können die Hauptlinien<br />
der Sozialen Arbeit als eine Strategie der<br />
Dominanzkultur zur Aufrechterhaltung des<br />
„Wertekonsens“ im „Dienst“ der „gesellschaftlichen<br />
Mitte“ gelesen werden.<br />
Seit jeher konstituiert sich das berufliche<br />
Selbstverständnis der in der Sozialen Arbeit<br />
Tätigen über die zentrale Kategorie „Hilfe“, mit<br />
der alles Handeln als „Helfen“ schon im Voraus,<br />
dann im Vollzug und schließlich im Nachhinein<br />
legitimiert ist. In der kirchlichen Sozialarbeit<br />
wird das „Helfen“ noch zum „Dienen“, die „Hilfe“<br />
zum „Dienst“ überhöht und den diakonischen<br />
MitarbeiterInnen die gewerkschaftliche<br />
Organisation und das Tarifrecht verweigert mit<br />
der Begründung, daß der kirchliche Träger kein<br />
Arbeitgeber und die MitarbeiterInnen keine<br />
ArbeitnehmerInnen seien (Bezeichnungen,<br />
die ja auch schon die Verhältnisse ideologisch<br />
auf den Kopf stellen), sondern alle miteinander<br />
eine „Dienstgemeinschaft“.<br />
Mit der Kategorie „Hilfe“ wird in der Sozialen<br />
Arbeit Identitätspolitik betrieben, um jenseits<br />
der Widersprüche und Ambivalenzen in Theorie<br />
und Praxis für die in ihr beruflich Handelnden<br />
über das Bewußtsein der Zugehörigkeit<br />
zu einer Profession, die sich selbst als den gesellschaftlichen<br />
Ort der „Hilfe“ definiert, eine<br />
18 . Nr.63 . SIT<br />
SIT . Nr.63 . 19<br />
stabile berufliche Identität zu erwerben, die historische für ein auf Jahrzehnte bemessenes sogenann-<br />
tes Berufsleben halten soll, dem immer dro-<br />
henden Born-Out vorbeugen soll. Dieser Beruf<br />
sei in seinen diversen, die ganz Gesellschaft<br />
durchziehenden Handlungsfeldern, der Würde<br />
des Menschen und den Menschenrechten ver-<br />
pflichtet, wird behauptet und stehe in den ma-<br />
kellosen Traditionen christlicher Liebestätig-<br />
keit, humanistischer und sozialistischer Ideale.<br />
Christentum, Humanismus und Sozialismus<br />
und die ihnen zugehörigen sozialen Bewegun-<br />
gen seien die weltanschaulichen „Schutz- und<br />
Trägermächte“ der Sozialen Arbeit, die sich<br />
immer auf der Seite des Fortschritts engagiert<br />
hätten und mit ihnen die Soziale Arbeit selbst.<br />
Mit diesem tradierten Selbstverständnis ist<br />
das die Geschichte der Profession durchzie-<br />
hende klassifizierende und sozial-rassistische<br />
Denken und Handeln nicht vereinbar. Ein<br />
Selbst-Verständnis, das seine Eckpunkte in den<br />
Kategorien von Hilfe, Nächstenliebe, Selbst-<br />
losigkeit und Opfer findet, verbunden mit der<br />
Vorstellung, daß sich professionelle „Hilfe“<br />
jenseits aller Politik den „notleidenden und<br />
bedürftigen Mitmenschen“ zuwende, droht<br />
zusammenzubrechen, wenn es die Blindheit<br />
gegenüber dem eigenen Verstricktsein und<br />
der eigenen Komplizenschaft (Hannah Arendt)<br />
mit den Strukturen aufgibt, die die Aufrecht-<br />
erhaltung von Herrschaft, die Verteilung des<br />
gesellschaftlich produzierten Reichtums, die<br />
kulturelle Teilhabe jedes und jeder Einzelnen<br />
in dieser Gesellschaft bestimmt.<br />
Die De-Konstruktion des in der Sozialen Arbeit<br />
dominierenden Begriffs von „Hilfe“, würde<br />
deutlich machen, daß er „keine eigene, von<br />
der Sozialen Arbeit als Handlungsnorm be-<br />
ziehungsweise als Leitvorstellung selbstdefi-<br />
nierte Bedeutung hatte (hat), sondern ein in<br />
wechselnden politischen und weltanschauli-<br />
chen Konstellationen beliebig zu verwenden-<br />
der Joker war und ist, ein in jeder Lage hilfrei-<br />
cher Legitimationsbegriff, der bislang nie die<br />
Dignität eines an nicht austauschbare Inhalte<br />
gebundenen Imperativs erreichte“ (Kappeler<br />
2000, S. 633ff.)<br />
Daß die dominante Geschichtsschreibung in<br />
der Sozialen Arbeit weitgehend den Mythos<br />
von der helfenden Profession bedient und zu<br />
wenig ihr tradiertes Selbstverständnis de-kon-<br />
struiert, liegt meines Erachtens an einer ungehistorische<br />
und aktuelle diskurse
nügenden „Trennschärfe“ bezogen auf die nor-<br />
mative und die pragmatisch-praktische Ebene<br />
der Sozialen Arbeit. Diese „Verwischung“ führt<br />
dazu, daß die von den AutorInnen für die Ge-<br />
genwart der Sozialen Arbeit propagierten Leit-<br />
vorstellungen a-historisch der Profession und<br />
ihrer Geschichte in toto unterstellt werden.<br />
Die in den Begriffen von Menschenwürde und<br />
Menschenrechten zusammengefaßten ethi-<br />
schen Leitvorstellungen werden von einer<br />
identitätspolitischen<br />
Geschichtsschreibung<br />
in Vergangenheit und Gegenwart nur als von<br />
außen bedroht angesehen und ihre unzurei-<br />
chende Realisierung in der professionellen<br />
Praxis beziehungsweise ihre Verkehrungen in<br />
das gerade Gegenteil werden entweder als<br />
politisch-ideologische Instrumentalisierungen<br />
beziehungsweise Funktionalisierungen oder<br />
als Ausdruck individueller Bewußtseinsdefizi-<br />
te von Professionellen beschrieben. Die immer<br />
wieder zu beobachtende In-Eins-Setzung von<br />
normativen Leitideen und realisierter Praxis<br />
führt dazu, daß für Widersprüche und Um-<br />
kehrungen im Verhältnis von Leitnormen und<br />
Praxis nur noch Kräfte von außen, die mit Ge-<br />
walt und List die Soziale Arbeit um ihr „Eige-<br />
nes“ bringen, verantwortlich gemacht werden<br />
können. Es ist mithin das „Fremde“, daß das<br />
„Eigene“ korrumpiert. In dieser Sichtweise ist<br />
das „Eigene“ im konkreten Falle lediglich zu<br />
unaufmerksam, zu schwach oder zu verführbar<br />
und dem großen politischen Kräftespiel unter-<br />
legen. Soziale Arbeit und die in ihr Handelnden<br />
werden in dieser Sichtweise zu Opfern von<br />
Verhältnissen, die sie angeblich selbst kaum<br />
beeinflussen können, und ihre Täterschaft be-<br />
ziehungsweise Mit-Täterschaft kommt nicht<br />
in den selbst-kritischen Blick. Selbstverständ-<br />
lich ist heute allen, die sich überhaupt mit<br />
der Geschichte der Sozialen Arbeit befassen,<br />
bekannt, daß auch Kontrolle, Disziplinierung,<br />
Ausgrenzung, Fremdbestimmung, ja sogar<br />
Beteiligung an der Vernichtung von Menschen<br />
zu dieser Geschichte gehörten und gehören,<br />
aber diese „Schattenseiten“ werden nicht als<br />
zu ihrem „Eigenen“ gehörend verstanden, son-<br />
dern als Verirrungen und Verführungen durch<br />
Zumutungen von „außen“ gesehen. Was im<br />
widersprüchlichen und ambivalenten Handeln<br />
einzelner Professioneller und einzelner Institu-<br />
tionen noch gesehen wird, die dialektische Ver-<br />
schlingung von Emanzipation und Herrschaft,<br />
diskursenügenden historische und aktuelle diskurse<br />
wird im Blick auf die Profession als Ganzes und<br />
auf ihre Geschichte ausgeblendet.<br />
Die Instrumentalisierungsthese hat in der<br />
Geschichtsschreibung der Sozialen Arbeit zu<br />
einer Dichotomisierung geführt, die „gut“ und<br />
„böse“ im Prinzip jeweils eindeutig bestimmten<br />
Personen, Organisationen und politischen<br />
Verhältnissen zuordnet in dem Bestreben, die<br />
die Soziale Arbeit bislang durchziehenden<br />
Ambivalenzen aufzulösen, mit dem Ziel, den<br />
Studierenden und PraktikerInnen der Sozialen<br />
Arbeit – aber auch sich selbst? – die positive<br />
Identifikation mit einem an Menschenrechten<br />
und KlientInnenautonomie orientierten<br />
Hauptstrang in der Berufsgeschichte zu ermöglichen,<br />
als vermeintlich notwendige Voraussetzung<br />
für eine positive berufliche Identität. Das<br />
„Fremde“ wird als bedrohliche Kraft mit Instrumentalisierungsabsichten,<br />
als Projektionsfläche<br />
für Funktionen und Praktiken, die nicht<br />
zum gewünschten positiven Selbst-Berufsbild<br />
der Sozialen Arbeit passen, genommen.<br />
Dafür spricht auch die Hypostasierung der<br />
Sozialen Arbeit als einer „Menschenrechtsprofession“,<br />
die „wie keine andere“ den „Rechten<br />
und der Autonomie der Menschen“ (Engelke)<br />
verpflichtet sei. Dem Postulat, daß Soziale<br />
Arbeit sich an den politischen und sozialen<br />
Menschenrechten orientieren soll, kann ich<br />
ohne Einschränkungen zustimmen, gehe aber<br />
davon aus, daß dieses Postulat als ethische<br />
Leitvorstellung genauso für andere Professionen<br />
gilt und von ihnen auch beansprucht wird,<br />
sofern sie mit ihrem Handeln unmittelbar in<br />
die Lebensgestaltung von Individuen unter<br />
der Überschrift „Hilfe“ eingreifen, wie zum<br />
Beispiel MedizinerInnen, JuristInnen, PsychotherapeutInnen<br />
etc. Die Selbsterklärung der<br />
Sozialen Arbeit zu einer besonderen „Menschenrechtsprofession“<br />
ist aus meiner Sicht<br />
weder durch die Summe der Praxisvollzüge<br />
gedeckt, noch im Vergleich mit anderen Professionen,<br />
mit denen oft genug kooperiert werden<br />
muß, berechtigt und für die Kooperation nicht<br />
förderlich. Es handelt sich meines Erachtens<br />
um eine zum „Identitätsprojekt“ gehörende<br />
Selbststilisierung.<br />
Liebe Kolleginnen und Kollegen, die immer<br />
umfassender und gleichzeitig detaillierter werdenden<br />
Studien zur Berufsgeschichte zeigen<br />
deutlich, daß Passung und Anpassung das Denken<br />
und Handeln der Personen, Institutionen<br />
und Organisationen der Sozialen Arbeit überwiegend<br />
bestimmen und nicht Distanzierung,<br />
Kritik, Verweigerung und Widerstand. Für die<br />
verschiedenen Ebenen der Selbst-Reflexion<br />
der Sozialen Arbeit kommt es meines Erachtens<br />
darauf an, die nicht mehr zu leugnenden<br />
historischen Befunde als Belege für die Mit-Täterschaft<br />
der Sozialen Arbeit zu verstehen, die<br />
Gründe für Beteiligung, Komplizenschaft und<br />
Verstrickung zu erforschen und nach Wegen zu<br />
suchen, die sich den postulierten Leitnormen<br />
und Zielen annähern: Selbstaufklärung statt<br />
Identitätspolitik.<br />
Das berufliche Handeln bedarf besonders in<br />
den sogenannten helfenden Berufen, die unmittelbar<br />
auf die individuelle Lebensgestaltung<br />
von Menschen einwirken, ethischer Normen,<br />
die für die Angehörigen solcher Berufe<br />
moralisch handlungsleitend werden sollen.<br />
Diese Normen müssen von der Profession als<br />
Ganzes aber auch gesellschaftlich vertreten<br />
werden und gegenüber den widerstreitenden<br />
Mächten verteidigt werden. Sie müssen, sollen<br />
sie praktische Bedeutung erlangen und nicht<br />
nur<br />
ideale Orientierungen für Einzelne bleiben,<br />
in den gesellschaftlichen Handlungsfeldern der<br />
Sozialen Arbeit, in denen sich viele Interessen<br />
begegnen und überschneiden, auch politisch,<br />
als Kritik an Herrschaftsstrukturen und verhärteten<br />
Handlungsmustern und als nicht-affirmative<br />
bewahrende Praxis in Handeln umgesetzt<br />
werden.<br />
Die Handelnden sind die gegenwärtig professionell<br />
in der Sozialen Arbeit Agierenden, als<br />
einzelne und in Zusammenschlüssen. Was die<br />
Profession ausmacht, entsteht aus der Summe<br />
dieses Handelns. Die Profession, also ihre Organisationen<br />
und Institutionen – in welcher Form<br />
auch immer sie sich materialisieren – darf die<br />
Verwirklichung ethischer Normen als Handlungsmaximen<br />
nicht an die einzelnen Professionellen<br />
delegieren, denn sie ist der Rahmen, in<br />
dem diese handeln.<br />
Die einzelnen Professionellen wiederum dürfen<br />
ihrerseits die ethisch-moralische Verantwortung<br />
für ihr individuelles berufliches Handeln<br />
nicht an die Meta-Ebene einer scheinbar<br />
übergeordneten Gesamt-Profession – an den<br />
„ideellen Gesamtsozialarbeiter“ – abgeben,<br />
denn beide leben voneinander: die Individuen<br />
von der Profession, die Profession durch die<br />
Beispiel 1: Das eugenische Paradigma in der<br />
Sozialen Arbeit<br />
Das eugenische Paradigma bestimmte wesent-<br />
lich die sozialpolitischen, fürsorgepolitischen,<br />
gesundheitspolitischen und kriminalpoliti-<br />
schen Diskurse – die viele Überschneidungen<br />
untereinander hatten – vom Ende des neun-<br />
zehnten Jahrhunderts bis zur Machtübernah-<br />
me der Nationalsozialisten in Deutschland<br />
1933. Der NS-Staat bündelte diese Diskurslini-<br />
en, trieb sie mit seiner rassistischen Bevölke-<br />
rungspolitik auf die Spitze und gab ihnen eine<br />
„flächendeckende“ technokratisch-hocheffek-<br />
tive Organisationsform (Gesetz zur Verhütung<br />
des erbkranken Nachwuchses 1933 / Nürnber-<br />
ger Rassengesetze 1935), gegen die es so gut<br />
wie keinen Widerstand gab. Alle Bereiche der<br />
Sozialen Arbeit waren in die nationalsozialis-<br />
tische Klassifizierungs- und Vernichtungsma-<br />
schinerie involviert.<br />
Julius Tandler (1869-1936), ein bis heute pro-<br />
minenter österreichischer sozialistischer Für-<br />
sorgepolitiker, 1919 Staatssekretär des Staats-<br />
amtes für Soziale Fürsorge und ab 1922 Leiter<br />
des international als vorbildlich berühmten<br />
Wohlfahrtsamtes der Stadt Wien schrieb 1924,<br />
neun Jahre vor Beginn der NS-Herrschaft in<br />
Deutschland und vierzehn Jahre vor dem An-<br />
schluß Österreichs an dieses Deutschland:<br />
„Rund achtzig Milliarden betragen die Ausga-<br />
ben für die geschlossene Armenpflege, also für<br />
Versorgungshäuser, das ist für jene Menschen,<br />
die im Leben Schiffbruch erlitten haben und<br />
ihre letzten Tage auf Kosten der Allgemeinheit<br />
in dazu bestimmten Anstalten verbringen, ge-<br />
wiß gerecht und human, aber sicher nicht pro-<br />
duktiv. Und vierundvierzig Milliarden kostet die<br />
Irrenpflege, gewiß nicht produktiv und umso<br />
irrationaler, als ein Großteil der Menschen, die<br />
in Irrenanstalten ihr Leben verbringen, dorthin<br />
kommen auf Grundlage jener Schäden, welche<br />
20 . Nr.63 . SIT<br />
SIT . Nr.63 . 21<br />
Individuen. Nur wenn die Individuen sich als historische politische Subjekte verstehen, kann die Organi-<br />
sation politische Kraft entfalten und nur wenn<br />
sie dieses kann, müssen sich die Individuen<br />
nicht im ethisch-moralischen Einzelkämpfer-<br />
tum erschöpfen.<br />
Jeder Ethik-Kodex der Berufsverbände bliebe<br />
wirkungslos, wenn er (psychoanalytisch gese-<br />
hen) zum „Über-Ich“ verkommen würde.<br />
historische und aktuelle diskurse
sie sich selbst erworben haben durch Syphilis<br />
und Alkohol oder welche ihre Eltern ihnen mit-<br />
gegeben haben, die selbst dem Trunke ergeben<br />
oder der Syphilis verfallen waren. Sie büßen Die<br />
Sünden ihrer Väter. Nehmen wir an, daß es uns<br />
gelänge, durch vernünftige bevölkerungspo-<br />
litische Maßregeln die Zahlen der Irrsinnigen<br />
auf die Hälfte herabzusetzen, so daß wir nur<br />
zweiundzwanzig Milliarden ausgeben müßten,<br />
so wäre es möglich, rund siebzigtausend Kin-<br />
der, nahezu ein Drittel aller Schulkinder Wiens,<br />
durch vier Wochen in Ferienerholung zu halten.<br />
(…) Welchen Aufwand die Staaten für vollkom-<br />
men lebensunwertes Leben leisten müssen, ist<br />
zum Beispiel daraus zu ersehen, daß dreißig-<br />
tausend Vollidioten Deutschlands diesen Staat<br />
zwei Millionen Friedensmark kosten. Bei der<br />
Kenntnis solcher Zahlen gewinnt das Problem<br />
der Vernichtung lebensunwerten Lebens im<br />
Interesse der Erhaltung lebenswerten Lebens<br />
an Aktualität und Bedeutung. Gewiß, es sind<br />
ethische, es sind humanitäre oder fälschlich<br />
humanitäre Gründe, welche dagegen spre-<br />
chen, aber schließlich und endlich wird auch<br />
die Idee, daß man lebensunwertes Leben op-<br />
fern müsse, um lebenswertes zu erhalten, im-<br />
mer mehr ins Volksbewußtsein dringen, denn<br />
heute vernichten wir vielfach lebenswertes<br />
Leben, um lebensunwertes Leben zu erhalten.<br />
Dieselbe Gesellschaft, die (…) in ihrer leicht-<br />
sinnigen Gleichgültigkeit Hunderte von Kin-<br />
dern, darunter vielleicht Talente und Genies,<br />
glatt zugrunde gehen läßt, füttert in sorgsamer<br />
Ängstlichkeit Idioten auf und rechnet es sich<br />
als Leistung an, wenn es ihr gelingt, den sel-<br />
ben ein behagliches Greisenalter zuzusichern.“<br />
(zitiert nach Kappeler, 2000, S. 238)<br />
Mit dieser Auffassung konnte Tandler sich auf<br />
bedeutende sozialistische Bevölkerungstheore-<br />
tiker wie Karl Kautzky, Rudolf Goldscheid, Oda<br />
Olberg stützen. Der klassifizierende eugenische<br />
Diskurs in der Sozialen Arbeit war von Anfang<br />
an legiert mit einer „Menschenökonomie“, die<br />
mit ihrer Skala vom wertvollen über das nütz-<br />
liche schließlich das noch brauchbare Men-<br />
schenleben bis hin zum unwerten, das heißt<br />
unbrauchbaren Menschenleben (die sogenann-<br />
ten Ballastexistenzen) die gesellschaftlichen<br />
Produktions- und Reproduktionskosten aus-<br />
rechnete, also die Kosten-Nutzen-Relation der<br />
„Menschenproduktion“ als wissenschaftliche<br />
Grundlage in die Sozialpolitik und damit auch<br />
historische und aktuelle diskurse<br />
diskursesie sich historische und aktuelle<br />
in die Soziale Arbeit einführte. Ihr prominentester<br />
Vertreter war der Wiener Sozialist Rudolf<br />
Goldscheid (1870-1931), dessen Hauptwerk<br />
„Höherentwicklung und Menschenökonomie<br />
– Grundlegung der Sozialbiologie“ (1911) zu<br />
den Standardwerken der soziologischen und<br />
volkswirtschaftlichen Literatur vor 1933 zählte.<br />
Die schreckliche Rede von der „Vernichtung<br />
des unwerten Lebens“ ist also keine Erfindung<br />
der Nationalsozialisten gewesen.<br />
Die „Menschenökonomie“ mit ihrer Input-Output-Relation,<br />
ihren Hauptkriterien von Effizienz<br />
und Effektivität der für die Soziale Arbeit bereitgestellten<br />
gesellschaftlichen Ressourcen,<br />
spiegelt sich in modernisierter Form in der<br />
aktuellen Ökonomisierung der Sozialen Arbeit<br />
und ihrer Rhetorik, die nur ein Teil der umfassenderen<br />
Strategie des sogenannten Umbaus<br />
des Sozialstaats ist. Auch die seit Jahren laufende<br />
Polemik vom Mißbrauch sozialer Leistungen<br />
gehört zu diesem Komplex.<br />
Liebe Kolleginnen und Kollegen, das „eugenische<br />
Paradigma“ war ein Kristallisationspunkt<br />
des „Zeitgeistes“ im letzten Drittel des<br />
neunzehnten Jahrhunderts, eine Konsequenz<br />
der naturwissenschaftlich-technischen Revolution.<br />
Der uralte Traum vom „vollkommenen<br />
Menschen“ beziehungsweise der Vervollkommnung<br />
der Menschheit in der Gestalt<br />
des Fortschrittglaubens, sollte schließlich in<br />
Deutschland, mitten im zwanzigsten Jahrhundert,<br />
mörderische Konsequenzen haben. Dieses<br />
Denken war um 1900 Allgemeingut der sogenannten<br />
Schutz- und Trägermächte der sich<br />
entwickelnden Sozialen Arbeit mit Akzentuierungen<br />
je nach dem, ob es sich um christliche,<br />
sozialistische, bürgerlich-humanistische oder<br />
völkisch-nationale Gruppierungen, Frauen und<br />
Männer handelte.<br />
Um dies zu belegen, will ich einen Blick in das<br />
späte neunzehnte Jahrhundert, in die Zeitschrift<br />
„Soziale Praxis“ werfen, die aus meiner<br />
Sicht die bedeutendste Fachzeitschrift der ersten<br />
Professionalisierungsphase der Sozialen<br />
Arbeit war. Sie erschien wöchentlich in hoher<br />
Auflage ohne Unterbrechung von 1893 bis 1933<br />
und spiegelt die bedeutenden Diskurse und<br />
Praxisentwicklungen dieses Zeitraums wieder.<br />
In einer Serie von Grundsatzartikeln in den<br />
Nummern 13 bis 20 des sechsten Jahrgangs<br />
1896 wird der Vorwurf an die „Armenpflege<br />
und Wohltätigkeit“ diskutiert: Sie wirke unter<br />
eugenischen Gesichtspunkten betrachtet<br />
kontraselektorisch, weil sie verhindere, daß die<br />
Schwachen und Untüchtigen im „Kampf ums<br />
Dasein“ untergehen und ihnen die Gelegenheit<br />
zur Fortpflanzung, das heißt zur Weitergabe<br />
ihres „minderwertigen Erbguts“ an die<br />
nächste Generation ermögliche. Abgesehen<br />
von der kontraselektorischen Wirkung sei das<br />
auch eine Verschwendung von Ressourcen an<br />
Zeit, Geld und Engagement, die der Förderung<br />
und Unterstützung „wertvoller, erbgesunder<br />
Kinder und Familien“ entzogen würde. Die „Soziale<br />
Praxis“ nimmt diesen Vorwurf ernst und<br />
fordert von ihren LeserInnen aus den „Kreisen<br />
der Armenpflege und Wohltätigkeit“ in ihrer<br />
Arbeit eugenische Gesichtspunkte zu berücksichtigen,<br />
die sich „auf ernste wissenschaftliche<br />
Forschung“ stützen könnten. Wie in der<br />
Sozialen Arbeit üblich, wurde diese Forderung<br />
an die Praxis mit Fallbeispielen aus der Praxis<br />
begründet. Dazu ein Beispiel:<br />
„Wir haben vor uns einen chronischen Kandidaten<br />
der Armenpflege. Der Mann ist gewöhnlicher<br />
Tagelöhner und keineswegs von besonderer<br />
Intelligenz, er ist des öfteren krank, sehr<br />
häufig ohne Arbeit und hat bereits ein- oder<br />
zweimal im Gefängnis gesessen; die Frau ist<br />
von ähnlicher Beschaffenheit. Beide haben eine<br />
Menge Kinder, zu denen sich fortgesetzt noch<br />
neue gesellen. Diese Kinder sind kränklich,<br />
schwächlich und nach verschiedenen Richtungen<br />
hin erblich stark belastet. Was würde aus<br />
dieser Familie ohne Armenpflege und Wohltätigkeit<br />
werden? Das Leben der Eltern würde<br />
in Ermangelung dieser Hülfe sehr viel früher<br />
enden, und infolge dessen würden sie auch<br />
weniger Kinder haben. Die einmal zur Welt gekommenen<br />
Kinder würden weniger Hülfe und<br />
Unterstützung finden als heute, und infolge<br />
dieser beiden Umstände würde die Zahl der<br />
zum Aufwachsen gelangenden Nachkommen<br />
dieses Elternpaares bedeutend geringer sein.“<br />
Der Autor fragt seine Leserinnen und Leser<br />
nach der Präsentation dieses „Falles“, ob Armenpflege<br />
und Wohltätigkeit gut daran täten,<br />
solchen Eltern die Fortpflanzung zu ermöglichen:<br />
„Belasten sie nicht vielmehr die Gesellschaft<br />
mit einer Reihe Existenzen, die fortgesetzt<br />
wieder anderen zur Last fallen, ohne selbst<br />
irgendwelche Freude am Dasein haben zu können?<br />
Mit einem Wort: Verschlechtern sie nicht<br />
die Rasse?“<br />
Die „Soziale Praxis“ empfiehlt, die rassenhygi-<br />
enische Kritik positiv aufzunehmen und „nach<br />
Mitteln Umschau zu halten, durch welche<br />
die humanitäre sozialpolitische Tätigkeit so<br />
ergänzt und umgestaltet werden kann, daß<br />
ihre rassenverschlechternde Tendenzen durch<br />
entgegengesetzte rassenverbessernde Wir-<br />
kungen aufgewogen und mehr als aufgewogen<br />
werden“.<br />
Die Artikelserie endet mit einem Resümee, aus<br />
dem ich zitiere:<br />
„Wird das allgemeine körperlich-geistige Ni-<br />
veau der Bevölkerung nicht heruntergedrückt<br />
dadurch, daß Armenpflege und Wohltätigkeit<br />
fortgesetzt die Reihen dieser Bevölkerung sys-<br />
tematisch gerade durch die Schwächsten und<br />
Elendesten verstärken, denen sie ihre Hülfe an-<br />
gedeihen lassen? Man kann diesen Gedanken<br />
auch noch von einer anderen Seite fassen und<br />
in etwas andere Richtung ausbauen: Schaffen<br />
Armenpflege und Wohltätigkeit nicht oft, in-<br />
dem sie Kranken und Schwachen zur Verlän-<br />
gerung ihres Lebens, zur Fortpflanzung, oder<br />
als Kindern überhaupt zum Aufwachsen ver-<br />
helfen, mehr Leid als Freude? Mehr Leid für die<br />
Unterstützten selber, die nie zu einem vollen,<br />
gesunden Leben gelangen; mehr Leid für ihre<br />
Umgebung, die ihre Schmerzen und Sorgen<br />
teilt; mehr Leid für ihre Kinder, die von Anfang<br />
an schwer belastet ins Leben eintreten; mehr<br />
Leid schließlich auch, wenn man die Sache so<br />
ausdrücken will, für die Gesellschaft, deren<br />
Hülfe in einem großen Bruchteil der Fälle von<br />
diesen schwachen Existenzen in hohem Grad<br />
in Anspruch genommen wird, und die oft, zum<br />
Beispiel wenn es sich um Verbrecher handelt,<br />
sogar direkt geschädigt wird?“<br />
Der Autor antwortet auf diese selbst gestellte<br />
Frage folgendermaßen:<br />
„Der Verbrecher, der Vagabund, der Kranke,<br />
der mit schweren Gebrechen behaftete ist kein<br />
produktives Glied der Volkswirtschaft; er lebt<br />
in irgendeiner Weise auf Kosten der Gesell-<br />
schaft. Indem die Armenpflege dahin wirkt,<br />
die Zahl dieser Unglücklichen zu vermindern,<br />
erhöht sie die Ziffer der produktiven Glieder<br />
der Volkswirtschaft im Verhältnis zu den un-<br />
produktiven.“<br />
Soweit die „Soziale Praxis“ aus den neunziger<br />
Jahren des neunzehnten Jahrhunderts.<br />
22 . Nr.63 . SIT<br />
SIT . Nr.63 . 23<br />
historische und aktuelle diskurse
diskurseBeispiel historische und aktuelle diskurse<br />
Beispiel 2: Wohnungslose Jugendliche – soge-<br />
nannte Straßenkinder<br />
Die Ordnungspolitik dieser Gesellschaft ver-<br />
langt und protegiert das Seßhaft-Sein als do-<br />
minante Lebensform, entweder im Eigentum<br />
oder in gemieteten Räumen oder in zugewie-<br />
senen Räumen. Nicht-Seßhafte Menschen<br />
„ohne festen Wohnsitz“ werden als Nomadi-<br />
sierende, Obdachlose, Wohnungslose, Penner<br />
bezeichnet und wenn es sich um Jugendliche<br />
handelt, manchmal auch um Kinder, werden<br />
sie TrebegängerInnen, Straßenkinder, Streune-<br />
rInnen genannt. Kunden hießen sie in der DDR<br />
und Wanderer vor 1945, als Sozialpolitiker aller<br />
weltanschaulichen Richtungen noch ungeniert<br />
vom „Wandererunwesen“ reden konnten, wie<br />
der Landesrat Würmeling 1934:<br />
„Das Ziel der Gesetzgebungs- und Verwal-<br />
tungsmaßnahmen darf nicht nur dahingehen,<br />
das Wandererwesen unter dem Gesichtspunkt<br />
des kleineren Übels in möglichst geordne-<br />
te Bahnen zu lenken, sondern das Ziel muß<br />
sein, den mittellosen Wanderer als überhaupt<br />
noch existenzberechtigt völlig zu beseitigen.<br />
Es wird bestimmt nicht verkannt, daß dieses<br />
Ziel nur unter erheblichen Schwierigkeiten zu<br />
erreichen ist, aber wenn je ein Zeitpunkt zur<br />
Erreichung eines solchen Zieles geeignet war,<br />
so ist es der jetzige, in dem der Staat eine nie<br />
dagewesene Stärke besitzt und tatsächlich<br />
durch straffes Zusammenarbeiten von Justiz<br />
und Polizei hierzu in der Lage ist.“<br />
Der 1934 so redete und schrieb war von 1953<br />
bis 1962 Bundesminister für Familie und Ju-<br />
gend in der Bundesrepublik Deutschland.<br />
Flüchtlinge, Asylsuchende/Asylanten, Ver-<br />
triebene, Exilierte heißen Menschen, die nicht<br />
freiwillig, die durch Not und Krieg und Gewalt,<br />
durch religiöse politische und rassistische<br />
Verfolgung und Unterdrückung ihr Land, ihre<br />
Heimat, ihre Wohnung verlassen mußten.<br />
Heimatlose werden sie alle genannt. Heimat,<br />
das ist bei uns ein emotional hoch besetzter<br />
Begriff. Wer keine Heimat hat ist „arm dran“,<br />
er/sie muß in der Fremde leben, unter den<br />
dort Beheimateten, den Einheimischen, den<br />
Verwurzelten (Erde, Bodenhaftung, Sicherheit,<br />
Vertrautheit, fällt dazu ein), als Fremdling, als<br />
Entwurzelter, Suchender, Ruheloser. Der An-<br />
tisemitismus in Deutschland hat im Bild vom<br />
ewigen Juden sogar einen negativen Sozialcharakter<br />
daraus konstruiert: Den „unsteten,<br />
rastlosen, entwurzelten, verschlagenen“ Juden<br />
und den „herumzigeunernden, diebischen und<br />
verschlagen-tückischen Zigeuner“ im Gegensatz<br />
zum „erdverbundenen, heimatliebenden,<br />
seßhaften, zuverlässigen, ehrlich-treuen Germanen-Stämmling“.<br />
Das nicht-seßhafte, das umherschweifende<br />
Leben in allen seinen Formen, ob nun aus eigenem<br />
Entschluß oder als aufgezwungene Wanderung,<br />
gilt als minderwertige Lebensform,<br />
als ein Überbleibsel einer längst überwundenen<br />
„niedrigen“ Kulturstufe der „Jäger und<br />
Sammler“ und der „nomadisierenden Stämme“,<br />
die in den „Zigeunern“ als ein „schäbiger<br />
Rest“ bis auf unsere Tage und in unsere Zeit<br />
und in unsere Stadt gekommen sind. In der<br />
auf Seßhaftigkeit gegründeten Gesellschaft, in<br />
einer Kultur der Seßhaften, repräsentieren alle<br />
Formen des umherschweifenden Lebens das<br />
radikal Andere.<br />
Uns mittelschichtsozialisierten SozialpädagogInnen<br />
und SozialarbeiterInnen ist das umherschweifende<br />
Leben fremd. Es bleibt uns<br />
fremd, auch wenn wir in unserem beruflichen<br />
Selbstverständnis die ordnungspolitischen<br />
Absichten unserer öffentlichen Geldgeber ablehnen<br />
und ihnen unsere professionelle Ethik<br />
entgegensetzen, mit der wir uns verpflichten,<br />
mit unserem Handeln allen Formen der Diskriminierung<br />
und Ausgrenzung entgegenzutreten.<br />
Diese Hinwendung, unser Angebot zur<br />
Hilfe/Unterstützung, setzt aber immer schon<br />
voraus, daß wir unser Gegenüber als ein unserer<br />
Hilfe Bedürftiges beurteilt haben, daß wir<br />
seine aktuelle Lebenssituation als eine zu behebende,<br />
zu beendende Notsituation definiert<br />
haben, daß unsere Einschätzung der Lebenslage<br />
der „Hilfe-Bedürftigen“, ihrer Selbstwahrnehmung,<br />
Selbsteinschätzung, Eigendefinition<br />
auch entspricht, zumindest mit ihr korrespondiert,<br />
so daß wir Anknüpfungspunkte für<br />
unser sozialpädagogisches Handeln finden<br />
können. Und immer wieder gibt es auch solche<br />
Übereinstimmungen und Anknüpfungspunkte,<br />
immer dann, wenn Menschen erstens ihre<br />
Lebenssituation als ihnen durch Bedingungen/<br />
Verhältnisse und eigenes Unvermögen aufgezwungen<br />
erleben und wenn sie zweitens nicht<br />
über ausreichende eigene Kräfte/Vorstellungen<br />
und Mittel verfügen, um die Situation, unter<br />
der sie leiden, wirksam und dauerhaft verändern<br />
zu können. Dann geht es uns gut. Unsere<br />
Beurteilungen und unsere Angebote werden<br />
angenommen. Unser Leiden resultiert dann<br />
aus der Erfahrung, daß unsere Unterstützungsmöglichkeiten<br />
begrenzt sind, wenn es um Wohnung,<br />
um Arbeit, um regelmäßiges und ausreichendes<br />
Einkommen, um Gesundheit geht und<br />
es gehört zu unseren Alltagserfahrungen, daß<br />
wir mit unserer Arbeit scheitern an eben den<br />
Bedingungen/Verhältnissen, an denen die der<br />
Hilfe Bedürftigen im privaten Leben schon gescheitert<br />
sind.<br />
Aber wenn die Umherschweifenden die auf<br />
Seßhaftigkeit gegründeten Lebensformen,<br />
die wir ihnen anbieten, ablehnen, wenn sie<br />
das Umherschweifen zur Form/zum Stil ihres<br />
Lebens gemacht haben, den sie beibehalten<br />
wollten, jedenfalls auf unbestimmte Zeit und<br />
jedenfalls in diesem Augenblick und wenn es<br />
sich dann um Minderjährige, um Jugendliche<br />
handelt, sind wir ganz schnell in einer sozialpädagogischen<br />
Grenzsituation, von der wir uns<br />
entlasten, indem wir auf vertraute und tradierte<br />
Sichtweisen, auf gesetzliche Regelungen<br />
und scheinbar klare Verantwortlichkeiten zurückgreifen:<br />
Kinder und Jugendliche gehören<br />
nicht auf die Straße – Erwachsene auch nicht,<br />
aber das mag noch hingehen, sie sind für sich<br />
selbst verantwortlich. Kinder und Jugendliche<br />
brauchen Geborgenheit, sie müssen versorgt<br />
werden. Die Straße aber ist kein Ort der Geborgenheit,<br />
sie ist das Gegenteil: Ein Ort der<br />
extremen Gefährdung, des Unverwahrt-Seins,<br />
ein Ort, der zwangsläufig in die „Verwahrlosung“<br />
führt, in die Prostitution, in die Eigentums-<br />
und Rauschgift- und Gewaltkriminalität,<br />
in den geistigen, seelischen und körperlichen<br />
Ruin. Die Straße ist ein „jugendgefährdender<br />
Ort“, der die Kinder und Jugendlichen ausgesetzt<br />
sind. Sie sind Ausgesetzte und wir<br />
sind gesetzlich und moralisch verpflichtet, die<br />
„Unreifen“, „Unmündigen“ vor solch einem Leben<br />
und seinen vorprogrammierten Folgen zu<br />
bewahren. Dies im Einzelfall auch gegen ihren<br />
erklärten Willen!? – denn zur Unreife gehöre<br />
der Mangel an Lebenserfahrung und die Unfähigkeit,<br />
die im Augenblick nicht sichtbaren<br />
Folgen des eigenen Handelns erkennen zu können.<br />
So sehen wir die Kinder/in der Mehrzahl<br />
Können denn die Argumente von Kindern und<br />
Jugendlichen, die sich nicht unterbringen las-<br />
sen wollen, als subjektive Willensäußerungen<br />
ernstgenommen werden? Sind es nicht nur<br />
trotzige Reflexe auf die Bedingungen, die sie<br />
auf die Straße getrieben haben? Denn Vertrie-<br />
bene sind sie doch alle, immer liegen doch die-<br />
sem Schritt Erfahrungen/Verhältnisse zugrun-<br />
de, die nicht mehr ertragen beziehungsweise<br />
verkraftet werden konnten. Zumindest aber<br />
haben diese Kinder und Jugendlichen in der<br />
frühen Zeit des Lebens erworbene Dispositio-<br />
nen, die wir in jeder einzelnen Biographie mit<br />
unseren Anamnese- und Diagnose-Instrumen-<br />
ten fachlich und wissenschaftlich begründet<br />
„erheben“ können, seit wir nicht mehr wie<br />
die Wohlfahrtspflege noch bis in die fünfziger<br />
Jahre vom „Wandertrieb“ ausgehen. Das mag<br />
ganz überwiegend so sein. Die pure Abenteu-<br />
erlust aus einem prallen Lebensgefühl heraus<br />
oder die einfache Verführung und Verlockung<br />
des Fremden wird uns als Ausgangspunkt für<br />
ein „Leben auf der Straße“ nur selten begeg-<br />
nen. Allermeist wird es ein Befreiungsversuch<br />
aus unerträglicher Enge und Bedrückung sein.<br />
Vielleicht die vorletzte Möglichkeit, dem tota-<br />
len Objektzustand zu entkommen und Subjek-<br />
tivität zurückzugewinnen, auch um den Preis<br />
hoher Risiken. Die letzte Möglichkeit wäre viel-<br />
leicht „nur“ noch der Suizid.<br />
24 . Nr.63 . SIT<br />
SIT . Nr.63 . 25<br />
die Jugendlichen, die „auf der Straße leben“ historische wollen. Wir glauben, daß wir solche Jugend-<br />
liche vor sich selbst und den ihnen drohenden<br />
Gefahren bewahren müssen, daß wir zumin-<br />
dest verhindern müssen, daß sie sich Gefahren<br />
aussetzen, die ihnen „auf der Straße“ drohen<br />
und die sie als solche nicht erkennen können.<br />
Und wenn sich diese Kinder/Jugendlichen<br />
hartnäckig weigern, die sie gefährdenden Orte<br />
zu verlassen, sich von uns in Sicherheit brin-<br />
gen zu lassen, glauben wir auch Zwang an-<br />
wenden zu dürfen, mit helfender Gewalt und<br />
mit barmherziger Strenge sie an Orte bringen<br />
zu dürfen, die wir für sie ausgesucht haben, an<br />
denen sie aber nicht sein wollen. Schließlich<br />
gibt es ein Aufenthaltsbestimmungsrecht und<br />
eine Aufsichtspflicht und eine gesellschaftliche<br />
Verantwortung der Jugendhilfe und ein Grund-<br />
gesetz, das den seßhaften Lebensformen in der<br />
Gestalt von Ehe und Familie den besonderen<br />
Schutz des Staates verspricht.<br />
historische und las-historische aktuelle diskurse
diskurseIn mehr 2.historische und aktuelle 1.historische diskurse<br />
In mehr als zwanzig Jahren sozialpädago-<br />
gischer Praxis, in der Heimerziehung, in der<br />
Arbeit mit TrebegängerInnen, im Georg-von-<br />
Rauch-Haus, in sozialpädagogischen Wohn-<br />
gemeinschaften, in der Offenen Jugendarbeit<br />
und in der Drogenarbeit sind mir unzählige<br />
Mädchen und Jungen begegnet, die auf die<br />
Straße gingen, um die Orte ihres Leidens und<br />
ihrer Zerstörung zu verlassen, die geflohen<br />
sind, zum zu überleben. Sie waren und sind<br />
Flüchtlinge mitten in unserer seßhaften Ge-<br />
sellschaft. Das sind nun zwei Bestimmungen,<br />
die zum klassischen Vokabular der Jugendhil-<br />
fe gehören: Flucht und Überleben. Sie deuten<br />
Not-Lösungen an, die schnellstens durch Per-<br />
spektivlösungen ersetzt werden sollen. Dabei<br />
übersieht unser sozialpädagogisches Denken<br />
drei Aspekte:<br />
Die Flucht ist auch eine Befreiung, in der<br />
tatsächlich auch unter prekären Bedingungen<br />
Freiheit erlebt wird und Subjektivität gewon-<br />
nen wird. Und die Not-Lösung ist eine Lösung<br />
von Not, auch wenn mit dieser Lösung wieder<br />
andere Nöte verbunden sein können bezie-<br />
hungsweise in der Regel verbunden sind. Es<br />
handelt sich um subjektiv bedeutsame Erfah-<br />
rungen, die mit dieser Bewegung gewonnen<br />
werden, um Erfahrungen, die wir, die das Ge-<br />
schehen bei allem fachlichen Wissen und bei<br />
aller Sensibilität doch immer nur von außen be-<br />
trachten können, nicht mit den sozialpädago-<br />
gisch tradierten negativen Bedeutungen von<br />
Flucht und Notlösung bewerten und abwerten<br />
sollen, etwa mit dem wirklich dummen Spruch:<br />
„Sucht ist Flucht“, mit dem noch immer in<br />
Bausch und Bogen der Gebrauch verbotener<br />
psychoaktiver Substanzen durch Jugendliche<br />
diskriminiert wird.<br />
Das Über-Leben ist auch ein Leben aus<br />
erster Hand. Es ist kein Zweitrangiges oder<br />
Drittklassiges per se, sondern ein anderes, in<br />
dem sich Erfahrungsräume öffnen lassen und<br />
Kompetenzen entwickelt werden, die zu Än-<br />
derungen des individuellen Werte-Horizontes,<br />
der Bedürfnisse und Wünsche und Notwendig-<br />
keiten führen, die im subjektiven Bewußtsein/<br />
Lebensgefühl alles andere als Notlösungen sein<br />
können. Mit anderen Worten: Im Überleben<br />
verbirgt sich – verborgen für unseren sozial-<br />
pädagogischen Blick – Entwicklung, das Über-<br />
Leben kann Selbstentwicklung sein. Jedenfalls<br />
steckt diese Behauptung – im Sinne von sich<br />
selbst Be-Haupten – in der Weigerung, die auf<br />
Unterbringung, auf fragwürdige Geborgenheit<br />
und auf Seßhaftigkeit zielende und auf diesen<br />
Zielen insistierende sozialpädagogische Hilfe<br />
anzunehmen.<br />
Was also in der Not, mit der Flucht begann,<br />
kann zu einem Weg der Selbst-Bestimmung<br />
und der Individuation in der Non-Konformität<br />
werden. Diese Möglichkeit anzuerkennen<br />
fällt uns schwer, weil sie in ihren je konkreten<br />
Ausdrucksformen in unseren, wie liberal auch<br />
immer gestrickten, Lebensentwürfen nicht<br />
vorgesehen sind und vor allem, weil in dieser<br />
Gesellschaft kein Raum für sie zu sein schient.<br />
Wenn wir schon die Identität von Huren, Junkies,<br />
Straßenkindern, Knackis anerkennen<br />
müssen, dann aber – und so retten wir unser<br />
sozialpädagogisches Bewußtsein – als negative<br />
Identität.<br />
3. Erst wenn das umherschweifende Leben,<br />
oder weitergefaßt, das Non-Konformistische,<br />
sich organisiert, eine öffentlich vernehmbare<br />
Stimme bekommt, wie die Hurenbewegung,<br />
wie JES (Selbstorganisation von Junkies,<br />
Ehemaligen und Substituierten), wie die Irren-Offensive<br />
oder um bei unserer Zielgruppe<br />
zu bleiben, die in den siebziger Jahren (auch<br />
wenn mit sozialpädagogischer Unterstützung)<br />
entstandene „Trebe-Bambule” der unter vierzehnjährigen<br />
TrebegängerInnen, ändern wir<br />
– vielleicht – unsere Haltung. Erst dann also,<br />
wenn sie als Selbstorganisation sichtbar werden,<br />
werden die neuen Qualitäten dieses aus<br />
der Not entwickelten anderen Lebens für uns<br />
annehmbar und erst dann wird uns die Unterstützung<br />
leichter, weil diese Formen der<br />
Selbstorganisation in unser Meta-Konzept von<br />
„Hilfe zur Selbsthilfe“ passen.<br />
Mir geht es in diesem Beispiel der Ambivalenzen<br />
von „Hilfe“ in erster Linie um die Jugendlichen<br />
und Kinder, die mit unseren Definitionen<br />
und Angeboten in ihrem aktuellen Leben<br />
nichts anfangen können und wollen. Wenn es<br />
uns gelingt, die Selbstdefinitionen dieser Kinder<br />
und Jugendlichen zu erkennen und anzuerkennen,<br />
bekommen wir eine Basis, von der<br />
aus wir diesem Leben angemessene Formen<br />
der Unterstützung entwickeln können, die die<br />
Subjekt-Behauptung solcher Jugendlicher anerkennen.<br />
Die Kinder und Jugendlichen, die das umherschweifende<br />
Leben zu einer passageren oder<br />
längeren dauernden Lebensform entwickeln,<br />
gehen diesen Weg.<br />
Zugegeben, bei Kindern und Jugendlichen gibt<br />
es eine Fülle besonderer Schwierigkeiten. Je<br />
jünger sie sind, je größer werden die Probleme,<br />
die einerseits in der Entwicklungstatsache und<br />
der Notwendigkeit von Erziehung und andererseits<br />
in den rechtlichen Rahmenbedingungen<br />
liegen und durch die außergewöhnliche emotionale<br />
Besetzung von Kindheit und Jugend in<br />
der Öffentlichkeit noch verstärkt werden. Die<br />
meisten Gesetze zum Beispiel, die wir als soziale<br />
Errungenschaften zum Schutz von Kindern<br />
und Jugendlichen im Laufe des letzten Jahrhunderts<br />
gegen schrankenlose Ausbeutung,<br />
Züchtigung und Mißbrauch aller Art, aber auch<br />
für Bildung und Ausbildung in dieser Gesellschaft<br />
gegen Widerstände durchgesetzt haben<br />
und an denen unserer Profession großen Anteil<br />
hatte, sind für Minderjährige, die sich gegenüber<br />
der bürgerlichen Erziehungsordnung als<br />
„Totalverweigerer“ verhalten, kontraproduktiv.<br />
Denken Sie nur an diverse Arbeitsverbote, die<br />
zu illegaler Sicherung des Lebensunterhalts<br />
zwingen – an das bei den Erwachsenen liegende<br />
Aufenthaltsbestimmungsrecht – an die mit<br />
Gewalt durchzusetzende Schulpflicht – alles<br />
mächtige und in ihrem Bestand für die heranwachsende<br />
Generation hoffentlich unantastbare<br />
rechtliche Bastionen. Im einzelnen Fall aber<br />
verkehren sie sich zu Gewaltinstrumenten,<br />
deren Anwendung für wenige und besondere<br />
Kinder, die sich existentiell gegen diese Anforderungen<br />
stellen, fürchterliche Folgen haben<br />
können.<br />
Hier zum Beispiel könnten wir professionell<br />
ansetzen, mit unserem Wissen und unserer<br />
Stimme Öffnungen schaffen und die Umherschweifenden<br />
ermutigen, ihre eigene Stimme<br />
zu erheben. Wir sind verantwortlich für die<br />
Öffnung unseres Blicks und für die Humanisierung<br />
der Gesellschaft im Sinne des „Räume-<br />
Öffnens“ für non-konforme Lebensformen. Auf<br />
der Ebene der unmittelbaren Begegnung mit<br />
den Kindern und Jugendlichen, die „auf der<br />
Straße leben“ wollen, sind wir verantwortlich<br />
für die Herstellung von Offenheit, für Akzeptanz<br />
und Toleranz, für die Aufrechterhaltung<br />
von Kommunikation.<br />
Der Erwerb und die Verstetigung all der Fähig-<br />
keiten des Verstehens und Handelns, die Fähig-historische<br />
eine<br />
Voraussetzung für die Offenheit gegenüber<br />
den Formen des „umherschweifenden Lebens“<br />
sind und die Umsetzung dieser Offenheit in<br />
eine Praxis der verstehenden und unterstüt-<br />
zenden Annäherung sind für mich der Inbegriff<br />
qualifizierter sozialpädagogischer Arbeit, die<br />
den Titel „Hilfe“ verdient.<br />
Beispiel 3: Kein Ort – nirgends? Die Ausgren-<br />
zung von Jugendlichen, die verbotene Drogen<br />
nehmen.<br />
Seit Jahren wird von KritikerInnen darauf auf-<br />
merksam gemacht, daß Jugendliche, die aus<br />
der Sicht von Erwachsenen mit illegalisierten<br />
Drogen einen problematischen Umgang ent-<br />
wickeln (im Suchtjargon „Drogenabhängige“<br />
oder „Suchtkranke“ genannt), in das soge-<br />
nannte Bermuda-Dreieck von Jugendhilfe-Dro-<br />
genhilfe-Jugendpsychiatrie geraten, das heißt<br />
zwischen den Hilfe-Systemen hin- und herge-<br />
schoben werden, mit fast gleichlautenden Be-<br />
gründungen: nicht zuständig, überfordert, mit<br />
diesen therapie- und behandlungsresistenten<br />
Jugendlichen, die eine Gefahr für die anderen<br />
Jugendlichen in der Einrichtung seien usw.<br />
Im gerade neu herausgegebenen Handbuch<br />
Sozialarbeit/Sozialpädagogik von H.U. Otto<br />
und H. Thiersch (Luchterhand) kann man im<br />
Stichwortartikel „Psychiatrie und Jugendhilfe“<br />
lesen:<br />
„Beobachtet werden kann beispielsweise,<br />
daß eine Jugendhilfeeinrichtung, die noch<br />
mit der Betreuung eines schwierigen Ju-<br />
gendlichen beschäftigt ist, argumentiert,<br />
es handle sich nicht um ein erzieherisches<br />
Problem, sondern es sei eine psychische<br />
Störung zu diagnostizieren. Ihr bliebe nur,<br />
einen Zustand jugendpsychiatrischer Be-<br />
dürftigkeit mit unzulänglichen Mitteln fort-<br />
zuschreiben. In diesem Moment bedient<br />
sich die sozialpädagogische Institution<br />
einer eher fremden Logik, nämlich der des<br />
medizinischen Modells. Ebenso kann beob-<br />
achtet werden, daß eine jugendpsychiatri-<br />
sche Klinik die Behandlung eines solchen<br />
Jugendlichen mit der Begründung ablehnt,<br />
es handle sich um ein pädagogisches Pro-<br />
blem. Dem Jugendlichen müsse ermöglicht<br />
werden, sich in soziale Zusammenhänge<br />
26 . Nr.63 . SIT<br />
SIT . Nr.63 . 27<br />
historische und aktuelle diskurse
Weiter heißt es in diesem Stichwortartikel, daß<br />
Jugendliche, die „suchtmittelabhängig“ seien<br />
und in diesem Zusammenhang wiederholt in<br />
psychische Krisen geraten, zu dem Personen-<br />
kreis gehören, für die beide Systeme – und ich<br />
erweitere: alle drei Systeme – eine gemeinsame<br />
„Fallverantwortung“ haben und einen „Modus<br />
der Zusammenarbeit“ finden müssen.<br />
Die Diskussion über die gemeinsame Verant-<br />
wortung der verschiedenen Hilfe-Systeme war,<br />
nach meiner Erinnerung, schon 1996 in Müns-<br />
ter auf dem Kongreß „In Kontakt bleiben“ das<br />
Hauptthema. Schon damals richtete sich das<br />
Hauptaugenmerk auf die Kooperation der Hil-<br />
fe-Systeme. Die unterschiedlichen Traditionen,<br />
Menschenbilder, Methoden und die Konkurrenz<br />
um staatlich anerkannte Zuständigkeiten und<br />
damit verbundene Finanzierungen wurden als<br />
Barrieren beklagt, auch die jeweilige Arbeits-<br />
belastung, die ein zusätzliches Engagement<br />
bedeute – und Kooperation, die Systemgrenzen<br />
durchlässig machen soll, kostet viel Zeit, Ge-<br />
duld und langen Atem – verhindere immer wie-<br />
der die als notwendig erkannte Zusammenarbeit<br />
historische und aktuelle diskurse<br />
hineinzufinden und angemessene Umgangsweisen<br />
zu erlernen. Eine jugendpsychiatrische<br />
Maßnahme bedeute hingegen<br />
eine zu große Gefahr der Stigmatisierung<br />
eines an sich nicht pathologischen Verhaltens.<br />
Auch die Klinik bedient sich hier<br />
einer eher fremden Entscheidungsgrundlage,<br />
nämlich dem Modell der pädagogisch<br />
zu fördernden Entwicklung. Es soll nun an<br />
dieser Stelle nicht um die Frage gehen, ob<br />
solche Einwände gegebenenfalls berechtigt<br />
scheinen, auch nicht darum, daß sie unter<br />
anderen Bedingungen ein Zeichen für Kooperationswillen<br />
und Interdisziplinarität<br />
sein könnten. Stutzig macht, daß beide Argumentationsgänge<br />
nur einem Ziel dienen:<br />
Sie sollen die eigene Unzuständigkeit beweisen.<br />
Dies geschieht mit Hilfe einer idealtypischen<br />
Argumentation, die noch dazu<br />
häufig einer fremden Disziplin entlehnt<br />
wurde. Nur so können Überschneidungsphänomene<br />
ausgeblendet werden, die sich<br />
eigentlich keiner der beiden Institutionen<br />
ausschließlich zuordnen lassen. Kinder und<br />
Jugendliche in psychosozialen sehr belasteten<br />
Lebenslagen ist mit einem solchen<br />
Streit um Zuständigkeiten natürlich nicht<br />
geholfen.“<br />
und vor allem ihre Verstetigung über zaghafte<br />
Anfänge hinaus. Diese Befunde für das Nicht-<br />
Zustande-Kommen beziehungsweise das<br />
Scheitern von Kooperationen der Hilfe-Systeme<br />
in der alltäglichen Praxis wiederholen sich seitdem<br />
und abgesehen von beispielhaften Einzelinitiativen<br />
bleibt das „Bermuda-Dreieck“<br />
im Ganzen unverändert. Es liegt also an den<br />
Traditionen, den Systemegoismen, den „objektiven“<br />
Hemmnissen, die in den rechtlichen und<br />
ökonomischen Rahmenbedingungen zu suchen<br />
seien – so die übereinstimmende Diagnose. Ich<br />
habe starke Zweifel, ob sie stimmt, ob die Analyse<br />
überhaupt die richtige Ebene getroffen<br />
hat. Zweifellos sind die genannten Faktoren<br />
wichtige und starke Punkte, aber es sind allesamt<br />
auch wieder nur „Äußerlichkeiten“, die<br />
bei so eindeutiger Übereinstimmung bezogen<br />
auf die große Bedeutung von Kooperation zur<br />
Erreichung einer nicht ausgrenzenden Praxis<br />
mit Jugendlichen doch zu überwinden sein<br />
müßten, jedenfalls im Verlauf so vieler Jahre.<br />
Ich wage eine andere These: Meines Erachtens<br />
bilden die beklagten Kooperationsschwierigkeiten<br />
nur den Vordergrund des Problems, mit<br />
dem die dahinter liegenden ausgrenzenden<br />
Sichtweisen und die aus ihnen resultierenden<br />
Abwehrmechanismen gegen Jugendliche,<br />
die verbotene Drogen konsumieren, vor allem<br />
wenn sie einen problematischen Konsum entwickeln,<br />
verdeckt werden.<br />
Diese ausgrenzenden Sichtweisen sind das<br />
heimliche Gemeinsame der verschiedenen Hilfe-Systeme,<br />
ihrer Institutionen und der Mehrheit<br />
der in ihnen arbeitenden Professionellen,<br />
ob sie nun SozialpädagogInnen, TherapeutInnen,<br />
PsychologInnen, MedizinerInnen etc.<br />
sind. Das setzt nur unterschiedliche Akzentuierungen<br />
im selben Geschehen. Ich spitze meine<br />
These absichtlich zu – überspitze sie vielleicht<br />
– um der Deutlichkeit willen, indem ich<br />
behaupte, daß die Kooperation zwischen den<br />
Hilfesystemen funktioniert und zwar als heimlicher<br />
Lehrplan auf der Ebene der Ausgrenzung.<br />
Sie funktioniert nicht auf der Ebene der<br />
offiziell immer wieder geforderten Integration<br />
der jugendlichen KonsumentInnen illegalisierter<br />
Drogen, die in den Handlungsbereich von<br />
Jugendhilfe, Drogenhilfe und Jugendpsychiatrie<br />
kommen. Die Praxis der drei Hilfe-Systeme<br />
braucht ja auch, genau besehen, den für solche<br />
Veränderungen notwendigen Leidensdruck<br />
nicht zu entwickeln, denn da gibt es noch ein<br />
viertes System im Bunde, das in der ganzen mir<br />
bekannten Kooperationsliteratur und Präventionsliteratur<br />
systematisch verschwiegen wird,<br />
obwohl es alle beteiligten PraktikerInnen und<br />
TheoretikerInnen kennen: Die von der Bundesdrogenbeauftragten<br />
erst vor kurzem auf einer<br />
internationalen Drogenkonferenz der Friedrich-<br />
Ebert-Stiftung in Berlin als „unverzichtbar“<br />
verteidigte sogenannte Ultima Ratio des Strafrechts<br />
in der Gestalt des Betäubungsmittelgesetzes,<br />
die „Repression als vierte Säule“ neben<br />
Prävention, Therapie und Nachsorge, wie die<br />
polizeiliche und justizielle Verfolgung der<br />
KonsumentInnen verbotener Stoffe vornehm<br />
genannt wird.<br />
Diskriminierung, Verfolgung und Unterdrückung<br />
durch das Strafrecht tatsächlich im<br />
klassischen Sinne als „Ultima Ratio“, als letzte<br />
Instanz im Hintergrund, die Jugendstrafrechtspflege,<br />
dieser riesige Apparat von Polizei,<br />
Staatsanwaltschaft, Jugendgerichtshilfe,<br />
Jugendgerichten, Bewährungshilfe, das alles<br />
als letzte „Auffanglinie“, wo diejenigen aufgefangen,<br />
eingefangen und zuletzt gefangen<br />
werden, die, wie es so lapidar heißt, bei den<br />
drei anderen Hilfesystemen „durch die Roste<br />
gefallen sind“. Erst in diesem Vierer-Verbund<br />
kann das mit der BTMG-Novelle von 1982 installierte<br />
System von „Therapie statt Strafe“,<br />
das sich längst als ein System von Therapie<br />
und Strafe und oft genug von Therapie als<br />
Strafe gezeigt hat, funktionieren. Liebe Kolleginnen<br />
und Kollegen, wie kommen drogenkonsumierende<br />
Jugendliche ins Gefängnis,<br />
was haben sie da zu suchen? Ich weiß: Die<br />
Straftatbestände des BTMG, die sogenannten<br />
Wiederholungs- und Intensiv-Täter und die<br />
Beschaffungskriminalität – aber wie kann jemand<br />
ernsthaft behaupten, daß der Umgang<br />
mit psychoaktiven Substanzen eine strafbare<br />
Handlung ist, genauer: mit bestimmten dieser<br />
Substanzen, mit anderen nicht minder riskanten<br />
aber nicht? Wie ist es möglich, diesen Umgang<br />
als Vergehen und Verbrechen zu definieren?<br />
Ich weiß, mit dem Hinweis auf die doch<br />
offensichtlichen schädlichen Folgen für das<br />
Individuum und die sogenannte Volksgesundheit<br />
– aber diese Folgen, das wissen wir inzwischen,<br />
sind doch in ihrer Mehrzahl und ihrer<br />
Schwere selbst die Wirkungen der Verbotspraxis,<br />
die sie angeblich verhindern sollen: Die Il-<br />
legalisierung schafft den schwarzen Markt mit historische seinen Profitstrategien, schafft das gestreckte<br />
und gepanschte Straßen-Heroin, die Kriminali-<br />
sierung, die Beschaffungskriminalität und die<br />
Beschaffungsprostitution – alle die Formen der<br />
Verelendung, die als sichtbares und medial<br />
vorgeführtes Schreckenszenario die Abwehrre-<br />
flexe in der Bevölkerung, bei den PolitikerInnen<br />
und nicht zuletzt in den Hilfesystemen selbst<br />
hervorrufen und verstärken.<br />
„Kein Ort – nirgends?“ – Ja, denn auch aus der<br />
Jugendstrafanstalt muß man sie schließlich<br />
wieder entlassen und auch aus den geschlos-<br />
senen Einrichtungen der Jugendhilfe und der<br />
Jugendpsychiatrie, den „sicheren Orten“ im<br />
sogenannten Vorfeld der Jugendstrafe muß<br />
man sie wieder entlassen.<br />
Kann jemand ernsthaft annehmen, daß dieses<br />
System in der Öffentlichkeit, im Bewußtsein<br />
aller Beteiligten, keine Wirkungen hinterläßt?<br />
Kann jemand in den Drei Hilfesystemen ernst-<br />
haft annehmen, die durch das Betäubungsmit-<br />
telgesetz implantierten Bedingungen seien<br />
unbedeutend für die eigene Arbeit und sei sie<br />
noch so weit weg im „Vorfeld“ angesiedelt?<br />
Und kann jemand, der es mit dem Anspruch der<br />
Integration von jugendlichen KonsumentInnen<br />
illegalisierter Drogen ernst meint glauben, die<br />
„vierte Säule der Repression“ sei hereditär und<br />
eigentlich zu vernachlässigen? Liebe Kollegin-<br />
nen und Kollegen, die willkürliche rechtliche<br />
Diskriminierung einer Reihe von psychoaktiven<br />
Substanzen, die vor allem von Jugendlichen<br />
genommen werden, die damit stigmatisiert<br />
und ausgegrenzt werden, hat kontraproduktive<br />
Wirkungen bis in die Präventionsbemühungen<br />
in den Feldern der primären Erziehung und<br />
der Offenen Jugendarbeit hinein. Die latenten<br />
Drogenängste der Erwachsenen drohen nicht<br />
ohne Grund in offene Panik und entsprechen-<br />
de Reaktionen umzuschlagen, schon bei nur<br />
vermuteten geringen Anzeichen von illegalem<br />
Konsum der Heranwachsenden. Mütter, Väter,<br />
LehrerInnen vereint im Credo der Angst: Hof-<br />
fentlich überstehen die Jugendlichen die gro-<br />
ßen Gefahren und Gefährdungen von Pubertät<br />
und Adoleszenz, deren größte der Umgang<br />
mit verbotenen Drogen zu sein scheint. Statt<br />
offener Kommunikation ohne Tabuisierungen<br />
und schon immer feststehenden Verboten, der<br />
moralische und pädagogische Zeigefinger, die<br />
angstvolle forschende Stimme, der suchende<br />
28 . Nr.63 . SIT<br />
SIT . Nr.63 . 29<br />
historische und aktuelle diskurse
zweifelnde Blick – statt Vertrauen Mißtrauen<br />
und schließlich Abbruch der Kommunikation,<br />
die eigentlich keine ist, denn von Dialog, der<br />
auf der Wertschätzung und der Offenheit be-<br />
ruht, kaum eine Spur in diesem sogenannten<br />
pädagogischen Gesprächen an allen Orten wo<br />
erzogen wird. Die Folge: aus-dem-Feld-gehen,<br />
verbergen, vertuschen, verheimlichen. So bil-<br />
den sich für die Jugendlichen, die sich in ihren<br />
jugendkulturellen Zusammenhängen zum ex-<br />
perimentierenden oder verstetigten Drogen-<br />
konsum entscheiden, zwei einander entge-<br />
gengesetzte und einander aus-schließende<br />
polarisierende Kommunikations-ebenen:<br />
Mit den erziehenden Erwachsenen eine ver-<br />
tikale „Kommunikation“, als Einbahnstraße<br />
von oben nach unten, mit einem negativen<br />
Thematisierungs-Modus, der alle möglichen<br />
negativen Aspekte des Drogenkonsums, auch<br />
solche, die im Drogendiskurs erfunden werden,<br />
monopolisiert und die verbotenen Stoffe und<br />
ihren Konsum dämonisiert und auf der anderen<br />
Seite in der jugendkulturellen Szene, in der die-<br />
se Drogen eine Rolle spielen, eine horizontale<br />
Kommunikation mit den Gleichaltrigen mit der<br />
Gefahr eines ausschließlich positiven Themati-<br />
sierungs-Modus, der alle denkbaren positiven<br />
Aspekte des Drogenkonsums monopolisiert<br />
unter Ausblendung möglicher Risiken, also im<br />
Gegenzug zur „Dämonisierung“ des Drogen-<br />
konsums durch die Erwachsenen eine „Glorifi-<br />
zierung“ unter den Jugendlichen hervorbringt.<br />
Beide wirken zusammen und die sich aus die-<br />
ser Polarisierung entwickelnde kommunikative<br />
Schere verhindert eine für erziehende Erwach-<br />
sene und Jugendliche gleichermaßen produk-<br />
tive Kommunikation des Drogenthemas. Das ist<br />
das Grab jeglicher Präventionsbemühungen,<br />
deren Erfolg ja zu hundert Prozent von gelin-<br />
gender Kommunikation abhängt.<br />
diskursezweifelnde historische und aktuelle diskurse<br />
Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit den Kom-<br />
munikationsabbrüchen beginnt der Weg von<br />
Jugendlichen in die Ausgrenzung.<br />
Zum Schluß muß ich mein Motto für dieses<br />
Beispiel „Kein Ort – nirgends“ relativieren. Es<br />
gilt nur für die von Erwachsenen organisierten<br />
und verantworteten Räume. Der Ort, der bleibt<br />
und immer wichtiger wird, ist die Gruppe der<br />
Gleichaltrigen mit ähnlichen Interessen, Wün-<br />
schen und Erfahrungen, die jugendkulturelle<br />
Szene und bei fortgeschrittener Abkoppelung<br />
von der sogenannten Normalgesellschaft<br />
schließlich die subkulturelle Drogenszene mit<br />
ihrer eigenen Sprache, ihren Lebensstilen und<br />
spezifischen Verstrickungen. Und diese Orte<br />
werden nun erst recht zur Provokation der Dominanzkultur,<br />
wozu unsere Hilfe-Systeme ja auch<br />
gehören, und zu einem ordnungspolitischen<br />
Problem erster Güte. Diese Orte, tatsächlich<br />
Überlebensorte der Marginalisierten, werden<br />
als „soziale Brennpunkte“, als „kriminogene<br />
Zonen“, als „jugendgefährdende Orte“ etc.<br />
klassifiziert. Sie werden zum öffentlichen Ärgernis,<br />
das aus dem Alltagsbild der Städte<br />
verschwinden soll: Zero-Toleranz, wie jetzt<br />
in Hamburg, oder „polizeiliche Auflösung der<br />
Szene“, zumindest ihre Verdrängung aus der<br />
City, dem Zentrum von Business und Tourismus,<br />
an die Peripherie – so heißen die Strategien.<br />
Wenn sie Erfolg haben, steigt die Zahl der<br />
Verelendeten und auch der Drogentoten, denn<br />
wer wirklich auch den letzten Ort noch verliert,<br />
ist am Leben bedroht.<br />
Mit einem Zitat des Geschichts-Philosophen<br />
Theodor Lessing aus seinem 1927 veröffentlichtem<br />
Buch „Geschichte als Sinngebung des<br />
Sinnlosen – Die Geburt der Geschichte aus<br />
dem Mythos“ möchte ich meinen Vortrag beschließen:<br />
„Immer tiefer verfestigt sich der Widerwille gegen<br />
all die unser Machtbegehren verkleidende<br />
Zielverborgenheit. (…) Handle es sich nun um<br />
das religiöse oder um das weltliche Anbild,<br />
handle es sich um staatliche oder um geistige,<br />
um völkische oder um gesellige, um künstlerische<br />
oder um sittlicher Wunsch- und Hochbilder<br />
– alles das, woran ich auf Erden gelitten<br />
habe und was mir am Menschen böswillig<br />
und gehässig erschien, brüchig und gemein,<br />
machtwillig oder eitel, alles das begegnete mir<br />
auf meinem Lebenswege stets im Gewand der<br />
Ideale. Im Gewande der Wahrheit: die Lüge. Im<br />
Gewande der Logik: der Irrsinn. Im Gewande<br />
des Rechts: jegliches Unrecht. Im Gewande<br />
des Menschheitsfortschritts: alles den Menschen<br />
entwürdigende. Und nie sah ich eine<br />
geschichtliche Niedertracht, nie eine wirkliche<br />
Abscheulichkeit, die nicht geübt wurde im Namen<br />
irgendeines Ideals.“<br />
Ein solches Ideal ist auch die unsere Profession<br />
begründende und legitimierende Kategorie<br />
„Hilfe“. Wir kommen nicht darum herum, sie<br />
immer wieder zu de-konstruieren um erkennen<br />
zu können, was in ihrem „Zeichen“ geplant<br />
und beabsichtigt ist und um entscheiden zu<br />
können wie wiruns, als Angehörige eines „helfenden<br />
Berufs“, im konkreten Fall dazu verhalten<br />
wollen.<br />
Zusammenfassung<br />
In dem folgenden Beitrag treffe ich Anmerkungen<br />
zu der Entwicklung der Jugendhilfe hin<br />
zu einer punitiven Pädagogik. Ich bespreche<br />
diese Entwicklung anhand der Rückkehr der<br />
geschlossenen Unterbringung. Dabei gehe ich<br />
folgendermaßen vor: Im ersten Schritt erinnere<br />
ich an die Gründe für die Heimreform in den<br />
siebziger und achtziger Jahren, die eine Reform<br />
von Unten, eine von den damaligen Zöglingen<br />
und veränderungsbereiten Erziehern<br />
beförderte Reform gewesen ist. Im zweiten<br />
Schritt beschreibe ich die derzeitige Entwicklung<br />
als eine Reform von Oben: Heute sind es<br />
nicht die pädagogischen Kräfte, die auf Änderung<br />
drängen, sondern der Veränderungsbedarf<br />
wird von Seiten der Politik formuliert.<br />
In einem dritten Schritt analysiere ich diese<br />
Entwicklung als eingebettet in die Politik des<br />
aktivierenden Staates, der ein helfender und<br />
ein strafender Staat zugleich sein will und seinen<br />
Strafanteil unter anderem in der Wiedereinführung<br />
der geschlossenen Unterbringung<br />
zu verwirklichen trachtet. In diesem dritten<br />
Schritt stelle ich einem ersten Abschnitt die<br />
politische Argumentation des aktivierenden<br />
Staates vor und zeige, dass ihr eine politische<br />
Ethik der Interessenlosigkeit zugrunde liegt. In<br />
dem letzten Absatz dieses dritten Teils arbeite<br />
ich die dazu korrespondierende punitive Praxis<br />
als eine politisch-pädagogische Methode des<br />
aktivierenden Staates heraus.<br />
Prof. Dr. Manfred Kappeler<br />
Technische Universität Berlin<br />
Institut für Sozialpädagogik<br />
Franklinstr. 28/29<br />
D-10587 Berlin<br />
Michael Lindenberg<br />
Von der Heimreform zur Heimrestauration:<br />
Das Beispiel der geschlossenen Unterbringung in den Jugendhilfe<br />
Bambule: Heimreform von Unten<br />
Die Darstellung des Teils über die Soziale<br />
Arbeit im 20. Jahrhundert, dem sozialpäda-<br />
gogischen Jahrhundert zwischen Reform und<br />
Revolte möchte ich mit dem längeren Zitat ei-<br />
nes Zeitzeugen beginnen. Peter Jürgen Boock<br />
(Jahrgang 1951), hat in den vergangenen Jah-<br />
ren gelegentlich über seine Erfahrungen zu<br />
den Studenten meiner Hochschule gesprochen,<br />
und mein Kollege Timm Kunstreich hat das in<br />
seinem „Grundkurs Soziale Arbeit“ (Kunstreich<br />
2001) zu Papier gebracht. Peter Boock war bis<br />
Ende der 70er Jahre Mitglied der RAF, stieg<br />
dann aus und lebte einige Zeit im Untergrund.<br />
Dort arbeitete er zeitweise an dem Aufbau<br />
eines alternativen Kommunika tionszentrums<br />
mit, wurde dann verhaftet und in mehreren<br />
Prozes sen zu lebenslanger Haft verurteilt. Zum<br />
Zeitpunkt seines hier zitierten Berichts (1995)<br />
war er Freigän ger in einer Übergangsanstalt,<br />
was ihm auch ermöglichte, an der Hochschule<br />
für Wirtschaft und Politik in Hamburg zu stu-<br />
dieren. Peter Jürgen Boock berichtet aus seiner<br />
Zeit in einem geschlossenen Heim Mitte der<br />
60er Jahre (vgl. Kunstreich 2001,88)<br />
„(Es) war ein in sich geschlossenes System.<br />
Makabrer ging‘s eigentlich kaum noch. Es gab<br />
zwei Möglichkeiten, vor 21 (...) rauszukommen,<br />
das eine war die Heringsfischerei und das an-<br />
dere die Bundesmarine. Und zwar deswegen,<br />
weil die Leute aus dem Heim dann direkt aufs<br />
Schiff kamen und erst in einem Jahr wieder<br />
30 . Nr.63 . SIT<br />
SIT . Nr.63 . 31<br />
historische und aktuelle diskurse
vor Ort waren. Makaber war weiter, dass die<br />
Leute, die die Heringsfischerei auch in Massen<br />
produzierte, nämlich die mit abgehackten Fin-<br />
gern oder Beinen, dann Heimerzieher wurden.<br />
Diese Leute waren furchtbar guter Stimmung<br />
und verbreiteten Optimismus, also herrschte<br />
eine Atmosphäre, wie man sie sich schlimmer<br />
nicht vorstellen kann (...).Die wichtigste Ar-<br />
beit, die man in diesem Heim verrichten konn-<br />
te, war Fischer netze stricken. Dafür gab es<br />
vier Zigaretten pro Tag. Die Kleidung bestand<br />
aus ehemaliger KZ-Kleidung und aus Holzlat-<br />
schen, damit man nicht weglaufen konnte.<br />
Bekocht wurden wir von weiblichen Insassen<br />
einer Irrenanstalt, die dem Erziehungsheim<br />
angegliedert war. (Das Heim, M.L.) hat in sich<br />
eine ‚nette‘ Geschichte: erst kaiserliche Kadet-<br />
tenanstalt, dann Frauengefängnis, dann Frau-<br />
en-KZ und jetzt eben Erziehungsheim - eine<br />
ungebrochene Tradition!“<br />
Es kam zur Revolte. Peter Boock berichtet:<br />
„Eines Tages bekam einer der Insassen des A-<br />
Hauses (das war das Zugangs haus) ein Paket<br />
und wollte es ausgehändigt bekommen. Der<br />
Erzieher sagte ‚nein‘, der Typ sagte, ‚das sehe<br />
ich überhaupt nicht ein, das hole ich mir jetzt<br />
doch.‘ Der Erzieher holte den Gummiknüppel<br />
aus dem Halfter und sagte ‚das kannste ja mal<br />
probieren‘, der Insasse haute ihm dann eins in<br />
die Fresse und holte sich sein Paket. Der Mann<br />
stieg auf die Trillerpfeife, innerhalb von kurzer<br />
Zeit war alles, was an Erziehern im Heim vor-<br />
handen war, beieinander, und der Aufstand<br />
begann. Im Verlaufe dieses Aufstandes wurde<br />
das gesamt A-Haus demoliert, die Heizung<br />
aus den Wänden gerissen, die Bettgestelle<br />
aus dem Fenster geworfen, einige Erzieher<br />
ziemlich verprügelt. (...) In der Zwischenzeit<br />
hatten Insassen die Treppe dieses A-Flügels<br />
mit flüssi gem Bohnerwachs überkippt und<br />
angezündet, damit keiner reinkommt. Dieses<br />
Feuer entwickelte sich allerdings sehr schnell<br />
und hatte zur Folge, dass wir nicht mehr<br />
rauskamen. Die Marine, einer solchen Situa-<br />
tion wohl noch nie ausgesetzt, hat dann noch<br />
zusätzlich Gasgranaten in das Treppenhaus<br />
geschossen. Wir waren ganz kurz davor, im<br />
zweiten Stock dieses Blocks abzukratzen. Wir<br />
haben uns mit Messern und Gabeln durch den<br />
Dielenboden einen Stock tiefer gearbeitet und<br />
sind im letzten Moment damit fertig geworden,<br />
bevor die Flammen im zweiten Stock über uns<br />
diskursevor Ort historische und aktuelle diskurse<br />
zusammenschlugen. Deswegen sind wir noch<br />
mal davon ge kommen. Ansonsten wären wir<br />
alle verbrannt.“ (Kunstreich 2001,88-89)<br />
Peter Boock wird in eine anderes Heim abgeschoben<br />
und erlebt folgendes: „Etwa eine Woche,<br />
nachdem ich (...) angekommen war, wurde<br />
uns angekündigt, dass Studenten der Pädagogischen<br />
Fakultät der Uni Frankfurt kommen<br />
würden, um sich in der Praxis anzusehen, was<br />
sie bis dato nur in der Theorie durchgenommen<br />
hatten. Als dann an dem Wochenende diese<br />
Studenten wirklich kamen, saß uns eine Gruppe<br />
gegenüber, zu der unter anderem Andreas<br />
Bader, Gudrun Ensslin, Thorwald und Astrid<br />
Proll gehörten. Der Hintergrund war eine<br />
Kaufhaus-Brandstiftung in Frankfurt gewesen,<br />
wegen der die genannten Leute vor Gericht gestanden<br />
hatten. Sie waren verurteilt worden,<br />
in Revision gegangen und bis zum Entscheid<br />
über die Revision wurden sie auf freien Fuß<br />
gesetzt - mit der Auflage, eine Tätigkeit im sozialen<br />
Bereich wahrzunehmen. Diese Tätigkeit<br />
im sozialen Bereich sahen sie darin, die Erziehungsheime<br />
zu leeren. Das stieß bei uns auf<br />
große Gegenliebe.“ (Kunstreich 2001,90)<br />
Aus heutiger Sicht ist es unglaublich, wie damals<br />
in Deutschland mit Jugendlichen in der<br />
Jugendhilfe umgegangen wurde. Wie unglaublich,<br />
erkenne ich immer an dem Unglauben der<br />
Studierenden, wenn ich mit ihnen den Film<br />
„Bambule“ sehe, der ja mit einem weiteren berühmten<br />
Namen aus dieser Zeit verbunden ist:<br />
Ulrike Meinhof. Weil der Film in Schwarz-Weiß<br />
gedreht ist, meinen einige der Studierenden,<br />
dass Zustände im Dritten Reich beschrieben<br />
werden oder aus der Frühzeit der DDR, aber<br />
ganz gewiss nicht aus der Bundesrepublik<br />
Deutschland zu einer Zeit, in der sie gerade geboren<br />
wurden. Die Zeit ist offensichtlich über<br />
diese von Boock beschriebene und von Baader<br />
und Meinhof bekämpfte Form der Einsperrung<br />
hinweggeschritten, sie ist undenkbar geworden.<br />
Daran besteht kein Zweifel, auch, wenn<br />
etwa Jugendgefängnisse weiterhin bestehen,<br />
und teilweise immer noch mit alter baulicher<br />
Struktur. Daran besteht kein Zweifel, auch<br />
wenn immer noch und andauernd in der Jugendhilfe<br />
noch geschlossen untergebracht<br />
wurde. Zuletzt bekannte Zahlen deuten auf<br />
mehr als 140 Plätze in Deutschland hin (vgl.<br />
Landesjugendamt Saarland 2001), Tendenz in<br />
den kommenden Jahren: Vermutlich steigend.<br />
Doch bewachen in diesen heutigen Heimen<br />
keine ehemaligen Heringsfischer mit Gummiknüppeln<br />
die Minderjährigen. Das ist abgeschafft.<br />
Und der Symbolgehalt der Abschaffung<br />
dieser deutlich grausamen und den Menschen<br />
vernichtenden Form der Jugendwohlfahrt war<br />
daher seinerzeit entsprechend beachtlich (Ehlers<br />
2002,1). Zur Zeit von Boock wurde nach<br />
drei Gesichtspunkten geschlossen untergebracht:<br />
einmal als gesicherte Unterbringung<br />
im Rahmen des Jugendwohlfahrtsgesetzes<br />
(das wurde ersatzlos abgeschafft), zweitens<br />
als einstweilige Unterbringung in einem geeigneten<br />
Erziehungsheim zur Abwendung<br />
der Untersuchungshaft (noch heute Unterbringungen<br />
nach §§ 71/72 GG) sowie drittens als<br />
kurzfristige Sicherung aufgegriffener Kinder<br />
nach den Vorschriften zum Schutze der öffentlichen<br />
Sicherheit und Ordnung (heute nach § 42<br />
SGB VIII, also als Maßnahme in Ausübung des<br />
Wächteramtes). (vgl. Bittscheidt-Peters & Koch<br />
1982,2)<br />
Ziel der Heimreform war es damals, „die Aufgaben<br />
von Heimerziehung als Hilfsangebot zu<br />
klären und damit zugleich repressive, sanktionierende<br />
oder generalpräventive Funktionen<br />
auszugrenzen.“ (Bittscheidt-Peters & Koch<br />
1982,1). Das bedeutete die Abschaffung der<br />
gesicherten Unterbringung im Rahmen des<br />
Jugendwohlfahrtsgesetztes (JWG). Und Hilfe<br />
im Wege der Einsperrung erschien nicht mehr<br />
möglich, die Verbindung von Einsperren und<br />
Hilfe war durch die Erfahrungen der Vergangenheit<br />
desavouiert.<br />
Heimreform von Oben: Restauration<br />
Trotz der reformerischen Anstrengungen im<br />
Ausgang des 20. sozialpädagogischen Jahrhunderts<br />
ist allerdings weiterhin festgehalten<br />
worden, wenn auch in einer dem Zeitgeist<br />
entsprechenden Form. Diese Form zeigt sich<br />
an den Sprachregelungen zur geschlossenen<br />
Unterbringung. Ich nenne einige Beispiele, aus<br />
Deutschland zusammengetragen: „pädagogisch-betreute<br />
Intensivgruppe“; „individuelle<br />
Teilgeschlossenheit“; „intensiv-pädagogische<br />
Gruppe“; „individuell-geschlossene intensivtherapeutische<br />
Gruppe“; „teilgeschlossene<br />
Gruppe.“ (Landesjugendamt Saarland 2001) In<br />
Hamburg wurde der Leiter der Einrichtung, die<br />
im Auftrag der Landesregierung seit Beginn<br />
Das doppelte Gesicht des<br />
aktivierenden Staates<br />
32 . Nr.63 . SIT<br />
SIT . Nr.63 . 33<br />
Politik<br />
Dazu muß zunächst einmal gefragt werden, wie<br />
diese wiederauflebende Verbindung aus Päda-<br />
gogik (also Hilfe, Anleitung und Unterstützung<br />
für Kinder und Jugendliche bei ihrer Entwick-<br />
lung) und Ordnungspolitik (also Strafe mit dem<br />
Ziel der General- und Spezialprävention) mög-<br />
lich wird. Diese Verbindung kann im Schatten<br />
des aktivierenden Staates hergestellt werden.<br />
Dem Leitbild des aktivierenden Staates sind<br />
in Deutschland mittlerweile alle Parteien mit<br />
Regierungsverantwortung verpflichtet. Dieser<br />
aktivierende Staat will ein helfender und ein<br />
strafender Staat zugleich sein. Hilfe gibt es in<br />
diesem Staat vorrangig für diejenigen, die sich<br />
des Jahres 2003 Minderjährige einsperrt, mit historische der Idee vorstellig, die Einsperrung „Zentrum<br />
für Intensivpädagogik“ zu nennen. Der zustän-<br />
dige Staatsrat (Staatssekretär) soll aber abge-<br />
lehnt haben: Das sei eine geschlossene Einrich-<br />
tung, und sie solle daher auch so heißen. Je-<br />
doch soll heute offensichtlich nicht mehr in die<br />
gewalttätigen Einrichtungen aus den Zeiten<br />
von Peter Boock eingesperrt werden, sondern<br />
nun sind es freundliche geschlossene Syste-<br />
me, in denen positive Beziehungen hergestellt<br />
werden sollen. Dabei muss jedoch die seit dem<br />
Ausgang des 20. Jahrhunderts und seit der Ab-<br />
schaffung der alten Erziehungsheime in der Ju-<br />
gendhilfe durchgängig als schädlich bewerte-<br />
te Verbindung von Hilfe und Strafe (denn nicht<br />
anders als Strafe kann die Einsperrung von den<br />
Eingesperrten aufgefasst werden) notwendig<br />
wieder zum Leben erweckt werden. Diese Ver-<br />
bindung ist die Grundvoraussetzung jeglicher<br />
Argumentation für geschlossene Unterbrin-<br />
gung. „Das Konzept der geschlossenen Unter-<br />
bringung verbindet Sicherungsnotwendigkei-<br />
ten mit modernen Grundsätzen erzieherischer<br />
Betreuung“ (FHH 2002,5), formuliert beispiels-<br />
weise die Jugendbehörde in Hamburg. Es sind<br />
also offensichtlich die „modernen Grundsätze<br />
erzieherischer Betreuung“, die die Freundlich-<br />
keit des Systems erzeugen sollen. Was nun<br />
unterscheidet diese modernen Grundsätze von<br />
den Grundsätzen der Heringsfischer in dem<br />
Heim von Peter Boock?<br />
historische und aktuelle diskurse
nicht selbst helfen können, also vor allem Be-<br />
hinderte und Kranke. Dazu formuliert etwa die<br />
Hamburger Sozialsenatorin: „Es gibt Rechte<br />
und Pflichten im Sozialstaat. Wer Hilfe braucht,<br />
dem wird Hilfe gewährt. Aber die Devise lautet<br />
auch: Wer kann, aber nicht will, dem müssen<br />
wir nicht helfen.“ (Schnieber-Jastram 2002)<br />
Strafe setzt immer dann ein, wenn die mit der<br />
Hilfegewährung verknüpften Erwartungen<br />
nicht erfüllt werden und dieses Versagen den<br />
Hilfeempfängern zugerechnet werden kann.<br />
In diesem Spannungsfeld aus Hilfe und Strafe<br />
bewegt sich auch die aktuelle Debatte in der<br />
Jugendhilfe und besonders beispielhaft um die<br />
geschlossene Unterbringung. Dabei ist eine<br />
bedingungslose Ablehnung der ordnungspoli-<br />
tischen Straf-Anteile in der Jugendhilfe immer<br />
weniger anzutreffen (Position 1). Offensichtlich<br />
geraten die Erfahrungen mit den Straf-Heimen<br />
und die Kritik, die das ausgehende sozialpäda-<br />
gogische Jahrhundert an ihnen formulierte, be-<br />
reits zu Beginn des 21.Jahrhunderts wieder ins<br />
Vergessen. Eine zwar allgemeine Ablehnung<br />
der geschlossenen Unterbringung als regelhaf-<br />
te Einrichtung, aber dann doch eine Zustim-<br />
mung in besonderen Einzelfällen bei Gefahr für<br />
Leib und Leben und unter Wahrung hoher Prüf-<br />
kriterien ist häufiger geworden und scheint mir<br />
selbst auf dem Gebiet der lebensweltorientier-<br />
ten Jugendhilfe auch unter Fachleuten durch-<br />
gesetzt (Position 2). Eine Zustimmung aus<br />
pädagogischen oder therapeutischen Gründen<br />
unter Hinnahme der ordnungspolitischen As-<br />
pekte ist dagegen die Position einer klinisch<br />
und therapeutisch orientierten, einschließen-<br />
den Jugendhilfe (Position 3). Eine Zustimmung<br />
zur Einsperrung ausschließlich aus ordnungs-<br />
politischen Gründen ist allerdings unter Fach-<br />
leuten weiterhin nicht jugendhilfefähig, wird<br />
aber immer deutlicher politikgängig (Position<br />
4). Die Übergänge dieser vier Positionen sind<br />
sicher fließend. Doch stehen sich im Rahmen<br />
der Politik des aktivierenden Staates vor allem<br />
die Position zwei (Lebensweltorientierung)<br />
und die Position drei (klinisch-therapeutische<br />
Sichtweise) in der Fachdiskussion strittig ge-<br />
genüber.<br />
Was ist nun mit der „Qualitätssicherung“ der<br />
Einsperrung im aktivierenden Staat, denn dar-<br />
auf legt er doch so viel wert? Schließlich ist<br />
Qualität in seinem Verständnis kein für sich<br />
stehendes Gut, sondern wird von ihm in den<br />
diskursenicht selbst historische und aktuelle diskurse<br />
Zusammenhang einer Zweck-Mittel-Relation<br />
gebracht. Ob die einsperrende, punitive Pädagogik,<br />
wie etwa die geschlossene Unterbringung,<br />
in diesem Sinn funktioniert, es also<br />
zu einem angemessenen Verhältnis zwischen<br />
den eingesetzten finanziellen Mitteln und<br />
den zu erreichenden Zielen kommt, ist bei der<br />
wiederauflebenden Einsperrung von Kindern<br />
und Jugendlichen, und anders als sonst in der<br />
Sozialen Arbeit, allerdings keine entscheidende<br />
Frage. Denn bei der geschlossenen Unterbringung<br />
haben wir es mit einer politischen<br />
„Bedarfsentscheidung mit entsprechender<br />
Kostendeckungsgarantie“ (Halfar 2001,540)<br />
zu tun. Kostendeckungsgarantien sind jedoch<br />
bereits seit Jahren für die Soziale Arbeit untypisch<br />
geworden. Heute wird eine Entscheidung<br />
für oder gegen eine soziale Investition<br />
immer weniger von politischen Erwägungen,<br />
sondern immer mehr von ökonomischen Gesichtspunkten<br />
abhängig gemacht wird (vgl.<br />
Halfar 2001,540). In diesem an ökonomischen<br />
Parametern orientierten „Finanzstrom schwimmen<br />
natürlich Partikel einer Logik, die nicht<br />
mehr politischen Präferenzordnungen, sondern<br />
der wirtschaftlichen Rentabilitätsüberlegung<br />
gehorcht.“ (Halfar 2001,541) Diese wirtschaftlichen<br />
Rentabilitätserwägungen werden bei<br />
Entscheidungen für geschlossene Unterbringungen<br />
jedoch vollständig außer Kraft gesetzt.<br />
Bei der geschlossenen Unterbringung fließt der<br />
Finanzstrom in dem ansonsten als veraltet betrachteten<br />
Bett einer ausschließlich staatlichpolitischen<br />
Steuerung. Und die Umlenkung in<br />
dieses zunehmend trocken gelegte Bett wird<br />
gerade von den politischen Kräften vorgenommen,<br />
die ansonsten alle ihre Mittel einsetzen,<br />
um den Zufluss in dieses staatliche Bett sorgsam<br />
abzudichten und dagegen auf ein ökonomisches<br />
Mäandern setzen.<br />
Damit offenbart sich jedoch kein Widerspruch,<br />
sondern die Doppelstrategie des aktivierenden<br />
Staates.2 So soll dieser aktivierende Staat zwar<br />
einerseits kein klassischer Interventionsstaat<br />
mehr sein. Stattdessen sei, so etwa Evers und<br />
Leggewie (1999,332), eine Leitidee auf den Plan<br />
getreten, die den Staat als Partner sozialer Hilfe,<br />
als Moderator sozialer Konflikte, als Supervisor<br />
sozialer Probleme, oder aber auch als Animateur<br />
der Selbsthilfe und Eigentätigkeit sieht.<br />
Nichts davon findet sich in der geschlossenen<br />
Unterbringung. Mit ihr wird nicht supervidiert,<br />
sondern überwacht, es wird nicht Selbsthilfe<br />
gefördert, sondern Fremdbestimmung gefordert,<br />
es wird nicht Eigentätigkeit angemahnt,<br />
sondern Eigentätigkeit wird eingeschränkt.<br />
Und eindeutig gehört es dieser Selbstbeschreibung<br />
zufolge zum aktivierenden Staat, dass er<br />
private, „also vor allem marktgestützte Aktivitäten<br />
fördert, sie durch Setzung angemessener<br />
Standards reguliert, dabei normativ die Verantwortlichkeit<br />
von Individuen und Familien<br />
hervorhebt, gleichzeitig aber einen festen Sockel<br />
an Hilfe und soziale Unterstützung für die<br />
meisten Bedürftigen garantiert“ (vgl. Evers &<br />
Leggewie 1999,332). Aber davon kann in der<br />
geschlossenen Unterbringung nicht die Rede<br />
sein. Wie beschrieben, handelt es sich bei der<br />
geschlossenen Unterbringung nicht um eine<br />
marktgestützte Aktivität, sondern um eine<br />
ausgesprochen marktferne, ausschließlich politisch<br />
motivierte Veranstaltung.<br />
In der geschlossenen Unterbringung offenbart<br />
sich daher die autoritäre Seite des aktivierenden<br />
Staates. Dieser Staat ist, entgegen der<br />
offiziellen Rhetorik, überhaupt nicht darauf<br />
angelegt, auf staatliche Oberleitung zugunsten<br />
einer Ökonomisierung sozialer Prozesse<br />
zu verzichten. Zwar wird außerökonomische,<br />
unmittelbare Gewalt wie in der geschlossenen<br />
Unterbringung nur ausnahmsweise angewandt.<br />
Doch bleibt außerökonomische und<br />
unmittelbare Gewalt auch im aktivierenden<br />
Staat unverzichtbar. Daher stecken im aktivierenden<br />
Staat zwei Grundströmungen. Der<br />
„aktivierende Staat“ ist ein „schlanker Staat“<br />
und ein „autoritärer Staat“ zugleich. Diese beiden<br />
Grundströmungen ergänzen sich wechselseitig;<br />
die eine Strömung ist ohne die andere<br />
nicht denkbar. Neben seinen Versuchen der<br />
indirekten Steuerung („Aktivierung“) über den<br />
Arbeitsmarkt ist der aktivierende Sozialstaat<br />
daher „trotz aller Rhetorik nach wie vor in<br />
erster Linie eine Institution mit externen Gewalt-<br />
und Kontrollcharakter.“ (Gruppe Blauer<br />
Montag 2003,3).<br />
Politische Ethik der Interessenlosigkeit<br />
In dieser Politik des aktivierenden Staates<br />
kommt gegenüber den auffälligen Minderjährigen<br />
eine Ethik der Interessenlosigkeit zum<br />
Ausdruck. Damit ist gemeint, dass sich die für<br />
die Durchsetzung der geschlossenen Unterbrin-<br />
gung und für die Durchsetzung einer punitiven historische Pädagogik politisch Verantwortlichen nur noch<br />
am Rande für die subjektiven Beweggründe der<br />
Minderjährigen interessieren, und dann auch<br />
nur soweit, wie sie Aufschluss darüber geben,<br />
wie deren künftiges abweichendes Verhalten<br />
vermieden werden kann. Diese Ethik der Inter-<br />
essenlosigkeit geht allerdings nicht ursächlich<br />
von der in der geschlossenen Unterbringung<br />
praktizierten Pädagogik aus. Im Gegenteil, es<br />
ist der Beruf und die Aufgabe der dort tätigen<br />
Erzieher, Interesse, also Aufmerksamkeit und<br />
Neigung für die Minderjährigen zu entwickeln.<br />
Daher, und auch, weil sie auf eine elaboriertes<br />
klinisch-therapeutisches Vokabular zurückgrei-<br />
fen, unterscheiden sie sich deutlich von den<br />
verquälten Erziehern aus dem Heringsfang, die<br />
Peter Boock uns geschildert hat. Doch nimmt<br />
die politisch erzeugte Ethik der Interessenlo-<br />
sigkeit diese Pädagogik in ihren Dienst, indem<br />
sie ihr deutlich punitive Aufgaben zuweist und<br />
ihre pädagogische Arbeit damit dominiert und<br />
überwuchert. Dies wird etwa in dem bereits<br />
angeführten Zitat aus dem Konzept zur ge-<br />
schlossenen Unterbringung deutlich, wonach<br />
in der geschlossenen Unterbringung Siche-<br />
rungsnotwendigkeiten mit modernen Grund-<br />
sätzen erzieherischer Betreuung verbunden<br />
werden. Damit sind die Pädagogen, „wie ihre<br />
Zöglinge, Subjekte der Einsperrung, sind in<br />
ihrem pädagogischen Wirken der Einsperrung<br />
unterworfen. Ihr Gewinn durch das Habhaft-<br />
Werden der Zöglinge ist ein trügerischer Ge-<br />
winn, der um den Preis der Unterwerfung un-<br />
ter ein geschlossenes System und seine Folgen<br />
erkauft werden muss.“ (Lindenberg 2002,121)<br />
Daher kommt diese Ethik der Interessenlosig-<br />
keit nicht nur gegenüber den eingesperrten<br />
Minderjährigen zum Tragen, sondern sie gilt<br />
auch gegenüber dem pädagogischen Personal,<br />
dass in einen unlösbaren Konflikt geschickt<br />
wird. Dabei besteht jederzeit für die Politik die<br />
Möglichkeit, die durchführende Pädagogik und<br />
eben nicht die entscheidende Politik für das<br />
voraussehbare Scheitern dieser punitiven Pä-<br />
dagogik verantwortlich zu machen.<br />
34 . Nr.63 . SIT<br />
SIT . Nr.63 . 35<br />
Methode<br />
Diese Ethik der Interessenlosigkeit kann zwar<br />
einerseits handlungsentlastend, entstigmati-<br />
sierend und rationell für alle Beteiligten sein,<br />
historische und aktuelle diskurse
diskurseweil sie historische und aktuelle diskurse<br />
weil sie der Rationalität des Marktes zu folgen<br />
versucht und dabei nicht mehr den Täter als<br />
Bezugspunkt sieht, denn an ihm hat sie in je-<br />
der Hinsicht das Interesse verloren, auch das<br />
Besserungsinteresse. Doch formen Praktiker<br />
auf der Grundlage dieser Ethik der Interessen-<br />
losigkeit eine spezielle „Ausgrenzungs-Me-<br />
thodik“ (vgl. Kunstreich & Lindenberg 2002).<br />
Diese Ausgrenzungs-Methodik greift immer<br />
dann mit voller Härte zu, wenn die Motive und<br />
die soziale Lage der Minderjährigen nicht mehr<br />
interessieren. Denn diese Methodik fragt zwar<br />
nach den Gründen des Handelns, aber nur in-<br />
soweit sie für die zukünftige Verhinderung des<br />
eingetretenen Schaden bzw. für die zukünftige<br />
Mehrung des Nutzens von Interesse sind. Eine<br />
darüber hinaus gehende Empathie oder gar So-<br />
lidarität kennt sie nicht, weder hinsichtlich der<br />
„Täter“, noch in Bezug auf die „Opfer“.<br />
Wie wird diese Ethik der Interessenlosigkeit<br />
methodisch umgesetzt? Zunächst einmal: es<br />
ist zu erwarten, wenn unter den Praktikern ein<br />
Übergang von der Vagheit der alten Pädagogik<br />
zur vermeintlichen Entscheidbarkeit der neu-<br />
en punitiven Pädagogik auf Gegenliebe stößt.<br />
Das ist das Hervortreten einer Managemen-<br />
torientierung, die sich selbstbewusst neben<br />
die Moralorientierung der alten Pädagogik<br />
stellt. „Maneggiare“ (it.), heißt handhaben,<br />
bewerkstelligen. Und zwar so, wie es in der<br />
(Zirkus)Manege geschieht, an einem festen,<br />
voraussehbaren Ablauf orientiert. Damit ist<br />
beschrieben, was in der wissenschaftlichen<br />
Fachdiskussion „Managerialismus“ genannt<br />
wird (vgl. Schaarschuch 2001)<br />
Es gibt einen kleinen Witz, den ich zu diesem<br />
Managerialismus erzählen möchte. Frage: Wer<br />
war der erste Sozialarbeiter? Antwort: Chris-<br />
toph Kolumbus. Warum? Als er seine Reise<br />
begann, hatte er keine Vorstellung, wohin er<br />
fahren würde. Als er die Neue Welt erreich-<br />
te, wusste er nicht, wo er sich befand. Als er<br />
nach Hause kam, konnte er nicht sagen, wo<br />
er gewesen war. Und all dies passierte mit<br />
dem Geld anderer Leute. Die Botschaft ist<br />
klar: Menschen, die sich sozial-beruflich mit<br />
anderen Menschen beschäftigen, wissen nicht<br />
wirklich, was sie tun, und sie bekommen auch<br />
noch Geld dafür. Und das, so die Botschaft des<br />
Managerialismus, gehört geändert.<br />
Warum kann dieser Sozialarbeiterwitz einen<br />
Hinweis auf die Umsetzung der Ethik der Interessenlosigkeit<br />
geben? Zur Beantwortung<br />
dieser Frage möchte ich ein kleines Experiment<br />
vorschlagen. Vielleicht haben Sie gelegentlich<br />
die Zeit, einen Tag mit jemanden zu verbringen,<br />
der dafür bezahlt wird, sich mit den Menschen<br />
zu beschäftigen, die der Jugendhilfe unterworfen<br />
sind. Wie geht jemand in der Jugendhilfe<br />
mit einem Minderjährigen um, ist die Forschungsfrage.<br />
Das kann jemand aus einer ambulanten<br />
Hilfe, einer stationären Maßnahme,<br />
von einem freien oder von einem staatlichen<br />
Träger der Jugendhilfe sein. Stellen Sie jedes<br />
Mal, wenn der Jugendliche oder das Kind den<br />
Raum verlassen hat, eine einfache Frage: „Warum<br />
haben Sie das gerade gemacht?“ Stellen<br />
Sie keine komplizierten Fragen, komplizierte<br />
Fragen führen zu komplizierten Antworten. Die<br />
Person wird in der Regel etwa so antworten:<br />
„Ich habe das bislang immer so gemacht.“<br />
Oder: „Das war reine Erfahrung und Intuition.“<br />
Oder: „Es hat ich bewährt.“ Oder: „Ich habe<br />
das von meinen Kollegen abgeguckt.“<br />
Was bedeutet das? Obwohl die Fachkraft aller<br />
Wahrscheinlichkeit nach sehr gute Arbeit leistet,<br />
kann sie nicht wirklich erklären, warum<br />
genau sie ihre professionellen Aktionen durchgeführt<br />
hat. Die Neue Sachlichkeit und ihr<br />
Managerialismus akzeptiert das jedoch nicht<br />
länger. Managerialismus will die Beschäftigten<br />
dazu zwingen, exakte Aussagen darüber<br />
zu treffen, was in welcher Zeit mit welchen<br />
Mitteln zur Erreichung eines vorher definierten<br />
Ergebnisses getan worden ist. Und wie kann<br />
das in die Tat umgesetzt werden? Indem das<br />
soziale Handeln der Beschäftigten trivialisiert<br />
wird.<br />
Ich gebrauche das Wort „trivialisieren“ nicht<br />
in einem beleidigenden Sinne, nicht im Sinne<br />
von: „das ist aber platt und abgedroschen“,<br />
sondern so, wie es in der soziologischen Systemtheorie<br />
benutzt wird: als die Grundlage<br />
von Entscheidbarkeit. Ich will das mit einem<br />
Beispiel verdeutlichen: Ein Auto ist eine triviale<br />
Maschine. Wir drehen den Schlüssel (Input)<br />
und die Maschine beginnt zu laufen (Output).<br />
Eine bestimmte Handlung ruft eine bestimmte<br />
Reaktion erwartbar hervor. Trivialität ist daher<br />
Verlässlichkeit und Determination. Was aber<br />
ist, wenn Sie aus der Garage herausfahren,<br />
und schon fällt Ihnen das erste Rad ab? Dann<br />
funktioniert Input-Output nicht mehr. Um das<br />
wiederherzustellen, bringen Sie das Auto in<br />
die Werkstatt, und der Automechaniker, oder<br />
besser: der Trivialisateur, macht das Auto wieder<br />
trivial, also erwartbar.<br />
Managerialismus ist der Versuch, die Komplexität<br />
des sozialen Handelns zu trivialisieren,<br />
also verlässlich zu machen. Damit jedoch wird<br />
der Dialog aus dem Sozialen Handeln beseitigt.<br />
Im Managerialismus bestehen sehr gute Gründe,<br />
diesen Dialog zu entfernen. Denn ein Dialog<br />
bedeutet, dass wir niemals sicher sein können,<br />
was bei ihm herauskommen wird. Und eine<br />
derartige Unsicherheit (Kontingenz) ist tödlich<br />
für den Managerialismus.<br />
Gute Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen<br />
wissen um die Unsicherheit und um die Grenzenlosigkeit<br />
des Dialogs. Sie bringen aber<br />
immer wieder den Mut auf, diesen Dialog zu<br />
führen. Sie wollen nicht einfach den Schlüssel<br />
umdrehen, wie es der Managerialismus,<br />
die Neue Sachlichkeit, von ihnen verlangt. In<br />
dem Regime der Neuen Sachlichkeit jedoch ist<br />
gerade derjenige ein guter Mitarbeiter, der zur<br />
rechten Zeit den rechten Schlüssel umdreht.<br />
So besteht der Zynismus des aktivierenden<br />
Staates in sozialpolitischer Hinsicht darin,<br />
„die Freiheit der Freien zu vergrößern, die Aktiven,<br />
die am wenigsten der Hilfe bedürfen, zu<br />
unterstützen, und die, die Hilfe bräuchten, zu<br />
marginalisieren“ (Ziegler 2001,36). Dieses politische<br />
Praxis ergänzt die punitive Pädagogik<br />
im Rahmen der geschlossenen Unterbringung<br />
dadurch, dass sie nicht mehr eine nachträgliche<br />
moralische Verurteilung und auch nicht die<br />
(re-)integrative, bessernde Einwirkung auf das<br />
Individuum anstrebt, sondern auf die Beantwortung<br />
der Frage gerichtet ist, wie Sicherheit<br />
durch eine „gerechtfertigte“ Einsperrung wie<br />
die geschlossene Unterbringung zuverlässig<br />
hergestellt werden kann. „Erzeugt Jugendhilfe<br />
Sicherheit? Ja oder nein?“ Das ist die triviale,<br />
aber vermeintlich entscheidbare Frage. Kennzeichnend<br />
dafür ist ein politischer Verzicht auf<br />
Empathie und Solidarität gegenüber den Minderjährigen,<br />
ein Verzicht auf Fragen nach ihren<br />
inneren Beweggründen. Das ist mit der Ethik<br />
der Interessenlosigkeit gemeint.<br />
Ich möchte mit einer kritischen Anmerkung in<br />
die Richtung der Sozialen Arbeit schließen, die<br />
sich gegenüber dieser punitiven Pädagogik ablehnend<br />
verhält. Diese Soziale Arbeit darf nicht<br />
in den hier beschriebenen Fehler der punitiven<br />
Pädagogik verfallen und ebenfalls so tun, als<br />
36 . Nr.63 . SIT<br />
SIT . Nr.63 . 37<br />
Literatur<br />
Bittscheidt-Peters, D. & Koch, U. (1982). Men-<br />
schen statt Mauern. Ein Konzept auf dem Prüf-<br />
stand. Staatliche Pressestelle Hamburg, Nr.<br />
685 (7. Oktober): Behörde für Arbeit, Jugend<br />
und Soziales/ Amt für Jugend.<br />
Ehlers, J. (2002). Diskussionsvorschlag zum<br />
Eckpunktepapier des Arbeitskreises Jugend<br />
der SPD-Bürgerschaftsfraktion für eine Reform<br />
der Hamburger Jugendhilfe. Hamburg: Manu-<br />
skript.<br />
Evers, A. & Leggewie, C. (1999). Der ermun-<br />
ternde Staat. Vom aktiven Staat zur aktivieren-<br />
den Politik. Gewerkschaftliche Monatshefte,<br />
S. 331-340.<br />
Freie und Hansestadt Hamburg. (2002). Senats-<br />
drucksache Nr. 2002/ 1002: Geschlossene Un-<br />
terbringung für Minderjährige bei Kindeswohl-<br />
gefährdung durch die Begehung von Straftaten<br />
in wiederholten oder gravierenden einzelnen<br />
Fällen und Maßnahmen der Jugendhilfe zur<br />
Stärkung der Erziehungsverantwortung der<br />
Eltern. Hamburg.<br />
Gruppe Blauer Montag. (2003). Arbeitskraftun-<br />
ternehmer, Ich-AG und „aktivierender Sozial-<br />
staat“. Hamburg: Manuskript.<br />
ob sie Kriminalität verhindern könnte, wenn sie historische nur genügend Ressourcen hätte. Es ist für sie<br />
zwar höchst bedauerlich, dass politische Ent-<br />
scheidungen zunehmend polizeiliche und ord-<br />
nungspolitische Maßnahmen zu ihrem Nachteil<br />
stützen. Sie kann sich gegen die damit verbun-<br />
denen Zumutungen aber nur wehren, wenn sie<br />
deutlich macht, dass sie stets der ernsthafte<br />
Versuch ist, die Probleme der Jugendlichen<br />
mit der Gesellschaft und die Schwierigkeiten<br />
der Gesellschaft mit den Jugendlichen zwar<br />
zu bearbeiten, aber wohl kaum zu lösen. Zu<br />
ihrer Ernsthaftigkeit gehört es auch, dass sie<br />
sich offen zu ihren begrenzten Möglichkeiten<br />
bekennt. Sie sollte keine unhaltbaren Verspre-<br />
chungen machen, wie sie von politischer Seite,<br />
aber zum Teil auch von interessieren Pädago-<br />
gen – oder besser: Managerialisten - im Zusam-<br />
menhang mit der absehbaren Renaissance der<br />
Straf-Heime in den Raum gestellt werden.<br />
und aktuelle 6historische diskurse<br />
,<br />
historische
diskurseHalfar, B. diskurseIn Otto, historische chehistorische und aktuelle diskurse<br />
Halfar, B. (2001). Finanzierung Sozialer Arbeit.<br />
In Otto, H.-U. & Thiersch, H. (Hg.), op.cit (S.<br />
540-547).<br />
Kunstreich, T. (2001). Grundkurs Soziale Arbeit.<br />
Sieben Blicke auf Geschichte und Gegenwart<br />
Sozialer Arbeit (Bd. 1 und 2). Bielefeld: Kleine<br />
Verlag.<br />
Kunstreich, T. & Lindenberg, M. (2002). Die Tan-<br />
talus-Situation. Soziale Arbeit mit Ausgegrenz-<br />
ten. In W. Thole (Hg.), Grundriss Soziale Arbeit.<br />
Ein einführendes Handbuch (S. 349-366). Opla-<br />
den: Leske und Budrich.<br />
Landesjugendamt Saarland. (2001). Bundesum-<br />
frage Juni 2000: Einrichtungen der Jugendhilfe,<br />
die geschlossene Unterbringung durchführen.<br />
Saarbrücken: Manuskript.<br />
Lindenberg, M. (2002). Geschlossene Unter-<br />
bringung und geknechtete Pädagogik. Ein<br />
Kommentar zur Wiedereinführung der ge-<br />
schlossenen Unterbringung in Hamburg. Wi-<br />
dersprüche, 86, S. 117-121.<br />
Lindenberg, M. (Hg.). (2000). Von der Sorge zur<br />
Härte. Kritische Beiträge zur Ökonomisierung<br />
Sozialer Arbeit. Bielefeld: Kleine Verlag.<br />
Otto, H. U. & Thiersch, H. (2001) (2., völlig neu<br />
überarbeitete Auflage). Handbuch Sozialarbeit<br />
Sozialpädagogik. Neuwied & Kriftel: Luchter-<br />
hand.<br />
Schaarschuch, A. (2000). Kunden, Kontrakte,<br />
Karrieren. Die Kommerzialisierung der Sozialen<br />
Arbeit und die Konsequenzen für die Professi-<br />
on. In M. Lindenberg (Hg.), op.cit (S. 153-163).<br />
Schnieber-Jastram. (2002). Zukunft der sozia-<br />
len Arbeit in Hamburg. Hamburg: Manuskript.<br />
Ziegler, H. (2001). Prävention - Vom Formen des<br />
Guten zum Lenken des Freien. In: Widersprü-<br />
, 79, S. 7-24.<br />
1 Der aktivierende Staat wird im Leitbild der<br />
Bundesregierung folgendermaßen definiert<br />
„Der aktivierende Staat bedeutet eine neue<br />
Verantwortungsteilung zwischen Bürger und<br />
Staat. Eigeninitiative und Freiraum werden<br />
stärker gefördert. Natürlich bleibt der Staat<br />
weiter verpflichtet, für individuelle Freiheit und<br />
Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu sorgen.<br />
Das gilt zum Beispiel für Innere Sicherheit,<br />
Rechtsschutz und die Finanzverwaltung. Aber<br />
in vielen anderen Bereichen müssen öffentliche<br />
Aufgaben nicht unbedingt direkt von staatlichen<br />
Organen wahrgenommen werden, zum<br />
Beispiel in Dienstleistungsbereichen wie Post,<br />
Kommunikation und Verkehr. Hier kann sich der<br />
Staat darauf beschränken, den Rahmen festzulegen.<br />
Bei Konflikten tritt er als Moderator auf,<br />
mit dem Ziel, mehr Freiraum für gesellschaftliches<br />
Engagement zu schaffen. So aktiviert<br />
der Staat gesellschaftliche Verantwortung.“<br />
(www.staat-modern.de/programm)<br />
Dr. Michael Lindenberg<br />
Ev. Fachhochschule des Rauhen Hauses<br />
Horner Weg 170<br />
D-22111 Hamburg<br />
e-mail: mlindenberg@rauheshaus.de<br />
Helga Cremer-Schäfer<br />
Die „gefährliche und gefährdete Jugend“. Über öffentliche Debatten und was<br />
wir zu beachten haben, wenn sie gerade nicht stattfinden.<br />
Hochkonjunkturen und das Versickern aufgeregter<br />
Debatten der Öffentlichkeit über gerade<br />
herrschende gesellschaftliche Zustände gehören<br />
zu unseren vertrauten Erfahrungen. Die<br />
Klage oder die Entrüstung über den Zustand<br />
„der Jugend“ zeigt sich als ein Vorgang, in<br />
dem bestimmt wird, wer unter welchen Bedingungen<br />
an Gesellschaft (den gesellschaftlich<br />
erzeugten Ressourcen) partizipieren soll und<br />
für wen dabei wer welche Grenzen setzen<br />
kann. Die bisher letzte Konjunktur der Debatte<br />
über eine „gewaltbereite Jugend“ und die Entrüstung<br />
darüber, dass „Die Täter immer mehr.<br />
Immer jünger. Immer brutaler“ werden, nahm<br />
schon fast den Charakter einer „langen Welle“<br />
an, als sie 1999 doch recht abrupt ein (wahrscheinlich<br />
vorläufiges) Ende fand. Die Nicht-<br />
Thematisierung einer „gefährlichen Jugend“<br />
bedeutet nicht zu jeder Zeit einen Fortschritt<br />
an Aufgeklärtheit der Akteure, die sie üblicherweise<br />
betreiben und der Akteure, denen Kampagnen<br />
gerade recht kommen. Es kann schlicht<br />
sein, dass Jugend als Projektionsfläche für Ordnungsphantasien<br />
gerade nicht gebraucht wird.<br />
Für die Darstellung von herrschender Moral,<br />
von Grenzen der Freiheit und der Zugehörigkeit<br />
können auch andere „Krisen“ auf die Agenda<br />
gesetzt werden. Die öffentliche Propagierung,<br />
dass wir alle nur als hochflexible „Arbeitskraftunternehmer“<br />
gebraucht werden, dass wir uns<br />
nicht zu beklagen brauchen, wenn wir uns den<br />
Markt-Verhältnissen nicht anpassen und dann<br />
zu den „Verlierern“ und „Überflüssigen“ zählen<br />
und im Übrigen die Lohnarbeits- und Lebensrisiken<br />
„selbstverantwortlich“ zu bewältigen<br />
haben, genügt als Begründung dessen, was an<br />
Veränderungen des „impliziten Gesellschaftsvertrages“<br />
machtvoll durchgesetzt wurde und<br />
wird.<br />
Der Vortrag bezieht sich insofern auf ein – ausnahmsweise<br />
– nicht „aktuelles Thema“. Die<br />
vergangene Hochkonjunktur der Aufregung<br />
über eine „gefährliche Jugend“ hat im Vergleich<br />
zu früheren Debatten nicht nur viele<br />
Jahre angehalten, es wurden in deren Verlauf<br />
auch neue „Typen“ von Abweichlern und Etiketten<br />
entwickelt, die weit über die professio-<br />
nelle Ideologie der benevolenten Degradierung<br />
von „gefährlichen, doch sozial schwachen<br />
Gesellschaftsmitgliedern“ und der bekannten<br />
Strategie des „Pessimismus als pädagogische<br />
Triebkraft“ hinaus in die Richtung einer neu-<br />
en „Punitivität“ gingen. Damit nicht alle mit<br />
„neu“ erscheinenden Etiketten naiv in eine<br />
nächste Kampagne driften und um über die<br />
etablierte „Kultur der Punitivität“ aufzuklären,<br />
werde ich Debatten über die „gefährliche, weil<br />
gefährdete Jugend“ rekonstruieren.<br />
Exkurs über Punitivität:<br />
Mit Punitivität meine ich nicht einen neuerli-<br />
chen Trend zur „Kontrolle“ von Jugend bzw. zur<br />
Selbstkontrolle sozialer Akteure. Es geht viel-<br />
mehr um eine Politik, die Personen und Gruppen<br />
in Privilegierte und Diskriminierte aufspaltet,<br />
und die den letzteren Ressourcen verweigert,<br />
die unverzichtbar sind, um sich innerhalb ei-<br />
ner herrschenden Arbeits- und Lebensweise zu<br />
reproduzieren. Das Herstellen einer diskrimi-<br />
nierenden Ordnung wird darüber hinaus syste-<br />
matisch mit der Herrschaftstechnik der Strafe<br />
und mit Prozessen sozialer Ausschließung<br />
verbunden. Die Politik der Punitivität bedeu-<br />
tet mehr als Reglementierung, als Repression<br />
oder Kontrolle; vielmehr ist es die Übertragung<br />
der Logik von staatlicher, moralisch legitimier-<br />
ter Bestrafung und amoralisch durchgesetzer<br />
sozialer Ausschließung auf Vorgänge der Her-<br />
stellung von Ordnung und der Strukturierung<br />
von Gesellschaft. Die nach wie vor gültigen<br />
disziplinierenden Formen der Herstellung von<br />
Ordnung und von Vorgängen der „Sekundärin-<br />
tegration“, die durch Hilfe und Kontrolle ge-<br />
schieht, erhalten eine andere Bedeutung, weil<br />
nicht mehr alle als disziplinierte bzw. pazifizier-<br />
te Subjekte gebraucht werden. In einer „Kultur<br />
der Punitivität“ werden Disziplinierungs- und<br />
Kontrollprozesse nicht überflüssig, aber stärker<br />
mit Hierarchisierungen, mit Grenzziehungen<br />
und Selektionen verbunden. Wer „ohne Erfolg“<br />
bleibt, wer gar trotz Kontrolle „versagt“, dem<br />
werden Ressourcen entzogen. Gleichzeitig wird<br />
unterstellt, dass jeder, der will, sich auch aus<br />
Existenzschwierigkeiten herausarbeiten kann.<br />
Das Prinzip der Strafenpolitik in den USA wur-<br />
38 . Nr.63 . SIT<br />
SIT . Nr.63 . 39<br />
historische und aktuelle diskurse
de mit der Metapher „Three strikes and you are<br />
out!“ charakterisiert. Im veränderten Kontext<br />
mutiert die „Spielregel“ der Sport-Veranstal-<br />
tung in eine soziale Drohung mit „Chancen“,<br />
die einem vorgegeben werden. Bei dreifachem<br />
Misserfolg kann sich keiner beklagen, er oder sie<br />
sind selbst an ihrem Schicksal schuld, weil sie<br />
(per Definition) eine „selbstverantwortliche Per-<br />
son“ sind. Das ist eine herrschaftlich gewendete<br />
Variante der bürgerlichen, kontrafaktischen<br />
Annahme der „Autonomie des Individuums“.<br />
Die Vermutung ist nicht unbegründet, dass in<br />
der (eventuell kurzen) Phase der Baisse der<br />
Entrüstung über die „gefährliche Jugend“<br />
eine weitere Möglichkeit versäumt wird, über<br />
„Kampagnenpolitik“ nachzudenken. Das Nach-<br />
denken braucht überhaupt nicht innovativ zu<br />
sein. Es steht inzwischen ein ziemlich fundier-<br />
tes Wissen über den Diskurs „gefährliche Ju-<br />
gend, gefährdete Jugend“ zur Verfügung. Die<br />
Geschichte von Wohlfahrtsstaaten (und insbe-<br />
sondere die des bundesdeutschen) könnte man<br />
auf eine interessante Weise als eine Geschich-<br />
te von öffentlichen Kampagnen schreiben, die<br />
eine „gefährliche, weil gefährdete Jugend“<br />
als eine gesellschaftliche Tatsache etablieren.<br />
Dass bei aller Rede von der Produktivkraft „Wis-<br />
sen“ das Wissen über solche Kampagnen er-<br />
folgreich für irrelevant erklärt wird, hängt nicht<br />
zuletzt damit zusammen, dass insbesondere<br />
helfende Professionen und erklärende Wissen-<br />
schaften sich damit ein Stück über ihre eigene<br />
Beteiligung an Kampagnenpolitik aufklären<br />
würden. Ebenso würde die Verankerung von<br />
Kampagnenpolitik im „strukturellen Populis-<br />
mus“ parlamentarischer Demokratien deutlich<br />
und könnte nicht mehr umstandslos nur dem<br />
Volksressentiment zugeschrieben werden. Zu-<br />
dem würde offengelegt, dass jeder „Ordnung“<br />
immer auch „überflüssige Herrschaft“ imma-<br />
nent ist und jede Ordnung deshalb, aufgrund<br />
innerer Widersprüche, eine ihr eigene „Dialek-<br />
tik“ impliziert. Jede Ordnung beruht auf Grenz-<br />
ziehung und schließt mit der Definition der<br />
Mitglieder „Nicht-Mitglieder“ aus ohne dass<br />
die „verhandelt“ würde. Das „Re-Odering“<br />
erzeugt Ausschließung von Personen, die es zu<br />
verdienen scheinen, dass ihnen der Status des<br />
„vollen“ Mitgliedes symbolisch und faktisch<br />
(wieder) aberkannt werden muss oder, wie bei<br />
Nachkömmlingen oder „Ankömmlingen“, noch<br />
nicht zuerkannt werden kann. Nach einem Akt<br />
diskursede mit historische und aktuelle diskurse<br />
von „Selbstaufklärung“ kann man nur unter<br />
erschwerten Bedingungen weitermachen wie<br />
bisher. Denn ein bisschen reflexiv sein, das<br />
geht nicht. – Vielleicht haben wir auch deshalb<br />
keine Geschichte der Entrüstungen über „die<br />
Jugend heute“.<br />
Disziplinierung und ein selbstreflexiver Umgang<br />
damit. Ein kurzes Wort zum Verhältnis<br />
von Disziplinierung und Befreiungen davon<br />
Wer heute gute 50 bis 60 Jahre alt ist, zählt zu<br />
einer Generation mit einer historisch spezifischen<br />
Erfahrung, was den Zusammenhang von<br />
Herrschaft und Fortschritt anbelangt: Das war<br />
zunächst die Erfahrung der Verallgemeinerung<br />
einer „disziplinierten“ Lebens- und Arbeitsweise<br />
und deren Intensivierung als eine Bedingung<br />
von Partizipation an Bildungs-, Arbeits-,<br />
Konsum- und von Befreiungsmöglichkeiten. Ich<br />
will keine Vergangenheitsverklärung betreiben,<br />
aber man kann nicht zuletzt am „Jugendprotest“<br />
der 60er und 70er Jahre ablesen, dass<br />
und in welchen Grenzen in der „fordistischen“<br />
Phase der Entwicklung des Kapitalismus,<br />
im Kontext von „Konsum- und Freizeitgesellschaft“<br />
bzw. sich „modernisierender“ staatlicher<br />
Apparate, verschiedene Lebensentwürfe<br />
lebbar wurden, zwar nicht nur die bürgerliche<br />
und proletarische „Rechtschaffenheit“ eines<br />
„autoritären Charakters“. Die Verallgemeinerung<br />
und Durchsetzung von Disziplin bedeutete<br />
daher, bei allem notwendigen realistischen<br />
Pessimismus, nicht nur ein umfassendes institutionelles<br />
Kerker- und Kontrollnetz, sondern<br />
war ein Prozess mit Widersprüchen und Grenzen,<br />
nicht nur auf der ökonomischen, sondern<br />
auch auf der Seite der Herrschaftstechnologie<br />
„Disziplin“. Eine „klug beherrschte Disziplin“<br />
kann an manchen Orten noch entwickelt und<br />
zur Grundlage von Selbstaufklärung über<br />
verschiedene Formen von Zurichtungen und<br />
verdinglichendes Denken werden. Vielleicht<br />
sollte ich viel vorsichtiger formulieren. Teil und<br />
„Lohn“ für die Selbstdisziplinierung einer sich<br />
ziemlich ausweitenden „(aus)gebildeten Klasse“<br />
war eine Beteiligung an der Ausübung von<br />
Herrschaft in der Form von erziehenden, bildenden,<br />
rehabilitierenden Investitionen in die<br />
(künftige) Arbeitskraft, von herrschaftlich gewährter<br />
Hilfe, sanfter Kontrolle, erzieherischen<br />
Strafen etc. Nicht zuletzt der widersprüchliche<br />
Charakter dieser Herrschaftstechniken einer<br />
auf Selbstdisziplin zielenden Fremddisziplinierung<br />
und die ziemliche Ausweitung des<br />
Herrschaftspersonals (Herrschaftsarbeit als<br />
Lohnarbeit) ermöglichte einen reflektierteren<br />
Umgang mit der eigenen Diszipliniertheit und<br />
der Herrschaftsform, an der man darüber vielfach<br />
beteiligt ist. Ich will wieder nicht übertreiben<br />
mit der Hoffnung auf Reflektiertheit des<br />
Erziehungs-, Helfer-, Wissenschafts-Personals,<br />
aber es gibt doch noch einige, die sich eine<br />
distanzierte Position erhalten konnten. In eine<br />
distanzierte Position kann man kommen, weil<br />
man z.B. politisch oder durch Konkurrenz an einer<br />
eigenen Karriere und Biographie-Disziplin<br />
gehindert wurde oder aktuell daran gehindert<br />
wird. Im anderen (erfreulicheren Fall) beruht<br />
die Distanz auf einem Privileg (z.B. dem einer<br />
„autonomen Wissenschaft“), die im Inneren<br />
eine (gewisse) Unabhängigkeit begründet.<br />
Distanz und Entfremdung sind hilfreiche<br />
Ressourcen für das Nach-Denken über gesellschaftliche<br />
Ereignisse und über die Deutungen<br />
und Begriffe, mit denen verschiedene Akteure<br />
solche Ereignisse beschreiben.<br />
Als eine kleine Vorarbeit und Reflexivitätsübung<br />
habe ich versucht, eine Geschichte der<br />
Kampagnen um Jugend als eine „Gefahr“<br />
(heute sagen wir ein „Sicherheitsrisiko“) zu<br />
skizzieren und die Hochkonjunkturen in Bezug<br />
zu meiner eigenen Arbeits-Biographie im Feld<br />
von Wissenschaft zu setzen. Ich will damit zunächst<br />
einmal den „Nutzen“ charakterisieren,<br />
den man als Kopfarbeiterin von einer „halbstarken“,<br />
„wohlstandsverwahrlosten“, „kriminellen“<br />
und „gewaltbereiten“ Jugend haben<br />
konnte. Sichtbar werden auch Formen von<br />
„Entfremdung“, die durch die jeweilige Reaktion<br />
auf eine „gefährdete Jugend“ veranlasst<br />
wurden.<br />
Zur Bezeichnung öffentlicher Debatten um eine<br />
„gefährdete und gefährliche Jugend“ werde<br />
ich den Begriff der „Moral-Panik“ übernehmen.<br />
Er wurde von dem Sozialwissenschaftler Stanley<br />
Cohen (1987/1972) vorgeschlagen, um eine<br />
der wichtigsten öffentlichen Kampagnen der<br />
„Skandalisierung“ von Jugend, einer gleichzeitigen<br />
Entrüstung über und der Sorge um die<br />
Nachwachsenden, zu analysieren: Es waren<br />
die Mods und die Rocker, Teile einer Jugend,<br />
die sich zu Beginn der 60er Jahre gerade anschickte,<br />
eine „Bewegung“ zu werden. In der<br />
Einleitung seiner Analyse der Jugenddebatte<br />
der 60er Jahre in England schildert Cohen ei-<br />
nen spezifischen Lauf von Ereignissen, ein Set<br />
ei-historische von sozialen Akteuren und ein spezifisches<br />
Arrangement:<br />
„Gesellschaften scheinen von Zeit zu Zeit<br />
Perioden einer Moral-Panik ausgesetzt. Ein<br />
Zustand, eine Episode, eine Person oder eine<br />
Gruppe taucht auf, um als Bedrohung gesell-<br />
schaftlicher Werte und Interessen definiert<br />
zu werden. Die Natur des Ereignisses wird<br />
von Medien geformt und stereotypisiert, die<br />
moralischen Barrikaden durch Redakteure, Bi-<br />
schöfe, Politiker und rechtschaffen denkende<br />
Bürger besetzt. Experten für das Soziale und<br />
das Abweichende geben ihre Diagnosen ab<br />
und machen ihre Lösungsvorschläge. Reak-<br />
tionen auf die Vorgänge werden entwickelt<br />
und angewendet; daraufhin verschwinden<br />
die Zustände, sie werden erstickt oder sie ver-<br />
schlimmern sich und werden noch sichtbarer.<br />
Manchmal sind die Objekte der Panik relativ<br />
neu, manchmal schon alte Bekannte, die neu<br />
aus- und beleuchtet werden. Manchmal geht<br />
die Panik vorüber und wird vergessen, ausge-<br />
nommen als Teil von Folklore und kollektivem<br />
Gedächtnis; zu anderen Zeiten gibt es ein<br />
ernsthafteres Nachspiel und sie kann Verände-<br />
rungen in der (Straf-)Rechts und Sozialpolitik<br />
auslösen oder sogar das Selbstverständnis von<br />
Gesellschaft verändern.“ (Cohen 1987: 9; mei-<br />
ne Übersetzung)<br />
„Moral panics“ bearbeiten das jeweilige Gene-<br />
rationenverhältnis einer Gesellschaft. Was sich<br />
daran verändert hat oder verändern soll, wird<br />
dargestellt, indem öffentlich über ausgesuchte<br />
„folk devils“ diskutiert wird. Als Politik-Typus<br />
gehören Moral-Paniken zu den „symbolic po-<br />
litics“. Damit bezeichnete der Politikwissen-<br />
schaftler Murray Edelman (auch bereits in den<br />
70er Jahren) Strategien der „Politik-Darstellun-<br />
gen“. Es wird keine Problem-Politik gemacht,<br />
es werden „Werte“ beschworen (und damit<br />
mindesten hochgehalten), es wird die starke<br />
„Hand des Staates“ verbal demonstriert (und<br />
ein entsprechendes Handeln legitimiert). Mo-<br />
ral- und Politik-Darstellungen haben eine ge-<br />
wisse Neutralität gegenüber den jeweiligen<br />
Inhalten. Wert- und Moraldarstellungen kön-<br />
nen sich auf Pflicht-Moralen und Nutzen für<br />
Ordnungen beziehen oder auf Befreiungen der<br />
Individuen von Zumutungen. Der Staat (oder<br />
andere institutionelle Akteure bzw. soziale Be-<br />
40 . Nr.63 . SIT<br />
SIT . Nr.63 . 41<br />
historische und aktuelle diskurse
wegungen) kann sich als ein „autoritärer oder<br />
demokratischer Staat“ (Franz Neumann) dar-<br />
stellen. Bei Moral-Paniken haben wir also sorg-<br />
fältig zu fragen, wann geht das einigermaßen<br />
ohne Folgen für die Situation von Jugendlichen<br />
ab, wann werden schwierigen Situationen (ins-<br />
besondere solche sozialer Ausschließung, aber<br />
auch solche der Intensivierung einer „integrie-<br />
renden“ Disziplinierung) durch Verweigerung<br />
intellektuellen Verstehens noch schwieriger<br />
für junge Leute? Können wir uns darauf ver-<br />
lassen, dass die Chancen für Entdramatisie-<br />
rung und Dramatisierung gleichverteilt sind?<br />
Ungefähr jedenfalls? Wie kommen wir auf den<br />
Gedanken, dass Drohung mit einer undiszipli-<br />
nierten, einer brutalisierten, einer normlosen<br />
Jugend als eine Werbung gelesen wird, dieser<br />
Jugend neue Freiheiten zu ermöglichen, Bil-<br />
dungsmöglichkeiten zu eröffnen, für ihr Dasein<br />
zu sorgen – oder doch wenigstens in sie zu<br />
„investieren“? Was garantiert, dass es keine<br />
law-and-order-Kampagne, dass es keine Aus-<br />
schluß-Propaganda für Teile der Jugend wird,<br />
die Feindbilder erzeugt oder mit vorhandenen<br />
Feindbildern arbeitet. Wann eskaliert die nicht<br />
mehr „symbolische“ Reaktion in Richtung „Pu-<br />
nitivität“?<br />
Mit einer gewissen Verzweiflung und Re-<br />
spektlosigkeit hat in den 80er Jahren Katha-<br />
rina Rutschky auf eine „in der Pädagogik seit<br />
altersher angewandte und grundlegende<br />
Technik“ hingewiesen, eine Technik, „mit<br />
Greuelmeldungen über den Zustand der Welt,<br />
der Jugend und der Kinder einen Handlungs-<br />
bedarf zu erzeugen, den sie (die Pädagogik)<br />
dann –die anderen sind ja vor Schrecken wie<br />
gelähmt- gern befriedigt.“ (Rutschky 1987:85)<br />
Die Lösung liegt in „Erziehung“, was immer<br />
historisch und praktisch in einer jeweiligen<br />
Herrschaftsordnung damit gemeint war. Diese<br />
Technik nennt Rutschky „Pessimismus als eine<br />
pädagogische Triebkraft“. Ich weiß nicht ge-<br />
nau, ob es für die Pädagogik eine gewisse Eh-<br />
renrettung darstellt, dass andere Professionen<br />
und wissenschaftliche Disziplinen bzw. soziale<br />
Bewegungen diese Technik ebenfalls ange-<br />
wendet haben und sogar der Wohlfahrtsstaat<br />
durch „Pessimismus als sozial-reformerische<br />
Triebkraft“ abgesichert wurde. Wie auch im-<br />
mer, zumindest gibt es im Feld von Erziehung<br />
und Fürsorge eine ziemlich lange Übung in die-<br />
ser Technik, man braucht nur an die Geschich-<br />
diskursewegungen) historische und aktuelle diskurse<br />
te der Verwahrlosungsdiagnosen zu denken.<br />
„Erfahrungen“ mit den Folgen dieser Technik<br />
wurden allerdings kaum tradiert (abgesehen<br />
von der einen oder anderen „Flaschenpost“).<br />
Das Wissen um die Dynamik des Pessimismus<br />
als pädagogische/reformerische Triebkraft<br />
blieb ziemlich erfolgreich neutralisiert: immer<br />
wieder schnell vergessen. „Dynamik“ klingt<br />
ziemlich neutral dafür, wie sich der Pessimismus<br />
als pädagogische oder sozialreformerische<br />
Triebkraft entwickeln und benutzen ließ. Die<br />
Transformation des Verwahrlosungskonzeptes<br />
von der Befürchtung, dass Menschen ohne<br />
Bewahrung weder „tüchtig“ noch „moralisch“<br />
werden können, zur Diagnose von „Verwahrlosung“<br />
als einer Eigenschaft der Person, zur<br />
Definition von „Asozialität“ als „Artung“ von<br />
„Rechtsbrechern“ und schließlich ein sichtbares<br />
Zeichen der „Gemeinschaftsfremden“ zeigt<br />
die Ausschlußdynamik dieses Pessimismus<br />
eigentlich sehr deutlich. Auch wenn das 10.<br />
Schuljahr, obwohl mit Dekadenztheorien begründet,<br />
eingeführt wurde, und die „Gewalt an<br />
der Schule“ mehr Jugendarbeit ins Gespräch<br />
gebracht hat, auch wenn „kriminelle Straßenkinder“<br />
Streetworker mobilisieren konnten und<br />
„Jugendgangs“ durch Mitternachtssport präventiv<br />
begegnet wurde – Moral-Paniken bleiben<br />
gefährlich. Auch in modernisierter Sprache<br />
und bei einem wohlfahrtsstaatlichen Kontext<br />
bleibt die Ausschlusstendenz erhalten, weil<br />
Moral-Paniken über Degenerations-Theorien,<br />
über Theorien einer gesellschaftlich erzeugte<br />
„Unzivilisiertheit“ betrieben werden. Das unterscheidet<br />
die „moralische Entrüstung“ über<br />
Abweichler der „Moral-Unternehmer“ (Becker<br />
1973) von der „moralischen Empörung über<br />
Ungerechtigkeit“, die von (manchen) sozialen<br />
Bewegungen artikuliert wird.<br />
Bei der Kontinuität von Moral-Paniken lernt<br />
man einerseits Lachen, wie Rutschky zurecht<br />
betont. Man lernt aber auch, wie einfach Tatsachen<br />
(„Wellen von Gewalt“) hergestellt werden,<br />
was alles geglaubt und welches Wissen<br />
(oder besser Unsinn) verbreitet wird, wenn der<br />
„Quelle“ nur Autorität zugeschrieben wird. Es<br />
gibt einen Grund, sich immer wieder ernsthaft<br />
mit dem degradierend-moralisierenden Reden<br />
über Jugend zu befassen: Moral-Paniken sind<br />
gesellschaftliche Ereignisse, in denen Ideologien<br />
erzeugt und verbreitet werden. Das Wissen<br />
um diese „Ideologieproduktion mit Menschenopfern“<br />
(Heinz Steinert) ist eine notwendige<br />
(wenn auch nicht hinreichende) Ressource für<br />
Gegenstrategien. Ich will versuchen, dieses<br />
Wissen zur Sprache zu bringen, indem ich eine<br />
ganz kurze Geschichte der Debatten über „die<br />
gefährliche und gefährdete Jugend“ rekonstruiere<br />
und die jeweiligen gesellschaftlichen<br />
Funktionen bzw. den sozioökonomischen bzw.<br />
politischen Kontext benenne.<br />
Eine ganz kurze Geschichte der Debatten<br />
über eine „gefährliche und gefährdete Jugend“<br />
In dem Alter, in dem ich wie andere Mädchen<br />
auch als ein „Teenager“ bezeichnet wurde (und<br />
mich selbst auch so bezeichnet habe), war gerade<br />
die Aufregung über die „halbstarke Jugend“<br />
am Abklingen. Die Entrüstung über die<br />
„Halbstarken“ in der zweiten Hälfte der 50er<br />
Jahre, bezog sich auf ihre „Ausschreitungen“<br />
in den städtischen Vergnügungsvierteln, auf<br />
„Großkrawalle“ als Begleitveranstaltung von<br />
Rockkonzerten, auf ihre Nutzung der Waren der<br />
Kultur- und Konsumgüterindustrie (gemeint<br />
war das ziellose Umherfahren mit Mopeds in<br />
einer „Horde“). Jugendliche, die die Ordnung<br />
störten, wurden auch von wohlwollenden<br />
Pädagogen in einem Vokabular beschrieben,<br />
das dem sozialrassistischen über den „Pöbel“<br />
wahlverwandt war und „den Arbeiter“ bzw.<br />
„den Jugendlichen“ als die „unzivilisierten<br />
Wilden“ typisierte. Und gegen eine „unzivilisierte“,<br />
„wilde“ Jugend waren allemal anständige<br />
Autoritätsverhältnisse zu restaurieren. Die<br />
Kosten dieses Redens über „Bedrohte Jugend<br />
– drohende Jugend“ hatten vor allem Jugendliche<br />
der „Unterschicht“ zu tragen. Die (bis heute)<br />
normale, klassenspezifische Kriminalisierung<br />
entwickelte sich in jener Phase zu einer<br />
„Kriminalisierungswelle“. Es gab keine Phase<br />
in der Bundesrepublik, in der mehr junge Leute<br />
in Gefängnisse und geschlossene Anstalten<br />
eingewiesen wurden als in der zweiten Hälfte<br />
der 70er. Sowohl die Moral-Panik wie die Kriminalisierungswelle<br />
können wir aus heutiger<br />
Distanz als ein „kulturelles Abwehrbündnis“<br />
beschreiben, gegen das die Arbeiterjugendlichen<br />
auch eine „Gegenmacht“ mobilisieren<br />
konnten, dass die „Welle“ nach einigen Jahren<br />
gebrochen wurde. Der Kulturwissenschaftler<br />
Kaspar Maase (1991) beschrieb die „vergebliche<br />
Kriminalisierung der Halbstarken“ als<br />
42 . Nr.63 . SIT<br />
SIT . Nr.63 . 43<br />
einen Restaurationsversuch, der sich im „for-<br />
distischen“, auf Massenkonsum und Lohn-<br />
„for-historische arbeit beruhenden Kapitalismus nicht lange<br />
halten konnte. Er schrieb: „Bedrohte Jugend“<br />
– drohende Jugend“ hieß eine zeitgenössische<br />
Broschürenreihe. Bedrohlich schienen in ers-<br />
ter Linie vulgärer Materialismus und fehlende<br />
Moral der Arbeiterjugendlichen; in dem Maß,<br />
in dem sie über die Generationenschiene die<br />
Kinder der höheren Schichten ansprachen,<br />
wurde Jugend überhaupt zur Gefahr für die<br />
überkommenen Ordnungen. Das kulturelle<br />
Abwehrbündnis konnte die Masse der Arbei-<br />
ter-Eltern hege-monial einbeziehen – aber die<br />
Jugendlichen hatten die Kultur- und die Frei-<br />
zeitindustrie an ihrer Seite. (...) Züge popularen<br />
Geschmacks, „gewöhnlichen“ Verhaltens und<br />
„ungehemmter Genusssucht“ nahmen ihren<br />
Weg in den Alltag der Bundesbürgerinnen“<br />
(Maase 1991: 199f). Auch aufgrund dieses<br />
„Bündnisses“ konnte der latente Konflikt um<br />
die „repressive“, „vormoderne“ Kriminalisie-<br />
rungs- und Strafen-politik gegenüber der Ju-<br />
gend bessere gesellschaftliche Bedingungen<br />
finden, in Richtung eines liberalisierten und<br />
doch erziehenden Strafrecht gelöst zu wer-<br />
den. Im Feld von Jugend, Erziehung und Strafe<br />
konnten sich staatliche Apparate und Professi-<br />
onen als „liberale“ darstellen. Wobei die Gren-<br />
zen von „modernisierenden“ Reformen stets<br />
sichtbar blieben. Einige unserer Beiträge zu<br />
einer „Geschichte der Kriminalisierungs- und<br />
Strafenpolitik“ der zweiten Hälfte des 20. Jahr-<br />
hunderts haben Heinz Steinert und ich in dem<br />
Buch „Straflust und Repression“ zusammenge-<br />
stellt. (Cremer-Schäfer/Steinert )<br />
Ab 1966, dem Jahr meines Studienbeginns,<br />
konnte ich das Verhältnis von „Protest der<br />
studentischen Jugend und Reaktion“ recht<br />
unmittelbar erfahren. An der Reaktion auf die<br />
rebellischen Studenten, die mehrheitlich eine<br />
andere Klassenzugehörigkeit als die „Halbstar-<br />
ken“ hatten (von der aber nur in der Kategorie<br />
der „Schicht“ gesprochen wurde), wird der<br />
Doppelcharakter der institutionellen Reaktion<br />
bereits wesentlich deutlicher. Für „Rädels-<br />
führer“ und solche, die allzu radikal blieben<br />
oder wurden, bedeutete dies ein „autoritäres<br />
Zurückschlagen“. Doch allen, die bereit und<br />
in der Lage waren, sich Integration durch<br />
„Leistung“ zu verdienen und sich ein wenig zu<br />
mäßigen, wurden mit der „Konsum- und Freihistorische<br />
und aktuelle diskurse
zeitgesellschaft“ (nach und durch den Protest)<br />
auch andere Möglichkeiten eröffnet als die der<br />
politisch bleiernen „Wirtschaftswunder“- Zeit.<br />
Vom Beginn der 70er Jahre bis zur politischen<br />
Wende zu Beginn der 80er Jahre konnte man<br />
eine dauerhafte Hochkonjunktur öffentlicher<br />
Debatten erleben: über Jugendkriminalität,<br />
das Rockerunwesen, das Rauschgiftproblem,<br />
den Terrorismus, die Rowdys, die Hausbeset-<br />
zer, die Startbahngegner, die Chaoten (alles<br />
sollte in Anführungszeichen gesagt werden).<br />
Für mich selbst war diese Phase das, was<br />
man in der Wissenschaft „Assistenten-Zeit“<br />
nannte. Und als angehende Wissenschaftlerin<br />
hatte ich die Gelegenheit über die „Wellen der<br />
Jugendkriminalität“, die „Randgruppen“ oder<br />
die „Rocker“ und die „Gewalttäter“ nachzu-<br />
denken.<br />
Um Fragen (weshalb steigt die Jugendkrimi-<br />
nalität? Ist Jugend „wohlstandsverwahrlost“,<br />
„normlos“ und daher eine „Gefahr“) nicht naiv,<br />
sondern reflexiv zu beantworten, wurde und<br />
ist (mir) die Etikettierungsperspektive sehr<br />
nützlich. Denn, wie das Stanley Cohen aus-<br />
gedrückt hat, „action“ (die Handlungsweisen<br />
von Jugendlichen) wird in dieser Perspektive<br />
stets in ein Verhältnis zu öffentlichen und insti-<br />
tutionellen Formen von „reaction“ gesetzt. Die<br />
Handlung erhält ihre Bedeutung aus der Reak-<br />
tion, die darauf erfolgt bzw. erfolgen soll. Was<br />
an der Jugend gefährlich, was „kriminell“ ist,<br />
ist keine Qualität der Handlung. „Jugendkri-<br />
minalität“ oder „Jugendgewalt“ sind Be- und<br />
Verurteilungen von Handlungen bzw. sozialen<br />
Gruppen. Und dass dies so und nicht anders<br />
thematisiert wird, sagt etwas über einen Konf-<br />
likt aus. Reaktion und Kategorisierung (Etiket-<br />
ten) geben einen Korridor vor, wie mit einem<br />
Konflikt umgegangen werden soll bzw. kann.<br />
An Kampagnen wird sichtbar, ob ein Konflikt<br />
pragmatisch mit Beteiligung von Jugend (oder<br />
anderer „Outsider“, wie es damals hieß) und<br />
durch Kompromissbildung reguliert werden<br />
kann oder ob machtvoll gegen (einen Teil der)<br />
Jugend entschieden wird, sei es auf einer<br />
symbolischen Ebene oder, folgenreicher, auf<br />
der Ebene des „Grenzen Setzens“. Das kann<br />
Disziplinierung und Kontrolle heißen oder in<br />
Richtung Ausschließung und Strafe gehen.<br />
Wenn man unter dieser Konflikt-Perspektive<br />
die „großen“ Kampagnen (wie die um die Ter-<br />
roristen, ihre Sympathisanten und geistigen<br />
diskursezeitgesellschaft“ historische und aktuelle diskurse<br />
Wegbereiter) und die Vielzahl der gleichzeitigen<br />
und anschließenden „kleineren“ Moral-Paniken<br />
rekonstruiert, lässt sich folgendes über<br />
„Deutungen, Kampagnen und Widersprüche“<br />
dieser Zeit festhalten: In den späten 60ern und<br />
vor allem den 70ern wurde im Reden (und auch<br />
auf der Ebene der Drogen- und Terrorismusgesetzgebung)<br />
reichlich kriminalisiert. Die Funktion<br />
der Kampagnen lag in der Produktion und<br />
Verbreitung von „Feindbildern“, die die Politik<br />
der inneren Sicherheit gegen Teile der sozialen<br />
Bewegungen begleitete und legitimierte. Am<br />
offensichtlichsten richteten sich Kampagnen<br />
gegen den linken Terrorismus und die Drogendealer,<br />
die aber beide ihre jüngeren Geschwister<br />
hatten. Den Topos „die Täter werden immer<br />
mehr, immer jünger und brutaler“ konnte man<br />
in den Medien bereits 1972 finden. (vgl. Cremer-Schäfer<br />
2000/1998)<br />
Trotz der Politik der inneren Sicherheit, die<br />
an die „Feindbildkampagnen“ gebunden war,<br />
muss man bei Jugendlichen auf der Ebene der<br />
institutionellen Reaktion dieser Phase auch<br />
eine andere Entwicklung festhalten. Im Reden<br />
wurde kriminalisiert, die institutionellen Reaktionen<br />
entpönalisierten und pädagogisierten<br />
sich dagegen. Die Kontrolle insgesamt wurde<br />
„sanfter“ und disziplinierender, sie formierte<br />
und integrierte. Dass der in den 50er und 60er<br />
Jahren auch mit polizeilichen Mitteln und strafrechtlicher<br />
Kontrolle ausgetragene Generationenkonflikt<br />
ein Stück von nachkommenden<br />
Generationen gewonnen wurde, zeigt nicht<br />
zuletzt die Veränderung der ausschließenden<br />
Formen der Jugendkontrolle (Jugendstrafe,<br />
Fürsorgeerziehung) in dieser recht langen<br />
Hochkonjunktur von Moral-Paniken. Der gedoppelte<br />
Umgang mit „gefährlichen Jugendlichen“,<br />
kriminalisierendes Reden einerseits, Rationalisierung<br />
der Reaktion in Richtung einer<br />
Disziplinierung durch Hilfe und Qualifizierung<br />
andererseits, demonstriert aber auch, dass die<br />
befreienden Initiativen (nicht nur, aber auch)<br />
der Jugend abgestoppt wurden.<br />
Ein Teil der Wissenschaft hat die Kampagnenpolitik<br />
der 70er und 80er Jahre gründlich<br />
wissenschaftlich analysiert. Die „Kritische Kriminologie“<br />
(die aber faktisch eine Sozialwissenschaft<br />
war und noch nicht der Strafrechtswissenschaft<br />
untergeordnet) der 70er und 80er<br />
Jahre bestand zu einem guten Teil darin, die<br />
soziale und politische Selektivität von Kriminalisierung<br />
und staatlichem Strafrecht empirisch<br />
zu belegen. Im Kontext von Herrschaftssoziologie,<br />
von Sozialtheorie und kritischer Gesellschaftstheorie<br />
wurde die Wahlverwandtschaft<br />
von Moral-Kampagnen, law-and-order-Kampagnen<br />
und Formen von Propaganda unübersehbar.<br />
Ich gestehe, dass ich doch überrascht war, wie<br />
schnell dieses wissenschaftliche Wissen in<br />
den 90er Jahren in der Institution Wissenschaft<br />
vergessen wurde, die sich gerade noch intensiv<br />
mit der „Politik der inneren Sicherheit“, mit den<br />
Funktionen von Kriminalisierung, von Feindbildern<br />
und von sich selbst erfüllenden Prophezeiungen<br />
(„Stigmatisierung“) beschäftigt<br />
hatten. Retrospektiv haben wir zur Kenntnis zu<br />
nehmen, dass Wissen als Kritik aktiv nicht zur<br />
Kenntnis genommen worden war, zumindest<br />
keine „Nachhaltigkeit“ zugebilligt bekam. Die<br />
Kampagnen der 90er Jahre über „Jugendgewalt“,<br />
„Ausländerkriminalität“, „Kinderkriminalität“,<br />
„Gewalt in der Schule“, „Straßenraub“,<br />
„Streetgangs“ wurden jedenfalls wesentlich<br />
stärker als zuvor unter Beteiligung von<br />
Fachleuten, Expertinnen und Wissenschaftlern<br />
geführt. Insbesondere hat sich „Kriminologie“<br />
in der neuen Form einer Wissenschaft vom<br />
„sozialen Delinquenten“ und den „soziale<br />
Problemen“, die diesen erzeugen, wieder als<br />
eine eigene Spezial- und Kontrollwissenschaft<br />
etablieren können. (Der „soziale Delinquent“<br />
geht übrigens ebenso auf Cesare Lombroso zurück<br />
wie der „geborene Verbrecher“.) Medien<br />
könnten ohne diese Wissenschaft vom „heteronomen<br />
Verbrecher“ und ohne die Ursachen-Erklärung<br />
der wissenschaftlichen „primären Definierer“<br />
kein „Problem“ auf die Tagesordnung<br />
der Öffentlichkeit bringen. Ebenso wenig wäre<br />
eine „Gefahr“ oder „Gefährdung“ zu benennen<br />
und „notwendige“ bzw. „legitime“ Reaktionen<br />
zu diskutieren.<br />
Diese Beteiligung von Experten und –Expertinnen<br />
wirkte nicht nur „aufklärend“. Es sei<br />
denn in der Hinsicht, dass insbesondere mit<br />
der Suche nach den „sozialen Ursachen“ von<br />
Delinquenz und Verbrechen viel Material entstand,<br />
an dem die Strukturen, Techniken und<br />
Funktionen solcher Diskurse deutlich gemacht<br />
werden konnten. Hier kann ich eine letzte<br />
arbeitsbiographische Anmerkung machen:<br />
Es gab viele Gelegenheiten, den Akteuren<br />
von Moral-Paniken zurückzuspiegeln, was in<br />
Sozialpädagogik und Öffentlichkeit<br />
Die „Öffentlichkeit“ ist für die Institution „Sozi-<br />
alpädagogik“ ein traditionell ambivalentes Feld.<br />
Es gilt den Professionellen als selbstverständ-<br />
lich, dass die Ressourcen für die Adressaten<br />
(und die Bezahlung der eigenen Arbeitskraft)<br />
konkurrierenden Verwendungen abgerungen<br />
werden muss. Wohlfahrtsstaatliche Regulati-<br />
on folgt dem Prinzip, dass hauptsächlich das,<br />
was zu einer ökonomischen oder politischen<br />
Dysfunktion führt, durch Intervention zu regu-<br />
lieren ist. Beseitigung von „Ungerechtigkeit“<br />
oder gar die Absicherung individueller Repro-<br />
duktion und Selbstbestimmung sind allenfalls<br />
nachrangig in die institutionelle Struktur ein-<br />
geschrieben. Da weder die Klientel der Hilfein-<br />
44 . Nr.63 . SIT<br />
SIT . Nr.63 . 45<br />
solchen Kampagnen über „soziale Sprengsät-<br />
Sprengsät-historische ze“ und „gesellschaftliche „Brutstätten von<br />
Gewalt und Kriminalität“ vor sich geht, wie<br />
Gewalt- und Kriminalitätswellen gemacht<br />
werden, wie die Typen des „jugendlichen An-<br />
greifers“, des „brutalisierten Gewalttäters“,<br />
des „zerstörerischen Fremden“, des „Intensiv-<br />
täters“, des „jungen Mehrfachauffälligen“, der<br />
„pädagogisch nicht Erreichbaren“ konstruiert<br />
wurden und für welchen Zweck das geschieht,<br />
welche Folgen es für die Etikettierten hat, und<br />
welche Folge für die soziale Kategorie, der sie<br />
zugehören. Das mag „die Jugend“ sein, meist<br />
wird aber schnell ein Teil herausgegriffen: „die<br />
Ausländer“, „die Modernisierungsverlierer“<br />
etc. Mir scheint, dass mit einem gewissen Ab-<br />
flauen der Entrüstung über kriminelle Kinder<br />
und gewaltbereite Jugend oder Modernisie-<br />
rungsverlierer bei einem Teil der Akteure die<br />
Nützlichkeit und die Folgen solcher Moral-Pani-<br />
ken überdacht werden. Haben die „Dramatisie-<br />
rer“ vielleicht „übertrieben“? Sollten wir nicht<br />
fragen, ob es überhaupt um etwas anderes<br />
ging als „Integration“?<br />
Die „Typen“, wenn wir sie uns etwas genauer<br />
ansehen, haben ja tatsächlich weniger etwas<br />
mit dem „Pessimismus als pädagogische Trieb-<br />
kraft“ gemein, den Katharina Rutschky als eine<br />
notwenige professionelle Ideologie des päda-<br />
gogischen Personals geschildert hat, als mit<br />
Feindbildproduktionen und der gesellschaftli-<br />
chen Praxis des „Fremdmachens“ zum Zweck<br />
der Ausschließung, mindestens zum Zweck<br />
der Bestimmung der Ausnahmen von Zugehö-<br />
rigkeit und „Förderungswürdigkeit“.<br />
historische und aktuelle diskurse
stitutionen noch deren Professionelle auf eine<br />
direkte Lobby zurückgreifen können, bleibt den<br />
„fürsprechenden Professionellen“ nur der Weg<br />
über das öffentliche „Skandalisieren“ eines<br />
„Problems“. Das Skandalisieren nimmt nach<br />
allen Beobachtungen schneller als z.B. im Fall<br />
sozialer Bewegungen, die „moralische Empö-<br />
rung über Ungerechtigkeit“ artikulieren, die<br />
Form der Warnung vor einer „Problemgruppe“<br />
an, die zu einer Gefahr für die Ordnung werden<br />
kann. Aber was steht denn einer „gefährlichen<br />
Jugend“ zu?<br />
Öffentliche Diskurse über Probleme, Konflikte<br />
und Adressaten von Sozialpädagogik aner-<br />
kennen oder verweigern die institutionelle<br />
Zuordnungen von Problemen, Konflikten und<br />
Adressaten. Sie organisieren einen Rahmen für<br />
die Zuteilung oder den Entzug von materiellen<br />
und immateriellen Ressourcen. Vor allem wird<br />
kanalisiert, in welcher Perspektive eine „sozia-<br />
le Arbeit“ erfolgen kann: Wird Sozialpädagogik<br />
in das traditionelle Geschäft einbezogen, die<br />
‚Dropouts‘ von Familie, Arbeitsmarkt, Schule,<br />
Sozialversicherungssystem, medizinischer Ver-<br />
sorgung und dem privaten Psychosektor noch<br />
einmal auf ihre „sekundäre Integrationsfähig-<br />
keit“ zu testen, sie erneut zu klassifizieren und<br />
die verlorenen Fälle mit Recht als „pädagogisch<br />
nicht erreichbar“ auszuschließen? Oder kann<br />
sie Widersprüche nutzen und unterschiedliche<br />
Lebensformen und Bewältigungsstrategien<br />
(nicht nur) von jungen Leuten stützen und sie<br />
(wenigsten vorläufig) nicht zum Identisch-Wer-<br />
den mit einem Leitbild zu bringen oder dazu<br />
zu zwingen. Ob die Spannung bestehen bleibt<br />
bzw. nach welcher Seite sich der Schwerpunkt<br />
und die Grenzen der Sozialen Arbeit verschie-<br />
ben, wird nicht allein fachlich, sondern in der<br />
Konkurrenz mit anderen Akteuren und Interes-<br />
sen entschieden.<br />
diskursestitutionen historische und aktuelle diskurse<br />
Jugend-Diskurse als Politik-Ressource. Für<br />
welche Politik und zu wessen Nutzen?<br />
Eines der wichtigsten Muster der „Öffentlich-<br />
keitsarbeit“ von Sozialpädagogik bestand und<br />
besteht in der Praxis einer „doppelten Beschrei-<br />
bung“. Sozialpädagogisches Wissen setzt „Ver-<br />
halten und Verhältnisse“ in Beziehung. Die<br />
Systematisierung dieses Wissens war verbun-<br />
den mit der gesellschaftlichen Funktion und<br />
den Praktiken der Institution. Zum „Klientel“<br />
von Fürsorge und Sozialpädagogik wurden die<br />
Gruppen, die auf Dauer oder Zeit von zentralen<br />
Institutionen (Arbeitsmarkt, Privateigentum,<br />
Familie) ausgeschlossen waren und sich daher<br />
in einer bürgerlichen, kapitalistisch organisierten<br />
Gesellschaft nicht selbst reproduzieren<br />
konnten. Aber selbst „Fürsorge-Erziehung“ als<br />
eine herrschaftlich gewährte Hilfe musste gegen<br />
Politiken sozialer Ausschließung durchgesetzt<br />
werden. Anlässlich einer Diskussion von<br />
„Modernitätsanforderungen und Traditionsbeständen“<br />
in der sozialen Arbeit schrieb Klaus<br />
Mollenhauer speziell zur Jugendhilfe: „Die<br />
sozialpolitischen Engpässe nötigen schon früh<br />
dazu, individuell erscheinende Problemlagen<br />
im Kontext gesellschaftlicher Bedingungen<br />
und Bewegungen zu interpretieren (...) von den<br />
quasi-privaten Merkmalen der Beziehungen<br />
und ihren Störungen sich voranzuarbeiten zu<br />
meso- und makrosozialen Kontexten, vom ‚Verhalten‘<br />
zu den ‚Verhältnissen‘.“ (1992, S.110)<br />
Dieses Argumentationsmuster zielte auf die<br />
Begründung einer „kompensierenden“, die<br />
Klientel „einpassenden“ Intervention. Verhältnisse,<br />
die die Entwicklung (Tüchtigkeit/ Autonomie/<br />
Mündigkeit/ Persönlich keit/ Subjektivität)<br />
der nachwachsenden Generation „fördern“<br />
und/oder „schädigen“, bilden den Kern des<br />
wissenschaftlichen und des Experten-Wissens<br />
über Jugend.<br />
Daraus abgeleitete und Interventionen begründende<br />
bzw. einklagende Argumente<br />
unterscheiden sich in einem zentralen Punkt<br />
von politischen, auf „Befreiungen“ zielenden<br />
Reden, die von „Rechten“ des Einzelnen oder<br />
„Interessen“ von sozialen Akteuren ausgehen.<br />
Das Wissen über „Verhalten und Verhältnisse“<br />
fasst Konflikte mit der nachwachsenden Generation,<br />
Verschiedenheiten von Menschen,<br />
Formen des Leidens an Ordnungen und der<br />
Widerständigkeit gegen Herrschaft als „Störung<br />
von Ordnung“ und als „Abweichungen<br />
von Normen“ durch die einzelne Person. Dem<br />
Abweichler wird jedoch (anders als etwas im<br />
Strafrecht) kein moralischer Schuldvorwurf gemacht.<br />
Diese Kategorie wird als defekter und<br />
verformter, aber formbarer Mensch typisiert,<br />
der der Gesellschaft zurückgegeben werden<br />
kann, wenn er kunstfertig und im Rahmen einer<br />
hierarchischen, aber fürsorglichen Beziehung<br />
von oben nach unten erzogen und eingepasst<br />
würde. Das impliziert mindestens eine soziale<br />
Degradierung: wer die Ordnung stört und von<br />
der Norm abweicht, wird stets zu einem Objekt<br />
„legitimer“ Veränderungstechnik. Es ist nicht<br />
zufällig, dass Erving Goffman dieses Deutungsmuster<br />
als die Logik von „totalen Institutionen“<br />
identifiziert hat. Totale Institutionen<br />
„sind die Treibhäuser, in denen unsere Gesellschaft<br />
versucht, den Charakter von Menschen<br />
zu verändern. Jede dieser Anstalten ist ein<br />
natürliches Experiment, welches beweist, was<br />
mit dem Ich des Menschen angestellt werden<br />
kann.“ (Goffman 1971: 22) Der Klassiker weist<br />
uns nur wenige Seiten später darauf hin, dass<br />
der Zweck der Institution, die Veränderung des<br />
Charakters „nicht wirklich einen kulturellen<br />
Sieg“ meint (geschweige denn ihn herbeiführen<br />
kann). Die totale Institution organisiert ein<br />
Spannungsverhältnis zwischen „Drinnensein“<br />
und „Hinauskommen“, zwischen (innerer) Ausschließung<br />
und Einbeziehung (draußen).<br />
Goffman benutzte die Metapher des „Treibhauses“<br />
zur Charakterisierung einer „modernen“<br />
Institution. Zygmunt Bauman veranschaulicht<br />
eine Dimension des modernen (Ordnungs-)<br />
Denkens mit der Metapher vom „gesellschaftlichen<br />
Gartenbau“. Gesellschaft als Zusammenhang<br />
von Einzelnen ist ein ständig zu bearbeitendes<br />
Projekt, das nur Nutzpflanzen an dafür<br />
vorgesehen Stellen hervorbringen soll, keine<br />
Unkräuter, keine Gewächse im falschen Beet,<br />
keine ungeplanten Wucherungen, ungestutzte<br />
Pflanzen. Wenn in die Gesellschaft Menschen<br />
nachwachsen sollen, die Regeln einhalten und<br />
an ihren Plätzen bleiben, bedarf das der vorbeugenden<br />
Pflege der Nutzpflanzen, dem Zurechtstutzen<br />
der Gewächse, ebenso wie dem<br />
gelegentlichen Ausrupfen des Unkrautes.<br />
Der Topos von der „gefährdeten und gefährlichen<br />
Jugend“ war einer der bedeutsamsten,<br />
die dem sozialpädagogischen Wissen inhärente<br />
„doppelte Beschreibung“ in verschiedenen<br />
Öffentlichkeiten zu verbreiten. Die Abhängigkeit<br />
des Verhaltens von den Verhältnissen, die<br />
Determiniertheit des sozialen Delinquenten<br />
durch sein „Milieu“ war immer wieder und in<br />
der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts<br />
sogar eine vergleichsweise lange Zeit<br />
eine Ressource, Elemente des „Generationenvertrages“<br />
zu verschieben. Jugendliche als<br />
Menschen „in Entwicklung“ zu verstehen ist<br />
heute eine Selbstverständlichkeit. Dieses Verständnis<br />
ist im „Sozialpädagogischen Jahrhundert“<br />
nicht nur als Anspruch formuliert, son-<br />
dern in beträchtlichem Umfang auch errungen historische worden. Jugend wurde als ein geschützter und<br />
von den Rechten und Pflichten der Erwachse-<br />
nen ausgenommener Status institutionalisiert.<br />
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat<br />
sich das hierarchische Gefälle zwischen Eltern<br />
und Kindern verändert. Als Herrschaftsverhält-<br />
nis ist das zwischen den Generationen weniger<br />
„autoritär“ und mehr „sorgender“ geworden;<br />
das bedeutet aber keineswegs aber weniger<br />
Disziplinierung, sondern ein Formwandel. Mit<br />
dem gesamten Prozess verband und verbindet<br />
sich gelegentlich ein Unbehagen („Jugend-<br />
wahn“). Dass Jugendliche in ihrer „Persön-<br />
lichkeitsentwicklung“ Unterstützung erfahren<br />
sollten, wurde verrechtlicht, institutionalisiert<br />
und zum Gegenstand der Arbeit verschiedener<br />
Professionen. Monetäre und infrastrukturelle<br />
Leistungen für die nachwachsende Generation<br />
gehören zum Kernbereich sozialstaatlicher Auf-<br />
gaben. In einem Resümee dieser Entwicklung<br />
für Kinder weisen Honig, Leu, Nissen auch dar-<br />
auf hin, dass und wie eine Ambivalenz bear-<br />
beitet wird. Sie schreiben: „Es gibt wenige Be-<br />
reiche, in denen sich das. Jahrhundert so sehr<br />
als eine Epoche der Humanisierung begreift<br />
wie in seinen Leistungen für Kinder und in der<br />
Klage über sein Versagen gegenüber Kindern.“<br />
(1996: 9) – Hier wird ein für Jugend erprobtes<br />
Muster „verjüngt“. In einer Phase, in der „Kin-<br />
der“ in den Status von Jugend kommen sollen,<br />
wird uns das auf Jugend angewandete Muster<br />
klarer.<br />
Nun war gerade das 20. Jahrhundert keines-<br />
wegs nur eine Epoche von Humanisierung<br />
oder gar eine „libertäre“ Phase . Nach Welt-<br />
kriegen und Nationalsozialismus lässt sich<br />
gerade eine (kurze) Phase abgrenzen, in der<br />
die auf Mündigkeit und Selbstbestimmung<br />
zielenden und die disziplinierenden Elemente<br />
des bürgerlichen Jugendkonzeptes auch für<br />
andere „Jugenden“ in Geltung gesetzt wur-<br />
den. „Die Mädchen“ waren die letzten in der<br />
(kurzen) Reihe; ihnen soll, inzwischen gegen<br />
einen gesellschaftlichen Trend, immer noch<br />
mehr „Selbstbestimmung“ ermöglicht wer-<br />
den. Generell ist die Vorstellung von „Jugend<br />
als Krise“ oder „Innovationspotential“ ein in<br />
öffentlichen Diskursen zunehmend weniger<br />
verbreiteter Topos. Abweichungen und Stö-<br />
rungen werden selten durch den Hinweis auf<br />
„Adoleszenz“ normalisiert (und verstanden).<br />
46 . Nr.63 . SIT<br />
SIT . Nr.63 . 47<br />
historische und aktuelle diskurse
diskurseUnd dass diskurse„Avantgarde“ historische und aktuelle diskurse<br />
Und dass in öffentlichen Diskursen Jugend als<br />
„Avantgarde“ gesellschaftlicher Entwicklung<br />
gilt, das habe ich lange nicht mehr gehört.<br />
Die Umsetzung von „lebenswerten, stabilen<br />
Verhältnissen, die es nicht zu Konflikten und<br />
Krisen kommen lassen“ (so formulierte dies der<br />
bundesdeutsche 8. Jugendbericht 1990), war<br />
und ist weiterhin verbunden mit spezifischen<br />
Jugend- und Kindheits-„Rhetoriken“, die Ab-<br />
weichungen von Jugend („unfertigen Men-<br />
schen“) und Kindheit („unschuldige Kinder“)<br />
als einen zu korrigierenden Defekt konzeptu-<br />
alisieren und somit eine Palette von erziehen-<br />
den, heilenden, disziplinierenden, helfenden,<br />
das Verhalten verändernden Interventionen<br />
legitimieren. Die wichtigsten Typen sind: Der<br />
junge Rebell, der jugendliche Delinquente, der<br />
benachteiligte Jugendliche, der kranke und<br />
schwache Jugendliche, das Opfer. (Die Typolo-<br />
gie lehnt sich an die „Kindheits-Rhetorik“ von<br />
Joel Best (1990) an.) Im Konkreten ist es nicht<br />
gleichgültig, welchen „Defekt“ die „gefährden-<br />
den“ Verhältnisse hervorbringen. „Gefährdun-<br />
gen“ sind nämlich nicht durch Diskriminierung<br />
und Ausschließung definiert, sondern durch<br />
Anomie im Sinn von „Normlosigkeit“, den<br />
Individuen fehlt das Korsett von Norm und<br />
(stets herrschaftlicher) Kontrolle. Insofern ist<br />
es logisch, dass der derzeitige Diskurs „ge-<br />
fährliche Jugend“ mit seiner Grundfigur, dem<br />
„Delinquenten“ arbeitet und nicht mit dem der<br />
„Sozialrebellen“.<br />
Sogar in guten Zeiten liegt der Demokratie<br />
ein „struktureller Populismus“ zugrunde: Po-<br />
litische Intervention kommt fast nur noch zu-<br />
stande, wenn ein „Skandal“ in der Form einer<br />
Bildungskatastrophe oder einer Gefahr für den<br />
Bürger und die Ordnung ausgerufen wird. „Un-<br />
gerechtigkeit“ entfaltet kaum mehr Wirkung.<br />
Das wissen auch Fachleute der Jugendhilfe<br />
und der Jugendforschung. Aber welches Bild<br />
führt zu welcher Politik? Skandalisierung von<br />
Ungerechtigkeit, die durch die Form des Wirt-<br />
schaftens, die Staatsform, die Lebensweise und<br />
die Herrschaftsverhältnisse erzeugt werden,<br />
legt andere Schlussfolgerungen nahe als eine<br />
„Gefährlichkeit“, die vom Menschen ausgeht.<br />
Der Diskurs über die „gefährliche Jugend“<br />
verwendet den oben beschriebenen „sozialpä-<br />
dagogischen“ Topos: den der „gefährdeten und<br />
gefährlichen Jugend“. D.h. es wird auf eine<br />
merkwürdige Weise das Ungerechtigkeitsthema<br />
mit dem der Gefährlichkeit verwirrt. Wer<br />
die Notwendigkeit von Reformen, „die soziale<br />
Gegensätze ausgleichen“, nicht aus sozialen<br />
Rechten von jungen Leuten ableitet, sondern in<br />
Aussicht stellt, dass damit ihre Disziplinlosigkeiten,<br />
Abweichungen und Gewalttätigkeiten<br />
verhindert würden, der praktiziert den „Pessimismus<br />
als pädagogische Triebkraft“ (Rutschky<br />
1987). Die Argumentationsweise degradiert<br />
eine Gruppe von Menschen in bezug auf ihre<br />
sozialen und moralischen Kompetenzen, um für<br />
sie etwas Gutes zu tun. Die Mahnung, mehr<br />
Gerechtigkeit, mehr Sozialarbeit und Sozialpolitik<br />
könnten Täter, die „immer jünger und<br />
brutaler“ werden, verhindern, enthält durchaus<br />
einen Erfahrungs-Kern. Die Vermutung<br />
ist nicht unbegründet, dass Diskriminierung<br />
und Ausschließung von der Teilhabe an gesellschaftlich<br />
produziertem Reichtum zu Protestbewegungen<br />
oder zu einem individuellen<br />
„Gegenschlag“ führen könnten. Der Ratschlag,<br />
(potentielle) Delinquente durch Reformen zu<br />
„bekämpfen“, richtet sich dementsprechend<br />
an die Mächtigen und den Herrschaftsapparat,<br />
sie sollten in ihrem eigenen Interesse die Zumutungen<br />
an Verzichtsleistungen der jungen<br />
Leute und Ungleichheit nicht übertreiben.<br />
Die Drohung, eine „gefährliche Klasse“ bzw.<br />
eine „gefährliche Generation“ könnte entstehen,<br />
kann vorhandene Reformtendenzen in<br />
Richtung einer Disziplinierung, die mit einem<br />
Versprechen von einem besseren Leben verbunden<br />
ist, gelegentlich verstärken. Ein Beispiel<br />
wären in der Tat die 70er Jahre und einige<br />
Reform-Nachzügler (wie das KJHG z.B.). Auch<br />
an den Vorhaben, die jetzt das Etikett „Prävention“<br />
erhalten, ist nicht alles verkehrt. Eine Politik,<br />
die sich gegen herrschende Tendenzen in<br />
Richtung mehr Partizipation entwickelt, kann<br />
sie nicht herbeiführen. Der Preis dieser Art<br />
von „Sozialanwaltschaft“ zeigt sich als hoch<br />
und muss von einem Teil der Jugend entrichtet<br />
werden. Von dem Teil, deren Bearbeitungsstrategien<br />
gesellschaftlicher Zumutungen (die die<br />
von Erziehungs- und Hilfeinstitutionen einschließt),<br />
nicht verstehbar gemacht werden.<br />
Mit und in den Kampagnen passiert etwas<br />
anderes als der „Pessimismus als reformerische<br />
Triebkraft“ es phantasiert. Ich habe an<br />
verschiedenen Teil-Kampagnen der 90er Jahre<br />
mit umfangreichem empirischem Material<br />
aus Printmedien und durch Vergleiche mit<br />
Kampagnen seit den 60er Jahren diese in der<br />
Geschichte sich wiederholenden Funktionen<br />
aufgezeigt. Das bezog sich generell auf (Un-<br />
)Sicherheitskampagnen, auf Gewalt, Gewalt in<br />
der Schule, auf Kinderkriminalität, Jugendkriminalität<br />
und die brutalisierten Mädchen; bei<br />
einem Teil der Arbeiten konnten offene Fragen<br />
am Ende der Kampagnen nochmals eingearbeitet<br />
werden. (Vgl. Cremer-Schäfer 1993, Cremer-<br />
Schäfer 2000/1992, Cremer-Schäfer 2000/1998,<br />
Cremer-Schäfer 2001, Cremer-Schäfer/Steinert<br />
1998) Im folgenden werde ich die Funktionen<br />
zusammenfassend benennen und versuchen,<br />
das neue Element der Kampagnen der 90er<br />
Jahre herauszuarbeiten.<br />
1. Die Artikulation von Unbehagen und sozialer<br />
Angst:<br />
Öffentliche, über Massenmedien vermittelte<br />
Debatten über Abweichler, Außenseiter und<br />
„Unmenschen“, über Kriminalität und Gewalt<br />
dienen generell dazu, öffentlich Unbehagen<br />
und soziale Angst über ökonomische und<br />
gesellschaftliche Entwicklungen zu artikulieren.<br />
Abweichung hat zudem den Vorteil der<br />
Unterhaltungsfunktion von Medien und dem<br />
Warencharakter dieses Mediums besonders<br />
gerecht zu werden. Indem gesellschaftliche<br />
Veränderungen bzw. soziale Angst am Thema<br />
„Kriminalität“ aufgehängt werden, findet eine<br />
„Verschiebung“ und ein Rationalitätsverlust<br />
der Diskussion statt.<br />
Das ist das Argument, sich nicht an Kampagnen<br />
zu beteiligen: Man kann in dieser Form<br />
nicht direkt über das sprechen, was<br />
an ge-<br />
sellschaftlichen Verhältnissen Unbehagen<br />
verursacht, sondern muss personalisierend<br />
darüber schreiben, wer<br />
Angst macht; genauer:<br />
wer zum Angst Machen benutzt wird. Soziale<br />
Angst ist ein hergestelltes soziales Gefühl.<br />
Über Kapitalismus, Ausschließung aus dem<br />
Arbeitsmarkt, über Konflikte um Teilhabe an<br />
gesellschaftlichen Ressourcen oder über politische<br />
Korruption, wirtschaftliche Konkurrenz<br />
und Ausbeutung braucht nicht direkt gesprochen<br />
zu werden, sie werden im Zusammenhang<br />
mit der Konstruktion einer bedrohlichen<br />
Generation von Kindern, Jugendlichen oder<br />
Ausländern z.B. als „Ellenbogengesellschaft“<br />
besungen. Verschieben und Projizieren als eine<br />
gesellschaftliche Praxis zielt auf Verkennen<br />
der eigenen Mitarbeit an einer „darwinstisch<br />
2. Die Personalisierung und Familialisierung<br />
gesellschaftlicher Konflikte:<br />
Wenn im Zusammenhang von „Kriminalität“<br />
über gesellschaftliche Verhältnisse in Form<br />
von „sozialen Problemen“ gesprochen (Ar-<br />
beitslosigkeit, Armut, verschärfte Konkurrenz)<br />
oder über die Zumutungen durch Institutionen<br />
(Schule, Markt, Medien) geklagt wird, ist nicht<br />
wirklich eine „Politisierung“ der Verhältnisse<br />
gemeint, d.h. Demokratisierung von Organi-<br />
sationen oder Reform von Strukturen. In äti-<br />
ologischen, in „Ursachentheorien“ führt die<br />
Diagnose, dass „etwas schief läuft in der Ge-<br />
sellschaft“, über eine Argumentationsschlaufe<br />
zurück zur Personalisierung des Problems. Die<br />
Theorie, dass „Normlosigkeit“ (konservative<br />
Version) oder „Ungerechtigkeit“ (liberale Ver-<br />
sion) „kriminelle Motive“ herausbildet, ist wis-<br />
senschaftlich erzeugt. Es mag paradox klingen,<br />
gerade durch die Darstellung von Theorien der<br />
„sozialen Ursachen“ als „Brutstätten der Moti-<br />
ve“ der Kriminalität bleibt die Aufmerksamkeit<br />
zuerst und wieder zuletzt an Personen hängen.<br />
Theorien der „sozialen Ursachen“ ermöglichen<br />
Vorgänge der Individualisierung. In medialen,<br />
auch für den Unterricht bestimmten Dokumen-<br />
tationen liest sich das dann so:<br />
„Wie Helden in US-Serien hauen sie drauf“<br />
Die Abwärtsspirale beginnt, wenn Eltern<br />
sich nicht um ihre Kinder kümmern.<br />
Der Katalog geht von A wie Arbeitslosigkeit bis<br />
Z wie Zappen. Die Faktoren, die Wissenschaft-<br />
ler und Praktiker als Ursache für kriminelles<br />
Verhalten anführen erreichen eine stattliche<br />
Zahl. Wenn man das alles zusammenzieht,<br />
müsste eigentliche jeder Jugendliche krumme<br />
Dinger drehen.“ (Serie „Jugendkriminalität“<br />
der Frankfurter Rundschau, Mai 1999, Sonder-<br />
druck, 5. Serienfolge)<br />
Bei der Ursachenfrage sind sowohl Wissen-<br />
schaftler wie Expertinnen unverzichtbar. Sie<br />
werden gebeten, ihr Wissen zu Verfügung zu<br />
stellen. Sie werden oft genug durch die bana-<br />
lisierte Form, in der das geschieht, öffentlich<br />
vorgeführt. Im vorliegenden Zitat etwa durch<br />
48 . Nr.63 . SIT<br />
SIT . Nr.63 . 49<br />
funktionierenden Gesellschaft“; es kann auch historische über die drohende Bedeutungslosigkeit und<br />
Machtlosigkeit beruhigen. Politik wird durch<br />
ein Ritual ersetzt. Insofern geht es bei Moral-<br />
Paniken nicht einmal um die Skandalisierung<br />
von Ungerechtigkeit.<br />
historische und aktuelle diskurse
den Hinweis, dass soziale Ursachentheorien<br />
viel zu viel Kriminalität prognostizieren. Was<br />
mit dem Experten- und dem wissenschaftli-<br />
chen Wissen in diesen Debatten geschieht,<br />
ist allerdings ziemlich selbstverschuldet. Wie<br />
immer differenziert und in neuem Vokabular<br />
kommen die meisten Wissenschaftler auf die<br />
altbekannten Faktoren zurück, die mit Krimina-<br />
lität und Gewalt korrelieren. Die Kritische So-<br />
zialwissenschaft und Erziehungswissenschaft<br />
hatte es schon einmal klar, wie Verstehen und<br />
Erklären hier ansetzen könnte: weshalb korre-<br />
liert was mit wem? Die neuerliche Beliebtheit,<br />
Armut, Familie und Kriminalität statistisch zu<br />
verknüpfen, zeigt das Elend dieser Theorie<br />
ganz besonders.<br />
Familialisierung dient dazu, das moralisierende<br />
Erklärungsschema vom „bösen und schuldigen<br />
Verbrecher“ zu verlassen und es durch das per-<br />
sonalisierende und sozial degradierende Bild<br />
des „gefährlichen Delinquenten“ und „defizi-<br />
tären Menschen“ zu ersetzen. Familialisierung<br />
wurde mit der Unterstützung wissenschaftli-<br />
cher Theorien ein moderner „Alltagsmythos“.<br />
Die implizite Theorie lautet, Kriminalität und<br />
Gewalt entsteht, wenn erzieherische Autori-<br />
tät ausfällt – nicht wenn Sorge und Offenheit<br />
fehlt.<br />
3. Legitimation professioneller und politischer<br />
Interessen:<br />
Die Akteure der Moral-Panik verbinden mit der<br />
„steigenden Kinder- und Jugendkriminalität“<br />
stets organisatorische Interessen. Folgende<br />
Verschiebungen konnte man beobachten:<br />
- Der Polizei ging es in den letzten Moral-Pani-<br />
ken weniger um mehr Personal und Kompeten-<br />
zen, sie war und ist darauf bedacht, unbeque-<br />
me „Sozialfälle“ anderen Instanzen zu über-<br />
eignen. Der Umgang mit schwierigen Kindern<br />
gehöre nicht zu den „eigentlichen Aufgaben“<br />
der Polizei, stört die Routinen, und deshalb for-<br />
derten einige Akteure eine Senkung der Straf-<br />
mündigkeitsgrenze auf 12 Jahre. Einige gingen<br />
es auch kumpelhaft und per „Eigenanzeige“<br />
an. (Gefunden habe ich diese Anzeige in der<br />
Frankfurter Rundschau, Lokalausgabe Main-<br />
Kinzig-Kreis, 31.1.1998)<br />
Wer ist schuld, wenn Kinder stehlen?<br />
Täter,<br />
Opfer,<br />
Abenteurer?<br />
Liebe Eltern, Lehrer und Geschäftsleute,<br />
diskurseden Hinweis, historische und aktuelle diskurse<br />
wer nur mit Strafe droht, hat null<br />
Feeling für Kids und Teenies.<br />
Wir wollen, daß Sie sicher leben. Ihre Polizei<br />
Wenn Verstehen („Feeling“) und „Pädagogisierung“<br />
angemahnt werden, dann in der<br />
Form wie das Patriarchen tun: Den Jungen soll<br />
„offiziell“ die Grenze gezeigt werden: vom Jugendrichter,<br />
vom Jugendamt, von der Jugendhilfe<br />
(aber nicht vom Jugendgefängnis), die<br />
auch über kleine, Anpassung ermöglichende<br />
Ressourcen verfügen und diese auch vergeben.<br />
Vor allem mit der Klage, was die jungen<br />
„Intensiv- und Mehrfachtäter“ alles anstellen<br />
können, weil sozialpädagogische Helfer das<br />
patriarchale Muster nicht bringen, nur helfen<br />
ohne zu kontrollieren, konnten pädagogischen<br />
Instanzen in diesen letzten Kampagnen mühelos<br />
diskreditiert werden. Sie haben sich ziemlich<br />
„anpassend“ verteidigt.<br />
- Wissenschaftler und insbesondere Kriminologen<br />
erhielten durch die Jugendgewalt und die<br />
„steigende Kinder- und Jugendkriminalität“<br />
eine weitere Gelegenheiten, Öffentlichkeit und<br />
Politik daran zu erinnern, dass „sanfte Kontrolle“<br />
und Integration durch eine soziale Technologie<br />
langfristig für ihre Interessen nützlicher<br />
sei als Sozialabbau und Law-and-Order-Kampagnen.<br />
„Kriminologen“ bestätigen sich dadurch<br />
mindestens selbst ihre Bedeutsamkeit<br />
als Verbrechens- und Ordnungsexperten und<br />
den Sinn ihrer forschenden Geschäftigkeit.<br />
Allerdings geht es nicht nur um Status: hier<br />
fließen eine Menge an Forschungsgeldern, an<br />
Anerkennung und Bedeutsamkeit an Politik-<br />
Berater, als Hüter der (instrumentellen) Vernunft<br />
und einer halbierten Integration.<br />
- Die sozialen Professionen hatten ein weiteres<br />
Thema, um ihre Arbeitsplätze zu legitimieren<br />
und Ressourcen für Kinder- und Jugendhilfe<br />
einzuklagen.<br />
- Die Forderungen nach einer Ersatzanstalt für<br />
die geschlossenen Heime und die Untersuchungshaft<br />
für Jugendliche erhielten einigen<br />
Nachdruck. Daran sind sowohl Akteure aus Polizei<br />
und Justiz wie solche aus der Jugendhilfe<br />
selbst interessiert. Geschlossene Unterbringung<br />
hat inzwischen wieder den Status einer<br />
Selbstverständlichkeit erreicht. In einer „enggeführten<br />
Betreuung“ sieht insbesondere die<br />
sonst auf die Freiheit des Einzelnen bedachte<br />
„gebildete Klasse“ die Lösung für die „sozialen<br />
Sprengsätze“.<br />
Kampagnen: „Ideologieproduktion mit Menschenopfern“?<br />
Generell ging es seit Beginn der 90er Jahre in<br />
den Kampagnen darum, dass Erziehung mehr<br />
Wert auf „Grenzziehung“ legen soll, vor allem<br />
bei dem Teil der jungen Leute, der durch die<br />
ökonomische Entwicklung nicht einmal mehr<br />
als eine „Reservearmee“ für den Arbeitsmarkt<br />
gebraucht wird. Der Ratschlag, „gefährliche<br />
Klassen“ und „soziale Sprengsätze“ durch<br />
soziale Reformen zu „bekämpfen“, ist noch<br />
verbreitet, erhält aber zunehmend einen Begleiter.<br />
Es ist die Phantasie, Delinquente seien<br />
zu reformieren, wenn sie nur in einer „festen<br />
Ordnung“ aufwachsen. Die Sympathie für eine<br />
„feste Ordnung“ hat „the sympathy for the little<br />
devil“ abgelöst. Die Phantasie einer „festen<br />
Ordnung“, einer „enggeführten Betreuung“<br />
ist in der Tat noch eine relativ „sanfte“ Variante<br />
der neuen Punitivität. Gehandelt werden<br />
deutlich punitivere Varianten bis hin zur Form<br />
der militärischen Anstaltsdisziplin (Glen Mills<br />
Schools) und Techniken der „schwarzen Psychologie“<br />
(Anti-Aggressions-Training als „Konfrontationspädagogik“).<br />
Insgesamt hören wir inzwischen weniger über<br />
die „gefährliche Jugend“, weil „Punitivität“<br />
eine verstärkte Legitimation erfahren hat. Man<br />
kann das an folgenden Veränderungen sehen:<br />
1. Die Rehabilitation der Jugend-Strafe wurde<br />
mit der Debatte über „rechte Jugendgewalt“<br />
eingeleitet. Getroffen hat das Klima der Punitivität<br />
zuerst „Ausländer“. Junge Leute ohne<br />
deutschen Pass bevölkern die Jugendgefängnisse.<br />
Sie wurden konsequenter zu „Insassen“<br />
gemacht als zu „Integrierten“. Insbesondere<br />
in der Verbindung mit der Diskussion um<br />
„junge Intensiv- und Mehrfachtäter“, um die<br />
Folk-Devils namens „Mehmet“, „Jens“ oder<br />
„Christian“, die von der Polizei besonders befördert<br />
wurde, wurde eine ganze Menge an<br />
ideologischer Arbeit geleistet, die Einsperrung<br />
und das Strafen rehabilitierte. Liberale Bürger<br />
und Soziale-Probleme-Professionen legen bei<br />
bestimmten Gruppen ihre vergangen, starken<br />
„Zweifel am Sinn der Strafe“ ab.<br />
2. Die neue Punitivität der „gebildeten Klasse“<br />
und das damit (noch) verbundene „schlechte<br />
Gewissen“ (oder auch Reste der Aufklärung)<br />
kann man an den Überhöhungen der Pädagogik<br />
beobachten, mit denen das neue Projekt<br />
der Grenzziehung gegen Delinquente verse-<br />
hen wird. Auf den Punkt gebracht hat dies am historische Ende der Kampagne ein Text, den ich in einer<br />
Wochenschrift für die „gebildete Klasse“ ge-<br />
funden habe (DIE ZEIT Nr. 27 v. 1.7.99, S. 4).<br />
In einem Artikel, der den sozialpädagogischen<br />
Topos „gefährlich und gefährdet“ als Headline<br />
gebrauchte, wird ein Reiz-Reaktionsmuster an-<br />
geboten: „Die Jugendgewalt nimmt zu: Krimi-<br />
nelle Kinder brauchen eine feste Ordnung“.<br />
Das Mitleid ist jungen Leuten noch gewiss,<br />
die aus einem entsetzlichen Zuhause kommen,<br />
auch dass man „Armut, Unwissenheit und<br />
Gewalttätigkeit in „schwierigen, eher subpro-<br />
letarischen als proletarischen Verhältnissen“<br />
bekämpfen müsse. Doch diese Kinder sind<br />
eben nicht nur „Opfer“. Sie sind fremdunterge-<br />
bracht, weil:<br />
„sie schlagen, stehlen, vergewaltigen, Drogen<br />
nehmen und Drogen verkaufen, weil sie, un-<br />
erreichbar, in einer eigenen regellosen Welt<br />
leben. Merkwürdig unbeteiligt sind sie, starr,<br />
wenig beeindruckt von niedlichen Zwergzie-<br />
gen und Ponys. Es sind, offen gesagt, nicht<br />
immer besonders nette Kinder. Niemand wür-<br />
de sich die härteren Fälle als Schulkameraden<br />
des eigenen Sohnes, der eigenen Tochter wün-<br />
schen.“<br />
Zu dem Wissen über den Umgang mit schwie-<br />
rigen Jugendlichen heißt es:<br />
„Niemand weiß, ob die Einzelbetreuung im<br />
Ergebnis mehr brächte als die Einzelzelle.<br />
Also muss man sich für die Praxis mit Mutma-<br />
ßungen und Plausibilitäten behelfen. Einiges<br />
spricht dafür, dass desorientierte Jugendliche<br />
enggeführte Betreuung brauchen, einen klar<br />
strukturierten Tag, Pflichten und Aufgaben,<br />
deren Erfüllung ihr Selbstwertgefühl stärkt;<br />
Regeln, deren Verletzung unweigerlich Kon-<br />
sequenzen nach sich zieht und verlässliche<br />
Beziehungen.“<br />
Die Zeit-Autorin beschreibt die Verhältnisse<br />
einer totalen Institution, der Erziehungsanstalt<br />
- das Modell für die erzieherische Jugendstra-<br />
fe. Dahin sollen die Jugendlichen der „eher<br />
subproletarischen“ Herkunft, die man sich<br />
nicht als Schulkamerad des eigenen Kindes<br />
wünscht. Weil sie aber weiß und schreibt, dass<br />
„Erziehungsgefängnisse“ nichts genützt hät-<br />
ten, beschwört sie den bildungsbürgerlichen<br />
Mythos von „pädagogischen Persönlichkei-<br />
ten“, mit „Berufung“, „Charakter“, „Vorbild“.<br />
Der Weg „jenseits von Liberalisierung und<br />
50 . Nr.63 . SIT<br />
SIT . Nr.63 . 51<br />
historische und aktuelle diskurse
Pädagogik vom Delinquenten aus, ist vielleicht<br />
der charismatische Erzieher.“<br />
Was die Autorin vergessen hat: „Charisma“ ist<br />
eine subtile Form von Führung und Beeinflus-<br />
sung und Fremdbestimmung und kann sehr<br />
leicht in eine sich maskierende Herrschaft<br />
umschlagen. Ehrlicher sind da tatsächlich<br />
diejenigen, die offen das Strafrecht den jungen<br />
(ausländischen, armen) Männern wieder näher<br />
bringen wollen.<br />
3. Neu ist, dass über die „gefährliche Jugend“<br />
und die „sozialen Sprengsätze“ in einer Form<br />
diskutiert wird, die die Geschlechterdifferenz<br />
betont. Der bescheidene Gewinn, den Mäd-<br />
chen von Gewalt- und Kriminalitätsdiskursen<br />
haben, liegt im großen und ganzen in der Be-<br />
stätigung, dass sie das „brave Geschlecht“<br />
seien. Kriminalität und Gewalt ist ein „Jungen-<br />
problem“, das wird von Expertinnen und Ex-<br />
perten, von Wissenschaftlerinnen und Wissen-<br />
schaftlern, von Politikerinnen anerkannt. Mehr<br />
Ressourcen mobilisiert das „brave Mädchen“<br />
nicht. „Wer keine Probleme macht, wird auch<br />
keine Probleme haben.“<br />
Die vergleichsweise immer noch „unvollkom-<br />
mene“ Modernisierung des Kontroll- und Kri-<br />
minalisierungsmusters bzw. der Strafenpolitik<br />
bei Frauen wird durch ein Bild von „immer<br />
mehr Mädchen, die prügeln und foltern“, nicht<br />
verändert. Im Gegenteil: Obwohl die „braven<br />
Mädchen“ heute nicht zur „gefährliche Ju-<br />
gend“ gezählt werden, steigt bei jungen Frau-<br />
en der Trend zu mehr kurzen und gleichzeitig<br />
den „langen“ Gefängnisstrafen stärker an als<br />
bei jungen Männern.<br />
Es gibt ein fundiertes Wissen über Moral-Pani-<br />
ken. Wir werden es wahrscheinlich auch brau-<br />
chen. Es wird sich wiederholen, was Stanley<br />
Cohen am Ende seines Buches über die Mods,<br />
die Rocker und die Moral-Paniken der 60er Jah-<br />
re feststellte:<br />
„Es werden mehr Moral-Paniken erzeugt wer-<br />
den und unsere Gesellschaft, so wie sie gegen-<br />
wärtig strukturiert ist, wird weiterhin für eini-<br />
ge ihrer Mitglieder – wie die Jugendlichen der<br />
Arbeiterklasse – Probleme erzeugen und wird<br />
verdammen, was immer diese Gruppen an Be-<br />
arbeitungsstrategien für diese Probleme finden<br />
wird.“ (Cohen 1987: 204, meine Übersetzung)<br />
Wenn die gesellschaftliche Reaktion in der<br />
Strategie „mehr desselben“ erfolgt, dann hält<br />
Wissen über die vergangen Kampagnen von<br />
diskursePädagogik historische und aktuelle diskurse<br />
Naivität und vom gutgemeinten Mitmachen ab.<br />
In der Situation der kritischen Distanz lassen<br />
sich dann (hoffentlich) weitere Ressourcen für<br />
einen pragmatischen oder sogar freundlichen<br />
Umgang mit jungen Leuten entwickeln.<br />
Literatur:<br />
Bauman, Zygmunt: Dialektik der Ordnung: Die<br />
Moderne und der Holocaust, Hamburg 1992.<br />
Becker, Howard S.: Außenseiter. Zur Soziologie<br />
abweichenden Verhaltens, Frankfurt 1971.<br />
Best, Joel: Threatened Children. Rhetoric and<br />
Concern about Child-Victims. Chicago/London<br />
1990.<br />
Cohen, Stanley: Folk-Devils & Moral Panics.<br />
The Creation of the Mods and Rockers, Oxford<br />
1987.<br />
Cremer-Schäfer, Helga/Steinert, Heinz: Straflust<br />
und Repression. Zur Kritik der populistischen<br />
Kriminologie, Münster 1998.<br />
Cremer-Schäfer, Helga: Einpolitisches Mandat<br />
schreibt man sich zu, in: Merten, Roland (Hg.),<br />
Har soziale Arbeit ein politisches Mandat? Positionen<br />
zu einem strittigen Thema, Opladen<br />
2001, S. 55-70.<br />
Cremer-Schäfer, Helga: Emanzipation, Anpassung<br />
und Gewalt. Über den einen oder<br />
anderen Vorteil der öffentlichen Bedeutungslosigkeit<br />
von jungen Frauen und Nachteile der<br />
öffentlichen Aufmerksamkeit für die gefährlichen<br />
jungen Männer, in: Rang Brita/ May, Anja<br />
(Hg.): Das Geschlecht der Jugend. Adoleszenz:<br />
weiblich/männlich?, Frankfurter Beiträge zur<br />
Erziehungswissenschaft. Kolloquien Bd. 5,<br />
Frankfurt 2001.<br />
Cremer-Schäfer, Helga: Sie klauen, schlagen,<br />
rauben, in: Heiner Barz (Hg.), Pädagogische<br />
Dramatisierungsgewinne. Jugendgewalt.<br />
Analphabetismus. Sektengefahr, Frankfurter<br />
Beiträge zur Erziehungswissenschaft, Reihe<br />
Kolloquien Bd. 3, Frankfurt, S. 81-108.<br />
Cremer-Schäfer, Helga: Skandalisierungsfallen,<br />
in: Heiner Barz (Hg.), Pädagogische Dramatisierungsgewinne.<br />
Jugendgewalt. Analphabetismus.<br />
Sektengefahr, Frankfurter Beiträge zur<br />
Erziehungswissenschaft, Reihe Kolloquien Bd.<br />
3, Frankfurt 2000 S. 109-130.<br />
Edelman, Murray: Politik als Ritual: Die symbolische<br />
Funktion staatlicher Institutionen und<br />
politischen Handelns, Frankfurt 1976.<br />
Goffman, Erving: Asyle. Über die soziale Situation<br />
psychiatrischer Patienten und anderer<br />
Insassen, Frankfurt 1972.<br />
Honig, Michael-Sebastian/Leu, Hans Rudolf/<br />
Nissen, Ursula: Kindheit als Sozialisationsphase<br />
und kulturelles Muster, in: Dies. (Hg.), Kinder<br />
und Kindheit, Weinheim, München 1996, S.<br />
9-30.<br />
Maase, Kaspar: Vergebliche Kriminalisierung.<br />
Zum Platz der Halbstarken in der Geschichte<br />
des Alltags, in: Kriminologisches Journal, 23.<br />
Jg., 1991, S. 189-203.<br />
Mollenhauer, Klaus: Jugendhilfe. Modernitätsanforderungen<br />
und Traditionsbestände für die<br />
sozialpädagogische Zukunft, in: Rauschenbach,<br />
Thomas/Gängler, Hans, Soziale Arbeit<br />
und Erziehung in der Risikogesellschaft, Neuweid,<br />
Kriftel Berlin 1992, S. 101-119.<br />
Moore, Barrington: Ungerechtigkeit: Die sozialen<br />
Ursachen von Unterordnung und Widerstand,<br />
Frankfurt 1982.<br />
Rutschky, Katharina: Das Milchmädchen rechnet<br />
– Über den Pessimismus als pädagogische<br />
Triebkraft, in: Baacke, Dieter (Hg.): Am Ende<br />
Postmodern, Weinheim und München 1987, S.<br />
83-85.<br />
Ausgrenzung und Integration<br />
Das Verhältnis der Jugendhilfe zu ihrer Zielgruppe<br />
der Mädchen und jungen Frauen ist<br />
über die gesamte Geschichte der Bundesrepublik<br />
Deutschland gekennzeichnet durch die<br />
Begriffe Integration und Ausgrenzung.<br />
Jugendhilfe kannte und kennt bis heute keinen<br />
anderen Umgang mit ihrer weiblichen Klientel:<br />
Sie grenzt sie aus, indem sie sich immer noch<br />
am patriarchalen Normalbild des Menschen<br />
(Mann-Sein = Mensch-Sein, Frau-Sein = Abweichung<br />
davon) orientiert. Damit waren und<br />
sind Mädchen und junge Frauen flur die Jugendhilfe<br />
allenfalls eine besondere Gruppe,<br />
eine Problemgruppe oder eine Minderheitengruppe,<br />
der „besonderer“ Aufmerksamkeit<br />
bedarf. Zu keiner Zeit aber waren Mädchen<br />
als Mädchen und als Hälfte der Zielgruppe<br />
1 Erweiterte Fassung des Vortrages. Auf einen großen<br />
Anmerkungsapparat wurde verzichtet. Wer die dar-<br />
gestellte Perspektive überprüfen möchte und weitere<br />
dar-historische Quellen heranziehen, kann in meinen zitierten Veröffent-<br />
lichungen entsprechende Verweise finden. Der Vortrag<br />
und der Text führen die Argumente aus verschiedenen<br />
Veröffentlichungen seit Beginn der 90er Jahre zusam-<br />
men.<br />
Prof. Dr. Helga Cremer-Schäfer<br />
Johann Wolfgang Goetheuniversität Frankfurt<br />
Fachbereich Erziehungswissenschaften<br />
Postfach 11 19 32<br />
D-60054 Frankfurt am Main<br />
e-mail: cremer-schaefer@em.uni-frankfurt.de<br />
Claudia Wallner:<br />
Mädchenarbeit im Wandel sozialer Arbeit<br />
der Jugendhilfe im Blick. Die Orientierung an<br />
männlichen Lebenswelten in der Gewissheit,<br />
dies sei die Normalität und der Standard führt<br />
zwangsläufig zur Ausgrenzung von Mädchen<br />
mit ihren Erfahrungen und Lebensrealitäten.<br />
Mädchen zu integrieren, das ist bis heute das<br />
einzige Angebot der Jugendhilfe an Mädchen<br />
und junge Frauen. Nur: Integration bedeutet,<br />
etwas oder Jemanden in ein bestehendes<br />
System einzufügen, nicht ein System zu über-<br />
denken, ob es für eine bislang vernachlässigte<br />
Gruppe attraktiv und richtig ist. Die Botschaft<br />
an Mädchen lautet heute immer noch wie Ende<br />
der sechziger Jahre im Rahmen der Einführung<br />
der Koedukation: die Angebote der Jugend-<br />
hilfe sind offen für Mädchen wie für Jungen,<br />
und wenn Mädchen sie nicht nutzen, so wie<br />
sie sind, dann haben sie offenbar keinen Be-<br />
52 . Nr.63 . SIT<br />
SIT . Nr.63 . 53<br />
historische und aktuelle diskurse
diskursedarf. Integration diskurseist faktisch historische und aktuelle diskurse<br />
darf. Integration in diesem Sinne verstanden<br />
ist faktisch eine weitere Form der mittelbaren<br />
Ausgrenzung.<br />
Jugendhilfe ist bis heute weit von einer kri-<br />
tischen Reflexion darüber entfernt, ob sie für<br />
Mädchen geeignete Strukturen, Leistungsbe-<br />
reiche, Träger- und Personalstrukturen, Ein-<br />
richtungen und Angebote vorhält.<br />
Konservatismus und Negierung<br />
Mädchenarbeit im Wandel sozialer Arbeit ist<br />
eine Geschichte von Ausgrenzung und Integra-<br />
tion, keine Geschichte von Gleichberechtigung<br />
und adäquater Förderung. Das spiegelt sich<br />
auch im pädagogischen Umgang mit Mädchen<br />
im Verlauf der Nachkriegsgeschichte wider:<br />
Auch hier werden zwei Strategien sichtbar, die<br />
Mädchen eher behindert als gefördert haben:<br />
In geschlechtshomogenen Angeboten und<br />
Einrichtungen transportierte Pädagogik kon-<br />
servative Mädchen- und Frauenbilder. Dies<br />
realisierte sich einerseits in einseitigen The-<br />
menangeboten, die Mädchen auf ihre zukünf-<br />
tige Hausfrauen- und Mutterrolle vorbereiteten<br />
und andererseits in einem rigiden Umgang mit<br />
weiblicher Sexualität. Die zweite Strategie des<br />
Umgangs mit Mädchen war ihre Nichtbeach-<br />
tung durch ihre unreflektierte Subsumierung<br />
unter die Gruppe der „Kinder und Jugendli-<br />
chen“.<br />
Mädchenbildungsarbeit<br />
Seit 1957 gab es in der BRD ein eigenständiges<br />
Angebot an Mädchen, das explizit als Mäd-<br />
chenangebot angelegt war. Insgesamt waren<br />
die Angebote der Jugendhilfe durch die Tren-<br />
nung der Geschlechter gekennzeichnet, was<br />
den moralischen Vorstellungen dieser Zeit ent-<br />
sprach. Doch führte der Bundesjugendplan als<br />
vom Bund finanziertes Förderinstrument der<br />
Jugendhilfe ein eigenständiges Programm der<br />
Mädchenbildung. Mädchenbildungsarbeit war<br />
das Pendant zur Jugendarbeit für Jungen und<br />
sollte sich vornehmlich an junge Arbeiterinnen<br />
richten. Ihnen sollten neben ihrer oftmals stu-<br />
piden Arbeit geistig anregende Betätigungen<br />
angeboten werden. Tatsächlich aber erreichten<br />
die Mädchenbildungsangebote in erster Linie<br />
junge Angestellte im Alter von 18 bis 24 Jah-<br />
ren. Sie fanden in Seminarform und in<br />
Mädchenclubheimen statt. Ihre Ziele beschrieb<br />
der erste Jugendbericht der Bundesregierung<br />
1965:<br />
„Mädchenbildung muss der weiblichen Jugend<br />
eine Zukunftsperspektive nahe bringen,<br />
die den häuslichen Lebenskreis in allen seinen<br />
erhöhten menschlichen und geistigen Ansprüchen<br />
sieht, die das Streben nach wirtschaftlicher<br />
Unabhängigkeit und beruflicher Leistung<br />
vernünftig beurteilt und die eine verbindliche<br />
Aussage darüber macht, wo, wann und wie<br />
lange den Familienaufgaben der Vorrang vor<br />
jeder anderen Anforderung gebührt.“ (Deutscher<br />
Bundestag 1965, S.85)<br />
Diese Form der einseitigen Mädchenbildungsarbeit<br />
geriet Ende der sechziger Jahre zunehmend<br />
in die Kritik, weil im Zuge des demokratischen<br />
Auf bruchs (außerparlamentarische<br />
Opposition, Studenten- und Frauenbewegung)<br />
auch die konservative Frauenrolle in die öffentliche<br />
Kritik geriet‘. Die Forderungen gingen bis<br />
hin zur Abschaffung dieser geschlechtshomogenen<br />
Form der Mädchenarbeit. Hier zeigten<br />
sich die Einflüsse einerseits der Frauenbewegung<br />
und andererseits der Debatte um die<br />
Einführung der Koedukation: Plädiert wurde<br />
für koedukative Angebote verbunden mit der<br />
Hofffiung, dadurch die konservative Ausrichtung<br />
der Mädchenbildungsarbeit auflösen zu<br />
können (Kentler 1966 und Bilden 1969).<br />
Fürsorgeerziehung<br />
Ebenso in die Kritik geriet Ende der sechziger<br />
Jahren die Fürsorgeerziehung für Mädchen.<br />
Die Heimkampagne im Rahmen der Außerparlamentarischen<br />
Opposition brachte menschenverachtende<br />
Zustände in deutschen Fürsorgeheimen<br />
zutage. Mädchenheime kamen<br />
nur vereinzelt in den Blick, aber wenn, dann<br />
wurden dramatische Lebensbedingungen<br />
der Mädchen deutlich: sie erhielten weder<br />
Schul- noch Ausbildung, wurden als billige Arbeitskräfte<br />
missbraucht, waren nicht über ihre<br />
Rechte informiert und unterlagen mangelnder<br />
medizinischer Versorgung und Gewalt.<br />
„Mädchen im Heim bekommen keine Ausbildung.<br />
Sie arbeiten für 20 Pfennig die Stunde in<br />
der Wäscherei, in der Heißmangel, in der Küche,<br />
im Garten, in der Nähstube. Industriearbeit im<br />
Heim besteht aus Tüten kleben, Lampenschirmen<br />
montieren, Besteckkästen mit Seidenstoff<br />
füttern, Puppen anziehen — idiotisierende,<br />
ungelernte Industriearbeit. Nicht einmal für<br />
den Haushalt werden sie ausgebildet im Heim:<br />
Nähte von Weißwäsche rauf und runter nähen,<br />
Nähte von Brauereischürzen, Laken heiß mangeln,<br />
den Hof fegen — davon lernt man nicht<br />
Wirtschaftsgeld einteilen, einkaufen, kochen.“<br />
(Meinhof 1971, S.9-10)<br />
Und während Jungen wegen krimineller Delikte<br />
oder aggressivem Verhalten der Fürsorgeerziehung<br />
zugeführt wurden, war es bei<br />
den Mädchen — und das ist ein dramatischer<br />
Unterschied zu den Jungen, der auf die gesellschaftliche<br />
Position und Rolle von Frauen<br />
in den sechziger Jahren verweist — ihr Sexualverhalten:<br />
HWG (häufig wechselnder Geschlechtsverkehr)<br />
war bei den Mädchen der<br />
häufigste Grund, sie in geschlossene Heime<br />
wegzusperren.<br />
‘Insbesondere in der „Deutschen Jugend“ wurden<br />
zwischen 1963 und 1969 umfassende Debatten<br />
darüber geführt, wie Mädchenbildungsarbeit<br />
an die sich verändernden gesellschaftlichen<br />
Verhältnisse angepasst und sie dem neuen<br />
Frauenbild gerecht werden könnte. Geführt<br />
wurde eine programminterne Debatte, die auf<br />
Veränderungen bezüglich der Zielgruppen, der<br />
Ziele und des gesellschaftlichen Frauenbildes<br />
abzielten und eine, die den Sinn der Mädchenbildungsarbeit<br />
im Kontext gesellschaftlicher<br />
Entwicklungen und politischer Zielsetzungen<br />
reflektierte.<br />
Ulrike Meinhof, die Journalistin, die 1970 in den<br />
Untergrund ging und sich der Roten Armee<br />
Fraktion anschloss, schrieb in ihrem Buch<br />
„Bambule“ 2 über die Einweisungsgründe von<br />
Mädchen:<br />
„In den Akten steht: sexuell haltlos, Herumtreiberei,<br />
Unzucht gegen Entgelt, Arbeitsplatzwechsel.<br />
Oder: Verkehrt mit Ausländern, trägt<br />
Miiröcke. Oder: renitent, aufsässig, verlogen.“<br />
(Meinhof 1971, S.10)<br />
An den Beispielen der Mädchenbildung und<br />
der Fürsorgeerziehung wird deutlich, dass Jugendhilfe<br />
in den sechziger Jahren aktive Beiträge<br />
zum Erhalt der weiblichen Rolle in Sinne<br />
der züchtigen, asexuellen, sorgenden Hausfrau<br />
und Mutter beisteuerte, gerade dort, wo es<br />
geschlechtshomogene Angebote für Mädchen historische<br />
und junge Frauen gab.<br />
Arbeitermädchenarbeit<br />
Erste Aufbrüche aus dieser einseitigen Sozi-<br />
alisation von Mädchen brachte die Jugend-<br />
zentrumsbewegung mit sich: sie war Teil<br />
der Außerparlamentarischen Opposition und<br />
zunächst getragen von GymnasiastInnen und<br />
StudentInnen, die aus der antiautoritären Be-<br />
wegung heraus Möglichkeiten der Freizeitge-<br />
staltung und der politischen Agitation suchten,<br />
die nicht repressiv und nicht fremdbestimmt<br />
sein sollten (Diemer u. a. 1973, S. 10) Die aus<br />
den Initiativen entstehenden selbstverwal-<br />
teten Jugendzentren hatten schnell mit dem<br />
Problem zu kämpfen, dass die BesucherInnen<br />
aus der Arbeiterschicht deutlich andere Be-<br />
dürfnisse der Freizeitgestaltung zeigten als die<br />
Mittelschichtsjugendlichen. Während letztere<br />
politisch arbeiten wollten, beanspruchten die<br />
Arbeiterjugendlichen Raum zur Erholung und<br />
zum Abschalten, was zu häufigen Konflikten<br />
innerhalb der Häuser führte. Die politisierten<br />
jungen Frauen sahen in der Verbindung von<br />
Klassenkampf und Frauenemanzipation die<br />
Mädchen aus Arbeiterfamilien, die die Jugend-<br />
zentren besuchten, als neue Zielgruppe der<br />
politischen Agitation: als zur Arbeiterklasse<br />
Gehörende im Kapitalismus und als Frauen im<br />
Patriarchat sahen sie diese Mädchen als dop-<br />
pelt marginalisierte und unterdrückte gesell-<br />
schaftliche Gruppe an, die es zu befreien und<br />
zu mobilisieren galt. Sozialistisch-feministische<br />
Konzepte sollten im Arbeitermädchenansatz in<br />
reinen Mädchengruppen das Bewusstsein der<br />
Mädchen für ihre unterdrückte gesellschaftli-<br />
che Position wecken und mit ihnen Möglichkei-<br />
ten der Veränderung erarbeiten.<br />
Der Arbeitermädchenansatz war der erste Ver-<br />
such, eine bestimmte Gruppe von Mädchen in<br />
ihrem unterdrückten gesellschaftlichen Status<br />
wahrzunehmen und mit pädagogischen Ange-<br />
boten zur Befreiung und Optioneneröfthung für<br />
diese Mädchen und jungen Frauen beizutra-<br />
gen. Der Ansatz scheiterte Anfang der siebzi-<br />
ger Jahre, weil er zu deterministisch ‚ zu global<br />
und zu wenig übersetzt auf den Alltag der Mäd-<br />
chen war und die Mädchen sich entsprechend<br />
verweigerten. Helga Bilden kritisierte Anfang<br />
der siebziger Jahre den Arbeitermädchenan-<br />
satz, weil Mädchen lediglich auf der Wahrneh-<br />
mungsebene ihres Verhaltens begegnet wür-<br />
54 . Nr.63 . SIT<br />
SIT . Nr.63 . 55<br />
historische und aktuelle diskurse
de, ohne die sozioökonomischen Beweggründe<br />
ihres Handelns zu erkennen (Bilden 1973, 5.82).<br />
Neben den politischen Gründen gab es auch<br />
alltagspraktische, sich der Gruppe der soge-<br />
nannten Arbeitermädchen 3 zu beschäftigen:<br />
Der Freiraum der selbstorganisierten Zentren<br />
in Zeiten der sexuellen Revolution führte of-<br />
fenbar zu immer wiederkehrenden sexuellen<br />
Über- und Angriffen von Jungen auf Mädchen.<br />
Die Mädchengruppen waren auch ein Versuch,<br />
Mädchen zu weniger „animierenden“ Verhal-<br />
tensweisen und Bekleidung zu bewegen, um<br />
diesen Übergriffen zu begegnen. Auch hier<br />
zeigte sich wieder das alte Bild sexueller Rol-<br />
lenverteilung: Nicht mit den aggressiven<br />
diskursede, ohne diskurseihres Handelns historische und aktuelle diskurse<br />
2 „Bambule“ war die Veröffentlichung des<br />
Drehbuchs eines Films, den Ulrike Meinhof<br />
1970 über die Zustände<br />
in westdeutschen Mädchenheimen drehte.<br />
Sogenannt deshalb, weil die Mädchen nicht<br />
selbst Arbeiterinnen waren, sondern aus Ar-<br />
beiterfamilien stammten und damit über ihre<br />
Herkunftsfamilien definiert wurden.<br />
Jungen wurde gearbeitet an ihrer Aggression,<br />
sondern mit den Opfern, den Mädchen, daran,<br />
durch ein verändertes Verhalten das Problem<br />
zu lösen (Jödicke 1975, S.20). Deutlich wird,<br />
dass der Umgang mit Mädchen in der sozialen<br />
Arbeit immer dem aktuellen gesellschaftlichen<br />
Status von Frauen und gesellschaftspolitischen<br />
Entwicklungen entsprach:<br />
- die Hausfrauen- und Mutterorientierung<br />
nebst der Sexualitätsreglementierung<br />
in den biederen fünfziger und sechziger<br />
Jahren und<br />
- der sozialistisch-feministische Aufbruch<br />
in Folge der Studenten- und Frauenbewegung.<br />
Feministische Mädchenarbeit<br />
1973/74 begann dann die Ära des Ansatzes<br />
von Mädchenarbeit, der sich bis heute in der<br />
Jugendhilfe durchgesetzt hat: die feministische<br />
und parteiliche Mädchenarbeit. Sie war von<br />
Anbeginn eine Provokation für die und in der<br />
Jugendhilfe:<br />
- Anfang der siebziger Jahre hatte sich<br />
gerade die Koedukation in der Jugendhilfe<br />
durchgesetzt, da forderte die feministische<br />
Mädchenarbeit die Rückkehr<br />
zur Geschlechtshomogenität.<br />
- Feministische Mädchenarbeit berief<br />
sich auf eine umfassende Kritik an der<br />
Jugendhilfe und insbesondere an der<br />
Jugendarbeit. Sie wurde als jungenund<br />
mannerlastig analysiert und damit<br />
als staatliches System, das die Hälfte<br />
ihrer Klientel durch Nichtbeachtung<br />
ausschloss.<br />
- Feministische Mädchenarbeit definierte<br />
sich als notwendige Kombination aus<br />
Pädagogik und Gesellschaftspolitik: individuelle<br />
Hilfe und Unterstützung für<br />
Mädchen sei nur sinnvoll in einem patriarchalen<br />
Gesellschaftssystem, wenn<br />
gleichzeitig das System selbst bekämpft<br />
würde. Feministische Mädchenarbeit<br />
wollte Mädchen individuell stärken und<br />
gleichzeitig Gleichberechtigung erreichen<br />
durch die Abschaffung des Patriarchats.<br />
Mädchenarbeit definierte sich als<br />
politische Pädagogik, was deutlich nicht<br />
dem allgemeinen Selbstverständnis der<br />
Jugendhilfe entsprach.<br />
- Feministische Mädchenarbeit agierte<br />
mit einem Mädchen- und Frauenbild,<br />
das seit Ende der sechziger Jahre in der<br />
Frauenbewegung entwickelt worden<br />
war und über die massive öffentliche<br />
Wahrnehmung der Frauenbewegung<br />
und ihrer Forderungen öffentlich diskutiert<br />
wurde aber das noch weit davon<br />
entfernt war, allgemein gültiges Frauenbild<br />
zu sein: Die Frau als Mensch mit<br />
den gleichen Rechten auf Bildung, Ausbildung<br />
und Erwerbsarbeit, auf eigene<br />
Sexualität, auf wirtschaftliche Unabhängigkeit<br />
und Selbstbestimmung über<br />
Körper und Lebensplanung, das war<br />
nicht das Mädchen- und Frauenbild der<br />
frühen siebziger Jahre und auch nicht<br />
das der Jugendhilfe.<br />
Feministische Mädchenarbeit kritisierte also<br />
Jugendhilfe grundsätzlich als männerlastig,<br />
lehnte ihre Modernisierung durch die Einführung<br />
der Koedukation als ebenso männerlastig<br />
ab, forderte eine eindeutige Politisierung der<br />
Pädagogik und agierte mit einem revolutionären<br />
Mädchen-, Frauen- und Gesellschaftsbild<br />
(Savier 1980a, 1980b, Savier/Wildt 1977 und<br />
1978). Feministische Mädchenarbeit war damit<br />
Provokation der Jugendhilfe und gleichzeitig<br />
Teil einer gesellschaftlichen Revolution, der<br />
Frauenbewegung.<br />
Das Frauenbild der sechziger und frühen<br />
siebziger Jahre<br />
Denn die Zeit der Entstehung feministischer<br />
Mädchenarbeit Anfang der siebziger Jahre<br />
war eine Zeit gesellschaftlichen Umbruchs<br />
und damit des Nebeneinanders alter und neuer<br />
Wertvorstellungen. Während Frauen zu Tausenden<br />
auf die Straße gingen und für ihr Recht<br />
auf Abtreibung, für Freiheit und Gleichberechtigung<br />
kämpften, sprachen deutsches Recht<br />
und Volkes Stimme deutlich Anderes: Frauen<br />
waren tatsächlich meilenweit von der Gleichberechtigung<br />
entfernt. Trotz des Artikels 3 im<br />
Grundgesetz, der Männer und Frauen seit 1949<br />
als gleichberechtigt deklarierte, vollzog sich<br />
Gleichberechtigung lediglich im<br />
Rahmen der zugeordneten gesellschaftlichen<br />
Rollen. Noch bis weit in die sechziger Jahre<br />
wurde davon ausgegangen, dass die Rollenverteilung<br />
zwischen den Geschlechtern biologisch<br />
vorgegeben und damit nicht veränderbar<br />
ist. Der erste Frauenbericht der Bundesregierung<br />
1966 zog dann unter Verweis auf Simone<br />
de Beauvoir erstmalig in Erwägung, dass diese<br />
Auffassung diskussionswürdig sei:<br />
„Erst in neuerer Zeit wurde die Auffassung<br />
vertreten, dass das Leitbild der Frau nicht<br />
etwas von vornherein Gegebenes, sondern<br />
etwas historisch Gewordenes sei (...); außer<br />
durch die Eigenschaften und Fähigkeiten der<br />
Frau werde die Vorstellung von der Frau vor<br />
allem durch die Erwartung geprägt, welche<br />
die Gesellschaft jeweils an sie stelle. Nach dieser<br />
Auffassung ist das Bild der Frau in einem<br />
bestimmten zentralen, insbesondere mütterlichen<br />
Bereich zwar ein für allemal festgelegt, im<br />
übrigen aber Wandlungen zugänglich.“ (Deutscher<br />
Bundestag<br />
1966, S.9)<br />
Die Frau sei, so der Frauenbericht weiter,<br />
nach ihrer körperlichen und geistig-seelischen<br />
Beschaffenheit auf die Mutterschaft hin ausgelegt.<br />
Erwerbstätigkeit sei nur dann akzeptierbar,<br />
wenn sie mit den Kindererziehungsund<br />
Haushaltsaufgaben vereinbar sei und für<br />
Mütter von Kleinkindern generell abzulehnen.<br />
Die in den sechziger Jahren katastrophale Bildungssituation<br />
von Mädchen insbesondere aus<br />
der Arbeiterklasse wurde durch ihren Bildungs-<br />
Bildungs-historische unwillen begründet und damit individualisiert.<br />
Dieses Frauenbild manifestierte sich auch in<br />
den bundesrepublikanischen Gesetzen. Bis zur<br />
Änderung des Familienrechts 1977 galt:<br />
„Die Frau führt den Haushalt in eigener Ver-<br />
antwortung. Sie ist berechtigt, erwerbstätig zu<br />
sein, soweit dies mit ihren Pflichten in Ehe und<br />
Familie vereinbar ist.“ (BGB § 1356 von 1957)<br />
Die Frau war demnach eine verheiratete Frau,<br />
etwas Anderes sah das Gesetz nicht vor. Und<br />
sie war zur Haushaltsführung und Kinderer-<br />
ziehung verpflichtet und zur Erwerbstätigkeit<br />
nur eingeschränkt berechtigt. Verpflichtet zur<br />
Erwerbsarbeit hingegen war sie, wenn die Ar-<br />
beitskraft oder die Einkünfte des Mannes nicht<br />
ausreichten.<br />
Bis 1970 legte das Bürgerliche Gesetzbuch<br />
fest, dass unverheirateten Frauen als Strafe<br />
dafür, dass sie Teilnehmerin einer unsittlichen<br />
Handlung waren, die elterliche Gewalt über ihr<br />
unehelich geborenes Kind zunächst generell<br />
entzogen und später nur in Ausnahmefällen<br />
zugebilligt wurde.<br />
Abtreibung war bis 1974 generell verboten,<br />
und erst mit Änderung des Familiengesetzes<br />
1977 erhielten beide EhepartnerInnen das<br />
Recht auf Erwerbstätigkeit. Ebenfalls bis 1977<br />
galt das Schuldprinzip im Rahmen des Schei-<br />
dungsrechts. Demnach hatte die/der schuld-<br />
haft geschiedene PartnerIn keinen Anspruch<br />
auf Unterhalt, und das Sorgerecht wurde in<br />
der Regel der/dem „Unschuldigen“ zugespro-<br />
chen. Diese Regelung traf insbesondere nicht<br />
erwerbstätige Frauen.<br />
Entstehung feministischer Mädchenarbeit<br />
Das Konzept feministischer Mädchenarbeit<br />
wurde von Sozialarbeiterinnen in der ersten<br />
Hälfte der siebziger Jahre entwickelt. Beein-<br />
flusst von den Analysen der Frauenbewegung<br />
zur gesellschaftlichen Situation von Frauen<br />
reflektierten sie ihren eigenen Arbeitsalltag<br />
insbesondere in Einrichtungen der offenen Ju-<br />
gendarbeit und kamen zu dem Schluss, dass<br />
die patriarchalen Gesellschaftsverhältnisse<br />
sich auch in der sozialen Arbeit wiederfinden<br />
und auch hier zu bekämpfen seien. Dabei lag<br />
der Fokus zunächst auf den eigenen Arbeits-<br />
bedingungen als Sozialarbeitemnnen im Ver-<br />
56 . Nr.63 . SIT<br />
SIT . Nr.63 . 57<br />
historische und aktuelle diskurse
hältnis zu den männlichen Kollegen und den<br />
Besuchern.<br />
Anders als in anderen europäischen Ländern<br />
hatte sich in der deutschen Frauenbewegung<br />
schnell die radikalfeministische Strömung in<br />
der Frauenbewegung durchgesetzt, die die<br />
Separierung des Frauenthemas und der Frauen<br />
vom allgemeinpolitischen Kampf um die Ab-<br />
schaffung des Kapitalismus propagierte und<br />
sich im Wesentlichen auf die Entwicklung von<br />
Frauenkultur und Frauenidentität festlegte.<br />
Grund dafür war, dass der in der Studenten-<br />
bewegung geführte antikapitalistische Kampf<br />
die Abschaffung des Patriarchats lediglich als<br />
einen Nebenwiderspruch gelten lassen wollte<br />
und davon ausging, dass in einem sozialisti-<br />
schen Staat die Gleichberechtigung der Ge-<br />
schlechter sich „von allein“ einstellen würde.<br />
Dieser Glauben fehlte den Frauen nach jahre-<br />
langen Erfahrungen mit ihren studentischen<br />
Kollegen in der gemeinsamen politischen Ar-<br />
beit.<br />
- Eigene Räume für Mädchen,<br />
- Geschlechtshomogenität der Angebote,<br />
- Ausschließlich Frauen in der Mädchenarbeit<br />
und<br />
- Die Abschaffung des Patriarchats<br />
diskursehältnis zu historische und aktuelle diskurse<br />
waren und sind bis heute die dem Radikalfemi-<br />
nismus geschuldeten Eckpfeiler feministischer<br />
Mädchenarbeit.<br />
Die siebziger Jahre<br />
In den siebziger Jahren wurden insbesondere<br />
in der Jugendarbeit aber auch in der Jugend-<br />
bildungsarbeit und in sozialen Trainingskursen<br />
die ersten Ansätze feministischer Mädchenar-<br />
beit entwickelt und erprobt. Mädchengruppen<br />
und —angebote wurden in koedukativen Ein-<br />
richtungen installiert, oftmals gegen den Wi-<br />
derstand von Kollegen und Besuchern. Wegen<br />
des Widerstands und mangelnder Unterstüt-<br />
zung und aus der radikalfemiistischen Einsicht<br />
heraus, dass Mädchenarbeit in gemischtge-<br />
schlechtlichen Arbeitszusammenhängen und<br />
Trägerstrukturen nicht möglich sei, gründeten<br />
Frauen erste autonom feministische Träger<br />
und richteten hier, außerhalb der Jugendhil-<br />
festrukturen, Angebote für Mädchen ein. Diese<br />
autonomen Strukturen boten die Möglichkeit,<br />
fern der Vorgaben und Reglementierungen des<br />
Jugendhilfesystems Angebote für Mädchen<br />
entlang ihren Lebenslagen, Bedürfnissen und<br />
Problemen zu entwickeln. Die Freiheit des autonomen<br />
Raums, den die Sozialarbeiterinnen<br />
mit Ehrenamtlichkeit und befristeten Arbeitsplätzen<br />
bezahlten, eröfthete Möglichkeiten,<br />
Ansätze von Mädchenarbeit zu entwickeln, die<br />
direkt an ihren Lebensbedingungen ansetzten.<br />
Innerhalb der Jugendhilfestrukturen wäre dies<br />
so nicht möglich gewesen.<br />
Die achtziger Jahre<br />
In den achtziger Jahren differenzierte femiistische<br />
Mädchenarbeit sich aus: innerhalb der<br />
Jugendhilfe wurde versucht, adäquate Angebote<br />
für Mädchen auf- und auszubauen und<br />
dabei<br />
auch die in der autonomen Mädchenarbeit entwickelten<br />
Themen und Ansätze aufzugreifen.<br />
Innerhalb der autonomen Mädchenarbeit wurden<br />
Konzepte entwickelt in den<br />
Themenbereichen<br />
- sexuelle Gewalt und Gewalt gegen<br />
Mädchen<br />
- Gesundheit<br />
- Sexualität und Körper<br />
- Bewegung und Raumaneignung<br />
- Kultur<br />
- Freizeit.<br />
Aber auch für spezielle Gruppen von Mädchen<br />
wurden Konzepte erarbeitet, so für lesbische<br />
Mädchen, für Migrantmnnen (wobei sich dies<br />
auf muslimische Türkinnen beschränkte) und<br />
Mädchen mit Behinderungen.<br />
Da im autonomen Bereich das Konzept der feministischen<br />
Mädchenarbeit so definiert wurde,<br />
dass dazu auch feministische Trägerstrukturen<br />
gehörten, bezeichneten die Frauen in der<br />
Jugendhilfe ihre Arbeit zunehmend als parteiliche<br />
Mädchenarbeit. Diese beinhaltete die<br />
gleichen Ziele wie die feministische Mädchenarbeit,<br />
war aber auch in koedukativen Zusammenhängen<br />
möglich.<br />
Gestützt wurde der Ausbau der Mädchenarbeit<br />
in den achtziger Jahren durch den sechsten<br />
Jugendbericht der Bundesregierung 1984<br />
zur Situation von Mädchen in der Bundesrepublik<br />
Deutschland. Er wies die strukturellen<br />
Benachteiligungen von Mädchen sowohl<br />
gesamtgesellschaftlich als auch im Rahmen<br />
der Jugendhilfe nach und forderte u.a. die flächendeckende<br />
Einführung von Mädchenarbeit<br />
in der Jugendhilfe und eine generelle Kehrtwende<br />
in der Jugendhilfe zugunsten einer<br />
geschlechterdifferenzierten Pädagogik. Mit<br />
dem sechsten Jugendbericht hatten die Mädchenarbeitemnnen,<br />
wie die Pädagoginnen sich<br />
selbst nannten, erstmals ein wissenschaftliches<br />
Unterstützungsinstrument in der Hand,<br />
mit dem sie ihre Forderungen nach Mädchenarbeit<br />
untermauern konnten.<br />
Die neunziger Jahre<br />
Die neunziger Jahre brachten zwei Ereignisse<br />
hervor, die die Mädchenarbeit stark beeinflussten:<br />
Die Wiedervereinigung der beiden<br />
deutschen Staaten und die Einführung des<br />
Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG)<br />
1990/91. Die Neunziger waren das Jahrzehnt<br />
struktureller Verankerung von Mädchenarbeit<br />
in der Jugendhilfe und gleichzeitig die Zeit<br />
des Aufbaus von Mädchenarbeit in den neuen<br />
Bundesländern, da die Koedukation in der DDR<br />
generelles Erziehungsprinzip war.<br />
Nach 25 Jahren Debatte erhielt die Jugendhilfe<br />
nun also eine neue gesetzliche Grundlage.<br />
Mädchenarbeit war bis dato maximal geduldet<br />
in der Jugendhilfe. Mit dem KJHG kam nun<br />
eine gesetzliche Verpflichtung, alle Angebote<br />
und Leistungen der gesamten Jugendhilfe so<br />
zu gestalten, dass die unterschiedlichen Lebenslagen<br />
von Mädchen und Jungen berücksichtigt<br />
werden, Benachteiligungen abgebaut<br />
und die Gleichberechtigung der Geschlechter<br />
gefördert wird (~ 9,3 KJHG). Waren die achtziger<br />
Jahre geprägt von der konzeptionellen<br />
Entwicklung und dem Ausbau der Praxis, so<br />
kennzeichneten Anstrengungen um die strukturelle<br />
Verankerung von Mädchenarbeit in der<br />
Jugendhilfe die Entwicklung der Mädchenarbeit<br />
in den neunziger Jahren. Dabei stellt sich<br />
die Situation in den alten und neuen Bundesländern<br />
gänzlich unterschiedlich dar: Während<br />
in den alten Bundesländern die neue Aufgabe<br />
der geschlechterdifferenzierten Pädagogik<br />
in der Jugendhilfe auf die Frauenbewegung<br />
und 16 Jahre Auf- und Ausbau feministischer<br />
Mädchenarbeit zurückgreifen konnte, Personal-<br />
und Angebotsstrukturen sowie Konzepte<br />
vorhanden waren, ereilte die neu aufzubauende<br />
Jugendhilfe in den neuen Bundesländern<br />
mit ihrer Koedukationshistorie die Anforderung<br />
als gesetzliche Vorgabe ohne irgend eine Vorerfahrung.<br />
Hinzu kam, dass in den neuen Bundesländern<br />
große Teile der Jugendhilfe über ar-<br />
beitsmarktpolitische Maßnahmen eingerichtet historische wurden, was bedeutete, dass viele Kräfte über<br />
keine oder nur geringe pädagogische Ausbil-<br />
dungen verfügten und schon gar keine Erfah-<br />
rungen in der Mädchenarbeit besaßen.<br />
Auf der Grundlage dieser unterschiedlichen<br />
Voraussetzungen in den alten und neuen Bun-<br />
desländern waren die neunziger Jahre in der<br />
Mädchenarbeit gekennzeichnet von Anstren-<br />
gungen der strukturellen Verankerung in der<br />
Jugendhilfe. Mädchenarbeit entwickelte mit<br />
dem Gesetz im Rücken vielfältige Instrumente,<br />
die die Angebote und Einrichtungen zu Re-<br />
gelangeboten der Jugendhilfe werden lassen<br />
sollten:<br />
- mädchengerechte Konzepte der Jugend-<br />
hilfeplanung,<br />
- Leitlinien zur Mädchenarbeit<br />
- MädchenfiSrderpläne<br />
- Arbeitsgemeinschaften zur Mädchenar-<br />
beit gemäß § 78 KJHG<br />
- Arbeitskreise zur Mädchenarbeit<br />
- Sitz und Stimme für die Mädchenarbeit<br />
in Jugendhilfeausschüssen<br />
- Mitarbeit in Jugendhilfegremien<br />
- Gründung von Landesarbeitsgemein-<br />
schaften der Mädchenarbeit<br />
- Gründung der Bundesarbeitsgemein-<br />
schaft Mädchenpolitik<br />
waren solche Instrumente, die mit großen<br />
Anstrengungen und gegen oftmals erhebli-<br />
che Widerstände durchgesetzt wurden, und<br />
der Mädchenarbeit fortan einen gesicherte-<br />
ren Status verlieh. Ziel war, die bestehenden<br />
Angebote der Mädchenarbeit konzeptionell,<br />
finanziell und personell zu sichern und alle Ju-<br />
gendhilfeangebote mädchengerecht weiter zu<br />
entwickeln.<br />
Mädchenarbeit im neuen Jahrtausend<br />
Dreizehn Jahre nach Einführung des KJHG<br />
kann nicht die Rede davon sein, dass die Vor-<br />
gabe des § 9,3 in der Jugendhilfe umgesetzt<br />
wäre. Die strukturelle Verankerung von Mäd-<br />
chenarbeit ist immer noch eine Arbeit gegen<br />
Widerstände, ist immer noch Provokation. Ein-<br />
ziger Motor ist die Mädchenarbeit selbst, und<br />
Jugendhilfe bewegt sich nur an den Stellen auf<br />
Mädchen zu, an denen sie von der Mädchen-<br />
arbeit unter öffentlichen Druck gesetzt werden<br />
kann. Trotzdem haben die Bemühungen der<br />
Mädchenarbeit Erfolg gezeigt: Mädchenarbeit<br />
58 . Nr.63 . SIT<br />
SIT . Nr.63 . 59<br />
historische und aktuelle diskurse
ist zwar keine Selbstverständlichkeit, aber auch<br />
nicht mehr wegzudenken aus der Jugendhilfe.<br />
Zumindest theoretisch ist sie anerkannt als<br />
Notwendigkeit. In einigen Leistungsbereichen,<br />
insbesondere in denen, in denen Mädchenar-<br />
beit entstand, gehört sie heute zum Angebot<br />
vieler Einrichtungen: Jugendzentren verfügen<br />
in der Regel über Mädchenräume oder Mäd-<br />
chentage. Aber auch in anderen Leistungsbe-<br />
reichen wie der Jugendsozialarbeit, der Inob-<br />
hutnahme und den erzieherischen Hilfen gibt<br />
es inzwischen Angebote der Mädchenarbeit.<br />
Gemeinsam ist allen, dass Mädchenarbeit in<br />
der Regel nicht strukturell sondern personell<br />
verankert ist. D. h., dort, wo engagierte Frauen<br />
Mädchenarbeit durchsetzen und anbieten, gibt<br />
es sie. Gehen die Frauen, geht die Mädchen-<br />
arbeit mit, weil sie nicht in den Konzeptionen<br />
der Träger und Einrichtungen verankert ist und<br />
weil sich außer den Mädchenarbeitermnnen<br />
Niemand verantwortlich fühlt.<br />
Die ehemals autonomen Projekte feministi-<br />
scher Mädchenarbeit der achtziger Jahre sind<br />
entweder zu Regelangeboten der Jugendhilfe<br />
geworden (insbesondere die Mädchenhäu-<br />
ser) oder mangels finanzieller Möglichkeiten<br />
geschlossen worden. Somit konzentriert sich<br />
Mädchenarbeit heute im Wesentlichen auf die<br />
Jugendhilfe und ist damit wieder in den Schoß<br />
zurück gekehrt, aus dem sie in den Siebzigern<br />
aufhrach. Diese Rückkehr war und ist mit Rei-<br />
bungsverlusten verbunden: zu verzeichnen ist<br />
ein Verlust gesellschaftspolitischer Ansprüche<br />
zu Gunsten politischer Arbeit innerhalb der<br />
Jugendhilfe. Ebenso konstatiert werden muss<br />
eine Qualitätsverschiebung respektive ein<br />
Qualitätsverlust: Mit den Bemühungen um die<br />
strukturelle Verankerung von Mädchenairbeit<br />
in der Jugendhilfe und dem Sterben der auto-<br />
nomen Projekte verschwand der feministische<br />
Anspruch der Mädchenarbeit zusehends und<br />
wurde durch die Parteilichkeit als Merkmalsbe-<br />
schreibung ersetzt. Aber auch die parteiliche<br />
Mädchenarbeit verschwindet seit einigen Jah-<br />
ren als Begriff. Übrig bleibt „Mädchenarbeit“,<br />
die ohne die Spezifizierungen als feministisch<br />
oder parteilich alles, was mit Mädchen getan<br />
wird, zu Mädchenarbeit deklarieren lässt. In<br />
neuerer Zeit wird sogar der Begriff der Mäd-<br />
chenarbeit zunehmend durch den Begriff der<br />
geschlechtsspezifischen Arbeit mit Mädchen<br />
ersetzt. Mit diesen Begriffsänderungen sind<br />
diskurseist zwar historische und aktuelle diskurse<br />
deutliche Einbußen der Ziele und Inhalte verbunden.<br />
Mädchenarbeit heute ist ein eigenständiges<br />
System im System der Jugendhilfe. Dieser Fakt<br />
ist einerseits dem Widerstand der Jugendhilfe<br />
und andererseits den radikalfeministischen<br />
Wurzeln feministischer Mädchenarbeit geschuldet.<br />
Aus Sicht der Mädchenarbeit wird<br />
dieser Status zwiespältig erlebt und beurteilt:<br />
einerseits ermöglicht er, Konzepte der Mädchenarbeit<br />
relativ autonom zu entwickeln,<br />
andererseits ist er ein wesentlicher Grund, warum<br />
Mädchenarbeit nicht zum Regelangebot<br />
der Jugendhilfe werden kann. Die Betonung<br />
des Besonderen macht es schwer, zur Normalität<br />
zu gehören, und dieses Dilemma ist bis<br />
heute nicht lösbar.<br />
Mädchenarbeit in der Kritik<br />
Und während Mädchenarbeit noch mit der Rettung<br />
ihrer Grundsätze und ihrer strukturellen<br />
Verankerung in der Jugendhilfe beschäftigt ist<br />
und Jugendhilfe ihren gesetzlichen Vorgaben<br />
in Bezug auf die Förderung der Gleichberechtigung<br />
noch nicht ausreichend nachkommt,<br />
werden seit einigen Jahren die Stimmen lauter,<br />
die Mädchenarbeit grundsätzlich in Frage stellen.<br />
Genährt werden diese Stimmen aus unterschiedlichen<br />
gesellschaftlichen, forscherischen<br />
und rechtlichen Entwicklungen jüngerer Zeit,<br />
die fehlinterpretiert darauf hinzudeuten scheinen,<br />
dass Mädchenarbeit nicht mehr notwendig<br />
oder sogar kontraproduktiv für die Gleichberechtigung<br />
von Mädchen und jungen Frauen<br />
wirkt. Als Argumente werden angeführt:<br />
- Mädchen heute sind starke, selbstbewusste<br />
Mädchen, die keine explizite<br />
Förderung mehr brauchen und wollen.<br />
Sie sind besser gebildet als Jungen,<br />
verfügen zusätzlich über mehr soziale<br />
Kompetenz und sind, abgesehen von<br />
wenigen Bereichen, heute gleichberechtigt.<br />
- Jungen haben große Schwierigkeiten<br />
mit ihrer klassischen Jungensozialisation<br />
in der modernen Gesellschaft. Ihre<br />
Fähigkeiten sind nicht mehr zeitgerecht,<br />
ihre Bildung ist nicht ausreichend und<br />
Selbstmord, stottern oder Bettnässen<br />
sind Symptome, die auf massive Schwierigkeiten<br />
hinweisen und bei Jungen<br />
erheblich öfter vorzufinden sind als bei<br />
Mädchen. Insofern brauchen nun Jungen<br />
die Aufmerksamkeit geschlechtsspezifischer<br />
Pädagogik.<br />
- Die moderne Frauenforschung beschäftigt<br />
sich mit dem Dekonstruktivismus<br />
als gesellschaftstheoretisches Konstrukt.<br />
Differenz- und gleichheitstheoretische<br />
Ansätze, die geschlechtshomogene<br />
Angebote für Mädchen begründeten,<br />
gelten heute als überholt. Insofern sind<br />
Angebote, die am Geschlecht als Zugang<br />
und Ausrichtung ansetzen, veraltet<br />
und führen eher zur Manifestation<br />
von Benachteiligungen als zu ihrer Aufhebung.<br />
- Gender Mainstreaming ist das kommende<br />
Instrument der Gleichberechtigungsförderung<br />
und macht Mädchenarbeit<br />
überflüssig.<br />
Diese Argumentationen haben Konjunktur,<br />
weil sie eingängig in ihrer Schlichtheit sind<br />
und weil sie all denen, die weiterhin unterschwellig<br />
oder offen Widerstand gegen Mädchenarbeit<br />
übten, Argumente an die Hand<br />
geben. Dass die sogenannten neuen Mädchen<br />
nicht reale Mädchen sind, sondern zunächst<br />
einmal medial hergestellte Bilder, an denen<br />
Mädchen sich orientieren, dass die Schwierigkeiten<br />
von Jungen nicht einhergehen mit einer<br />
Verbesserung der gesellschaftlichen Situation<br />
von Mädchen, sondern für sich als Problem zu<br />
lösen sind, dass die Frauenforschung immer<br />
wieder darauf verweist, dass theoretische Dekonstruktionskonzepte<br />
nicht einfach in Politik<br />
zu übersetzen sind und dass die Strategie des<br />
Gender Mainstreaming ausdrücklich als ergänzende<br />
Strategie zur bisherigen Mädchen-und<br />
Frauenpolitik verabschiedet wurde, scheint dabei<br />
nicht zu stören. Diese neuen Gegenstrategien<br />
gegen die Mädchenarbeit weisen deutlich<br />
darauf hin, dass das Patriarchat seine männlichen<br />
Machtpfründe auch weiterhin verteidigt<br />
und darauf, dass es richtig und notwendig ist,<br />
auch weiterhin strukturelle und reale Privilegien<br />
von Männern und Benachteiligungen von<br />
Frauen öffentlich zu benennen und Maßnahmen<br />
einzufordern.<br />
Perspektiven feministischer Mädchenarbeit<br />
Abgesehen davon, dass Mädchenarbeit ihre<br />
Konzepte und Angebote regelmäßig an<br />
gesellschaftliche Veränderungen anpassen<br />
60 . Nr.63 . SIT<br />
SIT . Nr.63 . 61<br />
muss, stehen für die kommenden Jahre we-<br />
sentliche<br />
we-historische Fragen und Aufgaben an, für die es Antworten<br />
und Lösungen zu finden gilt:<br />
- Gesellschaftliche<br />
Individualisierungs-<br />
und Pluralisierungstendenzen wirken<br />
sich auch auf die Lebensbedingungen<br />
von Mädchen aus. Immer weniger gibt<br />
es „die“ Mädchen, immer stärker diffe-<br />
renziert sich die „Gruppe“ der Mädchen<br />
aus. Für die Mädchenarbeit bedeutet<br />
dies den Abschied von Konzeptionen<br />
„für Mädchen“ und die<br />
Entwicklung zielgruppengenauer Kon-<br />
zepte, die immer wieder überprüft und<br />
modifiziert werden müssen. Neben dem<br />
Merkmal Geschlecht müssen andere<br />
wie die ethnische und religiöse Zuge-<br />
hörigkeit, die Familiensituation, der<br />
Bildungsstand oder das Lebensumfeld<br />
gleichermaßen in den Blick genommen<br />
werden, wenn Mädchenarbeit passge-<br />
nau Konzepte für Mädchen anbieten<br />
will.<br />
- Mädchenarbeit muss sich dem System<br />
der Jugendhilfe stärker öfTnen, ohne<br />
ihre Identität zu verlieren, will sie per-<br />
spektivisch zum Regelangebot werden.<br />
Das bedeutet, innerhalb der jeweiligen<br />
Einrichtung offensiv in Debatten um<br />
Konzepte von Mädchenarbeit zu gehen,<br />
mit allen Kolleginnen und Kollegen.<br />
Mädchenarbeit darf nicht länger die<br />
Aufgabe einzelner, sondern muss in die<br />
Verantwortung aller in einer Einrichtung<br />
gelegt werden. Wird sie dann um Jun-<br />
genarbeit ergänzt, ist dies zu begrüßen.<br />
Die gemeinsame Verantwortung für die<br />
Zielgruppe Mädchen kann aber auch<br />
übernommen werden, wenn es keine<br />
Jungenarbeitsangebote gibt.<br />
- Als eher „autonomes“ System im Sys-<br />
tem der Jugendhilfe brauchte Mädchen-<br />
arbeit sich nie mit den grundsätzlichen<br />
pädagogischen Fragen der Jugendhilfe<br />
zu beschäftigen und hat dies auch nicht<br />
getan. Debatten um die Funktionen von<br />
Jugendhilfe zwischen Strafe, Überwa-<br />
chung und Unterstützung liefen an der<br />
Mädchenarbeit vorbei. Mädchenarbeit<br />
hat sich immer als ausschließlich un-<br />
terstützend verstanden. Will sie zur<br />
historische und aktuelle diskurse
Die Geschichte der Mädchenarbeit im Wandel<br />
sozialer Arbeit ist eine Geschichte zweier Be-<br />
reiche, die eigentlich ineinander und mitein-<br />
ander existieren sollten, die aber, so zeigt die<br />
Geschichte, von zwei voneinander weitgehend<br />
unabhängigen Entwicklungen erzählt. Im Inte-<br />
historische und aktuelle diskurse<br />
Jugendhilfe gehören, kommt Mädchenarbeit<br />
aber nicht länger daran vorbei,<br />
sich auch mit den grundsätzlichen Fragen<br />
staatlicher Ziele von Jugendhilfe zu<br />
beschäftigen.<br />
- Gender Mainstreaming ist eine Strategie,<br />
die, wenn sie ernsthaft umgesetzt<br />
wird, die Gleichberechtigung der<br />
Geschlechter fördern kann. Damit sie<br />
sinnvoll installiert wird, ist das Wissen<br />
der Frauen- und Mädchenforschung<br />
notwendig und die Fachkompetenz der<br />
Mädchenarbeiterinnen. Mädchenarbeit<br />
muss sich in Gender Mainstreaming<br />
Prozesse aktiv einmischen und sie qualifizieren.<br />
Gleichzeitig braucht Mädchenarbeit<br />
eine eigenständige Debatte und<br />
Standortbestimmung darüber, wie die<br />
zukünftige Zusammenarbeit mit den<br />
zumeist männlichen Kollegen in Leitungspositionen<br />
aussehen kann, wenn<br />
diese zu überprüfen haben, ob Entscheidungen<br />
geschlechtergerecht sind oder<br />
nicht und welche Maßnahmen zu treffen<br />
sind, um Gleichberechtigung herzustellen.<br />
Hier verschiebt sich die Definitionsmacht,<br />
und Mädchenarbeit muss<br />
konkrete Umgangswege entwickeln.<br />
Wesentliche Privilegien von Männern liegen<br />
heute noch im Erwerbsarbeitssektor und<br />
in der Verteilung von Verantwortung für<br />
Familienaufgaben. Entsprechend verlagern<br />
sich Benachteiligungen für Mädchen<br />
auf das frühe Erwachsenenalter<br />
und realisieren sich auch wesentlich außerhalb<br />
von Feldern, die durch pädagogische<br />
Intervention bearbeitet werden<br />
können. Das bedeutet, dass das Feld der<br />
Jugendhilfe alleine für die Begleitung<br />
und Unterstützung von Mädchen und<br />
jungen Frauen zu eng ist. Mädchenarbeit<br />
muss stärker kooperieren lernen mit<br />
Arbeitsmarktpolitik, Familienpolitik, mit<br />
Arbeitgeberverbän-<br />
Gewerkschaften,<br />
den, Kammern etc.<br />
resse von Mädchen und jungen Frauen sollte<br />
sich das zukünftig ändern. Gender Mainstreaming<br />
in Verbindung mit dem Beharren auf der<br />
Notwendigkeit parteilicher und feministischer<br />
Mädchenarbeit könnte eine Perspektive sein,<br />
in Zukunft von der Geschichte einer mädchengerechten<br />
Jugendhilfe zu erzählen.<br />
Literatur:<br />
BILDEN; HELGA: Die Benachteiligung der<br />
Mädchen in der Jugendarbeit, in: DEUT-<br />
SCHE JUGEND 11/69, S.507-514<br />
BILDEN, HELGA: Die gesellschaftliche Lage<br />
lohnabhängiger Frauen und die Jugendarbeit<br />
mit weiblichen Jugendlichen. In:<br />
BOHNISCH, LOTHAR (Hrsg.): Jugendarbeit<br />
in der Diskussion. Pädagogische und<br />
politische Perspektiven. München 1973,<br />
S.69-83<br />
BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, SE-<br />
NIOREN, FRAUEN UND JUGEND: Kinder-und<br />
Jugendhilfegesetz (Achtes Buch<br />
Sozialgesetzbuch). 9. Auflage Bonn 1999<br />
DE BEAUVOJR, SIMONE: Das andere Geschlecht.<br />
Sitte und Sexus der Frau. Reinbek<br />
bei Hamburg 1968 (Erstveröffentlichung<br />
in deutscher Sprache 1951)<br />
DEUTSCHE JUGEND: Die Bildungsarbeit mit<br />
weiblichen Jugendlichen (ohne AutorIn).<br />
11/69, 5.515-520<br />
DEUTSCHER BUNDESTAG: Bericht der Bundesregierung<br />
über die Lage der Jugend<br />
und über die Bestrebungen auf dem Gebiet<br />
der Jugendhilfe. Drucksache IV/35<br />
15. Bonn 1965<br />
DEUTSCHER BUNDESTAG: Bericht der<br />
Bundesregierung über die Situation der<br />
Frauen in Beruf, Familie und Gesellschaft.<br />
Drucksache V/909. Bonn 1966<br />
DIEMER; ALVONS! KAPPELER, MANFRED!<br />
MUNZFELD; MAX! NOWICKI, MIChAEL!<br />
PUTZ; ROSA: „Wir wollen alles haben,<br />
wir wolln wir selber sein“ Zur politischen<br />
Bedeutung der Kämpfe um selbstverwaltete<br />
Jugendzentren, in: ERZIEHUNG UND<br />
KLASSENKAMPF 10-11/73, S.3-69<br />
FRIEBERTSHAUSER, BARBARA: Geschlechtertrennung<br />
als Innovation. Etappen<br />
geschlechtsbezogener Jugendarbeit im<br />
20. Jahrhundert, in: FRIEBERTSHAUSER,<br />
BARBARA! JAKOB, GISELA! KLEES-<br />
MÖLLER, RENATE (Hrsg.): Sozialpädagogik<br />
im Blick der Frauenforschung. Weinheim<br />
1997, S.113-135<br />
JAKOB, GISELA: Umbrüche in den Geschlechterverhältnissen<br />
und in der pädagogischen<br />
Arbeit — Mädchen- und Frauenarbeit<br />
in den neuen Bundesländern, in:<br />
FRIEBERTSHÄUSER, BARBARA! JAKOB,<br />
GISELA! KLEES-MOLLER, RENATE<br />
(Hrsg.): Sozialpädagogik im Blick der Frauenforschung.<br />
Weinheim 1997, S.136-155<br />
JÖDICKE; ALMUT: Arbeitemmädchen im<br />
Jugendzentrum. Arbeitsmaterialien Sozialarbeit!<br />
Sozialpädagogik Heft 2, Offenbach 1975<br />
KENTLER; HELMUT: Plädoyer gegen eine<br />
eigene Mädchenbildung, in: DEUTSCHE<br />
JUGEND 10/66, S.456-463<br />
ME1NHOF, ULRIKE MARIE: Bambule. Fürsorge<br />
— Sorge für wen? Berlin 1971<br />
S AC H V E R S T Ä N D I G E N KO M M I S S I O N<br />
SECHSTER JUGENDBERICHT (Hrsg):<br />
Alltag und Biographie von Mädchen; Bericht<br />
der Kommission: Verbesserung der<br />
Chancengleichheit von Mädchen in der<br />
Bundesrepublik Deutschland. Bonn 1984<br />
SAVIER, MONIKA: Mädchenarbeit: Donnerstags<br />
zwischen sechs und acht — das<br />
reicht uns nicht. In: BOHNISCH, LOTHAR!<br />
MUNCHMEIER, RICHARD! SANDER, EK-<br />
KEHARD (Hrsg.): Abhauen oder bleiben?<br />
Berichte und Analysen aus der Jugendarbeit.<br />
München<br />
1980 a, S.247-257<br />
SAVIER, MONIKA: Mädchen in der Jugendarbeit.<br />
Neue Ansätze einer emanzipatorischen<br />
Praxis. In<br />
MATERIALIEN ZUM FUNFTEN JUGENDBE-<br />
RICHT 5:<br />
Jugendarbeit - Mädchen in der Jugendarbeit<br />
— Gewerkschaftliche Jugendbildung.<br />
München 1980 b, 5.173 -211<br />
SAVIER, MONIKA! WILDT, CAROLA: Rockerbräute,<br />
Trebemnnen und Schulmädchen<br />
—zwischen Anpassung und Gegenwehr.<br />
Ein Beitrag über die Diskriminierung von<br />
Mädchen. In: KURSBUCH 47, 1977, S.161-<br />
173<br />
SAVIER, MONIKA! WILDT, CAROLA: Mädchen<br />
zwischen Anpassung und Widerstand.<br />
Neue Ansätze zur femiistischen<br />
Jugendarbeit. München 1978<br />
WALLER,, CLAUDIA: Das Kinder- und Ju-<br />
gendhilfegesetz und die Mädchenförde-<br />
rung, in:<br />
FRIEBERTSHAUSER, BARBARA! JAKOB,<br />
GISELA! KLEES-MÖLLER, RENATE(Hrsg.):<br />
Sozialpädagogik im Blick der Frauenfor-<br />
schung. Weinheim 1997, S.184-191<br />
WALLNER, CLAUDIA: Feministische Mäd-<br />
chenarbeit im Dilemma zwischen Diffe-<br />
renz und Integration, in:<br />
G1NTZEL, ULLRICH! SCHONE, REINHOLD<br />
(Hrsg.): Jahrbuch der sozialen Arbeit<br />
1997. Münster 1996, 5.208-223<br />
Dipl. Päd. Claudia Wallner<br />
Scheibenstrasse 102<br />
D-48153 Münster<br />
e-mail: clwallner@aol.com<br />
62 . Nr.63 . SIT<br />
SIT . Nr.63 . 63<br />
historische und aktuelle diskurse
Auf den ersten Blick erscheint die Frage nach<br />
sozialer Dienstleistung im Sozialstaat ein<br />
wenig trivial und wenig herausfordernd. Bei<br />
genauerem Hinsehen jedoch erweist es sich<br />
als ein höchst komplexes Thema. Dies hat vor<br />
allem damit zu tun, daß „die „ Gesellschaft<br />
und mit ihr die Rolle „des“ Staates und damit<br />
zugleich die Rolle des Sozialstaates zur Zeit be-<br />
trächtlichen Wandlungsprozessen unterliegen<br />
(Schaarschuch 2003).<br />
historische und aktuelle diskurse<br />
Andreas Schaarschuch<br />
Soziale Dienstleistung im Sozialstaat<br />
Häufig wird in der medialen Öffentlichkeit die<br />
Kategorie der ‚Globalisierung’ herangezogen,<br />
um diese Veränderungen zu kennzeichnen: die<br />
Globalisierung der Weltwirtschaft – also der<br />
internationalen Finanzströme, die zunehmende<br />
ökonomische und politische Macht transnatio-<br />
naler Unternehmen – so die These schränke die<br />
Handlungsspielräume der verschiedenen Nati-<br />
onalstaaten insbesondere im Hinblick auf die<br />
Höhe der Sozialleistungsquote erheblich ein.<br />
Daraus wird dann oft - aber fälschlicherweise<br />
- der Schluß gezogen, die regulative Macht und<br />
Funktion des Staates selber sei in Mitleiden-<br />
schaft gezogen. Es ist jedoch vielmehr davon<br />
auszugehen, daß sich die staatliche Regulati-<br />
onstätigkeit auf andere Bereiche verlagert und<br />
zudem einem Formwandel unterliegt. Dieser<br />
Wandlungsprozeß kann in regulationstheore-<br />
tischen Kategorie angemessen rekonstruiert<br />
und prägnant mithilfe englischsprachlicher<br />
Begriffe als der Übergang vom ‚welfare sta-<br />
te’ zum ‚workfare state’ (Jessop 1994; 2002)<br />
oder aber zum ‚nationalen Wettbewerbstaat’<br />
(Hirsch 1998; 2001) gekennzeichnet werden.<br />
Beide Konzeptionen gehen weitgehend von<br />
denselben Entwicklungen aus, setzen aber<br />
leicht unterschideliche Akzente: Während der<br />
‚nationale Wettbewerbstaat’ primär die Di-<br />
mension der Außenbeziehungen der verschie-<br />
denen Nationalstaaten zueinander bezeichnet,<br />
richtet sich die Bezeichnung ‚workfare state’<br />
primär auf die Binnendimension dieser Verän-<br />
derungen.<br />
Veränderungen der Wohlfahrtsstaatlichkeit<br />
Der Wohlfahrtsstaat klassischen Typs – und das<br />
heißt für alle westlichen Wohlfahrtsstaaten,<br />
insbesondere aber für den deutschen Wohlfahrtsstaat<br />
– ist gekennzeichnet durch eine<br />
Strategie der Sicherung der Vollbeschäftigung<br />
in relativ geschlossenen nationalen Ökonomien<br />
einerseits und andererseits durch die Organisierung<br />
korporativer ‚tripartistischer’ Formen<br />
gesellschaftlicher Steuerung. Hingegen sind<br />
die zentralen Kennzeichen des workfare State<br />
zum einen die Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit<br />
der nationalen Ökonomien im<br />
globalen Kontext primär durch Interventionen<br />
auf der Angebotsseite, d. h. im Bereich der<br />
Infrastrukturpolitik, der Forschungs- und Entwicklungspolitik,<br />
also dem, was unter dem<br />
Stichwort „Standortpolitik“ zusammengefaßt<br />
werden kann; zum zweiten die Unterordnung<br />
der Sozialpolitik unter die Anforderungen der<br />
nationalstaatlichen Standortpolitik. Hier geht<br />
es in erster Linie um die sog. „Arbeitsmarktflexibilisierung“,<br />
insbesondere aber um die<br />
Bearbeitung der Konsquenzen der politischen<br />
Hinnahme von struktureller Massenarbeitslosigkeit<br />
mit dem Ergebnist der Spaltung der<br />
Gesellschaft entlang der Scheidelinie von „Arbeit<br />
haben“ und „keine Arbeit haben“. Drittens<br />
hat sich im Übergang zum workfare state auch<br />
die Form der Regulationstätigkeit des Staates<br />
verändert. Statt einer Orientierung an relativ<br />
starren inhaltlichen Vorgaben zur Ausgestaltung<br />
von Lebensverhältnissen, wie sie etwa<br />
im sog. ‚Normalarbeitsverhältnis’ (Mückenberger)<br />
fixiert sind, werden nun die Rahmungen<br />
definiert, innerhalb derer die Akteure den<br />
Umgang mit den gesellschaftlichen Risiken<br />
der Lebensführung anhand von individuellen<br />
Kosten-Nutzen-Kalkülen eigenverantwortlich<br />
und rational ausgestalten. Das Subjekt wird<br />
hier zum Selbstunternehmer, das seine eigene<br />
Lebenstätigkeit zum Zweck des eigenen Überlebens<br />
instrumentalisieren muß. Dies ist insbesondere<br />
in theoretischen Ansätzen, die dies<br />
unter Rückgriff auf theoretische Ansätze von<br />
Foucault als gouvernementalité oder governmentality<br />
bezeichnen, wobei insbesondere auf<br />
die Verschmelzung mentaler Strukturen mit<br />
gesellschaftlichen Handlungsanforderungen<br />
verwiesen wird (Krasmann 1999; Lemke 2000).<br />
Der workfare state ist in seiner deutschen<br />
Variante als ‚aktivierender Sozialstaat’ und<br />
‚aktivierende Soziale Arbeit’ auch in den Personenbezogenen<br />
sozialen Dienstleistungen<br />
angekommen (vgl. Dettling 1995; Bandemer/<br />
Hilbert 1998; Olk 2000). Die Grundvorstellung<br />
des politischen Konzeptes des aktivierenden<br />
Staates ist, daß der als „pateranalistisch“<br />
attributierte klassische Wohlfahrtsstaat die<br />
Menschen zu passiven Objekten mache. Deshalb<br />
müßten die sozialen Leistungen so ausgestaltet<br />
werden, daß die Menschen, die zur<br />
Aufnahme jedweder Arbeit fähig sind, auch<br />
zur Aufnahme von Arbeit bewegt werden. Dies<br />
geschieht gemeinhin durch die Kürzung von<br />
Leistungen, oder aber eine punitive Ausgestaltung<br />
des Leistungsvollzuges indem etwa sog.<br />
„gemeinnützige Arbeit“ als Vorbedingung für<br />
den Bezug von Sozialhilfeleistungen auferlegt<br />
wird. Das Individuum – so die aktivierende Sozialpolitik<br />
– müsse durch die Sozialpolitik und<br />
insbesondere durch die personenbezogenen<br />
Dienste nun in die Lage versetzt werden, sein<br />
Leben in Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit<br />
zu führen.<br />
Die dem workfare state zugrundeliegende<br />
zentrale Idee, sowohl auf organisatorischer als<br />
auch auf ideologischer Ebene, ist die Idee des<br />
umfassenden Wettbewerbs. Wettbewerb und<br />
das Streben nach Wettbewerbsfähigkeit gelten<br />
als das Movens der Gesellschaft. Nur durch<br />
selektiven Wettbewerb und durch Konkurrenzverhältnisse<br />
sei Innovation zu gewährleisten,<br />
die Steigerung von Produktivität, Effektivität<br />
und Effizienz möglich sowie ein hohes Ausmaß<br />
an Qualität zu erreichen. Wettbewerb und Konkurrenz<br />
findet sich daher nicht nur auf der Ebene<br />
von Nationalstaaten („nationaler Wettbewerbsstaat“),<br />
sondern auch auf der Ebene von<br />
Regionen und Kommunen, die miteinander im<br />
Rahmen der Standortsicherung konkurrieren.<br />
Wettbewerb findet sich insbesondere auch auf<br />
dem Arbeitsmarkt zwischen den Beschäftigten<br />
verschiedener Arbeitsmarktsegmente, insbesondere<br />
aber zwischen den (noch) Beschäftigten<br />
und den Arbeitslosen. Und wir finden<br />
ihn schließlich auf der Ebene der Individuen,<br />
auf dem die Subjekte als Nutzen optimierende<br />
„Selbstunternehmer“ unter Konkurrenzverhältnissen<br />
ihre Lebensführung gestalten müssen<br />
(Kessl/Otto 2002)<br />
Wettbewerbsstaat, workfare state und Soziale<br />
historische<br />
Arbeit<br />
Auf dem Feld der Sozialen Arbeit hat dies – zu-<br />
mindest - zweierlei Konsequenzen: zum einen<br />
die Implementation von Wettbewerbs- und<br />
Marktmechanismen in sozialen Dienstleis-<br />
tungsbereich und damit die Institutionalisie-<br />
rung von Konkurrenzverhältnissen zwischen<br />
den verschiedenen Anbietern von sozialen<br />
Dienstleistungen (Otto/Schnurr 2000). Zum<br />
zweiten findet sich der politisch motivierte<br />
Versuch, die Adressaten sozialer Arbeit als<br />
nutzenoptimierende Kunden zu definieren, die<br />
sich auf einem Markt diejenigen Dienstleistun-<br />
gen heraussuchen, die ihren Präferenzen ent-<br />
sprechen (Schaarschuch 1996; 2000)<br />
Vor diesem Hintergrund der Durchsetzung des<br />
workfare state bzw. des aktivierenden Sozi-<br />
alstaates ergeben sich tiefgreifende Konse-<br />
quenzen für die Profession. Personenbezogene<br />
soziale Dienstleistungen werden stärker als je<br />
zuvor zur Feststellung der ‚Aktivierungsfähig-<br />
keit’ der Adressaten herangezogen. Soziale Ar-<br />
beit wird, indem sie die Unterscheidungen von<br />
„würdigen“ und „unwürdigen“ Armen treffen<br />
muß, auf den Stand des 19. Jahrhunderts zu-<br />
rückverwiesen. In diesem Prozeß geraten his-<br />
torisch entwickelte professionelle Handlungs-<br />
prinzipien – wie etwa die Lebenswelt- und<br />
Subjektorientierung, diskursive Problemdefi-<br />
nitionen, Konzepte stellvertretender Deutung<br />
und advokatorischen Handelns – zunehmend<br />
unter Druck. An ihre Stelle treten neue Formen<br />
der Beaufsichtigung, des Paternalismus, der<br />
Koppelung von Leistung und Gegenleistung,<br />
der Überwachung und Kontrolle der Lebens-<br />
führung (Dahme/Wohlfahrt 2002)..<br />
Nicht nur aufgrund der neoliberalen Strategie<br />
der Durchsetzung von Wettbewerb auf allen<br />
Ebenen, sonder auch aufgrund des extrem re-<br />
duzierten Finanzaufkommens in den Kommu-<br />
nen als Folge von Massenarbeitslosigkeit und<br />
steuerpolitischen Entscheidungen kommt es zu<br />
einem erheblichen Rationalisierungsdruck auf<br />
die kommunalen Dienstleistungen. Dabei geht<br />
es um eine Steigerung von Effektivität und Ef-<br />
fizienz, ohne dabei das Finanzvolumen zu erhö-<br />
hen („doing more with less“). Ausdruck dieser<br />
Rationalisierungsstrategie ist das ‚new public<br />
management’ mit seiner spezifisch deutschen<br />
Variante des ‚neuen Steuerungsmodells’. Das<br />
64 . Nr.63 . SIT<br />
SIT . Nr.63 . 65<br />
historische und aktuelle diskurse
diskurseLeitbild diskurse„Dienstleistungsunternehmen“ historische und aktuelle diskurse<br />
Leitbild des neuen Steuerungsmodells ist das<br />
„Dienstleistungsunternehmen“ Kommunalver-<br />
waltung (KGSt 1993). Die Intention des neuen<br />
Steuerungsmodells besteht darin, Steuerungs-<br />
mechanismen aus dem privatwirtschaftlichen<br />
Sektor in den bislang politisch-rechtlich ge-<br />
steuerten öffentlichen Sektor zu übertragen.<br />
Im Hinblick auf die Ebene der Einrichtungen<br />
bzw. der Organisationen soll dies erreicht wer-<br />
den durch<br />
- Kontraktmanagement (Steuerung durch<br />
Verträge)<br />
- Budgetierung (Zusammenfassung von<br />
Fach- und Ressourcenverantwortung)<br />
- durch Leistungs- d. h. durch Produktoder<br />
“Output-Orientierung”<br />
- durch Kontrolling und Qualitätssichrungsverfahren<br />
Im Hinblick auf die Ebene der Interaktionen<br />
der Verwaltungsmitarbeiter – und das heißt in<br />
unserem Fall: im Hinblick auf das Handeln der<br />
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter – wird<br />
entsprechend gefordert, dieses am Modell<br />
der Dienstleistung auszurichten. Damit ist ge-<br />
meint, daß sich das Handeln der Professionel-<br />
len weitgehend an den Wünschen der explizit<br />
als solchen bezeichneten „Kunden“ orientiert.<br />
Soziale Arbeit solle den Charakter eines Kun-<br />
dendienstes annehmen. Dabei wird angenom-<br />
men, daß über eine solchermaßen verstandene<br />
Form der Dienstleistung das Passungsverhält-<br />
nis von Angebot und Nachfrage optimiert wer-<br />
den kann und dies zu einer Effektivitäts- und<br />
Effizienzsteigerung der öffentlichen Dienste<br />
führen wird (Schaarschuch 1996).<br />
Von Seiten der Professionellen also von Seiten<br />
der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter wird<br />
dieser Forderung nach einer Dienstleistungso-<br />
rientierung, nach einer Orientierung an den<br />
Wünschen der ‚Kunden’, keineswegs nur mit<br />
Ablehnung nur begegnet. Vielmehr wird ihr<br />
eine große „Attraktivität“ und „Faszination“<br />
(Merchel 1995) bescheinigt.<br />
Wie aber ist es zu erklären, daß Professionel-<br />
le des Öffentlichen Dienstes oft bereitwillig<br />
auf die betriebswirtschaftliche Rhetorik der<br />
neuen Steuerung einschwenken? Seit etwa<br />
15 - 20 Jahren werden in der Sozialen Arbeit<br />
Konzepte der Lebensweltorientierung, bzw.<br />
der Subjektorientierung diskutiert und zwar<br />
auf disziplinärer wie auch auf professioneller<br />
Ebene. Im Zentrum dieser Ansätze stehen<br />
die lebensweltlichen Bedingungs- und Deutungskontexte<br />
sowie die Respektierung bzw.<br />
Anerkennung der subjektiven Perspektiven der<br />
Adressaten. An diese weitverbreitete fachliche<br />
Orientierung an den lebensweltlichen Bezügen<br />
der Subjekte lagert sich nun diese neue im<br />
Rahmen der Modernisierung der öffentlichen<br />
Dienste gestellte Forderung nach einer Dienstleistungsorientierung,<br />
nach einer Orientierung<br />
an den Wünschen der sog. ‚Kunden’ an. Der<br />
Dienstleistungs- wie auch der Kundenbegriff<br />
– so scheint es – verheißt dabei eine neue Qualität<br />
im Verhältnis von Professionellen und Klienten.<br />
Und zwar eine neue Qualität<br />
- die sich in einem egalitäreren respektvollen<br />
Verhältnis der Sozialarbeiterinnen<br />
und Sozialarbeiter zu ihren Adressaten<br />
ausdrückt;<br />
- die die subjektiven Präferenzen der Klienten<br />
ernst nimmt und nicht länger paternalistisch<br />
überformt;<br />
- eine neue Qualität, die nicht zuletzt<br />
eine Gleichwertigkeit mit dem privaten<br />
Sektor also ein Bewußtsein der eigenen<br />
Modernität signalisiert<br />
Der Dienstleistungsbegriff, wie er im Rahmen<br />
des New-Public-Managements bzw. der Modernisierung<br />
der öffentlichen Verwaltung formuliert<br />
worden ist, erhält eine erhebliche theoretische<br />
wie auch professionspolitische Brisanz<br />
und stellt zudem eine erhebliche Provokation<br />
für professionelle Sichtweisen und Handeln<br />
dar, die darin besteht, daß in der Dienstleistungsfigur,<br />
die am Bild des ‚Kunden’ orientiert<br />
ist, dem Anspruch nach die Privilegierung der<br />
Nachfrageseite systematisch impliziert ist.<br />
Es ist verschiedentlich argumentiert worden,<br />
daß der Kundenbegriff in vielerlei Hinsicht<br />
inadäquat für die soziale Arbeit ist. Z. B.<br />
verfügen Klienten nicht über die materiellen<br />
Ressourcen sich Dienstleistungen auf einem<br />
Markt einzukaufen. Sie verfügen zudem nicht<br />
über die Informationen, die zum Agieren auf<br />
einem Markt notwendig sind; auch wenn die<br />
verschiedenen Anbieter sozialer Dienstleistungen<br />
miteinander konkurrieren existiert für<br />
die Adressaten sozialer Arbeit kein Markt auf<br />
dem sie unter verschiedenen Dienstleistungen<br />
wählen könnten; die Adressaten sozialer Arbeit<br />
sind zudem nicht immer voll handlungsfähig<br />
(Schaarschuch 1996).<br />
Dennoch ist davon auszugehen, daß soziale<br />
Arbeit die Herausforderung, die in dieser Privilegierung<br />
der Nachfrageseite im Kundenbegriff<br />
enthalten ist, aufnehmen muß. Die erste These<br />
in diesem Zusammenhang ist, daß soziale Arbeit<br />
als Dienstleistung theoretisch begründbar<br />
ist, und zwar sowohl als sozialstaatliche<br />
Dienstleitung jenseits der Markt- und Kundenlogik,<br />
als auch unter dem Aspekt der systematischen<br />
Privilegierung der Nachfrageseite. Die<br />
zweite These ist, daß die Dienstleistungskategorie<br />
der Profession die Möglichkeit bietet, den<br />
Herausforderungen und Gefahren, die sich für<br />
sie sowohl aus der aktivierenden Sozialpolitik<br />
als aus dem New Public Management ergeben,<br />
konzeptionell - politisch entgegenzutreten.<br />
Soziale Arbeit als Dienstleistung<br />
Wenn wir von der grundlegenden subjekttheoretischen<br />
Annahme ausgehen, daß die Subjekte<br />
selbst es sind, die ihre eigene Gesundheit,<br />
ihre eigene Sozialität, ihre eigene Bildung, ihr<br />
eigenes soziales Verhalten usw. hervorbringen,<br />
d. h. produzieren, dann ist in systematischer<br />
Perspektive professionelles sozialpädagogisches<br />
Handeln sekundär, nachrangig auf diese<br />
originäre Produktivität der Subjekte bezogen.<br />
Es liegt auf der Hand, daß professionelles<br />
soziales Handeln nicht selber Gesundheit,<br />
Bildung etc. produzieren kann, sondern den<br />
Produktionsprozeß der Subjekte ‚lediglich‘ zu<br />
unterstützen, begleiten, anregen, und motivieren<br />
vermag. Dies ist die Begründung dafür, daß<br />
den die soziale Dienstleistungen konsumierenden<br />
Subjekten, die die eigentlichen Produzenten<br />
– ihrer Bildung, sozialen Beziehungen etc.<br />
- sind, im Dienstleistungsprozeß der Primat<br />
zukommt. Die Selbstproduktivität der Subjekte<br />
ist der Ausgangspunkt einer dienstleistungstheoretisch<br />
begründeten sozialen Arbeit (Schaarschuch<br />
1999).<br />
Wenn wir dies nun auf sozialpädagogisches<br />
Handeln beziehen, wenn wir also danach<br />
fragen: wie kann professionelles sozialpädagogisches<br />
Handeln aus der Perspektive der<br />
Subjekte konzipiert werden, dann bietet sich<br />
der Dienstleistungsbegriff, die Dienstleistungskonzeption<br />
an. Ein erster Vorschlag zur<br />
theoretischen Bestimmung von Sozialer Arbeit<br />
als Dienstleistung soll daher lauten:<br />
Dienstleistung ist ein professioneller Hand-<br />
lungsmodus, der von der Perspektive des<br />
nachfragenden Subjekts als Konsument und<br />
Produzent zugleich ausgeht und von diesem<br />
gesteuert wird.<br />
Diese Figur der Dienstleitung, d. h. diese Rela-<br />
tion, dieses Spannungsverhältnis von professi-<br />
onellem Handeln und nachfragendem Subjekt<br />
kann als „Erbringungsverhältnis“ konzipiert<br />
werden. Ein solcher Begriff von Dienstleistung<br />
- nimmt die Herausforderung an, die im<br />
Dienstleistungsbegriff, der auf der Kun-<br />
denfigur aufbaut, enthalten ist – nämlich<br />
den Primat der Nachfrageseite<br />
- er begründet ihn aber jenseits der Markt-<br />
logik in der grundsätzlichen Selbstpro-<br />
duktivität der Subjekte<br />
- damit überschreitet und radikalisiert er<br />
zugleich sozialpädagogische Konzepte,<br />
die sich an den Subjekten lediglich “ori-<br />
entieren”.<br />
Ein solchermaßen konzipierter Dienstleis-<br />
tungsbegriff ist natürlich äußerst voraus-<br />
setzungsvoll: Zum einen im Hinblick auf die<br />
Subjekte: Vielfach müssen die Nutzer sozialer<br />
Arbeit erst mit Hilfe der Professionellen in<br />
die Lage versetzt werden, ihre Nachfrage zu<br />
aktualisieren und zu artikulieren, um schließ-<br />
lich steuernd auf den Prozeß der Dienstleis-<br />
tungserbringung einzuwirken. Zum anderen<br />
ist er auch anspruchsvoll im Hinblick auf die<br />
Rolle der Professionellen: Diese müssen das<br />
Subjekt als aktives, selbstproduktives Subjekt<br />
zunächst theoretisch unterstellen, dann aktiv<br />
mitproduzieren, um schließlich ihre Tätigkeit<br />
der Logik der Selbstproduktion der Subjekte<br />
nachzuordnen.<br />
Zugleich hat ein solcher Dienstleistungsbegriff<br />
auch eine normativ-kritische Dimension. Denn<br />
damit wird die reale Verfaßtheit sozialer Arbeit<br />
analytisch zugänglich: Also der sozialstaatli-<br />
che Regulierungsanspruch (in der Regel gibt<br />
es in den sozialen Diensten keine ‚Komm-Struk-<br />
tur‘ sondern diese sind eher kontrollierend-dis-<br />
ziplinierend ausgerichtet); die reale Verfaßtheit<br />
der Institutionen und Einrichtungen, die weit<br />
davon entfernt ist, der Logik der Selbstproduk-<br />
tivität der Subjekte zu folgen; die strukturellen<br />
Machtasymmetrien zwischen Professionellen,<br />
Nachfragern und Organisationen. D. h. mit Hilfe<br />
66 . Nr.63 . SIT<br />
SIT . Nr.63 . 67<br />
historische und aktuelle diskurse
des Dienstleistungsbegriffes ist es möglich, die<br />
Realität sozialer Arbeit daraufhin zu befragen,<br />
inwieweit sie der Selbstproduktion der Subjek-<br />
te angemessen ist, d. h. im Wortsinne dienlich<br />
ist oder eben nicht angemessen ist und damit<br />
den tendenziell passiven Klientenstatus ledig-<br />
lich reproduziert.<br />
diskursedes Dienstleistungsbegriffes historische und aktuelle diskurse<br />
Organisationelle und institutionelle Kontexte<br />
der Dienstleistungserbringung<br />
Dieses hier nur skizzierte Erbringungsver-<br />
hältnis von sozialen Dienstleistungen – eines<br />
professionellen Handlungsmodus’, der vom<br />
nachfragenden Subjekt gesteuert wird – ist<br />
zunächst einmal eine sehr abstrakte Konzeptu-<br />
alisierung von Dienstleistung, die in konkrete<br />
Kontexte versetzt werden muß.<br />
Generell können zwei unterschiedliche Erbrin-<br />
gungskontexte von personenbezogenen sozia-<br />
len Dienstleistungen unterschieden werden:<br />
- Der kommerzielle, marktförmige Erbringungskontext,<br />
und der<br />
- Der (sozial-)staatliche Erbringungskontext<br />
von Dienstleistungen<br />
Zunächst zum marktförmigen Erbringungskon-<br />
text. Eingangs hatte ich darauf hingewiesen,<br />
daß die Forderung nach einer Dienstleistungs-<br />
orientierung, wie sie im Rahmen der Strategien<br />
zur Modernisierung der öffentlichen Verwal-<br />
tung gestellt wird, vor dem Hintergrund der<br />
Übertragung marktförmiger Steuerungsmittel<br />
in den Kontext der öffentlichen Dienste statt-<br />
findet und hierbei die Figur des ‚Kunden’ die<br />
zentrale Rolle spielt. Nach dieser Auffassung<br />
besteht der Vorteil einer Orientierung am<br />
‚Kunden’ darin, daß dieser mittels individu-<br />
eller Wahl- und Kaufakte auf der Basis seiner<br />
spezifischen Präferenzen Einfluß auf die Anbie-<br />
terseite ausüben kann – und zwar stets unter<br />
der Bedingung einer Mehrzahl von Anbietern,<br />
die zudem zueinander in einem Konkurrenz-<br />
verhältnis stehen müssen. Auf diese Weise<br />
– so wird dann angenommen – wird das Pas-<br />
sungsverhältnis von Angebot und Nachfrage<br />
optimiert, werden die Ressourcen effektiv und<br />
effizient eingesetzt und setzt sich qua Auslese<br />
das qualitativ bessere Angebot durch.<br />
Allerdings haben wir es in den konkreten so-<br />
zialstaatlichen<br />
Institutionalisierungsformen<br />
der sozialen Arbeit weder mit einem Markt<br />
konkurrierenden Anbieter zu tun noch können<br />
die Adressaten über die finanziellen Mittel<br />
zum Kauf von Dienstleistungen wie Kunden<br />
disponieren. Vielmehr – und damit kommen<br />
wir zum sozialstaatlichen Erbringungskontext<br />
– herrscht hier eine weitgehend alternativlose<br />
institutionelle Monostruktur. Besonders gut<br />
können die unterschiedlichen Dimensionen<br />
des marktförmigen und des sozialstaatlichen<br />
Erbringungskontextes mit ihren spezifischen<br />
Implikationen mittels der Begrifflichkeiten von<br />
Hirschman (1970) differenziert werden:<br />
Dem Modell nach kann der Kunde auf einem<br />
Markt konkurrierende Anbieter vor allem dadurch<br />
Einfluß ausüben, daß er den bisherigen<br />
Anbieter verläßt und zu einem neuen wechselt.<br />
Hirschman nennt dies die ‚Exit-Option‘.<br />
Natürlich will dies jeder Anbieter verhindern.<br />
Entsprechende Strategien der Kundenbindung<br />
sollen deshalb gewährleisten, daß die Kunden<br />
wiederkommen (Gross 1993). Durch die Migration<br />
der Kunden hin zu den Angeboten, die<br />
ihrer individuellen Nachfrage am weitesten<br />
entsprechen, bildet sich – so das Marktmodell -<br />
ein optimales Passungsverhältnis von Angebot<br />
und Nachfrage auf einem hohen Qualitätsniveau<br />
heraus.<br />
Anders im sozialstaatlichen Erbringungskontext<br />
sozialer Arbeit: Hier – wo es im Prinzip<br />
nur einen einzigen staatlichen Anbieter von<br />
Dienstleistungen gibt – ist ein steuernder Einfluß<br />
der Nachfragenden auf die Dienstleistungen<br />
der Anbieterseite prinzipiell nur dadurch<br />
möglich, daß diese ihre Interessen zur Artikulation<br />
bringen, um es mit Hirschman zu sagen,<br />
daß sie die ‚Voice-Option‘ zum Einsatz bringen.<br />
D. h. im sozialstaatlichen Kontext stellt ‚Voice‘<br />
das funktionale Äquivalent zu den je individuellen<br />
Wahlakten der Kunden auf dem Markt dar.<br />
Dies bedeutet zugleich, daß im Sozialstaat die<br />
Einflußnahme der Nutzer auf den Dienstleistungsprozeß<br />
politischer Natur sein muß.<br />
Was heißt dies für die Konzeptionalisierung<br />
von sozialen Dienstleistungen? Welche Konsequenzen<br />
ergeben sich aus der politischen<br />
Natur der Artikulation von Nachfrage im sozialstaatlichen<br />
Erbringungskontext? Es ist<br />
jedoch mit dieser Feststellung, daß die Einflußnahme<br />
der Nutzer auf personenbezogene soziale<br />
Dienstleistungen im Sozialstaat wesentlich<br />
politischer Natur sein muß, noch überhaupt<br />
nichts über die Chancen dieser Einflußnahme<br />
ausgesagt. Wenn man davon ausgeht, daß<br />
staatliche Institutionen – und damit auch die<br />
soziale Arbeit – Ausdruck, die materielle Gestalt<br />
gesellschaftlicher Machtverhältnisse und<br />
Machtrelationen sind, dann sind im Hinblick<br />
auf die erfolgreiche Einflußnahme der Nutzer<br />
auf den Dienstleistungsprozeß die Machtstrukturen<br />
das zentrale Moment, die entscheidende<br />
Bedingung, dem unsere Aufmerksamkeit zukommen<br />
muß. Ich will dies hinsichtlich zweier<br />
Ebenen kurz umreißen:<br />
Zunächst für die Ebene der direkten Interaktion<br />
von Nutzern und Professionellen. Diese Beziehung<br />
ist gekennzeichnet durch eine deutliche<br />
Macht-Asymmetrie zugunsten der Professionellen.<br />
Das Machtpotential der Professionellen<br />
speist sich wesentlich aus zwei Quellen. Erstens<br />
dem Wissen, insbesondere dem fachlichen<br />
Wissen. Zweitens der Tatsache, daß er/sie als<br />
Mitglied von Institutionen und Organisationen<br />
handelt. Um auf dieser Ebene den Einfluß der<br />
Nutzer geltend zu machen, bietet sich hier das<br />
Konzept des Empowerment, im Sinne von Be-<br />
Mächtigung an. Ich verwende hier einen engen,<br />
spezifischen Begriff von Empowerment, der im<br />
Wortsinne auf die Machtverhältnisse bezogen<br />
ist (Hasenfeld 1987). Der Ausgangspunkt dabei<br />
ist, daß die Machtverhältnisse in den Einrichtungen<br />
der sozialen Arbeit unhintergehbar<br />
sind. Professionelle aber müssen dennoch ein<br />
Interesse an der Veränderung der Machtasymmetrie<br />
im Hinblick auf eine größere Symmetrie<br />
des Erbringungsverhältnisses haben.<br />
Aber warum sollen sie dieses Interesse aufbringen?.<br />
Die Begründung hierfür liegt – wie<br />
vielleicht zu vermuten wäre - nicht auf der Ebene<br />
einer professionellen Ethik, die im Hinblick<br />
auf ihren normativen Gehalt voraussetzungsund<br />
anspruchsvoll ist. Vielmehr muß es dem<br />
Professionellen aus dem eigenen Interesse an<br />
der „Gebrauchswerthaltigkeit“, d. h. an der<br />
Adäquatheit bzw. Angemessenheit seiner Tätigkeit<br />
für die Subjekte heraus, aber auch zur<br />
Erfüllung seines gesellschaftlichen Auftrages,<br />
daran gelegen sein, diese Machtasymmetrien<br />
zu verändern – und zwar im Hinblick auf mehr<br />
Symmetrie, damit die Nutzerinnen und Nutzer<br />
Ein solchermaßen verfaßtes Konzept von Em-<br />
powerment ist ein höchst anspruchsvolles<br />
Konzept: Denn der Professionelle muß den Nut-<br />
zer in die Lage versetzen, seinen Einfluß ge-<br />
genüber der eigenen professionellen Tätigkeit<br />
auszuüben, mit anderen Worten ihn als Kon-<br />
fliktakteur aufbauen. Auf diese Weise können<br />
Bedürfnisse und Konflikte um die Angemes-<br />
senheit professioneller Tätigkeit im Kontext<br />
der jeweiligen Machtverhältnisse überhaupt<br />
erst thematisiert werden.<br />
Auf der Ebene der Institutionen und Einrich-<br />
tungen gibt es keine rechtlich garantierten<br />
Einflußmöglichkeiten für die Nutzer. Wenn wir<br />
den Einfluß der Nutzer nicht dem mehr oder<br />
weniger zufälligen good-will von Professio-<br />
nellen und Administratoren überlassen wollen<br />
– etwa im Rahmen organisationell unverbindli-<br />
cher Formen der „Beteiligung“ – dann geht es<br />
elementar darum, politisch-demokratische Ein-<br />
fluß- und Mitbestimmungsmöglichkeiten als<br />
Verfahrensrechte festzuschreiben. Einer Stra-<br />
tegie der Demokratisierung von Einrichtungen<br />
muß es zunächst einmal darum gehen, Orte<br />
der Auseinandersetzung, d. h. Möglichkeiten<br />
zur offenen Konfliktaustragung zwischen den<br />
Beteiligten: Nutzern, Professionellen, Admi-<br />
nistratoren, Öffentlichkeit – zu institutionali-<br />
sieren. Eine Strategie der Demokratisierung<br />
zum Zweck der Einflußnahme der Nutzer kann<br />
68 . Nr.63 . SIT<br />
SIT . Nr.63 . 69<br />
ihre Interessen, Bedürfnisse, Deutungen usw. historische geltend machen können. Empowerment meint<br />
hier die Relativierung und damit die Bemächti-<br />
gung der Nutzer aus dem Interesse der Professi-<br />
onellen an der Qualität d. h. an der Gebrauchs-<br />
werthaltigkeit ihrer Arbeit für die Nutzerinnen<br />
und Nutzer - es bedeutet aber zugleich nicht<br />
die Außerkraftsetzung der in alle soziale Arbeit<br />
eingelassenen Macht-Asymmetrien. Den Pro-<br />
fessionellen in der sozialen Arbeit muß eben<br />
nicht aus ethischen oder philanthropischen<br />
Gründen, sondern an dem wohlverstandenen<br />
Interesse an der eigenen Professionalität daran<br />
gelegen sein, den Gebrauchswert ihrer Arbeit<br />
für die Nutzer durch die Einschränkung der<br />
strukturellen Machtasymmetrien zu erhöhen.<br />
Das aber heißt zugleich, daß es sich hier nicht<br />
um ein konfliktfreies Verhältnis handeln kann.<br />
Angesichts struktureller Machtasymmetrien<br />
sind Konflikte unvermeidlich.<br />
historische und aktuelle diskurse
aber nicht bei bloßer Artikulation stehen blei-<br />
ben – und es der Organisation überlassen, wie<br />
sie damit verfährt – sondern es geht um die<br />
rechtlich abgesicherte Möglichkeit der Mitbe-<br />
stimmung über Form und Inhalt des Dienst-<br />
leistungsprozesses. Es geht also um die quali-<br />
tative Differenz von ‚to have a voice’ und ‘to<br />
have a say’ (Beresford/Croft 1992). Hierzu gibt<br />
es eine Reihe von Konzepten, gerade aus dem<br />
angelsächsischen Kontext (vgl. Beresford/Croft<br />
1993).<br />
diskurseaber nicht historische und aktuelle diskurse<br />
- Konzepte, die auf die strukturelle Demokratisierung<br />
lokaler Politik durch repräsentative<br />
und direkt-demokratische<br />
Verfahren abzielen, etwa lokale Sozialarbeitspolitik<br />
- Konzepte des user-involvement, die auf<br />
eine Binnendemokratisierung der Institutionen<br />
gerichtet sind<br />
- Konzepte des citizen-involvement, die<br />
die Binnendemokratisierung mit der<br />
politischen Struktur des Gemeinwesens<br />
verbindet.<br />
Die Demokratisierung betrifft aber nicht le-<br />
diglich die Ebene der Nutzerinnen und Nut-<br />
zer, sondern zugleich auch das Verhältnis von<br />
Professionellen und Organisationen. Über das<br />
Arbeitsrecht hinaus geht es um die Mitbestim-<br />
mung über die Operationsweise der Organi-<br />
sationen, über Form und Inhalt der geleisteten<br />
Arbeit sowie über die sozialpädagogischen<br />
Konzeptionen. Dies ist strategisch für die Pro-<br />
fession von hoher Bedeutung gerade im Hin-<br />
blick auf die Polarisierung von Management<br />
und Ausführungsebene im Zuge neuer Steue-<br />
rungsmodelle.<br />
Durch eine solche Strategie der Demokratisie-<br />
rung der Institutionen und Einrichtungen kann<br />
nicht nur das Passungsverhältnis von Nachfra-<br />
ge und Leistungserbringung optimiert werden,<br />
sondern zugleich – als ‚Beiprodukt‘ – über die<br />
tagtägliche Ausübung demokratischer Praxis<br />
aller Beteiligten zur Demokratisierung auf ge-<br />
sellschaftlicher Ebene beigetragen werden.<br />
Möglicherweise ist dies sogar der bedeutsa-<br />
mere Effekt.<br />
Wie läßt sich nun die politische Einflußnahme<br />
der Nutzerinnen und Nutzer auf die Dienstleistungserbringung<br />
im Sozialstaat legitimieren?<br />
Im Prozeß der sozialen Dienstleistungserbringung<br />
haben wir es mit einer Doppelstruktur<br />
zu tun: ‚Klienten‘ sind – wie auch die Professionellen<br />
– immer auch Bürger; Bürger, die soziale<br />
Rechte in Anspruch nehmen (van der Laan<br />
1997). Um sich die Bedeutsamkeit des Status<br />
als Bürger vor Augen zu führen, ist das Konzept<br />
von citizenship von Th. Marshall (1977)<br />
aufschlußreich. Für ihn besteht der „volle Bürgerstatus“<br />
in der Trias von zivilen Schutzrechten,<br />
politischen Teilnahmerechten und sozialen<br />
Teilhaberechten. Diese verschiedenen Rechte<br />
haben sich historisch nacheinander ausgebildet<br />
und sind in den verschiedenen Ausprägungen<br />
der modernen Wohlfahrtsstaaten weitgehend<br />
realisiert worden. Zwar hat dieses Modell<br />
durchaus auch einige problematische Aspekte<br />
– so etwa die Widersprüche zwischen den<br />
verschiedenen Rechtstypen bzw. die unausgesprochene<br />
Annahme, daß Vollbeschäftigung<br />
herrsche (vgl. Giddens 1983) – gleichwohl kann<br />
es als kritische Folie zur Analyse der realen<br />
Verfaßtheit von Wohlfahrtsstaaten dienen. Es<br />
ist wichtig anzumerken, daß die verschiedenen<br />
Rechtssorten nicht gleichgewichtig sind,<br />
sondern eine unterschiedliche Qualität aufweisen.<br />
Habermas (1994) hat darauf hingewiesen,<br />
daß nur die politischen Rechte es ermöglichen,<br />
daß sich die Bürger aktiv und reflexiv auf die<br />
Veränderung ihrer Lebensumstände beziehen.<br />
Zivile Schutzrechte und soziale Rechte können<br />
tendenziell auch in autoritären, nichtdemokratischen<br />
Verfassungen realisiert werden.<br />
In dieser Orientierung auf die politischen Bürgerrechte<br />
wächst der Demokratisierung sozialer<br />
Arbeit auch eine offensive Dimension zu: Indem<br />
die demokratische Praxis in den Institutionen<br />
rückgebunden wird an die aktive Seite des<br />
Bürgerstatus und damit auch an die Möglichkeit<br />
(!) zur Transformation gesellschaftlicher<br />
Verhältnisse, kann ihr ein gesellschaftlicher<br />
Beitrag zur Verwirklichung der Freiheitsrechte<br />
aller Bürger gelingen.<br />
Literatur<br />
Bandemer, S. v. /Hilbert,J. 1998: Vom expandierenden<br />
zum aktivierenden Staat, in: Blanke,<br />
B.; Bandemer, S. v.; Nullmeier, F.; Wewer,G.:<br />
Handbuch zur Verwaltungsreform, Opladen,<br />
S. 25-32<br />
Beresford, P.; Croft, S. 1992: The Politics of Participation,<br />
in: Critical Social Policy 35, 20 – 44<br />
Beresford, P.; Croft, S. 1993: Citizen-Involvement.<br />
A Practical Guide for Change. Houndmills,<br />
Basingstoke: Macmillan<br />
Dahme, H.-J.; Wohlfahrt, N. 2002: Aktivierender<br />
Staat – Ein neues sozialpolitisches Leitbild<br />
und seine Konsequenzen für die soziale Arbeit,<br />
in: neue praxis 1, 10 - 32<br />
Dettling, W. 1995: Politik und Lebenswelt. Vom<br />
Wohlfahrtsstaat zur Wohlfahrtsgesellschaft.<br />
Gütersloh, Verlag Bertelsmann Stif tung<br />
Giddens, A. 1983: Klassenspaltung, Klassenkonflikt<br />
und Bürger rechte. Gesellschaft im Europa<br />
der achtziger Jahre, in: Kreckel, R. (Hg.),<br />
Soziale Ungleichheiten. Soziale Welt Sonderband.<br />
Göttingen, 15 - 33<br />
Gross, P. 1993: Die Dienstleistungsstrategie in<br />
dr Sozialpoli tik. Neue Herausforderungen, in:<br />
Braun, H.; Johne, G. (Hg.); Die Rolle sozialer<br />
Dienste in der Sozialpolitik. Frankfurt/New<br />
York, 11 –26<br />
Habermas, J. 1994: Faktizität und Geltung.<br />
Frankfurt: Suhrkamp<br />
Hasenfeld, Y. 1987: Power in Social Work Praktice,<br />
in: Social Service Review, 3, 468 - 338<br />
Hirsch, J. 1998: Vom Sicherheitsstaat zum<br />
nationa len Wettbe werbs staat. Gesellschaft,<br />
Staat und Politik im globa len Kapita lis mus.<br />
Berlin/Amsterdam: Edi tion ID-Archiv<br />
Hirsch, J. 2002: Herrschaft, Hegemonie und politische<br />
Alternativen. Hamburg: VSA<br />
Hirschman, A. O. 1970: Exit, Voice and Loyalty.<br />
Cambridge/Mass. Harvard Univ. Press (dt. Abwanderung<br />
und Widerspuch. Tübingen 1974)<br />
Jessop, B. 1994: The transition to post-Fordism<br />
and the Schumpe terian workfare state, in: Burrows,<br />
R.; B. Loader (Hg.): Towards a Post-Fordist<br />
Welfare State? London: Routledge, 13 - 37<br />
Jessop, B. 2002: The Future of the Capitalist<br />
State. Cambridge: Polity Press<br />
KGSt (Kommunale Gemeinschaftstelle für<br />
Verwaltungsvereinfachung) 5, 1993: Das neue<br />
Steu erungsmodell. Begründung, Konturen,<br />
Umset zung. Bericht Nr. 5. Köln<br />
Krasmann, S. 1999: Regieren über Freiheit. Zur<br />
Analyse der Kontrollgesellschaft in foucault-<br />
scher Perspektive, in: Kriminologisches Journal<br />
2, 107 - 121<br />
Lemke, Th. 2000: Neoliberailismus, Staat und<br />
Selbststechnologien. Ein kritischer Überblick<br />
über die governmentality studies, in: Politische<br />
Vierteljahresschrift 1, 31 – 47<br />
Marshall, T. H. 1977: Class, Citizenship and<br />
Social Development. Chicago & London: (dt.<br />
Bürgerrechte und Soziale Klassen: zur Sozio-<br />
logie des Wohlfahrtsstaates, hg. von E. Rieger.<br />
Frankfurt/ New York: Campus ,1992)<br />
Merchel, J. 1995: Sozialverwaltung oder Wohl-<br />
fahrtsverband als “kunden-orientiertes Unter-<br />
nehmen“: ein tragfähiges zukunfts-orienties<br />
Leitbild? In: Neue Praxis 4, 325 - 340<br />
Mückenberger, U. 1990: Normalarbeitsverhält-<br />
nis: Lohnarbeit als normativer Horizont sozia-<br />
ler Sicherheit? In: Sachße, Ch.; Engel hardt, H.<br />
T. (Hg.): Sicherheit und Frei heit. Zur Ethik des<br />
Wohlfahrtsstaates. Frankfurt, 158 – 178<br />
Olk, Th. 2000: Der aktivierende Staat, in : Mül-<br />
ler, S. ; Sünker, H.; Olk, K. Böllert (Hg.): Soziale<br />
Arbeit. Gesellschaftliche Bedingungen und<br />
professionelle Perspektiven, Festschrift H.-U.<br />
Otto. Neuwied: Luchterhand, 99-118<br />
Otto, H.-U.; Schnurr, S. 2000: „Playing the Mar-<br />
ket Game?“ - Zur kritik markt- und wettbewerb-<br />
sorientierter Strategien einer Modernisierung<br />
der Jugendhilfe in internationaler Perspektive,<br />
in: dies. (Hg.): Privatisierung und Wettbewerb<br />
in der Jugendhilfe. Marktorientierte Moderni-<br />
sierungsstrategien in der Jugendhilfe. Neu-<br />
wied, Kriftel: Luchterhand<br />
70 . Nr.63 . SIT<br />
SIT . Nr.63 . 71<br />
Kessl, F.; Otto, H.-U. 2002: Entstaatlicht? Die<br />
neue Privatisierung personenbezogener sozi-<br />
aler Dienstleistungen, in: neue praxis 2, 122<br />
– 139<br />
historische und aktuelle diskurse
Schaarschuch, A. 1996: Der Staat, der Markt,<br />
der Kunde und das Geld? Öffnung und De-<br />
mokratisierung - Alternativen zur Ökonomi-<br />
sierung sozialer Dienste, in: Flösser, G.; Otto,<br />
H.-U. (Hg.): Neue Steuerungsmodelle für die<br />
Jugendhilfe. Biele feld, 8 – 28<br />
Schaarschuch, A. 1999: Theoretische Grunde-<br />
lemente Sozialer Ar beit als Dienstleistung. Ein<br />
analytischer Zugang zur Neuorien tierung Sozi-<br />
aler Arbeit, in: neue praxis 6 (1999), 543 - 560<br />
Schaarschuch, A. 2000: Kunden, Kontrakte,<br />
Karrieren. Die Kommerzialisierung der Sozialen<br />
Arbeit und die Konsequenzen für die Professi-<br />
on, in: Lindenberg, M. (Hg.): Von der Sorge zur<br />
Härte. Kritische Beiträ ge zur Ökonomisierung<br />
Sozialer Arbeit, Bielefeld: Kleine, 153 – 163<br />
diskurseSchaarschuch, historische und aktuelle diskurse<br />
Schaarschuch, A. 2003: Am langen Arm. Form-<br />
wandel des Staates, Staatstheorie und Soziale<br />
Arbeit im entwickelten Kapitalismus. In: Homfeld,<br />
H. G.; Schulze-Krüdener, J. (Hg.): Akteure<br />
und Settings Sozialer Arbeit. Hohengehren<br />
2003: Schneider, S. 36 - 65<br />
van der Laan, G. 1997: Client-Professional Interaction<br />
in Social Services and Social Citizenship,<br />
(Abstract), in: Hans-Uwe Otto; Andreas<br />
Schaarschuch (Hg.), Social Citizenship and<br />
Social Servi ce Work, International Symposium,<br />
Tagungsband, 20 - 23<br />
Prof. Dr. Andreas Schaarschuch<br />
Bergische Universität Wuppertal<br />
FB G – Bildungswissenschaft<br />
Gaußstr. 20<br />
D-42119 Wuppertal<br />
eMail: aschaar@uni-wuppertal.de<br />
1. Einleitung<br />
Josef Scheipl<br />
Jugendwohlfahrt in Österreich<br />
Historische Entwicklungslinien, aktuelle Zielsetzungen<br />
Aus aktuellen Gründen beginne ich mit gegenwärtigen<br />
Problemen und Zielstellungen<br />
der Jugendwohlfahrt in Österreich. Die Vorgangsweise<br />
bedingt, dass die Ausführungen<br />
nicht bei jedem Punkt ins Detail gehen können;<br />
manches wird provozierend angerissen, um die<br />
Diskussion dazu in Gang zu bringen, manches<br />
wird ausführlicher argumentiert werden.<br />
2. Analyse österreichischer Zeitschriften<br />
Aktuelle Trends und Probleme herauszufiltern,<br />
ist gar nicht leicht. Ich habe dazu<br />
drei heimische Zeitschriften hergenommen:<br />
„Sozialarbeit in Österreich“ (SIO), „Sozialpädagogische<br />
Impulse“ (SPI) und „Der österreichische<br />
Amtvormund“ (ÖA).<br />
Von diesen drei Zeitschriften nehme ich an,<br />
dass sie österreichweit verbreitet sind. Ich<br />
habe mich bemüht, die letzten drei Jahrgänge<br />
– 2000, 2001, 2002 – in Bezug auf aktuelle Probleme<br />
und Zielsetzungen zu analysieren, die<br />
auf Jugendwohlfahrt bezogen werden können.<br />
Ergebnisse:<br />
1a) Alle drei Zeitschriften haben sich mit<br />
dem Thema FAMILIE und damit aktuell zusammenhängenden<br />
Themen wie Besuchsbegleitung<br />
und Mediation befasst.<br />
1b) Auch ARMUT war im untersuchten<br />
Zeitraum bei allen dreien vertreten.<br />
JUGENDWOHLFAHRT (ÖA), KINDER-JUGEN-<br />
DANWALT (ÖA), aber auch wichtige RECHT-<br />
LICHE GRUNDLAGEN (JGG, KindRÄ) (ÖA)<br />
finden sich jeweils nur in einer Zeitschrift und<br />
hier bemerkenswerter Weise – nicht nur die<br />
rechtlichen Materien – vorwiegend im ÖA!<br />
Wenn die Anzahl der jeweiligen Artikel<br />
beachtet wird, dann dominiert die Thema-<br />
tik „Familie“, gefolgt von der Rechtsthe-<br />
matik. Das dürfte mit der Änderung des<br />
KindRÄ und des JGG zusammenhängen.<br />
Wenn ich davon ausgehe, dass die Redaktions-<br />
stäbe ihr Ohr an der Basis, an den Bedürfnissen<br />
der Basis haben, dann werden einerseits wich-<br />
tige Bereiche der JW zwar aufgegriffen – sie<br />
werden aber – ausgenommen Familie und Recht<br />
– lediglich in ein, zwei Beträgen thematisiert.<br />
Die einzelnen Beiträge bringen in der Regel<br />
praxisrelevant aufbereitete, lesenswerte Be-<br />
richte in meist recht knapper Form (im Durch-<br />
schnitt: 2 - 4 Seiten, maximal 7 bis 8 Seiten).<br />
Ich möchte im folgenden auf fünf Themenbe-<br />
reiche eingehen, die ich für wichtig erachte<br />
und die sich in der vorgestellten Erhebung z.T.<br />
nur marginal bis gar nicht finden.<br />
3. Wichtige fünf Themenstellungen für ak-<br />
tuelle Zielsetzungen<br />
2a) Unseren engeren Gegenstandsbereich<br />
3.1 Jugendwohlfahrtstatistik<br />
– die JUGENDWOHLFAHRT IM<br />
Mein erstes Thema ist von der Logik her kom-<br />
RAHMEN SOZIALER ARBEIT – themati-<br />
pliziert: Es betrifft ein ‚Nicht Thema’.<br />
sierten die beiden SIO und SPI je einmal.<br />
Ich möchte zunächst nachfragen, ob Ihnen in<br />
2b) In zwei Zeitschriften wurden auch die<br />
der öffentlichen Jugendwohlfahrt eigentlich<br />
Themen der GESCHLECHTSSENSIBLEN<br />
aufgefallen ist, dass Sie seit einiger Zeit, genau<br />
ARBEIT (SIO, SPI) sowie AUSLÄNDER<br />
seit drei Jahren – weniger Bleistifte mit der<br />
(FREMDE), FLÜCHTLINGE (ÖA, SIO) aufgegriffen<br />
Härte „zwei“ brauchen?<br />
und natürlich die QUALITÄTS-<br />
Es ist nämlich nicht mehr notwendig, die vie-<br />
SICHERUNG (eher allgemein; SIO, SPI).<br />
len Formblätter auszufüllen, welche zu Erstel-<br />
3a) So wichtige Bereiche wie DROGEN/SUCHT<br />
lung der Bundes-Jugendwohlfahrts-Statistik<br />
(SPI), GEWALT-SCHUTZ (ÖA), KINDES-MISS-<br />
nötig waren. Die Bundes-Jugendwohlfahrts-<br />
BRAUCH (ÖA), KINDERPSYCHIATRIE und<br />
Statistik wurde mit Ablauf des Jahres 1999<br />
72 . Nr.63 . SIT<br />
SIT . Nr.63 . 73<br />
schwerpunkt österreich
3.2 Jugendwohlfahrtsplanung<br />
Man scheint in der Jugendwohlfahrt überhaupt<br />
ein bisschen Skepsis gegenüber dem zu haben,<br />
was mit Zahlen zusammenhängen könnte. Ich<br />
denke hier konkret an die Jugendwohlfahrts-<br />
planung. Diese ist den Ländern als forschungs-<br />
orientierte Jugendwohlfahrts-Planung im JWG<br />
1989 aufgetragen (§ 7). Bis vor zwei Jahren<br />
konnten lediglich Salzburg und die Steiermark<br />
Jugendwohlfahrts-Pläne vorlegen. Vorarlberg<br />
hatte wichtige und interessante Qualitätsent-<br />
wicklungsprozesse im Rahmen der Jugend-<br />
wohlfahrt eingeleitet. Wien wartet auf ein ak-<br />
kordiertes Vorgehen mit anderen Bundeslän-<br />
dern. In Oberösterreich und Kärnten gibt es<br />
erste Ansätze zu einem umfassenden Pla-<br />
nungsvorhaben. In Tirol meinte man allerdings<br />
sinngemäß: Planungsvorhaben zu erstellen<br />
würde die Entwicklung eher einengen denn<br />
vorantreiben (vgl. SCHEIPL 2001, S. 286).<br />
Ich würde eine diskursorientierte und partizi-<br />
pative Vorgehensweise, wie sie in Salzburg<br />
gewählt wurde, durchaus als anregend für alle<br />
Beteiligten verstehen. Aber auch in der Steier-<br />
mark fühlt man sich durch die Planungsvorgän-<br />
ge eher angeregt als eingeschränkt.<br />
Dabei ist natürlich auch klar zu sagen: Gesell-<br />
schaftspolitische Analysen und rechtliche<br />
Grundlagen, finanzielle Bedingungen und de-<br />
mographische Trends – wie sie im steirischen<br />
Jugendwohlfahrts-Plan aufgegriffen werden -<br />
bilden die unerlässlichen Rahmungen eines<br />
Planungsvorganges. Aber erst politischer Wille<br />
und facheinschlägige Kompetenzen ermögli-<br />
chen seine Umsetzung. Jedenfalls ist darauf zu<br />
österreichschäft waren schwerpunkt österreich<br />
eingestellt (vgl. ÖA 2000, S. 200). So sehr Sie<br />
die Arbeitserleichterung schätzen dürften, es<br />
bleibt die Frage: Sollte sich Österreich – hier<br />
wiederum besonders die Fachöffentlichkeit –<br />
nicht doch an der Entwicklung der Jugend-<br />
wohlfahrt interessiert zeigen? Auch wenn<br />
manche Zahlen in den Statistiken möglicher-<br />
weise nicht ganz eindeutig scheinen – wie z.B.<br />
aktuell beim Streit um die Anzahl der Unter-<br />
richtsstunden. Die Bedeutung der Schulstatistik<br />
jedenfalls steht außer Zweifel. Die Jugend-<br />
wohlfahrt hingegen nahm es gelassen und<br />
schwieg. Sie zeigte wahrscheinlich zu wenig<br />
Interesse, so dass die Berichte über die Jugendwohlfahrts-Statistik<br />
kein wirkliches Ge-<br />
schäft waren und daher eingestellt wurden.<br />
achten, dass das Planungsunternehmen nicht<br />
bei der Erstellung von Normkostenmodellen<br />
stecken bleibt: Solcherart würde man die<br />
Dienstleistungsdiskussion, wie sie in den 90er<br />
Jahren auch die Sozialarbeit wieder erreicht<br />
hat, allzu sehr einschränken auf die finanzielle<br />
Dimension. Dabei würde der Sozialstaat um die<br />
gestaltende – nämlich die sozialpolitische – Dimension<br />
reduziert bleiben. Der Sozialstaat<br />
muss aktivierend, d.h. die Mitglieder aktivierend<br />
(Klienten als Koproduzenten) und er muss<br />
gestaltend, d.h. die sozialpolitische Aufgabe<br />
wahrnehmend, - agieren (vgl. BÖHNISCH/<br />
SCHRÖER 2002). Darauf hat die Jugendwohlfahrt<br />
in ihren sozialpolitischen Diskursen hinzuweisen,<br />
das hat sie einzufordern. (vgl.<br />
SCHEIPL 2003).<br />
3.3 Sozialpädagogische Diagnose<br />
Im Rahmen einer umfassenden Sozialraumanalyse<br />
haben wir einen Bezirk in einer großen österreichischen<br />
Stadt zur dortigen Situation der<br />
Jugend näher untersucht (vgl. SCHEIPL, PFO-<br />
SER, LEODOLTER, KERN 2000). Neben der Befragung<br />
von Jugendlichen, von Eltern und Experten<br />
haben wir auch eine Analyse von Jugendwohlfahrts-Akten<br />
durchgeführt. Wir wollten<br />
Genaueres über das Klientel und die Arbeit<br />
der Jugendwohlfahrt in diesem Raum in Erfahrung<br />
bringen. Nach dem Zufallsprinzip haben<br />
wir von ca. 120 Akten 29 ausgewählt (25 %)<br />
und näher analysiert. Dabei ist u.a. besonders<br />
aufgefallen: In nicht wenigen Fällen sind mehrere<br />
Jugendwohlfahrts-Unterstützungen pro<br />
Familie parallel gelaufen. In anderen Fällen haben<br />
sich Hilfsangebote in schöner Regelmäßigkeit<br />
immer wieder abgelöst (Heilpädagogische<br />
Station, Nachbarin, Heilpädagogische Station,<br />
Tagesmutter, Erziehungshilfe, Heim, Erziehungshilfe<br />
etc.). Wusste man nicht mehr weiter,<br />
waren durchaus auch Reiten und Voltigieren<br />
angesagt.<br />
In manchen Familien dauerten die Interventionen<br />
deutlich mehr als fünf Jahre. Die Kosten<br />
beliefen sich in einem Extremfall auf ATS 60.000<br />
monatlich bei 9-jähriger Dauer. Monatliche<br />
Kosten zwischen ATS 20.000 bis ATS 40.000<br />
waren keine Seltenheit (vgl. ebd., S. 153ff).<br />
So weit, so wenig befriedigend. – Trotz der verpflichtend<br />
angesetzten Helferkonferenz bei<br />
Entscheidungen über Maßnahmen zur Unterstützung<br />
der Erziehung bzw. bei Gewährung<br />
der vollen Erziehung (vgl. STJWG § 40).<br />
Die Probleme, dass z.B. im Vorfeld bzw. zur Vermeidung<br />
der Heimunterbringung zahlreiche<br />
inadäquate Maßnahmen gesetzt werden, die<br />
letztlich Misserfolge produzieren und eine stationäre<br />
Unterbringung nicht wirklich verhindern,<br />
sind aus der Literatur bekannt (vgl. BÜR-<br />
GER 1998, ADER/SCHRAPPER 2002, S. 27). Es<br />
findet sozusagen ein Probehandeln im Vorfeld<br />
zu Lasten der späteren Heimerziehung statt.<br />
Hinter dieser Problematik steht m.E. wesentlich<br />
das leidige Problem der Diagnose in der<br />
Sozialpädagogik.<br />
Interessanterweise steht aber gerade die Diagnose<br />
bereits ziemlich am Beginn der Professionsgeschichte<br />
der Sozialen Arbeit. Mary RICH-<br />
MOND schrieb 1917 das Buch Social Diagnosis,<br />
um einen systematischen Raster zur Analyse<br />
des Einzelfalles zu geben. Ihr folgte in Deutschland<br />
Alice SALOMON mit dem selben Anliegen<br />
und dem Buch „Soziale Diagnose“ (1926). Doch<br />
die Studenten- und Sozialarbeiter-Bewegung<br />
der späten 60er und 70er Jahre des letzten<br />
Jahrhunderts lehnten die sich mittlerweile etablierende<br />
psychologisch orientierte Einzelfall-<br />
Diagnose ab. Heute lehnt man die Diagnostik<br />
vielfach ab aus einer kritischen Haltung der<br />
Sozialen Arbeit gegenüber. Man befürchtet,<br />
dass eine diagnostisch-kategoriale Zuschreibung<br />
eine Pathologisierung bzw. Stigmatisierung<br />
hervorbringen könnte.<br />
Doch die „in den Kontexten der jeweiligen Institutionen<br />
(Heim, Bewährungshilfe, Heimschule,<br />
Kinder- und Jugendpsychiatrie) eingelagerten<br />
Berufsvollzüge stützen sich, wenn es<br />
um die Diagnostik der jeweiligen Symptomatik<br />
geht, teils auf psychiatrische Gutachten (DSM-<br />
IV, ICD-10), teils auf medizinische Befunde oder<br />
psychologische Diagnostik – und hier in der<br />
Regel auf standardisierte Testverfahren“<br />
(SCHREIBER 2000, S. 581).<br />
Auffallend ist bei Befragungen von in der Sozialen<br />
Arbeit Tätigen, dass die Fähigkeit, eine<br />
präzise Diagnose zu stellen, eher anderen Berufsgruppen<br />
wie z.B. den Psychologen oder<br />
Ärzten zugeordnet wird als den Sozialpädagogen.<br />
Weist das nicht auch hin auf eine Idealisierung<br />
dieser Berufsgruppen bei gleichzeitiger<br />
Abwertung der eigenen?<br />
Jedenfalls ist durch das JWG gefordert, Helfer-<br />
konferenzen bei Maßnahmen zur Unterstüt-<br />
Helfer-schwerpunkt zung oder bei Gewährung der vollen Erziehung<br />
einzuberufen. In der BRD wird seit dem KJHG<br />
mit der Verpflichtung, einen Hilfeplan zu erstel-<br />
len, ein ähnlicher Weg beschritten. Bloß hat er<br />
dort zu einer regen und – wie ich meine – pro-<br />
duktiven Auseinandersetzung geführt (vgl.<br />
MOLLENHAUER/UHLENDORFF:<br />
Sozialpäda-<br />
gogische Diagnosen – 3 Bände; HARNACH-<br />
BECK: 1995, 1999; PETERS: Diagnosen, Gut-<br />
achten, hermeneutischen Fallverstehen 1999;<br />
SCHREIBER: Zum theoretischen Ort sozialpäd-<br />
agogische Dia-gnostik, 2000 etc.). Sogar com-<br />
putergestützte Fallanalysen werden eingesetzt<br />
(CACM: Com-puter Aided Case Management<br />
– (vgl. C.W. MÜLLER 2002, S. 44 – beschrieben<br />
in F. PETERS). PANTUCEK (vgl. 1999) meint be-<br />
züglich der Entwicklung sozialpädagogischer<br />
Diagnosen: Die Anerkennung des anderen als<br />
Subjekt fordert subjektorientierte Sozialarbeit<br />
und problematisiert die Diagnose als reine Ex-<br />
pertInnenleistung. Sie soll eine gemeinsame<br />
Leistung von KlientInnen und Sozial-arbeite-<br />
rInnen sein, ein prinzipiell unabschließ-barer<br />
Prozess, stets in Frage zu stellen, zu überprü-<br />
fen, zu modifizieren. Mit Hilfe der Sozialarbeite-<br />
rInnen lernen die KlientInnen ihre soziale Wege<br />
zu verstehen und erfolgreich zu begehen.<br />
Erst im modernen Case-Management wird der<br />
Diagnose (neu verstanden) wieder verstärkt<br />
Aufmerksamkeit zuteil. Die klare Strukturie-<br />
rung des Prozesses in Assessment – Planung<br />
– Implementierung – Monitoring – Evaluation<br />
(Reassessment) ermöglicht es, die Diagnose<br />
wieder als relativ selbständige Phase des Pro-<br />
zesses zu verstehen. Dabei muss auf die koo-<br />
perative Ausrichtung nicht verzichtet werden,<br />
ebenso wenig auf das Verständnis der Diagno-<br />
se allerdings in diesem Verständnis als bloß<br />
vorläufiger, veränderbarer Einschätzung.<br />
Gleichzeitig wird aber konkret helfendes Handeln<br />
ermöglicht. (...)<br />
Die Leistung der SozialarbeiterInnen wird da-<br />
bei nach Meinung von PANTUCEK (vgl. ebd.)<br />
in drei Phasen erbracht:<br />
1. Eine explorative Bestandsaufnahme der vor-<br />
handenen Daten und deren Einschätzung<br />
durch die Betroffenen.<br />
2. Sie wird gefolgt von gezieltem Komplexitätsgewinn.<br />
Einschätzungen müssen in Frage ge-<br />
stellt, andere Optionen in Erwägung gezogen<br />
74 . Nr.63 . SIT<br />
SIT . Nr.63 . 75<br />
schwerpunkt österreich
Ich kann hier keine Lösungen anbieten – ich<br />
möchte auf wichtige Zielstellungen für die ös-<br />
terreichische Jugendwohlfahrt hinweisen. Es<br />
scheint mit wichtig hier zu erwähnen, dass<br />
„expertengestütztes Fremdverstehen“ nicht<br />
„durch selbstinterpretatives Eigenverstehen“<br />
(C.W. MÜLLER 2002, S. 44) ersetzt werden<br />
kann. Natürlich sind in der Helferkonferenz<br />
bzw. bei der Hilfeplanerstellung Aushand-<br />
lungsprozesse in Bezug auf die Handlungsfä-<br />
higkeit der KlientInnen sinnvoll und notwen-<br />
dig. Ohne die Betroffenen zumindest zu Kopro-<br />
duzentInnen zu machen, läuft „in unserem Ge-<br />
schäft“ gar nichts. Aber d.h. doch nicht, dass<br />
die Fachleute (des Jugendamtes) ohne diag-<br />
nostische Vorannahmen und ohne begründete<br />
sozialpädagogische Handlungsvorschläge in<br />
diese Gespräche gehen. Sozialpädagogen kön-<br />
nen doch nicht nur ModeratorInnen fremder<br />
Einschätzungen sein. Sie haben hoffentlich<br />
selbst auch eigene professionell gewonnene<br />
diagnostische Hypothesen (vgl. C.W. MÜLLER<br />
2002, S. 45).<br />
österreichmöchte auf schwerpunkt österreich<br />
österreichterreichische schwerpunkt<br />
werden, Quellen werden kritisch gewürdigt<br />
und Widersprüche thematisiert.<br />
3. Schließlich muss aber in einer dritten Phase,<br />
da alles vielleicht nicht mehr so eindeutig zu<br />
sein scheint, Handlungsfähigkeit erreicht wer-<br />
den, indem mit den Betroffenen eine vorläufige<br />
Problembeschreibung und ein Rahmenplan für<br />
das künftige Handeln entwickelt wird.<br />
In dieser Vermischung von Diagnose und<br />
Handlungsfähigkeit scheint mir aber ein für die<br />
Soziale Arbeit charakteristisches Problem vor-<br />
zuliegen.<br />
Ohne der Illusion zu verfallen, die soziale Diag-<br />
nose könnte in ähnlicher Form für die Allge-<br />
meinheit ein Ausweis des ExpertInnentums<br />
der sozialarbeiterischen Profession sein, wie<br />
dies die Diagnose für die medizinische Profes-<br />
sion ist, erscheint sie doch als wertvolles Hilfs-<br />
mittel für die Soziale Arbeit. Gerade in einem<br />
Kriseninterventionszentrum!<br />
Hier möchte ich eine grundsätzliche Bemer-<br />
kung anfügen:<br />
„Ohne die Betroffenen zu Koproduzenten zu<br />
machen, läuft in unserem Geschäft gar nichts“.<br />
Das ist die eine Seite.<br />
Die andere Seite ist, dass die Jugendwohlfahrt<br />
in einigen Bereichen, will sie ihre Aufgabe<br />
ernsthaft betreiben, sich mit der Frage des<br />
Zwanges bei Interventionen auseinandersetzen<br />
muss (vgl. dazu: HANSBAUER/SCHNURR<br />
2002, S. 90). Ich denke dabei z.B. an besondere<br />
Konstellationen in der SFH, an die Arbeit mit<br />
Straßenkids, an Fremd- oder Selbstgefährdung<br />
oder an die Maßnahme „Therapie statt Strafe“<br />
im Rahmen der Drogenarbeit. Wer dabei<br />
Zwang von vornherein verneint, verschließt<br />
die Augen vor möglichen Totalabstürzen.<br />
„Natürlich kollidiert die Frage nach Ausübung<br />
von Zwang, also die Verweigerung eines Veto-<br />
Rechtes der Betroffenen gegenüber pädagogischen<br />
Interventionen mit der Wahrung des<br />
Integritätspostulates, das die advokatorische<br />
Ethik pädagogischen Fachkräften auferlegt“<br />
(HANSBAUER/SCHNURR 2002, S. 90). Und es<br />
gibt keine Gewähr dafür, dass die gegen den<br />
Willen der Betroffenen gesetzten Maßnahmen<br />
tatsächlich ‚bedeutungsvoll’ für die KlientInnen<br />
geworden sind. Es gibt kaum befriedigende<br />
Antworten. Aber die Jugendwohlfahrt sollte<br />
vor diesen ethischen Fragen nicht die Augen<br />
verschließen. Diese Thematik muss auf der<br />
einen Seite stärker diskutiert werden. Auf der<br />
anderen Seite müssen die Jugendämter und<br />
die freien Träger für ihre MitarbeiterInnen aber<br />
auch die institutionellen und konzeptionellen<br />
Voraussetzungen schaffen, dass Entscheidungen<br />
angemessen vorbereitet, diskutiert<br />
und reflektiert werden können (vgl. ebd.).<br />
3.4 Kinderdelinquenz<br />
Man muss diesen Begriff nicht lieben. Aber<br />
man sollte sich auf Grund empirisch unterfütterter<br />
Aussagen mit dem Sachverhalt<br />
auseinandersetzen. Auch wenn er für<br />
manche zunächst bloß ein Produkt eines<br />
gegenwärtig für überdreht gehaltenen Sicherheits-<br />
und Anpassungsdiskurses ist.<br />
Natürlich unterliegen die Diskussionen über<br />
Delikte von strafunmündigen Kindern einer<br />
medialen Eigendynamik. Diese ergibt sich<br />
durch die Konzentration auf spektakuläre Einzelfälle.<br />
Einerseits hört man aus der Bundesrepublik<br />
von einer überproportionalen Zunahme<br />
von tatverdächtigen Kindern.<br />
Anderseits spricht die Jugendwohlfahrts-Praxis<br />
in vermehrtem Maße von „Problemkindern“<br />
aus hochgradig belasteten Wohn- und Lebensverhältnissen.<br />
Dabei berichtet man von der Er-<br />
fahrung, dass man mit sogenannten herkömmlichen<br />
Methoden nicht mehr weiter kommt. Es<br />
wird argumentiert, es könne nicht mehr die<br />
Fürsorge für diese Kids handlungsleitend sein,<br />
sondern es wird die Kontrolle des Bedrohungspotentials<br />
der Kids handlungsleitend: Also<br />
eine Ablösung des „Förderungsparadigmas“<br />
durch das „Störungs- und Präventionsparadigma“.<br />
Dabei wird allerdings Prävention häufig<br />
nicht mehr als sozialintegrierende Prävention<br />
verstanden sondern als Überwachungsmaßnahme<br />
im Vorfeld. Kommt also das „Big Brother<br />
Paradigma“ auf uns zu?<br />
Zunächst ist allerdings einmal ein Innehalten<br />
angesagt: Bei den kindlichen Delikten dominiert<br />
eindeutig der episodenhafte einfache Ladendiebstahl.<br />
Die erhöhte Rate der tatverdächtigen<br />
Kids hängt hier wohl zusammen mit einem<br />
im Vergleich zu früher rigoroserem Anzeigeverhalten.<br />
Und außerdem ist ziemlich gut<br />
belegt, dass diese Art von Kinderdelinquenz<br />
keine Einstiegsdelinquenz darstellt. Zu beachten<br />
ist aber doch, dass sich bis zu 60 % der<br />
kindlichen Delinquenz bei einer relativ kleinen<br />
Gruppe von Mehrfach- oder Intensiv-Tätern<br />
konzentriert (vgl. WOLFERSDORFF, 2002, S.<br />
516ff).<br />
Zwar finden sich auch hierbei überwiegend<br />
leichtere Deliktarten, welche schließlich nicht<br />
mehr als ein bloß vorrübergehendes Entwicklungsphänomen<br />
darstellen.<br />
Hier finden sich aber auch die schwierigen Fälle.<br />
Und das ist dann doch besorgniserregend:<br />
Die Gewaltdelikte scheinen in dieser Gruppe<br />
zuzunehmen. So wenig bei den leichten ubiquitären,<br />
episodenhaften Deliktarten, welche häufig<br />
mit dem Austesten von Grenzen, der Selbstwertbestätigung<br />
oder dem Statuserwerb in<br />
der Gruppe zu tun haben, eine institutionelle<br />
Intervention angebracht ist – sie ist nicht nur<br />
nicht angebracht, sondern kontraindiziert – so<br />
sehr ist klar, dass Gewaltdelikte wie Körperverletzung<br />
und Raub eine ernste sozialpädagogische<br />
Heraus-forderung darstellen.<br />
Das arbeitet auch ein Forschungsteam im Rahmen<br />
des DJI heraus, welches zwischen 1997<br />
und 2000 ein umfangreiches Projekt zur Delinquenz<br />
von Kindern und Jugendlichen durchgeführt<br />
hat (vgl. u.a. HOOPS/PERMIEN, 2002, S.<br />
66ff).<br />
Dabei wurde deutlich gemacht, dass die Jugendwohlfahrt<br />
in erster Linie zu prüfen hat, ob<br />
In der Tat: Die Einschätzung, was in einem<br />
konkreten Fall bzw. ob überhaupt etwas zu tun<br />
ist, bzw. ob überhaupt etwas getan werden<br />
sollte, ist nicht einfach (vgl. dazu auch die Aus-<br />
führungen am Ende von Abschnitt 3.3).<br />
Das diesbezügliche Fazit des Projektes war:<br />
„Wenn die Jugendwohlfahrt eine Chance ha-<br />
ben soll, festzustellen, ob eine polizeiliche Auf-<br />
fälligkeit mit Erziehungsschwierigkeiten im<br />
Zusammenhang steht und ob ein Hilfebedarf<br />
besteht, und wenn die Jugendwohlfahrt die<br />
Bereitschaft der Eltern und Kinder erhöhen<br />
will, dann müsste das möglichst bald nach<br />
dem Kontakt mit der Polizei geschehen. Denn<br />
auch wenn Kinderdelinquenz in der Mehrheit<br />
der Fälle von der Familie selbst bewältigt wer-<br />
den kann, legt der Blick auf ‚Delinquenzkarrie-<br />
ren’ den Schluss nahe, dass die Jugendwohl-<br />
fahrt den Polizeimeldungen anfangs manchmal<br />
zu wenig ‚Signalfunktion’ beigemessen und<br />
somit Präventions-maßnahmen verspielt hat“<br />
(HOOPS/PERMIEN 2002, S. 67).<br />
Das heißt aber auch, dass die Schnittstellen<br />
zwischen Polizei und Jugendwohlfahrt bear-<br />
beitet werden müssen – sowohl von Seiten der<br />
Polizei als auch von Seiten der Jugend-wohl-<br />
fahrt. Eine konstruktive Zusam-menarbeit von<br />
sachkundigen MitarbeiterInnen auf beiden Sei-<br />
ten dürfte den gefährdeten Kids langfristig<br />
zum Vorteil gereichen und kann m. E. nicht von<br />
vornherein ausschließlich als staatliche Re-<br />
pression gedeutet werden. Zumindest geben<br />
Modellprojekte in Deutsch-land zu optimist-<br />
ischen Sichtweisen in Bezug auf die Förderung<br />
der Kids Anlass (vgl. ebd.).<br />
Auf ein Ergebnis aus diesem Projekt sei aber<br />
noch besonders hingewiesen: „Trotz der ein-<br />
deutigen Zuständigkeitspriorität der Eltern<br />
beim Thema Kinderdelinquenz stießen die<br />
Projektmitarbeiter/innen zu Beginn des Pro-<br />
jektes eher auf Unkenntnis und Unsicherheit in<br />
den Handlungsstrategien bei den Fachkräften<br />
76 . Nr.63 . SIT<br />
SIT . Nr.63 . 77<br />
das Wohl des straffällig gewordenen Kindes<br />
gefährdet sei. Prüfen heißt – entsprechend der<br />
Kenntnis der Ubiquität und Episodenhaftigkeit<br />
der Kinderdelinquenz – dass die Jugend-wohl-<br />
fahrt nicht automatisch reagiert. In 20 % der<br />
Fälle reagiert sie tatsächlich nicht (das scheint<br />
mir angesichts der Ubiquität relativ wenig zu<br />
sein). In anderen Fällen sind Hausbesuche etc.<br />
angekündigt.<br />
schwerpunkt österreich
österreichder Probleme österreichauch wenn schwerpunkt österreich<br />
der Jugendwohlfahrt, was die Ressourcen,<br />
aber auch die Defizite und den Unterstützungsbedarf<br />
von Familien im Hinblick auf die Kinder-<br />
delinquenz angeht“ (ebd., S 68).<br />
Wichtig wäre vor allem die Rolle der Eltern in<br />
Bezug auf Normsetzung, Normverdeutlichung<br />
zu stärken und sie zu einem dialogischen Um-<br />
gang mit ihren Kindern zu befähigen, um deren<br />
Taten zu reflektieren und sie auf solche Weise<br />
gemeinsam besser zu bewältigen.<br />
Auch der Aufbau prosozialer Netze wäre eine<br />
wichtige sozialpädagogische Unterstützung.<br />
Die professionelle Jugendwohlfahrt wird über-<br />
dies Bemühungen der Familie um eine Lösung<br />
der Probleme zunächst immer aner-kennen,<br />
auch wenn sie auf den ersten Blick nicht funk-<br />
tional sein mögen. Sie können aber die Basis<br />
abgeben für weitere Hilfe-prozesse. Überhaupt<br />
dürfte es sich in der Mehrzahl der Fälle als<br />
sinnvoll heraus stellen, nicht nur Angebote an<br />
die Kinder zu richten, sondern immer auch die<br />
Eltern und die Stärkung ihrer Ressourcen in<br />
den Blick zu nehmen.<br />
3.5 Drogenproblematik<br />
Von der Kinderdelinquenz ist es oft nur<br />
ein kleiner Schritt zur Jugenddelinquenz.<br />
Diese ist in den letzten Jahren um 66 % ange-<br />
stiegen (vgl. Die Presse, 15.03.2003). Das war<br />
eine<br />
der schlimmen Meldungen der letzten Wo-<br />
chen. Vor allem die Drogendelikte sind massiv<br />
angestiegen (60 %). Hinter diesen „nackten“<br />
Zahlen kann sich eine breite Palette von Grün-<br />
den verbergen – neue Fahndung-smethoden<br />
der Polizei, eine strengere Hand-habung der<br />
Untersuchungshaft, neue Sucht-mittelbestim-<br />
mungen etc. Es steht jedenfalls nicht von vorn-<br />
herein fest, dass die gestiegene Einsperrpraxis<br />
auch gleich ein verändertes Jugendlichen-Ver-<br />
halten abbildet. Soviel zu Problematisierung<br />
der „reinen“ Zahlen.<br />
Und doch ist das Thema „Konsum illegaler<br />
Drogen“ eines, welches uns nicht erst seit<br />
dem 14. März bewegt. Zahlreiche Gespräche<br />
mit MitarbeiterInnen einschlägiger Einrich-<br />
tungen (Streetwork, Notschlafstellen, Dro-<br />
genberatung) vermitteln diesen Eindruck<br />
überdeutlich. Überraschenderweise ist in den<br />
drei Jahren von 2000 bis 2002 nur ein Artikel<br />
dazu in den besagten Zeitschriften (SPI) zu<br />
finden. Doch das letzte Heft von März 2003<br />
von SIO hat dieses Thema zum Leitthema<br />
gewählt und sehr vielfältig andiskutiert.<br />
Jedenfalls ist für das Verhältnis von Jugendwohlfahrt<br />
und Drogen gegenwärtig konstitutiv:<br />
Wo bei einer Einrichtung „Jugendwohlfahrt“<br />
drauf steht, dürfen keine Drogen „drin“<br />
sein.<br />
Schon viel zu lange versucht die Jugend-wohlfahrt<br />
das Problem der Suchtprävention und die<br />
Drogenarbeit an ExpertInnen außerhalb des<br />
eigenen Hilfesystems zu delegieren. Man bemüht<br />
sich krampfhaft, das Drogenproblem aus<br />
den Einrichtungen der Jugendwohlfahrt im<br />
wahrsten Sinne des Wortes auszusperren. Das<br />
führt dann zu solch kreativen Lösungen wie im<br />
Schlupfhaus in Graz, dass Schließfächer vor der<br />
Haustür angebracht werden. Die KlientInnen<br />
überschreiten die Schwelle also „drogenfrei“.<br />
Das kann wohl nicht der „Jugendwohlfahrts-<br />
Weisheit“ letzter Schluss sein.<br />
Wir reden immer davon, dass wir im Rahmen<br />
der Jugendwohlfahrt „Lebenskompetenz“ vermitteln<br />
wollen. Das darf aber keine Beschwörungsformel<br />
bleiben. Es müssen Mittel und<br />
Wege gefunden werden, Lebens-kompetenz in<br />
die Erziehung und Bertreuung von gefährdeten<br />
Jugendlichen zu bringen; sie müssen lernen zu<br />
leben, ohne sich selbst dabei nachhaltig zu<br />
schädigen.<br />
„Suchtvermeidung“ wird sich im Rahmen<br />
unserer Gesellschaft wohl nicht realisieren<br />
lassen. Sobald man allerdings zugesteht, dass<br />
Drogenkonsum integraler Bestandteil unserer<br />
Gesellschaft ist, muss man die ausschließliche<br />
Defizitperspektive verlassen. Suchtprävention<br />
kann dann, wie gesagt, nicht mehr auf<br />
bloße Suchtvermeidung reduziert werden. Es<br />
geht um den Aufbau von Risikokompetenz,<br />
um die Förderung von Resilienzfaktoren.<br />
Im Rahmen der akzeptierenden Drogenarbeit<br />
wird darüber in der Gesellschaft bereits erheblich<br />
offener gesprochen als noch vor wenigen<br />
Jahren. Auch die internationalen Entwicklungen<br />
und Erfahrungen wirken hier unterstützend.<br />
Wenn z.B. in der benachbarten Schweiz<br />
(mit ihrer massiv belasteten Vergangenheit<br />
in punkto Drogen) bald darüber abgestimmt<br />
werden soll, ob die „4-Säulen-Drogenpolitik“<br />
(Repression, Prävention, Reha-bilitation, Schadensminderung)<br />
ebenso gesetz-lich verankert<br />
werden soll, wie die heroingestützte Behandlung<br />
und der Cannabiskonsum (inkl. Anbau für<br />
den eigenen Verbrauch) legalisiert werden soll,<br />
dann bewirkt das doch einen Nachdenkprozess<br />
auch bei uns – so ist zumindest zu hoffen.<br />
(vgl. HAFEN 2003, S. 28). Damit würden weite<br />
Bereiche in diesem Feld endlich entkriminalisiert<br />
werden mit all den erwartbaren positiven<br />
Nebeneffekten und Folgen.<br />
Doch insgesamt möchte man sich in der Literatur<br />
nach wie vor nicht festlegen. Man scheut die<br />
Verantwortung klarer Aussagen. Hier verlässt<br />
uns der Mut. Wir versuchen darum herumzureden,<br />
wie z.B.: „Eine drogenfreie Gesellschaft<br />
gibt es nicht“. Oder: „Die Steigerung der Risikokompetenz<br />
lässt hoffen, dass die populistische<br />
Fixierung auf den letztlich siegreichen ‚Kampf<br />
gegen die Drogen’ sich nach einer überlangen<br />
Periode drogenpolitischer Stagnation von selbst<br />
erledigt“ (WOLFFERSDORFF 2002, S. 519).<br />
Mit solchen Aussagen verbaut man sich jedenfalls<br />
nichts. Klar ist aber wohl auch, dass<br />
Drogenersatzprogramme (Methadon) oder<br />
eine heroingestützte Be-handlung (was ist<br />
die Einstiegsschwelle für die ärztliche Verschreibung?)<br />
notwendig eine sozialpädagogische<br />
Begleitung und Strukturierungshilfe<br />
für die Alltagsbewältigung brauchen.<br />
Ernst genommen werden sollte u.a. auch<br />
der Wunsch der Jugendlichen, möglichst<br />
niedrigschwellige unspezifische Beratungsangebote<br />
zur Verfügung zu haben. Und<br />
schließlich ist neben entsprechenden Verbesserungen<br />
des Freizeitangebotes auch<br />
eine längerfristige Wohnversorgung für<br />
konsumierende Jugendliche sicher zu stellen<br />
(vgl. AUFERBAUER u.a. 2002, S. 105f).<br />
Jedenfalls sollte die Jugendwohlfahrt sich<br />
nicht ausklinken sondern aktuell hier ansetzen<br />
und dabei auch professionsübergreifend<br />
mit Ärzten, Psychiatern und Apothekern<br />
eine Zusammenarbeit anstreben. Eine Weiterführung<br />
der Präventions- bzw. Interventionsmaßnahmen<br />
in die Lebenswelt der<br />
Jugendlichen könnte über sozialraumorientierte<br />
bzw. gemeindenahe Suchtprävention<br />
erfolgen (vgl. FAZEKAS 2002, S. 55ff).<br />
Und vor allem sind die MitarbeiterInnen der<br />
Jugendwohlfahrtseinrichtungen entsprechend<br />
aus- und weiter zu bilden. So heißt es z.B.<br />
neuen Konsumgewohnheiten auf den Fersen<br />
Neben diesen fünf behandelten Berei-<br />
chen wären für die Diskussion der aktu-<br />
ellen Jugendwohlfahrtsprobleme zwei<br />
Themen noch von besonderem Interesse:<br />
a) Die Verbindung von Jugendwohlfahrt und<br />
Kinder- und Jugendpsychiatrie: Hier würde<br />
zu diskutieren sein, wie man mit dem The-<br />
ma geschlossen Unterbringung umgeht. Im<br />
steirischen Jugendwohlfahrtsplan (vgl. 1999<br />
S. 117) ist die Entwicklung einer langfristi-<br />
gen Zusammenarbeit als Projekt angeregt.<br />
Bisher wird daran m. W. nicht gearbeitet.<br />
b) Eine ausführliche Diskussion soll-<br />
te der Sozialraumorientierung in der<br />
Jugendwohlfahrt gewidmet werden<br />
– in dem Sinne: „Vom Fall zum Feld“ – zur Vernetzung<br />
– zum Sozialraumbudget.<br />
4. Einige Augenblicke – Geschichte<br />
Ich habe fünf Bereiche näher herausgearbeitet,<br />
bei denen ich mir für die Jugendwohlfahrt in<br />
Österreich in naher Zukunft vermehrte Diskussionen<br />
und Entwicklungen wünsche.<br />
Abschließend möchte ich noch einige wenige<br />
Blicke – dem Referatsthema entsprechend<br />
- in die Geschichte werfen.<br />
78 . Nr.63 . SIT<br />
SIT . Nr.63 . 79<br />
zu bleiben. Ein mäßiger Cannabis-Konsum ist<br />
schließlich etwas völlig anderes als ein Can-<br />
nabis-Flash in der Früh – vor der Schule oder<br />
der Lehre. Solche neuen Konsumgewohnheiten<br />
gefährden nämlich die Leistungen in der Schu-<br />
le und im Beruf und führen zu sozialen Kolla-<br />
teralschäden – mit all den negativen Folge-<br />
wirkungen. Dies sollte bei einer Freigabe von<br />
Cannabis-Konsum verantwortungsbewusst<br />
mitüberlegt werden. (Vielleicht bewirkt die<br />
Freigabe ohnedies, dass gefährdende „kicks“<br />
gar nicht mehr so gefragt sein werden.) Je-<br />
denfalls hat das Bild des existenziellen Elends,<br />
welches ich vor einigen Jahren am Limmat-Kai<br />
in Zürich gewonnen habe, in mir den Eindruck<br />
verstärkt, dass eine lediglich abolitionistische<br />
Argumentation im praktischen Diskurs nicht<br />
verantwortbar ist. Aus diesen Gründen würde<br />
ich einen Weg, den die Schweiz in der Drogen-<br />
politik zu gehen beabsichtigt, unter der Vor-<br />
aussetzung einer sorgfältigen und kritischen<br />
Begleitung auch für Österreich begrüßen.<br />
schwerpunkt österreich
österreich(1878 – schwerpunkt österreich<br />
4.1 Die klassische Heroengeschichte<br />
Ihre Rekonstruktion scheint mir um so wich-<br />
tiger, als die Kenntnis anscheinend immer<br />
mehr verloren zu gehen droht, dass Österreich<br />
einen beachtenswerten Beitrag zur Geschich-<br />
te der Sozialpädagogik aufzuweisen hat. Ich<br />
kann diese Befürchtung des Geschichtsverlustes<br />
damit belegen, dass im äußerst infor-<br />
mativen und bemerkenswerten Handbuch<br />
Sozialarbeit/Sozialpädagogik von OTTO und<br />
THIERSCH (vgl. 2001) von den Klassikern der<br />
Sozialarbeit bzw. der Sozialpädagogik, wel-<br />
che Österreich hervorgebracht hat, lediglich<br />
Ilse ARLT eine Würdigung erfährt. Es fehlen<br />
so berühmte Namen wie August AICHHORN<br />
(1878 – 1949), Siegfried BERNFELD (1892<br />
– 1953), Hildegard HETZER, Paul LAZARS-<br />
FELD, Fritz REDL (1902 – 1988) und Bruno BET-<br />
TELHEIM (1903 – 1990). Wahrscheinlich sollte<br />
auch Julius TANDLER genannt werden.<br />
4.2 Die Geschichte der Opfer<br />
Natürlich kann man eine Geschichte der So-<br />
zialen Arbeit in Österreich auch ganz anders<br />
anlegen – weniger klassisch, weniger hero-<br />
isch. Man könnte einfach damit beginnen, dass<br />
mindestens 493.670 tote Kinder den Beginn<br />
des Weges der Profession der Sozialen Arbeit<br />
in Österreich säumen. Das sind 68 % der über<br />
730.230 Kinder, welche im Zeitraum von 1784<br />
bis 1910 im Wiener Findelhaus aufgenommen<br />
wurden (vgl. PAWLOWSKY 2001, S. 200).<br />
Bevölkerungsvermehrung sowie der pro-<br />
duktive Einsatz der Untertanen zum Nut-<br />
zen des Staates waren wichtige Ziele des<br />
aufgeklärten Absolutismus in Österreich.<br />
Somit wurde die Säuglings- und Kinderfür-<br />
sorge zu einem seiner deklarierten Ziele.<br />
Prinzipielles:<br />
Die Einrichtung von Gebär- und Findelhäuser<br />
als Organisationen, in welchen unverheira-<br />
tete Frauen Schutz finden und ihre Kinder<br />
zurück lassen konnten, war die zeitgemä-<br />
ße Antwort auf die seit dem Ende des 18.<br />
Jhs. steigende Zahl unehelicher Geburten<br />
und auf den von aufgeklärten Zeitgenos-<br />
sen diskutierten Kindsmord (vgl. z.B. J.H.<br />
PESTALOZZI: Über Gesetzgebung und Kin-<br />
dermord 1783; Goethes Gretchen in FAUST<br />
– Aufarbeitung eines Prozesses in Frankfurt/M.<br />
aus den 70er Jahren des 18. Jhs.).<br />
Das Personal des Findelhauses hatte neben der<br />
Erstversorgung der hier geborenen bzw. abgegebenen<br />
Säuglinge v.a. die Aufgabe, diese an<br />
Pflegestellen (Pflegeeltern) zu vermitteln und<br />
die in Außenpflege befindlichen Kinder zentral<br />
zu verwalten. So mussten etwa im Jahr 1894<br />
27.500 Kinder durch die Anstalt versorgt werden.<br />
Dazu waren 29 Männer angestellt (vgl.<br />
PAWLOWSKY 2001, S. 109ff). Daneben gab es<br />
Ärzte, Hebammen, Pflichtammen, Wärterinnen<br />
etc.). Diese Vermittlungs-, Verwaltungs- und<br />
Betreuungstätigkeit führte neben der Kontrolltätigkeit<br />
des friendly visiting im Bereich<br />
der Armenfürsorge (vgl. MÜLLER 1988²) zu<br />
den Wurzeln des Berufs der Sozialen Arbeit.<br />
4.3 Ein skizzenhafter Streifzug durch das 20.<br />
Jh.<br />
Hier kann lediglich ein skizzenhafter Überblick<br />
über weitere Entwicklungen in der Jugendwohlfahrt<br />
gegeben werden. In Weiterführung<br />
des Phänomens Findelhaus soll die Einführung<br />
der Berufsvormünder als obligatorische Vertretung<br />
der unehelichen Kinder genannt werden.<br />
(1914) (vgl. PAWLOVSKY 2001, S. 198);<br />
Mit der Einführung des 1. JUGENDGERICHTS-<br />
GESTZES im Jahr 1928 wurde erstmals in<br />
Österreich „eine eigene Jugendgerichtsbarkeit“<br />
geschaffen. Es erkannte dieses JGG<br />
die Priorität der Erziehung des straffälligen<br />
Jugendlichen vor dessen Bestrafung an<br />
(vgl. BOGENSBERGER 1992, bes. S. 31f).<br />
„Heilen statt Bessern“ war das Motto, welches<br />
A. AICHHORN im Zusammenhang mit dem Jugendgerichtsgesetz<br />
von 1928 in die Diskussion<br />
gebracht hat (vgl. MAIERHOFER 1996, S. 64). Das<br />
war eine noch weiter reichende Zielstellung.<br />
Daher konnte die Jugendfürsorge allein mit<br />
dem JGG nicht zufrieden sein. Sie wollte<br />
vorbeugende Maßnahmen bei einem festgestellten<br />
dissozialen Verhalten gesetzlich verankert<br />
sehen und nachsorgende Maßnahmen<br />
ermöglichen: eben „Heilen“ und nicht nur<br />
„Bessern“. Deshalb wurden die Stimmen für<br />
ein Jugendwohlfahrtsgesetz damals besonders<br />
lauter. Die Bemühungen um ein solches<br />
waren zwar in der Ersten Republik – vor allem<br />
im Jahr 1928 – gegeben, aber letztlich nicht<br />
erfolgreich (vgl. MAIERHOFER 1996, S. 202).<br />
Im Jahr 1934 gab es durch die sogenannte<br />
Ständeverfassung sogar einen Rückschritt<br />
insofern, weil in dieser die Kompetenz der<br />
einschlägigen Grundsatzgesetzgebung<br />
nicht mehr enthalten war (vgl. ebd. S. 203).<br />
Damals wurde auch die weltweit gerühmte Fürsorgekompetenz<br />
des Roten Wien unter J. TAND-<br />
LER (1922 – 1933) beendet. Dabei war auch A.<br />
AICHHORN mit seiner Erziehungsberatungsstellen<br />
maßgeblich eingebunden gewesen.<br />
Die Jugendwohlfahrtspraxis in der NS-Zeit<br />
lässt sich sehr gut durch ein Zeitzeugnis<br />
veranschaulichen (vgl. GROSS 2000).<br />
Das erste Jugendwohlfahrtsgesetz konnte<br />
– wie Sie wissen – erst in der Zweiten Republik<br />
(1954) verabschiedet werden. Diese wurde<br />
schlussendlich 1989 durch das zweite JWG<br />
angelöst. Es bildet in mehrfach novellierter<br />
Form gemeinsam mit dem KINDSCHAFTS-<br />
RECHTSÄNDERUNGSGESETZ 2000, den<br />
neuen JUGENDSCHUTZGESETZEN und dem<br />
JUGENDGERICHTSGESETZ 1988 die wesentliche<br />
leitende Rechtsmaterie für die Soziale<br />
Arbeit. Aber nur das Jugendförderungsgesetz<br />
und das Jugendvertretungsgesetz sollte<br />
hier nicht ganz unberücksichtigt bleiben.<br />
Für das JGG 1988 sind v.a. die vier Maßnahmen<br />
der Diversion (BUSSGELD,<br />
ATA, Gemeinnützige Arbeit, Probezeit<br />
von einem bis zu zwei Jahren) als wichtig<br />
für die Jugendwohlfahrt zu nennen.<br />
Einige Anläufe zu einer Reform der Heimerziehung<br />
im Laufe der 60er und 70er Jahre des<br />
vorigen Jahrhunderts (Spartakus Bewegung:<br />
„Öffnet die Heime“; Ende der 60er Jahre;<br />
„Wiener Weg der Heimerziehung“ und Heimenqueten<br />
des Jugendamtes Wien Anfang<br />
der 70 und 80er Jahre (vgl. SCHEIPL 2001, S.<br />
210ff)) rüttelten die Jugendwohlfahrt wach.<br />
Wichtige Impulse zu Alternativen in der Heimerziehung<br />
wurden ebenfalls Anfang der 80er<br />
Jahre gesetzt. Auf diese Weise wurde das Feld<br />
für die Umsetzung des JWG 1989 aufbereitet.<br />
Dieses ist nach mehr als zehnjähriger Beratung<br />
endlich 1989 verabschiedet worden.<br />
Der darin enthaltene moderne Dienstleistungsaspekt<br />
sowie das Subsidiaritätsprinzip<br />
ermöglichten in den 90er Jahren meines<br />
Erachtens durchaus eine progressive Ent-<br />
5. Schlussbemerkung<br />
Eine ehemals progressive Entwicklung<br />
in der österreichischen Jugendwohlfahrt<br />
scheint momentan in eine Abschwung-<br />
phase eingetreten zu sein.<br />
Daher sind Veranstaltungen wie diese wichtig,<br />
damit die Idee das Aufbruchs, welche mit dem<br />
Begriff „Sozialpädagogisches Jahrhundert“ in<br />
Verbindung zu bringen ist, nicht verloren geht.<br />
Ich meine, die Jugendwohlfahrt braucht am<br />
Beginn eines neuen Jahrhunderts wieder star-<br />
ke Impulse. Und diese kommen aus solchen<br />
Veranstaltungen, wie diese eine ist.<br />
80 . Nr.63 . SIT<br />
SIT . Nr.63 . 81<br />
Literatur:<br />
ADER, S./SCHRAPPER, Chr.: Wie aus Kindern<br />
in Schwierigkeiten „schwierige Fälle“ werden.<br />
In: Forum Erziehungshilfen. 1/2002, S. 27 – 34.<br />
AMT der STEIERMÄRKISCHEN LANDESRE-<br />
GIERUNG (Hg.): Steirischer Jugendwohlfahrts-<br />
plan 1999. Graz 1999.<br />
Aus für die Bundes-Jugendwohlfahrts-Sta-<br />
tistik? In: Der österreichische Amtsvormund<br />
2000, S. 200.<br />
AUFERBAUER, M./EPPICH, Chr./ Bedarfsana-<br />
lyse psychosozialer Begleitmaßnahmen für<br />
HUTSTEINER, Th./SEEBAUER, S.: Jugendliche<br />
mit problematischem Drogenkonsum in Graz.<br />
Graz 2002 (http://www.suchthilfe-graz.at/<br />
SHG_welcome.htm)<br />
BAVING, L.: Im Spannungsfeld zwischen Ju-<br />
gendpsychiatrie und Jugendhilfe. In: Forum<br />
Erziehungshilfen 5/2002, S. 280 – 286.<br />
BOGENSBERGER, W.: Jugendstrafrecht und<br />
Rechtspolitik. Wien 1992.<br />
BÖHNISCH, L./SCHRÖER, W.: Die soziale Bür-<br />
wicklung z.B. das Reformkonzept der Stadt<br />
Wien: „Heim 2000“ und andere Reformen in<br />
den einzelnen Bundesländern, welche die<br />
private Trägerschaft in der Jugendwohlfahrt<br />
entsprechend betont und dabei Alternativen<br />
und neue Ansätze – wie z.B. Kriseninterventi-<br />
onszentren etc. – hervorgebracht haben.<br />
schwerpunkt österreich
österreichner Zeitschrift österreich– 60.<br />
schwerpunkt österreich<br />
Hermann Putzhuber<br />
gergesellschaft. Weinheim, München, 2002. Bd. 1. Weinheim, Basel 1988².<br />
BUNDES-JUGENDWOHLFAHRTSGESETZ, MÜLLER, C.W.: Helfen und Erziehen. Beltz.<br />
JU-Quest: ExpertInnenbefragungen zu Entwicklungen in der Jugendwohlfahrt<br />
BGBl I 161/1989; Novelle von 1989 (BGBl I. 53/ Weinheim. 2002.<br />
1999 vom 9.4.1999).<br />
PANTUCEK, P.: Möglichkeiten und Grenzen<br />
Projektpräsentation<br />
eines relativ selbstständigen Abschnitts „Dia-<br />
BRANDAU, H.: Das ADHS-Puzzle, systemischgnose“<br />
im Family Casework. Kurzfassung eines<br />
Sehr geehrte Damen und Herren!<br />
relevanten und für alle Interessierten über das<br />
evolutionäre Aspekte und klinisch-sozialpäd-<br />
Referates, gehalten auf der Jahrestagung des<br />
Ich freue mich, Ihnen hier und heute ein spannendes,<br />
neues Projekt präsentieren zu können<br />
Graz 2003.<br />
in Werfenweng, Salzburg am 19.05.1999.<br />
und möchte mich als erstes bei den Veranstal-<br />
Auf welchem Weg sollen diese Ziele erreicht<br />
BÜRGER, U.: Ambulante Erziehungshilfen und<br />
terInnen bedanken, dass sie uns die Gelegen-<br />
werden?<br />
Heimerziehung, Frankfurt/M. 1998.<br />
PAWLOWSKY, V.: Mutter ledig – Vater Staat.<br />
heit gegeben haben, JU-Quest im Rahmen die-<br />
Wie bereits erwähnt führen wir Befragungen<br />
Internet nutzbaren Wissens-Pool führen.<br />
agogische Konsequenzen. Habilitationsschrift Bundessozialamtes/Mobile Beratungsdienste<br />
Das Gebär- und Findelhaus in Wien 1784<br />
ser Tagung vorzustellen.<br />
von ExpertInnen zu Entwicklungen in der ös-<br />
FAZEKAS, Chr.: Zur Methodik gemeindenaher – 1910. Innsbruck 2001.<br />
Mein Name ist Hermann Putzhuber, ich bin terreichischen Jugendwohlfahrt durch.<br />
Suchtprävention am Modell Trofaiach. In: Wie-<br />
Die PRESSE: Unabhängige österreichische Tageszeitung<br />
für Österreich vom 15.3.2003. Mandorf<br />
und Projektleiter von JU-Quest, einem in-<br />
Anfang an auf das Schneeball-System gesetzt.<br />
– 60.<br />
fred SEEH: Kampf gegen die Hinterräume.<br />
stitutionsübergreifenden und österreichweiten<br />
Die Initiative für das Projekt ging vom Leiter<br />
GROSS, J.: Spiegelgrund. Leben in NS-Erzie-<br />
OLK, T.: Versäulung der Hilfen. Paper auf dem<br />
Projekt.<br />
des Fachbereiches Pädagogik von SOS-Kinder-<br />
hungsanstalten. Wien 2002.<br />
internationalen Kongress der IGfH am 19.9.2002<br />
Wenn ich Sie begrüße mit „Herzlich Willkom-<br />
dorf, Dr. Christian Posch, aus. Er konnte Fach-<br />
HAFEN, M.: Suchtpolitik in der Schweiz. In:<br />
in Berlin.<br />
men bei http://www.ju-quest.at“ dann finden<br />
leute aus unterschiedlichen Arbeitsfeldern<br />
SIO 1/2003, S. 28 – 29.<br />
OTTO, H.U./THIERSCH, H.: Handbuch<br />
sich hier bereits einige Anhaltspunkte dafür,<br />
und Bundesländern dafür gewinnen, sich als<br />
HANSBAUER, P./ SCHNURR, St.: Riskante Ent-<br />
Sozialarbeit/Sozialpädagogik. Neuwied/Kriftel<br />
was JU-Quest ist bzw. sein soll.<br />
Steuerungsgruppenmitglieder für das Projekt<br />
scheidungen in der Sozialpädagogik. In: Zeit-<br />
2001.<br />
„ju“ steht für Jugendwohlfahrt – und zwar die<br />
zu engagieren. Diese Steuerungsgruppe entwi-<br />
schrift für Erziehungswissenschaft 1/2002, S.<br />
SCHEIPL, J.: Jugendwohlfahrtsplanung in<br />
österreichische. „quest“ kommt von „question“<br />
ckelte das Projekt inhaltlich und jedes Mitglied<br />
73 – 94.<br />
Österreich. In: KNAPP, G./SCHEIPL, J (Hg.):<br />
aber auch von „questionnaire“, hat also etwas<br />
der Steuerungsgruppe kontaktierte mehrere<br />
HINTE, W.: Fall im Feld. In: Sozialmanagement Jugendwohlfahrt in Bewegung. Reforman-<br />
mit Fragen, Befragungen, Fragebögen zu tun<br />
ExpertInnen um sie für die Teilnahme an den<br />
6/2001, S. 10 – 13 (2001a).<br />
sätze in Österreich. Klagenfurt u.a. 2001,<br />
oder bedeutet auch schlicht „Suche“. „http:<br />
Befragungen zu gewinnen. Auf diese Weise<br />
HINTE, W.: Sozialraumorientierung und das<br />
S. 283 – 303.<br />
//www“ deutet darauf hin, dass das Ganze<br />
wurde für die erste Befragung eine Gruppe<br />
Kinder- und Jugendhilferecht – ein Kommentar<br />
SCHEIPL, J.: Soziale Arbeit. Sozialpolitik. In: G.<br />
etwas mit dem Internet zu tun hat. Wenn Sie<br />
von 60 ExpertInnen aus unterschiedlichsten<br />
aus sozialpädagogischer Sicht. In: Sozialpäd. KNAPP/K. LAUERMANN (Hg.) 2003. Im Druck.<br />
den Untertitel aus dem Logo hinzunehmen,<br />
Arbeitsfelder gefunden, wobei darauf geachtet<br />
Institut im SOS-Kinderdorf e.V. (Hg.): Sozialrau-<br />
dann könnte man das Projekt JU-Quest in ei-<br />
wurde, dass alle Bundesländer vertreten sind.<br />
morientierung auf dem Prüfstand. Frankfurt/M. SCHEIPL, J.: Heimreform in der Steiermark<br />
nem Satz beschreiben mit: JU-Quest ist auf<br />
Den Begriff „ExpertIn“ haben wir dabei weit<br />
2001, S. 125 – 156 (2001b).<br />
1980 – 2000. In: KNAPP, G./SCHEIPL, J. (Hg.):<br />
der Suche nach Trends in der österreichischen<br />
gefasst, gleichzeitig aber auch spezifisch fo-<br />
Jugendwohlfahrt in Bewegung. Klagenfurt<br />
Jugendwohlfahrt und nutzt dabei die Möglich-<br />
kussiert. Die Steuerungsgruppe von JU-Quest<br />
HOOPS, S./PERMIEN, A.: Straffälliges Verhalten 2001, S. 208 – 219.<br />
keiten des Internets. Da damit aber noch nicht<br />
hat sich entschieden, als ExpertInnen die<br />
von Kindern. In: Neue Kriminalpolitik 2/2002, SCHEIPL, J./PFOSER, B./ Jugend Eggenberg<br />
viel gesagt ist, möchte ich doch etwas weiter<br />
Menschen anzusprechen, die in verschiedenen<br />
S. 66 – 70.<br />
2000. Eine kleinräumliche Sozialraumanalyse.<br />
ausholen.<br />
Feldern der Jugendwohlfahrt arbeiten bzw. in<br />
JUGENDGERICHTSGESETZ 1988 in der Novel-<br />
LEODOLTER, M./KERN, S.: Graz 2000.<br />
Arbeitsbereichen tätig sind, in denen sie im-<br />
le gem. BGBl I 19/2001. Kommentierte Texte in:<br />
Welche Ziele verfolgt JU-Quest?<br />
mer wieder mit der Jugendwohlfahrt zusam-<br />
Der österreichische Amtsvormund 160/2001, S.<br />
SCHREIBER, W.: Zum theoretischen Ort sozialpä-<br />
JU-Quest verfolgt im Wesentlichen drei Ziele:<br />
menarbeiten oder mit Jugendwohlfahrtsfragen<br />
97 – 108.<br />
dagogischer Diagnostik. In: Neue Praxis 6/2000,<br />
Diskussion, Vernetzung und Wissen.<br />
beschäftigt sind (z.B. in der Ausbildung von<br />
KINDSCHAFTSRECHTS-ÄNDERUNGSGE-<br />
S. 580 – 586.<br />
Wir wollen eine Plattform für die Diskussion zu SozialpädagogInnen).<br />
SETZ, BGBl I 135/2000. Kommentierte Volltext<br />
WOLFFERSDORFF, Chr. v.: Kinder- und Ju-<br />
Jugendwohlfahrtsfragen zur Verfügung stellen<br />
Diese ExpertInnen befragen wir nach ihren<br />
in: Der österreichische Amtsvormund. 159/<br />
genddelinquenz. In: SCHRÖER, u.a. (Hg.):<br />
und die österreichweite Diskussion fördern. Zu<br />
Einschätzungen, wohin die Jugendwohlfahrt<br />
2001, S. 1 – 53.<br />
Handbuch der Kinder- und Jugendhilfe. Mün-<br />
diesem Zweck führen wir Befragungen von Ex-<br />
sich entwickeln wird. Dabei benutzen wir das<br />
KRAUSKOPF, S.: Sozialraumorientierung in der chen, Weinheim 2002, S. 495 – 525.<br />
pertInnen aus dem Jugendwohlfahrtsbereich<br />
Internet als Medium. Zum einen, weil in Öster-<br />
Jugendhilfe und ihre Planung (Teil 1). In: Unse-<br />
durch, deren Ergebnisse auf unserer Web-Seite<br />
reich relativ viele Menschen privat oder dienst-<br />
re Jugend 10/1999, S. 434 – 438.<br />
veröffentlicht und zu Diskussion gestellt wer-<br />
lich über einen Zugang zum Internet verfügen<br />
MAIERHOFER, A.: Jugendfürsorgepolitik und Univ. Prof. Dr. Josef Scheipl<br />
den. Über diese Diskussion und regelmäßige<br />
und per E-Mail erreichbar sind . Zum anderen<br />
Sozialpädagogik Österreichs in der Ersten Re-<br />
Universität Graz<br />
Tagungen der ExpertInnen soll die österreich-<br />
weil es ein schnelles und kostengünstiges<br />
wissenschaftlicher Mitarbeiter bei SOS-Kinder-<br />
Bei der Entwicklung des Projektes wurde von<br />
ner Zeitschrift für Suchtforschung 4/2002, S. 55<br />
Institut für Erziehungs- und Bildungswissenschaften<br />
publik. (Phil. Diss.). Graz 1996.<br />
weite Vernetzung von mit Jugendwohlfahrts-<br />
Medium ist um österreichweite Verbindungen<br />
Merangasse 70<br />
themen befassten Menschen unterstützt und herzustellen.<br />
A-8010 Graz<br />
MÜLLER, C.W.: Wie Helfen zum Beruf wurde. e-mail: josef.scheipl@glossa.uni-graz.at<br />
gefördert werden. Befragungen, Diskussion<br />
So wie das Projekt nach dem Schneeballsystem<br />
82 . Nr.63 . und Vernetzung sollen längerfristig zu einem<br />
entstanden ist, so soll es auch weiterwachsen.<br />
SIT<br />
SIT . Nr.63 . 83<br />
schwerpunkt österreich
österreichÜberblick zu schwerpunkt österreich<br />
Zum einen indem TeilnehmerInnen an JU-<br />
Quest weitere ExpertInnen ansprechen, zum<br />
anderen gehen wir davon aus, dass sich im<br />
Laufe der Zeit auch ExpertInnen von sich aus<br />
melden werden, die Interesse an einer Mitar-<br />
beit haben.<br />
Was macht JU-Quest nun konkret?<br />
Wir beabsichtigen zwei Mal pro Jahr eine On-<br />
line-Befragung durchzuführen, wobei wir uns<br />
in einem ersten Schritt an der in der Trendforschung<br />
etablierten Delphi-Methode orientie-<br />
ren.<br />
Im Oktober 2002 wurde eine erste Befragung<br />
mit fünf offenen Fragen durchgeführt, um einen<br />
Überblick zu bekommen, was denn die Themen<br />
sind, mit denen die befragten ExpertInnen kon-<br />
frontiert sind. Die Ergebnisse dieser Befragung<br />
wurden in einem Bericht zusammengefasst<br />
und auf der Web-Seite von JU-Quest veröffent-<br />
licht.<br />
Für die Diskussion wird auf der Web-Seite ein<br />
Diskussionsforum eingerichtet. Und letztend-<br />
lich ist geplant, einmal im Jahr eine Tagung<br />
zu veranstalten, auf der die Befragungsergeb-<br />
nisse auch live diskutiert und neue Kontakte<br />
geknüpft werden können.<br />
Welche Ergebnisse hat die erste Befragung<br />
gebracht?<br />
Die bei der ersten Befragung kontaktierten<br />
ExpertInnen sind österreichweit in verschie-<br />
densten Arbeitsfeldern tätig, u.a. in Jugend-<br />
wohlfahrtsbehörden, in Fremdunterbringungs-<br />
einrichtungen, in der ambulanten Familienbe-<br />
treuung, im Pflegekinderwesen, in Collegs,<br />
Fachhochschulen und Universitäten, im Be-<br />
reich Kinder- und Jugendneuropsychiatrie, bei<br />
der Kinder- und Jugendanwaltschaft oder in<br />
der Sonderschule. Vertreten waren letztendlich<br />
auch Menschen, die selbst fremduntergebracht<br />
waren und sich jetzt beruflich mit Jugendwohl-<br />
fahrtsfragen beschäftigen. Sie wurden zum<br />
größten Teil persönlich kontaktiert, bevor sie<br />
den Fragebogen erhielten. Insgesamt 34 Perso-<br />
nen haben den Fragebogen dann beantwortet.<br />
Zielsetzung dieser Befragung war es, einen<br />
ersten Überblick über die wichtigen Themen<br />
in der österreichischen Jugendwohlfahrtsland-<br />
schaft zu bekommen. Die Antworten haben<br />
ein dementsprechend breites, buntes und zum<br />
Teil auch widersprüchliches Bild der aktuellen<br />
84<br />
. Nr.63 . SIT<br />
Themen, der wahrgenommenen Trends bzw.<br />
der Interpretationen verschiedener Entwicklungen<br />
geliefert. Generalisierende Aussagen<br />
zu einzelnen Entwicklungen sind auf dieser<br />
Basis zwar nicht möglich, sichtbar wird aber,<br />
dass in der österreichischen Jugendwohlfahrt<br />
vieles in Bewegung ist und in den nächsten<br />
Jahren auch noch viele interessante Debatten<br />
und Entwicklungen zu erwarten sind.<br />
Spannungsfelder zeigen sich in bezug auf verschiedenste<br />
Fragen. Wenn es beispielsweise<br />
um Ausbau oder Reduktion von Aufgabenbereichen<br />
geht oder um die Rolle und Finanzierung<br />
präventiver Maßnahmen. Unterschiedlich<br />
sind die Einschätzungen über die Auswirkungen<br />
demographischer Veränderungen und die<br />
Erwartungen in Bezug auf Professionalisierung<br />
und Qualitätssicherung. Die Frage der<br />
Finanzierung von Jugendwohlfahrtleistungen<br />
nimmt einen großen Raum ein. Die Spannung<br />
zwischen Gewünschtem und Befürchtetem,<br />
zwischen Sein und Sollen, zwischen Ausbau<br />
und Abbau oder zwischen Optimismus und<br />
Pessimismus zieht sich mehr oder weniger<br />
durch. Sowohl bei den Einschätzungen der<br />
gesellschaftlichen und (sozial-)politischen Entwicklungen<br />
wie auch bei den Veränderungen<br />
von Aufgaben und Angeboten der Jugendwohlfahrt.<br />
Die nächste Befragung wird auf den vorliegenden<br />
Ergebnissen aufbauen. Dabei wird es darum<br />
gehen, einzelne Tendenzen herauszugreifen<br />
um sie genauer zu beleuchten und auch quantitativ<br />
festzumachen. Die Herausforderung<br />
wird dabei sein, die Fragen so zu formulieren,<br />
dass die Antworten eine vergleichende und<br />
auch quantifizierende Auswertung zulassen.<br />
Auch soll der Kreis der befragten ExpertInnen<br />
im Schneeballsystem erweitert werden.<br />
Mehr Informationen zum Projekt, zu den<br />
Befragungen, das Diskussionsforum und<br />
aktuelle Entwicklungen finden sie auf unserer<br />
Web-Seite unter http://www.ju-quest.at.<br />
Damit bleibt mir nur noch, mich herzlich für<br />
Ihre Aufmerksamkeit zu bedanken.<br />
Schau’n Sie mal rein!<br />
Dr. Hermann Putzhuber<br />
SOS Kinderdorf / Sozialpädagogisches Institut<br />
Staffler Strasse 10a A-6020 Innsbruck<br />
e-mail: hermann.putzhuber@sos-kd.org<br />
<strong>KIZ</strong><br />
Kriseninterventionszentrum<br />
Pradlerstraße 75<br />
6020 Innsbruck<br />
Tel.: 0512/58 00 59<br />
FAX: 0512/58 00 59-9<br />
e-mail: info@kiz-tirol.at<br />
www.kiz-tirol.at<br />
Erreichbarkeit: in Krisenfällen rund um die Uhr<br />
Das <strong>KIZ</strong> stellt Hilfen für Kinder und Jugendliche<br />
und deren Familien in Krisensituationen<br />
bereit.<br />
In den Aufgabenbereich des <strong>KIZ</strong> fallen persönliche,<br />
familiäre und soziale Krisensituationen,<br />
welche Betroffene in ihrem seelischen, geistigen<br />
oder körperlichen Wohl gefährden. Krisen<br />
sind gekennzeichnet durch das Versagen von<br />
bisherigen Problemlösungsmustern.<br />
Gründe für solche Krisen können sein:<br />
• persönliche und/oder familiäre Überforderung<br />
• eskalierende Adoleszenz- und Ablösungskonflikte<br />
• Ausreißerproblematik<br />
• Gewalt in der Familie (physische und psychische<br />
Mißhandlung)<br />
• sexuelle Gewalt<br />
• Vernachlässigung<br />
• gravierende Konflikte im Lebensumfeld<br />
(Schule, Arbeitsplatz, Freunde)<br />
• Suicidgefährdung<br />
Die Arbeit des <strong>KIZ</strong> ist auf kurzfristige, intensive<br />
Hilfe zur Überwindung einer momentanen<br />
Notlage ausgelegt.<br />
Für darüber hinausgehende, längerfristige,<br />
begleitende, beratende oder therapeutische<br />
Hilfen vermittelt das <strong>KIZ</strong> an bestehende Einrichtungen<br />
der Jugendwohlfahrt oder Gesundheitshilfe.<br />
Große Bedeutung bei der Hilfestellung durch<br />
das <strong>KIZ</strong> kommt der Kooperation mit anderen<br />
psychosozialen Einrichtungen bei. Das <strong>KIZ</strong> ist<br />
hier um enge Zusammenarbeit mit - und Unterstützung<br />
von KollegInnen anderer Institutionen<br />
bemüht.<br />
Das Hilfsangebot des <strong>KIZ</strong> umfaßt:<br />
• persönliche oder telefonische Beratung für<br />
Kinder, Jugendliche, Eltern, Angehörige,<br />
HelferInnen und Multiplikator(Inn)en<br />
• kurzfristige und kostenlose Unterbringung<br />
von Jugendlichen in der Zufluchtsstelle<br />
• mobiler Krisendienst<br />
Die Zufluchtsstelle des <strong>KIZ</strong>:<br />
Zur kurzfristigen bzw. mittelfristigen Entlas-<br />
tung der Betroffenen bzw. zur Deeskalation<br />
und Klärung von Krisensituationen stellt das<br />
<strong>KIZ</strong> in seiner Zufluchtsstelle Übernachtungs-<br />
möglichkeiten für max. 7 Jugendliche im Alter<br />
von 12 bis 18 Jahren zur Verfügung.<br />
Nicht aufgenommen werden Jugendliche:<br />
- die pflegebedürftig sind<br />
- mit akuter Alkohol- und Drogenproblematik<br />
- mit psychiatrischer Indikation<br />
Obdachlosigkeit ist kein Aufnahmekriterium<br />
für das <strong>KIZ</strong>.<br />
Die Aufnahme in der Zufluchtsstelle erfolgt gemäß<br />
den gesetzlichen Bestimmungen und un-<br />
ter Berücksichtigung der besonderen Situation<br />
des/der Jugendlichen auf freiwilliger Basis.<br />
Das <strong>KIZ</strong> ist ein Verein der freien Jugendwohlfahrt.<br />
Die Hilfsangebote sind unentgeltlich; finanziert<br />
wird das <strong>KIZ</strong> durch das Land Tirol.<br />
SIT . Nr.63 .<br />
kiz<br />
85