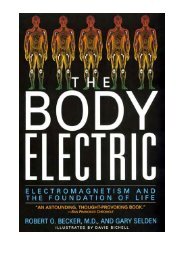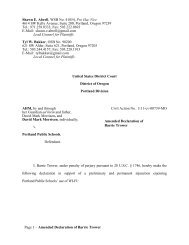Kurzwellentherapie - Micro-ondes
Kurzwellentherapie - Micro-ondes
Kurzwellentherapie - Micro-ondes
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Kurzwellentherapie</strong><br />
Die medizinische<br />
Anwendung elektrischer Höchstfrequenzen<br />
Von<br />
DR. ERWIN SCHLIEPHAKE<br />
Professor der inneren Mcdiiin, Gießen<br />
Unter Mitarbeit von<br />
DR. A. KOHAUT<br />
und<br />
GERT SCHUP.PHAKE<br />
(Physikalische Formeln)<br />
6. überarbeitete Auflage<br />
Mit 203 Abbildungen und 3 Tafeln<br />
GUSTAV FISCHER VERLAG • STUTTGART<br />
i960
SI3G<br />
Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1960<br />
Alle Rechte vorbehalten<br />
Satî: und Druck: Offizin Andersen Ncxrt in Leipzig<br />
einband H.A. lindera, Leipzig<br />
Printed in Germany
Vorwort zur ersten Auflage<br />
Das vorliegende Buch versucht eine zusammenfassende Darstellung der Kurzwellenanwendung<br />
in der Medizin und Biologie zu geben. Eine Reihe von Gesichtspunkten<br />
hat mich zu dieser Arbeit bestimmt.<br />
Das ganze Gebiet ist noch sehr jung; zwar haben schon früher einzelne Beobachtungen<br />
auf die Möglichkeit einer biologischen Wirkung hingewiesen, sie sind<br />
aber nicht systematisch ausgebaut worden. Die Kenntnis der Gesetze, unter denen<br />
die Wirkung auf Substanzen und Organismen vor sich geht, ist erst eine Frucht<br />
der allerletzten Jahre. Erst auf Grund dieser Erkenntnisse konnte der weitere<br />
Schritt gewagt werden, die Kurzwellen bei menschlichen Erkrankungen anzuwenden.<br />
Die Forschungen auf dem neuen Gebiet haben großes Interesse gefunden. Zahlreiche<br />
Anfragen, die aus dem In- und Auslande besonders auch nach technischen<br />
Einzelheiten einliefen, ließen es wünschenswert erscheinen, schon jetzt einen<br />
Überblick über die wichtigsten Tatsachen und Befunde zu geben, der sonst nur<br />
durch mühsames Zusammenlesen einzelner Veröffentlichungen gewonnen werden<br />
kann. Da die neue Therapie schon an mehreren Orten angewandt wird, können<br />
auch zum Nutzen der behandelten Kranken Fingerzeige gegeben werden.<br />
Dazu ist eine Einführung in die technisch-physikalischen Grundlagen unentbehrlich.<br />
Die technischen Ausführungen geben dem Arzt in großen Zügen ein<br />
Bild der Vorgänge, die sich bei der Kurzwellenanwcndung abspielen, und sollen<br />
ihn mit der Handhabung der Apparate bekannt machen. Es ist deshalb nur das berücksichtigt,<br />
was für den Mediziner in Frage kommt. Im physikalischen Teil kam<br />
es mir in erster Linie auf anschauliche Darstellung an. Dazu mußten Vergleiche<br />
herangezogen werden, bei denen auf physikalische Strenge im Interesse der Verständlichkeit<br />
verzichtet werden mußte.<br />
Wer sich über die quantitativen Verhältnisse unterrichten will, findet einige<br />
wesentliche Punkte im Anhang in mathematischer Form gebracht. Der Anhang<br />
will nur den Text ergänzen und enthält daher nur die Formeln, die gerade für<br />
dieses Gebiet wichtig sind. In dem Tcü, der sich mit der Krankenbchandlung befaßt,<br />
habe ich mich bemüht, durch Krankengeschichten ein möglichst getreues<br />
Bild von der therapeutischen Wirkung zu geben. Absichtlich sind auch Gebiete<br />
mit angeführt, auf denen bis jetzt nichts erreicht worden ist, um von vornherein<br />
kein schiefes Bild aufkommen zu lassen. Dadurch soll vermieden werden, daß<br />
etwa der Eindruck eines »Allheilmittels« erweckt wird ; andererseits soll dem Arzt<br />
gezeigt werden, was für Reaktionen er zu erwarten hat. Nur durch Erfahrungen<br />
auf den verschiedensten Gebieten kann ein Urteil darüber gewonnen werden,<br />
nach welchen Richtungen hin sich die weitere Arbeit lohnt. Denn die Möglichkeiten<br />
dieses Gebietes, das ¡n den ersten Anfängen steht, sind noch keineswegs<br />
erschöpft, und es steht außer Frage, daß zielbewußte Arbeit noch vieles Neue für<br />
die Therapie zutage fördern wird.<br />
Meinem Chef, Herrn Prof. VEIL, danke ich für die mir bei allen Arbeiten gewährte<br />
Freiheit sowie für die Zuweisung zahlreicher Kranker aus Klinik und<br />
Privatpraxis. Sodann gilt mein Dank Herrn Prof. ESAU, in dessen Institut ich die<br />
ersten grundlegenden Versuche ausführen konnte, und der mir immer mit Rat<br />
und Tat zur Seite gestanden hat, ebenso wie seine Assistenten. Von ihnen hat<br />
Herr Dr. ROHDE mich bei der Niederschrift des technisch-physikalischen Teils<br />
V
unterstützt und den Anhang verfaßt; weiterhin Herrn Prof. Joos für verschiedene<br />
wertvolle Winke.<br />
Für ihr freundliches Interesse und die Zuweisung von Kranken danke ich<br />
ferner den Herren Proff. IBRAHIM und DUKEN, Herrn Prof. BERGER, Herrn Prof.<br />
SPIETHOFF und Herrn Prof. HENKEL sowie verschiedenen praktischen Ärzten<br />
der Stadt Jena.<br />
Nicht minder gilt mein Dank meinen treuen Mitarbeitern, die zum Teil im Text<br />
genannt sind.<br />
Die Geldmittel, ohne die die experimentellen Untersuchungen nicht möglich<br />
gewesen wären , verdanke ich der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaften<br />
und der Gesellschaft der Freunde der Universität Jena.<br />
Herrn Dr. GUSTAV FISCHER schulde ich noch besonderen Dank für das Eingehen<br />
auf alle meine Wünsche und die gediegene Ausstattung des Buches.<br />
Jena, März 1932. ERWIN SCHLIEPHAKE<br />
Vorwort zur 5. und 6. Auflage<br />
Nach der j. ist nun schon eine sechste Auflage notwendig geworden, ein Zeichen<br />
für die Bedeutung, die die Kurzwellentherapic für die ärztliche Praxis gewonnen<br />
hat und immer mehr gewinnt. Viele neue Heilmittel sind in den letzten Jahrzehnten<br />
gekommen und wieder vergessen worden, an den Ergebnissen der Kurzwellentherapic<br />
hat sich nichts geändert. Sie kann allein oder in Kombination mit allen<br />
anderen Heilmitteln angewandt werden, und zwar auch bei akuten Prozessen.<br />
Alle von mir aufgestellten Thesen haben ihre Gültigkeit behalten.<br />
Die neue Auflage ist wieder erweitert und ergänzt. Die Anwendung der Mikrowellen<br />
ist ausführlich besprochen.<br />
Ein neues Anwendungsgebiet öffnet sich in der Kurzwellen-Diagnostik; durch<br />
die Provokation mit nachfolgender Leukozyten-Zählung wird die Blutbild-<br />
Diagnostik auf eine neue Grundlage gestellt.<br />
Neue Erkenntnisse und Aussichten ergeben sich durch die Beeinflussung der<br />
inkretorischen Organe mit Kurzwellen, die dadurch, je nach angewandter Dosis,<br />
aktiviert und reguliert werden. Dabei entstehen chemisch nachweisbare Veränderungen<br />
in den Körpersäften, aus denen erstmalig beim lebenden Menschen Schlüsse<br />
auf die Art der Funktionsstörungen gezogen werden können. Die Endokrinologie<br />
und Endokrinothcrapic hat dadurch neue Anregungen bekommen. Der Weg, auf<br />
diese Weise das Wachstum maligner Geschwülste zu beeinflussen, erscheint aussichtsreich<br />
und sollte in größerem Rahmen nachgeprüft werden.<br />
Zur besseren Übersicht sind Tabellen der Ergebnisse, der Indikationen und<br />
Dosierungen auf S.271 und 28off. beigegeben. Die Einstellungen der Elektroden<br />
und Verteilung der Feldlinien ist in den Tafeln S. 277-279 dargestellt.<br />
November 1959 ERWIN SCHLIEPHAKE
Inhaltsverzeichnis<br />
Historisches *<br />
A. Physikalisch-physiologischer Teil 3<br />
I. Stellung der Kurz- und Ultrakurzwellen im Spektrum der elektromagnetischen<br />
Wellen Î<br />
II. Entstehung und Anwendung kurzer elektrischer Wellen 7<br />
i. Geschlossene Schwingkreise 7<br />
a) Kapazität 7<br />
b) Selbstinduktion io<br />
c) Der Schwingungsvorgang im geschlossenen Kreis 11<br />
d) Eigenfrequenz 14<br />
e) Primär- und Sekundärkreis 14<br />
1. Abstimmung 14<br />
2. Kopplung 15<br />
3. Strom und Spannung im Kreis, Energie 17<br />
4. Dämpfung 18<br />
2. Der offene Schwingkreis (Dipol) , 15<br />
3. Reflexion, Sammlung durch Hohlspiegel, Brechung 21<br />
4. Messung der Wellenlänge 22<br />
III. Die Erzeugung von elektrischen Schwingungen für medizinische Zwecke . 25<br />
1. Ältere Verfahren: Hochfrequenz, d'Arsonvalisation, Langwellen-Diathermie<br />
23<br />
2. Die Elektronenröhre als Schwingungscrzcugcr. Prinzip. Schaltungen.. 25<br />
IV. Das Kurzwellen-Kondensatorfcld 29<br />
1. Kapazitive Wirkung 30<br />
2. Brechung und Oberflächenwirkung 31<br />
3. Wirkungen des Kondensatorfcldes auf Flüssigkeiten, Gewebe und<br />
Organe 32<br />
a) Vorgänge im Dielektrikum 32<br />
b) Das homogene Dielektrikum 40<br />
c) Das inhomogene Dielektrikum 43<br />
d) Wärmeentstchung im Blut 44<br />
e) Der menschliche Körper als geschichtetes inhomogenes Dielektrikum 47<br />
f) Erwärmung in menschlichen Geweben 49<br />
g) Die besonderen Tiefenwirkungen des UKW-Feldes 52<br />
h) Das Problem der thermischen Entlastung der Oberfläche 54<br />
i) Die relative Tiefenwirkung 56<br />
1. Im Modell 56<br />
2. Lokalisation der Wirkung in Körperteilen 60<br />
3. Verteilung der Energie im lebenden Tierkörper 62<br />
4. Lokalisation der Wirkung beim lebenden Menschen 65<br />
k) Gibt es spezifische Wirkungen ? 66<br />
V. Das Spulenfcld 71<br />
VII
VI. Die elektromagnetische Welle 74<br />
Mikrowellen 74<br />
Strahlenfeldbehandlung 75<br />
VII. Physiologische und pathologische Wirkungen auf Tiere und Menschen . . 82<br />
1. Einflüsse auf das Allgemeinbefinden 82<br />
a) Im Strahlungsbereich von Kurzwellensendern 82<br />
b) Im Kondensatorfcld 83<br />
z. Allgemeinwirkungen auf Tiere 84<br />
a) Tötung kleinerer Tiere bei großen Feldstärken 84<br />
b) Erzeugung krankhafter Zustände 84<br />
c) Wirkungen kleinster Dosen 86<br />
3. Veränderungen im strömenden Blut 87<br />
4. Histologische Veränderungen 92<br />
5. Wirkungen auf den Blutkreislauf 93<br />
6. Nervensystem 97<br />
VIII. Wirkungen auf Bakterien 10;<br />
IX. Wirkungen auf Gewebskulturcn 110<br />
X. Gefahren der Kurzwcllenbehandlung 112<br />
XL Experimentelle Infektionen und Spontanerkrankungen 116<br />
XII. Pathologisch-physiologische Grundlagen der Heilungsvorgänge bei Entzündungen<br />
118<br />
B. Technisch-klinischer Teil 121<br />
I. Kurzwellenapparate und ihre Handhabung in der Praxis 121<br />
1. Röhrenapparate 121<br />
2. Erzeugung und Anwendung von Wellen unter 1 m. Mikrowellen .... 126<br />
3. Funkenstreckenapparate 131<br />
4. Leistungs- und Dosismessung 131<br />
5. Strahlcnschutz 133<br />
II, Der Behandlungskrets 134<br />
1. Abstimmung der Kreise 134<br />
2. Abstandsprinzip 135<br />
3. Kondensatorelektroden 137<br />
4. Spulenfeldbchandlung 143<br />
III. Dosierung 144<br />
VI. Allgemeine Hyperthermie (Elelitropyrexic) 147<br />
1. Verfahren 147<br />
2. Zwischenfälle 152<br />
3. Physiologische Reaktionen 1Ï 3<br />
V. Indikationen und Behandlungsergebnisse 156<br />
1. Eitrige Entzündungen der äußeren Bedeckung 157<br />
a) Furunkel 157<br />
b) Karbunkel 15 9<br />
c) Hidroaedenitis 160<br />
VIII
d) Panaritien und Paronchicn 162<br />
c) Ulcus cruris varicosum 163<br />
f) Mastitis 163<br />
2. Hautkrankheiten verschiedener Art 164<br />
3. Zahnerkrankungen 165<br />
4. Verschiedene andere Entzündungen 166<br />
j. Obere Luftwege, Ohr 167<br />
6. Atmungsorgane 17 1<br />
7. Krankheiten der Knochen und Gelenke 185<br />
8. Rheumatische und arthritische Erkrankungen 187<br />
9. Gonorrhoe 196<br />
10. Verdauungsapparat 198<br />
11. Gynäkologische Erkrankungen 200<br />
12. Krankheiten des Zentralnervensystems 20 j<br />
i;. Periphere Nerven 211<br />
14. Erkrankungen der Kreisiauforgane 214<br />
15. Urogenitalapparat 217<br />
16. Tuberkulosen 220<br />
17. Wirkungen auf Tumoren 224<br />
18. Die Wirkungen auf die Hirnbasis und auf das endokrine System 225<br />
Die Reaktion der endokrinen Organe bei krankhaften Zuständen 233<br />
Zusammenfassung 242<br />
Die Therapie mit Durchflutung endokriner Organe (Autohomontherapie)<br />
243<br />
Störungen der Genitalfunktion 24J<br />
Versuche zur Beeinflussung maligner Tumoren 246<br />
19. Beobachtungen am Auge. Augenkrankheiten 251<br />
VI. Die Verwendung der Kurzwellen zur Diagnostik 256<br />
VII. Schlußbetrachtung 264<br />
VIII. Tabelle der Indikationen 280<br />
IX. Anhang: Formeln zum physikalischen Teil 286<br />
Spannung, Strom und Widerstand 286<br />
Wellenlänge, Frequenz und Fortpflanzungsgeschwindigkeit 287<br />
Spulen (Induktivitäten) 288<br />
Kondensatoren (Kapazitäten) 28c<br />
Schwingkreise 290<br />
Dämpfung 290<br />
Das elektrische Feld 291<br />
Dielektrika 293<br />
Leistung und Wirkungsgrad 294<br />
X. Regeln bei Kurzwellentherapic 296<br />
Verlauf der Behandlung 297<br />
Schrifttum 299<br />
Namenregister 312<br />
Sachregister 317<br />
Tafel I Verschiedene Elektrodeneinstellungen 277<br />
Tafel II Feldlinienverlauf 278<br />
Tafel III Feldlinien und Wärmeverteilung bei verschiedener Einstellung der Elektroden<br />
279
Historisches<br />
Wie alle medizinischen Verfahren hat die <strong>Kurzwellentherapie</strong> Vorläufer gehabt.<br />
Man kann im weitesten Sinne hierzu die Begründer der Elektromedizin überhaupt<br />
rechnen, also diejenigen, die elektrische Ströme aller Art auf den Körper einwirken<br />
ließen.<br />
Die Erzeugung von Hochfrequenzströmen mit hoher Spannung wurde zuerst<br />
durch den TESLA-Transformator ermöglicht, und der Erste, der solche Ströme dem<br />
menschlichen Körper zuführte, war D'ARSONVAL. Sein großes Verdienst um die<br />
Einführung der Hochfrequenzströme in die Medizin wird nicht davon berührt,<br />
daß er nur dem verhältnismäßig niederfrequenten Bereich seine Aufmerksamkeit<br />
schenkte und die höchstfrequenten Anteile für weniger wirksam hielt. Unter dem<br />
Eindruck seiner Autorität hat man sich daher mit diesen höchstfrequenten Strömen,<br />
die dem Kurzwcllenbereich entsprechen, nicht befaßt*. Nur ganz vereinzelt<br />
wurde darauf hingewiesen, daß auch die höchstfrequenten Schwingungen Bedeutung<br />
in der Medizin erlangen könnten, so 192J von STIEBÖCK.<br />
Die <strong>Kurzwellentherapie</strong> in ihrer heutigen Form hat sich nicht aus den älteren<br />
Verfahren der Hochfrequenzanwendung entwickelt, sondern sie ist erst viel später<br />
entstanden, und zwar nach Einführung der Elektronenröhre in die Fernmeldetechnik.<br />
Dies ist insofern bemerkenswert, als schon HERTZ mit kurzen Wellen<br />
experimentiert hat, solche Wellen also schon mit den alten Mitteln der Funkenstrecke<br />
hergestellt werden konnten.<br />
Die Voraussetzungen für eine wirksame Anwendung ungedämpfter Ultrakurzwellen<br />
waren erst durch die Elektronenröhre gegeben; ESAU hat durch seine<br />
Schaltung die Möglichkeit zur Erzeugung solcher Wellen mit hoher Energie bei<br />
kürzesten Wellenlängen geschaffen. ESAU hatte auch den Gedanken der Anwendung<br />
elektrischer Wellen beim Menschen bereits gehabt, als ich, mit den gleichen<br />
Problemen beschäftigt, durch Herrn Geh.-Rat WIEN an ihn gewiesen wurde. Versuche,<br />
die Wellen durch Hohlspiegel auf das Innere des Körpers wirken zu lassen,<br />
führten bei den damaligen Mitteln noch nicht zu brauchbaren Ergebnissen. Erst<br />
dadurch, daß ESAU das Kondensatorfcld anwandte, und durch gemeinsame Versuche<br />
an Fliegen und Mäusen, wurde es uns möglich, die Kurzwellcntherapie beim<br />
Menschen zu entwickeln.<br />
Unabhängig davon hatte SCHERESCHEWSKY kurz vorher das Kondensatorfcld<br />
in seiner Wirkung auf Mause untersucht und dabei festgestellt, daß die Tiere je<br />
nach angewandter Frequenz verschieden schnell zugrunde gingen.<br />
Ferner hatte LAKHOVSKY höchstfrequeme Schwingungen mit einem «radiocclluloscillatcur»<br />
erzeugt und auf Pflanzen einwirken lassen, wobei gewisse Krebse<br />
von Pelargonien geheilt worden sein sollen.<br />
Alle diese Befunde können als Vorläufer der Kurzwellcntherapie betrachtet<br />
werden, die sich aber erst auf einer wissenschaftlich fundierten Kurzwellen- Biologie<br />
aufbauen konnte. Von einer solchen konnte erst gesprochen werden, nachdem klar<br />
erkannt war, daß die Wirkungen dieses Frequenzbereiches auf den Menschen von<br />
* Insofern ist der Ausdruck Arsonvalisation für diesen Teil des Spektrums der elektrischen<br />
Wellen zum mindesten mißverständlich.Erst recht entbehrt der im Anschluß an<br />
meinen Vortrag 193; in Mailand (Italien) eingeführte Ausdruck «Marconithcrapic» jedes<br />
geschichtlichen Gehaltes; MARCONI hat die HERTZschcn Wellen nur in der Telegraphic<br />
angewandt.<br />
1
esonderer Art sind und sich von den Wirkungen der Langwellendiathermie und<br />
Arsonvalisation klar abgrenzen lassen.<br />
Zu diesen Besonderheiten gehört die von mir nachgewiesene kapazitive Tiefenwirkung<br />
in Körpersubstanzen und damit das Abstandsprinzip, wodurch eine<br />
einzigartige Wirkung auf tiefgelegene Organe erzielt wird, wie sie durch kein<br />
anderes physikalisches Mittel außer den Röntgenstrahlen in diesem Ausmaß möglich<br />
ist. Weiterhin ist zu nennen die von PÄTZOLD und BURSTYN gefundene selektive<br />
Erwärmung der Elektrolyte, die Mikrocrwärmung im Inneren der Zellen und<br />
Blutkörperchen und damit die anomale Dispersion im Gebiet der Körpersubstanzen<br />
(SCHLIEPHAKE, ScHAEFER, PÄTZOLD, RAJEWSKY), die zuerst von PFLOMM gefundenen<br />
und später von SCHLAG und v. NORDHEIM exakt nachgewiesenen physikochemischen<br />
Veränderungen in den Geweben, die Wirkungen auf die Blutgefäße<br />
(PFLOMM, CIGNOLINI), auf das Histamin (HILDEBRANDT), schließlich die von<br />
SCHLIEPHAKE und WEISSENBERG zuerst gefundenen Wirkungen auf das endokrin-vegetative<br />
System.<br />
Die Kurz-wéilcníberapie beginnt mit dem exakten Nachweis der Heilwirkungen<br />
bei akut citrigen Entzündungen, der zum erstenmal durch meinen Sclbstversuch<br />
bei einem Furunkel im März 1929 geführt wurde.<br />
Neben dieser Entwicklung läuft die Kurzweilenbyperthermie. Nachdem ESAU<br />
und SCHLIEPHAKE die allgemeine Erhitzung im Tierkörper durch das Kondensatorfcld<br />
gefunden und ich ihre Bedingungen in weiteren Tierversuchen untersucht<br />
hatte, wurde das Verfahren der allgemeinen Hyperthermie weiter ausgebaut,<br />
besonders von HALPHEN und AUCLAIR, HINSIE, CARPENTER, NEYMAN, RAAB:<br />
Dieses Verfahren hat im wesentlichen die gleichen Wirkungen wie andersartig<br />
künstlich erzeugtes Fieber, ermöglicht aber eine Erwärmung des Körpers von<br />
innen heraus und ist besonders bequem und angenehm in der Anwendung.<br />
So haben sich bereits mehrere Zweige der Kurzwellenwissenschaft ausgebildet,<br />
deren weiterer Ausbau noch viele Erkenntnisse verspricht.<br />
Auch zur Diagnostik habe ich die Kurzwellen neuerdings angewandt, worüber<br />
im Kapitel VI kurz berichtet wird.<br />
2
A. Physikalisch-physiologischer Teil<br />
I. Stellung der Kurz- und Ultrakurzwellen<br />
im Spektrum der elektromagnetischen Wellen<br />
Kurz- und Ultrakurzwellen entstehen beim sehr raschen Polwechsel elektrischer<br />
Spannungen. In einem Leitungssystem, etwa einem Draht, pendeln dabei elektrische<br />
Ladungen; es entsteht ein Wechselstrom. Der Wechsel erfolgt in einem<br />
Rhythmus, mit einer bestimmten Wcchsclzahl in der Zeiteinheit, einer bestimmten<br />
Frequenz- ^ie bei Kurz- und Ultrakurzwellen in Frage kommenden Wechselzahlcn<br />
sind sehr hoch; etwa 10 bis ioo Millionen in der Sekunde. Da das Hin- und<br />
Hcrpendeln der Ladungen einem Schwingungsvorgang gleicht, spricht man auch<br />
von elektrischen Schwingungen.<br />
Jeder elektrische Strom erzeugt um sich herum ein magnetisches Feld. Das ist auch<br />
hier der Fall. Außerdem entsteht zwischen elektrischen Ladungen ein elektrisches<br />
Feld. Man stellt sich vor, daß von den Potentialen Feldlinien ausgehen, die die<br />
Ladungen verbinden.<br />
Die magnetischen Kraftlinien umgeben den Stromleiter zirkulär, sie stellen mit<br />
den elektrischen Kraftlinien das elektromagnetische Feld dar. Aus ihm entsteht<br />
eine Strahlung, die HERTZschcn elektromagnetischen Wellen.<br />
Die elektrischen Wellen gehören zu den elektromagnetischen Strahlungen, ebenso<br />
wie Licht- und Röntgenstrahlen. Allen diesen Strahlungen ist gemeinsam, daß sie<br />
beim Schwingen elektrischer Ladungen entstehen. Während bei Licht und den<br />
sogenannten kurzwelligen Strahlungen kleinste Elemcntarladungcn, die Elektronen,<br />
für sich schwingen, sind es bei den HERTZschen Wellen größere Mengen<br />
von Elektronen, die hin- und herfließen.<br />
Bei jedem Schwingen der Ladungen entsteht eine Welle, bestehend aus Wellenberg<br />
und Wellental, und bei jeder weiteren Schwingung setzt sich eine neue Welle<br />
daran. Bei jeder Vollendung einer Periode ist daher der Vorgang um eine Wellenlänge<br />
weitergerückt. Die Häufigkeit, mit der sich dieser Vorgang in der Sekunde<br />
wiederholt, ist seine Scbn>ingungs%abl °der Frequenz- Diese Zahl sagt demnach aus,<br />
wie oft sich innerhalb i Sekunde der Vorgang um je i Wellenlänge fortgepflanzt<br />
hat, beziehungsweise welche Strecke die Welle durchlaufen hat. Diese in i Sekunde<br />
zurückgelegte Strecke ist aber für alle elektromagnetischen Strahlungen gleich, sie<br />
ist eine Grenzgeschwindigkeit, nämlich 300000 km/sec. Jede Schwingung muß<br />
sich deshalb so oft fortsetzen, daß sie in 1 Sekunde genau diese Wegstrecke durchläuft.<br />
Daraus folgt, daß eine lange Welle seltener schwingt als eine kurze.<br />
Man kann sich das leicht am Beispiel eines Rades klarmachen, das eine bestimmte<br />
Strecke durchläuft. In unserer Abb. 1 ist das Rad durch einen Kolben mit<br />
auf- und abgehender Bewegung angetrieben. Das kleine Rad muß sich oft drehen,<br />
das große viel seltener, wenn die gleiche Geschwindigkeit erreicht werden soll.<br />
Die Umdrehungszahl entspricht der Frequenz, dargestellt durch die Bewegungen<br />
des Kolbens. Wird sie auf den Radumfang bezogen, dann sprechen wir von der<br />
Kreisfrequenz (s. Anhang). Aus der Frequenz läßt sich die in der Zeiteinheit zurückgelegte<br />
Wegstrecke ohne weiteres errechnen, wenn man den Radumfang kennt.<br />
Das Produkt von Radumfang und Zahl der Umdrehungen ergibt die zurückgelegte<br />
Wegstrecke. Ist die in der Zeiteinheit zurückzulegende Wegstrecke für<br />
3
alle Fahrzeuge gleich, dann ergibt sich die Zahl der notwendigen Umdrehungen,<br />
indem man die Strecke durch die Radumfänge teilt. Haben wir eine Strecke von<br />
iooo m Länge, dann muß sich ein Rad von i m Umfang iooomal drehen, ein Rad<br />
von 2 m Umfang joomal. Den analogen Vorgang haben wir bei den elektrischen<br />
Schwingungen und Wellen.<br />
Oder einfach ausgedrückt: Radumfang X Drehzahl = Strecke. Bei gleicher<br />
Geschwindigkeit ist Strecke : Drehzahl = Radumfang.<br />
Um die Lichtgeschwindigkeit von 300000000 m je see zu erreichen, muß eine<br />
Welle von 1 m Länge 30omillioncnmal in 1 Sekunde schwingen, die Frequenz ist<br />
300 MHz (Megahertz). Bei 100 MHz = 100000 kHz erhalten wir eine 3-m-Welle,<br />
bei 3 MHz eine ioo-m-Wclle. Wellenlänge und Schwingungszahl sind demnach<br />
umgekehrt proportional.<br />
Diese Verhältnisse gelten nur im freien Raum und näherungsweise in Luft; in<br />
anderen Stoffen ist die Wellenlänge kürzer, die Fortpflanzungsgeschwindigkeit<br />
entsprechend geringer.<br />
Abb. 1 : Darstellung des Schwingungsvorganges durch Kolben, diu Räder verschiedener<br />
Größe antreiben. Um die gleiche Wegstrecke zurückzulegen, dreht sich das große Rad<br />
3mal, das kleine 7mal. Bei gleicher Fortpflanzungsgeschwindigkeit ist die Wellenlänge<br />
(Radumfang) umgekehrt proportional der Schwingungszahl bzw. Drehzahl pro Zeiteinheit<br />
(-- Frequenz). Der Kolbenhub versinnbildlicht die Amplitude der Schwingung.<br />
Die elektrischen Wellen sind die längsten Wellen des elektromagnetischen Spektrums;<br />
die Wellenlängen der Wärme-, Licht- und Röntgenstrahlen hegen in viel<br />
niedrigeren Größenordnungen. Alle Unterschiede in der Wirkung der verschiedenen<br />
Wellen sind in den Unterschieden der Frequenz begründet. Sie bedingen die<br />
chemischen und physikalischen Wirkungen und die Tiefenwirkung in den verschiedenen<br />
Stoffen.<br />
Bei der Kurzwellcntherapic benutzen wir meist nicht die von Antennen ausgestrahlte<br />
elektromagnetische Welle, sondern in der Hauptsache das elektrische<br />
Feld in Kondensatoren (s. S. 8). Die Bezeichnung Kurzwellcntherapic erscheint bei<br />
dieser Anwendungsweise nicht ganz korrekt, da als Welle im allgemeinen nur die<br />
Antcnncnstrahlung bezeichnet wird. Sie hat sich aber allgemein eingeführt, zumal<br />
die Rechnung nach Wellenlängen wesentlich bequemer ist als die nach Frequenzen.<br />
Im Grund bedeutet es das gleiche, ob man etwa von der Frequenz 50000 kHz<br />
oder der 6-m-Wcllc spricht. Letzteres ¡st viel anschaulicher.<br />
4
Die Wellenlängen der einzelnen elektromagnetischen Strahlungen sind in<br />
Abb. 2 wiedergegeben. Man sieht hier, daß sich die kürzesten Ultrakurzwellen<br />
{Mikrowellen) an die Wärmestrahlen unmittelbar nach oben anschließen und sie<br />
Physik<br />
N iederfreguente Schwingungen<br />
Tertin Kfechselslröme<br />
16YJ-100HI<br />
Übetiee-ercßfünh i-\<br />
Rundfunk TOO-500m<br />
Kuriwellenfunk 1Û-100ro<br />
UlfrakunweUenfunk<br />
0,l-lOm(Nanwrttht)<br />
Ultwot und WärmestTohl»<br />
Röntgenstrahlen<br />
(O'-g-lO* Voll<br />
Gammastrahlen<br />
Wellenlänge<br />
cm<br />
10"<br />
10*<br />
10 a<br />
10'<br />
10°<br />
10 a<br />
10«<br />
103<br />
10'<br />
10<br />
1<br />
10-'<br />
Î0- 1<br />
10-'<br />
10-*<br />
10»<br />
10-»<br />
10- »<br />
10-»<br />
10-«<br />
10-10<br />
10 •*<br />
10- 11<br />
Medizin<br />
Rsfï Ströme Für Diagnostik<br />
und Therapie 0-IBOHi<br />
H F-Chirugie und Diathermie<br />
100-1000 m<br />
Kurzwellen thérapie •<br />
K<br />
15-30 m (Spulenfeld)<br />
i 15m(Kondensator-uipulerifeld)<br />
0,1 -im (Mrahienfetd)<br />
Ulrrarot-Dieqaund Therapie<br />
UchtdiagnosHk 0,1-06><br />
Ultraviolett-Therapie<br />
fiontgenmedlzlm<br />
Grenzstrahlenlticrapie 5-20KV<br />
M<br />
Oberflächenlherapie<br />
urenz<br />
und<br />
H Oberfli<br />
Diagnostik 30-100 KV<br />
^UOia Ttefeniheraple 0,1-OAM"<br />
Kodwolttheraple<br />
0.4--2 MV<br />
Radiumtherapie<br />
Abb. z: Das Frequenzband der elektromagnetischen Wellen<br />
noch etwas überschneiden. Die Wellenlängen zwischen 1 ¡s und i mm können also<br />
sowohl durch Wärmcstrahlcr als auch auf elektrischem Wege erzeugt werden.<br />
Bei der Mikrowcllcnthcrapic wird nur die von Antennen ausgestrahlte Energie<br />
angewandt, weil Kondensatorfclder bei Wellenlängen unter i m nicht mehr<br />
verwendbar sind.<br />
5
Als Ultrakurzwellen bezeichnen wir allgemein die Wellenlängen unter iom,<br />
bis ioo m sprechen wir von Kurzwellen (KW), darüber von Mittel- und Langwellen.<br />
Besser spricht man von Zentimeter-, Dezimeter-, Meter-, Dekameter- usw.<br />
Wellen. Mikrowellen sind Ultrakurzwellen, deren Wellenlängen unter r m liegen<br />
(Zentimeter wellen).<br />
Die Wirkungen elektromagnetischer Wellen von den Radium- bis zu den Lichtstrahlen<br />
sind mit ihrem Gehalt an Quantenenergie verknüpft. Diese kurzwelligen<br />
Strahlungen wirken unmittelbar auf das Atom, so daß chemische Veränderungen<br />
zustande kommen. Man hat auch von aktinischen Strahlungen gesprochen. Die<br />
Quantenenergie nimmt mit zunehmender Wellenlänge ab und ist schon bei den<br />
Wärmestrahlen gering. Im Bereich der HERTZschen Wellen sind daher keine<br />
Quantenwirkungen mehr zu erwarten und damit auch keine stärkeren chemischen<br />
Veränderungen. Die Wirkungen greifen nur am Molekül an. Daher ist es möglich,<br />
Energiemengen zuzuführen, die der Organismus in Form von Licht- oder Röntgenstrahlen<br />
nicht mehr verträgt, weil sie irreversible Schäden hervorrufen würden.<br />
Die Durchdringungsfähigkeit ist bei den einzelnen Strahlcnarten sehr verschieden.<br />
Sie ist sehr groß bei den härtesten kurzwelligen Strahlungen, Radium- und Röntgenstrahlen.<br />
Beim Ultraviolett ist sie ganz gering, beim langwelligen Rot etwas<br />
besser, bei den Infrarot- und Wärmcstrahlcn wieder sehr gering. Für die ausgestrahlte<br />
elektromagnetische Welle ist die Durchdringungsfähigkeit erst teilweise<br />
erforscht; sie hängt von der Wellenlänge ab und ist jedenfalls bedeutend größer<br />
als diejenige der Licht- und Wärmcstrahlcn. Besonders groß ist die Tiefenwirkung<br />
im menschlichen Körper, wenn das elektrische Feld zwischen Kondensatorplatten<br />
angewandt wird, wie dies bei der <strong>Kurzwellentherapie</strong> geschieht.<br />
Die Eindringtiefe der von Antennen ausgestrahlten elektromagnetischen<br />
Wellen (Strahlenfeld) hängt von der Wellenlänge ab. Sie erreicht ein Maximum in<br />
einem Gebiet, das zwischen jo und ioo cm Wellenlänge liegt, und wird bei noch<br />
kürzeren Wellen wieder geringer.<br />
Das elektromagnetische Feld von Flachspulen überbrückt die Haut sehr gut,<br />
dringt aber in die unter der Muskulatur gelegenen Schichten nur in sehr geringem<br />
Maße ein.<br />
Innerhalb des Meterwellengebietes nimmt die Durchdringungsfähigkeit nach<br />
den kürzeren Wellenlängen hin zu. Sic beruht auf der kapazitiven Wirkung des<br />
KW-Feldcs.<br />
Aus diesen Ausführungen geht hervor, daß die Ultrakurzwellen mit den «kurzwelligen<br />
Strahlungen» nicht identisch sind. Sic sind kurz nur gegenüber dem Bereich<br />
der Wellen des Rundfunks; den kurz- und langwelligen Strahlungen des<br />
Lichtes und des Infrarots gegenüber jedoch sind sie außerordentlich lang. Die<br />
Abb. 3: Dieses Bild zeigt kurvenmäßig, welcher Frcqucnzuntcrschicd zwischen den<br />
Langwcllen-Diathcrmicströmen und den Ukrakurzweüenfrequenzen besteht. Während<br />
einer einzigen Diathermieschwingung, die durch die langgezogene flache Kurve dargestellt<br />
ist, wechselt der Kurzweilenstrom ioomal. Die linke Kurve stellt den Ablauf<br />
gedämpfter, mit Funkcnstrcckcn erzeugter Schwingungen dar.<br />
6
Bezeichnung Ultrakurzwellen birgt in dieser Beziehung eine gewisse Unklarheit<br />
in sich, die aber bei einiger Sachkenntnis keine Schwierigkeiten machen darf.<br />
Die Abgrenzung der Ultrakurzwellen gegenüber längeren Wellen ergibt sich<br />
schon aus einigen physikalischen Eigenschaften, die durch die hohe Frequenz<br />
gegeben sind. Wir haben es mit einem Gebiet zu tun, in dem die elektrischen<br />
Wellen mit manchen Eigenschaften den Lichtstrahlen nahekommen, sie können<br />
gebrochen, gebeugt und mit Linsen und Hohlspiegeln gebündelt werden. Wir<br />
.sprechen deshalb auch von quasi-optischer Strahlung.<br />
Von den physiologischen Wirkungen aus betrachtet, liegt die Besonderheit gegenüber<br />
den Langwellen nicht nur in der makroskopisch nachweisbaren stärkeren<br />
Tiefenwirkung, der stärkeren «kapazitiven» Wirkung, sondern besonders in den<br />
Einflüssen auf die mikroskopischen Strukturen sowie in den physikochemischen<br />
Wirkungen, die in späteren Kapiteln zu behandeln sein werden. Wie noch nachgewiesen<br />
wird, nehmen diese Wirkungen nicht kontinuierlich mit dem Frequenzgang<br />
zu, sondern sie treten oberhalb bestimmter Frequenzen, die in Beziehungen<br />
zu den Eigenschaften der Moleküle stehen müssen, sprunghaft ein. Dies gilt besonders<br />
für gewisse Wirkungen auf Moleküle und Kolloide. Hierin Hegt einwandfrei<br />
die Berechtigung, das Gebiet der Ultrakurzwellen in biologischer und therapeutischer<br />
Hinsicht von dem der Langwellen abzugrenzen. Diese Herausnahme<br />
ist zum mindesten so berechtigt wie bei anderen Strahlen mit biologischer Wirkung,<br />
etwa den Lichtstrahlen, deren Wellenlängenuntcrschied von Violett bis Rot<br />
nur eine Oktave des Frequenzbandes einnimmt, während schon der Unterschied<br />
zwischen den heute meist gebrauchten 7,37- und ii-m-Wellen und den Wellenlängen<br />
der Langwellendiathermie und Arsonvalisation über 6 Oktaven beträgt.<br />
IL Entstehung und Anwendung kurzer elektrischer Wellen<br />
1. Geschlossene Schwingkreise<br />
a) Kapazität<br />
Alle elektromagnetischen Wellen entstehen durch rasches Hin- und Hcrpcndcln<br />
elektrischer Ladungen in Schwingkreisen.<br />
Eine der ersten Voraussetzungen, unter der überhaupt elektrische Schwingungen<br />
in einem Leiter zustande kommen können, ist die Möglichkeit zur Aufnahme von<br />
Ladungen, das elektrische Fassungsvermögen, die Kapazität.<br />
An sich können alle Körper elektrisch geladen werden; bedeutend größere<br />
Kapazitäten lassen sich aber dadurch herstellen, daß 1 entgegengesetzt geladene<br />
Platten, getrennt durch eine Isolierschicht, einander gegenübergestellt werden, so<br />
daß sich die Ladungen durch ihre elektrische Anziehung festhalten. Wir haben<br />
dann einen Kondensator vor uns. Die bekannteste Form des Kondensators ist die<br />
Leydener Flasche.<br />
Wenn wir die beiden Beläge eines solchen Kondensators durch einen Drahtbügel<br />
miteinander in leitende Verbindung bringen (Abb. 4), so gleichen sich die<br />
Ladungen aus. Der Ausgleich besteht nicht in einer einmaligen Entladung, sondern<br />
die Ladungen kommen erst nach mehrmaligem Hin- und Hcrpendeln zur Ruhe.<br />
7
Damit ¡st zwischen den beiden Belägen des Kondensators und dem verbindenden<br />
Bügel ein Schwingkreis hergestellt. Die Beläge werden in schneller Folge abwechselnd<br />
positiv und negativ aufgeladen. Die Aufladung der einen Platte erzeugt<br />
jedesmal durch Influenz eine gleich große entgegengesetzte Ladung auf der an-<br />
Abb. 4 (oben): Geschlossener Schwingungskreis. Erregung<br />
von Schwingungen durch Funkenübergang<br />
Abb. 5 (rechts): Die elektrischen Kraftlinien im Kondcnsatorfcld<br />
(gestrichelt) und die elektromagnetischen<br />
Kraftlinien kreisförmig um den Draht (ausgezogen)<br />
deren Platte. Solange ein Strom in den Verbindungsdrähten fließt, ändert sich die<br />
Ladung des Kondensators und damit das Feld zwischen den Platten. Durch die<br />
zeitliche Änderung der elektrischen Kraftfelder zwischen den beiden Platten wird<br />
der Anschein eines in der Zwischenschicht stattfindenden Stromüberganges er-<br />
+ f<br />
+<br />
— _<br />
-<br />
—<br />
i_<br />
-<br />
—<br />
-<br />
+<br />
Große Platten: Kleine Platten: Größcrc Platten,<br />
Hohe Kapazität Geringe aber größerer Abstand:<br />
Kapazität Geringere Kapazität<br />
Durch die Ladungen<br />
des Dicleksrikums,<br />
die zur Oberfläche<br />
wandern, wird die<br />
Kapazität erhöht<br />
Abb. 6. Kapazität bei verschiedenen Abständen und Größen der Platten, Dielektrikum<br />
weckt, so daß man von einem Verschiebungsstrom spricht oder von der kapazitiven<br />
Wirkung (Abb. 5,6). Da die Influenz, d.h. die Anziehungskraft der Ladungen, mit<br />
der Annäherung der Platten zunimmt, ist es klar, daß auch die Kapazität des<br />
Kondensators um so größer sein muß, je näher die Platten einander gegenüberstehen.<br />
Auch ist leicht einzusehen, daß die Kapazität mit der Plattcngröße zunehmen<br />
muß (s. Anhang).<br />
Um bei Kondensatoren mit großer Kapazität nicht allzu große Platten verwenden zu<br />
müssen, werden in der Technik solche Kondensatoren aus mehreren nebeneinanderstehenden<br />
Platten gebaut.
Zwischen den Platten kann ein Vakuum bestehen, oder sie können durch irgendeine<br />
nichtleitende Schicht, ein Dielektrikum, voneinander getrennt sein. Das<br />
Dielektrikum übt einen bestimmten Einfluß auf die Kapazität aus, besonders wenn<br />
es flüssig oder fest ist. Dieser hängt von Zahl und Ladung der Molekel ab. Je nach<br />
seiner Beschaffenheit wird die Kapazität in verschiedenem Maß vergrößert. Die Zahl,<br />
die diese Vergrößerung gegenüber dem Vakuum ausdrückt, heißt Dielektrizitätskonstante<br />
(DK).<br />
Die DK hat für Vakuum, annähernd auch für Luft und Gase unter normalen Druckund<br />
Temperaturverhältnissen, den Wert i. Für Gas ist sie 2—3, für Wasser 81, für<br />
Körpergewebe 80—90. Demgemäß fließt die ßofachc Elcktrizitätsmengc in den (aus<br />
Körpergewebe bestehenden) Kondensator hinein, um ihn auf gleiche Spannung aufzuladen<br />
gegenüber Luftfüllung. In diesem Sinn kann man den kapazitiven Widerstand als<br />
Vso von demjenigen in Luft betrachten.<br />
Auch die Wellenlänge in einem bestimmten Medium wird durch die DK bestimmt,<br />
und zwar muß die Wellenlänge in Luft durch die Quadratwurzel der DK des Mediums<br />
dividiert werden. Ist die Wellenlänge in Luft 3 m, so haben wir demnach in Wasser<br />
J /9 — 33,; cm WL. Wie noch zu erörtern sein wird, stimmen die angegebenen Zahlen für<br />
die DK bei den Ultrafrequenzen des UKW-Bereiches nicht mehr, die DK ändert sich<br />
hier mit der Wellenlänge.<br />
Kondensatoren, die in einen Schwingungskreis eingeschaltet werden, wirken<br />
den Hochfrequenzströmen gegenüber ähnlich wie Widerstände. Diese «kapazitiven<br />
Widerstände'-' sind um so höher, je kleiner die Kapazität der Kondensatoren ist, d. h.<br />
je kleiner die Fläche, je größer der Abstand der Platten und je kleiner die Dielektrizitätskonstante<br />
ist. Die Zahl der in der Zeiteinheit wirksamen Kraftlinien wächst<br />
außerdem noch mit der Frequenz im Schwingungskreis; daher nimmt der kapazitive<br />
Widerstand mit höherer Frequenz ab ; er wird andererseits bei der FrequenzO,<br />
also dem Gleichstrom, unendlich groß. Der kapazitive Widerstand steht demnach<br />
in umgekehrtem Verhältnis zu Kapazität und Frequenz (s. Anhang). Man benutzt<br />
Kondensatoren (außer als wichtige Bestandteile von Schwingungskreisen) wegen<br />
der geschilderten Eigenschaften gelegentlich, um einen Kreis gegen Gleichstrom<br />
abzusperren, ohne daß die hochfrequenten Schwingungen wesentlich behindert<br />
werden (Blockkondcnsator).<br />
Mehrere in einen Kreis eingeschaltete Kondensatoren ändern die Gesamtkapazität des<br />
Kreises in verschiedener Weise, Schaltet man die Kondensatoren einander parallel wie in<br />
Abb. 7, so wirken sie zusammen wie ein Kondensator mit entsprechend großer Fläche,<br />
sie addieren sich zueinander. Anders ist es, wenn die Kondensatoren in Serie geschaltet<br />
sind (Abb. 8). Erregen wir Schwingungen in einem Kreis, in den ein großer und ein<br />
kleiner Kondensator eingeschaltet sind, so kann der große Kondensator zwar an sich<br />
einen großen Strom durchlassen; durch die geringe Kapazität des kleinen Kondensators<br />
wird das aber verhindert. Da die Schwingungen den ganzen Kreis durchlaufen, können sie<br />
immer nur eine Stärke annehmen, die etwa dem kapazitiven Widerstand des kleinsten<br />
Kondensators entspricht, meist aber unter ihm liegt (s. Anhang).<br />
Zum Vergleich können wir folgende Vorstellung heranziehen: In einen Flußlauf sind<br />
mehrere Schleusen eingeschaltet. Die kleinste Schleuse kann immer nur ein Boot hindurchlassen.<br />
Die größte Schleuse könnte zwar einen beliebigen Verkehr bewältigen, aber<br />
die Boote kommen in dem Abstand, in dem sie von der kleinen Schleuse abgegeben<br />
werden; daher wird die Gesamtzahl der durchfahrenden Boote sowie ihre zeitliche Aufeinanderfolge<br />
von der kleinsten Schleuse bestimmt (Abb. 9).<br />
So bestimmt im Hochfrequenzstromkreis der kleinste Kondensator nicht nur den<br />
kapazitiven Widerstand des Gesamtkreises ; auch die Frequenz im Kreis hängt, wie<br />
9
wir noch sehen werden, von seiner Kapazität ab (s. Anhang). Sehr große Kondensatoren<br />
können in einem solchen Kreis praktisch wie Kurzschlüsse für den Hochfrequenzstrom<br />
wirken. Will man die Kapazität des Gesamtkreises verändern, so<br />
geschieht dies zweckmäßig durch Änderung der kleinsten Kapazität. Diese Vcr-<br />
Abb. 7: Parallel-Kapazitätcn:<br />
Summation<br />
Abb. 8: Kapazitäten in Serie:<br />
Kleinste Kapazität maßgebend<br />
WM»M»»»M»MMMiM»m»»J.<br />
'»»»»»y/A»))»}»»»}»»»»}»»».<br />
MM>M»»»M»MM»¿»l»»MM.<br />
Mu<br />
Abb. 9: Die Wirkung der kapazitiven Widerstände<br />
wird hier versinnbildlicht durch hintcrund<br />
nebeneinandergeschaltete Schleusen im<br />
Schiffsverkehr<br />
hältnisse sind besonders wichtig, weil wir uns die kapazitive Wirkung im Kondensatorfcld<br />
für die Therapie zunutze machen; die Verhältnisse im Patientenkreis<br />
werden ganz wesentlich von den Kapazitäten bestimmt.<br />
Wird eine Spule auf den menschlichen Körper gelegt oder um ihn herumgeführt,<br />
so dringen die elektromagnetischen Feldlinien in den Körper ein bis zu einer bestimmten<br />
Tiefe (Spulenfeld). Der Spule wird dadurch Energie entzogen. Auch ein<br />
solcher Kreis muß einen Kondensator enthalten, der meist im Inneren des Apparates<br />
liegt.<br />
b) Selbstinduktion<br />
Auf die Schwingungen im Kreis hat außer der Kapazität auch die Art der leitenden<br />
Verbindung zwischen den Belägen Einfluß. Dabei tritt der OHMSche<br />
Widerstand an Bedeutung zurück ; er erhöht nur die Verluste und verringert daher<br />
die Schwingungsamplitude. Für die Schwingungszahl dagegen ist nur die Selbstinduktion<br />
dieser leitenden Verbindung maßgebend.<br />
Zum Verständnis dieses Begriffes müssen wir uns zunächst den Verlauf der Kraftlinien<br />
klarmachen. Bei jedem Wechsel des elektrischen Stromes in einem Leiter oder des<br />
elektrischen Feldes zwischen Kondensatorplattcn entstehen elektromagnetische Kraftlinien,<br />
die das elektrische Feld ringförmig umgeben (Abb.j, S,8). Schneiden diese Kraftlinien<br />
einen Leiter, so wird in ihm durch Induktion eine elektromagnetische Kraft<br />
erzeugt. Wächst der Primärstrom an, so läuft der Induktionsstrom ihm entgegengesetzt.<br />
Abschwächung oder Ausschaltung des Primärstromes hat einen Stromstoß in der ursprünglichen<br />
Stromrichtung zur Folge. «Das durch Induktion entstehende elektrische<br />
Feld ist stets so gerichtet, daß es den die Induktion einleitenden Vorgang verlangsamt»<br />
(LENZschcs Gesetz). Die induzierte Spannung wächst mit der Zahl der in der Zeiteinheit<br />
wirksamen Kraftlinien. Sic wird daher unter sonst gleichen Verhältnissen um so höher,<br />
je stärker der Primärstrom ¡st, andererseits nimmt sie zu mit der Zahl der Stromwcchsel<br />
in der Sekunde, also der Frequenz.<br />
10
In einer wechselstromdurchflos señen Spule schneiden die elektromagnetischen<br />
Felder, die um jede Windung herum entstehen, die nebenliegenden Windungen.<br />
Die so erzeugte elektromagnetische Kraft muß vom Primärstrom überwunden<br />
werden. Er hat also mit einem Widerstand zu kämpfen, den man als induktiven<br />
Widerstand (Induktanz) bezeichnet. Je mehr Windungen eine Spule hat und je<br />
naher die Windungen aneinander liegen, je größer schließlich ihr Durchmesser,<br />
desto höher ist die Selbstinduktion und (bei gleicher Frequenz) der induktive<br />
Widerstand. Bei einem geraden Leiter ¡st das ihn umgebende elektromagnetische<br />
Feld verhältnismäßig viel schwächer und daher der induktive Widerstand geringer.<br />
Er ist ungefähr proportional der Länge des Leiters.<br />
Die Induktanz ist in jedem Falle gegeben durch das Produkt der Kreisfrequenz und des<br />
sog. Sclbstinduktionskocffizicntcn. Dieser ist für ein gegebenes Leitcrgebilde eine Konstante,<br />
solange keine magnetisierbaren Stoffe in dessen Nähe sind. (s. Anhang)<br />
Der induktive Widerstand einer Spule mit zahlreichen Windungen kann gegenüber<br />
hochfrequenten Strömen so groß werden, daß die Spule keine Schwingungen<br />
mehr durchläßt. Der Gleichstromwiderstand solcher Drosselspulen kann dagegen<br />
sehr gering sein.<br />
Bei den sehr hohen Frequenzen, mit denen wir es hier zu tun haben, ist schon<br />
die Induktanz eines einfachen Drahtkreises verhältnismäßig hoch. Daher kommen<br />
meist keine Spulen, sondern einfacheDrahtkreisc und Schlingen zur Verwendung.<br />
c) Der Schwingungsvorgang im geschlossenen Kreis<br />
Unser Schwingkreis, der aus Kondensator und Sclbstinduktionsbügcl gebildet<br />
wird, ist gewissermaßen in sich geschlossen. Die metallische Fortleitung in den<br />
Drähten wird durch die Kraftlinien zwischen den Kondensatorplatten fortgesetzt.<br />
Wir sprechen deshalb von einem geschlossenen Schwingkreis.<br />
Das Schwingen der Ladungen in einem solchen Kreis ist mit dem Pendeln der Unruhe<br />
in einer Uhr zu vergleichen. Durch die Spannung der Feder, die am Ende der Schwingungsperiode<br />
immer neu eintritt, wird das Rädchen in Bewegung gesetzt; bis zur zeitlichen<br />
Mitte der Schwingung nimmt die Geschwindigkeit der Bewegung zu, nach Überschreiten<br />
dieses Punktes nimmt sie wieder ab, wobei der Feder eine entgegengesetzte Spannung<br />
erteilt wird, die schließlich zur Umkehr der Bewegung führt. Ebenso besteht zwischen<br />
den entgegengesetzten Ladungen der Kondensatorplatten eine Spannung, die den Ausgleich<br />
der Ladungen und damit den im Kreis fließenden Strom verursacht. Der Strom<br />
würde damit der in Bewegung gesetzten Masse des Rades entsprechen. Betrachten wir<br />
nun das Verhältnis zwischen der Spannung einerseits, der Bewegung der Masse bzw.<br />
dem Strom andererseits in ihrer zeitlichen Folge, so zeigt sich folgendes: Immer in dem<br />
Augenblick, wo die Feder am stärksten gespannt ist, steht das Rad still, im Schwingungskreis<br />
fließt kein Strom; andererseits ist die Bewegung, der Strom, dann am stärksten,<br />
wenn die Feder durch den Punkt geringster Spannung hindurchgeht. Die stärkste Bewegung<br />
folgt also der stärksten Spannung um die Hälfte der Zeit des einmaligen Pendeins<br />
nach; da wir als eine Periode das vollständige Hin- und Herschwingen bezeichnen, beträgt<br />
der Zeitunterschied dazwischen also eine Vicrtclpcriode (Abb. 10).<br />
Verbindet man die Beläge eines aufgeladenen Kondensators durch eine Induktionsspule,<br />
so werden sich die positiven und negativen Ladungen des Kondensators<br />
über diese Spule auszugleichen versuchen. Dabei muß ein Strom fließen.<br />
Dieser erzeugt in der Spule ein magnetisches Feld, dessen Größe von der Stärke des<br />
Stromes abhängt. Jede Änderung des magnetischen Feldes der Spule induziert in<br />
ii
dieser eine Spannung, die entgegengesetzt der ursprünglichen Spannung gerichtet<br />
ist, die den fcldaufbauenden Strom zum Fließen bringt. In unserem Falle wird<br />
durch das Anlegen der Spannung des Kondensators ein Strom zum Fließen<br />
gebracht, der in der Spule ein magnetisches Feld erzeugt. Dieses induziert bei<br />
JkU<br />
Abb io: Abbildung zum Schwingungsvorgang<br />
seinem Aufbau seinerseits eine entgegengesetzt gerichtete Spannung; sie bewirkt,<br />
daß der Anstieg des Stromes auf seinen Höchstwert verlangsamt wird (Abb. n).<br />
Hat der Strom, der durch die ursprüngliche Aufladung des Kondensators bestimmt<br />
ist, seinen Höchstwert erreicht, dann ist auch die Stärke des magnetischen<br />
ÍWWW1<br />
Stromrichtung<br />
im Kreis ^^%<br />
Ollff<br />
* Spannung ¿m Kondensator U<br />
4><br />
TOWW1<br />
* Strom im Kreis (magnet Felo in der Spule) J bau 4><br />
Abb. ii : Abbildung zum Schwingungsvorgang<br />
-,4><br />
positives<br />
Maximum<br />
negatives<br />
Maximum<br />
Feldes der Spule auf ihrem Maximum angelangt. In diesem Augenblick muß also<br />
die Änderungsgeschwindigkeit des Stromes und damit des magnetischen Feldes<br />
gleich Null sein. Damit wird die induzierte Gegenspannung ebenfalls Null. Der<br />
Kondensator ist jetzt entladen.<br />
Da keine Spannung mehr vorhanden ist, die den Strom aufrechterhalten könnte,<br />
muß dieser in seiner Stärke nachlassen. Dadurch ändert sich aber das magnetische<br />
Feld der Spule, und zwar wird es ebenfalls abgebaut, so daß wieder cinc Spannung<br />
induziert wird, die diesmal mit der ursprünglichen Spannung gleichgerichtet ist<br />
12
und daher auch einen Strom in der gleichen Richtung zum Fließen bringt. Dieser<br />
Strom transportiert weiterhin Ladung auf den Kondensator, d.h., es findet eine<br />
umgekehrte Aufladung statt. Mit dem Abbau des magnetischen Feldes sinkt auch<br />
der Strom, bis beide Großen verschwunden sind. Dann ist der Kondensator wieder<br />
voll aufgeladen, nur im entgegengesetzten Sinne wie vorher.<br />
Der Vorgang beginnt nun von neuem in umgekehrter Richtung. Falls keine Verluste<br />
auftreten, die die Schwingungen zum Abklingen bringen (Dämpfung), setzt<br />
er sich unendlich lange fort.<br />
Wichtig ist die Erkenntnis, daß in einem vcrlustfreicn Schwingkreis, der allerdings<br />
praktisch nicht herzustellen ist, keine Leistung verlorengeht.<br />
Dies wird klar, wenn man sich den Verlauf von Spannung und Strom in einem<br />
Diagramm aufzeichnet (Abb. 10). Man erkennt, daß die Kurven von Strom und<br />
Spannung sich nicht überdecken, sondern daß sie gegeneinander verschoben sind ;<br />
immer fällt ein Strommaximum mit der Spannung Null zusammen und umgekehrt,<br />
wie es auch aus der Erklärung des Schwingungsvorganges folgt. Es besteht demnach<br />
eine Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung von 90 0 , wenn man<br />
eine Schwingungsperiode (einmaliges Hin- und Herpcndcln der Ladungen im<br />
Schwingkreis) über einem Winkel von 360 0 aufträgt. Zeichnet man einen Einheitskreis<br />
daneben, dann zeigt sich der sinusförmige Charakter der Kurven wie in<br />
Abb. 10,11).<br />
Unter elektrischer Leistung versteht man das Produkt aus Stromstärke und<br />
Spannung. Multipliziert man die Werte der beiden Kurven des Diagramms mit<br />
90 o Verschiebung, die über demselben Winkel aufgetragen sind, miteinander, so<br />
erhält man genau so viele negative wie positive Produkte ; die Gesamtleistung über<br />
die ganze Periode ist daher Null (Blindstrom).<br />
Anders werden die Verhältnisse, wenn im Schwingkreis Verluste auftreten<br />
(OHMScher Widerstand, Verluste im Dielektrikum zwischen den Kondensatorplatten,<br />
etwa durch Einbringen organischer oder anorganischer Stoffe mit hohem<br />
Verlustfaktor). Dann beträgt die Verschiebung der Strom- und Spannungskurve<br />
nicht mehr genau 90 o , sondern weniger. Errechnet man nun wieder die Produkte,<br />
so ¡st die Summe der positiven und negativen Anteile nicht mehr Null, d.h., es<br />
wird cinc Wirkleistung umgesetzt, die bei unseren medizinischen Anwendungen<br />
hauptsächlich in Wärme übergeführt wird.<br />
Betrachten wir nun die örtliche EnergieverteÜung innerhalb einer größeren<br />
Zeitspanne, etwa indem wir an verschiedenen Punkten unseres Rades die wirksame<br />
lebendige Kraft bestimmen, so kommen wir an allen Punkten immer wieder zum<br />
gleichen Wert. Die wirksame Spannung ist dagegen an einzelnen Punkten der<br />
Feder verschieden.<br />
Ähnlich verhalten sich Strom und Spannung in geschlossenen Schwingungskreisen.<br />
Die Instrumente, die wir gewöhnlich zur Strommessung verwenden,<br />
geben eine durchschnittliche Stromstärke, den Effcktivwcrt, an. An welcher Stelle<br />
des Kreises wir auch unser Instrument anlegen, wir erhalten überall die gleiche<br />
effektive Stromstärke. Dieses Verhalten des Stromkreises bezeichnen wir als<br />
quasi-stationären Zustand. Dagegen ist die Spannung am höchsten an den Kondcnsatorplatten,<br />
am geringsten am gegenüberliegenden Punkt.<br />
M
d) Eigenfrequen%<br />
Die Schwingungsdauer in unserer Vorrichtung können wir entweder dadurch<br />
verlängern, daß wir die Radmasse vergrößern, oder daß wir eine schwächere Feder<br />
(bei gleichem Material) nehmen. In gewisser Analogie dazu werden die elektrischen<br />
Schwingungen langsamer, wenn Selbstinduktion und Kapazität größer werden.<br />
Stoßen wir unseren Schwingungskreis in irgendeiner Weise an, so entstehen<br />
immer Schwingungen von einer bestimmten Frequenz, die von den beiden genannten<br />
Faktoren abhängt und als Higenfrequen^ bezeichnet wird. Genau so hat<br />
die Saite eines Musikinstrumentes eine Eigenfrequenz, die den Ton bestimmt. Für<br />
die Berechnung verwendet man meist nicht die Schwingungszahl pro Sekunde,<br />
sondern die sog. Kreisfrequenz. Diese erhält man durch Multiplikation der Frequenz<br />
mit in (271 ist der Umfang des Einheitskreises).<br />
Die Erhöhung der Selbstinduktion wirkt auf die Schwingungsdauer im gleichen<br />
Sinn wie Vergrößerung der Kapazität. Soll ein geschlossener Schwingkreis auf<br />
cinc geringere Eigenfrequenz als vorher eingestellt werden, so kann das ebensogut<br />
durch Vergrößerung der Kapazität wie der Selbstinduktion geschehen. Maßgebend<br />
dafür ist die KiRCHHOFF-TnoMSONsche Formel (s. Anhang).<br />
Wir können uns auch die Einstellung des Kreises auf eine bestimmte Frequenz in<br />
anderer Weise erklären. Da der induktive Widerstand mit der Frequenz wächst, der<br />
kapazitive Widerstand dagegen abnimmt, gibt es eine Frequenz, bei der sich die beiden<br />
Widerstände kompensieren. Dann bleibt nur der OHMsche Widerstand, der meist nur<br />
sehr klein ist, übrig. Für diese Eigenfrequenz besitzt der Kreis demnach den geringsten<br />
Widerstand. Nur in diesem Fall ist die Phasenverschiebung so (90 o ), daß sich eine<br />
maximale Stromstärke ergibt.<br />
Bei der medizinischen Anwendung kommt es meistens darauf an, den Behandlungskreis<br />
auf der gleichen Eigenfrequenz zu erhalten, wenn die Kapazität des<br />
Kondensators durch Einschieben verschiedener Dielektrika ins Feld (z.B. Gliedmaßen)<br />
verändert wird. Man kann das dann durch Änderungen der Selbstinduktion<br />
oder der Kapazität ausgleichen. Gewöhnlich wird ein Drehkondensator in den<br />
Behandlungskreis eingebaut, durch dessen Veränderung die Eigenfrequenz des<br />
Behandlungskrcises auf Resonanz mit dem frequenzkonstanten Generatorkreis<br />
eingestellt wird.<br />
Hieraus ergibt sich für die Praxis Folgendes : Die Zuleitung zu den Behandlungselcktroden<br />
darf eine bestimmte Länge nicht überschreiten, sonst wird die Selbstinduktion<br />
zu groß, es ist dann nicht mehr möglich, den Kreis auf Resonanz abzustimmen.<br />
Umgekehrt kann man in einem zu kleinen Kreis keine Resonanz<br />
erhalten, weil die Selbstinduktion zu gering wird. Bei Verwendung zu großer<br />
Elektroden, insbesondere wenn sie dem Körper dicht anliegen, ist es ebenfalls<br />
schwierig, den Kreis in Resonanz zu halten, wie es die optimale Wirkung erfordert.<br />
(Gummielcktroden I)<br />
e) Primär- und Sekundärkreis<br />
1. Abstimmung<br />
Die Schwingungen können in einem Kreis auf verschiedene Weise erregt werden.<br />
Ziehen wir als Vergleich aus der Akustik die schwingende Saite heran, so<br />
kann diese entweder direkt angestrichen oder angeschlagen werden, oder sie kann<br />
auch von einer anderen Schallquelle aus zum Mitschwingen gebrachr werden.<br />
Dementsprechend kann ein elektrischer Schwingkreis - etwa durch Entladen eines<br />
Kondensators (sog. Stoßerregung) oder als schwingender Teil eines Röhrensenders<br />
14
- direkt erregt werden. Das ist der Primärkreis, der in unserem Beispiel der angeschlagenen<br />
Saite entsprechen würde. Durch die elektrischen oder elektromagnetischen<br />
Felder, die von einem solchen Kreis ausgehen, entstehen auch in<br />
anderen in die Nähe gebrachten Kreisen elektrische Schwingungen (Sekundärkreis).<br />
Die im Sekundärkreis erreichbare Stromstärke hängt erstens von der Stromstärke<br />
im Sendekreis ab, zweitens von der Genauigkeit der Abstimmung und<br />
drittens von der Kopplung.<br />
Wenn in einem Sekundärkreis eine günstige Leistung erreicht werden soll, so<br />
ist richtige Abstimmung auf den Sendekreis notwendig. Der Kreis verhält sich<br />
wie eine Violinsaitc, die nur auf den Ton anspricht, auf den sie gestimmt ist. In<br />
einem Kreis können zwar durch Kopplung mit einem Primärkreis auch Spannungen<br />
erzeugt werden, wenn er nicht abgestimmt ist. In diesem Fall ist aber sein Kreiswiderstand,<br />
der sich aus induktiven und kapazitiven Faktoren zusammensetzt, so<br />
groß, daß der Strom nur schwach bleibt. Ein Optimum wird nur dann erzielt,<br />
wenn die Eigenfrequenz mit der des Senders übereinstimmt, d.h. bei Resonanz-<br />
Wie die Violinsaitc eine bestimmte Lange und Spannung haben muß, wenn sie<br />
auf einen gesungenen Ton ansprechen soll, müssen auch Selbstinduktion und<br />
Kapazität im Sekundärkreis im richtigen Verhältnis zur Frequenz im Sendet<br />
stehen.<br />
Der nicht abgestimmte Sekundärkreis führt bei Anregung durch einen Erregerkreis<br />
nach dem Gesagten zunächst nur Schwingungen von kleiner Amplitude aus,<br />
die Stromstärke ist gering. Verändern wir dann fortlaufend die Kapazität in bestimmter<br />
Richtung, so tritt von einem gewissen Punkt an eine Zunahme der<br />
Stromamplituden ein. Je mehr wir die Eigenfrequenz des Kreises derjenigen des<br />
Senders annähern, desto großer wird der Strom, bis wir schließlich an dem<br />
Resonan^punkt angelangt sind. Ändern wir den Kreis weiter im gleichen Sinn, so<br />
geht die Stromstärke wieder zurück. Trägt man die Kapazitätsänderungen in<br />
einem Schaubild als Abszissen, die Stromstärken als Ordinaten auf, so ergibt sich<br />
die Resûnan^kurve (Abb. 12) des Schwingungskreises, deren Steilheit in der Hauptsache<br />
von seiner Dämpfung abhängt (s. nächsten Abschnitt). Die Abstimmung<br />
kann beim Empfangskreis ebensogut durch Änderung der Kapazität wie der<br />
Selbstinduktion erfolgen. Bei der Selbstinduktion geschieht das am besten durch<br />
Vergrößern oder Verkleinern der wirksamen Drahtlängen bzw. Spulenabschnitte.<br />
In unserem Vergleich mit der Violinsaite würde das dem veränderten Abgriff entsprechen,<br />
und wir reden auch hier vom Abgriff'an der Spule<br />
In den Sekundärkreisen, die zur <strong>Kurzwellentherapie</strong> benutzt werden, sind Änderungen<br />
der Kapazität unvermeidlich. Sie entstehen dadurch, daß verschieden<br />
große Objekte zwischen die Platten gebracht werden, die eine Änderung des Abstandes<br />
erfordern. Auch bei Benutzung von Platten verschiedener Größe sind die<br />
Kapazitäten verschieden, so daß vor jeder Behandlung neu abgestimmt werden<br />
muß. Bei den heute üblichen Apparaten wird die Abstimmung durch einen Drehkondensator<br />
vorgenommen, der zum Bchandlungskondensator parallel geschaltet<br />
wird.<br />
2. Kopplung<br />
Die Übertragung von Energie von einem Kreis auf einen andern geschieht durch<br />
Kopplung beider Kreise.<br />
Bei der galvanischen Kopplung bestehen zwischen Primär- und Sekundärkreis<br />
leitende Verbindungen (Abb. 13). Die Übertragung kann aber auch ohne jede<br />
15
Leitung erfolgen, und zwar entweder durch das magnetische Feld (induktive Kopplung)<br />
oder das elektrische Feld (kapazitive Kopplung). Die Stärke der Kopplung<br />
zweier Kreise hängt davon ab, eine wie große Zahl von Kraftlinien sie gemeinsam<br />
haben.<br />
Amp.<br />
3,k<br />
3.2<br />
3,0<br />
2,8<br />
2,6<br />
2,*<br />
2.2<br />
2,0<br />
fj<br />
1.6<br />
1A<br />
12<br />
10<br />
0,6<br />
0.6<br />
0,>><br />
0,2<br />
y<br />
/<br />
/<br />
j<br />
/<br />
/<br />
'<br />
'<br />
,<br />
\<br />
\ 1<br />
\<br />
\<br />
\ \ Í<br />
\<br />
y<br />
/<br />
/<br />
/<br />
><br />
V<br />
•»<br />
/<br />
/<br />
1<br />
i<br />
1<br />
/<br />
/<br />
1 2 3 * S 6 7 g 3 10 11 12 13 H 15 16 1? .18 19 20 2/<br />
cm Abstand<br />
Abb. tz : Resonanz- und Dämpfungskurvc<br />
(Aus ABDERHALDEN, Handbuch, Bd.V, 2/II, S.1770, Fig. 355)<br />
Vergleichen wir den Vorgang etwa mit dem Antrieb eines Mühlrades durch den Wasserstrorn,<br />
so ist dann eine feste Kopplung vorhanden, wenn der ganze Strom auf die<br />
Schaufeln auftrifft und wenn alle Schaufeln ausgenutzt werden. Geht dagegen der Strom<br />
C H<br />
II<br />
VVvV<br />
•"c<br />
¿V s<br />
C H<br />
II<br />
WA/SAT<br />
Abb. 13: Galvanische Kopplung. C,<br />
C —•- Kapazität. / —• Induktionsspulen.<br />
W *• Widerstand. A = Abgriff<br />
i_<br />
*-- \<br />
\<br />
\<br />
\ \ —<br />
\<br />
\<br />
\ \<br />
V<br />
IVvVWvvJ<br />
JvV\M/vVV\<br />
vi "v<br />
Abb. 14: Induktive Kopplung. C,<br />
C~ Kapazitäten./,/— Induktionsspulen<br />
teilweise vorbei, oder ¡st ein Teil der Schaufeln ausgebrochen, so ist die Kopplung lose.<br />
Andererseits ist es einerlei, ob das Rad durch das Gefälle des Wassers als oberschlächtiges<br />
oder durch den Strom als unterschlächtiges Rad angetrieben wird. Analog beeinflussen<br />
die elektrischen Schwingungskreisc einander durch die elektromagnetischen Kraftlinien<br />
16
ei der induktiven Kopplung oder durch das elektrische Feld bei der kapazitiven Kopplung.<br />
Vielfach ist die Kopplung auch kombiniert, wobei der induktive oder der kapazitive<br />
Faktor überwiegen kann.<br />
Maß für den Grad der Kopplung ist der Kopplungsfaktor (s. Anhang). Bei sonst<br />
gleichen Verhältnissen wächst die gegenseitige Induktion mit der Frequenz und<br />
der Annäherung der Kreise.<br />
Eine gute magnetische Kopplung wird beispielsweise erreicht durch einander gegenüberstehende<br />
Spulen, wie in Abb. 14. Die in der einen Spule erzeugten Kraftlinien<br />
schneiden dann die andere Spule in großer Ausdehnung. Stehen, wie in Abb. 15, zwei<br />
einfache geschlossene Schwingungskreise einander gegenüber, so haben sie sowohl<br />
6f<br />
Abb. 15 : Gemischt induktiv kapazitive<br />
Kopplung<br />
Abb. 16: Dasselbe mit Zwischenkondensator<br />
(Z)<br />
elektrische wie elektromagnetische Felder gemeinsam, und es besteht eine gemischt<br />
induktiv-kapazitive Kopplung. Unter Umständen kann die Kopplung zwischen zwei derartigen<br />
Kreisen noch enger gemacht werden, indem über einen Kondensator eine Verbindung<br />
hergestellt wird (Abbb. 16).<br />
Da die Kraftlinien gemeinsam sind, müssen auch die Vorgänge im Sekundärkreis<br />
auf den Sendekreis zurückwirken. Dem Sender wird Energie entzogen. Bei<br />
extrem loser Kopplung, also großem Abstand der beiden Kreise voneinander, wird<br />
diese Rückwirkung sehr gering sein. Wird jedoch die Annäherung größer, so<br />
nehmen die Amplituden von Strom und Spannung im Sekundärkreis zu ; um so<br />
mehr macht sich auch die Rückwirkung bemerkbar. Die Stromaufnahme des<br />
Primärkreises wird größer, die Verluste des Röhrenkreises werden geringer.<br />
Überschreitet man eine bestimmte definierte Große des Kopplungsgrades, so kann die<br />
Rückwirkung so stark werden, daß sich die Frequenz im Primärkreis ändert. Dies kann<br />
in der Praxis zu Betriebsstörungen führen. Der Kopplungsgrad, bei dem diese Erscheinung<br />
auftritt, wird als kritische Kopplung bezeichnet. Sie ist noch vom Wirkwiderstand im<br />
Sekundärkreis abhängig: je größer dieser Widerstand ist (große Dämpfung durch eingebrachte<br />
Körperteile usw.), um so fester kann man koppeln, ohne die kritische Kopplung<br />
zu überschreiten. Außerdem wird bei Röhrenapparaten auch die Rückkopplung<br />
beeinflußt, die für das Zustandekommen der Schwingungen im Sender von größter<br />
Wichtigkeit ¡st (s.S.27).<br />
3. Strom und Spannung im Kreis, Energie<br />
Set2en wir in unserem Kreis eine bestimmte Gesamtleistung voraus, so ändert<br />
sich mit dem Verhältnis von Kapazität und Selbstinduktion auch das Verhältnis<br />
zwischen Strom und Spannung.<br />
17
Unser Vergleich mit der Unruhe einer Uhr kann uns auch dieses Verhalten klarmachen.<br />
Die Unruhe soll auf eine bestimmte Eigenfrequenz abgestimmt bleiben. Ebenso soll die<br />
Arbeitsleistung, das Produkt von Kraft und Weg pro Zeiteinheit, die gleiche bleiben.<br />
Vergrößern wir das Rad, so wird wie Massenenergie größer; Mit Vergrößerung der<br />
Kapazität wächst im elektrischen Kreis die Stromstärke an. Um die gleiche Arbeit wie<br />
vorher zu erzielen, müssen wir den Weg des Rades und daher die Feder verkürzen, wir<br />
setzen die Selbstinduktion herab. Damit wird aber auch das Antriebsmoment am Rad<br />
schwächer, die Spannung geht zurück.<br />
Mit einer Zunahme der Selbstinduktion und gleichzeitiger Verringerung der<br />
Kapazität andererseits steigt die Spannung im Kreis an, und die Stromstärke geht<br />
zurück. Det Strom ändert sich also gleichsinnig mit der Kapazität, die Spannung<br />
mit der Selbstinduktion. Verkleinern wir z.B. in unserem Behandlungskreis die<br />
Kapazität durch Auseinanderrücken der Kondensatorplatten bei Innehaltung der<br />
Resonanzcinstellung, so erhalten wir höhere Spannung und schwächeren Strom.<br />
Die in einem Kreis erziclbare Schwingleistung hängt zunächst ab von Spannung und<br />
Stromstärke und damit auch von der Kapazität. Da nun die Erzeugung höchster<br />
Frequenzen nur mit sehr kleinen Kapazitäten möglich ist, kann dies nur auf Kosten<br />
der Leistung geschehen, d. h. je kleiner die Kapazität, desto höher die Eigenfrequenz<br />
des Kreises, desto geringer aber die Gesamtleistung.<br />
Erregt man in einem Kreis Schwingungen durch einen Hochfrcqucnzcrzcuger mit<br />
veränderlicher Frequenz, dann laßt sich nachweisen, daß der Ladungsstrom proportional<br />
der Frequenz, also umgekehrt proportional der Wellenlänge, zunimmt. Der höheren Zahl<br />
der Stromstöße je Sekunde entsprechen also größere Elcktrizitätsmcngcn, die den Kreis<br />
in der Zeiteinheit durchfließen.<br />
Die Spannung an den Flatten und damit die Feldstärke stehen in keiner Re^iebung z"<br />
den Energieverhältnissen im Generator, also auch nicht Z" den Angaben der Meßinstrumente<br />
im Primärkreis.<br />
Für die Therapie ist die Erzielung möglichst hoher Spannung an den Platten wichtig,<br />
denn sie bestimmt, zusammen mit dem Plattenabstand, die Feldstärke.<br />
4. Dämpfung<br />
Zu den genannten Faktoren, welche die Schwingungen im Kreis beeinflussen,<br />
kommen noch andere, die nicht auf die Frequenz einwirken, aber die Schwingungsamplitude<br />
und damit den Strom abschwächen oder mit anderen Worten zu Energieverlusten<br />
führen.<br />
Hierher gehören die Verluste durch Induktion in benachbarten Leitungen und<br />
durch Strahlung, die Verluste durch kapazitive Erdschlüsse, ferner die Verluste<br />
durch die OHMschen Widerstände im Kreis, und schließlich die dielektrischen<br />
Verluste im Kondensatorfeld. Sic stellen in ihrer Gesamtheit die Dämpfung im<br />
Kreis dar.<br />
Die Verluste, die durch Induktion und durch die ausgestrahlten elektrischen<br />
Wellen verursacht werden, können unter Umständen beträchtlich sein; sie hängen<br />
vom Flächeninhalt des Kreises und von der Art und Stellung der Kondensatorplatten<br />
ab. Die Ausstrahlung ist um so stärker, je größeren Abstand die Platten<br />
voneinander haben und wächst außerdem mit dem Quadrat der Frequenz (s. Anhang).<br />
Ferner können durch die Beschaffenheit der Stromleiter Verluste verursacht werden,<br />
und zwar kommt hierfür in erster Linie der OuMsche Widerstand in Betracht. Für die<br />
18
Hochfrequenzströme bestehen aber noch Besonderheiten. Das Wesen der Selbstinduktion<br />
bringt es nämlich mit sich, daß der induktive Widerstand im Innern der Leiter<br />
größer ist als an der Oberfläche. Daher werden die Stromlinien bei zunehmender Frequenz<br />
immer mehr aus der Mitte nach außen hin gedrängt, so daß die Fortleitung schließlich<br />
fast nur noch an der Oberfläche stattfindet (Skin-Effekt).<br />
Bei hohen Stromstärken kommt es also nicht so sehr auf die Dicke der benutzten Drähte<br />
an wie auf ihre ausreichende Oberfläche. Dicke, massive Stäbe bringen keine Vorteile.<br />
Röhren sind deshalb vorzuziehen. Vorteilhaft ist eine blanke Oberfläche der Leiter, den<br />
geringsten Widerstand bietet eine dauerhafte Versilberung.<br />
Zur Dämpfung gehören ferner die noch zu besprechenden dielektrischen Verluste;<br />
sie sind für uns besonders wichtig, da sie mit den biologischen Wirkungen unmittelbar<br />
zusammenhängen.<br />
Die Größe der gesamten Dämpfung hat Einfluß auf die Gestalt der Kesonan^kurve.<br />
Vergrößert sich die Dämpfung im Kreis, so nimmt die Resonanzkurve eine<br />
abgeflachte Gestalt an und wird im ganzen niedriger. Wir erhalten dann Dämpfungskurven<br />
(Abb. i$.i€), aus deren Gestalt sich die Dämpfung errechnen läßt (s. Anhang).<br />
Überschreitet die Dämpfung einen Wert, der in einem bestimmten Verhältnis zu<br />
Selbstinduktion und Kapazität stehen muß. so wird der Kreis aperiodisch, d.h.,<br />
er hat keine ausgesprochene Eigenschwingung mehr. Eine scharfe Abstimmung<br />
ist nicht mehr möglich, der Strom geht zurück. Deshalb ist auch kein genügender<br />
Strom mehr %u erzielen, wenn sieb ^wischen den Kondensatorplatten nur organisches<br />
Dielektrikum befindet, wenn sie also dem menschlichen Körper unmittelbar angelegt werden.<br />
In unserem Modell kann die Dämpfung etwa durch eine starke Reibung im Lager des<br />
Rädchens dargestellt werden. Ist sie zu hoch im Verhältnis zur bewegten Masse und der<br />
Federspannung, so können keine Schwingungen mehr zustande kommen.<br />
2. Der offene Schwingkreis (Dipol)<br />
In den von Höchstfrcquenzströmen durchflossenen Leitern herrschen, wie wir<br />
schon gesehen haben, ganz andere Verhältnisse, als wir sie von der klassischen<br />
Elektrizitätslehrc her kennen. So haben wir an einem von Gleich- oder technischem<br />
Wechselstrom durchflossenen Leiter nur den kontinuierlichen Spannungsabfall<br />
von einem Ende zum anderen, der das Fließen des Stromes bedingt und nur von<br />
den Widerständen abhängt. In Höchstfrequenz-Schwingkreisen ist der Strom<br />
nicht an allen Stellen derselbe. Der einfachste Fall eines Schwingkreises ist ein<br />
Stab, der Dipol, ein «offener Schwingkreis». Wir können ihn uns so entstanden<br />
denken, daß ein geschlossener Schwingkreis aufgebogen wird, bis der Draht eine<br />
Gerade bildet. Der Stab besitzt als metallischer Leiter sowohl Kapazität wie<br />
Selbstinduktion, die seine Schwingfähigkeit bedingen. Der Unterschied zu den<br />
Schwingungen im geschlossenen Kreis besteht darin, daß die Phasen von Stromund<br />
Spannungsdifferenz zwischen den Enden nicht nur zeitlich gegeneinander<br />
verschoben sind, sondern daß sich auch bei der Messung an verschiedenen Punkten<br />
ganz verschiedene Werte ergeben.<br />
Werden im Dipol elektrische Schwingungen induziert, so wechseln diese sehr<br />
rasch vom einen zum anderen Ende des Stabes, wobei sie jedesmal die Mitte durchfließen.<br />
Wie lange dieser Vorgang dauert, hangt im wesentlichen von der Länge<br />
des Stabes (vielmehr seiner Selbstinduktion, S.io) ab sowie von seiner Kapazität.<br />
19
Man kann sich die Vorgänge am Beispiel einer wassergefüllten Badewanne klarmachen,<br />
wenn der Vergleich auch nicht in allen Punkten stimmt (Abb. 17). Wird das Wasser vom<br />
Ende der Wanne aus angestoßen, dann schwingt es in einem bestimmten Rhythmus auf<br />
und ab. Die Schwingungsdaucr hängt dabei ab von der Größe der Wassermasse und<br />
damit von der Kapazität der Wanne bzw. ihrer Tiefe sowie von ihrer Länge. Je länger die<br />
Wanne und je tiefer sie ist, desto langsamer die Schwingung, desto geringer also die<br />
Frequenz, desto größer die Welle. Die Spannung wird in diesem Beispiel dargestellt durch<br />
den Druck, also die relative Höhe der Wassersäule. Steht das Wasser an einem Ende hoch,<br />
am anderen tief, dann ist die Spannung am größten; das Wasser bewegt sich nun durch<br />
die Wanne hindurch, und beim Durchgang durch den ebenen Stand des Wasserspiegels<br />
ist die Spannung Null. Die Stromstärke entspricht der Menge des strömenden Wassers.<br />
Abb. 17 (oben) : Schwingungen des Wassers in einer Badewanne. Bei I steht<br />
das Wasser links am höchsten und ist im Begriff umzukehren: hohe Spannung,<br />
kein Strom. Bei II geht der Wasserspiegel durch die Horizontale.<br />
Keine Spannung, aber stärkster Strom. Bei III ist rechts der höchste Punkt<br />
erreicht. Die Strömung hat damit aufgehört. Wieder hohe Spannung mit<br />
umgekehrtem Vorzeichen<br />
Abb. 18 (rechts): Spannungs- und Stromverteilung im Dipol<br />
Wir sehen, daß die höchste Spannung nur an den Enden besteht, die höchste Stromstärke<br />
dagegen nur in der Mitte. Ferner sieht man, daß im Augenblick der größten Spannung,<br />
in dem also die Bewegung des Wassers umkehrt, keine Strömung vorhanden ist, hier ist<br />
also die Spannung am höchsten, der Strom Null. Umgekehrt ist im Augenblick des stärksten<br />
Stromes durch die Mitte der Wanne keine Spannung vorhanden. Übertragen wir<br />
diesen Vorgang in ein Vektordiagramm (S. 12), dann zeigt sich, daß eine Phasenverschiebung<br />
zwischen Strom und Spannung um 90° besteht.<br />
Auch der Resonanzvorgang läßt sich an diesem Beispiel zeigen. Wird das Wasser unregelmäßig<br />
geschlagen, dann entsteht eine unregelmäßige Wellenbewegung. Wird dagegen<br />
der Rhythmus der Stöße der Eigenfrequenz der Wassermasse angepaßt, d.h. dem<br />
Rhythmus, in dem sie von selbst schwingt, dann werden die Schwingungen immer stärker<br />
und werden mit geringstem Aufwand von Kraft hervorgerufen.<br />
Das Beispiel läßt sich noch weiter ausführen, indem wir eine Dämpfung einschalten.<br />
Sie kann in einem Sieb bestehen, das in die Mitte gestellt wird, oder wir können eine<br />
Person in die Wanne setzen. Der Wasserstrom wird dadurch gebremst, die Schwingung<br />
wird flacher, und durch die Verzögerung des Stromes wird die Phasenverschiebung<br />
geändert. Sie betragt nicht mehr 90 o , sondern es entsteht ein Verlustwinkel.<br />
Im Dipol haben wir insofern dieselben Verhältnisse, als auch die höchste Spannung<br />
an den Enden vorhanden ist. Wir können dies leicht durch eine an den Stab<br />
herangehaltene Glimmlampe nachweisen, die nur an den Enden aufleuchtet. Dagegen<br />
ist der Strom am stärksten in der Mitte, was sich durch ein in den Verlauf<br />
des Dipols eingeschaltetes Meßinstrument oder eine Glühlampe zeigen läßt. Somit<br />
ist eine Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung um 90^ vorhanden<br />
(Abb. 18).<br />
Im Dipol setzt sich die Dämpfung teils aus dem OHMschen Widerstand zusammen,<br />
teils aus einer Größe, die wir S. 18 schon kurz erwähnt haben, dem<br />
20
Strahlungswiderstand. Die Kraftfelder des Dipols pflanzen sich durch den umgebenden<br />
Raum als elektromagnetische Wellen fort. Den ausgestrahlten Wellen<br />
müssen naturgemäß Verluste im Dipol entsprechen, die ihren Ausdruck im<br />
Strahlungswiderstand finden. Man setzt den Strahlungswiderstand einem OHMschen<br />
Widerstand gleich, der denselben Verlust verursachen würde.<br />
Die ausgestrahlte Wellenlänge steht in bestimmten einfachen, meist ganzzahligen Verhältnissen<br />
zur Länge des Dipols; durch Kondensatoren oder Selbstinduktionen, die in<br />
den Verlauf des Dipols eingeschaltet werden, kann aber die Eigenfrequenz verändert<br />
werden, d.h., bei gleichbleibender Frequenz wird der Dipol verkürzt.<br />
Man kann daher die Wellenlänge annäherungsweise durch Dipole von veränderlicher<br />
Länge messen, in deren Verlauf eine Lampe oder ein Meßinstrument<br />
eingeschaltet ist. Gewöhnlich entspricht bei Resonanz die Länge des Dipols der<br />
halben Wellenlänge.<br />
3. Reflexion, Sammlung durch Hohlspiegel, Brechung<br />
Die sehr kurzen elektrischen Wellen kommen durch ihre Länge an die optischen<br />
Strahlungen heran ; sie haben daher auch gewisse Eigenschaften mit ihnen gemeinsam,<br />
so daß man sie gelegentlich als «quasi-optisebe» Strahlung bezeichnet hat. An<br />
Spiegeln, die aus BIcchscheiben bestehen, findet Reflexion statt, bei der wie beim<br />
Licht Einfalls- und Reflexionswinkel gleich sind.<br />
Um Wirbclstromverluste zu vermeiden, stellt man solche Spiegel besser aus parallelen<br />
über einen Rahmen gespannten Drähten her. Zwischen zwei solchen Spiegeln kann man<br />
stehende Wellen erzeugen und die Erscheinungen der Interferenz nachweisen. Auch Hohlspiegel<br />
können in der gleichen Weise hergestellt werden; wegen der Polarisation der<br />
Welle ist die Krümmung nur in einer Ebene vorhanden. Die Länge der ausgespannten<br />
Drähte entspricht dabei zweckmäßig der halben Wellenlänge. Solche Hohlspiegel werden<br />
daher sehr groß und unhandlich, auch ist die Bündelung der Wellen nicht so, daß sie<br />
therapeutisch zu brauchen wäre. Man kann sich aber in der Praxis die Tatsache zunutze<br />
machen, daß die Wellenlänge in Wasser kürzer ist als in Luft. Deshalb füllt man solche<br />
Hohlspiegel mit Wasser oder besser einem Medium aus, dessen DK möglichst noch<br />
größer ist als die des Wassers und der Körpersubstanzen (Kondensa). Dadurch kann man<br />
die Größe der Spiegel stark verringern ; eine Welle von 1 m in Luft hat in Wasser nur eine<br />
Länge von 11 cm, so daß man mit Spiegeln von schon sehr handlichem Format auskommt.<br />
Man setzt sie so gut auf den Körper auf, daß kein Zwischenraum entsteht, so daß<br />
also der Übergang vom Dielektrikum des Spiegels zum Körper möglichst kontinuierlich<br />
ist. Bei der gebräuchlichen Welle von 12,5 cm Länge genügen verhältnismäßig kleine<br />
Spiegel (s.S. 76)<br />
Durch Prismen können die elektrischen Wellen aus ihrer Richtung abgelenkt<br />
werden, durch Linsen aus Glas oder Asphalt kann eine BrcnnÜnic erzeugt werden;<br />
allerdings müssen für eine 3-m-Wellc derartige Linsen schon sehr umfangreich<br />
sein, so daß solche Versuche im allgemeinen (auch aus anderen Gründen) nur mit<br />
noch kürzeren Wellen ausgeführt werden.<br />
21
4- Messung der Wellenlänge<br />
Die Wellenlänge ist nach dem vorn Gesagten von großer Wichtigkeit für die<br />
Größe der dielektrischen Verluste und daher auch für die therapeutische Wirkung.<br />
Eines der genauesten Verfahren, das den Vorzug großer Einfachheit hat, aber<br />
einen großen Raum erfordert, ist die Messung mittels LüCHER-Systems. Sie beruht<br />
auf der Reflexion, der die HERTZschen Wellen wie alle anderen Wellenbewegungen<br />
unterworfen sind. Das LECHER-Systcm wird auch in der Therapie benutzt.<br />
Koppelt man mit dem Sender einen Schwingungskreis, der in zwei parallel ausgespannte<br />
Drähte auslauft, so werden in diesen Drähten die elektrischen Schwingungen<br />
fortgeleitet- Durch eine auf den Drähten verschiebbare Brücke kann man die Welle reflektieren,<br />
so daß sich stehende Wellen bilden. Die Wellcnbáuchc und Knoten sind dann<br />
dadurch leicht nachweisbar, daß man an den Drähten entlang ein Meßinstrument oder<br />
noch einfacher eine Glühlampe verschiebt, die an den Strombäuchen aufleuchtet, an den<br />
Knoten erlischt. Durch einfache Messung<br />
des Abstandcs zweier Knoten oder<br />
Bäuche ergibt sich die halbe Wellenlänge.<br />
Ebensogut kann man die Brücke verschieben<br />
und die Lampe festmachen.<br />
Um sich ungefähr über die Wellenlänge<br />
zu unterrichten, kann man auch<br />
einen Dipol benutzen, in dessen Mitte<br />
eineGlühlampc eingeschaltet ist. Über die<br />
Drahtenden werden Röhren gesteckt, so<br />
daß das Ganze telcskopartig ausziehbar<br />
ist. Durch Verlängerung und Verkürzung<br />
kann man diesen Dipol auf den Sender<br />
abstimmen. 1st der Resonanzfall erreicht,<br />
Abb. 19au.br Zwei Typen von Wellenmessern<br />
so entspricht die Wellenlänge ungefähr<br />
der doppelten Länge des Dipols. Hinfache<br />
Wellcnmesser zur gröbsten Orientierung<br />
bestehen aus einem Drahtbügel mit<br />
einigen Windungen und einem geeichten Drehkondensator, also einem einfachen geschlossenen<br />
Schwingungskreis. Als Resonanzanzeiger kann eine Glühlampe dienen.<br />
Ein solcher Wellcnmesser gibt nur ein ungefähres Bild wegen der unkontrollierbaren<br />
Veränderungen von Selbstinduktion und Kapazität, die der Kreis durch den Rcsonanzanzeiger<br />
(Lämpchen oder Meßinstrument) erfährt. Besser sind deshalb Geräte, wo<br />
Resonanzkreis und Meßkreis getrennt sind, wie in Abb. 9. Der eigentliche Schwingungskreis<br />
bei a besteht aus Selbstinduktion L und dem Drehkondensator C, der direkt nach<br />
Wellenlängen geeicht sein kann. Von ihm wird ein zweiter Stromkreis abgezweigt, der<br />
einen Detektor D und ein Meßinstrument A als Resonanzanzeiger enthält. Bei Resonanz<br />
ist der Ausschlag des Instrumentes A maximal.<br />
Oder man benutzt (b) einen einfachen Kreis, wie oben beschrieben, der Kapazität,<br />
Selbstinduktion und Resonanzanzeiger enthält. Er dient nur zur rohen Orientierung. Der<br />
eigentliche Meßkreis enthält nur Selbstinduktion und geeichten Drehkondensator. Nachdem<br />
der Kreis A so gut wie möglich abgestimmt ist, so daß die Lampe brennt, wird der<br />
Kreis ß mit ihm induktiv gekoppelt und abgestimmt. Die ResonanzcinstcUung erkennt<br />
man daran, daß nun dem Kreis A Energie entzogen wird, so daß bei geeigneter Kopplung<br />
die Lampe erlischt bzw. der Ausschlag des Meßinstrumentes zurückgeht (Abb. 19).<br />
22
III. Die Erzeugung von elektrischen Schwingungen<br />
für medizinische Zwecke<br />
i. Ältere Vetfahren :<br />
Hochfrequenz, d'Arsonvalisation, Langwellen-Diathermie<br />
Elektrische Schwingungen bieten bei der medizinischen Anwendung den Vorteil,<br />
daß starke Ströme durch den Körper hindurchgeleitet werden können; bei<br />
Gleichstrom ist das nicht möglich wegen der clcktrolytischen Zersetzung und der<br />
Gefahr elektrischer Schläge. Die elektrische Nervenreizung und der elektrische<br />
Schlag beruhen nach NERNST darauf, daß an den Membranen der Nervenzellen<br />
bestimmte, von der Norm abweichende Veränderungen der Ionenkonzcntration<br />
auftreten. Die Stärke des Reizes hängt dabei von der an der betreffenden Stelle<br />
vorhandenen Stromstärke ab und<br />
ist umgekehrt proportional der<br />
Quadratwurzel aus der Frequenz.<br />
M»<br />
Die Gefahr elektrischer Reizung<br />
besteht daher auch noch bei niederfrequenten<br />
Wechselströmen genügender<br />
Intensität; es hat sich<br />
aber gezeigt, daß oberhalb bestimmter<br />
Frequenzen das Gesetz<br />
seine Gültigkeit verliert, wahrscheinlich<br />
wegen der durch die<br />
ff»<br />
passiv-elektrischen Eigenschaften<br />
(Leitungswiderstand, Polarisationskonstantc)<br />
bedingten Latenzzeit<br />
des Reizobjektes. Es ist nämlich<br />
eine bestimmte Zeitdauer Abb. 20: Gedämpfte und ungedämpfte<br />
nötig, um die in Frage kommenden Schwingungen<br />
Membranen genügend aufzuladen<br />
(Membran-Ladezeit). Bei Frequenzen oberhalb von 100 kHz fällt daher die Reizwirkung<br />
auf die Nerven auch bei großen Intensitäten weg.<br />
Die Einwirkung elektrischer Schwingungen kann auf verschiedene Weise geschehen.<br />
Am einfachsten ist die unmittelbare Einschaltung des zu behandelnden<br />
Körperteils in die Strombahn durch Kontakt. Wir haben dann Arten der früher<br />
üblichen Verfahren vor uns, der d'Annualisation und der Diathermie, deren Beziehungen<br />
zueinander und zu unserem Verfahren noch zu besprechen sind. Beide<br />
sind Hochfrequenzverfahren.<br />
Zur Erzeugung von hochfrequenten Schwingungen sind in der Medizin früher<br />
so gut wie ausschließlich Geräte mit Vunkenstrecken benutzt worden. Sie beruhen<br />
auf folgendem Prinzip: Wie im Anfang erwähnt, entstehen elektrische Schwingungen<br />
dann, wenn man die Platten eines Kondensators durch einen Drahtbügel<br />
miteinander verbindet. Es gelingt aber dabei nicht, dem Kondensator neue Ladungen<br />
zuzuführen, da diese sich unmittelbar durch den Bügel ausgleichen würden.<br />
Schaltet man in den Verlauf des Bügels eine Funkcnstrcckc ein, so besteht<br />
eine leitende Verbindung nur während der Dauer des Funkenüberganges. Schon<br />
während und nach dieser Zeit kann der Kondensator durch eine Stromquelle<br />
23
wieder neu aufgeladen werden, bis die Überschlagsspannung der Funkenstrecke<br />
erreicht ist und eine neue Entladung eintritt. Die Schwingungen dauern deshalb<br />
immer nur so lange, wie der Funke übergeht, und nehmen dabei außerdem an<br />
Amplitude ab. Erst nach einer darauffolgenden Zeitspanne, in der keine Schwingungen<br />
stattfinden, kann das Spiel von neuem beginnen. Wir sprechen bei dieser<br />
Art der Schwingungsentstehung von gedämpf ten Schwingungen (Abb. 17).<br />
Die erreichbare Höchstleistung ist in diesen Schwingkreisen immer nur in einem verhältnismäßig<br />
kleinen Teil der Gesamtzeit vorhanden (s. Anhang). Eine Steigerung der<br />
Funkenzahl und damit der Gesamtleistung würde zu starke Belastung und Abnutzung<br />
der Funkenstrecken nach sich ziehen.<br />
Von den meist flachenhaft gestalteten und mit Kühlrippen versehenen Elektroden<br />
wird die entstehende Wärme möglichst schnell abgeleitet, der Funke «gelöscht', so daß<br />
das angestoßene System für sich ausschwingt; nach der Löschung ist nämlich der Stoßkreis<br />
unterbrochen und kann als nicht vorhanden betrachtet werden. Das bietet den Vorteil,<br />
daß die Schwingungen im Hauptkreis nur schwach gedämpft sind.<br />
Die Erzeugung von Schwingungen in der eben beschriebenen Weise wird als<br />
«Stoßerregung» bezeichnet; unser Kreis ist der Stoßkreis, von dem aus andere<br />
Kreise oder Antennen angeregt werden können. Den wirksamen Funken nimmt<br />
man bei Diathermie und Kurzwellendiathermic sehr kurz, sog. Löscefunhen.<br />
Die D'ARSONVALschen Geräte haben einfache Funkenstrecken mit hober Überschlagspannung<br />
(Knallfunkenstrecke). Die Spannung wird im Teslatransformator<br />
noch weiter gesteigert, je nach Größe der Apparate bis auf mehrere 100000 Volt.<br />
Die Geräte werden gewöhnlich so gehandhabt, daß man aus den Elektroden, die<br />
meist aus gasgefüllten Glasröhren bestehen, Funken auf die Kranken übersprühen<br />
laßt. Die Fun ken übergange, die über 20 cm Länge erreichen können, werden als<br />
Sffluvien bezeichnet. Die mit solchen Apparaten erzeugten Frequenzen Hegen gewöhnlich<br />
bei etwa 2-300 kHz, was umgerechnet Wellenlängen von etwa zwischen<br />
1000 und 2000 m entsprechen würde.<br />
Diese Apparate werden teils bipolar angewandt, indem der Patient einen Pol<br />
der Tcslaspule in die Hand nimmt, oder «unipolar». Hierbei steht der Kranke auf<br />
dem Fußboden oder einem isolierten Schemel. Er bildet dann einen Belag eines<br />
Kondensators gegen Erde, ist also durch die Isolierschicht hindurch gegen die<br />
Erde kapazitiv kurzgeschlossen. Auch in diesem Fall wird also der Körper von<br />
dem zugeleiteten Stom im ganzen durchflössen. Bei den sehr kurzen Wellen läßt<br />
sich eine solche Zuleitung ebenfalls bewerkstelligen, dies ist aber unzweckmäßig.<br />
Die im Handel befindlichen «Hocbfrequen%apparate» sind nichts als eine kleine<br />
Form der D'ARSONVAL-Apparate, ebenso wie die ZEILEIS-Apparate.<br />
Bei den Diatbermeapparaten, die mit Löschfunken arbeiten, bewegen sich die<br />
Spannungen in der Größenordnung von einigen 100 Volt, die Stromstärke kann<br />
einige Ampere betragen.<br />
Die Frequenzen liegen meist unterhalb von \ MHz*, entsprechend Wellenlängen<br />
von 300-500 m. Der Strom wird mit aufgelegten Elektroden durch Kontakt<br />
zugeleitet. Die Stromstärke wird durch die Größe der Kontaktflächc mit bestimmt<br />
sowie durch den Widerstand des Körpers.<br />
Es ist früher schon versucht worden, die Feldwirkung der Hochfrequenzströme auf<br />
den Körper zu benutzen, so von D'ARSONVAL mit der sog. Autokandaktion. Der Patient sitzt<br />
dabei in einer großen Drahtspulc, die vom Hochfrequenzstrom durchflössen wird. Hier<br />
wird also das elektromagnetische Feld benutzt.<br />
* 1 MHz = 1 Megahertz = 1 Million Hz.<br />
24
Beim Kondensatorbett (APOSTOLI) wurde ein Diathermiestrom einer sehr großen biegsamen,<br />
mit ganz dünner Isolierschicht überzogenen Platte zugeleitet, die den ganzen<br />
Körper überdeckt. Hierbei wird die kapazitive Wirkung der Diathermieströme ausgenutzt,<br />
indem die Platte den einen, der Körper den anderen Belag eines Kondensators<br />
bildet. Das Verfahren hat sich nicht bewährt, da die Stromwirkung zu ungleichmäßig<br />
verteilt ist.<br />
Trotz verschiedener Versuche mit Elektronenröhren hat in der Langwellendiathermie<br />
die Funkenstrecke allein das Feld behauptet, da sie vor allem billig in<br />
der Anschaffung ist. An sich ist es möglich, auch mit Funkenstrecken Ultrafrequenzen<br />
zu erzielen, doch hat sich hierfür der Röhrenapparat als überlegen<br />
erwiesen.<br />
Um mit Funkenstrecken und Stoßkreis Ultrafrequenzen erzielen zu können, muß die<br />
Kapazität in den Kreisen bedeutend herabgesetzt werden. Damit geht aber die Leistung<br />
stark zurück. Um die Leistung erhöhen zu können, arbeitet man mit mehreren hintereinandergeschalteten<br />
Funkenstrecken. Die Selbstinduktion solcher Systeme wird dadurch<br />
verringert, daß die die Funkenstrecken enthaltenden Leitungen Zickzack- oder kreisförmig<br />
bïfilar angeordnet sind. Bei kurzen Wellen, wie sie sogar bis zu Teilen eines Millimeters<br />
erzeugt werden können, kommen nur noch minimale Leistungen zustande, die höchstens<br />
in Mikrowatt auszudrücken sind. Dazu kommt als Nachteil der gedämpften Schwingungen,<br />
daß die Energie immer nur in verhältnismäßig kurzen Zeitabschnitten wirksam<br />
werden kann.<br />
Auf Grund von Versuchen, die ESAU und ich 1926 sowohl mit Funkenstrecken<br />
wie mit Röhrengeneratoren ausführten, kamen wir schon damals zur<br />
Bevorzugung der Röhre. Während beim Röhrensender die Leistung bei kürzer<br />
werdender Wellenlänge ungefähr linear abnimmt, erfolgt die Abnahme beim<br />
Funkenapparat in stark gekrümmt abfallender Kurve. Wenn ein solcher Apparat<br />
beispielsweise bei 20 m Wellenlänge eine Leistung von 400 Watt hat, so ist bei<br />
4 m Wellenlänge nur mit einem kleinen Bruchteil dieser Leistung zu rechnen.<br />
Von einem für alle Anwendungsgebiete genügenden Kurzwcllenapparat muß aber<br />
auch bei 7-11 m Wellenlänge eine Nutzleistung von mindestens 300 Watt gefordert<br />
werden.<br />
Durch den Wellcnplan von Atlantic city sind jetzt nur noch bestimmte Wellenlängen<br />
für ärztliche Zwecke zugelassen, die Funkenstreckengeräte sind daher praktisch<br />
verboten.<br />
Die Funkenstrcckcngcrätc dürfen jetzt nicht mehr betrieben werden, da sie den<br />
Rundfunk und das Fernsehen stören.<br />
Wegen dieser Störungen müssen alle mit elektrischen Schwingungen arbeitenden<br />
elektromedizinischen Geräte von dem Fernmeldeämtern genehmigt sein.<br />
z. Die Elektronenröhre als Schwingungserzeuger. Prinzip. Schaltungen<br />
Ungedämpfte Schwingungen mit hohen Leistungen werden mit Elektronenröhren<br />
erzeugt.<br />
Schon früher ist die Verwendung der Elektronenröhren zur Langwellen-Diathermie<br />
versucht worden, doch haben sich derartige Apparate, wie sie zwischen 1921 und 1924<br />
von verschiedenen Firmen ausgeführt worden sind, nie recht einbürgern können. Ein<br />
Drei roh rcn-G erat hat 192J STIEBÖCK angegeben, das mit etwa 8000 kHz arbeitete, allerdings<br />
bei Leistungen von nur wenigen Watt.<br />
2-5
Die Elektronenröhre hat die Fähigkeit, Wechselströme bis zu den höchsten<br />
Frequenzen praktisch trägheitslos zu verstärken sowie unter gewissen, genau definierten<br />
Bedingungen als selbsterregtcr Generator zu wirken. Die in der Medizin<br />
benutzten Röhren sind im Grund die gleichen, die auch in Rundfunksendern verwandt<br />
werden.<br />
Die Röhre besteht aus einem hoch evakuierten Glasrohr, das eine Kathode, eine<br />
Anode und dazwischen ein oder mehrere Gitter enthält. Die Kathode besteht aus<br />
einem Wolframfaden, der durch den Heizstrom zum Glühen gebracht wird. Dabei<br />
treten Elektronen aus, die den Faden wie eine Wolke umgeben. Die Emission der<br />
Elektronen hängt ab von der Fläche und Temperatur des Heizfadens.<br />
Wird eine Spannung zwischen Anode und Kathode angelegt, dann durchfließt<br />
die Röhre ein Strom, der Anodenstrom. Seine Stärke richtet sich nach der Ergtcbig-<br />
Abb. 2i : MEissNERschc Rückkopplungsschaltung.<br />
R -- Induktive Rückkopplung<br />
DP A<br />
Abb. 22: ELcktronenrohr schematisch<br />
in EsAuschcr Schaltung. H -- Glühkathode;<br />
G — Gitter, A ^- Anode;<br />
C = Blockkondcnsator; AG ~ Gitterablcitung<br />
mit Widerstand W;Dr — Heizdrosseln;<br />
Dr A — Anodcndrossel.<br />
keit der Glühkathode und der angelegten Spannung; bei zunehmender Anodenspannung<br />
steigt er zunächst ebenfalls, um oberhalb einer bestimmten Grcnzehicht<br />
mehr zuzunehmen, die Sättigung ist erreicht, da jetzt alle emittierten Elektronen<br />
zur Anode übergehen. Bei Vergrößerung des Heizstromes der Wolfram-Kathode<br />
nimmt der Anodenstrom ebenfalls bis zu einem jetzt größeren Sättigungswert zu.<br />
Das Gitter liegt zwischen Kathode und Anode in der Bahn der Elektronen, die<br />
mit etwa 1 /I00 Lichtgeschwindigkeit auf die Anode zufliegen. Führt man dem Gitter<br />
negative Ladung zu, dann werden die Elektronen zurückgestoßen, also gebremst,<br />
bei positiver Ladung werden sie beschleunigt. Auf dieser Eigenschaft beruht die<br />
Verwendung der Elektronenröhre als Verstärker.<br />
Bei der früher meist üblichen Anordnung besteht die Kathode aus mehreren in der<br />
Mitte der Röhre senkrecht ausgespannten Wolframfäden; Gitter und Anode sind zylindrisch<br />
und umgeben die Kathode konzentrisch. Vom Anodenblech und dem Gitter<br />
gehen zwei Durchführungen nach außen; die Zuleitungen für den Heizstrom sind unten<br />
nebeneinander angebracht.<br />
Um das Gitter auf das jeweils gewünschte Potential zu bringen, muß für Ablcitung der<br />
Gitterströme Sorge getragen werden. Hierzu dient die Gitterableitung AG (Abb. 21);<br />
26
durch einen richtig dimensionierten Widerstand kann unter Umständen das Gitterpotential<br />
geregelt werden.<br />
Der primäre Schwingkreis wird aus den genannten Metallteilen der Röhre gebildet,<br />
die gegeneinander eine bestimmte Kapazität haben (die innere Kapazität der Röhre).<br />
Der Schwingkreis wird durch Verbindung des Gitters und der Anode mit einem<br />
Drahtbügel hergestellt, der noch einen Blockkondensator enthalten muß. Dieser<br />
verhindert, daß die hohe Anodenspannung an das Gitter gelangt, ohne jedoch den<br />
hochfrequenten Schwingungen ein Hindernis entgegenzusetzen.<br />
Schwingungen werden in einer solchen Röhre dadurch erzeugt, daß der Elektronenstrom<br />
rhythmische Impulse erhält, dem Gitter also wechselnde Ladungen<br />
in ganz bestimmter Weise erteilt werden. Man erreicht dies entweder durch Fremdsteucrung<br />
des Gitters, wobei das EIcktronenrohr in Hochfrequenzverstärker-<br />
Schaltung benutzt wird, oder durch Rückkopplung in Selbstcrregcr-Schaltung.<br />
Hierbei induzieren sich der Anodenkreis und Gitterkreis gegenseitig, so daß sich<br />
die wechselseitigen Stromschwankungen schließlich zu Schwingungen aufschaukeln.<br />
Derartige Schaltungen geben Abb. 21 u. 22 wieder.<br />
Der eigentliche Schwingkreis ist hier aus der Selbstinduktion R und der Kapazität C<br />
zusammengesetzt. Die Schwingungen entstehen durch irgendeinen vom Anodenkreis<br />
ausgehenden Anstoß und nehmen die durch Kapazität und Selbstinduktion gegebene<br />
Frequenz an. Durch die induktive Rückkopplung bei R bewirkt jede Schwingung dieses<br />
Kreises einen Stromstoß in entgegengesetzter Richtung im Gitterkreis mit entsprechender<br />
Aufladung des Gitters; durch die gegenseitige Beeinflussung der beiden Kreise gewinnen<br />
die Schwingungen an Amplitude und werden dauernd in Gang gehalten.<br />
Mit derartigen Schaltungen können längere Wellen mit Leistungen von mehreren<br />
Kilowatt erzeugt werden. Beim Heruntergehen mit der Wellenlänge unter<br />
eine bestimmte Grenze, die etwa bei 6 m liegt (für eine bestimmte Röhrentype),<br />
nehmen jedoch die Leistungen stark ab, und bei noch höheren Frequenzen lassen<br />
sich überhaupt keine Schwingungen mehr erzielen. Das hat seinen Grund darin,<br />
daß hier die innere Kapazität der Röhren anfängt, eine maßgebende Rolle für den<br />
Mechanismus der Schwingungserzeugung zu spielen. Während bei den niedrigeren<br />
Frequenzen der Arbeitskreis außerhalb der Röhre liegt, sind bei den sehr kurzen<br />
Weifen die inneren Kapazitäten in den Schwingungskreis einbegriffen, die nur<br />
auf Kosten der Schwingleistung verkleinert werden können. ESAU ist es zuerst<br />
gelungen, noch bei Wellenlängen zwischen 3 und 6 m hohe Schwingleistungen<br />
von 30-50% der zugeführten Leistungen zu erzielen.<br />
Bei den Sendern für sehr kurze Wellen werden statt der induktiven Rückkopplung<br />
kapazitive Rückkopplungen angewandt. Die Schaltungen, mittels derer auch bei Wellen<br />
unter 6 m große Leistungen erhalten werden, beruhen auf dem Spannungstcilcrprinzip,<br />
wobei die Anodenspannung dem Schwingungskreis an der Stelle des Spannungsknotens<br />
angelegt wird.<br />
Der eigentliche Schwingungskreis enthält als Selbstinduktion nur den kurzen Bügel<br />
A—C—G, der an Anode und Gitter angeschlossen ist. Die Kapazität in diesem Kreis<br />
wird im wesentlichen durch die innere Röhrenkapazität zwischen Anode und Gitter dargestellt,<br />
die in der Größenordnung von 10 cm liegt. Im Kreis befindet sich noch ein<br />
Kondensator C; da dessen Kapazität größer ist als die innere Röhrenkapazität, hat er auf<br />
die Gesamtkapazität nur einen geringen Einfluß (s.S. 10). Er dient lediglich als Blockkondensator,<br />
um die Anodenspannung vom Gitterkreis fernzuhalten. Die Aufladung des<br />
Gitters wird geregelt durch die Gitterableitung AG, die eine Drossel und einen Widerstand<br />
enthält. In die verschiedenen Zuleitungen zu Anode und Heizung sind ebenfalls<br />
2-7
Drosseln eingeschaltet. Sie dienen dazu, einen Übergang der Schwingungen in das<br />
Leitungsnetz zu verhindern. Diese Drosseln sind abstimmbar. Ihr Hauptzweck besteht<br />
darin, daß durch ihre Abstimmung einzelne Kreise entstehen, die sich auf den Hauptkreis<br />
abstimmen lassen, so daß dadurch die günstigsten Bedingungen für die Verhinderung<br />
eines Abflusses der Energie geschaffen werden. Nur bei richtiger Abstimmung aller dieser<br />
Kreise aufeinander kann der Sender gute Schwingleistungen ergeben. Hierzu gehört auch,<br />
daß der Abgriff für die Anodenspannung an die richtige Stelle gesetzt wird. Statt der<br />
Drosseln werden besser Sperrkreise verwandt, die aus einem Selbstinduktionsbügel und<br />
einem Drehkondensator bestehen; ihre Abstimmung erfolgt durch Veränderung der<br />
Kondensatorkapazitat. Im Hauptschwingungskreis selbst kann die Frequenz durch<br />
Änderung der Kapazität im Blockkondcnsator nur in geringem Maß verändert werden.<br />
Zur Änderung der Selbstinduktion kann ein von mir angegebener drehbarer Bügel angebracht<br />
werden. Zur Wcllenlängenänderung in weiteren Grenzen ist es notwendig, den<br />
Sclbstinduktionsbügel nech mehr zu vergrößern oder durch Spulen zu ersetzen.<br />
Zur Erzeugung noch längerer Wellen kommen verschiedene Schaltungen in Frage, auf<br />
die hier nicht näher eingegangen werden kann.<br />
Zum Betrieb eines solchen Generators können Gleich- oder Wcchselspannungen<br />
verwandt werden. Im ersteren Falle benutzt man Hochspannungs-Gleichstrommaschinen;<br />
ebensogut kann man Wechselspannung verwenden, die durch Glühventile<br />
gleichgerichtet wird. Der Heizstrom muß dann von einer besonderen Maschine<br />
mit entsprechender Spannung oder durch eine Batterie erzeugt werden.<br />
Bei unmittelbarer Verwendung von Wechselspannungen wirkt die Röhre selbst wie<br />
ein Glühventil-Gleichrichter; sie arbeitet dann nur auf der einen Halbwelle. Die Anodenspannung<br />
kann dann etwas höher sein als bei Gleichspannung. Die Verwendung von<br />
Wechselspannung hat den großen Vorteil, daß man durch Transformatoren die gewünschten<br />
Spannungen jederzeit herstellen kann. Man braucht dann nur einen Anodentransformator<br />
für Hochspannung und einen Heiztransformator, die am gleichen Netz Hegen<br />
können. Die Apparatur vereinfacht sich dadurch gegenüber dem Gleichstromgerät. Bei<br />
Betrieb der Röhrensender hängt der Stromablauf im Patienten kreis natürlich von der Art<br />
des Betriebsstromes ab. Die idealsten Verhältnisse hat man bei Betrieb mit Gleichstrom,<br />
wo man einen gleichmäßig fortlaufenden ungedämpften Wellenzug erhält. Da die meisten<br />
Geräte mit Wechselstrom betrieben werden, haben wir eine Modulation der Wellcnzüge<br />
durch die betreffende Frequenz. Bei Wechselstrom von jo Hertz sind die Schwingungen<br />
immer 1 /ieo Sekunde vorhanden und fallen dann für '/ioo Sekunde aus. Immerhin laufen<br />
bei einer $-m-Weite in dieser Zeit etwa 2 Million Schwingungen ab; die Welle ist innerhalb<br />
dieses Zeitabschnittes (im Gegensatz zur Welle des Funkenapparates) ungedämpft.<br />
Die gesamte Schaltung stellt sich demnach dar wie in Abb. 23. Ein Generator liefert<br />
Wechselstrom, in unserem Fall jo Hertz. TA ist der Hochspannungstransformator für<br />
die Anodenspannung von 4000 Volt, TH der Heiztransformator mit 16 Volt Sekundärspannung.<br />
Durch zwei Schalter ist der Strom zum Anoden- bzw. Heiztransformator auszuschalten.<br />
Um die Spannungen regulieren zu können, sind in die Primärkreise der Transformatoren<br />
Regulierwiderstände eingeschaltet. Im Heizkreis liegt ferner ein Voltmeter<br />
mit Meßbereich bis zo Volt; ein zweites Voltmeter Hegt im Primärkreis des Anodentransformators.<br />
Durch Verordnung ¡st jetzt nur noch die Benutzung bestimmter Wellenlängen zu<br />
therapeutischen Zwecken erlaubt, und zwar 7,37 m und 11,06 m. Diese Wellenlängen<br />
müssen sehr genau eingehalten werden. Da die Selbststeuerung meist nicht mehr die<br />
Gewähr für genaue Konstanz der Wellenlänge gibt, werden quarzgesteuerte Geräte<br />
gebaut. Diese Konstruktion beruht auf dem piezoelektrischen Effekt des Quarzes : Wird<br />
ein Quarz durch hochfrequente elektrische Wechselspannung angeregt, dann gerät er in<br />
Schwingungen, d.h. rhythmische Zusammenziehungen und Ausdehnungen. Ein Quarz<br />
hat eine bestimmte Eigenfrequenz, in der er schwingt; sie steht in einfacher Beziehung<br />
28
zu seiner Dicke. Man kann so Schwingungen erzeugen, die außerordentlich konstant<br />
sind.<br />
Bei der klinischen Prüfung hat sich ergeben, daß die Resultate mit der ii-m-Welle<br />
nicht sehr wesentlich von den mit 6-m-Wellen erzielten abweichen. Die Differenz in der<br />
Tiefenwirkung kann durch Verwendung größerer Elektrodenabstände und demgemäß<br />
höherer Feldstärken zu einem genügenden<br />
Grad ausgeglichen werden.<br />
Die Abkühlung der Elektronenröhren<br />
erfolgt meist durch Ausstrahlung<br />
der Wärme in den Raum. Die Röhren<br />
müssen deshalb verhältnismäßig groß<br />
sein. Röhren für sehr große Leistungen<br />
werden daher mit Wasser oder Ventilatoren<br />
gekühlt.<br />
Besonders gute Nutzleistungen er<br />
gibt die Schaltung von zwei Röhren im<br />
«Gegentakt». Dabei ist Gitter gegen<br />
Gitter und Anode gegen Anode geschaltet.<br />
Die eine Röhre bildet dabei den<br />
Blockkondcnsator der anderen. Bei solchen<br />
Schaltungen kann außerdem die<br />
Wellenlänge leicht verändert werden.<br />
Es können auch in einer Röhre zwei<br />
aus Anode, Gitter und Kathode bestehende<br />
Systeme angebracht sein.<br />
Zur Erzeugung noch kürzerer Wellen<br />
dient das Schtit^magnetron (Habann-<br />
Röhrc), das nach einem anderen Prinzip<br />
arbeitet. Die Elektronen werden von<br />
einer zentral gelegenen Glühkathode<br />
emittiert, die konzentrisch darum liegende<br />
Anode besteht aus mehreren<br />
Segmenten. Die Vorrichtung befindet<br />
sich im starken elektromagnetischen<br />
Feld einer Spule, die um die Röhre herumgclegt ist. Durch dieses Feld werden die Elektronen<br />
abgelenkt; sie fliegen nicht geradlinig auf die Anode zu, sondern in Kreisbahnen.<br />
Von der Stärke des Magnetfeldes hängt es ab, ob sie auf die Anode auftreffen oder<br />
nicht. Man stellt nun das Feld so ein, daß die Elektronen gerade eben an der Anode vorbeifliegen<br />
und sie nur erreichen, wenn sie eine zusätzliche Beschleunigung bekommen.<br />
Mit einem von PÄTZOLD entwickelten Generator dieser Art ist es bereits gelungen,<br />
Energien bis zu 600 Watt bei 1 m Wellenlänge zu erzeugen.<br />
IV. Das Kurzwellen-Kondensatorfeld<br />
Das Kondensatorfeld in der Anordnung, wie sie ESAU und SCHERESCHEFSKY<br />
unabhängig voneinander zuerst angewandt haben, bedeutet die bisher wirkungsvollste<br />
Anwendungsmöglichkeit der kurzen Wellen. Der Kondensator, der aus<br />
zwei einander gegenüberstehenden Platten besteht, bildet dabei einen Teil eines<br />
geschlossenen Schwingkreises.<br />
Or. A<br />
Abb. 23: Gesamtschaltbild. A = Anode;<br />
G = Gitter; H = Heizfaden; C = Blockkondensator;<br />
P = Spule im Primärkreis;<br />
Dr.H = Drossel im Heizkreis; Dr.G =<br />
Drossel in der Gitterableitung; W= Widerstand<br />
in der Gittcrableitung; Dr. A = Anodendrosscl,<br />
TH — Heiztransformator;<br />
TA = Hochspannungstransformator<br />
29
Im Primärkreis eines Kurzwellenerzeugers stößt die Behandlung von Patienten<br />
auf große Schwierigkeiten. Die stärkere Dämpfung übt hier einen nachteiligen<br />
Einfluß auf die Schwingungsfähigkeit des Generators aus; Bewegungen des Objektes<br />
würden dauernd die Wellenlänge verändern. Deshalb behandeln wir im<br />
Sekundärkreis.<br />
Die Wirkung des Kondensatorfeldes hängt ab von der Feldstärke, die ihrerseits<br />
durch die Spannung an den Platten und deren Abstand bestimmt wird. Die Spannung<br />
ändert sich je nach der Größe und Einstellung der Platten sowie Länge der<br />
Zuleitungen (S.14). Die Feldlinien laufen nur in der Mitte zwischen den Platten<br />
nahezu parallel, an den Rändern erfahren sie eine Streuung,<br />
sie divergieren (Abb. 24). Auch nach seitwärts und hinten<br />
wird Energie ausgestrahlt. Die Stärke der Streuung hängt ab<br />
von dem Verhältnis des Abstandes zum Durchmesser der<br />
Platten. Ist dieses Verhältnis klein, dann ist auch die Streuung<br />
gering. An sich müßten wir also bei Verwendung möglichst<br />
großer Platten in geringem Abstand die beste Zusammenfassung<br />
der Kraftlinien haben. Dies gilt auch bis zu einem<br />
gewissen Grade ; bei Durchflutung inhomogener Dielektrika<br />
bekommen wir jedoch andere Verhältnisse, auf die noch<br />
einzugehen ist.<br />
Die Erwärmung in einem Dielektrikum wächst mit dem<br />
Quadrat der Stromstärke bzw. Stromdichte. Da die Feldlinien<br />
nach der Mitte des Objektes zu divergieren, die Stromdichte<br />
also geringer wird, nimmt die Erwärmung entsprechend<br />
im quadratischen Verhältnis ab (Abb. 24). Bei Verwendung<br />
gekrümmter Platten wird das Feld mehr nach<br />
der Mitte hin verdichtet.<br />
Abb. 24: Verteilung<br />
der Kraftlinien und<br />
der Erwärmung im<br />
Dielektrikum eines<br />
Kurzwcllenfeldes<br />
(SCHAEFER)<br />
1. Kapazitive Wiikung<br />
Erst bei Frequenzen über 10 Millionen Hertz nähern wir<br />
uns dem Gebiet, wo neben der reinen Fortleitung des Leitungsstromes<br />
die kapazitive Wirkung bedeutungsvoll wird.<br />
Je höher die Frequenz, um so mehr wächst dieser Stromteil,<br />
der Verschiebungsstrom, an, bis er bei besonders hohen<br />
Frequenzen sogar den fortgeleiteten Stromteil übertreffen<br />
kann. Durch ihn ist im wesentlichen die Tiefenwirkung im zusammengesetzten<br />
Medium bedingt, wobei auch die Art der Energiezuführung von wesentlicher<br />
Bedeutung ist.<br />
Die kapazitive Wirkung ist im Grunde genommen eine Influenzerscheinung.<br />
Sie muß sich je nach der Beschaffenheit des Dielektrikums verschieden auswirken.<br />
Bei Metallen ¡st sie aus bereits erörterten Gründen nicht vorhanden. Entstehende<br />
Ladungen gleichen sich sofort aus. In Isolatoren andererseits kann kein derartiger<br />
Ausgleich erfolgen. Hier bildet sich nur ein Feld, die Leitungsstromkomponente<br />
fehlt jedoch. In Halbleitern schließlich bildet sich ein Feld von besonderer Art,<br />
wobei die Ladungen der Ionen und die loncnwandcrungsgeschwindigkcitcn die<br />
wichtigste Rolle spielen. Wir erhalten Verschiebungs- und Leitungsstrom (s.S. 8).<br />
Jedes elektrisch geladene Teilchen in einem solchen Halbleiter, das überhaupt im<br />
30
Bereich des Feldes Hegt, erfährt eine Beeinflussung, deren Art nur von seinem<br />
physikalisch-chemischen Aufbau abhängt.<br />
Die Stärke der Beeinflussung der Teilchen hängt ab von der Feldstärke und<br />
damit der Spannung an den Kondcnsatorplatten.<br />
2. Brechung und Obeiflächenwiikung<br />
In einem Dielektrikum ist entsprechend seiner Zusammensetzung auch in den<br />
tiefgclcgencn Schichten eine bedeutende Feldwirkung vorhanden. Die Richtung<br />
der Kraftlinien erfährt aber dabei noch Veränderungen an den Grenzflächen. Wie<br />
PATZOLD durch geeignete Erwärmungsversuche festgestellt<br />
hat, findet eine Brechung der elektrischen Kraftlinien<br />
beim Übergang zwischen Schichten verschiedener<br />
Dielektrizitätskonstanten statt. Dies ist insbesondere der<br />
Fall beim Übergang von der der Elektrode vorgeschalteten<br />
Luftschicht zur Hautoberfläche (s. Abb. 2j). Dadurch<br />
werden unter Umständen die Grenzflächen unter<br />
den Elcktrodcnrändern besonders stark belastet. Auf<br />
diese Weise entsteht - besonders bei falscher Einstellungeine<br />
Unglcichmäßigkeit der thermischen Belastung der<br />
Hautoberfläche, wodurch die Wirkung in der Mitte verringert<br />
wird. Derartige Brechungen entstehen auch zwischen<br />
den einzelnen Körperschichten. Andererseits kann<br />
auch das Feld in Medien von besonders guter komplexer<br />
Leiffähigkeit hineingezogen werden, hier findet also eine<br />
Verdichtung der Kraftlinien statt. Ein solches Verhalten<br />
muß bei der selektiven Erwärmung angenommen werden.<br />
Hier ist theoretisch-physikalisch ein Einwand möglich. Wir<br />
wissen, daß in metallischen Leitern die Hochfrequenzströme<br />
immer nur auf der Oberfläche entlangfließcn, der Querschnitt<br />
des Leiters sogar stromlos bleiben kann. Dieser Skin-Effeki<br />
steigert sich mit zunehmender Frequenz. Bei der geringen<br />
Leitfähigkeit des Körpers kommen Skin-Effekte aber kaum<br />
in Frage.<br />
Abb. 25: Verlauf der<br />
Kraftlinien und Linien<br />
gleicher Feldstärke in<br />
Umgebung einer Kondensatorplattc<br />
(links) in<br />
Luft und beim Übergang<br />
in ein anderes<br />
Dielektrikum (menschlicher<br />
Körper)<br />
Unter bestimmten Versuchsbedingungen haben wir eine Erscheinung beobachtet,<br />
die an eine solche Oberflächenwirkung erinnern könnte, mit ihr aber in Wirklichkeit<br />
nichts zu tun hat, und zwar dann, wenn die Kondcnsatorplatten sehr groß<br />
im Verhältnis zum Objekt sind, also den Rand des Objektes überragen. Hierbei<br />
entsteht unter bestimmten Bedingungen eine stärkere Erwärmung der Oberfläche.<br />
Die Erscheinung läßt sich auch beobachten, wenn Flüssigkeit, etwa in einem Reagenzglas,<br />
so ins Kondcnsatorfeld gebracht wird, daß der Flüssigkcitsspicgel sich<br />
noch innerhalb des durch die Platten begrenzten Raumes befindet. Man kann dann<br />
häufig ein Aufkochen seitlich am Flüssigkeitsmeniskus beobachten, ohne daß die<br />
Temperatur der übrigen Flüssigkeit sich bis zum Siedepunkt erhöht. Diese Erscheinung<br />
ist durch Zusammendrängen der Feldlinien an der Oberfläche zu erklären,<br />
wo die großen Sprünge der Dielektrizitätskonstante (Luft-Wasser) starke<br />
31
Feldzerrungen zur Folge haben; allerdings ist es nicht ausgeschlossen, daß noch<br />
eine besonders starke Erhitzung der Dampfschicht an der Flüssigkeitsoberfläche<br />
hinzukommt.<br />
Sind, wie bei jeder lokalen Thcrapiebehandlung, die Elektroden kleiner als die<br />
Oberfläche des behandelten Körperteils, so ist die Oberflächenwirkung so gering,<br />
daß sie vernachlässigt werden kann. In einem bestimmten Fall spielen solche<br />
Veränderungen an der Oberfläche aber auch in der therapeutischen Anwendung<br />
eine wichtige Rolle, wenn nämlich die Oberfläche des Körpers naß ist, wie bei<br />
der Bildung von Schweißtropfen, bei nässenden Wunden u. dgl. Durch Brechung<br />
der Feldlinien kann unter bestimmten Umständen eine starke Verdichtung an der<br />
Oberfläche solcher Flüssigkeitshäute stattfinden. Dann entsteht eine starke Erwärmung<br />
an diesen Stellen, die zur Verbrennung führen kann. PÄTZOLD hat hierzu<br />
einen schönen Versuch ausgeführt. Wird ein ausgebreiteter Flüssigkeitstropfen<br />
dem Kondensatorfeld ausgesetzt, so erhitzt sich nicht, wie man denken sollte,<br />
seine Mitte besonders stark, sondern eine ringförmige Zone am Rande des Tropfens.<br />
Die starke Erhitzung der Schweißtropfen erklärt sich zwanglos aus dieser Erscheinung.<br />
3. Wirkungen des Kondensatorfeldes auf Flüssigkeiten,<br />
Gewebe und Organe<br />
d) Vorgänge im Dielektrikum<br />
Alles, was sich zwischen den Kondensatorplatten befindet, ist Dielektrikum.<br />
Wir bezeichnen so allgemein die zwischen den Platten eines Kondensators liegende<br />
Isolierschicht, im erweiterten Sinne jedes von den Feldlinien durchflutete Medium<br />
wie Luft, Wasser, Körpergewebe. Das verschiedene Verhalten einzelner Stoffe im<br />
Feld, ihre Durchlässigkeit und ihre Erwärmbarkeit, bildet die hauptsächliche<br />
Grundlage für die Wirkung der <strong>Kurzwellentherapie</strong>. Gute Isolatoren, wie Luft,<br />
Quarz oder Glas, werden vom Kurzwcllenfeld ohne weiteres durchsetzt, ohne sich<br />
wesentlich zu erwärmen. Halbleiter jedoch erwärmen sich im Feld, wobei ein<br />
Teil der Energie absorbiert wird; es entstehen «dielektrische Verluste», mit denen<br />
die biologischen Wirkungen der Kurzwellen eng verbunden sind.<br />
Wir unterscheiden demgemäß ideale, verlustfreie Dielektrika und Verlust-<br />
Dielektrika, auch schlechte Dielektrika genannt, in denen elektrische Energie in<br />
Wärme umgewandelt wird. Sic interessieren uns hier hauptsächlich.<br />
Durch das Einbringen eines Verlust-Dielektrikums in das Kondensatorfcld<br />
entsteht eine Dämpfung, die größtenteils durch diese dielektrischen Verluste<br />
hervorgerufen wird. Die elektrischen Feldkräftc üben dabei auf die kleinsten Teilchen<br />
dieser Substanzen Wirkungen aus, die zu gewissen Lageveränderungen und<br />
dadurch schließlich zur Erwärmung führen. Diese Vorgänge machen sich als Verluste<br />
im Schwingungskreis bemerkbar, die Schwingungsamplituden nehmen ab,<br />
da Leistung verbraucht wird. Die Verluste sind deshalb für uns so besonders wichtig,<br />
weil die biologischen Wirkungen mit ihnen eng zusammenhängen. Auf ihr<br />
Zustandekommen wird in späteren Kapiteln noch näher eingegangen werden.<br />
Hier sei nur so viel gesagt, daß sie durch die Bewegung von Molekülen und Ionen<br />
unter dem Einfluß der Feldkräfte entstehen, die sich zu einem großen Teil in<br />
Wärme umsetzt.<br />
Der grundsätzliche Unterschied der Wirkung des Kurypellenfeldes gegenüber irgend-<br />
32
welchen bisher üblichen Strom^uführungen (z.B. Diathermie) ist der, daß die Energie<br />
nicht das Dielektrikum als reiner Leitungsstrom durchfließt, sondern im Inneren des<br />
Dielektrikums als Feldenergie an den kleinsten Teilchen selbst angreift. Art und Stärke der<br />
Einwirkung hängen, wie noch gezeigt wird, von der Zusammensetzung des Dielektrikums ab.<br />
Sowohl in einem vollkommenen Leiter wie in einem vollkommenen Isolator<br />
können keine dielektrischen Verluste stattfinden. Metalle einerseits und gute Isolatoren<br />
andererseits erwärmen sich daher so gut wie überhaupt nicht im Kondensatorfeld<br />
(siehe Anhang),<br />
Die dielektrischen Verluste durch Leitungsströme und damit auch die Erwärmung<br />
in Elektrolyten nehmen nämlich nur dann maximale Werte an, wenn<br />
"-nnnnrb—'<br />
Hi<br />
Abb. 26<br />
•-Tiuinmnj- 1<br />
Wellenlänge, Leitfähigkeit und Dielektrizitätskonstante* in einem definierten Verhältnis<br />
zueinander stehen (PATZOLD, MCLENNAN und BURTON). Hierauf werden<br />
wir in einem späteren Kapitel zurückkommen.<br />
Um uns die rechnerische Behandlung der elektrischen Vorgänge im Dielektrikum zu<br />
erleichtern, machen wir uns die Vorstellung, als ob eine fortgclcitctc Stromkomponcnt<br />
und unabhängig davon eine kapazitive Komponente, der Verschiebungsstrom, im Innern<br />
des Dielektrikums zustande kämen. Durch den Leitungsstrom würde dann die Erwärmung<br />
erfolgen, während die Tiefenwirkung eine Funktion des Verschiebungsstromes<br />
wäre.<br />
Dementsprechend stellen wir uns den Widerstand, den ein Gewebe dem Strom entgegensetzt,<br />
zusammengesetzt vor; dem Leitungsstrom gegenüber besteht ein OuMschcr<br />
Widerstand, während der Verschiebungsstrom gewisse Bestandteile des Dielektrikums<br />
kapazitiv überbrückt. Auch diesem Strom steht ein Widerstand entgegen, den wir uns<br />
als eine Kapazität vorstellen. Wir kommen so zu dem in Abb. 26 wiedergegebenen Ersatzschema<br />
mit nebeneinandergeschaltetem OuMschen und kapazitivem Widerstand. Lassen<br />
wir einen Strom von der Frequenz O, also einen Gleichstrom, durch unser Schema fließen,<br />
so wird der Widerstand der Kapazität für ihn unüberwindlich sein, er fließt nur als<br />
Leitungsstrom. Beim Anwachsen der Frequenz wird der kapazitive Widerstand immer<br />
mehr in die Strombahn mit einbezogen werden.<br />
Diesen kapazitiven Strom im Schwingkreis, der oft sehr hohe Werte erreicht, bezeichnen<br />
wir als den Verschiebungs- oder Blindstrom, da durch ihn keine Arbeit geleistet wird.<br />
Der Wirkstrom braucht dem Blindstrom durchaus nicht zu entsprechen, er ist bei Hochfrequenzströmen<br />
meist kleiner.<br />
Uns interessieren hier hauptsächlich die für menschliche und tierische Gewebe gültigen<br />
Verhältnisse. Aus dem Diagramm ersehen wir, daß bei Gleichstrom (der natürlich nur<br />
durch Kontakt zugeleitet sein kann) der Gesamtstrom als Wirkstrom fließt. 1 und i fallen<br />
zusammen. Dadurch wird auch die maximal mögliche Erwärmung erzielt. Sic ¡st auf<br />
Grund der bekannten Gesetze nur abhängig vom OHMSchen Widerstand, dem Quadrat<br />
der Stromstärke und der Zeit,<br />
* Leitfähigkeit und Dielektrizitätskonstante werden als Materialkonstanten bezeichnet.<br />
33<br />
R»
Bei steigender Frequenz wird mit dem Anstieg der kapazitiven Komponente der Wirkstrom<br />
geringer. Die kapazitive Komponente beginnt aber erst eine Rolle zu spielen beim<br />
Überschreiten einer bestimmten Frequenz, die für menschliche Gewebe um looooooo Hz,<br />
einer Wellenlänge von jo m entsprechend, herum Hegt (s. Anhang). Wird diese Frequenz<br />
überschritten, so wird erst die eigentliche Tiefenwirkung in nennenswertem Maß zur<br />
Geltung kommen. Über das Verhältnis der beiden Komponenten bei verschiedener<br />
Frequenz sind im Anhang Berechnungen angestellt. Man sieht, daß die kapazitive Komponente<br />
mit dem Quadrat der Frequenz wächst.<br />
In menschlichen und tierischen Geweben ist nun der Wirkstrom keineswegs eine einheitliche<br />
Größe. Wir müssen uns vorstellen, daß in jedem Gewebe, ja in jeder Zelle, unter<br />
dem Einfluß des Kurzwellenfeldes ein Strom erzeugt wird. Diese Einzelstrome können<br />
von ganz verschiedener Größe sein. Durch ihre Gesamtheit wird erst das gebildet, was<br />
wir als den Wirkstrom bezeichnen. Selbst genaueste Messungen können uns nichts<br />
darüber sagen, was im Inneren der Gewebe tatsächlich geschieht, und wie groß die Ströme<br />
in einer bestimmten Zellart sind.<br />
Der für die Erwärmung hauptsächlich in Frage kommende Leitungsstrom<br />
hängt von der Leitfähigkeit, die kapazitive Komponente dagegen vom kapazitiven<br />
Widerstand ab; dieser letztere sinkt seinerseits mit wachsender Frequenz<br />
und wird bei sonst gleichen Faktoren von der Dielektrizitätskonstante bestimmt.<br />
Zwischen diesen drei Größen muß deshalb eine rechnerische Beziehung vorhanden<br />
sein. Tatsächlich läßt sich, wenn Dielektrizitätskonstante und Leitfähigkeit<br />
bekannt sind, die Frequenz berechnen, bei der die Erwärmung maximal wird<br />
(s. Anhang).<br />
Allerdings gelten diese Verhältnisse streng genommen nur dann, wenn der Gesamtstrom<br />
im Dielektrikum konstant gehalten werden kann. Da dies nie genau<br />
der Fall ist, handelt es sich immer nur um Annäherungswerte. Eine weitgehende<br />
Konstanthaltung der innerhalb des Dielektrikums wirksamen Feldstärke läßt sich<br />
aber dadurch erreichen, daß zwischen die Platten und das zu untersuchende Dielektrikum<br />
ein großer Luftraum eingeschaltet wird. Damit ist ein Luftkondensator<br />
als hoher kapazitiver Widerstand in Serie zu dem Objekt gelegt, dem gegenüber<br />
der Widerstand des organischen Dielektrikums stark zurücktritt; der im ganzen<br />
System fließende Strom wird daher in der Hauptsache von diesem hohen kapazitiven<br />
Vor schaltwiderstand bestimmt (s. Abstandsprinzip).<br />
Bei der Einwirkung des Kondcnsatorfeldes auf biologische Substanzen entsteht<br />
immer und in jedem Fall Wärme; diese steht zunächst so im Vordergrund der Erscheinungen,<br />
daß wir sie zur Messung der Feldstärke und zur Untersuchung der<br />
Verteilung des Kondcnsatorfeldes in Modellen und Geweben benutzen. Die<br />
Dämpfungsverluste im Dielektrikum werden größtenteils in Wärme umgesetzt.<br />
Um das Zustandekommen dieser Erwärmung zu verstehen, gehen wir am besten<br />
von den Verhältnissen bei Gleichstrom aus, denn letzten Endes beruhen die verschiedenen<br />
Wirkungen der einzelnen Stromarten nur auf den verschiedenen Frequenzen,<br />
so daß wir fließende Übergänge erwarten müssen.<br />
Legen wir einen Gleichstrom, also einen Strom von der Frequenz O, an einen<br />
Elektrolyten an, so wandern die positiven Ionen an die Kathode, die negativen<br />
Ionen an die Anode. Dabei findet eine clektrolytische Zersetzung statt, durch die<br />
ein Teil der Stromlcistung verzehrt wird, die Erwärmung tritt in den Hintergrund.<br />
Die Fortleitung des Stromes besteht größtenteils in der Ionenwanderung, wobei<br />
die Wanderungsgeschwindigkeit der einzelnen Ionenartcn von Bedeutung ist; in<br />
zusammengesetzten Lösungen wird der Stromtransport zum größeren Teil von<br />
den am schnellsten wandernden Ionen übernommen. Enthält eine solche Flüssig-<br />
34
keit größere Teilchen, komplexe Moleküle oder Kolloidteilchen, so werden diese<br />
nur wenig beeinflußt und spielen für die Gesamtleitfähigkeit eine geringe Rolle.<br />
Sind in einer solchen Flüssigkeit noch größere Teilchen mit schlechter Leitfähigkeit<br />
suspendiert, so engen diese nur die Strombahn ein, die Stromleitung findet<br />
in den Zwischenräumen statt. Handelt es sich um Zellen oder Blutkörperchen mit<br />
isolierender Lipoidhülle, so sind im Inneren dieser Zellen so gut wie keine elektrischen<br />
Vorgänge vorhanden.<br />
Lassen wir nun den Strom rascher wechseln, so sind die Erscheinungen zunächst<br />
genau die gleichen. Oberhalb bestimmter Frequenzen jedoch ist der Wechsel 2u<br />
schnell, um elektrolytische Zersetzung hervorzurufen; wir beobachten in unserer<br />
Flüssigkeit jetzt nur noch Erwärmung. Wir sind inzwischen aus dem Bereich<br />
technischer Wechselströme heraus in das der elektrischen Schwingungen gekommen,<br />
wie sie zur Diathermie benutzt werden. Diese Ströme unterscheiden sich<br />
also von den Nicdcrfrcqucnzströmen durch das Fehlen der grob elektrochemischen<br />
Wirkungen. In der Stromverteilung sind sie ihnen jedoch gleich. Im großen<br />
ganzen durchfließt der Langwellenstrom das Modell genau so wie jeder Gleichstrom,<br />
er verteilt sich in Stromschlcifen, die den Bahnen geringsten Widerstandes<br />
folgen, und umgeht die Teilchen mit höherem Widerstand.<br />
Wir können unser Modell weiterhin auch so ausbilden, daß wir die Elektroden<br />
unseres Stromkreises nicht unmittelbar an das Modell anlegen, sondern in eine<br />
gewisse Entfernung davon bringen. In diesem Fall wird auf der Oberfläche des<br />
Modells durch Influenz eine kleine Ladung erzeugt. Sonst geschieht im Inneren<br />
der Flüssigkeit nichts. Erst wenn die Stromrichtung geändert wird, gleichen sich<br />
diese Ladungen durch den Elektrolyten hindurch genau wie jeder andere Leitungsstrom<br />
aus. Diese Wirkungen sind bei geringer Frequenz zu schwach, um irgendwie<br />
in Frage zu kommen.<br />
Schon bei den Diathermiefrequenzen macht sich aber eine Wirkung bemerkbar,<br />
die wir bereits kennenlernten, die kapazitive Wirkung.<br />
Legen wir in unser Modell Trennschichten ein, so sind die hochfrequenten<br />
Ströme zu einem geringen Grad imstande, diese Schichten zu überbrücken. Der<br />
«kapazitive Anteil» des Stromes, der dies ermöglicht, ist verschieden groß, je nach<br />
der Beschaffenheit des Dielektrikums und der Frequenz. In menschlichen und<br />
tierischen Geweben ist der kapazitive Anteil des Langwellen-Diathermiestromcs<br />
außerordentlich gering und beträgt nur wenige Prozent. Diese kapazitive Komponente<br />
(der Verschiebungsstrom) ist es aber, was die besondere Tiefenwirkung<br />
der Ultra-Kurzwellen-Frequenzen ausmacht. Wie wir gesehen haben, kann die<br />
kapazitive Komponente in menschlichen Geweben bei der Kurzwellcntherapie der<br />
Leitungsstromkomponente gleich und sogar größer als sie werden.<br />
Die kapazitive Wirkung der Kurzwellenfrequenzen setzt uns weiter instand, auf<br />
unserezubchandclndcnGegenständc über groBcrcL»//í7¿j-/¿W£hinwcgcinzu wirken.<br />
Wir leiten die elektrischen Schwingungen dem Körper grundsätzlich nicht mehr<br />
durch Kontakt zu, sondern es hat sich aus mehreren Gründen als vorteilhafter erwiesen,<br />
Luftabstände zwischenzuschalten (Abstandsprinzip). Nur dadurch können<br />
wir uns die große kapazitive Tiefenwirkung des Kondcnsatorfcldes voll nutzbar<br />
machen.<br />
Ähnlich werden die Widerstände innerhalb unseres Modells überbrückt. Ebenso<br />
wie das Feld bei diesen Frequenzen noch über einen großen Luftabstand hinaus<br />
starke Wirkungen entfalten kann, so sind auch Membranen innerhalb der Flüssigkeit<br />
keine nennenswerten Hemmnisse mehr. Sind in der Flüssigkeit Gebilde suspen-<br />
35
die«, deren gutleitendes Innere durch eine isolierende Membran von der Umgebung<br />
abgetrennt ist (Blutkörperchen, Zellen), so wirkt das Feld bei den Kurzwellenfrequcnzcn<br />
jetzt auch auf das Innere ein. Der Hochfrequenzwiderstand<br />
einer solchen Flüssigkeit ist daher wesentlich niedriger als der Gleichstromwert. Die<br />
Wirkung des Feldes folgt aus den gleichen Gründen nicht mehr allein den Bahnen<br />
mit der besten Leitfähigkeit, sie überträgt sich nicht mehr allein auf die am schnell-<br />
© ®ù &<br />
Abb. 27: Ionen: Leitungsverlust; Abb, 28: Moleküle;<br />
Reibungswärme bei geradliniger Reibungsverluste<br />
Bewegung bei der Drehbewegung<br />
sten beweglichen Ionen, sondern jedes Teilchen, das im Bereich des Feldes Hegt,<br />
wird in besonderer Weise durch die Feldkräfte beeinflußt. Wir werden hierauf<br />
noch im einzelnen eingehen.<br />
Die Wirkung auf die Teilchen werden wir uns ungefähr folgendermaßen vorzustellen<br />
haben: Zunächst werden selbstverständlich die Ionen der Wirkung der<br />
Feldkräfte unterworfen. Die Umpolung erfolgt teilweise so schnell, daß eine eigentliche<br />
Ionenwanderung nicht mehr stattfindet, sondern nur Verlagerungen der<br />
Kraftfelder. Wir haben dabei von der Vorstellung auszugehen, daß das Ion oder<br />
Atom aus einem Atomkern besteht, den die Elektronen in bestimmten Bahnen<br />
umkreisen. Die Bahnen können wieder in mehreren Schalen angeordnet sein.<br />
Unter dem Einfluß eines elektrischen Kurzwellenfeldes kann nun die Lage der<br />
Schalen zum Kern eine Veränderung in der Feldrichtung erfahren. Diese Veränderung<br />
der Lage, die sich auch auf die elektrischen Eigenschaften auswirkt<br />
(Dielektrizitätskonstante), wird als Polarisation des Atoms bezeichnet.<br />
Weiterhin befinden sich in den für uns in Frage kommenden Stoffen «Dipofo-<br />
Moleküle. So enthält beispielsweise eine Aminosäure eine positiv geladene NH2 + -<br />
und eine negativ geladene COO"-Gruppe. Diese Moleküle haben je eine überschüssige<br />
positive und negative Ladung, «polare» Ladungen, die wie bei einer<br />
kleinen Magnetnadel in kurzem Abstand nebeneinander liegen (Abb. 27-29). Wie<br />
ein Magnetfeld die Magnetnadel in seine Richtung zu stellen sucht, so tut dies das<br />
elektrische Feld mit den elektrischen Dipolen. Dieses Umspringen ¡st mit cinc der<br />
Ursachen der dielektrischen Verluste. Es würde an sich keine Energie verzehren<br />
(Verschiebungsstrom, wattlose Phase), wenn es reibungslos erfolgen würde. Infolge<br />
von Reibungsverlusten wird aber ein Teil der Energie in Wärme umgewandelt.<br />
Auch elektrisch neutrale Moleküle können durch den Einfluß eines elektrischen<br />
Feldes polarisiert werden, indem durch Influenz Ladungen in ihnen entstehen. Die<br />
Dipole, die sich vorher regellos durcheinander bewegten, nehmen ferner im Feld<br />
eine bestimmte Ordnung an (Abb. 29).<br />
Mit dem Vorhandensein der Dipol-Moleküle hängt auch der hohe Betrag der Dielektrizitätskonstante<br />
zusammen, der bei Wasser, Elektrolytlösungen und biologischen Flüssigkeiten<br />
in der Nähe des Wertes 80 liegt. Wenn an eine solche Flüssigkeit ein elektrisches<br />
Feld angelegt wird, so werden sich alle positiv geladenen Enden der Moleküle nach dem<br />
negativen Pol hin ausrichten, die negativ geladenen Enden nach dem positiven Pol. Die<br />
36
f<br />
Kraft, die dazu nötig ist, diese Drehbewegung hervorzubringen, nennt man das Dipolmoment.<br />
Es hängt ab von der Größe der Ladungen im Molekül und ihrem Abstand,<br />
analog dem Drehmoment eines Hebels.<br />
Nach dem Gesagten ¡st es klar, daß die Größe der Dielektrizitätskonstante unter<br />
sonst gleichen Verhältnissen noch von der Zahl der gelösten Dipole, d. h. von der<br />
lonenkonzentration, abhängen muß.<br />
0 % ^ V<br />
(£3<br />
großen, meist kolloidalen Moleküle und Molekülkomplexe suchen müsse. Diese<br />
Moleküle haben oft mehrere Ladungen, die an Seitenketten sitzen. Es ist aus der<br />
Kolloidchemie bekannt, daß durch Beeinflussung solcher Ladungen die kolloidale<br />
Struktur weitgehend verändert werden kann, und daß auch die Hydratation der<br />
Kolloidteilchen in engem Zusammenhang mit der Anordnung und Größe der<br />
Ladungen steht.<br />
Solche Vorgänge führen zu sprunghaften Änderungen der Dielektrizitätskonstanten<br />
oder der spezifischen Leitfähigkeit in bestimmtem Frequenzbereich<br />
{anomale Dispersion) und damit zu Veränderung der Absorption. Außer der Frequenz<br />
und der Konzentration der Lösungen kann hierbei auch die Viskosität eine<br />
Rolle spielen (K. KRAUSE). Abb. 30 ist einer Arbeit von SCHÄFER entnommen und<br />
zeigt die Veränderung der Energieabsorption bei verschiedenen Frequenzen.<br />
abnehmende Wellenlänge<br />
Abb. 30 (links): Absorption einer Dipolflüssigkeit<br />
in Abhängigkeit von der Wellenlänge<br />
Abb. 31 (Mitte): Schema eines organischen Moleküls<br />
mit großer, nicht polarer Hauptgruppe und<br />
polarer Seitenkette<br />
Abb. }2 Schematische Darstellung<br />
des Sphingomyclin-Molcküls<br />
ISOLDE HAUSSER, RICH. KUHN und GIRAL konnten solche anomalen Dispersionen<br />
auch in bestimmten Lösungen organischer Substanzen nachweisen, womit also die<br />
Möglichkeit einer «spezifischen» Kurzwellenwirkung auf organische Kolloide bewiesen<br />
ist. Auf Grund dieser Arbeiten, die an verschiedenen ßetainen und am<br />
Sphingomyelin ausgeführt wurden, kann man sich ungefähr folgende Vorstellung<br />
machen: Es gibt organische Moleküle, die aus langen KohlenwasscrstofTketten<br />
bestehen, an denen Seitenketten angesetzt sind. Oft haben die Hauptmassen des<br />
Moleküls nur geringe polare Ladungen, während die Seitenketten starke Ladungen<br />
in verhältnismäßig nahem Abstand, also große Dipolmomente haben. Abb. 31<br />
soll ein solches Molekül schematisch darstellen. Die als senkrechter Balken eines<br />
Kreuzes gezeichnete Hauptgruppe des Moleküls würde bei der Umpolung des<br />
Feldes kaum betroffen werden, die stark polare Gruppe NH2 4 "... COO~ würde<br />
dagegen eine Drehbewegung um die andere Gruppe als Achse ausführen. Abb. 31<br />
und 32 sollen ein Bild davon geben, wie wir uns nach den Arbeiten der vorgenannten<br />
Autoren das Verhalten des Moleküls Sphingomyelin, eines im Gehirn vorkommenden<br />
Stoffes, vorstellen können. Das Molekül besteht aus einer langen<br />
Kohlcnwasserstofigruppc (der linke seitliche Balken in der Abbildung) und einer<br />
Fettsäuregruppe (rechts oben). Diese Gruppen haben sehr schwache, weit auseinanderlegende<br />
Ladungen. Dagegen ist die dritte in der Abbildung unten an-<br />
3»
gehängte Gruppe stark polar*. Von einer bestimmten Frequenz an können nun die<br />
langen Ketten nicht mehr dem raschen Feldwechsel folgen, sie bleiben zurück.<br />
Die Cholinphosphorsäuregruppc dagegen führt Bewegungen aus, die zu Formänderungen<br />
des ganzen Moleküls führen können. Solche Veränderungen können<br />
aber unter Umständen im lebenden Organismus weitere Folgen haben, die besonders<br />
auf dem Gebiet der kolloidchemischen Reaktionen liegen dürften. Die<br />
großen Lipoidmoleküle sind zu einem großen Teil Mcmbranbildner, und zwar<br />
sind sie in den Zellmembranen palisadenartig nebeneinander angeordnet. Es ist<br />
daher wahrscheinlich, daß Oberflächenspannung und Membranpotcntiale, die für<br />
den Ablauf des Zcllebens eine so große Rolle spielen, verändert werden können.<br />
Ob und inwieweit dies geschieht, wird davon abhängen, welche Moleküle von der<br />
angewandten Wellenlänge beeinflußt werden, und welchen Strukturen der Zellen<br />
diese Kolloide angehören.<br />
Die später zu erwähnenden Untersuchungen von SCHLAG und v. NORDHEIM<br />
zeigen, daß sich tatsächlich die Durchlässigkeit der Zellwände für bestimmte Ionen<br />
im Kurzwcllenfeld ändert. Diese Wirkungen werden z. T. nur auf biologischem<br />
Wege faßbar sein und allen elektrischen und chemischen Meßverfahren entgehen.<br />
Wie wir aus der Pharmakologie wissen, genügen oft minimale Veränderungen an<br />
gewissen kleinsten Strukturen, um eingreifende biologische Wirkungen hervorzubringen;<br />
im Gesamtchemismus oder in den gesamten elektrischen Vorgängen<br />
brauchen aber dadurch keine meßbaren Veränderungen zu entstehen.<br />
Wenden wir uns nun nochmals dem Verhalten der Ionen zu, die im allgemeinen<br />
Verlagerungen in der Richtung der Feldlinien erfahren. Auch hierbei treten bei<br />
besonders hohen Frequenzen Abweichungen von dem Verhalten ein, das wir bei<br />
niedrigeren Frequenzen beobachtet haben. Diese Abweichungen beruhen auf den<br />
Relaxationseffekten, auf die wir kurz eingehen wollen.<br />
Die in einem Elektrolyten befindlichen Ionen bewegen sich zwar einzeln; im<br />
Durchschnitt über eine gewisse Zeitspanne befinden sie sich aber doch in einer<br />
gewissen Ordnung, so daß in der Nähe eines Kations mehr Anionen und in der<br />
Nähe eines Anions mehr Kationen sind, so wie auf einem Schachbrett an ein<br />
weißes Feld mehr schwarze angrenzen. Diese Verteilung entspricht einem Minimum<br />
an Energie. Wenn nun durch einen Stromstoß ein Ion eine Bewegung erleidet,<br />
so wird das Gleichgewicht im ganzen System gestört. Es muß sich eine<br />
neue Ordnung ausbilden, wofür eine bestimmte Zeit nötig ist. Diese Zeit wird als<br />
Kelaxations^eit bezeichnet. Zum Zerreißen und zum Wiederherstellen der Ordnung<br />
ist ein gewisser Arbeitsaufwand notwendig, der sich dem zugeführten Strom<br />
gegenüber als Widerstand bemerkbar macht. Die Relaxation bildet also einen Teil<br />
des Leitungswiderstandes.<br />
Bei sehr hohen Frequenzen können nun die Verlagerungen der Ionen-Kraftfelder<br />
so rasch erfolgen bzw. die Kraftfelder Verlagerung so gering werden, daß die<br />
Anordnung der übrigen Ionen kaum gestört wird, daß infolgedessen ein immer<br />
geringerer Arbeitsaufwand zur Erhaltung dieser Anordnung nötig wird. Der<br />
Leitungswiderstand ist daher bei sehr hohen Frequenzen nicht mehr der gleiche<br />
wie bei Niederfrequenz, sondern er wird immer geringer. Wir haben demnach im<br />
Kurzwcllenbcreich mit geringeren Leitungswiderständen zu rechnen als bei anderen<br />
elektrischen Strömen (DEBYE-FALKENHAGEN-Eftekt). Unter bestimmten<br />
* Die Bilder sollen nur einen Begriff davon geben, wie wir uns die elektrischen Kräfte<br />
am Molekül zu denken haben. Die tatsächlichen Valenzwinkel sind nicht berücksichtigt.<br />
39
Umständen kann die Leitfähigkeit im Kurzwellengebiet mit dem Quadrat der<br />
Frequenz anwachsen (HOLZER). Die Steigerung der Leitfähigkeit kann also bei<br />
bestimmten Frequenzen einerseits, bestimmten Konzentrationen andererseits sehr<br />
groß werden (s. Anhang).<br />
Die Änderungen, die die Kraftlinien des UKW-Feldes erleiden, hat KRASNY-<br />
ERGEN errechnet. An den Teilchen finden Verdichtungen und Phasenverschiebungen<br />
statt, es kann an einzelnen Punkten zur Bildung von Drehfeldern kommen.<br />
b) Das homogene Dielektrikum<br />
Bedeutung der Elektrolytkonzentration in Beziehung<br />
Zur Wellenlänge<br />
Die ersten Untersuchungen über Erwärmung von Elektrolyten sind vom Verfasser<br />
in Kochsalzlösungen durchgeführt worden, in Anbetracht der großen Bedeutung<br />
des Kochsalzes für den menschlichen Körper. Werden verschieden stark<br />
1 2 3 1 5 6 7 6 9 _ «%<br />
1 1 1 1 1 1 . 1 i 1 1 1<br />
1 2 3 * S S S 10 20
die Erwärmung ein Maximum erreicht. Das große Verdienst PÄTZOLDS besteht besonders<br />
darin, als erster experimenteil die Abhängigkeit dieses Maximums von der<br />
Wellenlänge nachgewiesen zu haben. Abb. 35-37 geben Kurven aus der PÄTZOLDschen<br />
Arbeit wieder.<br />
Ibö «¡7 KCl ufljijö ägad Uli «* M W t<br />
1<br />
•<br />
1<br />
f t<br />
1<br />
* M M wkv raw aw wwf<br />
•<br />
1 ftftfc* AMaW ftí OwäW« Zrc£S»*<br />
^pr ---jgç-<br />
1 L<br />
Abb. 34: Vergleichsweise Erwärmung verschiedener Elcktrolyte<br />
m/10 Konzentration der Zeiteinheit.<br />
(Aus Zeitschr. f. exper. Medizin, Bd. 66, Seite 234, Fig. 2, Julius Springer, Berlin)<br />
In Abb. 3J ist beispielsweise für eine NaCl-Lösung gezeigt, daß bei einer Wellenlänge<br />
vonî.jo m das Maximum der Erwärmung in etwa 1 /10 Normallösung eintritt, bei ), = 34m<br />
bei Vi0o n > während sich eine 1 /Iooi)- Nor m a N ösun g am stärksten im Kondensatorfeld einer<br />
98-m-Welle erwärmt. Abb. 36 zeigt die gleichen Verhältnisse, auf die Leitfähigkeit bezogen,<br />
für Kaliumbichromat, und in<br />
Abb. 37 sieht man, wie bei Anwendung<br />
gleicher Wellenlängen die Maxima für<br />
NaCl und KMn04 von gleicher Leitfähigkeit<br />
übereinander fallen.<br />
Abb. 37 zeigt die Tatsache, daß bei<br />
Verwendung der jeweils optimalen<br />
Wellenlängen des UKW-Bereiches in<br />
verschiedenen Lösungen die absolute<br />
Erwärmung ungefähr gleich groß ist.<br />
Das absolute Maximum Hegt ganz allgemein<br />
bei längeren Wellen höher,<br />
doch müssen dazu die Lösungen entsprechend<br />
stark verdünnt sein. Auf<br />
Grund dieser Untersuchungen läßt<br />
sich die allgemeine Regel aufstellen,<br />
daß bei zunehmender Verdünnung die<br />
Wellenlänge, bei der maximale Erwärmung<br />
stattfindet, immer größer wer<br />
0,1n 0,01n 0,001 n<br />
Normalität n<br />
Abb. 35 : Erwärmung als Funktion der Konzentration<br />
nach PÄTZOLD. (AUS Zeitschr. f.<br />
Hochfrcquenztcchnik 1930, Akad. Vcrlagsges.<br />
m. b. H., Leipzig)<br />
den muß. Die Konzentration unserer Körpersäfte liegt gerade in einem Bereich,<br />
wo die stärkste Erwärmung durch Wellenlängen unterhalb von 20 m herbeigeführt<br />
wird. Diese wichtige Tatsache konnte wenigstens größenordnungsmäßig von<br />
PÄT20LD gefolgert werden.<br />
Hierbei ist nicht die Leitfähigkeit allein zu beachten, sondern auch die Dielektrizitätskonstante<br />
(DK), die für die einzelnen Körpergewebe etwas verschiedene<br />
Werte hat. Sie beträgt z.B. für Serum 85,5, Leitfähigkeit und DK bezeichnen wir<br />
als Materialkonstanten. Bei sehr hohen Frequenzen ändern sie sich (s. Anhang).<br />
41
Wie schon S. 40 erwähnt, ergibt sich das Maximum der Erwärmung in einem<br />
Stoff mit der DK e und der Leitfähigkeit K nur dann, wenn die Wellenlänge X zu<br />
diesen beiden Größen in einer ganz bestimmten Beziehung steht (s. Anhang).<br />
Cn<br />
ISO<br />
2S<br />
26<br />
2h<br />
22<br />
20<br />
18<br />
_/\<br />
f\<br />
1 \<br />
t \<br />
^ *r V<br />
16 _, !s«<br />
( 71 I—'—'—I I—I I ^jvj—i—I—I<br />
4 ^<br />
4 ^^<br />
Abb - 3 6:<br />
/• —#• — ^ Erwärmung als Funktion der<br />
« /<br />
I<br />
F 1<br />
^<br />
^<br />
Leitfähigkeit bei X = 80 m in<br />
KJOJOJ (nach PÄTZOLD). (AUS<br />
Zcitschr. f. Hochfrcquenztcchnik<br />
1930. Akadem. VerUgsges.<br />
m. b. H., Leipzig)<br />
100* 10'H<br />
(2 14 16 IS<br />
Wellenlänge ¡n m<br />
Abb. 37 (links): Erwärmung als Funktion der Leitfähigkeit bei verschiedenen Wellenlängen<br />
(nach PÄTZOLD). (Aus Zcitschr. f. Hochfrequenztechnik 1930, Akadem. Verlagsges.<br />
m. b. H., Leipzig)<br />
Abb. 38 (rechts): Die Kurve zeigt, daß über die PÄTZOLDsche Bedingung hinaus beizunehmender<br />
Wellenlänge eine stärkere Belastung der Haut eintreten muß, wobei die Erwärmung<br />
dem Quadrat der Intensität entspricht. Angenommene Werte: R2=2 X Ri,C,~C2,<br />
Rj und C, sind so gewählt, daß für 6 m Wellenlänge R^ zu C, = 1 wird (PÄTZOLDS<br />
Bedingung) —, daß also in Rj die maximal mögliche Wärme erzeugt werden müßte<br />
bei minimaler Erwärmung von Ra (beispielsweise: R! Muskulatur, Rz Haut). Aus:<br />
H. SCHAEFER, Zur Frage der selektiven Tiefen-Erwärmung im Ultrakurzwellen-Kondensatorfeld<br />
(Zcitschr. f. d. ges. exp. Medizin)<br />
42
Arbeiten von RICHARDS und LOOMIS sowie Berechnungen von BURSTYN bestätigen die<br />
vorliegenden Auffassungen. Unabhängig von PÄTZOLD sind diese Fragen ferner durch<br />
MCLENNAN und BURTON bearbeitet worden, die genau zu den gleichen Ergebnissen gekommen<br />
sind.<br />
Der Abstand der Kondensatorplatten vom Dielektrikum bzw. die zwischengeschaltete<br />
Luftkapazität hat auch einen gewissen Einfluß auf die Lage des Maximums.<br />
Wird der Plattenabstand von vornherein genügend groß gewählt, so kann<br />
dieser Einfluß praktisch vernachlässigt werden. Auch hieraus ergibt sich die weiter<br />
unten näher zu begründende Forderung eines zwischen Dielektrikum und Platten<br />
einzuschaltenden Luftraumes.<br />
Aus diesen Erfahrungen geht hervor, daß bei einer gewissen Wellenlänge verschiedene<br />
Dielektrika, die sich gleichzeitig im Kondensatorfeld befinden, sich verschieden<br />
stark erwärmen müssen. Je besser die Leitfähigkeit der betreffenden<br />
Schicht, um so kürzer muß im allgemeinen die Welle sein, um ein Maximum an<br />
Erwärmung zu erzielen, und umgekehrt erwärmen sich stärker verdünnte Lösungen<br />
schneller bei niedrigeren Frequenzen.<br />
c) Das inhomogene Dielektrikum<br />
Als inhomogenes Dielektrikum bezeichnen wir alle zusammengesetzten, in das<br />
Kondcnsatorfcld gebrachten Gegenstände oder Stoffe. Hierher gehören Emulsionen,<br />
Mischungen, Suspcnsionskolloidc und alle organisierten Substanzen und<br />
Körper.<br />
ESAU hat erstmalig gezeigt, daß Emulsionen vom K W-Feld in besonderer Weise<br />
beeinflußt werden. Er mischte wenig Wasser mit viel öl und konnte diese Emulsionen<br />
im KW-Feld schon bei 50-60 0 zum Kochen bringen. Diese Erscheinung ist<br />
nur so zu erklären, daß die Wasserteilchen ioo° erreichen, während das sie umgebende<br />
öl nur wenig erhitzt wird. So kann das Wasser bei geringer Gesamttemperatur<br />
kochen.<br />
Zwei Stoffe, die für sich allein im UKW-Feld kaum erwärmt werden, können<br />
sich in Mischung stark erhitzen. Dies hängt damit zusammen, daß die Materialkonstanten<br />
der Mischung andere sind als die der reinen Stoffe. So hat der Verfasser<br />
schon früher nachgewiesen, daß mit Luftblasen durchsetzte Gelatine sich viel<br />
stärker erhitzt als homogene Gelatine. GJERTZ hat dies weiter verfolgt, mit dem<br />
gleichen Ergebnis. Er konnte ferner feststellen, daß die Größe der Luftblasen von<br />
Bedeutung ist: bei größeren Blasen ist die Erwärmung stärker.<br />
Der Einfluß der Größe der suspendierten Teilchen geht auch aus Versuchen des<br />
Verfassers hervor:<br />
Es wurden Aufschwemmungen von Kohlcpulvcr in Gclatinelösung hergestellt in der<br />
Weise, daß in allen Suspensionen die gleiche Konzentration vorhanden war, daß aber die<br />
Teilchengrößen verschieden waren. Es wurden nun 4 mit solchen verschiedenen Suspensionen<br />
gefüllte Gläser einem Kondcnsatorfcld einer 4-m-Welle ausgesetzt. Im Glas 1<br />
war die Teilchengröße etwa 100 ftt im Glas 2 80 /1, im Glas 3 60 ,11, im Glas 4 unter jo /A.<br />
Dabei traten in den einzelnen Gläsern ganz verschiedene Erwärmungen auf. In 1 Minute<br />
erwärmte sich das Glas 1 um 12 0 , Glas z um io°, Glas 3 um 9 0 , Glas 4 um 3 0 .<br />
Die Erwärmung war also um so stärker, je größer die Teilchen waren. Die Bedeutung<br />
für die Biologie liegt bei der verschiedenen Größe der betroffenen Gebilde<br />
wohl ohne weiteres auf der Hand*.<br />
* Vortrag in Mailand, April 1935.<br />
43
Für uns ist eine der wichtigsten Fragen, wie sich die Inhomogenitäten im menschlichen<br />
Körper auswirken, die durch die mikroskopische Struktur und durch die verschiedene<br />
Schichtung gegeben sind. Daß die Struktur eine Rolle spielen muß, ist<br />
nach dem vorher Gesagten anzunehmen. Außer der Mikrostruktur ist aber auch<br />
noch die Schichtung von größter Bedeutung, so daß diese in einem besonderen<br />
Kapitel behandelt werden muß.<br />
d) Wärmeentstehung im Blut<br />
Wird ein unhomogener Stoff, etwa Blut, von einem niederfrequenten Strom<br />
durchflössen, dann haben wir das elektrisch ziemlich homogene Serum, darin die<br />
von isolierenden Lipoidhüllen umgebenen roten Blutkörperchen. Der Strom fließt<br />
te<br />
T<br />
Wasser<br />
1 M M M<br />
IM W W JO S r¡ ¡t s 1%0/uf<br />
pre Minuit<br />
to<br />
Abb. 39: Erwärmung von Blut in verschiedenen<br />
Aufschwemmungen. Die schwarzen Säulen stellen<br />
den Gehalt der Aufschwemmung an Blut d*r:<br />
Ordinate 10 = 100%. Die Kurven bezeichnen<br />
die Erwärmung der einzelnen Verdünnungen in<br />
der Zeiteinheit. — Bei Aufschwemmung in isotonischer<br />
NaCl-Lösung, in H(0, (Aus Zeitschr.<br />
f. exper. Medizin, Bd. 66, S. 237, Fig. 3,<br />
Julius Springer, Berlin)<br />
um diese herum, die Einengung der Strombahn äußert sich darin, daß der Widerstand<br />
des Blutes wesentlich höher ¡st als der des Serums allein. Selbstverständlich<br />
wird sich zunächst nur das Serum erwärmen.<br />
Wir haben nun schon 1929 die Erwärmung der Bestandteile des Blutes im KW-<br />
Fcld untersucht und konnten nachweisen, daß sich die Erythrozyten stärker erwärmen<br />
als das sie umgebende Serum (Abb. 39). Das KW-Feld muß also die Blutkörperchen<br />
unmittelbar beeinflussen und in ihrem Inneren Wärme erzeugen.<br />
Im Feld einer 3-m-Wellc wurden gleiche Mengen von Vollblut, dann von Serum und<br />
Cruor des gleichen Blutes erwärmt. Dabei fand sich in 3 Minuten eine Erwärmung des<br />
Vollblutes um 10,5 o . Serum erhitzte sich in der gleichen Zeit um 8,j°, Cruor um 11,j°.<br />
Daraus ergibt sich, daß sich die roten Blutkörperchen auch im Vollblut stärker erwärmen<br />
müssen als das Serum, in dem sie aufgeschwemmt sind. Da sie ihre Wärme an das umgebende<br />
Serum abgeben, kommt ein Mittelwert zustande.<br />
Im gleichen Sinn spricht folgender weitere Versuch: Blut wird teils mit destilliertem<br />
Wasser verdünnt, wobei Hämolyse eintritt, teils in NaCl aufgeschwemmt. Bei zunehmender<br />
Verdünnung mit isotonischer NaCl-Lösung sinkt die Erwärmung allmählich bis zu<br />
dem für reine NaCl-Lösung gültigen Wert ab, sie entspricht also ungefähr der Abnahme<br />
der Zahl der aufgeschwemmten roten Blutkörperchen (Abb. 39). Ein anderes Verhältnis<br />
ergibt sich dagegen im hämolytischen Blut, wobei ein Maximum bei einer Verdünnung<br />
von 40 cem Blut in 60 cem Wasser auftritt. Erst bei weiterer Verdünnung sinkt die Wärmewirkung<br />
weiter ab. Dieser Versuch zeigt einwandfrei, daß sich innerhalb der Aufschwemmung<br />
die intakten Erythrozyten anders erwärmen müssen als die umgebende Flüssigkeit<br />
44
und daß die Substanzen, die bei der Hämolyse frei werden, sich in wässeriger Lösung<br />
anders verhalten als im Inneren der Erythrozyten; wahrscheinlich hängt das mit der veränderten<br />
Dissoziation inner- und außerhalb der roten Blutkörperchen zusammen. Diese<br />
Verhältnisse hat SCHAEFER unter anderen Voraussetzungen untersucht. Er konnte nachweisen,<br />
daß bei 3 m Wellenlänge die Absorption elektrischer Energie durch die roten<br />
Blutkörperchen viel größer ist als im Serum. Dies erklärt sich daraus, daß bei den Frequenzen<br />
der Ultrakurzwellen die Membranen der Blutkörperchen kapazitiv überbrückt<br />
werden.<br />
Hiermit ist cinc der hervorstechendsten Eigenschaften des KW-Feldes nachgewiesen,<br />
nämlich die unmittelbare Beeinflussung der Zellen. Sie wird als Mikro-<br />
Erwärmung bezeichnet.<br />
Abb. 40: Blutkörperchen und Zellen Abb. 41 : Das UKW-Feld überbrückt<br />
werden vom Langwellen-Diathermie- die Zcllenmcmbranen kapazitiv, der Instrom<br />
umgangen. halt erwärmt sich.<br />
Jeder Erythrozyt ist als ein Kondensator aufzufassen, dessen Dielektrikum von seiner<br />
Membran gebildet wird, während die Beläge von seinem Inhalt und vom umgebenden<br />
Setum dargestellt sind*. Erst die Frequenzen von etwa 15000 kHz (zo m WL) aufwärts<br />
sind imstande, die Membranen zu überbrücken (Abb. 40, 41). Die DK zeigt in diesem<br />
Bereich anomale Dispersion, die demnach anderer Art ist als die durch den Bau der Moleküle<br />
bedingte Dispersion.<br />
Welche Unterschiede dabei auftreten können, geht daraus hervor, daß SCHAEFER<br />
in einigen Versuchen eine 7,5mal so hohe Leitfähigkeit der Blutkörperchen für<br />
Höchstfrequenz als für Niederfrequenz fand.<br />
MCLENNAN hat unabhängig von den genannten Autoren verschiedene Blutreaktionen<br />
untersucht, und zwar 1. Vollblut, 2. Plasma, 3. Blut ohne Elcktrolyte (nach Dialyse) und<br />
ohne Erythrozyten. Die DK war in allen Fraktionen gleich, die Leitfähigkeit verschieden.<br />
Das Ergebnis ¡st in der Tabelle wiedergegeben.<br />
Fraktion WL = 43m 15 m 9 m<br />
1 1,21 1,39 1,43 Grad Erwärmung<br />
2 1,00 1,00 1,00 je Min.<br />
3 3.81 3.53 3. 21<br />
* Durch Untersuchungen mit dem Elektronenmikroskop wissen wir, daß die Erythrozyten<br />
eine Membran und flüssigen Inhalt haben.<br />
45
Die Blutkörperchen werden also mit höherer Frequenz stärker erwärmt, die<br />
Erwärmung des Blutplasmas nimmt umgekehrt bei niedrigerer Frequenz zu. Die<br />
Unterschiede sind noch nicht so hoch wie bei SCHAEFER, da die Frequenzen der<br />
anomalen Dispersion noch nicht erreicht sind.<br />
Die DK sinkt im genannten Bereich bei abnehmender Wellenlänge ziemlich<br />
rasch zu niedrigeren Werten ab. Diese Tatsache zeigt wieder die Berechtigung,<br />
dem KW-Gebiet eine gesonderte Stellung zuzuerkennen, die sich mit den anderen<br />
Hochfrequenzverfahren nicht ohne weiteres vergleichen läßt.<br />
100 1000 1CQ00<br />
• Weltentange in m<br />
•<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
1Q 1 3-10 1 10' 3-fO* 10 9 Hz<br />
i i r i i<br />
30 10 1 0,3m<br />
Abb. 42 (links) : Zunahme des spezifischen<br />
Widerstandes in verschiedenen Geweben bei<br />
größer werdender Wellenlänge (nach PÄTZOLD)<br />
Abb.43 (oben): Der spezifische Widerstand des<br />
Fettgewebes nimmt mit steigender Frequenz<br />
(Verkürzung der Wellenlänge) stark ab. Daher<br />
bessere Überbrückung des Unterhautgewebes<br />
bei kürzeren Wellen (nach ESAU, PÄTZOLD,<br />
AHRENS)<br />
Aus Untersuchungen von RAJEWSKY sowie von PÄTZOLD und OSSWALD geht<br />
hervor, daß das Gleiche auch für andere menschliche und tierische Gewebe gilt.<br />
RAJEWSKY bestimmte die Hochfrequenzwiderstände verschiedener Gewebe und<br />
fand, daß sie gegenüber dem UKW-Feld wesentlich niedriger sind als gegenüber<br />
technischen Wechselströmen oder gewöhnlichen Diathermieströmen. Dieser<br />
Unterschied wird viel geringer, wenn die Organe längere Zeit lagern; der Widerstand<br />
gegenüber niedrigeren Frequenzen nimmt dann erheblich ab. Der hohe<br />
Widerstand kommt daher, daß die Zellen vom gewöhnlichen Strom umgangen<br />
werden. Bei längcrem Lagern sterben sie ab, die Membranen lösen sich auf, der<br />
Strom kann jetzt ungehindert hindurchtreten.<br />
Hieraus sowie aus den schon für das homogene Dielektrikum geschilderten Verhältnissen<br />
geht hervor, daß die Widerstände und DK bei verschiedenen Wellenlängen<br />
keinen konstanten Wert haben, sondern sich ändern. ESAU, PÄTZOLD und<br />
AHRENS haben diese Werte bei verschiedenen Wellenlängen bestimmt und gefunden,<br />
daß sie bei zunehmender Frequenz sehr stark abnehmen. Schon aus diesem<br />
Grunde ist es vorerst unmöglich, etwa auf Grund der PÄTZOLDSchen Bedingung,<br />
optimale Wellenlängen für bestimmte Organe oder Gewebe errechnen zu wollen<br />
(s. Abb. 42, 43 u. Tabelle im Anhang).<br />
46
e) Der menschliche Körper als geschichtetes inhomogenes Dielektrikum<br />
Außer der Inhomogenität durch die mikroskopische Struktur ist im menschlichen<br />
Körper die Schichtung der einzelnen Gewebe von Bedeutung; der Verlauf<br />
der Schichten hat großen Einfluß auf die Verteilung elektrischer Ströme und des<br />
Kondensatorfeldes. Die zugrunde liegenden Verhältnisse mußten zunächst in<br />
Modellversuchen geklärt werden. Wie schon erwähnt, erwärmen sich verschiedenartige<br />
Lösungen und Gewebe bei verschiedenen Wellenlängen ungleich stark.<br />
Zur Bestimmung der Tiefenwirkung in zusammengesetzten Modellen wird am besten<br />
die Erwärmung als Maß herangezogen. Es ist auch schon versucht worden, die durchfließenden<br />
Ströme dadurch zu messen, daß zwei an ein Galvanometer angeschlossene<br />
Drähte eingeführt wurden, die zusammen einen Schwingungskreis bilden. Derartige<br />
Messungen sind meist wertlos. Der Strom, der in solchen Anordnungen fließt, wird nämlich<br />
nicht aus dem Dielektrikum abgeleitet, sondern man mißt dabei die Induktionsströme,<br />
die in dem vom Galvanometer, seinen Zuleitungen und dem Elektrolyten als Kapazität<br />
gebildeten Schwingungskreis entstehen. Nur die Erwärmung ist tatsächliches Maß der<br />
wirksamen Leistung.<br />
PÄTZOLD führte im Anschluß an seine weiter vorn beschriebenen Arbeiten Versuche<br />
aus, bei denen er mehrere Glasküvettcn mit verschieden konzentrierten<br />
NaCl-Lösungen hintereinander in das Kondensatorfcld stellte. Durch Verändern<br />
der Wellenlänge konnte er es dabei erreichen, daß sich einmal der Inhalt des einen<br />
Glases, bei einer anderen Wellenlänge der Inhalt des anderen Glases besonders<br />
stark erwärmte.<br />
Die selektive Erwärmung der Elektrolytc kommt nicht nur dann zustande, wenn<br />
der ganze Strom durch die einzelnen Schichten zwangsweise hindurchfließen muß,<br />
sondern auch bei anderer Anordnung der Elektrolytschichten, wie sie mehr den<br />
Verhältnissen im Körper entspricht. Dies zeigt der folgende, von KOEHLER und<br />
mir angestellte Versuch.<br />
Um für Parallelvcrsuche mit Langwellen vergleichbare Grundbedingungen zu haben><br />
wurden statt der Reagenzgläser Dialysicrhülscn verwendet, die wegen ihrer Porosität kein<br />
Hindernis für den Diathermiestrom bilden. (Es ist wohl selbstverständlich, daß der<br />
Langwellcnstrom durch die Gläser überhaupt nicht hindurch kann, doch wurden zur<br />
Sicherheit auch in dieser Richtung einige Versuche ausgeführt.)<br />
Bei dem in Abb. 44 wiedergegebenen Versuch sind in ein Bcchcrglas mit destilliertem<br />
Wasser zwei gleichgroße Diffus ions hülsen eingetaucht, von denen die eine mit 0,4 % iger<br />
NaCl-Lösung, die andere mit einer o,i %igen Kollargollösung bis zu gleicher Höhe angefüllt<br />
ist. Nach y Minuten ist im j-m-Kondensatorfcld die Temperatur des Wassers um<br />
0,8° gestiegen, diejenige des Kochsalzes um 2 0 , das Kollargol hat sich um 1,1° erwärmt.<br />
Wiederholung des Versuches ergab immer wieder ähnliche Zahlen mit dem gleichen<br />
gegenseitigen Verhältnis.<br />
Im Kondensatorfcld der 15-m-Welle erfahren diese Zahlen eine Verschiebung: Hier<br />
ist die Erwärmung des Kollargols stärker als die des Kochsalzes ; der Wassermantel zeigt<br />
auch bei dieser Wellenlänge die geringste Erwärmung. Das gleiche tritt bei beliebig<br />
anderer Stellung der beiden DirTusionshülscn zueinander ein.<br />
Wir haben in ein Glas mit Wasser eine Dialysicrhülsc mit tierischem Fett gebracht und<br />
in diese eine zweite Hülse mit 0,1 %iger Kochsalzlösung. Leitet man in das Wasser einen<br />
Langwellcnstrom, so erwärmen sich die Schichten verschieden stark, und zwar immer von<br />
außen nach innen abnehmend. In einem Versuch betrug die Erwärmung des Wassers 5 ;°,<br />
des Fettes 25,5 o , während sich die Lösung in der Mitte nur um 9 0 erwärmte (was schon<br />
allein durch die Wärmezuleitung zustande gekommen sein kann). Im 15-m-Kurzwcllcn-<br />
47
feld konnte dutch richtige Konzentration der Lösung in der Mitte gerade das gegenteilige<br />
Verhalten erreicht werden. In unserem Versuch hatten wir in Wasser auOen 2,6°, im<br />
Fett 4,8° und in der Mitte 13,;°, also das über Fünffache wie außen. Ein Versuch im<br />
3,5-m-Kurzwellenfeld zeigt deutlich, daß sich bei dieser anderen Welle das Verhältnis<br />
A-«77l X-3m Diathermie<br />
Abb. 44: Modellversuch mit Diffus i onshülsen im Wassermantel bei Diathermie und im<br />
Kondcnsatorfeld. In den Hülsen 0,4% NaCl und O.JVOO Kollargollösung Ag.<br />
verschiebt. Hier haben wir außen 6,8° und in der Mitte 8,7 o . Der Langwellenstrom dagegen<br />
erwärmt in der Hauptsache die Flüssigkeit im Becherglas und umgeht die Dialysierhülscn.<br />
Die Erwärmung der innersten Schicht liegt bei Diathermie weit unter derjenigen<br />
der umgebenden Flüssigkeit; daß sie überhaupt entsteht, kommt im wesentlichen durch<br />
die Wärmezuleitung von der äußeren Flüssigkeit.<br />
Abb.45 gibt einen anderen, von KOEHLER und mir ausgeführten Versuch wieder.<br />
Damit ergibt sich zweifelsfrei, daß die Fcldwirkung durch die Glasschichten<br />
nicht merklich behindert wird, und daß sie durch das Wasser hindurchgeht, ohne<br />
hier eine besonders starke Erwärmung hervorzurufen. Trotzdem werden die Lösungen<br />
im Inneren stärker erwärmt. Weiterhin ist deutlich die verschiedene Wirkung<br />
bei Veränderungen der Wellenlänge, wobei sich einmal das Kotlargol, ein andermal<br />
das Kochsalz am stärksten erwärmt. Versuche von KOWARSCHIK haben auch<br />
für andere Substanzen ähnliche Verhältnisse ergeben.<br />
Der grundlegende Unterschied in der Tiefenwirkung der Frequenzen des Diathermie-<br />
und UKW-Bereiches dürfte aus allen diesen Untersuchungen einwandfrei<br />
hervorgehen.<br />
Die Langwellen-Diathermie erzeugt eine rein mit dem Onuscben Widerstand paraf/e/gehende<br />
Erwärmung; der Strom fließt nur da, wo er keine besonderen Hindernisse findet ;<br />
48
er umgeht andersartige Schichten, besonders WÔ an der Grenze Übergangswiderstände bestehen.<br />
Durch das Kondensatorfeld dagegen läßt sich in zusammengesetzten Modeilen, deren<br />
einzelne Teile ungleichartige Beschaffenheit haben, eine selektive Erwärmung der einzelnen<br />
Stücke erreichen. Diese Wirkung ist weitgehend' unabhängig von der Anordnung des Modells;<br />
sie betrifft die einzelnen Bestandteile<br />
in gleicher Weise und geht auch durch w n .,<br />
Isolierschichten hindurch. " 3 f U 7 /o<br />
°'<br />
f) Erwärmung in menschlichen Geweben<br />
Auf Grund der PÄTZOLDschen<br />
Untersuchungen konnte angenommen<br />
werden, daß sich innerhalb eines Gewebsverbandes<br />
im Körper einzelne<br />
Zcllkomplexc, ja einzelne Zellen oder<br />
Zcllteile anders verhalten können als<br />
andere dicht dabeiliegendc, aber anders<br />
dissoziierte Gebilde, und daß auch<br />
Bakterien unabhängig von ihrem-<br />
Nährbodcn oder dem von ihnen befallenen<br />
Gewebe gesondert beeinflußt<br />
werden können. Die Unterschiede bei<br />
Erhitzung bestimmter Volumina von<br />
Geweben im Feld der 3-m-Welle und<br />
bei LW-Diathermie können groß sein.<br />
Aus Versuchen geht hervor, daß die<br />
Erhitzung des Fettes bei LW-Diathermie<br />
diejenige anderer Gewebe um<br />
das 20-jofachc übertrifft, und wie sie<br />
im KW-Fcld zurücktritt.<br />
Fett<br />
Kurzwellen feld<br />
Diathermie<br />
Abb. 45 : Selektive Erwärmung<br />
in geschichteten Stoffen.<br />
(Aus Kiin. Fortbildung I, 1933)<br />
Ähnliche Angaben macht SCHERESCHEWSKY, der die Frequenzabhängigkeit der Erwärmung<br />
verschiedener Gewebe eingehend untersucht hat.<br />
Nach Untersuchungen von KOWAESCHIK am Hund ist die optimale Wellenlänge für<br />
Blut und Ascitesflüssigkeit 4 m, für Gehirn 16 m, für Knochen und Lunge 28 m.<br />
Untersuchungen von LEROY an Fasern des Hisschen Bündels ergaben für dieses Gewebe<br />
ebenfalls eine Frequenzabhängigkeit, die sich von derjenigen anderer Herzmuskel<br />
fasern deutlich unterscheidet. Während sich bei 15 m Wellenlänge das Hisschc Gewebe<br />
schwächer und bei 9 m gleichstark erwärmte als das übrige Muskelgewebe, wurde seine<br />
Erwärmung bei 3 m Wellenlänge im Verhältnis doppelt so stark.<br />
Bei Veränderungen der Wellenlänge verschieben sich die Werte gegeneinander.<br />
Es kann aber von vornherein nicht erwartet werden, daß, wie bei Elektrolyten, ein<br />
scharf begrenztes Maximum der Erwärmung bei einer bestimmten Welle eintritt.<br />
Vielmehr muß in Betracht gezogen werden, daß in zusammengesetzten Organismen<br />
die Verhältnisse sehr verwickelt sind. Schon beim Blut haben wir gesehen,<br />
daß die Blutkörperchen sich anders erwärmen können als das Serum. Im Gewebe<br />
sind aber noch mehr verschiedene Bestandteile vorhanden, die dem elektrischen<br />
Feld Angriffspunkte bieten. Schon aus theoretischen Gründen ist daher anzunehmen,<br />
49
daß mehrere unscharf ineinander übergehende Maxima und Minima auftreten<br />
müssen.<br />
Unsere Untersuchungen sind von GEBBERT weitergeführt worden. Auch dabei<br />
hat sich einwandfrei die Möglichkeit selektiver Erwärmung ergeben. Sie geht aus<br />
der in Abb.46 wiedergegebenen Kurve aus der Überschneidung der Linien deutlich<br />
hervor.<br />
In geschichteten Stoffen läßt sich die besondere Art der Energieverteilung zeigen,<br />
wenn man verschiedene Gewebe längs und quer durchflutet. Schichtet man Muskel,<br />
Fett und Lunge aufeinander und läßt sie mit LW-Di a thermie längs durchströmen,<br />
so ergibt sich das Bild, das<br />
auf Grund des OHMsehen Gesetzes zu<br />
erwarten ist; der Strom durchfließt<br />
hauptsächlich Muskel und Lunge, die<br />
sich dadurch weitaus am stärksten erwärmen.<br />
Das schlecht leitende Fett<br />
wird umgangen und erwärmt sich daher<br />
wesentlich schlechter. Fließt der<br />
Strom quer zur Schichtung, dann sehen<br />
wir das umgekehrte Verhalten, denn<br />
der ganze Strom muß jetzt durch das<br />
Fett hindurch, das sich infolgedessen<br />
am stärksten erhitzt (Abb.48,1). Im<br />
UKW-Feld sind die Verhältnisse ganz<br />
I 1 1 IM • Ml tt * •)•• I - | " - | — ] • - »<br />
Q 1 2 3 if 5 6 7 8 S 10 11 12 131*15 15<br />
Wellenlänge in m<br />
Abb. 46: Erwärmung von geschichteten Geweben<br />
bei verschiedenen Wellenlängen (nach<br />
GEBBERT), bezogen auf die Erwärmung des<br />
Fettes. Die verschiedene Frequenzabhängigkeit<br />
geht aus der Überschneidung der Kurven<br />
hervor.<br />
anders. Die Werte der Erwärmung<br />
für die einzelnen Gewebe sind einander<br />
stark angenähert infolge der<br />
kapazitiven Wirkung des Feldes. Die<br />
Wirkung ist homogenisiert ¡ die Richtung,<br />
in der Schichten zueinander liegen,<br />
spielt für das Kondensatorfeld<br />
nur eine geringe Rolle (Abb. 48,2).<br />
Besonders interessant ist in dieser<br />
Beziehung das Verhalten bei verschiedenem<br />
Abstand der Elektroden. Bei nahe anliegenden Platten ist die Wirkung derjenigen<br />
der LW-Diathcrmie angenähert, die Vorteile des Kondensatorfeldes werden<br />
also nicht ausgenutzt.<br />
Wir sehen daraus, daß die Vorteile des Abstandsprin%ips in geschichteten Geweben<br />
noch viel stärker hervortreten als im homogenen Dielektrikum, und daß in<br />
geschichteten Körpern bei zu geringem Plattcnabstand die Tiefenwirkung sehr<br />
verschlechtert wird. Mit anderen Worten : durch Benutzung von Elektroden ohne Luftabstand<br />
geben alle Vorteile des Kur^wellenfeldes verloren.<br />
Auf Grund der vorliegenden Befunde wäre im geschichteten Dielektrikum zu<br />
erwarten, daß man durch Wahl einer geeigneten Wellenlänge eine selektive Wirkung<br />
auf eine bestimmte gewünschte Schicht hervorbringen könnte. Dazu sind<br />
aber die Unterschiede der Materialkonstanten zu gering. Wie schon ausgeführt,<br />
ändern sich außerdem sowohl die DK als auch die Leitfähigkeit mit der Frequenz,<br />
so daß es vorläufig nicht möglich ist, eine optimale Wellenlänge herauszufinden.<br />
Außerdem bilden gewisse Schichten eine Art Abschirmung für die anderen Gewebe,<br />
so daß die Wirkungsmaxima verschoben werden. SCHAEFER hat in diesem<br />
5°
Zusammenhang gezeigt, daß bei Querdurch flutung von Stoffen verschiedener<br />
Leitfähigkeit die Aufeinanderfolge der Schichten und die Wellenlänge von Einfluß<br />
auf die Tiefenwirkung sind. Liegt die schlcchtleitcnde Schicht in der Tiefe,<br />
die gutlcitendc Schicht außen, dann wird die mittlere Schicht durch eine möglichst<br />
niedrige Frequenz am besten erwärmt.<br />
Liegen umgekehrt die schlecht<br />
leitenden Schiebten außen, dann ist<br />
Zur Erzeugung einer größtmöglichen<br />
Tiefenwirkung eine möglichst kur^e<br />
Wellenlänge notwendig. Dies ist<br />
beim menschlichen Körper der<br />
Fall, da die schlechtleitcnde Haut-<br />
Fettschicht die besser leitenden<br />
Gebilde umgibt.<br />
Bei einem^Ä»^« Körperteil sind<br />
die Gewebe hinter- und nebeneinander<br />
geschaltet, so daß die<br />
Feldstärke in einem Teilgewebe<br />
durch den Hochfrequenzwiderstand<br />
der darum liegenden Gewebeteile<br />
mit bestimmt wird.<br />
Abb. 47: Schema der Verteilung eines Hochfrequenzstromes<br />
in zwei Schichten A,B mit verschiedener<br />
Leitfähigkeit. Links wird die besser<br />
leitende Schicht A am stärksten durchströmt<br />
und daher stärker erhitzt. Rechts ist der Strom<br />
gezwungen beide Schichten voll zu durchströmen:<br />
Die Schicht mit höherem Widerstand erhitzt<br />
sich stärker.<br />
Der gegenteilige Einfluß der teils neben-, teils hintereinandergeschalteten Teile bei<br />
Diathermie und im UKW-Feld ist u. a. von KOWARSCHIK näher untersucht worden.<br />
Von unseren an Leichenteilen gewonnenen Ergebnissen können wir nicht auf<br />
den lebenden Menschen schließen, da die Ionisation in den Geweben ja weit-<br />
MUM. (el> Uinjf<br />
Elektroden<br />
anliegend<br />
Elektroden mit AM/ano<br />
l/tok feil langt<br />
ÍS wm O V><br />
Abb. 48 : Erwärmung in drei Schichten im UKW-Feld. 1 Elektroden anliegend : Stärkste<br />
Erwärmung des größten Widerstandes bei Querdurchflutung, des geringsten Widerstandes<br />
bei Durchflutung längs zu den Schichten. 2 Luftabstand: Die Wirkung wird<br />
homogenisiert<br />
gehend vom Ablauf der Lebensvorgänge abhängig und daher eine vollkommen<br />
andere ist. Ferner sind die Werte individuell sehr verschieden, und es ist bis jetzt<br />
noch nicht möglich, die optimale Wellenlänge vor der Behandlung zu bestimmen.<br />
Schließlich zeigen die oben erwähnten Ergebnisse von SCHAEFER, daß durch<br />
die Vorschaltung des Fettes die Verhältnisse grundlegend verändert werden. Ein<br />
wichtiges Problem ist damit die bestmögliche Überbrückung und damit die thermische Entlastung<br />
des Unterbautfettgewebes und gegebenfalls der Muskelschicht geworden.<br />
Ji
g) Die besonderen Tiefenwirkungen des UK W- Feldes<br />
Eine Eigenschaft, die das KW-Feldverfahren vor allen anderen bisher bekannten<br />
Anwendungsarten des elektrischen Stromes auszeichnet, ist die starke Tiefenwirkung<br />
im Inneren der behandelten Gegenstände und Körperteile. Nur durch<br />
Röntgenstrahlen kann noch eine ähnlich weitgehende Beeinflussung tiefgehender<br />
Organe im intakten Körper ausgeführt werden, wobei aber die Art der Einwirkung<br />
ja eine vollkommen verschiedene ist.<br />
Bei allen anderen therapeutisch benutzten Fernwirkungen - Strahlungen und<br />
sonstigen elektrotherapeutischen Maßnahmen - dringt entweder nur ein Bruchteil<br />
in die Tiefe, oder die Energie wird überhaupt in der Haut und den oberflächlichen<br />
Schichten absorbiert.<br />
Um die Art der Tiefenwirkung des UKW-Feldes zu verstehen, betrachten wir<br />
zunächst die einfacheren Verhältnisse bei Strömen von geringerer Frequenz. Von<br />
Abb. 49: Stromverteilung bei Langwellen-Diathermie (links) und im KW-Feld (rechts)<br />
im Schädel (schemat.). Es ist angenommen, daß der Strom nur in einer Richtung (von<br />
links nach rechts) fließt. Die gestrichelten Linien stellen die Stromschlcifen dar, die<br />
Stromstärke wird durch die Dicke der Linien ausgedrückt<br />
den Hochfrequenzströmen in Gestalt der LW-Diatbcrmie hat man sich früher eine<br />
stärkere Tiefenwirkung auf den Organismus versprochen, und es gibt noch heute<br />
Lehrbücher der Diathermie, in denen ein geradliniger Verlauf der Kraftlinien<br />
quer durch die Gewebe phantasicvoll abgebildet ist.<br />
Da Schwierigkeiten bei der Zuleitung elektrischer Ströme zum menschlichen<br />
Körper beruhen auf der Art und Größe der zu überwindenden Widerstände und<br />
ihrer Lage in bezug auf die Stromrichtung. Durch diese Widerstände wird der<br />
Weg bestimmt, den ein Strom im menschlichen Körper einschlägt.<br />
Die Stromlinien eines Nieder- oder Hochfrequenzstromes müssen sich immer an<br />
die Bahnen geringsten Widerstandes halten. Dies sei an einem Beispiel erläutert.<br />
Werden zwei Elektroden an beiden Seiten des Kopfes angelegt, so sind für die Stromleitung<br />
folgende Verhältnisse gegeben. Der Strom tritt durch die Haut, die dem Gleichstrom<br />
gegenüber einen sehr hohen Widerstand hat, ein. Der Hautwiderstand muß auf<br />
jeden Fall überwunden werden, da er nicht umgangen werden kann. Es folgt die Kopfschwartc,<br />
die gut durchblutet ist und deshalb dem Strom keinen großen Widerstand entgegensetzt.<br />
Danach kommt der knöcherne Schädel mit ziemlich hohem Widerstand.<br />
Dieser Widerstand kann abet umgangen werden, es bilden sich Stromschlcifen (Abb. 49).<br />
Ein Teil von ihnen geht durch die gutlcitcndc Kopfschwartc um die Schädelkapsel<br />
herum, ein anderer Teil durchdringt die Knochen. Diese Verteilung geschieht nach Maßgabe<br />
der OHMsehen Widerstände und des KiRCHHOFFSchcn Verteilungsgesetzes auf dem<br />
Weg durch das Kapillarnctz der Kopfschwartc einerseits, durch den Schädelquerschnitt<br />
12
andererseits. Gefäßnetz und Schädelinhalt bilden in unserem Fall nebeneinandergeschaltete<br />
Widerstände. Die Summe solcher Widerstände, der Gesamtwiderstand des Schädels,<br />
kann aus mehreren nebeneinandergeschalteten Widerständen berechnet werden (s. Anhang).<br />
Es hängt also in unserem Fall von den Leitfähigkeiten und der Länge der jeweils<br />
eingeschlagenen Strombahnen ab, wie stark die Stromdichten werden. Ihr Verhältnis<br />
kann sich schon dadurch verschieben, daß beispielsweise eine Kapillarerweiterung<br />
eintritt, die sofort den Widerstand in diesem Zweig verringert.<br />
Verfolgen wir weiter den Stromteil, der die Knochcnschicht durchdrungen hat.<br />
Er findet wieder am verhältnismäßig gut leitenden Liquor cerebrospinalis geringeren<br />
Widerstand als am lipoidreichen Gehirn. Wiederum findet eine Teilung in<br />
mehrere Stromzweige statt, so daß schließlich nur ein kleiner Teil tatsächlich durch<br />
das Gehirn hindurchgeht (Abb.49)<br />
Der Gesamtwiderstand, den jeder einzelne Stromzweig auf seiner Bahn findet, hängt<br />
wieder von den hintereinandergeschalteten Einzelschichten ab. Bei dem gerade durch<br />
das Gehirn hindurchgehenden Teil wäre das z.B.: Haut—Schwarte—Knochen—Liquor—<br />
Gehirn. Diese Widerstände summieren sich algebraisch. Außer den Widerständen der<br />
einzelnen Gewebe kommen noch Übergangs widerstände in Frage. Die Abgrenzung der<br />
einzelnen Teile voneinander geschieht ja immer durch irgendwelche Schncnplattcn,<br />
Faszien oder Fettkapseln; ihre Gefäßversorgung ist häufig voneinander abgesondert, so<br />
daß die Stromgebiete nicht oder nur an wenigen Stellen kommunizieren. Für den elektrischen<br />
Strom bedeutet das Übergangswiderstände, wie sie bei jedem Kontakt bestehen,<br />
und die ebenfalls den Strom oft zum Ausweichen veranlassen.<br />
Die Widerstandsverteilung hat nun eine weitere Bedeutung für die Wirkung<br />
des elektrischen Stromes. Der Energieumsatz in Wärme geschieht auf Grund des<br />
jULEschcn Gesetzes: W = i 2 Rt, wo i die Stromstärke, t die Zeit, R der Widerstand,<br />
W die erzeugte Wärmemenge ist. Die Erwärmung wächst also mit dem<br />
Gewebewiderstand. Die stärkste Erwärmung muß daher da stattfinden, wo ein<br />
starker Stromzweig durch ein Gewebe mit hohem Widerstand hindurchgehen<br />
muß. Das ist vor allen Dingen an den Eintrittstellen der Fall. Der Widerstand der<br />
Haut ist für Ströme mit Frequenzen unter 1 j MHz verhältnismäßig hoch (wie wir<br />
sehen werden, wird er für höhere Frequenzen geringer); einen noch höheren<br />
Widerstand hat nach den Untersuchungen von WILDERMUTH das Untcrhautfcttgewebe.<br />
Hier kann der Strom keinen Umweg machen, die ganze zugeführte Stromstärke<br />
fließt hindurch. Infolgedessen findet hier die stärkste Erwärmung statt. Im<br />
Inneren müßte bei gleicher Stromstärke in Geweben höheren Widerstandes eine<br />
stärkere Erwärmung zustande kommen. Statt dessen werden aber diese Teile meist<br />
vom Strom umgangen, und zwar sind sie in um so geringerem Grade beteiligt, je<br />
größer ihr Widerstand ist. Da der durchfließende Strom proportional dem Widerstand<br />
abnimmt, die erzeugte Wärmemenge aber vom Quadrat desi durchfließenden<br />
Stromes abhängt, so geht daraus hervor, daß Gewebe hohen Widerstandes sich<br />
im Inneren des Körpers nur verhältnismäßig schwach erwärmen.<br />
Die Widerstände bedingen weiterhin das Spannungsgefälle. Wird eine Spannung<br />
zu beiden Seiten eines Körperteils angelegt, etwa 100 Volt, so findet durch<br />
diesen Körperteil hindurch ein Spannungsabfall von 100 auf o Volt statt. Die auf<br />
einer Teilstrecke der Strombahn abgegriffenen Spannungen verhalten sich nun wie<br />
die Teilwiderstände, die zwischen den Abgriffen liegen. Ist bei einem Menschen<br />
ein starkes Unterhautfcttgcwebc vorhanden, so findet hier ein starkes Gefälle<br />
53
statt; die an den inneren Teilen wirksame Spannung ist um diesen Betrag vermindert.<br />
In einem im Inneren des Körpers gelegenen Organen besteht daher oft nur<br />
ein ganz geringes Spannungsgefälle.<br />
Da die Spannung und Stromstärke auf Grund des OHMschcn Gesetzes bei<br />
gleichen Widerständen im geraden Verhältnis stehen, vom Strom aber die Erwärmung<br />
abhängt, so sind wir damit wieder am Anfang unserer Überlegungen<br />
angelangt. Vom Spannungsgefälle hängt der Strom und damit die Erwärmung in<br />
jedem Teilwiderstand ab.<br />
Die Langwellen-Diathermie ist, physikalisch gesehen, nur ein Sonderfall eines<br />
durchfließenden Stromes. Allerdings handelt es sich dabei nicht um einen Gleichstrom,<br />
sondern um hochfrequenten Wechselstrom. Die Wcchselzahl hat für den<br />
menschlichen Körper bei diesen Frequenzen nur die Bedeutung, daß der Hautwiderstand<br />
etwas besser überbrückt wird als vom Gleichstrom.<br />
h) Das Problem der thermischen Entlastung der Oberfläche<br />
Während das Problem der selektiven Erwärmung an Bedeutung verloren hat,<br />
ist das der bestmöglichen Überbrückung der Haut und des UnterhautFettgewebes<br />
in den Vordergrund getreten. Die hohen Widerstände dieser beiden Schichten<br />
beruhen auf verschiedenen Grundlagen.<br />
Wie GILDEMEISTER nachgewiesen hat, wird der hohe Widerstand der Haut<br />
durch die Polarisationskapazität bedingt.<br />
Die verschiedenen Gewebsteile des menschlichen Körpers stellen ebenso viele Einzelschichten<br />
von verschiedener Ionisierung dar, die durch zwischcnliegende, meist semipermeable<br />
Membranen getrennt sind. Elektrisch gedacht stellt jede derartige Schicht cinc<br />
clcktrolytische Zelle für sich dar, durch ihre Aneinanderreihung wird eine Konzentrationskette<br />
gebildet. Durch Anlegen einer elektrischen Spannung entstehen in den einzelnen<br />
Schichten Ioncnvcrschiebungen und Konzentrationsveränderungen, die dem durchgeleitetcn<br />
Strom entgegenwirken und damit zu einer Vergrößerung des Wirkwiderstandes<br />
führen. Bei Ausschaltung des zugeleiteten Stromes und Kurzschluß der beiden<br />
zuführenden Elektroden fließt ein dem Hauptstrom entgegengesetzter Polarisationsstrom,<br />
der dem scheinbaren Widerstand proportional ist: Der Vorgang ist der gleiche<br />
wie bei der Ladung eines Akkumulators, dessen innerer Widerstand auch in der Hauptsache<br />
von den Polarisationskräftcn gestellt wird.<br />
Bei Gleichstrom können die Polarisationsspannungen fast die angelegte Spannung erreichen,<br />
und daher können sehr hohe Widerstände vorgetäuscht werden. Diese Gcgcnspannungen<br />
entstehen selbstverständlich auch bei Wechselstrom; sie bewirken in jeder<br />
Phase vorzeitigen Stromabfall und nach dem Poíwechsel einen verfrühten Anstieg des<br />
Stromes, dadurch eine Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung, eine «Vorcilung»<br />
des Stromes. Dazu kommt eine Erhöhung des Wirkwiderstandes durch.freiwillige<br />
Dcpolarisation. Diese Erscheinung geht mit zunehmender Frequenz immer mehr<br />
und mehr zurück, da zu starken Konzentrationsänderungen die Zeit fehlt. Bei genügend<br />
hoher Frequenz finden wir so nur noch den reinen OiiMschen Widerstand.<br />
GILDEMEISTER hat am tierischen Körper Widerstandsmessungen mit wechselnder Frequenz<br />
vorgenommen. Bei Frequenzen von 400—1200 Hertz fand er eine kapazitive<br />
Phasenverschiebung des Stromes, die bei den niedrigeren Frequenzen am stärksten war<br />
und bei Steigerung der Frequenz abnahm. Da diese Erscheinung bei Wegnahme der Haut<br />
fast ganz verschwand, war ihre Ursache in erster Linie in der Haut zu suchen. Genaue<br />
Berechnungen ergaben gute Übereinstimmung mit den M. WiENSchen Gesetzen für die<br />
Polarisationserscheinungen in Flüssigkeiten, woraus hervorging, daß der Haut eine außerordentlich<br />
hohe Polarisicrbarkcit innewohnt.<br />
54
Für den Langwcllen-Diathermicstrom hat W. E. SCHMID diese Verhältnisse einer<br />
eingehenden Beleuchtung vom physikalischen Standpunkt unterworfen. Vor<br />
allen Dingen suchte er eine scharfe Unterscheidung zwischen den einzelnen Widerstandsarten<br />
zu treffen. Außer dem OHMSchen und dem Polarisationswiderstand<br />
kommt nämlich bei sehr hochfrequenten Schwingungen noch der kapazitive<br />
Widerstand in Frage (s. S. 9). Die Messungen von SCHMID, die mit einer besonders<br />
zusammengestellten Versuchsanordnung durchgeführt worden sind, hatten<br />
das Ergebnis, daß der Körper gegenüber dem Langwcllen-Diathermicstrom als<br />
nahezu reiner OuMschcr Widerstand aufgefaßt werden muß, in Übereinstimmung<br />
mit den GiLDEMEiSTERSchen Lehren. Die Frequenzen sind so hoch, daß die Polarisationskapazität<br />
keine Rolle mehr spielt; andererseits kommt bei Langwellen eine<br />
kapazitive Fortlcitung durch den Körper hindurch noch nicht in Frage.<br />
Wie wir oben bereits gesehen haben, drückt sich die Größe des kapazitiven Stromteils<br />
in der Phasenverschiebung aus, und zwar ist maßgebend der Kosinus des Phascnwinkcls.<br />
Wie SCHMID einwandfrei gezeigt hat, beträgt bei den üblichen Diathermieströmen der<br />
cos (f> = 0,99—0,98. Die kapazitive Fortlcitung kann also ohne weiteres vernachlässigt<br />
werden, (s. Anhang).<br />
Experimentell hat OSKAR SCHMID die Fortleitung von Gleich- und Diathermieströmen<br />
in den verschiedenen Schichten von Körperteilen bei Hunden untersucht.<br />
Die Zuleitung der Ströme geschah meist durch Eintauchen der Körperteile in<br />
physiologische Kochsalzlösungen. SCHMID fand die stärkste Erwärmung in der<br />
Unterhaut. Ganz allgemein konnte er zeigen, daß der Strom den Blutgefäßen folgt,<br />
die sich weit stärker erwärmen als die umgebenden Gewebe. Dies ¡st um so bemerkenswerter,<br />
als es sich um tote Tiere gehandelt hat; die starke Blutfüllung<br />
beim Lebenden dürfte den elektrischen Strom noch stärker auf die Gefäße ableiten.<br />
Andererseits kommen die peripheren Nerven als Stromleiter so gut wie überhaupt<br />
nicht in Betracht. Bei Querdurchströmung von Gelenken fand SCHMID die schon früher<br />
bekannte Tatsache, daß hier die Strombahn zwischen den Knochenenden eingeengt wird,<br />
so daß eine besonders starke Erwärmung in den Gclenkspaltcn erfolgt.<br />
Bei Langwcllcnstömcn fand SCHMID fast genau die gleichen Verhältnisse wie<br />
bei Gleichstrom, abgesehen von der fehlenden Polarisation der Haut. Nur bei<br />
Längsdurchströmung trat die Erwärmung der Unterhaut gegenüber der Muskulatur<br />
stärker hervor. Die Strombahn wurde gegen die Oberfläche hin verschoben.<br />
Es werden die gleichen Muskelgruppen bevorzugt wie bei Gleichstrom. Bemerkenswert<br />
ist, daß SCHMID an der Oberfläche von Muskeln eine größere Stromdichte<br />
nachweisen konnte als in der Tiefe. Bei Querdurchströmung des Kopfes<br />
vom einen zum anderen Ohr ging der größte Teil des Stromes durch die Nackenmuskulatur<br />
(s. Abb. 54).<br />
Am lebenden Tier fanden BESSEMANS und VANHOUTEGHEM experimentell eine<br />
sehr geringe Tiefenwirkung der LW-Diathermieströme auf die Bauchorgane und<br />
betonen, daß beim Menschen die Tiefenwirkung noch geringer sein muß, entsprechend<br />
der größeren Mächtigkeit der Gewcbscinhcitcn.<br />
Diese Ergebnisse stimmen völlig mit den unsrigen überein. Sie zeigen sowohl<br />
von der physikalischen wie von der tiercxperimcntcllcn Seite überzeugend, daß,<br />
abgesehen von der Polarisation in der Haut, die LW-Diathcrmieströmc sich ebenso<br />
wie Gleichstrom verhalten, und daß für ihre Fortleitung nur die OHMSchen Widerstände<br />
und das KIRCHHOFFSCIIC Verteilungsgesetz maßgebend sind.<br />
Ï5
Haut und Fett erwärmen sich daher weitaus am stärksten und absorbieren den<br />
größten Teil der Energie ; Fcttkapseln und Faszien im Inneren des Körpers dagegen<br />
werden umgangen (s. auch S. 47).<br />
Auch im UKW-Feld erwärmt sich das Fett am stärksten. Dies beruht auf seinen<br />
Materialkonstantcn. Die Lage der Fettschicht als Hülle um den Körper hat noch<br />
eine besondere Bedeutung, auf die SCHAEFER zuerst aufmerksam gemacht hat. In<br />
den Anfängen der KW-Therapie hatten wir gehofft, durch Veränderung der<br />
Wellenlänge bestimmte Schichten oder Organe im Körper selektiv besonders<br />
stark erwärmen zu können. Dies wird aber durch die Lage der Fettschicht verhindert.<br />
SCHAEFER hat nämlich gefunden, daß bei Qucrdurchfiutung geschichteter<br />
Stoffe, bei denen die am schlechtesten leitende Schicht außen liegt, die mittlere Schicht<br />
am besten erwärmt wird, wenn die Wellenlänge möglichst kurz ist (Abb.38 S.42<br />
Umgekehrt würde sich eine schlechter leitende Mittelschicht bei langer Welle am<br />
stärksten erwärmen. Aus diesen Versuchen geht hervor, daß eine möglichst kurze<br />
Wellenlänge innerhalb gewisser Grenzen die bestmögliche Tiefenwirkung verspricht<br />
Damit ist aber nicht ausgeschlossen, daß die Veränderung der Wellenlänge bei<br />
den Mikrostrukturen doch eine Rolle spielen kann. Gerade dort sind die Unterschiede<br />
der Materialkonstanten viel größer, als sie im ganzen Organ oder Gewebsstück<br />
summarisch zutage treten.<br />
1. Im Modell<br />
/) Die relative Tiefenwirkung<br />
Der Nachweis der Tiefenwirkung des UKW-Feldes ist experimentell in Modellversuchen<br />
mit organischem und anorganischem Material, an Leichenteilen, in<br />
Tierversuchen und am lebenden Menschen geführt worden.<br />
Grobe Unterschiede lassen sich schon an Brotteig deutlich machen, der im Kondensatorfeld<br />
durchgebacken werden kann. Auch Gelatincpuddings und Tonmodellc (nach<br />
KOWARSCHIK) erwiesen sich als einigermaßen brauchbar. Am besten hat sich zu diesen<br />
Modellversuchen Brot bewährt, weil es sich leicht in beliebige Fotm schneiden läßt, die<br />
eingesteckten Thermometer festhält und durch die Wärme kaum verändert wird. Auf<br />
diese Weise lassen sich leicht Messungen in den verschiedensten Schichten ausführen.<br />
Bei allen Wärmcmessungen im UKW-Feld muß darauf geachtet werden, daß die Thermometer<br />
selbst sich nicht erhitzen ; es kommt dabei auf die Glassorte an, aus der die Thermometer<br />
bestehen. Quecksilbcrthcrmometcr sind im allgemeinen am besten, unbrauchbar<br />
sind Wcingeistthertnomcter. Man prüft das vor dem Versuch empirisch durch Hineinbringen<br />
des bloßen Thermometers ins Kondensatorfcld. Besser ist die Messung mit<br />
Thermoelementen, die als Nadeln in das Gewebe eingestochen werden können. Sie<br />
werden bei richtiger Lage (genau senkrecht zu den Feldlinien) nicht selbst erhitzt und<br />
haben noch den Vorteil, daß sie infolge ihrer geringen Wärmekapazität und des hohen<br />
Wärmeleitvermögens fast momentan ansprechen. Allerdings sind besondere Schutzmaßnahmen<br />
nötig, um stärkere Induktionsströme zu verhindern. PÄTZOLD führte deshalb<br />
Quarzthermometer mit Benzolfüllung ein, die sich im Feld nicht erhitzen.<br />
Zahlreiche solche Versuche haben ergeben, daß die Wärme in den tiefen<br />
Schichten fast ebenso rasch ansteigen kann wie an den Außenflächen, vorausgesetzt,<br />
daß bestimmte Bedingungen erfüllt werden.<br />
Wenn die Versuche stichhaltig sein sollen, dann muß unbedingt darauf geachtet werden,<br />
daß das behandelte Objekt bedeutend breiter ist als die Fläche der Kondensator-<br />
56
platten. Nur das entspricht den tatsächlichen Verhältnissen bei Behandlung des menschlichen<br />
Körpers, wo die Platten immer nur einen Teil der Gesamtoberfläche bedecken.<br />
Viele fehlerhafte Anschauungen über die Tiefenwirkung der Langwellen-Diathermie<br />
sind daraus entsprungen, daß man den Strom durch Modelle fließen ließ, die ebenso groß<br />
oder sogar kleiner als die Elektroden waren ; dadurch ist der Strom auf einen verhältnismäßig<br />
kleinen Querschnitt zusammengedrängt und geht so durch sämtliche Schichten<br />
in gleicher Stärke hindurch, da er keine Umwege machen kann.<br />
Bei Verwendung genügend großer homogener Modelle sehen wir in der Tat ein<br />
sehr starkes Absinken der Diathermiewirkung nach der Mitte zu; auch die Kondcnsatorfeldwirkung<br />
sinkt noch etwas, wenn auch lange nicht so stark, nach der<br />
Mitte hin ab. Dies zeigt sich in unhomogenen Körpern noch vielfach verstärkt.<br />
Abb. 50: Modell mit eingeschobenen Isolierschichten<br />
bei Diathermie und im Kondensatorfeld.<br />
Erwärmung im Brotmodcll mit drei eingeschobenen Isolierschichten bei a, bt c<br />
In zahlreichen hierauf gerichteten Versuchen konnte ich nachweisen, daß die<br />
Stärke der relativen Tiefenwirkung (wie wir das Verhältnis der Tiefenerwärmung<br />
zu derjenigen der Oberfläche bezeichnen), von der Stellung der Kondensatorplatten<br />
abhängt. Werden nämlich die Kondensatorplatten beiderseits in genügende<br />
Entfernung vom Objekt gebracht, so wird die relative Tiefenwirkung immer stärker,<br />
bis bei einer bestimmten Stellung eine gleichmäßige Erwärmung in allen<br />
Schichten zustande kommt. (Abstandsprinzip)<br />
Zum Vergleich haben wir bei unseren Versuchen den LangwcIIen-Diathcrmicstrom<br />
mit herangezogen und Parallclmessungcn durchgeführt.<br />
Bei dem zugrunde liegenden Experiment versuchten wir die im menschlichen Organismus<br />
herrschenden Verhältnisse noch dadurch nachzuahmen, daß quer zur Feldrichtung<br />
Isolierschichten (Cellonplattcn) eingesteckt wurden. Diese sollen den verschiedenen<br />
Scpten (Faszien, Fettkapseln usw.) entsprechen.<br />
57
Die verschiedenen Linien geben die Höhe der Temperatur in den einzelnen Querschnitten<br />
des Objektes an, also den Stand der einzelnen in der mittleren Verbindungslinie<br />
der KondcnSatorplaUcn eingestochenen Thermometer, nach einem bestimmten<br />
Zeitabschnitt der Feldeinwirkung (Abb. 50).<br />
Bei LW-Diathermic fällt die Wirkung unter der Oberfläche sofort stark ab; die<br />
Erwärmung an den Außenflächen ist bedeutend stärker als im Inneren. Sind die<br />
KW-KondensatorpIatten beiderseits ganz nahe an die Modelle herangebracht, so<br />
ist die relative Tiefenwirkung schlecht, wenn auch besser als bei Langwellen.<br />
Werden beide Platten 2 cm vom Modell entfernt, so ist die Erwärmung in allen<br />
Schichten gleich. Die nach oben leicht konvexe Krümmung der Linie 2 kommt von<br />
der stärkeren Abkühlung der oberflächlichen Schichten. Bei 3 (Abb. 50) wurde<br />
Abb. 51: Wärmeverteilung in einem Versuchskörper (Mehl), räumlich dargestellt.<br />
a bei anliegenden Elektroden; b bei Elektrodcnabstand 2 cm (nach PÄTZOLD)<br />
nur die rechte Platte abgerückt, während die linke Platte dicht anliegt. Hier sehen<br />
wir eine starke Erhitzung unter der linken Platte und ein Absinken der Wirkung<br />
nach rechts hin. Durch verschiedene Stellung der Kondensatorplatten wird also<br />
das Wirkungsmaximum mehr nach der einen oder anderen Seite verschoben.<br />
Abb.si zeigt deutlich den Einfluß verschiedener Elektrodenabstände auf die<br />
Tiefenwirkung, nach Versuchsreihen von PÄTZOLD. Wir haben es also in der Hand,<br />
je nachdem eine besonders starke Tiefenerwärmung oder eine Oberflächenwirkung<br />
herbeizuführen; das ist in der Therapie unter Umständen da von Wichtigkeit, wo<br />
oberflächliche Prozesse beeinflußt werden sollen, ohne daß eine allzu starke Wirkung<br />
in der Tiefe auftritt; besonders kommt es am Kopf in Betracht bei Behandlung<br />
der Nasennebenhöhlen, wo man möglichst eine Beeinflussung des Gehirns<br />
vermeiden will.<br />
Die stärkere Beeinflussung einer Seite durch Annäherung einer Platte kann<br />
dann noch dadurch unterstützt werden, daß man diese Platte möglichst klein<br />
wählt und so eine Einengung der Strombahn an der Eintrittsstelle herbeiführt.<br />
Keineswegs gleichgültig ¡st die Art der Dielektrika, die sich zwischen Kondensatorplatten<br />
und Körper befinden. Die Bevorzugung von Glas hat sich aus vielen<br />
vergleichenden Versuchen mit verschiedensten Isolierstoffen ergeben. Man hat<br />
auch mit Gummi überzogene Elektroden benutzt und den Abstand durch Zwischcn-<br />
Ï«
lagen von Filz hergestellt. In eingehenden Untersuchungen hat aber KOWARSCHIK<br />
die Unzweckmäßigkeit solcher Anordnungen nachgewiesen. Nach seinen Ergebnissen<br />
verschlechtern Zwischenlagen von Gummi, Stoff und Fi/% die Tiefenwirkung derartig,<br />
daß sie noch unterhalb von derjenigen der Langwellen-Diathermie liegt. Nur<br />
hei Verwendung der Glas-Luft-Elektrodenschube kommen die besonderen Tiefenwirkungen<br />
der UK W wirklich %ur Geltung.<br />
Günstig scheinen sich nach PÄTZOLD bestimmte moderne Dielektrika mit hoher<br />
DK und geringer Absorption zu verhalten (Condensa, Mycalcx). Keinesfalls sind<br />
durchsichtige Kunststoffe, wie Plexiglas oder Zelluloid dem echten Glas gleichwertig<br />
; sie haben meist viel höhere Dielektrizitätskonstanten und absorbieren daher<br />
einen mehr oder weniger großen Teil der Energie.<br />
Nach GEBBERT ist die Stärke des Wärmeabfalles nach der Mitte hin auch unter<br />
sonst gleichen Bedingungen in verschiedenen Dielektrika verschieden groß. In<br />
Fleisch ist z.B. der Abfall stärker als im Brot, das offenbar besonders günstige<br />
Verhältnisse bietet. Unter gewissen Umständen ¡st es sogar möglich, eine Tiefenwirkung<br />
hervorzurufen, die weit über die Oberflächenwirkung hinausgeht. Dies<br />
ist nach PÄTZOLD der Fall, wenn die Elcktrodcnfläche größer ist als die Fläche des<br />
behandelten Körpers. In diesem Fall konvergieren nämlich die Kraftlinien nach<br />
dem Körperinneren zu, sie werden gewissermaßen in den Körper hineingezogen.<br />
In Flüssigkeitsmodcllen kann man Bestimmungen des Feldverlaufcs auch mit der<br />
Feldsonde ausführen. Das ist ein kleiner Kondensator, der durch Drähte mit einer<br />
kleinen Glühlampe verbunden ist. Man taucht diesen Kondensator in die Flüssigkeit<br />
ein und kann durch das Aufleuchten der Lampe den Verlauf der Feldlinien im<br />
Modell abtasten und bestimmen. Man kann sich durch dieses Verfahren und die<br />
Wärmemessungen ein einigermaßen getreues Bild vom Feldlinicnvcrlauf machen.<br />
Auf diese Weise sind Feldlinienbilder hergestellt, wie sie in Tafel 2 S. 278 wiedergegeben<br />
sind. Selbstverständlich entsprechen diese Bilder nicht in allen Punkten<br />
dem genauen Verlauf der Feldlinien im menschlichen Körper, wo er durch die<br />
verschiedenen Schichten "verändert wird. Man kann sich aber ein ungefähres Bild<br />
davon machen, wie sich bei verschiedener Plattcneinstellung die Feldwirkung<br />
ändert, und kann so einen Anhalt für die richtige Stellung bei der Behandlung gewinnen.<br />
Die absolute Tiefendosis hängt außerdem noch von der Größe der Platten ab. Je<br />
größer die Elektroden sind, desto weniger kann sich das Feld seitlich ausbreiten,<br />
so daß die absolute Menge der Feldlinien, die in der Tiefe wirksam werden, verhältnismäßig<br />
größer ist als unter kleinen Platten.<br />
Die Erwärmung ist proportional dem Quadrat der Stromstärke und somit der<br />
Feldlinicndichtc. Beträgt diese also in einem ticfgelegenen Organ die Hälfte wie an<br />
der Oberfläche, so ist die Erwärmung nur 1 /i. Wir hätten dann eine relative Tiefendosis<br />
von 1 : 4.<br />
Die Bündelung der Feldlinien ist um so besser, d. h. ihr Abstand voneinander um<br />
so geringer, je kürzer die Wellenlänge ist. Durch Versuche ist festgestellt worden,<br />
daß im menschlichen Becken die relative Tiefendosis einer i-m-Welle etwa das<br />
Sechsfache beträgt als bei einer 6-m-Welle. Die Absolutwerte können allerdings<br />
nicht verallgemeinert werden, da für jedes Individuum, je nach Dicke des Körperteils<br />
und der Fettschicht, andere Verhältnisse gelten.<br />
Daß der Elcktrodcnabstand sich im geschichteten Dielektrikum besonders stark<br />
auswirkt, wurde S. 31 gezeigt.<br />
Bei Messungen der Temperaturverteilung quer zur Feldrichtung läßt sich anderer-<br />
59
seits nachweisen, daß die seitliche Streuung nur gering ist. In der Mittelachse der<br />
Platten ist die Erwärmung am stärksten und fällt nur wenig nach den Verbindungsflächen<br />
der Ränder hin ab; außerhalb dieser Verbindungsflächen ist dagegen der<br />
Abfall sehr stark, so daß schon wenige Millimeter weiter außen nur noch geringe<br />
Erwärmung nachweisbar ist (Abb.51). Anders ist es bei Langwelle ndiathermie,<br />
wo die Streuung sehr stark ist.<br />
Eine andere Wärmeverteilung kann man dadurch herbeiführen, daß man gekrümmte<br />
Platten verwendet. Dann findet eine sehr starke Konzentration der Kraft-<br />
Abb. j2. Wärmeverteilung quer zur Feldrichtung zwischen parabolisch gekrümmten<br />
Platten. Plattenstcllung und Lage der Thermometer ist im nebenstehenden Bild wiedergegeben,<br />
a = Wärmeverteilung in der Mitte und b = in Randnähe des Modells. (Aus<br />
ABDERHALDEN, Handbuch, Bd. V, 2/II, S. 376, Fig. :79o. Urban& Schwarzenberg, Wien)<br />
Ünien da statt, wo die gekrümmte Fläche dem Körper am nächsten kommt. Diese<br />
Vorrichtung ist da von Bedeutung, wo man eine möglichst kleine Fläche stark<br />
beeinflussen will. An sich könnte man hierzu auch sehr kleine Kondensatorplatten<br />
nehmen. Dann wird aber die Kapazität des Kondensators sehr gering und<br />
damit, wie wir vorn gesehen haben, auch die zur Wirkung kommende Stromstärke.<br />
Durch die gekrümmten Platten wird dieser Nachteil vermieden. Bei genügendem<br />
Durchmesser kann die Kapazität groß sein, und trotzdem wird ein ziemlich eng<br />
umschriebenes Wirkunsgmaximum erzielt. Will man mehr punktförmige Wirkungen<br />
hervorbringen, so nimmt man Kalotten oder Rotationsparaboloidc ; durch<br />
Platten, die nur in einer Ebene gekrümmt sind, wird das Feld mehr in Bandform<br />
zusammengedrängt. Die Verteilung im Modell, quer zur Fcldrichtung gesehen,<br />
läßt sich aus der Abb.52 erkennen. Ebenso kann das Feld dadurch stärker konzentriert<br />
werden, daß die Platten gekantet werden. An der Kante verdichten sich<br />
die Feldlinien (s. Tafel II, S. 278).<br />
2. Lokalisat ion der Wirkung in Körperteilen<br />
Die Verhältnisse an toten Gliedmaßen geben ein ungefähres Bild über die Verteilung<br />
der Wirkung, wie wir sie im Körper zu erwarten haben. Abb.53, 54 geben<br />
den Wärmeanstieg in den Schichten eines menschlichen Beines wieder, wobei besonders<br />
der Anstieg im Inneren des Knochens bemerkenswert ist. Der Untcr-<br />
60
schied zwischen LW-Diathcrmie und UKW ist unverkennbar. Aus Abb. j6 ist zu<br />
erkennen, wie an einem menschlichen Bein die Stellung der Elektroden auf die<br />
Feldvcrtcilung wirkt. Genau so wie im Brotmodell findet eine verstärkte Wirkung<br />
gegenüber der näher anliegenden Platte statt. Abb. 55 zeigt die stärkere Erwärmung<br />
der Tiefe bei richtiger Plattenstcllung mit größerem Abstand.<br />
Beim Lebenden erfahren die Verhältnisse besonders durch den ftlutstrom eine<br />
wesentliche Umgestaltung. Durch den Blutschleicr, der alle Gewebe durchsetzt,<br />
findet eine beständige Kühlung statt. Für die Entfernung dieser zugeführten<br />
Wärmemengen aus dem Körper sorgen dann die Wärmeregulationsvorrichtungen.<br />
0 1 2 3 ¡i 6 min C><br />
Abb. 5 3 (oben links). Wärme Verteilung in einem<br />
Unterschenkel im Kondcnsatorfcld. Die Zahlen bezeichnen<br />
die Stellen der Wärmemessung; die mit den<br />
gleichen Zahlen bezeichneten Kurven ergeben den<br />
Wärmeanstieg an den entsprechenden Stellen<br />
Abb. J4 (oben rechts). Dasselbe Bein wie in der<br />
Abb. S3 bei Diathermie. Übermäßige Erhitzung der<br />
Oberfläche<br />
Abb. ji (rechts). Wärmeverteilung im Bein bei verschiedener<br />
Plattenstellung. A-A ~ beide Platten in<br />
2 cm Entfernung, A~B — rechte Platte berührt,<br />
C-B = beide Platten berühren. 1 = Thermometer<br />
im Untcrhautgcwebc links, 2 = Thermometer im<br />
Knochenmark der Tibia, 3 ~ Thermometer in der<br />
Fibula, 4 = Thermometer in der Muskulatur der<br />
Mitte, ; — Thermometer in der Muskulatur rechts.<br />
(Aus Strahlentherapie, Bd. 38, Urban & Schwarzenberg,<br />
Berlin)<br />
61<br />
°c<br />
HO<br />
0<br />
/<br />
1<br />
1<br />
1<br />
•<br />
l s 1<br />
1<br />
1<br />
/<br />
/<br />
/<br />
/<br />
/<br />
1<br />
S<br />
*<br />
2<br />
/<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
/<br />
1<br />
1<br />
s<br />
/<br />
/<br />
/<br />
s<br />
S<br />
/<br />
*<br />
.'*<br />
^<br />
*$<br />
3 4 min S<br />
9 ft 15 W 3t<br />
Minuten<br />
B A
Bei dauernder Wärmezufuhr mittels des Kondensatorfeldes wirken daher zwei<br />
Komponenten einander entgegen. Zunächst überwiegt die Entwärmung, so daß<br />
sich das Gewebe nicht merklich erhitzt. Wird die Leistung im Kondensatorfeld<br />
erhöht, so steigt die Wärme an. Zugleich werden aber auch die Blutgefäße der be-<br />
30<br />
Í<br />
—i<br />
y<br />
k an.<br />
-X-*-<br />
-.Uui k. Ah<br />
so so so m 159 m no wiStk.<br />
Abb. jó. Erwärmung im Bein eines lebenden<br />
Hundes im Kondensatorfeld. Temp, in 1 /10°.<br />
U.H. — Unterhaut, Kn. = Knochen. (Aus Zeitschrift<br />
f. exper. Medizin, Bd. 66, S. 251, Fig. 11,<br />
Julius Springer, Berlin)<br />
'odiej<br />
l/ntçrhauf<br />
links<br />
90 mSek.<br />
Abb. Í7- Dasselbe bei Annäherung<br />
einer Platte. (Aus Zeitschrift<br />
f. exper. Medizin, Bd.66, S.2ji,<br />
Fig. 17, Julius Springer, Berlin)<br />
troffenen Gegend erweitert, es tritt aktive Hyperämie ein; die Kühlung wird somit<br />
auch verstärkt. Aus Wirkung und Gegenwirkung muß sich zuletzt, wenn wir den<br />
zeitlichen Verlauf betrachten, eine gekrümmte Kurve ergeben. Schließlich wird<br />
sich ein Gleichgewichtszustand ergeben,<br />
der zu einem konstanten Endwert führt.<br />
210 2
schätzen zu können, außerdem auch um Versuchsfelder durch mangelhafte Gerätschaften<br />
rechtzeitig zu erkennen.<br />
Abb.;7 zeigt den Unterschied, der durch andere Einstellung der Platten zustande<br />
kommt, Abb.58 den Vergleich mit W.-Diathermie.<br />
Wechselfeld: Hinterkopf<br />
ZQ 30 m SO fO 70 S3 SO 1GO ffl? 720<br />
Sekunden<br />
Abb. 59. Wärmeverteilung im Kopf<br />
eines Kaninchens im Kondcnsatorfcld.<br />
(Aus Vcrh. d. dt. Kongr. f. inn.<br />
Medizin, XL. Kongr. Wiesbaden,<br />
1928, Kurve II/2, S. 309, Julius Springer,<br />
Berlin)<br />
*f\<br />
efi y i<br />
w .- a ;<br />
9fl •<br />
1<br />
'—1<br />
S i-I<br />
I 1<br />
1<br />
\ \<br />
'• \<br />
• • - "*<br />
m<br />
Ù/tHi.<br />
- . 1<br />
*H<br />
23 w so so m m m m wmsik.<br />
Abb. 61. Erwärmung im menschlichen<br />
Magen. 50 Tcilstr. = i°.<br />
Diathermie bis zur eben erträglichen<br />
Grenze der Hauterhitzung.<br />
Im Kondcnsatorfeld nur leichte<br />
Wärmeempfindung. (Aus Umschau,<br />
Jahrgang 54, H. 17, S.J27,<br />
Fig. 7, H. Bcchhold, Frankfurt<br />
a. M.)<br />
JC 20 30 HO SO SO &} so wo m 720 130 m rio tso<br />
Sekunden<br />
Abb. 60. Dasselbe bei LW-Diathcrmic. (Aus<br />
Vcrh. d. dt. Kongr. f, inn. Medizin, XL. Kongr.<br />
Wiesbaden, 1892, Kurve II/i, S. 309, Julius<br />
Springer, Berlin)<br />
In Abb. 59 sehen wir ein Beispiel, das auf<br />
S. s 2 schon vom theoretischen Standpunkt aus<br />
durchgesprochen wurde. Es handelt sich um<br />
den Kopf eines Kaninchens. Hier kommt der<br />
Unterschied der Langwellen-Diathermie und<br />
des Kondensatorfeldcs sehr deutlich zum Ausdruck.<br />
Im Kondensatorfeld kommt eine Wärmcverteilung<br />
zustande, wie sie im wesentlichen<br />
durch die physikochemische Beschaffenhcit der<br />
Gewebe bestimmt wird. Am stärksten erwärmt<br />
sich der Knochen, danach Gehirn, und Unterhaut<br />
ungefähr gleich stark. (Für Beurteilung<br />
der Kurven ¡st nicht die Lage der Ausgangswerte<br />
maßgebend, sondern nur das Verhältnis<br />
der Steigungswinkel der einzelnen Kurven.)<br />
Die Diathermickurven (Abb.63) dagegen ergeben<br />
eine immer mehr von außen nach innen<br />
abnehmende Wirkung; die Kopfschwartc ist<br />
demnach sehr stark erhitzt worden, Muskel<br />
63
und Knochen schon weniger und am geringsten das Gehirn (s. auch Abb. 49,<br />
S. 52).<br />
Um die Streuung der Ströme festzustellen, wurden bei diesem Versuch noch<br />
Messungen in der Kopfschwarte über dem Scheitelbein, also außerhalb des<br />
eigentlichenElektrodcnbereiches, vorgenommen. Man erkennt besonders beider<br />
Diathcrmiebchandlung einen starken Anstieg, bedeutend stärker als im Gehirn, der<br />
durch das Herumfließen des Stromes um die Schädelkapsel verursacht ist. Im<br />
Kurzwcllenfeld ist hier die Erwärmung viel geringer. Daß sie überhaupt vorhanden<br />
ist, liegt an der Kleinheit des Objektes, in dem die Streuung noch verhältnismäßig<br />
bedeutend ist.<br />
Teilstrichs Snxj<br />
10 1,33<br />
1. Strom i haffff<br />
ttftg.<br />
# 13 KfM/ft<br />
Abb. 6z. Erwärmung im menschlichen Nierenbecken.<br />
(Aus Zeitschrift f. exper. Medizin, Bd.66, S.255, Fig.20, Julius Springer, Berlin)<br />
Durch Messungen im Kniegelenk von Hunden konnte PRATT meine Ergebnisse<br />
bestätigen. Auch er fand, daß die relative Tiefenwirkung weitgehend vom Luftabstand<br />
abhängt. CIGNOLINI hat an einem menschlichen Kopf die Wärmeverteilung<br />
in verschiedenen Schichten und Tiefen gemessen, um die Beeinflußbarkeit der<br />
Hirnrinde und der Hypophyse festzustellen. Elektroden von 4 cm Durchmesser<br />
wurden mit verschiedenen Luftabständen angebracht. Die Ergebnisse waren bei<br />
bitemporaler Anwendung der Elektroden:<br />
Abstand 2 cm<br />
Unterhaut -f 7,1 o<br />
Hirnrinde + i,;°<br />
Hypophyse +0,6° (8%)<br />
Transversales Feld:<br />
Kopf-Durchmesser 16 cm<br />
6 cm<br />
+ 1,7°<br />
+ o,6° (35%)<br />
-r o,3° (18%)<br />
Sagittales Feld:<br />
10 cm<br />
+ o,8 ü<br />
+ o,3° (37%)<br />
+ 0,2° (24%)<br />
Thermometer vorn im Gehirn 5 cm hinter der Stirn, hinteres Thermometer 6cm vom<br />
Hinterkopf<br />
Luftabstand 4 cm 6 cm 7 cm 8 cm<br />
Vorderes 7'hcrmomctcr 0,4 o 0,3 o 0,3 o 0,25 o<br />
Hypophyse 0,2 o 0,2 o 0,2 o 0,2 a<br />
Hinteres Thermometer 0,4 o 0,3° 0,4 o 0,4^<br />
Unter günstigen Bedingungen kann die Erwärmung im Gehirn etwa 40% von<br />
derjenigen der Oberfläche erreichen. Eine Gefahr der Schädigung des Gehirns<br />
besteht also nicht, da das Wärmeempfinden der Haut vor Überhitzung warnt.<br />
64
4- Lokalisation der Wirkung beim lebenden Menseben<br />
Bei Menschen wurden Untersuchungen über die Tiefenwirkung in Körperhöhlen<br />
insoweit ausgeführt, als sich Thermoelemente leicht einführen ließen.<br />
Vergleiche mit der Haut und dem Unterhautgewebe wurden nicht angestellt, da sonst<br />
Einstiche mit den immerhin ziemlich dicken Thermonadeln nötig gewesen wären. So<br />
sind nur Vergleiche mit Diathermie in der Weise durchgeführt worden, daß das subjektive<br />
Hitzegefühl der Haut als allerdings sehr grober Maßstab diente.<br />
0 SO 120 180 ZW sek 300<br />
Abb. 63. Erwärmung in der Speiseröhre, Kurzwellen und Diathermie<br />
Abb. 61 gibt die Erwärmung im Magen wieder, die mittels eines im dünnen<br />
Magenschlauch angebrachten Thermoelementes gemessen wurde. Die Langwellendiathermie<br />
wurde mit Elektroden von 9:12 cm Größe mit solcher Stromstärke<br />
durchgeführt, daß die Erhitzung der Haut eben noch erträglich war. Man erkennt<br />
in der Abbildung deutlich, daß im Kondensatorfeld eine ebenso starke, ja stärkere<br />
Wärmesteigerung herbeigeführt werden konnte, ohne daß die Versuchsperson<br />
mehr als eine leichte angenehme Erwärmung der Haut empfand.<br />
Die angewandten Stromstärken sind in diesem und den folgenden Versuchen nicht<br />
verglichen worden. Ein solcher Vergleich wurde zu nichts führen, da wir ein sicheres<br />
Maß für die Leistung im Kondensatorfcld noch nicht haben. Außerdem folgt aber auch<br />
die Wärmcumwandlung der elektrischen Leistung im Innern der Gewebe (Abschnitt j),<br />
bei den beiden Verfahren völlig verschiedenen Gesetzen, so daß eine vergleichende Messung<br />
der Stromstärke hier ohne jede Bedeutung sein würde. Ein Vergleich auf Grund der<br />
subjektiven Wärmeempfindung auf der Haut ist a fortiori erlaubt, weil wir in einem Fall<br />
bis zum eben erträglichen Maximum gingen, das überhaupt verwendbar war, im anderen<br />
Fall nur eine eben merkliche Erwärmung hervorriefen.<br />
Auf entsprechende Weise ist die Abb. 62 gewonnen, nur wurde hier das<br />
Thermoelement mittels eines Urcterenkatheters in das Nierenbecken eingeführt.<br />
Auch hier ist die Erwärmung im Inneren bei Anwendung des Kondensatorfeldes<br />
stärker als bei der eben bis zur Grenze des Erträglichen gesteigerten Diathermie.<br />
Die Plattengröße betrug bei beiden Anwendungsarten 9:12 cm.<br />
Durch Wärmemessungen in der Blase hat DALCHAU diese Tiefenwirkung der Kurzwellen<br />
bestätigt.<br />
Noch stärkere Unterschiede ergeben sich im Ösophagus, wenn die Platten auf<br />
Brustbein und Rückenmitte aufgelegt werden (Abb.63). Infolge der großen<br />
65
Widerstände, die der Diathermiestrom durch die lufthaltige Lunge einerseits, die<br />
Wirbelsäule andererseits erfährt, ist die Erwärmung an dieser Stelle nur gering,<br />
während durch das Kondensatorfeld auch hier eine kräftige Wirkung erzeugt wird.<br />
Selbstversuche über die Temperatur Verteilung hat RAUSCHER mittels Messungen<br />
in Mundhöhle und After ausgeführt. Mit heißen Umschlägen und Packungen sowie<br />
auch mit Diathermie konnte dabei keine meßbare Temperaturerhöhung erzielt<br />
werden, selbst wenn mit der Erhitzung bis an die Grenze des Erträglichen gegangen<br />
wurde. Erst mit Erhöhung der allgemeinen Körperwärme stiegen die Temperaturen<br />
an. Im KW-Feld wurde dagegen rascher Anstieg der Temperatur gemessen.<br />
KORB führte Messungen im Uterus aus, bei denen er zum gleichen Ergebnis kam<br />
und außerdem die Überlegenheit der i-m-Welle gegenüber längeren Wellen feststellte.<br />
Aus allen Untersuchungen geht einwandfrei hervor, daß die Wirkung des Kondensatorfeldes<br />
zu einem großen Teil auf den Raum zwischen den beiden Platten<br />
beschränkt bleibt. Damit ist nicht gesagt, daß nicht auch außerhalb dieses Raumes<br />
eine Streuung der Feldlinien vorhanden ist. Schon durch Abtasten mit der Glimmlampe<br />
kann man sich davon überzeugen, daß beispielsweise am Ansatz der Zuleitungen<br />
zu den Kondensatorplatten starke Felder vorhanden sind. Diese Streuung<br />
nach den Seiten hat auf die Feldverteilung im Objekt kaum einen Einfluß. Mit<br />
Ultrakurzwellen ist also eine Tiefenwirkung möglich, wie sie mit keinem anderen<br />
Mittel, außer den Röntgen- und Radiumstrahlen, erreicht wird. Durch die Begrenzung<br />
zwischen den Platten ist bis zu gewissem Grad eine gerichtete Wirkung<br />
auf bestimmte Organe möglich.<br />
k) Gibt es spezifische Wirkungen?<br />
Die Frage nach spezifischen Wirkungen ist im Schrifttum immer wieder mit<br />
mehr oder weniger Sachlichkeit erörtert worden. Vor jeder Diskussion müßte geklärt<br />
werden, was man überhaupt unter «spezifisch» verstehen soll. Im Grund<br />
kommt es nur darauf an, wie weit man den Begriff faßt. Man kann als spezifisch<br />
alle Wirkungen bezeichnen, die sich von denjenigen anderer Agcntien unterscheiden,<br />
also etwa die Mikro-Erwärmung und die kapazitiven Wirkungen. Die<br />
meisten Autoren wollen aber den Begriff noch mehr eingeengt sehen auf rein<br />
elektrische Wirkungen, die streng von der Wärmewirkung getrennt sein sollen.<br />
Eine solche absolute Trennung gibt es, wie wir schon gesehen haben, nicht;<br />
denn alle elektrischen Wirkungen erzeugen Bewegungen der Teilchen, und diese<br />
Bewegung ist Wärme. Im Grund ist es daher ein Streit um Worte, ob man spezifische<br />
Wirkungen annehmen will und wo die Grenze solcher Wirkungen beginnt.<br />
Man könnte mit gutem Recht als spezifisch solche Wirkungen bezeichnen,<br />
bei denenbei einem Minimum an Wärmeentstehung deutlich nachweisbare physikochemische<br />
oder biologische Veränderungen hervorgebracht werden.<br />
Hierher gehört die «Peri schnür bildung» kleiner Teilchen. Sie tritt nicht nur im K W-<br />
Fcld, sondern auch bei anderen elektrischen Strömen auf. Beim KW-Feld gewinnt<br />
sie aber besondere Bedeutung dadurch, daß sie auf kapazitivem Weg auch in der<br />
Tiefe der Organe und Körpcrgcwcbc entstehen dürfte.<br />
ESAU hat erstmalig gezeigt, daß sich kleinste Teilchen einer Emulsion (z.B.<br />
Milch) in Richtung der Stromlinien aneinanderlegen. Man kann dadurch die<br />
Stromlinien deutlich nachweisen. Im KW-Feld wurde diese Erscheinung von<br />
66
LiEBESNY genauer untersucht, der einen Film davon 1937 vorgeführt hat. Erzeigte,<br />
daß die Kettcnbildung bei einer bestimmten Feldstärke am besten erfolgt, daß aber<br />
beim Überschreiten dieser Dosis die Ketten infolge Wärmeströmung wieder zerfallen.<br />
Hieraus ergibl sieb eine Erklärung dafür, daß bei manchen Erkrankungen eine bestimmte<br />
Dosis günstig wirkt, beim Überschreiten dieser Dosis jedoch Mißerfolge eintreten.<br />
Mit Wellenlängen von 50-80 cm stellte DENIER Beobachtungen an Lösungen<br />
von chinesischer Tusche an, wobei sich ebenfalls Teilchen die ¡e nach dem Verlauf<br />
der Feldlinien in verschiedener Weise anordneten.<br />
In Hunderten von Versuchen hat DENIER festgestellt, daß die Art der Verteilung<br />
von folgenden Faktoren beeinflußt wird : Vom Elcktrodenabstand beiderseits<br />
des Gefäßes; von Oberfläche und Größe des Gefäßes; der Elektrodenform; dem<br />
Vorhandensein metallischer Gegenstände in der Nähe; der Höhe der Erwärmung<br />
der Flüssigkeit; der Feldstärke und schließlich der Wellenlänge. Es ergab sich, daß<br />
sowohl zwischen den einzelnen Wellenlängen deutliche Unterschiede bestehen, wie<br />
auch zwischen ungedämpften und gedämpften Wellen. Von Interessse ist, daß<br />
DENIER in Übereinstimmung mit uns die Wichtigkeit des Elektrodenabstandes betont.<br />
Wichtig ¡st ferner die Tatsache, daß die Figuren schon dann auftraten, wenn<br />
durch Thermometer oder Thermoelemente noch keine Erwärmung nachgewiesen<br />
werden konnte.<br />
Es ist möglich, daß die Perlschnurbildung Einfluß auf die Agglutination von<br />
Bakterien und ähnliche kolloidchemische Vorgänge hat. Wie HELLER und CUT<br />
LER zeigen konnten, werden auch Bakterien im KW-Feld gleichgerichtet. Die<br />
Chromosomen stellen sich im Inneren der Zellen auf die Kraftlinien ein. Diese<br />
Wirkung hängt von der Frequenz im Feld ab.<br />
Die früher erwähnten Untersuchungen von J. HAUSSER, KUHN und GIRAL<br />
zeigen ferner, daß gewisse komplexe Moleküle während der Durchflutung Änderungen<br />
ihrer Struktur erleiden, womit auch Veränderungen der kolloidalen Eigenschaften<br />
der Membrandurchlässigkeit usw. zusammenhängen dürften. Tatsächlich<br />
haben die Untersuchungen von SCHLAG und v. NORDHEIM erwiesen, daß die<br />
Permeabilität der Zellmembranen für Wasscrstoffionen sich bei KW-Durchflutung<br />
ändert (s. S. 90).<br />
RECKNAGEL und SCHLIEFHAKE haben an menschlichem Serum zahlreiche Versuche<br />
über die Becinflußbarkcit des kolloidalen Zustandcs unternommen.<br />
Serum wurde in Reagenzgläsern dem Kondcnsatorfcld ausgesetzt, die Temperatur<br />
wurde durch Kühlung so gehalten, daß sie nicht über z° stieg. Die mit einem OSTWALDschen<br />
Viskosimctcr gemessene Zähigkeit nahm zunächst zu, nach 10 Minuten aber wieder<br />
ab. Bei Durchflutungen über 20 Minuten ging die Viskosität zurück. Untersuchungen<br />
der Fällbarkeit mit Ammonsulfat ergaben eine Zunahme der Stabilität. Bei Erwärmung<br />
waren die Veränderungen umgekehrt.<br />
An anorganischen Kolloiden sind von IZAR und MORETTI Untersuchungen angestellt<br />
worden, die eine Erhöhung der katalytischen Wirkung von Cu-Sol auf die 02-Abspaltung<br />
aus Hj[Os ergaben. Wellenlängen von 4,8 und 15m hatten dabei verschiedene Wirkungen.<br />
Je kürzer die Welle, um so stärker die Wirkung. Die gleichen Autoren fanden eine Steigerung<br />
der proteolytischen Wirkung der Pepsins im Feld einer 8-m-Welle, während andere<br />
Wellenlängen unwirksam waren.<br />
LEPESCHKIN hat folgende Versuche gemacht:<br />
Menschenserum wurde zwischen die Platten des Kondensators eines Röhrenapparates<br />
gebracht.<br />
67
Die notwendige Kühlung erfolgte durch Einstellen in Eis. Es wurde mit verschiedenen<br />
Apparaten gearbeitet, mit denen Wellenlängen von z, 3, 4, 6 und 20 m bei Leistungen<br />
von 60—370 Watt erzielt wurden. Die Abstände der Kondensatorplatten betrugen<br />
j—10 cm. Vor und nach der Einwirkung des elektrischen Feldes wurden mittels neuer<br />
Methoden die Veränderungen der Proteine untersucht:<br />
1. Methode der kngttudinalen Streuung im Ultrarot zur Bestimmung des Molekulargewichts.<br />
2. Acetontitration nach IRGENSONS zur relativen Bestimmung der Molekulargewichte.<br />
3. Titration mit gesättigter (NH4)„S04-LÖsung zur Bestimmung des Grades derHydration<br />
und der Menge der hydrophilen Gruppen.<br />
4. Titration mit 5 %iger Lösung von Sulfosalicylsäure zur relativen Bestimmung der<br />
Zahl der NHa-Gruppen,<br />
5. Calorimetrischc Methode zur Bestimmung der Reaktionswärme bei Einwirkung von<br />
Sublimat auf die COOH-Gruppen der Proteine und schließlich<br />
6. Hitzekoagulation bei konstanter Temperatur für Rückschlüsse auf die Veränderung<br />
der Proteinmolckül-Struktur (Einzelheiten vgl. Orig.). Zur Titration mit Aceton und<br />
(NH4)tS04 wurde meist verdünntes Serum, zu derjenigen mit Sulfosalicylsäure mit<br />
1 liWti. HCl 1: 10 verdünntes Serum verwendet.<br />
Ergebnisse: Das mittlere Molekular-Gewicht der Proteine des nativen"]Menschenserums<br />
Hegt gewöhnlich höher als das aus den Molekulargewichten der<br />
einzelnen Proteinfraktionen berechnete. Das stützt die Vermutung, daß die einzelnen<br />
aus dem Serum dargestellten Proteine Kunstprodukte sind. Besonders hoch<br />
war das mittlere Molekulargewicht der Serumproteine nach Zusatz von Acetatpuffer<br />
bei pH 4,8—4,9. Nach der Methode der longitudinalen Streuung ergab<br />
sich als mittleres Molekulargewicht der Serumproteine bei pH 6 — 8: 140000,<br />
160000, 200000, 270000, 330000, 340000, bei pH 4,8: 810000 und 900000. Das<br />
deutet auf starke pH-Abhängigkeit. Wurde Serum in flacher Kristallisierschale bei<br />
3° sich selbst überlassen, täglich mit destilliertem Wasser auf früheres Volumen<br />
aufgefüllt, so ergab sich eine Erhöhung des pH-Wertes von 8,03 auf 8,62 in<br />
4 Tagen, die dem Entweichen von C02 zugeschrieben wird. Es wurde daher in der<br />
Regel in Pufferlösungen gearbeitet.<br />
Alle Methoden zeigten übereinstimmend, daß Kurzwellen verschiedener Länge<br />
zunächst eine Vergrößerung des mittleren Molekulargewichtes hervorrufen, die<br />
dann bei weiterer Einwirkung einer Verminderung weicht. Freie NH2- und COOH-<br />
Gruppen verschwinden im Rahmen der Vergrößerung und treten mit der Verminderung<br />
neu auf. Die Zahl der hydrophilen Gruppen bleibt unverändert, wie<br />
sich auch aus zusätzlichen Messungen der gleichbleibenden Viskosität ergibt, was<br />
auf Konstanz der Hydratation schließen laßt.<br />
Das macht die salzartige Bindung der NH2- und COOH-Gruppen untereinander<br />
und deren Trennung durch Kurzwellen sehr wahrscheinlich. Vermutlich treten<br />
bei der Polymerisation kompliziertere Strukturen auf, als ursprünglich vorhanden<br />
waren. Beim Zerfall der Polymerisate unter Kurzwellenwirkung entstehen offenbar<br />
ebenfalls Substanzen, die im Serum nicht vorhanden waren.<br />
Die Wirkung der Kurzwellen beruht nicht auf der durch sie hervorgerufenen<br />
Erwärmung. Diese allein verursacht nur eine Verkleinerung des mittleren Molekulargewichtes.<br />
Allerdings wird beim Euglobulin, das jedoch nur 20% der<br />
Gesamtproteine ausmacht, eine Polymerisation beobachtet, während bei Albumin<br />
und Pseudoglobulin ein Zerfall der Moleküle unter Wärmeeinwirkung auftritt.<br />
Die Veränderung durch Wärme dauert nur wenige Minuten an, während die durch<br />
Kurzwellen verursachte viel dauerhafter ist. Abkühlung des Serums begünstigt die<br />
68
Polymerisation durch Kurzwellen, denn sie hindert die Molekular-Bewegung und<br />
hemmt den Zerfall der Moleküle durch die Wärme, allerdings bei gleichzeitiger<br />
Erhöhung der inneren Reibung, die der Beweglichkeit der Moleküle entgegenwirkt.<br />
Das pH ändert sich bei Pufferzusatz unter der Kurzwellenwirkung nicht,<br />
ohne Puffer durch Entweichen von COa.<br />
Mit diesen Ergebnissen bestätigt Vf. die Annahme, daß Polymerisation und<br />
Depolymcrisation bei Kurzweüenwirkung durch Bindung bzw. Spaltung der<br />
Bindung zwischen den NH2- und COOH-Gruppen zustande kommen. (Biochem.<br />
2. 318. 15—43. 3/7- I 947- Wien, Univ., Physiol. Inst.)<br />
Interessant sind weiterhin die Versuche von WrLKE und MÜLLER an verschiedenen<br />
Kolloiden, wie Arsentrisulfidsol, Mastixsol, Berlinerblau, Nachtblau,<br />
Kongorot-Hämoglobinlösungen und kolloidem Silber. Dabei wurden teils<br />
momentane Veränderungen beobachtet (Kataphorese und Leitfähigkeit), teils<br />
Nachwirkungen (Änderungen der Farbe, Ausflockung, Viskosiät). Die Wirkungen<br />
sind frequenzabhängig. Bemerkenswert ist dabei, daß schon die Energie der<br />
Rundfunkwcllen genügte, um Veränderungen hervorzurufen.<br />
Nach DE PEREIRA FORJAZ wird die Veresterung bestimmter Alkohole mit<br />
Säuren durch ein Kurzwellenfeld von 2 — 1,26 m beschleunigt; der Säuregrad<br />
verschiedener Öle und Weine ändert sich nach diesem Autor im KW-Feld teilweise<br />
recht bedeutend. SCHLAG und KELLER verfolgten an frischen tierischen<br />
Muskeln und Organen die Änderung der Wasserstoffionenkonzentration nach<br />
10—12 Minuten langer UKW-Durchflutung. Die Änderung unterscheidet sich<br />
von derjenigen nach bloßer Erhitzung deutlich und stark; verschiedene Wellenlängen<br />
wirken verschieden, und es bestehen Unterschiede zwischen der Wirkung<br />
ungedämpfter und gedämpfter Wellen.<br />
An Diphtherieheilserum haben RECKNAGEL und ich Versuche ausgeführt, wobei<br />
uns Herr Prof. SCHMIDT, Leiter der Behringwerke in Marburg, liebenswürdigerweise<br />
behilflich war.<br />
Abgelagerte Antitoxinmengen, deren Titer sich seit längerer Zeit konstant gehalten<br />
hatte und kurz vorher bestimmt worden war, wurden mit 3-m-Wellen im Kondcnsatorfeld<br />
bei Temperaturen behandelt, die durch beständige Kühlung zwischen 20 und 24 o<br />
gehalten wurden.<br />
Die Bestimmung des Antitoxingehaltes, die vom Behringwerk ausgeführt wurde,<br />
ergab eine starke Abnahme nach der Behandlung.<br />
Von Mäusen, denen eine tödliche Dosis von Diphtherietoxin eingespritzt worden war,<br />
kamen diejenigen, die mit dem nicht durchfluteten Serum behandelt wurden, mit dem<br />
Leben davon, ebenso die mit dem 1 (t Stunde lang durchfluteten Serum behandelten Tiere.<br />
Das Vs Stunde lang durchflutete Serum war noch teilweise wirksam, indem ein Teil der<br />
Tiere einging, während nach 3 /4stündiger Durchflutung die Antitoxinwirkung erloschen<br />
war. Die mit diesem Serum behandelten Tiere gingen alle zugrunde.<br />
Für eine spezifische Wirkung der Kurzwellen auf Eiweißkörper könnten die<br />
Untersuchungen von JÖRNS über den Einfluß des Kondensatorfeldes auf die Phagozytose<br />
von Leukozyten sprechen. JÖRNS fand, daß bei bestimmter Dosierung die<br />
Phagozytose stark angeregt, bei zu starker Einwirkung dagegen geschwächt wird.<br />
Dabei gelang ihm der Nachweis, daß die Schwächung durch eine unmittelbare<br />
Einwirkung auf die Leukozyten hervorgerufen wird, die Anregung der Phagozytose<br />
dagegen rein auf Veränderungen des Serums beruht. Durch Behandlung<br />
69
von Leukozyten ohne Serum konnte nämlich keine Steigetung der Phagozytose<br />
hervorgerufen werden. Wurden die Leukozyten dagegen in ein Serum gebracht,<br />
das vorher dem Kondensatorfcld längere Zeit ausgesetzt worden war (bei Wellenlänge<br />
4,8 m), so trat die Phagozytoscstcigcrung genau so auf wie im durchfluteten<br />
Serum-Lcukozyten-Gemisch. Ebenso konnte auch im lebenden Körper eine<br />
Steigerung des phagozytischen Index durch Behandlung im Kondensatorfeld<br />
hervorgerufen werden. Diese Beeinflussung des Serums, die Erzeugung von<br />
Phagozytose-anrcgenden Stoffen durch die Kondcnsatorfeldwirkung, könnte<br />
vielleicht als eine spezifische Beeinflussung der Serum-Eiweißkörper angesehen<br />
werden: gewöhnliche Wärmewirkung kommt nicht in Frage, da für Konstanthaltung<br />
der Temperatur gesorgt worden war.<br />
Von fermentativen Prozessen ist die Labgerinnung der Milch durch KÖRBER<br />
näher untersucht worden. Bei Roh-Votlmilch in der Verdünnung i : i Million<br />
wurde nach Kurzwellendurchflutung eine Verkürzung des Labvorganges um<br />
60% erzielt. Die Wellenlänge von 4 m war biologisch wirksamer als 151"; bei<br />
der letzteren trat sogar eine Verlängerung der Reaktionszeit auf. Die Verdünnung<br />
spielt bei dem Vorgang eine große Rolle.<br />
Nach IZAR steigert eine 20 Minuten dauernde Durchflutung mit 4-, 8-, 15-m-<br />
Wellcn das unspezifische Komplementbindungsvermögcnvon Normal- und Syphilitikerserum.<br />
Die Größe der Steigerung soll der Wellenlänge umgekehrt proportional sein. Dagegen<br />
werden das komplementäre Vermögen des Mecrschwcinchenscrums und die spezifische<br />
komplementbindcnde Fähigkeit des Syphilitikerserums nicht beeinflußt.<br />
In frischem Menschcnscrum 'wurde durch Wellenlängen von 4 und 8 m der<br />
Agglutinationstiter gegenüber Typhusbazillen erniedrigt; 1 j-m-Wellen waren dagegen<br />
wirkungslos.<br />
Im lebenden Körper scheint UKW-Durchflutung die Antitoxinbildung zu verstärken,<br />
wie NICOLAI und KRAINIK am typhus geimpften Kaninchen gezeigt haben.<br />
Diese Wirkung tritt nach den genannten Autoren besonders nach Durchflutung<br />
des Bauches, nur schwach dagegen nach Ganzdurchflutung auf (Einfluß auf die<br />
Milz?).<br />
Aus diesen Befunden läßt sich schließen, daß wir es im Kondensatorfcld nicht<br />
allein mit allgemeiner Erwärmung, sondern mit besonderen selektiv lokalisierten<br />
Wirkungen auf das Molekül zu tun haben müssen.<br />
Hierher gehören möglicherweise auch die Beobachtungen von RHEINBOLDT<br />
und HESSEL. Sie konnten im KW-Feld die Synthese von Selentrioxyd ausführen,<br />
die vorher mit den üblichen chemischen Mitteln nicht gelungen war. Gasmolekülc<br />
können demnach durch das KW-Feld in bestimmter Weise beeinflußt werden, so<br />
daß eine Reaktionsbeschleunigung zustande kommt.<br />
KRASNY-ERGEN erklärt dies physikalisch wie folgt: Sind in einem Feld kleine<br />
Teilchen vorhanden, so wirken die influenzierten Kräfte anziehend aufeinander<br />
und die Teilchen legen sich aneinander. Die zerstörende Wirkung der BROWNschen<br />
Molekularbewegung auf die Ketten ist wesentlich kleiner. Die Ketten werden<br />
im Linearfeld gebildet. Es entstehen aber im UKW-Bereich auch spontane<br />
Drehfelder um die Teilchen, oder Kombinationen von Dreh- und Linearfeldern.<br />
Das ursprünglich induzierte Feld gerät nämlich in Phasendifferenz zu Feldern, die<br />
von den Teilchen reflektiert werden. Diese Phascndifferenzen können beispielsweise<br />
bei 1 m Wellenlänge 90 0 betragen.<br />
7°
Das Auftreten von Drchfcldern ist für die UKW spezifisch und kann an Teilchen<br />
zu folgenden Wirkungen führen:<br />
i. An Stelle der Ketten können sich Platten bilden, zu denen sich die Teilchen ancinanderlagern.<br />
2. Die Geschwindigkeit der Sedimentation kann beeinflußt werden.<br />
3. Grenzflächenspannung und Struktur der Grenzflächen von Kolloiden können<br />
verändert werden. Das Gleichgewicht zwischen BnowNscher Molckularbewegung<br />
und Oberflächenaktivität wird verändert.<br />
Die Oberflächenspannung kann dadurch nur bei Kolloiden, nicht bei Flüssigkeiten<br />
verändert werden.<br />
4. Die Viskosität kann verändert werden, je nachdem sich Pcrlschnürc, Platten<br />
oder Wolken bilden, die nach Art des Feldes Deformicrungen nach DEBYE<br />
erfahren.<br />
j. Der Dispersionsgrad kann beeinflußt werden, und zwar entstehen durch Aneinandcrlagern<br />
der Teilchen Verschiebungen.<br />
SCHUETZ u.a. beobachteten solche Erscheinungen schon bei geringer Energie.<br />
Man wird bei der Erörterung der Frage, ob es sich um reine Wärmeerzeugung<br />
oder auch um andere Vorgänge handelt, immer wieder auf den Vorgang im Molekül<br />
zurückgreifen müssen. Letzten Endes ist ja jede Erwärmung eine Bewegung<br />
der Moleküle, und es ist nur eine Frage der Intensität und der Geschwindigkeit<br />
der Vorgänge, inwieweit das Gefüge des Moleküls dabei verändert werden kann.<br />
Chemische Veränderungen bei Kurzwellenfrequenzen sind unwahrscheinlich; es<br />
dürfte sich bei den beschriebenen Vorgängen meist um kolloidale Zustandsänderungen<br />
oder katalytische Wirkung handeln.<br />
Wenn versucht wird, einen Gegensatz zwischen Wärme- und spezifischer Wirkung<br />
zu konstruieren, so beruht dies auf falscher Fragestellung. Jede molekulare<br />
Bewegung muß sich schließlich als Wärme manifestieren. Die «spezifische» Wirkung<br />
ist also in gewissem Sinne nur eine besondere Art von lokalisierter Energie-<br />
Umwandlung, wobei zuletzt Wärme entsteht («Punktwärmc»). Es kommt eben<br />
nicht nur auf die Art der Umwandlung, sondern auf das «Wie» und «Wo» an.<br />
V. Das Spulenfeld<br />
Spulcnfeldcr wurden seit 1928 von ESAU und mir bezüglich ihrer Wirkung auf<br />
organische Stoffe untersucht.<br />
Im Spulenfeld eines 40-m-Sendcrs konnten deutliche Wirkungen hervorgebracht<br />
werden. Im Gegensatz zum Kondensatorfeld erwärmten sich gutleitende Stoffe besonders<br />
gut infolge der Wirbclströme ; Metalle konnten zum Schmelzen gebracht werden, ein Vorgang,<br />
der auch in der Industrie benutzt wird. Dagegen erwärmten sich organische Stoffe,<br />
wie Eier, Kartoffeln und Fleisch schwächer. Mäuse starben erst nach längerer Zeit als im<br />
Kondensatorfcld. Menschliche Gliedmaßen wurden in der Spule erwärmt.<br />
Große Spulen haben große Selbstinduktion, so daß man nur verhältnismäßig<br />
niedrige Frequenzen verwenden kann.<br />
Man benutzt deshalb bei der KW-Ganzbehandluug Spulen mit nur einer<br />
Windung, d.h. Schlingen, die um den behandelten Teil herumgelegt werden.<br />
71
KowARSCHiK hat später eine Methode zur Behandlung von Extremitäten im<br />
Spulenfeld entwickelt. Das bei seiner Versuchsanordnung beobachtete Verhalten,<br />
daß sich frei ins Spulenfeld gebrachte organische Substanzen relativ stärker erwärmten<br />
als Metall, kann auf kapazitive Wirkungen zwischen Spule und Dielektrikum<br />
zurückgeführt werden. Tatsächlich handelt es sich nicht um elektromagnetische<br />
Felder, sondern um eine Modifikation des Kondensatorfeldcs: Die innere<br />
Metalloberfläche der Spule bildet den einen, die Körperoberflächc den anderen<br />
Belag eines Kondensators. Die einzelnen Windungen der Spule können als hintereinandergeschaltete<br />
Kondensatorbeläge betrachtet werden.<br />
KOWARSCHIK empfiehlt das Verfahren zur Behandlung ganzer Extremitäten.<br />
Dieses Verfahren hat sich nicht bewährt, es ist überflüssig und der Längsdurchflutung<br />
der Elektroden mit 2 Elektroden unterlegen.<br />
Zur örtlichen Behandlung kann auch die Flachspule verwandt werden, sie ist in<br />
USA unter dem Namen pancake coil eingeführt. Die Tiefenwirkung geht nur bis<br />
zur ersten gutleitenden Schicht, d. h. der Muskulatur, zur Behandlung tiefliegender<br />
innerer Organe sind diese Elektroden daher nicht geeignet (Abb.64-66).<br />
Abb. 64. Das Spulcnfeld überbrückt<br />
die oberflächliche<br />
Schichtgutund erzeugt Wärme<br />
in der nächsten Schicht (Muskulatur),<br />
hat aber keine tiefer<br />
gehende Wirkung<br />
ab<br />
T<br />
~L 1-<br />
> a<br />
A- Wtlltnlinçtn in m<br />
X-Lum'iQkiihn STari' 0<br />
A»6m<br />
img.<br />
!!|ll A-25m<br />
SfiVg<br />
I<br />
et<br />
in<br />
C° i<br />
X KT 1<br />
4' ,<br />
C" 1<br />
xm*<br />
ai<br />
*eflW J<br />
él<br />
in<br />
C*<br />
* 7Û' 1<br />
s m 1 E\m I ÏÏ m<br />
[ X 1 M. 1 1<br />
f¡r»ww* NT* £ «r*
Um genügende Energie und gute Resonanz in Spulcnfcldern erzeugen zu können, ist<br />
bei den meisten Geräten eine Zusatzspule nötig, die zum Behandlungskreis parallelgeschaltet<br />
wird.<br />
Eingehendere Untersuchungen über Spulenfelder verdanken wir PÄTZOLD. Die<br />
Art der Wirkung hängt von der Wellenlänge, der Größe des Objektes und der<br />
Windungszahl der Spulen ab. Je nach Zahl der Windungen erhält man mehr die<br />
Verhältnisse des Kondensatorfeldes oder der Wirbelstromheizung durch das<br />
elektromagnetische Feld. Die reine Wirbelstromwirkung erhalten wir im allgemeinen<br />
nur mit i — 2 Windungen. Auf Grund der Untersuchungen von PÄTZOLD<br />
wurde die Monode entwickelt. Sie besteht aus einer Flachspule, deren beide Enden<br />
lylinderspule.senkr., ebene Spiralspule, lylinderspule, lylinderspule,parallel<br />
symm. Speisung symm. Speisung parallel el. stal Schirm<br />
Spiralspule mit Ringzonenstrahler Stabantenne<br />
versetzten Windungen i, Reflektor ¡.Reflektor<br />
Abb. 66. F,nergievertcilung in Fett und Muskulatur bei Spulenelektroden<br />
und Mikrowellenstrahlen<br />
an die Pole des Kurzwellcngerätcs angeschlossen werden. Die Spule ist in einer<br />
Kapsel untergebracht, deren Boden auf den Körper aufgesetzt wird. Dabei ist<br />
zwischen Spule und Körper Oberfläche ein bestimmter Luftabstand eingeschaltet<br />
(Abstandsprinzip). Die Halbwcrtschicht beträgt ca. 3 cm. Wie PÄTZOLD in<br />
Modellversuchen gezeigt hat, ist hierbei die Tiefenwirkung anders verteilt als im<br />
Kondensatorfeld. Wir bekommen eine gute Überbrückung der Haut und des<br />
Unterhautfettgewebes, der Energieumsatz gebt aber fast ausschließlich in der ersten gutleitenden<br />
Schicht vor sieb, d.h. in der Muskulatur. Tiefer liegende Schiebten werden durch<br />
das Spulenfeld nicht mehr beeinflußt. Das Spulenfeld ist somit gut geeignet zur Behandlung<br />
von Prozessen im Bewegungsapparat (Rheumatismus, Arthritis usw.), nicht<br />
dagegen für Erkrankungen innerer Organe (Abb. 66)<br />
Bei der Anwendung elektrischer Wellen unter 2 m Wellenlänge wird sowohl<br />
mit dem Kondensatorfeld als auch mit dem Spulenfcld die Abstimmung schwierig.<br />
Man kann aber noch mit dem Kondensatorfeld behandeln, wenn man die Energie<br />
mit einem LECHER-System (S. 22) zuleitet und die Platten im Schwingungsbauch<br />
des Systems anbringt.<br />
73
Im Grund sieht die Anordnung ähnlich aus wie die gewöhnlichen Schwingkreise, der<br />
Schwingungsvorgang ist aber ganz anders. Die Kabel müssen vom Generator aus streng<br />
parallel geführt werden, was durch Klammern bewerkstelligt wird. Erst nahe am Kranken,<br />
wo es unbedingt nötig ist, werden die Kabel getrennt und in möglichst geringem Abstand<br />
zu den Elektroden geführt. Durch eine im Innern des Generators angebrachte Fortsetzung<br />
des durch die Kabel gebildeten LECtiER-Systems kann so abgestimmt werden,<br />
daß der Schwingungsbauch an den Elektroden liegt. Auf diese Weise beschränkt sich der<br />
eigentliche Schwingkreis auf den divergenten Teil der Kabel mit den Elektroden.<br />
VI. Die elektromagnetische Welle<br />
Mikrowellen<br />
Die Ausstrahlung sehr kurzer elektrischer Wellen geschieht am besten durch<br />
Dipole, die bereits beschriebenen stabförmigen Antennen. Ein zweiter solcher<br />
Dipol kann auf die Welle abgestimmt werden und stellt dann den Empfänger dar.<br />
«de-* -<br />
• £<br />
Mitte<br />
m<br />
Vf<br />
Ende<br />
S<br />
r"<br />
V K<br />
Müh des<br />
ftohre$<br />
0 3S 60 90 120 150 SSk 0 30 60 90 120 tek<br />
Abb. 67. Erwärmung in wassergefüllten Glasrohren als Empfangsantenne<br />
Anscheinend kann auch der menschliche Körper einen solchen Dipol darstellen und<br />
einen Teil der ausgestrahlten Schwingungsenergie absorbieren. Dies scheint mir<br />
z. B. aus folgenden Erscheinungen hervorzugehen : Tritt eine Person in die Nähe des<br />
Empfängers oder stellt sie sich in gleicher Entfernung vom Sender auf, so läßt sich<br />
ein deutlicher Rückgang des Stromes ¡m Empfangsgerät feststellen. Zum Nachweis<br />
braucht man nur ein Meßinstrument oder eine Glühlampe in den Verlauf<br />
des Empfangsdipols einzuschalten. Die Größe der betreffenden Fcrson spielt anscheinend<br />
dabei eine Rolle; der Stromrückgang ist verschieden, je nachdem man<br />
Kinder oder erwachsene Menschen in den Strahlungsbereich bringt. Auch wenn<br />
die Personen eine hockende Haltung annehmen, wird der Rückgang anders als bei<br />
aufgerichtetem Körper.<br />
Daß es sich dabei nur um einfache kapazitive Beeinflussung des Empfängers durch den<br />
Menschen handelt, ist unwahrscheinlich, da — richtige Wahl der Wellenlänge vorausgesetzt<br />
— die Erscheinung auch bei ziemlich großem Abstand zwischen Mensch und<br />
Empfänger eintritt.<br />
74<br />
m
Im Modellversuch lassen sich diese Verhältnisse dadurch nachahmen, daß man ein mit<br />
Gclatinclösung gefülltes Glasrohr von der halben Wellenlänge als Empfänger-Dipol benutzt.<br />
In der Lösung tritt dann eine Erwärmung auf, die am stärksten in der Mitte, der<br />
Stelle des Strombauchs, ist, während sich die Enden nur wenig erwärmen (Abb. 67).<br />
Wenn eine Versuchsperson mit beiden Armen einen Kreis macht, indem sich die<br />
Fingerspitzen der beiden Hände berühren, so werden in dem so gebildeten geschlossenen<br />
Schwingungskreis Schwingungen erregt. In der Nähe eines Senders mit geeigneter<br />
Wellenlänge tritt an den Bcrührungsstellcn der Finger starke Hitze auf; eine an Fassung<br />
und Spitze mit beiden Händen angefaßte Glimmlampe leuchtet. Dies ist nur der Fall,<br />
wenn der von den Armen gebildete Kreis mit dem Sendekreis parallel steht.<br />
Strahlenfeldbehandlung<br />
Bei den experimentellen Untersuchungen der Behandlungsmöglichkeiten im<br />
Strahlenfeld werden, wie schon erwähnt, Hohlspiegel benutzt, die mit einem Material<br />
mit möglichst hoher DK ausgefüllt sind. Die Dipolantenne befindet sich im Reflektor.<br />
(Abb. 68).<br />
! ca. Vz<br />
fietiung =¿=<br />
o « i —<br />
abgestimmte<br />
Heizleitung<br />
(für Hf gesperrt)<br />
> il<br />
- Sittervorspannung<br />
Abstimmung<br />
tJT?<br />
Jl_||i, iwischenkms<br />
m (induktiv gekoppelt'<br />
+Anoúe<br />
Antenne<br />
Reflektor<br />
Abb, 68. Prinzipschaltung eines Generators für Mikrowelle mit Antenne und Reflektor<br />
PÄTZOLD hat die Verhältnisse experimentell verfolgt. Er konnte in einem Wasscrmodell<br />
unter bestimmten Bedingungen in einem gewissen Abstand vom Reflektor<br />
ein Energiemaximum erzeugen. Hierbei wurden verhältnismäßig kleine Reflektoren<br />
angewandt, deren Öffnung nur ¡n der Größenordnung der Wellenlänge unter<br />
Wasser lag. Für Wellenlänge 107 cm gab ein Spiegel von 20 cm Durchmesser die<br />
besten Resultate. Ein halbkugclförmiger Reflektor ergab bessere Verstärkung als<br />
eine Kalotte.<br />
Der Grad der erzielten Verstärkungen geht aus den Abb.71—74 hervor. Die<br />
Verstärkung wird nicht, wie man vermuten sollte, durch Konvergenz der Strahlen<br />
in einem Fokus hervorgerufen, ihre Lage entspricht nicht einem Brennpunkt des<br />
Reflektors (etwa bei Ellipsenspiegel dem II.Brennpunkt); sie entsteht vielmehr<br />
durch Reflexionen und Interferenzen. Die Lage der Verstärkungszone wird weitgehend<br />
bestimmt durch die Lage des Reflektors zum Modell bzw. zur Körperoberflächc<br />
und vom Antennen-Scheitelabstand im Spiegel (s.S.71).<br />
Zur therapeutischen Anwendung eignen sich am besten Reflektoren aus keramischen<br />
Stoffen mit hoher DK (Condensa), weil beim Übergang der Welle aus einem<br />
Medium mit höherer DK die Reflexe an der Körperoberfläche gering sind. Beim<br />
7J
Anstrahlen aus Luft entstehen Reflexions Verluste. Nach Versuchen von SPILLER<br />
werden aber dabei noch recht gute Tiefenwirkungen erzielt.<br />
Nach SPILLER arbeitet man im Zentimeterwellengebiet bei Luftübertragung<br />
vor teilhafter weise mit parallelen Strahlen, bei Dezimeterwellen ist eine konvergente<br />
Einstrahlung günstiger.<br />
Abb. 69. Apparat zur Behandlung im Strahlenfeld. WL — 50 cm.<br />
(Nach G. SCHLIEPHAKE)<br />
Am Ende des strahlenden Dipols werden die Kraftlinien zusammengedrängt;<br />
dies läßt sich dadurch vermeiden, daß der Dipol eine Krümmung bekommt, so<br />
Dipol-ScheitehAbslana<br />
RffítkkU'<br />
Reffektorachse<br />
¿ »X<br />
ende-Dipol<br />
Empfänger<br />
Abb. 70. Schema eines Reflektors zur Behandlung im Strahlenfeld<br />
der elektromagnetischen Welle<br />
daß seine Enden weiter vom Objekt entfernt sind als die Mitte. Zweckmäßig wird<br />
ein Reflektordipol oder ein Spiegel in V4 WL Abstand hinter dem Dipol angebracht.<br />
Das Feld kann durch Glühlampen ausgetestet werden, die an 2 Dipolstutzen angelötet<br />
sind. Unsen müssen konkav sein, da die Phasengeschwindigkeit größer als<br />
76
die Lichtgeschwindigkeit ist, die Strahlen daher vom Einfallslot weg gebrochen<br />
werden.<br />
Die Keflexion an der Körperoberfläche ist bei in der Einfallsebene schwingendem<br />
elektrischem Vektor geringer, als wenn er senkrecht dazu schwingt. Die nicht<br />
reflektierte Strahlung wird in das Innere des Körpers hinein gebrochen, der<br />
Strahl wird vom Einfallslot weg abgelenkt, der Brennpunkt ¡st daher in das<br />
Innere der Körpersubstanz hineingezogen, d.h., er liegt tiefer als es dem Schnittpunkt<br />
der einfallenden Strahlen entsprechen würde.<br />
SPILLER fand bei Einstrahlung in Fett und Muskel folgende Verhältnisse der<br />
Erwärmung :<br />
Verhältnis der Erwärmung von Fett zu der von Muskel bei der Dipolfcldmethode<br />
und Vergleich mit der Kondensatorfeldmethode.<br />
WL cm x F/M =¡ M/F i= F/M -* F/M<br />
60<br />
2 5<br />
0,4:1<br />
0,14:1<br />
0,04:1 0,9:1 2,2:1<br />
A t Fett : A t Muskel<br />
Kondensatorfeld<br />
Parallelschal lung Reihenschaltung<br />
l:i 7:1<br />
0,z:i 3,5:1<br />
PÄTZOLD findet dabei, daß im geschichteten inhomogenen Dielektrikum keine<br />
Konzentration auf eine Brennlinie oder einen Brennpunkt möglich ist. An jeder<br />
Übergangsschicht von einem Gewebe zum anderen finden starke Brechungen und<br />
Reflexionen statt; es ist deshalb wichtig, daß die Schwingungsbäuche und -knoten<br />
an den richtigen Stellen liegen. Beim Eintritt in eine Schicht ist jeweils ein starker<br />
Energieumsatz vorhanden,<br />
der dann stark abfällt, so daß<br />
immer die Außenseite einer<br />
Schicht besonders stark erwärmt<br />
wird, so z.B. beim<br />
Übergang von Fett zu Muskel<br />
oderzu inneren Organen<br />
(Abb.72). Immerhin wird<br />
durch die Verwendung von<br />
Hohlspiegeln eine gewisse<br />
Bündelung der Wellen erreicht,<br />
so daß die Tiefenwirkung<br />
bei dieser Anordnung<br />
gut ist. Bei Mikrowellen<br />
wird in Zukunft nur<br />
mit diesem Verfahren gearbeitet<br />
werden können, da<br />
Schwingkreise therapeutisch<br />
nicht mehr angewandt werden<br />
können.<br />
Ski<br />
D<br />
-£<br />
r<br />
W<br />
., )2i 02 22 (-2 62 S 3 0 3, ! 3 t3 63<br />
Die Überbrückung des Fettes ist besonders gut, in der Muskulatur kann unter<br />
Umständen die vierfache Erwärmung gegenüber Fett entstehen, doch ist es bis<br />
jetzt nicht möglich, ein Temperaturmaximum in beliebiger gewünschter Tiefe<br />
,' 1<br />
1<br />
,<br />
N<br />
N<br />
\<br />
><br />
s<br />
\<br />
*<br />
*\<br />
\ \<br />
,<br />
V<br />
\ J<br />
\<br />
t<br />
h V<br />
s,<br />
Li<br />
f<br />
\<br />
s<br />
•^<br />
\<br />
V<br />
S,<br />
*s<br />
\<br />
r<br />
s<br />
N<br />
^ --. «*. ^ V<br />
i-<br />
e * 04 2 * * * 6 tu<br />
\~107cm<br />
w x/jrvM,<br />
1 i.w-to-<br />
J IT •»••<br />
t HS -tOI<br />
S WS tO'><br />
i toi-«-»<br />
: ¡ 1<br />
50 -*-«r<br />
Abb. 71. Verteilung der Energie des Strahlcnfeldes in<br />
Medien von verschiedener Leitfähigkeit längs der<br />
optischen Achse des Reflektors (PÄTZOLD)<br />
77
der Muskulatur zu erzielen. Wir haben in etwa die Verhältnisse, wie wenn Licht<br />
¡n stark getrübtes Wasser fällt.<br />
BÖNI und LOTMAR führten an toten Geweben vergleichende Messungen mit<br />
Mikrowellen von 16,8 und 17,2 cm WL im Kondcnsatorfeld und mit Wärmestrahlen<br />
aus. Nach ihnen beträgt die Reflexion an der Oberfläche ca. 60% der an-<br />
ôfa<br />
emio o 10 an<br />
Abb. 72. Verteilung der<br />
Energie des Strahlcnfeldcs<br />
in Fett quer zur optischen<br />
Achse des Hohlspiegels<br />
fallenden Strahlung. Die Absorption in Muskelgewebe ist sehr hoch, die Halbwertschiebt<br />
betrug bei ihren Messungen in Muskeln ca. 2 cm, in Nierenfett 1 cm,<br />
in spongiösen Knochen 3,5 cm. Die Absorption im Fett ist verhältnismäßig<br />
gering. Die Reflexion an der Grenzfläche Fett-Knochen ist gering, stark ist sie da-<br />
K<br />
¡.<br />
\<br />
' r<br />
d- \<br />
-U<br />
^<br />
\<br />
u LE-<br />
^: 5 T<br />
*S<br />
II<br />
7<br />
\<br />
\<br />
N<br />
•*. x L.<br />
Reflektor $ »25 cm<br />
s- 9cm<br />
1 Fettschicht 3.5 an<br />
2 * ' 1,scm<br />
Ret ektc raü se<br />
mmtm»&m : i : 8g&s%':(<br />
—<br />
2 3 5 6 8 3 10 IÍ T2 13 Cm<br />
Abb. 72. Beim Einstrahlen der<br />
elektromagnetischen Welle mittels<br />
Reflektor konzentriert sich der<br />
Encrgicumsatz an den Trennschichten<br />
(Muskel-Fett)<br />
gegen an Grenzflächen Fett-Luft und Fett-Muskulatur. Ausgeschmolzenes Nicrcnfett<br />
vom Rind läßt die Energie fast unverbraucht durch, ebenso Butter. Knochenmark<br />
erwärmt sich schwach und läßt die Energie gut durch.<br />
Sind Gewebe aufcinandcrgcschichtct, so wird die angestrahlte Energie zum Teil<br />
von den basalen Grenzflächen reflektiert; dagegen kann starke Erwärmung an der<br />
Grenzfläche auftreten, wenn die Schicht nicht zu dick ist (Muskeln 1—1 cm,<br />
Knochen bis 10 cm). In menschlichem Fett von j,j cm Dicke tritt ein Temperaturmaximum<br />
in der Nahe der Oberfläche und eines an der Basis auf, offenbar infolge<br />
von Interferenzen. Im Mark längsbestrahlter Röhrenknochen wurden mehrere<br />
Tempcraturmaxima gemessen.<br />
78
In einem dreischichtigen Modell Haut-Fett-Mus kein erwärmt sich Muskulatur<br />
wesentlich niedriger als Haut, was auf Reflexion in den Grenzflächen schließen<br />
laßt. Die Oberflächcnrcflcxion<br />
an Fett ist geringer als an der<br />
Haut ; die Erwärmung des Fettes<br />
war höher als erwartet, offenbar<br />
durch die reflektierte Energie.<br />
Bei Untersuchungen mit<br />
Mikrowellen stellten SCHARECK<br />
SOWÍCLADEBURG und SCHARECK<br />
fest, daß bei der Bestrahlung<br />
gesunder Menschen der Temperaturanstieg<br />
in der Muskulatur<br />
hoher ist als in Fettgewebe<br />
und Haut. Die Blutzirkulation<br />
wird stark erhöht, was bei längerer<br />
Dauer cinc Entwärmung<br />
der Gewebe zur Folge hat. In<br />
Grenzschichten kommen Reflexe<br />
vor. H. SCHWAN hat umfangreiche<br />
Untersuchungen<br />
zum Vergleich zwischen Mikrowellen<br />
und dem Kurzwcllcn-<br />
Kondensatorfeld angestellt. Er<br />
findet bei der Mikrowcllcntherapie<br />
starke Reflexionen an<br />
der Hautoberfläche und stellte<br />
für die Dosierung das Verhältnis<br />
r -f~ m ~ ! auf (r = Rcflcxkoeffizient,<br />
m = Koeffizient<br />
der Energieabsorption).<br />
Durch Multiplikation von m<br />
mit der Ausgangsleistung des<br />
Strahlers erhält man die biologisch<br />
wirksame Dosis. Die Absorption<br />
in den Geweben hängt<br />
wiederum von deren Dielektrizitätskonstanten<br />
ab. Diese sind<br />
in der Muskulatur weitgehend)<br />
konstant, im Fett schwanken sie<br />
stark je nach dem wechselnden<br />
Wassergehalt. Die Höhe der absorbierten<br />
Dosen schwankt auf<br />
Grund dieser wechselnden Matcrialkonstantcn<br />
besonders stark<br />
bei Frequenzen über 1000 MHz.<br />
C-Fetd<br />
KW-Therqp/e<br />
(-Feld<br />
KW-Therapie<br />
S- Feld<br />
Mikrowellen-<br />
Tharapla<br />
iKnoOtttt Muiktl tfrih<br />
Abb. 73. Wärmeverteilung in einem Modell im<br />
Verglcichsversuch mit Kondcnsatorfcld, Flachspule<br />
und Strahlenfetd<br />
K> mm t/M<br />
20 mm f/M<br />
SO mm F/Af<br />
« mm T/M<br />
Abb. 74. Durch Veränderung des Abstandes zwischen<br />
Strahlen und Hautoberfläche ändert sich die<br />
Tiefenwirkung und die Energieverteilung in Fett<br />
und Muskel<br />
H. SCHWAN empfiehlt deshalb die Anwendung von Frequenzen unter 1000 MHz<br />
als biologisch günstiger.<br />
RAE, HERRICK, WAKIM und KRUSEN fanden die Erwärmung in der Muskulatur<br />
79
ei vergleichsweiser Anwendung von Kondensatorfeld und Mikrowellen fast<br />
gleich. In tiefer gelegenen Organen wurden keine Messungen ausgeführt. In<br />
Wasser fanden KRUSEN und Mitarbeiter eine 70oomal so große Absorption der<br />
Mikrowellen als bei Wellen von 27 MHz.<br />
Bei Bestrahlungen von Tieren kam es nach einiger Zeit zum Wärmetod. Bei<br />
schwächeren Durchflutungen wurden Temperaturerhöhungen in den bestrahlten<br />
Körpergegenden beobachtet, die sich nicht ausglichen, so daß die Temperatur in<br />
einzelnen Körpergegenden verschieden war. Das entspricht Beobachtungen, die<br />
E. SCHLIEPHAKE 1932 beschrieben hat. Bei Bestrahlungen des Bauches mit starker<br />
Dosen kann ein Syndrom auftreten, das dem Verbrennungsschock ähnlich ist. Die<br />
20 30<br />
Minuten<br />
Abb. 75. Einfluß der Mikrowellen auf Blutzirkulation und Temperatur<br />
der verschiedenen Gewebeschichten.<br />
Jeder Punkt ist der Durchschnitt von 26 Beobachtungen (nach GERSTEN).<br />
(Aus «Arch. f. phys. Therapie», 3.Jahrg., 19JI, S.169}<br />
Augen sind besonders empfindlich gegen Mikrowellen. Manche Schäden treten<br />
erst nach einigen Tagen in Erscheinung. Solche Schäden am Auge beruhen auf<br />
Wärmestauungen infolge mangelnden Temperaturausgleichs.<br />
Nach Tierversuchen von HINES und RANDALL tritt der Tod nach Mikrowellenbestrahlung<br />
nur durch Überhitzung ein. Durch Bestrahlung der Magengegend<br />
von Tieren können starke allgemeine Temperaturanstiege auftreten, ohne daß<br />
diese durch orale und rektale Messungen festzustellen sind (ähnliche Beobachtungen<br />
hat SCHLIEPHAKE 1932 veröffentlicht). Der Tod kann unter Syndromen<br />
auftreten, die denjenigen bei Verbrennungsschock oder traumatischem<br />
Schock ähnlich sind. Die Augen sind für Mikrowellen sehr empfindlich, Schäden<br />
können manchmal erst nach Tagen in Erscheinung treren. Bei Bestrahlungsversuchen<br />
mit 3 cm WL stellten sich Schäden zum Teil erst nach 60 Tagen ein.<br />
Durch engmaschige Drahtnetze können die Augen und andere Organe gegen die<br />
Strahlen geschützt werden.<br />
Die i-m-Welle scheint besonders günstige Verhältnisse für die Anwendung des<br />
Strahlenfeldes zu bieten; bei noch kürzeren Wellen wird die Streuung größer, die<br />
Möglichkeit der Erziclung eines Maximums daher geringer.<br />
Die Mikrowellen dringen, auch wenn sie durch Luft auf den Körper gestrahlt<br />
werden, verhältnismäßig gut ein. Die Halbwertschicht bei 12,5 cm WL wird von<br />
mehreren Autoren mit 1,2 bis 1,5 cm angegeben. Die biologischen Wirkungen<br />
bestehen hauptsächlich in Zunahme der Blutströmung, wie sich aus Abb. 75 von<br />
80
GERSTEN, LADEBURG und SCHARECK entnehmen läßt. Diese Zunahme ist auch nach<br />
Durchschneidung der hinteren Wurzeln und der vegetativen Nerven zu beobachten.<br />
Im Bereich zwischen 1,6 m und ; cm Wellenlänge nimmt die Tiefenwirkung nach<br />
den kürzesten Wellen hin ab (BOYLE, COOK, und BUCHANAN; MURPHY, PAUL und<br />
HINES; SEGUIN, CASTELAIN und PELLETIER; SEGUIN und PELLETIER; MARTIN und<br />
ERICKSON; SPILLER; GJERTZ; KEMP, PAUL und HINES).<br />
Eine therapeutische Über<br />
legenheit der Mikrowellen Ä$ 70<br />
gegenüber dem Kondensatorfeld<br />
hat sich bis jetzt nicht herausgestellt.<br />
Die therapeutischen Wirkungen,<br />
die mit den Mikrowellen<br />
erzielt werden können, sind die<br />
gleichen wie im Kondensatorfeld.<br />
Verschiedenheiten der Wirkung<br />
beruhen lediglich auf der<br />
anderen Verteilung des Feldes<br />
und dem Verlauf der Kraftlinien.<br />
Zusammengefaßt ist über die<br />
Wirkungen der Mikrowellen zu<br />
sagen : Die Mikrowellcntherapie<br />
hat grundsätzlich dieselben bio<br />
logischen Wirkungen wie die<br />
Behandlung mit etwas längeren<br />
Wellen im Kondensatorfcld. Sie<br />
ist da am Platze, wo es auf eine<br />
möglichst geringe Erwärmung<br />
von Haut und Fett bei starker<br />
Erwärmung der Muskulatur<br />
ankommt (sog. Fettcntlastung).<br />
Die Muskeln werden stärker<br />
.§<br />
60<br />
50<br />
1«<br />
."£ 30<br />
§.20<br />
0:5 o<br />
7<br />
Co 6<br />
i<br />
5<br />
I 3<br />
2<br />
^ 1<br />
ib<br />
Muskel<br />
Subcuhô<br />
Haut<br />
10 15 20 25 30<br />
Minuten<br />
Abb. 76. Einwirkung auf Blutzirkulation und Erwärmung<br />
verschiedener Gcwebcschichsen. Die Biutzirkulation<br />
wurde j Minuten nach beendeter Einstrahlung<br />
gemessen, die Temperaturen im Gewebe<br />
eine Minute danach. Höhe jeder Säule entspricht dem<br />
Durchschnitt von 26 Beobachtungen (nach LADE<br />
BURG u. SCHARECK). (AUS «Arch. f. phys. Therapie«,<br />
3. Jahrg., 1951, S.169)<br />
erwärmt als Haut und Fettgewebe. Dieses Verhältnis hängt stark von der<br />
angewandten Wellenlänge ab, und zwar ist es am günstigsten bei Wellenlängen,<br />
die um 1 m herum liegen. Sowohl bei längeren als auch bei kürzeren Wellen wird<br />
die Erwärmung des Fettes im Verhältnis wieder größer. Bei etwa 1 m Wellenlänge<br />
ist das Verhältnis der Erwärmung Haut : Muskel etwa wie 1 : 4, bei 12 cm<br />
WelJenlängc liegt es bei 1 : i. Im Muskelgewebe fällt die Wärmewirkung nach<br />
der Tiefe hin stark ab. Bei einer 12-cm-Welle ist die Halbwertschicht in Muskel<br />
nur etwa 1 cm, bei Wellen um r m Länge liegt sie bei 2 cm. In Fett ist die Halbwertschicht<br />
mit etwa 7 cm wesentlich größer. In geschichteten Medien, wie sie im<br />
menschlichen Körper vorhanden sind, können durch Reflexionen und stehende<br />
Wellen Verdichtungen der Energie eintreten, die unkontrollierbar sind, insbesondere<br />
in Trennschichten zwischen Fett und Muskulatur. Bei den zur Therapie<br />
angewandten Energien sind aber Verbrennungen in der Tiefe der Gewebe durch<br />
solche Verdichtungen nicht zu befürchten.<br />
81
VII. Physiologische und pathologische Wirkungen auf Tiere<br />
und Menschen<br />
i. Einflüsse auf das Allgemeinbefinden<br />
a) Im Strahlungsbereich von Kurzwellensendern<br />
Bei manchen Menschen, die in der Nähe von Kurzwellensendern arbeiten,<br />
treten manchmal leichte Störungen im Allgemeinbefinden auf, die sich nur aus<br />
einer Einwirkung der elektromagnetischen Ausstrahlung erklären lassen. Es handelt<br />
sich dabei im wesentlichen um subjektive Beschwerden; organische Schäden<br />
sind in keinem Fall nachgewiesen worden.<br />
Die Beschwerden, die von den einzelnen Personen angegeben werden, sind ziemlich<br />
verschiedener Art. Auch die Empfindlichkeit einzelner Menschen ist verschieden; während<br />
manche schon sofort beim Einschalten des Senders unangenehme Empfindungen<br />
haben, treten bei anderen erst Beschwerden nach täglich fortgesetzter mehrstündiger<br />
Beschäftigung an ungeschützten Sendern auf.<br />
Oft werden die Empfindungen im Kopf lokalisiert. Zunächst tritt manchmal das Gefühl<br />
eines eigenartigen Ziehens in der Stirn und der Kopfhaut auf; bei manchen Personen ist<br />
die Empfindlichkeit so groß, daß sie bei Betreten des Behandlungsraumes ohne weiteres<br />
angeben können, ob der Sender in Betrieb ist oder nicht, wobei selbstverständlich irgendwelche<br />
Gehörs- oder Lichterscheinungen vom Sender ausgeschlossen sein müssen. Bei<br />
längerem Aufenthalt im Strahlungsbereich eines Senders tritt dann meist Müdigkeit ein.<br />
Schließlich können sich Erscheinungen zeigen, wie wir sie an Neurasthcnikcrn zu sehen<br />
gewohnt sind: Unruhe, Aufgeregtheit, unter Umständen auch Angstgefühle und Pessimismus;<br />
abends fällt meist das Einschlafen schwer, die betreffenden Personen schrecken<br />
aus dem Schlaf auf. Morgens früh besteht dafür Mattigkeit, Zcrschlagenheit und Unlust.<br />
Bei weiterer fortgesetzter Einwirkung stellen sich dumpfer Druck im Kopf und Kopfschmerzen<br />
ein.<br />
Diese Empfindungen werden am meisten beschrieben, gelegentlich werden aber auch<br />
ziehende Empfindungen in Armen und Beinen sowie im Nacken angegeben, von anderen<br />
Personen wird über gürtelartige Gefühle in der Oberbauchgegend geklagt. Psychisch<br />
werden Depressions- und Minderwertigkeitsgefühle beobachtet, dabei Neigung zu<br />
Lamentieren und Streitsucht sowie oft auch eine gewisse Unsicherheit im Umgang mit<br />
anderen Menschen. Alle diese Beschwerden verschwinden aber nach kurzer Zeit vollständig.<br />
Etwa zugleich mit uns soll WHITNEY, ein Ingenieur aus Schenectady, ähnliche Beobachtungen<br />
gemacht haben. Es bestehen aber hierüber nur viel spätere und wenig genaue<br />
Literaturangaben.<br />
Die modernen Apparate sind so geschützt, daß irgendwelche unliebsamen<br />
Nebenwirkungen kaum zu befürchten sind.<br />
Wegen der Frage nach etwaigen bleibenden Schädigungen des Nervensystems<br />
sei noch erwähnt, daß alle die beobachteten Störungen schon nach kurzem Aussetzen<br />
der Tätigkeit am Sender wieder zurückgegangen sind. 6-8 Tage genügten<br />
hierzu vollkommen, selbst wenn die Beschwerden schon sehr stark geworden<br />
waren. Die Beschwerden treten außerdem, wie schon erwähnt, nur bei schlecht<br />
geschützten Sendern für sehr kurze Wellen in deren nächster Nähe und bei starken<br />
Leistungen auf. Ein Teil der Beschwerden dürfte auf Veränderungen des Blutzuckers<br />
beruhen (s. S. 225ÍÍ.).<br />
LIDMAN und COHEN haben Soldaten der amerikanischen Armee untersucht, die<br />
82
jahrelang der Strahlung starker RADAR-Sender ausgesetzt gewesen waren, konnten<br />
aber keinerlei Schäden entdecken.<br />
Am Kaninchenauge wurde festgestellt, daß nach Bestrahlungen mit einer<br />
Leistungsdichte von 3 Watt/qcm nach 10 min langer Bestrahlung Trübungen der<br />
Linse auftraten. Diese Dosis überschreitet die therapeutisch anzuwendenden Feldstärken<br />
erheblich. Bei den therapeutischen Dosierungen sind Schäden am Auge<br />
nicht zu befürchten.<br />
BARRON und BARRAFF konnten bei 226 Menschen, die bis zu 13 Jahren der Ausstrahlung<br />
von Mikrowellen-S endern hoher Leistung ausgesetzt waren, keine Häufung<br />
irgendwelcher krankhafter Störungen finden. Blutbilder, Nerven- und Kreislaufsystem<br />
wurden laufend kontrolliert.<br />
Die allzu starke Ausstrahlung der Sender läßt sich außerdem durch Metallkäfige<br />
verhindern, und die Personen können durch geeignete Kleidung weitgehend<br />
geschützt werden.<br />
b) Im Kondensatorfeld<br />
Bei der Behandlung im Kondensatorfeld werden etwas andere Angaben gemacht.<br />
Allgemein tritt bei der Behandlung beliebiger Körperteile eine auffallende Schläfrigkeit<br />
auf, manche der Kranken schlafen während der Behandlung ein. Die Empfindungen<br />
im Verlauf der Behandlung sind durchaus angenehm. Bei Behandlung<br />
des Kopfes kann allerdings nach längerer Zeit eine eigenartige Benommenheit auftreten<br />
sowie ein Gefühl in der Kopfhaut, das an leichte Anästhesie erinnert. Die<br />
anästhesierende Wirkung selbst schwach dosierter Kurzwellenfelder wird besonders<br />
von DAUSSET betont, der darin eine spezifische Wirkung sieht, während<br />
JÖRNS sie auf Wärme allein zurückzuführen sucht. Schwindelgefühlc werden nur<br />
ausnahmsweise, besonders bei einseitig verstärkter Durchflutung der Ohren- und<br />
Felsenbeingegcnd, beobachtet.<br />
Feldwirkung in nächster Nähe des Auges hat oft Tränenreiz zur Folge.<br />
An der im Kon densa torfeld selbst behandelten Körperstelle hat man bei Anwendung<br />
nicht allzu hoher Energie nur das Gefühl einer angenehmen Erwärmung.<br />
Erst bei höheren Energien treten unangenehme Empfindungen auf, die verschieden<br />
lokalisiert werden. Steht die eine Kondensatorplatte der Körperoberfläche<br />
sehr nahe, so können hier Hitzeempfindungen ausgelöst werden; bei weiterer<br />
Entfernung dagegen wird die Empfindung mehr ins Innere der Körperteile verlegt.<br />
Das Gefühl ist vielleicht dem ähnlich, das nach Quetschungen aufzutreten pflegt,<br />
oder wenn das betreffende Glied längere Zeit hindurch einem Druck ausgesetzt<br />
worden war; von manchen wird auch ein Stechen angegeben. Es handelt sich<br />
jedenfalls um eine durchaus eigenartige Empfindung, die ihren Sitz in der Tiefe<br />
der Körperteile hat. Sie wird bei großen Feldstärken derart unangenehm, daß man<br />
sofort aufhören muß.<br />
Die Geringfügigkeit der V/ärmeempfindung dürfte ihre Ursache darin haben, daß die<br />
• Stärke der Wahrnehmung wesentlich vom Wärmegefälle von der Oberfläche der Haut nach<br />
innen abhängt. Ist die Tiefenerwärmung stark, die Erwärmung der Oberfläche dagegen<br />
gering (also bei großer relativer Tiefendosis), so tritt - abgesehen von sehr großen Dosen<br />
- nur geringes Hitzegefühl ein.<br />
Personen mit sehr fein ausgebildetem Tastsinn empfinden an den ins Kondensatorfcld<br />
gehaltenen Fingern mitunter ein feines Vibrieren, das offenbar den<br />
50 Perioden des Wechselstroms entspricht, mit dem der Apparat betrieben wird.<br />
c-<br />
83
Dieses Vibrieren konnten wir auch im Brennpunkt eines Ellipsenspiegels beobachten.<br />
In einem Brennpunkt stand dabei eine mit dem Sender gekoppelte Antenne,<br />
im anderen Brennpunkt die Versuchsperson mit in Kopfhöhe nach vorn<br />
gestreckten Händen. Die Wellenlänge betrug bei diesem Versuch 3 m.<br />
Alle diese Erscheinungen sind schwer zu fassen. Durch Bestimmungen der<br />
Chronaxie haben wir aber ein Mittel in der Hand, ihnen auch einen objektiv meßbaren<br />
Ausdruck zu geben.<br />
Nachdem V.KNORRE und ich schon 1931 Veränderungen der Chronaxie festgestellt<br />
hatten, haben sich DELHERM und FISCHGOLD später mit dieser Frage befaßt.<br />
Sie finden nach Kurzwellcndurchflutung von Extremitäten, aber auch<br />
nach gewöhnlicher d'Arsonvaüsation, Herabsetzung der Chronaxie im behandelten<br />
Gebiet.<br />
2. Allgemeinwirkungen auf Tiere<br />
a) Tötung kleinerer Tiere bei großen Feldstärken<br />
Die Wirkungen sehr starker Kondensatorfelder auf kleinere Tiere können so<br />
stark sein, daß der Tod in kurzer Zeit eintritt. Die erste von ESAU und mir beobachtete<br />
Erscheinung, die uns auf besondere Wirkungen des Kondcnsatorfeldcs<br />
hinwies, war das Absterben von Mäusen und Ratten im KurzweiIcnfeld. Etwas<br />
vor und unabhängig von uns hatte SCHERESCHEFSKY die tödliche Wirkung des<br />
KW-Fcldcs auf Mäuse festgestellt.<br />
Bei starken Sendern kann diese Wirkung in sehr kurzer Zeit eintreten; Fliegen<br />
fallen fast augenblicklich beim Einschalten des Stromes auf den Boden des Gefäßes,<br />
und Mäuse sterben innerhalb weniger Sekunden. In schwächeren Feldern<br />
oder bei etwas größeren Tieren verlaufen die Vorgänge langsamer und lassen sich<br />
infolgedessen gut verfolgen.<br />
b) Erzeugung krankhafter Zustände<br />
Schon beim Einschalten des Stromes erfolgt bei manchen Tierarten öfters ein<br />
Zusammenzucken, das aber nicht konstant zu beobachten ist. Besonders deutlich<br />
tritt es meist bei den auch sonst sehr sensiblen Ratten in Erscheinung. Da in so<br />
kurzer Zeit noch keine Wärmewirkungen angenommen werden können, die<br />
gleiche Erscheinung zudem auch manchmal beim Ausschalten auftritt, ist der Gedanke<br />
an spezifisch elektrische Ursachen nicht ganz von der Hand zu weisen.<br />
Im weiteren Verlauf der Behandlung sind die Tiere zunächst ruhig, nach kurzer<br />
Zeit tritt jedoch je nach der angewandten Feldstärke eine zunehmende Unruhe auf;<br />
die Tiere rennen hin und her und suchen sich immer so zu drehen, daß sie aus dem<br />
Feldbereich herauskommen. Sic geben dabei viel Wasserdampf ab, was sich durch<br />
das Beschlagen des Gefäßes bemerkbar macht.<br />
Besonders auffällig äußert sich das, wenn eine größere Anzahl von Fliegen in einem<br />
Glas dem Kondensatorfeld ausgesetzt wird. Die Tiere sammeln sich anfänglich im Feldbereich<br />
und ziehen sich dann immer mehr so auseinander, daß sie möglichst außerhalb<br />
des Feldbereiches kommen. Die Glaswände beschlagen dabei dick mit Wasserdampf, und<br />
man sieht andererseits deutlich, wie die Tiere infolge des Wasserverlustes zusammenschrumpfen.<br />
Schließlich fallen sie tot zu Boden.<br />
84
Bei kleinen Säugern fällt auf, daß sie an den Extremitäten zu bluten anfangen,<br />
besonders an den Pfoten, zwischen den Zähnen und an der Schnauze. Sowie sie<br />
sich beim wilden Herumrennen im Kasten nur wenig an der Schnauze stoßen, tritt<br />
meist sofort eine Blutung ein. Atmung und Herzschlag sind in diesem Zustand<br />
stark beschleunigt.<br />
Nimmt man die Tiere in diesem Stadium aus dem Kondensatorfeld wieder<br />
heraus, so sind sie schlaff und Hegen im ersten Augenblick mit ausgestreckten<br />
Gliedmaßen da. Werden sie aber durch irgendwelche Geräusche gereizt, so sind<br />
sie außerordentlich schreckhaft; wenn man z.B. an die Wand des Käfigs pocht,<br />
in dem sich die Tiere befinden, so springen sie oft hoch empor, während die nicht<br />
behandelten Tiere nur schwach reagieren.<br />
Wird die Behandlung weiter fortgesetzt, so werden die Tiere apathisch und<br />
liegen still da. Wenn sie im Beginn dieses Zustandes in Freiheit gesetzt werden,<br />
erholen sie sich wieder vollkommen; nach längerer Einwirkung dagegen sind sie<br />
nicht mehr lebensfähig und gehen je nach der Zeitdauer der vorangegangenen Behandlung<br />
in Minuten bis Stunden zugrunde. Läßt man die Tiere dauernd unter<br />
der Einwirkung des Feldes, so erfolgt der Tod nach kurzen terminalen Zuckungen.<br />
Bei der Obduktion zeigt sich dann eine außerordentlich starke Überfüllung des<br />
venösen Teils des Blutkreislaufs; besonders das rechte Herz ist prall gefüllt, während<br />
der arterielle Teil nicht sehr stark durchblutet ist. Über die anatomischen<br />
Schädigungen soll weiter unter berichtet werden.<br />
Daß wohl der größte Teil dieser Schäden durch Wärmezufuhr bedingt ist, scheint<br />
daraus hervorzugehen, daß der Tod bei dauernder Zufuhr kalter Luft später eintritt<br />
als in geschlossenen Gefäßen (REITER). Außerdem werden viel größere Feldstärken<br />
vertragen, wenn der Strom nicht kontinuierlich eingeschaltet bleibt, sondern<br />
wenn 10 Sekunden ein- und 10 Sekunden ausgeschaltet wird, so daß Zeit zur<br />
Entwärmung bleibt.<br />
Die Folgen schwächerer, aber über längere Zeit fortgesetzter Behandlung hat<br />
PFLOMM untersucht.<br />
Von jungen Ratten, die dem gleichen Wurf entstammten, behandelte er einen<br />
Teil mit stärkeren, einen anderen Teil mit schwachen Dosen, während ein dritter<br />
Teil zur Kontrolle unbehandelt blieb. Die stärkeren Dosen wurden so gewählt,<br />
daß sich die Tiere jedesmal leicht wieder erholten und keine sichtbaren Schäden<br />
davontrugen.<br />
Selbst bei langdauernder Fortsetzung konnten bei den mit schwachen Dosen<br />
behandelten Tieren keinerlei Unterschiede gegenüber den normalen nachgewiesen<br />
werden. Größenverhältnissc, seelisches Verhalten und Fortpflanzungsfähigkeit<br />
waren genau wie bei den unbehandelten Kontrollen.<br />
Dagegen zeigte sich bei den mit starken Dosen behandelten Ratten während<br />
der Versuchsdaucr cinc gewisse Trägheit, sie waren psychisch gedrückt und blieben<br />
im Wachstum zurück. Innerhalb der Bcobachtungszeit von etwa 3 /4 Jahr erwiesen<br />
sich die Tiere als zeugungsfähig. Eine Förderung des Wachstums oder<br />
der Regenerationsfähigkeit bei schwach dosierter Behandlung konnten PFLOMM<br />
wie auch JÖRNS nie feststellen. KELLNER und KERESZTY durchfluteten infantile<br />
weibliche Mäuse mit verschiedenen Dosen. Die je 2 Minuten bestrahlten Tiere<br />
blieben im Körpergewicht um 14% gegenüber den Kontrollen zurück. Die sechsmal<br />
1 Minute lang bestrahlte Gruppe hatte ein um 8,7% erhöhtes Körpergewicht;<br />
der Östrus erschien durchschnittlich 4 Tage früher als bei der Kontrollgruppe.<br />
H. WITTE, STRATHMANN und E. HERTEL haben Drosophila-Puppen mit Ultra-<br />
Sí
kurzwellen in Impulsen von io- 5 sec. Dauer bestrahlt. Die Impulsleistung<br />
betrug 50 KW, was etwa 300 Watt bei kontinuierlichem Betrieb entspricht.<br />
Bei gleicher Wärmeerzeugung war die Abtötungsratc im Impulsbereich wesentlich<br />
höher als im kontinuierlichen Feld, obwohl die errechnete Temperaturerhöhung<br />
je Impuls im Tierkörper nur 0,0037 o betragen haben konnte. Die Verf. vermuten<br />
eine selektive Erwärmung lebenswichtiger Zentren der Puppen, denn durch die<br />
Impulse können an umschriebenen Punkten viel stärkere Energien konzentriert<br />
werden als beim kontinuierlichen Betrieb.<br />
HARMSEN durchflutete Ratten mehrerer Generationen lang bei einer Feldstärke<br />
von 77 V/m. In der Fruchtbarkeit und Lebensfähigkeit der Jungen traten keine<br />
Unterschiede gegenüber den Kontrollen auf, jedoch war das Geschlcchtsvcrhältnis<br />
zugunsten der Weibchen verschoben. Auch entwickelten die Tiere ein höheres<br />
Körpergewicht als die Kontrolltiere, insbesondere waren die Böcke schwerer. In<br />
der F2-Generation zeigten sich aber keine Abweichungen. Bei der Ausgangsgeneration<br />
ergaben sich geringe Unterschiede in der Kreatinin-Ausschcidung, in<br />
Wurfgröße und Wurfgewicht und im Fettgehalt, die sich in folgendenGcnerationen<br />
wiederum ausglichen. Schädigungen wurden nicht beobachtet.<br />
c) Wirkungen kleinster Dosen<br />
Dagegen gibt JELLINEK an, auch Wachstumsförderung gesehen zu haben. Er<br />
beobachtete die Einwirkung auf Papageieneier, die 14 Tage lang ununterbrochen<br />
dem Feld eines schwachen Senders (4 Watt) bei einer Frequenz von io 8 Hertz ausgesetzt<br />
wurden. Ein Teil der Eier war schon kurze Zeit vorgebrütet. In den<br />
durchfluteten Eiern entwickelten die Embryonen sich sehr rasch, in den vorbebrüteten<br />
Eiern ging die Entwicklung schneller vor sich als bei Kontrollen. Bei<br />
der geringen Leistung seines Senders nimmt JELLINEK an, daß eine wesentliche<br />
Erwärmung im Inneren der Eier nicht die Ursache dieser Erscheinung gewesen<br />
sein könnte.<br />
Bei frisch geworfenen Mäusen sah JELINEK zunächst eine auffallende Beruhigung ;<br />
während die unbehandelten Kontrolltiere unruhig umherliefen, bewegten sich die<br />
Mäuse im Kondensatorfcld viel langsamer. Bei täglich einstündiger Behandlung<br />
entwickelten sich diese Mäuse schneller als die Kontrollen und zeigten ihnen<br />
gegenüber stärkere Gewichtszunahme.<br />
V.ÖTTTNGEN konnte Ähnliches bei Pflan^enkeimlingen feststellen. Bei Bohnen<br />
ließ sich eine schnellere Entwicklung der behandelten Keime gegenüber den unbehandelten<br />
erkennen, die Pflanzen wuchsen kräftiger aus und wurden in der<br />
gleichen Zeit größer als die Kontrollen.<br />
Ob es sich bei dieser Gruppe von Untersuchungen um spezifisch elektrische<br />
Einflüsse handelt, kann vorerst nicht entschieden werden, da Wärmewirkungen<br />
nicht sicher ausgeschlossen erscheinen. Selbst wenn durch Messungen in solchen<br />
Versuchsobjekten keine allgemeinen Temperaturzunahmen nachgewiesen werden<br />
können, besteht doch immer noch die Möglichkeit einer clektiven Erwärmung<br />
lebenswichtiger Bestandteile, die für das Wachstum maßgebende Bedeutung haben.<br />
Wir hätten dann also das gleiche, was wir bei Erwärmung immer zu beobachten<br />
pflegen: fördernde Einwirkung von Temperaturen, die in der Nähe der Normaltemperaturen<br />
liegen, Schädigung bei zu starker Wärmezufuhr.<br />
86
3- Veränderungen im strömenden Blut<br />
Zu den allgemeinen Wirkungen gehören die Veränderungen im strömenden<br />
Blut. Die erste Mitteilung darüber stammt von v. ÖTTINGEN und SCHULZE-RHON-<br />
HOF. Sie untersuchten vor allen Dingen die Senkmgsgeschwindigkeit und das weiße<br />
Sofort<br />
Abb. 77. Veränderungen im strömenden<br />
Blut des Kaninchens bei<br />
Kurzwellcndurchflutung. (Nach<br />
v. ÖTTINGEN U. SCHULZE-RHON-<br />
HOF.) —— — Gesamtzahl der<br />
Leukozyten inemm; = Relative<br />
Zahl der Lymphozyten;<br />
= Relative Zahl der Pscudo-<br />
Eosinophilen; -hH = Relative<br />
Zahl der Monozyten. (Aus Zentralblatt<br />
f. Gynäkologie 1950,<br />
S.2248, Kurve II, Joh. Ambr.<br />
Barth, Leipzig)<br />
kOOO-<br />
3U00-<br />
Blut aus der Vene; Blut aus dem<br />
Finger; Blut aus dem Ohrläppchen<br />
Abb. 78. Durchflutung des Kopfes bei gesundem<br />
Menschen. Leukozyten-Bewegung<br />
16000 •<br />
17000 •<br />
1B000-<br />
15000-<br />
11.000 -<br />
1<br />
13000 •<br />
ñoco-<br />
•¡woo -<br />
.,<br />
"""--._<br />
--•"""<br />
„-'<br />
/<br />
,..-""<br />
..--'"<br />
no-<br />
Blut aus der Fingerbeere; Blut aus<br />
dem Ohrläppchen<br />
Abb. 79. Leukozyten-Provokation bei Kieferhöhlcnempyem<br />
und rote Blutbild bei Kaninchen. Die Blutkörperchensenkung wird nach v. ÖT<br />
TINGEN nach der Durchflutung zuerst beschleunigt und kehrt nach 1-3 Stunden<br />
zu normalen Werten zurück.<br />
Seitens der Erythrozyten sahen die Autoren ein uncharakteristisches Verhalten.<br />
Zwar fanden sie meist im Anschluß an die Behandlung eine Zunahme der Zahl in<br />
der Raumeinheit, doch konnten sie diesem Befund keine besondere Bedeutung<br />
beimessen, da immer eine Eindickung des Serums in Betracht gezogen werden<br />
muß. Für diese Auffassung wurde auch die Schrumpfung der roten Blutzcllcn ins<br />
Feld geführt, die sich nach Aufhören der Kurzwellenwirkung wieder zurück-<br />
87<br />
„,.
ildete. (Daß diese Verhältnisse beim Menschen offenbar etwas anders liegen,<br />
scheint aus unseren Ergebnissen S. 89 ff. hervorzugehen.) Gelegentlich fand sich<br />
auch ein Absinken der Erythrozytenzahlen mit nachfolgendem Anstieg.<br />
Im Gegensatz dazu standen die Beobachtungen, welche die beiden Forscher an<br />
den weißen Blutzellen machten; die Ergebnisse waren durchaus gleichartig, wie<br />
die ihrer Arbeit entnommene Abb. 77 zeigt. Bezüglich der Gesamtzahl fanden<br />
v. ÖTTINGEN und SCHULZE-RHONHOF immer schon wenige Minuten nach der Behandlung<br />
einen starken Abfall, der nach 1-3 Stunden in eine Hyperlcukozytosc<br />
umschlug. Die höchsten Werte wurden nach<br />
13000 •<br />
12000 •<br />
10000 • '<br />
8000 •<br />
1000 - > í --<br />
mo -<br />
- Blut aus der Armvcnc;<br />
Blut aus der Fingerbeere<br />
Abb. 80. Leukozyten-Kurven von<br />
UKW-Provokation des Bauches bei<br />
3 augenscheinlich gesunden Menschen<br />
etwa 3 Stunden erreicht, und erst nach<br />
9-24 Stunden stellten sich wieder normale<br />
Zahlen ein.<br />
Die anfängliche Bewegung ist, wie aus<br />
Differcntialzählungen der beiden Autoren<br />
hervorgeht, hauptsächlich durch einen<br />
Lymphozytensturz bedingt, der nach etwa<br />
1 Stunde beendet ist und von da ab allmählich<br />
zu den Normalwerten zurückkehrt. Dagegen<br />
erfährt die Gesamtzahl der Pseudoeosinophilcn<br />
(die den Ncutrophücn des<br />
Menschen entsprechen) gewöhnlich einen<br />
starken Anstieg, der bis etwa 3 Stunden anhält,<br />
mit anschließendem Abfall. Durch die<br />
sen Abfall ist somit der Sturz der Leukozytengesamtzahl<br />
zu dieser Zeit in der Hauptsache<br />
bedingt.<br />
Die Blutgerinnung fand sich kurz nach der<br />
Behandlung oft so stark gesteigert, daß die<br />
Blutentnahmen dadurch sehr erschwert wurden.<br />
Ein Zusatz von Natriumzitrat, der bei<br />
normalem Blut vollkommen zum Verhindern<br />
der Gerinnung genügte, konnte beim Blut<br />
der behandelten Tiere die Gerinnung nicht<br />
hintanhalten. Die rascheste Gerinnung wurde in dem etwa 1 Stunde nach der Behandlung<br />
entnommenen Blut beobachtet. Während des Verweilens der Tiere im<br />
Kondensatorf cid findet PFLOMM an Ratten zuerst eine Zunahme der Blutgerinnungszeit,<br />
bei längerer Einwirkung eine Abnahme, in Übereinstimmung mit v. ÖTTIN<br />
GEN. Nach Aufhören der Behandlung findet er wieder eine Verlängerung der<br />
Blutgerinnungszeit. Daß diese Gerinnungsveränderungen mit Schwankungen der<br />
Thrombozyten zusammenhängen, erscheint nach den Befunden von PFLOMM als<br />
unwahrscheinlich. Er fand bei Ratten nur ganz geringe Veränderungen der Blutplättchenzahlen.<br />
Wie ich feststellen konnte, wird die Blutgerinnungszeit verändert,<br />
wenn man die Hypophysengegend mit Kurzwellen durchflutet. Sie wird im Anfang<br />
oft so stark verkürzt, daß kein Blut aus den Kapillaren entnommen werden kann,<br />
und nach etwa 1 Stunde verlängert. Ebenso wird kurz nach der Durchflutung die<br />
Blutungszeit verkürzt.<br />
Bei Menschen ergibt sich nach den von NÖLLER durchgeführten Untersuchungen<br />
grundsätzlich das gleiche Verhalten. Fast sämtliche Kranke, die im Laufe eines<br />
Jahresin unsere Behandlungkamen, wurden auf die Veränderungen ihres Blutbildes<br />
88
hin untersucht. Die Veränderungen der Erythrozyten waren durchaus uncharaktcristisch;<br />
meist zeigte sich geringe Abnahme, manchmal auch Zunahme. Das<br />
letztere Verhalten war wiederholt besonders dann festzustellen, wenn die Brustorganc<br />
starken Feldern ausgesetzt worden waren.<br />
Die Leukozyten fielen nach Behandlung des Rumpfes und peripherer Gliedmaßen<br />
regelmäßig ab. Grundsätzlich anders war das Verhalten bei Behandlung<br />
des Kopfes. Hierbei verlief die Leukozytenbewegung oft umgekehrt, wir sahen<br />
Abb. 81. Wandstellung der Leukozyten in Blutgefäßen des durchfluteten Gebietes<br />
(PFLOMM)<br />
cinc Leukozytose. Bei diesen Untersuchungen ergab sich eine Abhängigkeit vom<br />
Zeitfaktor und vom Ort der Durchführung. Die Leukozyten wandern gewöhnlich<br />
zu der behandelten Stelle hin. An nicht behandelten Körpcrstcllcn ¡st die Bewegung<br />
meist umgekehrt. Die Befunde sind nicht konstant; sie hängen anscheinend<br />
stark von individuellen Faktoren ab. Auf jeden Fall haben allgemeine und<br />
lokale Durchflutungen verschiedene Wirkungen.<br />
Nach S. LANGE beeinflußt die Dauer der Behandlung die Stärke der Leukozytenschwankungen,<br />
nicht aber ihre Richtung. Im Venen- und Kapillarblut verlaufen<br />
die Schwankungen nur teilweise parallel, manchmal sind sie einander entgegengesetzt<br />
(Abb. 78). Die Leukozyten im Venenblut verhalten sich im allgemeinen<br />
so wie diejenigen im Kapillarblut des nicht durchfluteten Gebietes (Abb. 80).<br />
Im Verhalten der Monozyten, Basophilen, Eosinophilen wurden keine Gesetzmäßigkeiten<br />
erkannt.<br />
Die genannten Befunde wurden bestätigt von SCHULTZ, der Anstieg der<br />
Leukozyten in den durchfluteten, Abfall in den unbehandelten Gebieten fand.<br />
89
Schon PFLOMM war aufgefallen, daß in Schnitten von durchfluteten Geweben die<br />
Leukozyten sich stark in den kleinen Gefäßen, besonders in den Kapillaren, ansammelten<br />
und dort Randstellung einnahmen. FISCHER hat darüber experimentelle<br />
Untersuchungen an Meerschweinchen und Kaninchen ausgeführt. Er konnte<br />
an Hand zahlreicher Präparate zeigen, daß die Leukozyten sich nicht nur stark in<br />
den durchfluteten Gebieten anreichern, sondern daß auch besonders starke Diapedese<br />
in die Gewebe hinein einsetzt. Dies dürfte als Heilfaktor ganz besonders<br />
zu bewerten sein (Abb. 82).<br />
Abb. 82. Diapedcse von Leukozyten im Kurzwellen-durchflutcten Muskel<br />
vom Kaninchen (nach FISCHER)<br />
Diese Verhältnisse gelten nur bei Behandlung gesunder Individuen. Wie noch<br />
gezeigt wird (S. 256), verhält sich das Blutbild bei Durchflutung von Krankheitsherden<br />
anders, so daß daraus diagnostische Schlüsse gezogen werden können<br />
(heuko^y(enprovokation).<br />
Die refraktometrisch bestimmten Eiweißwerte an den durchfluteten Stellen<br />
erschienen zuerst erhöht, später vermindert. Es liegen aber noch zu wenige Untersuchungen<br />
in dieser Richtung vor, um Klarheit gewinnen zu können.<br />
Über die Zustandsändcrungcn einiger Bestandteile im Serum hat zuerst PFLOMM<br />
Untersuchungen ausgeführt.<br />
Er hatte bei Allgemcinbehandlung von Ratten eine Zunahme des Blutzuckerspiegels<br />
gefunden, die er dann auch bei Menschen nachwies. Die von ihm gefundenen<br />
Erhöhungen bleiben innerhalb der Fehlergrenzen und sind nicht bestätigt worden<br />
(WÜST). Er hatte ferner Aziditätsbestimmungen im Serum mit dem MiCHAELisschcn<br />
Komparator vorgenommen und kam in allen Fällen zu der Feststellung einer Zunahme<br />
der Wasserstoffionenkonzentration im Venenblut aus den behandelten Gebieten.<br />
Tm außerhalb des Körpers behandelten Serum glaubte PFLOMM eine Abnahme des pu<br />
festgestellt zu haben, was jedoch spätere Untersucher (v. NORDHEIM U. SCHLIEPHAKE)<br />
nicht bestätigten.<br />
In verschiedenen tierischen Geweben fand SCHLAG deutliche Veränderungen nach<br />
Kurzwellcndurchflutung. Bekanntlich sinkt in allen Geweben das pfl nach längerer<br />
Lagerung ab. Werden die Gewebe (Muskel, Leber, Lunge) bald nach dem<br />
Schlachten kurze Zeit durchflutet, und zwar so, daß keine Erwärmung über 1-2 0<br />
hinaus eintritt, dann verläuft der p[rAbfall in den nächsten 24-48 Stunden bedeutend<br />
steiler. In Vcrgleichsrcihen mit Einwirkung von Heißluft oder Wärmestrahlcn<br />
zeigte sich diese Veränderung nicht.<br />
90
v. NORDHEIM bestimmte in großen Versuchsreihen die Veränderungen der<br />
Wasserstoffionenkon^entration nach Durchflutung verschiedener Körperflüssigkeiten.<br />
In zollfreien Flüssigkeiten ändert sich das p(1 nicht meßbar. Chemische Umsetzungen<br />
im Serum kommen daher für die pH-Änderung nicht in Frage. In Eiter aus<br />
Abszessen dagegen wurde nach lurzdauernden Kurzwcllcndurchflutungen die<br />
Wasserstoffionenkonzentration stark erhöht. Dasselbe wurde mittels der Hämovennadel<br />
im strömenden Blut bei Menschen gefunden. Die Vermehrung der Wasserstoff<br />
ionen ist also an das Vorhandensein von Zellen gebunden. Es darf angenommen<br />
werden, daß im KW-Feld die Durchlässigkeit der Zellmembranen verändert<br />
wird, so daß die H-Ionen in größerer Zahl auswandern. Die Ursache hierfür ist<br />
260- *<br />
¿40<br />
220<br />
200<br />
180<br />
WO<br />
HO<br />
120<br />
'03<br />
60<br />
- Kopf-Durchflutung<br />
— — — — Pankreas gegend-Durchfiulung<br />
Obei Schenkel-Durch flu lung<br />
Aufgebunden ohne Durchflutunß<br />
Û l
Bei Behandlung der Leber kommt es nach ARCURI, WAKABAYASHI und SYMADA sowie<br />
ARCURI und MORGAÑO ZU folgenden Veränderungen im Blut:<br />
Zunahme Abfall<br />
Komplementtiter Leitfähigkeit des Blutes<br />
Viskosität von Blut und Plasma Viskosität des Serums<br />
Erythrozyten, Leukozyten K-Spicgcl im Blut<br />
Hämoglobin<br />
Rest-Stickstoff<br />
Blutsenkungsgeschwindigkeit<br />
Fibrinogen bis 42%<br />
Thrombozyten<br />
Bilirubin im Blut<br />
Histamin<br />
H-Ionengehalt<br />
Nach Durchflutung der Milz sah ich einen Anstieg des Cholesteringehaltes im<br />
Blut, offenbar infolge der stärkeren Mobilisierung des Prosplens der Milz.<br />
Die von JÖRNS festgestellten Veränderungen der Phagozytose, die S. 69 schon<br />
kurz erwähnt wurden, erscheinen besonders beachtlich im Hinblick auf die<br />
Therapie.<br />
Die Erhöhung trat zutage, wenn Leukozyten im Serum aufgeschwemmt dem Kurzwcllcnfcld<br />
ausgesetzt wurden, nicht dagegen bei Aufschwemmung in physiologischer<br />
Kochsalz- oder RiNGERScher Lösung. Sie ist andererseits vorhanden, wenn unbehandelte<br />
Leukozyten in ein Serum gebracht werden, das vorher der KurzwcIIcnwirkung ausgesetzt<br />
worden war. Daraus ist zu schließen, daß die Durchflutung Zustandsändcrungen<br />
im Serum bewirkt, die dann die Leukozyten zu verstärkter Freßtätigkeit anregen. JÖRNS<br />
sucht auch die Wirkungen auf Bakterien aus solchen Zustandsändcrungen der Nährböden<br />
zu erklären.<br />
An lebenden Tieren fand sich die Erhöhung des phagozytischen Index in<br />
gleicher Weise. Im übermäßig starken Kondensatorfeld ging sie allerdings wieder<br />
verloren, dann fand sich sogar oft eine Herabsetzung. Für das Verständnis der<br />
Heilungsvorgänge im Kurzwellenfeld bei verschiedener Dosis erscheinen diese<br />
Beobachtungen von sehr großer Bedeutung.<br />
Mit der Mikrowelle konnten wir bei kleinen Tieren die gleichen Blutzuckerveränderungen<br />
hervorrufen wie mit dem Kondensatorfeld, beim Menschen waren<br />
die Veränderungen kaum nachweisbar. Auch RUNE DIMBERG und I. ALMBORG<br />
fanden bei Menschen keinen Abfall der esosinophilen Zellen im Blut. Dagegen<br />
fanden sie in allen Fällen eine erhöhte Ausscheidung von Ketosteroiden (10-19%),<br />
nur bei einem Kranken mit endogener Depression cinc Minderausscheidung.<br />
4. Histologische Veränderungen<br />
Histologische Schädigungen, die durch überstarke Kurzwellcnfeider gesetzt<br />
wurden, sind von V.ÖTTINGEN und HOOK am Hoden untersucht worden. Sic behandelten<br />
Mäuse im Kondensatorfeld einerseits mit Energien, die noch keine unmittelbaren<br />
sichtbaren Schäden bei den Tieren hervorriefen, andererseits auch mit<br />
tödlichen Dosen. Im letzten Fall, also nach Tötung der Tiere im Kondcnsatorfcld,<br />
wird im wesentlichen nur cinc sehr starke Hyperämie mit Kapillarblutungen und<br />
Rhexisblutungcn aus Artcriolcn gefunden. Nur am Rand finden sich Nekrosen,<br />
9z
während die Spermiogenese unverändert bleibt. Das Protoplasma der Kanälchenepithelien<br />
weist Schrumpfungen auf. v. ÖTTINGEN und HOOK bezeichnen diesen Zustand,<br />
bei dem sich Verdichtungen und Lücken im Gewebe bilden, als Schmorung.<br />
Merkwürdiger sind die Befunde bei den chronisch behandelten Mäusen, die täglich<br />
einmal je iVa Minuten lang mit einer noch gut zu vertragenden Dosis behandelt<br />
worden waren. Diese Tiere wurden nach verschiedenen Zeitabständen<br />
getötet. Die Veränderungen, welche die Autoren feststellen konnten, erstreckten<br />
sich ¡c nach der Behandlungszcit von leichten Graden der Schädigung bis zu vollkommenen<br />
Nekrosen. Nach 6 Tagen bestand meist noch gute Spermiogenese; es<br />
traten einige Riesenzellen auf, wie sie auch STIEVE bei seinen Versuchen mit<br />
chronisch erwärmten Mäusen gefunden hat. Schon einen Tag später hatten die<br />
Schädigungen stark zugenommen. Nekrosen ganzer Kanälchen waren aufgetreten,<br />
und es fanden sich verkalkte Detritusmassen. Normale Zellen wurden kaum noch<br />
gefunden.<br />
Noch weitergehend waren die Schäden nach 9 Tagen, wo überhaupt nur noch<br />
die grobe Struktur eben erkennbar war. Nekrosen, Verkalkung und zahlreiche<br />
Ricsenzcllen kennzeichneten die schwere Zerstörung. Dagegen fand sich im Hoden<br />
einer Maus, die nur einmal behandelt und nach 14 Tagen getötet worden war, eine<br />
Vergrößerung des ganzen Organs mit Kapselverdickung. Neben geringen Verkalkungen<br />
in den oberflächlichen Schichten fand sich eine übermäßig starke<br />
Spermiogenese, die nach Ansicht der Autoren wahrscheinlich für einen Reizzustand<br />
des anfänglich geschädigten Organs spricht.<br />
Die zytologischen Veränderungen im Gehirn von Meerschweinchen nach<br />
Mikrowellen-Bestrahlung (10 cm) wurden von einigen USA-Autoren untersucht.<br />
Eine Temperatur von 45 o im Gewebe wurde nie überschritten. Es traten starke<br />
Veränderungen an der Zellsubstanz auf, wie Tigrolyse, Neuronophagic, besonders<br />
im Zwischenhirn. Die Beeinflussung des Zellstoffwechscls (festgestellt nach FEUL-<br />
GEN) ist nach Mikrowellen umgekehrt wie nach Infrarot. Die Permeabilität der<br />
Zellmembranen wird wahrscheinlich erhöht, der Gehalt der Zellen an Ribonukleinsäure<br />
sinkt ab.<br />
Je nach der Schwere der Kurzwelleneinwirkung finden sich also alle möglichen<br />
Stadien der Schädigung, die teilweise nach starker Einwirkung irreversibel sind,<br />
bei schwerer und nicht allzu langdauernder Schädigung aber zu kräftigen reparatorischen<br />
Vorgängen führen. Die Befunde von OSTERTAG am Gehirn, bei denen<br />
auch die Abhängigkeit von der Wellenlänge hervortritt, werden weiter unten<br />
(S. 103) behandelt.<br />
5. Wirkungen auf den Blutkreislauf<br />
Die Bedeutung der Kreislaufreaktion für die Heilungsvorgänge ¡st ja genügend<br />
bekannt, und gerade in dieser Hinsicht ist es auch von größter Wichtigkeit, die<br />
Einwirkung der Kurzwellen genau zu kennen. Hier hat besonders PFLOMM grundlegende<br />
Arbeiten geleistet, indem er die Reaktionen des peripheren Gefäßgebietes<br />
vor allem an der Schwimmhaut des Frosches untersuchte, weiterhin auch am<br />
Froschherzen die Beeinflussung der vegetativen Herznerven einer genauen Beobachtung<br />
unterwarf.<br />
An der Schwimmhaut tritt sofort nach Einschalten des Kondensatorfeldes eine<br />
schwache Kontraktion sämtlicher Blutgefäße auf, die aber nach einigen Sekunden<br />
wieder zurückgeht. Im Anschluß daran erfolgt eine starke Erweiterung besonders<br />
93
der Kapillaren. Auch die größeren arteriellen und venösen Gefäße beteiligen sich<br />
an der Erweiterung, wenn auch nicht in dem Maß wie die Kapillaren. Die Folge<br />
davon ist eine Beschleunigung des Blutstroms in den Arterien, dagegen starke<br />
Verlangsamung in den kleinen Venen und anschließend auch in den Kapillaren,<br />
die zuletzt Erweiterungen auf das 3-iofachc der Anfangsgröße aufweisen (Abb. 84).<br />
Schließlich tritt ein Stillstand des Blutstromes zunächst in den kleinsten Venen auf, der<br />
sich auf die größeren Venen und Kapillaren überträgt, bis ein pulsatorischcr Rückstrom<br />
aus den Venen ins Kapillargcbiet zustande kommt. Das Blut wird dabei lackfarben und<br />
dunkler, was PFLOMM auf ein Zusammenrücken der einzelnen Blutkörperchen bezieht;<br />
bei sehr starken Kurzwellcnwirkungen kann es zu Koagulationen und Nekrosen kommen.<br />
Abb. 84. Ein Kapillarsystem der Abb. 8j. Dasselbe System sofort nach<br />
Schwimmhaut vom Frosch Durchflutung. (2 = 4,50 m)<br />
Gefäßerwcitcrung an der Schwimmhaut des Frosches. Vergrößerung jyinal.<br />
(Nach PFLOMM)<br />
Wenn PFLOMM im Stadium des rückläufigen Stromes die Behandlung absetzte,<br />
so stellten sich nach einigen Minuten wieder normale Verhältnisse ein, wobei nur<br />
eine allgemeine starke Erweiterung der Kapillaren, eine geringere der Arterien<br />
und Venen bestehen blieb.<br />
Diese Erweiterung konnte nach schwachen Behandlungen noch nach 2-3 Tagen,<br />
nach Einwirkung stärkerer Felder noch nach 14 Tagen nachgewiesen werden.<br />
CiGNOLiNi hat durch seine Nachprüfung der PFLOMMschen Versuche festgestellt,<br />
daß diese Ergebnisse nur als ein Sonderfall der möglichen Reaktionen auf Kurzwellendurchflutung<br />
aufzufassen sind. Veränderungen, wie die von PFLOMM beschriebenen,<br />
treten nämlich nur bei starker Dosierung auf. Bei andersartiger<br />
Dosierung können dagegen Reaktionen ganz verschiedener Art und verschiedenen<br />
Grades auftreten. Schwache Dosen fähren %u Gefäßerweiterung durch Erregung der Diktatoren.<br />
Mittlere Dosen rufen Vasokonstriktion mit Verlangsamung des Blutstromes hervor,<br />
starke und stärkste Dosen können Veränderungen bis %u Ischämie und Stase nach sich<br />
Riehen. Hiernach kann nicht von einem allgemeinen Überwiegen der Vaguswirkung<br />
gesprochen werden. Vielmehr dürfte in manchen Fällen eine Steigerung der Erregbarkeit<br />
des Sympathikus im Vordergrund stehen.<br />
STOPPANI untersuchte die Gefäßwirkung der Kurzwellen mit dem Kapillartnikroskop<br />
im Vergleich zur Wirkung der LW-Diathermie und gewöhnlicher<br />
Wärme. Er fand, daß sich im KW-Feld hauptsächlich der arterielle Teil der Adern<br />
94
erweitert, während bei den anderen Anwendungen hauptsächlich der venöse Teil<br />
erweitert wird. Diese Gefäßerweiterung ist wahrscheinlich nicht spezifisch elektrisch,<br />
sondern durch die Mikroerwärmung hervorgerufen, wie Versuche von<br />
OLIVIERI gezeigt haben. Die Kurzwellen sind das einzige Mittel, das tiefgelegene Gefäßgebiete<br />
direkt beeinflussen kann.<br />
Dies zeigt sich auch in Untersuchungen von BACHEM, der freigelegte Organe<br />
von Tieren im K W-Feld durchflutete und danach eine starke Volumzunahme fand.<br />
Ähnliches beobachteten AJ. KOSMANN U. ST.L. OSBORNE sowie STROHL, DESGREZ<br />
U. RONCAYROL.<br />
Am lebenden Menschen läßt sich die Gefäßerweiterung durch Beobachtung des<br />
Augenhintergrundes zeigen (GLOZ) (Abb. 86). Fast unmittelbar nach dem Ein-<br />
Abb. 86a. Vorher Abb. 86b. io Minuten nach UKWD<br />
Abb. 86 a und b. Fall Schm. Man sieht auf Abb. b. sowohl die größeren wie kleineren<br />
Arterien schärfer gezeichnet und stärker reflektierend als auf Abb. a. Die Papille ist bei<br />
Abb. b. etwas grauer als Zeichen stärkerer Durchblutung (nach GLOZ).<br />
schalten eines Kondensatorfeldes quer durch den Kopf tritt zunächst Pulsation<br />
auf, dann erweitern sich die kleinsten Arterien, und es werden Gefäße sichtbar, die<br />
vorher nicht zu sehen gewesen waren.<br />
Es muß sich um eine zcntralnervöse Wirkung handeln, wofür auch das sehr<br />
rasche Auftreten der Reaktion spricht. Durch Erwärmung des Kopfes mit Heizkissen<br />
oder Wärmestrahler konnte die gleiche Reaktion niemals hervorgerufen<br />
werden. Hiermit ist die von KOWARSCHIK aufgestellte Behauptung ad absurdum<br />
geführt, daß alle Gefäßreaktionen in der Tiefe nur durch Erwärmung der Haut<br />
hervorgerufene kutiviszcrale Reflexe seien. Vielleicht spielt die von HILDEBRANDT<br />
gefundene Ausschwemmung von Histamin* dabei eine wesentliche Rolle. Das<br />
Histamin ist einer der hauptsächlichen intermediären Wirkstoffe für die Erweiterung<br />
der kleinsten Adern. Die Erweiterung der Blutgefäße in bestrahlten Extrcmi-<br />
Histidin<br />
CO—NH<br />
\<br />
N / >CH<br />
CH,<br />
CN (NH2)<br />
i<br />
COOH<br />
Histamin<br />
95
täten ist im Strahlenfeld einer 12,j-cm-Welle stärker als im UKW-Feld von Meterwellen<br />
(Abb.75, 76, S.80, 81).<br />
KUTTTG und SCHICK bestrahlten den Unterbauch von Patienten mit Mikrowellen<br />
und sahen im Cystoskop eine starke arterielle Hyperämie der Blasenschleimhaut<br />
auftreten.<br />
Aus weiteren Untersuchungen von PFLOMM scheint eine ionisierende Wirkung<br />
des KW-Feldcs auf den Vagus unter gewissen Bedingungen hervorzugehen.<br />
Abb. 87. Kurzwcllenwirkung auf die Tätigkeit des Froschherzens (PFLOMM). Obere<br />
Kurve vor der Durchführung, mittlere und untere Kurve während Durchflutung (Zeitscl.reibung<br />
je ; Sek.). 2 = 4,8 m<br />
Wurden Froschherzen in ENGELMANNschcr Suspension dem Kondensatorfcld<br />
ausgesetzt, so zeigte sich bald eine deutliche Verkleinerung der Exkursionen<br />
und eine Verlangsamung des Herzschlages. Auch diese Erscheinungen sind<br />
denjenigen bei einfacher Erwärmung gerade entgegengesetzt; während dabei<br />
bekanntlich gerade eine Beschleunigung und eine positiv inotrope Wirkung zustande<br />
zu kommen pflegen, entsprechen die Veränderungen im Kondcnsatorfeld<br />
deutlich der negativ chronotropen und negativ inotropen Wirkung, wie wir sie<br />
nach Vagusreizung sehen. Bei langdauernder Einwirkung des Kondensatorfeldes<br />
werden Frequenz und Herzkraft immer geringer, bis schließlich völliger Stillstand<br />
in Diastole erfolgt (Abb. 87).<br />
Daß es sich dabei nicht um irreparable Veränderungen im Herzmuskel handeln<br />
kann, ist dadurch einwandfrei erwiesen, daß die Herztätigkeit später allmählich<br />
wieder in Gang kommt.<br />
Nach Atropinvcrgiftung kamen diese Veränderungen des Herzschlages nicht<br />
zustande, was für die Annahme einer Vagusreizung durch das KW-Feld sprechen<br />
könnte. Beim Menschen kommt CIGNOLTNI durch röntgen-kymographische Untersuchungen<br />
zu ähnlichen Ergebnissen. Auf Grund seiner Untersuchungen nimmt<br />
LIEBESNY eine unmittelbare Wirkung der UKW auf die Herzganglien an. Die<br />
von PFLOMM beobachtete Steigerung der Dmndarmperistaltik bei Ratten im<br />
96
Kondensatorfeld dürfte in der gleichen Richtung verwertbar sein. Die günstige<br />
Beeinflussung der chronischen Obstipation spricht im gleichen Sinne.<br />
Nach HILL muß man aber annehmen, daß die Wirkungen auf das suspendierte<br />
Herz durch lokale Erwärmung an den Stümpfen des N. vagus und N. sympathicus<br />
hervorgerufen werden,<br />
LOTMAR erwärmte die Bauchhaut von Kaninchen durch Bestrahlung mit der<br />
17-cm-Welle bis 45 o und beobachtete die Auswanderung der Ionen. Die Durchlässigkeit<br />
der Haut wurde mit Isotopen — 35 S04 geprüft. Während Erwärmung<br />
mit warmem Wasser und Infrarot eine erhöhte Diffusion von Ionen hervorrief, war<br />
dies bei Mikrowellenbestrahlung nicht der Fall. Es ist daher nicht gleichgültig, ob<br />
eine Erwärmung durch Kontaktwärmc oder durch elektrische Wellen erzeugt<br />
wird. L. KIHN machte ebenfalls Untersuchungen über die Durchlässigkeit der<br />
menschlichen Haut unter dem Einfluß von Kurzwellen und fand, daß sich die<br />
Permeabilitätsänderungen anders verhalten als bei Erwärmung durch Kontakt oder<br />
strahlende Warme.<br />
6. Neivensystem<br />
Unsere Beobachtungen an Menschen, die sich lange Zeit im KW-Fcld befunden<br />
hatten (S. 84 ff), ließen daran denken, daß die nervöse Substanz in irgendeiner Weise<br />
beeinflußt würde. Auch die eben erwähnten Ergebnisse am Blutkreislauf sprechen<br />
für Änderungen der Erregbarkeit von Vagus und Sympathikus im behandelten<br />
Gebiet.<br />
NachÄRCHANGELSKY verfällt ein galvanisch gereiztes Nerv-Muskel-Präparat beim<br />
Einschalten des KW-Feldes in Tetanus, beim Ausschalten folgt ein Hemmungszustand.<br />
Ebenso gehen die durch Auflegen eines Kochsalzkristalles hervorgerufenen<br />
fibrillärcn Zuckungen im KW-Fcld in Tetanus über. Beim spinalen Frosch im<br />
tetanischen Reizzustand erfolgt im KW-Fcld Überhöhung der Kontraktionskurve,<br />
nach Exstirpation des Sympathikus bleibt sie aus. Der Effekt beruht nicht auf der<br />
ununterbrochenen Wirkung und der Menge der KW-Energie, sondern auf der<br />
elektrischen «Schlag»wirkung der Hochfrequenzenergie. Auch HILL und TAYLOR<br />
fanden Erhöhung der Erregbarkeit des Nerv-Muskel-Präparates, die bei starken<br />
KW-Doscn zum Tetanus gesteigert wird, doch wird dies durch unhomogene Erwärmung<br />
erklärt.<br />
DALTON beschreibt dagegen bei Durchflutung mit sehr geringen Energien am<br />
Nerv-Muskcl-Präparat Verlängerung der Latenzzeit nach elektrischen Reizen, Verminderung<br />
der Zuckungsamplitude und Verkürzung der Kontraktionsdauer. Erwärmung<br />
mit RiNGER-Lösung hatte gegenteilige Wirkung.<br />
Schon im Anfang unserer Arbeiten hatten wir unsere Aufmerksamkeit regulatorischen<br />
Vorgängen zugewandt, und in Anbetracht der durch Kurzwellen hervorgerufenen<br />
starken Wärmeerscheinungen erschien eine Untersuchung des Einflusses<br />
auf die Tcmpcraturrcgulicrung als besonders beachtenswert.<br />
Weiter oben ist erwähnt worden, daß sowohl bei Tieren wie bei Menschen Steigerungen<br />
der gesamten Körperwärme nach Behandlung im Kondensatorfeld hervorgerufen<br />
werden können. Bei rektaler Messung fanden sich bei Meerschweinchen<br />
nach 1-2 Minuten langer Einwirkung eines starken Kondensatorfcldes Temperaturerhöhungen<br />
um 3-4 0 (Abb.88), bei Kaninchen wurden Temperaturen von<br />
40-41° in wenigen Minuten erreicht. Auch bei Menschen lassen sich Temperaturen<br />
bis 42,5° erzielen (s. Elektropyrcxie).<br />
97
Wird die Überwärmung immer weiter getrieben, dann versagt ganz plötzlich<br />
die Wärmeregulierung. Während die Temperaturkurve zunächst nach oben im konvexen<br />
Bogen ansteigt, kommt bei einem bestimmten Punkt ein plötzlicher steiler<br />
Anstieg, dem bald der Exitus folgt.<br />
Diese Steigerungen beruhen auf dem starken Bnergicumsat^ im Körper, der<br />
unter Umständen bis zu mehreren roo Kalorien betragen kann. Für den Ausgleich<br />
S.U. 26 e.u. 7.S. 8JT.<br />
J5Ji ' ' t ' i ' i i i i i i i i i i i !_<br />
*0 1530 SO SOMinut. 10 17ürjr 8 00 &*> S 09 3 M 10"° 1Q 36 f1°°'S 00 T? 00<br />
Abb. 88. Temperatursteigerung beim Meerschweinchen im Kurzwcllenfdd<br />
bei Behandlung der vorderen Körperhälftc. = After, Maul.<br />
Durchflutung 5.XL und 7.XI., 8°°-8 ls .<br />
(Aus Zeitschr. f. exper. Medizin, Bd. 66, S.258, Fig. 24, Julius Springer, Berlin)<br />
Abb. 89. Fieberkurve nach Behandlung der Nackengegend.<br />
(Aus Zcitschr. f. exper. Medizin, Bd. 66, S. 258, Fig. 23, Julius Springer, Berlin)<br />
dieser starken Zufuhr sorgt die Wärmeregulation, die hauptsächlich vom Zentrum<br />
aus gesteuert wird und sich peripher in überall verteilten Erfolgsorganen auswirkt.<br />
Versuche von RAJEWSKY und seiner Schule haben die große Bedeutung des<br />
Zustandcsdes Nervensfs/tms für die Erwärmung des Tierkörpers erwiesen. Der Anstieg<br />
der Wärme ist bei toten Tieren viel geringer als bei lebenden ; besonders lebhafte<br />
Tiere erwärmen sich rascher als träge. In Narkose erwärmt sich der Tierkörper<br />
ebenfalls viel langsamer und schwächer als sonst. Die lirwärmung des Körpers<br />
entsteht also offenbar nicht nur durch die direkt entstehende JOULESCIIC<br />
Wärme, sondern auch durch Anregung der Zelltätigkcit im KW-Feld.<br />
Daß anscheinend auch durch periphere Reflexe solche Regulationsvorrichtungen<br />
in Tätigkeit treten können, laßt sich daraus entnehmen, daß bei manchen Menschen<br />
98
an dem im Kondcnsatorfeld befindlichen Körperteil fast augenblickliches Schwitzen<br />
eintritt, oft schon bevor eine ausgesprochene Wärmeempfindung vorhanden ist.<br />
Bei Tieren geht die periphere Regulation meist etwas anders vor sich als beim Menschen,<br />
so daß an sich von Tierversuchen allzu weitgehende Schlüsse auf die menschliche Physiologie<br />
nicht ertaubt sind. Aber gerade beim Kaninchen ist doch manches ähnlich, so daß<br />
die Beobachtungen immerhin geeignet sind, auch über analoge Fragestellungen beim<br />
Menschen gewisse Aufschlüsse zu geben. Die Entwärmung erfolgt auch beim Kaninchen<br />
hauptsächlich durch die Haut, und zwar besonders an den Ohren, die durch ihre Größe<br />
und Fiächcnform hervorragend als Strahler geeignet sind. Beim Meerschweinchen dürfte<br />
ähnlich wie beim Menschen die Tätigkeit der ganzen Haut die Hauptrolle spielen.<br />
Daneben wird durch die Atmung eine größere Wärmemenge abgeführt, und<br />
wir sehen auch ganz allgemein bei den im Kondcnsatorfeld erhitzten Tieren eine<br />
starke Wasserdampfabgabe durch die Lungen. Durch den beschleunigten Herzschlag<br />
wird die Durchblutung der Gewebe und damit ihre Erwärmung gefördert.<br />
Atmung und Herzschlag sind daher stets auch bei Allgcmeinbehandlung stark beschleunigt.<br />
Die wichtige Rolle der Aimung für die Wärmeabgabe sieht man schon daraus, daß<br />
Tiere im Glaskasten stets viel früher zugrunde gehen als solche, die mit der frischen<br />
Außenluft in Verbindung stehen. Wie REITER gezeigt hat, vertragen Ratten die vielfache<br />
Feldstärke, wenn sie dauernd mit kalter Luft angeblasen werden.<br />
Um die lokalen Reaktionen und die Frage des allgemeinen Wärmeausgleichs<br />
durch Kondensatorbehandlung zu untersuchen, wurden Vorder- und Hinterhälfte<br />
von Meerschweinchen sowie die Nackengegend für sich dem Feld ausgesetzt. Die<br />
Temperaturen wurden während und nach der Durchflutung in Maul und After<br />
gemessen. Bei der Betrachtung der Fieberkurven (Abb.88, 89) sieht man, daß die<br />
Wärmeverteilung über den ganzen Körper verhältnismäßig langsam vor sich geht,<br />
was bei der Kleinheit der Tiere erstaunlich ist. Bei den beiden Tieren wurde nun<br />
die eine Körperhälftc behandelt, und zwar so, daß immer 10 Sekunden eingeschaltet,<br />
dann 10 Sekunden ausgeschaltet wurde. Dadurch ¡st es möglich, mit größeren<br />
Feldlcistungcn zu arbeiten als bei fortgesetzter Einwirkung.<br />
Bei Vergleich der beiden Bilder fallt zunächst auf, daß bei alleiniger Behandlung der<br />
Nackcngcgcnd sehr bald auch die Temperatur im Maul ansteigt, also ein weitgehender<br />
Ausgleich stattfindet, daß dagegen umgekehrt bei alleiniger Behandlung des Kopfes ein<br />
Ausgleich nicht nachweisbar ist. Auf eine Erklärung dieses Verhaltens, die vielleicht<br />
im anatomischen Bau zu suchen ist, muß hier verzichtet werden; es soll lediglich auf die<br />
Tatsache einer verschiedenartigen Wärmeverteilung bei Beeinflussung der Vorder- und<br />
Hinterhälften hingewiesen werden.<br />
Bemerkenswert ist in fast allen Kurven das Absinken der AUgcmeintcmpcratur<br />
nach der Behandlung. Gewöhnlich ist es so, daß an derjenigen Körperhälfte, an<br />
der die stärkste Erwärmung stattgefunden hatte, die Temperatur hinterher auch<br />
am stärksten heruntergeht ; für die Maultemperatur zeigte sich das allerdings stärker<br />
bei Behandlung der Nackengegend als des Kopfes selbst. Er hat den Anschein,<br />
als ob eine lokale Überkompensation stattfände.<br />
Die Analogie mit den pFLOMMSchcn Untersuchungen am Kapillarnetz liegt auf<br />
der Hand, und es ist durchaus möglich, daß das Wesen der genannten Erscheinungen<br />
in lokalen Krcislaufveränderungcn gesucht werden muß.<br />
In weiteren Versuchsreihen ließ sich zeigen, daß es möglich ist, Störungen der<br />
centralen Wärmeregulation durch das KW-Feld hervorzurufen. Diese Störungen<br />
sind von verschiedener Art je nach Stärke und Dauer der Fcldwirkung.<br />
99
Die Versuche wurden so ausgeführt, daß durch schmale Elektroden ein bandförmiges<br />
elektrisches Feld gebildet wurde, das die Nackengegend gewissermaßen<br />
quer durchschnitt.<br />
Um die Tiere genau in ihrer Lage zu erhalten, wurden Gipsbetten angefertigt, in denen<br />
die Tiere so gut wie unbeweglich stillgelegt werden konnten. Der Abstand der Elektroden<br />
wurde durch Elektrodcnschuhc verschieden weit eingestellt, gewöhnlich auf 2 cm<br />
beiderseits, da es auf die Tiefenwirkung ankommt. Bei solchen Versuchen müssen auch<br />
die Schwankungen der Körpertemperatur berücksichtigt werden, die schon durch das<br />
Aufbinden der Tiere einzutreten pflegen. Näheres darüber ist von STRASSBURGER und<br />
mir in Originalarbeiten mitgeteilt worden.<br />
20. Tj 1930 21. 22. 23. 2V. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.<br />
s30 60 gtO 35 11 W15 rfO 1Z00 g « „ « ?gJ0<br />
36.Í* 1 '
normal, doch blieb auch später noch eine starke Labilität bestehen; bei anderen<br />
blieb die Temperatur weiter erhöht, die Regulation schien im ganzen auf ein<br />
höheres Niveau eingestellt. Tagesschwankungen waren vorhanden, doch bewegten<br />
sie sich um einen Durchschnitt, der oft mehr als i Grad höher lag als vorher<br />
(Abb. 90). Diese Tiere waren auch noch längere Zeit<br />
etwas gedrückt und nicht so lebhaft wie die anderen. Sie<br />
wurden unsauber, besonders an den Hinterbeinen wurde<br />
das Fell struppig und war meist stark beschmutzt.<br />
Diese Tiere erkrankten zum großen Teil mehrere<br />
Wochen nach der im Kondcnsatorfeld gesetzten Schädigung<br />
und gingen dann ein. Bei der Sektion fanden sich<br />
immer ausgedehnte pneumonische Herde in beiden Lungen,<br />
eitrige Pleuritiden, manchmal auch Perikarditis.<br />
Bei der drittten Gruppe, die mit sehr starken Feldern<br />
behandelt worden war, erfolgte meist schon kurz nach<br />
der Behandlung eine Senkung der Körperwärme, die<br />
unter Umständen sehr bedeutend war. Abb. 91 gibt die<br />
Temperaturkurve eines solchen Tieres wieder, das mehrmals<br />
hintereinander durchflutet worden war.<br />
Schon nach der ersten Behandlung fällt hier die Tcm- Abb. 91. Temperatursturz<br />
peratur. Die weiteren Behandlungen haben den gleichen<br />
Erfolg, bis die Körperwärme unter 35° abgesunken ist.<br />
Schließlich erfolgt ein kurzer Fieberanstieg und nach<br />
einigen weiteren Stunden der Tod. Die Sektion ergab als<br />
Todesursache schwere Pneumonie und Pleuritis.<br />
«}J<br />
ty<br />
¡S.Q<br />
HO<br />
?. «<br />
H<br />
\<br />
y s<br />
/<br />
ose<br />
i<br />
là<br />
i<br />
Ä<br />
H il<br />
\<br />
\<br />
n<br />
V<br />
V 1<br />
1<br />
1<br />
~j<br />
«<br />
v<br />
12.<br />
lOraA<br />
t<br />
nach sehr starker Einwirkung.<br />
(Aus Zcitschr. f.<br />
exper. Medizin, Bd. 66,<br />
S. 260, Fig. 26, Julius<br />
Springer, Berlin)<br />
Bei dem Zustandekommen dieser Störungen spielt die Wellenlänge cinc Rolle. Eine<br />
10-15-cm-Welle erwies sich als nicht so wirksam wie die 4-m-Wellc.<br />
26. SC. 30. 2t 28. 28. 30. J.I.30.<br />
19<br />
13,5<br />
«3,0<br />
i/2,S<br />
12,0<br />
102i is f1os 2S vs 12» 13oo 1soo vi 16*s 18a<br />
00<br />
«'« ieoo<br />
I<br />
5 cm 1,ti'Amp. X» 3,80m<br />
1<br />
/<br />
I 1<br />
( ^-<br />
1<br />
«1,6<br />
11,0<br />
10,5<br />
10,0 i<br />
39,5<br />
33,0<br />
II<br />
v 1<br />
11<br />
I<br />
\\ 11<br />
1<br />
¥<br />
38,0 s t<br />
.g 3<br />
38,0<br />
"a<br />
pa 3\h<br />
r<br />
'H K<br />
.__<br />
dung<br />
%<br />
il HT<br />
-<br />
- — *^_<br />
_ ' * ' * •<br />
! A<br />
//<br />
Wjfc<br />
1/<br />
ut<br />
1<br />
t'a"<br />
\<br />
J<br />
\<br />
\<br />
1<br />
i \<br />
\<br />
\<br />
\<br />
,' ^ v<br />
• \<br />
s \<br />
Abb. 92. Erfolg von Heißluftbädern vor und nach Kopfbehandlung<br />
101
STRASSBURGER ist, auf meine Anregung, den Kurzwellenwirkungen auf die<br />
Wärmeregulierung noch weiter nachgegangen. Er untersuchte das Verhalten von<br />
Kaninchen in kalten und heißen Badern vor und nach der Behandlung im Kondcnsatorfcld.<br />
Dabei stellte er fest, daß sich bei denjenigen Tieren, bei denen keine besondere<br />
Störung der Körpertemperatur eingetreten war, auch die Reaktion auf<br />
diese Bäder nicht wesentlich geändert hatte. Die zweite Gruppe antwortete auf<br />
kalte Bäder mit einem viel stärkeren Temperatursturz als vor der Behandlung,<br />
ebenso war der Wärmeanstieg im Heißluftbad bedeutender und anhaltender<br />
Abb. 93. Reaktion auf Pyrifcr bei einem Kaninchen vor und nach Durchflutung von<br />
Gehirn und Medulla oblongata mit X = 3,50 m. Durchgezogene Linie: Temperatur im<br />
After. Gestrichelt: Temperatur im Maul<br />
(Abb.92). Noch weniger war die dritte Gruppe imstande, ihre Körpertemperatur<br />
gegenüber Veränderungen in warmer und kalter Umgebung zu schützen. Diese<br />
Tiere waren demnach durch die Behandlung dem poikilothermen Zustand angenähert.<br />
Auch hier finden sich verschiedene Varianten.<br />
lis gibt Schädigungen im Kurzwcllcnfcld, bei denen die Regulierung gegen Kälte erhalten<br />
¡st, im Schwitzbad dagegen die Wärmeanstieg übermäßig stark wird; auch das<br />
Umgekehrte ist gelegentlich der Fall. Hieraus kann auf eine zusammengesetzte Funktion<br />
des Wärmezentrums geschlossen werden, wie sie von anderen Forschern schon vermutet<br />
worden ist. lit was Sicheres kann aber hierüber vorerst nicht ausgesagt werden.<br />
Bei einer weiteren Gruppe, und zwar nur bei solchen Tieren, die mit X = 3,20<br />
bis 3,50 behandelt worden waren, fand STRASSBURGER zuerst keinerlei Störungen<br />
der Wärmeregulierung. Dagegen reagierten diese Tiere auf Einspritzung von<br />
Pyrifcr nicht mehr mit einem Anstieg, sondern mit Abfall der Temperatur (Abb. 95).<br />
Je nach Dauer der Durchflutung bildeten sich diese Störungen wieder zurück<br />
oder blieben bestehen. OSTERTAG hat die Gehirne histologisch untersucht. Dabei<br />
fanden sich bei den Tieren der letzten Kategorie streng selektive Schädigungen<br />
102
zw. Zerstörungen bestimmter Arten von Ganglienzellen der vegetativen Kerne,<br />
besonders des dorsalen Vaguskerns (s. Abb.94, yj). Bei den Tieren der oben beschriebenen<br />
Gruppen (die mit Wellenlängen über 4 m behandelt worden waren)<br />
fand OSTERTAG mehr diffuse Schäden.<br />
Abb. 9j. Selektive Zerstörung bestimmter Gruppen von Ganglienzellen<br />
in der Medulla oblongata vom Kaninchen durch X = 3,50 m<br />
Die Stärke der Schädigungen, kann durch Arzneimittel verändert werden. Besonders<br />
die Narkotika haben in dieser Hinsicht starke Wirkungen. Abb. 95 ist<br />
die Temperaturkurve eines Kaninchens, bei dem vor der Behandlung cinc<br />
Chloroform nark ose bis zur eben eingetretenen Rcflcxlosigkcit gemacht worden<br />
war. Die Narkose an sich hatte in dem vorangegangenen Leerversuch nur unwesentliche<br />
Temperaturveränderungen nach sich gezogen, wie sie innerhalb des<br />
Bereiches der Tagesschwankungen lagen. Während der Durchflutung sehen wir<br />
einen Anstieg der Temperatur im Maul; nach der Behandlung dagegen sinkt die<br />
Körperwärme stark ab.<br />
Das gleiche sahen wir wiederholt bei Kombination der Kur zwei lenwirkung mit<br />
Äther, Alkohol und Urethan. Man gewinnt den Eindruck, als könnte das Wärme-<br />
103
¡o tf ni* «Î<br />
í*3 C-a
VIII. Wirkungen auf Bakterien<br />
Die Art der Feldwirkung, die an den kleinsten Teilchen selbst angreift und in<br />
ihnen Ströme erregt, macht eine unmittelbare Einwirkung auf Bakterien wahrscheinlich.<br />
Trotz der zahlreichen Versuche, die von HAASE und SCHLIEPHAKE<br />
begonnen wurden und von verschiedenen Autoren weiter ausgebaut worden<br />
sind, ist diese Frage noch ungeklärt.<br />
Die Schwierigkeiten, die sich derartigen Versuchen entgegenstellen, sind bedeutend.<br />
Sie liegen teils in Eigenschaften der Kurzwellengeräte, teils in biologischen Eigenschaften<br />
der Bakterien begründet. Bei der Anwendung des Kurzwcllenfeldes besteht eine große<br />
Unsicherheit darin, daß mit drei Variablen gerechnet werden muß: Zeitdauer der Behandlung,<br />
Wellenlänge und Feldstärke, von welch letzterer wieder die Wirkungsstärke<br />
im Dielektrikum abhängt. Außerdem ist es bei den bisherigen Generatoren außerordentlich<br />
schwierig, die gleiche Leistung konstant beizubehalten. Diese Schwierigkeiten<br />
wurden von uns dadurch umgangen, daß die Erwärmung des baktcricnhaltigcn Dielektrikums<br />
selbst als Maß der zugeführten Energie verwendet wurde. Die Feldstärke wurde<br />
so geregelt, daß in einem bestimmten Quantum der Bakterienaufschwemmung stets eine<br />
bestimmte Temperatur erzeugt wurde. War dieser Zustand erreicht, so ließen sich daraus<br />
wieder Rückschlüsse auf die Konstanz der Feldstärke ziehen. Ferner scheint die Art der<br />
Nährböden eine Rolle zu spielen. Aus der Verschiedenheit der Versuchsbedingungen<br />
dürften sich die negativen Ergebnisse einzelner Autoren (LENTZE, HASCHE und LEUNIG)<br />
erklären.<br />
Für die Bakterienwirkung des Kondcnsatorfeldes spielt die Temperatur der<br />
Nährböden eine Rolle. Allgemein wurden die Absterbezeiten mit höherer Temperatur<br />
verkürzt. Um die Versuchsdauer abzukürzen, wurden daher die Bakterienversuche<br />
bei verschiedenen Temperaturen angestellt. Hierbei stellten, wie sich<br />
weiterhin zeigte, die biologischen Eigentümlichkeiten der einzelnen Baktcricnstämmc<br />
einen nicht zu übersehenden Versuchsfelder dar.<br />
Besonders durch die starke Mutation der Bakterien ergeben sich große Schicriwgkeiten.<br />
Bestimmte Stämme können an einem Tag ein vollkommen anderes Verhalten zeigen als<br />
wenige Tage vorher oder später, so daß Vergleiche nicht möglich sind. Besonders<br />
Streptokokken zeichnen sich durch so starke Mutationserscheinungen aus, daß sie zu<br />
derartigen Versuchen unbrauchbar sind. Als geeigneter erwiesen sich Staphylokokken<br />
und Tiiberkeibaba^iüen. An ihnen wurden die wichtigsten Versuchscrgebnissc gewonnen.<br />
Weitere Schwierigkeiten liegen in der Beurteilung der Absterbetemperaturen. Bei verschiedenen<br />
Bakterienarten bewegen sich diese Temperaturen innerhalb sehr weiter Grenzen,<br />
schon zwischen den Stämmen einer Art bestehen aber außerdem nach unseren Untersuchungen<br />
so große Verschiedenheiten, daß sich keine Norm aufstellen läßt. Sämtliche<br />
derartigen Versuche müssen daher so ausgeführt werden, daß die eine Hälfte einer zu<br />
behandelnden Bakterienaufschwemmung dcmKurzwellcnfeld ausgesetzt wird, während<br />
die andere gleich große Hälfte im Wasserbad genau auf der gleichen Temperatur erhalten<br />
wird.<br />
Die Bakterien sterben im KW-Fcld rascher ab. Die schädigende Wirkung des<br />
Kondcnsatorfeldes auf Bakterien kann also nicht allein in der äußerlich meßbaren<br />
Erwärmung gesucht werden. Die Differenz der Absterbezeiten im Wasserbad plus<br />
Kondensatorfeld wird verkürzt gegenüber der Absterbezeit im Wasserbad bei<br />
gleicher Temperatur und nimmt mit fallender Versuchstemperatur immer mehr<br />
zu. Abb. 103 gibt die Zeitspanne an, um welche die Lebensdauer eines Staphylo-<br />
105
coccus-anhacmolyticus-Stammes im Kondensatorfeld verkürzt wird, gegenüber<br />
der Absterbezeit im Wasserbad bei gleicher Temperatur. Die Lebensdauer der<br />
Bakterien im Wasserbad ist in weißen Säulen dargestellt, während die schwarzen<br />
Säulen die Lebensdauer im Kondcnsatorfeld bei der gleichen Temperatur wiedergegeben.<br />
Andere Bakterienarten sind von HAASE auf ihr Verhalten im Kondcnsatorfeld<br />
untersucht worden, so Diphtheriebazillcn, Rindcrtubcrkclbazillcn, Schimmelpilze,<br />
Gonokokken, Pyozyancus, Meningokokken.<br />
60<br />
min<br />
55<br />
so<br />
US<br />
uo<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
1S<br />
c=z ] im<br />
Wass erba<br />
l im (ondt nsat
Weiterhin ergab sich die Frage, ob durch Änderung der Wellenlänge verschieden<br />
starke Wirkungen hervorgebracht werden könnten. Bei Tuberkelba^illen<br />
wurden solche Untersuchungen von HAASE und SCHLIEPHAKE im Wellenbereich<br />
von 3 bis loo m durchgeführt. Die Bazillen wurden nicht völlig abgetötet, jedoch<br />
wurde das Wachstum verzögert. Im allgemeinen waren die Schädigungen der<br />
Bazillen bei den sehr kurzen Wellen stärker als bei längeren Wellen.<br />
Auffallend ist aber, daß sich beim Durchlaufen der verschiedenen Wellenlängen Hochund<br />
Tiefpunkte fanden, bei denen mehr oder weniger starke Schädigungen der Bazillen<br />
eintraten. In wiederholten Untersuchungen mit ;;-m-Wcllcn konnte z.B. niemals eine<br />
Wachstumsverzögerung festgestellt werden, und ähnlich verhielt es sich bei 98-m-Wellen.<br />
Dagegen ergaben sich Schädigungen bei einer Wellenlänge von 4,5 m, ein weiteres<br />
weniger ausgesprochenes Maximum lag bei 31,5 m. Im ganzen sind in dieser Weise<br />
52 Versuche ausgeführt worden.<br />
Die Frage der Einwirkung der Kurzwellen auf Mikroorganismen ist jedoch noch<br />
in keiner Weise klar. Den genannten Befunden stehen völlig negative Ergebnisse<br />
anderer Forscher gegenüber. So konnten BESSEMANNS und seine Mitarbeiter niemals<br />
Bakterien im KW-Feld abtöten, und LENTZE konnte sich von der Wirkung<br />
auf Bakterien im KW-Feld nicht überzeugen. So steht immer noch die Frage offen,<br />
warum viele erfahrene Untersucher solche Wirkungen gefunden haben, andere<br />
dagegen nicht. Neben der Dosierung können die Art und Form der benutzten<br />
Gefäße mitspielen, wichtig dürfte die Beschaffenheit der Nährböden sein. Im<br />
Nährboden könnten gegebenenfalls Stoffe entstehen, die auf das Baktcrienwachstum<br />
einwirken; wichtiger dürfte der Unterschied der DK zwischen Bakterien und<br />
Nährböden sein, durch den an bestimmten Punkten konzentrierte Molekularbewegung,<br />
d.h. Wärme, entsteht. Dadurch können sich die Obcrflächcncigcnschaften<br />
verändern.<br />
SCHENCK zu SCHWEINSBERG hat deshalb Untersuchungen über die färberischen<br />
Eigenschaft en von Bakterien ausgeführt. Bei gewissen Arten von Bakterien war die<br />
Färbbarkeit verändert, während bei anderen Arten keine Unterschiede auftraten.<br />
Ein eigenartiges Ergebnis hatten Untersuchungen von LIEBESNY an zahlreichen Bakterienarten<br />
mit verschiedenen Wellenlängen bei 37 o . Eine Wärmeschädigung wurde in<br />
diesen Versuchen durch genaue Temperaturkontrolle ausgeschlossen. Unter anderen<br />
wurden Actinomyces hominis und Trichophyton tonsurans durch das Feld einer 15-m-<br />
Wcllc im Wachstum gefördert, bei 4 m Wellenlänge gehemmt.<br />
Diese beiden Wellenlängen wurden weiterhin bezüglich ihrer Wirkung auf die verschiedensten<br />
Baktcricnstämme verglichen. Dabei ergab sich beispielsweise für B.Tbc.<br />
poikilotherm. eine Förderung bei 4 m, Abtötung bei 1 j m. In ähnlicher Weise reagierten<br />
zahlreiche Baktcricnarten. Die Frequenzabhängigkeit bei Aktinomykose wird verneint<br />
von GROAG und TOMBERG, die aber ganz allgemein eine Baktcrienschädigung im Kurzwcllenfcld<br />
finden.<br />
Bei verschiedenen Pilzarten konnte eindeutige Beeinflussung durch KW nicht nachgewiesen<br />
werden (TROELTSCH, RUETE, PALMIERI, GIORDANO).<br />
Bei Kulturen von Staphylokokken wurde erst bei Temperaturen von j 5-65 ° Hemmung<br />
des Wachstums beobachtet (MARQUES und MILETZKY, SCHEDTLER, YAMAUA, SCHENCK<br />
zu SCHWEINSBERG). Auch bei Bact. coli commune konnten erst bei höherer Temperatur<br />
Schädigungen beobachtet werden (GRASSER, RUETE). Dagegen geben FABRIKANT und<br />
GRANOVA bakterizide Wirkungen bei Staphylokokken, Bact. coli, Pyocyaneus und Proteus<br />
an. Die Wirkungen auf Gonokokken bei Hyperthermie des Beckens beruhen jedenfalls<br />
wohl nur auf der entstehenden Wärme.<br />
107
HASCHE und LOCH konnten Diphtherieba^illen in Aqua destillata abtöten, während<br />
sie auf Zystinagar nicht abstarben. Das Optimum wurde mit Wellenlänge<br />
3,5 m erzielt, während Bact. coli und Staphylococcus pyogenes mit Wellenlänge<br />
52 cm gehemmt wurden, bei jstündiger Durchflutung. Durch weitere Untersuchungen<br />
wurde festgestellt, daß diese Wirkungen dadurch zustande kommen,<br />
daß im KW-Feld eine unhomogene Erwärmung an bestimmten Stellen der Kultur<br />
entsteht. Ähnliche Wirkungen konnten nämlich durch eine in die Kultur an bestimmter<br />
Stelle eingeführte Thermode hervorgerufen werden.<br />
Auch Zunahme der Vitalität von Mikroorganismen wurde von verschiedenen Autoren<br />
beobachtet, und zwar scheint die Dosis dabei eine Rolle zu spielen (LIEBESNY). MEYER,<br />
PESON und BECKER geben an, ebenso wie FORSTER, daß Streptokokken von dentalen<br />
Herden, die sonst vergrünend wuchsen, hämolytische Eigenschaften bekommen konnten.<br />
Beim Tntrakutantest beobachtete FÖRSTER Zunahme der Virulenz. Nach MEYER reagieren<br />
nur 20% der Fälle in dieser Weise.<br />
Gute Wirkungen beschreiben BERGER und BRECHER an mit Nagana Prowazeki geimpften<br />
Mäusen, wenn sie gleichzeitig Metallsalzc injizierten, um eine Verdichtung des<br />
Feldes an den Mctalltcilchcn zu erzielen.<br />
Bei den therapeutischen Durchflutungen ¡st sicher die Anregung der Abwehrkra'fte<br />
von größter Bedeutung. SCHIRA und NAKASHIMA fanden nach UKW einen<br />
Anstieg der bakteriziden Kraft des Kaninchenblutes mit Maximum nach 3-6 Stunden.<br />
Der opsonische Index gegenüber Staphylokokken und Bact. coli nimmt schon<br />
nach einmaliger Durchflutung zu (NAKASHIMA und UMEDA). Bei Durchflutung der<br />
Leber sah ARCURI Anstieg des Komplementtiters\ nach Behandlung von Brust<br />
oder Extremitäten wurde dies nicht erreicht. Nach ECKER und O'NELL scheint die<br />
Bildung des antisyphilitischen Ambozeptors beschleunigt zu werden. NEYMAN<br />
erklärt dies durch Abtötung der Spirochäten und die freiwerdenden Toxine, doch<br />
sprechen Untersuchungen BIERMANS nicht in diesem Sinn. MICHELSON fand Tendenz<br />
zum Anstieg des Komplementtitcrs.<br />
Mit Syphilis geimpfte Kaninchen heilten CARPENTER und BOAK durch mehrwöchige<br />
Behandlung mit Hyperthermie von 42 o . - Schon nach einmaliger Hyperthermie gingen<br />
die Erscheinungen zurück. Dies ¡st auch bei menschlicher Lues bestätigt durch RAAB,<br />
AUCLAIR, MARTINEZ, BECKMANN, REDEVILLE, WEYMANN, O'LEARY, SIMPSON, WARREN.<br />
Andererseits erscheint die Annahme berechtigt, daß eine Schädigung von<br />
Krankheitserregern auch im Inneren menschlischer Körperteile möglich ist. Die<br />
Befunde von LIEBESNY bei Aktinomykose könnten vielleicht auf eine differenzierte<br />
Wirkung verschiedener Wellenlängen bei dieser Erkrankung hindeuten.<br />
Bei einem Patienten war nämlich ein aktinomykotisches Infiltrat nach Durchflutung<br />
mit einem 1 j-m-Feld verschlimmert worden ; bei Verwendung einer 4-m-<br />
Welle trat Besserung ein. An fünf weiteren Patienten war das Ergebnis das gleiche.<br />
Eine Frequenzabhängigkeit der Wirkung auf Bakterien wird angegeben von IZAR und<br />
MoRETTi, die deutliche Unterschiede zwischen 4, 8 und ijm Wellenlänge fanden. Bac.<br />
paratyphi A wurde bei 4 m geschädigt und bei 8 und i; m nicht beeinflußt, ebenso Bac.<br />
Bang. Unbeeinflußt blieben Bac. typhi, paratyphi B, Shiga-Krusc, Bac. metadysentcriac.<br />
Bei Hefe-Emulsionen in 2,5-10% NaCl-Lösungen fanden die gleichen Autoren eine<br />
Steigerung der Gärfähigkeit durch 8-m-Wellen, während 4 und 15 m unwirksam blieben.<br />
Am Streptococcus cremoris, der eine Säuerung der Milch hervorruft, hat<br />
KÖRBER eingehende Untersuchungen ausgeführt, und zwar wurde die Stärke der<br />
108
Säureproduktion mit und ohne Kurzwcüendurchflutung festgestellt. Danach wird<br />
bei 4 m Wellenlänge die Entwicklung des Säureweckers gefördert, bei 15-m-<br />
Welle gehemmt. Die Befunde stimmen mit denjenigen von LIEBESNY und WERT<br />
HEIM an Bact. aeidi lactici überein.<br />
Zunächst muß versucht werden, die Wirkung des KW-Fcldcs auf die Bakterien<br />
aus Erwärmung zu erklären. Die Erwärmung kann aber, und das ist ja eine der<br />
wesentlichsten Eigenschaften des KW-Feldes, in jedem kleinsten Teilchen auftreten,<br />
das sich überhaupt im Feldbereich befindet ; sie kann demnach im Bakterienleib<br />
und seinen Strukturelcmenten von anderer Größe sein als in den umgebenden<br />
Medien.<br />
Gehen wir von der Erwärmung als Arbeitshypothese aus und betrachten die Schädigung<br />
des Bakteriums als ihre alleinige Folge, so ¡st diese Schädigung nur dann zu erwarten,<br />
wenn die Temperatur des Baktcrienleibes genügend lange Zeit auf der Absterbetemperatur<br />
erhalten werden kann. Diese Temperatur, die durch Vergleiche im Wasserbad<br />
festgelegt ist, müßte diejenige der Umgebung übertreffen. Nun erfolgt aber bei der<br />
geringen Wärmekapazität eines Bakteriums seine Wärmeabgabe an die Umgebung sehr<br />
rasch, auch entfällt von der gesamten Feldstärke auf die Größe eines Bakteriums nur<br />
ein geringer Bruchteil. Eine Wärmeschädigung der Bakterien ist daher nur dann zu erwarten,<br />
wenn ein möglichst großes Wärmegefälle vom Baktcrienleib nach seiner Umgebung<br />
hin besteht; die Feldstärke muß so groß sein, daß die Energiezufuhr in der Zeiteinheit<br />
die durch Wärmekapazität und Wärmeleitvermögen des Mikroorganismus bestimmte<br />
Wärmeabgabe an die Umgebung überwiegt. Läßt sich die dazu notwendige<br />
Feldstärke nicht erreichen, so müssen die Versuche von Mißerfolg begleitet sein.<br />
Hier sind die Ergebnisse von HASCHE mit «Lang^eit-Schwachbestrahlung* von<br />
Interesse, die zeigen, daß es sich nicht um spezifische Wirkungen handelt. Bei<br />
Durchflutung einer durch eine Membran diffundierenden Flüssigkeit wird die<br />
Diffusion (ohne meßbare Erwärmung) gesteigert. Die Erscheinung beruht auf<br />
lokalen Strömungen in der Flüssigkeit, die, wie HASCHE zeigen konnte, auf Inhomogenitäten<br />
des Feldes zurückzuführen sind. Auf diese Weise läßt sich erklären,<br />
daß das vorher normale osmotische Gleichgewicht der Zellen und ihrer Umgebung<br />
ohne meßbare Wärmewirkung erheblich verändert werden kann. Diese<br />
Wirkung der «Langzck-Schwachbestrahlung» unterscheidet sich grundsätzlich von<br />
den zcllschädigcndcn Wirkungen der Röntgen- oder Radiumstrahlen, da keine<br />
Schäden entstehen. Sie ist keine «spezifische» Wirkung der UKW, kann aber in<br />
gewissem Sinn als «spezifische Wärmewirkung» der UKW angeschen werden, da<br />
sie durch andere Agcntien nicht in dieser Weise hervorgerufen werden kann.<br />
Aus den Berechnungen von KRASNY-ERGEN und Versuchen von KULKA geht<br />
nun hervor, daß die Temperatur des Baktcrienleibes nicht meßbar über diejenige<br />
seiner Umgebung steigen kann. Bei Paramaccicn und kleinen Fischen konnte dagegen<br />
KOWARSCHIK eine Temperaturerhöhung über diejenige des umgebenden<br />
Wassers hinaus erzeugen, die zum Absterben führte.<br />
Nach unseren heutigen Kenntnissen müssen wir annehmen, daß die Erwärmung<br />
des einzelnen Bakteriums zum mindesten nicht das allein Maßgebende ¡st;<br />
Inhomogenitäten der Wärmeverteilung in der Kultur oder im Krankheitsherd<br />
dürften eine wesentliche Rolle spielen (HASCHE). Wir werden aber auch daran<br />
denken müssen, daß die Kolloide des Bakterienleibes - vielleicht auch des Nährbodens<br />
- Veränderungen vorübergehender oder bleibender Art erleiden, durch<br />
welche die Lebensbedingungen der Mikroorganismen beeinträchtigt werden<br />
(vgl. S. 66 ff).<br />
109
Bei bakteriellen Infiltraten im lebenden Gewebe kommt als günstiges Moment<br />
hinzu, daß in den meisten Fällen die Bakterien als Fremdkörper vom allgemeinen<br />
Säftestrom, der eine beständige Abkühlung der Gewebe bewirkt, ausgeschaltet<br />
sind. Übrigens scheint es nicht ausgeschlossen, daß auch Veränderungen des Nährbodens<br />
durch das elektrische Feld eine Rolle spielen (JÖRNS, LIEBESNY und WERT-<br />
HEIM).<br />
Für die Praxis ist es unwesentlich, ob die Wirkung auf Bakterien durch direkte<br />
Beeinflussung, durch ungleichmäßige Wärmeverteilung oder durch Veränderung<br />
der Nährböden zustande kommt. Auch ¡st es nicht notwendig, daß die Erreger absterben.<br />
Es genügt, wenn durch eine geringe Schwächung der Erreger der Abwehrkampf<br />
des Körpers unterstützt wird.<br />
IX. Wirkungen auf Gewebskulturen<br />
1928 veröffentlichte SCHERESCHEWSKY die Ergebnisse seiner Versuche an<br />
Mäusen mit impjsarkomm. Nach Behandlung im Kondcnsatorfcld eines kleinen<br />
3-m-Kurzwcllcnscndcrs konnte er einen Rückgang des Wachstums beobachten;<br />
die Sterblichkeit der behandelten war geringer als die der unbehandelten Tiere.<br />
Da die Energien, die SCHERESCHEWSKY benutzte, sehr gering waren, kommt eine<br />
Übertragung dieser Ergebnisse auf irgendwelche Erkrankungen größerer Tiere<br />
nicht in Frage. Immerhin kommt diesen Untersuchungen eine wissenschaftliche<br />
Bedeutung zu. Wenn auch die überimpften Mäuse- und Rattensarkome ¡m allgemeinen<br />
nicht als bösartige Geschwülste im Sinne der menschlichen Krebse angesprochen<br />
werden dürfen, so ist doch hier zum erstenmal ein Einfluß der Kurzwellen<br />
auf das Tumorwachstum erwiesen worden.<br />
Unabhängig davon hat PFLOMM sog. jENsxuN-Sarkom bei Ratten im Kondensatorfeld<br />
bei Wellenlänge 4,;o m behandelt.<br />
Diese Sarkome pflegen, wenn die Impfung angeht, in etwa 4 Wochen zur Hühnereigrößc<br />
anzuwachsen; sie töten die Tiere schließlich durch ihre Toxizität, wachsen aber<br />
nicht infiltrativ und machen keine Metastasen.<br />
Im Anschluß an die Kurzwellenbchandlung hörten die Tumoren fast augenblicklich<br />
auf zu wachsen und gingen nach einigen Tagen fortgesetzter Behandlung<br />
zurück. Sic nahmen dabei eine härtere und höckerige Beschaffenheit an. Die<br />
Lebensdauer der behandelten Tiere war im allgemeinen länger als die der unbehandelten.<br />
Die Wichtigkeit der Pi-LOMMschcn Untersuchungen liegt vor allem darin, daß er<br />
zuerst histologische Untersuchungen über den Kurzwellcncinfluß auf die Tumoren<br />
angestellt hat. Er fand dabei meist als Folge der Fcldwirkung stärkere kapilläre<br />
Hyperämie mit freien Blutaustritten an der Peripherie; die Gcfäßcndothclicn<br />
wiesen Zerstörungen bis zum völligen Unkenntlichwerden auf. Dazu bestand<br />
starke wandständige Leukozytenauswanderung. Teilweise bildeten sich kleinste<br />
Thrombosen, schließlich traten herdförmige Nekrosen ¡m ganzen Tumorgebiet<br />
auf, die sich auch in der Nähe von Gefäßen befanden, während die spontan im<br />
Tumor auftretenden Nekrosen an diesen Stellen nicht aufzutreten pflegen. ROFFO<br />
hat auch bei Mäusetumoren ähnliche Kurzwellcnwirkungen beobachtet.<br />
110
Diese Beschreibung gleicht ungefähr den Befunden, die v. ÜTTINGEN am Hoden von<br />
Mäusen erhoben hat. Im Grunde genommen scheint sich demnach das Tumorgewebe<br />
gegenüber der Kurzwcllenwirkung nicht anders als gewisse normale Gewebe zu verhalten.<br />
Auffallend ist nach PFLOMM, daß die Kerne der Geschwulstzellcn oft noch erhalten<br />
blieben, wenn das Protoplasma schon zerstört war. Selbst bei wiederholter<br />
Behandlung im Kondensatorfeld gelang es nicht, die Tumorzellen bis auf den<br />
letzten Rest zu zerstören, es blieben einige lebensfähige Elemente erhalten, von<br />
denen dann ein neues Wachstum ausging.<br />
Ähnliche Versuche sind von REITER ausgeführt worden.<br />
Um eine zu starke Uberhitzung der Tiere zu vermeiden, führte er ihnen dauernd eiskalte<br />
Luft zu; auf diese Weise war es möglich, wesentlich höhere Feldstärken zu verwenden,<br />
als die Tiere sonst vertragen hätten. Bei Anwendung verschiedener Wellenlängen<br />
glaubte REITER feststellen zu können, daß die stärkste Schädigung der Tumorzellen<br />
bei einer Wellenlänge von 3,40 m zustande kam und daß andere Wellenlängen<br />
teilweise erheblich schwächere Wirkungen entfalteten. Es gelang damit, nicht nur die<br />
Tumoren völlig zum Verschwinden zu bringen, sondern sie so zu zerstören, daß keine<br />
Rezidive mehr erfolgten; die Tiere blieben danach angeblich dauernd geheilt.<br />
Schon in früheren Arbeiten habe ich wiederholt darauf hingewiesen, daß eine Kombination<br />
der UKW mit Röntgen- oder Radiumstrahlen ein vielleicht aussichtsreicher Weg<br />
für die Ca.-Therapie sein könnte, zumal im Hinblick auf die Untersuchungen von WESTER-<br />
MARK über die Hitzeempfindlichkeit des Tumorgewebes. Besonders wenn eine selektive<br />
Beeinflussung von Tumorzellen durch UKW möglich ist, kann eine verstärkte Wirkung<br />
der Röntgen- und Radiumstrahlcn erwartet werden. REITER hat solche Versuche an<br />
Mäusen ausgeführt, die anscheinend positive Ergebnisse hatten.<br />
CiiRANowA sah EuRuai-Sarkome bei Mäusen im Feld der 6-m-Wellc abheilen,<br />
bei einer Dosis, bei der die Tiere gerade noch leben blieben.<br />
So vielversprechend diese verschiedenen Ergebnisse sind, so muß man doch<br />
mit Folgerungen für die menschliche Pathologie außerordentlich vorsichtig sein.<br />
Das spontane Karzinom des Menschen folgt anderen Gesetzen als die überimpften<br />
Rattentumoren, die sich in ihrem Wachstum und in bezug auf die Metastasierung<br />
ganz anders verhalten. Meine negativen Ergebnisse bei mcnschlischem<br />
Uterus-Ca (1931), wobei auch Röntgenbestrahlungen mit zur Anwendung kamen,<br />
mahnen jedenfalls zu vorsichtiger Beurteilung. In der Universitäts-Frauenklinik<br />
Erlangen sind UKW der verschiedensten Wellenlängen mit Röntgen- und Radiumstrahlcn<br />
kombiniert worden, ohne bisher sichere Erfolge (WITTENBECK), jedoch<br />
berichtet HEEREN über gute Ergebnisse bei einer solchen Kombination. Einen<br />
neuen Weg scheinen die Untersuchungen von SAMUELS ZU weisen, der das Tumorwachstum<br />
vom Endokrinium her beeinflußt (S. 246).<br />
Forschungen auf diesem Gebiet sind auf jeden Fall von größter Wichtigkeit.<br />
Vor verfrühtem Optimismus ist aber unbedingt zu warnen.<br />
Nach DE SEGUIN, CASTELAIN & PELLETIER wird durch Mikrowellen das Wachstum<br />
von Gewebekulturen besonders stark beschleunigt. Dies wurde von LAS-<br />
FARQUE, DELAUNY & PELLETIER bei Milzgewebe von Meerschweinchen und Herz<br />
von Hübncrcmbryoncn bei Bcsrrahlungszeiten von 3 min beobachtet.<br />
Bei lebenden Meerschweinchen wurden Gewebsveränderungen durch Bestrahlung<br />
mit Mikrowellen nur bei sehr hohen Dosen beobachtet. Sie beruhten auf der<br />
starken Erhitzung. In den Lungen fanden sich schon bei geringeren Dosen starke<br />
Erweiterungen im interalvcolarcn Gefäßnetz.<br />
in
X. Gefahren der Kurzwellenbehandlung<br />
Für die Therapie ist neben allgemeinen Erscheinungen die Frage nach den lokalen<br />
Gewebeveränderungen durch Behandlung im Kondensatorfeld besonders<br />
wichtig. Bevor seinerzeit an die Behandlung von Menschen mit dem neuen Heilverfahren<br />
herangegangen werden durfte, mußten wir uns klar darüber sein, welche<br />
Schädigungen unter Umständen zu erwarten waren und wie sie sich durch richtige<br />
Anwendung vermeiden lassen konnten.<br />
Schon nach dem vorher Gesagten erscheint er als selbstverständlich, daß<br />
durch zu starke Einwirkung lokale Schäden im Bereich der Kondensatorplatten<br />
entstehen müssen. Von der Form der Elektroden und ihrer Lage zum Körper<br />
hängt es dabei ab, ob oberflächliche oder tiefergehende Schäden in Frage kommen.<br />
Das Bild, das wir bei starker lokaler Einwirkung sehen, ist zunächst das einer<br />
Hyperämie, später einer Hitzekoagulation. Diese Befunde sind oft so streng auf<br />
das Gebiet des Kondensatorfeldes beschränkt, daß sich der betroffene Bereich längere<br />
Zeit nach der übermäßigen Einwirkung mitten aus der gesunden Umgebung<br />
demarkiert und später abstößt, so daß ein Loch entsteht.<br />
Besonders starke oberflächliche Schäden entstehen dann, wenn mit der entsprechenden<br />
Platte sehr nahe herangegangen wird.Y)ann entstehen Hautnckrosen,<br />
die zu Abstoßung der betroffenen Hautstellen führen. Ist der Abstand so gering,<br />
daß dauernde Funkenübergänge stattfinden, so kommt es zu tiefgreifenden<br />
Gewebsnekrosen, die manchmal infiziert werden und zu langwierigen und hartnäckigen<br />
Eiterungen führen. Keine besonderen Bedeutung haben dagegen einzelne<br />
kleine Funkenverbrennungen, wie sie bei gelegentlichem Berühren blanker<br />
Kondensatorplatten oder der Zuleitungen vorkommen können; wiederholen sie<br />
sich aber öfter, so kommt es auch dabei zu tiefgehenden örtlich beschränkten<br />
Schädigungen, die schlechte Heilungstendenz aufweisen.<br />
Die erste Erscheinung, die wir gewöhnlich auf der Haut behaarter Versuchstiere<br />
zu sehen bekommen, ist Haarausfall; die Haare werden zunächst an den befallenen<br />
Stellen struppig und gehen dann aus, so daß es aussieht, als seien an dieser<br />
Stelle die Haare ausgerissen worden. Dies tritt vor allen Dingen dann hervor,<br />
wenn die Haare während der Behandlung nicht zusammengedrückt worden waren.<br />
Die einzelnen Haare wirken nämlich dann als Spitzen und verzerren das elektrische<br />
Feld nach sich hin, so daß eine besonders konzentrierte Einwirkung auf die Haarbälge<br />
die Folge ist. Man empfindet an behaarten Körperteilen im Kondensatorfeld<br />
manchmal ein unangenehmes stechendes Gefühl in der Gegend der Haarwurzeln,<br />
das sich aus dem gleichen Grund erklärt.<br />
Nach längerer oberflächlicher Einwirkung sahen wir bei Kaninchen Nekrosen<br />
des Unterhautfettgewebes auftreten, wobei die Haut nicht erheblich beteiligt war.<br />
Wir fanden dann Phlegmonen, die sich im Unterhautgewebe über den ganzen<br />
Bereich der Fcldeinwirkung hin erstreckten und gelegentlich zur Fistelbildung geführt<br />
hatten. Da letzteres aber durchaus nicht immer der Fall war, wurden diese<br />
Phlegmonen oft erst durch die Sektion festgestellt.<br />
Bei einem Kaninchen hatten wir das eine Bein zwischen schmalen, zum Bein querstehenden<br />
Kondensatorplatten bei großer Feldstärke behandelt. Nach einigen Tagen<br />
waren genau im Feldbereich sämtliche Weichteile nekrotisch geworden und teilweise abgestoßen.<br />
Der periphere Teil des Beines war infolge der fehlenden Ernährung mumifiziert,<br />
uz
an der behandelten Stelle sah man nur eine Brücke von schwärzlichen Knochen zwischen<br />
dem zentralen und dem peripheren Teil.<br />
Andererseits sahen wir nach wiederholter Feldeinwirkung Sponianjrakiuren an<br />
Gliedmaßen von Tieren zustande kommen, ohne daß eine sichtbare Schädigung<br />
der Weichteile nachweisbar gewesen wäre; ein weiterer Beweis für die Tiefenwirkung<br />
des Kondensatorfeldes.<br />
Unangenehm starke Wirkungen können dann zustande kommen, wenn die<br />
Kondensatorplatten verkantet sind und an einer Stelle dadurch der Körperoberfläche<br />
besonders stark angenähert werden.<br />
Abb. 98: Konzentration der Wirkung an vorstehenden Teilen<br />
Ein Versuchskaninchen, bei dem eine solche Elektrodenstcllung am Bauch angewandt<br />
worden war, ging unter ileusarrigen Erscheinungen zugrunde. Bei der Sektion fand sich<br />
eine tiefgehende Nekrose der Leber in Drciccksform, ferner waren in diesem Bereich die<br />
Därme stark geschädigt und sahen wie verkocht aus. Die Nekrosen in den Bauchdcckcn<br />
waren demgegenüber nur verhältnismäßig gering.<br />
Schädigende Wirkungen auf das Zentralnervensystem konnten durch die oben<br />
beschriebenen Störungen der Wärmeregulation nachgewiesen werden. Bei sehr<br />
starker Beeinflussung des Halsmarkes in einem quergestellten bandförmigen Feld<br />
kam es zu klonischen Zuckungen der unteren Extremitäten und schließlich zu<br />
Lähmungen, die allerdings immer nach einiger Zeit wieder zurückgingen.<br />
Wie die Tiefenwirkung im Körper durch die Form der Kondensatorplatten<br />
lokalisiert werden kann, zeigen auch Versuche von REITER an Ratten. Im<br />
Bereich eines sehr starken Feldes entstanden Nekrosen in allen Körperschichten,<br />
besonders an den Därmen, die durch den ganzen Körper der Ratte hindurchgingen.<br />
Diese Schädigungen waren örtlich so genau begrenzt, daß sie fast einen<br />
Abklatsch der Kondensatorplatten bildeten. HELLER konnte durch scharf begrenzte<br />
kleine Felder bei Fröschen Querschnittsläsionen des Rückenmarks hervorrufen.<br />
Bei Hühnern konnte er durch intensive Durchflutung das Großhirn funktionell<br />
ausschalten. Die Bedeutung solcher Tiefenwirkungen ohne operativen<br />
Eingriff eröffnet neue Möglichkeiten für die Physiologie.<br />
Besonders gefährdet sind durch das Kondensatorfeld alle vorstehenden Teile,<br />
wo der Abstand von den Kondcnsatorplatten geringer ist als an anderen Stellen.<br />
Für die Haare ist das schon kurz beschrieben, doch kommen ebensogut auch<br />
größere Teile, Ohren, Gliedmaßen und herausgehobene Hautfalten, in Betracht<br />
(s. auch S. 60). An solchen Stellen bildet sich eine besonders starke Konzentration<br />
des Feldes (Abb. 98), so daß Verbrennungen die Folge sein können.<br />
113
Früher erlebten wir das oft bei unseren kleinen Versuchstieren. Nicht selten kam es<br />
vor, daß bei Meerschweinchen, die dem Kondensatorfeld ausgesetzt worden waren, die<br />
Ohren vollkommen nekrotisch wurden und abfielen; ebenso ging es häufig mit den<br />
Pfoten. Bei Mäusen und Ratten waren es meist die Schwanzspitzen, die mumifizierten<br />
und abfielen.<br />
Wie stark diese Spit^enwirhingen sein können, hat HEINRICH in eindrucksvollen Versuchen<br />
gezeigt. Legt man an die eine Kondcnsatorplatte einen Draht, der in eine Spitze<br />
ausläuft, und nähert diese Spitze der anderen Platte, so entsteht bei einer gewissen Entfernung<br />
ein Funkenübergang. Wenn man nun die Spitze wieder langsam zurückzieht,<br />
so entsteht ein Lichtbogen mit sehr starker Hitzeentwicklung, der sich oft mehrere<br />
Zentimeter lang ausziehen läßt.<br />
Größere Gefahren entstehen bei der maximalen Hyperthermie. Wie wir im Tierversuch<br />
gesehen haben (S. 97 ff), versagt beim Überschreiten einer gewissen Temperatur<br />
die Wärmeregulation, die Körpertemperatur steigt plötzlich steil an, und es<br />
erfolgt der Hitzetod. Beim Menschen besteht diese Gefahr besonders dann, wenn<br />
die Temperatur nicht richtig kontrolliert wird. Der Puls steigt dann ganz plötzlich<br />
an, die Atmung wird kurz und rasch, es kann Zyanose eintreten. Besonders ungünstig<br />
scheint Salzmangel zu wirken. Erheblich gefährdet sind Kranke mit<br />
zerebralen Störungen, bei denen ein Versagen der Wärmeregulation zu befürchten<br />
ist, so manche Paralytiker.<br />
Auch die Gefahr der Aktivierung chronischer oder latenter Prozesse ist bei der<br />
maximalen Hyperthermie größer als bei den müderen Verfahren. Man wird deshalb<br />
bei akuten und subakuten Entzündungen vorsichtig sein müssen, insbesondere bei<br />
tuberkulösen Erkrankungen.<br />
Auch bei Menschen läßt sich die Konzentration an Spitzen leicht zeigen. Hält<br />
man die Hände so ins Kondensatorfcld, daß der Handrücken der einen Platte<br />
gegenübersteht, und nähert die Fingerspitzen der anderen Platte, so spürt man<br />
bald die starke Erwärmung der Fingerspitzen. Das gleiche zeigt sich, wenn die<br />
Hand quer ins Feld gehalten wird. Dann ist die Erwärmung besonders stark an<br />
den Handkanten, ferner an den Interdigitalkanten, wo sich die Finger gegenseitig<br />
berühren. Beim Übergang der Energie von Finger zu Finger findet hier eine Verzerrung<br />
des Feldes nach den Punkten nächster Annäherung hin statt. Auch wenn<br />
die Patienten, besonders bei Querdurchflutung des Körpers oder bei Allgemeinbehandlung,<br />
mit den Fingerspitzen die Finger der anderen Haut oder bestimmte<br />
Körperstellen berühren, tritt an den Berührungstellcn Brennen auf.<br />
An Metallgegenständen ist die Feldver^errung stark. Bei der Behandlung von<br />
Personen muß dafür gesorgt werden, daß Ohrringe, Spangen, metallene Hosenknöpfe,<br />
Hüfthalter mit Metallstäbcn im Bereich des Feldes abgelegt werden, da<br />
sonst an diesen Gegenständen unangenehme Erhitzung eintreten kann.<br />
Ernstere Schädigungen von Menschen kommen bei den üblichen therapeutischen<br />
Dosen kaum jemals und nur bei unsachgemäßer Anwendung vor. Wir konnten<br />
Schädigungen bis auf ganz vereinzelte Fälle bisher vermeiden, zumal wir durch<br />
den Tierversuch genügende Erfahrungen gesammelt hatten. Die Nekrosen, die<br />
durch Funkenübergang, besonders an den Fingern, leicht entstehen, sind schon<br />
kurz besprochen. Sie sind nach einmaliger Einwirkung harmlos ; findet aber immer<br />
wieder an der gleichen Stelle ein Funkenübergang statt, so können sie torpid werden<br />
und braueben unter Umständen mehrere Wochen zum Abheilen.<br />
Bei Hinführung einer Vaginalclcktrodc mit einem Glasspckulum sahen wir zweimal<br />
leichte Verbrennungen an der Portio an der Stelle, wo die stärkste Krümmung der Elektrode<br />
der gekrümmten Portio entgegengestanden hatte. Die Stellen sahen aus wie<br />
114
gekocht. Infolge der genauen Beobachtung der Kranken wurden die Veränderungen<br />
sofort bemerkt und heilten innerhalb von 3 bis 4 Tagen von selbst ab.<br />
Sonst wurde nur einmal bei einer Patientin eine leichtere Nekrose am Rand des Ohres<br />
bemerkt, die auch in wenigen Tagen zurückging.<br />
Man kann sich gegen alle diese Vorkommnisse leicht schützen durch Verwendung<br />
der Elektrodenschuhc, mittels derer die vorstehenden Teile zusammengedrückt<br />
werden können, so daß bei genügender Kompression den Kondensatorplatten<br />
eine fast ebene Fläche gegenübersteht. Außerdem ist dadurch immer ein<br />
solcher Abstand hergestellt, daß allzugroße Annäherung und auch Funkenübergänge<br />
vermieden werden können. Die Verwendung von sog. «schmiegsamem<br />
Elektroden mit Gummiäber^ug hat sich, außer in besonderen Fällen, nicht bewährt.<br />
Die Gestaltung des Feldes ist unter solchen Elektroden völlig unkontrollierbar.<br />
Gerade die Spityenmrkung, die man vermeiden will, tritt hier besonders stark auf,<br />
da die Erhabenheiten der Körperoberfläche den geringen Elektrodenabständen<br />
gegenüber viel mehr ins Gewicht fallen. Zwischenlagen von Fil\ andern daran<br />
nichts, zumal Durchfeuchtung des Filzes schon infolge der Perspiratio insensibilis<br />
unvermeidbar ¡st. Diese Elektrodenarten sind auch aus anderen, bereits erwähnten<br />
Gründen abzulehnen (s. auch KOWARSCHIK, GEBBERT).<br />
Besonders können Verbrennungen unter solchen Gummielcktroden dann auftreten,<br />
wenn die Elektroden älter sind. Der Gummi wird durch die Kurzwellcnwirkung<br />
mit der Zeit zersetzt und wird leitend ; an den betreffenden Stellen können<br />
dann Funken übergehen und Verbrennungen verursachen. Gefährlich ist auch<br />
das Einlegen von Zellstoff zwischen Elektroden und Körper, besonders wenn er<br />
feucht ist. Durch das ungleichmäßige Anliegen des Zellstoffes entstehen Verdichtungen<br />
des Feldes. Das ist gefährlich bei Behandlung offener Wunden und Fisteln,<br />
wenn die Verbandstoffe mit Sekret durchnäßt sind. Man behandelt sie deshalb am<br />
besten ohne Verband, nachdem sie vorher möglichst gut getrocknet sind.<br />
Die Gefahren der Kurzwellenbehandlung sind demnach im ganzen gering, jedenfalls<br />
viel geringer als diejenigen der alten Diathermie. Etwa auftretendes stärkeres<br />
Hitzegefühl ist stets ein Warnungszeichen, das beachtet werden muß. Besonders<br />
gefährdet sind dabei Patienten mit Störungen der Sensibilität. Hierauf ist also stets<br />
zu achten. Außerdem sind alle Kranken darauf aufmerksam zu machen, daß sie<br />
unangenehme Empfindungen, besonders Hitzegefühl, sofort melden sollen.<br />
Bei Behandlung entzündlicher und eitriger Prozesse kommen die Gefahren der<br />
Aktivierung hinzu, die durch Überdosierung verursacht werden. Leider wird an<br />
vielen Stellen immer noch gern stereotyp mit der gleichen Dosis und Dauer behandelt,<br />
einerlei, ob akute oder chronische Krankheiten vorliegen. So können durch<br />
zu starke Behandlung akute oder subakute Prozesse aktiviert werden, bei eitrigen<br />
Entzündungen kann unter Umständen sogar Generalisicrung erfolgen. In der<br />
falschen Dosierung liegt danach eine der größten Gefahren.<br />
Die Anwendung von Elektroden ohne Luftabstand, insbesondere von gummiüberzogenen<br />
«schmiegsamen» Elektroden ohne Luftabstand, ist-abgesehen von einzelnen<br />
Indikationen - als Kunstfehler anzusehen. Metallische Fremdkörper, die in<br />
Körpergewebe eingebettet sind, bilden keine Kontraindikation gegen Kurzwellcndurchflutungcn.<br />
Nach Versuchen von EBBINGHAUS ist ihre Erwärmung nicht so<br />
stark, daß Verbrennungen oder Gewcbsschädcn auftreten können. Im lebenden Gewebe<br />
tritt erhebliche Erhitzung nur ein, wenn ein Fremdkörper frei in einer offenen<br />
Wunde liegt. Von außen der Haut aufliegende Metallteile werden jedoch stark<br />
erhitzt, so daß es zu Verbrennungen kommen kann.<br />
"J
XI. Experimentelle Infektionen und Spontanerkrankungen<br />
Vor der therapeutischen Verwendung der kurzen elektrischen Wellen bei Menschen<br />
haben wir seit 1927 Versuche mit künstlichen Infektionen bei Tieren angestellt.<br />
Zuerst wurden tuberkulös infizierte Meerschweinchen der täglichen Behandlung im<br />
Feld einer 3-m-Welle ausgesetzt. Eine Heilung der Tuberkulose, die bekanntlich beim<br />
Meerschweinchen ungemein progredient zu sein pflegt, wurde zwar nicht erreicht; im<br />
allgemeinen zeigte sich in den histologischen Präparaten, die nach der Sektion von den<br />
behandelten Tieren hergestellt waren, eher eine Neigung zu den zirrhotisch-prolifcrativen<br />
Formen, während bei den unbehandelten Tieren die exsudativen Prozesse überwogen.<br />
Die Lebensdauer der behandelten Tiere war im Durchschnitt länger.<br />
Mit HAASE gemeinsam wurden diese Versuche in der Weise weiter fortgesetzt,<br />
daß Tuberkelbazillen den Meerschweinchen ins Kniegelenk eingespritzt wurden.<br />
Nachdem die Knie dann 4 Wochen lang täglich 15 Minuten dem Kondensatorfeld<br />
ausgesetzt worden waren, wurden die Tiere getötet. Immer waren die anatomischen<br />
Veränderungen in den Kniegelenken bei den behandelten Tieren geringer als<br />
bei den unbehandelten. Dagegen ist es nicht gelungen, die Allgemeininfektion<br />
hintanzuhalten, was bei der außerordentlich großen Infektiosität des menschlichen<br />
Tubcrkelbazillus für Meerschweinchen verständlich ist. Soll doch nach<br />
manchen Autoren schon ein einziger in die Blutbahn eingeschwemmter Tuberkelbazillus<br />
genügen, um eine tödliche Infektion herbeizuführen. Bei einer Versuchsreihe<br />
von 20 Kaninchen, deren beide Knie tuberkulös infiziert worden waren,<br />
wurden nach Behandlung des einen Knies immer im durchfluteten Knie geringere<br />
anatomische Veränderungen gefunden. Wenn auch völlige Heilungen nicht erreicht<br />
werden konnten, so zeigen doch diese Befunde übereinstimmend, daß eine<br />
Beeinflussung tuberkulöser Prozesse selbst unter ungünstigen Verhältnissen möglich<br />
ist.<br />
Einwandfreie Ergebnisse hatte FPLOMM bei Fröschen, denen er Staphylokokken<br />
in den subkutanen Lymphraum des Unterschenkels einimpfte. Die Tiere wurden<br />
dann jmal an 5 aufeinanderfolgenden Tagen im Kondensatorfeld behandelt. Während<br />
bei den unbehandelten Fröschen starke Anschwellungen der Unterschenkel<br />
mit Infiltratbildung eintraten, war bei den behandelten Tieren außer einer geringen<br />
entzündlichen Reaktion an der Inzisionsstelle kein krankhafter Befund nachzuweisen<br />
(Abb. 99).<br />
Wurden mit Methylenblau vitalgefärbte Staphylokokken in eine Wunde beim<br />
Frosch eingeimpft, so ließ sich eine schnellere Resorption des Farbstoffes bei den behandelten<br />
Tieren nachweisen als bei den unbehandelten. Auch die Resorptionsvorgänge<br />
an Wunden werden demnach durch die Kondensatorfeldbehandlung<br />
beschleunigt.<br />
Während uns die eben beschriebenen Ergebnisssc, soweit sie am Warmblüter<br />
gewonnen sind, nur teilweise befriedigten, waren andererseits die Erfolge bei<br />
spontanen eitrigen Erkrankungen von Kaninchen ausgezeichnet.<br />
Fis handelte sich dabei um cinc Erkrankung, die uns von Veterinär-medizinischer Seite<br />
als «Vénerie* der Hasen bezeichnet worden ist.<br />
An den verschiedensten Körperstcllcn traten Abszesse auf, die nach einiger Zeit ihres<br />
Bestehens durchbrachen und einen sehr zähen gallertigen weißgraucn Eiter entleerten.<br />
Mikroskopisch fanden sich darin Streptokokken in sehr großer Zahl sowie dicke, kurze<br />
Stäbchen.<br />
116
Wenn auch die einzelnen Abszesse nach der Entleerung oft von selbst zurückzugehen<br />
pflegten, so traten doch bei den Tieren immer wieder neue Abszesse an den verschiedensten<br />
Körpcrstcllen auf, die immer größer wurden; die Tiere gingen schließlich an der<br />
Erkrankung zugrunde.<br />
Derartige Tiere, die uns von Händlern auf Bestellung geliefert worden waren,<br />
wurden im Kondensatorfeld behandelt mit dem Ergebnis einer raschen Heilung in<br />
sämtlichen Fällen.<br />
Abb. 99 : Behandlung von staphylokokkeninfiziertem Froschbein (nach PFLOMM)<br />
Bei zwei Tieren waren zufällig Abszesse an symmetrischen Körperstellen aufgetreten;<br />
es wurde jeweils der größere der Abszesse behandelt mit dem Erfolg, daß nach 3-4 Tagen<br />
der behandelte Abszeß völlig abgeheilt war. Der andere dagegen verschlimmerte sich<br />
weiter, bis er ebenfalls durch Kurzwellenbehandlung später geheilt wurde. Selbst ein<br />
sehr großer plegmonöser Abszeß, der bei einem Kaninchen zwei Drittel des ganzen<br />
Kopfes ergriffen hatte, wobei Orbita und Bulbus der einen Seite völlig von Eiter erfüllt<br />
waren, konnte ausgeheilt werden. Das Tier, das schon vollkommen apathisch dagelegen<br />
hatte, gesundete bis auf den Verlust des Auges völlig.<br />
Ratten mit künstlich erzeugter otogencr Meningitis wurden von OSTERTAG und<br />
mir im Kurzwellenfeld behandelt und größtenteils geheilt, während die Kontrolliere<br />
eingingen. Die histologische Untersuchung nach Tötung der behandelten<br />
Tiere ergab völlige Abheilung der entzündlichen Vorgänge.<br />
Ausgedehnte Versuche mit überimpften Krankheiten haben LEVADITI, ROTH<br />
SCHILD, AUCLAIR, HABER, VAISMAN und SCHOEN ausgeführt, und zwar mit folgenden<br />
Erregern : Spirochätosc der Hühner, Trypanosoma Eviansi bei Mäusen, Lyssa,<br />
Herpes bei Mäusen, Syphilis der Mäuse und Kaninchen, Rckurrens bei Ratten.<br />
Durch Kurzwellenwirkung wurden einige diese Krankheiten völlig geheilt, einige<br />
in ein latentes Stadium übergeführt. Individuelle Faktoren scheinen dabei mitzuspielen.<br />
Lyssa, Herpes und Spirochätosc der Hühner blieben unbeeinflußt.<br />
"7
Bei Druse und abszedierenden eitrigen Entzündungen bei Pferden erzielte VAN<br />
DRIEST ausgezeichnete Erfolge.<br />
Über Behandlungsergebnisse bei Tieren mit Mikrowellen berichtet WÜLLER an<br />
ioo Fällen mit verschiedenen rheumatischen Erkrankungen und Nephritis.<br />
SCHOENERT& SCHMITT behandelten hauptsächlich Krankheiten des Harnapparates<br />
und geben 75% Besserungen, davon jo% völlige Heilungen an.<br />
XII. Pathologisch-physiologische Grundlagen der Heilungsvorgänge<br />
bei Entzündungen<br />
Die Heilwirkungen der Kurzwellen beruhen zweifellos auf mehreren Faktoren,<br />
die sich, richtige Dosierung vorausgesetzt, in glücklicher Weise ergänzen. Im<br />
Vordergrund dürfte die Wirkung auf die Zellmembranen stehen ; ebenso wichtig ist<br />
die Gefäßerweiterung, die hauptsächlich in den<br />
Arteriolen eintritt, und zwar in allen Gebieten,<br />
/<br />
/<br />
r<br />
r<br />
A<br />
--»-" U *--<br />
\ \<br />
^<br />
19 W 60 SO<br />
" Sekunden<br />
•^<br />
fe -m<br />
Abb. 100: Wärmeanstieg im Terpentinabszeß<br />
im Bein eines Hundes.<br />
— = im Abszeß gemessen, =<br />
im gesunden Gewebe daneben,<br />
—- im danebenlicgenden gesunden<br />
Bein an korrespondierender<br />
Stelle. (AusKlin.Wochenschr. 1930,<br />
S.23J4, Julius Springer, Berlin)<br />
die vom Feld betroffen werden. Dies beweisen<br />
die Untersuchungen von BACHEM, GERSTEN,<br />
LADEBURG, noch mehr aber die Ergebnisse von<br />
GLOZ am Augenhintergrund des Menschen.<br />
Diese Untersuchungen zeigen deutlich, daß es<br />
sich nicht um kuti-viszerale Reflexe handeln<br />
kann, denn die Gefäßerweiterungen wurden<br />
durch andersartige Erwärmung nicht hervorgebracht.<br />
Es kann wohl angenommen werden,<br />
daß die Wärme eine gewisse Rolle spielt;<br />
wesentlich dürfte aber nicht die meßbare Wärme<br />
sein, sondern die Mikroerwärmung in den<br />
durchfluteten Gebieten. Wahrscheinlich hängt<br />
die Gefäßerweiterung mit der Mobilisierung des<br />
Histamins zusammen.<br />
Die Wärmezufuhr als solche kommt wahrscheinlich<br />
besonders bei der Beeinflussung der<br />
Erreger in Krankheitsherden in Frage. Wir<br />
denken daran besonders bei der Wirkung auf Herde, die vom Gefäßsystem abgeschlossen<br />
sind und daher nicht durch den Blutstrom gekühlt werden, wie Abszesse<br />
und Tuberkel. Daß ¡n Abszessen tatsächlich die Temperatur stärker ansteigt<br />
als in anderen Gebieten, zeigen Versuche mit Temperaturmessung in künstlichen<br />
Abszessen bei Tieren.<br />
Abb. 100 gibt den Temperatur verlauf ¡n einem künstlichen im Bein eines Hundes<br />
erzeugten Terpentinabszeß wieder, zum Vergleich außerdem den Verlauf im danebenücgenden<br />
gesunden Gewebe. In der dritten Kurve ¡st der Wärmeanstieg im<br />
gesunden Bein an der korrespondierenden Stelle wiedergegeben ; beide Beine lagen<br />
im Kondensatorfeld nebeneinander.<br />
Während sich im gesunden Teil der Wärmeanstieg sehr bald verringert und<br />
nicht über einen bestimmten Punkt hinausgeht, steigt die Temperatur im Abszeß<br />
viel stärker an. Dieser Befund ist verständlich, wenn man sich die Durchblutungs-<br />
118
Verhältnisse klarmacht. Im Gesunden findet durch den Blutstrom eine fortlaufende<br />
Entwärmung statt; durch Hyperämie während der Feldeinwirkung nimmt die<br />
Durchblutung zu, so daß nach einiger Zeit ein Gleichgewichtszustand zwischen<br />
Wärmezufuhr und Kühlung eintritt. Der Abszeß andererseits ist von der allgemeinen<br />
Blutbahn abgeschnitten; seine Entwärmung erfolgt bedeutend langsamer.<br />
Hierzu kommt vielleicht noch eine unmittelbare Wirkung der Kurzwellen auf<br />
die Krankheitserreger, doch, sind hierüber die Akten noch nicht geschlossen.<br />
Die Hyperämie ist einer der Hauptfaktoren für die Heilwirkung, und zwar liegen<br />
die Verhältnisse im KW-Feld besonders günstig dadurch, daß es sich um aktive<br />
Hyperämie handelt, die durch Vermehrung des arteriellen Zuflusses hervorgerufen<br />
ist (S.81). Hiermit ist wahrscheinlich auch eine Änderung der Durchlässigkeit<br />
der Kapillaren verbunden, worauf PFLOMM besonders hingewiesen hat.<br />
Die Austauschvorgänge zwischen Blut und Gewebe werden verbessert, und es<br />
ist experimentell nachgewiesen, daß die resorptiven Vorgänge durch das KW-Feld<br />
begünstigt werden. Hierzu kommt das Verhalten der Leukozyten. Wie mehrfach<br />
gezeigt worden ist, wandern die Leukozyten nach den durchfluteten Gebieten hin<br />
und sammeln sich dort in den Gefäßen an. Die Diapedcse wird erheblich vermehrt.<br />
Dazu kommt noch, daß die Phagozytose angeregt wird (JÖRNS).<br />
Diese Vorgänge hängen eng mit physiko-chemischen Veränderungen im Gewebe<br />
zusammen. Die Zunahme der H-Ioncnkonzentration unterstützt die natürlichen<br />
Abwehrvorgänge, denn sie steigt bei allen Entzündungen auch spontan<br />
(SCHADE).<br />
Die Reaktionsverschiebung des Serums nach der sauren Seite wirkt auf den<br />
Flüssigkcitsaustausch, und zwar führt nach SCHADE und CLAUSZEN Blutazidose<br />
zu einer Kapillarvcrändcrung im Sinn verstärkter Resorption, so daß eine Säuerung<br />
des Serums einen vermehrten Blutstrom nach den Kapillaren hin zur Folge<br />
haben müßte.<br />
Die Änderungen im Blutzuckergchalt zeigen den Einfluß auf physiko-chcmischc<br />
Austauschvorgänge, ebenso wie die von HILDEBRANDT nachgewiesene Mobilisierung<br />
des Histamins.<br />
Tatsachlich scheint nach Kurzwellenbehandlung Wasser aus dem Serum ins Blut zu<br />
wandern, wie aus dem von NÖLLER geführten Nachweis einer Herabsetzung des Brechungsindex<br />
im Serum hervorgehen dürfte.<br />
PFLOMM weist daraufhin, daß der Wärmeaustausch von den Geweben zum Blut<br />
unter Zuhilfenahme einer Flüssigkeitsströmung vor sich gehen muß. Wie wir<br />
schon vorhin gesehen haben, findet in den vom Kondensatorfeld beeinflußten<br />
Gewebselementen eine stärkere Wärmespeichcrung statt als im Blut, das nur<br />
kurze Zeit in diesem Bezirk verweilt und immer wieder durch Nachstrom kühlerer<br />
Blutmassen ersetzt wird. Dadurch entsteht ein Wärmcgefallc Gewebe-Blut, wie<br />
unteren anderem aus der parabolischen Krümmung der Kurven des Wärmeanstiegs<br />
in lebenden Geweben hervorgeht (S. 62-64). Die Wärmclcitung allein<br />
genügt nicht, um dieses Gefälle auszugleichen, es muß eine Konvcktion hinzukommen,<br />
ein Austausch wärmerer und kühlerer Flüssigkeit. Wie PFLOMM<br />
in Modellversuchen nachgewiesen hat, geht der Saftstrom mit dem Wärmestrom.<br />
PFLOMM fertigte cinc «künstliche Kapillare» in Gestalt eines Schlauches aus Schwcinsblase<br />
an, die von einer in einem Glaszylinder befindlichen ElcktrolytlÖsung umgeben war.<br />
Im Inneren der «Kapillare» befand sich die gleiche Lösung, die aber ¡n dauernder<br />
119
Strömung unter gleichbleibendem Druck erhalten wurde; durch Kühlung wurde die<br />
Temperatur stets auf derselben Stufe gehalten.<br />
Wenn im KW-Feld die äußere Flüssigkeit erwärmt wurde, so erfolgten ¡n ihr alsbald<br />
eine Druckabnahme und eine Zunahme der Konzentration. Dadurch ist erwiesen, daß -<br />
offenbar infolge des Temperaturunterschiedes - eine Änderung der osmotischen Verhältnisse<br />
zustande gekommen ist, daß die wärmere Flüssigkeit durch die Membran nach<br />
der kühleren Seite hinströmt. Bei Verwendung von RiNGERScher Lösung stieg in erster<br />
Linie die Kalziumkonzentration in der stärker erwärmten Flüssigkeit an, während Natrium<br />
und Kalium nicht so starke Unterschiede aufwiesen.<br />
Schon auf rein physikalischem Weg kommt demnach ein gesteigerter Flüssigkeitsaustausch<br />
zwischen Kapillaren und Geweben zustande. Inwieweit Wirkungen<br />
des KW-Feldes auf die Erreger bei den Heilungsvorgängen beteiligt sind, läßt<br />
sich nicht entscheiden; die Forschungen sind noch nicht abgeschlossen.<br />
Aus den vorliegenden Ergebnissen geht wieder die Bedeutung der richtigen<br />
Dosierung hervor. Die Kapillarerweiterung ist eine Funktion der Dosis, und insbesondere<br />
bei geschädigten Kapillaren kann Überdosierung ungünstige Wirkungen<br />
haben und sogar einen Spasmus hervorrufen. Bei eitrigen Erkrankungen<br />
können durch zu starke Erwärmung die Leukozyten geschädigt werden; die Erscheinungen<br />
bei der Perlschnurbildung (S. 67) erklären uns, warum eine bestimmte<br />
Dosis ganz anders wirken kann als eine andere.<br />
Bei Abszessen kann durch Uberdosíerung der leukozytärc Schutzwall durchbrochen<br />
werden, so daß die Entzündung weitergeht oder der Prozeß sogar<br />
generalisiert werden kann.<br />
Durch diese experimentell erhärteten Tatsachen sind gegenteilige Behauptungen<br />
ohne weiteres widerlegt. Die weitere Behauptung, daß schwache Dosen und kurzzeitige<br />
Durchflutungen von j Minuten Dauer «symbolische Handlungen» seien,<br />
¡st ad absurdum geführt durch die Ergebnisse der Kurzwellenprovokation (S. 256).<br />
Hierbei hat sich ergeben, daß schon kurzzeitige schwache Durchflutungen von<br />
tiefliegenden Eiterherden starke, im Blutbild nachweisbare Reaktionen des gesamten<br />
Körpers hervorrufen.<br />
Die Bedeutung der richtigen Dosis geht aus den vorliegenden Ergebnissen von<br />
neuem hervor. Bei Kombination mit Arzneibehandlung wirkt sich die UKW-<br />
Therapie besonders günstig aus. An radioaktiven «markierten» Arzneimitteln hat<br />
STROHL nachgewiesen, daß sie sich im durchfluteten Gebiet besonders anreichern.<br />
120
B. Technisch-klinischer Teil<br />
I. Kurzwellenapparate und ihre Handhabung in der Praxis<br />
i. Röhrenapparate<br />
Zur praktischen Kurzwellcntherapie hat sich heute der Röhrenapparat so gut wie<br />
allgemein durchgesetzt, da die Ausbeute an Leistung wesentlich besser ist als bei den<br />
Funkens trecken geraten. Das Dämpfungsdekrement, das nach jedem Funkenüber-<br />
Abb. loi : 400-Watt-Röhre und Gleichrichterröhre<br />
gang entsteht (S. 24), wird beim Einschalten des Dielektrikums, also bei der Behandlung<br />
von Patienten, stark vergrößert, so daß die Leistung erheblich abfällt.<br />
Demgegenüber geht die Leistung der Röhrenapparate nur um den Betrag der im<br />
Körper absorbierten Energie zurück. Ganz allgemein können durch Röhrenapparate<br />
höhere Leistungen hervorgebracht werden; dies ¡st schon in-Anbetracht der<br />
Abstandsbchandlung wesentlich, da die geringe Energie der Funkenapparate vielfach<br />
nicht genügt, um die Luftabstände an den Elektroden zu überbrücken.<br />
Während man früher Senderöhren benutzt hat, wie sie auch bei Sendern für<br />
Télégraphie überall üblich sind, werden heute Speziairöhren für Therapie gebaut.<br />
Sic können besonders stark belastet werden und haben lange Brenndauer.<br />
Da die Glühkathoden aus reinem Wolfram ohne verdampfbaren Zusatz bestehen,<br />
tritt kein Nachlassen der Leistung infolge Verminderung der Emission ein.<br />
Die 'Lebensdauer àct Röhren Hegt zwischen 1000 und 3000, ja oft über 4000 Stunden.<br />
Eine oft verwendete Type ist in Abb. 101 wiedergegeben. Der axial liegende Glühfaden<br />
wird mit 20 V geheizt, die Anodenspannung beträgt 4000 V.<br />
121
Um die Leistung zu erhöhen, kann man zwei Röhren in «Gegentakt» schalten, wie<br />
dies bei dem in Abb. 103 wiedergegebenen Apparat der Fall ist.<br />
Die Leistung beträgt bei den meisten im Handel befindlichen kleineren Röhrenapparaten<br />
etwa 200-400 Watt, bei den größeren Apparaten mit zwei Röhren im<br />
Gegentakt 500-600 Watt. Mit<br />
diesen lct2teren Apparaten läßt<br />
sich schon Fiebertherapie durchführen.<br />
Für die Bedürfnisse der Allgemeinpraxis<br />
genügt eine Leistung<br />
von 200 W in den meisten Fällen,<br />
da in der Hauptsache die Behandlung<br />
oberflächlicher Prozesse in<br />
Frage kommt oder solcher tiefer<br />
liegender Erkrankungen, die verhältnismäßig<br />
geringe Leistung erfordern,<br />
etwa Gastritis, Karditis,<br />
Angina pectoris, Entzündungen<br />
an den Sexualorganen bei mageren<br />
Frauen, arthritische Erkrankungen<br />
an kleineren Gelenken, Neuralgien<br />
und Neuritiden.<br />
Durch gesetzliche Verordnungen<br />
- zu denen niemals ein ärzt<br />
licher Sachverständiger gehört<br />
worden ist - sind in Zukunft nur<br />
folgende Wellenlängen gestattet :<br />
12,5 cm, 7,}7 m, 11,06 m und<br />
22,12 m, die mit größter Genauig<br />
Abb. 102 : Der erste Apparat, mit dem menschliche<br />
Krankheiten behandelt wurden, 400 W<br />
(1927)<br />
keit eingehalten werden müssen. Bei den meisten Apparaten ist daher die Selbsterregung<br />
nicht mehr ganz exakt genug, man muß mit Quar^steuerung arbeiten,<br />
Abb. 103 : Röhren-Aggregat mit Schwingkreis<br />
122
weil die Schwingquarze eine bestimmte Eigenfrequenz haben, die mit größter<br />
Exaktheit eingehalten wird.<br />
Beim Arbeiten mit Mikroivellen besteht der Vorteil, daß sie besonders gut gegen<br />
die Außenwelt abgeschirmt werden können. Wenn man in Kellern arbeitet, dringt<br />
keine nennenswerte Strahlung ins Freie.<br />
Abb. 104. 400-Watt-Gerät geöffnet (SRW)<br />
Alle Geräte sind heute so in Blech eingekapselt, daß keine elektromagnetische<br />
Strahlung nach außen dringt. Ganz eliminieren läßt sie sich allerdings nicht, da der<br />
Bchandlungskrcis strahlt. Dies um so mehr, je größer die von ihm umspannte<br />
Fläche ist. Die Behandlungskrcise sollten deshalb so klein wie möglich werden.<br />
Die Kopplungselemente und Sperrkreise liegen innerhalb des Gehäuses, in seinem<br />
unteren Teil sind die Transformatoren zur Herstellung der Heiz- und Anoden-<br />
123
Spannung untergebracht. Während die letztere gewöhnlich einen festen Wert hat<br />
(4000-6000 V), kann die Heizspannung verändert werden (meist im Bereich von<br />
15-25 V). Dadurch regelt man den Anodenstrom und damit die Schwingleistung.<br />
Die Größe der Schwingleistung ist aber keineswegs aus der Voltzahl des Heizstromes<br />
zu entnehmen, sondern die Verhältnisse liegen sehr kompliziert (S.17ÍT).<br />
r \ C\ f\ f\ f\ H Durchlaufende Welle<br />
c\ r\ r\ r\ r\ r\ Haibweic<br />
Abb. 105 : Tragbarer Apparat von Siemens<br />
Eine Gefährdung durch niederfrequente Netzspannung ist ausgeschlossen, da<br />
nur die Hochfrequenz führenden Elemente nach außen durchgeführt sind und<br />
keine Berührung mit den Niederfrequenzteilcn haben. Berührung des äußeren<br />
Schwingkreises kann höchstens zu Verbrennungen, nie aber zu elektrischen Schlägen<br />
führen.<br />
Abb. 106. 400-Watt-Gerät<br />
mit Illcktrodcn-Haltcarmcn<br />
Abb. 107. 200-Watt-Gerät<br />
Außerhalb des Gehäuses Hegt nur der der eigentlichen Behandlung dienende<br />
Teil des Sekundärkreises, der im Inneren mit dem Primärkreis gekoppelt ist. Er<br />
muß immer in Resanan^ zum Primärkreis stehen. Zur Abstimmung dient ein Drehkondensator,<br />
der von außen durch einen Knopf bedient wird. Der eigentliche<br />
Behandlungskreis besteht nur aus zwei isolierten Kabeln, die an die Elektroden<br />
angeschlossen werden.<br />
124
Die Abb.io6-io8 zeigen Geräte verschiedener Bauart.<br />
Die Schalttafeln der Apparate enthalten in jedem Fall einen Schalter zum Einund<br />
Ausschalten, einen Knopf zur Regulierung der Leistung und einen Knopf<br />
für den Abstimmkondensator sowie ein Meßinstrument oder eine Glimmlampe als<br />
Resonanzanzeiger. Nach dem Einschalten des Stromes soll etwas gewartet werden,<br />
bei Apparaten mit Gleichrichtern und mit Wasserkühlung mehrere Minuten, je<br />
nach Vorschrift, ehe man die Anodenspannung<br />
einschaltet. Danach wird die<br />
Heizspannung allmählich erhöht, bis<br />
Schwingungen auftreten. Befindet sich<br />
der Patient im Kondensatorfeld, dann<br />
wird mit dem anderen Knopf abgestimmt.<br />
Eine nicht oft genug zu wiederholende<br />
Regel ist die, daß immer nur<br />
bei Resonanz gearbeitet werden soll.<br />
Durch Hin- und Herdrehen des Resonanzknopfes<br />
stellt man den Resonanzpunkt<br />
am maximalen Ausschlag des<br />
Instrumentes oder am stärksten Leuchten<br />
der Glimmlampe fest. Erst dann<br />
wird der Heizstrom weiter bis zur gewünschten<br />
Höhe verstärkt, am Schluß<br />
wird nochmals nachgestimmt. Es soll<br />
immer nur einer der beiden Knöpfe betätigt<br />
werden\ niemals soll am Leistungsregler und<br />
Abstimmknopf gleichzeitig gedreht werden.<br />
Auch im Verlauf der Behandlung ist<br />
gelegentlich nachzustimmen, da durch geringe<br />
Verlagerung des Kranken die<br />
Resonanz gestört werden kann. Die<br />
Stromstärke ist durch Veränderung _ des Abb. 108: Apparat «Portable» 200 Watt<br />
heistungsreglers und niemals durch Ande- (Purtschcrt, Luzcrn)<br />
rung der Resonanz einzustellen. Kann aus<br />
irgendeinem Grund die Energie nicht genügend herabgesetzt werden, so kann<br />
man die Feldstärke durch Vergrößern des Plattcnabstandcs verringern.<br />
Erfahrungsgemäß wird gerade gegen diese Regel sehr oft verstoßen. Eine<br />
große Vereinfachung in der Handhabung der Geräte ist deshalb die automatische<br />
Resonanzabstimmung, wie sie in vielen modernen Geräten eingebaut ist, so der<br />
von PÄTZOLD & KEBBEL entwickelte Servomat. Beim Abweichen vom Resonanzpunkt<br />
entstehen Stromschwankungen, die dazu benutzt werden, einen Motor<br />
in Bewegung zu setzen. Dieser verändert die Kapazität eines Abstimmkondensators<br />
im Patientenkreis in der Weise, daß sie sich der veränderten Lage anpaßt.<br />
Die Abstimmung wird solange verändert, bis der Resonanzpunkt wieder erreicht<br />
ist. Beim Einschalten des Gerätes läuft der Abstimmkondensator in den<br />
Resonanzbereich hinein. Wird daher die Resonanzlage etwas durch die Bewegungen<br />
der Patienten verschoben, so regelt der Kondensator innerhalb von<br />
1-2 Sckundeunach. Nach Anlegen der Elektroden müssen daher nur nochLcistung<br />
und Behandlungsdauer eingestellt werden. Die Energiezufuhr ist von viel größerer<br />
Konstanz, als wenn von Zeit zu Zeit nachgestimmt werden muß (Abb. 109).<br />
I2J
2. Erzeugung und Anwendung von Wellen unter 1 m, Mikrowellen<br />
(Dezimeter- und Zcntimctcrwcllen)<br />
Mit den in der Rundfunktechnik üblichen Senderühren und Schaltungen ist eine<br />
Erzeugung von Wellen unter i m mit für Thcrapiczwcckc ausreichenden Leistungen<br />
nicht möglich, denn die inneren Röhrenkapazitäten, welche die Frequenz mit<br />
Abb. 109. Wirkung des Abstimmautomaten bei Durchflutung des 1. Knies.<br />
Elektroden 0 = 13 cm, Hautabstand 5 cm.<br />
Obere Kurve ohne, untere mit Resonanzautomat.<br />
a Gerat eingeschaltet; b Gerät abgestimmt, Knie mitten zwischen den Klcktrodcn (A);<br />
c Knie um etwa 2 cm aus LUektrodenmitte verschoben (B); d Knie wieder in Mitte (A);<br />
c Knie wieder um 2 cm seitlich verschoben (B). (Nach BARTH)<br />
bestimmen, treten zu stark in Erscheinung. Durch besonders kapazitätsarmen Aufbau<br />
und Ausnutzung der Röhrenkapazität als Element des Schwingkreises ist man<br />
bei ausreichenden Leistungen (etwa i;o Watt Hochfrequenz) bis 40 cm Wellenlänge<br />
heruntergekommen, womit aber die unterste Grenze für Röhren des üblichen<br />
Systems (Dreipolröhren) erreicht sein dürfte. Man arbeitet bei diesen Wellen<br />
nicht mehr mit geschlossenen Schwingkreisen, sondern mit Paralleldraht-(LECHER-)<br />
126
Systemen, da deren Aufbau genügend groß und stabil hergestellt werden kann,<br />
auch bei solch hohen Frequenzen. Für Wellen unter etwa ro cm verwendet man<br />
neuerdings «Topfkreisc» und Hohlraumrcsonatoren, deren Wirkung etwa mit der<br />
einer Orgelpfeife für Schallwellen zu vergleichen ist.<br />
• 1<br />
* V<br />
jUvJ<br />
•w*vH(i^<br />
IV H...JLWV H<br />
JWWVVAMJ<br />
y<br />
!.. ,<br />
Leistung 0<br />
,2 _T__<br />
Behandlungsdauer (min)<br />
4- IQ<br />
Leistung 0<br />
J 1 1 U H 1.<br />
io- 11 12 13 n 15 20<br />
Abb. no. Untcrlcibs-Durchflutung im Sitzen. Oben ohne, unten mit automatischer<br />
Abstimmung. Glasschalen-Elektrodcn 17 cm 0, EIcktroden-Hautabstand 3 cm (nach<br />
BARTH)<br />
Lecbersystem induktive<br />
¿weianoden - Magnetron Kopplung<br />
(mit Bêhn eines llektrons)<br />
Abb. in<br />
a 1 h Wellen lange<br />
Lechersystem<br />
Objekt<br />
Als Schwingungscrzcugcr werden bevorzugt Magnetfeld-Röhren verwendet,<br />
die für große Leistungen gebaut werden können. Ihr Arbeitsprinzip ist völlig<br />
anders als das der bekannten gittcrgcstcucrtcn Senderöhren (Dreipolröhren).<br />
Es besteht aus einer elektrisch beheizten Kathode und einer Anode, die zylindrisch<br />
darum angeordnet ist und aus 2, 4, 6 oder mehr voneinander isoHerten Segmenten<br />
besteht (Abb. in). An zwei gegenüberliegende Segmente ist ein LECHER-<br />
System angeschlossen, das auf die gewünschte Wellenlänge abgestimmt ist. Die<br />
127
ganze Röhre steckt konzentrisch in einem starken Magneten, der mit Gleichstrom<br />
gespeist wird. An den Anoden liegt positive Gleichspannung.<br />
Die von der Kathode emittierten Elektronen werden vonder Anodeangezogen,<br />
durch das Magnetfeld aber abgelenkt und können nur auf einer spiralförmigen<br />
Bahn um die Röhrenachse (Kathode) verzögert zur Anode gelangen. Durch den ungleichmäßigen<br />
Zustrom von Elektronen zur Anode ergibt sich eine hochfrequente<br />
Schwankung des Anodenstromes in dem<br />
Rhythmus, der durch die Abstimmung<br />
bzw. Eigenfrequenz des LECHER-Systcms<br />
zwischen den Anoden gegeben ist. Der<br />
Wirkungsgrad solcher Röhren liegt zwischen<br />
2j und 40%, je nach Größe.<br />
Abb. 112. Magnetron-Gehäuse eines<br />
Mikrowellen-Gerätes (Blaupunkt). In<br />
dem unteren Gehäuse befindet sich<br />
das Magnetron. Seitlich die Gleichrichterröhren<br />
Meistens werden Anodensysteme mit<br />
sechs und mehr Segmenten verwandt (Vielschlitzsystem).<br />
Die zylindrische Kathode<br />
wird dabei meist indirekt geheizt. Die<br />
Schwingkreise werden durch die einzelnen<br />
Segmente der Anode gebildet. Sie schwingen<br />
so. daß je zwei benachbarte Segmente<br />
einen Phasenunterschied von 180 0 gegeneinander<br />
haben, so daß alle Segmente mit<br />
gerader Nummer gleichphasig schwingen,<br />
diejenigen mit ungerader Nummer mit<br />
einem Phasenunterschied dazu von 18o°.<br />
Die Frequenz der Schwingungen hängt im<br />
wesentlichen von den geometrischen Abmessungen<br />
der Segmente ab. Die Energie<br />
wird durch ein Koaxialkabel einer Dipol-<br />
Antenne zugeleitet, deren Ausstrahlung<br />
auf den Patienten gerichtet wird.<br />
Die Tiefenwirkung der Dczimcterwcllenistbei<br />
der i-m-Welle und Anwendung<br />
im Kondcnsatorfcld sehr groß und scheint<br />
ihr Maximum bei etwa 50 cm Wellen<br />
länge zu haben. Von hier ab verringert sich die Eindringfähigkeit stark, besonders<br />
infolge der Divergenz durch Brechung an den einzelnen Grenzschichten. Ein Vorteil<br />
der Wellen zwischen etwa 10 und 20 cm ist aber nach Beobachtungen von<br />
PÄTZOLD und amerikanischen Autoren die gleichmäßige Erwärmung von Fett und<br />
Muskel durch diese Wellen, während bei längeren Wellen diese Erwärmung ungleichmäßig<br />
erfolgt.<br />
Ein Apparat der SRW hatte bereits 1939 eine Hochfrcqucnzlcistung von 600Watt<br />
bei 1 m Wellenlänge am Objekt.<br />
Geräte für 10 bis 20 cm Wellenlänge sind in Deutschland schon früher für Versuchszwecke<br />
gebaut worden. Ein von mir benutztes Versuchsgerät gibt Abb. 69<br />
wieder, einen serienmäßigen Apparat zeigt Abb.i20.RAYTHEON in USA hat einen<br />
Apparat mit 12-cm-WeIle und etwa 100 Watt Hochfrequenzleistung auf den Markt<br />
gebrachr, der mit einem Magnetron arbeitet. Die Möglichkeit der Bündelung ist<br />
allerdings wenig ausgenutzt, und die Energie wird daher nur mit großen Verlusten<br />
an den Patienten herangebracht.<br />
128
Das Hauptproblem dec Anwendung extrem kurzer Wellen ¡n der Therapie ist<br />
die Überleitung der Energie in den Körper. Bei etwa i m Wellenlänge hat man die<br />
Zuführung vom Sender zum Patienten als abgestimmte, nicht strahlende LECHER-<br />
Abb. 113a. Mikrowelkn-Gcrät A — 12,5 cm mit Strahler (Blaupunkt)<br />
Leitung ausgebildet und den zu bestrahlenden Körperteil in den Strombauch<br />
(Strommaximum) des Systems als kapazitiven Kurzschluß gelegt, indem die<br />
Leitungsenden mit isolierten Plattcnclcktroden versehen wurden. Dabei fließt der<br />
gesamte Hochfrequenzstrom durch den Körper.<br />
129
Für noch kürzere Wellen ist auch dieses Verfahren nicht mehr anwendbar, weil<br />
die mechanischen Abmessungen auch des LECHER-Systcms bereits zu klein werden,<br />
um eine rationelle Energiezuführung zum Patienten zu ermöglichen. Man ist deshalb<br />
in den letzten Jahren wieder mehr zur Strahlenfeldbchandlung übergegangen.<br />
Das Objekt liegt dabei nicht mehr im HF-Stromkreis, sondern wird von<br />
Strahler<br />
Transformator !<br />
Abb. 113b<br />
Instrument<br />
< Nete<br />
einer Antenne wie von einer Lampe angestrahlt. Dezimeter- und Zentimeter wellen<br />
lassen sich nämlich durch metallische Reflektoren sehr scharf bündeln und richten,<br />
ohne daß die mechanischen Abmessungen der Spiegel zu groß und unhandlich<br />
werden. Sie ähneln in ihrem Verhalten den Lichtwcllcn.<br />
Setzt man z. B. eine Dipolantenne, die eine Dczimcterwelle ausstrahlt, in den<br />
Brennpunkt eines parabolischen Hohlspiegels, so tritt aus dessen Öffnung die gegesamte<br />
Energie als paralleles Strahlenbündcl aus (von Verlusten abgesehen).<br />
Setzt man sie in den einen Brennpunkt eines rotationsclliptischcn Reflektors,<br />
schneiden sich sämtliche Strahlen im zweiten Brennpunkt der Ellipse, man kann<br />
mit dieser Anordnung eine fast punktförmige Konzentration der gesamten Energie<br />
erreichen.<br />
In der Praxis haben sich Schwierigkeiten ergeben, und zwar hauptsächlich dadurch,<br />
daß auch die HF-Strahlen, genau wie das Licht, beim Übergang in ein anderes<br />
Medium (hier von Luft m organische Stoffe) eine Ablenkung von ihrer Einfallsrichtung<br />
erfahren; durch die Inhomogenität des menschlichen Körpers wird<br />
130
dabei cine Konzentration sehr erschwert. Die Brechung beim Übergang aus Luft<br />
in Gewebe kann weitgehend herabgesetzt werden durch Verwendung dielektrischer<br />
Strahler, bei denen die Antenne in ein Material hoher DK eingebettet ist. Sie werden<br />
direkt auf den Körper (ohne Luftzwischenraum) aufgesetzt.<br />
Ihre Wirkung ist mit der ölimmersion bei Mikroskopen zu vergleichen.<br />
3. Funkenstreckenapparate<br />
Die Funkenstreckenapparate sind im Grund ebenso gebaut wie die Langwcllcndiathermieapparatc.<br />
Die Schwingungen werden in einem Primärkreis mit Löschfunkens<br />
trecken erzeugt, der mit einem Sekundärkreis gekoppelt ist. Um Kapazität<br />
und Selbstinduktion klein zu halten, müssen die Kreise ganz anders dimensioniert<br />
sein als bei den LW-Apparaten. Man kann auch die Selbstinduktion dadurch<br />
verkleinern, daß die Funkenstrecken kreisförmig bifilar angeordnet sind.<br />
Um genügende Leistungen erzielen zu können, muß die Anzahl derFunkcnstrccken<br />
groß sein, oft zehnmal so groß als bei LW-Apparaten.<br />
Die Wellenlänge ist beim Funkenapparat nicht einheitlich, sondern wir haben ein<br />
Wellengemisch, das um so stärker vorhanden ist, je größere Leistung dem Apparat<br />
entnommen wird. Wir können also im belasteten Kreis nur von einer dominierenden<br />
Welle sprechen, wenn wir die Wellenlänge kennzeichnen wollen.<br />
Der Unterschied bei Belastung hängt damit zusammen, daß ein unbelasteter<br />
Kreis im allgemeinen nur in einer bestimmten Frequenz schwingt, er ist selektiv<br />
und siebt aus dem vom Primärkreis ausgehenden Gemisch die dominierende Welle<br />
aus. Der belastete und daher gedämpfte Kreis dagegen siebt nicht mehr so ausgesprochen,<br />
sondern kann in verschiedenen Frequenzen schwingen. Man erhält<br />
daher auch eine viel breitere Resonanzkurve als beim Röhrenapparat.<br />
Auch die dominierende Wellenlänge ist bei den meisten Funkenapparaten nicht<br />
eindeutig festgelegt, weil sie von der Eigenfrequenz des Patientenkreises abhängt.<br />
Sehr kurze Wellen lassen sich daher nur bei Verwendung kurzer Kabel und kleiner<br />
Elektroden erzielen. Jede Veränderung im Schwingkreis und Dielektrikum (Bewegungen<br />
des Patienten, Feuchtwerden etwa zwischcngclegten Filzes usw.) kann<br />
dann Wellenlänge und Dosis verändern.<br />
Die Leistung der Funkenapparate sinkt bei Belastung außerordentlich stark ab,<br />
viel stärker als beim Röhrengenerator. Das hängt damit zusammen, daß die<br />
einzelnen Wellenzüge der gedämpften Welle viel rascher abklingen, als dies beim<br />
ungedämpften Kreis der Fall ist. Die Schwingungspausen werden dadurch wesentlich<br />
größer, und damit die Zeit, in der keine Energie wirksam ist. Es ¡st so wie bei<br />
einer Glocke, die mit Watte ausgestopft ist. Auch dabei klingen die Schwingungen<br />
schnell ab und setzen sich nicht fort.<br />
4. Leistungs- und Dosismessung<br />
Bei der Leistung eines Apparates müssen wir unterscheiden zwischen der Aufnahmeleistung,<br />
der Schwingleistung im leeren Kreis und der eigentlichen Nutzleistung,<br />
die stets wesentlich kleiner ist (s. Anhang). Die Nutzleistung allein ist ausschlaggebend<br />
für die Therapie (Therapicleistung). Wichtig ist, ob die Leistung<br />
bei Belastung konstant bleibt oder ob sie nur bei Leerlauf abgegeben wird.<br />
131
Es gibt bis jetzt noch kein sicher zuverlässiges Meßinstrument, um die therapeutisch<br />
wirksame Leistung unmittelbar zu bestimmen, sondern man ist auf Messungen<br />
an Phantomen angewiesen, die möglichst dieselbe Energie absorbieren wie der<br />
menschliche Körper. Man kann z.B. eine bestimmte Menge von Gewebebrei oder<br />
Fleisch in das Feld bringen und die Erwärmung in der Zeiteinheit bestimmen<br />
(kalorische Leistungsprüfung).<br />
Um verschiedene Apparate vergleichen zu können, ist es dann natürlich nötig, immer<br />
dasselbe Fleischoder Brei von derselben Zusammensetzung zu verwenden, da verschiedene<br />
Gcwebsartcn verschieden stark Energie absorbieren. Man kann auch stets eine Salzlösung<br />
verwenden, deren Konzentration allerdings so gewählt sein muß, daß sie nicht<br />
auf eine bestimmte Wellenlänge besonders stark anspricht. Dies ist wichtig, wenn Apparate<br />
mit verschiedenen Wellenlängen geprüft werden sollen. Die Gefäße müssen an Umfang<br />
mindestens so groß wie die Kondensatorplatten sein, denn bei kleineren Gefäßen werden<br />
die Kraftlinien hineingezogen, so daß sich unrichtige Werte ergeben.<br />
Man kann ferner Glüblampenphantome verwenden. Mit einer Glühlampe sind zwei<br />
Metallplatten von bestimmter Größe verbunden. Die Kondensatorplatten des<br />
Apparates werden auf diese Platten mit bestimmtem Luftabstand aufgelegt, die<br />
Helligkeit der Lampen wird photometrisch gemessen.<br />
Ganz ungefähr kann man die Leistung eines Apparates auch nach dem Wärmegefühl<br />
beurteilen. Am besten prüft man die Leistung einmal bei hohem und einmal<br />
bei niederem Widerstand, etwa indem man erst den Thorax mit großen Platten,<br />
dann den Unterschenkel längs mit kleineren Platten durchflutet. Besser bekommt<br />
man das Gefühl der Leistung bei Querdurchflutung des Gesichtes, wobei man das<br />
Wärmegefühl an Zunge und Zähnen spürt, also auch einen gewissen Anhalt für die<br />
Tiefenwirkung bekommt. Auch an der in das Feld gehaltenen Faust kann man die<br />
Wärmewirkung beurteilen. Selbstverständlich ist, daß bei allen Vergleichen dieselben<br />
Elektroden und dieselben Luftabstände genommen werden.<br />
Manche Apparate haben gute Leistung nur in einem bestimmten Widerstandsbercich,<br />
wie KOWARSCHIK gezeigt hat. Ein solcher Apparat würde also beispielsweise<br />
bei Behandlung des Kopfes gute Leistung geben, während bei Behandlung des<br />
Bauches, besonders bei fetten Menschen, die Leistung zu gering werden würde.<br />
Zur Dosismessung kann man entweder die entstehende Wärme in einem Modell<br />
oder an der Hautoberfläche messen oder die vom Schwingkreis absorbierte<br />
Energie bestimmen.<br />
NITSCHKE mißt die Hauttemperatur durch ein zwischen Elektrode und Haut eingelegtes<br />
Thermometer. Hierbei ist zu bedenken, daß am Thermometer die Feldlinien<br />
konzentriert werden. Deshalb müssen möglichst Thermometer mit sehr<br />
geringer Leitfähigkeit und DK benutzt werden. PÄTZOLD benutzt deshalb Quarz-<br />
Benzol-Thermometer. Jedoch sind auch Quecksilberthermometer geeignet, wenn<br />
sie quer zu den Kraftlinien liegen (SCHIERSMANN). Gute Ergebnisse wurden mit<br />
Hcxan-Brom-Thermomctern erzielt (BESSEMANS und VAN THIELEN).<br />
Bei der Behandlung von Gewebskulturen verwandte HASCHE ein besonderes<br />
Gasthermometer und konnte so die Temperaturen in Kulturen verzerrungsfrei<br />
messen. RAAB maß die Temperatur im Hühnerei mit einem Thermoelement, das<br />
wie eine Spule gewunden war. HASCHE entwickelte eine Maßeinheit, mit der Stromstärken,<br />
die noch keine Wärme erzeugen, bestimmt werden können. Er bezeichnet<br />
als «Grenzstromstärke» die Stromstärke, die eben noch eine thermische Wirkung<br />
hervorbringt.<br />
132
Als Meßgerät dient ein Schwingkreis, mit dem ein Milliamperemeter über einen Gleichrichter<br />
verbunden ist. Zur Eichung wird die Grenzstromstärke an der Reaktion eines<br />
physiologischen Präparates (z. B. Froschherz) festgestellt. Das Gerät muß für jedes Objekt<br />
neu geeicht werden.<br />
Die Erwärmung im Kondensatorfeld kann ferner durch Farbreaktionen gewisser<br />
Stoffe festgestellt werden, z.B. Quecksilber und Quecksilberjodid (RAAB), mit<br />
Farbumschlag von Gelb nach Rot bei 52°. Ein ähnliches Verfahren wandte KULKA<br />
an.<br />
Bestimmungen am Phantom sind von verschiedenen Autoren versucht worden,<br />
so von BELIKALA und TRENKEL.<br />
Eine Vorrichtung zur direkten Bestimmung der absorbierten Energie hat WENK<br />
entwickelt. Hierbei kann während der Behandlung durch Umschalten auf einen<br />
festen Phantomkreis jederzeit die Leistung in Watt abgelesen werden. Der Phantomkreis<br />
ist dauernd kapazitiv an den Behandlungskreis gekoppelt. Eine ähnliche<br />
Methode beschreibt TAGASI. MITTELMANN entwickelte ferner unter Mitarbeit von<br />
KOWARSCHIK ein Gerät, das den Grad der Dämpfung durch die behandelten<br />
Gegenstände mißt. Hierbei kann auch die abgestrahlte Energie bereits bei Leerlauf<br />
gemessen werden.<br />
CARTER bevorzugt die kalorische Methode im Spulenfeld und mißt im Kondensatorfeld<br />
mit Lampenphantomen.<br />
SCHAEFER und SCHAFER stellen fest, daß die Abtötungszeit von Tieren kein<br />
Maß für die Energiemenge ist.<br />
Als Amperemeter kann man Hitzdrahtinstrumente benutzen, doch sind die Angaben<br />
dieser Instrumente stets nur relativ zu bewerten.<br />
Schon die Metallkapseln der Instrumente wirken oft als Nebenschlüsse, durch Mctallteile<br />
an Klemmen u. dgl. können kapazitive Nebenschlüsse entstehen, die vollkommen<br />
unkontrollierbar sind. Diese Nebenschlüsse wirken schon deshalb ungleichmäßig, weil<br />
im Instrument sowohl OHMsche wie kapazitive und induktive Widerstände vorhanden<br />
sind, deren Verhältnis sich bei verschiedenen Wellenlängen in weiten Grenzen verschiebt,<br />
so daß auch die bei verschiedenen Wellenlängen erhaltenen Werte nicht miteinander<br />
vergleichbar sind.<br />
Besser als diese Geräte sind Thcrmokrcuze. Hier wird die Erwärmung eines<br />
dünnen Metallfadens durch Thermoelemente mit angeschlossenem Galvanometer<br />
gemessen und registriert.<br />
Die Meßinstrumente brauchen nicht unmittelbar in den Stromkreis eingeschaltet<br />
zu sein. Man kann sie ebensogut in einem besonderen Kreis anbringen, der<br />
nicht auf den Behandlungskreis abgestimmt ist.<br />
j. Strahlenschutz<br />
Die Störungen in Rundfunkempfängern, Elektrokardiographen usw. machen<br />
einen ausreichenden Schutz notwendig. In herkömmlicher Weise kann ein solcher<br />
Schutz dadurch herbeigeführt werden, daß der Sender mit einem Drahtkäfig umgeben<br />
wird (FARADAYScher Käfig).<br />
Wie PÀTZOLD gezeigt hat, müssen solche Käfige ringsum vollkommen geschlossen<br />
sein. Ist beispielsweise eine Seite offen, so können die übrigen Teile vom Sender aus in<br />
M3
der Art von Antennen in Schwingungen versetzt werden und verstärken so noch die<br />
Ausstrahlung. Ist eine Wandung in schlechtem Kontakt mit den anderen, so kann diese<br />
als Antenne wirken, da die räumlichen Abmessungen der Käfigwändc in der Größenordnung<br />
der halben oder viertel 'Wellenlänge liegen. Die Wände müssen deshalb nach<br />
allen sechs Seiten geschlossen sein, wenn sie einen genügenden Schutz bitten sollen.<br />
Die durchtretende Strahlung läßt sich leicht durch einen als Empfänger ausgestalteten<br />
Dipol mit Detektor nachweisen ; die beste Anordnung muß auf diese Weise experimentell<br />
festgestellt werden. Durch ungeeignete Schutzkäfige wird häufig die Strahlung nur umpolarisiert.<br />
Man erhält dann beispielsweise einen kräftigen Empfang bei waagerechter<br />
oder schräger Stellung der Antenne, während die vom Sender unmittelbar ausgehende<br />
Welle senkrecht polarisiert war.<br />
Wo es sich darum handelt, einen Schwingkreis nach außen abzuschirmen, ohne<br />
in der Hantierung am Kreis gestört zu sein, kann man Schutzkäfige aus Mctallketten<br />
und -litzen verwenden, die den Sender samt Sekundärkreis umgeben.<br />
Bei den vorhin beschriebenen Sendern in PÄT20LDscher Anordnung ist der<br />
Primärkreis durch einen Blechkasten genügend abgeschirmt; die Sekundärkreise<br />
können durch einen Kettenvorhang noch weiter geschützt werden.<br />
II. Der Behandlungskreis<br />
i. Abstimmung der Kreise<br />
Die Eigenfrequenz (S. 14) des Behandlungskreiscs muß immer in Resonanz zu<br />
der vom Generator erzeugten Frequenz stehen. Während die Frequenz eines<br />
Röhrensenders fest ¡st, ändert sich die Eigenfrequenz des Sekundärkreises, wenn<br />
der Plattenabstand verändert wird oder ein Körperteil in den Kreis kommt. Dann<br />
muß der Kreis neu abgestimmt werden.<br />
Dies geschiebt durch einen Drehkondensator, der meist in Serie zu dem durch die<br />
Behandlungsplänen gebildeten Kondensator geschaltet ist.<br />
Der Drehkondensator wird durch den Abstimmknopf des Apparates betätigt.<br />
Wird der Knopf in einer bestimmten Richtung gedreht, dann steigt die Leistung<br />
im Kreis an, um beim Überschreiten eines gewissen Punktes wieder abzusinken.<br />
Dieses ist der Resonanzpunkt; er muß durch Hin- und Herdreben aufgesucht<br />
werden, die richtige Einstellung ist auch während der Behandlung öfters zu kontrollieren.<br />
Zur Feststellung des richtigen Punktes dient ein Resonan%an%eiger, entweder<br />
ein Meßinstrument oder eine Glimmlampe. Niemals darf die Energie im Bebandlungskreis<br />
etwa dadurch herabgesetzt werden, daß man den Kreis verstimmt, also<br />
außerhalb des Resonanzpunktes arbeitet, sondern hierzu dient allein die Veränderung<br />
des Leistungsreglers oder Veränderung des Luftabstandes der Elektroden.<br />
Weder die Angaben des Voltmeters im Heizkreis noch diejenigen des Resoaa»Z an Z e (S ers<br />
können über die tatsächlich im Behandlungskreis vorhandene Energie Auskunft geben. Maßgebend<br />
hierfür ist nur die Feldstärke an den Kondcnsatorplattcn, die ihrerseits<br />
wieder von verschiedenen Faktoren abhängt.<br />
Wie S. 17 näher ausgeführt, hängen Strom und Spannung im Kreis hauptsächlich<br />
von Selbstinduktion und Kapazität ab, praktisch also ¡n der Hauptsache von<br />
Größe und Abstand der Kondensatorplatten und von Form und Größe des durchfluteten<br />
Objektes.<br />
Die Spannung ist an den einzelnen Punkten des Kreises verschieden. Bei richtiger<br />
134
Abstimmung liegt das Maximum der Spannung an den Platten, wie man leicht<br />
durch Entlangführen einer Glimmlampe am Kreis feststellen kann Das Minimum<br />
liegt am entgegengesetzten Punkte des Kreises.<br />
Ist dies nicht der Fall, dann schwingt der Kreis nicht in Resonanz und muß neu<br />
abgestimmt werden.<br />
Bei der Abstimmung kann es vorkommen, daß sich keine Resonanz erzielen<br />
läßt. Das Meßinstrument oder die Glimmlage zeigt bei Drehen des Abstimmknopfes<br />
zwar einen Anstieg, aber auch beim Drehen bis zum Anschlag geht die<br />
Spannung nicht wieder zurück, d. h., es ist kein Maximum vorhanden. Die Eigenfrequenz<br />
(S. 14) des Behandlungskreises ist dann entweder zu groß oder zu klein<br />
in bezug auf die Generatorfrequenz. Im erstcren Fall, der häufiger vorkommt,<br />
sind entweder die Zuleitungen zu lang oder die Kondensatorplatten zu groß oder<br />
zu nahe beieinander. Man kann das dadurch nachprüfen, daß man die Platten auseinanderzieht<br />
oder kleinere Platten nimmt. Die zu große Lange der Kabel kann<br />
man dadurch ausgleichen, daß man sie vom Apparat ab, so lang wie möglich, mit<br />
geringem Abstand parallel führt. Sie bilden dann ein LECHER-System, das nur die<br />
Rolle der Zuleitung spielt, während der eigentliche Schwingkreis nur vom aufgebogenen<br />
Teil gebildet wird. Zur Parallelführung kann man Klammern aus<br />
Isolicrmatcrial oder durchlochtc Brettchen verwenden.<br />
Wie bereits erwähnt, ist die genaue Resonanzabstimmung von größter Bedeutung<br />
für den Erfolg der Behandlung. Es sollte immer nur bei genauer Einstellung<br />
auf den Resonanzpunkt durchflutet werden. Dazu ist es nötig, daß von<br />
Zeit zu Zeit nachgestimmt wird, denn schon geringe Bewegungen der Patienten<br />
können die Abstimmung ändern. Deshalb wurde schon früher von mir die Forderung<br />
nach einer automatischen Abstimmung erhoben. Dieses Problem ist von<br />
einigen Firmen gelöst worden. Die Siemens-Reiniger-Werke bauen ihre Geräte mit<br />
dem «Servomat», Lorenz ein 7-m-Gcrät mit automatischer Abstimmung. Wird die<br />
Abstimmung durch Bewegungen des Patienten oder durch Veränderung des<br />
Elektrodenabstandes verschoben, so stellt die Vorrichtung die Resonanzlage in<br />
kurzer Zeit wieder her. Da die Geräte sehr empfindlich sind, können nur geringe<br />
Schwankungen der Feldstärke entstehen (s.Abb.109, 110).<br />
2. Abstandsprinzip<br />
Unerläßlich für die erfolgreiche KW-Behandlung ist die Anwendung des 1928<br />
von mir entdeckten Abstandsprinzips, und zwar gilt dies für alle Arten von Elektroden.<br />
Die relative Tiefenwirkung hängt vom Abstand der Platten und von der<br />
Hautoberfläche ab. Allzu großer Plattenabstand ist allerdings wieder ungünstig<br />
wegen der höheren Verluste an Energie. Bei den üblichen Abständen bis zu 6 cm<br />
sind diese Verluste nur gering, sie betragen nach Messungen von FRITSCH etwa<br />
5%-<br />
Schon bei Durchflutung homogener Körper zeigt sich, daß die relative Tiefenwirkung<br />
mit dem Abstand der Elektroden von der Hautoberfläche wächst. Die starke<br />
Tiefenwirkung der UKW kann also nur ausgenutzt werden, wenn zwischen Elektroden<br />
und Objekt c¡n ÍMftahstand von einigen Zentimetern eingeschaltet wird.<br />
Auch an Modellen mit Glühlampen in Wasser läßt sich dies deutlich zeigen. Die<br />
Versuche von DENIER (S. 67) haben ergeben, daß auch die Kcttenbildung von<br />
Tuschctcilchcn in einer durchfluteten Flüssigkeit vom Elcktrodcnabstand abhängt.<br />
Mí
Im allgemeinen wird man über Abstände von ;-6 cm nicht hinausgehen, doch<br />
gibt es Fälle, in denen noch größere Abstände angebracht sind (z. B. bei Lungen-<br />
Abb. 114a; Luftabstands-Elcktrodc<br />
abs2esscn). Man arbeitet dann mit freiem Luftabstartd, d.h., die Glasschale wird nicht<br />
angelegt. Die handelsüblichen Elektroden für örtliche Behandlung sind aus den<br />
oben ausgeführten Gründen für veränderliche Abstände bis zu 5-6 cm gebaut.<br />
Abb. 114b, Schmiegsame Elektrode<br />
mit Gummiüberzug, ohne<br />
Zwischenlagc aus Filz<br />
Um den gewünschten Zwischenraum zwischen<br />
Elektroden und Körper herzustellen, haben sich<br />
Schalen aus ScnoTTschcm Gcräteglas bewahrt.<br />
Sie erfüllen außerdem alle Anforderungen an<br />
Reinlichkeit und Asepsis, da sie abgewaschen<br />
und ausgekocht werden können. Meist wird der<br />
Abstand so hergestellt wie bei den in Abb, 113<br />
wieder gegebenen Elektroden. Die Glasschalen<br />
haben einen Deckel, durch den der Plattenhaltcr<br />
durchgeführt ist und durch eine Schraubvorrichtung<br />
in verschiedener Stellung festgelegt werden<br />
kann. Zur Behandlung hohler Körpcrstcllcn<br />
(z. B. Achselhöhle) gibt es gekrümmte Elektroden<br />
mit entsprechendem Überzug.<br />
Die Anordnung mit Glas-Luft-Abstand hat<br />
sich allen anderen Anordnungen mit Filz und<br />
anderen Materialien als überlegen erwiesen,<br />
da alle diese Stoffe Kapazität und Dämpfung<br />
in unkontrollierbarer Weise erhöhen (s.<br />
S. 58).<br />
Viel stärker noch als im homogenen Dielektrikum<br />
wirkt sich die Vorschaltung des<br />
Luftabstandes in geschichteten Stoffen aus<br />
(S. 51). Dies ist besonders wichtig fürdicÜber-<br />
brückung und thermische Entlastung des Unterhautfettgewebes, eine der wesentlichen<br />
Voraussetzungen für die erfolgreiche Behandlung tiefgelegener Organe.<br />
,36
Abgesehen davon hat die Abstandsbehandlung noch einen weiteren wesentlichen<br />
Vorteil darin, daß Unebenheiten der Hautoberfläche ausgeglichen werden.<br />
Abb.nj zeigt das Verhalten bei einem Furunkel. An der vorstehenden Stelle<br />
werden Kraftlinien konzentriert. Wie stark das der Fall ist, hängt ab von der Höhe<br />
der Unebenheit im Verhältnis zum Abstand der Platten. Ist dieser klein, dann kann<br />
die Felddichtc so stark werden, daß an dem vorstehenden Teil Verbrennungen<br />
auftreten. Bei großem Abstand verteilt sich das Feld viel mehr.<br />
i 2 3<br />
Abb. iij : Verdichtung der Feldlinien an einem vorragenden Objekt (z.B. Furunkel).<br />
i Elektrode stark angenähert; 2 mäßiger Abstand; 3 großer Abstand, dadurch ausgeglichene<br />
Feld Verteilung<br />
Da bei den sog. schmiegsamen "Elektroden der Abstand überall gering und außerdem<br />
ungleichmäßig ist, besteht Gefahr der Überhitzung an Unebenheiten. Dadurch<br />
entsteht eine ganz wesentlich vergrößerte thermische Belastung der Haut.<br />
Das Abstandsprin^ip gilt nicht nur für das Kondensatorfeld, sondern ebenso für jede<br />
Behandiungsweise mit K W, sei es im Inneren von Spulen oder mit Flachspulen.<br />
3. Kondensatorelektroden<br />
Die Elektroden müssen auswechselbar sein und haben sich in Größe und Gestalt<br />
nach dem Behandlungsgegenstand zu richten. Es ist wohl selbstverständlich,<br />
daß man zur Behandlung etwa eines Panaritiums kleine Platten verwendet, daß<br />
andererseits Durchflutungen einer ganzen Brustseite oder des Bauches größere<br />
Platten erfordern.<br />
Zu beachten ist, daß bei kleinen Platten die Felddichte verhältnismäßig groß ist.<br />
Bei gleicher Stromstärke im Kreis ist also die örtliche Dosis unter kleinen Platten<br />
immer größer als unter größeren Platten. Bei nahe anliegenden Platten ist die<br />
Hautbelastung verhältnismäßig groß.<br />
Um möglichst große absolute Tiefenwirkung in größeren Körperteilen hervorzubringen,<br />
sind große Platten vorteilhaft, da bei Verwendung kleiner Platten<br />
die Streuung größer wird.<br />
Das wirksame Kondcnsatorfeld hat im Inneren des Körpers im allgemeinen<br />
eine Form, die durch die Verbindungsflächc der Plattenränder bestimmt ist. Dies<br />
wurde unabhängig von mir auch von HEINRICH festgestellt und später u.a. von<br />
LlEBESNY, KOWARSCHIK, PÄTZOLD bestätigt.<br />
Die Feldverteilung zwischen gekrümmten Platten ist anders als zwischen ebenen<br />
Platten. Bei bestimmten therapeutischen Maßnahmen empfiehlt sich daher die<br />
Verwendung von gekrümmten Platten.<br />
Zwischen Platten, die in einer Ebene gekrümmt sind, erhält man Felder von<br />
Bandform, während sich zwischen kugelförmigen Elektroden das Feld mehr nach<br />
einem Punkt hin konzentriert (S. 60). Bei Verwendung einer kleineren und einer<br />
137
größeren Platte erhält man stärkere Felddichte unter der kleinen Platte («aktive<br />
Elektrode»),<br />
Die Gestaltung des Feldes hängt wesentlich vom Abstand ab. Geht man bis<br />
zum beiderseitigen Kontakt an den Körper heran, so wird der Kreis infolge der<br />
zu großen Dämpfung schwingungsunfähig (s. Anhang). Bei Zwischenschaltung<br />
eines nur dünnen Dielektrikums wird die Erhitzung der Körper Oberfläche verhältnismäßig<br />
viel stärker als die im Inneren, Erst bei genügend großem beiderseitigem<br />
Abstand der Platten wird die gewünschte Tiefenwirkung erreicht. Auch<br />
die Unterschiede in der Wirkung verschiedener Wellenlängen treten erst dann<br />
richtig hervor, wenn der Luftraum zwischen Platten und Körper groß genug ist<br />
(s.S. 50 sowie auch PÄTZOLD, KOWARSCHIK, GEBBERT).<br />
Für die Wahl der Isolicrmatcrialien, die für diese kapazitive Zwischenschaltung<br />
in Frage kommen, sind ihre dielektrischen Eigenschaften in erster Linie maßgebend.<br />
Fast alle Isolierstoffe, die man zwischen Elektroden und Körper einschaltet,<br />
erwärmen sich stark, was schon an sich unangenehm ist, außerdem aber mit<br />
unnötigen dielektrischen Verlusten einhergeht. Das Material, in dem nach unseren<br />
Erfahrungen die geringsten Verluste entstehen, ist Quarz, doch erfüllen auch gewisse<br />
Glassorten die an ein gutes Dielektrikum zu stellenden Bedingungen in<br />
weitem Maß.<br />
Durch die vorgeschalteten kapazitiven Widerstände wird hier ein sehr großes<br />
Spannungsgefälle erzeugt, demgegenüber das Spannungsgefälle im Körper zurücktritt.<br />
Dadurch arbeiten wir im allgemeinen mit konstanten Spannungen, was für<br />
die Wirkung wesentlich ist. DXNZER hat in einer ausführlichen Untersuchung diese<br />
Tatsache auch rechnerisch formuliert. Das allein durch den Luftwiderstand ermöglichte<br />
Festhalten einer konstanten Spannungsdifferenz ist von grundlegender Bedeutung<br />
für die Verteilung des Kraftfeldes im Körper.<br />
Ein weiterer Vorteil der Abstandsclcktrodcn ist, daß man weiche Körperteile<br />
damit komprimieren kann, was bei Tiefen thérapie von größter Wichtigkeit ist.<br />
Durch das Zusammendrücken wird die Strecke, die das Feld durchdringen soll,<br />
kürzer und damit die Einwirkung auf die in der Tiefe liegenden Teile intensiver.<br />
Dazu kommt, daß die S trah lungs Verluste bei näherem Zusammenrücken der<br />
Elektroden geringer werden. Ein weiterer Punkt, der ganz besonders beachtet<br />
werden muß, liegt darin, daß die Patienten selten ganz still liegen, sondern sich<br />
immer etwas bewegen. Vor allem bei Behandlung von Bauch- und Brustorganen<br />
macht sich die Atmung störend bemerkbar, indem sich durch die Volumänderung<br />
des Thorax die Kapazität und damit auch die Abstimmung dauernd ändert. Durch<br />
Kompression kann aber der Körper so festgelegt werden, daß diese Störungen<br />
praktisch ausgeschaltet sind.<br />
Die Kompression ist da von großem Vorteil, wo vorstehende Teile vorhanden<br />
sind, wie z.B. die Ohren, oder überhaupt wo den Kondensatorplatten gekrümmte<br />
Flächen gegenüberstehen. An diesen Stellen ¡st die Fclddichte besonders stark, es<br />
kommt eine höchst unerwünschte Spitzenwirkung zustande, die bis zu Verbrennungen<br />
führen kann. Die eigentliche Tiefenwirkung wird erheblich beeinträchtigt.<br />
Durch die Elcktrodcnschuhe wird die vorliegende Teilfläche zurückgedrückt, so<br />
daß der betreffenden Kondcnsatorplattc eine ebene Fläche gegenübersteht.<br />
Abgesehen von den Fällen, wo eine Kompression erwünscht ist, ist cinc Berührung<br />
von Glasschalc und Körper nicht notwendig. Bei Behandlung sehr ticfgclcgcncr Erkrankungen<br />
(Lungcnprozessc, gynäkologische Erkrankungen) entfernen wir oft sogar<br />
die Elektroden bis auf 15 cm und mehr Abstand. Die Metal lele ktrode wird dabei bis zur<br />
138
Berührung an den Boden der Schale herangebracht («freie Abstandsbehandlung»). Im<br />
allgemeinen muß der Abstand um so größer sein, je tiefer das zu beeinflussende Organ<br />
Hegt und je dicker die Fettschicht ist.<br />
Abb. 116. Randwirkung der Platten bei Eindrücken in Wcichtcilcn<br />
Abb. 117. Vermeidung dieses Fehlers bei richtigem Elcktrodcnschuh<br />
Bei Einstellung der Kondcnsatorplattcn auf weiche Körperstcllen, besonders<br />
am Bauch, kommt es vor, daß die Weichteile seitlich vom komprimierenden<br />
Elektrodenschuh herausquellen. Sie kommen dadurch in große Nähe des Plattenrandes,<br />
so daß sich infolge des geringeren kapazitiven Widerstandes hier das Feld<br />
besonders stark verdichtet (Abb. 116). Dadurch kann es zu unangenehmen Empfindungen<br />
und bei Unachtsamkeit zu Verbrennungen kommen. Deshalb sind die<br />
Elektrodenschuhe größer als die Platten, so daß die Weichteile seitlich von der<br />
eigentlichen Bchandlungsflächc weggedrückt werden (Abb. 117).<br />
J 39
Zu beachten ist bei der Behandlung ,daß zwischen Elektrodenschuhen und Haut<br />
keine Feuchtigkeitsansammlungen sind, z.B. wenn die Kranken schwitzen. Dann<br />
kann es an den feuchten Stellen zu starker Hitzeentwicklung kommen. Man kann<br />
sich durch Zwischenlage von Filtrierpapier helfen. Dickere Stofflagen oder Zellstoff<br />
lagen sind nicht zu empfehlen, da sie die Wärmeabgabe behindern und dadurch<br />
zu einer schlechteren Tiefenwirkung führen.<br />
Durch Zwischenlagen von Filz oder Kleiderstoffen zwischen Elektrode und Körper<br />
wird nicht nur die Entwärmung der Haut verhindert, sondern die Erhitzung des Filzes<br />
und der Grenzfläche zwischen Filz und Hautoberfläche bewirkt zusätzliche Hitzeentwicklung,<br />
so daß eine starke Überlastung der Haut und der darunterliegenden Gewebe die<br />
Folge ist. KOWARSCHIK hat nachgewiesen, daß die Feldwirkung bei Zwischenlagc von<br />
Filz und anderen Stoffen bedeutend verschlechtert wird, ja, daß die Tiefenwirkung dabei<br />
sogar geringer ¡st als bei der gewöhnlichen Langwellendiathermie. Infolge der Unebenheit<br />
der Haut- und Elektrodcnoberfläche ist die Wärmeverteilung noch dazu höchst<br />
ungleichmäßig.<br />
Bei der sog. «unipolaren» Anwendung wird nur eine Elektrode an den Körper herangebracht,<br />
die andere ist geerdet. Im Grunde genommen ist dies nichts weiter als Anwendung<br />
einer kleinen und einer sehr großen Elektrode, welch letztere vom Körper selbst<br />
gebildet wird. Der Kreis wird durch Erde-Patientenkörper kapazitiv geschlossen. Dies<br />
Verfahren bietet keinerlei Vorteile, nur die Verluste durch zusätzliche Dämpfung sind<br />
viel größer. Es kommt im übrigen nur in Frage für Behandlung oberflächlich gelegener<br />
Prozesse, da nur die ganz in nächster Nähe der Elektrode gelegenen Teile erwärmt<br />
werden.<br />
In die Körperhöhlen lassen sich geeignet gebaute Elektroden einführen. Das kommt<br />
vor allem bei der Behandlung solcher Prozesse in Frage, die unmittelbar von einer Körperhöhle<br />
ausgehen, oder wenn es darauf ankommt, das Feld stark auf einen kleinen Bezirk<br />
zu konzentrieren unter Entlastung anderer Gewebe. Bei Erkrankungen der Adnexe kann<br />
eine Elektrode in die Vagina eingeführt, die andere außen auf den Bauch gesetzt werden,<br />
wodurch man eine oft zu Schmerzen führende Beeinflussung der sakralen Ncrvenwurzcln<br />
und der Cauda equina vermeidet.<br />
Für solche Zwecke dient eine Vaginalelektrode. Die eigentliche Elektrode besteht aus<br />
einem oben abgerundeten Metallzylinder von 3 cm Durchmesser und 5-10 cm Länge,<br />
der an einer Mctallstange mit Kugelgelenk sitzt.<br />
Sie paßt in ein ebenfalls am oberen Ende abgerundetes Glasspekulum von 3 bis<br />
4 cm Durchmesser hinein. Zur Herstellung des Luftabstandes dient ein Glasring.<br />
Solche Elektroden können auch in Mund und Mastdarm eingeführt werden (Behandlung<br />
von Proktitis, Prostatahypertrophie, Mastdarmfisteln, Mandclcrkrankungen).<br />
Meist kommt man mit gewöhnlichen Elektroden aus.<br />
Eine Konzentration des Feldes im Inneren von Körperteilen kann auch durch<br />
Hilfselektroden erreicht werden, metallene Sonden oder Bougies, die in die betreffenden<br />
Hohlorgane eingeführt werden. Das Feld wird dann zu diesen Metalltcilcn<br />
hin verdichtet.<br />
Die Tatsache, daß sich gewisse Metallhydrossole in bestimmten Wellenlängen<br />
besonders stark erwärmen, kann man sich zunutze machen, indem man derartige<br />
Stoffe in Körperhöhlen einfüllt oder in Gewebe einspritzt.<br />
Die Erhitzung in der Umgebung von Mctallteilcn ist nicht so groß, daß man<br />
Verbrennungen befürchten müßte. Die Sorge, daß Schäden beim Durchfluten von<br />
Patienten mit Geschoßsplittern auftreten könnten, ist daher unbegründet.<br />
LION findet an Mctallteilcn, die in Elektrolyt^ und Eiweißlösungen eingeführt wurden,<br />
eine um so stärkere Energiekonzentration, je geringer der Abstand der Elektroden von<br />
140
der Außenoberfläche ist. ETTER, GERSH und PUDENZ konnten bei den klinisch gebräuchlichen<br />
Dosen keine irgendwie gefährliche Wärmekonzentration nachweisen, ebenso<br />
EBBINGHAUS.<br />
Zur Behandlung von Frostschäden an Händen und Füßen hat PATZOLD besondere<br />
Elektroden entwickelt, die auch zur Behandlung anderer Erkrankungen an diesen<br />
Gliedmaßen (z.B. Akrozyanosen) angewandt werden können.<br />
Zur Behandlung der Hände dienen zwei parallel ncbeneinanderlaufcndc Mctallbänder,<br />
die mit einer Glasscheibe in etwa i cm Abstand überdeckt sind. Die Hände werden auf das<br />
Glas so gelegt, daß sie die Elektrodcnbänder überbrücken. Die Vorrichtung ist in einen<br />
Kasten eingeschlossen.<br />
Die Füße werden mit der Sohle auf eine Flachspulc aufgestellt, die mit Filz umschlossen<br />
¡st. Man kann auf diese Weise die Gliedmaßen von mehreren Kranken<br />
zugleich behandeln.<br />
Eine Methode zur Längsdurchflutung von Extremitäten ist das von LEISTNER und<br />
SCHAEFER angegebene Ringfeld. Die Elektroden sind zwei Ringe, die in einem bestimmten<br />
Abstand um den Körperteil gelegt werden. In dem dazwischenliegenden Teil entsteht<br />
eine gute Ticfendurchwärmung. Auch hier ist Anwendung des Abstandsprinzips notwendig.<br />
Zwischen den Ringen und dem dazwischenliegenden Körperteil bildet sich<br />
ein Kondensatorfeld.<br />
Die Anordnung der gesamten Einrichtung zur Krankenbehandlung muß so getroffen<br />
sein, daß die Lage des Kranken bequem ist und daß ihre Veränderung nicht<br />
allzu große Schwierigkeiten macht. Vielfach kann die Behandlung im Sitzen ausgeführt<br />
werden, doch muß häufig der Kranke liegen.<br />
Zur Lagerung der Kranken dient ein fester Tisch aus Holz oder einem Isoliermaterial,<br />
das möglichst wenig Metallteile enthält.<br />
Als Unterlage für den Kranken dient am besten Schwammgummi. Dieses Material ist<br />
ein verhältnismäßig guter Isolator, dabei weich, jederzeit abwaschbar und leicht zu desinfizieren.<br />
Die Unterlage besteht vorteilhaft aus mehreren Einzelteilen, die auseinandergeschoben<br />
werden können, so daß man die Elektroden von unten ansetzen kann. Zu<br />
diesem Zweck sind in der Tischplatte entsprechende Klappen angebracht, oder es ist<br />
überhaupt keine Brcttuntcrlage vorhanden; die Gummiplatten sind in diesem Fall über<br />
den offenen Rahmen gespannt.<br />
Der Kopfteil muß hoch und tief verstellbar sein. Es ist erstrebenswert, den Kopf für<br />
sich möglichst frei hochlagern zu können, wozu entweder eine schmale Klappe dienen<br />
kann oder ein ganz schmales, aber dick ausgestopftes Kissen. Überhaupt ist es öfters notwendig,<br />
einzelne Glieder für sich emporzuheben, wobei die Stützfläche nur schmal sein<br />
darf. Andernfalls ¡st die Anbringung der Platten behindert; ferner ist es ungünstig, wenn<br />
die Kondcnsatorplatten zu nahe an die Unterlage herankommen, denn dabei können sich<br />
durch die Unterlage hindurch kapazitive Nebenschlüsse bilden, die dem Kreis Energie<br />
entziehen und einen viel größeren Strom im Patientenkreis vortäuschen, als er tatsächlich<br />
vorhanden ist.<br />
Bei der Anordnung der Elektroden ist es nicht nur wichtig, sie in richtiger Lage<br />
und Abstand an den Körper heranzubringen, sie müssen auch in dieser Lage festgestellt<br />
werden, und es soll mit ihnen ein Druck ausgeübt werden können. Diese<br />
Forderung ist schon dadurch zwingend begründet, daß der Kranke von sich aus<br />
nie ganz genau in der gleichen Stellung liegen bleibt, sondern immer Bewegungen<br />
macht. So finden beispielsweise bei Behandlung der Brust und des Bauches sehr<br />
beträchtliche Verschiebungen durch die Atembewegungen statt. Dadurch wird<br />
die Kapazität im elektrischen Feld dauernd verändert, es ergibt sich notwendig<br />
141
eine Verschiebung aus der Resonanzlage und damit schlechte Ausnützung der<br />
Energie.<br />
Der Körper muß möglichst zwischen den Platten festgelegt werden. Der bestimmte<br />
Abstand, der notwendig ist, wird durch die Wahl der richtigen Elektrodenschuhc<br />
eingestellt.<br />
Die Kompression hat weiterhin zwei Vorteile: Die Körperober fläche wird zusammengedrückt,<br />
so daß keine vorstehenden Teile oder Falten die Feldwirkung auf sich hin<br />
konzentrieren können (S. 159) ; außerdem kann dadurch der Gesamtabstand der Platten<br />
Abb. 118: Schlingen zur Wirbclstrombehandlung mit Filztaschen<br />
voneinander verringert werden. Je geringer dieser Abstand ist, desto größer die Feldstärke<br />
(s. Anhang). Da mit größeren Plattcnabstand die Strahlungsvcrluste anwachsen,<br />
wird damit ein Gewinn an Leistung erzielt; wo starke Tiefenwirkungen hervorgebracht<br />
werden sollen, wie es meistens erwünscht ist, kommt man durch die Kompression an die<br />
eigentlich zu beeinflussenden Teile näher heran. Andere störende Gewebsteile, die Energie<br />
absorbieren, wie in erster Linie starke Fettmassen, werden zum Teil beiseite gedrückt.<br />
Die Ablenkung und Konzentration der Feldlinien auf stärker gekrümmte und<br />
vorstehende Teile können wir uns bei der Behandlung oft zunutze machen. Wenn<br />
beispielsweise Kiefer- oder Stirnhöhlen behandelt werden sollen, so stellen wir<br />
unsere Platten möglichst tangential zu der zu behandelnden Stelle. Wir erreichen<br />
dadurch eine Konzentration auf den Mittelpunkt dieser Stelle, die nach den Seiten<br />
hin abnimmt (siehe Tafel II u. Ill S. 279).<br />
Bei der Anlage der Kondensatorplatten an den Körper wird man in erster Linie<br />
die Art des zu behandelnden Krankheitsprozesses berücksichtigen müssen. Allgemeine<br />
Vorschriften können dafür nicht gegeben werden. Bei tiefliegenden<br />
Krankheitsherden nimmt man großen Plattenabstand ; liegt der Herd exzentrisch,<br />
so wird man an die Stelle, der er stärker angenähert ist, die entsprechende Kondcnsatorplattc<br />
näher heranbringen, während die andere etwas weiter entfernt ist.<br />
Bei oberflächlichen Erkrankungen geht man mit der differenten Platte so nahe<br />
wie möglich heran und nimmt auf der anderen Seite eine größere Platte in weiterer<br />
Entfernung. Für die Behandlung räumlich beschränkter Krankheitsvorgänge verwendet<br />
man zweckmäßig die halbkugelig oder elliptisch gekrümmten Platten, die<br />
auch da gute Dienste leisten, wo in Falten oder Mulden sitzende Prozesse behandelt<br />
werden sollen. Auf die näheren Einzelheiten wird noch bei Besprechung<br />
der besonderen Krankhcitsbildcr hingewiesen werden.<br />
142
4. Spulenfeldbehandlung<br />
Zur Spulenfeldbehandlung dienen verschiedene Arten von Elektroden (Abb. 118<br />
bis 120), die in Schwammgummi eingebettet sind und um den zu behandelnden Körperteil<br />
herumgcschlungen werden. Wir haben dabei, wie schon früher erwähnt, eine<br />
Abb. 119. Flachspule (Monode) Abb. 120. Monode<br />
Abart des Kondensatorfeldcs, bei der die Kraftlinien von Windung zu Windung<br />
laufen und dabei das in der Mitte liegende Glied durchdringen. Das Verfahren<br />
eignet sich nur zur Behandlung von Armen und Beinen.<br />
In USA benutzt man häufig die Flacbspule (pancake<br />
coil), bei der das Behandlungskabel flach spiralig<br />
gewickelt ist (Abb. 118-120). Es ist meist in einem<br />
Sack aus Filz oder Stoff untergebracht und wird so<br />
auf den Patienten aufgelegt. Auch hier erstreckt sich<br />
nach den Untersuchungen von PÄTZOLD die Wirkung<br />
im wesentlichen nur auf die Muskulatur, allerdings<br />
bei guter Uberbrückung der Haut und des Fettgewebes.<br />
Irgendwelche Vorteile gegenüber der Behandlung<br />
im Kondensatorfcld bestehen nicht.<br />
Die von PÄTZOLD entwickelte Monode wird an Kurzwellen-Geräten<br />
als Elektrode für monopolare Applikation<br />
benutzt. Sie dient zur lokalen Behandlung<br />
hautnaher Gebiete - wie z.B. Muskulatur und Gelenke<br />
- und vermeidet eine unerwünschte Miterwärmung<br />
des subkutanen Fettgewebes. Die Anwendung<br />
der Monode ist einfach, da ihr Anschluß am Gerät und<br />
das Anlegen am Patienten nur wenige Handgriffe<br />
erfordert. Abb. 121.<br />
Die Wirkungsweise der Monode beruht im Prinzip KW-Gcrät mit Monode<br />
auf der Anwendung des hochfrequenten Magnetfeldes<br />
mittels einer Spule. Das Magnetfeld induziert in dem flüssigkeitsreichen und<br />
deshalb gut leitenden Muskelgewebe stärkere Ströme (Wirbelströme) als im<br />
143
Fettgewebe mit seiner geringeren Leitfähigkeit. Ein elektrisches Feld, wie es als<br />
Folge restlicher Kapazitäten bei Flachspulen sonst üblicher Konstruktion auftritt<br />
und eine Wärmebelastung des Fettgewebes verursachen kann, ist bei der Monode<br />
infolge einer definierten räumlichen Anordnung ihrer Spulenwindungen nahezu<br />
vollständig unterdrückt.<br />
Die Wärmeverteilung im Gewebe ist bei Anwendung der Monode (s. unteres Bild)<br />
die gleiche wie bei der Bestrahlung mit Mikrowellen.<br />
Eine andere Art der Spulenfeldbehandlung ist die mit der einfachen oder doppelten<br />
Schlinge, einem isolierten Kabel, das um den Körperteil herumgelegt wird.<br />
Bei Anwendung solcher Schlingen sind meist Zusatzspulen mit 6-8 Windungen notwendig,<br />
die parallel zu der Schlinge an die Anschlüsse des Generators angelegt werden.<br />
Die Schlinge eignet sich gut zur Behandlung des Nackens und beider Schultergelenke<br />
(Tafel I, S. 277) und besonders zur Behandlung von Erkrankungen in der<br />
Kreuzgegend, vorzugsweise der Ischias. Wie schon erwähnt, ist die Wirkung auf<br />
tiefgclegene Organe nicht groß.<br />
Die Schlingcnbehandlung hat sich besonders bewährt für die Hyperthermie<br />
(RAAB). Hierbei ist eine allzu große Hitzeentwicklung in den tiefgelegenen inneren<br />
Organen unerwünscht, es kommt vielmehr darauf an, die Bluttemperatur möglichst<br />
zu erhöhen. Man legt deshalb die Schlinge entweder auf oder unter den liegenden<br />
Patienten oder man nimmt je eine Schlinge von oben und unten. Man kann auch<br />
eine oder zwei Schlingen um den Bauch des Kranken herumlegen. Es hat sich<br />
gezeigt, daß dieses Verfahren das schonendste für die Kranken ist, da keine unangenehme<br />
Hitzeentwicklung erfolgt, und daß daher mit ihm am bequemsten<br />
höchste Wärmegrade erreicht werden können (RAAB).<br />
III. Dosierung<br />
Vielleicht die wichtigste Frage bei der KW-Therapie ist die der richtigen Dosierung.<br />
Um die Leistungen der Therapie voll auszunützen, ist individuelle Anpassung<br />
dringend erforderlich. Dadurch wird die Anwendung der KW-Therapie<br />
zur ärztlichen Kunst. Leider ist aber - hauptsächlich durch Unkenntnis der<br />
wissenschaftlichen Grundlagen - eine schematische Anwendung der KW-Therapie<br />
die Regel geworden. Dadurch wird oft mehr geschadet als genützt. Vielfach wird<br />
zu sehr dem Verlangen der Kranken nachgegeben, die es schön warm haben wollen<br />
und glauben, daß die Behandlung um so besser wirke, je länger sie ausgeführt wird.<br />
Das ist aber durchaus nicht der Fall. Wird z.B., wie es leider oft geschieht, jeder<br />
Kranke 15 Minuten mit mäßiger Energie durchflutet, so wird bei den akuten<br />
Fällen überdosiert, bei den chronischen unterdosiert.<br />
Nun ist noch keine einwandfreie brauchbare Dosismessung vorhanden, da es<br />
kein Mittel gibt, das uns über die tatsächlich im erkrankten Bereich absorbierte<br />
Energie unterrichtet. Wir sind deshalb auf das Gefühl und damit auf die Angaben<br />
der Patienten weitgehend angewiesen, sowie auf die genaue ärztliche Beobachtung<br />
des Krankheitsverlaufes. Bei dieser teilweise gefühlsmäßigen Einstellung kommt<br />
uns die große therapeutische Breite der Ultrakurzwellen zu Hilfe.<br />
144
Der -Arzt darf sich nicht damit begnügen, etwa ^Kurzwellen» z u verordnen, sondern er<br />
muß angehen, welche Dosis, welche Zeitdauer und welcher Plattenabstand im vorliegenden<br />
fall angewandt werden soll. Er muß die Kranken genau daraufhin beobachten, wie<br />
sie die Durchflutungen vertragen, und auf Grund ihres Verhaltens muß er je nachdem<br />
eine Verstärkung oder Abschwächung der Dosis oder Einschalten gewisser<br />
Pausen anordnen. Feste Regeln können hierfür nicht gegeben werden, es muß<br />
eben auf diesem Gebiet Erfahrung gesammelt werden, wenn man etwas erreichen<br />
will.<br />
Im allgemeinen gilt die Regel, daß akute Erkrankungen mit schwachen Dosen täglich<br />
kurze Zeit behandelt werden sollen; akute Eiterungen sind jeden Tag z u behandeln, chronische<br />
Erkrankungen dagegen kräftig und mit längeren Sitzungen. Hierbei genügt je nachdem<br />
2-îmal wöchentliche Behandlung.<br />
Treten stärkere Reaktionen auf, dann muß unter Umständen eine Pause von<br />
1-3 Tagen gemacht werden. Bei chronischen Erkrankungen sind nach 10-12Durchflutungen<br />
Pausen von 1-2 Wochen einzulegen.<br />
Ist man sich zunächst über die Dosis nicht im klaren, so empfiehlt es sich, mit<br />
schwacher Dosis anzufangen, die Reaktion des Kranken zu beobachten und je<br />
nach Verträglichkeit die Dosis immer mehr zu steigern. Bei sehr akuten Erkrankungen<br />
fängt man beispielsweise mit 2-4 Minuten an und steigert dann die Zeit<br />
allmählich. Durchflutungszeiten über 10 Minuten kommen selten in Frage.<br />
Je nach der Empfindung der Patienten unterscheiden wir 4 Dosen;<br />
Dosis I, schwächste Dosis: Man stellt ein, bis eben Wärmeempfindung geäußert<br />
wird und geht etwas zurück bis zum unterschwelligen Wert;<br />
Dosis II, schwache Dosis: Eben merkliche Wärmeempfindung;<br />
Dosis III, mittlere Dosis: Deutliche angenehme Wärmeempfindung;<br />
Dosis IV, starke Dosis: Noch gut erträgliche Wärmeempfindung.<br />
Bei tiefliegenden Prozessen muß man in Rechnung ziehen, daß nur ein Teil der<br />
Energie in der Tiefe tatsächlich wirksam wird. Man muß also entsprechend höhere<br />
Dosen oder längere Durchflutungszeiten nehmen.<br />
Bei Behandlung kleiner, in der Tiefe liegender Organe, wie etwa der Hypophyse<br />
oder der Ovarien, ist zu bedenken, daß auf ein solches Organ nur eine<br />
kleine Raumdosis kommt, d.h., die zwischen den Elektroden wirksamen Feldlinien<br />
durchsetzen und beeinflussen eine verhältnismäßig große Gewebsmasse und nur<br />
ein geringer Bruchteil der Energie entfällt auf das zu behandelnde Organ.<br />
Wir unterscheiden die von der Feldstärke abhängige Dosisleistung, d.h. absorbierte<br />
Energie, und die Zeitdauer. Bei vielen physikalisch-therapeutischen Anwendungen<br />
gilt die Regel, daß das Produkt von Dosisstärke und Zeit für die Wirkung<br />
maßgebend ist, daß also schwache Dosen von langer Zeitdauer die gleiche<br />
Wirkung haben wie starke Dosen von kurzer Zeitdauer. Ob dies auch für die<br />
KW-Therapie gilt, ist noch nicht geklärt. Nach vielen Beobachtungen hat es den<br />
Anschein, als ob es nicht der Fall wäre.<br />
Bei chronischen Prozessen sind starke, unter Umständen sehr starke, langdauernde<br />
Dosen nötig, besonders bei chronisch rheumatischen Erkrankungen,<br />
narbigen Veränderungen und Versteifungen, während für akut rheumatische Erkrankungen,<br />
beispielsweise akute Ischias, das gleiche gilt wie für andere akute<br />
Prozesse. Unter gewissen Umständen kann es auch bei Eiterungen notwendig<br />
werden, länger zu durchfluten, und zwar dann, wenn auf geringere Dosen keine<br />
Besserung mehr eintritt. Man muß dann, z.B. bei chronischen Pleuraempyemen,<br />
bis zu einer Stunde und länger durchfluten.<br />
MS
Bei Erkrankungen der Nutgefäße ist sehr vorsichtige Dosierung am Platze. Im<br />
allgemeinen gilt die Regel, daß bei angiospastischen und arteriosklerotischen Veränderungen<br />
schwächste Dosen, also Dosis I, verwendet werden sollen.<br />
Zur Beeinflussung endokriner Drüsen sind meist stärkere Dosen erforderlich, insbesondere<br />
hat sich auch experimentell gezeigt, daß zur Beeinflussung der Hypophyse<br />
mindestens 8-15 Minuten lang durchflutet werden muß, bei mittlerer bis<br />
starker Dosis (S. 225). Für die anderen endokrinen Drüsen sind noch keine Regeln<br />
aufgestellt.<br />
Akut entzündliche Erkrankungen können auf ein Übermaß an Energie mit starken<br />
Reaktionen antworten. RAAB, NITSCHKE, ROSA, RAUSCHER, POSATI u.a. sahen,<br />
ebenso wie der Verfasser, nach Überdosierung oft einen Anstieg des Fiebers,<br />
Leukozytose mit Linksverschiebung und gelegentliche Verschlimmerungen des<br />
Allgemcinzustandes. In solchen Fällen muß ausgesetzt und nach Abklingen der<br />
Erscheinungen mit schwächeren Dosen wieder neu begonnen werden.<br />
Dosis I und II sind nicht nur bei akuten Entzündungen angezeigt, sondern auch<br />
bei ödematöser Durchtränkung der Gewebe (SCHMITT). CIGNOLINI sah in Ödemen<br />
sehr starke Erwärmung.<br />
Wiederholt ist die Forderung aufgestellt worden nach Einrichtungen, die eine<br />
exakte Dosierung ermöglichen. Man sah das Maß der subjektiven Wärmeempfindung<br />
als unzuverlässig an. So beobachteten beispielsweise RAUSCHER und POSATI,<br />
daß manche Kranke schon bei 30 Watt Wärme verspürten, andere dagegen erst<br />
bei 60 Watt. Wie aus der experimentellen Pharmakologie bekannt ist, besteht ein<br />
gewisser Zusammenhang zwischen der Sensibilität und dem Grade der Entzündung,<br />
denn schmerzstillende Medikamente in lokaler Anwendung wirken<br />
meist gleichzeitig entzündungshemmend. Auch in der Wärmeempfindlichkeit entzündeter<br />
Gewebe bestehen ziemliche Unterschiede.<br />
Man wird deshalb in gewissem Sinne die nach der Wärmeempfindung eingestellte<br />
Dosis bei akuten Prozessen als biologische Dosierung ansprechen dürfen.<br />
Dies um so mehr, als die individuelle Reaktion einzelner Personen stark vom Grade<br />
der vegetativen Labilität, auch von der jeweiligen Disposition abhängt. Selbst bei<br />
einer einwandfreien physikalischen Dosierung würde somit die ärztliche Erfahrung und das<br />
ärztliche Gefühl keineswegs ausgeschaltet. Folgende Faktoren beeinflussen die Dosierung<br />
und können Fehler hervorrufen:<br />
1. Die Wahl der Elektroden.<br />
Unter einer aufgelegten Filzelektrode entsteht durch die verminderte Ausdünstung<br />
stärkere Wärme als bei Abstandselektroden mit Luftzwischenraum.<br />
Durch Kompression der Haut, besonders wenn der Kranke auf der Elektrode<br />
liegt, können Stauungen in den Kapillaren entstehen, wodurch die Wärmeableitung<br />
behindert wird. Ein stärkeres subjektives Wärmegefühl ist die Folge.<br />
2. Je größer der Abstand der Elektroden von der Haut, desto mehr werden die<br />
Wärmcrczcptorcn aus dem energiemäßig starken Teil des Feldes herausgebracht.<br />
3. Durch Spitzenwirkung an hervorstehenden Körperteilen, durch Schwcißbildung<br />
und durch nässende Wunden und Fisteln wird das Feld dort verdichtet,<br />
so daß Schmerz und Verbrennungen vorkommen können.<br />
4. Patienten mit chronischen Erkrankungen haben oft lange Zeit hindurch die<br />
Haut stark durch Heizkissen oder Kataplasmen erwärmt und sind dadurch gegen<br />
Wärme weniger empfindlich geworden.<br />
Alle diese Dinge müssen von erfahrenen Behandlern berücksichtigt werden.<br />
146
Um dem Personal die Anweisung für die richtige Behandlung zu geben, wird<br />
in meiner Klinik folgendes Schema angewandt:<br />
Kurzwelle (6 m)<br />
Patient: Müller.<br />
Diagnose: Lungenabsyeß.<br />
Körperteil: Brust.<br />
Elektroden: Durchmesser vorn: 15 cm, hinten: 15 cm.<br />
Stellung vorn: (rechts) Brust, hinten: (links) Kücken.<br />
Abstand vorn: j cm, hinten: 8 cm.<br />
Dosis: //, steigend bis: 77J".<br />
Dauer: 3 Minuten, steigend bis: 30 Minuten.<br />
Wie oft : 6mal wöchentlich.<br />
Gesamt2ahl: 20.<br />
IV. Allgemeine Hyperthermie (Elektropyrexie)<br />
1. Verfahren<br />
Die ersten Versuche von ESAU und SCHLIEPHAKE hatten 1926 ergeben, daß im<br />
KW-Feld eine Erhitzung des tierischen Körpers bis zu beliebigen Graden erreicht<br />
werden kann, wie sie mit der LW-Diathermie nicht möglich gewesen ist. Wir<br />
haben uns damals, besonders auch aus technischen Gründen, hauptsächlich der<br />
Entwicklung der örtlichen KW-Therapie zugewandt. Das Hyperthcrmieverfahten<br />
wurde mehr in Frankreich und USA ausgebaut. Zu nennen sind in erster Linie<br />
HALPHEN und AUCLAIR, HINSIE, NEYMANN.<br />
Bei diesem Verfahren ist nicht die Frage nach der möglichst begrenzten gezielten<br />
Tiefenwirkung maßgebend, sondern das Bestreben, den ganzen Körper, in<br />
erster Linie also das Blut, auf möglichst hohe Allgemeintemperaturen zu bringen.<br />
Um einen Menschen von 7 j kg Gewicht auf 42 o , also um j°zu erwärmen, sind 375 kcal<br />
nötig. Hierzu brauchen wir 0,436 Wattstunden absorbierter Energie. Demnach müßte<br />
ein Energieumsatz von 872 Watt genügen, um den Körper in einer halben Stunde auf<br />
42 o zu erhitzen.<br />
Praktisch ist das aber mit dieser Energie nicht möglich. Ein Generator, der diese<br />
Leistung hat, wird schon deshalb nicht ausreichen, weil stets nur ein Teil der Elektrizität<br />
im Körper absorbiert wird; ein Teil wird abgestrahlt, ein anderer Teil wird im Bchandlungstisch,<br />
in Kissen und Decken absorbiert.<br />
Im Körper selbst tritt sofort die Wärmeregulierung in Kraft, mit baldiger starker<br />
Erweiterung der Hautgefäße und vermehrter Abstrahlung, während das Schwitzen<br />
später einsetzt. Zur Unterdrückung des Schwitzens hat man verschiedene Mittel<br />
angewandt, wie intravenöse Injektionen von 20% Kochsalzlösung, Atropin und<br />
Morphium-Skopolamin (RAAB).<br />
Außerdem ist es wesentlich, die Wärmeabgabe soweit als möglich zu verhindern.<br />
Man packt deshalb die Kranken fest in Decken ein. Auch die Hände müssen unter<br />
den Decken sein, der Kopf muß bedeckt werden, da gerade von der Kopfhaut<br />
und den Händen viel Wärme ausgestrahlt wird. RAAB nimmt einen rings geschlossenen<br />
Sack aus Daunendecken, der durch einen Reißverschluß hermetisch<br />
abgeschlossen werden kann und mit wasserdichtem Stoff überzogen ist.<br />
147
Ein Problem ist die Belästigung des Kranken durch die Schweißabsonderung,<br />
besonders deshalb, weil in den Falten der durchfeuchteten Stoffe Feldverdichtungen<br />
und damit Verbrennungen entstehen können. Ungeeignet sind deshalb<br />
Stoffe, die leicht Wasser annehmen, Leinen und Baumwolle, am Körper. Am besten<br />
Neuritis<br />
Diagnose<br />
Chronische<br />
Arthritidcn<br />
einschließlich<br />
Polyarthritis<br />
Muskelrheuma<br />
Go.-Arthritis<br />
Go.-Infekt<br />
Lues primär<br />
und sekundär<br />
Tabes<br />
Paralyse<br />
Multiple<br />
Sklerose<br />
Asthma<br />
bronchiale<br />
Autor<br />
Koeppen<br />
Raab<br />
Med.Univ.-Klin.<br />
Erlangen<br />
Neymann*<br />
Koeppen<br />
Raab<br />
Med.Univ.-Klin.<br />
Erlangen<br />
Koeppen<br />
Med.Univ.-Klin.<br />
Erlangen<br />
Neymann*<br />
Neymann<br />
Raab<br />
Neymann*<br />
Neymann*<br />
Raab<br />
Neymann*<br />
Koeppen<br />
Neymann*<br />
Koeppen<br />
Med.Univ.-Klin.<br />
Erlangen<br />
Neymann*<br />
Koeppen<br />
Med.Univ.-Klin.<br />
Erlangen<br />
Temperatur<br />
"Celsius<br />
40<br />
39,5—40<br />
39—40<br />
40<br />
40<br />
39—40<br />
39—40<br />
40<br />
39—40<br />
41<br />
41.5<br />
42—42, j**<br />
41—42<br />
über 39,7<br />
39.5—40<br />
über 39,7<br />
40<br />
39,7—40.8<br />
40<br />
39—40<br />
40<br />
38,5—40<br />
3 8 —39,5<br />
Tabelle i Ergebnisse der<br />
Behandlungstechnik<br />
Behandl.dauer<br />
Stunden<br />
4—j<br />
2—4<br />
8<br />
1-17.<br />
4<br />
2—4<br />
I-IV,<br />
2—4<br />
5-8<br />
5-6<br />
6—8<br />
1-1V,<br />
2—4<br />
6—8<br />
Anzahl<br />
der<br />
Behandlungen<br />
2—12<br />
6—10<br />
3—12<br />
8—20<br />
3—3°<br />
20—30<br />
3—12<br />
3—11<br />
4—12<br />
ij<br />
2—6<br />
6—8<br />
3-4<br />
20<br />
20<br />
20—jo<br />
Ï-8<br />
20<br />
3- -20<br />
5—15<br />
2—10<br />
2—14<br />
Zahld<br />
Behan<br />
lunge<br />
je Woc<br />
* Gesamtstatistik aus den USA aus dem Jahre 1937. ** Temperaturen im Becken.<br />
148
ist ein glatt anliegendes Badetrikot aus "Wolle, darüber wollene Decken und außen<br />
ein verschließbarer Sack aus Daunen.<br />
Der hehandïungskreis kann außerhalb dieser Hüllen angelegt werden. Wir<br />
unterscheiden die milde Hyperthermie mit Temperaturen von 38-40 0 und die<br />
elektrischen Hyperthermie<br />
Gesamtzahl<br />
der Fälle<br />
34<br />
2<br />
20<br />
384<br />
45<br />
88<br />
26<br />
8<br />
9<br />
270<br />
590<br />
7<br />
7<br />
114<br />
8<br />
967<br />
3<br />
51<br />
20<br />
2<br />
133<br />
24<br />
3<br />
Ergebnisse<br />
Wesentl.<br />
gebessert<br />
oder<br />
geheilt<br />
%<br />
59<br />
100<br />
30<br />
11<br />
21<br />
54<br />
50<br />
23<br />
66<br />
79<br />
86<br />
100<br />
—<br />
27<br />
—<br />
—<br />
30<br />
12<br />
—<br />
Gebessert<br />
%<br />
41<br />
35<br />
52<br />
71<br />
78<br />
23<br />
50<br />
44<br />
24<br />
—<br />
5<br />
66<br />
75<br />
36<br />
100<br />
69<br />
80<br />
50<br />
45<br />
88<br />
66<br />
Nicht<br />
geheilt<br />
%<br />
35<br />
37<br />
29<br />
23<br />
33<br />
10<br />
16<br />
34<br />
25<br />
35<br />
3 1<br />
20<br />
50<br />
25<br />
33<br />
J49<br />
Bemerkungen<br />
Besonders<br />
Ischias-Neuralgien<br />
Kombiniert mit Pyramidon<br />
Kombiniert mit Salizyl u.a.<br />
Kombiniert mit Prontosil<br />
Kombiniert mit Uliron<br />
Kombiniert mit Wismut<br />
Frühfälle, deren Krise behoben wurde ;<br />
Gehvermögen wieder normal.<br />
3 Jahre kein Rückfall<br />
Behandlung Mortal. 2 %<br />
Meist Frühfälle<br />
Kombiniert<br />
mit Strophanthin<br />
Alles schwere Fälle
maximale Hyperthermie, bei der die Kranken gegebenenfalls bis zu 8 Stunden lang<br />
auf Temperaturen von 41,5-52,5° gehalten werden. Man läßt nach der Behandlung<br />
die Kranken stets noch einige Stunden eingepackt Hegen.<br />
Die Korpertemperatur wird im allgemeinen oral gemessen, am besten hält der Kranke<br />
dauernd ein Thermometer im Mund. Genauer ist die rektale Messung. Diese kann entweder<br />
mit gewöhnlichen Thermometern durch einen Schlitz in den Hüllen hindurch ausgeführt<br />
werden oder mittels elektrischer Meßinstrumente (Thermoelemente oder Widerstandsthermometer),<br />
die dauernd liegen bleiben. Hier ist aber auf gute Abschirmung<br />
gegenüber den Hochfrequenzströmen zu achten, da sonst falsche Werte angegeben werden.<br />
Nach BESSEMANNS und VAN MEIRHAEGE sind die gemessenen Temperaturen am höchsten<br />
im Rektum, dann folgen Muskeln und Unterhaut, am geringsten pflegt die Temperatur<br />
der Hautoberfläche zu sein.<br />
Die Innehaltung einer bestimmten Temperatur kann Schwierigkeiten bereiten,<br />
da bei der Wärmeentstehung und der Entwärmung verschiedene Faktoren mitwirken.<br />
Man kann deshalb so vorgehen, daß man beim Erreichen der gewünschten<br />
Temperatur den Strom ausschaltet und beim Absinken wieder einschaltet. Dadurch<br />
kann eine bestimmte Temperatur ziemlich kontinuierlich unterhalten werden.<br />
Selbstverständlich muß der Schweiß im Gesicht öfters abgetrocknet werden.<br />
Nach Abschalten de§ Stromes geht die Temperatur nicht gleich zurück; wir<br />
haben sogar beobachtet, daß sie manchmal noch etwas ansteigt, offenbar infolge<br />
der Anregung der gesamten Zelltätigkeit. Bei guter Verpackung gelingt es,<br />
die Körpertemperatur noch lange Zeit hoch zu erhalten, so daß sie erst im Verlauf<br />
von 3-4 Stunden auf normale Werte absinkt. Um die Über tempera tur stundenlang<br />
zu erhalten, genügt es, wenn man den Strom beim Absinken um 0,5-0,8°<br />
jeweils erneut für 10-15 Minuten einschaltet.<br />
Die elektrische Hyperthermie kann nach 3 verschiedenen Verfahren ausgeführt<br />
werden:<br />
1. Mit Apparaten besonders hoher Leistung, über 500 Watt. Die Patienten<br />
müssen dabei besonders gut eingepackt werden und liegen auf einem bequemen<br />
Stuhl. Das Kabel wird am besten um den Bauch herumgelegt. Noch besser ist die<br />
Verwendung von 2 parallel um den Bauch geführten Kabeln.<br />
2. Die Behandlung mit 2 Kurzwellengeräten mittlerer Leistung. Von jedem<br />
Gerät wird ein Kabel um den Leib des Kranken herumgeführt. Man kann auch<br />
ein Kabel (am besten in Filztaschc oder unter einer Schaumgummimatratze) unter<br />
den Patienten legen, das andere wird ihm auf Brust und Bauch gelegt. Sonst wie<br />
bei 1.<br />
3. Die Fieberkammer (Bild).<br />
Die elektrische Hyperthermie kann nach 3 verschiedenen Verfahren ausgeführt<br />
werden :<br />
1. mit Apparaten besonders hoher Leistung, über 600 Watt. Die Kranken müssen<br />
dabei sehr gut eingepackt werden und liegen auf einem bequemen Stuhl. Das<br />
Kabel wird am besten um den Bauch herumgeführt. Noch besser ist die Verwendung<br />
von 2 parallel um den Bauch geführten Kabeln.<br />
2. Behandlung mit 2 Apparaten mittlerer Leistung. Von jedem Gerät wird ein<br />
Kabel um den Leib des Kranken herumgeführt. Man kann auch ein Kabel (am<br />
besten in Filztasche oder unter einer Seh au m gum m ¡-Mat ratze) unter den Patienten<br />
legen, das andere auf Brust und Bauch. Sonst wie bei 1.<br />
150
3- Die Fieberkammern<br />
Sie sind Kästen, die dauernd von heißer Luft oder von Wasserdampf von 45°<br />
durchströmt werden. Die Kranken kommen nackt hinein, so daß nur der Kopf<br />
außen hervorsieht. Auf diese Weise wird die Wärmeabgabe verhindert und gleichzeitig<br />
der Schweiß getrocknet. Letzteres ist wichtig, da die Feldlinien sonst an den<br />
Schweißtropfen konzentriert werden und Verbrennungen herbeiführen können.<br />
Streng genommen ist es nicht richtig, von «künstlichem Fieber» zu sprechen.<br />
Als Fieber bezeichnet man nur solche Zustände, bei denen durch chemische Stoffe<br />
das Wärmezentrum beeinflußt und dadurch die Körpertemperatur erhöht wird.<br />
Man sollte also besser von Hyperthermie bzw. Radiothermic oder Pyrexie sprechen.<br />
Abb. 122: «Fieberkammer» «Pyrostat»<br />
Gegenüber anderen Verfahren zur Erzeugung von Hyperthermie hat die<br />
Elektropyrexie bedeutende Vorteile. Man kann nach WALINSKY Hyperthermie<br />
auch durch Bäder mit langsam ansteigender Temperatur hervorbringen. Hierbei<br />
können zwar hohe Körpertemperaturen erzeugt werden, aber es kommt viel häufiger<br />
zu Kollapsen, und die Prozedur ist für die Kranken unangenehmer. Die<br />
Temperaturen können auch nicht so lange aufrecht erhalten werden.<br />
Bei der Hyperthermie durch Bäder ist, wie BARZETT gezeigt hat, die wirkliche<br />
Tiefendurchdringung verhältnismäßig gering.<br />
Mit Heißluft gelingt es, hohe Temperaturen zu erzeugen und lange Zeit aufrechtzuerhalten<br />
(KETTERiNG-Hypertherm). Das Verfahren ist aber für die Kranken<br />
sehr unangenehm und erfordert viel strengere Wartung und Beobachtung selbst<br />
bei müder Anwendung.<br />
Die elektrische Überwärmung stellt sich den älteren Verfahren der Fiebererzeugung<br />
an die Seite, wie sie insbesondere nach dem Vorgang von WAGNER-<br />
JAUREGG ins Leben gerufen worden sind.<br />
Hl
Das ursprüngliche Verfahren besteht darin, daß Malariaparasiten auf Kranke übergeimpft<br />
werden, so daß je nach der Art der Erreger in bestimmtem Rhythmus Fieberanfälle<br />
erfolgen. Durch Behandlung mit Chinin oder den modernen Malariaheilmitteín<br />
Atebrin und Plasmochin kann die Krankheit an beliebigem Zeitpunkt beendet werden.<br />
Man kann auch Infektionen mit Rekurrens benutzen sowie Einspritzungen mit abgetöteten<br />
Krankheitskeimen (Pyrifer, Dmcicos), doch versagen diese oft.<br />
Daß alle diese Verfahren starke Eingriffe in das Körpergeschehen bedeuten und somit<br />
durchaus nicht immer harmlos sind, ist ohne weiteres einzusehen. Bei über jo Jahre<br />
alten Patienten kommt die Behandlung mit Malaria wegen der damit verbundenen Gefahren<br />
sowieso nicht mehr in Frage. Bei Tabikern wurden schwere Schäden, auch Tod,<br />
hervorgerufen (WÜLLENWEBER). Bei Rekurrensfieber kommen viele Versager vor.<br />
Dazu kommt, daß bei der Behandlung mit Infektfieber nicht mit Salvarsan kombiniert<br />
werden kann, da toxische Wirkungen und schwere Vergiftungen auftreten (WAGNER-<br />
JAUREGG). Pyrifer wirkt ungleichmäßig, oft treten dabei Schüttelfrost und Erbrechen auf,<br />
die Kranken haben unangenehme Empfindungen.<br />
Ausgesprochene Gegenindikationen des Malariafiebers sind Tuberkulose, Aortitis,<br />
Hypertonie, Fettsucht und urologische Erkrankungen. Von diesen bildet nur Tuberkulose<br />
eine Gegenindikation gegen die Elektropyresie, bei den anderen genannten Krankheiten<br />
kann sie angewandt werden. Bei der Behandlung der progressiven Paralyse, die<br />
bisher unheilbar gewesen war, spielen jedoch diese möglichen Schäden keine große Rolfe.<br />
Auch bei einem operativen Eingriff bei lebensgefährlicher Krankheit muß ja ein gewisses<br />
Gefahrenmoment mit in Kauf genommen werden.<br />
Der große Vorteil der elektrischen Überwärmung vor anderer Wärmeanwendung<br />
beruht darin, daß die Wärme nicht von außen durch die Haut zugeführt wird,<br />
sondern durch Umsetzung der elektrischen Energie im Inneren des Körpers entsteht.<br />
Wir erhalten also ein Wärmegefälle von innen nach außen, ähnlich wie es auch<br />
bei echtem Fieber vorhanden ist. Mit gewöhnlichen heißen Bädern, Schwitzpackungen,<br />
Lichtkästen ist es selten möglich, die Körpertemperatur wesentlich<br />
zu erhöhen, da dies durch die Wärmeregulation verhindert wird.<br />
Nach meinen über 20jährigen Erfahrungen, die gleichzeitig mit Bädern und<br />
Pyrifcrfieber gewonnen sind, ist die KW-Hyperthermie für die Kranken zweifellos<br />
das weitaus angenehmste Verfahren. Es entsteht kein unangenehmes Hitzegefühl,<br />
denn die Wärme wird im Körperinneren bei geringster Belastung der Haut erzeugt.<br />
Das Wärmegefühl hängt aber ab von der Stärke des Wärmcgcfälles von<br />
außen nach innen und nicht von der absoluten Temperatur, s. a. RAAB, V.TEUBERN,<br />
KOEPPEN, SCHULTZ, BARTH, LEHMANN, SCHOENEFELD und WACHSMANN.<br />
2. Zwischenfälle<br />
Zwischenfälle kommen bei müder Hyperthermie kaum vor. Sie wird auch von<br />
Kreislaufkranken auffallend gut vertragen, offenbar infolge der Herabsetzung des<br />
Widerstandes in Arteriolen und Kapillaren (S. 87fr.). Trotzdem ist größte Aufmerksamkeit<br />
und Achtsamkeit des bedienenden Personals, besonders bei der<br />
Temperaturmessung, unbedingt notwendig.<br />
Plötzlicher steiler Temperaturanstieg ist gefährlich, der Strom muß dann sofort ausgeschaltet<br />
werden. Besonders gefährdet sind Kranke mit cerebralen Störungen, bei<br />
denen ein Versagen der Wärmeregulierung zu befürchten ist. Bei Herzkranken<br />
und Patienten mit Aneurysmen der Aorta wird man sehr vorsichtig sein müssen.<br />
Zeichen, die zur Vorsicht mahnen, sind rasches Ansteigen der Pulszahl, Zyanose<br />
oder Blässe, Benommenheit. Die Behandlung ist abzubrechen bei Pulszahlen über<br />
152
16o, Anstieg der rektalen Temperatur über 42 o , CHEYNE-STOKEsschem Atmen,<br />
ferner bei Delirien, Koma und allgemeinem Tremor. Beim Versagen des Blutkreislaufes<br />
kommen Injektionen von Strophantin, Coffein oder Cardiazol in Frage;<br />
da die Erscheinungen manchmal auf Kochsalzarmut des Körpers und auf Sinken<br />
des Blutzuckers beruhen, sind Salzinfusionen und Zucker bereitzuhalten. Bei<br />
starkem Absinken des Blutdruckes sind Adrenalin oder Ephredin zu injizieren.<br />
Die Kranken werden zur Abkühlung sofort aufgedeckt, die Stirn mit Wasser<br />
gekühlt.<br />
Störungen des Blutkreislaufes sind jedoch sehr selten. Bei vegetativ leicht erregbaren<br />
Personen und bei solchen, deren Körpertemperatur sehr rasch auf 39 o ansteigt,<br />
evtl. mit Pulsanstieg und Herzbeschwerden, bewährt sich die Dämpfung<br />
des vegetativen Systems mit Skopolamin-Eukodal-Ephcdrin schwach.<br />
í Eine gewisse Mattigkeit der Kranken verschwindet schon nach 2-3 Stunden.<br />
Am nächsten Tag kann nochmals Mattigkeit eintreten. Manchmal tritt Herpes<br />
labialis auf, der im Laufe der Behandlung wieder verschwindet.<br />
RAAB sah bei 700 mit maximaler elektrischer Hyperthermie behandelten Kranken<br />
keine einzige schwere Gefahr. Die große Statistik der Weltliteratur ergibt nur<br />
1 % Todesfälle bei maximaler Hyperthermie, wobei die weniger schonenden<br />
Wärme ver fahren mit einbezogen sind. Alle Schäden, die bisher von amerikanischen<br />
Autoren beschrieben sind (besonders am Hoden), entstanden nur bei Behandlung<br />
mit dem KETTERING-Hypertherm (Heißdampf). Bei Elektrothermie wurden derartige<br />
Schäden bisher nicht gesehen (GILES, HERVEY, DAMPERE). Bei Malaria dagegen<br />
werden 6-10% Todesfälle angegeben, je nach Auswahl des Krankengutes.<br />
3. Physiologische Reaktionen<br />
Die Beeinflussung des Wutkreislaufes durch Erweiterung der Kapillaren entspricht<br />
der Erhitzung der Haut. Diese ist bei Überwärmung durch andere physikalische<br />
Mittel viel stärker; es kann dabei 2ur Stase kommen, was bei KW nicht<br />
beobachtet ist.<br />
Mitunter entsteht eine Wirkung auf das nervöse System der Gefäße und des<br />
Herzens, die aus der reinen Erwärmung nicht erklärt werden kann. Solche Erscheinungen<br />
(Beklemmungen und Tachykardie) sind stärker bei Durchflutung des<br />
Brustkorbes als des Unterleibes. Nach GILES soll sich die Aorta erweitern. Die<br />
Erhöhung der Erythrozytenzahl um etwa 1 Million entsteht vermutlich durch<br />
Eindickung des Blutes.<br />
Der Blutdruck verhält sich nach Untersuchungen von RAAB sehr günstig; er<br />
wird durchschnittlich um etwa 20% herabgesetzt, während er nach WILLBUR und<br />
STEVENS bei Hyperthermie mit strahlender Hitze übermäßig stark herabgeht,<br />
manchmal aber auch erheblich ansteigt. Nach den Erfahrungen der physikalischen<br />
Therapie ist anzunehmen, daß diese Unterschiede mit der Plötzlichkeit der äußerlichen<br />
Hitzeeinwirkung zusammenhängen; bei rascher Einwirkung sehen wir<br />
gewöhnlich anfängliche Kontraktion der Hautgefäße, beim Einschleichen nur<br />
Erweiterung.<br />
Die Pulsfrequenz wird durch die Elektropyrcxie lange nicht so stark erhöht wie<br />
durch andere Wärmeanwendungen. Bei Erwärmung auf 40 0 wurde meist Zunahme<br />
bis auf ijo gefunden, während sie beim «KETTERiNG-Hypertherm» oft bis 190<br />
ging. Die Pulsamplitude nimmt stark zu, der diastolische Blutdruck geht nach RAAB<br />
133
oft bis auf o herab. In der Fieberkammer steigt nach THOMSON die Pulszahl proportional<br />
der Temperatur an. Der Blutdruck steigt zuerst und fällt später ab.<br />
Die KW-Hyper thermie ist demnach besonders schonend für die Kreislauforgane.<br />
Bei der Allgemeinbehandlung in großen Kondensatorfeldcrn bis zur Erzeugung<br />
allgemeiner Hyperthermie treten Veränderungen auf, die von BIERMAN und FISH-<br />
BERG näher beschrieben sind. Sie erzeugten Temperaturen bis 140 0 F (40 o C), die<br />
bis zu 3-6 Stunden lang aufrechterhalten wurden. Der Blutstrom wurde dabei<br />
stark beschleunigt (bis um 400%), die Pulsbeschleunigung betrug pro Grad Temperatursteigerung<br />
etwa 8 Schläge, der Blutdruck war nur im Anfang erhöht, fiel<br />
aber dann etwas ab. Auffallend ist die Erhöhung der Atemfrequenz. Bei sehr<br />
starker Einwirkung können apnoische Perioden auftreten wie beim Hitzschlag,<br />
die mit Perioden gesteigerter Atemfrequenz abwechseln. Nach den Messungen<br />
von BIERMAN ist der produzierte Schweiß stark sauer (pH 4-;) und enthält bis zu<br />
250-350 mg% Milchsäure. Die Kohlensäure im Blut fällt stark ab, es entsteht eine<br />
manifeste Alkalose, die sich auch in einem Abfallen der CI-Ausscheidung in Urin<br />
und Magensaft bemerkbar macht.<br />
BINET, LAUDAT und AUCLAIR fanden bei Hunden bei Temperatur Steigerungen<br />
auf 43-46° eine starke Abnahme des Plasmavolumens und der Alkalireserve. Das<br />
Globulinvolum wurde dagegen vermehrt. Die Senkung der Alkalireserve erfolgte<br />
sehr rasch im Beginn der Behandlung und brauchte lange Zeit zum Wicderausgleich.<br />
Die Abgabe von Wasser beträgt bei eine Stunde langer maximaler Hyperthermie<br />
gewöhnlich 1-1,5 kg Wasser gegenüber 3-5 kg bei strahlender Hitze (RAAB).<br />
Delirien und Krämpfe, wie sie bei Anwendung strahlender Hitze auftreten<br />
können, werden bei Elcktropyrcxie nicht beobachtet. Nach etwa zehn Hyperthermien<br />
tritt nach SZOKOLL und RAAB eine Gewöhnung des Organismus ein, die<br />
anfängliche Gier nach Salzwasser schwindet.<br />
Die Kal^ium-Wcrtc des Serums steigen während der starken Hyperthermie bis<br />
14 mg% und gehen dann wieder zur Norm zurück.<br />
Der Grundumsatz soll sich nach RAAB bei der Temperatur von 40 o um 60% erhöhen.<br />
Erst bei sehr starker Hyperthermie an der Grenze der Gefahrenzone steigt<br />
die Milchsäure im Blut und die Alkalireserve wird herabgesezt. Sonst ist meist<br />
Alkalose des Blutes und Herabsetzung des C02 vorhanden. Der Blutzucker wird<br />
nur wenig beeinflußt, meist etwas erniedrigt (WÜST).<br />
Die Flüssigkeitsabgabe durch die Haut ist nach den Untersuchungen von NEY-<br />
MAN und OSBORNE bei Elektropyrexie reichlicher als bei Behandlung mit strahlender<br />
Hitze, doch gibt RAAB das Gegenteil an (s. oben).<br />
Die Ventilation und damit die Abgabe von Wärme durch die Atemluft nimmt<br />
stark zu; bei Versuchen von HILDEBRANDT an Kaninchen nach 10 Minuten auf<br />
das Doppelte. Die Ausnutzung des Sauerstoffes und die COa-Abgabe waren dabei<br />
verringert.<br />
Die Steigerung der Permeabilität der Zellen, die sich u.a. nach der Methode<br />
von WALTER an der Blut-Liauorschranke nachweisen läßt, führt zu vermehrter<br />
Durchlässigkeit für Schwcrmctallsalzc. So konnte BINET intravenös gegebenes<br />
Wismut bei Hunden nach Hyperthermie im Liquor nachweisen. Nach HAUPTMANN<br />
beträgt der Permeabilitätsquotient Blut-Liquor für Brom 2,8-3,2 und steigt nach<br />
Hyperthermie erheblich (MEHRTENS und POUPPIRT), während Brom im Liquor<br />
sonst nicht vorkommt.<br />
Während, wie schon erwähnt, die müde Hyperthermie verhältnismäßig un-<br />
154
gefährlich ist, können bei der maximalen Hyperthermie Todesfälle eintreten. Sie<br />
beruhen wahrscheinlich auf einem Versagen des Wärniezentrums bei dazu disponierten<br />
Individuen und treten deshalb vorwiegend bei Personen mit Erkrankungen<br />
des Gehirns auf. Die Temperatur pflegt dabei plötzlich unaufhaltsam stark anzusteigen.<br />
Die Höhe des im Körper erreichten Wärmegrades richtet sich neben<br />
der Energiezufuhr nach der Funktion der Regulationsorganc für die Körperwärme.<br />
Versuche von RAJEWSKY haben gezeigt, daß bei der Wärmeentstchung im Körper<br />
der Zustand des Nervensystems wesentlich mitwirkt (S. 98).<br />
Die Verteilung der Wärme im Körper habe ich an Meerschweinchen näher studiert<br />
(S. 99). Durch diese Untersuchungen erscheint das heutige Verfahren besonders gerechtfertigt,<br />
bei dem die Elektroden an die Körpermittc herangebracht werden.<br />
Die Belastung der einzelnen Körperfunktionen, insbesondere des Kreislaufes,<br />
ist bei der elektrischen Hyperthermie günstiger als bei andersartiger Erhitzung des<br />
Körpers. Dies ist schon daraus zu ersehen, daß bei körperlicher Anstrengung in<br />
heißen Klimaten schon bei verhältnismäßig geringem Anstieg der Körpertemperatur<br />
Hitzschläge eintreten können, während wir dies Ereignis bei KW-Behandlung<br />
kaum jemals und erst bei extrem hohen Temperaturen erleben. Vielleicht beruht<br />
dies auf der verhältnismäßig geringen Abgabe von Kochsalz. Doch sind wir hierüber<br />
noch nicht genügend unterrichtet.<br />
Ein großer Vorteil der elektrischen Überwärmung ¡st die Möglichkeit genauer<br />
Dosierung. Die Temperatur, die gewöhnlich im Mund gemessen wird, kann leicht<br />
auf einer bestimmten Höhe gehalten werden. Man kann sie genau so lange unterhalten,<br />
wie es erwünscht ist. Bei irgendwelchen Störungen braucht man nur den<br />
Apparat abzuschalten, während bei Malariafiebcr keine Unterbrechung des Anfalles<br />
möglich ist.<br />
Soll aus irgendwelchen Gründen die Temperatur wieder gesenkt werden, so<br />
genügt es meist, den Kranken nach Ausschalten des Apparates freizulegen und bei<br />
Bedarf mit kalten Aufschlägen zu behandeln.<br />
Die KW-Hyperthermie wird im allgemeinen selbst von schwachen Menschen<br />
gut vertragen. Kranke mit ausgesprochenen Herzfehlern, insbesondere mit sehr<br />
niedrigem Blutdruck, wird man nur mit besonderer Vorsicht behandeln. Patienten<br />
mit hohem Blutdruck sind nicht gefährdet, die Blutdruckkrankheit wird durch<br />
die Behandlung günstig beeinflußt.<br />
Tierversuche an Ratten, die mit Lues infiziert waren, stellte BESSEMANS an. Nach<br />
Hypcrthermiebehandlung war noch y4 der Tiere im Befund positiv; mit Salvarsan<br />
allein behandelte Tiere hatten noch positive Befunde an den Lymphdrüsen. Bei<br />
kombinierter Behandlung dagegen wurden alle Tiere geheilt.<br />
Die Indikationen und Behandlungsergebnisse werden im speziellen Teil mit besprochen,<br />
die Überwärmungsbehandlung der Gelenkerkrankungcn unter den<br />
rheumatischen Erkrankungen. Hier ist zu erwähnen, daß bei diesen Leiden so gut<br />
wie ausschließlich die milde Hyperthermie in Frage kommt. SOLOMON U. STECHER<br />
haben wiederholt schleichende arthritischc und rheumatische Erkrankungen<br />
mit maximaler Hyperthermie behandelt, mit unbefriedigenden Ergebnissen. Nach<br />
meinen Erfahrungen ist bei den rheumatischen Gelenkerkrankungcn mit geringeren<br />
Temperaturen, bis 39 o , mehr zu erreichen. Bei Ischias und anderen Ncuritiden<br />
ist Hyperthermie nur dann anzuwenden, wenn die lokale Behandlung nicht<br />
zum Ziel führt. Auch ist erst mit milder Hyperthermie (38-39°) zu beginnen. Die<br />
milde Hyperthermie ¡st hier überlegen, doch sind meist zahlreiche Sitzungen not-<br />
IJ5
wendig. Auch RENSHAW und ZEITLER geben Erfolge der milden Hyperthermie<br />
bei chronischer Arthritis an, während maximale Hyperthermie versagt hatte. Die<br />
viel älteren deutschen Arbeiten auf diesem Gebiet sind diesen Autoren anscheinend<br />
unbekannt geblieben. KOEPPEN berichtet über ähnliche Erfolge bei Arthritiden<br />
mit Anwendung einer «Fieberkammer».<br />
Gegenindikationen sind Lungentuberkulose, schwere Leberkrankheiten, Nierenerkrankungen<br />
mit Ödemen sowie Zuckerkrankheit.<br />
Wahrscheinlich wird sich das Gebiet der Hyperthermiebehandlung weiter ausdehnen.<br />
Heute läßt sich darüber noch nichts Abschließendes sagen. Durch vereinfachte<br />
Konstruktionen und Anwendung der Geräte wird sich die Behandlung<br />
sicher in weiteren Kreisen durchsetzen, zumal die Kranken sie angenehm empfinden.<br />
Gegenüber allen anderen Mitteln zur Erzeugung künstlichen Fiebers hat die<br />
KW-Hy per thermie besondere Vorteile, die nochmals kurz zusammengefaßt seien:<br />
i. Es treten keine Schäden am Blutkreislauf ein (Pulsbeschleunigung durchschnittlich<br />
bis 150, gegenüber 190 beim KETTERiNG-Hypertherm). Der Blutdruck<br />
sinkt systolisch um etwa 20 mm Hg, diastolisch manchmal bis o, gegenüber häufiger<br />
Steigerung bis 150-190 bei strahlender Hitze.<br />
2. Kein starkes Schwitzen, kein stärkerer Kochsalzverlust.<br />
3. Während in heißen Bädern eine Umkehr des Vorganges der natürlichen<br />
Fieberentstehung erfolgt (Wärmegefälle von außen nach innen), ist bei der KW-<br />
Hyperthermie meist die Temperatur der Haut niedriger als die des Inneren. Die<br />
Haut als Aufnahmeorgan der Reize für das vegetative Nervensystem erfährt weit<br />
schwächere Reizungen (SCHMITT, HOLMQUEST, MARSHALL, RAAB). Die Durchwärmung<br />
erfolgt in physiologischer Weise.<br />
Gegenüber dem Malariafieber bestehen folgende Vorteile:<br />
1. Gute Dosierbarkeit. Die Temperatur kann in ihrer Höhe und Dauer mit dem<br />
Drehknopf des Apparates geregelt werden. Die Behandlung kann jederzeit abgebrochen<br />
werden.<br />
2. Schädigungen des Allgemeinbefindens sind sehr selten.<br />
3. Es treten keine toxischen Wirkungen auf.<br />
4. Es besteht keine Altersgrenze nach oben, und es ist keine so strenge Auswahl<br />
der Kranken notwendig bezüglich der Verträglichkeit.<br />
5. Möglichkeit der Kombination mit Salvarsan, Wismut und anderen Mitteln.<br />
V. Indikationen und Behandlungsergebnisse<br />
Die hauptsächlichen großen Krankheitsgruppen, bei denen die KW-Bchandlung<br />
wirkt, sind:<br />
i. Entzündliche und eitrige, insbesondere durch Kokken hervorgerufene Krankheiten.<br />
2. Auf mangelhafter Durchblutung beruhende Krankheiten.<br />
3. Rheumatismus in seinen verschiedenen Erscheinungsformen.<br />
4. Alle sonstigen Erkrankungen, bei denen Wärme angebracht ist.<br />
j. Inkretorische Störungen.<br />
156
i. Eitrige Entzündungen der äußeren Bedeckung<br />
Seit meinem ersten Selbstversuch an einem Nasenfurunkel ist von vielen<br />
Autoren der ganzen Welt großes Material über die Erfolge bei eitrigen Entzündungen<br />
gesammelt worden. Aber auch bei anderen Krankheiten hat sich die KW-Therapie<br />
bewährt.<br />
Obwohl die citrigen Entzündungen geradezu eine Domäne der KW-Therapie<br />
sind, findet sich nur eine kleine Zahl von Arbeiten in der chirurgischen Literatur.<br />
Vom Standpunkt der Chirurgen erscheint die Skepsis gegenüber einem konservativen<br />
Mittel, besonders 2ur Behandlung großer Eiterungen, als verständlich.<br />
Einerseits ist dem Chirurgen das aktive Vorgehen mehr gelegen als das ((internistische»<br />
Abwarten und «Zeitverlieren» (wobei die Zeit der Nachbehandlung nach<br />
dem Eingriff nicht in Rechnung gezogen wird) und das Behandeln mit einem in der<br />
Dosierung nicht immer ganz leicht anzuwendenden Mittel, ferner sieht er in den<br />
UKW bloß ein Mittel zur Wärmeapplikation, das sich von einem Heizkissen nicht<br />
wesentlich unterscheidet. Andererseits scheint die Behandlung mit einem Mittel,<br />
das die Resorption fördert und dadurch die toxischen Produkte dem Kreislauf<br />
wieder zuzuführen scheint, gegen den überlieferten Grundsatz «Ubi pus, évacua»<br />
zu verstoßen.<br />
So ist es nicht verwunderlich, wenn von gewisser Seite der KW-Therapie das<br />
Indikationsgebiet akuter eitriger Entzündungen abgesprochen wird, meist allerdings<br />
ohne fachgemäße Nachprüfung. Die sich in großer Zahl häufenden Berichte<br />
über die außerordentlich gute, rasche und schmerzfreie Heilung solcher Erkrankungen,<br />
wie Furunkel, Karbunkel, Abszesse, Mastitis und Lungenabszesse, die<br />
aus allen Ländern der Welt vorliegen, lassen diesen Standpunkt nicht aufrechterhalten,<br />
mögen sie auch mancher bisherigen Theorie widersprechen. Erst neuerdings<br />
hat FUCHS wieder auf die guten Erfolge bei akuten Erkrankungen hingewiesen.<br />
Mißerfolge sind fast immer auf falsche Dosierung zurückzuführen.<br />
ä) Furunkel<br />
Bei der Behandlung von über joo mehr oder weniger ausgedehnten Furunkulosen<br />
hatten wir nur einen einzigen Versager, der dadurch bedingt war, daß die<br />
betreffende Kranke sich nicht an die Anordnungen hielt und nebenher eine «Selbstbehandlung»<br />
mit Salben und Pflastern trieb. In allen anderen Fällen erfolgte die<br />
Heilung in sehr kurzer Zeit und ohne jede Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit.<br />
Es hat sich dabei um Furunkel an verschiedenen Körperstellen, hauptsächlich<br />
Im Gesicht, und in verschiedenen Entwicklungsstadien gehandelt. Teilweise waren<br />
es akute Furunkel auf dem Höhestadium ihrer Entwicklung, teils waren sie noch<br />
im Entstehen begriffen, hart und ohne Abszedierung. Bei etwa einem Viertel der<br />
Erkrankungen war mehr oder weniger starke Lymphangitis und Schwellung der<br />
regionären Lymphdrüsen vorhanden. Verschiedentlich handelte es sich um zirkumskripte,<br />
z.T. schon monatelang bestehende chronische Furunkulosen mit immer<br />
wieder rezidivierender Aussaat. Bei mehreren der Kranken waren bereits Inzisionen<br />
vorgenommen worden, ohne daß dieser Therapie ein Erfolg beschieden war.<br />
Bei den beschriebenen Fällen wurden niemals Antibiotica oder Baktcriostatica<br />
gegeben.<br />
157
Die Platte, die dem Furunkel selbst angelegt wird, muß mindestens die Größe des<br />
entzündeten Bereiches haben; bei frischen Furunkeln, die noch im Entstehen begriffen<br />
sind, kommt man gelegentlich mit Platten von 5 cm Durchmesser aus, doch cmpBchlt es<br />
sich allgemein, größere Platten, bis zu 10 cm Durchmesser, zu nehmen.<br />
Man kann auch zu diesem Zweck vorteilhafterweise Elcktrodenschuhe verwenden,<br />
deren Boden konkav ist, so daß trotz festen Aufliegern der Ränder der Furunkel selbst<br />
nicht gedrückt wird.<br />
Sonst stellt man die Elektrode mit 2-3 cm freiem Luftabstand ein. Die andere Elektrode<br />
nimmt man «inaktiv» größer und mit größerem Abstand.<br />
Bei Furunkeln unter dem Unterkiefer, die schwer zugänglich sind, wird eine différente<br />
Elektrode mit kugeliger Oberfläche genommen, die ungefähr den Körperlinien angepaßt<br />
ist. Der Kopf wird zur Seite gebogen, die andere Platte kommt an die entgegengesetzte<br />
Backe. Sie dient gleichzeitig als Stütze für den Kopf des Kranken. Oder man setzt die<br />
Platten schräg auf die eine Kante. Sehr geeignet sind auch das Strahlenfeld und die<br />
Monode.<br />
Das Feld darf bei der Behandlung nicht zu stark gemacht werden. Man soll nur<br />
so weit gehen, daß angenehme Wärme und Entspannung empfunden wird. Benutzt<br />
man höhere Stromstärken, so können Hitzekoagulationen im erkrankten Gewebe<br />
entstehen, die sich schon bald nach der Behandlung in blauroter Verfärbung des<br />
Furunkels und seiner Umgebung bemerkbar machen. Die Ausheilung dieses Zustandes<br />
beansprucht dann meist längere Zeit, 8-10 Tage und mehr. Eine einzelne<br />
Angabe über Verstärkung der entzündlichen Vorgänge nach KW-Durchflutung<br />
beruht auf einer solchen falschen Dosierung.<br />
Als Dauer der einmaligen Behandlung genügen im Anfang 3-5 Minuten; nur<br />
bei ausgedehnten und tiefliegenden Prozessen geht man über diese Zeit hinaus.<br />
Einmalige Behandlung am Tage genügt fast immer.<br />
Der Krankheitsverlauf wird hier genau beschrieben, weil er in typischer Weise<br />
die Wirkung der Kurzwellen auf alle entzündlichen und eitrigen Prozesse zeigt.<br />
Er ist verschieden je nach dem Stadium der Erkrankung, in dem die Patienten zur<br />
Behandlung kommen. Das schnelle Verschwinden der Schmerle* un d das subjektive<br />
Aufleben der Kranken, oft schon nach der ersten Durchflutung, wird von<br />
fast allen Autoren immer wieder betont.<br />
Besteht nur ein entzündliches Infiltrat, ¡st also der Furunkel noch klein und im<br />
Entstehen begriffen, so setzt sich nach der ersten Durchflutung zunächst die gerötete<br />
Kuppe von der Umgebung scharf ab. Die Mitte schrumpft ein und vertrocknet.<br />
Am nächsten bzw. übernächsten Tag ist nur noch eine bräunüchrote<br />
Oberflächenerhebung da, die schnell, meist im Laufe des nächsten Tages, verschwindet.<br />
Die befallene Stelle unterscheidet sich dann in nichts mehr von der<br />
Umgebung.<br />
Anders ist das Verhalten, wenn bereits Erweichung vorhanden war. In diesem<br />
Fall erfolgt gewöhnlich bald ein Durchbruch, manchmal schon während der Behandlung,<br />
vielfach auch nach einigen Stunden oder im Verlauf der darauffolgenden<br />
Nacht. Immer entleert sich eine nicht sehr große Eitermenge, der kurz danach die<br />
Abstoßung des nekrotischen Pfropfes folgt. Die Eiterung pflegt danach gewöhnlich<br />
sofort aufzuhören, und dann geht die völlige Heilung auffallend rasch, meist in<br />
2-3 Tagen vor sich. Die gleichen Vorgänge vollziehen sich im Grund bei jeder<br />
Behandlung entzündlicher Herde durch KW: Bei frischen Infiltraten beschleunigte<br />
Resorption, hei älteren Processen Demarkation und Einschmel^ung.<br />
Die KW-Bchandlung der Furunkel ist nicht nur völlig schmerzlos, sondern für<br />
die Kranken so angenehm, daß sie immer gern wiederkommen.<br />
158
Zu unseren Ergebnissen ist zu sagen, daß keinerlei andere Nebenbehandlung<br />
stattgefunden hat; die befallenen Gliedmaßen wurden oft nicht einmal ruhiggestellt.<br />
Im Gegenteil schonten sich - entgegen unserer Verordnung - die Kranken<br />
infolge der nach der Durchflutung eingetretenen Schmerzlosigkeit überhaupt<br />
nicht, sondern setzten ihre gewohnte Beschäftigung fort.<br />
Diese Tatsache ist deshalb besonders bemerkenswert, weil Furunkel häufig unter<br />
konscrvativerBehandlung von selbst zurückzugehen pflegen, wenn sie vollkommen<br />
ruhiggestellt werden. Selbstverständlich sollte auch bei UKW-Behandlung stets<br />
Ruhigstellung erfolgen. Die selbst ohne Ruhigstellung erzieltten Erfolge sprechen<br />
aber für die rasche Heilwirkung der KW. Außerdem sind in allen von uns behandelten<br />
Fällen die Heilungen so schnell erfolgt, wie es sonst wohl nie beobachtet<br />
wird. Wer die lange Dauer bei den bisher üblichen Behandlungsverfahren, die<br />
Beschwerden der Inzisionsbehandlung und die Arbeitsbehinderung während der<br />
Nachbehandlung am eigenen Leib erfahren hat, kann sich ein genügendes Urteil<br />
über die Vorzüge des KW-Verfahrens bilden.<br />
Durchschnittlich betrug die Zeit, in der völlige Ausheilung der Furunkel erhielt wurde,<br />
4-6 Tage. Dazu ist aber zu bemerken, daß bei den meisten Einzelfurunkeln die<br />
Ausheilung schon in 2-3 Tagen erfolgt ist und daß bei der genannten Durchschnittszahl<br />
ausgedehnte Furunkulosen und Gesichtsfurunkel einbezogen sind.<br />
Eigenartig ist die Tatsache, daß rezidivierende Furunkel oft nicht so gut auf die<br />
KW-Behandlung reagieren wie der erste Furunkel. Ebenso verschlechtern frühere<br />
Inzisionen das Ergebnis. LIEBESNY hatte gute Erfolge bei schwersten Gesichtsfurunkcln,<br />
auch solchen an der Oberlippe, er hatte keinen Versager. SCHMITT berichtete<br />
über 10000 Behandlungen bei Furunkulosen aller Art in USA, mit einer<br />
durchschnittlichen Heilungsdauer von 3-4 Tagen.<br />
Eine Gruppe für sich bilden die Gehörgangsfurunkel. Immer hat es sich um besonders<br />
schwere und hartnäckige Erkrankungen gehandelt, die sich unter gewöhnlicher<br />
konservativer Behandlung, teilweise auch nach Inzision, nicht gebessert<br />
hatten. Bei fast allen von uns mit KW behandelten Kranken hatten ausgedehnte<br />
Schwellungen bestanden, die sich manchmal über eine Gesichtshälfte erstreckt<br />
hatten; mehrmals waren phlegmonöse Infíltrate der Parotisgegend vorhanden.<br />
Auch hier konnte ohne jede andere Nebcnbchandlung in den meisten Fällen ein<br />
voller Erfolg erzielt werden.<br />
b) Karbunkel<br />
Bei Karbunkeln verschiedener Größe war das Ergebnis in allen Fällen gut.<br />
Die Behandlung wurde in der gleichen Weise wie bei den Furunkeln vorgenommen<br />
; nur die Dauer der einzelnen Sitzung wurde im allgemeinen etwas länger, bis<br />
zu 30 Minuten, gewählt.<br />
Der 68jährige Arzt Dr. Schi., bei dem ein Karbunkel von Fünfmarkstückgroße auf<br />
dem Boden eines chronischen Ekzems in der Lendengegend entstanden war mit Lymphadenitis<br />
der Leistengegend und starker Behinderung im Gehen und Bücken, wurde 3 Tage<br />
lang je zweimal 10 Minuten behandelt. Der Erfolg war, daß die Schmcrzhaftigkeit verschwand,<br />
der Karbunkel aufbrach und sich danach sofort stark verkleinerte. Am 3.Tag<br />
waren drei nekrotische Pfropfe abgestoßen. Der Kranke konnte danach wieder eine längere<br />
Reise ohne Beschwerden ausführen und seinem Beruf nachgehen. Etwa 8 Tage später<br />
war die Erkrankung völlig ausgeheilt.<br />
Der 60jährige Dr. St. hatte einen Karbunkel, der sich seitlich von einem Ohr bis zum<br />
anderen, in der Höhe vom Haarwirbel bis zum 7. Halswirbel, erstreckte. Er war nach<br />
159
3 Tagen Behandlung mit 6 m Wellenlänge fieberfrei, konnte nach 5 Tagen den Kopf<br />
wieder bewegen; nach 14 Tagen war die Wunde gereinigt und der Kranke beschwerdefrei.<br />
Durchschnittlich betrug die Heilungsdauer bei den behandelten Karbunkeln<br />
etwa 8 Tage, bei sehr großen Karbunkeln 2-3 Wochen.<br />
Über ähnliche Erfolge berichten<br />
verschiedene Autoren, in<br />
erster Reihe LIEBESNY, der u. a.<br />
allein über 60 Kranke mit Oberlippenfurunkeln<br />
und Karbunkel<br />
berichtet. Diese Ergebnisse wurden<br />
kontrolliert von der chirurgischen<br />
Universitätsklinik in<br />
Wien (Prof.DENK), der die Patienten<br />
größtenteils angehörten.<br />
Neuerdings berichtet FUCHS<br />
(Wien) über Erfolge bei Oberlippenfurunkeln.<br />
Gleiche Ergebnisse hatten außer<br />
den bereits genannten Autoren<br />
RUETE sowie EGAN bei über 1000<br />
Furunkulosen und Karbunkeln<br />
hauptsächlich des Gesichtes, LIE-<br />
BESNY bei zahlreichen Oberlippenfurunkeln<br />
und SCHMITT (USA) bei<br />
über 100000 Behandlungen. Alle<br />
diese Autoren geben als durchschnittliche<br />
Heilunsgdauer 3-4 Tage<br />
an. FRIEBOES bezeichnet die KW-<br />
Therapie als «Mittet der Wahl» bei<br />
Furunkulosen.<br />
Abb. 123: Elektrode zur Furunkelbehandlung Mangelhafte Erfolge hatten da-<br />
(Monode) gegen nur KOWARSCHIK, BRUGSCH<br />
und PRATT, LEZIUS, welch letzterer<br />
sich jedoch später, bei richtiger Dosierung, vom Gegenteil überzeugt hat. Die guten<br />
Ergebnisse bei postoperativen Beschwerden und chronischen Entzündungen werden jedoch<br />
auch von diesen Autoren anerkannt.<br />
Í") Hidroadenitis<br />
Bei der Behandlung der Schweißdrüsenabszesse in den Achselhöhlen ist die<br />
Einstellung der Elektroden meist nicht ganz einfach, weil es für die Kranken<br />
schwer ist, die Arme lange Zeit nach oben gestreckt zu halten. Man muß deshalb<br />
den Kranken möglichst Gelegenheit geben, sich irgendwo mit der Hand festzuhalten.<br />
Die Stellung der Elektroden ist in der Abb.123 wiedergegeben.<br />
Als différente Elektrode wird eine kugelig oder parabolisch gekrümmte Platte genommen,<br />
damit stärkere Randwirkungen vermieden werden. Ist keine solche Elektrode<br />
vorhanden, dann kann man auch die gewöhnlichen Plattenelektroden in Kantenstellung<br />
verwenden. Vorteilhaft ist auch die Monode (Abb. 123). Die Behandlungsdauer ist zuerst<br />
3, steigend bis 10 Minuten. Im allgemeinen genügt täglich einmalige Behandlung.<br />
160
Hier sind ganz besonders günstige Heilungserfolge zu verzeichnen; selbst<br />
außerordentlich hartnäckige Erkrankungen dieser Art wurden in kürzester Zeit<br />
vollkommen geheilt. Die Kranken legten sich auch hierbei keine besondere Schonung<br />
auf, außer daß sie, wie es wohl selbstverständlich ist, anstrengende Arbeit<br />
mit den Armen vermieden. Zu empfehlen ist aber doch, auch während der Kurz-<br />
Abb. 125 : nach sechsmaliger Behandlung Abb. 124: Heilerfolg bei Hidradenitis<br />
(Â — 4,80 m) (nach PFLOMM)<br />
wcllcnbchandlung die Arme in der Schlinge tragen zu lassen, obwohl die Kranken<br />
durch die baldige Beseitigung der Schmerzen geneigt sind, diese Vorsicht außer<br />
acht zu lassen. Von der Ruhigstellung ist noch eine weitere Beschleunigung des<br />
Hcilungsvcrlaufcs zu erwarten.<br />
Frl. K., ijjährig, war schon seit 3 Wochen ohne Erfolg wegen ausgedehnter Schwcißdrüsenabszessc,<br />
die immer wieder rezidivierten, chirurgisch behandelt worden. Als sie<br />
in meine Behandlung kam, waren starke, harte Infiltrate in der ganzen Achselhöhle vorhanden,<br />
nur an einer kleinen Stelle hatte eine Abszedierung stattgefunden. Schon nach<br />
der ersten Behandlung mit Kurzwellen waren die Schmerzen vollkommen verschwunden ;<br />
die im Entstehen begriffenen Infiltrate hatten sich schon am anderen Tage zurückgebildct.<br />
Am 3. Tage war bis auf einen erbsengroßen Hautdefekt nichts mehr zu sehen.<br />
Der 37jährige Professor Wi. kam mit einer ausgedehnten und schmerzhaften Hidradenitis<br />
in unsere Behandlung. Während der größte Teil der Infiltrate noch bretthart war,<br />
ließ sich in der Mitte an umschriebener Stelle Fluktuation nachweisen. Schon während<br />
der Behandlung erfolgte ein Durchbruch; der Kranke verspürte starke Erleichterung.<br />
Nach sechsmaliger Behandlung war völlige Heilung eingetreten.<br />
Fr. I.U., 23)ährig, war schon seit 4 Wochen in chirurgischer Behandlung gewesen.<br />
Vor 10 Tagen hatte eine Inzision stattgefunden, die einem Teil des Eiters Abfluß verschafft<br />
hatte; danach war aber eine Verschlimmerung eingetreten, und als die Kranke uns<br />
aufsuchte, war ihr Befinden schlechter als je zuvor. Auch hier erfolgte im Anschluß an die<br />
161
Behandlung zunächst cinc starke Eiterung aus der bestehenden Fistel, die aber schon am<br />
nächsten Tag nachließ. Die verhärteten Teile gingen allmählich immer mehr zurück,<br />
nach 8 Behandlungen, die auf 13 Tage verteilt waren, war kein krankhafter Befund mehr<br />
nachzuweisen.<br />
Noch chronischer war der Verlauf bei der 20jährigen Wa. gewesen, die seit über<br />
4 Monaten an der immer wieder rückfälligen Erkrankung litt und jede Lebenslust eingebüßt<br />
hatte. 4 Wochen vor dem Beginn der Kurzwcllcnbehandlung hatte eine ausgiebige<br />
Inzision stattgefunden, ohne jeden Erfolg. Auch hier konnte die Erkrankung innerhalb<br />
von 10 Tagen bis auf den letzten Rest beseitigt werden.<br />
Die 23jährige Unb., die schon einmal in unserer Behandlung gewesen war, suchte uns<br />
später wieder auf, nachdem sich in der anderen Achselhöhle seit 2 Tagen eine neue Anschwellung<br />
zu bilden begonnen hatte. Es bestanden 2 brettharte bohnengroße Infiltrate.<br />
Nach 2 Kurzwellcnbehandlungcn an 2 aufeinanderfolgenden Tagen war nur noch eine<br />
erbsengroße völlig schmerzlose Verhärtung vorhanden, die am übernächsten Tag völlig<br />
verschwunden war.<br />
Auch bei den Hidroadcnitidcn sehen wir also in ganz frischen Fällen vollkommene<br />
Resorption, ein Ersticken des Krankheitsvorganges im Entstehen; bei den älteren<br />
Fällen dagegen eine Beschleunigung des Durchbruches und danach rasche Heilung.<br />
Erysipele werden durch mittelstarke Durchflutung in den meisten Fällen gut<br />
beeinflußt.<br />
Über gute Erfolge bei citrigen Wunden, Phlegmonen, Zellgewcbsentzündungcn,<br />
Panamien, Entzündungen der Lymphgefäße und Lymphknoten berichten ferner<br />
SHUCI und CHOREN, SCHLAEPFER, STOCK, SCHMITT. Unspezifische Lymphome hat<br />
FUCHS mit Erfolg behandelt.<br />
d) Panarilien und Paronychien<br />
Bei dieser Gruppe von Erkrankungen ist die Behandlung verhältnismäßig einfach,<br />
indem der Finger zwischen die beiden Kondensatorplatten eingeklemmt<br />
wird. Die Bchandlungsdauer beträgt jedesmal 3-j Minuten, zunächst täglich,<br />
später alle 2-3 Tage. Man muß sich vor Überdosierung hüten, denn die Feldlinien<br />
verdichten sich an einem so kleinen Körperteil sehr stark.<br />
Bei den von uns behandelten Fällen hat es sich um Erkrankungen jeden Schweregrades<br />
gehandelt. Allen Patienten, mit einer Ausnahme, konnten operative Eingriffe<br />
erspart werden (Tabelle S. 274).<br />
Der 48jährige Landwirt Z. kam mit einem ausgedehnten Prozeß, bei dem die linke<br />
große Zehe vollständig eitrig infiltriert war. Das Endglied wies eine dunkelbraune Verfärbung<br />
auf. Der Prozeß hatte sich seit etwa 3 Wochen ständig verschlimmert. Die Heilung<br />
nahm 10 Tage in Anspruch, während derer der Kranke seinem Beruf nachging.<br />
Hierher gehört auch die Erkrankung eines 40jährigen Wärters, der sich mit einem<br />
Sektionsmesser in das Mittelglied des linken Klcinflngcrs gestochen hatte, und bei dem<br />
daraufhin eine sehr rasch fortschreitende eitrige Tendovaginitis mit Lymphangitis und<br />
Achseldrüscnschwellung eingetreten war. Der kleine Finger und der entsprechende Abschnitt<br />
der Mittelhand waren citrig infiltriert. Nach einmaliger Kurzwcllcnbehandlung<br />
trat ein Stillstand des Prozesses ein, der nach weiteren 5 Behandlungen ausgeheilt war.<br />
Die 26jährige Krankenschwester L. P. war von einem diphtheriekranken Kind gekratzt<br />
worden. Darauf bildete sich ein Panaritium am linken Mittelfinger, das sehr hartnäckig<br />
war und trotz chirurgischer Behandlung immer wieder rezidivierte. Dazu kam<br />
ein Panaritium der 3. Zehe sowie mehrere Furunkel an verschiedenen Körpers teilen.<br />
Unter dem Auftreten von immer wieder neuen Furunkeln erstreckte sich dieser Zustand<br />
über mehr als 3 Monate. In 6 Sitzungen wurden jedesmal alle befallenen Teile nachein-<br />
162.
ander im Kondcnsatorfcld behandelt mit dem Erfolg, daß die Kranke nach 10 Tagen<br />
völlig beschwerdefrei und arbeitsfähig wurde.<br />
Bei mehreren Hunderten von uns behandelter Patienten ist nur in drei Fällen<br />
eine nachträgliche Inzision als vorteilhaft erschienen. Ke^idive können ebenso wie<br />
nach der chirurgischen Behandlung auftreten, besonders bei den Schweißdrüsenentzündungen;<br />
sie sind aber selten und werden durch wenige Durchflutungen beseitigt.<br />
Hervorzuheben ist noch, daß oft gerade solche Kranke in Behandlung<br />
kamen, denen Wochen- und monatelange chirurgische Behandlung mit mehreren<br />
Inzisionen keine Hilfe gebracht hatte. Die Heilungsdauer dieser Fälle ging kaum<br />
über den sonstigen Durchschnitt hinaus.<br />
e) Ulcus cruris varicosum<br />
Bei den bis jetzt behandelten Fällen dieser Art waren die Ergebnisse nicht einheitlich.<br />
Vereinzelt konnten Geschwüre, die schon seit 2 Jahren bestanden und jeder Behandlung<br />
getrotzt hatten, nach ungefähr 30 Sitzungen geheilt werden. In anderen Fällen dagegen<br />
war ein dauernder Heilungserfolg nicht zu erzielen. Wir hatten den Eindruck, daß nur<br />
bei Anwendung großer Energien, die auf der Haut eben noch erträglich waren, eine<br />
Besserung eintrat. Vorteilhaft ist die Verwendung großer Platten, so daß eine weitere<br />
Umgebung mit behandelt wird. Bessere Erfolge gibt DELHERM an ; die KW scheinen aber<br />
auf diesem Gebiet anderen Verfahren nicht überlegen zu sein.<br />
Zu erwähnen ist vielleicht in diesem Zusammenhang ein syphilitisches Geschwür von<br />
Zweimarkstückgröße am Unterschenkel bei einer 64jährigen Frau, das auf nur 2 Behandlungen<br />
hin verschwand, ein tuberkulöses Geschwür an der gleiche Stelle bei einem<br />
20jährigen Mädchen, das nach 4 Sitzungen mit 6-m-Welle ausheilte sowie ein analoger<br />
Fall mit gleichem Erfolg.<br />
Frische Phlebitis reagiert ausgezeichnet auf schwache Dosen.<br />
/) Mastitis<br />
Die Behandlung der Mastitis ist ein besonders dankbares Kapitel. Die Infiltrate<br />
werden, wenn sie frisch sind, schnell resorbiert; wenn sie teilweise cingegeschmolzch<br />
sind, wird der Zerfall beschleunigt, und es erfolgt schnell spontane<br />
Entleerung. So gut wie niemals ist es bei KWT nötig, den Säugling abzusetzen.<br />
Zwei Frauen erkrankten zu gleicher Zeit an Mastitis puerperalis mit gleichen Erscheinungen.<br />
Die eine wurde in einer Frauenklinik behandelt, machte 4 Inzisionen durch<br />
und wurde nach 5 Wochen in schlechtem Zustand entlassen. Das Kind mußte vollkommen<br />
künstlich ernährt werden.<br />
Die andere begab sich in Kurzwcllcnbehandlung. Der Prozeß war in 3 Tagen abgeheilt,<br />
das Kind konnte weiter gestillt werden, sogar an der erkrankten Brust.<br />
JELLINEK sah gleich gute Erfolge, ebenso GOETZ, der allerdings mehrmals mit<br />
Röntgenbestrahlung kombinierte. Über sehr gute Erfolge bei Mastitis berichten<br />
ferner RUNGE und ARDOGAST, sowie BRÜHL.<br />
GOETZ sah in vielen Fällen trotz der bestehenden Mastitis bei KWTh Anstieg<br />
der Milchkurve. Bei j6 von 76 behandelten Kranken blieb die Stillfähigkeit voll<br />
* Von den Autoren, die übereinstimmend gute Erfolge bei eitrigen Entzündungen angeben,<br />
seien unter anderem genannt: VAERNET, ROEVEKAMP, SAVONA und CUOLLA, SIEG<br />
BURG, FÖDERL, KÖVESLIGETHY, SAYASKI, RAUSCHER, LIÈVRE und AISENBERG, BERGLER,<br />
GUTSCH, SARENS, MICHELSON, V. HRABVOSKY, DIEKER, DIEFFENBACII, SHUCI und<br />
CHOREN, SCHLAEPFER, STOCK.<br />
163
erhalten, bei 31 stieg die Milchmenge sogar noch an. Nur in 4 Fällen erfolgte Abszedierung,<br />
bei den anderen wurden die Infiltrate resorbiert.<br />
Die Technik ist die gleiche wie bei der Behandlung von Furunkeln. Eine aktive Elektrode<br />
von 10 cm Durchmesser auf den Herd in 2 cm Abstand. Dosis II, 3-5 Minuten,<br />
allmählich steigern auf Dosis III bis 8-10 Minuten. Große inaktive Elektrode im Rücken<br />
mit 5-6 cm Abstand.<br />
2. Hautkrankheiten verschiedener Art<br />
Bei der Behandlung von Furunkulosen, die mit Ekzemen kombiniert waren, fiel<br />
uns zuerst auf, daß auch diese Ekzeme nach der Kurzwellenbehandlung oft schnell<br />
abheilten. Daher richteten wir unser Augenmerk auch auf das Verhalten von derartigen<br />
Hauterkrankungen im Kondensatorfeld.<br />
Um eine möglichst auf die Oberfläche beschränkte Wirkung zu erhalten, wurde die<br />
entsprechende Elektrode in große Nähe der Haut gebracht, die andere Elektrode weiter<br />
abgerückt. Die Dauer der einzelnen Sitzungen betrug meist 10-20 Minuten, nur bei sehr<br />
chronischen Erkrankungen bis zu 30 Minuten.<br />
Wir behandelten einige Arten von Ekzemen verschiedenster Ätiologie, die teilweise<br />
jahrelang bestanden und jeder lokalen und diätetischen Therapie getrotzt<br />
hatten. Die Erfolge sind durchweg als gut zu bezeichnen. Wiederholt verschwanden<br />
die Ekzeme schon nach kurzer Zeit, oft nach 2-3 Behandlungen, bei länger<br />
bestehenden tiefgreifenderen Prozessen wurden einige Wochen benötigt. Auch<br />
RECHOU berichtet über ausgezeichnete Erfolge bei generalisierten Ekzemen.<br />
Ebenso reagiert Neurodermitis in vielen Fällen gut.<br />
Bei Acne Juvenilis ist das schnelle Verschwinden vorher sehr lange bestehender<br />
Erkrankungen oft auffallend, jedoch liegen nur wenige Beobachtungen vor.<br />
Bei älterem Herpes poster hat SAIDMAN, ebenso wie ich, günstige Beeinflussung<br />
der schmerzhaften Begleiterscheinungen gesehen. Über frische Fälle liegen keine<br />
Erfahrungen vor.<br />
Bei anderen Hautkrankheiten Hegen noch keine allzu zahlreichen Ergebnisse<br />
vor.<br />
Sklerodermie wurde von RUHTE mit örtlicher UKW-Durchflutung und anschließender<br />
Massage behandelt. HALPHEN und AUCLAIR sahen Besserung mit<br />
KW-Hyperthcrmie.<br />
Erysipele werden durch mittelstarke Durchflutungen in den meisten Fallen<br />
günstig beeinflußt. Außer dem Verfasser hatten RUETE, FREUND und ISLER gute<br />
Erfolge.<br />
Köntgenscbäden der Haut behandelten MAHN und MARTIN, CRESPO. Sie geben<br />
gute Erfolge an, ebenso wie KOWARSCHIK.<br />
Über die guten Wirkungen bei Erfrierungen wird noch berichtet (S. 216).<br />
RUETE bestätigt diese Ergebnisse.<br />
Bei Erythema nodosum und Erythema induratum sah RUETE ebenfalls auffallende<br />
Schmerzstillung und rasche Heilung.<br />
Psoriasis soll in jo% günstig ansprechen, nach 4 Jahren wurden bei 33 % Rückfälle<br />
beobachtet (LITTERER und PHILIPS, PFLOMM, WILSON, ebenso HALPHEN und<br />
AUCLAIR mit Hyperthermie).<br />
Erythema multiforme heilten LITTERER und PHILIPS in 90% mit Hyperthermie.<br />
In j Monaten traten keine Rezidive auf, nach 2jahrenjedochin33%.Beiexanthem-<br />
164
artigen Hauterkrankungen hatten die Autoren in 96 von 167 Patienten sofortigen<br />
Erfolg. 69% davon blieben 4 Jahre rezidivfrei.<br />
SANTALOW rühmt die Erfolge bei pyogenen, durch Streptokokken verursachten,<br />
verhältnismäßig tiefgreifenden Pro2essen.<br />
Bei Impetigo habe ich keinen Erfolg gesehen.<br />
3. Zahnerkrankungen<br />
Bei Zahn- und Mundkrankheiten wird die Behandlung am besten so ausgeführt,<br />
daß auf beide Seiten des Gesichtes eine 10 cm im Durchmesser große Platte aufgesetzt<br />
wird, die Unter- und Oberkiefer soweit als nötig bedeckt. Die Ebene der<br />
Platte wird so gerichtet, daß<br />
sie ungefähr tangential zur<br />
Backe steht. Die Dauer der<br />
Behandlung schwankt je<br />
nach Art und Schwere der<br />
Erkrankungen zwischen 10<br />
und 30 Minuten.<br />
IL, ambulant. Zahnfistel mit<br />
anschließender Halsphlegmone.<br />
Am 3. 9. 32 operiert,<br />
ohne Erfolg. Seitdem dauernde<br />
Eiterung aus einer Fistel am<br />
I. Kieferwinkcl. Röntgcntiefentherapie,<br />
30% HED am<br />
24.9.32, 33 % HED am<br />
27.9.33. Keine Besserung.<br />
Unterhalb des linken Ohres Abb. 126: untere Schneidezähne (Monodc)<br />
und an der linken Halsseite<br />
handtellergroße brettharte,<br />
starke Schwellung, bei Kieferbewegung äußersr schmerzhaft. An der rechten Halsseitc<br />
eine stark eiternde Fistel dicht unterhalb des Kieferwinkels. UKW-Behandlung begonnen<br />
am 11.10. 33. 8 Amp. 10 Minuten zwei mal in der Woche.<br />
Seit der 2. Durchflutung fühlt der Kranke Besserung, die Schwellung ist weicher,<br />
Sekretion sehr gering. Geringe Druckschmcrzhaftigkeit besteht noch.<br />
Nach jeder Durchflutung etwas Schwindel, Kopfweh, Propulsion, 1.11. bcschwcrdcfrei.<br />
Noch etwas Schwellung, die aber weich und nicht mehr druckempfindlich ist. Entlassen<br />
mit der Weisung, sich bei etwaiger Verschlimmerung zu melden. Seitdem (bis<br />
10.3.33) nicht mehr gemeldet.<br />
Nach HEISE wurde Gingivitis und Stomatitis in 75 besonders langwierigen Fällen oft<br />
schon nach 6-8 Durchflutungen geheilt, Infiltrate und Beschwerden nach Extraktionen<br />
und Aufmcißclungen wurden in kurzer Zeit beseitigt. Osteomyelitis der Kiefer wurde besonders<br />
bei Kindern sehr gut beeinflußt, und zwar ohne daß jemals nachteilige Erscheinungen<br />
auftraten. Die Absonderung aus den Fisteln nahm fast immer zuerst zu, dann<br />
erfolgte Abstoßung von Sequestern und Schließung der Fisteln. Ebenso gut reagierten<br />
Periostitis perimandibularis und Mundbodeninfiltrate. Bemerkenswert ist, daß diese Ergebnisse<br />
schon mit einem Funkenstreckenapparat erzielt werden konnten. Bei Paradenrosen<br />
berichten jedoch alle Autoren, die mit Funkenapparaten behandelt haben, so gut<br />
wie keine Erfolge. Hieraus auf «den Wert der Kurzwellen thérapie» auf diesem Gebiet<br />
zu schließen, erscheint im Hinblick auf unsere Ergebnisse als ungerechtfertigt.<br />
i6j
Granulome können nicht beseitigt werden, da die Einwanderung neuer Keime<br />
nicht verhindert werden kann. Es ist daher zu fordern, daß zahnärtzliche Behandlung<br />
durchgeführt wird. Die UKW-Therapie ist nur als Unterstützung der zahnärztlichen<br />
Behandlung heranzuziehen (s. a. LIEBESNY).<br />
Andererseits müssen wir stets die Rolle der fokalen Infektion von den Zähnen<br />
aus im Auge behalten. Hier sind wir bis jetzt immer zur chirurgischen Behandlung<br />
gezwungen, wenn wir die Kranken vor den immer wiederkehrenden Einschwemmungen<br />
von Eitererregern von solchen Herden aus schützen wollen. Die Entfernung<br />
gleich mehrerer Zähne, wie sie dabei oft nötig wird, bildet aber für das<br />
Individuum einen schweren körperlichen Verlust durch die Schwächung seiner<br />
Verdauungswerkzeuge. Die erfolgreiche Bekämpfung citriger Zahnerkrankungen,<br />
unter Umständen kombiniert mit der üblichen konservativen zahnärztlichen Behandlung,<br />
stellt also eine sehr wichtige Zukunftsaufgabe der KW-Behandlung dar.<br />
Paradentosen werden, wenn sie nicht zu weit fortgeschritten sind, meist gut<br />
beeinflußt, offenbar infolge besserer Durchblutung. Das Zahnfleisch wird fester,<br />
die Blutungen gehen zurück, wackelnde Zähne werden befestigt.<br />
Mit Mikrowellen hat in erster Linie LAUTENBACH Erfahrungen gesammelt.<br />
Schmerzen und Lymphdrüsenschwellungen nach Zahnextraktionen wurden<br />
schnell beseitigt. Gut waren die Erfolge bei dentogenen Abszessen im subperiostalen<br />
und submukösen Stadium. Oft kam es zu Spontandurchbrüchen. Kiefergelenkentzündungen<br />
und Kieferklemme durch narbige Kontraktur wurden<br />
günstig beeinflußt.<br />
4. Verschiedene andere Entzündungen<br />
Die Behandlung der Aktinomykose scheint nach Angaben von LIEBESNY und<br />
GRYNBAUM einen gewissen Erfolg zu versprechen. 6 von 8 bzw. 4 von ; Kranken<br />
wurden geheilt. Einen geheilten Fall beschreibt IREDELL. DIEKER hatte in einem<br />
Fall keinen Erfolg.<br />
Sprityenabs^esse werden schnell schmerzfrei (MERDINGER). Bei indizierten<br />
Abszessen wird die Wundheilung stark beschleunigt.<br />
Heilung, Resorption von Hämatomen und Aufsaugung von Rei^ergüssen werden<br />
erheblich beschleunigt und damit die Wundheilung verbessert. LOB behandelte<br />
mit gutem Erfolg postoperative Pleuritiden, wobei auch die Bronchopneumonien<br />
zurückgingen. Nach Embolie wurden Husten und Auswurf nach KW-Durchflutungen<br />
geringer.<br />
Fisteln nach Appendix-, Gallenblasen- und Magenoperationen schließen sich<br />
schnell nach anfänglich vermehrter Sekretion (RINTELEN). Bei Fisteln unbekannter<br />
Herkunft kommt es zur Abstoßung von Fremdkörpern, wie Seidenfäden und<br />
Holzsplittern. Verwachsungsbescbwerden nach Brust- und Bauchoperationen werden<br />
subjektiv und objektiv gebessert. Auch nach Operation von Pankreatitis wurde<br />
sofortiger Temperaturabfall und Besserung des Pulses erzielt. Bei Perityphlitis<br />
sahen MICHELSON und GRYNBAUM auch in Fällen, die auf andere Therapie nicht<br />
angesprochen hatten, gute Erfolge.<br />
Über günstige Ergebnisse bei Analfisteln, Fissuren und Periproktitis berichtet<br />
BATJMGARTS ebenso wie KOWARSCHIK, SAIDMAN und CAHEN, DELHERM und FAIN-<br />
STLVER. Beschwerden durch entzündete Hämorrhoiden auch nach Operation werden<br />
schnell gebessert und beseitigt.<br />
166
Bei frischen Anginen kann cinc UKW-Durchflutung von j Minuten Dauer<br />
wesentliche Erleichterung bringen. Überragend sind die Erfolge bei retro- und<br />
paratonsillären Abszessen. Schon nach einer Durchflutung von j bis 10 Minuten<br />
Dauer pflegt der Erfolg einzutreten, und zwar in verschiedener Weise je nach dem<br />
Stadium. Steht die Erkrankung noch im Beginn, so geht sie meist zurück, und es<br />
kommt nicht zur Eröffnung des Abszesses. Bei weiter fortgeschrittener Erkrankung<br />
wird die Einschmelzung wesentlich beschleunigt, und gewöhnlich erfolgt<br />
der Durchbruch einige Stunden später. Nur selten sind zwei und mehr Durchflutungen<br />
nötig. Besonders angenehm wird von den Kranken das rasche Verschwinden<br />
von Schmerzen und Spannungsgefühl nach den Durchflutungen empfunden.<br />
Gegenüber der bisher üblichen Inzisionsbehandlung besteht der Vorteil, daß<br />
sich gewöhnlich der ganze Inhalt entleert, während die Inzision meist nur einen<br />
Teil der gekammerten Höhle eröffnet, so daß dann mehrere sehr schmerzhafte<br />
Inzisionen nötig sind. Außerdem entstehen keine Narben, die wieder die Disposition<br />
für neue Abszesse schaffen. In der Kinderklinik der Universität Frankfurt<br />
(Prof. DK RUDDER) hat SCHOTT alle Halsabszesse nur noch mit UKW behandelt<br />
mit dem Erfolg, daß in dieser Klinik seit über 10 Jahren bei keinem Abszeß mehr<br />
eine Inzision notwendig war. Dies deckt sich mit meinen Erfahrungen bei ungefähr<br />
40 Fällen. Es ist unverständlich, warum in Anbetracht so klarer Ergebnisse<br />
nicht bei Mandelabszesscn allgemein wenigstens ein Versuch mit UKW gemacht<br />
wird, che der äußerst schmerzhafte und unangenehme Eingriff unternommen<br />
wird.<br />
Diu Elektroden {8-ro cm Durchmesser) werden etwas schräg nach vorn konvergierend<br />
beiderseits am Kicfcrwinkcl in 3 cm Abstand aufgesetzt, Dosis III, 5 Minuten.<br />
5. Obere Luftwege, Ohr<br />
Furunkel der Nase sind durch UKW gut zu beeinflussen. Wie bei allen Furunkeln<br />
verschwinden Schmerz und Spannungsgefühl sofort. Meist genügt eine Durchflutung<br />
von 5 Minuten Dauer, um den Furunkel innerhalb von 1 bis 2 Tagen zum<br />
Verschwinden zu bringen. Dasselbe gilt für andere Furunkel im Gesicht, besonders<br />
an der Oberlippe. Sie müssen täglich durchflutet werden. Meist heilen sie in j bis<br />
6 Tagen, nur selten sind mehr Behandlungen nötig. Die Dosis ist so zu wählen, daß<br />
die Erwärmung eben fühlbar ist, nicht stärker. Nur wenn der Heilerfolg nicht eintritt,<br />
kann die Dosis erhöht werden.<br />
Bei Eiterungen der Nasennebenhöhlen ist die Wirkung der UKW wesentlich<br />
besser als die der üblichen Kopflichtbäder, was auf Grund der stärkeren Tiefenwirkung<br />
ohne weiteres verständlich ist. RAUSCHER hat in Selbstvcrsuchcn nachgewiesen,<br />
daß Licht- und Wärmeanwendungen keine merkliche Erhöhung der<br />
Temperatur im Inneren der Rachen- und Nasenhöhle hervorrufen, während bei<br />
UKW die Erwärmung in der Tiefe deutlich und kräftig ist.<br />
Die Ergebnisse bei Nebenhöhlenerkrankungen sind an der Innsbrucker HNO.-<br />
Künik von PRIETZEL untersucht worden. Von 120 Kranken mit Nebenhöhleneiterungen<br />
wurde die eine Hälfte mit UKW, die andere in der bisher üblichen<br />
Weise konservativ behandelt. Von den letzteren mußten 4 später operiert werden,<br />
von den 60, die mit UKW behandelt waren, keiner.<br />
167
Bei den chronischen Empyemen ist bei allen günstigen Erfolgen zu bedenken, daß die<br />
Schleimhäute oft weitgehend verändert sind. Es ist zweifelhaft, ob sie noch so weit regenerationsfähig<br />
sind, daß wieder eine vollkommen normale Funktion eintritt. Wenn wir in<br />
diesem Sinn vorsichtig mit der Annahme einer Heilung sein müssen, so ist doch schon<br />
viel damit gewonnen, daß die Kranken ihre Beschwerden so gut wie völlig verloren haben,<br />
ohne daß ein operativer Eingriff notwendig gewesen wäre. Besonders ist aber der Erfolg<br />
zu begrüßen in Fällen, wo nach der Radikaloperation der Kieferhöhlen die Sicbbcinzcllen<br />
Abb. 127: Stirnhöhle (Monode)<br />
vereitert sind und eine operative Inangriffnahme nicht mehr möglich ist. Es ist jetzt die<br />
Möglichkeit gegeben, auch solchen Kranken das Leben wieder erträglich zu machen und<br />
sie von ihren Beschwerden zu befreien. In Anbetracht der noch bestehenden Schleimhau<br />
tschädigung werden Rückfälle nicht immer vermeidbar sein, die durch irgendeinen<br />
Katarrh einen Schnupfen oder dergleichen herbeigeführt werden können. Bei den von<br />
uns behandelten Kranken konnte das bis jetzt dadurch vermieden werden, daß sie sich<br />
nach jeder derartigen Erkrankung wieder einer KW-Bchandlung unterzogen.<br />
Auch TEED und KRAUS hatten günstige Ergebnisse. Die Temperatur in den<br />
Kieferhöhlen stieg meist an, manchmal blieb sie gleich und sank sogar gelegentlich<br />
ab.<br />
Die Erfolge sind nach unseren Erfahrungen nicht ganz einheitlich, aber man<br />
sollte doch die KWT in jedem Fall versuchen, am besten in Kombination mit<br />
Sulfonamiden. Eine Pansinusitis, die wochenlang auf nichts reagiert hatte, wurde<br />
schließlich durch einen Eleudronstoß kombiniert mit UKW vollständig ausgeheilt.<br />
Die Dosis muß individuell angepaßt sein. Am besten beginnt man bei<br />
akuten Fällen mit 3 Minuten und Dosis IL Wenn die Behandlung gut vertragen<br />
wird, steigert man allmählich bis 5 Minuten bei Dosis III. Über 5 Minuten braucht<br />
man kaum jemals zu gehen.<br />
Zur Behandlung der Kieferhöhlen verwendet man Elektroden von 8 bis 10 cm<br />
Durchmesser. Die eine wird auf die erkrankte Seite mit 2 bis 3 cm Luftabstand<br />
aufgesetzt, die andere auf die andere Seite mit 4 bis j cm Abstand. Die Wirkung<br />
¡st nämlich immer unter der nähcrlicgendcn Platte stärker.<br />
Zur Behandlung der Stirnhöhlen wird die eine Elektrode (8-10 cm Durchmesser)<br />
auf die Stirnhöhlengegend mit 2 cm Abstand aufgesetzt. Am Hinterkopf<br />
nimmt man eine größere Elektrode (1 j-20 cm Durchmesser) in 6-7 cm Abstand.<br />
168
Oder man verwendet die Monode (Abb. 127). Man behandelt bei eitrigen Entzündungen<br />
zunächst jeden Tag, bei sehr akuten Prozessen auch zweimal am Tag.<br />
Erst wenn die Erkrankung zurückgeht, kann man Pausen einlegen.<br />
Bei Gehörgangsfurunkelsetzt man eine Elektrode (Abst. 2 cm, 5 cm Durchmesser)<br />
vor das befallene Ohr, wobei die Ohrmuschel angedrückt wird, eine andere<br />
größere Elektrode in etwa 4 cm Abstand auf die andere Kopfseite. Die Gehörgangsfurunkel<br />
pflegen in 2 bis 3 Tagen abzuheilen.<br />
Abb. 128: Behandlung der oberen Luftwege<br />
Bei akuter Otitis media sind bis jetzt keine nennenswerten Erfolge mit UKW<br />
beobachtet worden. Dagegen sind die Wirkungen bei chronischer Otitis media ausgesprochen<br />
gut. Besonders kommen solche Fälle in Betracht, bei denen es nach<br />
Perforationen nicht zur Heilung gekommen ist, oder Resthöhlen nach Radikaloperationen.<br />
Es gibt chronische Otitiden, welche schlagartig auf Kurzwellendurchflutung<br />
trocken werden, während andere nicht reagieren. Dies liegt sicher an den Erregerstämmen.<br />
Diese Tatsache wäre noch genauer durch bakteriologische Untersuchung<br />
zu klären.<br />
Bei Mastoiditis bringt die KWTh keine Vorteile, dagegen kann die Kurzwcllenprovokation<br />
in unklaren Fällen diagnostisch weiterhelfen. Durchflutet man näm-<br />
169
lieh ein gesundes Gebiet mit UKW, dann sinken gewöhnlich die Leukozyten im<br />
Blut hinterher ab. Bei fortlaufenden Blutentnahmen tn Abständen von 5, 15, 30,<br />
60 Minuten erhält man dann eine charakteristische Kurve der Leukozyten mit<br />
stärkstem Abfall meist nach einer halben Stunde und Wiederanstieg nach i 1 ^ bis<br />
2 Stunden. Befindet sich aber im durchfluteten Gebiet ein Eiterherd, dann steigen<br />
die Leukozytcnzahlen an. Da bei tuberkulösen Prozessen meist ein starker Abfall<br />
eintritt, können wir die Kurzwellcnprovokation zur differentialdiagnostischen<br />
Unterscheidung von Eiterungen tuberkulöser und nichttuberkulöser Natur verwenden.<br />
Das Verfahren muß noch weiter ausgearbeitet werden, da sich Herde<br />
am Kopf häufig anders verhalten als Lungen- und Baucherkrankungen.<br />
Abb. 129: Behandlung der seitlichen Halspartien (Drüscnschwellung)<br />
Anginen im akuten Stadium sprechen auf Kurzwellen kaum an, denn es handelt<br />
sich wahrscheinlich um eine Virusinfektion, auf die sich die Eiterung erst später<br />
aufpfropft. Deshalb ist bei subakuten Mandelentzündungen die KWT gut<br />
wirksam, und eine Angina, die nicht abheilen will, kann oft durch wenige UKW-<br />
Durchflutungcn entscheidend gebessert und geheilt werden. Besonders gut sprechen<br />
para- und retrotonsilläre Abszesse an. Die <strong>Kurzwellentherapie</strong> ist ferner angebracht<br />
bei verschiedenen eitrigen Prozessen der Mundhöhle, der Speicheldrüsen,<br />
besonders auch Mundbodenphlegmonen.<br />
Laryngitis spricht verschieden an. Man setzt eine 5-cm-Elektrode vorn auf den<br />
Kehlkopf, ein io-cm-Elektrode in 4 cm Entfernung auf den Nacken (Abb. 128).<br />
Dauer 5-10 Min. bei allmählich zu steigernder Dosis. Es gibt Laryngitiden, die<br />
auch auf die KWT in keiner Weise ansprechen wollen, sie sind aber selten, und<br />
man sollte deshalb die KW in allen Fällen versuchen. Die tuberkulöse Laryngitis<br />
wird in Fällen mit stationären Lungenprozessen gut beeinflußt, wie Untersuchungen<br />
von AROLD ergeben haben. Man muß dazu mit ganz schwachen Dosen behandeln,<br />
da stärkere Dosen Reaktionen hervorrufen. Wir haben zuletzt mit Dosis I,<br />
bei der noch keine Wärme empfunden wird, und 1 Minute Dauer jeden 2. Tag behandelt.<br />
170
Gut bewährt hat sich die <strong>Kurzwellentherapie</strong> zur Nachbehandlung nach Operationen.<br />
Insbesondere wird die Demarkation und Abstoßung etwa noch vorhandener<br />
Nekrosen und Eiterungen beschleunigt. Infolge der entstehenden aktiven Hyperämie<br />
der Kapillaren wird die Durchblutung verbessert, die Heilkräfte werden dadurch<br />
angereregt.<br />
Gut sind die Erfolge bei entzündlichen Drüsenschwellungen der verschiedensten<br />
Art. Tuberkulöse Lymphome am Hals werden mindestens ebenso gut beeinflußt<br />
wie durch Röntgenbestrahlung, ohne daß irgendwelche Nebenerscheinungen<br />
befürchtet werden müssen. Wenn noch keine Einschmclzungen vorhanden sind,<br />
bilden sie sich allmählich im Verlauf von mehreren Wochen zurück. Man durchflutet<br />
dabei mit Dosis I und II beginnend mit 2 Minuten und steigt allmählich auf<br />
j Minuten, nur in besonders hartnäckigen Fällen auf 10 Minuten. Unspezifischc<br />
Lymphdrüsenentzündungen reagieren ebenfalls gut, nur muß man etwas höhere<br />
Dosen anwenden (Abb. 129).<br />
6. Atmungsorgane /<br />
Bei akuter und chronischer Bronchitis ist die Wirkung der UKW, wie zu erwarten,<br />
ausgesprochen günstig. Bei fötider Bronchitis wurde wiederholt Besserung<br />
des üblen Geruches und Abnahme des Auswurfes erreicht, aber keine eindeutige<br />
Heilung. Hier hat sich Kombination mit Inhalieren von Antibiotica als gut wirksam<br />
erwiesen.<br />
Astbma bronchiale reagiert wie auf andere Heilmittel so auch auf UKW ganz verschieden.<br />
Manchmal erzielt man schon nach wenigen Durchflutungen mit mäßiger<br />
Dosis überraschende Besserungen, manchmal versagt die Behandlung. In anderen<br />
Fällen wirkt Hyperthermie außerordentlich günstig, jedoch werden spätere Rückfälle<br />
nicht immer vermieden. Allerdings sind immer nur alte und hartnäckige<br />
Asthmafällc in unsere Behandlung gekommen.<br />
Spezifische und unspezifische Pleuritiden lassen sich oft durch wenige UKW-<br />
Durchflutungen beseitigen, auch alte Pleuraschwarten werden bei Anwendung<br />
starker Dosen und langer Durchflutungszeiten erweicht, so daß die Atmungsfunktion<br />
wesentlich gebessert werden kann, besonders wenn gleichzeitig Atemübungen<br />
gemacht werden.<br />
Bei Pleuritis exsudativa (auch tuberkulöser Genese) wird die Aufsaugung der<br />
Ergüsse zweifellos beschleunigt. Am besten durchflutet man zuerst mit schwachen,<br />
dann mit mittleren Dosen entsprechend der verschiedenen Aetiologie und beginnt<br />
möglichst unmittelbar nach einer Punktion. Besonders interessant ist die Tatsache,<br />
daß allein unter UKW Empyeme der Pleura völlig resorbiert werden können.<br />
Gg.Sch. erkrankte im März 1944 an schwerer doppelseitiger Pneumonie, nach der sich<br />
ein beiderseitiges Pleuraexsudat entwickelte. Bei der nach einiger Zeit vorgenommenen<br />
Probepunktion kam rechts dicker Eiter. Temperaturen bis 40°.<br />
Die Röntgenuntersuchung zeigte ein großes gekammertes Empyem rechts vorn unten<br />
und einen zweiten Empyemhcrd im rechten Oberfcld, dazu einen faustgroßen Abszeß im<br />
Mittelfeld. Einen operativen Eingriff lehnte der zugezogene Chirurg ab, da der Kranke<br />
zu dekrepid sei, um den Eingriff überstehen zu können. Die ganze Mundhöhle war von<br />
einem dicken Soor-Rascn überzogen.<br />
Daraufhin wurde mit UKW behandelt, und zwar beginnend mit 3 Minuten täglich mit<br />
allmählicher Steigerung bis 10 Minuten. Schon nach einer Woche ging die Temperatur<br />
zurück, das Allgemeinbefinden besserte sich zusehends. In der 2. Woche hellten sich die<br />
171
Dämpfungen auf, das Röntgenbild änderte sich vorerst nicht. In der 3. Woche hatte der<br />
Kranke schon besseren Appetit und begann an Gewicht zuzunehmen. Der Auswurf ging<br />
von anfänglich 300 ccm täglich allmählich zurück und betrug in der 4. Woche nur noch<br />
5QCcm; er vcflor schon in der ;. Woche den putriden Geruch. Die Besserung machte<br />
dann weitere Fortschritte; nach 6 Wochen war die Verschattung durch das Empyem<br />
wesentlich zurückgegangen, es bestand noch eine kleine Abszeßhöhle mit Spiegel. Diese<br />
verschwand im Lauf der weiteren Wochen auch noch, so daß der Kranke nach to Wochen<br />
geheilt entlassen werden konnte. Er stellte sich alle 2 Monate vor und blieb völlig be-<br />
Abb. 130: Behandlung der rechten Lunge<br />
schwerdefrei. In den nach 1 und nach 4 Jahren aufgenommenen Röntgenbildern waren<br />
keinerlei krankhafte Veränderungen nachzuweisen. Der Patient erfreut sich seit 15 Jahren<br />
bester Gesundheit.<br />
Bei allen anderen postpneumonischen Empyemen der Pleura erreichten wir in<br />
4-8 Wochen völlige Resorption des Eiters. Besondere Hervorhebung verdient die<br />
Tatsache, daß entweder keine nachweisbaren Verwachsungen zurückbleiben oder<br />
daß sie außergewöhnlich gering sind. Man sollte deshalb in allen Fällen von postpneumonischem<br />
Empyem zunächst die UKW-Behandlung anwenden, ehe man<br />
zu irgendwelchen Eingriffen oder Heberdrainagen greift. Meist werden selbst<br />
Punktionen durch die UKW-Behandlung überflüssig.<br />
Hierzu ist noch zu bemerken, daß die bisher übliche Behandlung der Pleuraempyeme<br />
keineswegs befriedigend ist. SCHILDT hat aus der Chirurgischen Klinik in Upsala über<br />
289 Fälle berichtet, die mit subperiostaler Rippenresektion mit interkostaler Inzision und<br />
offener Drainage behandelt worden waren. Hierbei kam es siebenmal zu ernsten Zwischenfällen<br />
im Anschluß an die Operation, mit 4. Todesfällen. Nur 178 Kranke, also nur 61,5 %,<br />
waren endgültig geheilt, bei 12 % kam es zu Rückfällen, 15 wurden chronisch. Von diesen<br />
konnten nur 6 später noch geheilt werden. Bei 6% traten Thoraxdeformitäten ein, bei<br />
4% ausgedehnte Bronchiektasen.<br />
Ähnliche Zahlen werden von anderer Seite angegeben: die Mortalität dürfte etwas<br />
unter 20% liegen.<br />
172
Noch eindrucksvoller sind die Erfolge beim Lungenabs^eß. Wenn auch die Prognose<br />
dieser Erkrankung heute vielleicht nicht mehr so infaust ist wie früher, so<br />
ist sie doch immer noch sehr ernst, die Mortalität immer noch hoch.<br />
Unsere Erfolge werden von zahlreichen Autoren bestätigt, so von LIEBESNY,<br />
FIANDACA, STRAUCH, DIEFFENBACH, SCHINDLING, HAMANN, DIEKER u.a.m.<br />
Wenn demgegenüber ein einzelner keine Erfolge hatte, dann kann das nur auf ungenügender<br />
Vertrautheit mit der KW-Technik beruhen. Wenn ferner behauptet<br />
wird, daß die Lungenabszesse fast alle spontan heilen, dann ist dem entgegenzuhalten,<br />
daß ja dann eine chirurgische Therapie von vornherein unnötig wäre.<br />
Abb. 131: G.W. Pleuraempyem post- Abb.132: G.W. nach 2wöchiger Bepneumonisch<br />
handlung mit UKW<br />
Zu den angeführten Fällen ist noch besonders zu bemerken, daß sie in keiner<br />
Weise ausgewählt worden waren, sondern es wurde jeder Lungenabszeß behandelt,<br />
einerlei in welchem Zustand er kam. Zur chirurgischen Behandlung ist dagegen<br />
nur eine beschränkte Zahl von Fällen überhaupt geeignet, im wesentlichen die<br />
pleuranahen Untcrlappenabszesse, während ja bekanntlich die Prognose des Eingriffes<br />
bei den Oberlappenabszcssen viel schlechter ist ; bei den multiplen Abszessen<br />
versagt die chirurgische Behandlung überhaupt. Von fast allen chrirurgischen<br />
Autoren wird die Forderung gestellt, daß man die Abszesse nicht im hochakuten<br />
Stadium operieren, sondern einige Wochen warten soll. Da man mit UKW ohne<br />
weiteres schon im akuten Stadium anfangen kann, ist nicht einzusehen, warum man<br />
nicht in dieser Wartezeit auf jeden Fall die KW-Therapie einleiten soll. Man sieht<br />
dann so gut wie immer, daß die Operation überflüssig wird.<br />
Die Ergebnisse der Behandlung mit antibiotischen Mitteln sind nach Angaben<br />
der Weltliteratur auch nicht ermutigend. In Frage kommt die tägliche intrapleurale<br />
und intrapulmonale Applikation; sie ist keine Annehmlichkeit für die<br />
Patienten und hinterläßt starke Verwachsungen. Demgegenüber ist die KWT viel<br />
schonender und läßt keine Verwachsungen zurück. Sehr wirkungsvoll ist die<br />
Kombination der KWT mit der üblichen antibiotischen Allgcrncinbehandlung.<br />
Zum mindesten werden die Vorbedingungen für eine etwaige Operation wesentlich<br />
gebessert.<br />
173
Mit UKW wurden von uns gerade die eben genannten prognostisch besonders<br />
infausten Abszesse behandelt. Mehrere in meiner Klinik behandelte Fälle machten<br />
unter Sulfonamiden, Penicillin und Streptomycin in 3-j Wochen keine Fortschritte.<br />
Auf K WTh entfieberten sie in j Tagen und wurden in weiteren 4 Wochen<br />
geheilt.<br />
Die Heilerfolge sind wesentlich davon abhängig, ob es sich um akute oder chronische<br />
Abszesse handelt. Während die akuten Abszesse sehr günstige Vorbedingungen<br />
für die Heilung bieten, sind die Verhältnisse beim chronischen Abszeß<br />
nicht so günstig. Die Höhlen haben meistens starre Wände, sie kollabieren nicht<br />
Abb. 133 Abb. 134<br />
mehr; im weiteren Umkreis ist das Lungengewebc hart infiltriert. Trotzdem<br />
konnten bei einem großen Teil der chronischen Abszesse noch gute Erfolge erzielt<br />
werden, so bei einem Kranken, der schon über 2 Jahre lang mit allen möglichen<br />
Mitteln behandelt worden war. Die KW-Therapie beanspruchte hier allerdings<br />
7 Monate. Dieser Kranke war noch nach 12 Jahren völlig rezidivfrei<br />
(Abb. 133, 134).<br />
Wie erwähnt, kann man sowohl Empyeme als auch Abszesse im ganz frischen<br />
Stadium sofort mit UKW behandeln, ja man soll es sogar tun. Für den Erfolg ist<br />
einwandfreie Technik Voraussetzung.<br />
Man beginnt, wie bei allen akuten Erkrankungen, mit verhältnismäßig schwacher<br />
Dosis; da der Prozeß tief liegt, mit Dosis II und Behandlungszcit von 5 bis 7 Minuten,<br />
Elektrodenabstand 6-10 cm. Verträgt der Kranke die erste Behandlung gut, dann wird<br />
die Zeit täglich verlängert bis 15 Minuten und die Dosis allmählich verstärkt. Gewöhnlich<br />
geht das Fieber nach 5-7 Tagen zurück.<br />
Wichtig ist die dauernde Beobachtung des Allgemeinbefindens, das sich meist<br />
schon nach den ersten Behandlungen bessert; auch der Appetit nimmt zu. Klagt<br />
der Kranke über zunehmende Beschwerden oder treten starke Reaktionen auf<br />
(geringe Zunahme der Temperatur hat keine Bedeutung), dann kann man einen<br />
Tag aussetzen und danach mit kürzeren Zeiten Wiederbeginnen. Manchmal kommt<br />
174
es vor, daß nach 3 Wochen noch keine sichere Besserung zu verzeichnen ist. Dann<br />
muß man die Behandlungsdauer bis zu 1 Stunde erhöhen,<br />
Beim chronischen Abszeß fängt man zweckmäßig auch mit vorsichtiger Dosierung an,<br />
also Dosis II mit 7-10 Minuten, geht aber dann bald zu stärkeren Dosen und Zeiten bis<br />
zu 30 Minuten über, zuerst täglich, später 2-3mal in der Woche.<br />
Der gangränöse Abstieß reagiert meist ebenso gut wie der gewöhnliche, nur dauert<br />
die Behandlung länger. Zur Unterstützung lassen wir oft noch Sublimat oder zerstäubte<br />
Antibiotica inhalieren. Besteht bei Gangrän ein Pleuraempyem, dann ist<br />
chirurgischer Eingriff unvermeidlich. Die KWT wirkt zwar auch hier günstig, die<br />
Gefahr der Metastasierung wird aber nicht beseitigt, so daß möglichst rasche Entleerung<br />
des Eiters angezeigt ist.<br />
Bei allen Empyemen und Abszessen fällt die Tatsache auf, daß sich der Königenbefund<br />
zunächst nicht oder kaum zurückbildet. Dagegen hellt sich die perkutorische<br />
Dämpfung bald auf. Die Änderung des Röntgenbefundes kommt meist erst später.<br />
Beim Abszeß bildet sich zuerst das die Höhle umgebende Infiltrat zurück, die<br />
Höhle selbst verschwindet zuletzt.<br />
SARENS sah 9 von 10 akuten Lungenabszessen nach UKW-Behandlung abheilen. Bei<br />
chronischen Abszessen hatte er keinen Erfolg; allerdings hat er 2 chronische Abszesse<br />
nur 6- bzw. (jmal durchflutet. DIEFFENBACH sah einen seit 2 Jahren bestehenden chronischen<br />
Abszeß in 5 Wochen abheilen, bei V.HRABOWSKY heilten 11 von 13 Abszessen<br />
unter UKW ab. Von 2 Fällen von Lungengangrän heilte einer, ferner kam eine chronische<br />
Empycmhöhlc zur Abheilung, die schon j Jahre bestanden hatte. BRUGSCH und<br />
PRATT hatten dagegen bei Lungenabszessen keinen Erfolg.<br />
In dieses Gebiet fallen auch die vereiterten Scbußverletzuagen der Lungen; sie<br />
können schon im h och fieberhaften Stadium behandelt werden. Wir hatten wiederholt<br />
Fälle in Behandlung, bei denen bei jedem Versuch, die Drainage zu entfernen,<br />
sofort das Fieber hoch anstieg und schwere Allgemeincrscheinungcn auftraten.<br />
Wurden diese Kranken 4-5 mal mit UKW behandelt, so konnte das Drain entfernt<br />
werden, ohne daß Retentionserscheinungen auftraten. Der Pyopneumothorax<br />
resorbierte sich in auffallend kurzer Zeit, die Verwundung heilte. Meist<br />
blieben nur ganz geringe Verwachsungen zurück, die wenig Beschwerden machten.<br />
Bei chronischen Verwachsungen der Pleuren oder des Peritoneums wird durch<br />
KW-Thcrapic erhebliche Besserung erreicht. Hierbei werden starke Dosen angewandt,<br />
bei Behandlungszeiten bis 20 Minuten.<br />
Ein besonders günstiges Gebiet für die KW-Therapie bilden interlobäre Exsudate<br />
und Empyeme, die ohne Punktion in kurzer Zeit zum Verschwinden gebracht<br />
werden.<br />
Bei Mediastinitis ist die KW-Therapie angebracht.<br />
Hervorragend sind die Erfolge bei Kestinfiltraten von nicht gelösten Pneumonien,<br />
die selbst nach monatelangem Bestehen durch wenige Durchflutungen<br />
geheilt werden. Dies ist auch differentialdiagnostisch ex iuvantibus gegenüber<br />
tuberkulösen Infiltraten zu verwerten.<br />
ZANINI bestätigt dies bei 16 Kindern; die Besserung trat meist schon nach<br />
3 Durchflutungen subjektiv ein, die Verschattung im Röntgenbild hellte sich nach<br />
4-6 Behandlungen auf.<br />
Hier kann die KW-Therapie als Behandlung der Wahl bezeichnet werden.<br />
Keuchhusten bei kleinen Kindern behandelten KRASEMANN und WIRTH sowie<br />
v. ROQUES. Im allgemeinen genügten 10-16 Durchflutungen für die Heilung.<br />
175
NiTSCHKE berichtet über die interstitielleplasmozelluläre Pneumonie bei Säuglingen,<br />
die gewöhnlich jeder Therapie trotzt. Er hatte mit KW-Therapie dabei hervorragende<br />
Erfolge. Gewöhnliche Bronchopneumonien bei Kindern sprechen gut an.<br />
Bei Bronchektasen hatten wir verschiedene recht gute Ergebnisse in solchen<br />
Fällen, wo die Erkrankung noch nicht allzu weit vorgeschritten war. ROBERT gibt<br />
bei Bronchektasen im Kindesalter «frappante» Erfolge an.<br />
Abb. 155 : Chronisch gewordenes abgesacktes tuberkulöses Pleuraexsudat<br />
bei einem 30jährigen. Pneumothorax artef. vor 2 Jahren eingegangen.<br />
Große Punktionen wirkungslos, da sofortige Ergänzung.<br />
Nach 3monatiger KWT völlige Beseitigung des Exsudates<br />
Der 16jährige Lehrling Me. litt seit 1 /i Jahr an ausgedehnten Bronchektasen im rechten<br />
Untcrlappen, die schon mit den verschiedensten Maßnahmen behandelt worden waren.<br />
Schließlich war ein Pneumothorax angelegt worden ; da das Allgemeinbefinden des Kranken<br />
sich immer weiter verschlechterte, sich auch keine genügende Retraktion der Lunge<br />
erreichen ließ, hatte man den Pneumothorax wieder eingehen lassen.<br />
176
Der Kranke kam am 1.8.30 und wurde zuerst mit Wellenlängen von 7 m, dann mit<br />
16 m ¡m ganzen zjmal behandelt, zunächst täglich, später zweimal wöchentlich und dann<br />
einmal wöchentlich. Während der Kranke vorher meist bettlägerig gewesen war, hatte<br />
sich der Zustand nach 4 Wochen so weit gebessert, daß er aus der Klinik entlassen werden<br />
konnte. Mitte Dezember war er vollkommen bcschwcrdcfrci und nahm danach Dienst in<br />
einer Gärtnerei, wo er seine Arbeit voll leistet.<br />
Bei einem 14jährigen Mädchen konnte gute Besserung erzielt werden, während bei<br />
2 Kindern von 7 und 9 Jahren die Erfolge nur mäßig waren. Hier war die Erkrankung<br />
allerdings auch sehr vorgeschritten und rein konstitutionell bedingt.<br />
Abb. 136<br />
Pleuraempyem bei einem 2 jährigen Kind<br />
Zufälligerweise hatten wir Gelegenheit, dreimal Lungeninfiltrate nach Maltafieber<br />
zu behandeln.<br />
Der 34jährige H.l. war im November 1929.mil Maltafiebcr infiziert worden und<br />
glaubte schon die Erkrankung überstanden zu haben, als im November 1930 starke<br />
Schmerzen in der Brustseite beim Atmen, Nachtschweiße, Husten und Auswurf auftraten.<br />
Bei der Aufnahme am 8.12. 30 bestand Fieber über 38 o , Bluthusten. Über der rechten<br />
Rückenseite bis zur Schulterblattgräte war der Klopfschall massiv gedämpft, das Atcmgeräusch<br />
aufgehoben; desgleichen vorn von der 2.Rippe abwärts. Durch Probepunktion<br />
wurde nur 1 cem dickfibrinöses Exsudat gewonnen. Melitensis-Agglutination - : 3200 + .<br />
Auf Bettruhe und Atophanylcinspritzungen gingen die Temperaturen herunter, bleiben<br />
aber immer etwas gesteigert. Die Beschwerden besserten sich nicht; vielmehr verschlechterte<br />
sich der Lungenbefund unaufhaltsam. Die Senkungsgeschwindigkeiten der roten<br />
Blutkörperchen betrugen am 30.12.30: 45/1 Std., 55/2 Std., 124/24 Std.<br />
177
An diesem Tage wurde mit der K W-Behandlung begonnen. Die Beschwerden besserten<br />
sich danach sehr rasch. Nach 6 Durchflutungen war am 7. i. j i der Kräftczustand außerordentlich<br />
gehoben, der vorher dekrepide Kranke hatte wieder Lebensmut und hatte an<br />
Gewicht um 1 kg zugenommen. Auch der physikalische Befund, der sich vorher dauernd<br />
verschlechtert hatte, war gebessert. Die Dämpfung war durchschlagbar geworden und<br />
erreichte nur noch den Schultcrblattwinkcl bzw. 4.Rippe. Senkung: 25 : 55 : 115. Bang-<br />
Agglutination 1 : 800. Der Kranke wurde danach zu einem Kuraufenthalt entlassen.<br />
Fast ebenso verlief die Erkrankung bei dem 40jährigen Sk. Auch hier bestanden<br />
schwere Infiltrate der rechten Lunge, die sich jeder Allgemeinbehandlung gegenüber als<br />
Abb. 137<br />
Pleuraempyem s. Abb. 136 nach 3 Wochen KW<br />
hartnäckig erwiesen und dauernd fortschritten. Der Kranke, der zunächst von den<br />
K W-Behandlungcn nichts wissen wollte, kam später sehr gern und hatte bald den Eindruck<br />
bedeutender subjektiver Erleichterung. Dem entsprach auch die Besserung des Allgcmcinbefundes<br />
und des physikalischen Lungenbefundes. Im Röntgenbild war diese Besserung<br />
nur teilweise erkennbar, da noch starke Verschattungen durch Schwarten bestanden. Auch<br />
dieser Kranke konnte nach 25 Tagen weitgehend gebessert zu einem Kuraufenthalt entlasssen<br />
werden, in dessen Verlauf wieder volle Arbeitsfähigkeit eintrat. Zu erwähnen ist,<br />
daß auch eine arthritische Erkrankung in beiden Fußgelenken mit leichter teigiger<br />
Schwellung bestand, die durch KW-Behandlung schon innerhalb weniger Tage behoben<br />
wurde. Der sehr kritische Kranke hebt gerade diese Wirkung immer wieder hervor. Bei<br />
einer 3. Kranken wurden ebenfalls Lungeninfiltrat und Pleuraerguß in kurzer Zeit beseitigt.<br />
Die 14jährige B. Seh. litt an einem chronischen Empyem, das nach Grippe entstanden<br />
war. Bei der Probepunktion hatte sich dicker pneumokokkcnhaltigcr Eiter gefunden.<br />
178
Unter konservativer Behandlung hatte sich die Erkrankung vor allen Dingen auf den<br />
Intcrlobärraum zwischen dem rechten Mittel- und Unterlappen lokalisiert. Die Patientin<br />
hatte dauernd hohe Temperaturen, das<br />
Allgemeinbefinden hatte sich laufend<br />
weiter verschlechtert, die Prognose<br />
erschien als durchaus infaust. Eine<br />
Rippenresektion war bei dem schlechten<br />
Allgemeinzustand des Kindes aussichtslos,<br />
zumal es sich offenbar um<br />
ein gekammertes Empyem handelte*.<br />
Die KW-Behandlung wurde als ein<br />
letzter Versuch herangezogen. Schon<br />
nach 4 Behandlungen, wobei täglich<br />
20 Minuten lang mit einer 6-m- Welle<br />
durchflutet worden war, gingen die<br />
Temperaturen zur Norm zurück. Das<br />
Allgemeinbefinden besserte sich fast<br />
augenblicklich, die Kranke nahm wieder<br />
Anteil an ihrer Umgebung und<br />
begann langsam an Gewicht zuzunehmen.<br />
Schon nach 14 Tagen war die<br />
Patientin, die vorher einen moribunden<br />
Eindruck gemacht hatte, so weit,<br />
daß sie zur Behandlung zu Fuß kommen<br />
konnte. Sie ist jetzt vollkommen<br />
gesund und kann alle Spiele ihrer<br />
Altersgenossen mitmachen. Das<br />
Röntgenbild vor und nach der Behandlung<br />
zeigt.<br />
Die 42 jährige Ehefrau Mü. war<br />
Mitte März 1931 an rechtsseitiger<br />
kruppöser Pneumonie erkrankt, woraus<br />
sich nach 3 Wochen ein bis zur<br />
Schulterblattgräte reichendes Empyem<br />
entwickelte. Bei der Probepunktion<br />
wurde schon beim oberflächlichen<br />
Eindringen in den Pleuraraum<br />
dickflüssiger Eiter angesaugt,<br />
der Pneumokokken enthielt. Am<br />
23.4., dem 3. Tag nach der Aufnahme,<br />
wurde mit der KW-Behandlung begonnen.<br />
Während sich das Allgemeinbefinden<br />
sehr schnell besserte, war klinisch<br />
zunächst keine Veränderung zu bemerken.<br />
Eigenartig war nur das Verhalten<br />
der Senkungsgeschwindigkeit,<br />
die am 27. 4. von 84 auf 20 in der<br />
1 Stunde zurückgegangen war. Am<br />
28.4. sank die Körperwärme zur<br />
Norm ab, um von da ab nie wieder<br />
Abb. 138: Interlobärcs gangränöses Empyem<br />
bei einem 3 ijührigen Mann (Zei.). Im Auswurf<br />
Staphylococcus albus und Streptococcus viridans.<br />
Nach 6 Tagen UKW-Behandlung ohne<br />
Auswurf, nach 12 Tagen fieberfrei. (Aus Klinische<br />
Fortbildung I, 1933)<br />
Abb. 139: Zei. nach 6 Wochen UKW-Behandlung.<br />
(Aus Klinische Fortbildung I, 1933)<br />
* Für die Überweisung der Kranken sowie für Überlassung der Krankenblätter und<br />
Röntgenbilder aus der Kinderklinik Jena danke ich den Herren Prof. IBRAHIM und<br />
DUKEN bestens.<br />
179
über die Normalwertc anzusteigen. Das Allgemeinbefinden und der Kräftezustand<br />
besserten sich so, daß die Kranke schon allein für kurze Zeit ihr Bett verließ.<br />
Im Blutbild ist auffallend die starke Lymphozytose und Monozytose im Anschluß an<br />
die KW-Behandlung, die vielleicht als monozytäre Heilphase im Sinne SCHILLINGS<br />
aufzufassen ist. Der Auswurf hatte schon bald nach Beginn der Behandlung nachgelassen<br />
und war fast rein schleimig.<br />
Am ii.5., also 18 Tage nach Beginn der KW-Behandlung, war vorn auf der Brust<br />
überhaupt keine Dämpfung mehr nachweisbar, hinten erstreckte sie sich noch bis handbreit<br />
oberhalb der unteren Lungengrenze. Bei der Probepunktion, die an 3 verschiedenen<br />
Stellen innerhalb des gedämpften Bereiches vorgenommen wurde, ließ sich kein Eiter<br />
Abb. 140: Abszedierende Pneumonie. Paul L. 10. VIL 31<br />
mehr nachweisen, auffallend war aber, daß jedesmal schon in sehr geringer Tiefe reichlich<br />
Lungenblut aspiriert wurde. In meiner Klinik werden seitdem alle nichttuberkulösen<br />
Pleuraempyeme nur noch mit KW mit bestem Erfolg behandelt. Dieselben guten Erfolge<br />
berichtet LAUN aus der Univ.-Kinderklinik Frankfurt a.M., allerdings bei Kombination<br />
mit Sulfonamiden.<br />
Die Rippenresektion, die in Anbetracht der außerordentlichen Schwere und Ausdehnung<br />
der Erkrankung sonst nicht zu umgehen gewesen wäre, konnte der Kranken<br />
vollkommen erspart werden. Sic wurde am 25.5.31, also 4 1 /, Wochen nach Klinikaufnahme,<br />
als geheilt und arbeitsfähig entlassen und blieb von da ab bcschwcrdcfrci.<br />
Der 12jährige Paul I. war schon seit 5 Jahren Insasse eines Krüppclheims wegen<br />
spastischer Hemiplegie und Epilepsie, die seit seinem 1. Lebensjahr beobachtet worden<br />
waren. Vom 11.6. an gelegentlich subfebrile Temperaturen, am 2.7. erfolgte starker<br />
Fieberanstieg. Über dem rechten Überlappen bronchiales Exspirium und Schaltverkürzung,<br />
am nächsten Tag Krepitation. Vom 4.7. an starker Foetor ex ore, es wurde eitriger<br />
Auswurf mit elastischen Fasern, Pneumokokken und Streptokokken entleert. Das Röntgenbild<br />
zeigte eine haselnußgroßc Verschattung in Höhe der 2. Rippe, eine 2. ähnliche<br />
Verschattung etwas außen davon.<br />
Später traten noch mehrere ähnliche Schatten beiderseits auf, so daß die Diagnose auf<br />
abszedierende Pneumonie gestellt wurde. Behandlung mit Transpulmin und Diathermie<br />
führten zu keinem Erfolg. Der Lungenbefund nahm sogar zu, am 9.7. war das Atcm-<br />
180
Abb. 141: Abszedierende Pneumonie. 11 Tage später nach Behandlung der linken Seite.<br />
PaulL. 21. VII. 31<br />
Abb. 142: Abszedierende Pneumonie. PaulL. nach Abschluß der Behandlung. 16. VIII. 31<br />
181
geräusch über dem rechten Oberlappen fast amphorisch. Röntgenologisch (Abb. 140)<br />
sind an dieser Stelle mehrere dichte Schattenflecke zu erkennen; aus dem einen davon entwickelte<br />
sich ein Cavum.<br />
Mit der KW-Behandlung wurde am 15.7, begonnen. Schon am 18.7. fiel die jetzt<br />
dünnere und gelblichgrüne Beschaffenheit des Sputums auf. Die Temperatur fiel plötzlich<br />
zur Norm ab. Das Allgemeinbefinden war am 20.7. so sehr gebessert, daß der Junge, der<br />
bei Beginn der Behandlung einen fast moribunden Eindruck gemacht hatte, schon allein<br />
die Treppe zum Behandlungsraum herunterging und einen durchaus munteren Eindruck<br />
machte. Die vorher fahl-subikterische Gesichtsfarbe hatte einer frischen Farbe Platz<br />
gemacht. Das Gewicht nahm zu. Abb. 140 bis 142 zeigen die Besserung im Röntgenbild.<br />
Nachdem ein leichteres Rezidiv ebenfalls nach KW-Bchandlung zurückgegangen war,<br />
konnte das Kind geheilt entlassen werden.<br />
Die Tabelle 2 ist eine kurze Übersicht über die 1931—193 3 behandelten Kranken<br />
mit eitrigen Lungenkrankheiten, die alle noch ohne Bacteriostatica und Antibiotica<br />
behandelt worden sind. Inzwischen wurde nochmals ungefähr die dreifache<br />
Zahl behandelt.<br />
Zwei meiner Patienten mit Lungengangrän gingen später durch Metastasen<br />
zugrunde; von chronischen Abszessen mußten zwei später operiert werden.<br />
Wiederholt konnten Heilungen auch noch bei solchen Krankheiten erzielt werden,<br />
bei denen nach Rippenresektionen wegen Pleuraempyem Resthöhlen und<br />
Fisteln zurückgeblieben waren.<br />
Bei den bisher nicht geheilten Kranken war die Pleura- bzw. Lungencrkrankung nur<br />
Nebenbefund einer Sepsis. Bei der einen Kranken, einem ijjährigen Mädchen, bestand<br />
ein putrides Pleuraempyem, das infolge Perforation einer eitrigen Peritonitis nach Appendizitis<br />
durch das Zwerchfell entstanden war, im anderen Fall war der Lungenabszeß<br />
Nebenbefund einer Sepsis nach gynäkologischer Pclveopcritonitis. In beiden Fällen wäre<br />
wohl auch sonst keine Rettung möglich gewesen.<br />
Bei 2 weiteren Kranken, die nicht reagierten, stellten sich Karzinome als Ursache der<br />
Abszesse heraus. Nur bei einem Kranken mit Tuberkulose und mischinfiziertem Pleura-<br />
Empyem wurde am Schluß eine Rippenresektion gemacht, um die Heilung zu beschleunigen;<br />
bei Kindern wurden ausgiebige Punktionen gemacht. Sonst konnte auf alle Eingriffe<br />
verzichtet werden.<br />
Daß auch chronische Resthöhlen nach Empyemen noch beeinflußt werden können, zeigt<br />
folgender Fall:<br />
Das 9Jährige Mädchen M. Schw. hatte 2 Jahre vorher ein Pleuraempyem überstanden,<br />
es war eine Rippenresektion gemacht worden, von der eine Fistel geblieben war. Die<br />
Eiterung war so stark, daß viermal täglich der völlig durchtränkte Verband gewechselt<br />
werden mußte. Das Kind war im Wachstum zurückgeblieben und völlig apathisch. Es<br />
hatte sich eine starke Skoliose ausgebildet. Der Temperatur war dauernd erhöht. Nachdem<br />
sich das Kind 2 Jahre lang in diesem Zustand befunden hatte, sollte eine Thorakoplastik<br />
gemacht werden; man wollte aber vorher noch einen Versuch mit KW-Therapic<br />
machen. Röntgendurchleuchtung ergab, daß die Lunge fast völlig kollabiert war.<br />
Nach einigen Durchflutungen schickte ich das Kind wieder fort, da ich eine Besserung<br />
selbst für ausgeschlossen hielt. Nach 4 Wochen baten aber die Eltern um Wiederaufnahme<br />
des Kindes, da die Behandlung nachträglich so gut gewirkt hätte. Das Allgemeinbefinden<br />
und der Ernährungszustand waren auch etwas besser, am objektiven Befund<br />
hatte sich nichts geändert.<br />
Im Laufe eines Jahres wurde das Kind noch viermal aufgenommen und behandelt.<br />
Danach war die Wunde ausgeheilt, die Lunge voll entfaltet, und zwar ohne nachweisbare<br />
Verziehungen und Schwarten. Die Skoliose war ausgeglichen, das Kind turnte und hatte<br />
sich hervorragend entwickelt. Nach 24 Jahren war die Patientin verheiratet, hatte<br />
2 Kinder und fühlte sich gesund.<br />
i8a
B.Sch.<br />
Mm.<br />
E.Schr.<br />
F.R.<br />
Paul L.<br />
Sk.<br />
H.J.<br />
K.So.<br />
J.Ho.<br />
Fr.Bch.<br />
E.Zei.<br />
P.Ste.<br />
Fe.Ba.<br />
O.G1.<br />
Gg. Kl.<br />
Mal.<br />
E.K1.<br />
B.Ncu.<br />
I.Ko.<br />
E.Be.<br />
H.Dc.<br />
Kind S.<br />
Dr.K.<br />
Tabelle 2.<br />
VON 1931—1933 behandelte eitrige Erkrankungen der Brmtorgane<br />
Diagnose<br />
Empyem nach Grippe r.<br />
Empyem postpneumonisch r.<br />
Tuberkulöse Exsudat 1.<br />
Lungengangrän r.<br />
Abszedierende Pneumonie beiderseits<br />
Empyem nach Maltafleber r.<br />
Empyem nach Maltafiebcr r.<br />
Lungenabszeß nach Embolie<br />
r. Obcrlappen<br />
Lungenabszeß r. Oberlappen<br />
nach Grippe<br />
Pleuraempyem und Lungenabszeß 1.<br />
Interlobärempyem u. Lungengangränr.<br />
Interlobärcs Empyem r., Abszeß im<br />
r. Obcrlappen<br />
Abszeß 1. Oberlappen<br />
Doppelseit. Pneumonie mit Intcrlobärexsudat<br />
u. Abszcßbildung beiders.<br />
Lungenabszeß 1. Unterlappen<br />
Abszedierende Pneumonie und Pleuritis<br />
exsudativa 1.<br />
Abszedierende Pneumonie r. Unterlappcn<br />
Tbc. pulm. beiders., Pleuraempyem r.<br />
Pleuraempyem, Fistel nach Rippcnresektion<br />
Lubgcnabszeß r. Mittelfeld nach Tonsillektomie<br />
Pleurarestempyem, Lungenkollaps nach<br />
Rippenresektion<br />
Tuberkulöses mischinfiziertes Empyem<br />
Chron. Mediastinitis<br />
Vorherige<br />
Dauer<br />
7* Jahr<br />
6 Woch.<br />
3 Mon.<br />
ca. 4 Woch.<br />
2 Woch.<br />
8 Woch.<br />
4 Woch.<br />
14 Tage<br />
8 Tage<br />
17 Tage<br />
3 Woch.<br />
2 Woch.<br />
ca. 2 Mon.<br />
19 Tage<br />
4 Woch.<br />
6 Woch.<br />
8 Woch.<br />
5 Woch.<br />
7 Mon.<br />
6 Woch.<br />
1 Jahr<br />
6 Woch.<br />
4 Jahre<br />
Geheilt<br />
nach<br />
6 Woch.<br />
4 Woch.<br />
2 Mon.<br />
3 Woch.<br />
14 Tagen<br />
4 Woch.<br />
3 Woch.<br />
4 Woch.<br />
37a Wo.<br />
6 Woch.<br />
4V1 Wo.<br />
57, Wo.<br />
5 Woch.<br />
5 Woch.<br />
3 Woch.<br />
4 1 /. Wo.<br />
3 Woch.<br />
9 Woch.<br />
17 Tagen<br />
6 Woch.<br />
6 Mon.<br />
4 Woch.<br />
6 Woch.<br />
Völlig<br />
fieberfrei<br />
nach<br />
4 Tagen<br />
Ï Tagen<br />
23 Tagen<br />
2 Woch.<br />
5 Tagen<br />
7 Tagen<br />
6 Tagen<br />
4 Tagen<br />
4 Tagen<br />
10 Tagen<br />
Ï Tagen<br />
3 Tagen<br />
3 Tagen<br />
6 Tagen<br />
6 Tagen<br />
2 Woch.<br />
4 Tagen<br />
S Woch.<br />
—<br />
8 Tagen<br />
_<br />
8 Tagen<br />
—<br />
Die Ergebnisse bei Lungenabszessen und Pleuraempyemen bilden einen einwandfreien<br />
Beweis für die besondere Heilwirkung der UKW. Die Mortalität der<br />
Abszesse bei anderen Behandlungsverfahren dürfte gegenüber den unten angegebenen<br />
Zahlen abgesunken sein, ist aber immer noch hoch. Sie beträgt bei<br />
konservativer Behandlung 60-75% (wobei gelegentlicher Durchbruch in einen<br />
Bronchus vorkommt), bei chirurgischer Behandlung günstigenfalls 35-40%*.<br />
* Schriften über Lungenabs^esse: ANDERSON: Ohio state med. journ. 23, 291, 1927. (110<br />
intern behandelte Fälle. Heilung in 10%, besser 15 %,gestorben 75 %, operativ 47,8%.)-<br />
BERNARDI: Giorn. clin. med. 10, 131, 1920. (Von 27 verschieden behandelten Kranken<br />
13 gestorben, 6 unbeeinflußt, 8 geheilt.) - DELANGLADE und FIOLLE: Lyon Chir. 1910,<br />
Bd, 3, S.607. (Bei Pneumotomie Mortalität 40%.) - KISSLING: Hamburg, Leopold Voß,<br />
1906. (Bei operativer Behandlung Heilung 63%.) - KÖRTE: Arch. klin. Chir. 8j, 1,<br />
183
Beim operativen Vorgehen muß außer der Schwere des Eingriffs und der langen<br />
Dauer der Nachbehandlung noch in Betracht gezogen werden, daß es sich um eine<br />
Heilung mit schwerem Defekt handelt.<br />
Bei den von mir geheilten Kranken wurde nicht etwa eine Auswahl getroffen,<br />
sondern alle anfallenden Erkrankungen wurden behandelt. Hierbei ist nochmals<br />
zu betonen, daß es sich bei den Abszessen nicht etwa um eine besonders gutartige<br />
TV. 16.7. 1?. « 19 SB. it. 22. 23. ZV. ES. 26. El 28. 29. 30 31. 1.ÏÏ. 2 3. V.<br />
Sputum ¥5 SO 130 60 HS ?S 60 35 20 20 S<br />
CCïïl 6Shg ZW. 71 kg<br />
Abb. 14} : Kl. Fieberkurve von einem Kranken mit Lungenabszeß<br />
unter UKW-Behandlung. (Aus Klinische Fortbildung I, 19}})<br />
Epidemie gehandelt hat, sondern um verschiedenste Ätiologie und Herkunft. Auch<br />
überwiegen gerade die prognostisch so ungünstigen Oberlappenabszesse, da von<br />
vornherein die Neigung bestand, die am wenigsten günstig gelagerten Fälle, bei<br />
denen «nichts zu verderben» war, der KW-Therapie zuzuführen. Irgendwelche<br />
Beeinträchtigungen des Blutkreislaufes bei der Resorption der großen Eitermassen,<br />
wie sie von anderer Seite befürchtet worden sind, haben wir nie beobachtet ;<br />
1908. - LORD: Certain Aspects. Boston med. a surg. ¡ourn. 192, 785, 1925. (227 Fälle.<br />
Interne Behandlung 7;%, operativ 47,8% Mortalität.) - MATOLAY: Zcntralorg. ges.<br />
Chir. u. i. Grcnzgcb. 47, 558, 1929. (Von 47 operierten Kranken 17 gestorben.) -<br />
MIDDELDORPF: Dtsch. Zeitschr. Chir. Bd. 212, 17, 1929. (Bei Paraffïnplombc }4%<br />
Mortalität.) - MIGNOT: Presse Med. 38, 387, 1930. - MÜLLER: Amer, journ. of roentgen.<br />
a. rad. ther. 15, 421, 1926. (Bei konservativer Behandlung heilten 22%.) - Ders.: Ann<br />
of surg. 91, 361, 1930. (Endgültige Ergebnisse nach Operation 40% Mortalität.) -<br />
MORRISON: Californ. a. Western med. 27, 729, 1927. (Bei 241 operierten Fällen 40-50%<br />
Mortalität.) - NISSEN: Chir. 1929, Jg. 1, 115 3.- RAHNENFÜHRER: Fortschritte a.d. Geb.<br />
d. Rontgenstr. 28, 97, 1921. (Bei Abszeß und Gangrän 66 B /a% Mortalität.) - SAUER-<br />
BRUCII: 30% letal nach operativer Behandlung. - SCHILDT: Beiträge z. Kenntnis der<br />
septischen Pleuraempyeme. Läk. f. Förb. N. F. 37, S. 1, 193t. - SEITZ: Z. Kenntnis d.<br />
Lungenabszesses. Zbl. inn. Med, 1934, S. 46. (Bei chirurg. Drainage 30-40% Mortalität). -<br />
STEPP: Über die Behandlung der Lungengangrän. Ther. Halbmonatsh. 34, 161, 192c-<br />
SUNDE: Long Island med. journ. 21, 143, 1927. (Bei bronchoskop. Behandlung Mortalität<br />
30%.) - TEWKSBURY: R. f. Zcntralorg. f. d. ges. Chir. 34, 700, 1926. (Bei<br />
akuten Abszessen 40% Mortalität.) - TUFFIER: Bull. a. mem, de lasoc.dechir.de<br />
Paris 29, 529, 1903. (Bei Operation 35-40% Mortalität.) - TUFFIER et MARTIN: Gaz.<br />
d'Hóp. civ. et milit. 82, 1567, 1909. (Bei Pneumonie 30% gestorben.) - WOLCOTT &<br />
MURPHY (Dis. of Chest 32, 62, 1957) behandelten 6; Kranke. Bei Sulfonamidbehandlung<br />
hatten sie eine Mortalität von 31,5 %, bei Penicillin 17,2%, bei Tryptarund Antibiotics<br />
0%. Bei diesen letzteren war aber in 3; % eine Resektion notwendig!<br />
184
im Gegenteil hat sich der oft schwer darniederliegende Kreislauf während der Bchandlungszeit<br />
in allen Fällen gut erholt.<br />
Welche Rolle die richtige Dosierung und Technik spielt, geht aus den Angaben von<br />
LIEBESNY hervor. Er hatte zuerst bei einigen Lungenabszessen keinerlei Erfolg. Erst nach<br />
Aufstellung eines neuen KW-Apparates und Anwendung anderer Technik konnte er<br />
gleichwertige Ergebnisse erzielen. Eine volle Bestätigung an Hand zahlreicher Röntgenbilder<br />
hat ferner FIANDACA gebracht. Er hatte bei 12 Kranken mit Lungenabszessen<br />
z. T. schwerster Art und verschiedener Ätiologie nur 2 Mißerfolge. Besonders sei noch auf<br />
die Arbeiten von DIEKER, MUTH, ROBBY verwiesen.<br />
Technik<br />
Bei der Behandlung der eitrigen Krankheiten im Brustraum wird auf die erkrankte<br />
Seite vorn und hinten je eine Platte von 20 cm Durchmesser in Seitenlage oder in Rückenlage<br />
aufgesetzt. Die eine Elektrode liegt unter dem Behandlungstisch, dessen Platte am<br />
besten an dieser Stelle aus Glas besteht. Die Stärke des Kondensatorfcldcs wird individuell<br />
verschieden gewählt. Leider lassen sich, wie schon vorn ausgeführt, keinerlei<br />
absolute Maße geben, man ¡st auf die Empfindungen der Kranken und die ärztliche<br />
Erfahrung angewiesen. Im allgemeinen wird die Stärke so eingestellt, daß die Kranken<br />
angenehme Wärme in der Tiefe empfinden (Dosis II). Es wird mit kurzen Behandlungszeiten<br />
und mäßiger Energie begonnen, gewöhnlich j Minuten in fieberhaften, 10 Minuten<br />
bei fieberfreien Fällen. Bei tuberkulösen Pleuraergüssen beginnt man mit Dosis II,<br />
1 Minute, und steigert allmählich bis 5 Minuten. Der Plattenabstand beträgt vorn und<br />
hinten mindestens je 6-8 cm. Das Befinden der Kranken muß dabei genau beobachtet<br />
werden. Gewöhnlich tritt nach dieser ersten kurzen Behandlung noch keinerlei Änderung<br />
im Befinden auf. Erst wenn die Zeiten länger genommen werden, können sich gewisse<br />
Beschwerden bemerkbar machen. Manche Kranke klagen über Druckgefühl in der Brust<br />
und leichte Atemnot, die 2 bis 3 Stunden nach der Behandlung beginnt. Auch Stiche<br />
können auftreten. Diese Erscheinung ist wohl durch die eingetretene Hyperämie der<br />
Lungen bedingt. Wird über solche Beschwerden geklagt, so soll mit Feldstärke und<br />
Bchandlungsdaucr nicht höher gegangen werden ; man richtet die Dosis am besten so ein,<br />
daß ganz leichte Druckgefühlc auftreten, die aber nicht unangenehm werden dürfen.<br />
Die Hyperämie der Lungen zeigt sich bei Punktionen; wenn man dabei die Pleura<br />
pulmonalis verletzt, so witd fast immer auffallend viel Blut aspiriert.<br />
Oft tritt nach Behandlung der Brustorgane eine allgemeine Temperatursteigerung von<br />
1 /E— 1 ° auf, die im Verlauf von 1 bis 2 Stunden wieder völlig zurückgeht. Es handelt sich<br />
hier wohl nur um Retention der durch das Kondcnsatorfcld zugeführten Wärme. Wie es<br />
kommt, daß die Abgabe dieser Wärme so lange Zeit beansprucht, mag dahingestellt<br />
bleiben. Am naheliegendsten erscheint die Annahme, daß in den betroffenen Geweben<br />
und Krankheitsherden die Stoffwcchselvorgänge angeregt werden und daß diese Anregung<br />
noch eine Zeitlang nachdauert. Fieberreaktionen wie bei unspezifischer Eiweißtherapie<br />
wurden nur selten beobachtet. Gelegentlich sahen wir bei einer produktivzirrhotischen<br />
Lungentuberkulose abendliche Fiebersteigerungen von */i
Bei ganz frischen Osteomyelitiden mit nur geringen oder noch nicht nachweisbaren<br />
röntgenologischen Veränderungen kann ein völliger Rückgang aller Erscheinungen<br />
(Fieber, Schwellung, Schmerzen) erreicht werden. In älteren Fällen werden die<br />
Demarkation und Sequestrierung begünstigt. Besonders in solchen Fällen, wo<br />
wegen der starken Disseminierung und schwierigen Abgrenzbarkeit der Herde die<br />
Aussichten operativer Eingriffe ungünstig sind, können diese Aussichten durch<br />
die scharfe Demarkierung verbessert werden. Allgemein werden die kürzesten<br />
Wellenlängen (3-4 m) als besonders wohltuend und wirksam empfunden. Der Verlauf<br />
ist gewöhnlich so, daß nach der ersten Behandlung eine verstärkte Sekretion<br />
von dickerem Eiter auftritt. In diesem Eiter finden sich später oft auch kleine<br />
Knochcntcilchen. Nach längerer Behandlung läßt die Sekretion nach. Häufig werden<br />
dann kleinere Sequester spontan durch die Fisteln abgestoßen. In einem Fall,<br />
bei dem vorher in 4 Jahren keine Sequestrierung eingetreten war, erreichten wir<br />
durch 8wöchige Behandlung die völlige Abstoßung eines Sequesters, der mittels<br />
eines verhältnismäßig geringfügigen Eingriffs mit der Pinzette herausgenommen<br />
werden konnte. Die Dosierung muß mit Vorsicht gehandhabt werden, da gelegentlich<br />
Reaktionen auftreten. Kombination mit Penicillin erscheint besonders aussichtsreich.<br />
Während über akute Osteomyelitis keine neueren Veröffentlichungen vorliegen,<br />
haben sich die Berichte über die gute Wirkung der KW-Therapie bei chronischer<br />
Osteomyelitis gehäuft. SOAVE beobachtete Verkleinerung der Herde und bessere<br />
Demarkierung der Sequester. In einigen Fällen mußte noch operiert werden. Die<br />
Regeneration des Knochengewebes wird beschleunigt.<br />
Über ausgezeichnete Erfolge berichtet RINTELEN. Lange bestehende Fisteln,<br />
auch tuberkulöser Ursache, heilten rasch zu, die Sequestrierung wurde erheblich<br />
beschleunigt. Auch LOB sah Besserungen bei tuberkulösen Fisteln.<br />
Über die Wirkungen der KW-Therapie auf Knocbenbrüche sind die Berichte uneinheitlich.<br />
Versuche PINELLIS an Meerschweinchen ergaben nach Durchflutungen<br />
von täglich J Minuten bessere Kallusbildung. Beim Menschen sah PIANI keine<br />
bessere Frakturheilung, ja manchmal sogar Verzögerungen; dagegen berichtet<br />
GUARINI über sehr gute Erfolge, ebenso wie SCHMIDT. Hier dürfte die Dosierung<br />
für die Verschiedenheit der Ergebnisse maßgebend sein.<br />
MARAGLIANO hatte beste Erfolge bei Nachbehandlung traumatischer Gelenkerkrankungen,<br />
wie Distorsionen, Luxationen, endoartikulären und periarttkulären<br />
Frakturen. Hier, wie auch bei Behandlung von Muskelzerrungen und Blutergüssen,<br />
wird die seht gute Schmerzstillung hervorgehoben. Auch GUARINI hatte ausgezeichnete<br />
Erfolge bei Verrenkungen, Verstauchungen, Quetschungen und<br />
Narbenwucherungen. Die Behandlungsdauer wurde verkürzt und die anatomische<br />
und klinische Heilung vollständiger.<br />
Paratendinitis crepitans und andere chronische Entzündungen des Bindegewebes<br />
wurden u.a. von LOB und SCHLAEPFER erfolgreich behandelt.<br />
Arthralgien bei Caissonarbeitern behandelte MOLEFINO, der Übergang ins chronische<br />
Stadium konnte verhindert werden.<br />
In der Kriegschirurgie hat sich die KW-Therapie bei allen frischen und älteren<br />
eiternden Wunden bewährt. Chronische Fisteln bei Knochenentzündungen und<br />
Steckschüssen werden gut beeinflußt, die Abstoßung von Fremdkörpern und<br />
Sequestern wird beschleunigt. Wegen der diagnostischen Verwendung der UKW<br />
zur Aufdeckung latenter Knochenherde s.S.236fr.<br />
Die Dosis muß im Anfang klein sein, wir beginnen mit j Minuten. Erst später<br />
186
wird bis io Minuten gesteigert. Im akuten Stadium muß täglich behandelt werden,<br />
später seltener.<br />
Durch Überanstrengung und Überlastung hervorgerufene Ergüsse in Gelenken<br />
gehen immer in kurzer Zeit zurück, ebenso Ergüsse auf allergischer Grundlage.<br />
Versteifungen und narbige Verhärtungen werden durch kräftige KW-Behandlung<br />
erweicht. Die KW-Therapie kann daher auch zur Nachbehandlung von versteiften<br />
Gelenken benutzt werden.<br />
Ich verwandte hierzu seit 1934 außerdem eine Behandlung mit Schallwellen von<br />
jo bis 100 Hz und später Ultraschall mit gutem Erfolg.<br />
Bei Behandlung der Wirbelsäule, aber auch anderer Gelenke, sahen wir baldige<br />
Lockerung. Bei noch bestehenden Entzündungen ist jedoch mit der Schallbehandlung<br />
Vorsicht am Platze, da sie sonst aufflackern können.<br />
Bei Tuberkulose der Knochen und Gelenke sind noch zu wenig Erfahrungen<br />
gesammelt worden. Es hat aber den Anschein, als ob dieUKW dabei ausgesprochen<br />
günstig wirkten, und zwar bei nicht zu kräftiger Dosierung.<br />
Bei vielen Erkrankungen zeigt sich die resorptive Wirkung des UKW-Feldes.<br />
So werden toxische Ödeme schnell schmerzfrei und kommen schnell zur Resorption<br />
(LOB). Besonders gilt dies für stärkere Ödeme nach Insektenstichen sowie nach<br />
paravenösen Injektionen. Reizergüsse in Gelenken durch Kontusion werden<br />
schnell resorbiert.<br />
Dasselbe gilt für die Resorption von Hämatomen nach Quetschungen und<br />
Prellungen, wie auch nach Apoplexien.<br />
Traumatische Ödeme an Gliedmaßen nach Knochenbrüchen, bei ischämischen<br />
Kontrakturen usw. konnten wir oft in wenigen Wochen beseitigen, nachdem schon<br />
monatelang andere Mittel vergeblich angewandt worden waren.<br />
Bei der Behandlung des hämophilen Hämatoms und Hämarthros sah FONIO<br />
schnellere Resorption der Blutergüsse, Nachlassen der Schmerzen sowie der<br />
Bewegungscinschränkung des Hämarthros. Im Experiment wies er nach, daß<br />
10-20 min lang mit Ultrakurzwellen bestrahlte Emulsionen von Blutplättchen die<br />
Retraktion und Serumauspressung des Fibringerinnsels eines plättchenfreien<br />
Plasmas erhöhen.<br />
Die SuDECKsche Knochendystrophie eignet sich nach SCHOLZ & LEITNER besonders<br />
für die Kurzwellenbehandlung. Als beste Dosierung wird Dosis 1 bei<br />
15-25 min Dauer angegeben. Danach soll aktive Heilgymnastik angeschlossen<br />
werden. Kombination mit Testoviron-Injektionen ist günstig.<br />
8. Rheumatische und arthritische Erkrankungen,<br />
Seit 1927 werden die KW von uns zur Behandlung rheumatischer Leiden angewandt.<br />
Die Ergebnisse konnten inzwischen bedeutend verbessert werden.* Die<br />
Behandlung der rheumatischen und arthritischen Erkrankungen stellt sowohl an<br />
den Arzt wie an die Apparatur große Anforderungen. Eine Behandlung mit ungenügenden<br />
und billigen Apparaten kann manchmal bei lokalisierten Erkrankungen<br />
kleinerer Gelenke Besserung bringen, ¡st aber bei ausgedehnteren Erkrankungen<br />
so gut wie wertlos. Angaben über angeblich mit solchen Apparaten erzielte<br />
* Eingehende Darstellung bei SCHLIEPHAKE, Rheumatismus. Darmstadt, Stcinkopff<br />
1952<br />
187
Erfolge stimmen um so mißtrauischer. Weiterhin muß der Arzt die UKW-Therapie<br />
vollkommen beherrschen und große Erfahrungen darin besitzen, wie sie nur in<br />
jahrelanger Arbeit erworben werden können.<br />
Voraussetzung jeder erfolgreichen Behandlung ist selbstverständlich genaue<br />
Diagnose und Indikationssteltung ; denn es sind keineswegs alle Fälle mit rheumatischen<br />
Schmerzen in gleicher Weise für die UKW-Behandlung geeignet, auch<br />
muß der tatsächliche Ausganspunkt der Erkrankung berücksichtigt werden.<br />
Zunächst muß man sich durch eingehende Untersuchung der Kranken darüber<br />
schlüssig werden, ob lokale Behandlung genügt und wo diese anzusetzen ist, oder<br />
ob Allgemeinbehandlung am Platze ist. Entscheidend ist hierfür, ob die Krankheit<br />
selbständig geworden ist und sich auf eine Stelle beschränkt, oder ob ein Herdinfekt<br />
vorhanden ist, von dem aus immer neuer Nachschub erfolgt. In diesem<br />
letzteren Fall hat sich die Therapie in erster Linie gegen den Herdinfekt zu richten,<br />
dann erst wird das sekundär erkrankte Organ behandelt. Auf jeden Fall ist genaue<br />
Durchuntersuchung des ganzen Körpers nötig, um Herdinfekte aufzudecken. Blutbild,<br />
KW-Provokation und Senkungsreaktion leisten dabei wertvolle Dienste.<br />
Die Behandlung lokaler Prozesse kann unter Umständen einfach sein; bei Verallgemeinerung,<br />
etwa einer allgemeinen chronischen Polyarthritis bietet die Behandlung<br />
dagegen größere Schwierigkeiten. Sie stellt große Ansprüche an die<br />
Geduld des Arztes und der Patienten. Die Technik ist in beiden Fällen völlig verschieden.<br />
Je nach dem erhobenen Befund wird die Behandlung entweder in Form der örtlichen<br />
UKW-Therapie durchgeführt oder als allgemeine Hyperthermie.<br />
Bei der lokalen Behandlung ist die Benutzung richtiger Elektroden Voraussetzung. Der<br />
Abstand der Elektroden von der Körpcrobcrflächc hängt unter anderem von der Dicke<br />
des zu durchflutenden Körperteils ab, weiterhin von dem Durchmesser der Elektroden<br />
und von der Lage des Krankheitsherdes im Körper. Bei schmalen Gliedmaßen, etwa Arm<br />
oder Unterschenkel, kann man den Abstand geringer wählen als etwa bei der Behandlung<br />
des Thorax oder Beckens. Andererseits ist es ratsam, bei umfangreichen Körperteilen<br />
größere Elektroden zu nehmen, da unter zu kleinen Elektroden die Streuung zu groß<br />
wird. Die Unbrauchbarkcit von Elektroden mit Filz- oder Gummiüberzug für Tiefenbehandlung<br />
ist von mir, später auch von KOWARSCHIK und GEBBERT überzeugend dargetan<br />
worden.<br />
In gewissen Fällen kann Anwendung des Spulenfeldes von Vorteil sein.<br />
Die lokalisierte Behandlung ist in erstet Linie am Platze, wo monarth mische Reste<br />
einer akuten oder schleichenden Polyarthritis vorliegen. Hierher gehören manche<br />
Formen von Omarthritis, Monarthritiden der Hand- und Fußgelenke, Arthritiden der<br />
Halswirbelgelenke, ferner die Arthritiden der Kniegelenke, die oft jeder anderen<br />
Behandlung gegenüber refraktär sind.<br />
Zu den durch lokale UKW-Behandlung gut beeinflußbaren Erkrankungen gehören<br />
ferner unspezifische Entzündungen von Periost und Sehnenscheiden sowie periarthritische<br />
Prozesse. In der überwiegenden Mehrzahl solcher Erkrankungen<br />
haben wir Heilungen in verhältnismäßig kurzer Zeit erzielen können.<br />
Wir behandeln bei den genannten Gruppen gewöhnlich mit Elektroden von 10 cm<br />
Durchmesser mit einem Abstand von 3 cm, wenn es sich um Arm- oder Kniegelenke<br />
handelt. Bei Schukergeknken beträgt der Elektrodenabstand 4 cm, bei den Hüftgelenken<br />
nehmen wir Platten von 15-20 cm Durchmesser mit mindestens 4-5 cm Abstand.<br />
Die Bchandlungsdaucr ist iQ-20 Minuten bei Dosis III-LV. Bei Ischias, Bcckcn-<br />
188
neuralgic und Erkrankung beider Schultcrgelcnkc kann man im elektromagnetischen<br />
Feld einer Schlinge behandeln, die um den Körperteil herumgelegt wird.<br />
Der Verlauf ist bei den einzelnen Fällen verschieden. Manchmal wird schon die<br />
erste Behandlung angenehm empfunden; Schmerzen, die vorher vorhanden<br />
waren, verschwinden für mehrere Stunden, um manchmal erst viel später wiederzukehren,<br />
öfters sehen wir Resorption selbst größerer Ergüsse nach der j. bis<br />
6. Behandlung. Bei anderen Kranken sind Ergüsse und Schmerzen sehr hartnäckig ;<br />
es sind dann oft 20 und mehr Durchflutungen nötig, um sie zum Rückgang zu<br />
bringen.<br />
Bemerkenswert ist, daß die Beschwerden oft erst spät nachlassen. Wir haben<br />
wiederholt erlebt, daß mehrwöchige Behandlung ohne irgendeinen nachweisbaren<br />
Erfolg geblieben war. Etwa 4-8 Wochen später erhielten wir Nachricht von den<br />
Kranken, daß in der Folgezeit die Beschwerden völlig verschwunden waren, und<br />
zwar ohne daß sich die Kranken besonders geschont oder andere Heilmaßnahmcn<br />
angewandt hätten.<br />
Wir müssen unterscheiden zwischen solchen Erkrankungen, bei denen ein Herdinfekt<br />
noch vorhanden ist, und solchen, wo er nicht mehr nachweisbar ¡st, die<br />
Erkrankung also als lokalisiert betrachtet werden muß. Auf die Behandlung der<br />
Herdinfekte wird noch zurückgekommen; zunächst interessiert die letztere<br />
Form. Die UKW-Therapie ist nicht in allen Fällen gleich wirksam, aber wir haben<br />
doch eine große Anzahl von Erfolgen selbst bei hartnäckigen Erkrankungen zu<br />
verzeichnen.<br />
Gelegentlich kann der Erfolg schlagartig sein, so bei manchen Fällen von schwerer,<br />
seit Wochen bestehender Lumbago. Es kommt vor, daß Kranke, die gebückt am Stock<br />
¡n das Behandlungszimmer kamen, den Bchandlungstisch vollkommen beschwerdefrei<br />
und ohne jede Bewegungshemmung verlassen. Es muß allerdings zugegeben werden, daß<br />
so rasche Erfolge vereinzelt sind. Meistens sind 10-12 Durchflutungen nötig, doch ¡st<br />
fast immer schon im Verlauf der 1. Durchflutung oder kurz danach eine bedeutende Erleichterung<br />
feststellbar.<br />
Wo Herdinfekte vorhanden sind, müssen diese gleichzeitig behandelt werden,<br />
um die Eintrittspforten der Erkrankung nach Möglichkeit zu beseitigen. Über die<br />
Behandlung von Paradentose und Zahngranulomen s. S.i6jff. Die chronische<br />
Tonsillitis ¡st in vielen Fällen gut beeinflußbar, doch ist der Erfolg nicht von Dauer<br />
vor. Spätere chirurgische Beseitigung der Herdinfekte ist in den meisten Fällen<br />
unerläßlich. Oft ist es möglich, die Herdinfektion ex iuvantibus ausfindig zu<br />
machen, denn wir haben wiederholt gesehen, daß nach einigen Durchflutungen des<br />
fraglichen Herdinfektes die rheumatischen Schmerzen vorübergehend verschwanden.<br />
So verschwand eine seit 8 Wochen dauernd in gleicher Stärke bestehende Lumbago<br />
nach jmaliger Durchflutung eines Zahngranuloms. Die Beschwerden traten nach einigen<br />
Wochen wieder auf und konnten — ebenso wie bei noch mehrmaligem späteren Auftreten<br />
— durch 2 Durchflutungen zum Verschwinden gebracht werden. Nach Entfernung<br />
des Zahns blieben dann die Anfalle ganz weg.<br />
Bei den meisten Kranken mit chronischen Arthritiden, die von uns behandelt<br />
wurden, hat es sich um alte verschleppte Fälle gehandelt, dieschonalle erdenklichen<br />
therapeutischen Maßnahmen ohne Erfolg versucht hatten. Ungefähr in zwei<br />
Drittel der Fälle waren einwandfreie Erfolge zu verzeichnen, die in Wiederkehr<br />
189
der Beweglichkeit und Schmerzfreiheit bestanden. Die röntgenologisch erkennbaren<br />
Veränderungen wurden nur wenig beeinflußt und oft war noch Knarren in<br />
den betroffenen Gelenken bei Bewegung nachweisbar; die Kapselschwellungen<br />
gingen dagegen erheblich zurück. Die Hauptsacheist aber in jedem Fall die Wiederherstellung<br />
der Funktionstüchtigkeit. Die Blutkörperchensenkungsgescbwindigkeit ging<br />
oft während, meistens aber erst nach der Behandlung bedeutend zurück.<br />
Wenn mehrere Gelenke oder alle Gelenke mehr oder weniger schwer erkrankt<br />
sind, kommt man mit Lokalbehandlung nicht aus. Vor allen Dingen gilt das auch<br />
für die Spondylarthritis. Hier ist unbedingt Behandlung mit sehr großen Energien<br />
und künstlicher Hyperthermie am Platze. Wie erwähnt, hat sich die maximale<br />
Hyperthermie dabei nicht so bewährt wie eine milde Hyperthermie bis 39 o , die zunächst<br />
3 mal, später 2mal in der Woche ausgeführt wird. Sie kann im späteren Verlauf<br />
der Erkrankung auch ambulant gemacht werden.<br />
Während SOLOMON und STECHER mit maximaler Hyperthermie keine wesentlichen<br />
Erfolge bei chronischen Arthritiden gehabt hatten, geben DAVISON, LOWANCE und CROWE<br />
gute Erfolge mit milder Hyperthermie an. Sie bestätigen damit meine langjährigen<br />
Erfahrungen.<br />
BURNETT hatte nur Erfolge bei hypertrophischen Formen der Arthritis, während<br />
atrophische Formen refraktär blieben, dagegen gibt PETCO gerade bei A. deformans beste<br />
Erfolge an. Er behandelte ferner Neuritiden, DupuYTRENsche Kontrakturen und entzündliche<br />
Plattfüße mit bestem Ergebnis. In gleicher Weise äußert sich V.TEUBERN. Auch<br />
KOEPPEN berichtet über gute Erfolge bei verschiedenen rheumatisch-arthritischen<br />
Prozessen. Die Verschiedenheit der Ergebnisse dürfte auf Unterschieden der Dosierung<br />
beruhen.<br />
Besonders schwierig ist die Behandlung der primär chronischen Polyarthritis. Sie<br />
beginnt meist fieberlos oder mit subfebrilen Temperaturen; im Verlauf treten<br />
Schwellungen der Gelenkkapseln auf, manchmal auch Ergüsse in den Gelenken.<br />
Später schrumpfen die Gelenkkapseln, und es können Subluxationen und Kontrakturen<br />
entstehen. Die Gelenke sind schmerzhaft. Die BSG ist immer beschleunigt.<br />
Bei den malignen Formen ist Anämie vorhanden, sonst pflegt das Blutbild<br />
uncharakteristisch zu sein.<br />
Es kommt darauf an, die Behandlung in einem möglichst frühen Stadium der<br />
Krankheit zu beginnen. In solchen Fällen ist die primär chronische Polyarthritis<br />
durch KW-Therapie vollständig heilbar, während früher die Prognose, selbst im<br />
Anfangsstadium, immer sehr schlecht quoad sanationem gewesen ist. Bekanntlich<br />
hat die Entfernung von Infektherden auf den Verlauf der Krankheit wenig Einfluß.<br />
Immerhin sollte man aber doch in allen Fällen etwaige Ursachen einer Fokaltoxikose<br />
vor oder während der Behandlung beseitigen.<br />
Während bei der Behandlung von frischen Fällen die Ergebnisse ausgesprochen<br />
gut sind, muß bei fortgeschrittenen Fällen mit längerer Behandlungsdauer gerechnet<br />
werden und die Erfolge treten nur in einem gewissen Prozentsatz ein.<br />
Man kann auch nicht so sicher mit einem vollen Erfolg rechnen. Mit einer einmaligen,<br />
6 Wohen dauernden Kur kommen wir in den seltensten Fällen aus und<br />
müssen mehrere Behandlungsserien in Abständen von 1 /2 bis 1 Jahr anwenden.<br />
Wir lassen gewöhnlich die Temperatur im Lauf von l /i Stunde auf }8,Ï—39 o steigen,<br />
halten sie bis 1 Stunde auf dieser Höhe und lassen die Kranken dann mindestens 1 Stunde<br />
lang eingepackt liegen.<br />
Um den Heilungsvcrlauf zu beschleunigen, verwenden wir gewöhnlich nicht mehr die<br />
KW-Hypcrthermie allein, sondern kombinieren mit anderen Mitteln. Bei fieberhaften<br />
190
Fällen geben wir im Anfang Salizylatc oder Pyramidon, bei den nicht fieberhaften Goldpräparate<br />
als Injektion, später auch per os(Aurubin). Gerade die letztere Kombination<br />
hat sich sehr gut bewährt. Bei endokriner Komponente sind ferner entsprechende Hormone<br />
zuzuführen. Cortison geben wir nur bei manchen besonders schmerzhaften Erkrankungen<br />
in den ersten Tagen.<br />
Gewöhnlich ist die Besserung bei der ersten Behandlungsserie (12-20 Durchflutungen)<br />
nur gering. Wir machen immer wieder die Erfahrung, wie auch sonst<br />
vielfach bei der KW-Therapie, daß eine nachweisbare Besserung erst nach Abschluß<br />
der Behandlung, manchmal noch nach Monaten, eintritt.<br />
Bei der starken Progredienz und Hartnäckigkeit der primär chronischen Polyarthritis<br />
allen Einflüssen und Heilmitteln gegenüber ist es klar, daß von vornherein<br />
nicht allzu große Erfolgszahlen erwartet werden dürfen und daß schon<br />
Stillstand der Krankheit als bedeutender Erfolg zu buchen ist. Immerhin haben<br />
wir auch bei fortgeschrittenen Erkrankungen noch in etwa 2 /3 der Fälle wesentliche<br />
Besserungen gesehen, und zwar meist einen Stillstand der Erscheinungen nach der<br />
1. Behandlungsserie, Besserungen nach der 2. und 3. Serie. In der Zeit zwischen<br />
den Kuren lassen wir die Kranken noch ansteigende heiße Bäder, unter Umständen<br />
mit Salzzusatz, nehmen. Bei der Bedeutung des Endokriniums ist manchmal auch<br />
eine Hormonbehandlung am Platze, Durchflutungen der Hypophyse können die<br />
Dysfunktion im Endokrinium weitgehend regulieren.<br />
Im Gegensatz zur primär chronischen Polyarthritis, die so gut wie immer in den<br />
kleinen Gelenken beginnt, befällt die Arthritis sicca zuerst die großen Gelenke.<br />
Sie wird wegen der Veränderungen an den Knochen, Auszichungcn und Bildung<br />
von Randgeschwülsten, als Arthritis deformans, im Ausland als Osteoarthrosis bezeichnet;<br />
doch sind diese Deformierungen nur sekundäre Merkmale der Krankheit,<br />
die sich zunächst hauptsächlich an den Knorpeln abspielt, im Gegensatz zur<br />
primär-chronischen Polyarthritis mit ihrer Lokalisation an Kapsel und Bandapparat.<br />
Sie findet sich hauptsächlich bei Pyknikern. Die BSG ist meist nicht<br />
erhöht, nur während der Schübe steigt sie an. Die Gelenke sind bei Bewegung<br />
gewöhnlich nicht schmerzhaft.<br />
Die Arthritis sicca wird auch heute noch oft als Abnutzungskrankheit angesehen und<br />
demgemäß als «Arthrosis» deformans bezeichnet. Hiergegen sprechen aber verschiedene<br />
Punkte. Die Gelenke sind gewöhnlich gerade in derjenigen Bewegungsrichtung am<br />
meisten beeinträchtigt, in der sie am wenigsten benutzt werden, so das Hüftgelenk beim<br />
Spreizen und bei Rotation, das Schultcrgelenk bei Abduktion und Rotation. Bei genauer<br />
Untersuchung findet man ferner, daß es sich um eine Allgemeinkrankheit handelt, die nur<br />
einzelne Gelenke bevorzugt befällt. V.NEERGAARD weist besonders auf die periostitischen<br />
Prozesse an den verschiedenen Knochen, insbesondere das Stachelbecken, hin, ferner auf<br />
den Verlauf in Schüben. Alle diese Beobachtungen berechtigen dazu, die Arthritis sicca<br />
unter die rheumatischen Krankheiten einzureihen. Im gleichen Sinne spricht auch das<br />
gute Ansprechen auf KW-Bchandlung, das bei reinen Abnutzungsvorgängen nicht zu<br />
verstehen wäre.<br />
Selbstverständlich soll hiermit nicht bestritten werden, daß es Arthropathien durch<br />
Abnutzung gibt, wie bei statischen Störungen, Arbeiten mit dem Preßluftbohrer, der<br />
An klopf krankheit der Lederarbeiter und ähnliche unphysiologische Beanspruchungen.<br />
Meist hatten unsere Kranken schon die verschiedensten Kuren mit Fango, Diathermie,<br />
Bädern, Einspritzungen und in Bädern aller Art umsonst gebraucht. Die<br />
KW-Pyrothermie hat in derartigen Fällen Erfolge aufzuweisen, wie bis jetzt kaum<br />
ein anderes Verfahren. Allerdings ist mit Rückfällen zu rechnen. Aber bei einer<br />
191
etwaigen Wiederkehr der Beschwerden ist es ein leichtes, die Kranken noch einigen<br />
Behandlungen zu unterziehen; je früher sie kommen, desto besser!<br />
Bei der Arthritis sicca sind die Ergebnisse der KW-Behandlung gut, jedenfalls<br />
wesentlich besser als die der bisher üblichen Behandlungsverfahren. Die Technik<br />
ist die gleiche wie bei der primär-chronischen Polyarthritis. Gelegentlich geben<br />
wir zur Unterstützung Injektionen von Atophanyl.<br />
Bei beiden Erkrankungsarten sollen baldigst Bewegungsübungen ausgeführt werden,<br />
um Versteifungen zu verhindern. Bei der A. sicca fangen wir sofort damit<br />
an, bei der primären Polyarthritis dann,<br />
wenn die Schwellungen an den Gelenken<br />
zurückgegangen sind. Wir lassen<br />
dann auch die Muskulatur massieren.<br />
Niemals legen wir die Gelenke ganz<br />
still, da dann die Gefahr der Versteifungen<br />
groß wird. Die Ultraschallbehandlung<br />
bewährt sich in diesem Stadium<br />
sehr gut.<br />
In das Gebiet der A.sicca gehört das<br />
Malum coxae senile, das bekanntlich<br />
allen bisherigen Behandlungsverfahren<br />
getrotzt hat. Mit der KW-Therapie<br />
kann man bei einem großen Teil der<br />
Kranken noch Stillstand und oft recht<br />
gute Besserungen erzielen. Hier ist mit<br />
müder Hyperthermie zu behandeln, mit<br />
örtlicher Behandlung erreicht man,<br />
wenigstens im vorgeschrittenen Sta-<br />
Abb. 176: Schultergelenk sagittal dium, nichts. Wir hatten aber den Eindruck,<br />
daß die i-m-Welle, die viel größere<br />
Tiefenwirkung hat als die bisher üblichen Wellenlängen, auch bei örtlicher<br />
Anwendung gute Erfolge erzielt.<br />
Indas gleiche Gebiet gehört die Spondylarthritis sicca, die im allgemeinen gut auf die<br />
KW-Therapie anspricht. Bei nicht zu ausgedehntem Befund kann man lokal behandeln,<br />
wobei die eine Elektrode auf die Halswirbelsäule, die andere auf das<br />
Kreuzbein aufgesetzt wird (Abb. 149). Bei fortgeschrittener Erkrankung kommt<br />
man nur mit Hyperthermie weiter.<br />
Die Spondylarthritis ankylopoetica (BECHTEREW) gehört mehr in das Gebiet der<br />
primär-chronischen Polyarthritis. Erfolge lassen sich nur bei verhältnismäßig<br />
frischen Fällen erzielen. Sind bereits ausgedehntere Versteifungen eingetreten,<br />
dann ist auch die KW-Therapie machtlos, wie überhaupt jede Therapie. Immerhin<br />
sollte man noch einen Versuch mit Hyperthermie, kombiniert mit Solganalinjektionen,<br />
machen, da nicht jeder Fall wie der andere reagiert. Die Ergebnisse sind die<br />
gleichen wie mit Röntgenbestrahlung, meist besser und nachhaltiger. Dabei ist<br />
immer zu bedenken, daß die KW-Therapie die Gewebe nicht schädigt, während<br />
die Röntgenbestrahlung ein nicht abzusehendes Gefahrenmoment in sich birgt.<br />
Gut ist Kombination mit Ultraschall.<br />
Ein großer Teil der Bandscheibenschäden ist durch rheumatische Erweichung<br />
des Nucleus pulpos sus mit hervorgerufen. Man findet bei den Kranken vielfach<br />
Erhöhungen der Blutsenkung, Veränderungen im Blutbild und Erscheinungen<br />
192
am kollagenen Apparat, die auf rheumatische Allgemeinerkrankung hinweisen.<br />
Diese Fälle sprechen auf antirheumatische Ganzbchandlung und auf örtlich<br />
Kurzwellen- und Ultraschallbehandlung gut an.<br />
Im Übrigen ist bei der Modediagnosc „Bandscheibcnprolaps" in den meisten<br />
Fällen von vornherein eine gewisse Skepsis am Platz.<br />
Die Periarthritis humero-scapularis bildet eine Indikation für die KW-Therapie.<br />
Sie beruht auf Erkrankung der Gelenkkapsel des Schultcrgclenkes, deren Falten<br />
miteinander verkleben, so daß das Gelenk versteift, zumal es infolge der großen<br />
Schmcrzhaftigkeit ruhig gestellt zu werden pflegt. Die Schmerzen werden oft nicht<br />
im Gelenk selbst empfunden, sondern irgendwo in der Umgebung. Sie können bis<br />
in das Pektoralisgebiet und bis in Arm und Fingerspitzen hinein ausstrahlen.<br />
Die meist übliche orthopädische Behandlung, erst mit Ruhigstellung und dann<br />
mit gewaltsamer Mobilisierung (brisement forcé), ist ungemein schmerzhaft und<br />
nimmt mehrere Monate in Anspruch. Mit der einfachen KW-Therapie kommt man<br />
man nur ganz im Beginn der Krankheit aus. Je früher sie behandelt wird, desto<br />
besser ist der Hcilungserfolg. Man kann im Kondensatorfeld behandeln oder mit<br />
der Schlinge (Tafel i). In späteren Stadien genügt die Lokalbehandlung gewöhnlich<br />
nicht mehr, sondern es muß milde Hyperthermie angewandt werden. Unterstützend<br />
kann man Salicyl, Atophanyl oder Gold geben.<br />
Wir behandeln im allgemeinen zunächst jeden 2. Tag. Die Temperatur wird im Lauf von<br />
30 Minuten auf 38—39 e (je nach Fall) gesteigert und noch 30 Minuten unterhalten, dann<br />
bleibt der Kranke 1 Stunde eingepackt liegen. Später brauchen wir nur 1-2 Sitzungen in<br />
der Woche. Gewöhnlich geben wir in 4-6 Wochen 12-20 Behandlungen. Man soll<br />
dann abbrechen und den Erfolg abwarten, da oft nach etwa 20 Durchflutungen eine gewisse<br />
Anpassung des Körpers an die UKW stattfindet, die Wirkung läßt nach. Nach einer<br />
kürzeren oder längeren Pause können wir dann wieder anfangen,<br />
Ruhigstcllung des Gelenkes ist, seit wir die KW-Bchandlung haben, ein Kunstfehler,<br />
der Kranke soll im Gegenteil immer bewegen.<br />
Der Muskelrheumatismus wird meist als allergische Reaktion auf irgendeine<br />
in den Körper eingedrungene Noxe betrachtet. In manchen Fällen spielen<br />
Infektherde eine Rolle, in einem großen Teil sind sie jedoch nicht nachweisbar,<br />
v. NEERGAARD sucht die Ursache im Katarrhvirus KRUSE-DOCHEZ. Dazu kommt<br />
eine hormonale Komponente. Jedenfalls ist anzunehmen, daß der eigentliche<br />
rheumatische Anfall durch Angiospasmen im Muskel mit gesteigerter Kapillardurchlässigkeit<br />
und Ernährungsstörungen hervorgerufen ist, was SCHLIEPHAKE<br />
und KAETHER schon früher wiederholt betont haben und durch Untersuchungen<br />
von RATSCHOW sowie durch arteriographische Aufnahmen von LEB später bestätigt<br />
worden ist. Jede Einwirkung, die die Kapillaren erweitert und den Spasmus löst,<br />
kann günstig auf den rheumatischen Anfall wirken, ohne allerdings dessen<br />
Ursachen zu beseitigen.<br />
So kommt es, daß manchmal rheumatische Anfälle schon durch 1 KW-Durchflutung<br />
beseitigt werden, dies ist aber nicht die Regel. Führt eine Serie von 10 bis<br />
12 Durchflutungen nicht zum Ziel, so ist die Behandlung zunächst aufzugeben<br />
und der Kranke nochmals genau auf Vorhandensein von Infektherden zu untersuchen,<br />
die sich auch in Nebenhöhlen der Nase, Prostata, Samcnblasen und Gallenwegen<br />
finden können. Diese sind dann entsprechend zu behandeln. Gegebenenfalls<br />
kann zur Diagnose auch die KW-Provokation (S.a^ßff.) herangezogen werden.<br />
Beim Muskclrhcumatismus ist Kombination mit anderen Mitteln von Vorteil; so<br />
haben wir recht gute Ergebnisse mit Forapin, Apicur oder Apicosan als intra-<br />
193
kutane Injektion oder Einreibung gesehen. Auch können selbstverständlich<br />
zwischen den Behandlungen Bäder und sonstige physikalische Anwendungen gegeben<br />
werden.<br />
Auf die tendoperioslitiscben Formen des Rheumatismus wirken die UKW-Durchflutungen<br />
meist ausgesprochen günstig, doch gibt es auch hartnäckige Erkrankungen<br />
dieser Gruppe. So muß man bei der Epicondylitis meist mit recht langen<br />
Behandlungszeiten rechnen. In dieses Gebiet gehört auch der sog. Calcaneus sporn,<br />
eine rheumatische Entzündung an den Sehnenansätzen des Os calcaneum. Die<br />
Beschwerden sind meist durch einige örtliche UKW-Behandlungen zu beheben.<br />
Die Coccygodynie, die sehr unangenehme Beschwerden macht, wird meist in<br />
kurzer Zeit beseitigt (ISLER). Weiterhin ist zur UKW-Behandlung geeignet die<br />
Beckenneuralgie, die allerdings nicht immer rheumatischen Ursprungs zu sein<br />
braucht. Wir nehmen dabei Dosis III, Beginn mit 5 Minuten Dauer, allmählich zu<br />
nehmend bis zu 15 Minuten bei 1 cm Elektroden-Haut-Abstand.<br />
Tendovaginitis verschiedener Genese ist ein dankbares Gebiet für die KW-<br />
Therapie, wir sahen sogar mehrmals Ganglien und Sebnenscheidenhygrome nach den<br />
Durchflutungen verschwinden.<br />
Die verschiedenen Formen von Nervenrbeumatismus werden im Kapitel Nervensystem<br />
abgehandelt.<br />
Bei der Behandlung aller rheumatischen Erkrankungen muß berücksichtigt<br />
werden, daß jeder Rheumatismus im Grunde eine AUgemeinkrankbeit ist, die sich<br />
nur an bestimmten Stellen vorzugsweise manifestiert. Die Allgemeinkrankheit<br />
kann latent oder erloschen sein, während an bestimmten Stellen noch ein Rest<br />
fixiert ist. Solche Fälle sind ein dankbares Gebiet für die örtliche KW-Therapie,<br />
während sonst immer auch entsprechende Allgcmeinbchandlung angezeigt ist, sei<br />
es durch Behandlung etwaiger Infekte, sei es mit Hyperthermie oder mit anderen<br />
Mitteln.<br />
Jeder Kranke bat seinen eigenen Rheumatismus! Jeder Kranke ist deshalb individuell %u<br />
bebandeln!<br />
Kasuistik<br />
Ludwig Z., 47 Jahre alt, Metallarbeiter. Seit 1 Jahr Schwellung des rechten Ellcnbogengclenkes<br />
und starke Schmerzen bei Bewegung. Zuerst mit Einreibungen behandelt, dann<br />
in einem Krankenhaus. Auf eine Röntgenaufnahme hin wurde Knochenhautentzündung<br />
angenommen. Behandlung mit Heißluft und Diathermie. Dabei dauernde Verschlimmerung<br />
des Befundes. Dann Einspritzungen, Heißluftbehandlung, Massage. Der Befund<br />
verschlimmerte sich aber immer weiter. Seit etwa 74 Jahr vollkommene Arbeitsunfähigkeit.<br />
Bei der Untersuchung am 26.6.34 war das rechte Ellenbogcngclenk stark teigig geschwollen.<br />
Druck auf den Gelenkspalt schmerzhaft. Starker Bewegungsschmerz, der<br />
Arm wird deshalb in der Binde getragen. Röntgenologisch o.B. UKW-Durchflutungcn<br />
mit Wellenlänge 6 m 4mal in etwa ytägigen Abständen: Völlige Bcschwcrdefrcihcit, der<br />
Kranke ist voll arbeitsfähig. Seither keine Klagen mehr.<br />
Friedrich K., Ischias. Seit Anfang 1931 Beginn der Erkrankung mit Schmerzen im<br />
linken Bein, Hinken und schiefer Körperhaltung. Es kam schließlich dazu, daß er in gebückter<br />
Haltung gehen mußte und sich nicht mehr aufrichten konnte. Es bildete sich eine<br />
starke Skoliose aus. Über 12 Diathermiesitzungen hatten keinen Erfolg. Dann 11 Wochen<br />
lang Krankenhausbchandlung mit Massage, Turnübungen, Stützkorsett und Einspritzungen<br />
in den Nerv. Zweimalige Streckung in Narkose. Vor z Jahren mehrwöchige Kur in<br />
Wiesbaden. Vor 1 Jahr Moorbäder in Bad Nauheim. Die Beschwerden haben sich aber<br />
dauernd verschlechtert, so daß der Kranke schließlich Invalidisierung beantragen wollte.<br />
Die Beschwerden waren im Dezember 1933 so, daß K. das Zimmer nicht mehr verließ, da<br />
er nicht mehr die Treppe hinuntersteigen und sich nicht mehr selbst anziehen konnte.<br />
194
Bei der Untersuchung im Dezember 1933 saß der Kranke zusammengekrümmt in einem<br />
Stuhl, von dem er sich nicht ohne Hilfe erheben konnte. Gang nur in gebückter Haltung<br />
möglich. Lascguc links stark positiv. Patellarreflex links erheblich abgeschwächt. Umfang<br />
des linken Beines (Wadenmitte) i l f2 cm geringer als des rechten.<br />
Stationäre Behandlung mit, Elektropyrexie. Nach 12 Durchflutungen erhebliche Besserung,<br />
wieder aufrechter Gang. Nach 3 Wochen kann der Kranke entlassen werden und<br />
nach 4 Wochen wieder seinen Dienst aufnehmen. Ambulante Weiterbehandlung. Jetzt<br />
seit 15 Jahren beschwerdefrei.<br />
Clara S., 36 Jahre, Ischias. Seit 8 Wochen Schmerzen am linken Bein, die so stark sind,<br />
daß die Kranke nicht mehr aufrecht gehen kann und das Bett hüten muß. Behandlung in<br />
einem Krankenhaus mit Einspritzungen, Diathermie, Packungen. Die Erkrankung hat<br />
sich aber nur verschlimmert.<br />
Bei der Untersuchung am 16. j. 34 ist der Lascguc im linken Bein stark positiv. Bücken<br />
unmöglich. Die Patellar- und Achülesreflexc sind am linken Bein erheblich herabgesetzt.<br />
Nach viermaliger Elektropyrexie kann die Kranke wieder am Stock gehen und kann<br />
wieder sitzen. Nach 8 Tagen ist Gehen ohne Stock möglich. Nach 12 Tagen wird die<br />
Kranke beschwerdefrei entlassen.<br />
Wilhelm Pf., 35 Jahre, kam am 24.4.34 in Behandlung. Diagnose: Spondylarthritis<br />
ankylopoetiea. Vor 3 Jahren Beginn mit Schmerzen im unteren Teil des Rückens, besonders<br />
beim Gehen. Die Schmerzen nahmen allmählich zu, und es stellte sich eine von unten nach<br />
oben fortschreitende Versteifung ein. Heute kann der Kranke den Rücken überhaupt<br />
nicht mehr krumm machen. Er kann nicht mit dem Kopf nicken und keine Drehbewegungen<br />
ausführen. Seit 3 /4 Jahr kann er seinem Beruf als Schuster nicht mehr nachgehen.<br />
Vor 1 Jahr wurden die Mandeln ausgeschält, ohne Erfolg.<br />
Bei der Untersuchung wird die Wirbelsäule völlig steif gehalten, Klopfschmcrz geringen<br />
Grades in Mitte Brustwirbelsäule. Der Kopf kann nur um etwa 1 cm rechts und<br />
links bewegt werden. Röntgenologisch sind die Wirbel eng aneinandergezogen, die Wirbclkörper<br />
sind kalkarm. An den Rändern kommt es fast zur Berührung der WirbclkÖrpcr,<br />
die Kanten sind auffallend scharf.<br />
Behandlung mit Elektropyrexie ambulant, zweimal wöchentlich. Vor jeder Behandlung<br />
10 cem Atophanyl intravenös. Schon nach 3 Wockcn Erleichterung der Schmerzen.<br />
Der Kopf kann wieder etwas bewegt werden. Nach etwa VJährigcr Weiterbehandlung<br />
kann der Kopf wieder gebeugt und gedreht werden, bis um etwa 45 o nach beiden<br />
Seiten. Die Brustwirbelsäule ist wieder etwas beweglich. Eine volle Beweglichkeit kann<br />
natürlich bei dem schweren Befund nicht mehr erzielt werden, aber der Kranke kann jetzt<br />
doch seinem Beruf wieder nachgehen und braucht nicht invalidisiert zu werden.<br />
Frau K. Be., 63 Jahre. Arthritis im linken Hüftgelenk. Seit etwa 15 Jahren Hüftschmerzen,<br />
die zunächst mit Unterbrechungen auftraten, jetzt seit 5-6 Jahren ununterbrochen<br />
bestehen. Schlaflosigkeit, da bei jeder geringsten Bewegung im Bett Schmerzen auftreten.<br />
Behandlung bei verschiedenen Ärzten und in Badeorten.<br />
Untersuchung am 26.6.34: Hinkender Gang. Skoliose. Krampfadern an beiden<br />
Beinen. Gynäkologischer Befund o. B. Lasèguc negativ. Im Unken Hüftgelenk Schmerzen<br />
bei Bewegung, besonders bei Rotation, sowie starker Stauchungsschmerz. Etwas<br />
Druckschmerz links vom Kreuzbein und in der Umgebung des Foramen ischiadicum.<br />
Röntgenologisch verengerter Gclcnkspalt des linken Hüftgelenkes. Am Pfannenrand<br />
beiderseits deutliche Auszichungcn nach oben und unten. Rechts oben am Pfannenrand<br />
Kalkvcrarmung.<br />
Nach 4 Ganzdurchflutungen bedeutende Besserung der Beschwerden. Noch hinkender<br />
Gang, aber keine so starken Schmerzen mehr. Nach 8 Durchflutungen weitere Besserung.<br />
Kann jetzt ohne Stock gehen. Im ganzen 16 Durchflutungen im Lauf von 10 Wochen.<br />
Weitere Besserung. Danach Aussetzung der Behandlungen, Nach 4 Wochen Wiedervorstcllung.<br />
Die Kranke kann jetzt größere Gänge machen, fühlt sich wohl, außer einer<br />
leichten Steifheit in der Hüfte bestehen keine Beschwerden mehr.<br />
All., 37jahre. Hüftgelenksentzündung. Seit etwa 4 Wochen dauernde Schmerzen im<br />
Rücken, die nach Erkältungen stärker werden und seit 6 Wochen unaufhörlich bestehen,<br />
J 95
auch nachts im Bett. Umdrehen im Bett schmerzhaft. Behandlung bei verschiedenen<br />
Ärzten mit Analgit, Katzenfell, Pillen. Früher häufige Halsentzündungen, die nach Entfernung<br />
von 2 Zahngranu lomen aufhören. Auch Kur in Badeort war erfolglos.<br />
Bei der Untersuchung am 6.11.33 " £ 1 die schiefe Haltung beim Gehen auf. Das linke<br />
Bein wurde geschont. Rotation im linken Hüftgelenk sehr, schmerzhaft, Stauchschmerz<br />
in der Hüfte. Röntgenologisch erscheint der linke Hüftgelenkspalt etwas verengert und<br />
in den Umrissen verwaschen. Oben und unten an der Pfanne Randaus Ziehungen. Blutkörpersenkung<br />
in 1 Stunde 6 mm, in 2 Stunden 12 mm.<br />
Behandlung abwechselnd mit Hlcktropyrexic und lokaler Durchflutung des Hüftgelenks.<br />
Schon nach 10 Tagen fast beschwerdefrei. Gerader, aufrechter Gang. Nach<br />
3 Wochen keine Beschwerden mehr. 2 Monate später läuft der Kranke Schi. Seitdem<br />
weiter bcschwerdcfrci.<br />
Bei Arthritis sicca kann von einer völligen Restitutio ad integrum wohl nur<br />
selten gesprochen werden, da meist doch schon tiefgehende Veränderungen der<br />
Gelenkknorpcl oder der Knochenenden bestehen; eine Beseitigung der osteophytischen<br />
Auflagerungen bei der Arthritis deformans dürfte kaum im Bereich der<br />
Wahrscheinlichkeit liegen.<br />
Bei fast sämtlichen Kranken, bei denen die Allgemcininfcktion zum Stillstand<br />
gekommen war, konnten weitgehende Besserungen erzielt werden; bei einigen<br />
wurde die seit Jahren darniederliegende Arbeitskraft so weit wiederhergestellt, daß<br />
sie ihrem Beruf ohne wesentliche Beschwerden wieder nachgehen konnten. Auch<br />
von PFLOMM sind zahlreiche Arthritiden mit KW mit durchgehend guten Erfolgen<br />
behandelt worden; J.WILSON berichtet über günstige Erfolge bei Osteoarthritis<br />
und Arthritis der Hüftgelenke bei lokaler Behandlung. RAAB, DAUSSET, V. TEU-<br />
BERN berichten über ausgezeichnete Erfolge, ebenso KOEPPEN an sehr großem<br />
Material.<br />
9. Gonorrhoe<br />
Die Angaben über Ergebnisse mit örtlicher Behandlung wechseln stark. Manchmal<br />
sind die Erfolge überraschend, manchmal sind keine Wirkungen zu verzeichnen.<br />
Während GUMPERT gute Erfolge sah, hat NAGELL nichts gesehen. Es müßte<br />
noch untersucht werden, welche Rolle Dosis und Wellenlänge spielen.<br />
Die maximale Hyperthermie ist, besonders in USA, auch zur Behandlung der<br />
Gonorrhoe verwandt worden. Nach MANN konnte bisher die Gonorrhoe mit<br />
Fieberbehandlung in 90% geheilt werden.<br />
Nach der Einführung der Bacteriostatica in die Therapie schien es, als ob alle anderen<br />
Behandlungsweisen dadurch verdrängt würden. Nach den genannten Autoren betragen<br />
aber die HcilungszifFcrn durchschnittlich nur 75 %.Bci den etwa 25 % Kranken, die gegen<br />
Sulfonamide resistent waren, konnten noch 90 % Heilungen erzielt werden, wenn Hypcrthermiesitzungen<br />
von 39,5-40° und 6 Stunden Dauer angewandt wurden. Vor den<br />
Sitzungen werden 6,6 g Sulfonamid gegeben.<br />
Ähnliche Erfolge geben BELT und FOLKENDERG an, die Hyperthermiesitzungcn<br />
von 10 Stunden Dauer bei 41,5° anwandten. Nach ihren Angaben wurden dabei<br />
42 von 49 Kranken mit Gonorrhoe-Komplikationen geheilt. Wie sich die Ergebnisse<br />
der Penicillin-Behandlung in Kombination mit KW-Therapie stellen werden,<br />
bleibt abzuwarten.<br />
Die Wirkung auf sekundäre gonorrhoische Infektionen zeigen folgende Fälle:<br />
Der 23jährige K. war vor einem Jahr an Gonorrhoe erkrankt, und es hatten sich im<br />
Anschluß daran paraurethrale Abszesse und Gänge gebildet, die außerordentlich hart-<br />
196
nackig waren und schon nach n Monaten jeder Behandlung in der Hautklinik Jena<br />
widerstanden hatten. Gonokokken waren im Abstrich immer nachweisbar geblieben. Der<br />
Kranke wurde im Kondensatorfeld so behandelt, daß der Penis zwischen 2 Kondensatorplatten<br />
von 10 cm Durchmesser eingeklemmt wurde. Bei einer Behandlungsdaucr von<br />
täglich 30 Minuten waren die Fisteln innerhalb von 14 Tagen verschwunden. Nach<br />
4 Wochen konnte der Kranke als geheilt und arbeitsfähig entlassen werden. Der Abstrich<br />
enthielt keine Gonokokken mehr.<br />
Beim 23jährigen J.W. war die Infektion vor j Wochen erfolgt; die paraurcthralen<br />
Abszesse und Fisteln waren sehr ausgedehnt und schwer. In 4wöchiger KW-Behandlung<br />
gelang es, die Gänge und Abszesse vollkommen zu beseitigen, doch waren noch Gonokokken<br />
nachweisbar. Deshalb wurde mit lokaler Behandlung begonnen, Auffallender-<br />
Abb. 145 : Behandelte gonorrhoische Arthritis (nach PFLOMM)<br />
weise war die Gonorrhoe nach zweimaliger Protargolcinspritzung mit nachfolgender<br />
KW-Behandlung verschwunden, der Kokkenbefund war negativ, so daß der Kranke als<br />
geheilt entlassen werden konnte. Wir hatten hier den entschiedenen Hindruck, als obdas<br />
vorher für sich allein unwirksame Protargol sensibilisierend für die KW-Behandlung<br />
gewirkt hätte, Ein 3., seit 4 Monaten erkrankter Patient konnte allerdings nur teilweise<br />
gebessert werden.<br />
Bei Gonokokkcncpididymitis und Orchitis tritt meist schon nach 2-3 Durchflutungen<br />
mit schwacher Dosis Schmerzfreiheit ein. Die Schwellung geht unter<br />
weiterer Behandlung allmählich zurück, und man kann mit Heilung nach 14 Tagen<br />
bis 3 Wochen rechnen.<br />
Von weiblicher Gonorrhoe mit Pyosalpinx wurden von uns nur 3 Fälle behandelt. Das<br />
Ergebnis war zweifelhaft. Bei der einen Kranken wurden nach etwa 10 Behandlungen<br />
keine Gonokokken mehr gefunden; bei der anderen war der Befund vorübergehend<br />
negativ, wurde aber dann wieder positiv. Die entzündlichen Tumoren gingen bei beiden<br />
zurück, doch muß man in Betracht ziehen, daß an sich schon bei diesen Erkrankungen<br />
der Tastbefund außerordentlich wechselnd sein kann.<br />
197
Diese letzteren Fälle werden hier auch nur der Vollständigkeit halber erwähnt,<br />
zumal das weitere Beschreiten dieses Weges immerhin aussichtsreich erscheint.<br />
Günstig sind die Ergebnisse bei gonorrhoischen Artbritiden, die oft innerhalb<br />
weniger Tage ausgeheilt waren. Meine eigenen Erfahrungen auf diesem Gebiet<br />
sind nicht groß; dagegen berichtet PFLOMM über mehrere Fälle, bei denen z.T.<br />
sogar die veränderte Knochenstruktur im Röntgenbild wieder normal geworden<br />
ist (Abb. 145). Hier sei nur ein von mir behandelter Fall angeführt.<br />
Stci., Siegfried, 23 Jahre. Gonorrhoische Arthritis des linken Knies. 1929 Gonorrhoe,<br />
danach Arthritis im linken Knie und ¡m Großzehengrundgelenk sowie rechten Handgelenk.<br />
1930 nochmals Gonorrhoe, angeblich ohne neue Infektion.<br />
1932 im Februar wieder Ausfluß. Im August 1932 in stationärer Krankcnhausbchandlung<br />
wegen rechtsseitiger Pyelitis. Seit 6.10. 32 Schmerzen und Anschwellung im linken<br />
Knie und Interphalangcalgclenk der großen Zehe.<br />
Patient wurde bereits mit Röntgentiefenthcrapie (fünfmal) sowie mit Lichtkasten behandelt,<br />
ohne Erfolg.<br />
Befund am 24.10.32 : Inguinaldrüsen etwas vergrößert, nicht schmerzhaft. Ausfluß aus<br />
der Urethra. Linkes Kniegelenk geschwollen, großer Erguß in der linken Bursa praepatcllaris.<br />
Linkes Großzeheninterphalangcalgelenk und rechtes Handgelenk gerötet und<br />
geschwollen, aber ubeweglich.<br />
25.10. 32. Beginn der UKW-Behandlung (nebenbei weiter Lichtbügel). 27.10. wesentliche<br />
Besserung der Beschwerden. Alle Behandlungen außer UKW sind eingestellt.<br />
29. io. 32 beschwerdefrei aus dem Krankenhaus entlassen. Gesamtzahl der Durchflutungen:<br />
4.<br />
BADAINES und BERNARD sahen gute Erfolge bei gonorrhoischen Arthritiden.<br />
Ebenso berichten GRAF sowie NAGFXL über gute Erfolge. Die Schmerzcmpfiridlichkeit<br />
geht oft schon nach 2-3 Sitzungen zurück, was bei dieser äußerst<br />
schmerzhaften Erkrankung schon einen großen Gewinn bedeutet; auch die Zeit<br />
der objektiven Heilung wird stark verkürzt. Allerdings ist die Zahl der behandelten<br />
Kranken noch nicht groß genug, um ein allgemein gültiges Urteil fällen zu können.<br />
10. Verdauungsapparat<br />
Die Wirkungen der UKW auf den normalen Magen untersuchte BAUER. Er<br />
fand mit pneumatischer Übertragung der Bewegungen und vor dem Röntgenschirm<br />
Zunahme der Peristaltik und der Säureproduktion, während heiße Aufschläge<br />
auf den Bauch das Gegenteil bewirkten.<br />
JORDAN kommt zu ähnlichen Ergebnissen. LESKOVAR machte Druckmessungen<br />
im Magen, an der Gallenblase und am Sphincter Oddi. Danach wird durch kurze<br />
UKW-Einwirkung der Tonus des Magens erhöht, der Druck in der Gallenblase<br />
steigt in Perioden von 3 zu 3 Minuten, der Tonus des Sphincter Oddi wird nach<br />
kurzem Anstieg herabgesetzt. Gewöhnliche Wärme hat mehr allgemein beruhigende<br />
Wirkung, während UKW die Austreibung aus den Gallenwcgen anregen.<br />
Nach MCLOUGHLIN, MANN und KRUSEN nimmt die Häufigkeit der Darmkontraktionen<br />
ebenso zu wie bei gewöhnlicher Erwärmung, vor dem Röntgenschirm<br />
war jedoch kein Einfluß zu beobachten.<br />
PERONA und ROSETTO beobachteten den Zerfall von mit Bariumbrei gefüllten<br />
Röhrchen im Magen; er erfolgte unter UKW-Einfluß wesentlich schneller als<br />
sonst.<br />
198
Beim frischen Ulcus ventriculi halten wir die KW-Therapie für nicht angezeigt,<br />
da durch die Hyperämie die Blutungsgefahr größer werden kann. Dagegen werden<br />
beim älteren Ulcus, besonders beim Ulcus callosum, die Beschwerden gut beeinflußt,<br />
auch haben wir den Eindruck besserer Heilungstcnden2.<br />
Wir pflegen das frische Ulcus mit Injektionen von Milzextrakt (Prosplcn) zu<br />
behandeln, erst von der 3. Woche an geben wir vorsichtige UKW-Durchflutungen.<br />
Ausgesprochen angenehm wirkt UKW-Behandlung bei Gastritis; Druckgefühl<br />
und Beschwerden pflegen zu verschwinden.<br />
Akute und chronische Cholecystitis bilden ein wichtiges Anwendungsgebiet für<br />
die KW-Therapie. WOLF hat bei akuten und subakuten Fällen aus dem Eppcndorfer<br />
Krankenhaus in Hamburg ausgezeichnete Erfolge berichtet.<br />
Bei Cholezystitis und Cholangitis auch mit Ikterus wurden so gut wie immer<br />
rasche Besserung, Rückgang der Temperatur und Beseitigung der Beschwerden<br />
erzielt. Auch bei chronischer Cholezystitis sind die Ergebnisse durchweg gut.<br />
Man kann cholezystitischc Beschwerden besonders im Anfang durch kurzzeitige<br />
Durchflutungen kupieren.<br />
Pankreatitis wird ausgezeichnet beeinflußt.<br />
Die eine Elektrode von etwa 10 cm Durchmesser wird auf die Gegend der Gallenblase<br />
mit 3-4 cm Abstand aufgelegt, die andere auf die rechte Rückcnsckc in 5-7 cm. Man<br />
kann hinten eine größere Elektrode nehmen. Dauer 5-10 Minuten, Dosis II.<br />
Bei Erkrankungen des Darmes kommt die KW-Therapie gelegentlich in Frage.<br />
Appendizitis kann durch KW-Durchflutung zum Aufflackern gebracht werden;<br />
selbst nach Durchflutungen von 3-5 Minuten Dauer wird oft schon Zunahme der<br />
Beschwerden angegeben (S. 257). Bei chronischer Appenzitidis wirkt KW-Therapie<br />
in vorsichtiger Dosis oft günstig, ebenso bei entzündlichen Beschwerden in<br />
alten Operationsnarben.<br />
Bei Colitis ulcerosa werden die Beschwerden durch KW-Durchflutungen in<br />
sehr starker Dosis manchmal gut beeinflußt; ausgesprochene Besserungen des objektiven,<br />
rektoskopischen und röntgenologischen Befundes werden nicht immer<br />
erzielt. Dagegen sind die Wirkungen bei nicht ulzeröser Colitis ausgesprochen<br />
günstig. Das gleiche gilt für die Cólica mucosa, die wie alle allergischen Erscheinungen<br />
gut reagiert. Die Wirkung des Chloromycctins kommt unter KW-Einfluß<br />
besser zur Geltung.<br />
Die UKW wirken antispasmodiscb auf den Dünn- und Dickdarm, obwohl man<br />
auf Grund der Histaminproduktion das Gegenteil erwarten sollte.<br />
RENSHAW sah günstige Wirkungen beim «reizbaren Kolon», d. h. verschiedenen<br />
mit Spasmen einhergehenden Zuständen, spastischer Obstipation, Colitis membranácea<br />
und «nervösen» Bauchbeschwerden. Die allgemein krampflösende Wirkung<br />
der UKW ist auch hier deutlich nachweisbar.<br />
Bei spastischer Obstipation lassen sich daher oft schöne Wirkungen erzielen. Man<br />
durchflutet mit Dosis I-II zunächst täglich, später 2-3tnal in der Woche, 5 Minuten<br />
lang. Abwechselnd damit empfiehlt sich Elektrisieren mit Exponcntialströmen.<br />
Sehr günstig sind ferner die Wirkungen bei entzündlichen und citrigen Prozessen<br />
in der Umgebung der Därme, so bei Periproktitis. Beschwerden bei Hämorrhoiden,<br />
die durch entzündliche Reizung verursacht sind, werden ausgezeichnet<br />
beeinflußt. Bei Analfissuren lassen sich oft schöne Besserungen und Heilungen<br />
herbeiführen, wenn die Behandlung lange genug fortgesetzt wird.<br />
Nach LOB kann eitrige Peritonitis durch UKW geheilt werden, und zwar durch<br />
199
langzeitige Durchflutungen von 4-6 Stunden Dauer mit schwacher bis mittlerer<br />
Dosis.<br />
Die tuberkulöse Peritonitis wird gut beeinflußt. Die Erfolge bei der exsudativserösen<br />
und adhäsiv-fibrösen Form sind mindestens die gleichen wie mit Röntgenbestrahlung.<br />
Man nimmt große Platten, Abstand vorn 4, hinten 6 cm, schwache Dosis, im Anfang<br />
3, später bis zu 15 Minuten bei täglicher Anwcngung.<br />
Ausgezeichnet ist ferner die Wirkung bei Beschwerden durch peritoneale Adhäsionen<br />
nach Operationen oder Unfällen. Sic werden fast immer durch einige Behandlungen<br />
für längere Zeit beseitigt (Abstand vorn 2-4, hinten 6-8 cm, Dosis II<br />
bis III, 10-ii Minuten).<br />
Ein dankbares Gebiet sind Lebererkrankungen verschiedener Art. 2 Fälle von<br />
chronischer diffuser Hepatitis seien hier angeführt. Der eine ging mit Fieber einher,<br />
das seit einem Jahr zweimal in der Woche bis zur Höhe von 39-59,5° auftrat. Nach<br />
3wöchigcr UKW-Behandlung war der Kranke fieberfrei. Nach etwa l j2 Jahr trat<br />
wieder eine Attacke auf, die durch 6 UKW-Behandlungen beseitigt wurde. Der<br />
Kranke, der vorher völlig aufgegeben war, konnte danach wieder seinem Beruf<br />
nachgehen. Eine 52jährige Frau litt schon seit etwa 2 Jahren an starkem Ikterus<br />
und Abmagerung. Die Stühle waren acholisch. Nach 6 UKW-Behandlungen mit<br />
6 m Wellenlänge nahm der Stuhl normale Farbe an, der Ikterus ging fast völlig<br />
zurück, die Leber wurde kleiner. Nach 1 /i Jahr traten die früheren Beschwerden<br />
wieder auf. Bei erneuter Behandlung trat Besserung mit Verschwinden des Ikterus<br />
und Braunfärbung des Stuhlganges ein. Bei Leberzirrhose berichtet RÉCHOU über<br />
gute Erfolge. Bei Hepatitis epidemica wird die Heilung beschleunigt. Man durchflutet<br />
die Lebergegend 3 bis 5 Minuten lang mit Dosis II. Das Spannungsgefühl<br />
geht schnell zurück, und das Allgemeinbefinden bessert sich nach wenigen Tagen.<br />
Ich habe den Eindruck, daß die Heilung in kürzerer Zeit erfolgt als sonst.<br />
Gynäkologische Erkrankungen<br />
RAAB ist wohl der erste gewesen, der sich, durch Erfahrungen des Verfassers<br />
angeregt, mit der KW-Therapie von Adncxerkrankungen befaßt hat. Er hat auch<br />
durch besondere Thermometer eine bedeutende Tiefenerwärmung im Inneren des<br />
Uterus festgestellt. Die gynäkologische KW-Therapie bietet besondere Schwierigkeiten,<br />
die auf den anatomischen Lageverhältnissen beruhen. Die Adnexe liegen<br />
zwischen den großen Fett- und Knochenmassen des Beckens und unmittelbar neben<br />
den besonders empfindlichen Därmen. So kann in Anbetracht der Kleinheit der<br />
Organe nur ein kleiner Teil der Energie (eine kleine Raumdosis) zur Auswirkung<br />
kommen. Rasche und leichte Erfolge waren also hier von vornherein nicht zu<br />
erwarten; es steht aber Zu hoffen, daß die Weiterentwicklung der Technik uns noch<br />
weiterbringen wird.<br />
Die in der Vagina z.T. ganz unterschiedlichen Temperaturen erklären sich durch<br />
Wärmestauung, die im Becken bei zu hohen Dosen entsteht. Dabei kann auch die<br />
Körpertemperatur im ganzen steigen. Bei gefüllter Blase erwärmt sich der Urin<br />
stärker als die umliegenden Organe und Gewebe, wie Messungen ergaben. Eine<br />
wesentliche Rolle spielt dabei die mangelnde Fähigkeit der Schleimhäute zur Ableitung<br />
der Wärme. Bei Zystoskopic beobachtet man hochgradige Hyperämie der<br />
200
Schleimhaut und stark gefüllte Blutgefäße. Die Blase muß deshalb vor der Behandlung<br />
entleert werden.<br />
Auch andere Flüssigkeitsansammlungcn im Becken, wie Zysten und Abszesse,<br />
erwärmen sich besonders stark.<br />
Nach RAAB, SIEDENTOPF, RAUSCHER, WINTZ, KORB, RUNGE u. a. hat sich das<br />
Kon densa torfei d zur gynäkologischen Behandlung ausgezeichnet bewährt. Es besteht<br />
kein Bedürfnis, durch andere Methoden unkontrollierbare überhohe Erwärmungen<br />
in der Tiefe zu erzeugen.<br />
Dies gilt z.B. für die von KOWARSCHIK propagierte Ringfcldméthode und für die eingeführte<br />
Vaginalclektrodc. Durch die Vagmalelektrode können Verdichtungen der Energie<br />
in der Scheide entstehen, die mehr als das 35fache der Hanterwärmung hervorrufen.<br />
Ungeeignet sind Spulcnfeld (RAAB, KORB), unipolare Vaginalclcktrodcn und Flachspulen.<br />
Abb. 146: Behandlung der Unterleibsorgane<br />
Die Lage der Elektroden ist wichtig. Eine ventrale Elektrode soll nach unten das<br />
Schambein noch überdecken. Die dorsale Elektrode soll über das Steißbein hinausragen.<br />
Bei Anwendung von Elektroden von 15-25 cm Durchmesser genügt meist ein Luftabstand<br />
von 2-; cm zur Applikation therapeutischer Dosen. Besser ist die Tiefenwirkung<br />
bei 3-j cm Abstand, wobei aber '/3 m chr an Energie benötigt wird.<br />
Besser ist es (nach KORB), die Patientin auf dem Behandlungstisch mit gebeugtem<br />
Hüftgelenk zu lagern und die Elektroden über dem Kreuzbein und unter dem Gesäß<br />
anzubringen. Hierbei werden die Elektroden nicht durch die Bauchatmung verschoben;<br />
der Energieverbrauch ist größer.<br />
Bei entzündlichen Adnextumorcn wird nach Qucrdurchflutung des Abdomens<br />
ein Rückgang der Beschwerden nach 6-8 Behandlungen erreicht. Der Tastbefund<br />
bildet sich jedoch erst später zurück; dies ist nicht anders zu erwarten, da es sich<br />
um schwartige und wenig durchblutete Massen handelt, die nicht so rasch resorbiert<br />
werden können. Immerhin ist es schon als ein Erfolg zu buchen, daß oft<br />
201
moríate- und jahrealtc Beschwerden beseitigt werden und die Frauen sich subjektiv<br />
wohler fühlen.<br />
Die Erfolge der KW-Thcrapic in der Gynäkologie erstrecken sich nicht etwa nur<br />
auf chronische Prozesse, sondern gerade akute entzündliche Erkrankungen, auch<br />
auf gonorrhoischer Grundlage, werden rasch und in für die Kranken angenehmer<br />
Weise der Heilung zugeführt.<br />
Dosierung und Indikationsstcllung erfordern hier besondere Erfahrung und<br />
Beobachtung. Es hat sich gezeigt, daß Mißerfolge nicht im Verfahren liegen, sondern<br />
in den meisten Fällen daran, daß überhaupt keine Indikation zur KW-Thcrapic<br />
bestanden hatte oder daß falsch dosiert worden und mit Apparaten ungenügender<br />
Leistung behandelt worden war. Die KW-Therapic vermag trotzdem weit<br />
mehr zu leisten als andere konservative Verfahren, einschließlich der Diathermie.<br />
Ihr großer Erfolg liegt in der Dauerheilung, auch in Fällen, in denen andere<br />
nicht operative Therapie scheiterte (RAAB).<br />
Die Menses werden nach RAAB nicht verstärkt, man braucht in dieser Zeit die<br />
Behandlung nicht zu unterbrechen (im Gegensatz zu KOWARSCHIK).<br />
Kontraindikation besteht bei Adncxtuberkulose, wie BRUNO bei künstlich infizierten<br />
Mäusen und RAAB, GESENTUS, SCHUMACHER beim Menschen feststellten. Der<br />
Prozeß bleibt unbeeinflußt oder verschlechtert sich sogar. STOECKEL glaubt diese<br />
Verschlechterung diagnostisch für Tbc verwerten zu können. Wahrscheinlich<br />
spielen hier Dosierungsfragen mit, denn wir wissen, daß tuberkulöse Erkrankungen<br />
nur mit schwächsten Dosen behandelt werden dürfen.<br />
Bei den Entzündungen an den Adnexen spielt die Genese keine wesentliche<br />
Rolle für die Indikation zur KW-Therapie*.<br />
Für die Dosierung gelten die allgemeinen Regeln: Im akuten Stadium schwache<br />
Energie. Im Gegensatz zu RAUSCHER wartet RAAB im allerersten Stadium der Entzündung<br />
3-5 Tage ab und sieht danach eine absolute Indikation für die Behandlung,<br />
ohne Rücksicht auf das Fieber.<br />
Man beginnt bei ganz frischen Prozessen mit schwachen, bei etwas älteren Erkrankungen<br />
mit mittleren Dosen bei ;-i 5 Minuten Dauer. Nach längstens 4 Tagen<br />
fällt das Fieber ab, die subjektiven Beschwerden verschwinden schon nach 1 bis<br />
2 Tagen. Die Schwellung geht nach 1-2 Wochen zurück. Man gibt höchstens<br />
20 Durchflutungen, meist ist danach nur noch eine strangförmige Narbe oder in<br />
sehr schweren Fällen ein fingerdicker Resttumor zu fühlen.<br />
Im subakuten Stadium (Fieber bis j8° und Schmerzen) wird mit mittelstarken<br />
Dosen behandelt.<br />
Wenn der Erfolg nicht in dieser Weise eintritt, ist meist falsch dosiert worden,<br />
oder es sind Komplikationen (p'aramctraner Abszeß) hinzugetreten.<br />
PROUST, MoRicARD und PuLSFORD berichten über geheilte Fälle von entzündlichen<br />
Adnextumoren, bei denen vorhergegangene Langwellen-Diathermie keinerlei<br />
Wirkung gehabt hatte.<br />
Nach STAEHLER scheint die Wellenlänge wichtig zu sein, denn er konnte mit<br />
sehr kurzen Wellen von 4-6 m Länge bessere Erfolge erzielen als mit längeren<br />
Wellen. Die Bedeutung der Apparatetypen und der Wellenlänge geht besonders<br />
aus der Veröffentlichung von SIEDENTOPF aus der Leipziger Universitäts-Frauenklinik<br />
hervor.<br />
* VAERNET, SAVONA und CIULA, SIEC;BURG, KÖVESLIGETHY, SOVASAKI, FÖDERL, WINTZ,<br />
LORBE, RAUSCHER, RAAB, LIÈVRE und AISENBF.RG.<br />
202
Hier wurde zunächst ein kleinerer Apparat benutzt, wobei unter 32 behandelten Fällen<br />
nur z Besserungen erzielt wurden. Ehe die Autoren auf Grund dieser Erfahrungen die<br />
KW-Therapic für die Gynäkologie völlig verwarfen, machten sie noch einen Versuch mit<br />
einem leistungsfähigen Röhrenapparat. Der Erfolg war der, daß jetzt bei 32 Kranken nur<br />
noch 2 Versager zu verzeichnen waren, und zwar bei einer alten doppelseitigen Parametritis<br />
mit Adncxschwellung und bei einer chronischen Adnexschwcllung mit Adhäsionen<br />
nach Peritonitis und Laparotomie. Bei allen anderen, auch chronischen Erkrankungen,<br />
wurden subjektive Beschwerden und Tastbefund gebessert. Besonders gut reagierten<br />
ganz akute, hoch fieberhafte Fälle von Adnexcntziindungcn.<br />
Gut scheinen gonorrhoische Pyosalpingen anzusprechen, die schmerzunempfindlich<br />
werden und sich im Tastbefund manchmal völlig zurückbildcn. Außer geringfügigen,<br />
mit Fieber einhergehenden Reaktionen wurden Nachteile nie beobachtet.<br />
Nicht genug betont werden kann, daß solche Behandlungen nur von KW-<br />
Thcrapcutcn, die über langjährige Erfahrung verfügen, in enger Verbindung mit<br />
mit Gynäkologen ausgeführt werden sollten.<br />
Bei Rezidiven nach mehreren akuten Schüben sind die Erfolge nicht immer so<br />
gut. Bei der Operation zeigt sich dann meist eine chronische Adnexitis.<br />
Bei den erfolglos behandelten Fällen wurden bei der Laparotomie meist Verwachsungen<br />
der Adnexe mit der Umgebung oder gleichzeitig chronisch induriertc<br />
Tuben mit z.T. knorpelharten Wandungen gefunden. Bei den letzteren kann der<br />
sterile alte Eiter nicht resorbiert werden, da die Wände nicht kollabieren.<br />
56% der chronischen Adnexitiden wurden nach RAAB total geheilt und blieben<br />
Jahre hindurch rezidivfrei. In 38% trat nur Besserung ein, wie sie mit anderen<br />
konservativen Verfahren auch zu erzielen gewesen wäre. Aber auch viele als<br />
aussichtslos geltende chronische Fälle können mit UKW geheilt werden, auch<br />
wenn sie vorher gegen Medikamente, Wärme und Elektrotherapie resistent gewesen<br />
waren.<br />
Die Prognose ist schwer zu stellen, da der Heilerfolg von der Art der pathologischanatomischen<br />
Veränderungen an den Adnexen selbst und deren Umgebung abhängt.<br />
Bei mehreren als chronische Adnexitis diagnostizierten Fällen, die auf UKW<br />
nicht reagierten, stellte sich nachträglich heraus, daß Ovarial- oder Tubovarialzysten<br />
vorlagen (RAAB).<br />
Ovarial- und Tubovarialzystcn wurden von RAAB versuchsweise durchflutet.<br />
Schon nach einer Behandlung traten starke Reaktionen mit heftigen Schmerzen<br />
auf, die am nächsten Tag wieder verschwunden waren. Sie erklären sich aus der<br />
erhöhten Erwärmung im Zysteninhalt bei mangelnder Kühlung durch das Blut.<br />
Die Schmerzen entstehen durch vermehrte Wandspannung.<br />
Bei einer entzündlichen Zyste sah RAAB rasche Vergrößerung und Temperaturerhöhung<br />
nach KW-Therapie. Diesem Verhalten kommt diagnostische Bedeutung<br />
zu.<br />
Bei Parametritis berichten VAERNET, LIÈVRE, AISENBERG, RAAB übereinstimmend<br />
gute Erfolge, ebenso wie FRANCILLON-LOBRE, WILSON u.a. Die Parametritis, im<br />
engeren Sinne der lymphangitischen Form eines Infektes (nach Abort, Abrasio,<br />
Geburt) zeigt bei KW-Therapie 2 typische Verlaufsformen. Entweder wird das<br />
entzündliche Infiltrat nach Rückgang der Schmerzen und des Fiebers schnell<br />
resorbiert (oft nach 2-3 Behandlungen), oder es kommt zu Abszedierung und<br />
Einschmclzung. Liegt der Prozeß oberflächlich, so erfolgt spontaner Durchbruch.<br />
Tiefer gelegene Abszesse machen gründliche Drainage nötig. Sic ist nach anfänglicher<br />
KW-Therapic meist leicht durchzuführen.<br />
203
Der Vorteil der KW-Therapie liegt hierbei in der rascheren Abgrenzung der<br />
Prozesse mit Schmerzlinderung und Temperaturabfall. Weiterbehandlung nach<br />
Drainage fördert den Heilungsverlauf.<br />
Die subjektiven Beschwerden durch chronische Parametritis werden durch K W-<br />
Therapie meist behoben. Die indurative Narbenbildung wird jedoch nicht wesentlich<br />
beeinflußt.<br />
Perimetritis stellt nach RAAB und VAERNET ein dankbares Anwendungsgebiet<br />
der KW-Therapie dar. 6-8 Durchflutungen genügen meist. Verschlimmerung,<br />
wie sie bei Langwellen-Diathermie meist beobachtet wurde, tritt nie auf.<br />
Douglasabs^esse werden wie abszedierende Formen der Parametritis behandelt<br />
(RAAB, SIEGBURG).<br />
Pelveoptritoniiis und Bauchdeckenabs%esse werden nach FÖDERL günstig beeinflußt,<br />
io Behandlungen genügen meist, Dauer 10-30 Minuten. Zur Spülung bleibt<br />
nur eine kleine Öffnung.<br />
Gonorrhoische Erkrankungen des weiblichen Genitale werden unter Haut- und<br />
Geschlechtskrankheiten angeführt. Bemerkenswert ist, daß RAAB bei diesen spezifischen<br />
Eiterungen rasche Abheilung unter KW-Therapie sah.*<br />
Postoperative Komplikationen, besonders die Stumpfexsudate, bei denen unmittelbar<br />
nach der Operation Infiltrate deutlich fühlbar werden, können durch<br />
UKW subjektiv und objektiv ausgeheilt werden (SCHUMACHER).**<br />
Bei Verwach sungsbesebwerden leisten die KW Besseres als andere konservative<br />
Methoden.<br />
Hormonale Störungen des Menstrualzyklus, Hypoplasien und Involutionsstörungen,<br />
deren Ursache meist ovarielle Unterfunktion oder hypophysäre Dysfunktion<br />
ist, werden durch KW-Therapie günstig beeinflußt.***<br />
Oft können auch Fälle, die der Hormontherapie getrotzt haben, noch beeinflußt<br />
werden. Die Wirkung entsteht wahrscheinlich durch die Gefäßerweiterung an<br />
den Drüsen. Die dadurch hervorgerufene Mehrfunktion ist also durchaus physiologisch,<br />
im Gegensatz zur Hormontherapie, die bei längerer Anwendung zur<br />
Unterfunktion und Atrophie der betreffenden Drüsen führt.<br />
Dysmenorrhöen werden durch Behandlung der Ovarien (iomal) mitunter völlig<br />
geheilt. In anderen Fällen ¡st es besser, jeweils einige Tage vor der zu erwartenden<br />
Menses 5-6 Behandlungen zu geben, oft ist es richtiger, die Hypophyse oder<br />
Hypophyse und Ovarien gleichzeitig zu durchfluten. Man muß meist etwas probieren.<br />
Mit dem neuen, S.225 ff. beschriebenen Verfahren läßt sich feststellen, an<br />
welcher Stelle des hormonalen Systems die Hauptursache der Störung liegt.<br />
Auch Amenorrhoen können auf diese Weise oft geheilt werden. Das gleiche gilt<br />
bei mangelnder Involution des Uterus und Hypoplasien (CAFFARETTO).<br />
Die Behand/ungszeit muß mindestens 15 Minuten betragen, wie die Untersuchungen<br />
über Beeinflussung des Blutzuckers zeigen (WÜST).<br />
Über Mastitis s.S. 163.<br />
Lit.: RAAB, WITTENBECK, DAUSSET, STAEHLER, RHCHOU, SIEDENTOPP, DALCHAU.<br />
* Ebenso wie VOGT, VALLEBONA, GIAVOTTT, GIARDINA, SCHUMACHER, GUTIIMANN.<br />
** RAAB, FÖDERL, VOC-T, VALLEBONA, GIAVOTTÍ, GTARDINA, SCHUMACHER, GUTH-<br />
MANN.<br />
*** DAUSSET und FERRIER, BODO, CIRNOLINI, SAMUELS, BERTALAN, CAITARETTO,<br />
OSTRCIL, SAVONA, OOLLA, KÖVESLIGETHY, BERTOLOTTO, WINTZ, RAAB.<br />
204
12. Krankheiten des Zentralnervensystems<br />
Das Zentralnervensystem ¡st für die therapeutisch angewandten Dosen nicht<br />
empfindlich. Bei direkter Durchflutung des Kopfes fanden KAUDERS und LIEBESNY<br />
nach Anwendung sehr großer Energien meningeaic Reizerscheinungen, Pleozytose,<br />
Erhöhung des Eiweißgchaltes im Liquor, Hyperämie der Gefäße und Diapcdcsc.<br />
Nach REITER beruht dies auf zu starker Erwärmung über 45°. GLOZ untersuchte<br />
den Liquordruck nach Kopfdurchflutungcn im Lumbal- und Subokzipitaliiquor.<br />
Das Ergebnis zeigt Abb. 207. Fast immer wird der Druck erhöht. Die Beschwerden<br />
nach Enzephalographie werden durch Kurzwcllenbchandlung des Kopfes beseitigt.<br />
Abb. 147: Kopf quer mit großem Abstand (Migräne)<br />
BALDI durchflutete den freigelegten N. ischiadicus bei Kaninchen. Dabei sank<br />
die Rheobase, nach 10 Minuten trat Tachykardie, Polypnoe und allgemeiner Tremor<br />
auf. Bei stärksten Dosen kamen die Tiere in Zyanose und Dyspnoe ad exitum.<br />
Allgemeine Überwärmung muß nach dem Obduktionsbefund als Todesursache<br />
angesehen werden. Nach Exstirpation des Sympathikus traten erst nach<br />
40 Minuten leichtere Erscheinungen auf, keine Krämpfe und schwereren Symptome.<br />
BALDI glaubte daher, daß auf dem Wege vegetativer, insbesondere vasosensibler<br />
Nerven irgendwelche Wirkungen in andere Körperteile fortgclcitet<br />
wurden. Es komme zu Beeinflussung des Wärmezentrums sowie vasomotorischer<br />
Zentren, vielleicht auf reflektorischem Wege. Mikroskopische Untersuchung der<br />
Nerven zeigte Desorganisation der Myelinscheiden.<br />
In Anbetracht der Erfolge der Fiebertherapie war eine Behandlung der progressiven<br />
Paralyse mit Kurzwellen von vornherein naheliegend.<br />
Erst nachdem jahrelang durchgeführte Tierversuche und Selbstvcrsuchc die relative<br />
Unschädlichkeit dem Gehirn gegenüber gezeigt hatten, wurde zur therapeutischen Anwendung<br />
übergegangen. Von den bis jetzt behandelten Kranken wurde die Behandlung<br />
20J
durchweg als angenehm empfunden, nach etwa 10 Behandlungen traten Besserungen ein.<br />
Etwas Abschließendes wird man aber erst nach langer Bcobachtungszeit sagen können,<br />
da ja solche Besserungen durch vorübergehende Remissionen vorgetäuscht werden<br />
können.<br />
Die Hyperthermie ist der örtlichen Behandlung überlegen. Sic wird hauptsächlich<br />
bei denjenige Erkrankungen durchgeführt, bei denen auch die Malariakur zur<br />
Anwendung kommt. Dies sind in erster Linie die syphilitischen Erkrankungen des<br />
Zentralnervensystems: Progressive Paralyse und Tabes dorsalis.<br />
Nachdem DAVISON, LOWANCE und CROWE zuerst das Kondensatorfeld zur<br />
Hyperthermie beim Menschen angewandt hatten, wurde das Verfahren besonders<br />
von BIERMANN sowie HALPHEN und AUCLAIR entwickelt und von NEYMAN und<br />
HINSIE weiter ausgebaut.<br />
Diese Autoren hatten mit der Elektropyrexie die gleichen guten Erfahrungen<br />
wie mit der Malariabehandlung. Auch in italienischen Kliniken sind Erfahrungen<br />
auf diesem Gebiet gesammelt worden. MASSAZZA und VALLEBONA kamen bei<br />
Berücksichtigung der Weltliteratur zu folgenden Ergebnissen:<br />
Progressive Paralyse<br />
Sehr gute Remissionen<br />
Gute Remissionen<br />
Leichte Remissionen<br />
Geringe Besserung<br />
Unverändert<br />
Schlechter<br />
18%<br />
18%<br />
20%<br />
20%<br />
22%<br />
20%<br />
Langwellen-<br />
Diathermie<br />
2%<br />
18%<br />
24%<br />
19%<br />
36%<br />
Bei Dementia praecox geben dieselben Autoren folgende Resultate an:<br />
Sehr gute und gute Remissionen<br />
Leichte Remissionen<br />
Geringe Besserung<br />
Unverändert<br />
Schlechter<br />
4%<br />
"%<br />
32%<br />
?i%<br />
2%<br />
0%<br />
Langwellen-<br />
Diathermie<br />
5%<br />
16%<br />
54%<br />
32%<br />
2%<br />
Kurzwellen-<br />
Therapie<br />
4%<br />
20%<br />
22%<br />
22%<br />
26%<br />
6%<br />
Kurzwellen-<br />
Therapie<br />
27%<br />
18%<br />
18%<br />
30%<br />
6%<br />
Besonders günstig stellt sich die elektrische Überwärmung in bezug auf die<br />
Todesfälle bei der Behandlung. Nach NEYMAN betrugen sie bei Impfung mit Sodoku<br />
10%, bei Malaria 18%, bei Elektropyrexie 0%.<br />
Wirksam ist bei Lues nur die Höhe der Temperatur (JAHNEL und WEICHBRODT,<br />
SCHAUMBURG, RULE, BESSEMANS, OAK und CARPENTER). Zur Behandlung der<br />
Paralyse ist daher die Erziclung hoher Temperaturen unbedingt notwendig. RAAB<br />
erzeugt Temperaturen zwischen 39,5 und 40,5 o mindestens 6 Stunden lang bei<br />
20 Sitzungen, NEYMAN hält sogar 8-10 Stunden lange Sitzungen für nötig und<br />
gibt bis zu 20 Behandlungen. V.TEUBERN unterhält eine Hyperthermie von 40 o<br />
3 Stunden lang.<br />
206
20<br />
70<br />
300<br />
SO<br />
60<br />
70<br />
60<br />
250<br />
W<br />
JO<br />
20<br />
70<br />
200<br />
30<br />
00<br />
70<br />
60<br />
7S0\<br />
W<br />
30<br />
20<br />
70<br />
700<br />
SO<br />
60<br />
70<br />
60<br />
30<br />
VO<br />
30<br />
20<br />
70<br />
/-.<br />
mo<br />
>Nr7f<br />
Nr. 73<br />
£r/äuteru/jgen:<br />
Versuch Nn: Name:<br />
7 BKl.<br />
2 SchDo.<br />
3 JWi.<br />
Ein nicht hoch genug einzuschätzender Vorteil der elektrischen Überwärmung<br />
gegenüber anderen Verfahren der Fiebererzeugung besteht in der Möglichkeit der<br />
gleichzeitigen Anwendung von Heilmitteln, besonders von Salvarsan, worauf der<br />
Verfasser zuerst hingewiesen hat. Am besten spritzt man das Salvarsan unmittelbar<br />
vor der Behandlung ein. Im Tierversuch zeigten BESSEMANS, LEVADITI u.a.,<br />
daß diese kombinierte Therapie besonders günstig wirkt. Für Antibiotica gilt<br />
dasselbe.<br />
Experimentelle Untersuchungen (S. 154) berechtigen zu der Annahme, daß die<br />
Durchlässigkeit der Hirnhäute für Salvarsan während der Überwärmung besser<br />
wird (KAUDERS), SO daß die Bedingungen für das Eindringen des Salvarsans in das<br />
Zentralnervensystem sich günstiger gestalten.<br />
Bei Tabes dorsalis ist die elektrische Überwärmung noch nicht in so hohem Maße<br />
angewandt worden wie bei Paralyse. RAAB gibt 99 Fälle aus der Literatur an, die<br />
von verschiedenen Autoren behandelt und beschrieben sind. Von ihnen wurden<br />
64 wesentlich gebessert, 35 besserten sich nur wenig oder nicht. Immerhin ist der<br />
genannte Prozentsatz von Besserungen im Vergleich mit den bisher so trostlosen<br />
Ergebnissen als sehr günstig zu bezeichnen.<br />
Ähnliche Erfolge wurden auch bei anderen Formen der Lues des Zentralnervensystems<br />
erzielt, doch sind die Ergebnisse noch nicht so zahlreich, um zu einem abschließenden<br />
Urteil zu kommen. AUCLAIR, MARTINEZ, BECKMANN, REDEVILLE<br />
besitzen darüber die meisten Erfahrungen.<br />
Bei primärer und sekundärer Lues waren die Ergebnisse bisher unbefriedigend.<br />
Eine große Sammlung von Fällen ist von O'LEARY, BRUETSCH, EBAUGH,<br />
SIMPSON, SOLOMON, WARREN, VANDERLEHR, USILTON, SOLLINS veröffentlicht worden.<br />
Sic sind zum Teil elektrisch, teils mit einem besonderen Heißluftverfahren<br />
(KETTERiNG-Hypertherm) behandelt worden. Hierunter waren nicht nur Paralysen,<br />
sondern alle möglichen syphilitischen Erkrankungen des Gehirns und<br />
Rückenmarks. Von 1420 Kranken wurden 1100 mit Malaria, 3 20 mit physikalischer<br />
Hyperthermie im Zeitraum von 2 Jahren behandelt.<br />
Bei leichteren Fällen ergab sich kein Unterschied zwischen den Ergebnissen der<br />
Malaria- und Hypcrthcrmicbehandlung (etwa 52% Remissionen). Bei mittclschweren<br />
Erkrankungen wurden mit Malaria 25%, mit Hyperthermie 31%<br />
Besserungen erzielt. Von Schwerstkranken waren nach 4 Jahren 11 der mit Hyperthermie<br />
behandelten Kranken gebessert gegenüber 1 der mit Malaria behandelten.<br />
Todesfälle waren bei Malaria 13%, bei Hyperthermie 8% vorhanden.<br />
Rückfälle traten nach Malaria in 3,3%, nach Hyperthermie in 5,5% auf. Die<br />
Wassermann-Reaktion wurde allerdings nur bei 12% der Kranken negativ. Die<br />
klinische Besserung ist also vom serologischen Befund unabhängig.<br />
Durch Steigerung der Temperatur über 41 o wird kein besseres Ergebnis mehr<br />
erzielt. Dies ist wichtig, weil Temperaturen über 41,5° gefährlich werden.<br />
Multiple Sklerose behandelten BENNET und LEWIS mit dem «KETTERiNG-Hypertherm».<br />
Bei 51 Kranken wurden im Zeitraum von 4V2 Jahren jeweils 6 Behandlungen<br />
von 3 Stunden Dauer bei 40 o vorgenommen. Von 10 akut Erkrankten wurden<br />
8 gebessert, davon 3 voll, 1 fast voll arbeitsfähig.<br />
Von 15 Mittclschwcren wurden 13 deutlich besser, 11 davon konnten wieder<br />
arbeiten. Bei 16 Schwerkranken wurde keine Besserung erreicht. Hierbei ist zu<br />
bedenken, daß immer mit einem gewissen Prozentsatz von Spontanremissionen<br />
gerechnet werden muß. RAAB gibt ähnliche Erfolge mit Elcktropyrexic an.<br />
Nur geringe Wirkungen haben wir mit örtlichen Durchflutungen bei multipler<br />
208
Sklerose gesehen, jedoch scheint es, daß bei frischen Fällen mit maximaler Hyperthermie<br />
langdauernde Remissionen herbeigeführt werden können (s.S. 147fr).<br />
Bei Meningoencephalitis luica sah LASCHE nach Hyperthermie erhebliche subjektive<br />
Besserungen, die Wassermann-Reaktion wurde jedoch nur bei einem Teil der<br />
Kranken negativ.<br />
Bei nicht zu ausgedehnten Hirnabszessen sowie bei meningitischen Reizungen<br />
sollte die KW-Therapie unbedingt versucht werden.<br />
Gutes leistet die KW-Therapie ferner bei der Behandlung der Qucrschnitts-<br />
Myelitis. KW-Hyperthermie ist anzuwenden bei Enzephalomyelitis, auch im subchronischen<br />
Stadium, wobei die Erfolge oft recht gut sind.<br />
Abb. 149<br />
Bei Meningitis serosa sind die Erfolge oft überraschend, die Erscheinungen<br />
können manchmal durch wenige Sitzungen beseitigt werden.<br />
Bei Enzephalitis (Ecónomo) sind Besserungen bis zu einem gewissen Grad erzielt<br />
worden. Über frische Fälle liegen keine Erfahrungen vor. Bei nicht zu alten<br />
Erkrankungen werden einige Erscheinungen recht günstig beeinflußt. Vor allen<br />
Dingen der Rigor, die starke Ermüdbarkeit und die Somnolenz bessern sich oft<br />
recht erheblich; die Hyperkinesen scheinen dagegen nach meinen Erfahrungen<br />
kaum beeinflußt zu werden. Wesentlich bessere Ergebnisse als mit den gewöhnlichen<br />
Apparaten wurden von uns mit der i-m-Welle erzielt.*<br />
Chorea minor wird mit Sicherheit durch j-6 Durchflutungen des Kopfes geheilt.<br />
Sehr gut wirkt KW-Therapie bei MÉNIEREJ-C^OT Syndrom und bei Migräne. Man<br />
dosiert schwach, jeden 2. Tag 5-10 Minuten lang, Plattenabstand am Kopf beiderseits<br />
4-; cm.<br />
Bei frischer Poliomyelitis wurden Erfolge beschrieben. Da es bis jetzt keine<br />
einwandfrei wirksamen Mittel gegen diese Krankheit gibt, muß zum mindesten<br />
ein Versuch mit KW-Therapie angeraten werden.<br />
* Literatur: HINSIE, BIERMAN und SCHWARZSCHILD, WAGNER-JAUREGG, MARIE und<br />
MEDAKOVITCH, HALPHEN und AUCLAIR, DAUSSET, RÉCHOU.<br />
209
Die Behandlung der Poliomyelitis mit Ultrakurzwellen ist mehrfach versucht<br />
worden. CoLARizigibt Erfolge bei einem ziemlich großen Krankengut an, und später<br />
berichtete MENKE über Ergebnisse mit Durchflutung der Gliedmassen. Bei der<br />
Poliomyelitis-Epidemie 1948 wurden von mir 60 Kranke, Kinder und Erwachsene,<br />
mit Ultrakurzwellen behandelt. Der Erfolg war der, daß beim Verlassen des<br />
Krankenhauses nur ein geringer Teil der Patienten noch ausgesprochene Lähmungen<br />
hatte, einige andere wiesen geringfügige Paresen auf, die sich zum Teil später<br />
noch besserten. 1948 war bei den nicht mit KW behandelten Kranken der Prozentsatz<br />
der mit Lähmungen entlassenen Kranken wesentlich größer gewesen. Mit der<br />
elektrischen Überwärmung (Elektropyrexie, Radiothermie) konnten noch bei<br />
einigen veralteten Fällen wesentliche Besserungen erzielt werden, wenn auch nach<br />
monatelanger Behandlung. KLARE bestätigt die guten Erfolge bei frischer Poliomyelitis,<br />
Bei einer 30jährigen Frau, die die akute Infektion 2 Jahre vor dem Beginn der Behandlung<br />
überstanden hatte, bestand eine Tétraplégie sowie Parese der Nacken- und Kaumuskulatur.<br />
Bei ihr wurde 2mal wöchentlich eine Behandlung mit Hyperthermie bis<br />
J9° durchgeführt. Nach 8 Monaten war die Beweglichkeit so weit wiedergekehrt, daß<br />
sie allein aufstehen und herumgehen konnte.<br />
In Alexandria hatte ich Gelegenheit, über joo Kinder mit Poliomyelitis zu behandeln.<br />
Nur 2% der Fälle waren resistent, alle anderen wurden wesentlich gebessert.<br />
Das Stad. paralyticum lag 3 Tage bis z Jahre zurück.<br />
Gerade in Anbetracht der Unwirksamkeit der sonstigen Mittel wird man der<br />
<strong>Kurzwellentherapie</strong> mehr Aufmerksamkeit schenken müssen als bisher. Die Behandlung<br />
kann nach 2 Methoden ausgeführt werden;<br />
1. Bei der Plattenmcthodc wird eine Kondcnsatorplattc im Nacken, die andere über<br />
der Lendenwirbelsäule angebracht. Der Kranke liegt entweder auf dem Bauch, oder die<br />
Platten werden bei Rückenlage untergeschoben. Wir verwandten einen Siemens Ultratherm.<br />
Jeder Patient wurde 15-20 min lang mit Dosis 3 (angenehme Wärme) durchflutet.<br />
2. Die Schiingenmethode. Bei dieser wird das Wirbelstromfcld einer Spulenwindung<br />
angewandt. Die Schlinge wird zweckmäßig in der Lendengegend von der Seite herangebracht<br />
und dann haarnadelförmig zu beiden Seiten der Wirbelsäule entlanggeführt, so<br />
daß der Bogen im Nacken des Patienten liegt. Die Kabel sind entsprechend isoliert. Die<br />
Kraftlinien durchsetzen dann Wirbelsäule und Rückenmark in der ganzen Länge.<br />
Die Kombination dieses Verfahrens mit der Eisernen Lunge ¡st besonders aussichtsreich,<br />
weil die <strong>Kurzwellentherapie</strong> während der Beatmung ausgeführt werden<br />
kann.<br />
Es kann sowohl die Platten- als auch die Schlingcnmethode angewandt werden. Die<br />
letztere erscheint zweckmäßiger, weil mit ihr leichter eine allgemeine Hyperthermie<br />
erzielt werden kann. Wenn die Temperatur in der Eisernen Lunge so weit erhöht ist, daß<br />
der Körper des Kranken keine Wärme mehr abgibt, genügt eine Leistung des Kurzwcllengerätes<br />
von 400 bis 500 Watt, um eine Erhöhung der Körpertemperatur bis auf Î8-39 0<br />
herbeizuführen. Die Behandlung kann sowohl im Inneren des Zylinders ausgeführt werden<br />
als auch bei herausgezogenem Lager und Mundbeatmung. Der Kurzwellenapparat<br />
kann durch Stecker von außen angeschlossen werden; Energiezufuhr und die Abstimmung<br />
werden von außen so reguliert, wie es im Einzelfall notwendig ist,<br />
Die Kurzwellcnbchandlung der Poliomyelitis kann schon früh begonnen werden.<br />
In unseren Fällen wurden meist am 3.-4.Tag des Stadium paralyticum angefangen.<br />
210
Worauf die Wirkung beruht, läßt sich heute noch nicht sagen. Eine direkte Beeinflussung<br />
des Erregers liegt im Bereich der Möglichkeit, etwa in der Art der<br />
bekannten Perlschnurbildung. Suspendierte Teilchen stellen sich dabei in Richtung<br />
der Feldlinien ein. Andererseits kennen wir die Wirkung der Ultrakurzwellen<br />
auf die Abwehrkräfte und auf die Austauschvorgänge im Gewebe, durch die möglicherweise<br />
die Antikörperbildung und die Reaktionen zwischen Antikörpern und<br />
Antigenen beeinflußt werden. Schließlich muß die Hyperämie als Heilfaktor in<br />
Betracht gezogen werden. Wie dem auch sei, die bisher in der Praxis gemachten<br />
Erfahrungen sind so, daß auf die Anwendung dieses Mittels in keinem Fall verzichtet<br />
werden sollte.<br />
13. Periphere Nerven<br />
Ehe man an die Behandlung der schmerzhaften Erkrankung der peripheren<br />
Nerven herangeht, muß man ihre Ursachen ergründen. Bei toxischen Neuritiden<br />
wird man das betreffende Gift entziehen müssen, bei Fokaltoxikosen den Infekt<br />
entfernen. Viele Neuralgien beruhen auf Mangel an Vitamin B, wie überhaupt<br />
Zufuhr dieses Vitamins oft eine gute Unterstützung der sonstigen Therapie ist. Es<br />
ist daran zu denken, daß Nervenschmerzen durch Druck auf den Verlauf der<br />
Nerven entstehen können; in solchen Fällen sind die Ursachen, wie Geschwülste,<br />
Exostosen, Entzündungsherde, zu behandeln.<br />
Der größte Teil der Neuritiden und Neuralgien ist jedoch rheumatisch und ein<br />
dankbares Gebiet der KW-Therapie. Man wird vor Beginn der Behandlung alles<br />
das berücksichtigen müssen, was in dem Kapitel über rheumatische Erkrankungen<br />
gesagt ist. Es muß also immer untersucht werden, inwieweit eine rheumatische<br />
Allgemeinerkrankung vorliegt; diese ist entsprechend zu behandeln.<br />
Zur örtlichen Behandlung sind besonders diejenigen Fälle geeignet, bei denen die<br />
Allgcmeinerkrankung keine Rolle mehr spielt. In Zweifelsfällen kann man zunächst<br />
die örtliche Behandlung versuchen; wenn sie nicht nach 6 Durchflutungen zur<br />
Besserung führt, muß man zu entsprechender Allgemeinbehandlung übergehen.<br />
Die periphere Fazialislähmung pflegt immer gut auf UKW anzusprechen. Die<br />
eine aktive Elektrode von 10 cm Durchmesser wird mit 2-3 cm Abstand auf die<br />
Felsenbeingegend aufgesetzt, die andere wird in 6-8 cm Entfernung auf die andere<br />
Schläfe eingestellt.<br />
Frischere Lähmungen gehen oft schon nach 5-6 Durchflutungen zurück. Oft<br />
erzielt man Heilungen selbst noch bei Kranken, bei denen die Lähmung monatelang<br />
bestanden hatte und die alle möglichen medikamentösen, hydrotherapeutischen<br />
und elektrischen Prozeduren einschließlich LW-Diathermic erfolglos versucht<br />
hatten. Anschließend wird mit Exponentialströmen behandelt.<br />
Ok%ipita!neuralgien reagieren ausgezeichnet. Sie sind häufig durch arthritische<br />
Veränderungen der Halswirbclsäule verursacht. Diese ist in solchen Fällen mit zu<br />
behandeln.<br />
Man setzt die eine Elektrode auf die Halswirbelsäule, die andere auf die Mitte<br />
des Hinterkopfes auf und behandelt mit Dosis II 5-10 Minuten.<br />
Ähnliches gilt für Neuralgien der Armnerven, bei denen oft die Halswirbelsäule<br />
oder die hinteren Wurzeln des Halsmarkes beteiligt sind. Hier wird eine Elektrode<br />
auf die Halswirbelsäule, die andere auf den Arm möglichst peripher aufgelegt.<br />
Über die Dosierung gilt das gleiche wie für die Fazialislähmung.<br />
Bei Interkostalneuralgien ist stets die Brustwirbelsäule genau zu untersuchen. Ist<br />
211
sie erkrankt, dann wird sie behandelt, wie unter Rheumatismus beschrieben.<br />
Sonst wird eine Elektrode auf die Wirbelsäule in Höhe des entsprechenden Segmentes<br />
aufgelegt, die andere peripher auf denNerven. Auch Neuralgien nach Herpes<br />
zoster werden gut beeinflußt.<br />
Für die Dosierung gilt allgemein die Regel: Bei frischen Fällen Beginn mit Dosis II,<br />
5 Minuten, später Steigerung bis 10 Minuten, mit kräftigeren Dosen je nach Reaktion des<br />
Kranken. Bei älteren Fällen kräftigere Dosen. 10 bis 15 Minuten.<br />
Abb. ijo: Fußsohle - Kniegelenk<br />
Bei Ischias muß zunächst die Frage geklärt werden, ob es sich um echte Neuritis<br />
ischiadica oder um symptomatische Ischias handelt. Letztere kann durch verschiedene<br />
Ursachen hervorgerufen sein, die z.T. anderer Behandlung zuzuführen<br />
ist. So besonders statische Veränderungen an Beinen oder Füßen, die orthopädisch<br />
korrigiert werden müssen. Ferner können alle möglichen, insbesondere raumbeengende<br />
Prozesse im Becken, den N. ischiadicus beeinflussen, etwa Tumoren,<br />
deren Vorhandensein vor Beginn der KW-Behandlung ausgeschlossen werden<br />
muß. Auch entzündliche Vorgänge kommen in Frage. Oft wird übersehen, daß<br />
bei Frauen Adnexerkrankungen und Parametritis Ursache von Ischias werden<br />
können. Arthntische oder raumbeengende Prozesse an der Wirbelsäule müssen in<br />
Erwägung gezogen werden. Sic können, soweit sie entzündlich sind, erfolgreich<br />
mit UKW behandelt werden.<br />
212
Bei der eigentlichen Ischias, der Neuritis ischiadica, ist daran zu denken, daß die<br />
Erkrankung nicht nur den peripheren Nerven betrifft, sondern daß die unteren<br />
Segmente des Rückenmarkes, mindestens die hinteren Wurzeln, häufig beteiligt<br />
sind, was aus der im Liquor fast immer vorhandenen Pleozytose hervorgeht.<br />
Wir setzen deshalb die eine Elektrode auf die Lcndenwirbelsäule auf, die andere je<br />
nachdem auf Knie oder Fuß, so daß die Stromlinien den Nerven der Länge nach durchsetzen.<br />
Der Elektrodenabstand braucht nur 2-3 cm zu betragen, es können auch<br />
Gummiclektrodcn genommen werden. Bei sog. Wurzelischias hat sich auch die Spulcnbehandhing<br />
mit einer um das Gesäß hcrumgclegten Schlinge bewährt (Tafel I, S. 277).<br />
Abb. IJI: Elektrodenstellung bei Armncuralgic.<br />
Der Unterarm ruht auf einer Armclektrodc<br />
Bei sehr akuten Ischiasfälicn muß man besonders vorsichtig behandeln, zunächst mit<br />
Dosis 1 und nur 3 bis 5 Minuten Dauer. Wenn der Kranke es gut verträgt und keine<br />
Reaktion auftritt, kann man allmählich steigern. Man behandelt zunächst jeden Tag und<br />
setzt nur nach stärkeren Reaktionen 1-2 Tage aus, um mit schwächerer Dosis wieder<br />
zu beginnen. Wenn Besserung eintritt, kann man 2-3mal die Woche behandeln. Bei<br />
älteren Fällen geht man bald zu starken Dosen über und verlängert die Behandlungen bis<br />
zu 10 und 15 Minuten, ja unter Umständen auf 20 Minuten.<br />
Oft, besonders in veralteten Fällen, genügt die örtliche Behandlung nicht, dann<br />
muß Hyperthermie angewandt werden. Die Elektroden werden dabei hauptsächlich<br />
auf den unteren Teil des Rückens und das Gesäß angelegt.<br />
Bei richtiger Anwendung der KW-Therapie, die allerdings hier besondere Erfahrung<br />
erfordert, lassen sich selbst in veralteten Fällen von Ischias noch Heilungen<br />
erzielen.<br />
213
14. Erkrankungen der Kreislauf organe<br />
Aus physiologischen Untersuchungen geht hervor, daß sich im KW-Feld die<br />
kleinen Blutgefäße erweitern (S. 94). Die so hervorgerufene Hyperämie bedeutet<br />
einen nicht zu unterschätzenden Faktor für die Heilung nicht nur beiEntzündungen,<br />
sondern bei allen Erkrankungen, die auf Durchblutungsstörungen infolge Spasmen<br />
der kleinsten Adern beruhen. Hierher gehört ein Teil der allergischen und<br />
rheumatischen Gruppe sowie der eigentlichen Krankheiten der Blutgefäße, in<br />
erster Linie der Arteriosklerose.<br />
Angiospasms der verschiedensten Art werden durch das KW-Feld gelöst; ob<br />
durch unmittelbare Wirkung auf die Gefäßwände oder durch Beeinflussung der<br />
Innervation, sei dahingestellt. Sicherlich spielen physikochemische Veränderungen,<br />
insbesondere die Mobilisierung von Histamin, eine Rolle.<br />
Die Besserung bei Erfrierungen kann nur durch solche Vorgänge erklärt werden.<br />
Akro^janosen werden durch KW-Therapie momentan gut beeinflußt, doch erzielen<br />
wir keine Dauerwirkungen, solange die (meist endokrine) Ursache der Erkrankung<br />
nicht beseitigt wird (S, 234).<br />
Eindrucksvoll sind die Erfolge der KW-Therapie oft bei arterieller Hypertension,<br />
soweit sie nicht auf chronischer Nephritis beruht. Da wir eine zentrale Regulationsstörung<br />
annehmen, durchfluten wir bei Hypertension hauptsächlich das<br />
Zentralnervensystem; wenn eine nephrogene Komponente nicht auszuschließen<br />
ist, können wir gleichzeitig die Nierengegend durchfluten.<br />
Wir setzen deshalb eine Elektrode auf den Kopf, die andere auf die Lcndengegend,<br />
so daß Gehirn, Rückenmark und Nierengegend durchflutet werden. Nach<br />
unseren Untersuchungen senkt sich der Blutdruck auch etwas, wenn andere größere<br />
Bereiche durchflutet werden. Zunächst geht gewöhnlich der diastolische Blutdruck<br />
herunter. Die Senkung erfolgt meist schon nach der ersten Durchflutung, wenn<br />
auch noch nicht stark.<br />
Die Wirkung ist nachhaltig, und bei größeren Durchflutungsserien sinkt der Blutdruck<br />
immer mehr ab. Die Dosis darf, wie bei allen Erkrankungen des Gefäßsystems, nicht zu<br />
groß sein. Wir durchfluten 5 bis höchstens 10 Minuten mit Dosis II. Untersuchungen<br />
über das Absinken des Blutdruckes bei Gesunden und Hypertonikern sind mehrfach<br />
ausgeführt worden (DAVIS, ADAM, APEL).<br />
Bei Arteriosklerose kann mit der KW-Therapie oft noch viel erreicht werden,<br />
aber nur solange die kleinen Gefäße überhaupt noch erweiterungsfähig sind. Bei<br />
arteriosklerotischer Gangrän durchfluten wir die betreffenden Gliedmaßen am<br />
besten so, daß die Gefäße auf eine möglichst lange Strecke durchflössen werden.<br />
Am Bein setzen wir also eine Elektrode auf die Leiste, die andere auf den Fuß. Die<br />
Dosierung muß äußerst vorsichtig geschehen ; zu starke Dosen können den Krankheitsprozeß<br />
beschleunigen und raschere Nekrose herbeiführen.<br />
Wie von der physikalischen Therapie her schon bekannt, reagieren stark geschädigte<br />
Gefäße auf Wärme paradox, nämlich mit Kontraktion. Irgendwelche<br />
stärkere Erwärmung muß deshalb auf jeden Fall vermieden werden.<br />
Wir beginnen daher mit Dosis I und einer Dauer von 2 bis 3 Minuten. Nur auf Grund<br />
genauer Beobachtung des Kranken kann dann allmählich zu größeren Dosen übergegangen<br />
werden.<br />
214
Bei beginnender Gangrän können die UKW auch diagnostisch angewandt werden.<br />
PFLOMM sah, daß sich nach stärkerer Durchflutung die erkrankten Teile deutlich<br />
von den gesunden absetzten, da nur in den letzteren Gefäßerweiterung eintrat,<br />
während die erkrankten Teile unbeeinflußt und daher kalt blieben, so daß schon<br />
durch den eingetretenen Temperaturunterschied die künftige Demarkationslinie genau<br />
bestimmt werden konnte.<br />
Bei RAYNAUDscher Gangrän können mit gleicher Technik oft schöne Besserungen<br />
erzielt werden. Die KW-Therapie sollte daher auf jeden Fall mindestens versucht<br />
werden, che man operativ vorgeht (LAST, RfiCHOu).<br />
Claudicatio intermittens kann im Anfangsstadium beeinflußt werden, später<br />
nicht mehr (LIEBESNY, LAST). Bei Endarteritis obliterans haben wir bisher keine<br />
Erfolge gesehen. Eindrucksvoll sind die Erfolge bei Apoplexien (SCHLIEPHAKE,<br />
DAUSSET). Hier wirkt sowohl die gefäßerweiternde Komponente wie die Förderung<br />
der Resorption. Wir haben in den ersten Tagen nach Apoplexien nicht mit UKW<br />
behandelt, man kann aber nach etwa 6-7 Tagen beginnen.<br />
Unliebsame Zwischenfälle und neue Blutungen haben wir dabei nie gesehen; dagegen<br />
besserten sich die subjektiven Beschwerden und die objektiven neurologischen<br />
Erscheinungen bald nach den ersten Durchflutungen.<br />
Wir hatten deutlich den Eindruck, daß sich die Ergüsse rascher resorbierten<br />
und daß durch Erweiterung der Adern die gesamte Hirnfunktion gebessert wurde.<br />
Bei Angina pectoris sind die UKW wiederholt angewandt worden, so besonders<br />
von SIEGEN und von BIEBER (Juliusspital Würzburg). Beide sahen eindrucksvolle<br />
Besserungen im elektrokardiographischen Befund und im Allgemeinbefinden selbst<br />
nach Koronarinfarkten. Schon im Anfang wird das subjektive Befinden stets<br />
schnell und günstig beeinflußt. Wir können wohl mit Recht annehmen, daß die<br />
Spasmen der kleineren Adern gelöst werden und daß auch die Ernährung der<br />
Gefäßwände selbst durch Beeinflussung der Vasa vasorum gebessert wird. Die<br />
Schmerzen nach Koronarinfarkt können oft durch eine einzige Durchflutung des<br />
Herzens beseitigt werden. Ich habe wiederholt nach ganz frischen Infarkten das<br />
Herz durchflutet. Die Schmerzen in der Herzgegend pflegen danach sofort zu<br />
verschwinden, selbst in Fällen, in denen 0,02 g Morphium ohne Wirkung geblieben<br />
waren. Man durchflutet Vu bis 1 Minute mit Dosis I, nicht länger! Die<br />
Mikrowelle hat sich hier gut bewährt (jo Watt, 1 min). Bei älteren Infarkten wird<br />
die Durchblutung des Herzmuskels gebessert. Man wird auch hier mit 1 /2 Minute<br />
beginnen und nicht über 3 Minuten bei Dosis II—III hinausgehen.<br />
Auch hier ist Vorsicht mit der Dosierung am Platze, da durch zu starke Dosen manchmal<br />
auch stenokardische Anfälle ausgelöst werden können. Wir beginnen mit Dosis I<br />
und 1 /a bis 3 Minuten Dauer, wobei die eine (8-10 cm) Elektrode in 2-3 cm Entfernung<br />
auf die Herzgegend, die andere mit j-6 cm Abstand auf den Rücken aufgelegt wird,<br />
Von Erkrankungen des Hertens kommt in erster Linie die frische, von Angina<br />
oder Polyarthritis ausgehende Myokarditis in Frage. Die Erfahrungen auf diesem<br />
Gebiet sind noch nicht sehr groß, jedoch haben wir bei akuter Myokarditis den<br />
deutlichen Eindruck, daß die UKW günstig wirken. Den gleichen Eindruck hatten<br />
wir bei Endokarditis, auch bei älteren, torpiden und latenten Fällen, besonders in<br />
Kombination mit antibiotischen Mitteln.<br />
Wir beginnen mit der gleichen Technik wie bei Koronarinsuffizienz, steigern die Dosis<br />
aber allmählich je nach Verträglichkeit unter Umständen bis Dosis II und gehen bis zu<br />
einer Dauer von 30 bis 40 Minuten. Über die vegetative (neurozirkulatorische) Dystonie<br />
s.S. 234.<br />
21J
Zum Gebiet der Kreislauferkrankungen gehören die Erfrierungen. Wir unterscheiden<br />
zwischen den Örtlichen Frostschäden besonders an Extremitäten und der<br />
allgemeinen Erfrierung.<br />
Bei den örtlichen Frostschäden tritt nach Ansicht der meisten Autoren zunächst<br />
ein Spasmus der Arteriolen und Kapillaren ein, erst später entstehen Schäden am<br />
Gewebe durch Ernährungsstörung und vermehrte Durchlässigkeit der Gefäßwände.<br />
Gelingt es, den Kapillarspasmus rechtzeitig zu lösen, dann können schwere<br />
Schäden vermieden werden. Von außen zugeführte Wärme ist dazu ungeeignet,<br />
da sie die Gewebe schädigt, ohne den Spasmus zu lösen. Auf diese Weise kommen<br />
schwere Schäden oft erst nach dem Auftauen zustande. Durch den Angriff des<br />
UKW-Feldes in der Tiefe werden die Adern unmittelbar beeinflußt, und hierauf<br />
ist die günstige Wirkung zurückzuführen.<br />
Die ersten Erfahrungen bei örtlichen Frostschäden haben BÜRKMANN und später<br />
LAST veröffentlicht, die bei frischen Schäden ausgezeichnete Erfolge gesehen haben.<br />
Das entspricht völlig unseren eigenen Erfahrungen, die zeigen, daß die Erfolge<br />
um so besser sind, je früher mit UKW behandelt wird. Künstlich geset2tc Frostschäden<br />
am Hahnenkamm bestrahlten WILD & ALM mit Mikrowellen und erzielten<br />
überzeugende Resultate.<br />
CIGNOLINI hat Tierversuche sowohl bei Frostschäden an den Extremitäten als<br />
auch bei allgemeiner Erfrierung angestellt. Er sah allgemein, daß bei frühzeitig<br />
einsetzenden UKW-Durchflutungen schwere Schäden verhindert werden können.<br />
Bei Angehörigen der italienischen Alpentruppen sah CIGNOLINI diese Erfahrungen<br />
voll bestätigt, außerdem zeigte er, daß noch bei älteren Erfrierungen Besserungen<br />
erreichbar sind.<br />
Wir haben aus Rußland kommende Erfrierungen oft erst nach 3-6 Wochen in<br />
Behandlung nehmen können. Die Ergebnisse waren selbstverständlich lange nicht<br />
so gut wie bei frischen Fällen, aber es zeigten sich immer noch zahlreiche Besserungen,<br />
die die durch andere Mittel erzielbaren übertrafen.<br />
So behandelten wir bei Erfrierung beider Hände in mehreren Fällen immer nur die<br />
schwerer betroffene Hand und sahen nach einigen Durchflutungen, daß diese Hand in<br />
besserem Zustand war als die andere. JAMIN hat solche Untersuchungen an größerem<br />
Krankengut ausgeführt und ist zu gleichen Ergebnissen gekommen.<br />
Bei nicht zu schweren Frostschäden sahen wir schon bald einen Rückgang der<br />
Schwellung und bessere Blutversorgung; nicht mehr reparable Gewebsteile werden<br />
schneller nekrotisch, die Demarkationslinie tritt rascher und deutlicher hervor,<br />
und die Abstoßung erfolgt schneller.<br />
Bei allgemeiner Erfrierung sind die Verhältnisse andere. Das Blut hat sich aus der<br />
«poikilothermen Schale» zurückgezogen. Der «Kern», das Kesselgebict des Blutkreislaufes,<br />
versucht die Temperatut zunächst festzuhalten, was aber beim Fortschreiten<br />
der Durchkühlung nicht mehr gelingt. Schließlich tritt Bewußtlosigkeit<br />
ein. Bei zu starker Erwärmung von außen besteht die Gefahr, daß das Blut aus dem<br />
Kcssclgebiet wieder in die Peripherie strömt, dadurch aber stark abgekühlt wird<br />
und nun dem Kern noch mehr Wärme entzieht; sie wirkt also schädlich. Von<br />
fast allen Autoren, die diese Frage bearbeitet haben (WELTZ, KÖNIG, CIGNOLINI),<br />
wird übereinstimmend angegeben, daß die Aufwärmung durch UKW den anderen<br />
Verfahren weit überlegen ist. Dies ist von CIGNOLINI und von WELTZ auch mit<br />
Tierversuchen belegt worden.<br />
Bei UKW-Durchflutung kann nämlich die Wärme unmittelbar dem Kcrngcbict<br />
216
zugeführt werden, so daß die Aufwärmung von innen her erfolgt und die oben<br />
genannten Gefahren nicht bestehen. Man wird dieses Verfahren auch mit Vorteil<br />
nach der Hibernisation anwenden können.<br />
Die Dosierung ist für die allgemeine Erfrierung noch nicht genügend ausgebaut.<br />
Um möglichst starke Tiefenerwärmung zu erzielen, wird man mit leistungsstarken<br />
Apparaten und mit möglichst großen Elektrodenabständen arbeiten müssen.<br />
Inwieweit die Spulenmethode brauchbar ist, müßte noch erwiesen werden, doch<br />
ist anzunehmen, daß das Kondcnsatorfcld wegen seiner stärkeren Tiefenwirkung<br />
überlegen ist. Die Feldstärke wird man zunächst nicht zu stark einstellen, um die<br />
Haut nicht zu sehr zu belasten, dann aber während der Behandlung allmählich<br />
steigern. Um möglichst viel Wärme zuzuführen, muß man lange (u.U. stundenlang)<br />
behandeln.<br />
Bei den örtlichen Frostschäden behandelt man zunächst mit Dosis I bis II und beginnt<br />
mit 3-5 Minuten. Jede stärkere Erwärmung sollte vermieden werden, um die feinen<br />
Adern nicht zu schädigen. Man kann dann, je nach Reaktion des Kranken, allmählich<br />
steigern, doch hat es keinen Zweck, über 10 Minuten hinauszugehen. Stärkere Dosen<br />
sind nur dann am Platz, wenn rasche Abstoßung der bereits nekrotischen Teile gewünscht<br />
wird.<br />
Für die Behandlung der Frostschäden werden mit besonderem Vorteil die von PÄTZOLD<br />
entwickelten Spezialelektroden angewandt.<br />
Überraschend sind die Erfolge bei Entzündungen der Venen. Bei akuter und<br />
subakutcr Thrombophlebitis erreicht man meist mit wenigen Durchflutungen Rückgang<br />
der Beschwerden und völlige Heilung.<br />
Gewöhnlich haben wir zur Heilung nicht mehr als 8-10 Tage gebraucht, während<br />
derer weder Wicklungen noch feste Bettruhe nötig waren. Auch hier ist schwache Dosis<br />
am Platze, zuerst 3-5 Minuten bei Längsdurchflutung. Eine Elektrode in der Leistenbeuge,<br />
eine in Knickchic oder am Fuß. Man kann auch Spulen- oder Ringfelder verwenden,<br />
doch bieten sie keinen Vorteil. Embolien haben wir nie gesehen.<br />
i j. Urogenitalapparat<br />
Über die Behandlung von Nierenentzündungen ist bisher wenig veröffentlicht<br />
worden. Es ¡st aber a priori anzunehmen, daß die kapillarerweiternde Wirkung der<br />
UKW auch bei diesen Erkrankungen günstig ist. Nach mündlicher Mitteilung<br />
auf diesem Gebiet besonders erfahrener Autoren (DOENECKE, BOHN) ist dies auch<br />
der Fall. Bei akuter Nephritis mit Anurie empfiehlt VOLHARD UKW-Durchflutungen,<br />
um die Harnsekretion wieder in Gang zu setzen. KOWARSCHIK und HAUER<br />
wandten die KW-Therapie bei Anurie und Präurämie an, auch nach Nierenoperationen.<br />
Die Harnausscheidung kam auch dann wieder in Gang, wenn vorher Diurética,<br />
Kochsalzinfusioncn und Dekapsulation erfolglos gewesen waren. EISEN<br />
REICH beschreibt 2 Fälle von geheilter Anurie bei Eklampsie. Nach FUCHS wirkt<br />
die KW-Durchflutung bci-Anuric oft lebensrettend und verhütet die drohende<br />
Urämie.<br />
Bei subakuten und chronischen Nepbritiden wird der Blutdruck gesenkt, die<br />
Harnmenge vermehrt (SCHWEITZER, VOSS).<br />
Nach HUKASAKO und KOYANAGI wird beim Gesunden die Stickstoffausscheidung bis<br />
maximal 35 %, die Ausscheidung von Harnstoff um 43%, von Schwefelsäuren um 16 bis<br />
217
loo % erhöht. Offenbar war der Eiwcißzerfall gesteigert. ROCCHINI und CALCHI-NOVATI<br />
sahen Anregung und Beschleunigung der Diurèse, dabei Erhöhung der Konzentration<br />
mit Verminderung der Chlormengc.<br />
Bei akuter Glomerulonephritis wurde nach SCHWEITZER der sonst nicht beeinflußbare<br />
krankhafte Sedimentbefund schnell zum Verschwinden gebracht.<br />
Voss behandelte 8 Kinder mit Nephritis. Das Sediment wurde nach 8-10 Tagen<br />
normal, die Diurèse besserte sich, die Konzentrationsfähigkeit<br />
blieb herabgesetzt.<br />
Bei Pyelitis und Cystitis sind die Wirkungen<br />
in manchen Fällen ausgezeichnet,<br />
in anderen fraglich. Die durch Kokken<br />
hervorgerufenen Erkrankungen werden<br />
besser beeinflußt als die durch Coli verursachten.<br />
Sehr gut ist eine Kombination<br />
mit Mandelaten oder Sulfonamiden. Bei<br />
Pyonepbrose kann die UKW-Therapie mit<br />
großem Vorteil angewandt werden. Cystitis<br />
ulcerosa wurde von Feustel erfolgreich<br />
behandelt.<br />
In chronischen Fällen wenden wir<br />
milde Hyperthermie mit Vorteil an.<br />
Bei Durchflutung von Nierenbecken- und<br />
Harnleitersteinen nehmen die Schmerzen<br />
nach starken Dosen manchmal zu. Dies<br />
kann diffcrentialdiagnostisch gegenüber<br />
gewöhnlicher Pyelitis verwandt werden.<br />
Spezifische und unspezifische Orchitis<br />
und Epididymitis wird durch UKW aus-<br />
Abb. 152: Behandlung der Prostata im gesprochen gut beeinflußt, jedoch muß<br />
Sitzen. Untere Elektrode unter dem man mit der Dosierung sehr vorsichtig<br />
Stuhlsitz sein und nur mit kurzen Zeiten (3-5 Minuten)<br />
beginnen.<br />
Der 61jährige H. litt seit 5 Monaten an Epididymitis unbekannter Ätiologie. Der linke<br />
Nebenboden war taubencigroii geschwollen und druckempfindlich. Gonorrhoische Infektion<br />
soll nicht stattgefunden haben, auch war kein Anhalt dafür nachweisbar. Durch<br />
10 Behandlungen im Feld der 4-m-Welle konnte die Erkrankung innerhalb von 4 Tagen<br />
vollkommen beseitigt werden.<br />
Ein sehr dankbares Gebiet für die UKW-Therapie sind die Erkrankungen der<br />
Prostata. Gonorrhoische und unspezifische Prostatitis bessert sich gewöhnlich<br />
schon nach wenigen Durchflutungen. In manchen Fällen muß die Behandlung<br />
monatelang fortgesetzt werden. Auch die Prostatabypertropbie wird sehr gut beeinflußt<br />
(RUETE, BERRY).<br />
Ein 68jähriger Herr kam wegen plötzlich eingetretener Anurie in die Sprechstunde. Er<br />
war schon seit 2 Jahren unter ärztlicher Kontrolle wegen Prostata hypertrophic Die<br />
Prostata war klemapfelgroß, hart und glatt. Durch Katheter wurden allmählich<br />
1200 cem Harn entleert. Spätere Prüfung ergab 600 cem Restharn. Die vorgeschlagene<br />
Operation lehnt der Kranke ab.<br />
218
Nach UKW-Durchflutung sofort Erleichterung, hinterher starke Harnflut. Nach mehreren<br />
Durchflutungen noch weitere Abnahme der Beschwerden, nach 12 Behandlungen<br />
keine Klagen mehr. Nach 8 Wochen im Anschluß an Diätfehler erneute Anurie. Wieder<br />
Ultrakurzwellen. Dazu wird in den ersten 14 Tagen Testoviron eingespritzt. Rasche<br />
Besserung. Testoviron wird weggelassen, UKW fortgesetzt, zuerst täglich, dann jmal<br />
wöchentlich, später nur noch einmal in der Woche. Nach 2 Monaten ist der Kranke völlig<br />
beschwerdefrei und kann aus der Behandlung entlassen werden. Er war noch ; Jahre<br />
später völlig beschwerdefrei und starb an den Folgen eines alten Mitralvitiums.<br />
Viele der Kranken sind nach einer<br />
mehrwöchigen Behandlung jahrelang beschwerdefrei<br />
geblieben, bei anderen mußten<br />
etwa alle 6 Monate etwa 6-8 Durchflutungen<br />
gemacht werden, damit die<br />
Beschwerden wegblieben. Fast allen<br />
Kranken konnte eine Operation erspart<br />
werden. Diemeisten Kranken wurden nur<br />
mit UKW behandelt; einigen wurde zeitweise,<br />
besonders am Anfang, Testoviron<br />
eingespritzt, um über die anfänglichen<br />
Beschwerden rascher hinwegzukommen.<br />
Gewöhnlich setzt schon nach der ersten<br />
Behandlung verstärkte Harnflut ein, die<br />
Beschwerden verschwinden schnell, und<br />
das Allgemeinbefinden bessert sich. Wir<br />
haben bei Kranken mit unter joo cem<br />
Restharn und ohne Präurämie stets diese<br />
Behandlung mit Erfolg durchgeführt.<br />
Zusätzliche Behandlung der Hypophyse<br />
(jmal wöchentlich 10 Minuten) kann das<br />
Ergebnis noch verbessern.<br />
Die Behandlung kann im Sitzen oder<br />
Liegen ausgeführt werden. Zum Sitzen benutzt<br />
man am besten einen Stuhl mit einem<br />
Loch im Sitz. Im Liegen werden die Beine<br />
angezogen. In beiden Fällen kommt die eine<br />
Abb. 153: Behandlung der Prostata mit<br />
Hilfselektrode<br />
Elektrode unter den Damm, die andere größere Elektrode auf den Bauch. Bei leichteren<br />
Fällen genügt diese Anordnung, bei fortgeschrittenen schwereren Erkrankungen wird<br />
noch eine Hilfsclcktrodc in das Rektum eingeschoben (s.Abb.ij3). Die Behandlungsdauer<br />
beträgt 10-15 Minuten bei Dosis II, später Dosis III. Bei schwereren Erkrankungen<br />
wird zunächst täglich, später 2-jmal wöchentlich behandelt, in leichteren Fällen<br />
genügt von vornherein 2~3mal wöchentliche Behandlung, insgesamt 10-12 Durchflutungen.<br />
Bei Prostatitis erzielten HIBBS und OSBORNE in 85 Fällen Heilung, während sie<br />
mit bloßer Erwärmung durch eine ins Rektum eingeführte Thermode keinen Erfolg<br />
hatten.<br />
Induratio penis plastica wird zum Stillstand gebracht, oft wesentlich gebessert.<br />
219
16. Tuberkulosen<br />
Die Erfahrungen sind hier immer noch gering, offenbar da man Aufflackern der<br />
Prozesse befürchtet. Diese Befürchtung ist aber bei vorsichtiger Dosierung unbegründet.<br />
Vor allen Dingen sind noch viel zu wenig Versuche mit verschiedener Dosis gemacht<br />
worden. Sicher ist, daß stereotype, vor allem zu starke Dosierung, niemals<br />
Abb. 154: Tuberkulöses Frühinfiltrat<br />
zum Ziel führt. Bei Kehlkopftuberkulose haben wir gemeinsam mit der Heilstätte<br />
Seltersberg in Gießen KW-Behandlung bei 20 Kranken durchgeführt, worüber<br />
AROLD auf der Tagung der Hals-Nasen-Ohren-Ärzte 193 8 berichtet hat. Allgemein<br />
wurden ausgesprochene Besserungen erzielt. Bei der fortlaufenden Beobachtung<br />
zeigte sich, daß selbst Durchflutungen von 3-4 Minuten Dauer bei Dosis I gelegentlich<br />
stärkere Reaktionen hervorriefen, so daß schließlich nur.noch 2mal in<br />
der Woche je 1 Minute lang durchflutet wurde. Auch für andere tuberkulöse Erkrankungen<br />
besteht sicher ein starker Einfluß der Dosis, so daß hier unbedingt<br />
noch Versuche gemacht werden müßten. Nach den geringen, bisher von uns gemachten<br />
Erfahrungen können wir sagen, daß gewisse Fälle von Tuberkulose für<br />
die KW-Therapie geeignet erscheinen. Es handelt sich dabei hauptsächlich um die-<br />
220
jenigen Erkrankungen, die nicht stark progredient sind, andererseits aber schlechte<br />
Heilungstendenz aufweisen.<br />
Tuberkulosen verschiedenster Art hat SCHEDTLER behandelt. An Bazillen und<br />
mit Tuberkeln infizierten Tieren konnte dieser Autor mit KW keine bemerkenswerten<br />
Wirkungen hervorbringen. Dagegen waren die Erfolge bei manchen Arten<br />
von tuberkulösen Erkrankungen günstig. Bei trockenen Kippenfelient^imdungen mit<br />
Abb. 155: Dasselbe nach 3 Monate langer KW-Behandlung täglich steigend von '/s<br />
auf 5 min, Dosis 1-2<br />
Fieber, Schmerzen und Atembeschwerden wurden in 14 Fallen ausnahmslos gute<br />
Erfolge erzielt. Verschiedene Wellenlängen wirkten dabei gleich. Die subjektiven<br />
Beschwerden gingen schnell zurück. Die Verträglichkeit der Behandlung war stets<br />
gut. Bei feuchter Rippenfellentzündung sind mehr Einzelbehandlungen nötig<br />
(manchmal bis zu 40). Bei 6 Kranken mit hartnäckigen Exsudaten trat Resorption<br />
und Vcrschwartung ein. Die Endzustände waren besonders gut, indem die<br />
Schrumpfungen gering blieben. Vor Beginn der Behandlung wurde ausgiebig punktiert.<br />
Frühere Punktionen hatten bei den Kranken nicht zum Ziel geführt. Bei<br />
2 Kranken blieb die Behandlung erfolglos. Tuberkulöse Empyeme wurden in } Fällen<br />
nicht beeinflußt. Nichttuberkulöse Pleuraeiterungen bzw. Empyemresiböb/en wurden<br />
2mal geheilt. Bei tuberkulösen Artbritiden waren die Erfolge zweifelhaft, bei<br />
nichttuberkulösen Arthritiden gut.<br />
Bei Peritonitis tuberculosa gingen die subjektiven Beschwerden schnell zurück<br />
(4 Fälle), Besserung der Herdsymptome und des Allgemcinzustandcs waren gleichmäßig<br />
gut.<br />
221
Abb. 156 : Offene exsudativ-produktiveLungentuberkulose<br />
bei einem 36 j.<br />
Mann (N.U1.)<br />
Abb. 157: N. Ul. nach<br />
3 Monate langen KW-Behandlung<br />
jeden 2. Tag steigend<br />
von V2 bis 7 min bei<br />
Dosis 2<br />
222
Bei Darmtuberkulose wurden in 3 Fällen die starken Schmerzen rasch beseitigt,<br />
die Darmentleerungen wurden in günstiger Weise reguliert.<br />
Günstig waren ferner die Ergebnisse bei interkurrent aufgetretenen Leiden der<br />
Tuberkulosekranken, wie Neuralgien verschiedenster Lokalisierung, rheumatischen<br />
Affektioncn, Ischias und Hautentzündungen sowie 2 Fällen von Bronchiektasen.<br />
Bei Lungentuberkulose mahnt SCHEDTLER zur Vorsicht, da in einem Fall ein Infiltrat<br />
zur Kaverne eingeschmolzen wurde, bei einer kavernösen Tuberkulose trat<br />
Abb. IJ8: Derselbe Patient nach 6 Monate langer Behandlung<br />
Propagierung ein. Im übrigen waren die Ergebnisse bei Lungentuberkulose<br />
zweifelhaft. Es Hegt aber nur ganz wenig Material vor, da man die Versuche nicht<br />
fortzuführen wagte. Die Lungentuberkulose ist bisher als Gegenindikation für<br />
die KWT angesehen worden. Die Gründe dafür sind nicht ganz klar, denn es sind<br />
bisher keine ernsteren Schaden bei durchfluteten Tuberkulosen bekannt geworden.<br />
Es ist aber durchaus möglich, daß bei Überdosicrung tuberkulöse Herde vorübergehend<br />
zum Aufflackern gebracht werden können; ich habe selbst solche Fälle<br />
erlebt.<br />
Hier wie überall ist die richtige Dosierung für das Ergebnis grundlegend. Bei<br />
Tuberkulosen beginnen wir mit 1-2 Minuten und Dosis I und steigern die Dosis<br />
bei guter Verträglichkeit, jedoch nicht über Dosis II und 5 Minuten; nur bei<br />
Pleuritis kann mit der Zeit höher gegangen werden. Unsere Beobachtungen zeigen,<br />
223
I<br />
daß die KWT bei vielen Formen der Tuberkulosen nicht nur nicht gegenindiziert<br />
ist, sondern daß sich sogar schöne Besserungen erzielen lassen.<br />
Tuberkulöse Frühinfiltrate habe ich wiederholt mit Kurzwellen behandelt und<br />
konnte sie innerhalb von 3-4 Monaten zum völligen Verschwinden bringen. Die<br />
Patienten sind auch später gesund geblieben. In zwei Fällen waren Frühkavernen<br />
röntgenologisch nachweisbar. Sie sind vollständig verschwunden. Der eine dieser<br />
Kranken war mit vom Gesundheitsamt eingewiesen worden, da bei ihm ein Frühinfiltrat<br />
gefunden worden war. Er war für eine Heilstättenbehandlung vorgemerkt.<br />
Unterhalb des Schlüsselbeins waren 2 Kavernen deutlich zu erkennen. Die Wartezeit<br />
bis zur Heilstättencinweisung benutzte ich zur Kurzwellenbehandlung. Auf<br />
der nach 8 Wochen angefertigten Röntgenaufnahme war kein krankhafter Befund<br />
mehr zu erkennen, ebenso konnte in der Heilstätte - auch auf Schichtaufnahmen -<br />
nichts mehr nachgewiesen werden, der Patient wurde nach gründlicher Untersuchung<br />
als gesund wieder nach Hause geschickt, da eine Kur unnötig geworden<br />
war.<br />
Eines kann mit Sicherheit gesagt werden: Die Kurzwellenbehandlung ¡st bei<br />
tuberkulösen Krankheiten nicht kontraindiziert, wenn Technik und Dosierung<br />
einwandfrei gehandhabt werden. Nur falsche Anwendung schadet.<br />
Die bisher vorliegenden Erfahrungen erlauben kein abschließendes Urteil über<br />
den Wert der KW-Therapie bei Tuberkulose, abgesehen von bestimmten Fällen.<br />
Sie regen aber unbedingt dazu an, auf dem beschrittenen Weg weiterzugehen.<br />
17. Wiikungen auf Tumoren<br />
Wie bereits S. 110 berichtet, wird Tumorgewebe erst bei ziemlich hohen Temperaturen<br />
verändert, bei denen auch Lebensgefahr besteht. Hierbei ist auch die<br />
Gefahr der Schädigung von Nachbargewebe und von irreversiblen Schäden am<br />
Blutkreislauf vorhanden. Besonders groß ist die Schwierigkeit, tiefgelegene Tumoren<br />
elektiv zu erhitzen. Vielleicht kann hier die Weiterentwicklung des Strahlenfcldes<br />
bei Mikrowellen zu neuen Ergebnissen führen.<br />
Die Versuche von LANGENDORFF lassen aber von kombinierter KW-Röntgenbestrahlung<br />
Fortschritte auf diesem Gebiet erwarten, ebenso wie die Erfahrungen<br />
von HEEREN.<br />
Schon früher sind Versuche angestellt worden, Gewebe gegenüber Röntgenstrahlen<br />
zu sensibilisieren und ihre Empfindlichkeit herabzusetzen, v. BERDT<br />
machte zuerst derartige Versuche mit Diathermie, MÜLLER, WERNER und CAAN,<br />
LENZ und TEILHABER sahen bei einer solchen Kombination bessere Erfolge als<br />
bei alleiniger Röntgenbehandlung. Allerdings stellte CHR. MÜLLER fest, daß bei<br />
tiefliegenden Tumoren diese Wirkung nur gering war. FUCHS wandte 1936 zuerst<br />
kombinierte KW- und Röntgenbehandlung an. Am Kaninchenhoden fand<br />
MÜHLENHARDT eine erheblich stärkere Wirkung einer Röntgenbestrahlung, wenn<br />
KW-Durchflutungen vorhergegangen waren (20 Minuten UKW, dann 2400 bis<br />
2800 r). Die Scrtoli-Zellen wurden völlig zerstört, es waren keine samenbildenden<br />
Zellen mehr zu sehen. Regeneration trat nicht mehr auf. An den Blutgefäßen war<br />
nichts verändert. Strahlende Wärme gleichzeitig mit Röntgenstrahlen hatte nicht<br />
dieselbe Wirkung. VALLEBONA und DENIER bestätigten die erhöhte Wirkung der<br />
Kombination von Kurzwellen mit Röntgenstrahlen.<br />
Beim Menschen machte zuerst KORB kombinierte Bestrahlungen mit ähnlichen<br />
224
Ergebnissen. Die Dosis spielt dabei eine große Rolle. Nach LANGENDORFF wird<br />
das Optimum der kombinierten Behandlung erzielt, wenn die Röntgenbestrahlung<br />
sofort an die UKW-Durchflutung angeschlossen wird. Jeder zeitliche Zwischenraum<br />
wirkt ungünstig auf das Ergebnis. Wegen der guten Tiefenwirkung ¡st nach<br />
KORB die i-m-Welle den längeren Wellen überlegen.<br />
HEEREN bestrahlte Karzinome bei Menschen mit UKW und Röntgenstrahlen.<br />
Von 7 Ösophaguskarzinomen wurden j deutlich gebessert, von 14 Magenkarzinomen<br />
wurden 5 nicht sicher beeinflußt, 9 dagegen deutlich gebessert. Mediastinaltumoren,<br />
Lungenkarzinom und Rektumkarzinom wurden gebessert und verkleinerten<br />
sich zeitweise. Alle diese Fälle hatten jedoch keine Aussicht auf Heilung.<br />
Dagegen trat stets eine auffallende Besserung des Allgemeinbefindens und des<br />
Appetits ein. Das Hämoglobin stieg bis um 20%, auch das Gewicht stieg an.<br />
Gleichzeitige Insulinbehandlung hatte keinen Einfluß. Der von manchen Autoren<br />
geprägte Satz: «Die Patienten sterben an den Folgen der Behandlung» wird durch<br />
die Kombinationsbehandlung in das Gegenteil verkehrt. Nach HEEREN wurde bei<br />
Besserung des Zustandcs das Leben verlängert; beim Magenkarzinom von<br />
4 Monaten (nach WEESE) auf i 1 /* Jahr.<br />
Technik: UKW 15-20 Minuten kräftig, dann Röntgen nach HOLFELDER-Verfahren<br />
täglich 60% HED in Kreuzfeuertechnik, 180 KV, 4 mA, 0,5 Cu, FHA<br />
40 cm. FUCHS schickt den Röntgenbestrahlungen maligner Tumoren eine Kurzwellendurchflutung<br />
von 10-ij min Dauer voraus, mit Dosis 3. Er findet eine erhebliche<br />
Steigerung der Strahlensensibilität der Tumoren. Bei inoperablen Karzinomen<br />
wurden z.T. mehrjährige Remissionen erzielt. Insgesamt wurden über 200<br />
Karzinome und Sarkome verschiedener Art behandelt. Über ähnliche Ergebnisse<br />
berichten ARONS & SOKOLOFF aus USA, BIRKNER & WACHSMANN, KORB. Wie<br />
LANGENDORFF konnte auch MIKAWA bei Gewebekulturen eine Steigerung der<br />
Strahlenscnsibilität in Gewebekulturen feststellen.<br />
DENIER sah bei Kombinationsbehandlung mit Wellenlänge 80 cm stets Rückgang<br />
bei Rezidiven von Tumoren des Uterus, des Magens und Ösophagus. Bei<br />
einem Teil traten Rezidive ein. Kombination mit Radium hatte nach IREDELL<br />
gute Erfolge bei malignen Geschwülsten am Meatus acusticus ext. und bei Aktinomykose,<br />
obwohl vom Chirurgen eine schlechte Prognose gestellt worden war.<br />
Nach MOSSBERG wird die Fibroadenomatosis mammae gut beeinflußt. Von<br />
j8 behandelten Fällen wurden 42 symptomfrei. Es wurden 5—15 Behandlungen<br />
von zuerst 2-5 Minuten, später io-ij Minuten Dauer gegeben. Ca wird nicht beeinflußt.<br />
Aussichtsreicher erscheint die Beeinflussung des Tumorwachstums vom Endokrinium<br />
her, durch KW-Behandlung von Hypophyse und Gonaden (S.246 ff).<br />
18. Die Wirkungen auf die Hirnbasis und auf das endokrine System<br />
Im Jahre 1932 habe ich erstmalig gemeinsam mit WEISSENBERG über Uniersuchungen<br />
an Tieren und Menschen berichtet, bei denen es gelungen war, mittels<br />
Durchflutungen der Hirnbasis die Blutzuckerregulierung und die Funktion endokriner<br />
Drüsen zu beeinflussen. Nach Durchflutungen des Kopfes mit verhältnismäßig<br />
schwachen Dosen stieg der Blutzucker meist bis auf den doppelten Ausgangswert<br />
an, nach Durchflutung einer Extremität entstand regelmäßig eine Senkung,<br />
während nach Durchflutung des Oberbauches erst ein kurzer Anstieg, dann eine<br />
225
Senkung beobachtet wurde (Abb. 83, S. 91). Gesunde Menschen reagierten in<br />
derselben Weise, wie auch spätere Untersuchungen meiner Mitarbeiter WÜST,<br />
FABRI, SATTLER ergeben haben. Das Absinken des Blutzuckers nach Durchflutungen<br />
der Muskulatur erklärt sich höchstwahrscheinlich daraus, daß die Ultrakurzwellen<br />
die Membrandurchlässigkeit beeinflussen und daß der Zucker stärker<br />
an die Zellen fixiert wird.<br />
Daß es die Hypophyse ist, die auf KW-Durchflutung der Hirnbasis anspricht,<br />
und nicht etwa das Gehirn, wird durch folgende Beobachtungen bewiesen oder<br />
zum mindesten sehr wahrvi(£%<br />
scheinlich gemacht:<br />
;\— Normal Das gesunde Nervensystem<br />
spricht auf KW-Reize der üblichen<br />
Dosis nur wenig an.<br />
Erscheinungen, die auf Beeinflussung<br />
des Zentralnervensystems<br />
zurückzuführen wären,<br />
sind nicht nachweisbar. Erst bei<br />
sehr starken und konzentrierten<br />
KW-Reizen, die bereits Wärmeschädigungen<br />
hervorrufen, wer<br />
60 90 120 750min.noch<br />
VKW<br />
Abb. 159: Blutzuckerkurven nach Durchflutung<br />
mehrerer endokriner Drüsen bei 30 gesunden<br />
Studenten (Durchschnitt). H — Hypophyse,<br />
Ob — Oberbauch, G — Genitale. Punktiert:<br />
Arm. Diese Kurven wurden 1943/44 gemacht.<br />
Beim Vergleich mit Abb. 169 fallen die geringeren<br />
Anstiegshöhen auf, was auf die damalige<br />
schlechte Ernährung zurückzuführen sein dürfte<br />
den Störungen der Wärmeregulierung<br />
beobachtet (SCHLIE-<br />
PHAKE, STRASSBURGER, OSTER-<br />
TAG).<br />
Im Sinne einer Beeinflussung<br />
der Hypophyse spricht weiterhin,<br />
daß bei ihrer direkten<br />
elektrischen Reizung ähnliche<br />
Blutzuckerveränderungen hervorgerufen<br />
werden wie im K W-<br />
Feld (KROLL und BECKER,<br />
REISS). Bei Menschen, deren<br />
Hypophyse operativ entfernt oder durch Röntgenbestrahlung entfernt worden ist,<br />
ruft die Durchflutung keine Veränderungen des Blutzuckers hervor.<br />
Bei zwei Patientinnen, die an hypophysärer Magersucht litten, habe ich Implantation<br />
von Kalbshypophyse in die Glutäalmuskulatur vorgenommen. Bei einer<br />
KW-Durchflutung vor der Implantation entstand die für Muskeln typische Blutzuckerkurve<br />
mit Abfall um 2omg%. Nachdem das Implantat eingeheilt war, fand<br />
ich nach Durchflutung einen Anstieg des Blutzuckers ähnlich wie nach Durchflutung<br />
der Hypophyse. 3 Monate später war das Verhalten wieder wie am Anfang.<br />
(Abb. 168).<br />
Auch andere Stoffwechselfaktoren werden beeinflußt, auf die die Hypophyse<br />
Einfluß hat, so die Ausscheidung von Ketosteroiden, die Menses, das Serum-<br />
Cbolesterin, der Wasserbaushalt, wie im folgenden noch ausgeführt wird.<br />
Wie noch gezeigt wird, sprechen alle inkretorischen Drüsen mehr oder weniger<br />
stark auf die KW-Durchflutung an. Auch diese Tatsache spricht dafür, daß die<br />
endokrine Substanz besonders empfindlich für Kurzwellenreiz ¡st (wahrscheinlich<br />
durch Beeinflussung der Membrandurchlässigkeit) und daß infolgedessen<br />
auch die Hypophyse besonders stark darauf anspricht.<br />
226
Im gleichen Sinne spricht es, daß bei bestimmten Krankheiten der Hypophyse die<br />
Blutzuckeckurvcn verändert sind. Bei Krankheiten, von denen wir wissen, daß<br />
eine Überfunktion der eosinophilen Zellen vorliegt, ist der Blutzuckeranstieg verstärkt,<br />
bei Hypertrophie der basophilen Zellen fehlt der Anstieg oder wir finden<br />
sogar einen Abfall.<br />
Interessant ist, daß die meisten Drüsen mit innerer Sekretion in irgendeiner<br />
Weise den Blutzucker beeinflussen (Abb.i88). Bei Durchflutung der Hirnbasis<br />
gesunder Menschen erfolgt zunächst ein Anstieg des Blutzuckers um 20-40 mg%,<br />
nach etwa einer Stunde ein Wiederabfall. Die Stärke des Anstiegs hängt von der<br />
Stärke der Durchflutung und von dem Funktionszustand der Drüse ab. Nach<br />
meinen bisherigen Erfahrungen mit ungefähr 3000 Blutzuckerkurven ist der Anstieg<br />
bei ergotroper Einstellung verstärkt, bei trophotroper Einstellung vermindert.<br />
Wir können annehmen, daß ein Teil der Hypophysenhormone ergotrope<br />
Wirkungen haben (thyreotropes Hormon, STH) und daß eine andere Gruppe der<br />
Hormone trophotrop wirkt (ACTH, Gonadotropine).<br />
Diese beiden Gruppen von Hormonen stehen im gesunden Organismus in<br />
einem gewissen Gleichgewicht, wodurch auch der Blutzucker auf seiner normalen<br />
Höhe erhalten wird. Bei KW-Durchflutung wird zunächst die ergotrope<br />
Funktion angeregt (die ja allgemein schneller reagieren muß), der Blutzucker<br />
steigt an. Bei einem Überwiegen der ergotropen Funktion wird dieser Anstieg verstärkt.<br />
Wif dürfen daher annehmen, daß ein überfunktionierender Anteil einer<br />
Drüse zunächst zu noch stärkerer Tätigkeit veranlaßt wird. Diese Annahme wird<br />
gestützt durch weitere, im folgenden wiedergegebene Untersuchungen und durch<br />
Beobachtungen zahlreicher Autoren.<br />
Unsere Beobachtungen bieten eine Möglichkeit, sich über den Funktionszustand<br />
einzelner inkretorischer Drüsen ein Bild zu machen, und ich habe darauf fußende<br />
Funktionspräfungen des endokrinen Systems aufgebaut. Die bisherigen Möglichkeiten,<br />
sich am lebenden Menschen ein Bild über die Funktion der Drüsen zu<br />
machen, sind gering oder ungenau. Injektionen von Hormonen wirken nicht nur<br />
auf das gesamte endokrine System, sondern darüber hinaus auf fast alle Organe.<br />
Die Mehr- oder Minderausscheidung bestimmter Hormone (Ketosteroide usw.)<br />
kann verschiedene Ursachen haben und beim Diabetes gibt die Beobachtung der<br />
Zuckerbiianz und Toleranz nur ein aus vielen Faktoren integriertes Gesamtbild,<br />
eine Endsumme, die über die Beteiligung der einzelnen Drüsen und Organe nichts<br />
aussagt. Dasselbe gilt für die anderen bisher üblichen «Funktionsprüfungen» des<br />
endokrinen Systems.<br />
Die KW-Funktionsprüfung erlaubt bei einigen Drüsen eine ganz isolierte Beeinflussung<br />
(Hoden, Schilddrüse) bei manchen anderen Drüsen kann die Reizung<br />
nicht so selektiv ausgeführt werden, weil benachbarte Organe ins Feld mit einbezogen<br />
werden. Man kann aber doch meist eine spezifische Reaktion der zu<br />
prüfenden Organe (bei NN-Durchflutung Anstieg der Ketosteroid-Ausscheidung<br />
usw.). beobachten.<br />
Der Blutzucker ist heute in fast jedem klinischen Laboratorium leicht zu bestimmen<br />
und daher am geeignetsten für die Zwecke der Funktionsprüfung. Schon<br />
die Durchflutung größerer Muskelmassen hat einen Einfluß auf den Blutzucker,<br />
und zwar sinkt er nach ij Minuten langer Durchflutung um rund 20 mg% ab,<br />
einerlei ob man eine Extremität, Rücken oder Brust durchflutet. Nach der Durchflutung<br />
des Qberbaucbs pflegt der Blutzucker um 20-30 mg% anzusteigen. Hier<br />
werden Pankreas, Leber und Nebennieren getroffen. Daß die NN dabei reagieren,<br />
227
geht aus der vermehrten Ausscheidung von Kctosteroiden hervor. Untersuchungen<br />
bei Diabetikern könnten auch dafür sprechen, daß Glukagon im Pankreas mobilisiert<br />
wird. Bei mit Alloxan vergifteten Kaninchen ist der Anstieg verstärkt. Andererseits<br />
sah SPIEGL auch bei einem Patienten mit Phäochromozytom einen vermehrten<br />
Anstieg, so daß wahrscheinlich anzunehmen ist, daß sowohl das Pankreas als<br />
auch die Nebennieren am Blutzuckeranstieg beteiligt sind. Hier müßte durch Versuche<br />
mit Ausschaltung oder Auslagerung der<br />
HVparmyicDie<br />
Abb. 160: Blutzucker-Funktionskurve<br />
bei Hyperthyreose<br />
(thyreogene Form). Nach<br />
Durchflutung der Schilddrüse<br />
sehr starker Anstieg des Blutzuckers,<br />
nach Hypophysendurchflutung<br />
Abfall (Gegenregulation),<br />
bei Durchflutung<br />
der Gonaden Anstieg<br />
betreffenden Organe Klarheit geschaffen werden.<br />
Die normale Schilddrüse reagiert auf UKW-<br />
Durchflutung mit einem geringen Anstieg des<br />
Blutzuckers. Bei thyreotoxischen Schilddrüsen ist<br />
meist ein stärkerer Anstieg vorhanden, wenn die<br />
Krankheit nicht rein hypophysenbedingt ist; nach<br />
Durchflutung der gewöhnlichen Struma sinkt der<br />
Blutzucker ab, was auf eine Unterfunktion des<br />
Organs hindeutet.<br />
Durchflutung der Testes ruft eine charakteristische<br />
zweigipflige Blutzuckerkurve hervor, bei der<br />
der Abfall überwiegt, die Kurven nach Durchflutung<br />
des Unterbauchs von Frauen im Intermenstruum<br />
verlaufen ähnlich ; während der Menses<br />
sind sie verändert, wie KIHN in zahlreichen Untersuchungen<br />
nachweisen konnte. ERBSLÖH & Lo-<br />
RENTZEN stellten bei 24 gesunden Frauen fest, daß<br />
bei Durchflutung der Ovarien schon mit 20 Watt<br />
die gleichen charakteristischen Veränderungen des<br />
Blutzuckers auftreten wie bei Anwendung stärkerer<br />
Energien. Einfache Erwärmung des Untcrbauches<br />
hatte keine Wirkung.<br />
PiOTTi und BRAGA haben die gleichen Veränderungen des Blutzuckers nach<br />
Durchflutung der Hypophyse nachgewiesen. Sie fanden bei einem Teil der Versuchspersonen<br />
Anstieg, bei anderen Abfall des Blutzuckers. Um diese verschiedene<br />
Reaktionsweise zu erklären, untersuchten sie gleichzeitig das Verhalten dieser<br />
Individuen auf Injektionen von Adrenalin und Insulin. Dabei ergab sich, daß bei<br />
denjenigen Menschen, die auf Adrenalin stark ansprachen, ein kräftiger Anstieg<br />
des Blutzuckers nach Kopfdurchflutung auftrat. Diese Individuen sind ergotrop<br />
eingestellt. Bei denjenigen Personen, die auf Kopfdurchflutung mit Gleichbleiben<br />
oder Abfall des Blutzuckers reagiert hatten, fand sich eine besonders starke Empfindlichkeit<br />
gegenüber Insulin. Es handelt sich um stark trophotrope, «vagoton»<br />
eingestellte Menschen.<br />
Die Kopplung des vegetativen Nervensystems mit dem endokrinen System ist sehr eng,<br />
allein schon dadurch, daß Vagus und Sympathikus über die hormonähnlichen intermediären<br />
Wirkstoffe ihren Einfluß ausüben; diese sind auf der einen Seite Azetylcholin<br />
und Histamin, auf der anderen Seite das Adrenalin bzw. Sympathin.<br />
Ich konnte 1926 nachweisen, daß das Schilddrüscnhormon nicht den Sympathikus<br />
reizt, sondern ihn für Adrenalin sensibiliert - abgesehen von seinen unmittelbaren<br />
Wirkungen auf die exothermen Gewerbsreaktionen. Ähnliches gilt für viele andere<br />
Hormone.<br />
Immer wieder ist versucht worden, auf der Reaktion nach Einspritzung von Adrenalin<br />
eine Funktionsprüfung des vegetativen Systems aufzubauen. Solche Prüfungen haben<br />
228
nur dann Wert, wenn, wie bei meinen eben geschilderten Versuchen, völlig klare Verhältnisse<br />
geschaffen werden können, etwa durch Exstirpatton eines Organs oder Zufuhr bestimmter<br />
Wirkstoffe. Im übrigen hängt die Reaktion auf einen der intermediären Wirkstoffe<br />
von zahlreichen unübersehbaren Faktoren ab. Schon die Ansprechbarkeit der<br />
Zellen kann eine verschiedene Ausgangslage schaffen und damit die Reaktion verändern.<br />
Sic kann wiederum konstitutionell bestimmt sein, sie kann vom Zentralnervensystem aus<br />
beeinflußt werden, und schließlich spielt die Disposition eine Rolle, die wiederum weitgehend<br />
vom Zusammenspiel der Hormone bestimmt wird. In meiner Arbeit 1926 habe<br />
ich das vegetative System als eine Ebene mit unendlich vielen Freiheitsgraden bezeichnet,<br />
die durch irgendeinen Ausfall oder durch Kräfte, die an irgendeiner Stelle angreifen,<br />
weitgehend verändert und verschoben werden kann. Bei jeder solchen Veränderung<br />
treten sofort Gegenregulierungen verschiedener Art auf, so daß der Zeitpunkt, an dem<br />
die Untersuchungen gemacht werden, von größter Wichtigkeit ist.<br />
Bi mg %<br />
100<br />
l Woche intratnenstruell<br />
30-<br />
ao-<br />
7f>-<br />
so mm 15 30<br />
t<br />
2. Woche postmenstruell<br />
3. Woche intermenstrueü k Woche ¡¡rsemsastrueli<br />
Abb. 161 : Blutzuckerkurven nach Durchflutung der Hypophyse<br />
während verschiedener Stadien des Menstrualzyklus (nach L. KIHN)<br />
Von der Frage ausgehend, ob ACTH in der Hypophyse aktiviert wird, hat<br />
L. KIHN Untersuchungen über das Verhalten der eosinophilen Zellen im Blut eingestellt.<br />
Sie fand nach KW-Durchflutungen der Hypophyse einen starken Abfall.<br />
Selbst wenn man in Betracht zieht, daß der Gehalt des Blutes an eosinophilen Zellen<br />
sich spontan oft innerhalb kurzer Zeit ändern kann und daß er sich auch nach<br />
Durchflutung beliebiger Körpersteücn etwas ändert, gehen die Werte nach Kopfdurchflutung<br />
doch weit über die gewöhnlichen Schwankungen hinaus. DESGREZ<br />
und PAINVTN fanden ebenfalls einen Abfall der Eosinophilen im Blut sowie in<br />
Tierversuchen eine Herabsetzung des Gehaltes der Nebennieren an Ascorbinsäure<br />
nach längeren Durchflutungssericn. Nach DE G ROOT tritt nach Kopfdurchflutungen<br />
Lymphopenie ein.<br />
Sehr gründliche vergleichende Untersuchungen wurden von E.ADLER und<br />
A.MAGORA durchgeführt. Sie durchfluteten bei drei Gruppen von gesunden<br />
Menschen Knie, Kopf und Oberbauch. Bei allen trat ein Abfall der eosinophilen<br />
Zellen im strömenden Blut auf und zwar weitaus am stärksten nach Durchflutung<br />
des Kopfes (Abb. 161). Der Abfall war nach 40 Minuten langer Bestrahlung<br />
stärker als nach 20 Minuten. Die Reaktionen am Vor- und Nachmittag unter-<br />
229
schieden sich nicht wesentlich. Die Ergebnisse wutden durch den negativen Ausfall<br />
von Wärmebestrahlungen und «Placebo»-Versuche bekräftigt. Die Verfasser<br />
nehmen an, daß die KW-Durchflutung einen unspezifischen «stress» auf das Hypophysen-Nebennierenrinden-System<br />
ausübt und auf dem Umweg über ACTH<br />
Mobilisierung wahrscheinlich eine Ausschüttung von Oxy-Cot ticos tero ¡den verursacht.<br />
Sie glauben, daß die von ihnen erzielten Erfolge bei rheumatischer<br />
Arthritis auf diese Hormonausschüttung zurückzuführen ist.<br />
- M > -<br />
Knie Kopf<br />
zo min t,o min w nun uo win<br />
% r-i n r<br />
- 60-<br />
- so-J LI. i-J-.Li I l.J 1 -L I I I 1 I 1 I LI. I —Li _<br />
0 1 2 3 4 - 0 1 Z 3 k 0 1 2 3 4 0 T Z 3 U<br />
Abb. 162: Verhalten der eosinophilen Zellen nach Durchflutung von Knie und Kopf<br />
(nach ADLER & MAGORA)<br />
Die Lipoide im Serum ändern sich nach Durchflutung der Hypophyse und zwar<br />
findet sich bei Gesunden regelmäßig ein Anstieg des Gesamtcholesterins um<br />
3-10 mg%, an dem der freie und veresterte Anteil in gleicher Weise beteiligt sind.<br />
KÜVER untersuchte jo gesunde Personen und konnte den Anstieg regelmäßig feststellen.<br />
Auch nach Durchflutung der Mify ändert sich der Cholesteringehalt des<br />
Blutes, jedoch sind hier die individuellen Verschiedenheiten sehr groß.<br />
Über das Verhalten der Eiweiß kör per sind Untersuchungen von HEYMANN und<br />
von GÜNTHER mittels Protogramm im Serum durchgeführt worden. Sie ergaben<br />
aber keine signifikante Verschiebung zwischen den einzelnen Eiweißfaktoten nach<br />
Durchflutung inkretorischer Organe bei Gesunden. Das Verhältnis der Fraktionen<br />
zueinander wird sehr zäh festgehalten.<br />
Die Ausscheidung der Ketosteroide ist von mehreren Forschern untersucht worden.<br />
ANTOGNETTT fand nach Durchflutung der Nebennierengegend immer einen<br />
Anstieg der Ausscheidung, während nach Durchflutung des Kopfes bei manchen<br />
Menschen ein Anstieg, bei anderen ein Abfall erfolgte. Nach Piorri und BRAGA<br />
steigen die reduzierenden Kortikoide am stärksten an. Die Ausscheidung der<br />
17 Ketosteroide wird durchschnittlich um 15% (4-48%) erhöht. Sic geht nicht<br />
parallel mit der Ausscheidung der 11 Oxysteroide. Die Veränderungen des Blutzuckers<br />
können nach diesen Autoren nicht durch Abgabe von ACTH oder STH<br />
verursacht sein, denn diese Hormone ändern den Blutzucker nicht. Die Autoren<br />
glauben, daß im Zwischenhirn und Hyophysenstiel Adrenalin und Acctylcholin<br />
230
mobilisiert werden und daß diese Stoffe Reize auf die Hypophyse und vielleicht auf<br />
die Peripherie ausüben können.<br />
GUERCIO und BRAGA fanden bei kastrierten Füchsen nach Durchflutung des<br />
Kopfes eine Erhöhung der Ausscheidung von Pregnandiol im Harn, dessen Ursprung<br />
nur die Nebennierenrinde sein kann. SCHLIEPHAKE und LUTZ sahen nach<br />
io Minuten langer Durchflutung der Hypophysengegend<br />
gesunder Menschen meist ein Absinken<br />
der Ketosteroide im Harn, bei einer Kranken mit<br />
Bronchial-Asthma einen Anstieg und bei einem<br />
Kranken mit Tumor im Oberbauch einen sehr<br />
starken Abfall.<br />
Die Menstruation kann nach Durchflutung des<br />
Kopfes verfrüht eintreten, auch wurde beobachtet,<br />
daß bei Frauen, die schon j-6 Jahre jenseits der<br />
Menopause standen, wieder mensesähnliche Blutungen<br />
eintraten, wenn sie wochenlang KW-Bestrahlungen<br />
auf den Kopf erhalten hatten. Bei<br />
Männern wird die Libido sexualis angeregt.<br />
Über den Einfluß der Hypophysendurchflutung<br />
auf den Wasserhaushalt stellten HAUS und JAHN<br />
umfangreiche Untersuchungen an. Bei Gesunden<br />
wurde die Ausscheidung im Trinkversuch immer<br />
verändert, aber bei einem Teil der Versuchspersonen<br />
trat Retention, bei einem Teil vermehrte<br />
Ausschwemmung ein. Bei 213 Kranken mit Tuberkulosen<br />
und un spezifischen Erkrankungen der<br />
Lungen durchfluteten die genannten Autoren die<br />
Schädelbasis 30 Minuten lang mit 6-m-Welle, nach<br />
dem die Kranken 4 Tage lang immer die gleiche<br />
Menge Flüssigkeit und Kochsalz erhalten hatten.<br />
Am 2. Tag wurde ein Trinkversuch mit 800 cem<br />
Wasser durchgeführt, dieser Versuch wurde 2 Tage<br />
später wiederholt (Hauptversuch), jedoch wurde<br />
gleich nach dem Trinken die Schädelbasis durchflutet.<br />
Bei einem Teil der Kranken wurden auch<br />
Chloride und Ketosteroide im Harn bestimmt.<br />
HAUS und JAHN fanden signifikante Unterschiede<br />
in der Reaktion der Tuberkulösen und zwar in Abhängigkeit<br />
von der Aktivität der Tbc beziehungsweise<br />
der Reaktionsart der Kranken. (Abb. 163)<br />
Bei den vorwiegend produktiven Fällen zeigte sich in der Regel eine Zunahme<br />
der Ausscheidung nach Durchflutung, die Kranken mit exsudativen Tbc-Formen<br />
reagierten mit Retention. Wenn sich der Verlauf der Krankheit änderte, war auch<br />
die Hypophysenreaktion umgestellt, und zwar meist schon vor Eintritt der Veränderung.<br />
Bei mehreren Kranken hatten zuerst produktive Verlaufsformen vorgelegen,<br />
und sie hatten dem gemäß nach derHypophysendurchflutungüberschicßend<br />
ausgeschwemmt. Nachdem die Krankheit eine exsudative Form angenommen<br />
hatte, bewirkten erneute Hypophysendurchflutungen Wasserretention. Ein ähnliches<br />
Verhalten fand sich bei unspezifisch entzündlichen Lungenerkrankungen.<br />
231<br />
+ 40<br />
20<br />
0<br />
10<br />
40<br />
ea<br />
+ 40<br />
to<br />
0<br />
zs<br />
" *s<br />
EO<br />
eo%<br />
40 °k<br />
4 20<br />
0<br />
20<br />
- 40<br />
SO<br />
15%<br />
i i<br />
15%<br />
günstig<br />
fsiPaf.J<br />
SSW.<br />
7sPaf<br />
_L<br />
Ver<br />
Besserung ùbtr<br />
zGndeínPan<br />
lauf<br />
ungünstig<br />
fsiPiti<br />
r<br />
«.Z Pjf<br />
J<br />
40 Par.<br />
r<br />
Vf rs efe fife run jen<br />
in to j<br />
l/tersc/iuC<br />
flefenfton<br />
Abb. 163: Einfluß von Durchflutungen<br />
der Hirnbasis auf<br />
die Wasserausscheidung bei<br />
Patienten mit produktiven<br />
(links) und exsudativen (rechts)<br />
Formen von Tuberkulose
Die Kochsalzausscheidung ging der Wasserausscheidung parallel, die Ausscheidung<br />
von Ketosteroiden und Adiurctin standen in keiner eindeutigen Beziehung<br />
dazu. Offenbar besteht ein Zusammenhang zwischen den zentralnervösendokrinen<br />
Faktoren, die den Wasserhaushalt regeln, und denjenigen, die die<br />
Reaktionsart des Organismus auf Entzündungserreger und damit den Charakter<br />
der Entzündung (produktiv oder exsudativ) bestimmen.<br />
E. HORTEN fand nach Durchflutung der Hirnbasis einen Abfall der Lympho^jten-<br />
%ahl im strömenden Blut. Der Sauerstoffverbrauch wurde um 4-27 % erhöht, es<br />
trat Schlaflust ein. Die Spontandiurese nach Trinken von 800 cem Wasser stieg im<br />
Zweistundenwert um 350-500 cem an. Die Elektrolytausscheidung nahm zu, die<br />
StickstofTausscheidung blieb gleich.<br />
Dafür, daß bei Durchflutung des Oberbauches die Hebennieren mit reagieren,<br />
sprechen die Versuche von ANTOGNETTI, der nach Bauchdurchflutung immer einen<br />
Anstieg der Ketosteroide im Harn nachwies. Die Höhe dieses Anstieges war<br />
individuell verschieden, er war aber in allen Fällen significant.<br />
SPIEGL durchflutete bei einer Kranken mit rechtsseitigem Phäochromozytom die<br />
beiden Nebennieren getrennt. Bei Durchflutung auf der Seite des Tumors war<br />
der Anstieg des Blutzuckers ca. 6mal so hoch als nach Durchflutung der gesunde;<br />
Seite. Nachdem das Phäochromozytom exstirpiert worden war, wurde der Versuch<br />
wiederholt. Der übermäßige Anstieg war jetzt nicht mehr vorhanden (Abb. 66).<br />
Blutgerinnungs^eit und Biutungs^eit werden nach Durchflutungen der Hypophyse<br />
verändert. Es war mir aufgefallen, daß es oft unmöglich war, bei Tieren nach<br />
der Hypophysendurchflutung Blut zu entnehmen. Entnommenes Blut gerann nach<br />
wenigen Sekunden. Daraufhin habe ich bei über 200 Gesunden und Kranken das<br />
Verhalten dieser Blutfaktoren untersucht. Es ergab sich, daß bei Gesunden nach<br />
5 Minuten die Blutungszeit sowohl wie die Gerinnungszeit bis fast auf die Hälfte<br />
verkürzt werden nach 15 min langer Durchflutung der Hypophyse. Nach 10 bis<br />
15 Minuten normalisieren sich die Werte und gehen dann in eine Verlängerung über ;<br />
nach 1-2 Stunden ist der Anfangswert wieder erreicht. Bei den meisten Patienten<br />
und Versuchspersonen wurde nur je eine Blutentnahme vor und 10 Minuten nach der<br />
Durchflutung vorgenommen. Das Ergebnis war übereinstimmend. Es zeigte sich,<br />
daß bei allen Gesunden Blutungszeit und Gerinnungszeit abfallen. Die Prothrombinzeit<br />
fällt nicht so stark wie die in der üblichen Weise bestimmte Gerinnungszeit.<br />
Offenbar sind es andere Faktoren als das Prothrombin, die in der Hauptsache verändert<br />
werden.<br />
Von besonderem Interesse ist hier die Reaktion von Patienten mit Störungen des<br />
Blutkreislaufes verschiedener Art.<br />
Bei Hypertonie, Ulcuskrankhcit und Carcinomatose sind keine signifikanten<br />
Veränderungen festzustellen. Bei vegetativer Dystonie scheint die Blutungszeit<br />
noch stärker verkürzt zu werden als bei völlig Gesunden, doch sind hier die Versuchsziffern<br />
noch nicht groß genug, um eine eindeutige Aussage zu erlauben. Dagegen<br />
fallen die Patienten mit verhältnismäßig frischen Apoplexien, Herzinfarkten<br />
und Thrombophlebitis aus dem Rahmen. Hier wird die Blutungszeit verkürzt, die<br />
Gerinnungszeit verlängert. Es besteht eine Diskrepanz zwischen diesen beiden<br />
Größen. Dieses Verhalten eröffnet interessante Perspektiven. Einerseits istbekannt,<br />
daß bestimmte Beziehungen zwischen den Gerinnungsfaktoren einerseits, der<br />
Durchlässigkeit der Gefäßwände andererseits bestehen. Ferner haben DESGREZ<br />
und PAINVIN in Tierversuchen nachgewiesen, daß seelische Belastungen, etwa<br />
Lärm oder die mit dem Transport verbundenen Erregungen die Gerinnungszeit<br />
232
eeinflussen können. Die Autoren schreiben, daß sie sich die Zusammenhänge<br />
nicht erklären können. Diese Erklärung ergibt sich durch meine Untersuchungen.<br />
Das Ergebnis der Durchflutungen des Hypophyscn-Zwischenhirnsystems spricht<br />
dafür, daß auch die vom Zentralnervensystem ausgehenden Impulse bestimmte<br />
Hormone der Hypophyse aktivieren und daß auf diesem Wege die Gerinnungsfaktoren<br />
und die Gefäßwände<br />
beeinflußt werden. Hier werden mo% Kaninchen Nr. 383<br />
die Glieder einer Kette sichtbar,<br />
die von den seelischen Erregungen<br />
über das hormonale System<br />
zu Veränderungen des Blutes und<br />
der Blutgefäß wände hinführt,<br />
damit unter Umständen zur Angina<br />
pectoris, der Apoplexie und<br />
dem Herzinfarkt.<br />
Schließlich sei darauf hingewiesen,<br />
daß die Blutzuckerkurve<br />
nach Hypophysendurchflutung<br />
von den einzelnen Individuen<br />
in ziemlich gleichbleibender<br />
Form festgehalten wird. Bei<br />
6 Kaninchen haben wir die Funktionsprüfung<br />
in Zeitabständen<br />
von 3 Monaten wiederholt; bei<br />
jedem Tier wurde immer die<br />
VtO -i<br />
r-<br />
$ Min KW Kopf këitesWasser<br />
_.__<br />
wamesWasser<br />
ohne Wasser<br />
P-—-o ~""°*'*^.<br />
Abb. 164: Hypophysenfunktionskurven von<br />
einem Kaninchen bei normaler Umgebung, nach<br />
Baden in Eiswasser und im Uberwärmungsbad<br />
gleiche charakteristische Form gefunden. Unter äußeren Einflüssen kann sich aber<br />
diese Form vorübergehend verändern. Nachlängerdauernden kalten Bädern fanden<br />
wir eine Erhöhung, nach warmen Bädern eine Erniedrigung der Kurve (Abb. 164).<br />
Die Reaktion der endokrinen Organe bei krankhaften Zuständen<br />
Bei Hyperthyreosen besteht ausgesprochen ergotrope Einstellung im Organismus.<br />
Wie ich 1929 experimentell nachweisen konnte, wird der Sympathicus durch<br />
das ergotrope Schilddrüscnhormon nicht direkt erregt, sondern sensibilisiert, das<br />
heißt, die Reaktionslage des vegetativen Systems wird nach der ergotropen Seite<br />
hin verschoben, es wird empfindlicher gegen Adrenalin, während die Erregbarkeit<br />
durch Acetylcholin herabgesetzt wird.<br />
Dies prägt sich auch in der Reaktion des Blutzuckers aus. Dabei ist zu erkennen,<br />
daß die Veränderungen an der Schilddrüse durchaus nicht immer so stark im<br />
Vordergrund stehen, wie früher angenommen worden ist. Nur bei einem Teil der<br />
Kranken entsteht nach Durchflutung der Schilddrüse ein erheblich verstärkter<br />
Anstieg des Blutzuckers, der allerdings in manchen Fällen sehr hoch sein kann.<br />
Bei einem Teil der Kranken reagiert die Hypophyse sehr stark mit Blutzuckeranstieg,<br />
wogegen die Reaktion der Schilddrüse zurückbleiben kann. Bei einigen<br />
Kranken wurde nach Durchflutung der Gonaden ein Blutzuckcransticg gefunden.<br />
Nach Durchflutung der Struma ohne Überfunktion fällt der Blutzucker gewöhnlich<br />
ab.<br />
Bei einem Kranken mit Akromegalh im Frühstadium stieg die Blutzuckerkurve<br />
nach Hypophyscndurchflutung sehr stark an.<br />
233
Das umgekehrte Verhalten zeigt sich bei Zuständen, die mit stark trophotroper<br />
Einstellung im Endokrinium einhergehen; hierher gehören in erster Linie die<br />
Dystrophia adiposo-genitalis (FRÖHLICH) und das Cushing-Syndrom. Hierbei fällt der<br />
Blutzucker nach Durchflutung der Hypophyse mehr oder weniger stark ab, dagegen<br />
sehen wir manchmal einen Anstieg nach Durchflutung der Keimdrüsen.<br />
Bei hypophysärer Kachexie besteht meist völlige Starre, die Kurven von Hypophyse,<br />
Oberbauch und Genitale laufen eben und parallel.<br />
15' 30'<br />
Abb. 165<br />
181- Hypophyse =<br />
231 Oberbauch = ,<br />
III. Keimdrüsen = .<br />
Eindrucksvoll und besonders einheitlich ist das Verhalten bei Subgenitalismus<br />
in der Adoleszenz (Abb.iöj). Hierbei sind alle Kurven mehr oder weniger stark<br />
verändert, besonders die nach Durchflutung der Hypophyse gewonnene. Sie weist<br />
meist einen Abfall auf. Ebenso entsteht nach Durchflutung des Oberbauches ein<br />
Abfall. Da die Nebennierenrinde beim Subgenitalismus unterentwickelt zu sein<br />
pflegt, dürfen wir mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit annehmen, daß der<br />
fehlende Anstieg der Kurve damit zusammenhängt. Diese Annahme liegt um so<br />
näher, als bei einer Frau mit schwererer cystischer Degeneration der Ovarien ähnliche<br />
Kurven gefunden wurden. Dabei wich auch die von den Keimdrüsen gewonnene<br />
Kurve stark von der Norm ab, indem ein Anstieg im Vordergrund<br />
stand.<br />
Eine starke Abschwächung der anfänglichen ergotropen Reaktion, oft sogar<br />
einen Abfall des Blutzuckers nach Hypophysendurchflutung finden wir bei<br />
Patienten mit vegetativer Dystonie. Schon 1944 habe ich darauf hingewiesen, daß die<br />
Grundlagen für die Beschwerden dieser Kranken außerhalb des Herzens zu suchen<br />
234
sind. Immer liegen Störungen verschiedener Regulationen des vegetativen Gleichgewichtes<br />
vor. Der Blutdruck ist meist niedrig und sinkt im Stehen noch mehr ab.<br />
(Hypotone Regulationsstörung), während die Herzfrequenz dabei ansteigt Fast<br />
120 -i<br />
TOD -<br />
izo mm<br />
Abb. 166: DFP bei Phäochromozytom.<br />
a Durchflutung auf der Seite des Tumors<br />
b auf der gesunden Seite<br />
120 -i<br />
100 -<br />
T7 immer ist Akrocyanosc der Hände<br />
-"<br />
vorhanden, der Blutzucker ist niedrig.<br />
Die Schwindelgefühle können<br />
sich bis zum orthostatischen Kollaps<br />
steigern. Die vegetative Dystonie<br />
(VD) beruht auf Störungen<br />
der Blutverteilung im Körper. Daher<br />
die Akrocyanose, daher auch<br />
Veränderungen im Ekg, die als<br />
«coronare Durchblutungsstörungen»<br />
gedeutet werden. Die Funktionen<br />
der Blutverteilung im Körper<br />
werden in erster Linie von den<br />
Hormonen der Nebenniere gesteuert.<br />
Ihnen übergeordnet ist die<br />
Hypophyse. Meine Befunde nach<br />
Durchflutung der Hypophyse deuten<br />
darauf bin ,daß eine Funktionsschwäche<br />
des HVL mit zu stark trophotroper<br />
Einstellung vorliegt. Diese Kranken<br />
reagieren auch besonders stark<br />
auf Insulin und Acetylcholin. In<br />
diesem Sinne spricht auch, daß der<br />
Zustand der Patienten sich nach<br />
einer Reihe von Durchflutungen<br />
120 min<br />
der Schädelbasis erheblich bessert, Abb. 167: DFP,bei Hodenatropie. Blutzucker<br />
und daß bei vielen von ihnen am<br />
Ende der Behandlung eine normale<br />
a nach Durchflutung b der Hypophyse<br />
Blutzuckerkurve nach Durchflutung<br />
gefunden wird.<br />
Mit der Hypophysenfunktionsprüfung<br />
kann auf diese Weise herausgefunden<br />
werden, ob bei einem<br />
Patienten echte vegetative Dystonie<br />
oder ein psychastenisches Syndrom<br />
vorliegt. Wir finden die trophotrope<br />
Reaktion der Hypophyse besonders<br />
auch bei Männern, die<br />
lange in Kriegsgefangenschaft gewesen<br />
waren und an Dystrophie<br />
gelitten hatten. Es dauert oft viele<br />
Jahre, bis die Hypophysenreaktion<br />
bei diesen Patienten wieder zur<br />
IZO min<br />
Abb. 168: Durchflutung der<br />
latur 5 min. Blutzucker a<br />
Glutäal-Muskuvor,<br />
b 2 Wochen<br />
nach Implantation von 2 Kalbshypophysen.<br />
Nach 3 Monaten war die Reaktion wieder wie<br />
vor der Implantation (nach SPIEGL)<br />
Norm zurückkehrt. Auch der Anstieg nach Durchflutung des Oberbauches wird<br />
bei diesen Menschen oft vermißt.<br />
Das entspricht den anatomischen Befunden, bei denen eine starke Hypertrophie<br />
235
der basophilen Zellen der Hypophyse mit manchmal völligem Schwund der<br />
eosinophilen Zellen beschrieben worden ist (OVERZIER). Auch Atrophie der<br />
Nebennierenrinde wird gefunden.<br />
Abb, 169<br />
Abb. 170<br />
Abb. 171<br />
Die Befunde bei vegetativer Dystonie sind wiederholt bestätigt worden, so von<br />
GROPLER bei einer großen Anzahl von Patienten. Er betont, daß sich bei fast<br />
allen Kranken der Allgemeinzustand bessert, daß aber die von der Hypophyse<br />
gewonnenen Kurven nur bei einem Teil durch die Behandlung normalisiert werden.<br />
L. KIHN kommt zu den gleichen Ergebnissen.<br />
236
Bei UIcuskranken, die ja meist in die Gruppe der Dystoniker fallen, hat<br />
CH. SATTLER regelmäßig bestimmte Abweichungen von der Norm gefunden<br />
(Abb. 171). Das entspricht der auch auf Grund meiner Untersuchungen des Cholcsterinstoffwechsels<br />
beim Magenkranken gewonnenen Überzeugung, daß dem<br />
Magenulcus eine Regulationsstörung im Sto/fwechsel zugrunde liegt. Dies wird<br />
von MAHLO und von BOHN bestätigt.<br />
Fast alle endokrinen Drüsen beeinflussen den Blutzucker mehr oder weniger<br />
stark. Eine Senkung wird veranlaßt durch die Hormone der basophilen Zellen der<br />
Hypophyse, der Keimdrüsen, der A-Zellen<br />
des Pankreas, vielleicht durch einzelne<br />
Hormone derNebennicrenrindc. Alle diese<br />
Hormone wirken aufbauend, anabol, assimilatorisch,<br />
trophotrop. Sie sensibilisieren<br />
den Vagus, den trophotropen Teil des<br />
vegetativen Nervensystems, durch dessen<br />
Erregung der Blutzucker gesenkt wird.<br />
Sein Überträgerstoff ist das Acetylcholin,<br />
daher sprechen wir zweckmäßigerweise<br />
vom cholinergischen System.<br />
Ihm polar gegenüber steht das adrenergische<br />
System, dessen Über träger Stoffe aus<br />
dem Nebennierenmark stammen. Es ¡st<br />
ergotrop, bei seiner Erregung steigt der<br />
Blutzuckerspiegel, es regt die Entzündungsvorgänge<br />
an. Das ergotrope, adrenergische<br />
System steht unter der Herr<br />
schaft derjenigen Gruppe von endokrinen<br />
Drüsen, die dissimilatorisch wirken. Hierher<br />
gehören die eosinophilen Zellen der<br />
Hypophyse, die Schilddrüse, die A-Zellen<br />
des Pankreas, das Nebennierenmark und<br />
Teile der Nebennierenrindc. Die Hypophyse<br />
mit ihren beiden polar gerichteten<br />
Potenzen steht als Dirigent an der Spitze,<br />
als Regulator und Ausgleicher bei etwaigen<br />
Störungen haben wir die Milz, eines der<br />
m 1 ïruntfifi<br />
Abb. 172 : Diabetes, überwiegend pankreatische<br />
Form (Überwiegen der<br />
a-Zellen?). Starker Anstieg nach<br />
Durchflutung des Oberbauches, Abfall<br />
nach Durchflutung der Hypophyse<br />
(Gegenregulierung?). Zum Vergleich<br />
Staub-Effekt<br />
phylogenetisch ältesten Ausgleichsorgane. Ihre Hormone können auf den Blutzucker<br />
je nach Bedarf senkend und' erhöhend wirken, sie suchen immer irgendwelche<br />
gestörten StoffwechSeifunktionen der Norm anzunähern.<br />
Beim Diabetiker ist der Ablauf der Kurven in verschiedener Weise verändert.<br />
Der Regulationsmechanismus für die Konstanthaltung des Blutzuckerspiegels<br />
bewirkt, daß Bildung und Verbrauch des Zuckers im Stoffwechsel beim Gesunden<br />
einander stets parallel gehen. Für den Aufbau wesentlich ist das Hormon der B-<br />
Zeiien der Pankreas!nsein, das Insulin, für den Abbau verschiedene Hormone, in<br />
vorderster Linie das Adrenalin. Wie HOUSSAY und Mitarbeiter 1920 nachgewiesen<br />
haben, hat die Hypophyse dabei eine übergeordnete Funktion, denn ein experimentell<br />
durch Entfernung des Pankreas hervorgerufener Diabetes kann durch Hypophysektomic<br />
zum Rückgang gebracht werden. Extrakte von Hypophyscnvorderlappen<br />
erzeugen ihn von neuem. YOUNG konnte durch fortgcsetztejlnjektionen<br />
237
delt. Bei Gruppe 2 fallt der Blutzucker sofort stark ab. Bei den Kranken dieser<br />
Art besteht meist mäßig erhöhter Blutzuckerspiegel (250-300 mg%), die Zuckerausscheidung<br />
ist verhältnismäßig gering. Insulin wirkt hier stark (Abb. 175).<br />
Bei einer dritten Gruppe drückt sich die Unsicherheit der Regulation in wechselndem<br />
Anstieg und Wicderabfall aus, meist mit Wiederanstieg nach 2-3 Stunden.<br />
Hier pflegen die Anfangswertc des Blutzuckers verhältnismäßig hoch zu liegen<br />
(über 30omg%), die Ausscheidung im Harn ist nicht hoch. Kohlehydratarme<br />
Diät wirkt gut. Bei dieser Form, die wohl als überwiegend hypophysär anzusprechen<br />
sein dürfte, ist an den folgenden 1-2 Tagen oft eine anhaltende Senkung des<br />
Blutzuckers festzustellen, dadurch kann bei Fortsetzung der UKW-Therapie Insulin<br />
gespart werden. Die Pankreas-Funktionskurve pflegt bei diesen Kranken ziemlich<br />
flach zu verlaufen.<br />
Außerdem haben wir noch Formen beobachten können, bei denen nach Hypophysendurchflutung<br />
ein starker und lange anhaltender Blutzuckeranstieg eintritt,<br />
in einem Fall von 250 auf 800 mg%. Diese Fälle haben starke Ausscheidung bei<br />
verhältnismäßig geringen Blutzucker-Ausgangswerten und reagieren wenig auf<br />
Insulin. Dagegen sind sie gegen größere Insulindosen überempfindlich und verfallen<br />
leicht in den hypoglykämischen Schock. Diese Form sehen wir als überwiegend<br />
hypophysären Diabetes an. In den auf die Durchflutung folgenden Tagen<br />
tritt meist eine Besserung des Blutzuckers und der Bilanz ein.<br />
Die Durchflutung des Oberbauches gibt weitere Aufschlüsse. Auch hierbei gibt<br />
es Formen, die hauptsächlich mit Abfall des Blutzuckers reagieren. Sie sprechen<br />
gut auf Insulin an. Eigenartig ist das Verhalten in manchen Fällen, die sich vornherein<br />
durch starke Insulinresistenz auszeichnen. Sie haben hohen Blutzucker bei<br />
verhältnismäßig geringer Ausscheidung. Bei ihnen kann im Anfang ein Abfall<br />
erfolgen. Nach 30-90 Minuten steigt aber der Blutzucker erheblich an, oft weit<br />
über den Ausgangswert. Wir konnten zuerst diese Form in kein Schema einordnen,<br />
zumal die Reaktion der Hypophyse normal sein kann. Auf Grund der Untersuchungen<br />
von FERNER und im Zusammenhang mit dem eigenartigen Verhalten<br />
gegenüber Insulin möchte ich annehmen, daß es sich hier um eine besondere Form<br />
des Diabetes handelt, die auf Überproduktion von Glukagon beruht, einen Glukagon-Diabetes.<br />
Bei allen anderen Diabetesformen fällt der Blutzucker spätestens<br />
60 Minuten nach der Kurzwellendurchflutung ab.<br />
Daß die Funktion der Keimdrüsen beim Diabetes verändert ist, zeigt das unterschiedliche<br />
Verhalten bei der Funktionsprüfung. Bei der Hälfte der Kranken war das<br />
Bild ganz normal : Langdauernde Senkung, die in 70% der Fälle durch einen leichten<br />
Wiederanstieg nach 30-60 Minuten unterbrochen ist. Der Endwert Hegt unter<br />
dem Ausgangswert. Bei der anderen Hälfte der Diabetiker war das Verhalten unterschiedlich.<br />
Teils kam es nach 30 Minuten zu einem kurzen Anstieg über den Ausgangswert<br />
mit Wiederabfall und teils erheblichem Anstieg nach 2-3 Stunden bis<br />
3omg% über den Ausgangswert hinaus. Diese abwegigen Reaktionen wurden<br />
durchweg bei älteren Diabetikern gefunden. Demnach ist anzunehmen, daß die<br />
Rückbildung der Keimdrüsen beim Zustandekommen des Diabetes eine Rolle<br />
spielt, und daß die Keimdrüsen bei der Regulierung des Kohlehydrathaushaltes<br />
direkt oder indirekt beteiligt sind.<br />
Ein wichtiges Bild ergeben Durchflutungen von Gliedmaßen, wobei hauptsächlich<br />
die Muskeln reagieren dürften. Bei allen Gesunden sinkt der Blutzucker nach<br />
Durchflutung ab und nähert sich erst nach 2-3 Stunden dem Ausgangswert. Bei<br />
einer bestimmten Gruppe von Diabetikern fehlt dieser Abfall. Alle diese Fälle sind<br />
240
dadurch charakterisiert, daß ihr Blutzuckerspiegel verhältnismäßig niedrig ist, die<br />
Ausscheidung dagegen hoch, die Kohlehydratbilanz schlecht. Fast immer sind es<br />
ältere Personen. Insulin ist nur wenig wirksam, dagegen sind diese Kranken durch<br />
Diät und Sulfonamide meist gut beeinflußbar.<br />
Die Diabetiker, die dieser Gruppe angehören, haben fast immer irgendwelche<br />
gewebliche Störungen. Es sind diejenigen, die zu Ekzemen, Furunkulosen und<br />
Katarakt neigen, die über Jucken und Gefäß Störungen klagen. Noch stärker tritt<br />
die Veränderung hervor bei Kranken mit Gangrän. Hier kann statt des normalen<br />
Blutzuckerabfalles sogar ein Anstieg auftreten. Diese Art der Störung ist so<br />
charakteristisch, daß man aus der Art des Krankheitsbildcs, aus dem Verhalten von<br />
Blutzucker, Kohlehydratbilanz und Verhalten gegenüber Insulin, Schlüsse auf die<br />
voraussichtliche Form der Drüsenfunktionskurve ziehen kann. Bei diesen Kranken<br />
können alle anderen Funktionskurven normal sein. Daher ist anzunehmen, daß<br />
hier die hauptsächliche Ursache des Diabetes in der Peripherie liegt. Wir haben<br />
daher den Begriff des Gewebsdtabeies geprägt. Unter ihn dürfte auch der sogenannte<br />
renale Diabetes fallen. Vereinzelt haben wir solche Anstiege nach Durchflutung<br />
von Gliedmaßen auch bei Kranken mit peripheren Arteriosklerosen ohne Diabetes<br />
gefunden. Dies spricht zusammen mit den anderen Beobachtungen vielleicht<br />
in dem Sinn, daß gewisse arteriosklerotische Veränderungen beim Diabetes nicht<br />
als Folge der Zuckerkrankheit aufgefaßt werden müssen, sondern als eine ihrer<br />
Ursachen, daß also die Ernährungsstörung im Gewebe eine Disposition zum Diabetes<br />
herbeiführt, der dann durch Dazukommen anderer endokriner Faktoren<br />
manifest werden kann.<br />
Ich möchte annehmen, daß es sich um eine Störung des Muskelstoffwechsels<br />
handelt, möglicherweise um Funktionsuntüchtigkcit der Hexokinase infolge gcwcblichcr<br />
Veränderungen. Die gewebüchen Störungen ziehen nämlich nicht notwendig<br />
einen Diabetes nach sich, sie können anscheinend durch andere Regulationen<br />
ausgeglichen werden. Das würde unserer Gesamtauffassung entsprechen,<br />
daß dem Diabetes niemals eine Störung eines einzelnen Organs oder Systems zugrunde<br />
liegt, sondern eine ungünstige Kombination mehrerer Faktoren. Es gibt<br />
viele Möglichkeiten, eine Verschiebung des Gleichgewichtes im System zu regulieren.<br />
Erst wenn mehrere dieser Regulationen versagen, kommt es zur diabetischen<br />
Störung des Kohlenhydrathaushaltes.<br />
Zusammenfassend kommen wir auf Grund unserer Beobachtungen an 22 Diabetikern,<br />
die durch Untersuchungen an etwa 200 weiteren Zuckerkranken unterstützt<br />
werden, zu folgendem Ergebnis. Durch die Drüsenfunktionsprüfung mit<br />
Ultrakurzwellen können erstmals beim lebenden Menschen verschiedene Arten<br />
von Diabetes mellitus festgestellt werden:<br />
1. Eine Form, die im wesentlichen auf Unterfunktion der B-Zellen des Pankreas<br />
beruht. Nach Durchflutung der Hirnbasis und das Oberbauches überwiegt der<br />
Abfall des Blutzuckers (Insulinmangeldiabetes). Gutes Ansprechen auf Insulin.<br />
2. Eine Form mit Überfunktion der A-Zellen (Glukagondiabetes). Nach Durchflutung<br />
des Oberbauches langanhaltender Anstieg des Blutzuckers. Insulinresistenz.<br />
3. Eine Form mit starkem Überwiegen der ergotropen Funktion des Hypophyscnvorderlappens.<br />
Insulinresistenz. Starke Ausscheidung bei verhältnismäßig geringem<br />
Blutzucker. Starke Schwankungen. Schockbercitschaft (Hypophysärer Diabetes.)<br />
4. Eine Form mit Störung des Zuckerumsatzes in der Muskulatur. Starke Ausscheidung<br />
bei verhältnismäßig nicht sehr hohen Blutzuckerwerten. Resistenz gegen<br />
Insulin, gutes Ansprechen auf Diät (Gewebsdiabetcs).<br />
241
Selbstverständlich kommen reine Formen dieser Art selten vor. Fast immer sehen<br />
wir Kombinationen verschiedener Formen. Bei den einzelnen Formen überwiegen<br />
aber doch bestimmte Störungen die anderen, so daß wir auf Grund unserer Funktionsprüfungen<br />
Typen aufstellen können. Diese Unterscheidungen gewinnen dadurch<br />
praktische Wichtigkeit, daß wir die Behandlung mit Diät und Insulin entsprechend<br />
einstellen können und daß wir sehen, ob ein Fall für die Behandlung<br />
mit Sulfonamiden (Rastinon u. dgl.) geeignet ist. Außerdem gelingt es bei Berücksichtigung<br />
der Lage im Einzelfall, durch geeignete Kurzwellendurchflutungen die<br />
sonstige Therapie wesentlich zu unterstützen, den Gesamtzustand zu bessern und<br />
gegebenenfalls Insulin zu sparen. In nicht zu veralteten Fällen kann eine wesentliche<br />
Besserung der Stoffwechsellage durch gezielte Kurzwellendurchflutungen erreicht<br />
werden.<br />
Der Blutzucker wird von den meisten endokrinen Drüsen beeinflußt, er stellt<br />
daher einen Indikator für den Gleichgewichtszustand im Endokrinium dar. Mit<br />
Ultrakurzwellenreizen können die endokrinen Drüsen einzeln aktiviert werden.<br />
Dabei treten Steigerungen oder Senkung des Blutzuckers auf, die bei normalen<br />
Menschen in charakteristischen Kurven ablaufen. Die Art einer Funktionsstörung<br />
im Endokrinium läßt sich aus Art und Form der Blutzuckerkurven erkennen. Es ist<br />
dadurch erstmals möglich geworden, bei einem Diabetiker nachzuweisen, welche<br />
Art der Störung bei ihm vorliegt.<br />
Zusammenfassung<br />
Das Ergebnis unserer Untersuchungen sei hier kurz zusammengefaßt.<br />
i. Es ist möglich, mittels gezielter und richtig dosierter Ultrakurzwellen-Durchflutungen<br />
die Drüsen mit innerer Sekretion zu verstärkter Tätigkeit anzuregen.<br />
2. Durch die Veränderungen des Blutzuckers können Schlüsse auf die Tätigkeit<br />
der einzelnen Drüsen gezogen werden. Hierauf wird eine Drüsenfunktionsprüfung<br />
(DFP) aufgebaut.<br />
}. Mit dem Verfahren der DFP ist es zum ersten Male gelungen, beim lebenden<br />
Menschen Gleichgewichtsstörungen im endokrinen System kurvenmäßig darzustellen.<br />
4. In bisher über 1000 Funktionsprüfungen konnten für einzelne endokrine<br />
Störungen charakteristische Kurvenbilder gewonnen werden. Die Bilder zeigen<br />
u. a., welche komplizierten Vorgänge den endokrinen Wuchsstörungen, der<br />
vegetativen Dystonie, den Hyperthyreosen und den verschiedenen Arten des<br />
Diabetes zugrunde liegen.<br />
;. Es wurde gezeigt, daß bestimmten Arten von Diabetes eine primäre Störung<br />
im Gewebsstoffwechsel zugrunde liegt (Gewebsdiabetes). Durch die Drüsenfunktionsprüfungen<br />
lassen sich folgende Formen des Diabetes erkennen:<br />
Unterfunktion der insulinerzeugenden Zellen des Pankreas.<br />
Überfunktion der Glukagon-erzeugcndcn Zellen des Pankreas.<br />
Dysfunktion des Hypophysen-Zwischenhirnsystcms.<br />
Störungen der Zuckerverwertung in den Verbrauchsorganen = Gewebsdiabetes.<br />
Diese Formen treten selten rein zutage, meist sind Mischformen vorhanden.<br />
6. Bei Ulkuskranken sind Störungen in der Zusammenarbeit des endokrinen<br />
Systems nachweisbar.<br />
242
Die Therapie mit Durchflutung endokriner Organe (Autobormontberapie)<br />
Für die Therapie haben wir mit den UKW zum erstenmal ein Mittel ¡n der Hand,<br />
mit dem wir auf unschädliche Weise endokrine Organe zur Tätigkeit anregen<br />
können. DAUSSET berichtet über Besserung verschiedener Erkrankungen auf endokriner<br />
Grundlage unter dem Einfluß allgemeiner Durchflutungen. So wurden<br />
Fälle von Dystrophiaadiposo-genitalis% endokrine Akrocyanosen, Alopecien sowie Injantiiismus<br />
gebessert. Samuels berichtete zuerst über Beeinflussung des Karzinoms.<br />
Dysmenorrhöen und Amenorrhoen bei jungen Mädchen werden in einem<br />
großen Teil der Fälle durch Behandlung der Hypophyse und des Unterbauches<br />
geheilt oder wesentlich gebessert.<br />
Die Behandlung innersekretorischer Störungen und endokrin beeinflußter<br />
Krankheiten mit Kurzwellendurchflutungen steht noch in ihren Anfängen; es<br />
sind aber schon beachtliche Erfolge damit erzielt worden. Diese Behandlung hat<br />
mehrere Vorteile gegenüber der üblichen Hormonbehandlung. Es werden keine<br />
körperfremden Hormone eingespritzt. Diese Hormone sind bei noch so sorgfältiger<br />
Herstellung und Behandlung körperfremd. Sie enthalten oft Eiweißkörper<br />
und sonstige Substanzen, auf die der menschliche Körper allergisch<br />
reagiert. Im Magen-Darmkanal werden viele der oral eingegebenen Hormone<br />
ganz oder teilweise verändert, es kommt nur ein Teil zur Resorption, dessen<br />
Menge nicht kontrollierbar ¡st. Bei der Einspritzung entsteht immer ein plötzlicher<br />
Hormonstoß, der unphysiologisch ist und von einer entgegengesetzten Phase gefolgt<br />
wird, wie ich dies für verschiedene Wirkstoffe schon 1929 zeigen konnte.<br />
Auch entsprechen die isolierten und gereinigten Hormone nicht den Stoffen oder<br />
Stoffgemischen, die bei einer Aktionssteigerung der Drüsen auf natürlichem Wege<br />
im Körper wirksam werden.<br />
Bei der Autohormontherapie werden dagegen die Drüsen aktiviert, und es kommt<br />
zur Ausschüttung der natürlichen körpereigenen Hormone. Dieser Vorgang kann durch<br />
geeignete Dosierung der Kurzwellenenergie geregelt werden. Aus dem Verlauf<br />
der Blutzuckerkurven läßt sich entnehmen, daß bei ambivalenten Drüsen zuerst<br />
die ergotope Phase aktiviert wird, ein Vorgang, der teleologisch verständlich ist,<br />
denn die ergotropen Reaktionen müssen schnell erfolgen, während für den trophotropen<br />
Aufbau mehr Zeit zur Verfügung steht.<br />
Überwiegt bei einer Drüse die eine Richtung, so wird diese zunächst stärker<br />
aktiviert. So kommt es bei Hypertrophie der ergotrop eingestellten eosinophilen<br />
Zellen der Hypophyse zum verstärkten Blutzuckeranstieg, beim Cushing-Syndrom<br />
zum Abfall. Daß die Blutzuckeränderung nachDurchflutung des Oberbauches<br />
beim Diabetiker meist anders ausfällt als bei Gesunden, kann auf veränderte Einstellung<br />
sowohl des Pankreas als auch der Nebennieren zurückgeführt werden.<br />
Ich möchte aber ausdrücklich betonen, daß diese theoretischen Ausführungen nur<br />
auf klinischen Beobachtungen aufgebaut sind. Durch exakte Tierversuche wären<br />
sie leicht zu bestätigen. Hier sei nur erwähnt, daß der Anstieg des Blutzuckers auf<br />
Durchflutung des Oberbauches nach Vergiftung mit Alloxan stark verändert<br />
wird.<br />
Nach einer Reihe von Durchflutungen in 2-3tägigcn Abständen ändert sich die<br />
Reaktionsweisc der Hypophyse, wahrend sie sonst Monate hindurch immer den<br />
gleichen Charakter beibehält, wie in Tierversuchen festgestellt wurde. Bei Patienten<br />
mit vegetativer Dystonie tritt, wie erwähnt, am Anfang ein Abfall des Blutzuckers<br />
nach Hypophysendurchflutung ein. Durch eine oder mehrere Serien von Bcstrah-<br />
243
lungcn wird es bei der Mehrzahl der Patienten erreicht, daß der Blutzucker nach<br />
den Bestrahlungen in zunehmendem Maße ansteigt, bis schließlich die Kurven<br />
normale Form annehmen. Zur gleichen Zeit verschwinden die Beschwerden<br />
der Kranken. GROPLER hat dies an einer großen Anzahl von Patienten mit VD<br />
bestätigt. Er findet, daß bei einem Teil der Patienten die Blutzuckerkurven nicht<br />
normalisiert wurden, daß sich aber bei ihnen trotzdem das Allgemeinbefinden<br />
besserte. L. KIHN fand ein ähnliches Verhalten.<br />
Bei der sogenannten hypophysären Magersucht wirken Durchflutungen der Hypophyse,<br />
die 3mal wöchentlich durchgeführt werden, ausgezeichnet. Schon länger ist<br />
bekannt, daß die FRÖHLiCHSche Dystrophia adiposogenitalis günstig beeinflußt<br />
wird (DAUSSET, FERRIER, SIMARD, VULCANESCU). Beim Cushing-Syndrom dagegen<br />
konnte ich keine signifikanten Erfolge erzielen. Endokrin bedingte Akrocyanosen,<br />
Infantilismus und Alopécie können nach DAUSSET wesentlich gebessert werden.<br />
Bei Stoffwechselerkrankungen behandelt man allgemein die unterfunktionierenden<br />
Hormondrüsen. So erzielte SCHÖDEL bei Hyperthyreosen Senkungen des<br />
Grundumsatzes um 8-32%, bei Hypothyreosen Erhöhungen um 4-29% in 9 von<br />
11 Fällen. WINTZ sah nach Durchflutungen der Schilddrüsen mit 3,8 m und 1 m<br />
Wellenlänge hyperthyreotischeErscheinungen entstehen, die später wieder zurückgingen.<br />
Bei Basedowscher Krankheit verkleinerte sich nach CIGNOLINI nach Kopfdurchflutungen<br />
die Schilddrüse, der Exophthalmus ging zurück, auch bei Frauen, die<br />
auf Röntgenbestrahlungen der Schilddrüse nicht reagiert hatten. WINTZ beschreibt<br />
einen Fall von Adipositas mit 109 kg Gewicht bei Hypothyreose, der nach<br />
11 Tage lang fortsetzter Hypophysendurchflutung um 8 kg abnahm.<br />
Nach elektrischer Hyperthermiebehandlung geben HALPHEN und AUCLAIR<br />
sowie DAUSSET Verminderung des Schilddrüsenhormons und Erhöhung der<br />
Nebennierentätigkeit bei Kranken mit gestörter Funktion an. RAAB stellte bei<br />
Hyperthermiebehandlung Steigerungen des Grundumsatzes bis um 60% fest, bei<br />
hyperthyreotischen Kranken dagegen wurde der G.U. nach 6 Behandlungen<br />
(39,5 o , 3 Stunden Dauer) um 20% gesenkt. Röntgenbestrahlungen und Injektionen<br />
waren vorher erfolglos gewesen.<br />
RAAB nimmt an, daß das hormonale Gleichgewicht durch KW-Hyperthermie<br />
im ganzen günstig beeinflußt wird. Er sah in einem Fall mit 60% Grundumsatzsteigerung<br />
einen Rückgang um 20% nach 6 Hyperthermien. BINET sah nach starker<br />
Hyperthermie bei Hunden starke Gefäßerweiterung in der Schilddrüse. Das<br />
Epithel war niedrig, histologisch sah man Zeichen von Unterfunktion mit kompaktem<br />
Kolloid, An den Nebennieren war die Kapsel stark hyperämisch, es bestand<br />
das Bild der Funktionssteigerung. Auch beim Menschen beobachteten<br />
HALPHEN und AUCLAIR und DAUSSET Verminderung der Schilddrüsen- und Erhöhung<br />
der Ncbennicrenfunkticn.<br />
Nach Behandlung der Schädelbasis fanden FRADA und SICARI meist eine<br />
Erhöhung des Grundumsatzes.<br />
Bei einem Fall von Diabetes insipidus erreichten STÜBINGER & WOLF mit KW-<br />
Durchflutungen wesentliche Besserung. Ich kann dies an einem anderen Falle bestätigen.<br />
Spontan-Hypoglykämie wird durch Kopfdurchflutungen ganz wesentlich gebessert,<br />
die Anfälle können meist ganz behoben werden.<br />
KELLNER durchflutete atrophische Säuglinge, die anderen Behandlungsverfahren<br />
getrotzt hatten, täglich 5-10 Minuten lang so, daß sich Magen, Leber und Pankreas<br />
244
im Feld befanden. Die Gewichtskurven stiegen dabei erheblich an, und die bessere<br />
Entwicklung hielt auch später an.<br />
WEGHAUPT und WENGRAF versuchten mit gutem Erfolg die Wutbildung mittels<br />
Durchflutung des Hypophysen-Zwischenhirnsystems anzuregen. Sie sahen bei<br />
hyperchromen Anämien nach Durchflutungen einen stetigen Anstieg der Zahl der<br />
Erythrozyten, nachdem vorher andere Behandlungsverfahren versagt hatten. Auf<br />
die gleiche Weise wurden Leukopenien, die nach Röntgenbestrahlung von Tumoren<br />
eingetreten waren, mit ausgezeichnetem Erfolg behandelt. Bei 6j Patienten<br />
war nie ein Zwischenfall zu beobachten. In keinem Fall sanken trotz Fortsetzen der<br />
Röntgentherapie die Leukozyten weiter ab, im überwiegenden Teil der Fälle stiegen<br />
sie sogar noch an, ebenso wie die Erythrozyten.<br />
Störungen der Genitalfunktion<br />
Dysmenorrhöen und Amenorrhoen junger Mädchen werden nach übereinstimmenden<br />
Angaben zahlreicher Autoren im größten Teil der Fälle durch Behandlung der<br />
Hypophyse und des Unterbauches geheilt oder wesentlich gebessert.<br />
Nach WINTZ besserten sich Amenorrhoen nach Durchflutung der Ovarien, bei<br />
Hypoplasie wurde das Wachstum des Genitales angeregt. Nach Untersuchungen<br />
von SCHMIEMANN aus der Universitäts-Frauenklinik Würzburg (Prof. GAUSS),<br />
die 1943 begonnen wurden, ist die Behandlung funktionell-hormonal bedingter<br />
Störungen des weiblichen Genitalzyklus mittels KW-Durchflutung der Hypophyse<br />
als sehr erfolgversprechend zu bezeichnen. Nach Anlegen zweier Elektroden<br />
biparietal an die Hypophysengegend wurden Einzelsitzungen von 3-20 Minuten<br />
Dauer mit Dosis I—II verabfolgt. Bei primärer Amenorrhoe sowie bei langdauernden<br />
sekundären Amenorrhoen konnte auf diese Weise ein normaler Zyklus ausgelöst,<br />
bei zu starken bzw. zu lang dauernden Menstruationen eine Normalisierung<br />
der Blutungen herbeigeführt werden. Der Effekt dieser äußerst einfachen und ungefährlichen<br />
Behandlung beruht offensichtlich auf einer Regulierung der Hypophysenfunktion,<br />
wodurch auf dem Wege über das Ovar ein normaler Gcnitalzyklus<br />
angeregt wird. Die bisherigen Ergebnisse des Verfahrens berechtigen den<br />
Autor zu der Annahme, daß damit eine neuer Weg zu einer kausalen Therapie<br />
funktioneller Regelstörungen der Frau und darüber hinaus auch anderer endokrin<br />
bedingter Erkrankungen überhaupt beschritten worden ist. CIGNOLINI beobachtete<br />
nach Durchflutung des Schädels bei Frauen ein Gefühl der Spannung<br />
des Busens und Zusammenziehungen des Uterus nach einigen Stunden. Die<br />
Menses wurden verlängert und verstärkt. Zahlreiche Autoren beschreiben die<br />
günstige Wirkung von UKW-Durchflutungen bei Störungen, deren Ursachen in<br />
ovarieller Unterfunktion oder hypophysärer Dysfunktion liegen, so hormonale<br />
Störungen des Menstrualzyklus, Hypoplasien und Involutionsstörungen (DAUSSET<br />
und FERRIER, BERTALAN,CAFFARRETTO, OSTRCIL, SAVONA, CIOLLA, KÖVESLIGETHY,<br />
SIMARD, v. BODO, WINTZ, BERTOLOTTO, RAAÜ, CIGNOLINI). Bei Dysmenorrhöen ist<br />
oft Bestrahlung der Ovarien wirksam, in vielen Fällen muß gleichzeitig die Hypophyse<br />
durchflutet werden. Individuelle Dosierung unter Beobachtung ist unbedingt<br />
notwendig, auch muß die psychische Einstellung der Patienten berücksichtigt<br />
werden. Menstruelle Störungen werden oft noch in Fällen beeinflußt, bei<br />
denen andere Therapie keinen Erfolg hatte, v. BODO behandelte 40 Kranke mit<br />
sekundärer Amenorrhoe, Oligomenorrhoe, Hypomenorrhoe und klimakterischen<br />
Beschwerden. Nur 14 Kranke blieben ungebessert. RAAB und DAUSSET sahen, ebenso<br />
24Í
wie WINTZ, Wiederkehr der Periode im Klimakterium nach KWTh. Ich habe bei<br />
einigen Frauen noch j-io Jahre nach der Menopause Wiederkehr der Uterusblutungen<br />
gesehen. Nach WINTZ wird die Entwicklung des Genitale bei hypoplastischen<br />
Zuständen begünstigt.<br />
Nach DAUSSET gehen Uterusmyome bei täglichen Kopf durchflutungen von 30 bis<br />
3 5 Minuten Dauer zurück, auch bei solchen Frauen, die auf Röntgenbestrahlungen<br />
nicht angesprochen hatten.<br />
RAKOFF behandelte Patientinnen im Alter unter 35 Jahren, die seit 2 Jahren<br />
wegen Unfruchtbarkeit in Beobachtung gestanden hatten. Alle anderen therapeutischen<br />
Maßnahmen hatten versagt. Es wurde endometriale Biopsie vorgenommen,<br />
Basaltemperatur und Hormonstatus beobachtet. Ferner wurden Bestimmungen<br />
von Gonadotropinen, Östrogenen und Pregnandiol im Harn vorgenommen, manchmal<br />
wurden auch Ketosteroidc bestimmt. Vaginalabstriche wurden wiederholt<br />
untersucht. Über Strahlenart und Dosis ist nichts gesagt. Bei einer Gruppe von<br />
20 Patientinnen wurden Hypophyse und Ovarien in 3 geteilten Dosen mit einer<br />
Woche Abstand bestrahlt, bei einer 2. Gruppe nur die Ovarien, bei der 3.Gruppe<br />
nur die Hypophyse. Bei über der Hälfte der beiden ersten Gruppen besserte sich<br />
die Östrogene Funktion, bei V3 auch die Corpus lutcum-Funktion, bei 7 von 20 trat<br />
Schwangerschaft ein. Die Menstruation besserte sich. Bei den Störungen durch<br />
Mangel an Gonadotropinen waren die Erfolge wesentlich besser als bei primär<br />
ovariellen Funktionsstörungen, jedoch wurden auch bei einem Teil der letzteren<br />
Besserungen beobachtet. Es scheint, daß die Bestrahlung der Ovarien am wirksamsten<br />
¡st. Nur bei 4 Patientinnen traten unangenehme Störungen auf, wie Oligomenorrhoe,<br />
Blutungen, Hitzewellen mit entweder zu starker oder zu geringer<br />
Ausscheidung von Gonadotropin. Auch MANSTF.IN berichtet über Erfolge bei<br />
vegetativen Störungen bei Frauen.<br />
Bei bestimmten Formen von Diabetes sind Einsparungen von Insulin möglich,<br />
Durchflutungen von Hypophyse und Pankreas können in geeigneten Fällen die<br />
StofTwcchscllage bessern.<br />
KELSTRUP wendete Ultrakurzwellen und Mikrowellcn-Durchflutungen der<br />
Hypophyse bei chronischer Polyarthritis an. Bei 39 Patienten, selbst solchen in<br />
3. und 4. Stadium, traten im Laufe von 3-4 Monaten erhebliche Besserungen ein.<br />
Unerwünschte Nebenerscheinungen wurden nie beobachtet. Über ähnlich gute<br />
Erfolge berichtet E. VAN WENT und L.KIHN.<br />
Versuche zur Beeinflußung maligner Tumoren<br />
Die Autohormontherapie konnte bisher nur bei solchen Kranken durchgeführt<br />
werden, bei denen von chirurgischer Seite eine operative Behandlung als aussichtslos<br />
abgelehnt worden war. Es war daher von vornherein klar, daß nicht mit einer<br />
großen Aussicht auf Erfolg gerechnet werden konnte. Trotzdem ist es gelungen,<br />
mehrere Kranke soweit wiederherzustellen, daß sie seit mehreren Jahren ihrer<br />
früheren Tätigkeit wieder voll nachgehen und keine Beschwerden haben. Hier<br />
seien nur einige Fälle angeführt:<br />
Ein i8jähriger Engländer kam 1934 in meine Behandlung in desolatem Zustand<br />
mit einem Hirntumor. Er war bereits 2mal trepaniert worden, das Gliom am Wurm<br />
des Kleinhirns konnte aber von dem Londoner Chirurgen Trotter nicht entfernt<br />
werden, es wurde lediglich eine Probeexcision vorgenommen, die ein malignes<br />
Glioblastom ergab. Der Kranke war kachektisch; er konnte nicht stehen und nur<br />
246
mit Unterstützung sitzen, erbrach dauernd, war desorientiert und konnte nur<br />
lallende Laute von sich geben. Es bestand Stauungspapille. An der Stelle der Entlastungstrepanation<br />
im Nacken befand sich eine gespannte Vorwölbung. Die<br />
Kopfdurchflutung wurde zuerst täglich, später jmal in der Woche durchgeführt.<br />
Der Zustand besserte sich nur sehr langsam. Zunächst Heß das Erbrechen nach,<br />
dann kehrte der Appetit zurück und der Kranke nahm langsam an Gewicht zu.<br />
Erst nach einem Jahr wurde er geordnet, lernte wieder, wenn auch mit gewissen<br />
Störungen, zu sprechen,<br />
schreiben und lesen. Er lebt<br />
noch heute, nach 25 Jahren,<br />
in verhältnismäßig gutem Zustand,<br />
wenn auch gewisse<br />
Ausfallserscheinungen bestehen,<br />
wie Gleichgewichtsstörungen<br />
beim Gehen, leichte<br />
Hemiparese und geringe<br />
Sprachstörungen. Der Kranke<br />
kann sich aber beschäftigen,<br />
leichte Arbeiten ausführen<br />
und Reisen machen.<br />
Bei einer 56jährigen Frau<br />
war von einer Universitäts-<br />
Frauenklinik ein Ovarial-Ca<br />
festgestellt und operiert worden<br />
Die Diagnose wurde<br />
histologisch erhärtet. Nach<br />
etwa einem Jahr trat einRccidiv<br />
auf, das mit Röntgenbestrahlungen<br />
erfolglos behandelt<br />
wurde. Die Kranke<br />
kam in desolatem Zustand in<br />
meine Behandlung. Bei jedem<br />
Stuhlgang traten starke Blutungen<br />
auf, die Schmerzen<br />
Abb. 179: Füüungsbildcr des Colon bei einer 56J.<br />
Frau mit Ca des Colon nach Rezidiv von Uterus-Ca<br />
waren nur durch täglich 4malige Morphiumgabe beeinflußbar. Bei der gynäkologischen<br />
Untersuchung fand sich das kl. Becken mit Tumormassen ausgemauert.<br />
Rektoskopie war wegen Verengung des Mastdarmes nicht möglich. Nach 6 Wochen<br />
langer Bestrahlung der Hypophyse besserte sich der Zustand. Die Kranke nahm<br />
stark an Gewicht zu, Opiate konnten weggelassen werden. Die Blutungen hatten<br />
nachgelassen. Erst jetzt war Einführung eines Rektoskops möglich. Es zeigte sich,<br />
daß das Rectum bis zu 15 cm ringsum von Tumormassen ummauert war, das<br />
Lumen war starr und verengt (Abb. 179). Nach 3 Monaten fühlte sich die Kranke so<br />
wohl, daß sie aufstehen konnte. Sie hat jetzt, nach 6 Jahren, keine Beschwerden. Die<br />
Behandlung wird alle 14 Tage einmal durchgeführt. Wenn die Patientin längere<br />
Zeit mit der Behandlung aussetzt, treten wieder leichte Beschwerden ein.<br />
Ein ;2jähriger Bauer kam 1950 in meine Behandlung wegen Atemnot und Bluthusten.<br />
Röntgenologisch wurde eine etwa apfclgroße runde Verschattung in der<br />
Lunge festgestellt, die von Herrn Prof. DYES als Bronchialkarzinom aufgefaßt wurde.<br />
Nach 3 Monate lang durchgeführter Autohormontherapie nahm der Kranke 10 kg<br />
2 47
an Gewicht zu und wurde wieder voll arbeitsfähig. Der Schatten bildete sich bis<br />
auf einen fünfmarkstückgroßen Rest zurück. Aus äußeren Gründen konnte<br />
V<br />
Abb. 180 und 181 : Schädelaufnahmcn von einer Kranken mit Stirnhirntumor<br />
nach etwa einem Jahr die Behandlung nicht weitergeführt werden. Der Patient<br />
war in sehr guter Verfassung. Etwa i Jahr nach Aussetzen der Behandlung verschlechterte<br />
sich der Zustand wieder, die Verschattung nahm zu und durch Bron-<br />
248
choskopic wurde Krebsgewebe festgestellt. Nach üblicher Behandlung starb der<br />
Kranke.<br />
Frl. G., 59 Jahre alt, hatte eine Mammaamputation durchgemacht, es war Ca.<br />
histologisch festgestellt worden. 2 Jahre später, 1952, traten unerträgliche Schmerzen<br />
im rechten Bein auf, so daß die Kranke nicht mehr stehen und gehen konnte.<br />
Sie wurde wegen Ischias eingewiesen. Eine Röntgenaufnahme ergab 3 etwa haselnußgroße<br />
Aufhellungen im rechten Femurkopf. Das rechte Bein war leicht geschwollen.<br />
Herr Prof. DU MESNIL DE ROCHEMONT bestätigte meine Auffassung,<br />
daß es sich nur um Ca-Metastasen handeln könne. Nach Autohormontherapic<br />
besserten sich die Beschwerden nur langsam. Erst nach 3 Monaten konnte die<br />
Kranke wieder auf dem rechten Bein stehen und einige Schritte machen. Nach<br />
einem Jahr konnte sie frei gehen. Sie kommt jetzt, nach 5 Jahren noch alle 2 Wochen<br />
zur Behandlung und ist - bis auf eine Anschwellung des Armes auf der Seite der<br />
Mamma-Amputation - völlig beschwerdefrei.<br />
Bei der 62jährigen Frau Z. war in einer großen neurologischen Universitätsklinik<br />
ein Hirntumor festgestellt worden. Die Diagnose wurde durch Encéphalographie<br />
bestätigt. Der 3.Ventrikel der Seite war durch die Tumormassen ganz<br />
zusammengedrückt (Abb. i8o, 181). Eine Operation wurde von den zugezogenen<br />
Hirnchirurgen als aussichtslos abgelehnt. Als ich die Kranke übernahm, war die<br />
Kranke völlig desorientiert. Sie konnte sich nicht aus ihrer passiven Bettlage aufrichten,<br />
die Sprache war schwer gestört, sie konnte nur lallen und sich nicht verständlich<br />
machen. Stuhl und Harn gingen unwillkürlich ab. Ich übernahm die Behandlung<br />
solaminis causa, ohne Hoffnung. Wider Erwarten besserte sich der Zustand nach<br />
6 Wochen ganz allmählich. Die Kranke lernte wieder Stuhl und Harn geregelt zu<br />
entleeren und Laute von sich zu geben. Allmählich lernte sie wieder zu sprechen,<br />
die motorische Aphasie ging in eine sensorische Aphasie über, dann war nur noch<br />
die Wortfindung gestört. Schließlich bestand retrograde Amnesie, die sich auch<br />
noch allmählich 2urückbildete. Die Kranke war nach einem Jahr wieder voll<br />
leistungsfähig und ohne Beschwerden. Die Behandlung wird seit j Jahren je einmal<br />
in 2 Wochen weitergeführt.<br />
Der 60jährige Bauer K.J. kam 1952 mit schwerer Dyspnoe und Cyanose, die<br />
sich im Laufe von einigen Monaten langsam entwickelt hatten. Er litt an Husten<br />
und hatte Blutstreifen im Auswurf. Eine Treppe mit j Stufen konnte er nur mit<br />
Hilfe unter schwerer Atemnot erklimmen. Die Röntgenaufnahme zeigte in beiden<br />
Lungen mehrere runde Schatten, die nur als Karzinomknoten aufgefaßt werden<br />
konnten (Abb. 182). In diesem Fall sind gewisseZ weifel berechtigt, weil kein histologisches<br />
Untersuchungsergebnis vorlag, aber mit 90% Wahrscheinlichkeit war Ca.<br />
anzunehmen. Aber selbst wenn es sich um irgendwelche gutartige oder entzündliche<br />
Infiltrate gehandelt haben sollte, ist das Ergebnis der Autohormontherapie einzigartig.<br />
Innerhalb von 3 Monaten besserte sich der Zustand so, daß der Kranke<br />
wieder leichte Arbeiten ausführen konnte. Die Schatten gingen ganz allmählich<br />
zurück. Jetzt sind nur noch einige Strangschatten feststellbar. Der Kranke arbeitet<br />
voll auf dem Feld. Er muß alle 2 Wochen zur Behandlung kommen. Setzt er<br />
längere Zeit aus, so tritt wieder Atemnot ein, und er kommt von selbst wieder.<br />
Die hier angeführten Fälle sind über 6Jahre lang behandelt worden, es stehen<br />
aber noch mehrere Kranke seit 3-5 Jahren in meiner Behandlung. Alle behandelten<br />
Kranken waren nach Ansicht der zugezogenen Chirurgen inoperabel, oder es<br />
handelte sich um Recidive nach Operationen. Ein großer Teil war in desolatem<br />
Zustand. Ein Versuch der Behandlung wurde selbst bei Schwerstkranken im Bett<br />
249
unternommen. Da es gewöhnlich mindestens 8-12 Wochen dauert, bis ein Erfolg<br />
zu bemerken ist, kann nur dann überhaupt mit Erfolg gerechnet werden, wenn<br />
noch eine Lebenserwartung von 4-5 Monaten besteht. Keine Besserungen wurden<br />
bisher bei Kranken erzielt, die Exsudate hatten. Wenn die Kranken nach 3 Monate<br />
Abb. 182: Lungenaufnahmen von K.J. Abb. 183: K.J. am 27.7.55 nach jmal<br />
vor Behandlung. Cyanose, stark erhöhte wöchentlich durchgeführten Dutch-<br />
BSG, starke Dyspnoe (7.10.52) (seilen- flutungen des Kopfes. Keine Beschwerverkehrt<br />
den mehr, der Patient arbeitet wieder<br />
auf dem Feld<br />
Abb, 184: Derselbe am 27.6.56 Abb. 185 : K.J. am 20.1.1958. Volles<br />
Wohlbefinden<br />
fortgesetzter Behandlung noch leben, steigen die Aussichten auf Besserung erheblich.<br />
Bisher ist es gelungen, von 100 behandelten Kranken 20 so erheblich zu bessern,<br />
daß sie ihrer früheren Tätigkeit wieder nachgehen konnten und keine Beschwerden<br />
hatten.<br />
2J0
Drei Kranke setzten nach erheblicher Besserung mit der Behandlung aus, da<br />
sie keine Beschwerden mehr hatten. Beiihnenkam es etwa i Jahr später zu Recidiven<br />
mit tödlichem Ausgang. Zwei ebenfalls sehr gut gebesserte Kranke starben an interkurrenten<br />
Krankheiten, einer an Herzinfarkt, eine Pat. an einer Tuberkulose.<br />
Zur Beurteilung der von mir behandelten Fälle möchte ich ausdrücklich Folgendes<br />
bemerken: Es war nicht immer möglich, Material zur histologischen Untersuchung<br />
zu erhalten, denn man kann es den Kranken nicht zumuten, sich nur zu<br />
diesem Zweck gefährlichen Operationen zu unterziehen. Bei einer ganzen Anzahl<br />
der behandelten Kranken Hegen aber histologische Befunde vor. Bei mehreren<br />
anderen Patienten waren früher Karzinome exstirpiert und histologisch untersucht<br />
worden. Wenn bei solchen Kranken nach 2-3 Jahren Tumoren auftreten,<br />
hat die Annahme, daß es sich um Ca-Recidive handelt, eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit<br />
für sich, zumal wenn auch die Blutbefunde dafür sprechen. Bei anderen<br />
Kranken waren die Tumoren röntgenologisch nachgewiesen und es bestanden<br />
auch die sonstigen Symptome eines Karzinoms, wie hohe Blutsenkung, Anämie<br />
usw. Fast in allen Fällen waren die Diagnosen in anderen Kliniken gestellt worden.<br />
Man kann daher bei diesen Kranken zwar nicht von absoluter Sicherheit der Krebsdiagnose<br />
sprechen, wohl aber von einer hohen Wahrscheinlichkeit.<br />
Mit der Besprechung dieser Fälle möchte ich nur zu einer Nachprüfung anregen,<br />
die von in der KWTh geschulten Ärzten ohne weiteres durchgeführt werden<br />
kann. Es ist nicht einzusehen, warum diese Behandlung nicht ausgeführt werden<br />
sollte, besonders bei inoperablen Kranken und zur Nachbehandlung nach Operationen,<br />
etwa nach Magenresektionen. Die erschreckend kurzen Überlebenszeiten<br />
nach Operation des Magenkarzinoms könnten wahrscheinlich erheblich verlängert<br />
werden. Bisher Hegt nur eine bestätigende Mitteilung von THRAN vor.<br />
Es ist auch wahrscheinlich, daß durch weiteren Ausbau der Behandlungstechnik<br />
und Dosierung noch wesentlich bessere Ergebnisse erzielt werden. Auch wäre es<br />
wünschenswert, wenn für die Therapie eine Welle von 1 m Länge freigegeben<br />
würde; nach meinen Erfahrungen 1938/39 können dadurch die Heilerfolge noch<br />
sehr gesteigert werden.<br />
19. Beobachtungen am Auge. Augenkrankheiten<br />
In der Augenheilkunde sind experimentelle und klinische Erfahrungen über<br />
KW-Anwendung bekannt geworden, die z.T. mit Röhren-, z.T. mit Funkenstreckenapparaten<br />
gewonnen wurden und daher nicht ohne weiteres unter sich<br />
vergleichbar sind.<br />
Experimentelle Untersuchungen über den Grad der Erwärmung des Auges hat<br />
P. KIEWE gemeinsam mit E. VON KOEHLER und H. HERTENSTEIN in Genf mit<br />
Funkenstreckenapparaten ausgeführt. Die Forscher bestimmten die durch KW<br />
erzeugte Wärme mit Thermonadcln an Ticraugen und stellten fest, daß es im Auge<br />
zu einer gleichmäßigen, in die Tiefe dringenden Erwärmung kommt.<br />
GRÜTER impfte die Hornhaut mehrerer Kaninchen mit einem standardisierten<br />
Herpesstamm und durchflutete dann die Augen nach 1-3 Tagen mit KW (Funkenstreckenapparat).<br />
Er stellte zuerst für 1-2 Tage eine Hemmung der progressiven<br />
Herpeskeratitis fest, es folgte aber wieder ein Fortschreiten der herpetischen Hornhauterkrankung,<br />
und es konnten trotz KW-Behandlung weitere positive Impfungen<br />
auf die Hornhaut anderer Kaninchen ausgeführt werden.<br />
2JI
Unmittelbar nach der Beendigung der 2j Minuten langen KW-Durchflutung<br />
konnte er eine bis dahin nicht vorhandene starke serofibrinöse Ausschwitzung im<br />
Pupillargebiet und in der vorderen Kammer, sowohl an Augen mit herpetischer<br />
Keratitis wie an ganz gesunden Kaninchenaugen, die zur Kontrolle herangezogen<br />
wurden, feststellen. Untersuchungen von SCHLEIPEN am Kaninchenauge ergaben,<br />
daß tägliche Durchflutungen von i 5 Minuten Dauer noch keine histologischen<br />
Veränderungen erzeugen. Erst nach 60 Tage fortgesetzter Behandlung zeigten<br />
sich Aufsplitterungen und z. T Abschilferungen der Hornhaut an den oberflächlichen<br />
Schichten. Uvea und Linse blieben ganz unverändert.<br />
Was die Technik der KW-Anwcndung am menschlichen Auge anbelangt, so wurde,<br />
wenn es sich um Durchflutung nur eines Auges handelte, eine kleine Elektrode mit<br />
geringem Abstand vor das Auge, dagegen eine große Elektrode mit größcrem Abstand<br />
an den Hinterkopf gebracht. Sollten beide Augen gleichzeitig durchflutet werden, so<br />
wurden 2 gleich große Elektroden vor beiden äußeren Orbitalrändcrn fixiert. Die Durchflutungsdauer<br />
betrug in der Regel j bis ij Minuten. (Abb. 186)<br />
Die Patienten empfinden die KW-Durchflutung der Augen (6-m-WeIIe) meist<br />
angenehm. GRÜTER hat mit dem Hornhautmikroskop und der Spaltlampe nach<br />
Behandlung mit einem Funkenstreckenapparat am lebenden menschlichen<br />
Auge eine lange nachwirkende ödematöse Auflockerung des Hornhaut- und<br />
Irisgewebes beobachtet. W. HOFFMANN (Königsberg) und SATTLER haben nach<br />
der Durchflutung mit der 6-m-Wclle eines Röhrensenders niemals eine Veränderung<br />
am lebenden Gewebe des Auges an der Spaltlampe feststellen können.<br />
Der Unterschied gegenüber den Beobachtungen GRÜTERS beruht wohl auf<br />
der Verschiedenheit der Schwingungen von Funkenstreckenapparaten und<br />
Röhrenapparaten.<br />
152
Nach Sattler werden entzündliche Erkrankungen am Auge besonders gut beeinflußt.<br />
Er sah sehr gute Wirkungen bei Lidabszessen und Tränensackphlegmonen.<br />
Abszesse, die schon fast reif zur Inzision erschienen, bildeten sich zurück,<br />
andere kamen nach Inzision auffallend rasch zur Heilung. Äußere Gerstenkörner<br />
schienen besser beeinflußt zu werden als innere, bei denen nach der Rückbildung<br />
gelegentlich ein verhärteter chalazionartiger Knoten zurückblieb. Dies bestätigt<br />
FUCHS (Wien). Eine besonders günstige Wirkung sah SATTLER in einem Fall von<br />
Orbitalentzündung mit starkem Exophthalmus, Schmerzhaftigkeit der Augenbewegungen<br />
und DruckempfindKchkeit, die sich im Anschluß an eine Sondierung des<br />
Tränennasenkanals eingestellt hatte. Auch BIRCH HIRSCHFELD beobachtete in einem<br />
Fall von Orbitalphlegmone und einem Fall von Orbitalabszeß eine rasche Rückbildung<br />
nach KW-Durchflutung (4 bzw. 10 Sitzungen). Auch nach ARCURI, der 2000<br />
Kranke behandelt hat, sind die entzündlichen Erkrankungen das Hauptgebict für die<br />
UKW-Anwendung. Übereinstimmend wird die Schmerzstillung und rasche Resorption<br />
von Exsudaten hervorgehoben. Hordeolum, Lidphlegmonen, eitrige Entzündungen<br />
der Tränenwege, Ulcus serpens, Orbitalabszesse, septische Kornealabszessc<br />
und postoperative Infektionen sowie perforierende entzündliche Verletzungen<br />
wurden mit gleich gutem Erfolg behandelt. Bei allen diesen Erkrankungen ist die<br />
K WTh allen früher geübten Verfahren überlegen (BERGLER). In einem Fall von perforieren<br />
der Hornhautverletzung mit Infektion (Hypopyon der vorderen Kammer)<br />
sah SATTLER unter KWTh völlige Heilung und Besserung des Sehvermögens von<br />
3 /fi0 auf 5 /4 innerhalb von 4 Wochen. Keratohypopyon wird oft schon nach 2 bis<br />
6 Durchflutungen resorbiert.<br />
Bei Thrombose der Zcntralvene erzielten RUEDEMANN und ZEITLER in 2 von<br />
Í Fällen Heilung. Gebessert wurden ferner Orbitalentzündungen, Tarsitis, Episkleritis<br />
und in 2 von 3 Fällen Sekundärglaukom.<br />
Bei Iritis und Iridozyklitis hatten GUTSCH, BIRCH HÍRSCHFELD und SATTLER<br />
gleich gute Erfolge. Uveitis wird danach teils wesentlich gebessert, teils geheilt<br />
Der intraokulare Druck sinkt dabei ab. In der Königsberger Augenklinik wurden<br />
26 Fälle mit gutem Erfolg behandelt.<br />
Den negativen Ergebnissen bei der Behandlung der Chorioiditis, die ARCURI<br />
angibt, stehen gute Erfolge von CULLER und SIMPSON gegenüber; sie behandelten<br />
allerdings mit allgemeiner Hyperthermie, kombiniert mit Metallsalzen. Nur in<br />
einer geringen Anzahl von Fällen verursachten Narben eine Beeinträchtigung der<br />
Sehschärfe. Die rasche Besserung und Heilung, die Sicherheit und Gefahrlosigkeit<br />
der Behandlung werden hervorgehoben.<br />
An Hornhauterkrankungen hat GRÜTER mit einem Funkenstreckengerät 22 Fälle<br />
von Ulcus serpens und 41 von Herpes corneae (22 epitheliale und 19 parenchymatöse<br />
Formen) durchflutet. Von den Ulcus serpens-Fällen kamen 19 zur Heilung.<br />
Bei den übrigen 3 Kranken zeigte sich nur eine vorübergehende Hemmung, dann<br />
aber ein Fortschreiten, so daß eine Spaltung des Geschwürs erforderlich wurde.<br />
Von Hornhautherpes wurden die epithelialen Formen alle geheilt. Bei den tiefen<br />
Formen (Keratitis diseiformis) schienen die Hornhautherde zunächst noch dichter<br />
infiltriert, anschließend zeigte sich aber nach mehrtägiger Behandlung eine ungewöhnlich<br />
schnelle Aufhellung. Bei der KW-Durchflutung erfolgte die Heilung<br />
rascher und gründlicher als bei anderen Behandlungsarten. Rückfälle wurden verhütet.<br />
DE DECKER und ARENDT behandelten 4 Kranke mit herpetischen Hornhauterkrankungen<br />
(2 davon mit Bläschenbildungen) der Hornhaut, bei denen z.T.<br />
mehrwöchige übliche Behandlung erfolglos gewesen war. Die KWTh brachte<br />
2 53
asche Linderung der Beschwerden und völlige Heilung. Eine auffallend schnelle<br />
Aufhellung tiefer Hornhauttrübungen bei einer Keratitis parenchymatosa führen<br />
die genannten Autoren auf KWTh zurück. Dagegen sah BARTELS bei schwerer<br />
Keratitis parenchymatöse (Lues connata) nach 43 Bestrahlungen keine Beeinflussung<br />
der Trübung. Bei sklerosierender Keratitis dagegen beobachtete er einmal nach<br />
15 Bestrahlungen keinen Erfolg, in einem anderen Fall nach 44 Durchflutungen<br />
Ausheilung des Prozesses. Eine tiefe tuberkulöse Hornhautentzündung heilte unter<br />
KWTh. Eine deutliche Beeinflussung von Skleritiden und Episkleritiden konnten<br />
weder BIRCH HIRSCHFELD noch DE DECKER feststellen.<br />
Trübungen der Hornhaut reagieren je nach ihrer Ätiologie verschieden. Bei<br />
Keratitis parenchymatosa luica geht die Trübung schnell zurück, die Heilung erfolgt<br />
in höherem Prozentsatz als bei den früheren Methoden. Selbst durch Vaskularisation<br />
komplizierte Fälle können bei längerer Behandlung zu weitgehender<br />
Aufhellung gebracht werden. Die KWTh ist in dieser Beziehung der Röntgenbestrahlung<br />
weit überlegen. Bei Keratitis herpetica wird der Heilungsverlauf erheblich<br />
abgekürzt. Schmerz, Lichtscheu und Tränenträufeln verschwinden schneller<br />
als sonst. Nach BERGLER ist allerdings bei den oberflächlichen herpetischen<br />
Erkrankungen der Hornhaut die KWTh den älteren Behandlungsverfahren nicht<br />
überlegen. Dagegen ist die Behandlung sehr wertvoll bei Keratitis punctata superficialis<br />
und bei rezidivierenden Erosionen. Sklerosierende Keratitis wird nach<br />
ARCURI nicht beeinflußt. KRAUSZ beschreibt dagegen Aufhellung der Hornhaut<br />
und Wiedererlangung des Sehvermögens. Die schmerzstillende Wirkung der<br />
KWTh zeigt sich ferner in eklatanter Weise bei Episkleritis ; die Knötchen verschwinden<br />
auffallend rasch.<br />
Trachom konnte KRAUSZ durch kombinierte Behandlung mit UKW und anschließender<br />
Iontophorese mit Kupfersulfat in 30 Fällen schon nach 6-10 Wochen<br />
heilen. Ebenso konnte BUSSE GRAWITZ die Dauer der üblichen Trachombehandlung<br />
durch gleichzeitige KWTh wesentlich abkürzen.<br />
Keratitis parenchymatosa auf tuberkulöser Grundlage soll nach ARCURI durch<br />
KWTh besser beeinflußt werden als durch Röntgenbestrahlung.<br />
Bei Netzhauttuberkulose geben GUTSCH sowie BERGLER Erfolge an, HAUS<br />
MANN sah Teilerfolge. GUTSCH sah völlige Resorption eines riesigen blasenförmigen<br />
tuberkulösen Ergusses im Glaskörper und Wiederherstellung des Sehvermögens.<br />
In mehreren Fällen von Tbc der Aderhaut bildeten sich konglobierte Tuberkel<br />
unter glatter Narbenbildung zurück, es wurde gute Sehschärfe erreicht.<br />
Venöse Thrombosen im Augenhintergrund werden günstig beeinflußt, was den<br />
guten Erfolgen bei Thrombophlebitis entspricht. Blutungen sind keine Gcgcnindikation,<br />
sie werden im Gegenteil schneller resorbiert. Neuritis retrobulbaris<br />
wird nach RABINOWITSCH, RUEDEMANN und ZEITLER gut beeinflußt. Die letzteren<br />
Autoren kombinierten mit künstlichem Fieber durch Typhusvakzinc. SATTLER<br />
sah bei 3 von 4 Fällen mit retrobulbärer Neuritis eine Besserung. Tabischc Opticusatrophic<br />
reagierte nicht.<br />
Bei einer schweren, anscheinend tuberkulösen Erkrankung der Hornhaut,<br />
Lederhaut, Regenbogenhaut und des Ziliarkörpers mit großen klumpigen Beschlägen<br />
der Hornhauthinterwand und starken Glaskörpertrübungen, die bei<br />
monatclanger Behandlung verschiedener Art nicht gebessert waren, sah SATTLER<br />
nach 20 KW-Durchflutungen Abblassen des Auges und Aufsaugung der Trübungen.<br />
Eine verhältnismäßig rasche Vernarbung eines großen Konglomerattuberkels<br />
der Aderhaut unter KWTh beobachtete WEGNER.<br />
254
Opticusatrophie wird nicht beeinflußt. Keine Erfolge wurden weiterhin erzielt<br />
bei Glaukom, Tumoren, Ablatio retinae, Glaskörperblutungen, Maculablutungen<br />
bei Myopie (BARTELS, BIRCH HIRSCHFELD, GUTSCH, ZEZI, SATTLER).<br />
EULER hat von 18 gleichzeitig eingelieferten Vergiftungen mit Methylalkohol<br />
6 mit KW-Durchflutungcn der Augen behandelt, 4 mit KW und gleichzeitigen<br />
Injektionen und Punktionen, die übrigen mit den bisher üblichen Mitteln. Es war<br />
auffallend, daß sich von den letzteren nur einer besserte, während bei allen mit<br />
KW behandelten Kranken Besserungen eintraten. Nur ein mit Lumbalpunktionen<br />
und KW behandelter Kranker besserte sich nicht.<br />
Nach Bestrahlung der Augen mit Mikrowellen sahen OSBORNE und FREDERICK<br />
keine Schäden an der Retina, auch keine Erweiterung der Retinagefäßc.<br />
STUMPTNER & THOM stellten bei Bestrahlungen von Kaninchenaugen fest, daß<br />
bei einer Leistungsdichte von etwa 3 Watt/qcm und 10 min Dauer Trübungen<br />
des Linsenkörpers auftraten. Man sollte daher am Auge nicht über eine Leistungsdichte<br />
von 0,6 W/qcm hinausgehen (d.h. bei Rundfeldstrahlern unter 60 W bei<br />
10 cm Abstand, oder 100 W bei 20 cm Abstand), s.a. SALISBURY, CLARK, HINES,<br />
DAILY.<br />
Nach BURMEISTER wird die Wirkung von Antibioticis bei Lidabszessen und<br />
anderen Erkrankungen durch Mikrowellenbestrahlung verstärkt.<br />
Gute Erfolge durch Mikrowellen werden angegeben bei tiefen herpetischen<br />
Keratitiden mit bis zu 20 Sitzungen. Die Trübungen hellen sich auf. Sehr gut<br />
reagieren beginnende Tränensackphlegmone, Tränendrüsenentzündungen und<br />
Lidabszessc, ferner frische Iritis und Iridozyklitis. Die Beschläge resorbieren sich,<br />
der Tyndall-Effckt geht zurück. Uveitis wird günstig beeinflußt.<br />
Die Resorption von intraokularen Blutungen wird auch durch Mikrowellen beschleunigt,<br />
besonders gut sind die Erfolge bei traumatischen Glaskörperblutungen,<br />
die möglichst frühzeitig bestrahlt werden sollten. Ferner liegen Erfahrungen vor<br />
bei Lid- und retrobulbären Hämatomen, V.K.Blutungen nach Verletzungen und<br />
Operationen, Fundusblutungen bei Myopie und Maculablutungen bei Maculadegeneration.<br />
Bei Zentralvcnenthrombose kam es nach 8-10 Tagen zum Rückgang der Erscheinungen.<br />
Neuritis retrobulbaris wurde gut beeinflußt, nicht jedoch bei Multipler<br />
Sklerose. Papillcnödeme gingen zurück.<br />
Berichte über KWTh liegen noch vor von RUEDEMANN, MAURICI, BERGLER,<br />
GRÜTER, CULLER und SIMPSON, MAS, GAVIC, HAUSMANN, BÜRKI, RIEGER.<br />
Technik und Dosierung : Richtige Handhabung der Apparate und feinfühliges Dosieren<br />
sind von größter Wichtigkeit.<br />
Behandlung eines Auges: Kleine Elektrode von j cm Durchmesser in etwa 4 cm Entfernung,<br />
große Elektrode mit 10 cm Abstand hinter dem Kopf. Bei 2 Augen: Je eine<br />
io-cm-Elcktrodc über beiden Schläfen mit 3-4 cm Abstand. Dauer 10 bis 20 Minuten.<br />
Dosierung bis zum angenehmen Wärmeempfinden (Dosis II). Die Temperatur im Inneren<br />
darf auf keinen Fall 41 0 überschreiten.<br />
255
VI. Die Verwendung der Kurzwellen zur Diagnostik<br />
Erst in neuer Zeit hat sich ergeben, daß UKW auch zur Diagnose verwertbar<br />
sind. GUTZEIT und KÜCHLEIN verwandten sie zuerst zur Provokation von Zahnherden.<br />
Von größter Wichtigkeit ist hier die Frage, inwieweit vorhandene Zahngranulome<br />
das krankhafte Geschehen im Körper, insbesondere rheumatische Prozesse,<br />
beeinflussen, denn viele Herde sind inaktiv.<br />
Die Autoren benutzten einen Funkenstreckenapparat geringer Leistung und besondere,<br />
am Zahnhals anzulegende Elektroden. Sie fanden, daß nach ij Minuten langer Durchflutung<br />
aktiver Herde die Blutkörpcrchcnsenkungsgcschwindigkcit (BSG) in dem aus der<br />
ungestauten Vene entnommenen Blut anstieg, und zwar am stärksten 2 Stunden nach<br />
Entnahme. Bei Durchflutung von gesunden Zähnen oder inaktiven Granulomen soll der<br />
Anstieg nicht erfolgen.<br />
Die Ergebnisse wurden von PFANNKUCH und KARPF und von STOPPELHAAR angezweifelt,<br />
doch glauben GUTZEIT und BETTGE deren abweichende Ergebnisse auf andere<br />
Technik zurückführen zu können. Auch für die Tonsillen wurde das Verfahren ausgebaut.<br />
Das Verfahren hat sich in der Praxis aus verschiedenen Gründen nicht recht<br />
durchsetzen können. Die Abweichungen der BSG nach Durchflutung sind sehr<br />
gering, so daß große Erfahrung und exakteste Technik notwendig sind. Wenn<br />
man unter mehreren fraglichen Herden den wirklich aktiven herausfinden will,<br />
sind zahlreiche Durchflutungen und ebenso viele Blutentnahmen nötig, was den<br />
Patienten nicht zugemutet werden kann. Dazu kommt die Erscheinung der<br />
Anachorese (ASCOLI). Wird nämlich ein Infektherd beseitigt, dann werden oft andere,<br />
vorher ruhende Herde aktiv und beginnen zu streuen. Die Erkennung eines<br />
aktiven Herdes verliert dadurch an Wert.<br />
Nach BRAENSTRUP wird die BSG nach Durchflutung eitriger entzündlicher Herde in<br />
6 von 20 Fällen erhöht, in 2 Fällen erniedrigt. Bei Durchflutung nicht entzündeter Teile<br />
trat stets nur Anstieg ein. Der Grad der Erwärmung spielte dabei keine Rolle.<br />
Bei Durchflutung von Herden im weiblichen Genitale sah GUTHMANN keine<br />
einheitlichen Veränderungen der BSG und des Blutbildes.<br />
GUTHMANN und SCHMIDT untersuchten das weiße Blutbild nach UKW-Behandlung<br />
entzündlicher gynäkologischer Erkrankungen (Wellenlänge 5 m, 20 Minuten). Die Zahl<br />
der Leukozyten an der Peripherie nahm stark ab, sie sammelten sich in den durchfluteten<br />
Gebieten an. Jugendformen und Stabkernige waren vermehrt, die Lymphozyten nahmen<br />
zu, während die Eosinophilen vermindert waren. Die Stärke der Ansammlung der Leukozyten<br />
in den durchfluteten Gebieten hing vom Grad der Entzündung ab. Die Diskrepanz<br />
mit den noch zu beschreibenden Ergebnissen des Verfassers dürfte mit der verschiedenen<br />
Dosis und Zeit der Blutentnahme zusammenhängen.<br />
Wir selbst haben uns seit längerer Zeit mit der Frage befaßt, wie die Durchflutung<br />
von Entzündungsherden auf das Blut wirkt, ausgehend von der Tatsache<br />
der Aktivierung solcher Herde nach Ubcrdosierung. Außerdem hatten wir die<br />
Erfahrung gemacht, daß bei Durchflutung des rechten Unterbauches mit schwachen<br />
und mittleren Dosen die chronische Appendizitis meist mit Zunahme der Beschwerden,<br />
Adnexitis dagegen fast immer mit Besserung reagiert. Unsere Untersuchungen<br />
wurden zuerst an Eiterherden verschiedener Art ausgefürt. Die verdächtigen<br />
oder manifesten Herde wurden ; Minuten lang mit mittlerer Dosis<br />
2,6
durchflutet. Leukozyten wurden vorher sowie 7, 15, 30 und 60 Minuten später<br />
gezählt und ein Differentialblutbild gemacht. Selbstverständlich waren die Kranken<br />
nüchtern.<br />
Mit diesem Verfahren lassen sich diagnostisch wichtige Anhaltspunkte gewinnen,<br />
wie die beiden folgenden Fälle zeigen:<br />
Eine 52jährige Frau hatte eine Otitis media durchgemacht, die klinisch geheilt war. Sic<br />
bekam nach einiger Zeit subfebrile Temperaturen, die wochenlang anhielten. Otologisch<br />
war nichts zu finden. Auch an den inneren Organen war kein krankhafter Befund nachweisbar.<br />
Darauf wurde eine j Minuten lange KW-Durchflutung des Kopfes vorgenommen.<br />
Die Leukozytenzahl stieg danach um über 2000 an. Daraufhin wurde zur Antrotomie<br />
geraten, die tatsächlich einen Eiterherd aufdeckte.<br />
Eine 28jährige Frau hatte starke Albuminurie und Cylindrurie sowie die Erscheinungen<br />
eines Mitralvitiums. Die Erkrankung war als chronische Nephritis mit altem Herzfehler<br />
aufgefaßt worden. Da Verdacht auf noch aktive Endokarditis bestand, wurde das<br />
Herz 5 Minuten lang durchflutet. Die Leukozytenzahl stieg danach um fast 3000 an. Die<br />
daraufhin gestellte Diagnose Endokarditis mit embolischer Nephritis wurde in längerer<br />
Beobachtungszeit bestätigt, zumal wiederholt fieberhafte Schübe mit Zunahme der<br />
Erscheinungen am Herzen und Milztumor auftraten.<br />
Bei einer 3 s jährigen Frau war die Diagnose „Brightsche Krankheit" gestellt worden.<br />
Um eine Karditis auszuschließen, wurde K W-Provokation des Herzens ausgeführt, mit<br />
einem Leukozytenanstieg von 12000 auf über 30000. Bei der einige Wochen später<br />
ausgeführten Autopsie fanden sich im ganzen Myokard verteilte miliare Eiterherde.<br />
• •*•*•*•<br />
Systematische Untersuchungen, die E. SCHMIDT auf meine Anregung an der<br />
chirurgischen Abteilung des Juliusspitals Würzburg (Obermcdizinalrat Dr.BuND-<br />
SCHUH) ausgeführt hat, zeigten dasselbe bei Ostcomyclitiden nach Verwundungen.<br />
Auch bei sonst nicht erkennbaren latenten Herden erfolgte nach j Minuten langer<br />
Durchflutung ein Anstieg der Leukozyten. Die BSG verhielt sich uncharaktcristisch<br />
und war meist nicht verändert.<br />
Der Wert dieser Befunde Hegt auf der Hand, denn die Aussichten von Nachamputationen,<br />
Transplantationen und Plastiken hängen weitgehend davon ab, ob<br />
die Eiterungen völlig zur Ruhe gekommen sind oder nicht. Um dies zu erkennen,<br />
hat es aber bisher kein Mittel gegeben, da auch die Röntgenuntersuchung hier<br />
versagt.<br />
An jo Fällen von Appendizitis hat WITTHOFF Untersuchungen im Städtischen<br />
Krankenhaus Monchen-Gladbach angestellt, mit gleichem Ergebnis. Bei gleichbleibenden<br />
Werten oder Abfall der Leukozyten (20-25 Fälle) lag niemals Appendizitis<br />
vor, im Verlauf längerer Beobachtung, bis zu 2 Jahren, traten keine Beschwerden<br />
auf.<br />
Bei Anstiegen um 300-800 war gewöhnlich keine Appendizitis vorhanden. Nur<br />
einer dieser Kranken wurde operiert, es fand sich ein ganz geringer entzündlicher<br />
Prozeß.<br />
Stiegen die Leukozyten über 3000 an, dann wurde operiert; hier stellte sich<br />
jedesmal einwandfreie Appendizitis heraus. Hatten die Leukozytenzahlen schon<br />
vorher über 10000 gelegen, dann war der Anstieg nicht immer so eindrucksvoll<br />
(meist nur um 1000-2000).<br />
Je aktiver also die Appendizitis, desto stärker ist der Anstieg der Leukozyten<br />
nach Durchflutung. Das Verfahren hatte so gute Ergebnisse, daß wir es ohne<br />
weiteres zur Diagnose fraglicher chronischer Appendizitis verwenden konnten.<br />
Stieg nach Durchflutung die Leuko2ytenzahl über 2000 an, dann ließen wir<br />
operieren und fanden regelmäßig die Diagnose bestätigt; andernfalls nahmen wir<br />
M7
an, daß es sich um harmlose Schmerzzustände im Bereich des Kolon handele und<br />
haben bei solchen Kranken auch später niemals irgendwelche sicheren Zeichen<br />
von Appendizitis oder ein Aufflackern der Erscheinungen gesehen.<br />
Wie WEITNAUER nachweisen konnte (bisher nicht veröffentlicht), sind die durch<br />
KW hervorgerufenen Veränderungen im Blutbild bei Eiterungen stets durch Anstieg<br />
der Granulozyten hervorgerufen, während die Lymphozytenzahl häufig zurückgeht.<br />
Deshalb kann es<br />
wichtig sein, Difieren tialblutbildcr<br />
zu machen und die absoluten<br />
Zahlen der Granulozyten<br />
in Beziehung zueinander<br />
zu bringen.<br />
Ein Verfahren, das die Diagnose<br />
von Entzündungsherden<br />
im Herzen mit fast<br />
absoluter Sicherheit erlaubt,<br />
ist die Kurzwellcnprovokation.<br />
Das Blutbild reagiert sehr<br />
empfindlich auf dieUltrakurzwellcndurchflutung<br />
von Entzündungsherden,<br />
wenn diese<br />
nicht zu klein sind. In großen<br />
Untersuchungsreihen, die inzwischen<br />
über iooo Fälle um<br />
15' 30'<br />
—**- = normale Herzen<br />
= Endocarditis (fieberhaft)<br />
—a—D = ¡¡tinte Endocarditis i'ohne Fiebtr)<br />
Abb. 18 7 : Kurzwcllcnprovokation : Verhalten der<br />
Leukozyten nach 5 min langer Durchflutung von<br />
Krankheitsherden im Herzen<br />
fassen, konnte nachgewiesen<br />
werden, daß die Leukozytenzahl<br />
schon nach j Minuten<br />
langen Durchflut ungen mit<br />
schwacher Dosis erheblich ansteigt,<br />
wenn durch Kokken<br />
verursachte Entzündungsherde<br />
getroffen werden.<br />
Bei Durchflutungen des Herzens fallen die Ergebnisse am stärksten in die Augen.<br />
Bei frischer Endokarditis sahen wir Anstiege der Leukozytenzahl bis auf das Zwcibis<br />
Dreifache, bei älteren und latenten Prozessen sind die Anstiege geringer. Gcwertet<br />
werden nur Veränderungen um mindestens 2000-3000. Eine Ausnahme<br />
bilden Entzündungen, bei denen die Leukozytenzahl von vornherein stark erhöht<br />
ist. Liegt sie über 20000, dann erhalten wir in vielen Fällen keinen Anstieg, sondern<br />
einen Abfall. Bei Durchflutungen normaler Herzen haben wir niemals einen Anstieg<br />
gesehen, sondern so gut wie immer einen Abfall. Selbstverständlich entsteht<br />
auch dann ein Anstieg, wenn Entzündungen in der Umgebung des Herzens vorhanden<br />
sind, etwa im Mediastinum oder in den Lungen. Diese müssen differentialdiagnostisch<br />
ausgeschlossen werden.<br />
Der Anstieg beginnt oft schon nach 5 Minuten, ist am stärksten nach 15 bis<br />
30 Minuten, hält etwa 60-80 Minuten an und geht dann wieder zurück.<br />
Die Diagnose der aktiven oder latenten Endokarditis kann mit diesem Verfahren<br />
einwandfrei gestellt werden. Die Bedeutung für die Indikationsstcllung bei<br />
Herzoperationen liegt auf der Hand.<br />
2,8
Bei subakuter und primär chronischer Polyarthritis war ebenfalls Zunahme der<br />
Leukozyten nach Durchflutung der befallenen Gelenke zu beobachten, allerdings<br />
in geringerem Maße.<br />
Bei reinen tuberkulösen Infektionen ruft die Kurzwellenprovokation einen<br />
Abfall der Lcukozytcnhervor. Wir finden ihn daher bei frischen Frühinfiltraten, aber<br />
nicht mehr bei Kavernen. Über das Verhalten von Gclcnktuberkulosen liegen<br />
noch keine genügenden Erfahrungen vor. Durchflutungen der Brustorgane gesunder<br />
Menschen bewirken meist erheblichen Abfall der Leukozyten, wahrscheinlich<br />
infolge Reaktion der Hüusdrüscn. Bei mischinfizierten Tuberkulosen nehmen<br />
die Kurven einen Verlauf, der offenbar teils durch die Tuberkulose, teils durch<br />
die unspezifischen Infektionen bestimmt wird (KROISS und SCHLIEPHAKE).<br />
Nach Durchflutung des Thorax bei Dosis II und ) Minuten Dauer und bei Blutentnahme<br />
am Ohrläppchen (kurz vor der Provokation, sofort danach und nach 5,<br />
15, 30 und 60 Minuten) ergaben sich folgende Befunde:<br />
1. Bei Gesunden sank nach der Provokation die Gesamtzahl der Leukozyten ab,<br />
um nach 60 Minuten den Ausgangswert annähernd wieder zu erreichen. Der Abfall<br />
der Gesamtleukozytenzahl betrug maximal 2800. Anstiege über den Ausgangswert<br />
waren selten. Sic überschritten 500 nur einmal (Abb. 188).<br />
2. Nach Provokation unspeziFischer Entzündungen des Pleuraraumes, der<br />
Lungen und des Endokards stiegen die Gesamtleukozytenzahlen sofort nach der<br />
Durchflutung steil an, in schweren Fällen (Lungenabszeß, Plcurcampycm) um<br />
mehr als 5000 (Abb. 189).<br />
3. Nach Provokation der Brustorgane bei aktiven tuberkulösen Prozessen und<br />
spezifischen tuberkulösen Pleuritidcn ergaben sich bisher 3 typische Vcrlaufsformen<br />
der Leukozytenkurven.<br />
a) Bei einem Teil der Fälle blieben die Gesamtleukozytenwerte bis 30 Minuten<br />
nach der Provokation annähernd gleich, um nach 60 Minuten steil anzusteigen,<br />
zum Teil um mehr als 6000. Diese Verlaufsform wurde von uns als «Typ I»<br />
bezeichnet. Klinisch handelte es sich vorwiegend um beginnende oder gutartig<br />
verlaufende, meist produktive Tuberkulosen oder um spezifische Pleuritidcn (im<br />
Punktat vorwiegend Lymphozyten) (Abb. 190).<br />
b) Auffällig war der Verlauf der Leukozytenkurve in 2 Fällen, bei denen ältere<br />
Kavernen bestanden, die nach den Sputumbcfunden durch Eitererreger mischinfiziert<br />
waren. Nach starker Zunahme sofort nach der Durchflutung fiel die<br />
Leukozytenzahl wieder ab, um nach etwa einer Stunde erneut etwas anzusteigen.<br />
Dieser Kurventyp II ist wahrscheinlich eine Kombinationsform, bewirkt durch<br />
die unspezifische Entzündung (Anstieg) und den spezifischen Prozeß (Abfall der<br />
Leukozytenzahl gemäß Typ III) (Abb. 191).<br />
c) Die klinisch vorwiegend maligne verlaufenden Tuberkulosen und schweren<br />
spezifischen Pleuritidcn zeigten eine andere Verlaufsform der Leukozytenkurveh.<br />
Bei ihnen fielen die Lcukozytenzahlen nach der Durchflutung steil ab, mindestens'<br />
um 3000, womit sie also gegen die normalen abgegrenzt sind, oftaberum 6ooound<br />
mehr. Der Hauptabfall trat innerhalb der ersten 15 bis 30 Minuten ein. Später<br />
stiegen die Werte wieder an. Von diesen Kranken kam einer nach 3 Wochen ad<br />
exitum; bei einer anderen Patientin war der Lungenprozeß soweit fortgeschritten,<br />
daß Heilstättcnbchandlung nicht mehr in Frage kam (Abb. 192 und 193).<br />
In allen Fällen wurde vor der Provokation und 30 Minuten danach ein Differcntialblutbild<br />
angefertigt. Bei Gesunden und Tuberkulosekranken zeigten die Lymphozyten<br />
fallende, die Granulozyten steigende Tendenz, während bei unspezi-<br />
259
+1000 •<br />
Vor KW KW 5' 15' 30' 60*<br />
Abb. i88: Gcsamtlcukozytcnzahl. Gesunde<br />
+10000<br />
+9000<br />
+8000<br />
+7000<br />
+6000<br />
+ 5000<br />
+4000<br />
+ 3000<br />
+2000<br />
• 1000<br />
Vor KW KW 5' 15<br />
«Typ I.»<br />
Abb. 190: Klinisch gutartige Tuberkulosen<br />
und spezifische Pleuritiden<br />
+ IODO<br />
-1000<br />
-2000<br />
-5000<br />
-4000<br />
-sooo<br />
-6000<br />
-7000<br />
-8000<br />
•<br />
A<br />
'•\<br />
s XV<br />
*••*"<br />
w ,A ,<br />
\\y/<br />
\ /<br />
\ ,.
fischen Entzündungen vor allem die Lymphozyten vermehrt gefunden wurden.<br />
Der Unterschied zeigte sich besonders bei den Tuberkulosekurven vom Typ II,<br />
wo bei Vermehrung der Gesamtleukozytenzahl vorwiegend die segmentkernigen<br />
Leukozyten vermehrt waren.<br />
Bei der einmaligen, schwach dosierten Durchflutung traten weder subjektive<br />
Beschwerden noch objektive Verschlechterungen auf.<br />
STROHMAIER sah ebenfalls bei Lungentuberkulosen meistens einen Abfall der<br />
Gesamtleukozytenzahl, und zwar um so starker, je höher die Ausgangswerte<br />
waren. Dasselbe wurde bei tuberkulösen Pleuraexsudaten festgestellt. Die Ergebnisse<br />
der Provokation bei Lungentuberkulosen werden als «wertvoll, wenn auch<br />
nicht unbedingt sichen> bezeichnet. Bei Gelenktuberkulosen fanden mehrere<br />
Autoren einen Abfall der Leukozyten nach KW-Durchflutung, bei unspezifischen<br />
Gelenkschwellungen einen Anstieg.<br />
Bei der KW-Provokatîon von Bauchtuberkulosen in 60 Fällen sah THOM ähnliche<br />
Kurven wie wir. Er hat dabei den Eindruck gewonnen, daß die Verlaufsformen<br />
der Leukozytenreaktionen nicht so sehr von der Spezifität der Erkrankung<br />
abhängen als von der Aktivität. Chronische, nicht spezifische Prozesse neigten<br />
eher dazu, indifferent oder schwächer zu reagieren als tuberkulöse Baucherkrankungen.<br />
THOM glaubt mit BERNHARD, daß ein Aufflackern bei Prozessen im<br />
Bauch für Tuberkulose spricht. Es scheint, daß Prozesse im Bauch allgemein etwas<br />
anders reagieren als solche im Thorax. Ähnliches haben wir auch bei Krankheitsherden<br />
im Kopf beobachtet.<br />
Diese Ergebnisse hat MEUWSEN an großem Material bestätigt. Nach JAKOBI läßt<br />
sich mittels KW-Durchflutungcn der Tonsillen ein diagnostischer Anhalt dafür<br />
gewinnen, ob chronische Tonsillitis vorliegt oder nicht.<br />
Neue diagnostische Möglichkeiten eröffnet die Leukozytenprovokation bei den<br />
Leberkrankheiten, und zwar sind die Kurven besonders charakteristisch bei Tumoren<br />
und Zirrhose. Bei vielen bisher von uns untersuchten und durch Autopsie<br />
bestätigten Fällen von Leberzirrhose hatten die Kurven eine mehrphasige Form. In<br />
den bestätigten Fällen von Karzinom in der Leber war meist ein mehr oder weniger<br />
starker Abfall vorhanden. Da es bis jetzt keine befriedigende Möglichkeit gab,<br />
Zirrhosen von Karzinomen mit Verschlußikterus zu unterscheiden, liegt die Bedeutung<br />
dieses Untersuchungsverfahrens auf der Hand. Bei Hepatitis steigt die<br />
Leukozytenzahl meist an. Die Form der Kurven ändert sich je nach dem Stadium<br />
der Erkrankung, Bei Cholangitis und Cholezystitis tritt gewöhnlich ein Anstieg<br />
auf, der je nach der Aktivität der Entzündung mehr oder weniger stark ist. Somit<br />
ist es durch diese Kurven möglich, beim Verschlußikterus zwischen Verschluß<br />
durch Tumoren und durch Gallensteine zu unterscheiden, da im letzteren Falle<br />
die Gallenblase stets entzündet ist und daher bei Provokationen ein Anstieg der<br />
Leukozyten entsteht. Ausnahmen sind selten.<br />
In einem Fall von Leberlues sahen wir einen sehr starken Anstieg nach 60 Minuten.<br />
Schwellungen der Lymphdrüsen können mit einem hohen Grad von Sicherheit<br />
diagnostiziert werden. Bei Tuberkulose hatten wir bisher überwiegend Abfall, bei<br />
Mischinfektion ganz geringe Anstiege. Bei Lymphogranulom ist der Anstieg sehr<br />
stark, manchmal auf das 6-8fache; bei lymphatischer Leukämie entsteht ein Anstieg<br />
nach Durchflutung der Milz, während bei myeloischer Leukämie ein Abfall eintritt.<br />
In der Kurzwellenprovokation besitzen wir daher ein Mittel nicht nur zur<br />
261
Unterscheidung zwischen verschiedenartigen Prozessen, sondern auch zur Feststellung<br />
der Aktivität einer Entzündung.<br />
Es gab bisher kein Verfahren, um ent^ändlicbe Prozesse am Herren zu diagnostizieren,<br />
außer in besonderen Fällen, in denen sich - etwa im Anschluß an eine Infektionskrankheit<br />
oder Sepsis - das Fortschreiten bestimmter Veränderungen verfolgen<br />
läßt. So die Endo- und Myokarditis nach Scharlach oder nach Gelenkrheumatismus,<br />
die septische Endokarditis oder die Endokarditis lenta, bei der der<br />
bakteriologische Befund zusammen mit den Veränderungen am Herzen Schlüsse<br />
zu ziehen erlaubt. Die Erscheinungen eines Herzklappenfehlers für sich allein bedeuten<br />
wenig für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit des Kreislaufes und die<br />
Prognose. Diese beiden Größen hängen in weitestem Maße davon ab, ob entzündliche<br />
Prozesse am Herzen noch bestehen oder ob sie zur Ruhe gekommen sind.<br />
Aus der Sportmedizin ist genügend bekannt, daß Herzen mit Klappenfehlern in<br />
jeder Beziehung leistungsfähig sein können. Dagegen ist klar, daß die Leistungsfähigkeit<br />
stark beschränkt sein muß, wenn an den Herzklappen, und mehr noch,<br />
wenn im Myokard Entzündungsherde bestehen. Bei Sektionen werden vielfach<br />
solche Entzündungen gefunden, die intra vitam niemals in Erscheinung getreten<br />
waren. Temperatur und Blutkörperchensenkung können völlig normal sein, und<br />
das Blutbild läßt uns in diesen Fällen vollkommen im Stich. Das Elektrokardiogramm<br />
zeigt nur selten bei solchen Erkrankungen irgendwelche Veränderungen.<br />
Nur manchmal bestehen gewisse Allgcmeinerscheinungen, wie Dyspnoe bei Anstrengung,<br />
gelegentliche Albuminurie, geringe Temperatursteigerungen, die bei<br />
Frauen besonders in der Zeit der Menses auftreten. Selbst diese Erscheinungen<br />
können ganz fehlen.<br />
Bei nicht infizierten Karzinomen entstand meist ein Abfall der Leukozyten, bei<br />
stärkerem jauchigem oder eitrigem Zerfall ein Anstieg. Dagegen reagierten Tumoren<br />
auf Röntgenbestrahlung mit 30% HED mit deutlichem Anstieg der Leukozyten.<br />
HARTL hat unter meiner Leitung maligne Tumoren vergleichsweise mit UKW<br />
und Röntgen bestrahlt. Er fand folgende Verhältnisse: Bei allen mit UKW durchfluteten<br />
Tumoren sanken die Werte des Blutcholesterins, und zwar um durchschnittlich<br />
27mg%. Nach Röntgenbestrahlung dagegen stiegen sie bei 13 von<br />
15 Fällen um durchschnittlich 26 mg%. Eine Ausnahme machten nur 2 Fälle mit<br />
ausgedehnten Knochenmetastasen, bei denen der Wert abfiel.<br />
Nach Durchflutung der Hypophyse steigen bei normalen Menschen die Cholesterinwerte<br />
im Serum. Bei Ulcuskrankcn fanden wir fast immer einen übermäßigen<br />
Anstieg, bei Karzinomatösen in der Mehrzahl einen Abfall, doch gibt es hier auch<br />
Ausnahmen. Weitcrc Untersuchungen sind im Gange. Anstieg und Abfall sind<br />
hauptsächlich mit der freien Cholcstcrinfraktion verbunden. Wichtig ist die Trennung<br />
der einzelnen Steroidfraktioncn, die z. Z. noch von uns bearbeitet wird. Der<br />
Abfall des Gcsamt-Cholestcrins betrifft freies und vcrcstcrtcs Cholesterin ungefähr<br />
im gleichen Verhältnis.<br />
Inzwischen wurden bei über 500 Kranken mit malignen Tumoren Durchflutungcn<br />
der Hirnbasis von 30 Minuten Dauer durchgeführt. Bei über 75 % dieser<br />
Kranken fand sich ein Abfall des Cholesterins im Serum anstatt des bei gesunden<br />
Menschen beobachteten Anstieges. Ich verwende deshalb dieses Verfahren als<br />
Hilfsmittel zur Tumordiagnostik. Es soll nicht verschwiegen werden, daß<br />
einer allgemeinen Verwendung zur Frühdiagnostik noch gewisse Schwierigkeiten<br />
entgegenstehen. Die Cholcsterinbcstimmung nach SCHMIDT THOMF. ist schwierig<br />
262
und arbeitet selbst bei exakter Ausführung mit j % Fehlerbreite. Sie kann deshalb<br />
nur von Chemikern oder besonders eingearbeiteten Personen ausgeführt werden.<br />
Bei Kranken, die mit Röntgenstrahlen oder Radium vorbestrahlt waren, fanden<br />
wir den Abfall gewöhnlich nicht. Ebenso fehlt er manchmal bei Kranken im Endstadium.<br />
-0,9<br />
-0,8<br />
10 20 30 40 50 60 70 Ö0 90<br />
— vor<br />
nach Durchflutung der Leber von 5 min Dauer<br />
Normale Elcktrophoresckurve (Durchschnitt)<br />
Abb. 194: Papier-Blektrophoresc bei einem Kranken mit Leberkarzinom<br />
Andererseits wurde der Abfall des Cholesterins auch bei (meist älteren) Personen<br />
gefunden, bei denen kein Krebsiciden nachzuweisen war. Hier müßte noch die<br />
Frage geklärt werden, ob vielleicht eine Disposition zum Karzinom vorliegt. Um<br />
diese Frage zu entscheiden, bedarf es aber noch jahrelanger Beobachtung und Verfolgung<br />
des weiteren Lebenslaufes.<br />
Ich möchte deshalb zusammenfassen, daß wir in der Bestimmung des Serumcholesterins<br />
nach Hypophyscndurch/lutung ein wertvolles Hilfsmittel zur Krebs-<br />
263
diagnostik besitzen, das aber noch weiterer wissenschaftlicher Entwicklung bedarf.<br />
Es ist wahrscheinlich, daß es noch zu größerer Genauigkeit ausgearbeitet<br />
werden kann.<br />
Hier seien nur kurz einige Fälle erwähnt, in denen die Diagnose durch dieses<br />
Verfahren ermöglicht wurde.<br />
i. Röntgenologisch Ulcus duodeni festgestellt, kein Anhalt für Tumor. Cholesterinprobe<br />
im Blut positiv. Deshalb Überweisung zum Chirurgen. Operation ergab<br />
Karzinom mit einer ulzerierten Stelle im Duodenum.<br />
z. Verschattung in der Lunge, als Tumor angesehen. Malignitätsprobe negativ.<br />
Lobektomie ergab gutartigen Tumor.<br />
3. Struma ohne Zeichen von Komplikation, Cholesterinprobe positiv. Operation<br />
und histologische Untersuchung ergab maligne Degeneration im Schilddrüsengewebe.<br />
HEYMANN untersuchte auf meine Veranlassung den Einfluß von Kurzwellendutchflutungen<br />
der Hypophyse auf die Serum-Eiweißkörper mit der Papier-Elektrophorese.<br />
Er fand, daß die Zusammensetzung des Eiweißes außerordentlich<br />
zäh festgehalten wird und sich bei Gesunden nicht verändert. Nur bei Kranken<br />
mit erheblicher vegetativer Dystonie und mit entzündlichen Erkrankungen wurden<br />
geringe Veränderungen gefunden.<br />
GÜNTHER stellte die gleichen Untersuchungen bei Leberkranken an. Nach<br />
Durchflutung der Leber traten Verschiebungen der Serum-Eiweißkörper ein, und<br />
zwar traten die krankhaften Veränderungen der Eiweißkurve in verstärktem Maße<br />
auf. Bei Krebskranken wird nach Durchflutung der Hypophyse die überhöhte<br />
Zacke der Alpha-2-GIobuline in den meisten Fällen geringer. Die Veränderungen<br />
sind aber zu schwach, um darauf eine Diagnostik aufzubauen.<br />
Bei direkter Durchflutung von Karzinomen tritt die Vermehrung der Alpha-<br />
2-GlobuIine stärker zutage als vorher (Abb.194).<br />
VII. Schlußbetrachtung<br />
Um den gesamten jWirkungsmechanismus dieser Therapie zu verstehen, erscheint<br />
es angebracht, uns nochmals zusammenfassend Rechenschaft über Wesen<br />
und Wirkung der KW-Bchandlung zu geben.<br />
Die Tatsache der Wärmeerzeugung im Körper rückt diesen Punkt in den Vordergrund<br />
der Betrachtung. Wir haben gesehen, daß es JouLEsche Wärme ist, die im<br />
KW-Fcld entsteht. Sie wird aber nicht - wie etwa bei der Diathermie - so erzeugt,<br />
daß Ströme den Geweben unmittelbar zugeleitet werden und von einem zum andern<br />
Pol hindurchfließen. Vielmehr benutzen wir eine Feldwirkung ohne Kontakt;<br />
der menschliche Körper stellt das Dielektrikum dieses Feldes dar; durch die<br />
Feldkräfte werden in seinen kleinsten Bausteinen, Zellen, Kolloidteilchen und<br />
Molekülen, Wirkungen hervorgebracht, die ihrerseits die Erwärmung herbeiführen.<br />
Maßgebend für diese Erwärmung ist deshalb nicht allein der OHMSchc<br />
Widerstand, sondern die Impedanz, die Summe der OHMschen und kapazitiven<br />
Widerstände. Da diese ihrerseits wieder von der Wellenlänge abhängt, ¡st auch die<br />
Wärmewirkung im Gewebe eine Funktion der Wellenlänge.<br />
Nach den Versuchen verschiedener Autoren an Kolloiden sind noch andere<br />
Wirkungen besonderer Art mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen.<br />
264
Ob man diese Wirkungen als spezifisch bezeichnet oder als eine besondere Art<br />
von Punktwärme, ist eine müßige Streitfrage. Auf jeden Fall sind es Wirkungen,<br />
die in dieser Weise nicht durch andere Agentien im lebenden Zcllverband ausgeübt<br />
werden können. Es kommt weniger darauf an, was für Energieformen sich<br />
im Gewebe umsetzen, als darauf, wo sie sich umsetzen. Mit anderen Worten<br />
kommt es darauf an, daß sich die Energiewirkung auf bestimmte Strukturen konzentriert.<br />
Durch Versuche verschiedener Art hat sich ergeben, daß die Energiewirkung unmittelbar<br />
an den kleinsten Strukturelementen angreift (Pcrlschnurphänomen), daß<br />
Moleküle von verschiedener Polarität verschieden stark beeinflußt werden und<br />
daß schließlich in der einzelnen Zelle und dem einzelnen Blutkörperchen unmittelbar<br />
Wärme erzeugt wird.<br />
Von mehreren Physikern wurde entsprechend nachgewiesen, daß in den einzelnen<br />
Zellen besonders starke Verluste an elektrischer Energie entstehen (Mikroerwärmung)<br />
und daß die Widerstände der Zellmembranen vom UKW-Feld überbrückt<br />
werden (anomale Dispersion).<br />
Ferner haben HAUSSER, KUHN und GIRAL gezeigt, daß auch innerhalb eines<br />
großen Molekülkomplexes unter Umständen gewisse Seitenketten selbständig<br />
beeinflußt werden können und daß so Zerrungen und Veränderungen im Molekülverband<br />
entstehen.<br />
Da diese hochmolekularen Stoffe oft Membranbildner sind, ergab sich weiterhin<br />
die Frage, ob die Permeabilität der Zellen durch das UKW-Feld irgendwie beeinflußt<br />
würde. Dies ist mehr als wahrscheinlich gemacht durch den Nachweis<br />
physikochemischer Veränderungen in zellhaltigen Substanzen, insbesondere durch<br />
die Zunahme der Wasserstoffionen-Konzentration in der Suspensionsflüssigkeit,<br />
die nur durch eine verstärkte Auswanderung von Ionen aus den Zellen, also durch<br />
vermehrte Durchlässigkeit der Membranen für die Ionen zu erklären ist.<br />
Über die Beeinflussung von Bakterien sind die Forschungen noch nicht abgeschlossen.<br />
Von vielen Autoren ist Abtötung und Schwächung von Krankheitserregern<br />
im UKW-Feld beobachtet worden, während andere Forscher nichts nachweisen<br />
konnten. Nach dem heutigen Stand der Forschung kann man annehmen,<br />
daß solche Wirkungen tatsächlich vorhanden sind, und zwar kommen sie wahrscheinlich<br />
durch inhomogene Verteilung der Wärme in den Bakterienherden und<br />
Kulturen zustande. Für die Wirkung maßgebend ist offenbar nichtnurder Zustand<br />
der Bakterien selbst, sondern besonders auch die Art der der Nährböden bzw. der<br />
umgebenden Gewebe. Daß im menschlichen Körper Bakterien direkt abgetötet<br />
werden, ist unwahrscheinlich, schon in Anbetracht der verhältnismäßig kurzen<br />
Dauer der Durchflutungen.<br />
Was wir aber als Ärzte erreichen wollen, ¡st ja nicht eine Therapie stcrilisans<br />
magna, eine völlige Vernichtung der Krankheitserreger, sondern unsere Aufgabe<br />
ist es, die Natur ¡n ihrem Abwehrkampf gegen die eingedrungenen Schädigungen<br />
zu unterstützen.<br />
Wir behandeln mit den KW in der Hauptsache örtlich beschränkte Erkrankungen.<br />
Die Lokalisierung eines Vorganges bedeutet aber, daß sich eingedrungene<br />
Schädlichkeit und Abwehrkräfte des Körpers ungefähr die Waage halten. Dem<br />
Körper ist es gelungen, eine allgemeine Ausbreitung der Krankheit zu verhindern ;<br />
andererseits sind die Krankheitserreger zwar auf ihren Platz beschränkt, bleiben<br />
aber dort am Leben und können sich ständig vermehren.<br />
Nur von der augenblicklichen Reaktionslage des befallenen Menschen oder von<br />
2ÓJ
irgendwelchen Zufälligkeiten hängt es ab, ob eine weitete Aussaat erfolgt. Wo es<br />
uns nur gelingt, die Krankheitserreger etwas zu schwächen, ihre Virulenz herabzusetzen,<br />
oder den Organismus zu kräftigen, verschieben wir das Gleichgewicht<br />
zugunsten des Körpers und stärken damit den Heilungsvorgang.<br />
Nach den von HAASE und mir begonnenen, von LIEBESNY U. a. ausgebauten<br />
Untersuchungen an Bakterien ist es aber nicht ausgeschlossen, daß eine gewisse<br />
Schwächung der Krankheitserreger auch innerhalb des Körpers zustande kommt.<br />
Teilweise scheint diese Schädigung schon bei Körpertemperatur möglich zu<br />
sein, aber sie wird mit zunehmenden Temperaturen stärker. Hierfür sind aber die<br />
Verhältnisse in lokalisieren Herden besonders günstig, denn dort fehlt die Entwärmung,<br />
deren Träger im gesunden Gewebe der Blutstrom ist. Andererseits<br />
konnte gezeigt werden, daß nicht, wie es beispielsweise bei der L W-Diathermie der<br />
Fall ist, die meisten Stromschleifen gerade die gutlcitenden Blutbahnen bevorzugen<br />
und daher die abgekapselten Herde umgehen ; vielmehr werden im Kondensatorfeld<br />
alle überhaupt im Feldbereich gelegenen Gebilde gleichmäßig erfaßt.<br />
Im Abszeß kommt daher, wie auch im Tierversuch nachgewiesen worden ist,<br />
besonders starke Erwärmung zustande. Die Wirkung des KW-Feldes auf die Bakterien<br />
findet so viel günstigere Bedingungen, als wenn die Krankheitserreger in<br />
den Geweben verteilt sind ; die unmittelbare Wirkung auf die Bakterien wird multipliziert<br />
durch die gleichzeitige allgemeine Erwärmung des umgebenden Nährbodens.<br />
Diese Überlegungen sind vor allen Dingen dann am Platze, wenn es sich um die<br />
Behandlung von Abszessen und von Tuberkulose handelt. Der abgekapselte Abszeß,<br />
der Tuberkel und die Kaverne verhalten steh insofern einander ähnlich, als<br />
sie in sich geschlossen und gefäßlos sind und daher alle Bedingungen für einen<br />
besonders günstigen Angriff der KW bieten.<br />
Inwieweit hierbei die einzelnen Weilenlängen verschiedene Wirkungen ausüben, kann<br />
vorerst noch nicht sicher gesagt werden. Zunächst sind von uns nur die experimentellen<br />
Grundlagen für die Möglichkeit frequenzabhängiger Wirkungen geschaffen worden.<br />
Sowohl bei der Erwärmung von Geweben wie bei der Schädigung von Bakterienstämmen<br />
durch verschiedene Wellenlängen muß mit einer großen Variationsbreite gerechnet<br />
werden. Leider sind schon Bakterienstämmc der gleichen Art oft in ihrem Verhalten<br />
gegenüber dem KW-Feld sehr verschieden, so daß sich keine bestimmten Regeln<br />
etwa für eine Bakterienart aufstellen lassen. Auch ist bekannt, daß der spezifische Widerstand,<br />
der für die Wcllcnlängcnabhängigkcit in erster Linie maßgebend ist, mit der Temperatur<br />
sehr stark schwankt, so daß auch hierdurch eine weitere Variable gegeben ist.<br />
Vorerst können also die letztgenannten Erfahrungen nicht ohne weiteres auf die<br />
Praxis übertragen werden. Durchaus im Bereich der Wahrscheinlichkeit liegt aber, daß<br />
es uns mit der Zeit gelingen wird, auch diese Ergebnisse für die Therapie nutzbar zu<br />
machen.<br />
Ganz sicher ist es, daß grundlegende therapeutische Unterschiede ^wischen den UKW<br />
und den in der £ Arsonvalisation und Diathermie benutzten Wellenlängen bestehen. Dieser<br />
Unterschied manifestiert sich am deutlichsten in der verschiedenen Wirkung auf<br />
akute Entzündungen. Wie von allen in der Diathermie erfahrenen Autoren übereinstimmend<br />
angegeben wird, ist Diathermie bei frischen eitrigen Entzündungen<br />
kontraindiziert, da sie Aufflackern der Prozesse und sogar Generalisation herbeiführen<br />
kann. Von der KW-Thcrapie (bei richtiger Anwendung) wissen wir dagegen<br />
heute, daß gerade akute Eiterungen eines ihrer Hauptanwcndungsgebietc<br />
sind; es gilt sogar - wenn auch mit bestimmten Ausnahmen - der Satz: Je akuter<br />
266
der Prozeß, um so besser die Aussiebten. Diese Besonderheit kann nur durch die<br />
Frequenz bedingt sein. Für den Arzt ist sie jedenfalls derart grundlegend,<br />
daß sie die Abtrennung der KW-Therapie von den anderen elektrotherapeutischen<br />
Verfahren ohne weiteres begründet. Selbstverständlich gibt es hier keinen abrupten<br />
Unterschied, sondern nur fließende Übergänge; so kommt es, daß manche Wirkungen<br />
sowohl durch die langen Wellen der Diathermie wie durch die KW-Therapie<br />
hervorgebracht werden können.<br />
Zu der Einwirkung auf die Krankheitserreger selbst kommen noch verschiedene<br />
andere Momente. Auch auf nicht abgekapselte Entzündungen sind die Einflüsse des<br />
KW-Feldcs ausgesprochen günstig. Die Erweiterung der Kapillaren und Arteriolcn,<br />
die im Bereich des KW-Feldes oft fast augenblicklich eintritt, schafft durch<br />
starke aktive Hyperämie besonders günstige Durchblutungsverhältnisse. Diese<br />
Hyperämie entsteht fast momentan. Sie beruht nicht nur auf der Erwärmung,<br />
sondern auf einer Steigerung des parasympathischen und Abschwächung des sympathischen<br />
Tonus der Gefäßwände, die ihrerseits zum Teil mit der Mobilisierung<br />
des Histamins zusammenhängen. Sie ist nicht flüchtig wie die durch irgendwelche<br />
physikalischen Maßnahmen hervorgerufene Erwärmungshyperämie, sondern<br />
schon nach einmaliger KW-Bchandlung kann sie bis zur Dauer von mehreren<br />
Tagen bestehen bleiben. Auffallend ist weiterhin die Schmerzstillung, die bei Entzündungen<br />
meist schon während der ersten Behandlung eintritt.<br />
Dazu kommen noch der unmittelbare Einfluß des KW-Feldes auf die Kapillardurchlässigkeit,<br />
der wieder seine Ursachen in der durch die Eigenart der KW-Wirkung<br />
bedingten Wärmeverteilung hat. Der Säftestrom, der dem Wärmestrom<br />
gleichgerichtet zu sein pflegt, wird vermehrt und führt zu einem erhöhten Austausch<br />
zwischen Blut und Geweben und zu einer gesteigerten Resorption von<br />
Exsudaten und Ödemflüssigkeit. Ferner scheinen dadurch, daß im Entzündungsherd<br />
die sauren Stoffwechsclprodukte überwiegen, hier besondere Wirkungen<br />
stattzufinden. Die KW-Wirkung unterstützt hier die natürlichen Vorgänge, indem<br />
die Säuerung vermehrt wird. Diese Beeinflussung der physikochemischen Faktoren<br />
im entzündeten Gewebe stellt sich der unmittelbaren Einwirkung auf die<br />
Krankheitserreger an die Seite.<br />
Von dieser Richtung aus dürfte wohl auch die ausgesprochen günstige Wirkung<br />
der KW auf Katarrhe zu verstehen sein. Hier kommt wohl - zumal bei der gewöhnlich<br />
von uns geübten Bchandlungsdauer von io Minuten - eine unmittelbare<br />
Schädigung von Krankheitserregern kaum in Frage, zumal wir es ja gerade im Beginn<br />
des Schnupfens meist noch gar nicht mit bakteriellen Entzündungen zu tun<br />
haben; vielmehr muß die XJmstimmung im Gewebe, sei es die Hyperämie, sei es die<br />
Beeinflussung der lonenverteilung - oder beides - verantwortlich gemacht werden.<br />
Auch die Abheilung von Ük^emcn kann anders überhaupt nicht verstanden<br />
werden. Gerade bei den von uns behandelten Ekzemen, die teils gewerblicher, teils<br />
endokriner Genese waren, spielen primär bakterielle Vorgänge keine Rolle. Hier<br />
muß die Umstimmung in der Haut selbst und vielleicht auch eine Rückwirkung<br />
von da auf den gesamten Körper als Ursache der Heilung angesehen werden.<br />
Daß solche Wirkungen auf den Gesamtkörper vorhanden sind, haben wir schon<br />
gesehen, wenn sie auch im einzelnen noch nicht ganz sicher zu fassen sind. Feststehend<br />
ist die Anregung der Phagozytose, die sich offenbar nicht nur auf das unmittelbar<br />
dem Kondensatorfcld ausgesetzte Gebiet, sondern auf den gesamten<br />
Körper erstreckt, und auf Veränderungen im Serum zurückzuführen ist.<br />
Die eben aufgezählten Faktoren wirken in dem Sinne zusammen, daß bei<br />
267
frischeren Entzündungen die Resorption, bei älteren die Demarkation und Abstoßung<br />
beschleunigt "wird, wie wir dies besonders bei der Osteomyelitis sehen.<br />
Andererseits sind die auch bei lokaler Behandlung einzelner Körperteile nachgewiesenen<br />
Verschiebungen im weißen Blutbild zu erwähnen, die je nach der Art<br />
der behandelten Körperstelle und nach Dauer der Behandlung verschieden sind,<br />
sowie die verstärkte Diapedese.<br />
So kommt es, daß die richtige Dosierung bis jetzt nur eine Frage der Erfahrung<br />
und des ärztlichen Gefühls bleibt und nicht, wie bei den Röntgenstrahlen, genau<br />
bestimmt und schematisch angewandt werden kann.<br />
Während bei akuten Prozessen starke Durchflutungen schaden können und nur<br />
schwache Dosen angewandt werden dürfen, sind bei chronischen Erkrankungen<br />
und Veränderungen starke Dosen am Platz, wenn man etwas erreichen will. Die<br />
Untersuchungen am Blutbild zeigen deutlich, daß schon schwächste Dosen von<br />
5 Minuten Dauer keineswegs als «symbolische Handlung» angesehen werden dürfen.<br />
Auch das Experiment hat ja ergeben, daß die bei geringen Dosen hervorgerufene<br />
Perlschnurbildung der kleinen Teilchen unter Umständen durch stärkere<br />
Dosen wieder aufgehoben wird, infolge der dann entstehenden Wärmeströmung.<br />
Bei der Behandlung von Furunkulosen sahen wir femer öfters, daß nach Durchflutung<br />
einzelner Furunkel auch solche an anderen Körperstellen zurückgingen<br />
Das kann vielleicht auf die gesteigerte Phagozytose zurückzuführen sein. Ebenso<br />
darf aber auch die Möglichkeit nicht von der Hand gewiesen werden, daß durch<br />
die vermehrte Entstehung von Abbauprodukten der Krankheitserreger im behandelten<br />
Gebiet die Bildung von Antikörpern und sonstigen Abwehrstoffen verstärkt<br />
wird. Auch hierüber werden erst genauere Untersuchungen weiteren Aufschluß<br />
geben können.<br />
Eine eigenartige Beobachtung, die wir sowohl bei der Behandlung chronischer<br />
Eiterungen als auch bei Gelenkaffektionen gemacht haben, ist die der oft erst viele<br />
Wochen später einsetzenden Nachwirkung. Es kommt vor, daß wir während der<br />
eigentlichen Behandlungszeit keine Besserungen, ja sogar verstärkte Beschwerden<br />
sehen, und daß erst viele Wochen später ein Rückgang der Beschwerden beobachtet<br />
wird. Für diese Erscheinung haben wir vorerst keine befriedigende Erklärung.<br />
Ein weites und wichtiges Gebiet hat sich die Kurzwcllenthcrapie erobert in der<br />
Beeinflussung der endokrin bedingten Stimmung im Organismus. Die ungeheure<br />
Bedeutung der Einstellung des inkretorischen Systems für Konstitution und<br />
Disposition, Gesundheit und Krankheit ist erst in den letzten Jahren klargeworden.<br />
Der Verlauf von erworbenen Krankheiten hängt in weitem Maße von dieser Einstellung<br />
ab.<br />
Mittels UKW-Durchflutungcn ist es möglich, beim Menschen die Tätigkeit inkretorischer<br />
Drüsen anzuregen und auf Grund von danach entstandenen Veränderungen<br />
im Blut eine Diagnose über Funktionsänderungen zu stellen. Durch<br />
richtig eingesetzte und dosierte Durchflutungen kann die Tätigkeit bestimmter<br />
Drüsen angeregt oder gehemmt und dadurch die gesamte körperliche Disposition<br />
beeinflußt werden. Auf diesem Gebiet sind noch große Fortschritte zu erwarten.<br />
Auf dem Umweg über die Endokrinium scheint es aber möglich zu sein, das<br />
Wachstum von Tumoren mittelbar zu beeinflussen. Auf diesem Gebiet müssen<br />
noch weitere Erfahrungen gesammelt werden.<br />
Die direkte Kurzwellendurchflutung ist gegenüber malignen Tumoren bisher<br />
machtlos geblieben. Damit ist aber nicht gesagt, daß uns nicht auch auf diesem<br />
Gebiet in Zukunft noch Erfolge beschieden sein könnten. Leider sind die bis-<br />
268
herigen Ergebnisse von Tierversuchen, die recht günstig gewesen sind, nicht ohne<br />
weiteres auf menschliche Verhältnisse übertragbar, da die bis jetztbehandeltenlmpfsarkome<br />
in keiner Weise mit echten autochthonen Tumoren verglichen werden<br />
können. Wenn uns nicht ein günstiger Zufall zu Hilfe kommt, wird es schwerer<br />
und mühsamer Forschungen bedürfen, um die Möglichkeit oder Unmöglichkeit<br />
einer Krebstherapie auf diesem Weg sicherzustellen. Wir erinnern nur an die jetzt<br />
schon seit Jahrzentcn tobenden Kämpfe um die Röntgentherapie, der gegenüber<br />
sich die Krebse eines Organs oder einer Zellgruppe oft ganz anders verhalten als<br />
die eines anderen, und Metastase und Stammgeschwulst ganz verschiedene Verhältnisse<br />
darbieten können. Dagegen eröffnen sich neue Aussichten in der Möglichkeit<br />
der Beeinflussung der Hypophyse durch Ultrakurzwellen in Hinsicht auf die<br />
Forschungen, die einen Einfluß der Hypophysenfunktion auf das maligne Wachstum<br />
ergeben haben.<br />
Die unbekannten Faktoren, mit denen wir bei der KW-Therapie rechnen<br />
müssen, sind noch zahlreicher als bei der Röntgentherapie. Nach unseren bisherigen<br />
Erfahrungen sind es 3 Veränderliche, von denen die Art der Wirkung abhängen<br />
kann : Die Zeit, die Dosisleistung und die Wellenlänge.<br />
Wir haben gesehen, daß zur Heilung von akuten Eiterungen wenige Minuten<br />
genügen, daß aber für subakute und chronische Erkrankungen die Behandlungszeiten<br />
länger genommen werden müssen. Die Behandlungen wurden im allgemeinen<br />
so verteilt, daß sie zuerst täglich, dann jeden 2. oder 3. Tag durchgeführt<br />
wurden. Dabei ist aber keineswegs ausgeschlossen, daß in manchen Fällen günstigere<br />
Heilerfolge durch einmalige oder selten wiederholte Dauerbehandlungen<br />
von mehreren Stunden erzielt werden können. Daß wir bis jetzt noch keine Versuche<br />
in dieser Richtung unternommen haben, hat rein technische Gründe.<br />
Über die dritte Unbekannte, die Wellenlänge, ist schon genügend berichtet worden.<br />
Es scheint, als ob in dem Spektrum von 0,5 bis 15 m die günstigsten Wirkungen<br />
hervorgebracht würden, doch mögen auch noch bei den darunter liegenden<br />
Wellenlängen bis hinunter zu einigen Millimetern Geheimnisse verborgen<br />
sein; wir können sie bis jetzt nicht aufklären, da uns diese Wellen gesperrt sind,<br />
da alle, außer ganz wenigen Wellenlängen für die medizinische Forschung praktisch<br />
verboten sind. Auf jeden Fall ändert sich die Tiefenwirkung auf einzelne<br />
Organe mit der Frequenz in verschiedener Weise.<br />
Ein besonderer Vorteil liegt in der Möglichkeit, die Kurzwcllentherapic mit<br />
anderen Heilmitteln zu kombinieren. Dies ist geradezu ideal, da es kein Mittel<br />
gibt, mit dem die KWTh nicht gleichzeitig angewandt werden könnte. Die Wirkung<br />
vieler Mittel kann dadurch verstärkt werden, daß im Kur2wellenfeld ihre<br />
Resorption gefördert wird. Nach den Untersuchungen von STROHL mit radioaktiven<br />
Mitteln wird die Fixation in den durchfluteten Gebieten begünstigt.<br />
Die Dosierung ist das weitaus wichtigste Problem, da wir ja noch kein Mittel<br />
zu ihrer exakten Bestimmung in der Hand haben. Die Angaben der Hitzdrahtinstrumente<br />
sind nur relativ zu verwerten, und auch das nur, wenn immer die<br />
Angaben eines und desselben Instrumentes miteinander verglichen werden; genauer<br />
sind die Angaben der Thermokreuze.<br />
Es kann nicht genug betont werden, daß die Angaben der Instrumente auf den<br />
Schaltbrettern der Kurzwellengerätc keinerlei Schlüsse auf die im Patienten wirksame<br />
Feldstärke zulassen.<br />
Selbst wenn wir die Feldstärke genau einstellen können, ist die tatsächlich zur<br />
Wirkung kommende Dosisleistung noch durch große individuelle Verschieden-<br />
269
heilen mit bestimmt. Wie-wir gesehen haben, sind schon die Matcrialkonstanten<br />
der Gewebe einzelner Menschen sehr voneinander verschieden. Sie verändern die<br />
Kapazität und die Dämpfung im Feld in einem bis jetzt noch nicht kontrollierbaren<br />
Maß; selbst wenn wir also die Stärke des Gcsamtfeldes kennen, wissen wir<br />
noch nichts über die Feldstärke im Innern der menschlichen Körperteile. Außerdem<br />
ist die Reaktionsweise der Individuen sehr verschieden. Von einem Menschen<br />
werden große, vom anderen kleine Dosen vertragen. Dabei haben wir gesehen,<br />
daß gegenüber vielen Krankheitsprozessen mit den kleineren Dosen mehr erreicht<br />
wird als mit größeren und umgekehrt. Eine gewisse Grenze nach oben darf nicht<br />
überschritten werden, um die Gewebe nicht zu schädigen. Glücklicherweise ist<br />
diese Grenze sehr weit gesteckt, so daß Schäden äußerst selten vorkommen. Aber<br />
Mißerfolge und Aktivierung von Krankheitsprozessen können durch falsche<br />
Dosierung vorkommen. Auf diesem Gebiet sind wir also noch stark auf das<br />
ärztliche Empfinden angewiesen, und wir werden auch noch lange Zeit hinaus<br />
keine anderen Möglichkeiten haben. Vielleicht ist aber gerade diese Tatsache in<br />
Anbetracht der heute auch in der Medizin herrschenden Neigung zur Technisierung<br />
und Typisierung als nicht unerfreulich bezeichnen; der Arzt ist gezwungen, sich<br />
vom Zustand seiner KW-beh andel ten Kranken selbst zu überzeugen.<br />
Der ärztliche Faktor ist überhaupt viel wichtiger, ais es bei oberflächlicher Betrachtung<br />
den Anschein hat. Die Einfachheit der Handgriffe verleitet leicht zum Glauben, als<br />
ob jedermann ohne große Vorkenntnisse und genaue Indikationsstcllung die<br />
KW-Therapie ausüben könnte. Daß dies ein Trugschluß ist, dürfte aus den obigen<br />
Ausführungen genügend hervorgehen. Es zeigt sich auch darin, daß es immer<br />
wieder nur einige besonders erfahrene Ärzte sind, die wirklich vollgültige, mit<br />
Bildern und Fieberkurven belegte Erfolge erzielen, während in anderen Händen<br />
selbst die besten Apparate versagen. Die Erfahrung und das «Fingerspitzengefühl»<br />
unterscheiden, wie überall, den Meister und den Pfuscher.<br />
Unter Berücksichtigung aller dieser Faktoren wird es wahrscheinlich in Zukunft<br />
gelingen, unsere jetzt schon so günstigen Heilerfolge noch auf andere Gebiete zu<br />
übertragen und weiter zu steigern. Es sind bescheidene Anfänge, die wir auf diesem<br />
Gebiet machen konnten, und erst eingehende Weiterarbeit nach allen Richtungen<br />
hin sowie auf den verschiedensten Fachgebieten der Medizin wird uns zeigen<br />
können, in welcher Weise wir am besten in den Abwehrkampf des menschlichen<br />
Körpers gegen die Krankheit eingreifen können, um die Heilung am schnellsten<br />
herbeizuführen, wie wir mit anderen Worten dem kranken Menschen am besten<br />
helfen können. Es ist gelegentlich bemängelt worden, daß das Indikationsgebice<br />
der KWT weit gespannt erscheint und daß Heilerfolge bei so vielen Krankheiten<br />
beschrieben sind. Das ist dadurch erklärlich, daß die Wirkung der KWT nicht<br />
nicht gegen bestimmte Erreger gerichtet ist. Sie regt vielmehr die Abwchrkräftc<br />
des Körpers in un spezifischer Weise an und unterstützt sie im Kampf gegen Entzündungserreger<br />
verschiedener Art. Diese Wirkungen sind aber größtenteils unspezifisch.<br />
Die KWT wird also nur solange wirksam sein, als der Organismus<br />
noch Abwchrkräftc aufbringen kann.<br />
Die von mir aufgestellten Behauptungen haben bisher allen Nachprüfungen<br />
standgehalten.<br />
Die Tabelle S. 271 gibt eine Übersicht über 1948-1952 bei 3548 Kranken erzielten<br />
Ergebnisse nach einer Zusammenstellung von BURKERT aus mehreren<br />
Abteilungen des Stadtkrankenhauses Schweinfurt.<br />
270
Krankheit<br />
Augenkrankheiten :<br />
Iritis fibrinosa<br />
Iritis fibrinosa chron.<br />
Iritis rhcum.<br />
Ulcus corneae<br />
Herpes corneae<br />
Chorioiditis<br />
Neuritis nerv. opt.<br />
Krankheiten des<br />
Zirkulationsapp.<br />
Extrasyst. Arrhythm.<br />
Myokarditis ak.<br />
Myokarditis chron.<br />
Myodcgcncratio cord.<br />
Angina pect.<br />
Endocarditis<br />
Hcrzklappenfehler<br />
Arteriosklerose<br />
Winiwarter Bürger<br />
Raynaud<br />
Claudicatio interm.<br />
Hypertonie<br />
Venenthrombose<br />
Varixknoten<br />
Erfrierungen<br />
Krankheiten des Gehöru.Respirationsapparates<br />
Otitis ext.<br />
Tubenkatarrh<br />
Otitis media chron.<br />
Otitis media ak.<br />
Otitis n. Parazentese<br />
Schwerhörigkeit<br />
Rhinitis acuta<br />
Rhinitis chron.<br />
Stirnhöhlcnempycm<br />
Kieferhöhlenvereiterung<br />
Pansinusitis<br />
Laryngitis acuta<br />
< -a<br />
4<br />
l 3<br />
8<br />
9<br />
ii<br />
10<br />
8<br />
5<br />
10<br />
i8<br />
3<br />
3<br />
22<br />
18<br />
J6<br />
2<br />
21<br />
4<br />
2<br />
5<br />
46<br />
19<br />
6<br />
36<br />
Behandlungsdauer<br />
3 W<br />
2 W<br />
5 W<br />
1 W<br />
1 W<br />
2 W<br />
2-4 W<br />
8—16 W<br />
4 W<br />
'J<br />
6 W<br />
9M<br />
3~8 W<br />
1—18W<br />
9—16 W<br />
HW<br />
4W<br />
2—6 W<br />
3W<br />
3-4 J-<br />
1—4 W<br />
6W—2 M<br />
6M — 2j<br />
14 Tg<br />
2\V— 4.I<br />
2—3 W<br />
2 W<br />
271<br />
Zahl der<br />
UKW<br />
9<br />
6<br />
9—12<br />
6-9<br />
10—12<br />
9—12<br />
9<br />
12<br />
12<br />
16—18<br />
9—12<br />
6—12<br />
10—12<br />
9—12<br />
9—18<br />
12—18<br />
9<br />
18<br />
9—12<br />
5—15<br />
9—12<br />
15<br />
4-6<br />
9—12<br />
6-9<br />
4<br />
9—15<br />
8<br />
2-4<br />
9—12<br />
y—21<br />
9—12<br />
8—12<br />
3—5<br />
UKW<br />
Bchandlungsdaucr<br />
2 W<br />
2 W<br />
3W<br />
1—2 W<br />
3W<br />
2 W<br />
2—3 W<br />
2 W<br />
3-4 W<br />
4 W<br />
4w<br />
4 W<br />
4 W<br />
4 W<br />
2—4 W<br />
4—6 W<br />
2—3 W<br />
3W<br />
3W<br />
4 W<br />
4 W<br />
,W<br />
1 W<br />
2—3 W<br />
2 W<br />
4 Tg<br />
2-3 W<br />
2 W<br />
2 Tg<br />
i-ioTg<br />
2—4W<br />
2—4 W<br />
2—3 W<br />
1 W<br />
2<br />
Ï<br />
iy<br />
7<br />
3<br />
30<br />
4<br />
11<br />
3<br />
4<br />
4<br />
18<br />
1<br />
5<br />
4<br />
45<br />
Erfolg:<br />
16 I 8<br />
s<br />
10 I —•<br />
2 ¡ i<br />
6 ! -
Nr.<br />
35<br />
36<br />
37<br />
38<br />
39<br />
40<br />
41<br />
42<br />
43<br />
44<br />
45<br />
46<br />
47<br />
48<br />
49<br />
ïo<br />
51<br />
52<br />
53<br />
54<br />
55<br />
56<br />
57<br />
58<br />
59<br />
60<br />
61<br />
62<br />
63<br />
64<br />
65<br />
66<br />
67<br />
68<br />
69<br />
70<br />
Krankheit<br />
Laryngitis chron.<br />
Kehl kopfödem<br />
Bronchitis<br />
Bronchiektasen<br />
Asthma bronchiale<br />
Pneumonie ak. u.<br />
chron.<br />
Lungenabszesse<br />
Lungentumoren<br />
Lungen-Tbc<br />
Pleuritis sicca<br />
Pleuritis exsudât.<br />
Pleuraschwarte<br />
Pleuraempyem<br />
Pleurahämatom<br />
Hydrothorax<br />
Krankheiten des Verdauungsapparates<br />
Párulis<br />
Gingivitis<br />
Periodontitis<br />
Schmerzen nach Zahnextraktion<br />
Granulom<br />
Zahnfistel<br />
Stomatitis<br />
Mund bogen-<br />
Phlegmone<br />
Parotitis<br />
Fistcleiterg nach<br />
Exstirp.d. Parotis<br />
Rachenkatarrh<br />
chronisch<br />
Rachengaumenöd em<br />
Schwellung des Gesichts<br />
bei Rachcn-Ca<br />
Tonsillitis chronisch<br />
Peritonsillar-Abszeß<br />
Cardiospasms<br />
Gastritis<br />
Ulc. ventr. od. duod.<br />
Magentumoren mal.<br />
G astroenteroptose<br />
Gastroenteritis<br />
g<br />
1<br />
TS V<br />
w<br />
2—3 W<br />
—<br />
2—8 W<br />
1 -3 W<br />
2W<br />
2W<br />
1 W<br />
2—3 W<br />
3 M<br />
2—Î W<br />
1 W<br />
1—4W<br />
- - • -<br />
2W-3M<br />
3W<br />
_<br />
3 -5 M<br />
—<br />
2—4W<br />
—<br />
2—3W<br />
3- 12 W<br />
3-4 W<br />
2 W—2 M<br />
272<br />
Zahl der<br />
UKW<br />
12—15<br />
6<br />
6—12<br />
8—9<br />
6—18<br />
6-1 í<br />
15—36<br />
10<br />
6-9<br />
4-6<br />
4-6<br />
2<br />
3-6<br />
9<br />
4—9<br />
3—4<br />
9—15<br />
4—9<br />
4<br />
3<br />
6<br />
6<br />
!—4<br />
9-12<br />
9—12<br />
6—21<br />
6<br />
6<br />
6—12<br />
UKW<br />
Behandlung»<br />
dauer<br />
2—3 W<br />
2 W<br />
2—3 W<br />
2—3 W<br />
2—6 W<br />
2—4 W<br />
r 6 W<br />
2—3 W<br />
verschieden<br />
4-6 2—3 W<br />
9—25 3—8 W<br />
9—18 3-5 W<br />
12—30 7—12<br />
7 14 Tg<br />
12 jW<br />
1—2 W<br />
1 W<br />
1 W<br />
3- 4 Tg<br />
2- 3 W<br />
1-2 W<br />
1 W<br />
3 Tg<br />
1 W<br />
1 W<br />
1-4 Tg<br />
2-jW<br />
1--2W<br />
1—4W<br />
2W<br />
1-2W<br />
1--3 W<br />
0
Krankheit<br />
Dickdarmkatarrh<br />
Proktitis<br />
Obstipation<br />
Ileus (Sub.)<br />
Periproktitis<br />
Analfistcl<br />
Appendicitis (diag.)<br />
Appendicitis chron.<br />
(therap.)<br />
Pelveo-Peritonitis<br />
Fistelcitcrg nach<br />
Appendektomie<br />
Peritoncal-Tbc.<br />
Bauchfellverwachs.<br />
Krankheiten der Leber,<br />
Gallenblase tt. Bauchspeicheldrüse<br />
Ikterus simplex \<br />
homologer Scrumikt. ><br />
Hepatitis epid. J<br />
Lebcrcirrhosc<br />
Leberstauung<br />
Leberabszess<br />
Cholecystitis ac.<br />
Cholecystitis chron.<br />
Cholelithiasis<br />
Cholecystopathie<br />
Postoper. Bcschw.<br />
n. Cholecystektomie<br />
Pankreatitis<br />
Krankheiten des Harnapparales<br />
Glomerulonephritis<br />
Nephritis chron.<br />
Nephrose<br />
Pyoncphrosc<br />
Hydroncphrose<br />
Nephrosklerose<br />
Pyelitis ac.<br />
Pyelitis chron.<br />
Pyclonephritidcn<br />
Cystopyelitis<br />
Nephrolithiasis<br />
Cystitis ac.<br />
G<br />
u<br />
.nzahl<br />
er Patient<br />
«3-U<br />
13<br />
3<br />
*7<br />
5<br />
3<br />
9<br />
44<br />
4<br />
2<br />
i?<br />
1<br />
8<br />
32<br />
2<br />
6<br />
5<br />
27<br />
7<br />
4<br />
39<br />
10<br />
4<br />
5<br />
33<br />
3<br />
1<br />
4<br />
2<br />
12<br />
7<br />
2<br />
7<br />
3<br />
"<br />
Behandlungsdauer<br />
2—4 W<br />
2—3W<br />
1W-3 M<br />
iW<br />
4—6 W<br />
4 W<br />
UKW<br />
3-4 W<br />
2—3 W<br />
—<br />
3W<br />
2—4W<br />
2 W<br />
4—6 W<br />
5 W<br />
4 W<br />
1 W<br />
3~7 W<br />
2—8 W<br />
3—12 W<br />
1 W<br />
2—6 W<br />
2—3 W<br />
5-7 W<br />
4 W<br />
5 W<br />
4—6 W<br />
6 W<br />
1—2 W<br />
4—8 W<br />
4-5 W<br />
1—2 W<br />
3 W<br />
1—2 W<br />
273<br />
Zahl der<br />
UKW<br />
6<br />
12<br />
9—13<br />
12<br />
10<br />
12—18<br />
9—12<br />
6<br />
12<br />
9—12<br />
12—15<br />
12<br />
9<br />
6<br />
6<br />
12—15<br />
12—18<br />
12—ij<br />
9<br />
6-9<br />
9<br />
6<br />
12<br />
10<br />
12<br />
8<br />
6<br />
UKW<br />
Bchandlungsdauer<br />
i<br />
2 W<br />
6—10W<br />
1—2 W<br />
3-4 W<br />
2—3 W<br />
2—3 W<br />
3-4 W<br />
2 W<br />
3W<br />
2—3 W<br />
4 W<br />
2 W<br />
2-3 W<br />
1 W<br />
1—2 W<br />
2—4 W<br />
3-4 W<br />
3W<br />
2 W<br />
2—3 W<br />
2—3 W<br />
2 W<br />
2—3 W<br />
2 W<br />
2—3 W<br />
8 Tg<br />
2 W<br />
•bellt<br />
*<br />
es, geb.<br />
FS<br />
Erfolg<br />
ja<br />
u<br />
00<br />
¡cht geb.<br />
d<br />
¡cht<br />
erwert.<br />
6-ij 2—8W 10 2 1<br />
6-9<br />
3—9<br />
9—12<br />
12—1 j<br />
1-2W —<br />
3W 12<br />
2—3 W —<br />
2—3 W 1<br />
3<br />
5<br />
2<br />
—<br />
...<br />
—<br />
2<br />
—<br />
—<br />
—<br />
1<br />
2<br />
4 1 W 6 1 I 1<br />
als Diagnostil um in 40 Fällen chir.<br />
jestätigt<br />
—<br />
2<br />
12<br />
—<br />
8<br />
M<br />
—<br />
—<br />
3<br />
»9<br />
—<br />
—<br />
24<br />
—<br />
1<br />
_<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
5<br />
—<br />
7<br />
—<br />
*9<br />
—<br />
—<br />
3<br />
___<br />
—<br />
16<br />
2<br />
6<br />
2<br />
6<br />
5<br />
4<br />
9<br />
10<br />
—<br />
5<br />
5<br />
3<br />
—<br />
3<br />
—<br />
7<br />
—<br />
—<br />
3<br />
6<br />
4<br />
—<br />
—<br />
„<br />
— —<br />
—<br />
—<br />
—<br />
_<br />
—<br />
—<br />
2<br />
2<br />
• —<br />
—<br />
—<br />
3<br />
„<br />
20<br />
_ —<br />
1<br />
—<br />
• —<br />
6<br />
2<br />
—<br />
1<br />
1<br />
—<br />
2<br />
—<br />
—<br />
—<br />
__<br />
—<br />
—<br />
6<br />
—<br />
—<br />
—<br />
7<br />
—<br />
1<br />
—<br />
2<br />
C ><br />
_<br />
__<br />
—<br />
...<br />
__<br />
—<br />
—<br />
—<br />
2<br />
—<br />
—<br />
-_<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
__.<br />
—-<br />
-_<br />
1<br />
—<br />
....<br />
—<br />
..-<br />
— ' —<br />
1 I —<br />
— 1 -----<br />
— ! --<br />
— • - -<br />
2 3
Mr.<br />
OÍ<br />
06<br />
o?<br />
08<br />
09<br />
10<br />
11<br />
12<br />
*3<br />
14<br />
is<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
22<br />
2 3<br />
24<br />
2 5<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
30<br />
31<br />
32<br />
33<br />
34<br />
35<br />
36<br />
37<br />
38<br />
39<br />
40<br />
41<br />
42<br />
Krankheit<br />
Cystitis chron.<br />
Incontinentia vesivae<br />
Postop. Beschw. n.<br />
Nephrektomie<br />
Krankheiten der<br />
Geschlechtsorgane<br />
Ovarialtumor<br />
Salpingitis<br />
Adnexitis ac.<br />
Adnexitis chron.<br />
adnex. Reizcrsch.<br />
Endometritis<br />
Parametritis<br />
Perimetritis<br />
Vulvaabszesse<br />
Amenorrhoe<br />
Prostatitis<br />
Prostatahypertrophie<br />
Orchitis<br />
Epididymitis<br />
Follikulitis<br />
Furunkel<br />
Karbunkel<br />
Hidrosadenitis<br />
Phlegmone<br />
Panaritium<br />
Erysipel<br />
Herpes Zoster<br />
Ekzem chron.<br />
Mastitis<br />
Mamma-abszeß<br />
Mastopathie<br />
Narbenulcus<br />
Spritzenabszeß<br />
Lymphangitis ac.<br />
Lymphangitis spez.<br />
Lymphangitis chron.<br />
Lymphangitis<br />
Krankheiten der Drüsen<br />
mit innerer Sekretion<br />
Hyperthyreosen<br />
Strumitis<br />
Hypogenitalismus<br />
l<br />
1<br />
II<br />
5 w<br />
< -a<br />
14<br />
3<br />
13<br />
8<br />
5<br />
141<br />
82<br />
3 1<br />
11<br />
12<br />
3<br />
16<br />
12<br />
17<br />
34<br />
8<br />
9<br />
12<br />
107<br />
37<br />
38<br />
19<br />
18<br />
5<br />
7<br />
2<br />
37<br />
15<br />
38<br />
3<br />
9<br />
48<br />
13<br />
3<br />
5<br />
4<br />
2<br />
3<br />
Behandlungsdauer<br />
HW<br />
JW<br />
1 W<br />
3W<br />
3W<br />
2 W<br />
3W-2M<br />
2 W<br />
I—2 W<br />
3W<br />
2—3 W<br />
1 W<br />
1—4 W<br />
}W- 2 M<br />
4W—3 M<br />
2 W<br />
2 W<br />
2 W<br />
1—2 W<br />
2—3 W<br />
2—8 W<br />
2 W<br />
!_a W<br />
1—2 W<br />
2—3 W<br />
6 W<br />
—<br />
1—3 W<br />
2—3 W<br />
3M-2J<br />
1—2 W<br />
4 W<br />
4—6 W<br />
1 W<br />
2—4M<br />
2 W<br />
2M—ij<br />
274<br />
Zahl der<br />
UKW<br />
9—12<br />
6<br />
12—15<br />
6<br />
6—12<br />
9—12<br />
15—18<br />
6<br />
6-9<br />
9—12<br />
9—12<br />
4<br />
6<br />
9—IJ<br />
15—18<br />
6<br />
9<br />
4<br />
2—6<br />
4-6<br />
6-is<br />
6—12<br />
6-9<br />
6<br />
6<br />
9<br />
4-8<br />
6<br />
6<br />
12<br />
3<br />
9—12<br />
12—15<br />
6-9<br />
6-9<br />
12—18<br />
6<br />
9—12<br />
UKW<br />
Behandlungsdauer<br />
Î-4W<br />
1 W<br />
2—3 W<br />
1 W<br />
I—2 W<br />
2—3 W<br />
3-4 W<br />
1—2 W<br />
2 W<br />
2—3 W<br />
3-4 W<br />
4 Tg<br />
2 W<br />
2—3 W<br />
4 W<br />
2 W<br />
2 W<br />
4 Tg<br />
2—6 Tg<br />
io-i4Tg<br />
M W<br />
2—3 W<br />
1— 2 W<br />
6 Tg<br />
6 Tg<br />
2 W<br />
4Tg-2W<br />
2 W<br />
1—2 Tg<br />
2—3 W<br />
1 W<br />
2—3 W<br />
4 W<br />
3W<br />
2 W<br />
2—4W<br />
2 W<br />
3-5 VC<br />
¿5<br />
s<br />
"S<br />
§b<br />
—<br />
—<br />
—<br />
85<br />
31<br />
—<br />
5<br />
6<br />
—<br />
10<br />
8<br />
12<br />
—<br />
—<br />
—<br />
10<br />
85<br />
2 5<br />
20<br />
H<br />
12<br />
5<br />
—<br />
2<br />
25<br />
10<br />
28<br />
2<br />
6<br />
2J<br />
—<br />
—<br />
5<br />
—<br />
—<br />
—<br />
i<br />
S<br />
10<br />
3<br />
13<br />
4<br />
4<br />
20<br />
20<br />
—<br />
—<br />
3<br />
—<br />
4<br />
—<br />
28<br />
6<br />
6<br />
—<br />
10<br />
6<br />
10<br />
—<br />
—<br />
—<br />
7<br />
—<br />
10<br />
—<br />
8<br />
—<br />
I<br />
17<br />
l i<br />
—<br />
4<br />
—<br />
3<br />
Erfolg<br />
-s<br />
00<br />
—<br />
—<br />
i<br />
3<br />
7<br />
3 1<br />
—<br />
3<br />
—<br />
—<br />
—<br />
2<br />
__<br />
—<br />
u<br />
00<br />
u<br />
'2<br />
4<br />
—<br />
4<br />
—<br />
2<br />
8<br />
—<br />
6<br />
3<br />
—<br />
2<br />
4<br />
Î<br />
6<br />
—<br />
i<br />
2<br />
C (-<br />
__<br />
—<br />
—<br />
31<br />
16<br />
-—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
__<br />
_<br />
—<br />
—<br />
2<br />
—<br />
7 (UKW-Beh.<br />
durch chit. Eingriff<br />
abgebrochen j)<br />
4<br />
—<br />
4<br />
-—<br />
—<br />
—.<br />
—<br />
3<br />
—<br />
1<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
2<br />
—<br />
4<br />
4<br />
5<br />
2<br />
—<br />
—<br />
—<br />
_ 2<br />
2<br />
1<br />
1<br />
2<br />
—<br />
3<br />
„<br />
—-<br />
2<br />
—<br />
—<br />
— •<br />
—<br />
—<br />
—<br />
2<br />
__<br />
—<br />
—<br />
—<br />
4<br />
—<br />
—<br />
—<br />
— •<br />
—
Nr.<br />
143<br />
144<br />
145<br />
146<br />
147<br />
148<br />
149<br />
150<br />
151<br />
152<br />
M3<br />
154<br />
*55<br />
156<br />
157<br />
158<br />
159<br />
160<br />
161<br />
162<br />
163<br />
164<br />
165<br />
166<br />
167<br />
168<br />
169<br />
170<br />
171<br />
172<br />
173<br />
174<br />
175<br />
176<br />
177<br />
178<br />
Krankheit<br />
Infantilismus<br />
Hypopitu itarismus<br />
Morbus Simmonds<br />
Dystonie, neuro-veg.<br />
plurigl. Insuffizz.<br />
Stoffwechselkrankheiten<br />
Diabetes mell.<br />
Mumifikation<br />
Gicht<br />
Diabetes insip.<br />
Krankheiten des<br />
Bewgungsapparates<br />
Muskclrhcuma acut<br />
Muskelrheuma chron.<br />
Polyarthritis rheum.<br />
Fungus<br />
Arthritis sicca<br />
Arthritis Tbc.<br />
Arthritis gonorrhoica<br />
Hydrops genus<br />
Hämarthrosis<br />
Coxitis spez.<br />
Coxitis ac. rheumat.<br />
Spondylarthr.<br />
ankylopoctica<br />
Malum coxae sen.<br />
Arthritis deform.<br />
(Knie)<br />
Omarthritis def.<br />
Periarthritis hum.<br />
scapul.<br />
Spondylitis def.<br />
Osteochondritis diss,<br />
(postop. Beschw.)<br />
Periostitis<br />
Osteomyelitis<br />
Osteomalazie<br />
Ca.-Metastasen WS<br />
Fistclcitcrg n. Exartik.<br />
Contusio<br />
Facialis-Parese<br />
Plexus brachialis<br />
Lähmungserschein.<br />
Trigeminusneuralgie<br />
c<br />
c<br />
N &*<br />
tí v><br />
< -a<br />
3<br />
4<br />
Í<br />
4<br />
11<br />
3 1<br />
3<br />
3<br />
3<br />
152<br />
97<br />
44<br />
7<br />
17<br />
7<br />
8<br />
81<br />
18<br />
2<br />
37<br />
3<br />
6<br />
126<br />
3 1<br />
97<br />
11<br />
5<br />
6<br />
ij<br />
8<br />
6<br />
M<br />
22<br />
17<br />
4<br />
S5<br />
Behandlungsdauer<br />
3W—6M<br />
2W-3M<br />
3W—4M<br />
4-6W<br />
2W-3M<br />
4W-2J<br />
1-2 J<br />
3W—2M<br />
2—6 W<br />
2—4 W<br />
2W—4M<br />
2—3 W<br />
2W-2M<br />
2—8 W<br />
3—6 4w W<br />
2—4 W<br />
1 W<br />
2—3 M<br />
2—4M<br />
2-4 j<br />
2—3 W<br />
2M—2j<br />
4W- 6 M<br />
2—8 W<br />
3-7 W<br />
—<br />
2—3 W<br />
4—6 W<br />
2-4W<br />
4 W<br />
__<br />
—<br />
3W-2M<br />
3W—4M<br />
2W-3M<br />
*73<br />
Zahl der<br />
UKW<br />
9—12<br />
12—ij<br />
9—ij<br />
18<br />
9—12<br />
6—18<br />
6—12<br />
6<br />
6<br />
6—18<br />
6—28<br />
6—18<br />
6—18<br />
6—18<br />
6—12<br />
9—12<br />
6—12<br />
8<br />
6<br />
9—18<br />
12—21<br />
12—15<br />
9—32<br />
12—18<br />
12—24<br />
6—12<br />
6<br />
6<br />
6—21<br />
8—12<br />
6—18<br />
6—12<br />
6<br />
6—24<br />
18<br />
9—12<br />
UKW<br />
Behändlungsdaucr<br />
3-5 W<br />
4-5 W<br />
3-4 W<br />
3-4 W<br />
2—3 W<br />
2—6 W<br />
2—3 W<br />
2—3 W<br />
2—3 W<br />
1—5 W<br />
2—8 W<br />
1-4W<br />
3-5 W<br />
4-6W<br />
4 W<br />
2—3 W<br />
I—2 W<br />
8 Tg<br />
2 W<br />
2—6W<br />
4—6 W<br />
3-5 W<br />
3—8 W<br />
3-5 W<br />
2—6W<br />
3-4W<br />
1 W<br />
2 W<br />
2—6 W<br />
2—4 W<br />
3W<br />
2—3 W<br />
2 W<br />
2—4 W<br />
3W<br />
3W<br />
1<br />
%<br />
—<br />
—<br />
123<br />
20<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
S»<br />
12<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
__<br />
S»<br />
—<br />
5<br />
6<br />
9<br />
—<br />
—<br />
3<br />
T i<br />
9<br />
—<br />
21<br />
-si<br />
ö<br />
3<br />
4<br />
—<br />
4<br />
8<br />
14<br />
__<br />
3<br />
3<br />
7<br />
62<br />
12<br />
4<br />
12<br />
—<br />
8<br />
15<br />
6<br />
—<br />
19<br />
—<br />
3<br />
73<br />
12<br />
30<br />
7<br />
—<br />
—<br />
2<br />
8<br />
—<br />
10<br />
7<br />
6<br />
4<br />
16<br />
irfolg :<br />
V<br />
OD<br />
—<br />
2<br />
—<br />
8<br />
_<br />
—<br />
6<br />
M<br />
5<br />
—<br />
1<br />
7<br />
—<br />
8<br />
—<br />
—<br />
12<br />
—<br />
_<br />
38<br />
10<br />
6<br />
—<br />
• "~<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
2<br />
—<br />
H<br />
ji<br />
u<br />
Mi<br />
M<br />
u<br />
'S<br />
—<br />
3<br />
2<br />
9<br />
3<br />
10<br />
11<br />
3<br />
3<br />
4<br />
—<br />
—<br />
3<br />
—<br />
—<br />
4<br />
3<br />
3<br />
15<br />
9<br />
10<br />
4<br />
—-<br />
—<br />
4<br />
—<br />
6<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
2<br />
8<br />
'2 S<br />
_<br />
—<br />
__<br />
—<br />
1<br />
—<br />
„<br />
—<br />
6<br />
9<br />
4<br />
—<br />
—<br />
—<br />
__<br />
4<br />
—<br />
2<br />
2<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
_<br />
—<br />
„<br />
—<br />
—<br />
2
Krankheit<br />
Occipital neuralgic<br />
Ic.-Ncuralgic<br />
Ncuralg. vcrsch. l.ok.<br />
Ischias akut<br />
Ischias chron.<br />
Neuritis<br />
Migräne<br />
Kopfschmerz<br />
Chorea minor<br />
Postcnccphal. Zust.<br />
Contusio cerebri<br />
Poliomyelitis<br />
Enuresis noct.<br />
Epilepsie sympt.<br />
Neurasthenic ace.<br />
Vasomot, Neurose<br />
Verschiedene Krankheiten<br />
Abszesse<br />
Op. Wundgcbiete<br />
Narbcnbcschwcrdcn<br />
Adhäsionsbeschwerden<br />
Infiltrate<br />
Appendicitis<br />
Keuchhusten<br />
JZ<br />
N<br />
C<br />
<<br />
c<br />
y<br />
4-j<br />
c<br />
CJ<br />
«<br />
&.<br />
der<br />
41<br />
ÏI<br />
22<br />
84<br />
20<br />
il<br />
il<br />
37<br />
6<br />
3<br />
3<br />
10<br />
î<br />
4<br />
4<br />
5<br />
65<br />
104<br />
17<br />
53<br />
? 2<br />
4<br />
4<br />
Behandlungdauer<br />
2W-3M<br />
2 W—3 M<br />
1—2 W<br />
2W-;M<br />
1—8 W<br />
4 -6 W<br />
2—5 W<br />
3-5 W<br />
4—8 W<br />
4 W<br />
6W-5M<br />
,1-12 W<br />
4--6 W<br />
5 W<br />
1—2 W<br />
2-3 W<br />
3-i W<br />
2—3 W<br />
I -2 W<br />
2 W<br />
Zahl der<br />
UKW<br />
6-TJ<br />
6-9<br />
6—12<br />
6—12<br />
6—28<br />
12—24<br />
6-8<br />
4-6<br />
6-ij<br />
6-12<br />
12<br />
6—42<br />
12—19<br />
12 -15<br />
6-9<br />
6-9<br />
¿—6<br />
z—-10<br />
6<br />
4—8<br />
6<br />
4-6<br />
6—12<br />
UKW<br />
Behändlungsdaucr<br />
3W<br />
2—3 W<br />
2—4 W<br />
1—3 W<br />
i—6 W<br />
4Tg-6W<br />
2—3 W<br />
4-6 Tg<br />
2-3 W<br />
3-4W<br />
2 W<br />
2W-4M<br />
r 4 W<br />
2—3 W|<br />
2-3 W!<br />
1 W<br />
4Tg-3W:<br />
6 Tg J<br />
4Tg-2w!<br />
1 W<br />
4-6 Tg|<br />
2 W I<br />
30<br />
30<br />
16<br />
66<br />
16<br />
10<br />
30<br />
50<br />
8i<br />
4<br />
10<br />
6<br />
4<br />
—<br />
29<br />
9<br />
23<br />
2<br />
Eifoljj:<br />
7<br />
8<br />
—<br />
10<br />
2<br />
---<br />
S<br />
14<br />
16 -<br />
1. Dicht anliegende Elektroden. Die Kraftlinien haben ungenügende Tiefenwirkung und<br />
umgehen Knochen und andere Organe.<br />
2. Abstandsbchandlung. Homogene Wirkung in der Tiefe.<br />
Energieverteilung im Kondensatorfcld Energieverteilung unter der Flachspule<br />
Platten gekantet Rechte Platte dicht anliegend linke, mit Abstand. Platten tangential<br />
276<br />
II<br />
10<br />
.<br />
?<br />
1<br />
2<br />
3
Tafel I<br />
Schulter und Nacken<br />
(Neuritis plex. brachialis)<br />
Halsdreieck<br />
(Tonsille, Lymphdrüsen)<br />
Verschiedene Elektrodeneinstellungen<br />
Kopf<br />
(Migräne)<br />
Achselhöhle (Hidradenitis)<br />
A\% T T<br />
Stirnhöhle,<br />
Hypophyse<br />
Wirbelsäule<br />
Becken, Oberschenkel (Isdiias) Schultergürtel<br />
277<br />
1<br />
L. Kieferhöhle
Tafel II<br />
i I<br />
Feldlinienverlauf: i. bei Langwellen-Diathermie, 2. UKW mit Luftabstand. Wärmeverteilung<br />
bei UKW mit verschiedener Stellung der Elektroden, ;. Nahe anliegende,<br />
schmiegsame Elektroden, 4. Luftabstand, j. Flachspulc, 6. links Elektrode mit Luftabstand,<br />
rechts angenähert, 7. schräg zum Umfang, 8. tangential<br />
278
Tafel III<br />
Plattenabstand Plattenabstand Zu kleine Platten,<br />
zu gering richtig zu großer Abstand<br />
Linke Platte Platten an gekrümmter Desgl. mit dem oberen<br />
verkantet Oberfläche stark schräg Rand angenähert<br />
gestellt<br />
Elektroden an den Metallteil (Hilfs- Sog. unipolare<br />
Oberschenkeln elektrode) im Modell Behandlung<br />
Elektroden parallel am Rücken<br />
Feldlinien und WärmeverteÜung bei verschiedener Einstellung<br />
der Elektroden<br />
279
VIII. Tabelle<br />
In der Tabelle sind nur diejenigen Erkrankungen angeführt, bei denen Erfahrungen<br />
und Abstände sollen nur ungefähre Anhaltspunkte geben; Individualisicrurig ist undaucr<br />
und kleiner Dosis zu beginnen und allmählich zu steigern, je nachdem der Kranke<br />
und Zeit zurückzugehen. Hy.m. = Hyperthermie mild.<br />
Krankheit<br />
Abscess, orbitae<br />
Adnexitis akut<br />
Adnexitis chronisch<br />
Akne tuvenüis<br />
Akrozyanoscn<br />
A ktinomykose<br />
Analfissur<br />
Angina, akut<br />
Analfistel<br />
Angiospasmen<br />
Angina pectoris<br />
Appendic. chron.<br />
Anurie bei Nephritis<br />
Arteriosklerose<br />
Arthritis prim, chronisch<br />
Arthritis sicca<br />
Asthma bronch.<br />
Atrophia N.opt.<br />
Bronchitis, akut<br />
Bronchitis, chronisch<br />
Bronchektasen<br />
Cholezystitis, akut<br />
Cholezystitis, chronisch<br />
Chorioiditis<br />
Claudicado intermittens<br />
Coccygodynie<br />
Colitis ulcerosa<br />
Colitis mucosa<br />
Cystitis, Pyelitis<br />
Dakryozystitis<br />
Douglasabszeß<br />
Dysmenorrhoe<br />
Ekzem, seborrhoisches<br />
Empyema pleurae non spez.<br />
Empyema pleur, interlob<br />
Endarteriitis<br />
Epikondylitis<br />
Episklefitis<br />
Erfrierung allgemein<br />
Erfrierung, lokal frisch<br />
Erfrierung, lokal alt<br />
Dosis<br />
I—II<br />
II—III<br />
III—IV<br />
I—III<br />
II<br />
III—IV<br />
I—II<br />
I—II<br />
n—m<br />
i<br />
ii<br />
H—m<br />
ii—in<br />
II<br />
Hy.m.<br />
Hy.m.<br />
I—IV<br />
II<br />
II<br />
III—IV<br />
III—IV<br />
II—III<br />
III—IV<br />
I<br />
II—III<br />
Hy.m.<br />
II—III<br />
II—IV<br />
I—II<br />
II—III<br />
I—II<br />
II—III<br />
III—IV<br />
I<br />
I—II<br />
I—II<br />
II<br />
I<br />
I—II<br />
280<br />
Dauer<br />
Min.<br />
5—io<br />
io<br />
15—20<br />
IO<br />
J—10<br />
20—30<br />
5<br />
S<br />
10<br />
5<br />
5<br />
5<br />
10<br />
Í<br />
30—40<br />
30—40<br />
5—20<br />
10—15<br />
j—10<br />
10—15<br />
10—-15<br />
5—10<br />
10<br />
Hyperthermie<br />
5—10<br />
3—10<br />
30<br />
10—-20<br />
10—20<br />
5—ro<br />
Ï— 20<br />
5—10<br />
j—30<br />
10—20<br />
5<br />
3—10<br />
10<br />
30<br />
5—10<br />
10<br />
Zahl<br />
10<br />
6—10<br />
6—10<br />
10<br />
6<br />
20—30<br />
10—ij<br />
2—4<br />
20<br />
5—10<br />
io<br />
10<br />
1—2<br />
10<br />
12—20<br />
12—20<br />
10<br />
20—30<br />
6<br />
IO<br />
10<br />
IO<br />
IO<br />
10<br />
IO<br />
10<br />
6—10<br />
10—20<br />
6<br />
10<br />
6<br />
12—20<br />
12—20<br />
10<br />
10<br />
10—30<br />
11—20<br />
6<br />
10—20<br />
Abstand<br />
aktiv inaktiv<br />
2<br />
4<br />
4<br />
2<br />
3<br />
4<br />
3<br />
3<br />
3<br />
6<br />
6<br />
6<br />
6<br />
3<br />
6<br />
6<br />
3<br />
8<br />
verschieden<br />
6<br />
6<br />
6<br />
verschieden<br />
6<br />
2<br />
4<br />
4<br />
6<br />
3<br />
3<br />
Jängs<br />
6<br />
6<br />
4<br />
4<br />
6<br />
6<br />
6<br />
s. Hypogcnitalismus<br />
2<br />
4<br />
6<br />
2<br />
2<br />
längs<br />
6<br />
6<br />
8<br />
2<br />
6<br />
Hyperthermie<br />
versci lieden
der Indikationen<br />
gesammelt und veröffentlicht worden sind. Die angegebenen Zahlen für Dosis, Zeiten<br />
bedingt notwendig. Bei Angabe einer Zeitspanne (z.B. 5-15 Min.) ist mit kurzer Zcites<br />
verträgt. Bei stärkeren Reaktionen ist eine Pause zu machen und auf eine kleinere Dosis<br />
Heilungsdauer<br />
2 W<br />
3W<br />
verschieden<br />
6—8T<br />
2 W<br />
6 W<br />
2 W<br />
3-4 T<br />
4 W<br />
—<br />
2 W<br />
3W<br />
I-2T<br />
4-6W<br />
4—6 W<br />
3W<br />
unbestimmt<br />
1 W<br />
2 W<br />
2W<br />
îW<br />
1—3 W<br />
4 W<br />
4—6 4w W<br />
10 T<br />
4W<br />
und Hypopituarismus<br />
10—14 T<br />
4 W<br />
4 W<br />
1—3 W<br />
8 W<br />
2—4 W<br />
6—8 W<br />
3-4 W<br />
Ergebnis<br />
Bemerkungen<br />
gut<br />
sehr gut<br />
sehr gut<br />
mittel<br />
Kombination mit Eigenblut<br />
gut, vorübergehend<br />
fraglich, subjekt. gut<br />
gut, aber vor Operation unbedingt zu versuchen<br />
sehr gut<br />
fraglich, aber vor Operation unbedingt zu versuchen<br />
gut, vorübergehend<br />
gut<br />
fraglich, oft Aufflackern<br />
gut<br />
Beschwerden besser<br />
gut<br />
gut<br />
Kombinationen<br />
evtl. Komb. m. üblich. Methoden<br />
evtl. Komb, mit Gold oder Pyramidon<br />
evtl. mit Antophanyl<br />
individuell sehr verschieden, evtl. starke Hyperthermie<br />
sehr fraglich<br />
individuell versch.<br />
gut<br />
vorübergehend<br />
sehr gut<br />
gut<br />
mittel<br />
gut, vorübergehend<br />
gut<br />
manchmal gut<br />
gut<br />
gut, bes. bei Kokken<br />
sehr gut<br />
gut beschleunigte Abzedierung<br />
gut<br />
sehr gut<br />
sehr gut<br />
schlecht<br />
gut<br />
fraglich<br />
sehr gut b. Frühfällen<br />
281<br />
Herdsanierung<br />
(Fortsetzung der Tabelle nächste Seite
Krankheit<br />
Erysipel<br />
Erythema nodosum<br />
Erythema multiforme<br />
Fazialislähmung<br />
Fisteln, postoperativ<br />
Furunkel<br />
Gelenkergüsse d. Überlastung usw.<br />
Gingivitis und Stomatitis<br />
Go. der Harnröhre<br />
Go. der Gelenke<br />
Granulom<br />
Hämatome<br />
Hämorrhoidale Beschwerden<br />
Hidroadenitis<br />
Hordeolum<br />
Hypertension<br />
Hypogenitalismus und<br />
Dystroph, adip. gen.<br />
Hypopituitarismus<br />
Indurado penis plastica<br />
Iridozyklitis<br />
Kalkaneusspron<br />
Karbunkel<br />
Keratitis parench.<br />
Kcratohypopyon<br />
Laparatomie, Beschwerden nach<br />
Laryngitis<br />
Lungenabszeß<br />
Lungenabszeß chronisch<br />
Lungenschuß vereitert<br />
Lymphadenitis non spezif.<br />
Lymphadenitis tbc.<br />
Mastitis<br />
Mediastinitis<br />
Meniere<br />
Meningitis serosa<br />
Metritis<br />
Migräne, Chorea<br />
Myelitis transversa<br />
Myokarditis<br />
Nebenhöhlenempyem, akut<br />
Nebenhöhlenempyem, chronisch<br />
Nephritis akut<br />
Nephritis chron.<br />
Netzhaut-Tbc,<br />
Neuritis chronisch<br />
Neuritis ischiad, akut<br />
Dosis<br />
I<br />
II<br />
II<br />
II—III<br />
11—III<br />
I<br />
II—III<br />
II<br />
III—IV<br />
II—III<br />
II—III<br />
II—III<br />
II<br />
I—II<br />
II<br />
II<br />
II<br />
III<br />
II—III<br />
I—II<br />
II—111<br />
I—II<br />
I—II<br />
I<br />
II—III<br />
II—III<br />
II—III<br />
II—IV<br />
II—III<br />
II—III<br />
I—11<br />
I—II<br />
III—IV<br />
I—II<br />
II—III<br />
II<br />
I—II<br />
II—III<br />
II—III<br />
I—II<br />
I—II<br />
II<br />
II—III<br />
I<br />
Hy.m.<br />
I—II<br />
282<br />
Dauer<br />
Min.<br />
IO<br />
IO<br />
IO<br />
5 IO<br />
IO—IJ<br />
3—Ï<br />
5 — 15<br />
6—8<br />
20 ÓO<br />
20 30<br />
10—20<br />
IO—15<br />
5—10<br />
3 — IO<br />
Ï—10<br />
5—15<br />
IO<br />
25<br />
IS<br />
5<br />
3—10<br />
3—10<br />
Î<br />
5 —10<br />
5—10<br />
5—10<br />
5—4Ï<br />
15—60<br />
10—30<br />
5 — 15<br />
3—10<br />
3 — 10<br />
5—20<br />
5—10<br />
10<br />
ï<br />
j—10<br />
5—20<br />
10<br />
5—10<br />
5—10<br />
5—10<br />
10<br />
5<br />
10—20<br />
5—10<br />
Zahl<br />
10<br />
10<br />
10<br />
10<br />
20—30<br />
3—4<br />
6—10<br />
4—15<br />
10<br />
10<br />
10—30<br />
j—10<br />
6—10<br />
5 — 10<br />
3<br />
10—20<br />
10—30<br />
10—30<br />
20—30<br />
10—20<br />
10<br />
5—15<br />
10—20<br />
10<br />
10—20<br />
10<br />
15—30<br />
40—60<br />
12—20<br />
10—12<br />
20<br />
3-6<br />
12—20<br />
6<br />
6<br />
10<br />
6<br />
20<br />
20<br />
12<br />
20<br />
10—20<br />
10 20<br />
20<br />
10<br />
IO<br />
Abstand<br />
aktiv 1 inaktiv<br />
2<br />
2<br />
2<br />
3<br />
3<br />
2<br />
4<br />
4<br />
2<br />
2<br />
2<br />
2<br />
6<br />
6<br />
6<br />
4<br />
4<br />
2<br />
verschieden<br />
2 4<br />
4 6<br />
3 6<br />
2—3 6<br />
2 6<br />
längs<br />
3<br />
4<br />
2<br />
2<br />
2<br />
3<br />
2<br />
2<br />
4<br />
3<br />
6<br />
6<br />
6<br />
3<br />
2<br />
3<br />
6<br />
ï<br />
Î<br />
4<br />
5<br />
4<br />
3<br />
4<br />
4<br />
6<br />
6<br />
2<br />
lär igs<br />
3<br />
4<br />
2<br />
6<br />
4<br />
6<br />
6<br />
6<br />
6<br />
3<br />
8<br />
8<br />
8<br />
6<br />
6<br />
6<br />
8<br />
î<br />
5<br />
6<br />
5<br />
8<br />
6<br />
4<br />
4<br />
6<br />
6<br />
6
Heilungsdauer<br />
.W<br />
2 W<br />
3W<br />
4W<br />
je nach Größe<br />
verschieden<br />
3-4 T<br />
1^2 W<br />
6-BT<br />
I W<br />
3 W<br />
4W<br />
1—3 W<br />
zW<br />
ro—14 T<br />
4-5 T<br />
4W<br />
unbestimmt<br />
unbestimmt<br />
verschieden<br />
3-4 W<br />
1—3 W<br />
IO—20 T<br />
8 W<br />
4W<br />
1 W<br />
2W<br />
4W<br />
versch. bis 1 Jahr<br />
verschieden<br />
2—3 W<br />
4 W<br />
3—14 T<br />
4 W<br />
2 W<br />
2 W<br />
4W<br />
2 W<br />
6W<br />
verschieden<br />
3-4 W<br />
4 H S W<br />
6—8 W<br />
—<br />
4-W<br />
2 W<br />
Ergebnis<br />
sehr gut<br />
gut<br />
gut<br />
sehr gut<br />
gut<br />
sehr gut<br />
sehr gut<br />
gut<br />
unterschiedlich<br />
sehr gut<br />
vorüberg. Inaktivier.<br />
sehr gut<br />
gut<br />
sehr gut<br />
sehr gut<br />
gut<br />
gut<br />
gut<br />
Besserung<br />
gut<br />
gut<br />
gut<br />
mittel<br />
sehr gut<br />
sehr gut<br />
gut<br />
sehr gut<br />
mittel<br />
sehr gut<br />
gut<br />
gut<br />
sehr gut<br />
sehr gut<br />
sehr gut<br />
sehr gut<br />
gut<br />
sehr gut<br />
sehr gut<br />
gut<br />
sehr gut, wenn Abfluß<br />
gut<br />
gut<br />
gute Beeinflussung<br />
mittel<br />
sehr gut<br />
Kombinationen<br />
Bemerkungen<br />
evtl. zuletzt Stichinzision<br />
evtl. Kombin. mit Mundspülen<br />
Wiederholungen nötig<br />
evtl. zuletzt Stichinzision<br />
auf Genitale, gleichzeitig wie bei<br />
Hypopituitarismus<br />
evtl. zuletzt Stichinzision<br />
Kombin. mit üblichen Mitteln<br />
Auch als Vorbereitung zur Operation<br />
evtl. zuletzt Stichinzision<br />
muß aber wiederholt werden<br />
Kombinationen<br />
Heilung in etwa 30 %<br />
Heilungsdauer beschleunigt<br />
Herdsanicrung !<br />
(Fortsetzung der Tabelle nächste Seite)
Krankheit<br />
Neuritis Ischiad, chronisch<br />
Neuritis brachialis<br />
Neuritis intercostalis<br />
Neuritis rctrobulbaris<br />
Neuritis retrobulbaris<br />
Obstipatio spast.<br />
Orchitis, Epididymitis<br />
Osteomyelitis akut<br />
Osteomyelitis chronisch<br />
Osteomyelitis der Kiefer<br />
Otitis media chron.<br />
Panaritien<br />
Patulis<br />
Parametritis<br />
Periarthritis humeri, akut<br />
Periarthritis humeri, chronisch<br />
Perimetritis<br />
Periostitis<br />
Perioproctitis<br />
Peritonitis, eitr.<br />
Peritonitis, tbc.<br />
Periton. Adhäsionen<br />
Perityphlitis<br />
Pleuritis sicca<br />
Pleuritis exsud. non spez.<br />
Pleuritis exsud. spez.<br />
Pneumonie, chronisch<br />
Pneumonie, plasmacellul<br />
Postoperative Verwachsungsbeschwerden<br />
Prostatitis<br />
Prostata-Hypertrophie<br />
Psoriasis<br />
Raynaud<br />
Schnupfen<br />
Spritzenabszeß<br />
Sklerodermie<br />
Stumpfexsudatc<br />
Tbc. laryngis<br />
Tbc. pulmón, prod.<br />
Tbc. extrapulmon<br />
Tbc. retinae<br />
Tendovaginitis<br />
Thrombose d.V. centralis retinae<br />
Thrombophlebitis<br />
TonsillarabszefJ<br />
Trachom<br />
Traumat. ödem<br />
Tubovarialzyste<br />
i<br />
Dosis<br />
III- IV<br />
II<br />
II<br />
I<br />
II—III<br />
III—IV<br />
il—m<br />
i—ii<br />
i<br />
il<br />
ii<br />
ni—iv<br />
Hy. m.<br />
II<br />
11—III<br />
II—III<br />
I—II<br />
I<br />
III<br />
II—III<br />
I—III<br />
I—III<br />
I—II<br />
II—IV<br />
II—III<br />
II—III<br />
III<br />
II—III<br />
II<br />
II<br />
I—II<br />
I—II<br />
II<br />
11—III<br />
I<br />
I<br />
I—II<br />
I<br />
I- III<br />
I—II<br />
I—II<br />
I—11<br />
II<br />
in—iv<br />
ii- in<br />
284<br />
Dauer<br />
Min.<br />
lo—30<br />
10—15<br />
40<br />
S<br />
5—10<br />
5 — 15<br />
10—30<br />
10—15<br />
Ï<br />
3—10<br />
5- 10<br />
5 —10<br />
1»—20<br />
zo—30<br />
5—10<br />
J—10<br />
10<br />
200<br />
3 — IO<br />
IO<br />
5<br />
j —15<br />
10—15<br />
3 — 10<br />
10<br />
5 — 15<br />
5 — 10<br />
10—15<br />
10<br />
10<br />
ï<br />
5<br />
5 — 10<br />
ij<br />
5 — 20<br />
1—5<br />
3—s<br />
3 — 10<br />
2 — 5<br />
3—to<br />
5<br />
3-6<br />
5<br />
5 — 10<br />
Ï — r S<br />
10<br />
1 Zahl<br />
1<br />
1<br />
1<br />
20<br />
20—30<br />
20<br />
3-6<br />
10<br />
10<br />
20—30<br />
10—-;o<br />
IO<br />
5—12<br />
5 — 10<br />
10—20<br />
10—20<br />
10—20<br />
10—20<br />
10<br />
6—12<br />
6—8<br />
30<br />
6<br />
10<br />
10<br />
10—20<br />
20—30<br />
10<br />
10<br />
12<br />
10<br />
10<br />
10<br />
10<br />
1—2<br />
2—5<br />
10-—20<br />
10<br />
30<br />
20—30<br />
20— 30<br />
20— 30<br />
10<br />
10—20<br />
10<br />
2—4<br />
6—10<br />
8-15<br />
6<br />
Abstand<br />
aktiv j inaktiv<br />
1<br />
längs<br />
wie bei Ischias,<br />
wie bei Ischias,<br />
2 6<br />
4 6<br />
3 3<br />
verschieden<br />
verschieden<br />
4<br />
3<br />
3<br />
3<br />
4<br />
5<br />
4<br />
3<br />
4<br />
4<br />
4<br />
4<br />
4<br />
4<br />
4<br />
4<br />
6<br />
6<br />
4<br />
4<br />
4<br />
2<br />
4<br />
4<br />
1<br />
4<br />
3<br />
4<br />
längs<br />
4<br />
8<br />
3<br />
6<br />
6<br />
5<br />
6<br />
6<br />
6<br />
6<br />
6<br />
6<br />
6<br />
6<br />
6<br />
6<br />
8<br />
8<br />
6<br />
6<br />
6<br />
2<br />
4<br />
6<br />
5<br />
6<br />
3<br />
6<br />
verschieden<br />
2<br />
2<br />
2<br />
3<br />
2<br />
4<br />
4<br />
längs<br />
6<br />
4<br />
6<br />
3<br />
6<br />
4<br />
6
Heilungsdauer<br />
6"W<br />
c nach Akuität<br />
e nach Akuität<br />
unbestimmt<br />
?<br />
3 W<br />
8—20 T<br />
4—6 W<br />
6—8 W<br />
IW<br />
io—14 T<br />
io—14 T<br />
4W<br />
i—z W<br />
4w 4W<br />
i W<br />
i—z W<br />
zW<br />
6 W<br />
2 W<br />
3W<br />
4 W<br />
verschieden<br />
verschieden<br />
2 W<br />
2 W<br />
2 W<br />
2—4 W<br />
4w ?<br />
—<br />
I - J T<br />
3-4 T<br />
verschieden<br />
2 W<br />
verschieden<br />
verschieden<br />
verschieden<br />
verschieden<br />
1—3 W<br />
3-4 W<br />
2 W<br />
2- 4 T<br />
2—8 W<br />
3-4 W<br />
—<br />
Ergebnis<br />
sehr gut<br />
fraglich<br />
gut<br />
gut<br />
gut<br />
gut<br />
gut<br />
gut<br />
gut<br />
gut<br />
gut<br />
sehr gut<br />
sehr gut<br />
gut<br />
gut<br />
gut<br />
gut<br />
gut bei produkt. Formen<br />
gut<br />
sehr gut<br />
gut<br />
nach Punktion<br />
sehr gut<br />
sehr gut<br />
sehr gut, aber Rezidive<br />
sehr gut<br />
sehr gut<br />
fraglich<br />
fraglich<br />
gut, aber unterschiedlich<br />
sehr gut<br />
fraglich<br />
sehr gut<br />
mittel<br />
unbestimmt<br />
unbestimmt<br />
mittel<br />
gut<br />
gut<br />
sehr gut<br />
sehr gut<br />
gut<br />
gut<br />
schlecht<br />
285<br />
Herdsanicrungl<br />
Bemerkungen<br />
Hyperthermie<br />
Wiederholungen nötig<br />
Abstoßung d. Sequester beschleun.<br />
evtl. zuletzt Stichinzision<br />
evtl. zuletzt Stichinzision<br />
evtl. mit Salizyl oder Pyramidon<br />
evtl. mit Salizyl oder Pyramidon<br />
evtl. später Stichinzision<br />
Wiederholungen nötig<br />
beginnen<br />
Wiederholung nach 6 Monaten<br />
absol. Indikation<br />
Herdsanierung<br />
(Fortsetzung der Tabelle nächste Seite)
Krankheit<br />
Ulcus corneae<br />
Ulcus cruris<br />
Ulcus serpens<br />
Ulcus ventric, akut<br />
Ulcus ventric, chronisch call.<br />
Uveitis<br />
Dosis<br />
I—II<br />
I—II<br />
I—II<br />
I<br />
III<br />
I—II<br />
IX. Anhang:<br />
Dauer<br />
Min.<br />
5—io<br />
5<br />
J—IO<br />
J<br />
10—IJ<br />
5—10<br />
Zahl<br />
IO<br />
10—20<br />
10<br />
6—8<br />
IO<br />
Formeln zum physikalischen Teil<br />
Von A.Kohaut und Gerhard Schliephakc<br />
Spannung, Strom und Widerstand<br />
IO<br />
Abstand<br />
aktiv inaktiv<br />
Hat ein Leiter den Widerstand R Ohm und wird er von einem Strom von<br />
I Ampere durchflössen, dann herrscht zwischen seinen Enden die Spannung<br />
E Volt, die für jeden Augenblickswert des Stromes gegeben ist durch<br />
2<br />
3<br />
2<br />
4<br />
4<br />
2<br />
E = IR. (i)<br />
Die Gleichung (i) heißt das Ohmschc Gesetz. An Stelle des Widerstandes R wird<br />
oft sein Kehrwert = — verwendet, den man als Leitwert bezeichnet. Die Ein-<br />
R.<br />
heit des Widerstandes ist das Ohm.<br />
Als Werkstoffe für Widerstände verwendet man meistens Metallegierungen<br />
oder Kohle. Der Widerstand eines Würfels mit i cm Seitenlange heißt der spezifische<br />
Widerstand Q des Werkstoffes, aus dem der Würfel gefertigt ist. Der Kehrwert<br />
— = H heißt Leitvermögen.<br />
Ô<br />
Bei den praktisch ausgeführten elektrischen Schaltungen hat man es immer mit<br />
mehreren Leitern zu tun, die in mannigfacher Weise miteinander verkettet sein<br />
können. Die Beziehungen zwischen den Spannungen, Strömen und Widerständen<br />
in den einzelnen Leitern werden durch die KiRCHHOFFschen Regeln bestimmt:<br />
a) An jedem Verzweigungspunkt mehrerer Leiter ist die Summe der zuerst abfließenden<br />
Ströme gleich Null, also<br />
X7 = o; (2)<br />
dabei sind in (2) die abfließenden Ströme mit entgegengesetztem Vorzeichen zu<br />
nehmen wie die zufließenden.<br />
b) In einem beliebigen in sich geschlossenen Stromkreis ist die Summe der<br />
Produkte aus den einzelnen Widerständen und den sie durchfließenden Strömen<br />
286<br />
6<br />
Î<br />
6<br />
8<br />
8<br />
6
Heilungsdauer<br />
2 W<br />
3-4 W<br />
2 W<br />
2—3 W<br />
4W<br />
2 W<br />
Ergebnis<br />
sehr gut<br />
fraglich<br />
mittel<br />
nicht indiziert<br />
gut<br />
gut<br />
Kombination<br />
Bemerkungen<br />
gleich der Summe der in diesem Kreis vorhandenen elektromagnetischen Kräfte;<br />
also ist<br />
EE = ElRy oder E (E - IR) = o. (5)<br />
Aus den Gleichungen (2) und (3) folgt 2. B. für die Schaltung von mehreren Widerständen<br />
Rx, Ra, R3,.... daß sich bei Hintereinanderschaltung (Reihenschaltung)<br />
aller Widerstände als Gesamtwiderstand R ergibt:<br />
R = ERt = Rt + R2 + Rz + ;<br />
schaltet man alle Widerstände nebeneinander (parallel), dann gilt:<br />
1 _ 1 1 1 1<br />
R Rt R, ^ Rz ^ £3<br />
Bei der Reihenschaltung addieren sich demnach die Widerstände, bei der Parallelschaltung<br />
addieren sich die Leitwerte der einzelnen Widerstände.<br />
Ist die Größe der Einzel wider stände und die angelegte Spannung bekannt, so<br />
läßt sich auch die Verteilung der Stromzweige berechnen:<br />
1 1 1<br />
/j : ;2 : /3 = —- : —- : —-.<br />
Rx R2 R3<br />
Wellenlänge, Frequenz und Fortpflanzungsgeschwindigkeit<br />
Die Wellenlänge A, die Frequenz v und die Fortpflanzungsgeschwindigkeit c<br />
einer elektromagnetischen Schwingung sind durch folgende Beziehung miteinander<br />
verknüpft:<br />
l • v = r, (6)<br />
Die Größe der Fortpflanzungsgeschwindigkeit ist gegeben durch<br />
2,99 • 10<br />
c = —^—= cm • s -1<br />
il<br />
Für das Vakuum ist e = 1, für Luft ist e sehr angenähert gleich 1. Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit<br />
elektromagnetischer Wellen in Luft ist demnach praktisch<br />
gleich 3 • 10 10 cm • s -1 = 3 • io 5 km • s- 1 , also gleich 300000 km je Sekunde.<br />
287<br />
(4)<br />
CO<br />
(?)
Spulen (Induktivitäten)<br />
Die Induktionsspulen sind wesentliche Teile jeder Hochfrcqucn2schaltung. Hat<br />
man es nur mit einer Spule zu tun (mit nur einem geschlossenen Leiter), dann spielt<br />
nur die Selbstinduktion des Leiters eine Rolle ; sind mehrere, aufeinander wirkende<br />
geschlossene Leiter vorhanden, dann kommt noch die Gegeninduktion dazu ;<br />
letztere soll hier aber nicht behandelt werden.<br />
In einer Leiterschleife (einer Spule), die sich in einem Magnetfeld befindet, entsteht<br />
immer dann eine elektromagnetische Kraft (eine elektrische Spannung),<br />
wenn sich der Induktionsfluß durch die Spule zeitlich ändert; z.B. dadurch, daß<br />
sich das Magnetfeld selbst zeitlich ändert. Nun ruft jeder Strom in seiner Umgebung<br />
ein magnetisches Feld hervor; ein Wechselstrom erzeugt in einer Spule<br />
also ein magnetisches Wechselfeld, also ein zeitlich veränderliches Feld, und daher<br />
tritt dabei gleichzeitig in der Spule eine elektromotorische Kraft auf, welche Erscheinung<br />
man als Selbstinduktion bezeichnet. Der vom Stromkreis insgesamt<br />
erzeugte Induktionsfluß 0 ist jederzeit proportional dem Augenblickswert der<br />
Stromstärke 7, also<br />
0 = LI. (8)<br />
Der Faktor L in (8) heißt die Induktivität des Stromkreises und hängt von dessen<br />
Form und Abmessungen ab.<br />
Einheiten: i Henry (H) = io 3 Millihenry (mH) = io 6 Mikrohenry (fiH)<br />
= io 9 Nanohenry (nH) -— io 9 cm.<br />
Für Hintereinanderschaltung (Reihenschaltung) gilt:<br />
L = EL, = L¡ + L2 + ¿3 +, (9)<br />
für Nebeneinanderschaltung (Parallelschaltung)<br />
7-^7 -f+/ +•;-+< <br />
wobei L die Gesamtinduktion der einzelnen Teilinduktionen Lt ist. Die Gleichungen<br />
(7) und (8) gelten nur dann, wenn sich die einzelnen Induktivitäten Lt nicht<br />
gegenseitig beeinflussen.<br />
Wird eine Induktivität (z.B. eine Spule) mit der Selbstinduktion L und dem<br />
OHMSchcn Widerstand R von einem sinusförmigen Wechselstrom der effektiven<br />
Stromstärke I durchflössen, so gilt:<br />
E - / |/>"+ \invLf, t 11 )<br />
wo JE die wirksame (effektive) Wcchsclspannung zwischen den Spulenenden, in<br />
Volt gemessen, und v die Periodenzahl bedeutet. Der Ausdruck mv, also die<br />
Frequenz in m Sekunden, heißt die Kretsfrequenz und wird mit o bezeichnet:<br />
0) — 271V (12)<br />
Ein kennzeichnendes Merkmal vieler Hochfrcqucnzkrcisc besteht darin, daß man<br />
in (11) R gegen (urv-L) 2 vernachlässigen kann. Dann geht (11) über in<br />
E = I-mL. (13)<br />
288
Vergleicht man (13) mit (i), dann versteht man sofort, warum to L als induktiver<br />
Widerstand bezeichnet wird. Der induktive Widerstand ist wegen (12) um so<br />
größer, je größer die Frequenz, je kleiner also die Wellenlänge des hindurchfließenden<br />
Wechselstromes ist.<br />
Kondensatoren (Kapazitäten)<br />
Stellt man zwei Metallplatten isoliert einander gegenüber auf und verbindet die<br />
eine Platte mit dem Pluspol, die andere mit dem Minuspol einer Spannungsquelle<br />
dann bildet sich (hauptsächlich) zwischen den Platten ein elektrisches Feld aus.<br />
Man nennt diese Anordnung einen Kondensator. Die Stärke des elektrischen<br />
Feldes an einer Stelle definiert man durch die Kraftwirkung, die ein bestimmt geladenes<br />
Probekörperchen dort erfährt. Praktisch gibt man die Feldstärke so an, daß<br />
man die Spannung zwischen den beiden Platten durch ihren Abstand in cm dividiert.<br />
Beispiel : sind die beiden Platten auf 2000 Volt gegeneinander aufgeladen und<br />
haben sie einen gegenseitigen Abstand von 2 cm, dann herrscht in dem Raum<br />
zwischen den Platten die Feldstärke 2000/2 = 1000 Volt/cm = 1 kV • cm -1 .<br />
Unter der Kapazität C eines Leiters versteht man das Verhältnis seiner Ladung Q<br />
zu dem Potential V, zu dem er aufgeladen ist:<br />
Nähert man die Platten eines geladenen Kondensators einander, so sinkt die Spannung,<br />
d. h. die Kapazität ist größer geworden.<br />
Einheiten: 1 Farad (F) = 10 6 Mikrofarad (//F)<br />
= 10 12 Picofarad (pF) = 0,9 . io ia cm.<br />
Für Hintereinanderschaltung (Reihenschaltung) gilt:<br />
1 „ 1 1 1 1 . „<br />
= z = + + +, (15)<br />
U L, L-i L-2 O3<br />
für Ncbcncinanderschaltung (Parallelschaltung)<br />
C = 27C£ = C 1 ! + C, + Ca +, (:6)<br />
wobei C die Gesamtkapazität der einzelnen Teilkapazitäten Ct ist.<br />
Die Kapazität eines Plattcnkondensators mit der Plattcnflächc F cm 2 , dem<br />
Plattenabstand a cm und der relativen Dielektrizitätskonstante eT im Dielektrikum<br />
¡st:<br />
F • €<br />
C = —- r cm. (17)<br />
47t a<br />
Durch ganz entsprechende Überlegungen, wie sie oben für Induktivitäten angestellt<br />
wurden, gelangt man für Kapazitäten zur Beziehung:<br />
E = I.~ (18)<br />
289
und nennt, wieder im Hinblick auf (i), —- den kapazitiven Widerstand. Er wird<br />
um so kleiner, je größer o>, also je größer die Frequenz v, je kleiner also die Wellenlänge<br />
X ist. Beispiel: Zwei Geldstücke in der Größe der früheren Fünfmarkstücke<br />
haben bei einem gegenseitigen Abstand von i mm eine Kapazität von etwa 10 pF.<br />
Für eine Welle von 3 m Länge ergibt sich aus obiger Formel ein Widerstand von<br />
nur 160 Ohm. Bei 160 Volt würde also ein Strom von 1 Ampere als Verschiebungsstrom<br />
zwischen den beiden Geldstücken fließen.<br />
Bei den Schwingkreisen der KW-Therapie ist die Kapazität des Kreises meist<br />
nicht eindeutig definiert. Das kommt daher, daß die als Kapazität dienenden Platten<br />
nicht nur Kapazität gegeneinander, sondern auch gegen die Umgebung haben.<br />
Die Gesamtkapazität, die solchermaßen wirksam wird, die man als Betriebskapazität<br />
bezeichnet, hängt um so mehr von der Umgebung ab, je kleiner die<br />
Kapazität der Kondcnsatorplatten gegeneinander ist. Daraus folgt die starke Vcrstimmbarkeit<br />
derartiger Kreise durch die Annäherung von Personen.<br />
Schwingkreise<br />
Schaltet man eine Induktion L, eine Kapazität C und einen Widerstand R zusammen<br />
(ohne Widerstand geht es praktisch nicht), dann erhält man einen<br />
Schwingkreis. Die Eigenfrequenz des Schwingkreises gibt man aus praktischen<br />
Gründen durch die Eigenwellc an:<br />
l^iTt^C-L + i^-J. (i9)<br />
In der Hochfrequenztechnik baut man die Schwingkreise so auf, daß möglichst<br />
R < L, d.h., daß die Maßzahl des Widerstandes klein ist gegen die Maßzahl der<br />
Selbstinduktion; dann kann man in (19) den zweiten Summanden unter der Wurzel<br />
vernachlässigen und erhäit:<br />
l = Z7C \IC • L\ (20)<br />
setzt man in (20) C in cm und L in cm ein, dann ergibt sich X in cm; in dieser<br />
Form ist die Formel sehr leicht zu merken.<br />
Dämpfung<br />
Werden in einem Kreise Schwingungen angestoßen und wird der Schwingkreis<br />
dann sich selbst überlassen, so klingen die Schwingungen ab. Die Schwingungen<br />
eines elektromagnetischen Kreises bestehen ja darin, daß dauernd elektrische<br />
Energie in magnetische umgewandelt wird, indem sich der Kondensator über die<br />
Spule entlädt und selbst wieder aufgeladen wird usw., wozu es nötig ist, daß<br />
Strom durch einen Leiter fließt. Nun hat jeder Leiter einen Widerstand, und daher<br />
wird dauernd Strom in Wärme verwandelt; eine Rück Verwandlung von Wärme in<br />
Strom findet aber nicht statt, so daß bald alle elektromagnetische Energie in<br />
Wärme verwandelt ist und die Schwingung erlischt. Betrachtet man die aufein-<br />
290
anderfolgenden Amplituden der Schwingung, so findet man, daß jede etwas kleiner<br />
ausfällt als ihre Vorgängerin; das Verhältnis zweier unmittelbar aufeinanderfolgenden<br />
Amplituden heißt die Dämpfungsziffer d:<br />
-~ = -~ = d\ (21)<br />
sie ergibt sich für irgend zwei aufeinanderfolgende Schwingungen immer gleich,<br />
ist also für einen gegebenen Schwingungsvorgang konstant. Den natürlichen<br />
Logarithmus der Dämpfungsziffer nennt man das logarithmischc Dekrement der<br />
Dämpfung, oder kürzer, das Dämpfungsdekrement &;<br />
log nat —- = log nat-"—"•• • = &. (22)<br />
Eine nähere Betrachtung ergibt für das Dämpfungsdekrement §• folgende Beziehungen,<br />
die zur Berechnung von # aus den Daten des Schwingkreises dienen:<br />
_ RW 1 nroil/^ 1 CR j XR . ,<br />
* = Tm'j = n • R )/m = TÏT • ^H = ^7 • -ir- (23)<br />
In den Gleichungen (23) bedeutet RP, daß der Widerstand in Ohm einzusetzen ist,<br />
U"l, daß die Selbstinduktion in Henry einzusetzen ist usw.<br />
In den Formeln (23) tritt als Dämpfungswiderstand nur der OHMSCIIC Widerstand<br />
R auf, dies gilt für den Grcnzfall des geschlossenen, nicht strahlenden<br />
Schwingkreises, der praktisch nur bei langen Wellen zu realisieren ¡st. Bei kurzen<br />
Wellen strahlt auch der «geschlossene» Schwingkreis Energie aus, wodurch eine<br />
zusätzliche Dämpfung, die Strahlungsdämpfung, auftritt. Der offene Schwingkreis,<br />
die Antenne, strahlt bei allen Wellenlängen.<br />
Einen Schwingkreis ohne Dämpfung gibt es nicht. Aber eine Schwingung mit<br />
konstanter Amplitude kann man leicht herstellen, indem man genau soviel Energie<br />
zuführt, wie durch die Dämpfung insgesamt verlorengeht; man spricht dann von<br />
ungedämpften Schwingungen.<br />
Das elektrische Feld<br />
Zwischen Trägern unterschiedlicher elektrischer Ladungen bildet sich ein elektrisches<br />
Feld aus. Dieses Feld hat eine Richtung und eine Größe, ist also ein Vektor<br />
und wird durch Feldlinien veranschaulicht, die beide Ladungen verbinden.<br />
Abb. 203 zeigt die von einer positiv geladenen Kugel in einem geerdeten Raum<br />
ausgehenden elektrischen Feldlinien, Abb. 202 das Feld in einem Plattcnkondcnsator.<br />
Wir betrachten hier nur das Feld des Kondensators, wobei dieses als homogen<br />
(gleichmäßig auf die Plattcnflächc verteilt) angenommen wird.<br />
Die Einheit der elektrischen Feldstärke ß ist 1 Volt/cm und ergibt sich aus der<br />
Definition, daß (S proportional der angelegten Spannung U und umgekehrt proportional<br />
dem Plattcnabstand d ist:<br />
e = •?. (24)<br />
291
Bringt man in das Feld eine Ladungjg, so wird eine Kraft in Richtung der Feldlinien<br />
auf diese ausgeübt:<br />
* = £.(£. IO.Z kg, (2j)<br />
wobei Q in Coulomb (Amperesekunden), (£ in Volt/cm gemessen werden.<br />
Setzt man für Q die Elemcntarladung (Ladung eines Elektrons bzw. Ladung<br />
eines Ions mit einer freien Ladung), so erhält man die Kraft, die im elektrischen<br />
Feld auf diese ausgeübt wird.<br />
+ o<br />
Abb. 202 Abb. 203<br />
Elektrische Elemcntarladung:<br />
e = 1,60 • io" 19 Coulomb (Amperesck.). (26)<br />
Entsteht zwischen den Platten eines Kondensators, dem die ElektrizitätsmengeQ<br />
(Coulomb) zugeführt wurde, die Spannung U(Volt), so ist seine Kapazität:<br />
C =* Qj in Farad (F).<br />
1 Farad ist eine sehr große Maßeinheit, man nimmt deshalb Bruchteile:<br />
(*7)<br />
1 Farad = io 8 Mikrofarad (F),<br />
= io 12 Picofarad (pF), (28)<br />
— 0,9 • io 12 cm.<br />
Auf dipolare Moleküle, bei denen die Ladungen nicht mit ihrem Schwerpunkt<br />
zusammenfallen, übt das elektrische Feld ein Drehmoment aus, um ihre elektrische<br />
Achse in Richtung der Feldlinien zu drehen. Wenn /die Entfernung der beiden<br />
entgegengesetzten Ladungen des Moleküls, Q die Größe einer der beiden Ladungen,<br />
© die elektrische Feldstärke und ip der Winkel, den die Achse gerade mit der<br />
Richtung der Feldlinien bildet, ist, so beträgt das Drehmoment:<br />
M = 1 • Q • (5 • sin y) • 10,2 in cmkg<br />
292<br />
1 in cm<br />
Q in Coulomb<br />
CS in Volt/cm<br />
(29)
Dielektrika<br />
Wir haben bisher stillschweigend angenommen, daß zwischen den Platten des<br />
Kondensators sich Luft befindet. Luft ist ein sehr dünnflüssiger Stoff und verhält<br />
sich hier kaum anders als das Vakuum. In der KW-Therapie hat man jedoch den<br />
Fall, daß zwischen den Platten eines Kondensators lebende Substanz als «Dielektrikum»<br />
wirksam ¡st. Diese läßt sich näherungsweise auffassen als ein Dielektrikum,<br />
das aus einzelnen Schichten aufgebaut ist, so zwar, daß diese Schichten untereinander<br />
verschiedene Dielektrizitätskonstanten und verschiedene Leitfähigkeit<br />
besitzen, Ein solcher Stoff entzieht dem elektrischen Feld zwischen den Kondensatorplatten<br />
Energie, und zwar auf dreierlei Weise:<br />
i. An den Grenzflächen zwischen den einzelnen Schichten des Stoffes bilden<br />
sich im elektrischen Feld Ladungen aus; da wir ein Wechselfeld haben, müsssen<br />
diese Ladungen, also Elektrizitätsmengen, fortwährend hin- und hergeschafft<br />
werden; dies geht unter Wärmeentwicklung vor sich, die dazu nötige Energie<br />
muß das elektrische Feld liefern. Je nach der Art der einzelnen Schichten fällt die<br />
Wärmeentwicklung verschieden aus, sie kann z.B. innen größer sein als in den<br />
äußeren Schichten.<br />
2. Die lebende Substanz hat eine gewisse Leitfähigkeit. Ein Teil der an den<br />
Grenzflächen auftretenden Ladungen wird sich also durch gewöhnliche Stromleitung<br />
ausgleichen, und auch damit ist Wärmeentwicklung verbunden.<br />
3. Bei den hohen Frequenzen, deren sich die KW-Therapie bedient, tritt schließlich<br />
noch eine dritte Art von Verlusten auf, die ihre Ursache in molekularen Vorgängen<br />
hat. Bei den Nichtleitern sind die positiven und die negativen Bestandteile<br />
der Molekeln elastisch aneinander gebunden; da sie eine gewisse Masse haben,<br />
kommt ihnen auch eine Eigenschwingung zu. In einem äußeren, elektrischen Feld<br />
erfahren sie eine Verschiebung, deren Größe zunächst von der Feldstärke abhängt;<br />
kommt das Wechselfcld aber mit der Eigenschwingung der Molekelbcstandtcilc<br />
in Resonanz, dann treten besonders große Bewegungen auf, d. h., es<br />
wird Wärme entwickelt; natürlich wiederum auf Kosten des elektrischen Feldes.<br />
Eine genauere Behandlung würde über den Rahmen dieses Buches hinausführen<br />
; für einen ersten Überblick mögen folgende Berechnungen dienen, die sich<br />
auf die beiden ersten Arten der Umwandlung von elektrischer Energie in Wärme<br />
beziehen.<br />
Zwischen den Platten eines Kondensators mit der Fläche q und dem Abstand a<br />
sei ein Körper mit der Dielektrizitätskonstanten eT und der Leitfähigkeit x. Dann<br />
hat der Körper den Widerstand<br />
R = .*--, fco)<br />
durch den ein Teil des Stromes fließt. Der andere Teil fließt durch die Kapazität<br />
des Kondensators; letztere ¡st<br />
4?ca<br />
Der Gesamtstrom, der durch den Körper fließt, setzt sich zusammen aus Leitungsund<br />
Verschiebungsstrom, er ist<br />
Iges = /( + /„. (32)<br />
293
Man kann nun berechnen, daß im Dielektrikum (im Körper) bei gegebenem Gesamtstrom<br />
I dann am meisten Wärme erzeugt wird, wenn ^ = 7„ wird; dies ist<br />
dann der Fall, wenn der Widerstand R ebenso groß ist wie der kapazitive Widerstand,<br />
wenn also gilt:<br />
R = - ^ . (33)<br />
Setzen wir nun, um zu sehen, bei welcher Leitfähigkeit diese Bedingung erfüllt ist,<br />
die Gleichungen (30) und (31) in (33) ein, dann erhalten wir:<br />
also<br />
a l 47id<br />
K t=r. = ——- = —, (34)<br />
Xp Ü)C Z7lVErp w ^<br />
zx<br />
v=—-- (35)<br />
Bei geschichteten Stoffen ¡st die Erwärmung in der Schicht am größten, für die die<br />
Bedingung (35) am besten erfüllt ist.<br />
Bei der gewöhnlichen Diathermie ¡st die Frequenz etwa V100 der bei der KW-<br />
Therapie verwendeten, der kapazitive Widerstand ist also etwa 100mal größer; die<br />
Gleichung (33) ist dann auch nicht annähernd zu erfüllen, der Leistungsverbrauch<br />
und damit die Wärmeentwicklung im Dielektrikum, also im behandelten Körperteil,<br />
bleibt gering.<br />
Leistung und Wirkungsgrad<br />
Die in der KW-Therapie nötigen Leistungen liegen zwischen 50 und 500 Watt ;<br />
das ist die dem Körper in Form von Hochfrequenz zugeführte und in ihm in<br />
Wärme umgesetzte Leistung.<br />
Wenn man Strom, Spannung und Phasenwinkel kennt, kann man die Leistung<br />
berechnen. Da aber die Schwingkreise bei sehr kurzen Wellen oft nicht mehr als<br />
quasi-stationär anzusehen sind, ergeben sich bei der Berechnung leicht große<br />
Fehler, zumal sich der Widerstand R aus allen Verlusten zusammensetzt. Es ist<br />
daher am besten, wenn man die Betriebsleistung mit dem Kalorimeter bestimmt.<br />
Dazu mißt man die Erwärmung, die eine bestimmte Wassermenge in einer bestimmten<br />
Zeit erfährt. Es gilt:<br />
N=ESJ^m. (J6)<br />
0,24 . / " '<br />
In (36) bedeuten : Wdie Wassermenge einschließlich des Wasserwertes des Kalorimeters;<br />
?*! und Tz die Temperaturen des Wassers vor bzw. nach der Erwärmung,<br />
/ die Zeit in Sekunden und N die Leistung in Watt. Die so gemessene Leistung<br />
steht dann für die Behandlung zur Verfügung, wenn man die Kopplung stets<br />
optimal einstellt.<br />
Aber auch die soeben beschriebene Leistungsmessung ist praktisch nicht gerade<br />
einfach durchzuführen. Die dem Netz entnommene Leistung ist natürlich wesentlich<br />
größer; bei 50 bis joo Watt Nutzleistung kann man mit einem Wirkungsgrad<br />
von etwa 20% rechnen.<br />
294
Tabelle 2. DK e und Leitfähigkeit x tierischer Gewebe bei 20 o und 37 o nach OSSWALD.<br />
Gewebe<br />
Muskel<br />
Leber<br />
Milz<br />
Niere<br />
Gehirn<br />
Bauchspeicheldrüse <br />
Fettgewebe <br />
Knochenmark<br />
Blut<br />
Serum<br />
Lunge<br />
Galle<br />
t°<br />
20<br />
37<br />
20<br />
37<br />
2D<br />
37<br />
20<br />
37<br />
20<br />
37<br />
20<br />
37<br />
20<br />
37<br />
20<br />
37<br />
20<br />
37<br />
37<br />
20<br />
37<br />
20<br />
3 m<br />
7'<br />
69-7;<br />
73,3<br />
71-76<br />
7Î<br />
7U-7Î.Î<br />
78<br />
76-79<br />
89<br />
BB-90<br />
100<br />
100-101<br />
8}.J<br />
SJ-B4<br />
89.!<br />
87-9;<br />
7M<br />
70-75<br />
Si,)<br />
K1-S3<br />
61<br />
ÎI-71<br />
67<br />
6o-6j<br />
7Î<br />
72-73,5<br />
74<br />
73-76<br />
E<br />
6 m<br />
»5<br />
83-89<br />
85-97<br />
«i<br />
85-90<br />
90<br />
88-93<br />
116<br />
iií-117<br />
• 37<br />
135-140<br />
" 5<br />
riö-izo<br />
127<br />
119-132<br />
95<br />
92-99<br />
111<br />
110-114<br />
89<br />
8J-5J<br />
96<br />
94-97<br />
12<br />
li-ij<br />
7.3<br />
6,8-7.7<br />
86<br />
83-87<br />
89<br />
»S-pi<br />
82<br />
76<br />
27-50<br />
3*<br />
12 m<br />
96<br />
91-100<br />
108<br />
105-115<br />
1 22<br />
iso-123<br />
'37<br />
136-158<br />
20;<br />
198-114<br />
S-2O0<br />
zaa<br />
>!00<br />
140<br />
156-143<br />
160<br />
140<br />
»5J-MÍ<br />
158<br />
I2D<br />
"5-125<br />
I40<br />
130-Jjo<br />
_<br />
Grad<br />
ú m<br />
0,4<br />
0,4<br />
1,1<br />
0,6<br />
1,1<br />
0.5<br />
o.l<br />
-0.4 i<br />
-0.35<br />
N F<br />
0.9<br />
0.7-*, 5<br />
1<br />
0.7-}<br />
'.5<br />
O.S-2.Ú<br />
1.2<br />
0,7-1,9<br />
1.2<br />
0,7-1,6<br />
',4<br />
'"3<br />
0.7<br />
0,16-0,77<br />
0,9<br />
o.75->,3<br />
1,1<br />
0,9-1.3<br />
LT<br />
1,5-1,9<br />
1,6<br />
0,9-3,0<br />
1.3<br />
07.-Ï.4<br />
0.2Û<br />
0,1-0,4<br />
0,4<br />
O,JS-O,Í<br />
o,iG<br />
0,14-0,19<br />
0,22<br />
0,17-0,25<br />
5.1<br />
4.9-5.7<br />
7.3<br />
6,6-8,<br />
12<br />
ii-il<br />
16<br />
14-18<br />
0,4 -1,2<br />
12,8<br />
•6.7<br />
x-io^iß-'cm- 1 }<br />
3 m Gm 11 m<br />
5<br />
4.S-Í.Í<br />
6,1<br />
5,6-6,5<br />
6,8<br />
6,8<br />
S. 3<br />
S-î-8,4<br />
4.3<br />
3.8-4,5<br />
5.4<br />
í.'-í.7<br />
6,8<br />
6,4-7,9<br />
8,4<br />
6,9-11<br />
f<br />
5.9<br />
5-7<br />
8,1<br />
6,8-8,5<br />
4fi-4.9<br />
5-5<br />
5.1-5.8<br />
6.4<br />
6,3-6,5<br />
4.1<br />
3,9-4,1<br />
5.'<br />
4.8-J.Î<br />
4<br />
5.4<br />
4.1-5,9<br />
0,36<br />
o.2 3-o,45<br />
0.5<br />
°A-°,fi<br />
0,20<br />
oj 9-0,24<br />
0,27<br />
0,2O-0,í!<br />
7,5<br />
6,7-8,5<br />
11<br />
IO-IJ.J<br />
1!<br />
1.8-2,4<br />
1.9<br />
1.2-3.9<br />
•3.1<br />
'7<br />
4,o<br />
3.9-4.'<br />
5.1<br />
4.8-5.4<br />
J,7<br />
5.3-6<br />
4.9<br />
4.Í-J.4<br />
4.5<br />
mi<br />
(6m)<br />
6,-<br />
8,1<br />
5.»<br />
4.&<br />
5.3<br />
5.!<br />
9,5<br />
9,3<br />
3,7<br />
4<br />
3<br />
1.38<br />
',15<br />
1,22<br />
1,44<br />
1.52<br />
1<br />
1<br />
1,02<br />
1,0!<br />
Axj<br />
Grad<br />
Um sich ein ungefähres Bild der Spannung an einem Punkt des Schwingungskreises zu<br />
machen, kann man sich des folgenden Verfahrens bedienen* : Man lötet an den Fußkontakt<br />
einer kleinen Glühlampe (4-12 Volt) einen etwa ij cm Jangen Draht von 1 mm<br />
* Ich verdanke dieses Verfahren einer Mitteilung von Herrn KUMMERER (Tclefunken)<br />
295<br />
%<br />
(6 m)<br />
2,5<br />
2<br />
1.5<br />
i,6<br />
".4<br />
Í<br />
1.5<br />
1<br />
2.7<br />
'.97<br />
1.5<br />
i,8
Durchmesser an, der mit seinem freien Ende in Kontakt mit dem Schwingungskreis gebracht<br />
wird.<br />
Vom Fußkontakt fließt dann ein Strom durch den Glühfaden zum Gewinde der Fassung<br />
und von da kapazitiv zur Erde bzw. den umliegenden Wänden. Die Stromstärke kann,<br />
dadurch geschätzt werden, daß man ein zweites gleichartiges Lämpchcn mit Gleichstrom<br />
auf gleiche Helligkeit einreguliert und den durchfließenden Strom mißt. Die Stärke dieses<br />
Stromes hängt u.a. ab vom Kapazitätswert dieses Gewindes, gegen Erde, der bei Zwcrglämpchen<br />
etwa 0,4 cm beträgt. c<br />
Der kapazitive Widerstand kann berechnet werden nach der Formel : X = 480 — (ß),<br />
À<br />
wobei X die Wellenlänge, C die Kapazität in Zentimeter bedeutet. Dies ergibt bei einer<br />
Kapazität von 0,4 cm und einer Wellenlänge von 6m:^= 480 • — = 7200 Q,<br />
Ist der Strom / bekannt, so muß auf Grund des OuMSchen Gesetzes die zu messende<br />
Spannung U betragen: U ~ 1 • X.<br />
Haben wir beispielsweise durch unseren photometrischen Vergleich mit dem anderen<br />
Lämpchen einen Strom von ijo mA gemessen, so ergibt sich für die Spannung:<br />
U = —L- . 7200 — 1080 Volt. Unter Berücksichtigung der Plattcngröße und des Platten-<br />
1000<br />
abstandes läßt sich hieraus die Feldstärke E leicht bestimmen. Durch geeignete Tabcllcnoder<br />
Kurven läßt sich dieses Verfahren in jedem Fall leicht und schnell ausführen.<br />
Geräte, welche die Erwärmung irgendeines Stoffes im Kondensatorfeld unmittelbar<br />
messen, haben stets den Nachteil, daß sie das Feld verzerren und sich selbst mehr oder<br />
weniger stark erwärmen und dadurch falsche Werte ergeben.<br />
X. Regeln bei <strong>Kurzwellentherapie</strong><br />
1. Lagerung: Möglichst bequem, entspannt.<br />
2. Tuch: Keine Metalltische oder -stuhle. Holzmöbel mit möglichst wenig Nägeln.<br />
Als Unterlage keine Halbleiter, wie feuchte Stoffe, alte Gummitücher. Kein<br />
Wachstuch.<br />
3. Kleidung: Kranke möglichst entkleiden. Mctallsachen an Kleidungsstücken entfernen.<br />
An Kleiderfalten verdichtet sich das Feld!<br />
4. Patient: Vorher fragen, ob Gefühlsstörungcn bestehen, evtl. darauf untersuchen.<br />
Aufmerksam machen, daß keine unangenehme Hitze entstehen darf.<br />
Unangenehme Gefühle während der Behandlung müssen sofort gemeldet<br />
werden. Feuchte Stellen (Wunden, Verbände, Fisteln, Schweiß, Blut) verdichten<br />
das Feld. Dort leicht Brennen. Deshalb vorher trocknen. Abstand!<br />
j. Kabel: Kabel sollen nirgends aufliegen, möglichst frei hangen.<br />
6. Elektroden: Größe je nach Krankheitsherd. Am Rumpf im allgemeinen größere,<br />
an Extremitäten kleinere Elektroden. Absolute Tiefendosis wächst mit Elektrodengroßc.<br />
Keine Feuchtigkeit unter den Elektroden. Möglichst keine Stoffe<br />
zwischenlegen, höchstens etwas dünnes Papier.<br />
Bei kleinen Elektroden ist die Felddichtc groß ; deshalb Gefahr der örtlichen<br />
Überdosierung.<br />
7. Tiefenbehandlung: Große Elektroden abstände zur Erzielung gleichmäßiger<br />
Tiefendurchwärmung, besonders auch bei Unebenheit der Oberfläche. Bei zu<br />
geringem Abstand oft stechende Wärme durch Unebenheiten der Oberfläche<br />
und Feuchtigkeit.<br />
296
Abstände: Extremitäten quer: 2-3 cm, längs 1-3 cm.<br />
Stamm: 4-6 cm. Bei fetten Patienten mehr. Kopf 3-6 cm.<br />
Je größer der Abstand, desto besser die Entlastung der oberflächlichen<br />
Schichten und damit die relative Tiefenwirkung. Bei zu großem Abstand<br />
wird jedoch die Ausstrahlung zu groß, und damit wachsen die Verluste.<br />
Im allgemeinen: Je tiefer der Krankheitsherd und je dicker die Fettschicht,<br />
um so größer der Abstand. Bei .dünnen Gliedern geringer Abstand. Vorstehende<br />
Teile anbinden oder mit dem Elektrodcnschuh andrücken.<br />
8. Unsymmetrische Einwirkung: Soll die Wirkung an einer Körperseitc verstärkt<br />
werden, so wird dort der Abstand verringert (Abszesse, Wunden).<br />
9. Verstärkte Wirkung auf kleine Flächen oder in Vertiefungen (Achsel, Leistenbeuge<br />
usw.) durch Verkanten der Elektroden oder gekrümmte Elektroden.<br />
10. Sog. monopolare Behandlung nur an Oberflächen.<br />
11. Bei Schweiß kann etwas Fließpapier aufgelegt werden.<br />
12. Schmiegsame Elektroden: Lagerung des Kranken auf schmiegsamen Elektroden<br />
ist unzweckmäßig wegen Wärmestauung. Lieber Abstandselcktrodc unter dem<br />
Holztisch oder Spezialelektrode.<br />
13. Am Kopf keine schmiegsamen Elektroden anwickeln (Wärmestau). Zwecks<br />
Tiefenwirkung freier Luftabstand der Elektroden ohne Berührung des Glases<br />
mit dem Körper. Achtung auf vorstehende Teile (Nase, Ohren)!<br />
14. Spulenfeld nur bei Extremitäten. Flachspule bei oberflächlichen Prozessen. Bei<br />
den meisten Apparaten Zusatzspule nötig.<br />
ij. Abstimmung: Es darf nur bei Resonanz behandelt werden. Bei jeder Behandlung<br />
muß neu abgestimmt werden. Resonanzanzeiger beobachten (evtl. Glimmlampe).<br />
Abstimmknopf hin- und herdrehen, bis Maximum eingestellt ist. Läßt<br />
sich kein Maximum erzielen, so muß die Eigenfrequenz des Kreises verändert<br />
werden (S. 14).<br />
16. Dosierung: Individuell verschieden. Je akuter die Krankheit, desto geringer die<br />
Dosis.<br />
Dosis I: Eben unter der Empfindungsschwelle. Feldstärke bis zur eben<br />
fühlbaren Warme, dann die Heizspannung etwas zurückdrehen.<br />
Dosis II: Eben fühlbare Wärme.<br />
Dosis III: Angenehmes Wärmegefühl.<br />
Dosis IV: Noch erträgliches Hitzegcfühl.<br />
Bei akut fieberhaften Prozessen Beginn mit 2-j Minuten, allmählich je nach<br />
Verträglichkeit steigern. Akute Krankheiten, insbesondere eitrige Entzündungen,<br />
täglich behandeln. Chronische Erkrankungen mit starken Dosen, länger<br />
und seltener (2- bis 3mal wöchentlich) behandeln.<br />
In Zwcifelsfällcn mit täglicher schwacher Dosis und 3-5 Minuten anfangen,<br />
später steigern und seltener behandeln.<br />
Verlauf der Behandlung<br />
17. Wärmegefühl: Man soll den Patienten wiederholt nach dem Wärmegefühl<br />
fragen. Es ist oft im Anfang, besonders bei kalter Haut, nur sehr gering und<br />
nimmt dann später zu, so daß unter Umständen zurückreguliert werden muß.<br />
Besonders bei kalter Haut kann ein Schmerzgefühl in der Tiefe (ohne Wärmeempfinden)<br />
auftreten, das zum Zurückdrehen der Energie mahnt.<br />
297
i8. Erhaltung der Resonan^; Es ist dafür zu sorgen, daß die Elektrodenabstände<br />
gleich bleiben (evtl. Lagerung durch Sandsäcke u.dgl.).<br />
Die richtige Einstellung kann durch Leuchtröhrchen, oder besser Glimmlampen,<br />
kontrolliert werden. Die Lampen sollen an den Elektroden am stärksten<br />
leuchten.<br />
Während der Behandlung muß von Zeit zu Zeit die Abstimmung kontrolliert<br />
werden (Glimmlampe oder Instrument).
Schrifttum<br />
Kursiv: Monographien. Kürzungen: A.p.M. = Archives of physical Medicine;<br />
A. ph. T, = Archiv für physikalische Therapie ; A. P. T. = Archives of physical Therapy ;<br />
X-Ray = Radium; Brit, Jl. Ph. M. = The British Journal of Physical Medicine ; D.M. W. =•-<br />
Deutsche Med. Wochenschrift; E.T.Z. — Elektrotechnische Zeitschrift; Hf. u. Elektroak.<br />
= Hochfrequenz u. Elektroakustik; Fortschr. Ro. = Fortschritte der Röntgenstrahlen;<br />
M.M.W. ; — Münchner Med. Wochenschrift; Strahl. = Strahlentherapie; Wien.<br />
M. W. = Wiener Med. Wochenschrift ; Wien. Kl. W. = Wiener klinische Wochenschrift.<br />
ACCARDO : Diagnost. (Ital.) 1936 (Genitale). - ADAMI : Boll. Soc. It. Biol. Sper. 7,1940.-<br />
ADLER: Am. Jl. Ph. Med. 34, S. 521,1955 (Endokrin). - AGANFORA: Arch, di Radiol. i6,<br />
5. 18;, 1940.-AGNOLI und VALLEBONA: Boll. Marcon. Med. II, S.7,1935. Ders.: Radiol,<br />
e Fis. Med. z, fase. 2, 1935, S. 3, Ï937. - Ders.: Boll. Marcon. Nr. 1, 1935. Gaz. d. Ospedali<br />
c dclle Cliniche, Nr. 14, 1935. Radiol, e fis. Med. 265, 1935. - Ders,: und AGOSTA:<br />
Arch. Ital. d¡ Chir., Bd. 43, S.389. - ALB: Diss. Zürich 1940 (Provokat. Herdinfekt.). -<br />
ALDERSON: Arch, Dermat. (Amer.) 32, 8.469, 1935. - ALM: Einführung in die Mikrowcllentherapic,<br />
Berlin 1937- -ALM: .REIMERS: Dtsch. med J. 4 164, 1953. - ALPERN und<br />
S0LODUOKK0: Trydy. Inst. Med.-cxper. Ukraine 217, S.26, 1940 (Desensibilisierung). -<br />
ALSENBERG: Akus. i. Ginck. 5, S. j6,1940 (Gynäk.).-AMANO: jap. I. Med. Sei. Biophys.<br />
6, S. 13,1940 (Katalase). - AMERICO VALERIO : II. de Syph. et Urol. S. 198,1937. - ANSEL-<br />
MINO und HOFFMANN: Kl. W. S.2380, 1931. Z. Exp. Med. S.305, 1934. - ANTOGNETTI:<br />
A. ph. T. 2, S. 309, 1950 (Harnsteroidc). - APEL: Diss. Jena 1938 (Blutdruck). - ARAKI:<br />
Nagasaki Igakki Zassi 14, 1936 (Gynäk.). - ARCURI: Rass. Ital. Ottalm. 9, 232, 1940<br />
(Augen). -üiTJ\;Radiotcr. e fis. med. 8, S.239,1943. - ARONS, I& SOKOLOFK, B. Am. II.<br />
Surg 36, J93 1937 (Tumor) - ARPIÑO: Fol. med. (Napoü) 26, S.808,1940 (Sperma). -<br />
ASCOLI: Rif. Med. 20,1920. - AUCLAIR: Soc. Rad. Med. Fr.zo,S. 587,1932(Hypcrthcrm.).-<br />
Ders. und DROUET: Bull. Mém. Soc. Rad. Med. Fr. 1932. - Ders. und HALPHEN: Int.<br />
Rad. Kongr. Zürich 1934. - AUDIAT: Rcv. d'Actinol. et de Physiothérapie S. 227, 1932<br />
(Neurol.). - AYERZA und MULCAHY: Arch. Argent. Enfcrm. 12, 1937 (Lunge).<br />
BABIER CHEVAYE: I thèse, Paris 1933 (Applikat). - BACCARONI: Otorinolaringoiatria<br />
1938, S.84. - BACHEM: A. P. T. 2i, S.197, 1940 (KW u. Diathermic). - BADAINES und<br />
BARNARD: Med. Bull. Veteran Administr. 17, S.31, 1941. - BAKARDIJEW: Physikal.<br />
Therapie, Sofia 1950. - BALDI: Boll. Soc. Ital. Biol. Sper. 13, S.i, 1938; ibid. S.867. -<br />
BALDWIN und NELSON : Proc. Soc. Exp. Biol. 26, S. 5 88, 1928 (Histologic). - BALESTRA :<br />
Atti II. Congr. Marcon. Vcnczia 1936 (Lunge). - Ders. e PICCONE: Il.Congr. Marcon.<br />
Venezia 1936 (Ovar).-BALLICO: Arch. Ital. Dcrmat. 16, S.212,1941 (Go.).-BARNACLE:<br />
Jl. Am. Med. Assoc. 106, 8.2046,1936 (Chorea). - Ders., EBAUGH und EWALT: Jl. Am.<br />
Med. Assoc. 107, S.1031, 1936. - BARTH: Arch. phys. Ther. 5, S.217, 1953. Automat.<br />
Resonanz. - Ders.: A. p. T. 5, S. 217, 1953 (Resonanz). - Ders. und THOM: Z. angew.<br />
Bädcrklimahk. 1, S. 401, 1954. - Ders., THOM und KEBBEL: Elcktromcd. 2, S.179,<br />
1957. - Ders. und HEINZE: Strahlentherapie 103, S. 546, 1957. - BARTH, LEHMANN,<br />
ScHOENEFELD und WACHSMANN: Fiebcrbchandlung. D. M, W. 74. Jahrg., S. 1584. -<br />
BAUER: Arch. Verdau. 58, S.239, 1935 (Magen). - BAUMEYER: Strahl. 62, S.373, 1938<br />
(Tumor). - BAUMGART: Zbl. Chir. S.1940, 1937 (Analfistel). - BAUWENS: A. P. T. 21,<br />
Z.80, 1940 (Techn.). - BAZETT: Jl. Am. Med. Assoc. 97, 1931. Phys. Rev. 531,1937. -<br />
BEERENS und REMOUCHAMPS: Cpt. ren. Soc. Biol. 16, 8j, 1935 (Tbc). - BEERMANN,<br />
HIRSCHFELD, EPSTEIN, PAUL: Californ. u. Wester Med. 40, S. 177, 1934. - BELL und<br />
FERGUSON: U. S. Nav. Med. Bull. 29, S.52Î, 1931. A. P. T. 10, S-477, 1931. Z. Phys.<br />
Thcr. S.66, 193a. - BELT und FOLKENBERG: A. P. T. 21, S.203, 1940 (Go.). - Dies.:<br />
A. P. T. 21, S.203, *94* (Go.). - BENASSI: Arch. Pat. c Clin. Med. 1936, vol. 5, fase. 2.<br />
Boll. Marcon. Nr. 3, 1937. Congresso di Marcon. Bologna 1938 (Lungenabszeß). -<br />
Ders. und MIGAZZO: Ann. Radiol. 42, S.1917, 1934. - BENNETT: Jl. Am. Med. Ass.<br />
299
I07, S.845, 1936. - Ders.&L AUSTIN: A. P. T. 1938. - Ders.&L HUSER& KRUSEN: Am, Jl.<br />
Heart 21, S.490,1941. - Ders. & LEWIS: JI. Ncrv. Dis. 92, S. 202,1940 (Mult. Sklerose). -<br />
BERGAMI: Accad. Med. Lombard. 1935 (Biol.). - BERGER & BRECHER: Wien. KL. W. II,<br />
S. 1129.1938. -BERGH& KRARUP: Act. Med. Scand. Suppl. 90, S. 338,1938. -BERLCTTO:<br />
Fol. Gyn. (Genova) 33, S. 303,1936. (Metropathic) -BERNHARD; D. M. W. 75,600,1950<br />
(Provok). - BERRY: Brit. Jl. Phys. M. 9, S. 137, 1934. - BERTALAN & v. BODO: Z. Gyn.<br />
1942, S. 1550,1942 (Hypophyse).-BERTOLOTTO: Folia Gyn. 1938,1939. AttiSoc.lt. Ost.<br />
Gin. 2, 1938; 3, 1940 (Uterus, Gravidität). - BERUTTI; Ginecol. Nr. 12, 1935 (Sterilität);<br />
ebd. 1936. - BESANCON & JECQUELIN; Pyrctotherapie. Quebec, 1934, Masson. - BESSE-<br />
MANS: Med. Welt 52, 8.1858, 1938. Brit. J. Ven. Dis 14, S.71, 1938 (Lues). D. M. W.<br />
1938, Act. Brcv. NécrI. Phys. 1940, 10, S.211 (Tcmp.). - Ders. & VAN THIELEN: Strahl.<br />
70, S.352, 1941 (Temp.). - Ders.&L CANNEYT: Arch. d'Ophthalm. 3, S. 18, 1939. - Ders.<br />
& VAN MEtRHAEGE: Rcv. Belge Sei. Med. 14, S. 339,1942 (Tcmp.). - Ders., RUTGERS &<br />
VAN THIELEN: C. r. ac. sei. 202, S. 157,1936. - Ders. & VAN THIELEN: Act. Brcv. Néerl.<br />
Physiol. 10, S.2II, 1940. Vlaamsch. Gencesk. Tijdschr. 1938. Strahl, 70, S.352, 1941. -<br />
BiAHCHi: Boll. Marcon. Nr. 1,1936. - BIANCHI und CIGNOLINI: Marconi terapia (Milano<br />
1936). - BIANCO: Arch. Radiol. Napoli 9, S.247, 1952. - BIDDAU: PoHclinico infantile<br />
S. I6J, 1936 (Niere). - BIEBER: Diss. Würzburg 1944 (Coronarinfarkt), - BIERMAN:<br />
A. P. T. 13, S.389,1932. Intern. Clin. (Am.) 3, S.73, 193a. - Ders.ik FISHBERG: Jl. Am.<br />
Med. Ass. 103, S. 13/54, 1934. - Ders.&L HOROWITZ: Rep. y th. Ann. Fever Conf. S.30,<br />
*935- jl- Am. Med. Ass. 104, S.1197, 1935, N.Y. Jl. Med. 33, S.218, 1933 (Hyperthermie).<br />
- Ders. & SCHWARZSCHILD: Proc. Soc. Exp. Biol. a. Med. 29, S.439, 1952<br />
(Hyperthermic). - Ders. Sc VERSELL: Rep. j. Ann. Fever Congr. S. 32, 1935. - BINET:<br />
Rapp. JI. Congr. Franc, thér. 1933 (Hyperthermic). - Ders., LAUDAT, AUCLAIR: Presse<br />
Med. 42, S. 1917, 1934- - BiRKNER & WACHSMANN: Strahlenther 79, 93, 1949 (Tumor)<br />
BISHOP, LEHMANN, WARREN: Jl. Am. Med. Ass. 104, S.910, 1935. - BITTEVIN: Congr.<br />
int. clectr. Paris Nr.8, 1932. - BLATT und NEYMANN: RCV. (Am.) 18, 1938. - BOAK,<br />
CARPENTER, STRAFFORD, WARREN: Jl. Exp. Med. S.725, 1932.-BOCCHI: Boll. Marcon<br />
1936 (Frakturheilung). - v. BODO: Zbl. Gyn. S. 1550, 1942 (Hypophyse). -BORNER:<br />
Dtsch, Elcktrotcchn. 10, S. 173, 1956. - BOLTZ: Diss., Freiburg 1940 (Tumor). -<br />
BORDIER: Jl. Radiol, et Electr. 16, S. 261, 1932. Am. Jl. Phys. Ther. 9, S.92,1932. Arch.<br />
d'Electr. Med. 40, S.21, 1932 (Biol.). - BOULESTREAU: Bull. Soc. Electr. et Radiol. 1934<br />
(Dosis). - BOYLE, COOL und BUCHANAN (London) Mikrowellen. Brit Journal of Physical<br />
Med. 13,1950/2. -BRASS; Tierärztl. Wschr. S.429,1940(Veterinär).-BRAUNundDHOM:<br />
Strahlentherapie 99, S.617,1956. -BRENNING, RUNER, HULTMANN: UpsalaLäk.för, Fork.<br />
N. F. 47, S.305, 1942 (Wärmeregulation). - BRINCH und KILERICH: D. M. W. 59, S.288,<br />
1933 (Tcmp.). - BROWN, R.KING: Brit. Jl. Actinothcr. 3, S. 133 1929 (Sarkom). -<br />
BRUGSCH und PRATT: Jl. Am. Med. Ass. 112, S.2114, 1939 (Abscess, pulm.). -BRÜNE:<br />
Hf. u, Elektroak. 50, S.73, '937 (Ausbreit.). - BRÜNING: Kurzwcllcnprovokation,<br />
Tonsillen. Med. Klin. 44, Nr. 13, 1949. - BRÜNNER-ORNSTEIN : Wien. Kl. W. Nr.9,1937<br />
(Neurol.). Strahl. 59, S.267, 1937. Jb. Psych. 49, S.226, 1933 (Paralyse).-BRUNNER und<br />
KRUSEN: A. P. T. 21, S.16, 1940. - BRUNO: Ann. di Radiol, usw. (Genital-Tbc). -<br />
BÜCIISEL: Arch. phys. Ther. 3, S.237, 1951 (Durchblutung). - BÜRKI: Ophthalmologe<br />
(Basel) ioo, S.43, 1940. - BÜRKMANN: Dcrmat. Wschr. 98, Nr.20, 1934 (Congclatio). -<br />
BURKERT: Therapie-Kongreß 1953. Dissertation Würzburg 1952. - BURMEISTER: Klin.<br />
Mon. Augcnhk. 129, S. 356, 1956. - BURNETT; Med. Bull. Vct. Adm. 17, S.23, 1940<br />
(Arthritis). - BURSTYN: Funk, S.230, 1930 (Tcmp.). - BUSCH-GRAWITZ: Arch. Schiffs- u.<br />
Tropenhyg. 40, S.520,1936 (Trachom).<br />
CAFFARATO: Ginecolog. (Torino) 9, S. 62, 1943 (Uterus). - CALCHI-NOVATI: Quad.<br />
Rad. 2, 1940 (Klinik). - Ders. und ROCCHINI: Radiobiol. Med. 26, S. 122. 1939. - CA<br />
MAGNI: Boll. Marcon. Nr.2, 1936 (Blutchemismus). - CAMERON: Brit. Jl. Phys. Med. 7,<br />
S.83, 1932. - CANESTRO: Congr. It. Laring. 1934, Padova (Ohr, Nase). - CAPALDI: Zbl.<br />
Chir. 1932. Ref.: Zbl, Radio!. H.7, 1933. Arch, di Sei. Biol. V, S.430, 1934- - Ders.:<br />
Radiol, Rdschau 2, S. 187,1933 (Kond.-Feld). - CARPENTER und BOAK: Am. Jl. Syph. 14,<br />
300
S.34Ö> 1930. - Ders. und PAGE: Science 71, S.450, 1930 (Hyperthermie). - Ders.: Gen.<br />
Electr. Comp, res. Lab. Nr.528, 1930. - CARTER: A. P. T. 19, S.699, 1938 (Dosis). -<br />
CASABONAundCAVAZZiNi: Giorn. Clin. M. 21, S.13,1940.-CASH: Radiology 20,1933.-<br />
CASSUTO: Forzc San. Nr.16, 1935 (Prostata). - CASTALDI: Radiol. Tagung Venedig 1934<br />
(Biol.). - CASTELLINO: Rif. Med. 1937 (Dcrmat., Vener.). - CATTANEO: Fol. Medica 23,<br />
1938, (Schädelbasis). - CHRANOWA: Diss. Würzburg 1944 (Mäusetumor). - CHRISTIE und<br />
LOOMIS: Jl. Exp. Med. 49, S. 303, 1929. - CIGNOLINI: Le Onde Corte in Medicina. Ann.<br />
Inst. Actiol. Paris 6, 1935. Rass. Clin. Scient. Nr.13, 1935. Med. Cont. Nr.io, 1935<br />
(Hypophyse). Accad. Med. Lomb. 1935 (Nerven). Quaderni deU'Allcrgia IV, 1935. Scr.<br />
Ital. ci Radiobiol. 4, 1937. Quaderni di Riad. 1, 1937. Int. Kongr. Kurzw. Wien 1937. La<br />
Medic. Contcmp. 1938. Acc. Med. 1939, 3 (Angina pectoris). Minerva Med. 50, 1940<br />
(Congelât). Rass. Clin. Scinentif. 1940. Zbl. Chir. 1943, S.63 (Erfrierungen). - Ders. und<br />
BARATA: Accad. Med. Genova j, 1935. - Ders. und OLIVIERI: Radiobiol. Generalis IV,<br />
1935 (Kapillar). - Ders. und TRAVERSO: Boll. Marconit 1936 (Schädel). ~ COLANI und<br />
MEYER-MICKELEIT : Leitwertmessungen Gehirn. Klin. Wschr. z8 u. 29,1950. - COLARIZI :<br />
I. Int. KW-Kongr. Wien, S.254, 1937 (Poliomyel.). - Ders.: Wien. M. W. Nr.43, 1935<br />
(Di-Bazillus). - COLONIEN. MIRAMONT DE L'AROQUETTE, BLONDEAU: Bull. Soc. Radiol<br />
Med. France 23,5.212,1935. (Go.). - COMPERE: Brit. Jl. Ph. M. 8,S.ioi, 1933,-CoRPER,<br />
COHN, und SIMPSON: Am. Rev. Tbc. 37, S. 763,1937.-COULTER und CARTER: Jl. Am. Med.<br />
Ass. 106, S. 2063, 1936. - CREIGHT und MCKINLEY: Proc. Soc. Exp. Biol. a. Med. 27,<br />
S.248, 1930, (Biol.). - CULLER und SIMPSON: Arch. Ophthalm. Am. ij, S.624, 1936. -<br />
CULLINS,MORGAN, SEYMOUR : Med. Bull. Vet. Adm. 11, S. 217,1935. - CUNDERLIK : Scxualerkrankungen.<br />
Gynaccologia 129, 2:73, I 95°- ~ CURTEVA, NEICEVA, ELENA: Pediatr.<br />
Med. Prat. 15, S. 176, 1940 (Atemorganc). - CURTIS und DICKENS: Nature 138, S.63.<br />
DAAN: Z. Exp. Med. 100, S.675, 1937. - DALCHAU: D. M. W. II, S. 1765, 1934<br />
(Gynäk.). - DALMARK und BOLDIN: Ugcskr. Laeg. S.303, 1940. - DÄNZER: Ann. Physik<br />
20, S.463, 1934; S.78;, 1934/35. Hf\ u. Elcktroak. 45, S.85, 1935. - DAENZER, HOLL<br />
MANN, RAJEWSKY, SCHAEFER, SCHLIEPIIAKE: UKW in Med. u. Biol. Leipzig 1938.<br />
- DARMSTÄÜTER: Diss. Jena 1929. - DATTNER: Moderne Therapie der Neurosyphilis. Wien,<br />
Maudrich 1933.-DAUSSET und DOGNON: Paris Med. S. 99,1934, (Biol.).- £W.,FERRIER,<br />
SIMARD:1V. Int. Radiol. Kongr. S.499,1934 (Endokrin.). - DAVISON, LOWANCE, CROWE:<br />
A. P. T. 21, S.728, 1940 (Hyperth.). - DAILY: U. S. nav. med. Bull. 41, S.1052, 1943.<br />
- DE DECKER und ARENDT: Klin. Mschr. Augenhk. 95, S.462, 1935. - DE GROOT C.<br />
HARRIS, Journ. Physiol m, 335, 1950. - DEL ACH AUX und SCHNEIDER: Schweiz. M. W.<br />
Nr.23, 1939 (Blutdruck). - DELHERM: IV. Kongr. Radiol. S. 509, 1934, (Hemiplegie).<br />
- Ders. und FISCHGOLD: C r. Acad. Sei. Paris 199, S. 1688, 1934 (Nerv.). - Ders. und<br />
STUHL: Rev. Med. Franc. 13, S. 19, 1932. - DENIER: Arch. d'Elcctr. Med. 1936. Int.<br />
KW-Kongr. S.321, 1937. Wien. M. W. Nr.28, 1937. Electrother. 41, S.384, 192. Ibid.<br />
S.386 (Sklerodermie). Arch. Electr. Med. Nr.j88, 1933. Bull. Soc. El. 1935. Ann. Inst.<br />
Actin. Paris io, S.25, 1935 (Einfl. a. Teilchen). - DEROW: A. P. T. 20, S. 101, 1939.<br />
-DESGREZ, DESGREZU.PAINVIN: Jdcradiolctclcctol32,59;,i95i.-DESjARüiNs: A.P. T.<br />
17, S. 206, 1936. - DESPLATS: Jl. Sei. Med. Lille 51, Nr_4j, 1933. - DIDE: Bull. Soc.<br />
Franc. Electr. 45, 1936. - Ders. und DROUET: Soc. Rad. Med. Fr. 20, S. 607, 1932<br />
(Psych.). - DIETZENBACH: Ultra short wane therapy. Westermann, New York, 1936. -<br />
DIEKER: Strahl. 61, S. 338, 1938. Fortschr. Rö. 59, S. 193,1939. D. M. W. S. 1076, 1937.<br />
Thcr. Ggw. H.4, 1939. Thcr. Ggw. S. ijo, 1939 (Abscess, pulmón.). - DOGNON: Siècle<br />
Med. 1932. Rév. Med. Fr. S. 13, 1932. Act. Un. int. contre Cancer 4, S. 187, 1939. Bull<br />
assoc. frc. p. l'avance des sei. 61, S.653, 1932. (Biol.). - DOHNAL: Wien. M. W. S.145,<br />
1935. - DREYFUS und WEINBERG: D. M. W. 28,1932. -VAN DRIEST: Z. Vcterin. Kd. 49,<br />
S.406, 1937 (Pferde). - DUMSCHAT: Z. Rheumaforsch. 12, 237, 1951 (Muskelfibrillieren.<br />
- DUNN und SIMONS: Ann. int. Med. (Am.) 1938. - DURANGEAU: I thèse, Lyon 1933.<br />
EBBINGHAUS: Ärztl .Wschr. 8, 36, 1952 (Fremdkörper im Feld). - ECKER und O'NEILL:<br />
Am. Publ. Health 22, S.1050, 1932. - EGAN: A. P. T. 17, S.688, 1936. - Ders. und<br />
30J
PiAKoSKi: A. P. T. 1938. - EIDINOW: Brit. Med. Jl. S. 332, 1934 (Tumor). - ENGEL,<br />
HERRICK etc. A. p. M. 31, S.4j;, 1950. - EPSTEIN: Rev. Méd. Suisse Rom. 63, S.586,<br />
1943 (Histamin).- Ders. und PAUL: Am. j!. Syph. 27, S.72,1933.-Dm. und SOLOMON,<br />
KOPP: Jl. Am. Med. Ass. 106, S. 1527, 1936. - ESAU: E. T. Z. 47, S.321, 1926. - Ders.<br />
PÄT20LD, AIIRENS: Naturwiss. 24, S.520, 1936 (Phys.). - ESSMANN und WISE: A. p. M.<br />
31, S. 502, 1950. - EULER: Klin. Mschr. Augcnhk. 112, S. 172,1947. - EVANS & SIMPSON<br />
in The Hormones Acad Press, New York. - EVERDINGEN: Act. Radiol. (Stockholm) 19,<br />
8.565,1938.<br />
FALLÍS: Am. J. Physiol. 147, S.281, 1946. - FARNETI: Boll. Marvun. 1935 (Cirrhos.<br />
hepatis). - FEINBERG, OSBORNE, AFRAMOW: J I. Allergy 2, S. 291, 1931. - FLANDACA: Rjf.<br />
Med. S.323, 1934 (Absc. pulm.). -Ders. und MONACA: Ann. Radiol. 1936 (Absc. pulm.).<br />
- Fianderic, FISCHER, C. H. - . Dtsch. Zahnärztl. Wschr. S.824, 1936 (Zahn). -Fiandcsto<br />
e Quaglia Minerva med (Torino) 190, 1955 (Mikrowellen). - FISCHER, ERNST: Strahl.<br />
77, S. 131, 1948 (Diapedesc). - FLOHR: Dtsch. Zahnärztl. Wschr. S.1097,1935 (Zähne,<br />
Nebenhöhlend. Nase). -FÖDERL: Wien Kl. W. S. 229,1938 (Gynak.). FÖLSCHE: Z.Naturforsch,<br />
9b, 429, 1954. - FoNio, Schweiz. Med. Wschr. 83, 353, 1953 Blut. - FORSTER:<br />
D. M. W. I, S. 86, 1942 (Eigenblut). -FOSSATI: Sperimcntalc 94, S.Ó09, 1940. - FRADA:<br />
Ref. Med. Nr. 34, 1942. Napoli. Arch, Ital. Med. Spcr. S.266, 315, 417, 1939. - Ders. und<br />
MASNATA: Giorn. Clin. Med. Bd.20, 1939. - FRADA U. SICARI; Riv. Pat. Spur. 27,<br />
S.2I5, 1941 (Dicnccphal.). ~ FRANCILLON-LOBRE: D. M. W. 28, S.ioyó, 1937 (Gynäk.).<br />
- Dies, und I.EROT: V. Congrès français de Gynecologic. - FRENKEL und BELICKAJA:<br />
Leningrad, Verl, d. Physiothcr. Inst. S. 565, 1940 u. Vcrtn. Chir. 61, S.435, 1941. -FREY:<br />
Strahlentherapie 95, 440, 1954. - FRITSCH und SCHUBART: Hinführimg in die KWT. Berlin<br />
1938. FUCHS, G: KU. Wo. 14, 1582 1935 (Tumor). - Ders.: Strahlcnther. 55, 473 1936<br />
Rad. Austr. 5, 117 1952 Röntgentherapie, URBAN & SCHWARZENBERG, München, 1958<br />
El. Med. 1, S. }8, 1956 (akute Hntzünd.) - FUCHS: Strahlentherapie 88, 647, 1953.<br />
Ders.: Rad. Austriaca 7, 167, 1954. Ders.: F.lcktromcd. 1, 38, (1956. Ders. : Wien. med.<br />
Wschr. 255, 1956.<br />
GALE und MILLER :J1. Labora, clin. Med. 21, S. 31,1935 (Bakter.). -GALM: Med. Klin.<br />
H.48, 1937 (Gefäßspasmen). - GEBBERT: K. W. 13, S.905, 1934 (Tiefenwirkung). Ibid.<br />
113, S. 1563, 1934 (Wellenlänge). - GEMELLI: Atti Pontif. Ac. Sei. 86, S. 21, 1933 (Cerebrum).<br />
-GENZ: Diss. Halle 1933 (Biut-Calcium). -GERSTEN, WAKIM, HERRICK, KRUSEN:<br />
Arch. phys. Med. 30, S. 7, 1949. - GESENIUS : D. M. W. 62, S. 15 3 3, 1936 (Hyperämie). -<br />
GESSLER und SCHMITZ : Strahlentherapie 93,617,1954 (Muskel). -GHIO : I. Congr. Marcon.<br />
Bologna 1955 (Tbc. oss.). - GIARDINA; Ann. Radiol, e Fis. Med. S. TO, 1936 (Gynäk.).<br />
- Ders.: Arch. Gincc. 193; (Hypogalaktie). - GILDEMEISTER: Pflüg. Arch. 149, S.389,<br />
1913; ibid. 176, S.84; ibid. 195, S. 112 (Polarisation). - GILES: A. P. T. 19, S.619, 1938.<br />
- GILLERSON: Akus. i. Gcnek. (Russ.) 2, S. 36, 1942 (Gynäk.). - GIROUX und DAUSSET:<br />
Monde Med. 44, S. 43, 1934. Bull. Acad. Méd. 1934. - GIUDICI: Clin. Ostetr. 42, 297,<br />
1940. - GjERTZ : Skand. Arcb. 1939 (Inhomogenes Dielektr.). - GLAUNER und SCHORRE :<br />
Strahl. S. 58, 1937. M. M. W. S. 1635, 1937 (Liquor). - GLOZ: Strahlentherapie Bd. 80,<br />
H.4, 1949 (Liquor cerebrospinalis). - Ders.: A. ph. T. 3, S.45, 1951. - GOLDIN und<br />
HEINILD: Ugeskr. Lacg. S. 933,1941 (Blut). - GÖSSET, GUTMANN, LAKHOVSKY, MAGROU:<br />
Cpt. Rend. Soc. Biol. 76, S.626, X924. - GOTTESMANN und LAST: Wien. M. W. S.749,<br />
1937. - GOETZ: Zbl. Gynäk. 63, Nr. 61 1939 (Mastitis). -GRAF: Dcrmat. Z. S.470,1953<br />
(Arthritis Go.). - GRAHAM: II, Ment. Dis. 79, S.83. 1933. - GRAUE: Hals-, Nasen-,<br />
Ohrenarzt 27, S, 161, 1936 (Sinus). - GRASSER: Med. Klin. 31, S.706, 1936. - GRAUL:<br />
Ann. Phys. 24, S.326,1935 (Leitfähigkeit).-GRAUPNER: Med. Markt 366,1954.-GROAG<br />
und TOMBERG: Wien. Kl, W. S.267, 1934; S.929 u. 964, 1933. D. M. W. Nr.28, 1937<br />
(Technik).-GROPLER: Arch.phys. Thcr. 5, 25,1953 (Vgl. Dystonie). -GROSSI MASSAZZA:<br />
Atti Osp. psich. Genova 1935 (Aortitis luica). - GRUETER : Klin. Monatsbl. Augcnhk. 95,<br />
S.46Z, 605, 1935 (Augen), - GRYNBAUM: Internat. KW-Kongr. S.238, 1937 (Kasuistik).<br />
- GRYNBAUM, MEGIBOW, BIERMAN: Arch, of physical Medicine 31, S.629, 1950 (End-<br />
302
Zirkulation). -GUARINI: Arch, di Radiol. 1940, S. 354; ibid. 17, S. 109,1941 (Endokrin.).<br />
- GÜNTHER, Diss. Würzburg 1956. (KW-Beeinflussung der Elektrophorese bei Leberleiden).<br />
- GUMPERT: Med. Welt 7, S. 5 5 8,1933 (Go.). - GUTHMANN : M. M. W. Nr. 40,1936<br />
(Gynäk.). - Ders. und REITZ: Strahl. Bd.60, S. 582 (Gynäk.). - GUTSCH: Kl. W. Nr.49,<br />
1937. Klin. Mbl. Augenhk. 97, S. 386, 1936. D. M. W. 49, S. 1838, 1937 (Augen). - GUT<br />
ZEIT: M. M. W. S.164, 1938 (Dental-Infekt.). -Ders. und KÜCHLEIN: M. M. W. 5.961,<br />
1937. - Ders. und BETTGE: Kl. W. Nr.45,1939, M. M. W. 25, S.964, 1937. - Ders. und<br />
KUHLENDAHL: Arch. Hals usw. 148, S.127, 1940.<br />
HAAS und LOB: Strahl. 50, S. 345,1934. Dt. Z. Chir. 243, S.318,1934. Kurzwellen in<br />
der Chirurgie. Enkc, Stuttgart. - HAASE: Strahl. 43, 8.589 1932 (Chir.). - Ders. und<br />
SCHLIEPHAKE: Strahl. 40, S.133, 1931 (Baktcr.). - HABICHT: Strahl. 51, 8.532, 1931<br />
(Physik.). - HADIOPOULOUS und BIERMAN: Jl. Labor, a. Clin. Med. 1934. - HALPHEN und<br />
AUCLAIR: A. P, T, 14, Nr.2, 1931. Elcctrother. 40, S.485, 1931. Congr. Rheumatismc,<br />
Paris 1932, Soc. Elcctrother. 41. 1932. Revue Act. et Phys. 81, S.154, 1932. Ann. Inst.<br />
Actinol. S. 199, 1932. La medicine en 14. année S.446,1933. Gazette Med. Limousin 26,<br />
1933 (Hyperthermie). La prophylaxie antivencr. 10, 1936 (Go.). Congr. Franc. Med.<br />
Quebec S.137, 1934. ~ HAMANN: D. M. W. 1080, 1937 (Lungenabszeß). - HARMSEN<br />
u. Mitarb.: Arch. Hyg. 138, 278, 1954. Protozoen. - Ders.: Umschau 55, 21, 1955.<br />
- HARTMUTH: Strahlentherapie 94, 434, 1954. - Ders.: Z. Naturforsch. 9b, 257,<br />
1954. - HARTL: Diss. Würzburg 1944 (Diagn.). - HARTMANN, MAJOR, DOUB: I. Int.<br />
Congr. Pyretother, New York 1937 (Tbc). - HASCHE: D. M. W. S.797, 1940 Naturwiss.<br />
S.613, 1940 (Selektivität). M. M. W. S.1033 u. 1378, 1938. Athcrm. Wirk. Strahl.<br />
64, S. 335,1939. Z. Kind. 61,S.506,1939. Naturwiss. 26, S.493,1938 (Gewebe). D.M. W.<br />
S. 1748,1939.-¿>erj. und COLLIER: Strahl. 51, Sl 309,1934 (Tumor). -Ders. undLEUNIG:<br />
Strahl. 50, S. 351, 1934 (Baktcr.).- Dies.: Strahl. 52, S. 179, 1935. - Dies.; D. M. W. 61,<br />
S. 1193, 1935 (Baktcr.). - Dies., LEUNIG, LOCH: Inter. KW-Kongr. 1937 (Diphtherie).<br />
- Ders. und LOCH: Kl. W. 17, S.59, 1938 (Baktcr.). - Ders. und TRIANTAPHYLUDES:<br />
Med. Klin. 38, S. 1239, 1935. M. M. W. S. 1033, 1938 (Athcrm. Wirk.). - HAUG: Mschr.<br />
Psych. 94, 1936. - HAUPTMANN: Z. Neuroi. 100, S.532, 1926 (Blutliquor). -HAUS: Kongreß<br />
d. Ges. f. Balneologieu. phys. Therapie, Lugano 1955 (Wasserhaushalt).-HAUSSER:<br />
Ultrakur%}vellen. Heidelberg 1939. - Ders., KUHN, GIRAL: Naturwiss, S.639, 1935 (Dispersion).<br />
- HAYASHI: Jap. IL Med. Sei. 1940, Biophys. 6, S. 138 (Tumor). - HAYER: Kl.<br />
W. 12, 1933 (Allg.). ~ HEEREN: Strahl. 68, S.444, 1940 (Tumor). -HEINRICH: Elcktrot.<br />
u. Masch. 49,1931. E. T. Z. S. 1088,1929. - HEINSEN und V.MASSENBACH: Klin. Wschr.<br />
27, S. 126, 1949 (Amenorrhoe). ~ HEISE: Dt. Zahnürztl. W. 44, 8.795, 1931. Kl. W. 10,<br />
S.2390,1931.-HELLER: Wien. Kl. W. 44, S.795,1931. Kl. W. 10, S.2390,1931.-HENCH<br />
und SLOCUMB: Proc. Mayo. Clin. 10, S.207,1935 (Hyperthermie).-HENRARD: Les <strong>ondes</strong><br />
Hertziennes. Bruxelles 1934. - HERRICK, KRUSEN: Elcctr. Eng. 72, 239, 1953. M. W.<br />
HERTZMANN und KOTKIS: A. P. T. S.248, 1940 (Carotis-Sinus). - HEUSTERBERG: Med.<br />
Techn. 75, 10, 1955. - Ders.: Ärztl. Prax. 9, 20, 1957. - HEYMANN, W., Beeinflussung<br />
der Elektrophorcsekurvc bei Durchflutung der Hypophyse Diss. Würzbg. 1956. -<br />
HIBBS und OSBORNE: Am. Jl. Med. Sei 201, S.547, 1941 (Prostata). - HILDEBRANDT:<br />
Arch. Exp. Path. Pharm. 201, S. 278,1943 (Histamin). Kl. W. 19, S. 270,1940. - HILL und<br />
TAYLOR: A. P. T. 18, S.263, 1937. -HILPISCH: Diss. Frankfurt 1938 (Katalase). - HINES<br />
und RANDALL: Electr. Eng. 71, 879,1952 (M.W.)-HINSIE: Wien. Kl.R. 44,8.696,1931<br />
(Hyperthermie). - Ders. und CARPENTER: Psych, Quart. 5, S.215, 1931 (Paralyse).<br />
- HINTERSATZ: Z. f. Vcterinärkd. 1938. - HOFF: Wien. M. W. Nr.28, 1937 (Cerebrum),<br />
- Ders. und WEISSENBERG: Z. Neur. S.460, 1932 (Cerebrum). - Dies.: Wien. Kl. W.<br />
Nr. 14,1932 (Ccrcbell).-HOFFMANN und SCHLIEPHAKE: M. M. W. S.1359,1935 (Neurol.<br />
- HOEFLER: Kindcrärztl. Praxis H.7, 1935 (Kinder). - HÜLLENDER: A. P. T, 22, S. 12.<br />
1941. - HOLLMANN: Hf. u. Elcktroak, 44, S.37, 1934, u. 50, S.81, 1937 (Hohlspiegel),<br />
-HOLZER: Z. Exp, Med. 93, S.296,1934. E. T. Z. 55, S. 282,1934. -Ders. und WEISSEN<br />
BERG: Grundriß der KurzwcHcntherapic, Maudrich, Wien 1935. - HÖRN, KAUDERS<br />
LIEBESNY: Wien. Kl. W. 47, S.936, 1934 (Cerebrum). - HORTEN: Kl. W. 8.392,<br />
303
1947 (Endokrin). - HOSMER: Science 58, S.325, 1928 (Temp.). - HÜBNER: Elektronik 5,<br />
173, 1956. - HÜBNER: Dt. Zahnärztl. W. S.6jj, 1938 (Dentalinfekt). - HÜNEMANN:<br />
Fortschr. Med. S. 165,1934 (Oto-Rhino). - HUTTER und LIEBESNY: Wien. Kl. W. Nr. 21,<br />
1933 (Fisteln).<br />
IMPAIXOMENI: Rif. Med. Nr.27,1937 (Harnwege). - INGRAIIAM: Am. Jl. Übsthct, 32,<br />
S. 1048, 1936. - INGRAO und VALLI: Ann. Inst. Forlanini 6, S.741, 1942 (Protease).<br />
- INOUYE: Script. Soc. Rad. Jap. 6, 859, 1936. -IREDELL: I. Int. KW-Kongr. S. 324, 1937<br />
(Kombin. Radium). - IZAR und CAIZZONE : Biochim. c ter. sper. 20,1933 (Blut). Rif. Med.<br />
Nr. 8,1934 (Sedimentation). - Ders. und CALDERONE: Rif. med. 1933 (Urea). - Ders. und<br />
FAMULARI: Giorn. Batt. e Immun. 11, 1933 (Komplement); 11, 12, 1933 (Agglutin).<br />
- Ders. und MORETTI: Kl. W. 14, S.46, 1935 (Maltafieber). Rif. Med. S. 199, 1935 (Fermente).<br />
Kl. W. 13, S.771, 1934 (Kolloide); ibid. 1934, Nr.31. Rif. med. Nr.47, 1933;<br />
Nr. 3, 1934 (Anaphylaxie). Rif. Med. 43, 1933 (Fermente). - Ders. und PRESTOPINO:<br />
Biochim. e ter. sper. 20, 1933 (Blut).<br />
JAKOBI: D. M. W. S.734, 1940 (Mastitis). - JAKOBI: Z. Laryngol. 32, 379, 1953.<br />
- JAMIN: Zbl. Chir. 70, S.J4, 1943 (Congclatio). - Ders. und PÄTZOLD: Sitz.-Bcr. Phys.<br />
Med. Soz. Erlangen Bd. 73, S.77,1942.-JELLINEK: Cpt. Rend. Ac. Sei. 191, S. 1 ojo, 1930.<br />
Kl. W. 43, S.IJ49, 1930. Wien. Kl. W. 44, S.292, 1931. Schweiz. M. W. S.i65, 1939<br />
(Histologie). - JOHNSEN Acta med Scand. 144, 165,1952 (Rö-Bcstrahlung d. Hypophyse<br />
bei Gushing - JOHNSON: Am. Jl. Canc. 38, S.535,1940 (Tumor).-JoLTRAiN-MoRATund<br />
DELHERM: RCV. Physiother. 12, S. 114,1936. -JONES: A. P. T. 15, S. 155,1935. - JONESCO,<br />
ARAMA, LUPULESCO, OLTEANU: Bull. Soc. Med. Hop. Bucarest 22, S.6, 1940. - JÖRNS:<br />
Bruns' Beitr. Chir. 159, S. 1, 1937, Zbl. Chir. S.28, 1937, (Knochen, Gelenke). - JÖRNS:<br />
Med. Klin. jo, 881 1955, Provok. - JUDOVITCH und POMERANZ: A. P. T. 21, S.688, 1940.<br />
- JUNGHANS: Med. Techn. 74, 264, 1954, M. W.<br />
KAHLER und KNOLLMAYER: Wien. Kl. W. 42, S. 1342, 1939. - KAIIN: Diss. Zürich<br />
1937 (Blutdruck). - KATO: Jap. Ges. Gynäk. 31, H. 11, 1936. - KAUDERS: Ver. Psychiatr.<br />
Wien 1932 (Paralyse). - KAUDEWITZ: Z. Naturforsch. 9, 145, 1954. - KEBBEL: VDH<br />
Jahresber. ij, 176, 1951. - Ders., LAPPE, PÄTZOLD: Arch. phys. Ther. 5, 213, 1953.<br />
(Automat. Resonanz). - Ders.: Funk u, Ton 8, 329, 1954. - Ders.: Med. Klin. Beilage<br />
Elektromcd. 3, 9, 1954- -Ders. und PÄTZOLD: Strahlentherapie 95,107,1954. -KELLGREN<br />
und LEITNER: Brit. J. Phys. Med. 16, 93, 1953- - KELLNER: Gyogyaszat 72, S. 274,1932<br />
(Neuritis).-Z?er¿. /OrvosokLapja 2 sz. 1946, (Säuglings-Atrophie). -üe/\f.:undKERESZTY:<br />
Orvosi Hctilap 39 sz, 1934 (Östrus). KEMP, PAUL und HINES : Arch, of Physical Med. Januar<br />
1948, Vol. XXIX, S. 12-17 (Blood Flow).-KELSTRUP: Yokohama Med. Bull. 3,125,1952.<br />
- KIEWE: Klin. Mbl. Augenhk. Bd.95, S. 108,1935. - KIHN: Med. Klin. 50, S. 868, 1955;<br />
Strahlenth. 99, 610, 1956 (Blutzucker). - Ders.; Ärztl. Wschr. 10,760,1955 (Hndokrin).-<br />
KING: Phys. ther. 49, S. 149,1931, Radiology 20, S.449,1933.-K1SSIN und BIEMAN: Proc.<br />
Soc. Exp. Biol. 30, 1933. - KLARE in: Abhandl. a. d. Gebiet d. phys. Therapie S 85<br />
Leipzig 1956. - KLEIN: Deutsches Gesundheitswesen S. 107,1950(Adnexe). - KLINGER:<br />
J. Franklin-Inst. 2j6, 129, 1953; Phys. Bl. 9, S. 166, 1953 (MW). - KLOTZ: Hippokrates<br />
18, S. 528, 1950 (Veg. Dystonie). - KNOPFMACHER: Wiener medizinische Wochenschrift<br />
81, 1931 (Fntzündung). - KNOTH: Dissertation Frankfurt 1938 (Hyperthermie).<br />
KNUDSONund SCHAIBLE: Arch.pathol. 11,8.728,1931 (Biochem.).-KoBAK und MITTEL<br />
MANN: A. P. T. 21, S.87,1940 (Dosis). - KOCKA: Cas. lek. cesk. S. 18 ji, 1941 (Otologic).<br />
-KOHL: Diss. Frankfurt 1935 (Zahn). - v. KÖHLER: IV. Int. Radiol. Kongr. S.494,1934.<br />
- KOEPPEN: Ther. Ggw. H.11, 1943 (Asthma). Z. Rheumat. 7, S.447, 1944 (Arthritis).<br />
- KOEPPEN & SCHLOMKA, Ther. Ggw. 91, 294, 1952, diese Med. Welt. 20, 949, 1951.<br />
- KOEPPEN: Mch. med. Wschr. 93, Nr.42, 1951. - Ders. Arch phys. Ther. 2, 368,1950;<br />
El Med. 1, S.8, 1955. - Europ. Wiss. Dienst 2, 1944. - Ders. und VOLBERT: Ther. Ggw.<br />
84, S.298, 1943 (Asthma). - KORB: Radiol. Rdsch. 2, S.169, 1933. Zbl. Gynäk. S.139,<br />
1936, Strahl. 72, S.220,1943, (Tumor); ibid. 64, S. 536,1939, (Gynäk.). I. Int. KW-Kongr.<br />
S.279, 1937 (Gynäk.). Mschr, Geburtsh. 104, S.358, 1936. Strahl. jj, S.686,1936. Strahl.<br />
304
6o, S.615, 1937 (Gynäk.). - KÖRBER: österr. Chcmikcr-Z. 38, S. 122, 1935 (Ferment);<br />
ibid. 38, S. 123, 1935 (Bakter.), - KOTTKE und Mitarb. : Arch. Phys. Med. 36, 137, 1955.<br />
-KOVDA: Neuropath. (Russ.)S. 82,1941 (Nerven).-KOWARSCHIK: Wien. Kl. W. S. 1692,<br />
1931; I, 1934; Nr. 43, 1937; 17, S.401,1938; Nr. 18, S. 512,1938; Kl. W. Nr. 45, S. 1757,<br />
1933 ;S. 1493,1934; 11,1936; 17, S.401,1938. Z.ärztl. Fortb. Nr. 21, S.628,1934. Balncol.<br />
S. 57, 1934. Med. Klin. Nr. 50, S.1661, 1934. Ärztl. Praxis II, 12, 1934. Radiol. Rdch.<br />
S.200, 1935. M. M. W. S.1158, 193s, Nr.47, 1936; S.380, 1943; S.219, 1938. Balneol.<br />
2, S. 154, 1935. Thcr. Ggw. 78, S. 108,1937. - Ders.: Med. Klin. 51, 1973,1956. - Ders.:<br />
Kurvgvelkntherapie. Springer, Wien 1936. - KRAMER: Strahlentherapie 89, 689 1953. -<br />
KRASEMANN: D. M. W. S. 183, 1941 (Pertussis).-KRASNY-ERGEN: Ann.-Phys. 23, S.278<br />
u. 304, 1935 ; 27, S.4J9, 1936. Hf. u. Elcktroak. 46, S. 85, 1935 ; 49, S. 195, 1937; 50, S.81.<br />
Ärztl. Praxis H.12, 1934. - KRAUSE: Physikal. Z. ;j, S.684, 1934 (Physik). - KRAUSZ:<br />
I, Int. KW-Kongr. 1937, S.214 (Trachom). - KROISS und SCHLIEPHAKE: Tuberkulosearzt<br />
6:337, 1949. - KROLL und BECKER: M. M. W. 82, S.908, 1934 (Neuroi.) - KROLL<br />
und REISS: Klin. Wo. 27, S.786, 1949 (Elektr. Hypophysenreizung). - KRUSEN: Mil.<br />
Surgeon 87, S. i j8,1940 (Chir.). Jl. Am. Med. Ass. 107, S. 1215,1936. - KRUSEN, HERRICK<br />
und WAKIM: J. AMA 104, S.1237, 1935. dies. Proc. Staff. Migo Clin. 22, S.209, 1947<br />
(MW). - KUEHN: Zahnärztl. Rdsch. S.1659, 1938 (Zahn). - KUTTIG und SCHICK: Hf.<br />
Thcr. 7, S.7,1938 (MW).- KÜVER: Diss. Würzburg 1949 (Cholesterin). - KULKA: Wien.<br />
M. W. S.210, 1935 (Bakter.).<br />
LACHI : Liguria Med. Nr. 26,1936 (Auge). - Ders. und VALLEBONA : II Congr. Marcon.<br />
1936. -LACHNIET: Diss. Köln 1937. -LADEBURGund SCHARECK: A. P. T. 3, S. 164,1951.<br />
- LAKIIOVSKY: Le secret de la vie. Paris 1925. - LAMPERT: Vcrh. Kongr. Wärme Frankfurt<br />
1937. - LANGE: Diss. Würzburg 1945 (Leukozyten). - LANGENDORFF: Strahl. 64,<br />
S.512, 1939 (Tumor). -LAQUER: jb. ärztl. Fortb. 24, S.33, 1933. Ther. Ggw. 3, 1937. -<br />
Ders. und RIZA REMZI: Med. Welt. S.167, 1933. - LARENS: Z. Klin. Med. 137, S.685,<br />
1940 (Absc. pulm.). - LASCH: Med. Bull. Vct. Adm. 17, S.28,1940 (Ncurolucs). - LAST:<br />
Wien. M. W. S.288 u. 1946, 1933. - LAUN: Z. Kinderhk. 64, S.101, 1943 (Empyema<br />
pleurae). - LAUTENBACH: Dtsch. zahnärztl. Z. 11, 1159, 1956. -LAX: Dt. Gcsundh. Wes.<br />
5, S.107, 1950. - LEHMANN und Mitarb.: Arch. Phys. Med. 3;, 627, 1954. - LEISTNER<br />
und SCHAEFER: Klin. Wschr. 14, S.899, 1935, Strahl. 52, S.676, 1935 (Techn.). -LE MEE<br />
SAIDMAN COURLAND: Ann. Inst. Actin. 7, Nr.4,1932.-LENTZE: Zbl. Bakter. 126, S.jo8.<br />
1932. - LEPESCHKIN: Chcm. Zbl. 1948. - LEROY: Documents pour l'emploi des o. c.<br />
Paris 1935. Bull, <strong>ondes</strong> courtes 1, S.4, 1933. Ann. Inst. Actin. Paris 10, S. 22, 1935. -<br />
LESKOVAR: Z. Exp. Med. 108, S.523, 1940. Strahl. 70, S.332, 1941 (Galle). - LEUNER:<br />
Strahlentherapie 77, S.421, 1948 (Entwicklung). - LEVADITI, AUCLAIR, VAISMAN: SOC.<br />
Biol. S. 84, 1932. - Ders.y ROTHSCHILD, AUCLAIR, HABER, VAISMAN, SCHOEN: RCV.<br />
d'actinol. et de Physiotherapie 9, S.462, 1933. - LIEBESNY: Kl. W. S. 1692, 1931; 12,<br />
S.141, 1933; M. M. W. S.493, 1932. Z. Phys. Thcr. 44, S.146, 1933. Mitt. Volksgcs.-<br />
Amt Wien H.3, 1933. et de Physiotherapie 9, S.462, 1933. ~ LIDMANN und COHEN:<br />
Air Surgeons Bull. 2, S.448, 1945. - LIEBESNY: Kl. W. S. 1692, 1931; 12, S. 141,<br />
1933. M. M. W S. 493, 1932. Z. Phys. Ther. 44, S. 146, 1933, Mitt. Volksges. Amt<br />
Wien H. 3, 1933. Der prakt. Zahnarzt. Nr. i, 1933. Z. urol. Chir. 38, S.132, 1933.<br />
Wien. KI. W. Nr. 18, 1933; Nr. 2, 1934; Nr. 42, 1935 (Diphth.-Baz.). IV. Int. Kongr.<br />
Radiol. S. 502, 1934. D. M. W. S.728, 1935; Nr.28, 1937. Strahl. 56, 1936, J. 1.<br />
Int. KW-Kongr. 1937. - Ders.: Kurz- tm ^ Ultrakurzwellen- Urban & Schwarzcnberg,<br />
Berlin 1935. - Ders. u. FINDY: M. M, W. S.493, 1932. - Ders. u. Wcrthcim, SCHOLZ:<br />
Kl. W. 12, S. 141, 1933. - LIÈVRE: Bull. Med. S.3, 1940 (Gynäk.). - LION: Arch, of<br />
Physical Medicine June 1947, Vol. XXVIII, S. 345 (Metals in Tissures). - LION : Helvct.<br />
Phys. act. 14, S.21, 1941. - Ders.; Metals in Tissues, Arch, of Physical Medicine June<br />
1947, Vol. XXVIII, S.345. -LippELTund HELLER: Kl. W. 13, Nr.48, 1934 (Bakter.). -<br />
LITTERER und PHILIPS: Söth. med. J. 31,1938 (Hyperthermic). - LOB : M. M. W. S.1812,<br />
i934(Chir.).-LosEKEundGuNDERsoN:A. P. T. 22, S. 171,1941. (Blutzucker). - LOEWEN-<br />
STEIN und STIEBÖCK: Wien. Kl. W. 44, S. 1501, 1931. - LÖWY: Wien. M. W. 87, S.761,<br />
305
1937- -LoTMAR, Arch. phys. Ther 10 S.48 1958 (Sudcck). - LUDWIG und VRIES: Schweiz.<br />
M. W. 70, S.uoS, 1940 (Biol.).<br />
MAHLO: Die Medizinische S.188,1952 (Endokrin.).-MCCAY, GRAY, WINANIS: Am II.<br />
Psych. 12, S.531, 1932 (Hyp.). - MCLENNAN: Archives of Physical Therapy S. 143,1931<br />
(Phys.). -McLouGHLiN, MANN, KRUSEN: A. P. T. 22, S. 525,1941 (Dzrm).-Ders., R AGS-<br />
DALE GARRISSON: Jl. Dairy Sei 23, S. 552, 1940. - MAGNONI: Policlin. Nr. 32,1935 (Abs.<br />
pulmón.). - MAHLO: D. M. W. 8.403,1934 (Ulcus ventr.). -MALOW: Phys. Z. S. 880,1933<br />
(Temp.). -MANARA: I. Congr. Marcon. 1935 (Mastitis). -MANN: Am. Jl. Syph. 24, S. 743,<br />
1940 (Go.). - MANSTEIN: Med. Klin. 47, 653,1952 (Gynäk.). - MARAGLIANO: Wien. M.<br />
W. 87, S. 755, 1937. - MARIE und MEDAKOVITCH: Arch. int. Neur. 52, S. 57, 1933 (Paralyse).<br />
- MARKSONund OSBORNE: Illinois M. J. 64, S.231,1933. A.P. T. ij,S.t67, 1934. -<br />
MARNITZ: Therap. Gegcnw. 93, 95, 1954. - MARQUES und MILETZKY: Bull, et Mém.<br />
Electrocardiol. Med. Fr. 27, 8.482, 1939. - MARTIN, ERICKSON, ROCHESTER: J. amer,<br />
med. Assoc. 142, 27:44,1950.-MARTINI; Ball. Soc. di Biol. Sperim. S.384,1934. Radiobiol.<br />
1934 (Herz). - MARUCCI: Rass. Ital. Ottalm. 9, S.56, 1940 (Auge). - MASSAZZA:<br />
Ann. Osp. Psich. Genova 1934. - Ders. und VALLEBONA: Acc. Med. Osp. Psíchiatr. di<br />
Genova 1935. - Dies.: Rad. Med. Nr.6, 1937 (Paralyse). - MAY und SCHAEFER: Z.<br />
Phys. 73, S.452, 1931. Z. Exp. Med. 84, S.240, 1932- - MELLER und FUCHS: Wiener<br />
medizinische Wochenschrift S.756, 1937 (Augen). - METZEL; Dissertation Jena 1938<br />
(Phagozyten). - MEYER : Ann. Inst. Actionol. Paris S. 215,1932 (Stcnokard). - MICHELSON :<br />
1. Internationaler KW-Kongrcß S. 246, 1937. - MIKAWA, M. : zit. n. Zbl. Radiol 28, 335,<br />
1939. -MINOSIMA: Jap. Med. Sei. Biophysics S. 116,1938. - MIRAULT: Praxis (Schweiz)<br />
19, 927, 1959. - MITTELMANN: E. U. M. 55, S.461, 1937, (Dosis). A. P. T. S.613, 1937. -<br />
MOLEFINO: Fol. Med.(Napoli) 27,8.289, 1941 (Gelenke).-MOLLE: Ecsti Arst 19, S.745,<br />
1940 (Abscess, pulmón.). - MORETTI: Mincrv. Med. 1936. Gazz. Med. Ital. S.81, 1937<br />
(Abscess, pulmón.). Arch. Ital. Med. Spcr. 231,1937. Rif. med. Nr. 27,1937 (Metabolism.).-<br />
MORTAR A: Atti 36. Congr. Ostetr. Bologna 1935 (Gynäk.). -MORTIMER: Radiol. 16,8.705,<br />
1931.-M0SSBERG: Acta Radiol. XXX, S.415,1948 (Fibroadenoma Mammae).-MUEHLEN-<br />
HARDT, I. Int. KW-Kongr. S. 246, 1937. Diss. Kiel 1938 (Kombin. Rö.). - MURPHY, PAUL,<br />
HINES (Lora City), Arch. phys. med. 1950/51 (Temperaturveränderungen, Wellenlänge und<br />
Infrarotstrahlen). - Muzio, VITALE: I. Congr. Marconit. Bologna 1935.<br />
NAGELL: Med. Welt 7, Nr.20, 1933 (Go.). - Ders. und BERGGREN; Dcrmat. Z. 67,<br />
S.i^t, 1933.-NAGELSC11MIDT: Brit. H. Ph. M. 8,5.117,1933.- Ders.: Diathermie. Springer,<br />
Berlin. - NEIDIIARDT und SCHLINKE: Balncol. II. 7, 1937 (Magen). - NEYMANN: Am.<br />
Jl. Syph. 18, S. 149, 1934. A. P. T. 15, S.423, 1934. Am. Jl. Psych. 92, S.517, 1936 (Spirochäte).<br />
Z. Neur. 132, S. 184, 1931. Brit. Jl. Ph. M. 6, S. 31, 1931. - Artificial fever produced<br />
by physical means. Ed. Thomas, Springfield, 1938. - NEYMANN, BLATT, OSBORNE: Jl. Am.<br />
Med. Ass. 107, 8.938, 1936 (Chorea). - Ders., OSBORNE, MARKSON; Ann. Int. M. 1938,<br />
Jl. Am. Med. Ass. 96,1931 (Paralyse). - Ders. und KOENIG: Jl. Am. Med, Ass. 96, $.1858,<br />
1931. - Ders., LAWLESS, OSBORNE: Jl. Am. Med. Ass. 107, S. 194, 1936. - NEMEG: Mitt.<br />
Elektromed. u. RÖ. 3, S. 3401, 1937 (Dosis). - NICHOLIS, HANSSON, STAINSBY: J. Bone<br />
Surg. S.69, 1934. - NICOLAU und KRAINIK: Cpt. r. Soc. Biol. 1933. Ann. Inst. Actinol.<br />
9, S. 1, 1934. - NITSCHKE: Z. Kind. 62, S. 200, 1940 (Intcrstit. Pneumonie). - NOBUOKA:<br />
Script. Soc. Rad. Jap. 6, S.719, 1938 (Tumor). - NÖLLER: Diss. Jena 1932. - v. NORD<br />
HEIM: Fortschr. Rö. 58, S.71,1938 (pu). Diss. Gießen 1940. - Ders. und SCHLIEPHAKE:<br />
Strahl. 75, S. 151, 1944. -- NRUMORI und TORRISI: Am. Jl. Ph. Th. 7, S. 101, 1930.<br />
OARTEL und WOLF: Jl. Dental res. 14, Nr.6 (Zähne). - v. OETTINGEN: Strahl. 41,<br />
S.251, 1931 (Biol.). - Ders. und HOOK: Z. Gynäk. S.2308, 1930 (Testes). - Ders. und<br />
SCHULZE-RHONHOF: Z. Gynäk, S. 2245,1930 (Blut). -O'LEARY, BRUETSCH, EBAUGH: Jl.<br />
Am. Med. Ass. 11 í, S. 677, 1940 (Hyperthermie). - OLIVIERI : Scr. Ital. Radiobiol. 1936,<br />
Radiol. Med. 1936 (Mikroorgan.). Policlinico XLV, 1938 (Herz). Gazz. Med. Ital. 1937<br />
(Hyperämie). - Ders.: Radiol, c fis. med. 4, 1936. - OSBORNE; Ann. int. Med. 1938.<br />
A. P. T. 17, S. 22, 1941 (pH). - Ders. und BALLENGER; The Brit. Journal of Ph. Med. 13,<br />
306
S. 177, 1950 (Mikrowellen). - Ders. und HIBBS: Am. Jl. Med. Sei. 201, S.547, 1941<br />
(Prostata). - Ders. undMARKSON: Ann. int. M, 7, S. 1391, 1934- -OSKEN: Kunststoffe 44,<br />
S. 558, 1954. - OSSWALD: Hf. u. Elektroak, 49, S.40, 1937. Int. KW-Kongr. 1937. Strahl.<br />
64, S.i, 1939 (Technik). - OSTERTAG: D. M. W. S. 1240, 1932 (Cerebrum). -OTTO und<br />
GILBRICHT: Z. inn. Med. 10, S.398, 1955.<br />
PALMRICII, SCHMIEDECKER, JANTSCH, NUCKEL: Wien. Kl. W. 61, Nr.4o, 1949 (Wchenanregung).<br />
-PÄTZOLD: Z. Hochfreq. 36, S.85,1930, Strahl. 45, 1932; 47,1933; 49,1934;<br />
47»i933> s -5 10 ; 54» ^935 i 57» '93 6 ; 5J>S.692,1936; ;8,1937; 60, S.700,1937; Z. Tcchn.<br />
Phys. 13, S.212, 1932. Z. ärztl. Forth. Nr.14, S.427, 1932. Med. Klin. Nr.17, 1934. Z.<br />
Exp. Med. 94, S.696, 1934. Radiol. Rdsch. 4, H. 1, 1935 ; 5, H. 1, 1936. Fortschr. Rö. 54,<br />
1936. Radiológica i, H.i, 1937. Int. KW-Kongr. 1937. - PÄTZOLD: Strahlentherapie<br />
92, S. 308, 1953. - Ders.: Med. Klin. Beilage Elcktromcd. 1, S.5, 1954. - Ders. und OSS<br />
WALD: Naturwiss. 26, S.478, 1938. - Ders. und WENK: Strahl. 61,1938. Fortschr. Rö. 54,<br />
1936. - Ders. und SCHLIEPHAKE: Radiol. Rdsch. 4, H.i, 1935. - PALMIERI und GIOR<br />
DANO: Rad. eus. Med. 3, S.2, 1937. - PAULIAN und BISTRICEANU: AC. Med. Paris 1936. -<br />
DE PEREIRA FORJAZ: Arq. Univ. Lisboa, S. i, 1933. - PERONA und ROSSETTO: Bull. Marconitcr,<br />
12, 1939. - PETERS und TEGETHOFF: Z. Tbc. 74, S. 178, 1935. - PETCÜ: Wien.<br />
M. W. S. 191, 246, 261,1940 (Orthopädie). -PETZOLD: Radiology (Am.) ;i, S.707,1938.<br />
-PFANNKUCII und KARPF: Kl. W. 18, S.884, 1939 (Dentalinf.). - PFEIFFER: Ärztl. Prax.<br />
7, S.9, 1955. - PFLOMM: M. M. W. 1845, 1930. Arch. klin. Chir. 166, S.2ji, 1931- -<br />
PiccHio: Raduno del Radiol. Ligure 1938 (Absc, pulmón.). - PICKER: Omt. KW-Kongr.<br />
S.71,1937. -PiNELLi: Scr. Irai. Radiobiol. 9, S.IJ7,1942; ibd. 8, S. 95,1941.-PICKIIAN:<br />
D.M. W. S. 1071,1937 (Gen-Mutation). -Ders., TIMOFEEFF-RESSOWSKY, ZIMMER: Strahl.<br />
jó, S.488, 1936. - PIOTTI und BRAGA: Policlinico LIX 59, S. 1, 1952. - PITZEN: Z.<br />
Orthopäd. Chir. 40, Beil. 127, 162, 1934. - POPPER und RABINOWITSCH: Radiol Rdsch.<br />
7, S. 392, 1938. - POITTF.VIN: Soc. Franc. El. et Rad. 9, 1933; ibid. 46, 1933. Revue<br />
gén. de Radiol. 11, Nr. 3,1933 (Techn.). - PORTRET und BOUDACHIAM : Soc. Fr. ¿Telectrothér.<br />
et Radiol. 23,2, 1937 (Absc. pulomn.). - PRATT und SHEARD: Proc. Soc. Exp.<br />
Biol. a. Med. 32, S.776, 1935 (Tcmp.). - PRIETZEL: Mschr. Ohrcnh. 74, 8.496, 1940<br />
(Sinus). - PROUST, MORICARD, PULSFORD: Presse Med. S. 1001, 1935.<br />
RAAB: Vcrh. Dt. Rontgcngcs. 24, 1932. M. M. W S. 1442, 1932. Fortschr. Ther. H.4,<br />
1934. Zbl. Chir. 1934. D. M. W. Nr. io, 1935; 62, S. 177, 1936; 62, S. 1553, 1936; Nr. 28,<br />
1937; S. 1098, 1937; S. 372, 1938. Ktir%u>elletilherapie in der Praxis. Leipzig 1937. Kurzwellen<br />
in der Gynäkologie. Berlín 1937. Hyperthermie mil Kurzwellen. Berlin 1939. - Ders.:<br />
KW-Hyperther mie. Arch, physik. Therapie 2, 1: jo, 1950. - RAE, MARTIN, TREANOR,<br />
KRUSEN: Proc. Staff. Meet. Mayo Clin. Rochester 25, 15,1950. - RAE, HERRICK, WAKIM<br />
und KRUSEN: Am, Congress of Phys. Med. Washington 1948. - RAJEWSKY: Kurzwellen.<br />
Ergebnisse d. biophys. Forschung. Dresden 1938. - Ders. und REOHARDT: Arch, elektro.<br />
Ubertr. 11, S.163, 1957. - Ders., OSKEN und SCHAEFER: Naturwiss. 25, S.780, 1937. -<br />
Ders. und OSKEN: D.M. W. S.780, 1937 (Leitfähigkeit). -Ders. und SCHAEFER: DMW.<br />
S.1065, 1937. -RAKOFF: Fertility a Sterility 4, S. 263, 1953. Einfluß auf Zyklus u. Gravidität.<br />
- RAUSCH: D. M. W. Nr. 32,1932. Fortschr. Ther. io, S. 394, 1934 (Niere). - RAU<br />
SCHER: Z. Gynäk. S.438, 1940. Strahl. 72, S. 170, 1942 (Tiefenerwärmung). - RAVAULT<br />
und CECCALDI : Ann. Inst. Act. 7, S. 204,1932 (Arthrit.). - RAVENNA : Congr. Soc. It. Med.<br />
Int. Roma 1936 (Endokarditis). - RECHOU, WANGER-METZ, HALPHEN, AUCLAIR, DAUS<br />
SET: Arch. Electr. Med. 41, S.291, 1933. Jl. de Radiol, et Elcctrol. 17, S.481, 1933. -<br />
Ders.: Revue d'Actinol. et de Physiothérapie 9, S. 387, 1938. - REGNAULT: Côte d'Azur<br />
Med. 1931. - REITER: D. M. W. S.1497, 1933 (Tumor). Brit. Jl. Ph. M. 8, S.119, 1933.<br />
D. M. W. S. 1241,1932. - REUSSE: Strahlenther. 87, S.491,1952. Wellenlänge. REVIGLIO:<br />
Radiol. Med. 1933. Radiol, c fis. med. S. 141, 1934. - RICHET und FACQUET: Pyrcthotherapic.<br />
Quebec 1934, Mason. - RIEKE: Industr. Med. a. Surg. 23, S.401, 1954. - RIN-<br />
TELEN: D. Z. Chir. 256, S.575", 1942 (Osteomyelitis). - ROBERT: Jl. de Radiol. 25, S. 107,<br />
1942 (Bronchitis). -ROCCINI und NOVATI: La Radiol. Med. 23,1936. - ROCCHINI: Radiol.<br />
307
Med. Nr. 8, 1937 (Baktcr.). - ROFFO: Bol. des Inst, de Med. Exper. (Argent.) 51, S. 342,<br />
1932; 30, S.9, 1932; S.72, 1933. Rev. Lat.-Amer. 19, S.1368, 1934. - Ders,: Bull. Inst.<br />
Med. Exper. Canc. 479, 1937. - ROQUES: Med. Welt, H. 36, 1937. M. m . W. S.680, 1936<br />
(Pertussis). - ROSA: Kl. W. S.225, 1940. Z. Exp. Med. 107, S.441, 1940 (Dosis). - ROST<br />
undScHLiNK:Brit. Jl. Phys. Med. NS 16,5.243,1953 (Sinusitis). -ROTH: Internat. KW-<br />
Kongr. S.2IJ, 1937 (Samen). - RUBIO und VIJANDA: Medicina 9, S. 203, 1941. - RUETE:<br />
Derm. W. S. i, 1936. Int. KW-Kongr. S.266, 1937. - RUCKER: Diss. Erlangen 1935. -<br />
RuEDEMANN und ZEITER : A. P. T. 21, S.4ji, 1940 (Auge). - RICHET: Presse méd. Nr.85,<br />
1933.-R0HDE: A. T. M. Z. 1940. - Ders. und SCHLEGELMILCH: E. T. Z. 24, S. 581,1933-<br />
- Ders. und SCHWARZ: Z. Hf. u. Elektroak. 41, S.204, 1932.<br />
SAIDMAN: Ann. Inst. Act. 7, S.185, 1932; ibid, S.218, 1932. Cpt. rend. Ac. Sei. 193,<br />
S-783, 1931. Jl.Med. Chir. prat. S. 105, 1932. Rev. Act. et Phys. S.473, 1932. - Ders, und<br />
CAHEN: Ann. Inst, Act. 5, Nr. 1, 1931. - Ders., MEYER und CAHEN: Cpt. rend. Ac. Sei.<br />
192, S. 1760,1931. - Den. und MEYER: Leí <strong>ondes</strong> courtes en thérapeutique. Paris, Doin. 1936,<br />
1943. - SALMERI: Congr. Marconibiol. Bologna 1938 (Absc. pulmón.). - SAMUELS: Jap.<br />
J. Obstctr. 22, S. 132, 1939 (Endokrin.). - Ders.: KW-Kongr. Wien, S.273, 1937. Endogenous<br />
Bndocrinolberapy. Amsterdam 1947,1951.-v. S ANDEN: Med. Markt 2, S. 232,1954.-<br />
SARENS: K. klin. Med. 137, S.68j, 1940 (Absc. pulmón.). - SAVAJAKI: Mitt. jap. Ges.<br />
Gynäk. 31, H.10, 1936. - SAVONA: Atti Soc. Ital, Obstctr. 32, S.406, 1936 (Gynäk.). -<br />
SAWASAKI: Mitt. Jap. Ges. Gynäk. 31, S.93, 1936. - SARTORI: Riv. Clin.-pediatr. 137,<br />
S.68j, 1941 (Thymus). - SARASIN und WALTHARD: Kongr. Nat. Radiol. S.245, 1940. -<br />
SCOTT: Ann. Phys. M:d. 103, 1952. - Ders.: Ann. Phys. M:d. 238, 1953. - Ders.: Ann.<br />
Phys. M d. 48, 1954. - Ders.: Ann. Phys. M:d. 169, 1955. - SEVERIN: Nord. Med.<br />
(Stockholm), S.2707, 1941 (Chorea). - SIEDENTOPF: M. M. W. S.382, 1935. - SIEBURG:<br />
Med. Welt S. 1 jn, 1936. -SIEGEN: Int. KW-Kongr. S.aji, 1937 (Herz). - SILBERMANN:<br />
I. Thèse, Paris 1934. - SIMPSON: jl. Am. M:d. Ass. 100, S.67, 1933 (Hyperthermie). -<br />
Ders.: Jl. Am. M:d. Ass. ioo, S.69, 1933. - SLAUGHTER und TRAUTMAN: New Orleans<br />
M. J. 189, S.6,1936.-SOEKEN: Arch. Kinderhk. 1942. - SOILAND: Act. Radiol. 9, S.474,<br />
1929 (Tcmp.). - SPIEGL: Arch. phys. Ther. 8, S.2ij, 1956. - SZYMANOWSKY und HICKS:<br />
Jl. Infect. Dis. 50, S, 1, 1932 (Serum). - SKOPIL und ÚLDRICH: Arch. Klin. Chír. 203,<br />
S. 137,1942. - SoLODDOUKiio: Exper. M;d. S. 14,1940. -SOLOMONund STECHER: A.P.T.<br />
21, S.339, 1940. - SHITA und NAKASHIMA: Mitt. Akad. Kioto 29, S.351, 1940. - Ders.<br />
und TAKEDA: ¡bid. 29, S.618 u. 357, 1940. - SHORT und BAUER: Jl. Am. Med. Ass. 104,<br />
S.2165, 1935. - SiiUKi: Jl. Choren Med. Ass. 30, S.202,1940 (Chirurg). - SCHAEFER: Z.<br />
Exp. Med. 92, S. 341,1933 (Blut). Kl. W. 12, S. 102,1933 (Blut). Z. Phys. 73,8.452,1931;<br />
77, S. 117,1932 (Hochlreq.). KW-Kongr. 1937 (Physik.). D. M. W. S. 95 5,1938. Z. Exp.<br />
Med. 100, S.706, 1937. - Ders. und SCHÄFER: Z. Exp. Med. 100, S.691, 1937 (Dosis). -<br />
Ders. und SCHWAN: Ann. Physik 4;, H. 1, 1943. - Ders. und STACHOWIAK: Z. techn.<br />
Phys. Nr. 12, 1940. - SCHEDTLER: Beitr. Klin. Tbk. 86, S. 161, 1935 (Tbc). - SCHENCK ZU<br />
SCHWEINSBERG: Strahl. 63, S. 213,1938 (Baktcr.). - SCHERESCHEWSKY: Publ. Health rep.<br />
41, S.I929, 1926; 43, S.937, 1928; 48, S.844, 1933; Int. KW-Kongr, Wien 1937. Wien.<br />
M. W. S.769, 1937 (Biol.). - Ders. und ANDERVONT: Publ. Health rep. 43, S.940, 1928. -<br />
SCHIEDSMANN: Arch. Psychiatr. 108, H.3. Arch. Psych, u. Nerv. 103, H. ; (Cerebrum). -<br />
SCHINDLING: M. M. W. S.918, 1938 (Absc. pulmón). - SCHLAEPFER: West. J. Surg. 49,<br />
S. 153, 1941 (Chirurg.).- SCHLAG: Diss. Gießen 1936. - SCHLEIPEN: Diss. Frankfurt 1939<br />
(Auge). - SCHLIEPHAKE: Kongr. D. Inn. Med. S. 307, 1928. KI. W. 7, S. i6oo, 1928. Z.<br />
Exp. Med. S. 212, 66,1929. Funk S. 737, 1929. Gesundh. Ingenieur H, 46,1929. Kl. W. 9,<br />
S.2333, 1930 (Therapie). Strahl. 38, 1930. Abderhaldens Handbuch 58, S.176J, 1930.<br />
Strahl. 22,1930; 40,1930 (Bakter., mit HAASE). Wien. Kl. W. ^i.Mcd. Klin. H.4,1932.<br />
Vcrh. Ges. D. Röntgenologcn i. d. Tschechoslowakei, Strahl. 4% 1932. Wien. Kl. W.<br />
Nr. 18,1932 (mit WEISSENBERG, Blutzucker). Z. ärztl. Fortb. 29,1932. D. M. W. i, 1932,<br />
Med. Welt 1933. Verh. Ungar, ärztl. Ges. Budapest, Juli 1933. Jl. ärztl. Fortb. S.40,1933.<br />
D. M. W. S. 1443, 1933. Wien. Kl. W. Nr. 41, 1933. Zbl. Inn. Med. 54, S. 977, 1932.<br />
Kl. W. 12, S. 1730,1933. Kinderarzt!. Praxis j, 1933. Med. Welt 1934. Kl. W. 12,8.1729,<br />
308
1934 (Spezif.) m. Compère. Z. ärztl. Fortb. ji, 1934. Arch. exp. Path. Pharm. 177, 1934<br />
(mit STRASSBURGER, Wärmeregulierung). Wien. KL W. Nr. ji, 1934. Radiol. Rdsch. 4,<br />
S. i, 1935 (mit PXTZOLD). Strahl. 52, S. 193,1935. Balncol. 2.H.6,1935. M. M. W. S. 1359,<br />
1935 (mit HOFFMANN, Neurol.). Med. Welt, Nr.49,1934. E. T. Z. 57, S.863 (mit WENK).<br />
Ther. Ges. Inn. Med. 1936, Hauptreferat. Fortschr. RÖ. 54,1936. Med. Klin. H, 12,1936<br />
(Absc. pulmón.). M. M. W. 83, S.450, 1936 (Spezif.). Kindcrärztl. Praxis 8, S. 118,1936.<br />
Strahl. 57. S. 553,1936. D. M. W. S. 1073,1937 (Indik.). Wien. M. W. Nr. 28,1937. Kongr.<br />
D, Inn. Med. S. 53,1937 (Rheuma). Röntgenpraxis 10, S. 120 1938 (Zwischenfälle). M.M.<br />
W. S. 671,1938 (Elektrode). Thcr. Ggw. H. 4,1939 (Absc. pulmón.). Kongr. D. Röntgcngcs.<br />
Strahl 66, 296, 1939. M. M. W. S. 626, 1941. Mzd. Klin. Nr. 26, 1942 (Indikat.). Umschau<br />
1943. Ther. Ggw. H. j, 1944 (Congelatio). Physical therapeutics Nov. 1931. Invest<br />
y Progreso 7, S.236,1933. A. P. T. 19,1933. ElDia Med. S. 1014,1933. Brit. JI. Ph. M.8,<br />
1933. Rev. M;d. 12, S.J47, 1933. Brit. Jl. Ph. M. 1934. Internat. Radiol.-Kongr. Zürich<br />
1934. Revista med. Gcrman-Ibero-Am. 1934. Schweiz. M. W. 65, S. 140, 1935. Accad.<br />
Med. Lombard. 13, 1935. Jl. de Radiol, et Electrol. Nr. 6, 1935. Revue du rhumatisme<br />
1935. Brit. Jl. Ph. M. S. 80,193;. Med. Z. Siebenbürgen, S.6,1936. V.Int. Radiol.-Kongr.<br />
Chicago 1937 (Hauptrcf.). Brit. Jl. Ph. M. S. 7, 1938. La casa del Medico, S. 58, 1944.<br />
Praxis (Schweiz) 1948. - Ders.; Kur^wellentherapie. Jena 1933, 1934, 1936. - Ders.: Short<br />
wave therapy. London, Actinic press 1936. - Ders.; Behandimg rheumatischer Erkrankungen<br />
mit Ultrakurzwellen. Dresden u. Leipzig 1938. - Ders. (mit RAJEWSKY, SCHAEFER, PÄT-<br />
ZOLD): Ultrakurzwellen, Berlin 1938. - Ders.: Behandlung rheumatischer Erkrankungen, in:<br />
LAMPERT-HEUPKE, Ergebnisse der physikalischen Therapie. Dresden 1942. - Ders.: Les<br />
<strong>ondes</strong> courtes en biologie. Paris 1938. - Ders. : Strahl. 78, S. 467,1948 (mit WÜST, Blutzucker).<br />
Tagung der südwestd. Tuberkuloseärzte, Oberstdorf 1948 (Die Aktivitätsdiagnose). Z.<br />
f. Laryngologic usw. 28, S. 348,1949 (mit JORDAN, Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde). Tbc-<br />
Arzt, H.6, 1949 (mit KROISS, Die Leukozytenreaktion). Z. Laryngol. usw. 28, H.7, 1949<br />
(Peritonsillarabszesse). 54. Kongr. f. Inn. Med. Karlsruhe 1948 (Endokrin.). Neue Med.<br />
Welt, S. 300, 1950 (mit SATTLER, Endokrinium, Magenkranke). Wien. M. W. 100, S. 639<br />
bis 641, J950 (Vegetative Dystonie). Med. Mschr. H.8, S. 575 1950, (Herzentzündung).<br />
Neue Med. Welt, N.26, 1950 (Dystonie). Hippokratcs 21, 8.598, 1950 (Herzbeschwerden).<br />
Arch. f. Physikalische Therapie, Nr. 60, 1951 (Hirnbasis, endokrines System). Brit.<br />
]1. Phys. Thcr. 1950 (Short waves and altrasonics). Kongr. f. Physikal. Thcrap., Bad Pyrmont<br />
1950 (Hauptrcf.). D. Arch. klin. Med. Bd. 197, S. 449-467, 1950 (mit FABRI, Endokrine<br />
Drüsen). D. M. W. 75, S. 1709-1713, 1950 (Endokrin.). - Ders.: Behandlung innerer<br />
Krankheiten. Neubearbeitung des Buches v. DRIGALSKI. Piscator-Verlag, Stuttgart 1950. -<br />
Ders.: Therapiewoche j, S.7J, 1954/55). - Ders. und SMETS: Münch. med. Wschr. 97,<br />
S. 343,1955. - Ders.: Elektromcd. 2, S. 1,1957. - Ders.: Fortschr. Med. 75, S. 125, 1957. -<br />
Ders.: <strong>Kurzwellentherapie</strong>. IV.Auflage. Verlag Gustav Fischer, Jena 1949. - Ders.: Medizinische<br />
Poliklinik (klinische Vorlesungen). II. Auflage. Verlag Gustav Fischer, Jena 1952. -<br />
Ders.: Physikalische Therapie. Bern, Auber-Verlag 1958. - Ders.: Fortschr. der KWT<br />
in Lamport, Ergebn. Phys. Thcr. Dresden 1958. - Ders. und COMPERE: Kl. W. 12, S. 1729,<br />
1934 (Spezif.). - Ders. und WEISSENBERG: Wien. KI. W. Nr. 18,1932 (Zucker). - SCHMIDT,<br />
OSKAR: Arch. Ticrhk. 55, S. 53, 1426 (Stromverteilung).- SCHMID, W.E. : Arch. Elcktrotechn.<br />
24, S. 202, 1930 (Widerstand). - SCHMIDT und WEISS: Phys. Therap. (Am.). 49,<br />
S.336, 1931. - SCHMITT: A. P. T. 20, S.227, 1939 (Hyperthermie). - Ders., MILTON, G.:<br />
A. P. T. zi, S.716,1940 (Eiterungen).-SCHMIEMANN: Zcntralbl. f. Gynäkol. 70. Jahrg.,<br />
H. 2,1948(Amenorrhoe).-SCHMITZ: undGESSLER: Strahlcnther. 93, S.62;, 1954. (Muskel).<br />
-SCHNABEL und FETTER: Am. Jl. Syph. 22, 8,39,1938 (Go.). -SCHOEDEL: Diss. Erlangen<br />
1940 (Thyreoidea). - SCHOTT: Kindcrärztl. Praxis 13, 1943 (Absc. Tonsill.). - SCHÖNE<br />
MANN: Z. Tbk. S. 75, 1938 (Pleuritis tbc). - SCHOTLZ: Hippokrates, S.97, 1940 (Hyperthermie).<br />
D. M. W. 1938. Fortschr. Ther. 17, S. 297,1941 (Hyperthermie). - SCHOEN : Thcr.<br />
Ggw. S.105, 1942 (Arthritis). - SCHOLZ: Arch, physik. Therapie 2, jo, 1950 (Hyperthermie).<br />
- SCHOLZ u. LEITNER: A. p. T. 10, S.69, 1958 (Sudcck-Syndrom). - SCHORRE:<br />
D. Z. Ncrvcnhk. 147, S.2036, 1936 (Neurol.). - SCHOTT: Kinderärztl. Praxis 13, S.233,<br />
1942. - ScnÜLY und VOLK: Temp, im Becken, Z. Geburtsh, 141, S.288, 1954. - SCHU-<br />
309
MACHER: Z. Gynäk. Nr.33, 1936 (Gynäk.). - SCHWAN: Ann. Physik. 40, S.7, 1941. Z.<br />
Exp. Med. 109, S.531, 1941 (Physik). - Den., CARSTENSEN: Trans. Amcr. Inst. Electr.<br />
Eng. 72, 48;, 1953. - Ders., PiERSOL:Amer. j. Phys. Med. 33, 371,1954. - Ders,: Arch.<br />
Physic.Med. aRchab. 36, 363,1955.-SCHWARZ: Diss. Basel 1939.-£>crj.:Jnt.KW-Kongr.<br />
S. 245, 1937 (Dosis). - SCHWARZSCHILD: A. P. T. 14, S. 347, 1933. - SCHWEINBURG und<br />
TOMBERG: Int. KW-Kongr.S. 217,1927 (Physik). -SCHWEITZER: Med. Welt Nr. 4 1934. Int.<br />
Radiol. Kongr. 8.469, 1934. - SCHWING: Hals-, Nasen-, Ohren-Arzt 10, S.29, 1938. - DE<br />
SfiGUiN, CASTELAIN, PELLETIER: La Revue Scientifique 86, S. 336, 1948 (Mikrowellen). -<br />
Ders. und PELLETIER: C. r. So. Biol. 226, 1048, 1948 (Absorption). - SIEMS, KOSMANN,<br />
OSBORNE : Arch, physic. Med. (Am.) 29,75 9,1948 (Mikrowellen). - SPILLER : Diss. Jena 1939<br />
(Physik)-•D«\r..' ETZ 71, 2:27,1950 (Dezimeter-und Zentimetcrwellen).- Ders,: Hochfr.<br />
Techn. 52, S. 129,1938 (Mikrowellen).-STACHOWIAK: Ann. Phys. 37, S.495,1940. Pflügers<br />
Arch. 244, S. 570, IL T. Z. 62, S. 441,1941. (Physik). - STAEHLER: Fortschr. Rö. 50, S. 51,<br />
1934 (Gynäk.). - STECHER und SOLOMON: Am. Jl. M. Sei. 192, S.497, 1936. - STEIN<br />
HAUSER: Strahl. 68, S.79, 1940. - STIEFBÖCK: W. M. W. S.403, 433, 1935. Z. Phys.Ther.<br />
30, S.203, 1925. Wien. Kl. W. S.ijj8. 1928. - Ders. und FRÜHWALD: Wien. Kl. W.<br />
45, S.7J2,1932. - STOCK: Brit. Jl. Ph. M. S.406, 1938; ibid. S.446 u. 1012, 1940. - Ders.<br />
und BURCH: Brit. Jl. Ph. M. S.406, 1938. - STOPPANI: Medic, contemp. Nr. 1, 1935. -<br />
Ders.; Boll. Marconiter. S. 17, 1939 (Gefäße). - STRASSBURGER und SCHLIEPMAKE: Arch.<br />
Exp. Path. Pharm. 177, S. i, 1934 (Wärmeregulation). - STRAUCH: D. M. W. S. 1070,1940<br />
(Absc. pulm.). - STROHMAIER: Tuberkulosearzt 4, Nr. 4, 1950 (Leukozytenreaktion). -<br />
STROHL, DESGREZ, ROUCAY: Journal de Radiologie et d'Elccttologie 31, S.276 bis 279,<br />
1950 (Radioisotope). - Ders.: Presse med 23, 1950. - STÜBINGER und WOLF: Med. Klin.<br />
44. Jahrg., Nr. 39, 1949 (Diabetes inspidus). - STUHL: Ann. inst, actinol. 7, S.213,1932.<br />
STUMPFNER U. THOM 59.Tagung der Ophthalm. Ges. Heidelberg 1955 (MW, Auge).<br />
TAGASI: Strahl. 67, S.ij2, 1940. - TAYLOR: A. P. T. 19, 1938. Brit. Jl. Ph. M. S.82,<br />
1938. - TEED und KRAUS: Arch. Otorhinolar. 34, S.743, 1941 (Sinus). - TENNY: Ann,<br />
Int. Med. 6, S.4S7, 1932 (Hyperthermie). - Ders. und SNOW: 5. Ann. fever conf. S.46,<br />
1935. - V.TEUBERN: D. M. W. S.2ij, 1942 (Hyperthermie). - THEIS: Strahl. 66, S.494,<br />
1939. - THOM: Tbc-Arzt 5, S.393, 1951 (Provokation). - Ders.: Arch. phys. Ther. 6,<br />
S. 256,1954. - Ders.; Einführung in die Kurzwellenthcrapic (München 1956).-THOMSON:<br />
Edinburg M. Jl. 48, S.629, 1941. - THRAN: Medizinische 387, 1957. - TITUS: A. P. T.<br />
19, Nr.ii, 1938. - TOMBERG : Int. Kongr. Radiol.-Biol. S.445, 1935 (Speiif.).- TORELLI<br />
VALLI: Boll. Marconit. 1935 (Blut). - TRAUTMANN: A. P. T. 77, S.277,1937. - TRINCAS<br />
und ZANETTI: L'ascesso polmonare. Bologna 1938. - TROELTSCH: Dermat. Wschr.<br />
S. 1297, 1937.<br />
UTAGAWA: Arch. Jap. Chir. 17, S.483, 493, 1940; ibid. 17, H.2 (Magen, Darm). -<br />
UMEDA: Edinburgh M. Jl. 48, S.629, i94°- Mitt. Med. Ak. Kioto 29, S. 182, 1940.- USE;<br />
ETZ «A» 78, 389,1957.'<br />
VALLEBONA: Int. KW-Kongr. S. 235, 1937. Strahl. 65, S. 361, 1935 (Tumor). - Ders.:<br />
Congr. sanitär. Ospcd. Genova 1935. Congr. Marconiter. Bologna 1938. - Ders. und<br />
GiAVOTTo: Folia gínecol. 1934 (Gynäk.). - VAERNET: Zbl. Gynäk. Nr. 33,1937 (Gynäk.).<br />
- VAISMAN: Akus. i. Ginck. (Russ.) S. 71,1940. - VANOTTI: Z. Exp. Med. 97,8.826,1936.<br />
-VoLLMARundLAMPERT: Z. Krcbsf. 51, S. 322,1941.- VOGT: Strahl. S. 51,1934(Gynäk.).<br />
- Voss: Kindcrärztl. Praxis 5, S.289, 1934. - Ders.: Kinderarzt!. Praxis H.7, 1934. -<br />
VOSSCHULTE und SCHWARZKOPF; M. M. W. S.580,193S (Absc. pulmón.).- VULCANESCU<br />
und ALEXIU: Rev. Radiol. Electr. Med. S. 257, 1942.<br />
WAGNER-JAUREGG: Wien. M. W. 8,328, 1932 (Paralyse). - WAHRER: A. P. T. 21,<br />
S.410, 1940 (Sinus). - WAITER: Jl. de Radiologie d'P21ektro logic usw. 31, 319, I9S°<br />
(Wellenlängen). - WAKABAYASHI; Jap. Med. Sei. j, S.ijo, 1938; 6, S.io, 1940. - Ders.<br />
und SAWADA : Jap. J. Med. Sei. Trans. 3 (Chemie). - WAKIM, GERSTEN, HERRICK, ELKINS,<br />
KRUSEN: Arch, oí Physic. Med. (Am.) 29, 583, 1949 (Mikrowellen). - WALINSKI und<br />
310
BLEISCH: D.M.W. S.717,1959(Cholesterin).-WALTER¡Bull.Soc.Franc.Elcctr.46,S.214<br />
1937. - WARREN, SCOTT, CARPENTER: J. amer. med. Assoc. S. 109, 1937. - WEGHAUPT<br />
Z. Geburtsh. u. Gyn. 148, H 3, 1957 (Zwischenhirn, Ca.) - Ders. und WENGRAF:<br />
Wien. med. Wo. 102, S.260, 1952 (Gynäk.). - WEINMANN und WEISSENBERG: Zahnärzte<br />
Rdsch. S.1897, 1933. - WEISSENBERG: Wien. M. W. 8.778, 1937. Int. KW-<br />
Kongr. 1937, S.329. Int. Kongr. phys. Ther. London 1936. - WEISZ: Die physikal.<br />
11. techtt. Grundlagen der Hochfrequen^bebandhmg, Wien 1935, - Ders.: Balncol. S. 154, 1935<br />
(Spulenfcld). ~ WEITZ, PICK, TOMBERG: Kl. W. 21, S.750,1937 (Physik). - WENK: Strahl.<br />
S.113, 1938; 65, S.6j7, 1939 (Physik). - VON WENT: Shorts wave and Ultrasonics,<br />
Amsterdam 1934- _ WESTERMARK: Skand. Arch. Phys. 52, 1927 (Tumor und Temp.). -<br />
WETZEL und KIESSELBACH: Strahl. 64, S. 322,1939, D.M. W.62, S.725,1936.-WHITNEY:<br />
Jl. Am. M.Ass. 104, S. 1794, 1935 (Auge). - Ders.; Gen. Electric Revue 35, S.410,1932.-<br />
Ders. und PAGE: A. P. T. 16, S.477, 1935. - WILBOUR, LLOYD, STEPHENS: South. M. J.<br />
(Am.) 30, 1937. - WILGUS, KUHNS: A. P. T. 14, S.4j6, 1935. - WILKE und MÜLLER:<br />
Kolloid-Z. 65, S.257, 1933 (Kolloide). - WILSON, JUSTINA: The Brit. Homoeopath. Jl.<br />
1938, Brit. Jl. Ph. M. 9, S.203, 1935. Proc. Roy. Soc. 1934.- WINTZ: Zbl. Gynäk. S. 1719,<br />
1939 (Endokrin.), Wien. M. W. Nr. 28, S. 781,1937. Strahl. 60, S. 61 Í , 1937 (Gynäk.). D. M.<br />
W. S. 1095, 1937. - WIRTH: D. M. W. S. 183 u. 577, 1941 (Pertussis). - WISE: A. p. M.<br />
29, S. 17, 1948 (Mikrowellen, Blutstrom). - WITTE: Strahlentherapie 97, S. 146, 1955. -<br />
WITTENBECK: Fortschr. Rö. 50, S.53, 1934. Radiol. Rdsch. 2, S. 143, 1933. Strahl. 47,<br />
S. 540,1933; 50,1934. IV. Int. Radiol. Kongr. 1934. Z. Krankcnhausw. 1935.-W1TTHOFF:<br />
Diss. Würzburg 1945 (Provok. d. Appendizitis). - WOEBER: Hautarzt 7, S.228, 1956. -<br />
WOLF, H. : Int. KW-Kongr. S.212,1937. - WOLF, R. Fortschr. Thcr. 11, S.721, 1935. -<br />
WOLF: Arch. phys. Thcr. 9, S. 150, 1957. - WÜST, IRMGARD: Diss, Würzburg 1944 (Blutzucker.).<br />
YOUE: Diss. Hamburg 1936 (Gynäk.). - YOSHISHIRO: Jap. Jl. Urol. 29, S.41, 1940<br />
(Enuresis). - YOUNG und DAY: Proc. Soc. Exp. Biol. 28, S. 1080, 1931. - YAMADA:<br />
Fukuoka Act. M. 34, S.41, 1941 (Kokken).<br />
ZANETTI: An. Rad. Fis. Med. 2, 1938. - ZANINÍ: Med. Ital. 24, S.73, 1943. - ZEITER<br />
und RENSHAW: A. P. T. 22, S.452, 1941 (Colon.). - ZIMMER: KW-Kongr. S.328, 1937<br />
(Kombin. Rö.).<br />
3"
ABDERHALDEN 60<br />
ADAM 214<br />
ADLER, E. 229, 230<br />
AHRENS 46<br />
AlSENBERG l6j, 202, 20J<br />
ALM 216<br />
ALMBORG, I. 92<br />
ANDERSON 183<br />
ANTOGNETTI 230, 232<br />
ApEL 214<br />
APOSTOLI 25<br />
ARBOGAST 163<br />
ARCHANGELSKS 97<br />
ARCURI 92, 108, 253, 254<br />
ARENDT 253<br />
AROLD 170, 220<br />
ARONS 225<br />
d'ARSONVAL I, 24<br />
ASCOLI 256<br />
AucLAIR 2, IOS, 117, 147,<br />
I54, 164, 206, 208, 209,<br />
244<br />
BACHEM 95, 118<br />
BADAINES 198<br />
BALDI 205<br />
BARRON & BARRAFF 8}<br />
BARTFLS 254, 255<br />
BARTH 126, 152<br />
BARZETT 151<br />
BAUMGARTS 166<br />
BECHTEREW 192<br />
BECKER 91, 108, 226<br />
BECKMANN IO8, 208<br />
BELIKALA 133<br />
BELT 196<br />
BENNET 208<br />
v. BËRDT 224<br />
BERGER 108<br />
BERGLER 163, 253, 254,<br />
255<br />
BERNARD 198<br />
BERMARDI183<br />
BERNHARD 261<br />
BERRY 218<br />
BERTALAN 204, 245<br />
BERTOLOTTO 204, 245<br />
BESSEMANS 5S, 107, 132,<br />
I JO, 206, 208<br />
BETTGE 2j6<br />
BlEBßR 2 I 5<br />
Namenverzeichnis<br />
BIERMAN 154, 206, 209<br />
BINET IJ4, 244<br />
BlRCH-HlRSCHFELD 2J3<br />
BIRKNER 225<br />
BOAK I08<br />
v. BODO 204, 245<br />
BÖNI78<br />
Bonn 217, 237<br />
BOYLE 8l<br />
BRAENSTRUP 256<br />
BRAGA 228» 230, 231<br />
BRECHER 108<br />
BROWN 71<br />
BRÜHL 163<br />
BRUETSCH 208<br />
BRUGSCH 160, 175<br />
BRUNO 202<br />
BUCHANAN 81<br />
BÜRKI2J5<br />
BÜRKMANN 216<br />
BuRKERT 270<br />
BURMÊISTER 255<br />
BURNETT 190<br />
BURSTÏN 2, 43<br />
BURTON 33, 43<br />
BUSSE GRAWITZ 254<br />
CAAN 224<br />
CAFFARETTO 204, 245<br />
CAHEN 166<br />
CALCIJI-NOVATI 218<br />
CARPENTER 2, 108, 206<br />
CARTER 133<br />
CASTEJ-AIN 81, in<br />
CHEYNE-STOKES 153<br />
CHOREN 162, 163<br />
CHRANOWA I 11<br />
CIGNOLINI 2, 64, 94, 96,<br />
146,204,216, 244, 245<br />
ClULA 202<br />
ClOLLA 204, 245<br />
CLARK 255<br />
CLAUSZEN 119<br />
COHEN 82<br />
COLARIZI 210<br />
COOK 81<br />
CRESPO 164<br />
CROWE 190, 206<br />
CULLER 253, 25 5<br />
CUOLLA I6J<br />
CUTLER 67<br />
312<br />
DÁNZER 138<br />
DAILY 255<br />
DALCHAU 65, 204<br />
DALTON 97<br />
DAMPERE 153<br />
DAUSSET 83, 196, 204, 209,<br />
215, 143, 244, *4î, 246<br />
DAVIS 214<br />
DAVISON 190, 206<br />
DEBYE 39, 71<br />
DE DECKER 253, 254<br />
DELANGLADE 183<br />
DELAUNY 111<br />
DELHERM 84, 163, 166<br />
DENIER 67, 135, 224, 225<br />
DENK 160<br />
DESGREZ 95, 229, 232<br />
DlEFFENBACH 163, 173, I7J<br />
DIEKER 163, 166, 173, 18s<br />
DIMBERC, RUNE 92<br />
DOENECKE, 217<br />
VAN DRIEST 118<br />
DUPUYTREN 190<br />
EBAUGH 208<br />
EBBINGIIAUS 115, 141<br />
ECKER IO8<br />
EGAN 160<br />
EHRLICH HI<br />
EISENREICH 217<br />
ENGELMANN 96<br />
HRBSLÖH 228<br />
ERICKSON 81<br />
ESAU I, 25, 26, 29, 43, 46,<br />
66, 71, 84, 147<br />
ETTER 141<br />
EULER 25 5<br />
FABRI226<br />
FABRIKANT 107<br />
FAINSILVER 166<br />
FALKENHAGEN 39<br />
FARADAY 133<br />
FERNER 240<br />
FERRIER 204, 244, 245<br />
FEULGEN 93<br />
FEUSTEL 218<br />
FlANDACA I73, 185<br />
FlOLLE l8 J<br />
FISCHER 90
FISCHGOLD 84<br />
FlSHBERG 154<br />
FÖDERL 163, 202, 204<br />
FOLKENBERG I96<br />
FoNio 187<br />
FORSTER 108<br />
F RADA 244<br />
FRANOLLON-LOBRE 203<br />
FREDERICK 255<br />
FREUND 164<br />
FRIEBOES160<br />
FRITSCH 135<br />
FRÖHLICH 234<br />
FUCHS 157, 160, 162, 217,<br />
224,225,253<br />
GAUSS 245<br />
GAVIC 255<br />
GEBBERT 50, 59, nj, 138,<br />
188<br />
GERSH 141<br />
GERSTEN 80, 81, 118<br />
GESENIUS 202<br />
GlARDINA 204<br />
GlAVOTTI 204<br />
GILDEMEISTER 54,55<br />
GILES 153<br />
GIORDANO 107<br />
GiRAL ;8, 67, 91, 265<br />
GjERTZ 43, 8l<br />
GLOZ 95, 118, 205<br />
GOETZ 163<br />
GRAF 198<br />
GRANOVA 107<br />
GRASSER 107<br />
GROAG 107<br />
DE GROOT 229<br />
GROPLER 236, 244<br />
GRÜTER 251, 252, 253, 255<br />
GRYNBAUM 166<br />
GüARINI 186<br />
GÜNTHER 230, 264<br />
GlSERCIO 231<br />
GUMPERT I96<br />
GUTHMANN 204, 256<br />
GUTSCH 163, 253, 254, 255<br />
GUTZEIT 256<br />
HAASE IOJ, 106, 107, 116,<br />
266<br />
HABER I 17<br />
HALPHEN 2, 147, 164, 206,<br />
209, 244<br />
HAMANN 173<br />
HA RM SEN 86<br />
HARTL 262<br />
HASCHE 105, 108, 109, 132<br />
HAUER 217<br />
HAUPTMANN 154<br />
HAUS 231<br />
HAUSMANN 254, 255<br />
HAUSSER, Isolde 38, 67, 91,<br />
265<br />
HEEREN in, 224, 225<br />
HEINRICH 114, 137<br />
HEISE (65<br />
HELLER 67, 106<br />
HERRICK 79<br />
HERTEL, F.. 85<br />
HERTENSTEIN, H. 251<br />
HERTZ I, 3, 6<br />
HERVEY, 153<br />
HESSEL 70<br />
HEYMANN 230, 264<br />
HIBBS 219<br />
HILDEBRANDT 2, 95, 119,<br />
154<br />
HILL 97<br />
HlNES 80, 8l, 2JJ<br />
HINSIE 2, 147, 206, 209<br />
HIRSCHFELD, BIRCH 254,<br />
255<br />
HOFFMANN, W. 252<br />
HOLMQUEST 156<br />
HOLZER 40<br />
HOOK 92, 93<br />
HORTEN, E, 232<br />
HOUSSAY 237<br />
v. HRABOWSKY 163, 175<br />
HUKASAKO 217<br />
IREDELL 166, 225<br />
IRGENSONS 68<br />
ISLER 164, 194<br />
IZAR 67, 70, 108<br />
JAHN 231<br />
JAHNEL 206<br />
JAKOBI 261<br />
JAMIN Ï.16<br />
JELLINEK 86, 163<br />
JENSSEN I 10<br />
JORDAN 198<br />
313<br />
JÖRNS 69, 83, 85, 92, no,<br />
119<br />
JOULE 53, 264<br />
KAETHER 193<br />
KARPF 256<br />
KAUDERS 205, 206<br />
KELLER 69<br />
KELLNER 85, 244<br />
KELSTRUP 246<br />
KEMP 81<br />
KERESZTY 85<br />
KETTERING 151, 208<br />
KIEWE, P. 251<br />
KIHN, L. 97, 22S, 229, 236,<br />
244, 246<br />
KIRCHHOFF 52<br />
KISSUNG 185<br />
KLARE 210<br />
v. KNORRE 84<br />
von KOEHLER.E. 47,48,251<br />
KÖNIG 216<br />
KOEPPEN 152, 156, 190,196<br />
KÖRBER 70<br />
KÖRTE 183<br />
KÖVESLIGETHY 163, 202,<br />
204, 245<br />
KORB 66, 201, 224, 225<br />
KOSMANN, A. J. 95<br />
KOWARSCHIK 48, 49, j 1, 56,<br />
72,95,109,115, 132,133,<br />
137, 138, 140, 160, 164,<br />
166,188,201,202, 217<br />
KOYANAGI 217<br />
KRAINIK 70<br />
KRASEMANN 175<br />
KRASNY-ERGEN 40, 70, 109<br />
KRAUS 168<br />
KRAUSE, K. 38<br />
KRAUSZ 254<br />
KROISS 259<br />
KROLL 91, 226<br />
KRUSE-DOCHEZ 193<br />
KRUSEN 79, 80, 198<br />
KÜCHLEIN 256<br />
KÜVER 230<br />
KUHN, RiCH. 38,61,91,265<br />
KULKA 109, 133<br />
KUTTIG 96<br />
LADEBURG 81, 118<br />
LAKHOVSKY I
LANDEBURG 79<br />
LANGE, S. 89<br />
LANGENDORFP 224, 225<br />
LASCHE 209<br />
LASFARQUE III<br />
LAST 215, 216<br />
LAUDAT 154<br />
LA UN 180<br />
LAUTENBACH 166<br />
O'LEARY 108, 208<br />
LECHER 22,73, 12 ^> 12 7><br />
128, 129,130, 135<br />
LEHMANN 152<br />
LEISTNER 141<br />
LEITNER 187<br />
Me I.ENNAN 33, 43, 45<br />
LENTZE IOJ<br />
LENZ 224<br />
LEPESCHKIN 67<br />
LEROY 49<br />
LESKOVAR 198<br />
LEUNIG 105<br />
LEVADITI 117, 208<br />
LEWIS 208<br />
LEZIUS 160<br />
LIDMANN 82<br />
LIEBESNY 67, 96, 106, 107,<br />
io8, 110, 157, 159, 160,<br />
166, 173, 185, 205, 215,<br />
266<br />
LIÈVRE 163, 202, 203<br />
LION 140<br />
LIPPELT 106<br />
LITTERER 164<br />
LOB 186, 187, 199<br />
LOBRE 202<br />
LOCH 108<br />
LOOMIS 43<br />
LORD 184<br />
LORENTZEN 228<br />
LOTMAR 78, 97<br />
MC LoUGHLIN I98<br />
LOWANA 206<br />
LOWANCE 190<br />
LUTZ 231<br />
MAGORA, A. 229, 230<br />
MAHLO 237<br />
MAHN 164<br />
MANN 196, 198<br />
MANSTEIN 24(1<br />
MARAGLIANO 186<br />
MARCONI I<br />
MARIE 209<br />
MARQUES 107<br />
MARSHALL 150<br />
MARTIN 81, 164, 184<br />
MARTINEZ 108, 208<br />
MAS 255<br />
MASSAZZA 206<br />
MATOLAY 184<br />
MAURICI 255<br />
MEDAKOVITCII 209<br />
MEHRTENS 154<br />
VAN MEIRHAEGE 150<br />
MEISSNER 26<br />
MENKE 210<br />
MERDINGER 166<br />
MEUWSEN 261<br />
MEYER 108<br />
MICHELSON 108, 163, 166<br />
MIDDELDORPF 184<br />
MlGNOT 184<br />
MlKAWA 225<br />
MlLETZKY 107<br />
MITTELMANN 133<br />
MOLEriNO 186<br />
MORETTI 67, 108<br />
MORGAÑO 92<br />
MORICARD 202<br />
MORRISON 184<br />
MOSSBERG 225<br />
MÜHLENIIARDT 224<br />
MÜLLER 69, 184, 224<br />
MÜLLER, Chr. 224<br />
MURPHY 81, 184<br />
MUTH 185<br />
NAGELL 196, 198<br />
NAKASHIMA 108<br />
v. NEERGAARD 191, 193<br />
O'NELL 108<br />
NERNST 23<br />
NEYMAN 2, 108, 147, 154,<br />
206<br />
NICOLAI 70<br />
NISSEN 184<br />
NiTSciiKE 132, 146, 176<br />
NÖLLER88, ÏI9<br />
v. NORDHEIM 2, 39, 67, 90,<br />
OAK 206<br />
O ARTEL 106<br />
v. ÖTTINGEN 87, 88, 92, 93,<br />
in<br />
314<br />
OLIVIERI 95<br />
OSBORNE, St. L. 9;, 154,<br />
2r9. 2 55<br />
OSSWALD46, 295<br />
OSTERTAG 93,102,103,117,<br />
226<br />
OSTRCIL 204, 245<br />
OVERZIER 236<br />
PÄTZOLD 2, 31, 32, 33, 4o;<br />
41,43,46,47, 56, 58, 59,<br />
72, 73. 75, 77, 12», 133.<br />
134, 137, 138, 141, M3.<br />
217<br />
PÄTZOLD& KEBBEL I25<br />
PAINVIN 229, 232<br />
PALMIERI 107<br />
PAUL 81<br />
PELLETIER 81, in<br />
DE PEREIRA FORJAZ 69<br />
PERONA 198<br />
PESON 108<br />
PETCO 190<br />
PFANNKUCH 256<br />
PFLOMM 2, 85, 88, 89, 90,<br />
93, 94, 96, 99, no, in,<br />
116, 117, 119, 161, 164,<br />
196, 197, 198, 215<br />
PHILIPS 164<br />
PINELLIS 186<br />
PlOTTI228,23O<br />
POSATI I46<br />
POUPPIRT I 54<br />
PRATT 64, 160, 175<br />
PRIETZEL 167<br />
PROUST 202<br />
PUDENZ 141<br />
PULSFORD 202<br />
PURTSCHERT, Lu2crn 125<br />
RAAB 2, 108, 132, 133, 144,<br />
146, 147, 152, *53, 154,<br />
156, 196, 200, 201, 202,<br />
203, 204, 206, 208, 244,<br />
245<br />
RABINOWITSCH 254<br />
RAE 79<br />
RAHMENFUHRER 184<br />
RAJEWSKY 2, 46, 98, 155<br />
RAKOFI 1 246<br />
RANDALL 80<br />
RATSCHOW 193
RAUSCHER 66,146,163,167,<br />
202<br />
RAYNAUD 215<br />
RAYTHEON 128<br />
RÉCHOU 200, 204, 20g<br />
RECKNAGEL 67, 69<br />
REDEVILLE 108, 208<br />
REISS 91, 226<br />
REITER 85,99, I I I, 113, 205<br />
RENSHAW 156, 199<br />
REUSCHER 201<br />
RHEINBOLDT 70<br />
RICHARDS 43<br />
RIEGER 255<br />
RINTELEN 166, ï8
WALINSKY IJI<br />
WALTER 154<br />
WARREN 108, 208<br />
WEESE 225<br />
WEGHAUPT 245<br />
WEGNER 254<br />
WEICHBRODT 206<br />
WEISSENBERG 2, 225<br />
WEISZENBERG 91<br />
WEITNAUER 258<br />
WELTZ 216<br />
WENGRAF 245<br />
VAN WENT, E. 246<br />
WERNER 224<br />
WERTHEIM 106, 109, no<br />
WESTERMARK m<br />
WEYMANN 108<br />
WHITNEY 82<br />
WIEN I<br />
WIEN, M. 54<br />
WILD 216<br />
WILDERMUTH 5Î<br />
WlLKE 69<br />
WlLLBUR I J J<br />
WILSON 164, 203<br />
WILSON, J. 196<br />
WINTZ 201, 202, 204, 244,<br />
245,246<br />
WlRTH 175<br />
WITTE, H. 85<br />
316<br />
WlTTENBECK III, 204<br />
WITTHOFF 257<br />
WOLCOTT 184<br />
WOLF 106, 199, 244<br />
WÜLLENWEBER IJ2<br />
WÜLLER I18<br />
WÜST 90, 91, 154, 204, 226<br />
YAMADA 107<br />
YOUNG 237<br />
ZANINI 175<br />
ZEITLER 156, 25;, 254<br />
ZEZI 255
Abgriff 15<br />
Abkühlungsgröße 62<br />
Ablatio retinae 255<br />
absolute Tiefendosis 58<br />
absolute Tiefenwirkungij7<br />
Absorption 38, 79<br />
Abstand 43<br />
Abstand der Elektroden 50,<br />
146<br />
Abstandsbchandlung 121<br />
Abstandsbchandlung, freie<br />
139<br />
Abstandsprinzip 2, 34, 35,<br />
57,73.135<br />
Abstimmung 14, 124, 297,<br />
298<br />
Abstimmung der Krcisci34<br />
Abscess orbitae 280<br />
Abszesse io6,116,117, n8,<br />
120, 266, 276<br />
Abszeß, gangränöser 175<br />
Abszeß, paratonsillarer 167<br />
Abwehrkräftc 108, 270<br />
Abwehrstoffe 268<br />
Acetylcholin 233, 237<br />
Acne 164, 280<br />
ACTH 227, 229<br />
Actinomyces 107<br />
Aderhaut 254<br />
Adhäsionen 200<br />
Adhäsionsbeschwerden 276<br />
Adipositas 244<br />
Adiuretin 232<br />
Adnexerkrankungcn 200<br />
Adnexitis 256, 274, 280<br />
Adnextubcrkulosc 202<br />
Adnextumorcn 201<br />
Adrenalin 228, 233<br />
After 66<br />
Agglutination 67<br />
Agglutinationstiter 70<br />
Akrocyanosc 214, 235, 243,<br />
280<br />
Akromegalic 233<br />
Aktinomykosc 108, i66,<br />
280<br />
Aktivierung 115, 256, 270<br />
akute Erkrankungen 145<br />
Alkalircscrvc 154<br />
Allergie 187<br />
Allgemeinbefinden 82<br />
Sachverzeichnis<br />
Allgemcinbehandlung 154<br />
Allgemeinwirkungen 84<br />
Alloxan 243<br />
Alopccien 243<br />
Ambozcptor 108<br />
Amenorrhoen 204, 243,<br />
245,274<br />
Amperemeter 133<br />
Amperesekunden 292<br />
Anachoresc 256<br />
Analiissur 199, 280<br />
Analfistcln 166, 273, 280<br />
Angina 167, 170, 280<br />
Angina pectoris 215, 233,<br />
271,280<br />
Angiospasmcn 2i4> 280<br />
Anodenstrom 26<br />
anomale Dispersion 38<br />
Anordnung der Elektroden<br />
140<br />
Antennen 134<br />
Antibiotika 173, 208<br />
Antikörper 268<br />
antispasmodisch 199<br />
Antitoxinbildung 70<br />
Antitoxinmengen 69<br />
Anuric 217, 280<br />
Anwendung, unipolare 140<br />
aperiodisch 19<br />
Apoplexien 187, 215, 232,<br />
233<br />
Appendizitis 199, 256, 2J7,<br />
273,276,280<br />
Armnerven 211<br />
Armncuralgic 213<br />
d'Arsonvalisation 23<br />
Artcriolcn 267<br />
Arteriosklerose 214, 241,<br />
271, 280<br />
Arthralgien 186<br />
Arthritidcn 148<br />
Arthritis 275, 280<br />
Arthritis deformans 191<br />
Arthritis, gonorrhoische<br />
197,198<br />
Arthritis sicca 191<br />
Asthma 272, 280<br />
Asthma bronchiale 148,171<br />
Atemfrequenz 154<br />
Atmungsorganc 171<br />
Atom 6<br />
317<br />
atrophische Säuglinge 244<br />
Augen 80, 83, 251<br />
Ausstrahlung 18<br />
Autohormontherapic 243<br />
Autokonduktion 24<br />
Azetylcholin 228<br />
Bact. coli commune 107<br />
Bäder 151<br />
Bakterien 105, 265<br />
bakterizide Kraft 108<br />
Bandschcibenprolaps 193<br />
Bandschcibenschädcn 192<br />
Basedowsche Krankheit 244<br />
Bauchdeckenabszesse 204<br />
Bauchfcllvcrwachsung 273<br />
Bauchorgane 5 5<br />
Bauchspeicheldrüse 273<br />
Bauchtuberkulose 261<br />
Becken 201<br />
Bcckenneuralgie 194<br />
Behandlung, monopolarc<br />
297<br />
Behandlungsarten 253<br />
Bchandlungsergcbnissc<br />
iS6<br />
Behandlungskreis 134<br />
Bein 61<br />
Beschwerden 82<br />
Beschwerden, klimakterische<br />
245<br />
Bewegungsapparat 275<br />
Bewegungsübungen 192<br />
Bilirubin 92<br />
biologische Dosierung 146<br />
Blase 6;, 200<br />
Blasenschlcimhaut 96<br />
Blindstrom 13, 33<br />
Blockkondcnsator 9<br />
Blut 87<br />
Blutbild 87, 268<br />
Blutbildung 245<br />
Blutdruck 153, 214<br />
Blutergüsse 186<br />
Blutgefäße 146, 214<br />
Blutgerinnung 88<br />
Blutgcrinnungsücit 232<br />
Blutkörperchen 36<br />
Blutkörperchensenkung 87<br />
Blutkreislauf 93, 153<br />
Blut, K-Spicgel im 92
Blut, Leitfähigkeit des - 92<br />
Blut-Liquorschrankc 154<br />
Blut und Plasma Viskosität<br />
von 92<br />
Blut, Wärmcentstchung im<br />
44<br />
Blutsenkungsgeschwindigkeit<br />
92, 256, 257<br />
Blutstrom 61<br />
Blutungen 254<br />
Blutungszeit 232<br />
Blutzirkulation 79, 81<br />
Blutzucker 91, 154, 227,230<br />
Blutzuckergehalt 119<br />
Blutzuckerregulierung 225<br />
Blutzuckerkurve 23}<br />
Brechung 21, 31, 131<br />
Brennlinie 77<br />
Brennpunkt 77<br />
brisement forcé 193<br />
Bronchektasen 176<br />
Bronchialkarzinom 247<br />
Bronchiektasen 272<br />
Bronchitis 171, 272, 280<br />
Bronchopneumonien 166<br />
BSG 256, 2J7<br />
Bündel, Hisschcs 49<br />
Bündelung 59<br />
Calcancussporn 194<br />
Carzinomatosc 232<br />
Cardiospasmus 272<br />
CuEYNE-STOKEssches Atmen<br />
153<br />
Cholangitis 199, 261<br />
Cholesterin 226, 230, 262<br />
Cholesteringehalt 92<br />
Cholezystitis 199, 261, 273,<br />
280<br />
Chorea minor 209, 276<br />
Chorioiditis 253, 271, 280<br />
Chronaxie 84<br />
Claudicatio intermittens<br />
215, 271, 280<br />
Coccygodynic 194, 280<br />
Cólica mucosa 199<br />
Colitis 280<br />
Colitis ulcerosa 199<br />
Coltitis 199<br />
Contusio 275<br />
Contusio cerebri 276<br />
Cortison 191<br />
Coulomb 292<br />
Coxitis 275<br />
Cushing-Syndrom 234, 243,<br />
244<br />
Cu-Sol 67<br />
Cystitis 2i8, 273, 274, 280<br />
Cystitis ulcerosa 218<br />
Cystopyelitis 273<br />
Dämpfung 13, 15, 18, 20,<br />
32,290<br />
Dämpfungsdekrement 121<br />
Dämpfungskurven 19<br />
Dämpfungsvcrluste 34<br />
Dakryozysitis 280<br />
Darm 199<br />
Darmkontraktionen 198<br />
Darmtuberkulose 223<br />
DEBYE-FALKENIIAGEN-Effekt<br />
39<br />
Dckameterwcllen 6<br />
Delirien 153<br />
Demarkation 158, 186<br />
Dementia praecox 206<br />
Dczimetcrwcllen 6, 126<br />
Diabetes 227, 246<br />
Diabetes insipidus 244, 275<br />
Diabetes mell. 275<br />
Diabetes, renaler 241<br />
Diabetiker 237, 238<br />
Diagnostik 256<br />
Diapcdesc 90,<br />
Diathermicapparate 24<br />
Dickdarmkatarrh 273<br />
Dielektrikum 9, 14, 32, 58,<br />
264, 293<br />
Dielektrikum, homogenes<br />
40<br />
Dielektrikum, inhomogenes<br />
43<br />
dielektrische Verluste 19,<br />
32<br />
Dielektrizitätskonstante 9,<br />
3». 34, 3
Elektrodenabstand 67<br />
Elektroden, Anordnung<br />
der- 141, 146<br />
Elektrodeneinstellungen<br />
2-11<br />
Elektroden, schmiegsame<br />
137,297<br />
Elcktrodcnschuhc 115, 139<br />
Elektrodenschuhe, Glas-,<br />
Luft- î9<br />
Elcktrolyte 40<br />
elektrolytischc Zersetzung<br />
34<br />
Elektrolytkonzcntration 40<br />
elektromagnetische Welle<br />
74<br />
elektromagnetische Wellen<br />
HERTZ sehe 3<br />
Elektronen 26<br />
Elektronenröhre i, 25<br />
Elektrophorcsekurvc 263<br />
Elcktropyrexic 147<br />
Embolie 166<br />
Emission 26<br />
Empyema pleurae 171, 280<br />
Empyem, chronisches 168<br />
Empyem, interlobärcs 175<br />
Empyem nach Grippe 183<br />
Empyemresthöhle 221<br />
Empyem, tuberkulöses 221<br />
Emulsionen 43<br />
Endarteritis 280<br />
Endarteritis obliterans 215<br />
Endokarditis 215, 258, 262,<br />
271<br />
endokrin 235<br />
endokrine Drüsen 146, 268<br />
endokrines System 225<br />
Endokrinium 268<br />
Endometritis 274<br />
Energie 17<br />
Entlastung, thermische 54<br />
Entzündungen 118, 166,<br />
266,267<br />
Entzündungen, eitrige 157<br />
Entzündungsherde 256<br />
Enuresis noct. 276<br />
Enzephalitis 209<br />
Enzephalographic 205<br />
eosinophil 229<br />
Epicondylitis 194<br />
Epididymitis 218, 274<br />
Epikondylitis 280<br />
Epilepsie 276<br />
Episkleritis 253, 254, 280<br />
Erfrierungen 164, 214, 216,<br />
271,280<br />
ergotrope Funktion 227<br />
Ergüsse in Gelenken 187<br />
Erkältung 104<br />
Erkrankungen, akute 145<br />
Erkrankungen, arthtitischc<br />
187<br />
Erkrankungen, gonorrhoische<br />
204<br />
Erkrankungen, gynäkologische<br />
200<br />
Erkrankungen, rheumatitischc<br />
187<br />
Erwärmung 30, 59<br />
Erwärmung, selektive 50<br />
Erysipele 164, 274, 282<br />
Erythema 282<br />
Erythema induratum 164<br />
Erythema multiforme 164<br />
Erythema nodosum 164<br />
Erythrozyten 45, 87, 92<br />
Erythrozytenzahl 15 3<br />
Erzeugung 23<br />
eosinophile Zellen 92<br />
Exsudate 221, 250, 253<br />
Exsudate, intcrlobärc 175<br />
Exsudat, tuberkulöses 183<br />
Färbbarkcit 107<br />
Farad 289<br />
FARADAYschcr Käfig 133<br />
Farbreaktionen 13;<br />
Farbstoff 116<br />
Fazialislähmung 211, 282<br />
Fazialis-Parcse 275<br />
Feld 8, 138<br />
Felddichte 137<br />
Feld, elektrisches 3, 291<br />
Feld, magnetisches 3, 11<br />
Feldcncrgic 33<br />
Feldkräfte 32<br />
Feldlinien 3, 30, 279<br />
Fcldlinienbildcr 59<br />
Feldsondc 59<br />
Feldstärke 18, 31, 134, 142,<br />
269, 296<br />
fermentative Prozesse 70<br />
Fett 49, 51<br />
Fettkapscln 56<br />
Feuchtigkeitsansammtung<br />
140<br />
319<br />
Fibrinogen 92<br />
Fibroadenomatosis 225<br />
Fieber 151<br />
Fieberkurve 98<br />
Filtrierpapier 140<br />
Filz 59, iij, 136, 140<br />
Filztaschen 142<br />
Fissuren 166<br />
Fistclcitcrung 272, 273<br />
Fisteln 166, 282<br />
Flachspule 6, 72, 137, 143,<br />
201<br />
Fliegen 84<br />
Flüssigkeiten 32<br />
fokale Infektion 166<br />
Follikulitis 274<br />
Formel, KIRCHHOFE<br />
TnoMSONsche 14<br />
Fortpflanzungsgeschwindigkeit<br />
287<br />
Frakturen 186<br />
freie Abstandsbchandlung<br />
139<br />
freier Luftabstand 136<br />
Fremdkörper, metallische<br />
"5<br />
Fremdsteuerung 27<br />
Frequenz 3, 9, 30, 34, 287<br />
FRÖHLICHSCIIC Dystrophia<br />
adiposogentalis 244<br />
Froschherzen 96<br />
Frostschäden 141, 216<br />
Frühinfiltrat, tuberkulöses<br />
220, 224<br />
Frühkavernen 224<br />
Fungus 275<br />
Funkenstrecken 23<br />
Funkcnstrcckenapparatc<br />
131<br />
Funktion, ergotrope 227<br />
Funktionsprüfung 227, 228<br />
Furunkulose 157, 268, 274,<br />
282<br />
Gärfähigkeit 108<br />
Gallenblase 273<br />
Ganglien 194<br />
Gangrän 214, 241<br />
Gangrän, diabetisches 238<br />
Gangrän, RAYNAUDSCIIC<br />
215<br />
gangränöser Abszeß 175<br />
Gasthermometer 132
Gastritis 199, 272<br />
Gastroenteritis 272<br />
Gefäßerweiterung 118<br />
Gefahren der Kurzwcllenbehandlung<br />
112<br />
Gegenindikationen 156<br />
Gcgcnrcgulierungcn 229<br />
Gegentakt 29, 122<br />
Gehirn 53, 93<br />
Gchörgangsfurunkcl 15 9,<br />
169<br />
Gelenke 5;, 185<br />
Gclenkcrgüssc 187, 282<br />
Gclenktuberkulose 259<br />
Genehmigung 25<br />
Gcnitalfunktion 245<br />
Genitalzyklus 24;<br />
Gerstenkörner 253<br />
Gesamtcholesterin 230<br />
Geschlechtsorgane 274<br />
Geschoßsplitter 140<br />
Geschwür, syphilitisches<br />
163<br />
Geschwür, tuberkulöses<br />
163<br />
Gesetz, JouLEschcs 53<br />
Gesetze, M. WiENsche 54<br />
Gcsichtsfurunkcl 159<br />
Gewebe 32, 46<br />
Gewebe, menschliche 49<br />
Gewebsdiabetcs 241<br />
Gewcbskulturcn 110<br />
GiLDEMEisTERSche Lehren<br />
jj<br />
Gingivitis 165, 272, 282<br />
Gitter 26<br />
Glas 57<br />
Glas-Luft-Elektrodcnschuhc<br />
59<br />
Glaskörperblutungen 255<br />
Glasschalen 136<br />
Glassorten 138<br />
Glaukom 255<br />
Gleichrichtung 28<br />
Gleichstrom 23, 33<br />
Gliom 246<br />
Glomerulonephritis 218,<br />
273<br />
Glühkathoden 121<br />
Glühlampe 132<br />
Glukagon-Diabetes 240<br />
Goldpräparatc 191<br />
Gonadotropine 227, 246<br />
Gonokokken 107, 197<br />
Gonokokkcnepididymitis<br />
197<br />
Gonokokkcn-Infckt 148<br />
Gonorrhoe 196, 282<br />
gonorrhoische Arthritis<br />
148, 197, 198<br />
gonorrhoische Erkrankungen<br />
204<br />
Granulome 166, 282<br />
Grenzflächen 78, 293<br />
Grenzstromstärke 132<br />
Großhirn 113<br />
Grundumsatz 154, 244<br />
Gummi 58<br />
Gummielektroden 14<br />
Gummiüberzug 115<br />
gynäkologische Erkrankungen<br />
200<br />
Haare 112<br />
Hämarthros 187, 275<br />
Hämatome 166, 187, 255,<br />
282<br />
Hämatom, hämophiJes 187<br />
Hämoglobin 92<br />
Hämorrhoiden 166) 1991<br />
282<br />
Halbleiter 30, 32<br />
Halbwolle 28<br />
Halbwcrtschicht 78, 80<br />
Halswirbelsäulc 211<br />
Harnapparat 118, 273<br />
Harnlcitcrstcine 218<br />
Haut, Durchlässigkeit der<br />
menschlichen 97<br />
Hautkrankheiten 164» 274<br />
Hautoberfläche 31<br />
Haut, Überbrückung der 54<br />
Heilungsvorgänge 118<br />
Heißluft 151<br />
Heizstrom 26<br />
Henry 291<br />
Hepatitis 200, 273<br />
Herdinfekt 188, 189<br />
Herpes 117<br />
Herpes corneae 271<br />
Herpesstamm 251<br />
Herpes zoster 164, 212, 274<br />
HERTZsche elektromagnetische<br />
Wellen 3<br />
HERTZsche Wellen 6<br />
Herz 215, 258<br />
Herzgegend 215<br />
320<br />
Herzklappenfehler 262<br />
Herzoperationen 258<br />
Herzinfarkt 232, 233<br />
Hexan-Brom-Thermomcter<br />
132<br />
Hibernisation 217<br />
Hidradenitis 160, 274,282<br />
Hilfselektroden 140<br />
H-lonengchalt 92<br />
H-Ioncnkonzentration ny<br />
Hirnabszeß 209<br />
Hirnbasis 225, 262<br />
Hirnhäute 208<br />
Hirntumor 246, 249<br />
Hisschc Bündel 49<br />
Histamin 92, 95, 119, 214,<br />
267<br />
histologische Veränderungen<br />
92<br />
Hitzdrahtinstrumente 133<br />
Hitzempfindungen 83<br />
Hochfrequenz 23<br />
Hochfrcqucnzapparatc 24<br />
Hoden 92<br />
Hohlspiegel 1, 21, 75, 77<br />
Hordeolum 253, 282<br />
hormonale Störungen 204<br />
Hormone 228<br />
Hornhaut 254<br />
Hornhauterkrankungen 25 3<br />
Hüftgelenke 188, 194<br />
Hydronephrose 273<br />
Hydrops genu 275<br />
Hydrothorax 272<br />
Hyperämie 62, 119, 185,<br />
214,267<br />
Hypertension 214, 282<br />
Hyperthermie 72, 144, 147»<br />
188, 190, 206, 208<br />
Hyperthermie, maximale<br />
150<br />
Hyperthyreosen 233, 244,<br />
274<br />
Hypertonie 232, 271<br />
Hypogcnitalismus 282, 274<br />
Hypophyse 64,91,145,14*J><br />
191,226, 237, 269<br />
Hypophysenfunktionsprüfung<br />
235<br />
Hypophysengegend 88<br />
Hypopituitarisms 275,<br />
282<br />
Hypoplasien 204<br />
Hypopyon 253
Ikterus 199, 273<br />
Ileus 273<br />
Impedanz 264<br />
Impetigo 165<br />
Impfsarkom no<br />
Indikationen 156<br />
Indikationsgebiet 270<br />
Indikationsstcllung 188<br />
Induktanz 11<br />
Induktivitäten 288<br />
Indurado penis 282<br />
Indurado penis plastica2i9<br />
Infantilismus 24;, 275<br />
Infektherde 193<br />
Infektionen 116<br />
Infektion, fokale 166<br />
Infiltrate 276<br />
Influenz 8, 30<br />
Influenzerscheinung 30<br />
Inhomogenes Dielektrikum<br />
43<br />
Inhomogenitäten 44<br />
inkretorische Störungen<br />
IJ6<br />
Insektenstiche 187<br />
Insulin 241<br />
Insuffizienz, plurigl. 275<br />
Insulinresistenz 240<br />
Interkostalneuralgie 211<br />
Intcrlobärcmpycm 18;<br />
Involutionsstörungen 204<br />
Ionen 32, 34, 36, 39<br />
lonenkonzentration 23<br />
Ionisierung 54<br />
Iridozyklitis 253, 255, 282<br />
Iritis 253, 255, 271<br />
ischämische Kontrakturen<br />
187<br />
Ischias 194, 212, 276<br />
Isolatoren 32<br />
Isolicrmaterialicn 138<br />
Isolierschichten 57<br />
Isotopen 97<br />
JENSSEN-Sarkom 110<br />
JoULEsche Gesetz 33<br />
JouLEschc Wärme 264<br />
Kabel 296<br />
Kachexie, hypophysäre 234<br />
Kalkancusspron 282<br />
Kapazität 7, 14, 15, 134,<br />
141, 289<br />
kapazitive Widerstände 9,<br />
34,i3 8<br />
kapazitive Wirkung 7, 8,<br />
30,35,50,66<br />
Kapillaren 94, 119, 267<br />
Kapillaren, künstliche 119<br />
Kapillarmikroskop 94<br />
Kapsclschwcllungcn 190<br />
Karbunkel 159, 274, 282<br />
Karzinom 111, 261, 262<br />
Katarrhe 267<br />
Kathode 26<br />
Kaverne 224<br />
Kehlkopfödem 272<br />
Kchlkopftuberkulose 220<br />
Keimdrüsen 240<br />
Kcratits 2JJ, 282<br />
Keratitis diseiformis 253<br />
Keratitis herpetica 254<br />
Keratitis parenchyma tosa<br />
254<br />
Keratohyopyon 253, 282<br />
Ketostcroidc 92, 226, 227,<br />
230,232<br />
Ketten 70<br />
Kettcring-Hypcrthcrm 151<br />
Keuchhusten 175, 276<br />
Kicfcrgclcnkcntzündungcn<br />
166<br />
Kieferhöhlen 142, 168<br />
Kieferhöhlenvereiterung<br />
271<br />
KiRCHHOFFschcs Vcrtcilungsgesctz<br />
52<br />
KiRCHHOFFschc Regel 286<br />
KIRCHHOFF-THOMSONschc<br />
Formel 14<br />
Kleiderstoffe 140<br />
Kleidung 296<br />
klimakterische Beschwerden<br />
245<br />
Klimakterium 245<br />
Kniegelenke 64, 188<br />
Knochen 60, 185<br />
Knochcnbrüchc 186<br />
Knochendystrophic, Su-<br />
DECKschc 187<br />
Kochsaizausschcidung 232<br />
Kochsalzlösungen 40<br />
Körpertemperatur 150<br />
Körperwärme 97<br />
Kohlehydratbilanz 241<br />
kolloidaler Zustand 67<br />
Kolloidchcmic 38<br />
321<br />
Kolloide 7J 69<br />
Koma IJ3<br />
kombinieren, <strong>Kurzwellentherapie</strong><br />
mit anderen<br />
Heilmitteln 208, 267<br />
kombinierte Therapie 208,<br />
267<br />
Komplementbindungsvcrmögen<br />
70<br />
Komplcmcnttiter 92, 108<br />
Kompression 142<br />
Kondensatoren 4, 8, 9, 289<br />
Kondensatorbett 25<br />
Kondensatorclcktroden 137<br />
Kondcnsatorfcld 29, 83<br />
Kondcnsatorplattcn 6<br />
Kontrakturen, DUPUY-<br />
TRENSche 190<br />
Kontrakturen, ischämische<br />
187<br />
Konvcktion 119<br />
Konzentration des Feldes<br />
113<br />
Kopf 55,63<br />
Kopfschmerz 276<br />
Kopplung 15<br />
Kopplung, kritische 17<br />
Kopplungsclcmcntc 123<br />
Korncalabszcsse 253<br />
Koronarinfarkt 215<br />
Kraft, bakterizide 108<br />
Kraftfelder 2 t<br />
Kraftlinien 10, 40<br />
krankhafter Zustand 84<br />
Krankheiten, entzündliche<br />
156<br />
Krankheitserreger 267<br />
Krankheitsverlauf 158<br />
Kreatinin 86<br />
Kreisfrequenz 3, 11, 14<br />
Kreislauf 155<br />
Kreislauforgane 214<br />
Kreiswiderstand 15<br />
Kriegschirurgie 186<br />
kritische Kopplung 17<br />
K-Spicgcl im Blut 92<br />
Kurzwcllcnapparatc 121<br />
Kurzwcilenbchandlung,<br />
Gefahren der 112<br />
Kurzwellen-Biologie 1<br />
Kurzwcllcnprovokation<br />
120, 170, 188, 193, 258<br />
Kurzwellen-Röntgenbestrahlung<br />
224
Labgcrinnung 70<br />
Ladungen 7, 289<br />
Lagerung 296<br />
Langwellen-Diathermie 23,<br />
48,52<br />
Langwellcnstrom jj<br />
Langzeit-Schwachbestrahlung<br />
109<br />
Laryngitis 170, 271, 272,<br />
282<br />
Lebensdauer der Röhren<br />
121<br />
Leber 92,27}<br />
Leberabszeß 273<br />
Lebererkrankungen 200<br />
Leberkarzinom 263<br />
Leberkrankheiten 261<br />
Leberlues 261<br />
Leberzirrhose 200, 261,273<br />
Lecher-Leitung 129<br />
LECHER-Systcm22,73,127,<br />
r 3J<br />
Leistung 13» 122, 294<br />
Leistungsmessung 131<br />
Leistungsreglcr 134<br />
Leitfähigkeit 34, 40, 43,<br />
294, 295<br />
Leitfähigkeit des Blutes 92<br />
Leitungsstrom 30, 33, 34<br />
Leitwert 286<br />
LcNzschc Gesetz 10<br />
Leukämie 261<br />
Leukopenie 245<br />
Leukozyten 89,92,119,257<br />
Leukozytenprovokation 90<br />
Leydcner Flasche 7<br />
Libido scxualis 231<br />
Lichtgeschwindigkeit 4<br />
Lidabszesse 253, 255<br />
Linsen 21, 76<br />
Lipoide 230<br />
Lipoidmoleküle 39<br />
Liquordruck 205<br />
Löschfunken 24<br />
Lokalisation 60<br />
Lokalisation der Wirkung<br />
beim lebenden Menschen<br />
65<br />
Lokalisierung 265<br />
Lucs 155, 206, 208<br />
Lucs primär 148<br />
Lues sekundär 148<br />
Lues des Zentralnervensystems<br />
208<br />
Luftabstand 35, 135<br />
Luftabstand, freier 136<br />
Luftraum 34, 138<br />
Luftwege, obere 167<br />
Lumbago 189<br />
Lunge 172<br />
Lungenabszeß 173, 183,<br />
272,282<br />
Lungengangrän 182,185<br />
Lungentuberkulose 223,<br />
272<br />
Lungentumoren 272<br />
Luxationen 186<br />
Lymphadenitis 282<br />
Lymphangitis 274<br />
Lymphdrüsen 261<br />
Lymphdrüsenentzündun ggen<br />
171<br />
Lymphgefäße 162<br />
Lymphknoten 162<br />
Lymphogranulom 261<br />
Lymphome 171<br />
Lymphozytensturz 88<br />
Lymphozytenzahl 232<br />
Lyssa 117<br />
Maculablutungen 255<br />
Magen 65<br />
Magersucht 244<br />
Magnetfeld-Röhren 127<br />
magnetisches Feld 11<br />
Magnetron-Gehäuse 128<br />
Malaria 208<br />
Malariaparasiten 152<br />
maligne Tumoren 246<br />
Maltafiebcr 177<br />
Malum coxae 275<br />
Malum coxae senile 192<br />
Mandelentzündung 170<br />
Mandelerkrankungen 140<br />
Mastdarmfistcln 140<br />
Mastitis 163, 274, 282<br />
Mastoiditis 169<br />
Matcrialkonstantc 41, 43,<br />
270<br />
maximale Hyperthermie 150<br />
Mediastinitis 175, 183, 282<br />
Megahertz 4<br />
Membram 35, 54, 265<br />
Membranbildncr 39<br />
Membran-Ladezeit 23<br />
Meniere 282<br />
MÉNiEREschcs Syndrom 209<br />
322<br />
Meningitis 117, 282<br />
Meningitis serosa 209<br />
Meningoencephalitis 209<br />
menschliche Gewebe 49<br />
Menses 202, 226, 228, 245<br />
Mcnstrualzyklus 204, .229<br />
Menstruation 231<br />
Messung 22<br />
Meßinstrumente 18<br />
Metalle 33<br />
Metallgegenstände 114<br />
Metallische Fremdkörper<br />
Metallteile 140<br />
Meterwellen 6<br />
Methylalkohol 255<br />
Metritis 282<br />
Migräne 205, 209, 276, 282<br />
Mikroerwärmung 45, 66,<br />
118,265<br />
Mikrofarad 289<br />
Mikrostrukturen 56<br />
Mikrowellen 5,74» 123,126,<br />
166, 2IJ,2J5<br />
Milz 92, 230, 237<br />
Milzextrakt 199<br />
Modellversuche 56<br />
Moleküle 32, 36, 71<br />
Molekül verband 265<br />
Molckular-Gewicht 68<br />
Monarthritiden 188<br />
Monode 73, 143, 160, 165,<br />
168,169<br />
Monopolar 297<br />
Morbus Simmon 275<br />
Multiple Sklerose 148, 208<br />
Mundbodeninfiltratc 165<br />
Mundbodenphlegmone<br />
272<br />
Mundhöhle 66<br />
Muskeln 240<br />
Muskclrhcumatismus 148,<br />
193. 275<br />
Muskelzerrungen 186<br />
Myelitis 209, 282<br />
Myokarditis 215, 282<br />
Myokarditis ak. 271<br />
Nachbehandlung nach<br />
Operationen 171<br />
Nachwirkung 268<br />
Nährboden 107<br />
Nagana Prowazek* 108
Narbenbeschwcrden 276<br />
Narbenwuchcr ungen 186<br />
Nase 167<br />
Nasennebenhöhlen 167<br />
NebenhÖhlcnempycm 282<br />
Nebennieren 232<br />
Nekrosen 112<br />
Nephritiden2i7<br />
Nephritis 118, 273, 282<br />
Nephrosklerose 273<br />
Nerven, periphere 211<br />
Nervenreizung 2}<br />
Nervenrheumatismus 194<br />
Nerven als Stromleiter 55<br />
Nervensystem 97, 98<br />
Nervensystem, vegetatives<br />
228<br />
Netzhaut-Tuberkulose 282<br />
Neuralgien 211<br />
Neuralgie, Intercost. 276<br />
Neurasthenie 276<br />
Neuritidcn 211<br />
Neuritis 148, 276, 282, 284<br />
Neuritis nerv. opt. 271<br />
Neuritis retrobulbaris 254<br />
Nierenbecken 65<br />
Nierenentzündungen 217<br />
Nutzleistung 131<br />
Oberbauch 240<br />
Oberflächenspannung 39,<br />
Oberflächenwirkung 31<br />
Oberlippe 159, 167<br />
Obcrlippenfurunkel 160<br />
Obstipation 97, 199, 273<br />
Obstipatio spast. 284<br />
Occipitalneuralgic 276<br />
ödem 284<br />
ödematösc Durchtränkung<br />
146<br />
Ödeme, toxische 187<br />
Ödeme, traumatische 187<br />
Ösophagus 65<br />
Ösophaguskarzinom 225<br />
OiiMsche Gesetz 286<br />
ÖHMschc Widerstand 10,14<br />
Ohr 167<br />
Okzipitalneuralgie 211<br />
Omarthritis 188, 275<br />
Operationen, Nachbehandlung<br />
nach 171<br />
Opsonischer Index to8<br />
Opticusatrophie 255<br />
Orbitalenzündung 253<br />
Orchitis 197, 218, 274, 284<br />
Organe 32<br />
Organe, endokrine 233<br />
Osteoarthrosis 191<br />
Osteochondritis diss. 275<br />
Osteomalazie 275<br />
Osteomyelitis 165,185, 257,<br />
268,275,284<br />
Otitis 169<br />
Otitis ext. 271<br />
Otitis media 257<br />
Ovarial-Ca »47<br />
Ovarialzysten 203<br />
Ovarien 145, 204<br />
Panariticn 162, 274, 284<br />
pancake coil 143<br />
Pankreatitis 166, 199, 273<br />
Pansinusitis i68j 271<br />
Paradcntose 165, 166, 189<br />
Paralyse 148, 208<br />
Paralyse, progressive 205<br />
Paramaecien ioy<br />
Parametritis 203, 274, 284<br />
Paratendinitis crepitans 186<br />
paratonsillärcr Abszeß 169<br />
Paronychien 162<br />
Parotitis 271<br />
Párulis 272, 284<br />
Pclvcopcritonitis 204, 27;<br />
Penicillin 174<br />
Pepsin 67<br />
Periarthritis 284<br />
Periarthritis humeroscapu-<br />
laris 193, 275<br />
Perimetritis 204<br />
Periodontitis 272<br />
Periostitis 275, 284<br />
Periostitis pcrimandibularis<br />
165<br />
Periproktitis 166, 199, 273,<br />
284<br />
Peritoneal-Tubcrkulosc 273<br />
Peritonitis 199, 284<br />
Peritonitis tuberculosa 200,<br />
221<br />
Peritonsillar-Abszcß 272<br />
Perityphlitis 166, 284<br />
Pcrlschnüre 71<br />
Pcrlschnurbildung 66, 120<br />
Perlschnurphänomcn 265<br />
523<br />
Permeabilität 154, 265<br />
Permeabilitätsquotient<br />
Blut-Liquor 154<br />
Pflanzcnkeimlinge 86<br />
Phäochromozystom 232,<br />
235<br />
Phagozytose 69, 92, 119,<br />
267<br />
Phantome 132<br />
Phasen 19, 243<br />
Phasenverschiebung 13,14,<br />
55<br />
Phasenwinkel 294<br />
Phlebitis 163<br />
Phlegmone 162, 274<br />
Picofarad 289<br />
Pilzarten 107<br />
Plasma, Viskosität von<br />
Blut und - 92<br />
Platten 15<br />
Plattenabstand 135<br />
Pleura, Empyeme der 17I1<br />
172, 183<br />
Pleuraexsudat, tuberkulöses<br />
176<br />
Pleuraschwarten 171<br />
Plcuritiden i66, 171<br />
Pleuritis 284<br />
Pleuritis sicca 272<br />
Plexiglas J9<br />
Plexus brachialis 275<br />
plurigl. Insuffizienz 275<br />
Pneumonie 175, 183, 272,<br />
284<br />
Pneumonie, abszedierende<br />
180<br />
Pneumonie, plasmazclluläre,<br />
interstitielle 176<br />
Polarisation 36<br />
Polarisationskapazität 54<br />
Polarisierbarkeit 54<br />
Polarität 265<br />
Poliomyelitis 209, 210, 276<br />
Polyarthritis 148, i88, 2461<br />
2 59, 275<br />
Polyarthritis, chronische<br />
190<br />
Polymerisation 68<br />
Postcnccphal. Zust. 276<br />
Präurämie 217<br />
Pregnandiol 231<br />
Primärkreis 14, 15<br />
Prismen 21<br />
progressive Paralyse 250
Proktitis 140, 273<br />
Prosplen 199<br />
Prostata 218<br />
Prostatahype rtrophic 218,<br />
140<br />
Prostatitis 274, 284<br />
Prozesse, fermentative 70<br />
Psoriasis 164, 284<br />
Pulsfrequenz 15 ;<br />
Punktwärmc 71<br />
Pyelitis 218, 273, 28c<br />
Pyonephrose 218, 273<br />
Pyopneumothorax 175<br />
Pyosalpingen 203<br />
Pyosalpinx 197<br />
Pyrifer 102<br />
Pyrostat 151<br />
Quantenenergie 6<br />
Quarz 28, 138<br />
Quarz-Bcnzol-Thermomcter<br />
132<br />
Quarzstcucrung 122<br />
Quarzthermometer 56<br />
quasi-optische Strahlung21<br />
quasi-stationärer Zustand<br />
13<br />
Quecksilberthcrmomctcr<br />
132<br />
Quetschungen 186<br />
Rachenkatarrh 272<br />
RADAR-Scndcr 83<br />
radioceilulosciliateur 1<br />
Radiothermie 151<br />
Ratten 84<br />
Raumdosis 145<br />
Raynaud 271, 284<br />
RAYNAUDScher Gangrän<br />
2I5<br />
Reaktionen 145<br />
Reaktionen, physiologische<br />
153<br />
Reaktionsweise 270<br />
Reflektor 76<br />
Reflexion 21, 77<br />
Regeln bei Kurzwelicntherapie<br />
296<br />
Regulationsstörung, hypotonc<br />
235<br />
Reibungsverluste 36<br />
Reihenschaltung 287<br />
Reizergüsse 166, 187<br />
Reizwirkung 23<br />
Rckurrcns 117<br />
relative Tiefenwirkung 56,<br />
62, 135<br />
ReSaxationscffckt 39<br />
renaler Diabetes 241<br />
Resonanz 15, 124, 125, 134,<br />
135,298<br />
Resonanzabstimmung, automatische<br />
125<br />
Resonanzanzeige 134<br />
Resonanzkurve 19<br />
Resonanzvorgang 20<br />
Resorption 158, 255, 267<br />
Resorptionsvorgänge 116<br />
resorptive Wirkung 187<br />
Resthöhlen 182<br />
Restinfiltrate 175<br />
Rest-Stickstoff 92<br />
Rheumatismus 156<br />
Rhinitis 271<br />
Ringfeld 141<br />
Rippenfellentzündung 221<br />
Rippenresektion 180, 182<br />
Röhrenapparate 121<br />
Röhren, Lebensdauer der<br />
121<br />
Röhrensender 25<br />
Röntgenschäden 164<br />
Röntgenstrahlen 4<br />
Rückenmark 113<br />
Rückkopplung 17, 26<br />
Rückwirkung 17<br />
Rund fun kemp fanger, Störungen<br />
in 133<br />
Säftestrom 267<br />
Sättigung 26<br />
Säuerung 267<br />
Säuger 85<br />
Säuglinge, atropische 244<br />
Salpingitis 274<br />
Salvarsan 208<br />
Sarkom 110<br />
Schäden 112<br />
Schallwellen 187<br />
Schaltungen 25<br />
Schaltung, EsAUsche 26<br />
Schalttafeln 125<br />
Schema 147<br />
Schichtung 44, 47<br />
Schilddrüse 228<br />
324<br />
Schlingen 72, 142<br />
Schlitzmagnetron 29<br />
Schmerzstil lung 186, 267<br />
schmiegsame Elektroden<br />
M7<br />
Schneidezähne 165<br />
Schnupfen 284<br />
Schultergclenke 188<br />
Schußverlctzungcn 175<br />
Schwangerschaft 246<br />
Schweiß 297<br />
Schweißabsonderung 148<br />
Schweißdrüsenabszesse 160<br />
Schweißtropfen 32<br />
Schwerhörigkeit 271<br />
Schwindclgcfühlc 83<br />
Schwingkreis 7, 8, 27, 290<br />
Schwingkreis, offener 19<br />
Schwingleistung 18, 124<br />
Schwingungen 3, 290<br />
Schwingungen, gedämpfte<br />
24<br />
Schwingungsdaucr 14<br />
Schwingungsvorgang n<br />
Schwingungszahl ;<br />
Schwitzen 147<br />
Sehnenscheiden 188<br />
Schnenscheidcnhygromc<br />
194<br />
Scitenkcttcn 38, 265<br />
Sekretion, innere 274<br />
Sekundärkreis 14, 1;<br />
Sckundärglaukom 253<br />
Selbstcrrcgcr-Schaltung 27<br />
Selbstinduktion 10, 14, 134,<br />
291<br />
selektive Erwärmung 50<br />
selektive Wirkung 50<br />
Sclcntrioxyd 70<br />
Senkungsgeschwindigkeit<br />
87<br />
Senkungsreaktion 188<br />
Sensibilität 115<br />
Sequester 186<br />
Serum 44, 67, 90<br />
Scrum-Eiwciiikörper 264<br />
Serumproteine 68<br />
Serum, Viskosität des 92<br />
Scrvomat 125, 135<br />
Skin-Effekt 19, 31<br />
Sklerodermie 164, 284<br />
Spannung 13, 17, 134, 286<br />
Spannungsgefälle 53, 138<br />
Spannungsteilerprinzip 27
Speiseröhre 65<br />
Spektrum 3<br />
Spermiogenese 93<br />
Sperrkreise 28, 123<br />
spezifisch 265<br />
spezifische Wirkungen 66<br />
Sphingomyclin-Molekül 38<br />
Spirochäten 108<br />
Spirochätose 117<br />
Spitzen 114<br />
Spitzenwirkung 115, 138,<br />
146<br />
Spondylarthritis 190, lyj,<br />
275<br />
Spondylarthritis ankylopoetica<br />
(BECHTEREW) 192<br />
Spondylarthritis sicca 192<br />
Spondylitis 275<br />
Spontandiurcsc 252<br />
Spontanfraktur 113<br />
Spontan-Hypoglykämic 244<br />
Spritzenabszeß 166, 274,<br />
284<br />
Sprungwcllcnlänge 37<br />
Spulen 288<br />
Spulcnfeld 10, 71, 188, 297<br />
Spulenfcldbehandlung 143<br />
Staphylokokken 105, 107,<br />
116<br />
STH 227<br />
Stickstoffausschcidung 217<br />
Stirnhöhle 168, 142<br />
Stirnhöhlcnempycn 271<br />
Störungen, hormonale 204<br />
Störungen, inkretorische<br />
156<br />
Störungen in Rundfunkempfängern<br />
133<br />
Stoffwechsel 275<br />
S toffwechselcr krankungen<br />
244<br />
Stomatitis 165, 272, 282<br />
Stoßerregung 24<br />
Stoßkreis 24<br />
Strahlcnfcld 6, ijo<br />
Strahlcnfcldbehandlung 75<br />
Strahlenschutz 133<br />
Strahlungen 3, 123, 134<br />
Strahlung, quasi-optischc<br />
7,21<br />
Strahlungsvcrlustc 138<br />
Strahtungswiderstand 21<br />
Streptokokken 105, 106,<br />
108<br />
Streptomycin 174<br />
Streuung 30, 60, 66<br />
Strom 17, 134, 286<br />
Stromschleifcn 52, 266<br />
Stromstärke 1 j<br />
Stromverteilung 35<br />
Struktur 44<br />
Struma 228<br />
Strumitis 274<br />
Stumpfexsudate 204, 284<br />
Subluxationen 190<br />
SüDECKsche Knochendy-<br />
strophic 187<br />
Sulfonamide 174<br />
Suspensionskolloid 43<br />
Sympathikus 97, 228, 233<br />
Sympathin 228<br />
Syndrom, MÉNiERESches<br />
209<br />
Syphilis 108, 117<br />
syphilitisches Geschwür<br />
163<br />
System, endokrines 225<br />
Tabes 148<br />
Tabes dorsalis 206, 208<br />
Tarsitis 253<br />
Teilchen 35, 36<br />
Temperaturregulicrung 97<br />
Temperatursteigerung 185<br />
tendoperiostitische Formen<br />
194<br />
Tendovaginitis 194, 284<br />
TESLA-Transformator 1,24<br />
Testes 228<br />
Therapie, kombinierte 208<br />
Therapicleistung 131<br />
thermische Entlastung 54,<br />
136<br />
Thermoelemente 56<br />
Thcrmokrcuze 133<br />
Thermometer ;6<br />
Thrombophlebitis217, 232,<br />
284<br />
Thrombosen 254, 284<br />
Thrombozyten 88, 92<br />
Ticfenbehandlung 296<br />
Tiefendosis, absolute 59<br />
Tiefenwirkung 29, 47, 52,<br />
65, 66, 81, 135, 269<br />
Tiefenwirkung, absolute<br />
Tiefenwirkung, kapazitive 2<br />
3*1<br />
Tiefenwirkung, relative 56,<br />
62, 135<br />
Tierkörper 62<br />
Todesfälle 155, 206<br />
Tötung 84<br />
Tonsillarabszeß 284<br />
Tonsillen 256<br />
Tonsillitis 189, 272<br />
Trachom 254, 284<br />
Tränenreiz 83<br />
Träncnsackphlcgmonc 253,<br />
Tränenwege 253<br />
Transformator 28, 123<br />
traumatische Ödeme 187<br />
Tremor 153.<br />
Trennschichten 35<br />
Trichophyton 107<br />
Trigcminusncuralgie 27J<br />
trophotrop 228<br />
Trypanosoma 117<br />
Tubcnkatarrh 271<br />
Tuberkelbazillcn ioj, 107,<br />
116<br />
tuberkulöses Geschwür<br />
163<br />
tuberkulöse Peritonitis 200<br />
Tuberkulose 187, 220, 231,<br />
259,266<br />
Tuberkulose, Netzhaut 282<br />
Tubcrkulosis pulmón. 284<br />
Tuberculosis retinae 284<br />
Tubovarialzystcn 203<br />
Tumor 110, 224, 245, 255,<br />
262,269<br />
Tumoren, maligne 246<br />
Uberbrückung der Haut 54<br />
Ubcrbrückung des Untcrhautfettgewebes<br />
54<br />
Uberdosierung 115<br />
Ubcrgangsschicht 77<br />
Uberhitzung 137<br />
Ulcus 262, 286<br />
Ulcus corneae 271<br />
Ulcus cruris varicosum 163<br />
Ulcuskranke 237<br />
Ulcuskrankhcit 232<br />
Ulcus serpens 253<br />
Ulcus ventriculi 199, 272<br />
Ultrakurzwellen 6<br />
Ultraschallbehandlung 192<br />
Ultraviolett 6
Umstimmung 267<br />
Unfruchtbarkeit 246<br />
unipolare Anwendung 140<br />
Unterhautfettgewebe ; 1<br />
Unterhautfettgewebe,<br />
Uberbrückung des 54<br />
Unterleibsorgane 201<br />
Urogcnitalapparat 217<br />
Uterus 66, 200<br />
Uterusmyome 246<br />
Uveitis 253, 255, 286<br />
Vagina 200<br />
Vaginalelektrodc 140,<br />
201<br />
Vagotonic 228<br />
Vagus 97, 228, 237<br />
Vaguskern 103<br />
Varixknoten 271<br />
vegetative Dystonie 243<br />
Venen 217<br />
Venenthrombose 271<br />
Veränderungen, histologische<br />
92<br />
Verbrennungen 139<br />
Verdauungsapparat 198<br />
Veresterung 69<br />
Verhärtungen 187<br />
Verlauf 189<br />
Verluste 13, 18, 293<br />
Verluste, dielektrische<br />
19, 32<br />
Verlustwinkel 20<br />
Verschiebungsstrom 8, 30,<br />
33. 35. 3 6<br />
Verschlußikterus 261<br />
Verstauchungen 186<br />
Versteifungen 187<br />
Verteilungsgesetz, KIRCH-<br />
HOFFschcs ; 2<br />
Verwachsungen 172<br />
Verwachsungsbeschwerden<br />
166,204» 2S4<br />
Viclschlitzsystem 128<br />
Viskosität 37, 71<br />
Viskosität von Blut und<br />
Plasma 92<br />
Viskosität des Serums 92<br />
Voltmeter 134<br />
Vulvaabszeß 274<br />
Wachstumsförderung 86<br />
Wärme 34<br />
Wärmeabgabe 147<br />
Wärmeausgleich 99<br />
Wärmeempfindung 146<br />
Wärmeentstehung im Blut<br />
44<br />
Wärmeerzeugung 264<br />
Wärmcgcfällc 83,152<br />
Wärmegefühl 297<br />
Wärmeregulierung 147<br />
Wärmestrahlen 5<br />
Wärmeverteilung 144, 279<br />
Wärmezentrum 20;<br />
Wanderungsgeschwindigkeit<br />
34<br />
Wasser 119, 154<br />
Wasserhaushalt 226, 231<br />
Wassermann-Reaktion 208<br />
Wassers toffionen 67<br />
Wasserstoff i onenkonzentration<br />
90<br />
Wechselstrom 3<br />
Welk 3,6<br />
Welle, elektromagnetische<br />
74<br />
Wellen, HERTZsche 1, 6<br />
Wellenlängen 5,22,28, 122<br />
264,266, 269, 287<br />
Wellenlänge, dominierende<br />
131<br />
Widerstand 46, 52, 286<br />
Widerstand, kapazitiver 9,<br />
34, 13 8<br />
Widerstand, OuMSche 10,<br />
H<br />
WiENsche Gesetze 54<br />
Winiwarter Bürger 271<br />
Wirbelsäule 187<br />
326<br />
Witbelströmc 143<br />
WJrbclstrombehandlung<br />
142<br />
Wirbelstromheizung 73<br />
Wirkstrom 33<br />
Wirkung, gerichtete 66<br />
Wirkung, kapazitive 7, 8,<br />
30, 35, 50. 66<br />
Wirkung, resorptive 187<br />
Wirkung, selektive 50<br />
Wirkungen, spezifische 66<br />
Wirkungsgrad 294<br />
Wunden 162<br />
Wurzelischias 213<br />
/.ahncr krankungen 165<br />
Zahnfistel 272<br />
Zahngranulome 189<br />
Zahnhcrdc 256<br />
ZEiLEis-Apparatc 24<br />
Zeit 269<br />
Zeitdauer 145<br />
Zellen 36<br />
Zellen, eosionphile 229<br />
Zellen, coosinophile 92<br />
Zcllgewcbscntzündungen<br />
162<br />
Zellmembran 39, 91, 118<br />
Zellstoff 115<br />
Zelluloid 59<br />
Zentimetcrwcllcn 6, 126<br />
Zcntralnervcnstysem 113,<br />
205<br />
Zcntralvencnthrombosc<br />
«55<br />
Zentralvcne 25 3<br />
Zersetzung, elcktrolytische<br />
34<br />
Zuleitung 14<br />
Zustand, kolloidaler 67<br />
Zustand, krankhafter 84<br />
Zustand, quasi-stat'ionärer<br />
13<br />
Zwischenfälle 152, 21 j