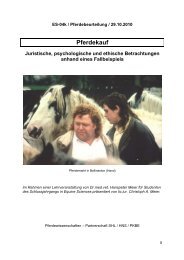Masterthese
Masterthese
Masterthese
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Masterthese</strong><br />
ZUR ERLANGUNG DES AKADEMISCHEN GRADES<br />
„Master of Science“<br />
(Psychotherapeutische Psychologie)<br />
Titel: Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator<br />
im psychotherapeutischen Prozess<br />
Empfänger: Zentrum für Psychosoziale Medizin<br />
An der Donau<br />
Universität Krems<br />
und Schweizer Charta für Psychotherapie<br />
Begutachter: Prof. Stavros Mentzos<br />
Verfasser: Matthyas Arter<br />
Auf der Platte 80<br />
CH-8706 Meilen<br />
Tel +41792213603<br />
Auskunft@Arter-Beratung.ch<br />
Datum: Vorgelegt im Juni 2007
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator<br />
im psychotherapeutischen Prozess<br />
Theorieverschränkter Praxisbericht
Vorwort/Dank<br />
Die vorliegende Arbeit stellt den Versuch dar, eine mir unangenehm aufstossende<br />
Beobachtung kritisch zu hinterfragen und nach möglicher Abhilfe zu suchen. Gemeint<br />
ist der Umstand, dass wir Menschen – mich eingeschlossen – auch dort Antworten<br />
geben wollen, wo nur Fragen sein können und Vergleiche anstellen, wo Einzigartigkeit<br />
gefragt ist. Das ist unachtsam - in der konstruktiven Auseinandersetzung mit anderen<br />
Menschen gar verheerend.<br />
Mein Dank gilt vorab Bruno K. und Carla S., die sich einverstanden erklärt haben,<br />
meine Ideen über Dilemmatoleranz an ihren konkreten Lebensbiografien zu evaluieren.<br />
Die in dieser Arbeit gegebenen Abrisse von den Biografien der beiden sind nur die<br />
Spitzen der Eisberge, zwischen welchen ich das Konzept der Dilemmatoleranz hindurch<br />
zu manövrieren hatte. Dass es eine erfolgreiche Fahrt wurde, verdanke ich der<br />
Offenheit, welcher ich begegnen durfte.<br />
Weiter gilt mein Dank Dr. F. Brander und Prof. S. Mentzos, die sich schon vor Beginn<br />
der Arbeit freundlicherweise bereit erklärt haben, diese nach Abschluss kritisch zu<br />
würdigen. Dieser Umstand erwies sich als optimale Motivation, mir an dem nicht<br />
einfachen Stoff die Zähne auszubeissen. Ich gab mein Bestes – wie viel oder wie wenig<br />
das auch sein mag!<br />
Matthyas Arter
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
1. Einleitung ..................................................................................................................... 3<br />
1.1. Individualität der Normalität ................................................................................. 3<br />
1.2. Das Dilemma als Basis.......................................................................................... 4<br />
1.3. Dilemmatoleranz und Leidensfähigkeit................................................................. 5<br />
1.3.1. Überlebensfähigkeit als oberste Maxime ....................................................... 5<br />
2. Nähe/Distanz ................................................................................................................ 7<br />
2.1. Der Mensch als Konzept und Kopie...................................................................... 7<br />
2.1.1. Grundkonflikt als Anfang............................................................................... 8<br />
2.1.2. Nähe-Distanz-Dilemma................................................................................ 10<br />
2.1.3. Das „wahre“ Selbst....................................................................................... 10<br />
2.2. Die hinreichend gute Mutter................................................................................ 12<br />
2.3. Ambivalenz, Dilemma und Ich-Genese............................................................... 13<br />
2.4. Psychose als Ventil.............................................................................................. 15<br />
2.5. Die paradoxe Natur der Grundproblematik......................................................... 16<br />
2.5.1. Affektive Besetzung als Wertbasis............................................................... 18<br />
3. Selbst- und Ichbildung................................................................................................ 20<br />
3.1. Das körperliche Ich.............................................................................................. 20<br />
3.1.1. Das Ich als formbare und handelnde Instanz................................................ 21<br />
3.1.2. Sein oder nicht sein für das Ich .................................................................... 23<br />
3.1.3. Dem Ich mangelt absolute Existenz ............................................................. 24<br />
3.2. Problematik der Ich-Schwäche............................................................................ 26<br />
3.3. Realität als Wahn................................................................................................. 28<br />
3.3.1. Stabilität der Illusion .................................................................................... 29<br />
3.4. Das Selbst als Subjekt ......................................................................................... 30<br />
3.5. Wandelbare Symbolbildung ................................................................................ 31<br />
3.5.1. Dilemmahafte Selbstfindung zwischen Angst und Liebe ............................ 36<br />
4. Konfliktbewältigung................................................................................................... 40<br />
4.1. Konflikt in welchem Sinn?.................................................................................. 40<br />
4.1.1. Konflikt ohne Normalität.............................................................................. 41<br />
4.2. Schuldgefühl schafft den Konflikt....................................................................... 42<br />
4.2.1. Konfliktbewältigung versus Konfliktbeseitigung......................................... 43<br />
4.2.2. Traum als Schlüssel zur Konfliktbewältigung ............................................. 45<br />
4.2.3. Doppelbedingtheit des Konfliktes ................................................................ 48<br />
4.2.4. Konfliktschwere ........................................................................................... 49<br />
5. Dilemmatoleranz ........................................................................................................ 53<br />
5.1. Überleben als nicht überprüfbares Hauptkriterium ............................................. 53<br />
5.2. Normalität als Prokrustesbett............................................................................... 55<br />
5.3. Dilemmatoleranz der Schizophrenen................................................................... 57<br />
5.3.1. Postulat der innerpsychischen Normalität als adäquate Dilemmatoleranz... 62<br />
5.3.2. Dilemmatoleranz als Erklärung beider Extrempositionen............................ 63<br />
6. Bruno K ...................................................................................................................... 64<br />
6.1. Umfeld, Familie................................................................................................... 65<br />
6.2. Rollenverteilung .................................................................................................. 65<br />
6.3. Früheste Erinnerungen......................................................................................... 66<br />
6.4. Pubertät................................................................................................................ 66<br />
6.5. Heutiges Umfeld.................................................................................................. 67<br />
Matthyas Arter 1/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
6.6. Dilemmatoleranz ................................................................................................. 68<br />
7. Carla S. ....................................................................................................................... 72<br />
7.1. Umfeld, Familie................................................................................................... 72<br />
7.2. Rollenverteilung .................................................................................................. 73<br />
7.3. Früheste Erinnerungen......................................................................................... 74<br />
7.4. Pubertät................................................................................................................ 78<br />
7.5. Dilemmatoleranz durch Verdrängung und Kreativität ........................................ 78<br />
8. Therapiekonsequenzen ............................................................................................... 81<br />
8.1. Paradigmawechsel ............................................................................................... 81<br />
8.1.1. Symptomverschiebung ................................................................................. 82<br />
8.2. Würdigung der Dilemmatoleranz ........................................................................ 83<br />
8.2.1. Problematik des Leidens............................................................................... 83<br />
8.3. Fahrt zwischen Skylla und Charybdis ................................................................. 85<br />
8.4. Mögliche Ausrichtung künftiger Erfolgsbeurteilung .......................................... 87<br />
8.4.1. Rezepte, aber keine Patentrezepte ................................................................ 89<br />
8.4.2. Therapie als Übungsraum............................................................................. 90<br />
Matthyas Arter 2/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
1. Einleitung<br />
Die vorliegende Arbeit sprengt den Rahmen des „Normalen“. Dies in dem Sinne als<br />
dieser Text, obgleich sich mit dem befassend, was gemeinhin als „normal“ bezeichnet<br />
würde, den Begriff der Normalität bewusst und begründet als mögliche Realität streicht.<br />
Die Konsequenzen, die sich daraus ergeben sind beträchtlich, indem scheinbar an die<br />
Stelle normativer Wissenschaftlichkeit die chaotische Beliebigkeit tritt. Ein<br />
Spannungsbogen, dessen Ähnlichkeit mit psychischen Zuständen, die von<br />
zwangsneurotisch bis psychotisch reichen, nicht zu übersehen ist. Und die Frage ist<br />
berechtigt, was denn mit dieser doch seltsamen Verkomplizierung der Dinge gewonnen<br />
werden soll. Es ist ja unbestritten, dass jeder Mensch im Grunde kein Problem hat, die<br />
einen Phänomene als „normal“ und andere als „verrückt“ zu identifizieren. Das<br />
bestreitet auch dieser Beitrag zur Klärung dessen, was mit „normal“ sinnvollerweise<br />
ausgedrückt werden soll, keineswegs.<br />
1.1. Individualität der Normalität<br />
Die Problematik, um welche es geht, ist vielmehr die Tatsache, dass es für jeden<br />
einzelnen Menschen klare Vorstellungen gibt, die ihm bezeichnen, was normal<br />
(erwünscht, angenehm, nicht zu vermeiden) und was verrückt (unerwünscht,<br />
unangenehm und allenfalls zu vermeiden) ist. Was es dagegen nie und nimmer geben<br />
kann – und das ist die Crux – ist ein interpersoneller Konsens darüber, was als normal<br />
und was als verrückt gelten soll.<br />
Die Genese der menschlichen Psyche als Naturprodukt einer empirisch nachvollziehbar<br />
darwinistisch selektionierten Trial-and-Error-Konstruktion ist ohne je zu ergründenden<br />
paradoxen Bauplan situativ und individuell, archetypisch gestützt, aber in der konkreten<br />
Ausgestaltung nicht nachvollziehbar und (für den Betroffenen) doch zwingend.<br />
Damit ist das Grunddilemma der Normalität offensichtlich. Es gibt sie und gibt sie<br />
nicht. Vor diesem Hintergrund ist es vernünftig, den Fokus nicht auf die Normalität zu<br />
richten. Diese kann zwar definiert werden, wendet sich aber gerade dadurch gegen das,<br />
was in der Natur des Menschen das Normalste ist, nämlich eine individuelle, situative<br />
Normalität zu schaffen, die bestenfalls indirekt normierend sein kann, da sie sich immer<br />
Matthyas Arter 3/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
zwingend auf den Einzelfall bezieht. Man könnte auch sagen, der Mensch ist aufgrund<br />
seiner einmaligen Biografie (bedingt durch seinen und durch keinen andern<br />
einzunehmenden Standpunkt) dazu gezwungen, eine für ihn geltende Normalität zu<br />
bestimmen, die schon deshalb nicht normal sein kann, weil sie lediglich für eine ganz<br />
bestimmte Person und Lebensgeschichte als das zwingend Normale hervorgebracht<br />
wurde. Anderseits ist eine Normalität, welche von genereller Gültigkeit wäre, für den<br />
Einzelfall unbrauchbar, da die spezifische Ausformung derselben nicht entsprechen<br />
kann, wie in dieser Arbeit insbesondere unter Bezug auf C.G. JUNG, ERICH FROMM,<br />
aber auch STAVROS MENTZOS deutlich wird.<br />
1.2. Das Dilemma als Basis<br />
Dieses Abweichen individueller Normalität von dem, was Bezugsgruppen, oder gar die<br />
menschliche Gesellschaft als Ganzes für normal hält, ist entsprechend zwingend und<br />
dilemmabehaftet. Es ist die Spannung, welche dadurch entsteht, dass die Formung der<br />
menschlichen Psyche durch Gegensätze wie Nähe und Distanz, Liebe und Angst usw.<br />
geprägt wird, also immer mit der Bewältigung von Dilemmata zusammenhängt. Das<br />
Dilemma besteht ja darin, dass beispielsweise nur Nähe zur Mutter, also faktische<br />
Einheit mit der Mutter, die Selbstwerdung des Kindes ausschliesst, dass aber nur<br />
Distanz von der Mutter, also die Verleugnung des emotional belegten Objektes,<br />
ebenfalls unerträglich ist, weil es in die totale Einsamkeit führen würde. Nähe und<br />
Distanz schliessen sich fundamental betrachtet gegenseitig aus, so dass als lebbare Form<br />
ein Zustand, respektive eine psychische Dynamik gebildet werden muss, welche das<br />
einer kombinierten Lebensform von Nähe und Distanz zugrunde liegende Dilemma<br />
erträgt. Daher ist es nachvollziehbar, wenn die notwendige Dilemmatoleranz gefordert<br />
wird. Also die Möglichkeit, die mit der Akzeptanz des Dilemmas zusammenhängende<br />
Spannung auszuhalten.<br />
Man darf ruhig behaupten, dass dies jedes Lebewesen notgedrungen tut, denn<br />
andernfalls wäre es nicht am Leben. Jene Vorfahren, die nicht reflexartig zur Seite<br />
sprangen, wenn etwas im Laub raschelte, sind nicht unsere Vorfahren geworden. Wir<br />
können nicht nur erschrecken, wenn tatsächlich eine Schlange mit tödlichem Gift die<br />
Ursache des Raschelns ist. Wir müssen damit fertig werden, auch dort Gefahren zu<br />
Matthyas Arter 4/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
vermuten, wo keine sind. Ein Dilemma, das Leiden minimierende Handlung erfordert,<br />
wenn das Lebensgefühl insgesamt deswegen nicht dramatisch geschmälert werden soll.<br />
Darin liegt der Nutzen, nicht von normal und abnormal zu sprechen, sondern den Blick<br />
auf adäquate Dilemmatoleranz zu richten.<br />
1.3. Dilemmatoleranz und Leidensfähigkeit<br />
Die Forderung liegt unter Berücksichtigung der entwicklungspsychologischen<br />
Gegebenheiten des Menschen, aber auch jedes sonstigen Lebewesens, auf der Hand.<br />
Entscheidend ist allerdings, dass sie den Blickwinkel für die Beurteilung von Leiden<br />
umkehrt. Es steht nicht die Frage im Vordergrund, wie man jemandem zu einem<br />
normalen, respektive gesunden Leben verhelfen kann, sondern vielmehr, ob die vom<br />
Individuum geschaffene Realität und die dadurch geforderte Dilemmatoleranz dergestalt<br />
entwickelt ist, dass der Betreffende damit gut leben kann. Ist sie es nicht, ergeben sich<br />
zwei Ansatzpunkte für die therapeutische Intervention: Einerseits kann das<br />
Realitätsverständnis, die Sinngebung so angepasst werden, dass – je nach konkreter<br />
Situation - weniger oder mehr Dilemmatoleranz möglich ist, anderseits kann aber auch<br />
– nicht zuletzt durch verhaltenstherapeutische Konditionierung – das Mass der<br />
erträglichen Dilemmatoleranz erhöht oder reduziert werden.<br />
Was jedoch nicht geht – und das ist die entscheidende Erkenntnis, die sich aus der<br />
Existenz der Dilemmatoleranz ergibt – ist eine manipulative Intervention im Sinne<br />
angepassteren Verhaltens. Diese Art von Interventionen sollten Gefängnissen<br />
vorbehalten bleiben, welche auf das Verhalten des Einzelnen erzieherisch Einfluss<br />
nehmen, nicht weil sich dadurch der Betroffene besser fühlt, sondern weil die<br />
gesetzgebende Gesellschaft das Verhalten desselben als für zu störend und nicht<br />
tolerierbar bestimmt.<br />
1.3.1. Überlebensfähigkeit als oberste Maxime<br />
Für den Menschen als Einzelwesen und Teil des evolutionären Abenteuers Universum<br />
gilt zumindest grundsätzlich als oberste Maxime Überlebensfähigkeit im nachhaltigsten<br />
Sinne. Das bedeutet aber, dass nicht bekannt sein kann, was sich als besonders<br />
Matthyas Arter 5/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
überlebensfähig erweisen wird und was nicht. Sicher sind es jene Wesen, die eine<br />
lebbare Dilemmatoleranz entwickelt haben. Aber welche Art von Ausprägung sich in<br />
welcher Situation besonders eignet, übersteigt das, was ein Mensch an Weltverständnis<br />
und Selbstverständnis im besten Falle bilden kann, bei weitem. Das ist aber der Grund,<br />
warum die Frage nach der Normalität nicht gestellt werden darf. Das Normale kann<br />
tödlich und das Abnormale ausgesprochen nachhaltig sein. Die Dilemmatoleranz ist<br />
dagegen ein Begriff, der geeignet ist, das mögliche Leiden im Einzelfall (die<br />
Abweichung von Weltverständnis und Welterfahrung) zu orten, anderseits aber den<br />
Raum offen lässt für Entwicklungen, die sich später als besonders fruchtbar und<br />
überlebensfähig erweisen. Wer das Augenmerk auf die Dilemmatoleranz in diesem<br />
Sinne richtet, kommt nicht in Versuchung, Glieder zu kürzen, damit der Betreffende<br />
seinen Platz im Prokrustesbett findet. Ein Nutzen für die therapeutische Tätigkeit,<br />
dessen Bedeutsamkeit man gar nicht überschätzen kann.<br />
Der für die Arbeit gewählte Aufbau könnte auf den ersten Blick den Eindruck<br />
erwecken, dass sich Dilemmatoleranz als Folge einer logischen Entwicklung<br />
konstituiert, indem die Nähe-Distanz-Problematik als Grundkonflikt zu Ichbildung und<br />
Selbstverständnis führt, womit vermehrt Konfliktfähigkeit und in letzter Konsequenz<br />
adäquate Dilemmatoleranz gebildet wird.<br />
Dem ist natürlich nicht so. Vielmehr finden entwicklungspsychologische Prozesse in<br />
der Form statt, dass sie einen Beitrag zu allen vier erwähnten Komponenten leisten.<br />
Durch die Behandlung der einzelnen Schwerpunkte wird lediglich der Blickwinkel<br />
geändert. Die betrachtete Materie, nämlich die psychodynamische Menschwerdung und<br />
Auseinandersetzung mit sich und der Welt, bleibt immer dieselbe. Die Betrachtung ist<br />
entsprechend ein Gesamtbild, dessen Ausführungen über die Nähe-Distanz-Problematik<br />
erst klar erkennbar werden, wenn auch das verinnerlicht wurde, was über<br />
Konfliktbewältigung, Dilemmatoleranz sowie Ich und Selbst geschrieben wurde.<br />
Matthyas Arter 6/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
2. Nähe/Distanz<br />
Dilemmatoleranz im Rahmen eines psychodynamischen Konzeptes zu beschreiben, hat<br />
das psychische Funktionieren zu berücksichtigen, wie es seinen Anfang nimmt. Also die<br />
Entwicklungsphase, wo das für den Menschen zentrale Thema, nämlich der Umgang<br />
mit Nähe und Distanz die erste Formung erlangt. Auch wenn nicht exakt gesagt werden<br />
kann, wie denn die Entwicklung der menschlichen Psyche im Anfangstadium vor sich<br />
geht, insbesondere, was schon genetisch vorgegeben, was durch Umweltprägung<br />
mitgestaltet wird, scheint es doch naheliegend, den Anfang sehr weit zurück anzusetzen.<br />
2.1. Der Mensch als Konzept und Kopie<br />
Nach SPITZ 1 ist das Neugeborene mit Ausnahme weniger Muskeln im Kopfbereich,<br />
bereits aus anatomischen Gründen unfähig dazu, sich als Urheber seiner Bewegungen<br />
zu erleben. Es erschrickt über die (noch nicht ich-haften) Vorgänge, die mit seinen<br />
Gliedmassen geschehen. Erst mit der zunehmenden Myelinisierung der Nervenbahnen<br />
werden willkürliche Bewegungen möglich. Das Ich ist also bereits aus anatomischen<br />
Gründen für längere Zeit noch nicht in das, was später sein Körper sein wird,<br />
eingezogen. Um aber das grundlegende und existentielle Dilemma des Menschen<br />
überhaupt erfahren zu können, ist eine „Subjektbildung“ oder ein Selbstverständnis<br />
unabdingbar. Wir dürfen an dieser Stelle also davon ausgehen, dass der Mensch nach<br />
der Geburt von Grund auf werden muss, zwar mit vorgegebenen Ausbaupotentialen, die<br />
selbstredend auch unterschiedlich sein können, aber im Grunde immer geprägt sind<br />
durch das Erlebte. Es scheint auch unbestritten, dass die Ich-Bildung, auf welche später<br />
gesondert eingegangen werden soll, zunächst an den eigenen Körper gebunden ist.<br />
„Das Ich ist vor allem ein körperliches“ (FREUD 13, 253).<br />
1 R.SPITZ, 1965,Vom Säugling zum Kleinkind, Klett-Cotta Stuttgart 1987<br />
Matthyas Arter 7/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
2.1.1. Grundkonflikt als Anfang<br />
Weiter kann der in gewissem Sinne bereits von FREUD 2 entwicklungspsychologisch<br />
beschriebene Prozess der konflikthaften dyadischen Trennung von Mutter und Kind<br />
sowie der späteren Triangulation, also das Beziehungsgefüge Mutter Kind, Vater Kind<br />
und Mutter Vater, sicher mit guten Argumenten als zentrale Gestaltungsproblematik für<br />
die menschliche Psyche betrachtet werden. MENTZOS 3 spricht vom Grundkonflikt<br />
„Autophil –Heterophil“, aber auch von „Verschmelzung“ versus „Unabhängigkeit“,<br />
immer im Interesse der Ich-Bildung respektive der Subjekt-Objekt-Differenzierung:<br />
“Die (normale) Aneignung und Besetzung der von der Mutter beherrschten<br />
Gebiete, also der Ich-Funktionen, wird deswegen für das Kind zum Problem, weil<br />
es wie jedes Kind, der Mutter nicht gleichgültig, nicht fremd gegenübersteht. Es<br />
ist nicht nur die Macht der Mutter, die es bei diesem Vorgang hindert und<br />
blockiert, sondern auch die (wenigstens potentielle) Zuneigung zu ihr und die<br />
Bindung an sie. Das Kind kann die Mutter nicht einfach aus seinem eroberten<br />
2 Die Verbindung von Mutter und Kind ist bis zur Geburt unzertrennlich im wörtlichen Sinn. Mit dem<br />
Durchtrennen der Nabelschnur beginnt ein offensichtlicher Trennungsprozess, welcher durch<br />
widerstrebende Interessen aber in jedem Fall konfliktbehaftet erfolgen muss. Je stärker die Macht der<br />
Mutter erlebt wird, desto schwieriger wird es für das Kind (bei FREUD explizit für den Sohn), sich von<br />
der Mutter zu lösen. Und wenn die Mutter auch noch von ihrem Mann enttäuscht und in ihrem Sohn einen<br />
Ersatz-Mann suchen sollte, dann sind die Widersprüche, mit denen sich der Sohn konfrontiert sieht,<br />
besonders schwer aufzulösen. Freud hat diesen Widerspruch von Stimulierung und Hemmung der<br />
Männlichkeit in einer Studie über Leonardo da Vinci angesprochen. Über Leonardos Mutter heißt es dort:<br />
„So nahm sie nach der Art aller unbefriedigten Mütter den kleinen Sohn an Stelle ihres Mannes an und<br />
raubte ihm durch die allzu frühe Reifung seiner Erotik ein Stück seiner Männlichkeit.“ Weiter heisst es:<br />
„Die Liebe der Mutter zum Säugling, den sie nährt und pflegt, ist etwas weit Tiefgreifenderes als ihre<br />
spätere Affektion für das heranwachsende Kind. Sie ist von der Natur eines vollbefriedigenden<br />
Liebesverhältnisses, das nicht nur alle seelischen Wünsche, sondern auch alle körperlichen Bedürfnisse<br />
erfüllt, und wenn sie eine der Formen des dem Menschen erreichbaren Glückes darstellt, so rührt dies<br />
nicht zum mindesten von der Möglichkeit her, auch längst verdrängte und pervers zu nennenden<br />
Wunschregungen ohne Vorwurf zu befriedigen. In der glücklichsten jungen Ehe verspürt es der Vater,<br />
dass das Kind, besonders der kleine Sohn, sein Nebenbuhler geworden ist, und eine tief im Unbewussten<br />
wurzelnde Gegnerschaft gegen den Bevorzugten nimmt von daher ihren Ausgang“ (FREUD 1910, 187).<br />
3 MENTZOS äussert sich an dieser Stelle zur Idee von LEMPA: „ Was ich recht allgemein als Subjekt-<br />
Objekt-Differenzierung nenne, konzipiert Lempa aus ich-zentrierter Sicht als das Misslingen der<br />
normalerweise stattfindenden Aneignung und Besetzung von Gebieten, die vorher unter fremdem<br />
Einfluss (Mutter) standen. Am Anfang stehe eine physiologische, normale Fremdbeeinflussung, bis das<br />
Ich in einer interpersonellen Auseinandersetzung seine Umwelt in sein Ich einfügen könne. Obwohl ich<br />
diese Beschreibung treffend finde, bestehe ich weiter auch auf der Notwendigkeit der Betonung des<br />
Gegensatzes autophil-heterophil, also des Grundkonfliktes, weil ich nur so den von Lempa genau<br />
geschilderten, aber noch nicht erklärten Vorgang verstehen kann.<br />
Seite 13/14 MENTZOS S, 2000<br />
Matthyas Arter 8/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
Terrain hinauswerfen, um sich überhaupt nicht mehr um sie zu kümmern“<br />
(MENTZOS, 2000, 13).<br />
MENTZOS umschreibt diesen Punkt in der Folge entsprechend als den Grundkonflikt<br />
in einer Therapie überhaupt (siehe Seite 81, Therapiekonsequenzen). Die Erweiterung<br />
des triebbasierten Modells FREUDS durch KOHUT 4 , welcher den Aspekt der<br />
Selbstentwicklung als wesentlichen Teil der Subjekt-Objekt-Differenzierung<br />
hinzufügte, unterstreicht die Konflikthaftigkeit der Nähe-Distanz-Problematik noch<br />
zusätzlich. Die Wichtigkeit der Selbstentwicklung in diesem Zusammenhang hebt auch<br />
MENTZOS hervor 5 .<br />
4 KOHUT geht davon aus, dass das Selbstverständnis über die Selbstobjekte gebildet wird. Zwei Arten<br />
von Selbstobjekten werden unterschieden. Einerseits die, welche das Gefühl von Lebenskraft vermitteln<br />
und bestätigend wirken und anderseits diejenigen, zu welchen das Kind aufblicken kann<br />
(Bezugspersonen), und Ruhe und Geborgenheit vermittelt bekommt. KOHUT schreibt: „Die erste Art<br />
wird als spiegelndes Selbstobjekt bezeichnet, die zweite als idealisierte Elternimago [… ] Je nach Qualität<br />
der Interaktionen zwischen dem Selbst und seinen Selbstobjekten in der Kindheit wird das Selbst<br />
entweder als gesunde oder als mehr oder weniger schwer beschädigte Struktur hervortreten. Das<br />
erwachsene Selbst kann daher in Zuständen unterschiedlicher Kohärenz existieren – von kohärent bis<br />
fragmentiert; in Zuständen unterschiedlicher Grade von Vitalität – von kraftvoll bis schwach; in<br />
Zuständen unterschiedlicher Grade funktionaler Harmonie – von geordnet bis chaotisch. (H. KOHUT/E.<br />
WOLF, 10, 688)<br />
5 Damit ist die Verdrängung der Begierde nach dem gegengeschlechtlichen und die Verinnerlichung des<br />
Bildes des gleichgeschlechtlichen Objekts gemeint. Diese Fähigkeit, den Konflikt bis zu einem gewissen<br />
Grade zu ertragen und dann in der geschilderten Weise zu lösen versuchen, ist allerdings nur dann ohne<br />
Komplikationen möglich, wenn das Kind schon ausreichendes Selbstvertrauen hat, wenn die Beziehungen<br />
zu den Eltern tragfähig sind, wenn die Objektkonstanz schon erreicht worden ist, wenn (in<br />
Zusammenhang mit alledem) die Kastrationsangst nicht übermässig ist. Betrachtet man die Aufgabe<br />
genau, so geht es hier darum, die relative Sicherheit der dyadischen Beziehung zu verlassen und das<br />
Wagen der Dreierbeziehung mit ihren Chancen und/aber auch ihren Risiken und Komplikationen auf<br />
sich zu nehmen. Der Konflikt besteht hier nicht nur<br />
- zwischen heterosexuellen libidinösen Impulsen einerseits und Inzesttabu und Kastrationsangst<br />
andererseits;<br />
- zwischen heterosexuellen und homosexuellen Tendenzen (positiver und negativer<br />
Ödipuskomplex);<br />
- vielmehr geht es auch um den Konflikt zwischen (auf den gegengeschlechtlichen Elternteil<br />
gerichteten) Triebbedürfnissen und narzisstischen (Selbst-) Bedürfnissen dem<br />
gleichgeschlechtlichen Elternteil gegenüber. Der Junge rivalisiert zwar mit dem Vater um die<br />
Mutter als „Triebobjekt“ – er sympathisiert aber mit ihm als Vorbild, Identifikationsfigur,<br />
idealisiertem Objekt. Analog verhält es sich beim Mädchen. Das Dilemma lautet also in dieser<br />
Phase: Sicherheit und Beschränkungen der dyadischen Beziehung versus Chancen (und Risiken)<br />
der Dreierbeziehung.( MENTZOS, 2005, 127)<br />
Matthyas Arter 9/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
2.1.2. Nähe-Distanz-Dilemma<br />
Es ist zu vermuten, dass die Nähe-Distanz-Problematik sozusagen ab den ersten<br />
Lebensmomenten nichts Geringeres als die existentielle Problematik schlechthin, das<br />
Grunddilemma darstellt. Dazu BECKER:<br />
„Was die interpersonalen Verhältnisse betrifft, so ist leicht einzusehen, dass die<br />
betroffene, von den Affekten des Beziehungspartners überschwemmte Person in<br />
eine spezifische Unterlegenheit oder Ohnmacht gegen dieses Objekt geraten und<br />
dabei subjektiv die Erfahrung des zerstörerischen Eindringens, der Intrusion<br />
machen kann“ (BECKER in MENTZOS, 2000, 90).<br />
Die Folgen davon sind vielfältig:<br />
„Der Konflikt zwischen Gehorsam (Fremdbestimmung) und Autonomie<br />
(Selbstbestimmung) wird oft nicht ohne Traumatisierung bzw. Fixierung<br />
überstanden. Einige Eltern sind enttäuscht und überfordert durch die<br />
„Aufsässigkeit“ des früher so ruhigen und lieben Kindes und versuchen mit<br />
Einschüchterung oder sogar Schuldgefühlserweckung die Autonomiebestrebungen<br />
und expansiven Tendenzen zu unterdrücken. Dies kann zu Verbitterung,<br />
Gereiztheit, Rachewünschen oder totaler Anpassung, Aggressionshemmung und<br />
vielleicht später zum Ansatz einer zwangsneurotischen Struktur führen“<br />
(MENTZOS, 2005, 98).<br />
2.1.3. Das „wahre“ Selbst<br />
In ähnlicher Weise drückte sich auch schon WINNICOTT 6 aus, indem er die zentrale<br />
Rolle der Mutter als „Holding“ definiert. Dieser Begriff weist auf das Zusammenspiel<br />
zwischen Mutter und Kind hin, bei dem sozusagen „gesunde, physiologische Ich–<br />
Störungen“ ablaufen. Ich-Funktionen, Gefühle werden von der Mutter „gehalten“, man<br />
könnte auch sagen gehätschelt, bis sie auf eigenen Füssen stehen können, das Ich sich<br />
als ihr Agent und Uhrheber wahrnimmt. WINNICOTT sieht in der Mutter entsprechend<br />
die Quelle, die Ausleihstelle, welche dem Kind durch Identifikation mit dem Objekt das<br />
„wahre Selbst“ ausleihen kann, bis sich das Kind das eigene Ich-Verständnis diesem<br />
Vorbild nachgebildet hat und entsprechend der Umgang mit Spannungen, die sich aus<br />
6 WINNICOTT, 1965, Reifungsprozesse und fördernde Umwelt, Fischer, Frankfurt a.M. 1974<br />
Matthyas Arter 10/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
der Nähe-Distanz-Problematik respektive den zunehmend damit verbundenen Gefühlen<br />
für das Kind als Orientierungsmuster in der Welt nach dem Vorbild der Mutter prägt.<br />
FROMM:<br />
„Die Mutter sollte Vertrauen zum Leben haben und daher nicht überängstlich sein<br />
und das Kind mit ihrer Angst anstecken. Sie sollte den Wunsch, dass das Kind<br />
unabhängig wird und sich schliesslich von ihr trennt, zu einem Bestandteil ihres<br />
Lebens machen. Die väterliche Liebe sollte sich von Grundsätzen und<br />
Erwartungen leiten lassen. Sie sollte geduldig und tolerant und nicht bedrohlich<br />
und autoritär sein. Sie sollte dem heranwachsenden Kind in immer stärkerem<br />
Masse das Gefühl der eigenen Kompetenz geben und ihm schliesslich erlauben,<br />
über sich selbst zu bestimmen und ohne die väterliche Autorität auszukommen.<br />
Schliesslich hat der reife Mensch den Punkt erreicht, an dem er seine eigene<br />
Mutter und sein eigener Vater ist. Er besitzt dann sozusagen ein mütterliches und<br />
ein väterliches Gewissen. Das mütterliche Gewissen sagt: „Es gibt keine Missetat,<br />
kein Verbrechen, die dich meiner Liebe, meiner guten Wünsche für dein Leben<br />
und für dein Glück berauben könnten.“ Das väterliche Gewissen sagt: „Du hast<br />
unrecht getan und musst die Folgen tragen; vor allem aber musst du dein<br />
Verhalten ändern, wenn ich dir auch weiterhin gut sein soll.“ Der reife Mensch<br />
hat sich von der äusseren Mutter- und Vaterfigur freigemacht und sie in seinem<br />
Inneren aufgebaut“ (FROMM, Liebe, 55).<br />
Die Relevanz dieser Problematik, die Berechtigung dieselbe als Grundkonflikt zu<br />
bezeichnen, leuchtet unter diesen Gesichtspunkten also durchaus ein. FROMM<br />
formuliert weiter hinten noch etwas poetischer folgendermassen:<br />
„Die Milch ist das Symbol des ersten Aspekts der Liebe, dem der Fürsorge und<br />
Bestätigung. Der Honig symbolisiert die Süssigkeit des Lebens und das Glück zu<br />
leben. Die meisten Menschen sind fähig, „Milch“ zu geben, aber nur eine<br />
Minderzahl unter ihnen kann auch „Honig“ spenden. Um Honig spenden zu<br />
können, muss die Mutter nicht nur eine „gute Mutter“ sein, sie muss auch ein<br />
glücklicher Mensch sein – ein Ziel, das nur wenige erreichen. Die Wirkung auf<br />
das Kind kann man kaum zu hoch einschätzen. Die Liebe der Mutter zum Leben<br />
ist ebenso ansteckend wie ihre Angst“ (FROMM, Liebe, 61).<br />
Matthyas Arter 11/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
2.2. Die hinreichend gute Mutter<br />
Wenn WINNICOTT im Gegensatz zu FROMM nicht die „gute Mutter“, sondern die<br />
„hinreichend gute Mutter“ fordert, dann eben deshalb, weil in FROMMS Worten das<br />
Missverständnis einer nur (im Sinne von ausschliesslich und sorglos) glücklichen<br />
Mutter mitschwingt, was eine denkbar schlechte Vorbildung für die Unbill des Lebens<br />
wäre. Die Angst gehört ebenso zum Leben wie die Liebe. Es ist das Dilemma von<br />
Distanz (Angst) und Nähe (Liebe), was selbstredend auch FROMMS Überzeugung ist.<br />
Es versteht sich von selbst, dass die Bildung dessen, was durch Trennung, respektive<br />
Distanz geschaffen werden soll, nämlich das Selbst, gerade dadurch überhaupt erst für<br />
zerstörerisches Eindringen konstituiert wird und entsprechend der nie verschwindenden<br />
Gefahr von zuviel Nähe, respektive zuviel Distanz ausgesetzt ist. Zuviel Nähe bedeutet<br />
entsprechend Destruktion erwünschter Autonomie, zuviel Distanz Verlust der<br />
Beziehung zum Objekt und damit zur Realität. FREUD sagt, dass die grösste Kränkung<br />
des Menschen darin bestehe, dass das Ich nicht Herr im eigenen Haus sei (FREUD 12,<br />
11). Über die Begriffe Ich und Selbst soll weiter hinten noch referiert werden. An dieser<br />
Stelle genügt es festzustellen, dass sowohl das Selbst als auch das Ich (hier als<br />
bewusster, willensvollstreckender Teil des Selbst verstanden), überhaupt nur durch die<br />
permanente Bewältigung des Grundkonfliktes von Nähe und Distanz aufrecht erhalten<br />
werden können. Dass dieser Grundkonflikt in verschiedenen Modellen 7 unterschiedlich<br />
betont wird, unterstreicht nur dessen zentrale Bedeutung. Unabhängig davon, worauf<br />
der Fokus gesetzt wird, es bleibt bei einem in der Logik durch Unvereinbarkeit<br />
geprägten Gegensatz. Dieser Gegensatz ist meines Erachtens treffend als Dilemma zu<br />
bezeichnen. Dilemma deshalb, weil sich die beiden theoretischen Parameter in logisch<br />
7 Die psychoanalytische Entwicklungslehre ist daher in erster Linie eine Psychologie der Triebe und der<br />
durch sie zustandegekommenen Beziehungen. Entwicklung, psychische Reifung finden innerhalb einer<br />
Hierarchie von Konfliktlösungen statt; in einem dialektischen Spannungsverhältnis erfolgen<br />
Konfliktlösungen (Synthesen), die wiederum auf einer höher geordneten Stufe selbst eine Gegenthese<br />
erschaffen. Die wichtigsten entwicklungspsychologischen Schulen (z.B. FREUD, SPITZ, ERIKSON,<br />
MAHLER) haben sich mit Dualismen als Motor der psychischen Entwicklung befasst, dabei aber<br />
bestimmte Modi selektiv in den Vordergrund gestellt, zum Beispiel Libido – Aggressivität, Aktivität –<br />
Passivität, Einverleiben – Ausstossen, Nähe – Distanz, Autonomie – Abhängigkeit, Urvertrauen –<br />
Misstrauen, Identität – Rollenkonfusion und weitere. Essentiell scheinen mir drei Dualismen zu sein:<br />
Die Getrenntheitserfahrung: Subjekt – Objekt<br />
Die Triebqualitäten: Libido – Aggression<br />
Der Geschlechtsunterschied: männlich – weiblich<br />
(ELZER in MENTZOS, 2000, 104f)<br />
Matthyas Arter 12/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
denkbaren Modellen gegenseitig ausschliessen und für eine funktionierende Existenz<br />
dennoch unter einen Hut gebracht werden müssen, also weder der Entscheid nur für das<br />
eine noch nur für das andere gefällt werden kann.<br />
2.3. Ambivalenz, Dilemma und Ich-Genese<br />
Es handelt sich – immer aus dem theoretisch logischen Blickwinkel betrachtet - nicht<br />
um Ambivalenz, da dies voraussetzen würde, dass Nähe und Distanz eine gleichwertige<br />
Alternative darstellte, was die Entscheidung erschwerte, eine Wahl für das eine oder<br />
andere aber grundsätzlich zuliesse. Ambivalenz bezeichnet die Schwierigkeit, eine von<br />
zwei gleichwertigen Möglichkeiten zu wählen. Dies fällt ausser Betracht. Nur Nähe<br />
würde zur Verschmelzung, respektive Selbstauflösung führen. Nur Distanz führte zur<br />
totalen Isolation und Vereinsamung. Nähe und Distanz gleichzeitig sind aber rational<br />
betrachtet auch nicht möglich, also paradox und möglicherweise gerade deshalb<br />
existentiell. Diese zentrale Aussage ist insofern entscheidend, als es einen ersten<br />
Hinweis darauf gibt, dass diese Problematik auf dem logischen Fundament keine<br />
Ambivalenz provoziert, sondern ein Dilemma darstellt, welches nicht grundsätzlich,<br />
sondern nur situativ und zudem lediglich dynamisch, respektive ausserhalb der<br />
logischen Erklärbarkeit zu lösen ist. Wir dürfen und können daher nicht davon<br />
ausgehen, dass es eine „richtige“ Lösung im Sinne von „logisch“ für diese Problematik<br />
gibt. Gleichzeitig müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass dieses allgegenwärtige<br />
Dilemma aber immer sofort gelöst wird – auf tausenderlei Arten, keineswegs nachhaltig<br />
und zuweilen um den Preis der eigenen Existenz. Es hat aber keinen Sinn, sich<br />
diesbezüglich irgendwelchen Illusionen hinzugeben und so etwas wie mehr oder<br />
weniger geglückte Lösungen zu postulieren. Die gewählte Lösung ist augenblicklich<br />
immer die einzige, die in Frage kommt. Ebenso klar ist entsprechend, dass jederzeit eine<br />
völlig andere angestrebt werden kann. In dieser Tatsache steckt wiederum das<br />
Phänomen der Ambivalenz, nicht weil man gleichwertige Alternativen zur Verfügung<br />
hat, sondern die gewählte immer gleich an Attraktivität verliert, weil sie unter den<br />
neuen Verhältnissen automatisch relativiert wird. Das Dilemma wirkt stärker als die<br />
Ambivalenz. Meta-Aussagen über den richtigen Umgang mit der Nähe-Distanz-<br />
Problematik sind daher nichts weiter als eine Leugnung der offensichtlichen<br />
Matthyas Arter 13/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
Dilemmastruktur der Problematik und entsprechend Versuche, die am Hauptproblem<br />
vorbei gehen. Es überrascht daher auch nicht, dass sich in der wissenschaftlichen<br />
Psychologie die Erkenntnis etabliert hat, dass es bestenfalls gelingt, den praktikablen<br />
Umgang mit der Nähe-Distanz Problematik zu beschreiben, wie dies beispielsweise<br />
LEMPA anschaulich tut:<br />
„Die primären Bezugspersonen unterstützen also unter genügend guten<br />
Bedingungen das sich ausbildende Ich des Kindes. Sie beschützen seinen Willen,<br />
brechen ihn nicht, sondern schaffen ihm, wenn möglich, einen Übergangsraum.<br />
Ein Kind, das unbedingt „auch Wein“ haben möchte, erlebt keine totale Abfuhr,<br />
es bekommt etwa „Kinderwein“, bestehend aus Apfelsaft in einem Weinglas.<br />
Dahinter steckt die intuitive Erkenntnis, dass nun die Ich-Funktion des Kindes,<br />
das Gefühl, Urheber der Ereignisse zu sein, in die Aussenwelt aktiv eingreifen zu<br />
können, behüten muss, dass sie zu ihrer Entwicklung eine Art Schonraum<br />
benötigen. Diese mütterlichen Hilfestellungen liessen sich, wie ich meine auch gut<br />
unter dem Terminus „Hilfs-Ich“ (WINNICOTT) subsumieren. Noch besser wäre<br />
es vielleicht, von einem ‚Hilfskörper’ zu sprechen“ (LEMPA in MENTZOS,<br />
2000, 53).<br />
Wir könnten auch von „Nachbau“, „Kopie“ oder „Stellvertreter“ sprechen, indem<br />
Mutter und Vater versuchen, im Kinde jenen Gestaltungskräften Form zu geben, welche<br />
das eigene Leben – als Folge der Prägung durch deren Eltern – auf einen mehr oder<br />
minder verlässlichen Boden von Nähe und Distanz gestellt haben. Der von LEMPA<br />
zitierte TAUSK formulierte es bereits 1919 radikal:<br />
„Es ... ist Ausdruck der Tatsache, dass das Kind nichts allein aus sich selbst kann,<br />
sondern alles von den andern Menschen empfängt, den Gebrauch der<br />
Gliedmassen, die Sprache, die Gedanken. In jener Zeit wird dem Kind tatsächlich<br />
alles gemacht, jede Lust, jedes Leid, und es ist gewiss nicht in der Lage, zu<br />
erfassen, wieviel Anteil es selbst an seinen eigenen Leistungen hat“ (TAUSK,<br />
1919, 15).<br />
LEMPA verdeutlicht dies weiter wie folgt:<br />
„Kleinianisch ausgedrückt, kommt es in der Kindheit also zur introjektiven und<br />
projektiven Identifikation nicht nur von unerträglichen Affekten und Trieben,<br />
sondern von Ich-Funktionen. Die Mutter übernimmt den Apparat des Zuganges<br />
Matthyas Arter 14/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
zur Realität, bis das Kind als Resultat seines interpersonellen Austausches stark<br />
genug ist, den Körper und seine Funktionen in eigener Regie zu übernehmen, zu<br />
ihrem Agenten zu werden. Diesen Prozess zwischen Mutter und Kind scheint mir<br />
der klassische Begriff der primären Identifizierung einigermassen brauchbar zu<br />
beschreiben. [...] Es wird (aber) zuwenig Wert darauf gelegt, dass diese<br />
‚Aneignung’ (Identifizierung) das Resultat eines komplexen Austausches darstellt.<br />
Ist dieser, und damit die ‚Inbetriebnahme’ des Körpers und seiner Funktionen<br />
durch das Ich, gestört, entsteht die Disposition zur Psychose. Ein Ich, das<br />
psychotisch reagiert, hat es nur unzureichend geschafft, sich einen psychischen<br />
Binnenraum zu sichern und die Herrschaft in seinem Körper zu erobern“<br />
(LEMPA in MENTZOS, 2000, 54).<br />
2.4. Psychose als Ventil<br />
Der Bezug zur Psychose ist im Zusammenhang dieser Darstellung besonders wichtig,<br />
weil ein direkter Zusammenhang zu nicht bewältigten Dilemmata schon an dieser Stelle<br />
vermutet werden darf. Es wäre indes falsch, die Disposition zur Psychose als etwas<br />
Krankhaftes, als Konsequenz einer schief gelaufenen Hilfs-Ich-Funktion oder ähnlich zu<br />
erklären. Die hinreichend gute Mutter ist mit Mängeln behaftet, welche dem Kind in<br />
seiner Ich-Funktion mit auf den Weg gegeben werden, nicht weil es Mängel sind,<br />
sondern weil die Mutter mit diesen Mängeln umgehen kann, zumindest überlebensfähig<br />
ist. Zum „Gerangel um Realität und Ich“ (LEMPA, in MENTZOS, 2000, 54) kommt<br />
es in allen Familien, weil sowohl das Ich als auch die relevante Realität einem<br />
dynamischen Entwicklungsprozess unterliegen, was ständige Anpassung erfordert. Erst<br />
wo diese Anpassung nicht befriedigend, respektive mit inadäquater Dilemmatoleranz<br />
erfolgen kann, setzt sich die Psychose als Regression im Sinne eines reculer pour mieux<br />
sauter durch. Diese Notwendigkeit besteht insbesondere dann, wenn die Lösung von der<br />
Mutter im Beziehungsgefüge gar nicht vorgesehen ist, oder wie LEMPA schreibt:<br />
„Bedrohlich wird die Situation, wenn beispielsweise ein junger Mann, dessen<br />
Gedanken eigentlich nur eine Filiale der Gedanken seiner Mutter darstellen, in<br />
eine Situation kommt, die ein selbständiges Denken erfordert. Wenn er sich<br />
verliebt, ist es unmöglich, sich sein Denken weiterhin von der Mutter auszuleihen,<br />
Matthyas Arter 15/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
er kann sich nicht von ihr einsagen lassen, was er in jedem Augenblick tun soll.<br />
Dies würde den Wunsch, der ja von der Mutter wegzielt, ersticken“ (Seite 65,<br />
LEMPA in MENTZOS, 2000).<br />
2.5. Die paradoxe Natur der Grundproblematik<br />
Verkompliziert wird die Problematik dadurch, dass eben gerade nicht klar sein kann, wo<br />
zuviel Nähe oder zuviel Distanz die optimale Entwicklung des „eigenen“ Potentials<br />
behindert. Man könnte bestenfalls von einem iterativen Prozess sprechen, von einer<br />
schwankenden Gratwanderung, für welche das oberste Gebot darin besteht, weder auf<br />
die eine noch auf die andere Seite zu kippen, ungeachtet der Tatsache, dass gleichzeitig<br />
nicht wirklich klar ist, wo denn die Mitte wäre. Der Umgang mit Nähe und Distanz<br />
bleibt paradox, willkürlich und doch zwingend. FROMM postuliert als möglichen<br />
Lösungsansatz die Liebe der Mutter in einem ganz spezifischen Sinn:<br />
„Eine der wichtigsten Voraussetzungen ist, dass die Bezugsperson im Leben des<br />
Kindes an diese Entwicklungsmöglichkeiten glaubt. Ob dieser Glaube vorhanden<br />
ist oder nicht, macht den Unterschied aus zwischen Erziehung und Manipulation.<br />
Erziehung bedeutet, dem Kind zu helfen, seine Möglichkeiten zu realisieren. Das<br />
Gegenteil von Erziehung ist Manipulation, bei welcher der Erwachsene nicht an<br />
die Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes glaubt und überzeugt ist, dass das<br />
Kind nur dann zu einem ordentlichen Menschen wird, wenn er ihm das, was er für<br />
wünschenswert hält, einprägt und alles unterdrückt, was ihm nicht wünschenswert<br />
scheint“ (FROMM, Liebe, 136).<br />
Bemerkenswert ist in der Auseinandersetzung mit der Nähe-Distanz-Problematik, dass<br />
der für die Mutter-Kind-Ablösung typische Ablauf von Abgrenzung (des Fremden) und<br />
Verinnerlichung (des Eroberten) sich in allen psychischen Belangen zumindest in<br />
ähnlicher Form wieder findet. Ziel dieses Prozesses ist die Selbstbildung oder man<br />
könnte auch sagen die Statuierung einer handelnden Einheit, nicht zuletzt mit dem Ziel,<br />
aufgrund der erfolgten Konditionierung mit optimalen Überlebens- und<br />
Fortpflanzungschancen den Gang der Welt respektive deren Gestaltung zu beeinflussen.<br />
Das bedeutet, dass wir auf der Basis der Nähe-Distanz-Problematik so etwas wie einen<br />
Matthyas Arter 16/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
„Selbst-Darwinismus“ etablieren können, also die Idee entwickeln können, wonach jede<br />
„Selbstbildung“ respektive „Ich-Konstruktion“ ein Versuch darstellt, ein (für das<br />
Überleben, respektive die eigenen, aktuellen, höchsten Werte) taugliches Verhältnis<br />
zwischen Nähe und Distanz, zwischen Unabhängigkeit und Verschmelzung zu<br />
etablieren.<br />
Etwas gelindert wird diese existentielle Problematik dadurch, dass die Entwicklung des<br />
Selbst- und Weltverständnisses offenbar enger an Verhaltensmuster gebunden ist, als<br />
man rein theoretisch annehmen könnte. Bereits PIAGIET konnte diesbezüglich mit<br />
überzeugenden Beobachtungen aufwarten:<br />
„Die Generalisierung der sekundären Verhaltensschemata stellt sich von selbst<br />
ein, wenn das Kind vor neue Gegenstände gebracht wird. In solchen Fällen<br />
wendet das Kind ohne weiteres seine ihm vertrauten Verhaltensweisen an und<br />
assimiliert den unbekannten Gegenstand an diese Schemata. Es ist wirklich eine<br />
erstaunliche Sache, dass die neuartigen Dinge dem Kind umso weniger neuartig<br />
erscheinen, je jünger es ist. Leider ist es unmöglich, in dieser Beziehung die<br />
sekundären Reaktionen mit den primären Reaktionen vor unbekannten<br />
Gegenständen zu vergleichen, es besteht zwischen ihnen kaum ein gemeinsames<br />
Vergleichsmass. Wenn man aber die Reaktionen des gegenwärtigen Stadiums mit<br />
demjenigen des folgenden vergleicht und erst recht mit den ‚tertiären<br />
Zirkulärreaktionen’ des fünften Stadiums, wird der Unterschied umso<br />
frappierender, je vergleichbarer die Situationen sind. Das Kind des fünften<br />
Stadiums ist vor einem neuartigen Phänomen in der Lage, eine<br />
Experimentierhaltung einzunehmen (das bedeutet nicht, dass es diese Haltung<br />
notwendigerweise annimmt, aber es ist dazu fähig. Es sucht nach dem Neuartigen<br />
um seiner selbst willen und variiert die Bedingungen des Ereignisses, um alle<br />
seine verschiedenen Erscheinungsweisen zu prüfen. Das Kind des vierten<br />
Stadiums gelangt noch nicht zu solchen „Experimenten, um zu sehen“<br />
(‚expérience pour voir’), im eigentlichen Sinn, es hat aber doch Interesse für den<br />
neuen Gegenstand an sich. Um diesen neuen Gegenstand zu ‚verstehen’, versucht<br />
es, die verschiedenen, ihm bekannten Verhaltensschemata auf den Gegenstand<br />
anzuwenden, um dasjenige herauszufinden, das ganz besonders auf ihn passt“<br />
(PIAGET, 1, 202).<br />
Matthyas Arter 17/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
Bemerkenswert an diesen Beobachtungen ist im Hinblick auf die Dilemmatoleranz,<br />
dass mit der Ausbildung der Art und Weise, wie „Fremdes“ in die eigene<br />
Weltvorstellung integriert wird, einer offenbar allgemein beobachtbaren Entwicklung<br />
unterliegt und entsprechend auch festgestellt werden kann, welche Entwicklungsschritte<br />
erwachsene Menschen im Einzelfall nur unvollständig vollzogen haben und<br />
entsprechend andere Muster bezüglich der Integration von „Welt“ anwenden müssen,<br />
um das stets labile Gleichgewicht von Nähe und Distanz nicht zu gefährden. Es versteht<br />
sich von selbst, dass die von PIAGET beschriebene fünfte Stufe der neugierigen<br />
Integration von Gegenständen unter Anpassung der eigenen Weltvorstellung eine völlig<br />
andere Dilemmatoleranz nach sich zieht, als sie jemand haben kann, der durch massive<br />
Verunsicherung auf einer tieferen Stufe stehen geblieben ist, also nicht in der Lage ist,<br />
sein (zu einfaches und unzureichendes) Weltbild den wachsenden Erfordernissen<br />
anzupassen. Auch wenn nicht sicher ist, ob das Kind tatsächlich „um seiner selbst<br />
willen nach dem Neuartigen sucht“ oder vielmehr weil es die Erfahrung machen konnte,<br />
dass die Integration von Fremdem die Angst vor demselben zum Verschwinden bringt<br />
und entsprechend Lust bereitet, ist nicht so wichtig. Wichtig ist vielmehr, dass dort, wo<br />
diese Bereitschaft fehlt, die zum Leben notwendige Konfliktbewältigungsbereitschaft<br />
reduziert ist.<br />
2.5.1. Affektive Besetzung als Wertbasis<br />
Als Basis für den Umgang der Nähe-Distanz-Problematik dienen die dem werdenden<br />
Subjekt als Sinneswahrnehmung zur Verfügung stehenden Eindrücke sowie die<br />
kognitiven Möglichkeiten zur Verarbeitung und affektiven Besetzung derselben. In<br />
diesem Prozess nehmen Gefühle als Signale einen entscheidenden Platz ein.<br />
MENTZOS:<br />
„In seiner zweiten Angsttheorie, dem Konzept der Signalangst, war FREUD<br />
unseren heutigen Auffassungen über die eminente regulatorische Bedeutung der<br />
Affekte und Gefühle sehr nahe gekommen; aber erst allmählich und später begriff<br />
man, dass auch fast alle anderen Affekte und Gefühle ebenfalls die Funktion von<br />
Signalen und Indikationen haben, die angenehme oder unangenehme, gefährliche<br />
oder sicherheitsbietende Zustände ankündigen und somit zu entsprechenden<br />
Matthyas Arter 18/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
Reaktionen Anlass geben […] Selbst die höchste Form symbolischer<br />
Repräsentanz wird erst durch ihre direkten öder indirekten Verbindungen mit<br />
Gefühlen sinnhaltig. In diesem Sinne gibt es überhaupt keinen rein kognitiven<br />
oder intellektuellen Vorgang. Eine erfolgreiche mathematische Operation ist mit<br />
Gefühlen von Richtigkeit assoziiert und diese wiederum sind mit<br />
Sicherheitsgefühlen verbunden, mit ‚guten’ Gefühlen von Erfolg und<br />
‚Funktionsverlust’“ (MENTZOS, 2005, 28).<br />
Gefühle sind aber erst dann möglich, wenn ein Minimum an Selbstrepräsentanz bereits<br />
vorliegt. KRAUSE:<br />
„Als Gefühl im engeren Sinne bezeichnen wir die bewusste Wahrnehmung eines<br />
Affekts. Sie setzt eine rudimentäre Selbstrepräsentanz voraus, ebenso wie eine<br />
kognitive Repräsentanz des Affekts. Empathie im engeren Sinne setzt nun eine<br />
weitere kognitive Komponente voraus, nämlich die Befähigung, sich selbst an die<br />
Stelle eines anderen zu setzen, also das was PIAGET Dezentrierung genannt hat,<br />
oder die Aufgabe des egozentrischen Weltbildes“ (KRAUSE, 1985, 105).<br />
Man könnte auch sagen, die Affekte werden angeeignet, verarbeitet zu Signalen, welche<br />
„selbstgemäss“ in Aktionen und Reaktion umgesetzt werden und auf diese Weise nicht<br />
nur den Umgang mit äusseren Geschehnissen definieren, sondern auch die Person selbst<br />
und ihre Handlungsweise mit einer unverkennbaren Identität. Wie weiter vorne<br />
dargelegt, ist die Mutter als Vorbild für den Umgang mit Affekten von entscheidender<br />
Bedeutung. Sie definiert für das Kind Interpretationsmuster, welche hernach als<br />
bestimmende Faktoren die Selbstbildung und den Umgang mit der Welt formen. Sie<br />
sind das Resultat des dyadischen Prozesses, erfahren eine Relativierung durch die<br />
Triangulation und können während der Pubertätsphase durch eine Neuorientierung<br />
nachgebessert werden. Auch hier manifestiert sich das Dilemma exemplarisch: Die<br />
Bildung der eigenen Gefühle, respektive der Umgang mit den Signalen der Affekte wird<br />
hauptsächlich durch Nachahmung geprägt. Es überrascht denn wohl kaum, dass eben<br />
gerade für die Bildung von Ich und Selbst Spannungen insbesondere im Bereich der<br />
gefühlsmässigen Besetzung von Affekten die zentrale Rolle spielen.<br />
Matthyas Arter 19/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
3. Selbst- und Ich-Bildung<br />
Aufgrund der Ausführungen über die Nähe-Distanz-Problematik ist es nachvollziehbar,<br />
dass im vorgestellten Modell der Komplex - durchaus im JUNGSCHEN Sinn gemeint-,<br />
mit welchem man das umschreibt, was mit Ich gemeint sein kann, ein<br />
entwicklungspsychologisches Produkt aus Nachahmung und Sinneswahrnehmung<br />
sowie selbständiger respektive selbsttätiger Konstruktion ist.<br />
3.1. Das körperliche Ich<br />
Das Ich, von FREUD als bewusste Instanz mit eigenem Willen verstanden, aber<br />
abhängig von Über-Ich und Es, kann demnach nicht mehr sein als eine psychische<br />
Illusion, wenn auch mit durchaus real empfundenen Konsequenzen. LEMPA schreibt zu<br />
Ich und Ich-Illusion treffend:<br />
„Alle Theorien zeigen also ein Ich, einen Apparat der Repräsentation der<br />
Aussenwelt, der sich täuscht, der falsche Resultate liefert. Vom gesunden<br />
Menschenverstand aus gesehen ist dies sicher unbestritten, es unterschlägt aber<br />
ganz einfach die Tatsache, dass es in der Psychose zu dem zutiefst unheimlichen<br />
Phänomen kommt, dass nicht nur die Inhalte der Erkenntnis, sondern der<br />
Erkenntnisapparat selbst, die Werkzeuge, die den Zugang zur Realität erzeugen,<br />
dem Ich abhanden kommen. Sie geraten unter fremden Einfluss, das Ich verliert<br />
die Kontrolle über das, und mehr als das, was der moderne Mensch seit<br />
DESCARTES als Grundlage seiner Selbstgewissheit ansieht. (MENTZOS, 2000,<br />
46).<br />
Anzumerken ist hier, dass die Werkzeuge dem Ich möglicherweise nur deshalb<br />
abhanden kommen, weil es sich nicht im Sinne des lebbaren Ichs konstituiert hat. Die<br />
Änderung der Konstituierung ist aber nur über den Ausweg der Psychose überhaupt<br />
möglich, da das Ich nichts weniger gerne aufgibt als die Vorstellung seiner selbst.<br />
Die Entstehung der Ich-Illusion ist zunächst wie schon erwähnt und von FREUD<br />
postuliert, vernünftigerweise auf der Basis der Körperlichkeit zu verstehen. „Das Ich ist<br />
vor allem ein körperliches“.<br />
Und weiter schreibt Freud in „Triebe und Triebschicksale“:<br />
Matthyas Arter 20/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
„Stellen wir uns auf den Standpunkt eines völlig hilflosen, in der Welt noch<br />
unorientierten Lebewesens, welches Reize in seiner Nervensubstanz auffängt.<br />
Dieses Lebewesen wird sehr bald in die Lage kommen, eine erste Unterscheidung<br />
zu machen, um eine erste Orientierung zu gewinnen. Es wird einerseits Reize<br />
verspüren, denen es sich durch Muskelreaktion (Flucht) entziehen kann, diese<br />
Reize rechnet es zu einer Aussenwelt, anderseits aber auch noch Reize, gegen<br />
welche eine solche Aktion nutzlos bleibt, die trotzdem ihren konstant drängenden<br />
Charakter behalten; diese Reize sind das Kennzeichen einer Innenwelt, der<br />
Beweis für Triebbedürfnisse. Die wahrnehmende Substanz des Lebewesens wird<br />
so an der Wirksamkeit ihrer Muskeltätigkeit einen Anhaltspunkt gewonnen haben,<br />
um ein ‚Aussen’ von einem ‚Innen’ zu unterscheiden“ (FREUD, 10, 212).<br />
Der Körper mit seinen Möglichkeiten zu agieren und die Sinneswahrnehmungen mit der<br />
Möglichkeit zu reagieren, lassen das von FREUD beschriebene Abgrenzungsprozedere<br />
als naheliegend erscheinen. Was wird verinnerlicht, was bleibt draussen, was ist nahe,<br />
was ist distanziert? Der Umgang mit diesen Fragen ist eng mit dem Ich-Begriff<br />
verknüpft, wobei die herkömmliche Idee der Ich-Bildung für die Entstehung von<br />
Neurosen und Psychosen fallen gelassen werden muss, wenn man die Nähe-Distanz-<br />
Problematik zum Grundkonflikt erklärt, was, wie gezeigt wurde, durchaus vernünftig<br />
ist. MENTZOS:<br />
„Man sieht üblicherweise den zentralen Unterschied zwischen Psychose und<br />
Neurose gerade darin, dass den Neurosen ein Konflikt zugrundeliege, während<br />
den Psychosen die „Ich-Schwäche“ und der Strukturmangel (gleich ob<br />
psychosozial oder somatisch-biologisch bedingt oder beides) […] Wir beginnen<br />
uns zu fragen, ob die Psychotiker tatsächlich so „ich-schwach“ sind, wie wir es<br />
annahmen. Wir beginnen auch zu begreifen, welche zentrale Bedeutung gerade<br />
antinomische Konstellationen innerhalb der psychotischen Dynamik besitzen“<br />
(MENTZOS, 2000, 9f).<br />
3.1.1. Das Ich als formbare und handelnde Instanz<br />
Es scheint also vernünftiger zu sein, nicht so sehr zwischen Konflikt und Ich-Schwäche<br />
zu unterscheiden, als vielmehr zwischen Distanz (klare Trennung) und Nähe<br />
Matthyas Arter 21/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
(Verschmelzung). Das Ich – egal wie stark oder schwach – ist Resultante der damit<br />
verbundenen Erfahrungen.<br />
Das Ich als handelnde Instanz tritt relativ spät auf. Erst im dritten Lebensjahr beginnt<br />
der Mensch Aktivitäten seiner selbst als Willensäusserungen eines selbständigen Ichs zu<br />
verstehen und durchzusetzen. Die Konstruktion bleibt zeitlebens „schwach“, anfällig<br />
und nicht gefeit vor Regression. Gerade die JUNGSCHE Psychologie nahm das, was<br />
heute die moderne Neuropsychologie in zunehmendem Masse bestätigt, erstaunlich<br />
zuverlässig vorweg. Der Ich-Komplex als sozusagen schwimmende Insel am Rande<br />
oder auch inmitten des Meeres des Unbewussten und stets gefährdet, die ihn nährende<br />
psychische Energie an mächtigere Komplexe zu verlieren, ist ein sehr treffendes Bild.<br />
JUNG schreibt:<br />
„Wenn unbewusste Teile der Persönlichkeit bewusst gemacht werden, so ergibt<br />
sich daraus nicht etwa nur eine Assimilation derselben an die schon längst<br />
bestehende Ichpersönlichkeit, sondern vielmehr eine Veränderung letzterer. Die<br />
grosse Schwierigkeit besteht eben darin, die Art der Veränderung zu<br />
charakterisieren. Das Ich ist in der Regel ein fest gefügter Komplex, welcher<br />
wegen des damit verbundenen Bewusstseins und dessen Kontinuität nicht leicht<br />
verändert werden kann und darf, wenn man nicht pathologische Störungen<br />
gewärtigen will. Die nächsten Analogien zu einer Ichveränderung liegen nämlich<br />
im Gebiet der Psychopathologie, wo wir nicht nur den neurotischen<br />
Dissoziationen, sondern auch der schizophrenen Fragmentierung und sogar der<br />
Auflösung des Ich begegnen“ (JUNG, 8, 255, §430).<br />
Die Problematik, respektive die Gefahr, welcher der Ichkomplex ausgesetzt ist,<br />
umschreibt JUNG weiter so:<br />
„Ist dagegen die Struktur des Ichkomplexes so kräftig, dass er den Ansturm<br />
unbewusster Inhalte ertragen kann, ohne in seinem Gefüge fatal gelockert zu<br />
werden, dann kann Assimilation stattfinden. In diesem Falle aber werden nicht<br />
nur die unbewussten Inhalte alteriert, sondern auch das Ich. Es vermag zwar<br />
seine Struktur zu bewahren, wird aber aus seiner zentralen und beherrschenden<br />
Stellung quasi zur Seite geschoben und gerät dadurch in die Rolle des erleidenden<br />
Zuschauers, dem die nötigen Mittel fehlen, seinen Willen unter allen Umständen<br />
geltend zu machen.; letzteres weniger darum, weil der Wille etwa an sich<br />
Matthyas Arter 22/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
geschwächt würde, als vielmehr, weil ihm gewisse Überlegungen hindernd in den<br />
Arm fallen. Das Ich kann nämlich nicht umhin zu entdecken, dass der Zustrom an<br />
unbewussten Inhalten die Persönlichkeit belebt und bereichert und eine Gestalt<br />
aufbaut, welche an Umfang und Intensität das Ich irgendwie überragt. Diese<br />
Erfahrung lähmt einen allzu egozentrischen Willen und überzeugt das Ich, dass<br />
ein Zurücktreten auf den zweiten Rang trotz aller Schwierigkeiten immer noch<br />
besser ist als ein aussichtsloser Kampf, in welchem man schliesslich doch den<br />
kürzeren zieht. Auf diese Weise unterstellt sich der Wille als disponible Energie<br />
allmählich dem stärkeren Faktor, das heisst der neuen ganzheitlichen Gestalt, die<br />
ich als das Selbst bezeichnet habe. Bei dieser Sachlage besteht natürlich die<br />
grösste Versuchung, einfach dem Machtinstinkt zu folgen und das Ich kurzerhand<br />
mit dem Selbst zu identifizieren, um damit die Illusion eines beherrschenden Ich<br />
aufrechtzuerhalten. In anderen Fällen erweist sich das Ich als zu schwach, um<br />
dem einbrechenden Zustrom unbewusster Inhalte den nötigen Widerstand zu<br />
leisten, und wird dann vom Unbewussten assimiliert, wodurch eine Verwischung<br />
und Verdunkelung des Ichbewusstseins und eine Identität desselben mit einer<br />
vorbewussten Ganzheit entsteht“ (JUNG, 8, 256, §430).<br />
3.1.2. Sein oder Nichtsein für das Ich<br />
Es ist leicht erkennbar, dass auch die Ich-Bildung einem untrüglichen Dilemma<br />
unterliegt, indem beide Extreme, sowohl die totale Dominanz als auch die totale<br />
Auflösung nicht zum gewünschten Erfolg eines tragenden Selbstverständnisses,<br />
respektive einer stabilen Subjektbildung führen, so dass ein steter Kampf um die<br />
Willenskräfte zwischen bewusstem Ichkomplex und unbewussten Inhalten ausgetragen<br />
werden muss, in dessen Verlauf sowohl auf der einen Seite wie auf der andern mit<br />
Veränderungen, Opfern und Gewinnen gerechnet werden muss, ohne dass je eine stabile<br />
Lösung erzielt werden könnte.<br />
ROTHAUPT umschreibt diesen komplexen Wettkampf präzis:<br />
„Ich nehme an, dass die psychotische Struktur immer die Aufhebung ihrer selbst,<br />
ihren „psychischen Tod“ einschliesst. Ich sehe ihre Entwicklung als Folge<br />
Matthyas Arter 23/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
gestörter Beziehungen zu den Primärobjekten im Sinne BIONS (1962), also die<br />
Störung der Denkentwicklung infolge fehlender „Alpha-Funktionen“ (BION<br />
1962) primärer Objekte (z.B. Mutter oder Vater). Diese Überlegungen schliessen<br />
traumatisierende Beziehungserfahrungen psychotischer Menschen ein,<br />
körperliche Misshandlungen oder Double-bind-Kommunikation (BATESON et. al<br />
1969, CIOMPI 1982). Die eigentliche Botschaft, die dieser Struktur gewordenen<br />
Erfahrung zugrunde liegt, lautet: ‚Sei, aber sei nicht’. Dem entspricht auf Seiten<br />
des schizophrenen Menschen ‚sein zu wollen, aber nicht sein zu können’<br />
(ROTHHAUPT, in MENTZOS, 2000, 212).<br />
Die Ich-Bildung ist demgemäss an lebbare Verhältnisse gebunden. Sie ist das Resultat<br />
einer erfolgreichen Gratwanderung zwischen Nähe und Distanz. Die früher übliche<br />
Argumentation, dass in der Ich-Psychologie psychotische Symptome an sich nicht<br />
sinnvoll seien, weil sie auf einem Defekt des Ich beruhen würden, der unter Belastung<br />
zu einer Regression führt, in der die Grenzen zwischen Ich und Nicht-Ich<br />
verschwimmen, der Grund für diese Psychose also ein schwaches Ich, eine mangelhafte<br />
oder fehlerhafte Entwicklung der Ich-Funktionen sei, (FEDERN, 1956 , HARTMANN<br />
1964), lässt sich in dieser Einseitigkeit nicht aufrecht halten. Es kann auch umgekehrt<br />
die Psychose gerade dazu führen, dass eine bessere Ich-Bildung, also auf einer<br />
geeigneteren Basis unter Beizug tauglicherer Wertvorstellungen durch die Psychose<br />
ermöglicht wird, indem eben gerade die Grenzen zwischen Ich und Nicht-Ich<br />
vollständig in Frage gestellt und eine überlebenstauglichere Abgrenzung von Innen und<br />
Aussen, Ich und Nicht-Ich akzeptabel werden kann. Das Ich-Verständnis – man ahnt es<br />
schon an dieser Stelle – ist entsprechend ein Schlüsselfaktor für die<br />
Anpassungsmöglichkeiten der Dilemmatoleranz.<br />
3.1.3. Dem Ich mangelt absolute Existenz<br />
Dem Ich muss aber die Idee der absoluten Existenz schon aus praktischen Gründen<br />
abgesprochen werden. Es müsste sehr ideal gebildet worden sein, wenn es denn durch<br />
die vielfältigen Wechsel in anderer Form als einer grossen Illusion Bestand haben<br />
könnte. ZIEGLER lässt in Sachen Ich-Illusion keine Zweifel offen:<br />
Matthyas Arter 24/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
„Obschon dieser Zwang von Anfang an bestanden haben muss, wurde doch<br />
verhältnismässig spät von einem ‚Ich’ gesprochen. Auf jeden Fall scheint man es<br />
im antiken Griechenland noch nicht gekannt zu haben, denn vor PLOTIN, der im<br />
dritten Jahrhundert gelebt hat, wird es von niemandem erwähnt. Erst im 18.<br />
Jahrhundert wird es mit DESCARTES zum eigentlichen psychologischen und<br />
philosophischen Gegenstand, zur res cogitans, zu einer denkenden Wirk-lichkeit<br />
(im Sinne von Wirkendem, Anm. d. V.). Wie eine unabsehbare Anzahl von<br />
anderen Wirklichkeiten erblickt das Ich erst in der Neuzeit das Licht der Welt;<br />
und zwar nicht nur als blosse Errungenschaft, sondern als ein fortschrittliches<br />
Produkt unserer Wirklichkeit, die in der Welt wuchert, wie ein genialischer<br />
Tumor.“ (ZIEGLER, 1983, 26)<br />
ZIEGLER spricht damit in kompromissloser Klarheit an, was für den Menschen als<br />
zentrale Qualität immer offensichtlicher wird, nämlich seine herausragende<br />
Überlegenheit, sowohl Wirklichkeit zu schaffen, als auch sich auf dieselbe einzurichten.<br />
Wie flexibel dieses Instrumentarium eingesetzt werden kann, stellt LEMPA im<br />
Zusammenhang mit der Bildung eines Verfolgungswahns sehr anschaulich dar und<br />
relativiert damit die von M. KLEIN und M. MAHLER postulierten Theorien von Ich-<br />
Schwäche, respektive den Ich-Defekt. LEMPA schreibt:<br />
„Die Theorie von MAHLER 8 stösst letztlich auf Defekte. Das Ich ist, aufgrund<br />
der inhärenten, vielleicht angeborenen Schädigung, unfähig eine symbiotische<br />
Beziehung zu verlassen.<br />
In der Theorie von KLEIN ist die Disposition zur Psychose ein affektiver Defekt.<br />
Das Ich ist zu schwach, um reifere Mechanismen (depressive Position)<br />
anzuwenden, wodurch Innen- und Aussenwelt differenzierbar, die Wahrnehmung<br />
adäquat wären. ...Kurz, das Ich des späteren Psychotikers hat in allen Theorien<br />
einen Material- oder Konstruktionsfehler“ (MENTZOS, 2000, 48).<br />
8 M.Mahler, 1979, „Symbiose und Individuation“, Klett-Cotta, Stuttgart 1986<br />
Matthyas Arter 25/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
3.2. Problematik der Ich-Schwäche<br />
Nun legt LEMPA im Weiteren aber dar, dass diese „Schwäche“ des Ich doch keine<br />
letzte Tatsache sein kann, sondern vielmehr funktional und sinnvoll unbewussten Zielen<br />
dient:<br />
„Die hier vertretene Hypothese der Ich-Bildung greift nicht auf angeborene oder<br />
erworbene Läsionen in der Organisation des Ich zurück, um psychotische<br />
Phänomene zu erklären. Die Störungen des Bezugs zur Realität werden sich dabei<br />
nicht als Täuschungen, als falsches Funktionieren des psychischen Apparats<br />
erweisen. Sie stellen nichts anderes dar als einen Wechsel der Besitzverhältnisse,<br />
von dem diejenigen Funktionen betroffen sind, die den Zugang zur Realität<br />
garantieren. Die bestehen, bildlich ausgedrückt, in intrapersonellen und<br />
interpersonellen Enteignungen und Okkupationen“ (LEMPA in MENTZOS,<br />
2000, 49).<br />
Der kompetente Umgang mit derlei Enteignungen und Okkupationen lüftet den<br />
Schleier sonst schwer verständlicher Reaktionen. LEMPA: „Psychoanalytische<br />
Theorien konzeptualisieren Wahnbildungen als Resultate primitiver<br />
Abwehrmechanismen des Ich. Unerträgliche Selbstanteile werden externalisiert,<br />
nach aussen projiziert. Ein Verfolgungswahn entsteht demzufolge durch<br />
Projektion einer aggressiven Regung. Der Träger des externalisierten Wunsches<br />
wird als Verfolgter gefürchtet. Die hier vorgeschlagene Hypothese zur<br />
paranoiden Symptombildung weicht von den bisherigen psychoanalytischen<br />
Theorien in zweierlei Hinsicht ab: Sie sieht erstens paranoide Symptome als<br />
kompromisshafte Wunscherfüllungen und nicht nur einseitig als Resultate der<br />
Abwehr. Sie sieht zweitens eine Ich-Veränderung, eine Regression des Gesamt-Ich<br />
und damit auch des Realitätsbezugs, als konstitutiv für das an, was man unscharf<br />
als psychotische Projektion bezeichnet“ (LEMPA in MENTZOS, 2000, 56).<br />
Der Nutzen dieses Verhaltens ist offensichtlich. MENTZOS:<br />
„…ein psychoanalytisch orientierter Psychiater (neigt) dazu, die geschilderten<br />
psychischen Vorgänge als Folge einer beginnenden Auflösung (oder als Reaktion<br />
darauf?), jedenfalls einer Gefährdung der Selbstgrenzen und der Selbstidentität<br />
zu verstehen – einer Gefährdung und einer beginnenden Auflösung, die sich aus<br />
Matthyas Arter 26/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
der vermehrten Nähe zu wichtigen Personen (bei den jeweiligen Besuchen zu<br />
Hause) ergeben.<br />
Bemerkenswert ist nun der weitere Verlauf, wie die Patientin ihn erlebt und<br />
geschildert hat. Man erfährt von ihr, dass sie während ihres letzten Besuchs bei<br />
einer Neuentwicklung des gleichen Zustandes (grosse Angst und Flucht, Anm. d.<br />
V.) nachts aufstand, um in der Küche ein Glas Milch zu holen. Plötzlich, das Glas<br />
Milch in der Hand, erkannte sie, dass die Milch vergiftet sei. Jetzt hat der<br />
psychodynamisch denkende Psychiater noch weniger Bedenken anzunehmen, dass<br />
es der Patientin diesmal ‚gelungen’ war, mit Hilfe dieser eindeutigen<br />
Wahnbildung, die vorab diffuse Gefährdung ihres Selbst zu konkretisieren und<br />
insbesondere zu externalisieren, das heisst ihr subjektives Erlebnis als von aussen<br />
verursacht zu empfinden“ (MENTZOS, 2002, 20).<br />
Die (frühkindlich bedingte) Angst vor der totalen Vereinnahmung, respektive der<br />
Zwang zur totalen Vereinsamung auf der andern Seite, kann mit diesem Kniff<br />
wenigstens behelfsmässig in Schach gehalten werden.<br />
Mit andern Worten, um dem Horror Vacui auszuweichen bei totaler Unfähigkeit zur<br />
Verhinderung der Verschmelzung mit dem Objekt der Begierde, respektive dem<br />
Abhalten des Objektes der totalen inneren Bedrohung, drängt sich als intelligente<br />
Lösung der Verfolgungswahn auf. Der Vorteil ist ein zweifacher: Die drohende Leere<br />
aufgrund der undenkbaren Verschmelzung kann durch Umsetzung der Ängste in<br />
handfeste Aggression wenigstens in Schach gehalten werden, womit zudem automatisch<br />
die Existenz des Ichs gesichert ist. In den Worten LEMPAS:<br />
„Dem Ich wird eine Erwartung von Aggressivität bewusst, während die<br />
Aufmerksamkeit, wie die Hunde dem Jäger, dem Ich die Beweise, Hinweise<br />
zutreibt. Das Ich rettet sich aus seiner Not, nicht mehr Herr seiner Situation zu<br />
sein, mit der Bildung des Wahns, verfolgt zu werden. Der Wahn verschafft dem<br />
Ich andererseits ‚Feinde’ und damit die Berechtigung für Aggressivität“ (LEMPA<br />
in MENTZOS, 2000, 61f).<br />
Dass dabei von einer Ideallösung gesprochen werden könnte, scheint allerdings<br />
übertrieben. Es ist vielmehr eine Notlösung, die geeignet ist, das Schlimmste (den<br />
totalen Untergang der Ich-Funktion) zu verhindern, aber nachhaltig ist diese Lösung<br />
keinesfalls. MENTZOS schreibt:<br />
Matthyas Arter 27/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
„Es ist das Verdienst von Anna Freud 9 , die einzelnen Abwehrmechanismen<br />
aufgrund der bis dahin angesammelten Erfahrungen systematisch beschrieben zu<br />
haben. Seitdem gab es mehrere Versuche, diese Vorgänge besser zu verstehen, sie<br />
systematisch zu beschreiben und genetisch abzuleiten. Wir begreifen sie heute als<br />
habituelle, unbewusst ablaufende Vorgänge, die zwar primär Ich-Funktionen mit<br />
Schutz- und Bewältigungsaufgaben darstellen 10 , die jedoch im Rahmen der<br />
neurotischen Konfliktverarbeitung letztlich dysfunktional werden. (MENTZOS,<br />
2005, 60).<br />
In ähnlicher Weise finden sich auch Hinweise auf diesen Sachverhalt bei JUNG:<br />
„Wir haben durch vielfache psychoanalytische Arbeit an diesen Kranken die<br />
Erfahrung gemacht, dass für den Mangel an äusserer Anpassung eine progressive<br />
Vermehrung der Phantasietätigkeit eintritt, welche so weit geht, dass die<br />
Traumwelt für den Kranken mehr Realitätswert besitzt als die äussere<br />
Wirklichkeit [...] Wir sagen, dass die Libido sich von der Aussenwelt immer mehr<br />
zurückgezogen habe, weshalb sie in die Innenwelt, in die Phantasie gerät und dort<br />
notwendigerweise als Ersatz für die verlorene Welt ein sogenanntes<br />
Realitätsäquivalent erzeugen muss. Dieser Ersatz erfolgt sozusagen Stück für<br />
Stück, und es ist überaus interessant zu sehen, mit was für geistigen Materialien<br />
diese innere Welt aufgebaut wird“ (JUNG, 4, 144, §272).<br />
3.3. Realität als Wahn<br />
Zu ergänzen ist allenfalls, dass auch die so genannte Realität natürlich nur ein Produkt<br />
aus verarbeiteten Sinneseindrücken und archetypischen Bauplänen sein kann, also<br />
immer inneres Abbild von Wirklichkeit darstellt, welche direkt und objektiv nicht<br />
erkennbar, sondern nur indirekt und individuell erfahrbar sein kann, in jedem Fall aber<br />
entscheidend ist für das Selbstverständnis. Aus dieser Herleitung ist zudem leicht<br />
ersichtlich, dass die Variabilität der Ich-Illusion im Einzelfall und situativ von<br />
entscheidender Bedeutung ist für das Mass der erzielbaren Dilemmatoleranz, respektive<br />
den Umgang mit den laufend entstehenden Spannungsverhältnissen. ZIEGLER macht<br />
9 Das Ich und die Abwehrmechanismen, London (Mayo) 1936, Kindler Verlag , München 1974<br />
10 Seite 24, Das Vokabular der Psychoanalyse , J.LAPLANCHE und J.B. PONTALIS , Suhrkamp<br />
Frankfurt a.M. 1973,<br />
Matthyas Arter 28/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
diesbezüglich (in der Tradition NIETZSCHES) eine prüfenswerte Einschränkung,<br />
indem er dem Menschen nicht so viel eigenwillige Wirklichkeitsgestaltung zutraut:<br />
„Des Menschen Instinkt ist seine Wirklichkeit. Daraus aber ergibt sich wie von<br />
selbst, dass unsere Wirklichkeit als ein Zustand, auch als ein besonderer Wahn<br />
des Menschen bezeichnet werden kann, der uns dazu treibt, uns in besonders<br />
wirkungsvoller Weise in der Welt vernehmbar zu machen; und gerade jene<br />
Menschen und Völker, die von diesem Bewusstseinszustand am umfänglichsten<br />
erfasst sind, sind demnach auch jene, von denen man sagen muss, sie lebten am<br />
ahnungslosesten in einer Umnachtung. Gerade jener Geisteszustand also, der<br />
üblicherweise als der normale gilt, weil er ach so wirklich ist, ist auch der<br />
verblendetste“ (ZIEGLER, 1983, 9).<br />
Die Vorstellung dessen, was ein Mensch als Ich-Illusion aufbaut und zur bewussten<br />
Basis seiner Willensumsetzung in einer von ihm „instinktiv“ geschaffenen Wirklichkeit<br />
macht, ist trotz ihrer Variabilität also doch keineswegs zufällig, sondern gründet<br />
weitgehend auf der Art und Weise, wie die unterschiedlichen Selbstanteile unter einen<br />
Hut gebracht werden können. Das, was als Selbst bezeichnet werden könnte, müsste<br />
nach FREUD „Es“, „Ich“ und „Überich“, also sämtliche Wirkkomponenten enthalten,<br />
die einem Wesen Struktur, Charakter und Wirkungsrichtung geben. Nach der<br />
Terminologie von JUNG umfasst das Selbst sämtliche Archetypen des kollektiven<br />
Unbewussten sowie die spezifischen Ausgestaltungen derselben im individuellen Fall.<br />
Spätere Autoren sehen im Selbst so etwas wie den Bauplanraster, nach welchem sich<br />
das Einzelwesen mehr oder weniger getreulich aufbauen muss. Weitgehende Einigkeit<br />
herrscht offensichtlich darüber, dass es weder die perfekte Ich-Illusion gibt, noch das<br />
Ich tatsächlich „Herr im eigenen Hause“ sein kann. Entsprechend muss der Mensch mit<br />
der Kränkung leben lernen, welche FREUD diesem Mangel zu Recht zur Seite stellte.<br />
3.3.1. Stabilität der Illusion<br />
Die bisherigen Darlegungen zeigen, dass die menschliche Psyche einerseits durch die<br />
genetische Disposition und anderseits durch die Bewältigung der<br />
entwicklungspsychologisch unabdingbaren Nähe-Distanz-Problematik zu einer Ich-<br />
Bildung als relativ stabile Illusion führt, mit welcher es überhaupt erst möglich ist, ein<br />
Matthyas Arter 29/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
über die Zeit immer verlässlicheres, respektive brauchbares Selbstverständnis zu<br />
generieren. Und so wie aus der Grundproblematik von Nähe und Distanz der<br />
Grundkonflikt abgeleitet werden kann, ergibt sich für die dynamische Anpassung von<br />
Ich-Illusion und Selbstverständnis in einer durch „Wirklichkeitswahn“ geprägten Welt<br />
die generelle Konfliktbewältigung als Nährboden für eine optimierte Lebensgestaltung<br />
respektive Überlebensstrategie.<br />
3.4. Das Selbst als Subjekt<br />
Bis dahin wurde mit den Begriffen Ich und Selbst differenziert, was sich aus dem<br />
Grundkonflikt von Nähe und Distanz als Subjekt ergibt. Diesem Subjekt wird als ‚Welt’<br />
das Objekt entgegengesetzt. Nun scheint es aber insbesondere im Hinblick auf<br />
therapeutische Effekte lohnenswert, nicht bei der Subjekt-Objekt-Spaltung zu verharren,<br />
sondern stattdessen nach dem zu fragen, was denn vorliegen würde, wenn man den<br />
Blick nicht wie bis anhin von Subjekt-Objekt-Beziehung, sondern auf die Subjekt-<br />
Subjekt-Beziehung richten würde, also berücksichtigt, dass nicht nur das Subjekt die<br />
Objekte beseelt, sondern umgekehrt auch von Subjekten beseelt wird. DÖRNER/PLOG<br />
schreiben:<br />
„Jede Beziehung zwischen Menschen ist gekennzeichnet dadurch, dass der<br />
Partner bei mir Gefühle auslöst und dass ich bei ihm Gefühle auslöse. Diese<br />
Gefühle und gefühlsmässigen Stellungnahmen sind nicht nur mit mir, sondern er<br />
behandelt mich auch wie andere (Übertragung). Mit dem, wie er mir begegnet,<br />
löst er bei mir Gefühle aus, die dazu führen, dass ich ihn behandle wie andere<br />
Personen aus meinem Leben (Gegenübertragung). – Unsere Absicht ist, beide<br />
Seiten zu verstehen und in unser Handeln einzubeziehen. Indem wir das tun,<br />
denken wir nicht nur über den Anderen nach und geraten in eine Beziehung zu<br />
ihm, sondern der Versuch der Wahrnehmung der eigenen subjektiven Anteile und<br />
Gefühle, die durch den Anderen in mir ausgelöst sind, verändern zwangsläufig<br />
auch mich“ (DÖRNER / PLOG, 34).<br />
Matthyas Arter 30/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
Für JUNG handelt es sich bei diesem Phänomen um die so genannte „Transzendente<br />
Funktion“. 11 Diese wiederum beinhaltet als zentrales Element Veränderungen der<br />
sinnstiftenden Symbole, respektive der für das Subjekt relevanten Werte. Die eher –<br />
wenn auch stark relativiert – technische Natur der Einführung eines psychischen<br />
Wertverständnisses korrespondiert modellhaft mit JUNGS Symbolverständnis in diesem<br />
Zusammenhang, denn er schreibt:<br />
„Wir haben also allen Grund, die Symbolbildung (Werte- oder Sinnbildung) zu<br />
schätzen und dem Symbol unsere Achtung entgegen zu bringen als dem<br />
unschätzbaren Mittel, das uns die Möglichkeit gibt, den bloss triebmässigen<br />
Ablauf des energetischen Prozesses zu effektiver Arbeitsleistung zu benützen [...]<br />
In derselben Weise, wie wir in der physischen Natur nur einen ganz beschränkten<br />
Teil der natürlichen Energie in praktisch verwertbare Form überzuführen<br />
vermögen, während wir weitaus den grössten Teil ungenützt in Naturphänomenen<br />
sich auswirken lassen müssen, so können wir auch in unserer psychischen Natur<br />
nur einen kleinen Teil der Energie dem natürlichen Ablauf entziehen [...} Nur wo<br />
es der Fall ist, dass das Symbol (der Wert oder Sinn) ein grösseres Gefälle<br />
darbietet als die Natur, ist es möglich, die Libido in andere Formen überzuführen.<br />
[...} Ich habe das Symbol, das Energie umsetzt, auch als Libidoanalogie<br />
bezeichnet und darunter Vorstellungen verstanden, welche geeignet sind, die<br />
Libido äquivalent auszudrücken und dadurch eben in eine andere Form als die<br />
ursprüngliche überzuführen. Die Mythologie liefert unzählige Gleichnisse dieser<br />
Art“ (JUNG, 8, 51ff, §90-93).<br />
3.5. Wandelbare Symbolbildung<br />
Aus dieser Schilderung folgt nachvollziehbar die mögliche Ausgestaltung der<br />
therapeutischen Arbeit, welche darin besteht, die Symbolbildung in geeigneter Art und<br />
11 Unter dem Namen ‚transzendente Funktion‘ ist nichts Geheimnisvolles, sozusagen Übersinnliches oder<br />
Metaphysisches, zu verstehen, sondern die psychologische Funktion, die sich ihrer Art nach mit einer<br />
mathematischen Funktion gleichen Namens vergleichen lässt und eine Funktion imaginärer und realer<br />
Zahlen ist. Die psychologische ‚transzendente Funktion‘ geht aus der Vereinigung bewusster und<br />
unbewusster Inhalte hervor“ (JUNG, 8, 79, §131)<br />
Matthyas Arter 31/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
Weise zu modifizieren 12 . Mit andern Worten, die Symbolbildung, das sinnstiftende<br />
Wertgefüge ist das A und O für die Bildung – um es mit den Worten Zieglers zu sagen<br />
– eines lebbaren Wirklichkeitswahns, für eine Wirklichkeit also, die mit den Werten des<br />
kollektiven Unbewussten soweit korrespondiert, dass kein übermässiger Leidensdruck<br />
die psychische Energie des Individuums in unerspriessliche Gefilde abzieht. Das<br />
Individuum steht entsprechend in einer permanenten Interaktion zwischen individueller<br />
Wertgestaltung und Erfordernissen des „in die Welt geworfen seins“ (HEIDEGGER,<br />
Sein und Zeit), welche die Existenz an sich respektive das Unbewusste insgesamt an<br />
den Einzelnen stellen. JUNG formuliert dies sehr anschaulich. 13 Wichtig erscheint in<br />
diesem Zusammenhang die Betonung der Subjektivität. Dazu JUNG an anderer Stelle:<br />
„Nach dieser Definition ist das Gewissen ein komplexes Phänomen, das einesteils<br />
aus einem elementaren Willensakt oder aus einem bewusst nicht begründeten<br />
Antrieb zum Handeln, andernteils aus einem Urteil des vernünftigen Gefühls<br />
besteht. Dieses ist ein Werturteil, das sich dadurch von einem intellektuellen<br />
Urteil unterscheidet, dass es neben einem objektiven, allgemeinen und sachlichen<br />
Charakter auch die Eigenschaft der subjektiven Bezugnahme erkennen lässt. Das<br />
Werturteil impliziert immer das Subjekt, indem es voraussetzt, dass etwas schön<br />
oder gut ‚für mich’ sei“ (JUNG, 10, 475, §825).<br />
Der Anpassungsprozess zwischen kollektiven Erfordernissen einerseits und dem<br />
Steuern der psychischen Energie durch das Individuum anderseits ist nichts anderes als<br />
die von JUNG beschriebene transzendente Funktion. Gemeint ist damit die Anpassung<br />
bewusster und unbewusster Werte, respektive der verschiedenen Komplexe, die in<br />
einem dauernden Wettstreit um Libido, respektive psychische Energie alte Symbole<br />
destruieren und neue Symbole schaffen.<br />
12 „In der praktischen Arbeit mit unseren Patienten stossen wir auf Schritt und Tritt auf solche<br />
Symbolbildungen, welche die Umwandlung der Libido bezwecken. Im Anfang einer Behandlung finden<br />
wir Symbolbildungen am Werke deren Unzweckmässigkeit sich dadurch zeigt, dass sie ein zu geringes<br />
Gefälle darbieten, so dass die Libido sich nicht in effektive Leistung umsetzen lässt, sondern unbewusst<br />
auf altem Wege abströmt, in archaisch-sexuelle Phantasien und Phantasiebetätigungen; infolgedessen ist<br />
der Patient uneins mit sich selber, das heisst neurotisch“ (JUNG. 8, 54, §93).<br />
13 Die Wertfunktion, eben das Gefühl , ist ein integrierender Bestandteil der Bewusstseinsorientierung und<br />
darf daher in einem mehr oder weniger vollständigen psychologischen Urteil nicht fehlen, weil sonst das<br />
Modell des wirklichen Vorganges, das erzeugt werden soll, unvollständig wäre. Jedem psychischem<br />
Vorgang haftet die Werteigenschaft, nämlich der Gefühlston an. Dieser gibt an, in welchem Masse das<br />
Subjekt vom Vorgang affiziert ist, respektive wieviel ihm dieser bedeutet (sofern nämlich der Vorgang<br />
überhaupt zum Bewusstsein gelangt). Durch den ‚Affekt‘ wird das Subjekt einbezogen und und bekommt<br />
damit das ganze Gewicht der Wirklichkeit zu fühlen“ (JUNG. 9/2, 42, §61).<br />
Matthyas Arter 32/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
Diese Betrachtung ist insofern entscheidend, als sie offen legt, dass jeder Mensch in<br />
seiner Beziehung als Subjekt zur Welt und zum andern Subjekt die Möglichkeit besitzt,<br />
sinnstiftende Symbole und Wertordnungen ebenso anzupassen, wie andererseits das,<br />
was das Subjekt als zu sich gehörig verstehen kann und will.<br />
JUNG kam zur bemerkenswerten Überzeugung, dass ein Teil der Menschwerdung das<br />
Erbe vorangegangener Generationen ist und deren Erfahrungen mit der Welt das Selbst<br />
definiert:<br />
„Die Kindheit ist nicht nur darum von Bedeutung, weil dort einige<br />
Instinktverkrüppelungen ihren Anfang genommen haben, sondern auch darum,<br />
weil dort jene weitausschauenden Träume und Bilder, welche ein ganzes<br />
Schicksal vorbereiten, erschreckend oder ermutigend vor die kindliche Seele<br />
treten, zugleich mit jenen rückblickenden Ahnungen, die weit über den Umfang<br />
der kindlichen Erfahrungen in das Leben der Ahnen hinausgreifen. So stellt die<br />
Seele des Kindes der „natürlichen“ Bedingung eine geistige gegenüber.<br />
Bekanntlich ist der im Naturzustande lebende Mensch keineswegs bloss<br />
„natürlich“ , etwa wie ein Tier, sondern er sieht, glaubt, fürchtet, verehrt Dinge,<br />
deren Sinn aus den natürlichen Umweltbedingungen allein gar nicht ersichtlich<br />
ist, denn deren untergelegter Sinn sogar weit von aller Natürlichkeit,<br />
Sinnenfälligkeit und Verständlichkeit wegführt, ja sogar nicht selten mit den<br />
Instinkten auf schärfste kontrastiert“ (JUNG, 8, 57, §98).<br />
Diese dem Menschen innewohnende Neigung, über das „Natürliche“ hinaus in die Welt<br />
gestaltend zu wirken, um auf diese Weise ein neuartiges Selbstverständnis zu erwirken,<br />
untersteht sodann nach JUNG dem darwinistischen Selektionsprinzip im weitesten Sinn,<br />
indem sich das, was sich als überlebensfähig bewährt, dem Richterspruch der höchsten<br />
Instanz entzieht und trotz Irrtum und Sünde nicht länger geächtet wird. Dieselbe Idee<br />
vertrat auch schon NIETZSCHE:<br />
„Es ist nicht die Gerechtigkeit, die hier Gericht sitzt; es ist noch weniger die<br />
Gnade, die hier das Urteil verkündet, sondern das Leben allein, jene dunkle,<br />
treibende, unersättlich sich selbst begehrende Mach“ (NIETZSCHE,<br />
Betrachtungen, 124).<br />
JUNG schreibt dazu:<br />
Matthyas Arter 33/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
„Der Geist, als das wirksame Prinzip der Erbmasse, besteht aus der Summe der<br />
Ahnengeister, der unsichtbaren Väter, deren Autorität mit dem Kinde geboren<br />
wird. Der philosophische Begriff von Geist hat noch nicht einmal vermocht,<br />
seinen eigenen sprachlichen Terminus von der überwältigenden Fessel der<br />
Identität mit dem anderen Begriff von Geist, nämlich „Gespenst“, zu befreien. Es<br />
ist hingegen der religiösen Anschauung gelungen, über die sprachliche<br />
Verhaftung an die Geister dadurch hinauszugelangen, dass sie jene geistige<br />
Autorität als Gott bezeichnet. Im Laufe der Jahrtausende hat sich diese<br />
Anschauung als eine Formulierung jenes geistigen Prinzips, das der blossen<br />
Triebhaftigkeit hemmend entgegensteht, entwickelt. Das ungemein Bedeutsame an<br />
diesem Begriff ist der Umstand, dass Gott auch zugleich als Naturschöpfer<br />
gedacht ist. Er wird als der Macher jener unvollkommenen Geschöpfe, die irren<br />
und sündigen, angesehen, und zugleich ist er ihr Richter und Zuchtmeister“<br />
(JUNG, 8, 59, §102).<br />
JUNG zeigt zudem deutlich, dass dieser Sachverhalt sogar zwingend eine starke<br />
Irritation in sich trägt, welche bei genauerem Hinsehen ebenfalls als Dilemma erkannt<br />
werden kann. JUNG:<br />
„Trotz allen rationalistischen Umdeutungsversuchen ist und bleibt die psychische<br />
Wirklichkeit eine genuine Angstquelle, die an Gefährlichkeit gewinnt, je mehr sie<br />
geleugnet wird. Die biologischen Triebe stossen damit nicht nur gegen eine<br />
äussere, sondern auch gegen eine innere Schranke. Dasselbe psychische System,<br />
das einerseits auf der Konkupiszenz der Triebe beruht, gründet sich andererseits<br />
auf einen Gegenwillen, der mindestens ebenso stark ist wie der biologische Trieb.<br />
Der Wille zur Verdrängung oder Unterdrückung der natürlichen Triebe, das<br />
heisst genauer gesagt der Vorherrschaft und Unkoordiniertheit derselben,<br />
nämlich der superbia und concupiscentia, stammt – sofern das Motiv nicht von<br />
der äusseren Notlage gebildet wird – aus der geistigen Quelle, das heisst aus<br />
numinosen, psychischen Bildern . Diese Bilder, Auffassungen, Überzeugungen<br />
oder Ideale wirken vermöge der dem Individuum eigentümlichen Energie, die es<br />
allerdings nicht immer freiwillig zu diesem Zwecke disponiert, sondern die ihm<br />
sozusagen von diesen Bildern entzogen wird“ (JUNG, 5, 199, §222).<br />
Matthyas Arter 34/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
Auf die Doppelfunktion Gottes (im Menschen als vorgestellte Wirk-lichkeit) weist<br />
ZIEGLER im gleichen Sinne und mit noch deutlicheren Worten hin:<br />
„Die indogermanische Wurzel von „Geist“ ist gheis, was soviel bedeutet wie<br />
„aufgebracht sein“; geiski im Altnordischen bedeutet schlicht „der Schreck“,<br />
gaeska im Angelsächsischen „in Schrecken versetzen“; Geister sind im<br />
Bayerischen „Quäler“, aghast bedeutet im Englischen „vor Entsetzen gelähmt“,<br />
während der ghist im Mittelhochdeutschen „der Brausende“ war.<br />
Was geistig ist, entsteht demnach gleichfalls aus unserer Wirklichkeit heraus, als<br />
ein Erzeugnis unseres Wirklichseins, das bereits das Wahre, Sittliche und Richtige<br />
zustande gebracht hat. Auf diese Weise ist denn auch einer der wichtigsten<br />
Wesenszüge unseres jüdisch-christlichen Gottes zustande gekommen: Er ist ja<br />
nicht nur ein Wissender und Begründer, sondern auch ein Zorniger, ein Rächer;<br />
er moralisiert ernsthaft, er ist die Wahrheit und die Gerechtigkeit. Es ist eher<br />
erstaunlich, dass er sich weit mehr als zweitausend Jahre als eine zentrale,<br />
angebetete Projektion im Himmel halten konnte; es ist eher verwunderlich, dass<br />
wir erst in der Neuzeit allgemeiner von der Überzeugung erfüllt sind, wir selbst<br />
seien Gott und mit ihm seine bedrohliche Wahrheit, die nicht mit den Wolken<br />
zieht, sondern in unseren Knochen sitzt“ (ZIEGLER, 1983, 50).<br />
Unter Berufung auf GOETHE formulierte auch NIETZSCHE diesen Sachverhalt im<br />
gleichen Sinne:<br />
„Wie der Handelnde, nach Goethes Ausdruck, immer gewissenlos ist, so ist er<br />
auch immer wissenlos; er vergisst das meiste, um eins zu tun, er ist ungerecht<br />
gegen das, was hinter ihm liegt, und kennt nur Ein Recht. Das Recht dessen was<br />
jetzt werden soll. So liebt jeder Handelnde seine Tat unendlich mehr, als sie<br />
geliebt zu werden verdient: und die besten Taten geschehen in einem solchen<br />
Überschwange der Liebe, dass sie jedenfalls dieser Liebe unwert sein müssen,<br />
wenn ihr Wert auch sonst unberechenbar gross wäre“ (NIETZSCHE,<br />
Betrachtungen, 107).<br />
Matthyas Arter 35/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
3.5.1. Dilemmahafte Selbstfindung zwischen Angst und Liebe<br />
Der Mensch wird in seiner Selbstfindung im wahrsten Sinn des Wortes und bestenfalls<br />
sich selbst (seinem Selbst) überlassen, nämlich dann, wenn er die Bereitschaft<br />
aufbringen kann, mit seinen Ängsten zu ringen, statt diese zu verdrängen.<br />
Orientierungslos und mit der gesamten Geschichte aller Vorahnen und Vorahnungen<br />
belastet, sucht er entsprechend seinen Weg, wo es keine Wege gibt, sondern nur den<br />
inneren Kompass als Erbe und die aktuellen Sinneswahrnehmungen als mögliches<br />
Korrektiv.<br />
Dieses Höchstmass an selbstdefinitorischem Gestaltungserfordernis bringt es nun<br />
allerdings mit sich, dass Begegnungen sowohl mit Objekten als noch viel mehr mit<br />
Subjekten genau gleich wie die innerpsychische Begegnung auf unterschiedliche Weise,<br />
jedoch immer nur emotional erlebt werden können.<br />
DÖRNER/ PLOG schreiben:<br />
„Jede Begegnung macht Angst […] Auch wenn ich als Subjekt den Anderen nur<br />
als Objekt beobachten will, so findet auch dies im Rahmen einer Begegnung<br />
zwischen zwei Subjekten statt, die sich wechselseitig beeinflussen. Das ist<br />
unvermeidlich“ (DÖRNER/ PLOG, 53).<br />
Das Gegenstück zur Angst machenden Begegnung mit dem Andern ist entsprechend die<br />
in der Begegnung erfahrbare Liebe (in der Tat). FROMM schreibt:<br />
„In engem Zusammenhang mit der Entwicklung der Liebesfähigkeit steht die<br />
Entwicklung der Liebesobjekte. In den ersten Monaten und Jahren ist das Kind<br />
seiner Mutter am engsten verbunden. Die Bindung beginnt schon vor dem<br />
Augenblick der Geburt, wo Mutter und Kind noch eins sind, wenngleich sie zwei<br />
sind. Die Geburt ändert die Situation in gewisser Hinsicht jedoch nicht so<br />
drastisch, wie es zunächst scheinen mag. Obwohl das Kind jetzt ausserhalb des<br />
Mutterleibes lebt, ist es doch von der Mutter noch völlig abhängig. Aber es wird<br />
jetzt täglich unabhängiger. Es lernt selbständig zu laufen, zu sprechen und die<br />
Welt zu erforschen; die Beziehung zur Mutter verliert einiges von ihrer vitalen<br />
Bedeutung, und stattdessen wird die Beziehung zum Vater immer wichtiger. Um<br />
dieses Hinüberwechseln von der Mutter zum Vater zu verstehen, müssen wir uns<br />
die wesentlichen, qualitativen Unterschiede zwischen mütterlicher und väterlicher<br />
Liebe vor Augen halten. Über die Mutterliebe haben wir bereits gesprochen.<br />
Matthyas Arter 36/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
Mutterliebe ist ihrem Wesen nach an keine Bedingungen geknüpft. Eine Mutter<br />
liebt ihr neugeborenes Kind allein weil es ihr Kind ist, und nicht weil es<br />
bestimmten Voraussetzungen entspricht oder bestimmte Erwartungen erfüllt<br />
(zumindest auf Mütter im Tierreich ist dies nicht anwendbar, abnormale Kinder<br />
werden nicht selten verstossen oder ausgehungert, Anm. d. V). Wenn ich hier von<br />
der Liebe der Mutter und des Vaters spreche, so spreche ich natürlich von<br />
„Idealtypen“ im Sinn Max WEBERS oder von Archetypen im JUNGSCHEN Sinn<br />
und behaupte damit nicht, dass jede Mutter und jeder Vater auf diese Weise liebt.<br />
(Ich meine damit das mütterliche und väterliche Prinzip, das sich in einer<br />
mütterlichen oder väterlichen Person zeigt). Eine Liebe, die an keine<br />
Bedingungen geknüpft ist, entspricht einer tiefen Sehnsucht nicht nur des Kindes,<br />
sondern eines jeden menschlichen Wesens; wenn man dagegen seiner eigenen<br />
Verdienste wegen geliebt wird, so bleiben immer irgendwelche Zweifel bestehen;<br />
vielleicht habe ich es dem, der mich lieben soll, nicht recht gemacht, oder ich<br />
habe dies oder jenes falsch gemacht – immer muss ich fürchten, die Liebe könnte<br />
vergehen“ (FROMM, Liebe, 52f).<br />
Die Schilderung zeigt deutlich, dass entsprechend auch auf der intersubjektiven Ebene<br />
dasselbe dilemmabehaftete Konfliktpotential stets von neuem zu bewältigen ist wie auf<br />
der Subjekt-Objekt-Ebene. Eine ganzheitliche Menschwerdung umfasst alle Ebenen,<br />
nach FROMM ist sogar einzig die zwischenmenschliche Liebe im Sinne der<br />
Vereinigung erfüllend:<br />
„Die bei einer produktiven Arbeit erreichte Einheit ist nicht<br />
zwischenmenschlicher Art; die bei einer orgiastischen Vereinigung erreichte<br />
Einheit ist nur vorübergehend; die durch Konformität erreichte Einheit ist eine<br />
Pseudo-Einheit. Daher sind alle diese Lösungen nur Teillösungen für das<br />
Problem der Existenz. Eine voll befriedigende Antwort findet man nur in der<br />
zwischenmenschlichen Einheit, in der Vereinigung mit einem andern Menschen,<br />
in der Liebe“ (FROMM, Liebe, 28).<br />
Was heisst das nun in einer Welt voller Konflikte? Der Mensch als Subjekt erkennt sein<br />
Selbst in der vorbehaltlosen (Liebes-)Vereinigung mit einem andern Menschen,<br />
allerdings – und das scheint sehr wesentlich, ohne Aufgabe des Selbstverständnisses.<br />
Matthyas Arter 37/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
Die Liebe als Lösung der Nähe-Distanz-Problematik, Liebe als Akzeptanz des<br />
Paradoxen.<br />
FROMM schreibt:<br />
„Im Gegensatz zur symbiotischen Vereinigung ist die reife Liebe eine<br />
Vereinigung, bei der die eigene Integrität und Individualität bewahrt bleibt. Liebe<br />
ist eine aktive Kraft im Menschen. Sie ist eine Kraft, welche die Wände<br />
niederreisst, die den Menschen von seinem Mitmenschen trennen, eine Kraft, die<br />
ihn mit anderen vereinigt. Die Liebe lässt ihn das Gefühl der Isolation und<br />
Abgetrenntheit überwinden und erlaubt ihm trotzdem er selbst zu sein und seine<br />
Integrität zu behalten. In der Liebe kommt es zum Paradoxon, dass zwei Wesen<br />
eins werden und trotzdem zwei bleiben“ (FROMM, Liebe, 31).<br />
Aber nicht eine beliebige Vereinigung sieht FROMM als Lösung:<br />
„Von diesem Standpunkt aus könnte man die Meinung vertreten, Liebe sei<br />
ausschliesslich ein Akt der willensmässigen Bindung an einen andern, und es<br />
komme daher im Grunde nicht darauf an, wer die beiden Personen seien. Ob die<br />
Ehe von anderen arrangiert wurde oder das Ergebnis einer individuellen Wahl<br />
war; nachdem sie einmal geschlossen ist, sollte dieser Akt den Fortbestand der<br />
Liebe garantieren. Diese Auffassung übersieht jedoch ganz offensichtlich die<br />
paradoxe Eigenart der menschlichen Natur und der erotischen Liebe. Wir alle<br />
sind eins – und trotzdem ist jeder von uns ein einzigartiges, nicht wiederholbares<br />
Wesen. In unserer Beziehung zu anderen wiederholt sich das gleiche Paradox.<br />
Insofern wir alle eins sind, können wir jeden auf die gleiche Weise im Sinne der<br />
Nächstenliebe lieben. Aber insofern wir auch alle voneinander verschieden sind,<br />
setzt die erotische Liebe gewisse spezifische, höchst individuelle Elemente voraus,<br />
wie sie nur zwischen gewissen Menschen und keineswegs zwischen allen zu finden<br />
sind“ (FROMM, Liebe, 68).<br />
Zwischen den Zeilen drückt FROMM damit aus, was als Grundsatzfrage durch die<br />
ganze Philosophiegeschichte stets mitgetragen wurde. Die Frage nach der richtigen<br />
Liebe oder man könnte auch sagen nach der Liebe zu Gott, Gott verstanden als höchster<br />
Wert, letztes Symbol, als das Sinnstiftende schlechthin. Und hier schliesst sich der<br />
Kreis, indem das höchst Individuelle, das Ich als Illusion und Teil des Selbst, welches<br />
dem Subjekt überhaupt erst die Existenz als Getrenntes von der Welt und doch eins mit<br />
Matthyas Arter 38/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
ihr erlaubt, am Schluss nur deshalb zustande kommt, weil diesem ein höchster Wert, die<br />
grösste Sehnsucht nach Vereinigung innewohnt und aus der gewonnenen Distanz<br />
zurück in die Nähe, in die Einheit mit Gott führt, also gelebtes Paradox darstellt 14 .<br />
14 „Die Welt des Denkens bleibt in Paradoxien verfangen. Die einzige Möglichkeit, die Welt letztlich zu<br />
erfassen, liegt nicht im Denken, sondern im Akt, im Erleben von Einssein. So führt die paradoxe Logik zu<br />
dem Schluss, dass die Gottesliebe weder im verstandesmässigen Wissen über Gott noch in der<br />
gedanklichen Vorstellung, ihn zu lieben, besteht, sondern im Akt des Erlebens des Einsseins mit Gott.<br />
Dies führt dazu dass das grösste Gewicht auf die rechte Art zu leben gelegt wird. Unser gesamtes Leben,<br />
jede geringfügige Handlung, dient der Erkenntnis Gottes – aber nicht einer durch richtiges Denken zu<br />
erlangenden Erkenntnis, sondern einer, die im richtigen Handeln begründet ist……In der neueren<br />
Geschichte finden wir das gleiche Prinzip im Denken von SPINOZA, MARX und FREUD. SPINOZA<br />
legt in seiner Philosophie das Hauptgewicht nicht auf den rechten Glauben, sondern auf die richtige<br />
Lebensführung. Marx steht auf dem gleichen Standpunkt, wenn er sagt: „Die Philosophen haben die Welt<br />
nur verschieden interpretiert; es kommt darauf an, sie zu verändern“ (Seite 341, Die Frühschriften, Karl<br />
Marx Herausgegeben von Siegfried Landshut, Kröners Taschenausgabe 209, Stuttgart 1971, Alfred<br />
Kröner Verlag). FREUD wurde durch die paradoxe Logik zum Prozess seiner psychoanalytischen<br />
Therapie, der sich immer weiter vertiefenden Erfahrung seiner selbst, hingeführt“ (FROMM, Liebe, 89).<br />
Matthyas Arter 39/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
4. Konfliktbewältigung<br />
4.1. Konflikt in welchem Sinn?<br />
Die umgangssprachliche Definition des Konfliktes hat ihre Tücken, wenn es darum<br />
geht, psychologische Konflikte zu fassen. MENTZOS zeigt deutlich auf, wie schwierig<br />
es ist, das zu fassen, was mit Konflikt sinnvollerweise gemeint sein sollte:<br />
„Es ist nicht sinnvoll, das Zusammenspiel von Agonisten und Antagonisten im<br />
Muskelsystem als einen Konflikt zwischen beiden darzustellen. In Wirklichkeit (!)<br />
geht es um eine notwendige Bipolarität, die sich bei verschiedenen<br />
Körperfunktionen nachweisen lässt und die eigentlich dem übergeordneten Ziel<br />
einer sowohl stabilen als auch differenzierten und flexiblen Funktion dient.<br />
Beispiele auf der psychischen Ebene: Emotionelle Bindung einerseits und<br />
Autonomiestreben andererseits brauchen nicht unbedingt zu einem Konflikt zu<br />
führen. Passivität und Aktivität können sich ohne weiteres ablösen.<br />
Von einem Konflikt, auf jeden Fall von einem pathologischen Konflikt sollte man<br />
erst dann sprechen, wenn sich Hemmungen, Blockierungen, Gegensysteme zum<br />
Zwecke der Abwehr aufgebaut oder wenn sich die normal gegebenen<br />
Bipolaritäten (oder die innerhalb der Entwicklung normalerweise vorübergehend<br />
auftauchenden Gegensätze) zu Konflikten gefestigt haben“ (MENTZOS, 2005,<br />
122).<br />
Der Konflikt wäre demzufolge dann ein Konflikt, wenn er als solcher offensichtlich und<br />
mit Gegensystemen zum Zwecke der Abwehr zumindest scheinbar wieder zum<br />
Verschwinden gebracht würde. Für die Herleitung dessen, was mit Dilemmatoleranz<br />
gemeint sein soll, genügt diese Definition nicht, da sie implizit voraussetzt, dass nur<br />
eine Wirklichkeit (und nicht jene des Betroffenen) relevant ist und eine Vorstellung<br />
dessen bedingt, was als normal gilt. Auf diese Voraussetzungen muss aber aufgrund der<br />
vorangegangenen Herleitung von der Nähe-Distanz-Problematik sowie der Ich- und<br />
Selbstbildung verzichtet werden.<br />
Matthyas Arter 40/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
4.1.1. Konflikt ohne Normalität<br />
Klarheit darüber, was ein Konflikt ist und welche Möglichkeiten zu dessen Lösungen es<br />
gibt, ist aber dennoch die Voraussetzung für eine Betrachtung über den Begriff<br />
Dilemmatoleranz. Entsprechend muss ein anderer Ansatz gewählt werden, welcher sich<br />
aber durchaus mit dem Konfliktverständnis von MENTZOS vereinbaren lässt,<br />
insbesondere dann, wenn das Schwergewicht weniger auf den Konflikt als vielmehr auf<br />
dessen Bewältigung gelegt wird, was auch aus praktischen Gründen respektive im<br />
Hinblick auf Therapie durchaus vernünftig erscheint.<br />
Aus der Grundproblematik von Nähe und Distanz, „Autophil –Heterophil“, ergibt sich<br />
aufgrund der genetisch vorgegebenen Strukturen und der individuellen Biografie ein<br />
entwicklungspsychologisch einmalig definiertes Wesen mit einem ebenso einmaligen<br />
Ich- und Selbstverständnis, welches sich in einem dynamischen Prozess permanent<br />
adaptiert, bedingt durch äussere Vorkommnisse, aber auch entwicklungsdefinierte<br />
Aufbau- und Zerfallsprozesse von Körper und Geist. Gemeinsam ist all diesen<br />
Erscheinungen, dass sie stets im Rahmen akuter Konfliktbewältigung vor sich gehen.<br />
JUNG braucht den Begriff Konflikt spezifisch:<br />
„Während nämlich ein Teil der Libido auf einer Vorstufe verweilt, geht die Zeit<br />
und damit die sonstige Entwicklung des Individuums unaufhaltsam vorwärts, und<br />
die körperliche Reifung bringt es mit sich, dass der Abstand und die Diskordanz<br />
zwischen der perseverierenden Infantiltätigkeit und den Anforderungen des<br />
erhöhten Alters und der damit veränderten Lebensbedingungen immer grösser<br />
werden. Damit wird die Grundlage gelegt zur Dissoziation der Persönlichkeit und<br />
damit zum Konflikt, was das eigentliche Fundament der Neurose ist. Je mehr<br />
Libido in rückständiger Anwendung begriffen ist, desto intensiver wird der<br />
Konflikt sein“ (JUNG, 4, 154, §295).<br />
Speziell an diesem Konfliktverständnis ist der Umstand, dass dieser durch eine<br />
Diskrepanz bedingt ist, welche als Folge mangelhaft entwickelter Dilemmatoleranz<br />
verstanden werden kann. Sinnvoller wäre es wohl von entwicklungspsychologisch oder<br />
genetisch bedingter Konfliktverschärfung zu sprechen, da in diesen Fall offenbar von<br />
nurmehr schwer zu bewältigenden Konflikten die Rede ist.<br />
Der Umgang mit Konflikten, nicht nur mit dem Grundkonflikt von Nähe und Distanz,<br />
bildet das Kernstück jeder Entwicklung, ja es steht zu vermuten, jedes Daseins<br />
Matthyas Arter 41/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
überhaupt. Ist das Paradox die Basis des Lebens, wie weiter vorne dargestellt, so ist der<br />
Konflikt als treibende Kraft die logische Konsequenz einer ansonsten gänzlich<br />
unlogischen Existenz. Der Konflikt fordert zu seiner Linderung respektive<br />
vermeintlichen Beseitigung eine Entscheidung. Diese kann nicht leicht fallen, da<br />
hiermit immer ein Verlust verbunden ist. MENTZOS:<br />
„Bei der Geburt eines Kindes trennt sich die Mutter vom Kind. Später müssen die<br />
Eltern von ihren Kindern Abschied nehmen. Im Klimakterium trennt sich die Frau<br />
und analog der Mann von wichtigen körperlichen Funktionen und einem<br />
bestimmten Köperbild. Der Tod impliziert schliesslich die schwierigste Trennung.<br />
Aber auch jede wichtige Entscheidung im Leben bedeutet die Trennung von den<br />
dann nicht mehr zu verwirklichenden Alternativen“ (MENTZOS, 2005, 129).<br />
Man könnte daher auch sagen, der Konflikt bestehe meist darin, dass die Entwicklung<br />
des Einzelmenschen Anpassungen seiner Wirklichkeitsvorstellung und seines<br />
Selbstverständnissees fordern, welche zwingend mit dem Verlust von Alternativen<br />
verbunden und damit schmerzhaft respektive konflikthaft sind. Aus dem weiter vorne<br />
Dargelegten ist auch leicht ersichtlich, dass Konflikte in der Tendenz etwas mit Nähe<br />
und Distanz oder m.E. anschaulicher ausgedrückt mit Liebe und Angst zu tun haben.<br />
Mit der Liebe nämlich, sich in eine neue, den wahrgenommenen Verhältnissen<br />
angepasstere Weltvorstellung hinein zu begeben und der Angst, die angestammte,<br />
vertraute, aber leider nicht länger taugliche Vorstellung von sich und der Welt zu<br />
verlieren.<br />
4.2. Schuldgefühl schafft den Konflikt<br />
Es erstaunt nicht weiter, dass diese Erkenntnis wahrscheinlich so alt ist, wie die<br />
Menschheit selbst. Ein Blick auf das Wesen der Scham macht dies nur allzu deutlich:<br />
FROMM schreibt zum Entstehen der Scham:<br />
„Nachdem Mann und Frau sich ihrer selbst und ihres Partners bewusst geworden<br />
sind, sind sie sich auch ihrer Getrenntheit und Unterschiedlichkeit bewusst,<br />
insofern sie verschiedenen Geschlechts sind. Sie erkennen zwar ihre Getrenntheit,<br />
bleiben sich aber fremd, weil sie noch nicht gelernt haben, sich zu lieben. (Dies<br />
geht auch sehr klar daraus hervor, dass Adam sich verteidigt, indem er Eva<br />
Matthyas Arter 42/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
anklagt, anstatt dass er versucht, sie zu verteidigen). Das Bewusstsein der<br />
menschlichen Getrenntheit ohne die Wiedervereinigung durch die Liebe ist die<br />
Quelle der Scham. Und es ist gleichzeitig die Quelle von Schuldgefühl und Angst“<br />
(FROMM, Liebe 19).<br />
Das darin schlummernde Konfliktpotential ist unübersehbar. Wir könnten auch sagen,<br />
das Schuldgefühl schafft den Konflikt. Es ist auch gar nicht möglich, diesem<br />
Konfliktpotential auszuweichen. Wie gezeigt wurde, besteht der<br />
entwicklungspsychologische Werdegang ja gerade darin, dass von (geliebten)<br />
Vorbildern übernommene Werte (sinnstiftende Symbole) hinterfragt und der eigenen<br />
Lebenssituation (die immer eine andere weil zwingend einmalige ist) angepasst werden<br />
müssen, was ohne „Verrat“ der alten Werte und damit ohne Schuld und ohne Konflikt<br />
nicht möglich ist. In diesem Sinne ist die Pubertät als korrigierende Phase zu verstehen,<br />
in welcher – wie EISSLER 15 meint – nochmals taugliche Anpassungen an die<br />
tatsächlichen Erfordernisse vorgenommen werden können: EISSLER bezeichnet die<br />
Pubertät als eine zweite und oft letzte Chance, Konflikte der präadoleszenten Phasen<br />
noch zu lösen. Er vergleicht die Adoleszenz mit einem Verflüssigungsprozess, um eine<br />
Neustrukturierung des Individuums zur Identitätsfindung (in einer ausserfamiliären<br />
Umwelt) zu ermöglichen.<br />
4.2.1. Konfliktbewältigung versus Konfliktbeseitigung<br />
Mit Konfliktbewältigung ist aber nicht gemeint, den Konflikt als solchen zu beseitigen,<br />
sondern vielmehr für sich selbst eine Position zu definieren, aus welcher heraus die mit<br />
der Lebenssituation verbundenen Spannungen erträglich werden. Also keine<br />
Verdrängung derselben, sondern eine permanente dynamische Auseinandersetzung im<br />
Sinne einer Optimierung der eigenen Position.<br />
Für JUNG ist diese permanente Herausforderung der Konfliktbewältigung durch<br />
archetypisch vordefinierte Entwicklungsmuster einigermassen relativiert, indem der<br />
Mensch grundsätzlich gar nicht anders kann, als den für ihn richtigen Weg zu gehen.<br />
NIETZSCHE sah den Weg zwar konfliktbehaftet, aber instinktmässig vorgegeben:<br />
15 K.R.EISSLER: Bemerkungen zur Technik der Psychoanalytischen Behandlung Pubertierender nebst<br />
einigen Überlegungen zum Problem der Perversion in PSYCHE 1966, Nr. 20: Seite 837-872<br />
Matthyas Arter 43/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
„Denn da wir nun einmal die Resultate früherer Geschlechter sind, sind wir auch<br />
die Resultate früherer Verirrungen, Leidenschaften und Irrtümer, ja Verbrechen;<br />
es ist nicht möglich, sich ganz von diesen Ketten zu lösen. Wenn wir jene<br />
Verirrungen verurteilen und uns ihrer für enthoben erachten, so ist die Tatsache<br />
nicht beseitigt, dass wir aus ihnen herstammen. Wir bringen es im besten Falle zu<br />
einem Widerstreite der ererbten, angestammten Natur und unserer Erkenntnis,<br />
auch wohl zu einem Kampfe einer neuen strengen Zucht gegen das von alters her<br />
Angezogene und Angeborene, wir pflanzen eine neue Gewöhnung, einen neuen<br />
Instinkt, eine zweite Natur an, so dass die erste Natur abdorrt. Es ist ein Versuch,<br />
sich gleichsam a posteriori eine Vergangenheit zu geben, aus der man stammen<br />
möchte, im Gegensatz zu der, aus der man stammt: - immer ein gefährlicher<br />
Versuch, weil es so schwer ist, eine Grenze im Verneinen des Vergangenen zu<br />
finden, und weil die zweiten Naturen meistens schwächlicher als die ersten sind“<br />
(NIETZSCHE, Betrachtungen, 125).<br />
FROMM urteilt ähnlich:<br />
„Wenn es auch keine von vornherein festgelegte menschliche Natur gibt, so darf<br />
man sie doch auch nicht als etwas unbegrenzt Formbares ansehen, das sich an<br />
Bedingungen jeder Art anpassen könnte, ohne eine eigene psychologische<br />
Dynamik zu entwickeln. Wenngleich die menschliche Natur das Produkt der<br />
historischen Entwicklung ist, so besitzt sie doch bestimmte, ihr innewohnende<br />
Mechanismen und Gesetze, deren Aufdeckung die Aufgabe der Psychologie ist“<br />
(FROMM, Freiheit, 18).<br />
Zu bedenken ist allenfalls, dass das, was NIETZSCHE als „Verirrungen, Leidenschaften<br />
und Irrtümer abtut, immerhin die nachfolgende Generation hervorbrachte, sich also als<br />
das Überlebensfähige durchsetzte, worum es ja auch ihm geht. Ebenso kann FROMM<br />
dem Menschen die weitere historische Entwicklung nicht abschlagen, zumal<br />
offensichtlich ist, dass die von FROMM vermuteten Mechanismen und Gesetze der<br />
menschlichen Psyche höchstens dynamischer (und letztlich paradoxer) Natur sein<br />
können.<br />
Matthyas Arter 44/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
4.2.2. Traum als Schlüssel zur Konfliktbewältigung<br />
In der Terminologie von FREUD ist es die Libido, welche unbedingt Befriedigung<br />
sucht.<br />
Für FREUD ist daher die entscheidende Komponente, Frustration entweder durch<br />
Ersatzbefriedigung (beispielsweise Wunscherfüllung im Traum) oder neuen Lustgewinn<br />
zu kompensieren. FREUD betonte das Konflikthafte des Traumes. In seiner 29.<br />
Vorlesung, der „Revision der Traumlehre“ (1933), sah er den Traum als „ein<br />
pathologisches Produkt, als das erste Glied der Reihe, die das hysterische Symptom, die<br />
Zwangsvorstellung, die Wahnidee umfasst.“ Die Abwendung von der realen Aussenwelt<br />
sei das charakteristische Merkmal der Psychose wie des Schlafzustandes. Die<br />
Abwendung als das charakteristische Merkmal wird auf zweierlei Weise<br />
hervorgerufen:<br />
„Entweder, indem das Unbewusst-Verdrängte überstark wird, so dass es das an<br />
der Realität hängende Bewusste überwältigt, oder weil die Realität so<br />
unerträglich leidvoll geworden ist, dass sich das bedrohte Ich in verzweifelter<br />
Auflehnung dem unbewusssten Triebhaften in die Arme wirft“ (FREUD, 15, 16).<br />
Den Traum als Vorstufe zur Psychose unterscheidet sich von derselben nur insofern, als<br />
erst eine massive Regression den psychotischen Prozesses einleitet, indem das Ich des<br />
Psychotikers versucht - unter anderem mittels Halluzinationen, Wahnbildungen sowie<br />
anderer „Produktionen“ - eine „neue Welt“ entstehen zu lassen, in der es sich<br />
erträglicher leben lässt (FREUD, 13a, 385f) .<br />
Umgekehrt ist der Traum aber auch ein probates Mittel zur Psychoseverhinderung,<br />
indem er als Regulativ schwelende Konflikte entschärfen kann. Dem Traum – als<br />
„Hüter des Schlafes“ – gelingt es nach FREUD, das Produkt eines Zusammenwirkens<br />
äusserer oder innerer Anregungen und unbewusster Triebquellen in ein „unschädliches<br />
halluzinatorisches Erlebnis“ einmünden zu lassen und so die Fortdauer des Schlafes zu<br />
sichern: Die nächtliche Absperrung des Seelenlebens von der Realität, die dadurch<br />
ermöglichte Regression zu primitiven Mechanismen machen es möglich, dass die<br />
gewünschte Triebbefriedigung halluzinatorisch als Gegenwart erlebt wird, ohne dass<br />
hierdurch der Realitätsbezug im Wachzustand direkt verändert würde. Infolge derselben<br />
Regression werden im Traum Vorstellungen in visuelle Bilder umgesetzt, die latenten<br />
Traumgedanken also dramatisiert und illustriert, was die Stellung zur Welt auch im<br />
Matthyas Arter 45/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
Wachzustand beeinflussen, einen neuen Standpunkt definieren kann. Der Traum ist<br />
nach FREUD also eine Kompromisslösung mit einer doppelten Funktion:<br />
„Er ist einerseits ich-gerecht, indem er durch die Erledigung der schlafstörenden<br />
Reize dem Schlafwunsch dient, anderseits gestattet er einer verdrängten<br />
Triebregung die unter diesen Verhältnissen mögliche Befriedigung in der Form<br />
einer halluzinierten Wunscherfüllung“ (vgl. FREUD, 15, 19).<br />
BÖCKER, der eben dieser Frage in Bezug auf die Pathologie des Psychotikers<br />
nachgegangen ist und in diesem Zusammenhang auch die obgenannten Stellen von<br />
FREUD zitiert, fasst diese Konfliktlösungskomponente des Traumes anschaulich<br />
zusammen:<br />
„Im Bewusstmachen der im manifesten Traum erkennbar werdenden Ich-<br />
Strukturen und Ich-Funktionen erschliessen sich dem träumenden Psychotiker<br />
bisher verborgene Konfliktlösungsmöglichkeiten. Die Wahrnehmungen dieser<br />
kreativen Kräfte des Träumers erfordern eine Abkehr von der ausschliesslich auf<br />
das Aufspüren latenter Triebwünsche orientierten Deutungsarbeit (vgl. BEESE<br />
1983).<br />
KEMPER hat darauf aufmerksam gemacht, dass der Träumer als spezifische<br />
Denkfunktion im Schlaf immer auch den vorausschauenden, auf die Zukunft<br />
bezogenen Anteil dieser Ich-Leistung enthält“ (BÖKER in MENTZOS, 2000,<br />
160).<br />
Dieser vorausschauende Aspekt betonte auch JUNG, der in diesem Zusammenhang von<br />
der „finalen“ Deutung des Traumes spricht, während FREUD eher die<br />
Wunscherfüllungsfunktion aufgrund bereits erfolgter Frustration betonte, wobei darin<br />
kein Widerspruch, sondern eher eine Ergänzung zu sehen ist. ADLER betont dagegen<br />
mehr die selbststärkende Seite, wenn er die Geschichte des Dichters Simonides zitiert,<br />
der die Einladung erhielt, in Kleinasien aus seinen Werken vorzutragen.<br />
„Er zögerte, die Reise anzutreten, und verschob sie wiederholt, obwohl im Hafen<br />
ein Schiff lag, das auf ihn wartete. Seine Freunde versuchten ihn zu bewegen, sich<br />
endlich auf das Schiff zu begeben, doch ohne Erfolg. Schliesslich hatte er einen<br />
Traum, in dem ihm ein toter Mann erschien, dem er einst in einem Wald begegnet<br />
war, und dieser Mann sagte ihm: „Da du so lobenswert an mir gehandelt und<br />
dich in jenem Wald um mich gesorgt hast, möchte ich dir heute den Rat geben,<br />
Matthyas Arter 46/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
nicht nach Kleinasien zu reisen.“ Simonides wachte auf und erklärte: „Ich werde<br />
nicht reisen“. In Wahrheit war er allerdings bereits vor seinem Traum<br />
entschlossen, die Reise nicht anzutreten“ (ADLER, 1929, 90).<br />
Was ADLER andeutet, ist letztlich auch eine Wunscherfüllung, indem das unsichere<br />
‚Ich’ des Simonides Schützenhilfe aus dem Unbewussten bekam, respektive sein<br />
bewusstes Ich von Entscheid entlasten konnte, indem die fraglos stärkere Kraft des<br />
Unbewussten die Verantwortung übernahm und Simonides eine Ausrede lieferte, die er<br />
selbst glauben konnte.<br />
Ziel des Traumes ist in jedem Fall das Herbeiführen eines erträglichen<br />
Spannungsniveaus unter Berücksichtigung von mehr Aspekten, als bewusst zur<br />
Verfügung stehen würden. In diesem Sinne ist auch die Bedeutung des Traumes als<br />
selbstheilende, ja sogar Selbst-heilende Kraft zur Konfliktbewältigung jedes Einzelnen<br />
entsprechend hoch einzuschätzen, indem er den „Königsweg“ (FREUD) ins<br />
Unbewusste darstellt und geeignet ist, Ungleichgewichte im psychischen Energiefluss<br />
sowie die damit verbundenen Konflikte und Spannungsverhältnisse manifest werden zu<br />
lassen. MENTZOS erkennt im Einhalten eines erträglichen Spannungsniveaus<br />
bezüglich der laufend zu bewältigenden Konflikte eine entscheidende Komponente zur<br />
Aufrechterhaltung eines relativen Wohlbefindens:<br />
„Konflikt und Spannungsniveau, Lust- und Unlustempfindungen sowie ihre<br />
späteren Differenzierungen (z.B. Freude, Begeisterung, Wohlbefinden, Stolz,<br />
Hochgefühl usw. einerseits und Angst, Trauer, Scham, Schuldgefühl usw.<br />
andererseits) sind, rein funktionell betrachtet, Indikatoren innerhalb eines<br />
komplizierten Regulationssystem. Sie sind Indikatoren, die Lustvolles (bzw.<br />
Unlustvolles) sowie Gefährliches (bzw. Sicherheit Bietendes) anzeigen und zu<br />
bestimmten Reaktionen Anlass geben. Dabei ist die Aufrechterhaltung eines<br />
optimalen (keineswegs immer eines konstanten!) Spannungsniveaus wichtig.<br />
Übersteigt diese Spannung bestimmte Grenzen, etwa bei Überreizung durch<br />
äussere oder innere Reize, so schalten sich regulatorische Mechanismen ein, um<br />
diesen unlustvollen oder gefährlichen Zustand auf das optimale Spannungsniveau<br />
zurückzuführen. Aber auch ein zu niedriges intrapsychisches Spannungsniveau ist<br />
unverträglich und wird durch Gefühle der Langeweile und Bedrücktheit<br />
Matthyas Arter 47/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
signalisiert. Auch darauf folgen normalerweise Reaktionen, um diesen Zustand zu<br />
ändern“ (MENTZOS, 2005, 76).<br />
4.2.3. Doppelbedingtheit des Konfliktes<br />
Der Konflikt als zentrale Komponente für ein lebbares Spannungsverhältnis ist deshalb<br />
von entscheidender Bedeutung, aber ausgesprochen schwierig zu handhaben weil dieser<br />
sowohl durch äussere Umstände als auch durch intrapsychische Fehldispositionen zu<br />
einer schwer zu lindernden Belastung werden kann. MENTZOS sieht im Konflikt beide<br />
Problembereiche, wobei der letztere durch seine weitgehend unbewusste Wirksamkeit<br />
besonders leidvoll wirken kann.<br />
„Zwar können auch äussere Konflikte und auch einfache äussere Belastungen,<br />
sofern sie anhaltend und intensiv genug sind, zu Störungen führen. Abnorme<br />
Haftreaktionen, das Konzentrationslagersyndrom, Belastungen durch schwer<br />
gestörte Partner usw. sind Beispiele dafür. Den meisten psychoneurotischen<br />
Störungen jedoch liegen vorwiegend unbewusste, intraspychische Konflikte<br />
zugrunde, also unbewusste innerseelische Zusammenstösse entgegengerichteter<br />
Motivationsbündel“ (MENTZOS, 2005, 75).<br />
Wichtig scheint in diesem Zusammenhang zudem die von ELZER postulierte<br />
Zusammenführung der psychisch relevanten Antagonismen, deren Überwindung nach<br />
der Theorie zumindest zu höherer seelischer Reife führen soll:<br />
„Die psychoanalytische Entwicklungslehre ist daher in erster Linie eine<br />
Psychologie der Triebe und der durch sie zustande gekommenen Beziehungen.<br />
Entwicklung, psychische Reifung finden innerhalb einer Hierarchie von<br />
Konfliktlösungen (Synthesen statt), die wiederum auf einer höher geordneten Stufe<br />
selbst eine Gegenthese erschaffen. Die wichtigsten entwicklungspsychologischen<br />
Schulen (z.B. FREUD, SPITZ, ERIKSON, MAHLER) haben sich mit Dualismen<br />
als Motor der psychischen Entwicklung befasst, dabei aber bestimmte Modi<br />
selektiv in den Vordergrund gestellt, zum Beispiel: Libido-Aggressivität, Aktivität-<br />
Passivität, Einverleiben-Ausstossen, Nähe-Distanz, Autonomie-Abhängikeit,<br />
Urvertrauen-Misstrauen, Identität-Rollenkonfusion und weitere“ (ELZER in<br />
METNZOS, 2000, 104).<br />
Matthyas Arter 48/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
Die Entwicklungsstufe scheint dabei für die Hartnäckigkeit von letztlich immer<br />
konfliktbedingtem Leiden mehr als nur klassifikatorischer Natur:<br />
„Obwohl alle psychogenen psychischen Störungen letztlich konfliktbedingt sind,<br />
behält die Unterscheidung zwischen Psychoneurosen einerseits und<br />
Selbstpathologie andererseits ihre theoretische und praktische Relevanz. Denn<br />
frühe pathologische Konflikte und ihre Folge sind schwerwiegender, weil sie in<br />
die Phase der Konstituierung des Selbst fallen und somit dessen Struktur und<br />
Konsistenz beeinflussen“ (METNZOS, 2005, 84).<br />
4.2.4. Konfliktschwere<br />
Frühe Konflikte sind entsprechend schwerwiegender als späte Konflikte, was deren<br />
Therapierung angeht. Die dabei unterstellte Behauptung, dass das Selbst während einer<br />
bestimmten Phase konstituiert und hernach entsprechend gefestigt sei, sollte aber nicht<br />
als Argument gegen Therapiebemühungen missbraucht werden. Gesichert ist ja<br />
höchstens, dass wesentliche Teile des Selbstverständnisses nach einer bestimmten<br />
Entwicklungsphase weitgehend erhärten und für Anpassungen ähnlich ungeeignet sind<br />
wie der Chitinpanzer von Insekten. Wir müssen aber dem einzelnen Menschen<br />
zugestehen, dass seine Flexibilität bezüglich Konfliktbewältigung nicht zuletzt dank<br />
seiner Einflussmöglichkeit auf die ihn umgebende Umwelt, sowie die Wahrnehmung<br />
derselben, dennoch sehr gross ist und damit Linderung für innerpsychisch nicht mehr zu<br />
erreichende, respektive ins tief Unbewusste versunkene Konflikte geschaffen werden<br />
kann. Die Unterscheidung von frühen pathologischen Konflikten (Selbstpathologie) und<br />
Psychoneurosen sollte indes als Frucht jahrzehntelanger Therapiearbeit ernst genommen<br />
werden, gerade weil die Auslotung inadäquater Dilemmatoleranz im Einzelfall erst dann<br />
praktischen Nutzen hat, wenn über den offen gelegten Konflikt respektive dessen<br />
Symptome eine Vermutung darüber abgegeben werden kann, mit wie viel Widerständen<br />
der Therapiewillige voraussichtlich zu rechnen hat, wenn er sich dem nicht nur<br />
ungelösten, sondern längst nicht mehr manifesten Konflikt stellen will. In diesem Sinne<br />
Matthyas Arter 49/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
sind auch die von MENTZOS als wesentlich postulierten Diagnoseachsen<br />
unabdingbar. 16<br />
Konflikte sind nicht offensichtlich und in den meisten Fällen wird von jedem Einzelnen<br />
viel dafür getan, dass sie nicht erkennbar werden, indem allerhand Phantasien anstelle<br />
wahrnehmbarer Sinneseindrücke gesetzt werden. JUNG:<br />
„In solchen Phantasien verrät sich ein der harten Wirklichkeit der Dinge<br />
abholder Sinn; es ist darin etwas wenig Ernsthaftes, etwas Spielerisches, das bald<br />
wirkliche Schwierigkeiten tändelnd zudeckt, bald Kleinigkeiten zu grossen<br />
Schwierigkeiten übertreibt, das immer Phantasmen ersinnt, um damit den<br />
Ansprüchen der Wirklichkeit (dem Konflikt Anm. d. V.) zu entgehen. Wir<br />
erkennen darin ohne weiteres jenes unabgemessene psychische Verhältnis,<br />
welches das Kind zur Wirklichkeit hat, ein schwankendes Urteil, seine<br />
mangelhafte Orientierung über Dinge der äusseren Welt und seine Scheu vor<br />
unangenehmen Pflichten. Auf einer solchen infantilen Geistesdisposition können<br />
alle möglichen Wunschphantasien und Illusionen üppig wuchern, und hierin<br />
haben wir das gefährliche Moment zu erblicken. Durch solche Phantasien geraten<br />
die Menschen in eine unwirkliche und gänzlich unangepasste Stellung zur Welt,<br />
was eines Tages zur Katastrophe führen muss“ (JUNG, 4, 156, §298).<br />
Die Behauptung, dass es zur Katastrophe führen muss, ist insofern nachvollziehbar, als<br />
der Konflikt zwischen Selbst und übriger Welt durch Ignoranz immer grösser werden<br />
muss. Die Meinung, dass es zur Katastrophe führen kann, scheint aber dennoch<br />
begründeter, indem dieses Abgleiten in die Welt der Phantasie ja nicht nur die Qualität<br />
von Realitätsverkennung hat, sondern auch die Basis dessen bildet, was man als<br />
gestalterische Kraft in der Welt, als das Visionäre bezeichnen könnte. Gelingt es also,<br />
16 Aus Gründen der Praktikabilität empfiehlt es sich, die Diagnose auf drei Ebenen zu beschränken. :<br />
1. Die Art des zugrunde liegenden, zentralen Konfliktes und der daraus entstehenden sekundären<br />
Konflikte<br />
2. der Reifungsgrad, die Kohäsion, überhaupt die strukturelle Beschaffenheit des Ichs (Selbst),<br />
insbesondere die Frage nach Art und Ausprägung eventueller struktureller Mängel<br />
3. die im Vordergrund stehenden Abwehr-, Ersatzbefriedigungs- und Reparationsvorgänge bzw.<br />
Mechanismen, die in ihrer Gesamtheit jeweils den charakteristischen Modus der<br />
Konfliktverarbeitung darstellen.<br />
(MENTZOS, 2005, 109)<br />
Matthyas Arter 50/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
ein Stück Phantasie in Realität umzusetzen, so würde keine Katastrophe, sondern ein<br />
evolutionärer Fortschritt erzielt. Voraussetzung dafür ist aber, dass der damit<br />
einhergehende Konflikt zwischen unorthodoxem Selbstverständnis und Welt<br />
ausgehalten werden kann. Das wiederum ist der Fall, wenn die notwendige<br />
Dilemmatoleranz vorhanden ist. JUNG führte diesen Gedanken übrigens auch schon<br />
aus, indem er dem Menschen - konkret FREUD und im Dienste des wissenschaftlichen<br />
Fortschrittes - den Mut zum Irrtum als Qualitätsmerkmal attestierte:<br />
„Wir müssen froh und dankbar sein, dass FREUD den Mut hatte, diesen Weg sich<br />
führen zu lassen. Nicht solche Dinge hindern den Fortschritt der Wissenschaft,<br />
sondern das konservative Festhalten an einmaligen Einsichten, der typische<br />
Konservativismus der Autorität, die kindische Eitelkeit des Gelehrten auf sein<br />
Rechthaben und seine Angst, sich zu irren. Dieser mangelnde Opfermut schädigt<br />
das Ansehen und die Grösse der wissenschaftlichen Erkenntnis weit mehr als ein<br />
ehrlicher Irrweg“ (JUNG, 4, 158, §302).<br />
Dieser Gedanke lässt sich direkt auf die Menschwerdung übertragen. Die Idee, dass es<br />
eine einzig richtige Realität gebe, lässt sich Kraft der Tatsache, dass wir denken und<br />
sind weder beweisen noch leugnen, aber zu behaupten dass wir diese auch erkennen<br />
können ist, wie weiter vorne dargestellt wurde, nicht haltbar. Der Mut zum Irrtum, zur<br />
Begehung des eigenen, irrtumbehafteten Weges ist ein Beitrag zur evolutiven<br />
Entwicklung des Menschen als Teil einer stets nur ums Überleben ringenden<br />
Gesamtheit - man könnte auch sagen zur steten Veränderung gezwungen oder mit<br />
NIETZSCHE „unersättlich sich selbst begehrenden Macht“ - , deren Grundkonflikt<br />
darin besteht, dass nur überleben kann, was grundsätzlich auch scheitern könnte. Damit<br />
ist auch der Ungang mit Konflikten ein individueller, zwar nach Grundmustern<br />
strukturierter, aber im Einzelfall doch nicht unterteilbar in richtig und falsch, weil eben<br />
nie klar sein kann, welches Verhalten sich im Endeffekt als das Überlegene respektive<br />
Überlebende erweist.<br />
JUNG beschreibt dies ebenso anschaulich wie deutlich. Es ist dem nichts hinzuzufügen:<br />
„Bei der schöpferischen Phantasie handelt es sich um einen Vorgang, bei dem die<br />
psychischen Inhalte aus dem Unbewussten ins Bewusstsein dringen. Es sind<br />
Eingebungen, also etwas, das sich dem bedächtigen Denkprozess des<br />
Bewusstseins in keiner Weise vergleichen lässt. So kann das Unbewusste als<br />
Matthyas Arter 51/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
schöpferischer Faktor betrachtet werden, sogar als kühner Neuerer, doch ist es<br />
zugleich eine Hochburg des Konservatismus. Ich gebe zu, dass diese Auffassung<br />
paradox erscheint, die Tatsachen sind aber so. Es ist der Mensch, der paradox ist,<br />
was man nicht ändern kann. Es hat seine guten Gründe, dass unsere<br />
Auseinandersetzung mit einem Pardoxon endet und dass diese paradoxe Aussage<br />
eher der Wahrheit entspricht als eine einseitige, so genannte „positive“<br />
Feststellung“ (JUNG, Praxis, 36, §62/63).<br />
Matthyas Arter 52/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
5. Dilemmatoleranz<br />
Die bis dahin präsentierte Auslegeordnung diente zwei Zielen. Erstens sollte gezeigt<br />
werden, dass keine psychologische Betrachtungsweise Bestand haben kann, wenn sie<br />
nicht von Anfang an dem Umstand Rechung trägt, dass es keine „richtige“ oder<br />
„falsche“ Betrachtungsweise geben kann, da es nichts gibt unter der Sonne, was letztlich<br />
nicht paradox respektive ein Dilemma wäre. Der Tag bedingt die Nacht, das Werden<br />
bedingt das Sterben, das Männliche bedingt das Weibliche, die Nähe bedingt die<br />
Distanz, die Liebe bedingt die Angst. Der Konflikt ist allgegenwärtig und nicht<br />
abschliessend lösbar weil dilemmahaft. Das Eine ist ohne das Andere nicht möglich. Es<br />
existiert zusammen, was sich gegenseitig ausschliesst. Das ist das Dilemma und das ist<br />
paradox.<br />
5.1. Überleben als nicht überprüfbares Hauptkriterium<br />
Alles was überlebt, erweist sich entsprechend und banalerweise lediglich als existent.<br />
JUNG schreibt: „Alles Lebendige ist lebendige Geschichte, sogar der Kaltblüter lebt<br />
noch als sous-entendu in uns fort“ (JUNG, Praxis, 75, §159) Wir müssen also aus dem<br />
evolutionstheoretischen Blickwinkel jeder existenten Kreatur ein gehöriges Mass an<br />
Überlebenstauglichkeit attestieren, schaffte sie es doch immerhin als vorläufig letzte<br />
Variation aus der langen Entwicklungskette seit den ersten Einzellern, das Licht der<br />
Welt zu erblicken. Selbstredend zeichnet diese Leistung nicht nur alle lebenden<br />
menschlichen Kreaturen aus, sondern auch jeden (noch nicht von einem Automobil<br />
überfahrenen) Laubfrosch, respektive jede (für uns Menschen ausgesprochen lästige)<br />
Stechmücke. Kurz, so vielfältig die Kreaturen auch sein mögen, allen gemein ist, dass<br />
sie sich in einer dynamischen Welt einen Platz sichern konnten, wo sie das<br />
überlebenstaugliche Verhältnis von Nähe und Distanz in der Weise etablieren konnten,<br />
dass sie leben und den Fortgang der Welt – wenn auch vielleicht in nur sehr<br />
bescheidenem Rahmen – mitbestimmen. „Alles Kreatürliche steht im Wettstreit<br />
untereinander, oder auch als ergänzendes Teil zum Ganzen in vollkommener<br />
Harmonie“. Dieser von Hegel postulierte Grundsatz: "Das Wahre ist das<br />
Matthyas Arter 53/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
Ganze“ 17 bringt die Freiheit im Teil mit sich, sowohl von Bestand zu sein oder auch<br />
nicht. Hegel spricht im vierten Kapitel von einem unglücklichen Bewusstsein:<br />
„Dieses unglückliche, in sich entzweite Bewusstsein muss also, weil dieser<br />
Widerspruch seines Wesens sich ein Bewusstsein ist, in dem einen Bewusstsein<br />
immer auch das andere haben, und so aus jedem unmittelbar, indem es zum Siege<br />
und zur Ruhe der Einheit gekommen zu sein meint, wieder daraus ausgetrieben<br />
werden“ (HEGEL, Phänomenologie, 157).<br />
Der Gedanke hilft also nicht weiter, wenn es darum geht, die Überlebenstauglichkeit<br />
einer psychischen Ausgestaltung zu prüfen, zumal immer erst im Nachhinein klar<br />
würde, ob es sich bewährt hat oder nicht. Das „Wahre-Ganze“, also entsprechend<br />
Überlebensfähige realisiert sich – immer noch ganz im Sinne Hegels, respektive Fichtes<br />
und Schellings 18 - in der Geschichte durch antithetische Teilwahrheiten, die sich in einer<br />
höheren Synthese zusammenfinden. Diese wird ihrerseits zur Antithese in einem neuen<br />
Gegensatz. Damit ist denn auch schon der wesentlichste Punkt deutlich geworden. Die<br />
psychischen Funktionsweisen befinden sich - ebenso wie alle lebensrelevanten Prozesse<br />
- in einem dialektischen Prozess, einem grundsätzlichen Dilemma, indem keine<br />
Verhaltensweise denkbar ist, die nicht in eine Konfliktsituation mit der Umwelt in der<br />
einen oder andern Form führen würde. Diese Konflikte sind ihrem Grundsatz nach<br />
immer Dilemmata, indem die Durchsetzung der eigenen Position, Wünsche, Triebe<br />
automatisch den Widerstand der Umgebung potenzieren, so dass eine lebbare Mitte<br />
gefunden werden muss. Es ist denn auch die lebbare Mitte, die von besonderem<br />
Interesse ist, indem es sich um eine individuelle lebbare Mitte in Relation zum<br />
unbekannten Ganzen handelt.<br />
17 Hegel G.W.F, Phänomenologie des Geistes<br />
18 Hegel entwickelte unter Beibehaltung aufklärerischer und kritischer Positionen, wie Rousseau und Kant<br />
und Einbeziehung der historischen Betrachtungsweise ein philosophisches System, in dem er das<br />
Absolute als absolute Idee, als Natur und Geist in den Mittelpunkt stellt; als Verbindung von Begriff und<br />
Realität, subjektivem und objektivem Geist, mit dem Ergebnis des absoluten Geistes inform von Religion,<br />
Kunst oder Philosophie.Es geht um das Zurückfinden zu sich selbst und das immer stärker werdenden<br />
Selbstbewußtsein des menschlichen Geistes, sein "An-und-für-sich-sein" In diesem Sinne vollzieht sich<br />
die Verwirklichung des Absoluten im dialektischen Dreischritt von These, Antithese und Synthese..<br />
Fichte spricht von einem "synthetischen Verfahren", welches die Vereinigung der Gegensätze in einem<br />
Dritten gerade zum Zweck hat. Zu mehr als einer Methode wird die "Triade" (Dreiheit) von These-<br />
Antithese-Synthese beim jungen Schelling. Er behauptet, dass diese Dreiheit der Entwicklung in Natur<br />
und Geschichte entspricht.<br />
Siehe auch http://www.uni-mainz.de/FB/Philosophie_Paedagogik/agas/content/HA/hegel/methode.html,<br />
zitiert 15.02.2007<br />
Matthyas Arter 54/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
5.2. Normalität als Prokrustesbett<br />
Aufgrund dieser Anmerkungen wird schon ersichtlich, dass hier etwas in Frage gestellt<br />
werden soll, was gemeinhin als völlig normal betrachtet wird, die Normalität nämlich.<br />
Ebenso wie es das Nichts nur in Relation zu Etwas geben kann (SCHOPENHAUER,<br />
Wille und Vorstellung), ist die Normalität an Vorstellungen gebunden, die für sich<br />
genommen den Tatbeweis der Überlebenstauglichkeit schuldig bleiben müssen. Auch<br />
das Normale ist relativ. JUNG:<br />
„…welcher Anspruch könnte weiter und höher gehen, als ein normal angepasstes<br />
soziales Wesen zu sein? Normalmensch zu sein, ist das Nützlichste und<br />
Zweckmässigste, das man sich wohl denken kann. Aber im Begriff<br />
„Normalmensch“ schon, wie im Begriffe der Anpassung, liegt eine Beschränkung<br />
auf das Durchschnittliche, die nur dem als eine wünschenswerte Verbesserung<br />
vorkommt, der sowieso schon Mühe hat, mit der gewöhnlichen Welt fertig zu<br />
werden, der z. B. infolge seiner Neurose unfähig ist, eine normale Existenz zu<br />
gründen. Der „Normalmensch“ ist das ideale Ziel für die Erfolglosen, für alle<br />
die, die noch unterhalb des allgemeinen Anpassungsniveaus stehen. Für<br />
Menschen aber, die weit mehr können als der Durchschnittsmensch, Menschen,<br />
denen es nie schwer fiel, Erfolge zu erreichen und mehr als genügende Leistungen<br />
hervorzubringen, für solche ist die Idee oder der moralische Zwang, nichts als<br />
normal sein zu müssen, der Inbegriff eines Prokrustesbettes, einer unerträglichen,<br />
tödlichen Langeweile, einer sterilen, hoffnungslosen Hölle. Und es gibt<br />
dementsprechend ebenso viele Neurotiker, die erkranken, weil sie bloss normal<br />
sind, wie es solche gibt, die krank sind, weil sie nicht normal werden können. Der<br />
Gedanke, dass jemand darauf verfallen könnte, erstere zur Normalität erziehen zu<br />
wollen, bedeutet für diese Menschen soviel wie ein böser Traum, denn ihre tiefste<br />
Notwendigkeit liegt in Wirklichkeit darin, ein abnormes Leben führen zu können“<br />
(JUNG, Praxis, 75, §161).<br />
Gemeinsam ist den beiden von JUNG beschriebenen Arten von Neurotikern, dass sie<br />
mit den augenblicklichen Lebensumständen offenbar nicht zufrieden sind. Im einen Fall<br />
liegt eine Unterforderung, im andern eine Überforderung vor, welche sich aus der<br />
immer von aussen aufgetragenen Forderung nach gesellschaftsspezifischer Normalität<br />
Matthyas Arter 55/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
ergibt, vom Betreffenden aber nicht geleistet werden will, respektive geleistet werden<br />
kann. Und selbst jener scheinbar Glückliche, für den das Prokrustesbett wie<br />
massgeschneidert erscheint, weil er genau so ist, wie man sich den „Normalmenschen“<br />
wünscht, würde schon bald enttäuscht, da eben auch das, was man gemeinhin unter<br />
„normal“ versteht, einem steten Wandel unterliegt, gerade weil die „Abnormalen“ durch<br />
ihr „Abnormalsein“ massiv an dem rütteln, was als „normal“ gelten kann. Diese<br />
„Normalität“ ist an das Kulturverständnis gebunden und dieses wiederum kann nicht<br />
stabil sein. RUDOLPH (in FISCHER H. 1992, 62) definiert Kultur als „Gesamtheit der<br />
Ergebnisse von Innovationen“, also täglich neu und überraschend.<br />
Daher ist die Frage nach der Normalität – so gerne man sie auch immer wieder stellt<br />
und gar zum Mass aller Dinge machen möchte – zumindest in psychotherapeutischen<br />
Belangen und aufgrund der obigen Ausführungen ausgesprochen unzweckmässig. Die<br />
von MENTZOS vertretene psychoanalytische Neurosenlehre geht denn auch deutlich in<br />
eine andere Richtung:<br />
“Eine der Hauptthesen dieser Einführung in die psychoanalytische Neurosenlehre<br />
ist die Auffassung, dass das Neurotische nur ein (unter ungünstigen Bedingungen<br />
fast zwangsläufig) abgewandeltes »Normales“ ist; dass neurotische<br />
Abwehrvorgange, neurotische Symptome und Charaktere also zwar verfehlte,<br />
aber trotz allem oft respektable adaptive Ich-Leistungen sind. Weder die<br />
neurotisch verfestigten Konflikte noch die neurotischen Modi ihrer Verarbeitung<br />
sind ‚vom Himmel gefallen’“ (MENTZOS, 2005, 19).<br />
Nicht die Frage, wie „normal“ jemand sein kann oder sein will, steht im Zentrum des<br />
Interesses, sondern die Frage, wie erträglich präsentiert sich dem Einzelnen das<br />
Dilemma, grundsätzlich mit allen andern eins zu sein und dennoch gleichzeitig<br />
vollkommen auf sich allein gestellt seinen (unbekannten) Weg zu gehen. Das aber ist<br />
die Frage nach der vorhandenen Dilemmatoleranz.<br />
Der Starke so gut wie der Schwache ist in jeder Situation vor die nur subjektiv<br />
beantwortbare Frage gestellt, wie er sich augenblicklich verhalten soll. Damit ist jeder<br />
im höchsten Grade ambivalent. NIETZSCHE unterschlägt in seiner Betrachtung, dass<br />
der Starke auch die schwache Seite in sich trägt und umgekehrt der Schwache auch die<br />
Matthyas Arter 56/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
starke Seite in sich vorfinden kann. Im Antichrist weist NIETZSCHE anderseits aber<br />
zumindest auf die Fragwürdigkeit einer zielgerichteten Entwicklung zum Stärkeren hin:<br />
„Die Menschheit stellt nicht eine Entwicklung zum Besseren oder Stärkeren oder<br />
Höheren dar, in der Weise, wie dies heute geglaubt wird. ’Der Fortschritt’ ist<br />
bloss eine moderne Idee, das heisst eine falsche Idee“ (NIETZSCHE, Antichrist,<br />
193).<br />
Fraglich bleibt, ob ein Begriff wie ‚Menschheit’ überhaupt geeignet ist, Entwicklungen<br />
zusammenzufassen, welche zwingend divergierend und individuell sind. Natürlich ist<br />
der Entscheid des Einzelnen zur lebensbejahenden Variante unbestritten, unklar ist aber<br />
immer, welches diese ist. Zwar scheint jeweils klar, wofür man kämpft, aber es bleibt<br />
nicht dabei, weil mit der Zielerreichung das Ziel dreht, wie FROMM plausibel darlegt:<br />
„Der Kampf um die Freiheit wurde von den Unterdrückten, die neue Freiheiten<br />
beanspruchten, gegen jene ausgefochten, die Privilegien zu verteidigen hatten.<br />
Immer wenn eine Klasse um ihre eigene Befreiung kämpfte, so tat sie das in dem<br />
Glauben, für die menschliche Freiheit als solche zu kämpfen, so dass sie an ein<br />
Ideal, an die Sehnsucht nach Freiheit bei allen Unterdrückten appellieren konnte.<br />
In diesem langen und praktisch noch immer andauernden Kampf um die Freiheit<br />
liefen jedoch Klassen, die gegen die Unterdrückung gekämpft hatten, in einem<br />
gewissen Stadium zu den Feinden der Freiheit über, nämlich dann, wenn der Sieg<br />
errungen war und es galt, neue Privilegien zu verteidigen“ (FROMM, Freiheit,<br />
9).<br />
5.3. Dilemmatoleranz der Schizophrenen<br />
BLEULER, der sich zeitlebens intensiv mit schizophrenen Menschen auseinandersetzte,<br />
auf welche im Hinblick auf das Verständnis von Dilemmatoleranz ein besonderes<br />
Augenmerk gelegt werden soll, fand in diesem Sammelsurium von Dissonanzen,<br />
respektive Gegensätzlichkeit und Zwiespältigkeit sogar die wesentliche Grundlage für<br />
die allgemeine Gefährdung der Persönlichkeitsentwicklung:<br />
„Zwiespalt, Zerrissenheit, Ambitendenzen in der Lebenserfahrung des<br />
Schizophrenen verhindern die Entwicklung einer starken, einheitlichen<br />
Persönlichkeit. Sie verunmöglichen eine einheitliche, persönliche Haltung im<br />
Matthyas Arter 57/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
Leben, die Bildung des Willens und der Tatkraft, die auf eigene Behauptung im<br />
Leben zielen, und die Anpassung an die harten Anforderungen der Umwelt“<br />
(BLEULER M. a, 607).<br />
Schon diese kurze Schilderung von BLEULER legt nahe, das Qualitätskriterium einer<br />
Psyche in dem zu suchen, was er selbst als „Überstieg“ bezeichnet. Gemeint ist damit,<br />
dass der Erkrankende die Konfrontation seines psychischen Lebens mit der<br />
grundsätzlich wahrnehmbaren Realität in massgebenden Belangen aufgrund der nicht<br />
mehr zu leistenden Dilemmatoleranz völlig aufgibt, also dann, wenn das Ringen um<br />
Einheit, respektive Harmonisierung der inneren Welt als Fundament für Ich-Illusion und<br />
Selbstverständnis sowie die notwendige Anpassung an die äussere Welt zu anstrengend<br />
und schmerzhaft und entsprechend aufgegeben wird. Man könnte dies auch als<br />
Ausklinken aus Konflikt- und Ambivalenzgefühlen oder eben Abspalten von nicht<br />
länger Zusammenfügbarem bezeichnen. Eine psychische Wucherung, ein psychisches<br />
Krebsgeschwür, welches sich nicht länger um die nach aussen gerichtete Funktionalität<br />
kümmert, weil dieses Ziel aufgrund der herrschenden Verhältnisse offenbar für nicht<br />
mehr erreichbar, nicht mehr erträglich, ja als ichzerstörend erlebt wird.<br />
Dieser kurze Exkurs in die Pathologie der Schizophrenie ist hilfreich, weil insbesondere<br />
BLEULER aufgrund seiner jahrzehntelangen Erfahrung mit Schizophrenen diesen einen<br />
Normalstatus attestiert, welcher lediglich durch den „Überstieg“ pathologisch wird:<br />
„Den Schizophrenen sehen wir als einen von uns, der sich im gleichen Kampfe<br />
um ein Ich, um ein persönliches Dasein, den wir alle führen, erschöpft ergeben<br />
hat und die innere Widersprüchlichkeit der Wirklichkeit nicht mehr anpasst“.<br />
(BLEULER M. b, 149).<br />
Die innerlich als wahrhaftig verstandene psychische Welt wird nurmehr mangelhaft<br />
oder überhaupt nicht mehr den äusseren Eindrücken entsprechend angepasst, so dass<br />
Selbstverständnis und die nach aussen wahrnehmbare Persona (Maske) im Sinne von<br />
JUNG total auseinander brechen. Psychische Energie entzieht sich dadurch dem<br />
Bewusstsein und steuert unkontrolliert, respektive unbewusst Komplexe an im Sinne<br />
einer Kompensation, nicht zuletzt mit der Wirkung, dass ein Selbstheilungsprozess<br />
inszeniert werden kann, dessen Ziel sodann hinreichende Dilemmatoleranz zur<br />
Etablierung eines überlebenstauglichen Selbstverständnisses wäre.<br />
Matthyas Arter 58/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
JUNG als zentrierter Wanderer auf der Scheide zwischen Bewusstem und Unbewusstem<br />
formulierte dies an verschiedenen Stellen recht eindrücklich 19 . Damit aber die Basis der<br />
Dilemmatoleranz auf ein verlässliches Fundament gestellt werden kann, muss genau<br />
dieses Hin- und Hergerissensein, in passender Form verstanden werden. Es fällt nicht<br />
schwer, in EUGEN BLEULERS (dem Vater von M. BLEULER) Begriff der<br />
Ambivalenz den tragenden Grund zu finden:<br />
„Es ist, wie wenn ihre Person zwischen den beiden zusammengehörigen<br />
Gedanken einen Riss hätte. Sie betont die Idee der Entlassung mit zweierlei<br />
Gefühlen; einerseits möchte sie gern wieder ihr eigener Meister sein; anderseits<br />
weiss sie sich in der Anstalt vor allen Schwierigkeiten des Lebens geschützt. Der<br />
Gesunde würde nun in bewusster Überlegung oder instinktiv die Vorteile und<br />
Nachteile gegeneinander abwägen und dann in der Richtung handeln, wo nach<br />
seiner subjektiven Wertung die Unannehmlichkeiten am geringsten sind und das<br />
Angenehme am grössten ist. Die gespaltene Psyche der Kranken aber führt Buch<br />
über Aktiven und Passiven, vermag aber die beiden Wertungsreihen nicht zu einer<br />
einheitlichen Bilanz zu verdichten.“ (BLEULER E., 85).<br />
Die Ambivalenz, die Gleichwertigkeit zweier gegensätzlicher Kräfte, ist entsprechend<br />
naturgemäss gegeben und durch Abwägen von Vor- und Nachteilen (aus aktueller,<br />
selbstverständlich subjektiver Sicht) zu lösen, indem der einen Stossrichtung der<br />
Vorzug gegeben wird. Wenn man mit MENTZOS in seinem Polaritätsmodell 20 von<br />
zwei Grundbedürfnissen des Menschen ausgeht, nämlich dem nach Nähe und Bindung<br />
einerseits und dem nach Freiheit und Autonomie andrerseits, dann wird deutlich, dass es<br />
19 „Hier tritt nun aber ein heilsamer kompensierender Effekt hervor, den ich immer wieder wie ein<br />
Wunder bestaunen muss. Gegenüber der gefährlichen Auflösungstendenz erhebt sich aus demselben<br />
kollektiven Unbewussten eine Gegenwirkung, in der Form eines durch eindeutige Symbole<br />
gekennzeichneten Zentrierungsvorganges. Dieser Prozess schafft nichts Geringeres als ein neues<br />
Persönlichkeitszentrum, welches zunächst durch Symbole als dem Ich überlegen gekennzeichnet ist und<br />
sich später empirisch auch als überlegen erweist. Man kann es daher nicht subsumieren, sondern es muss<br />
letzterem in der Bewertung superordiniert werden. Auch kann man ihm den Namen Ich nicht mehr geben,<br />
weshalb ich es als Selbst bezeichnet habe. Das Erfahren und Erleben dieses Selbst ist das vornehmste Ziel<br />
des Yoga, weshalb wir auch gut daran tun, uns für die Psychologie des Selbst in den Schätzen des<br />
indischen Wissens umzutun. Die Erfahrung des Selbst hat, wie bei uns, so auch in Indien mit<br />
Intellektualismus nichts zu tun, sondern sie ist ein vitales und von Grund auf verwandelndes Geschehen.<br />
Den Prozess, der zu dieser Erfahrung führt, habe ich Individuationsprozess benannt. (JUNG, Praxis, 108,<br />
§219)<br />
20 Stavros Mentzos, Psychotherapie in der Behandlung von chronisch schizophrenen Patienten,<br />
Psychotherapie im Dialog, September 2003, S.223- 229 und ders.(2003) Psychodynamik und<br />
Psychotherapie schizoaffektiver Psychosen, Vortrag<br />
Matthyas Arter 59/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
einen Zusammenhang zwischen beeinträchtigter Autonomieentwicklung,<br />
Verschmelzungstendenzen und destruktivem Verhalten gibt, indem es nicht gelingt,<br />
eine für das Individuum konstruktive Entscheidung zu treffen. Unter diesem<br />
Blickwinkel leuchtet es auch ein, dass sich Pathologien wie Sadismus, oder<br />
Masochismus quasi logisch ergeben, wenn die notwendige Dilemmatoleranz nicht<br />
generiert werden kann und sich der betreffende in ein Extrem der beiden Möglichkeiten<br />
treiben lässt, indem die Aufrechterhaltung des labilen Gleichgewichts der Ambivalenz<br />
durch Resignation statt moderate Adaptation der Wertvorstellungen entschieden wird.<br />
Wie E. BLEULER weiter ausführt, ist diese Fähigkeit der Anpassung an die äusseren<br />
Umstände durch Umbildung des inneren Weltbildes bei schizophrenen Patienten in<br />
hohem Masse nicht oder nicht mehr gegeben. Es ist die Unmöglichkeit, ein<br />
Wertesystem derart auszugestalten, dass trotz Widersprüchlichkeiten der einen<br />
Handlungsmöglichkeit oder Denkart der Vorzug gegeben werden kann. Die Ambivalenz<br />
ist in diesem Zusammenhang mit dem Dilemma dann synonym zu setzen, wenn sich aus<br />
dem Entscheid für das eine erhebliche Nachteile aus der Sicht für das andere ergeben<br />
und damit die selbstgemässe Entscheidung verunmöglichen. Dilemmatoleranz zeichnet<br />
sich entsprechend dadurch aus, dass ein Wertesystem gebildet, respektive herbei<br />
gezogen werden kann, welches die praktische Beantwortung der grundsätzlich<br />
unlösbaren Problematik (für Dilemmata gibt es definitionsgemäss keine grundsätzliche<br />
Lösungen) für den Augenblick auf (für das Subjekt) erträgliche Art und Weise erlaubt.<br />
Die Ambivalenz ist laut E. BLEULER und auch für jeden von uns erfahrbar<br />
allgegenwärtig, wie er anschaulich darstellte. 21 Der Umstand, dass es einer<br />
intellektuellen Überformung bedarf, um die Ambivalenz auflösen zu können, erklärt<br />
denn auch nebenbei, dass die Schizophrenie vorgängig als Dementia praecox, also<br />
vorzeitige Verblödung bezeichnet wurde. In der Tat ist der betreffende Mensch „zu<br />
blöde“ um sich für eine von zwei sich widersprechenden Regungen selbstgemäss zu<br />
entscheiden.<br />
21 Die gewöhnliche Wurzel ambivalenter Gefühlsregungen ist indessen entweder das Vorhandensein<br />
verschiedenwertiger Eigenschaften oder verschiedener Beziehungen beim nämlichen Dinge. Die Rosen<br />
haben ihre Dornen, und die Dornen haben ihren Nutzen. Man hätte gern warmes und trockenes Wetter für<br />
seinen Rheumatismus; im Hinblick aber auf den Gemüsegarten wünscht man Regen. Am wichtigsten ist<br />
das Bestehen dieser zwei Seiten im Verhältnis von Mann und Frau. Schon die Ehe als solche ist nicht<br />
ohne Schatten; man gibt seine Freiheit auf, seine ökonomische Unabhängigkeit, seine Freunde. Die<br />
speziellen persönlichen Verhältnisse sind auch bei der grössten Verliebtheit nie oder nur vorübergehend<br />
mit ausschließlich positiven Gefühlen betont. (BLEULER E., 87)<br />
Matthyas Arter 60/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
Es fehlt das augenblicklich kohärente Selbst- und Weltbild mit richtungsbestimmenden<br />
Wertigkeiten. Lachen und Weinen, Liebe und Hass oder auch Bleiben und Gehen<br />
gleichzeitig sind zwar logisch absurd, aber möglich und sodann nicht zu bewältigen.<br />
Bemerkenswert ist indes, dass die Ambivalenz aber auch dann nicht bewältigt werden<br />
kann, wenn ganz im Gegenteil eine grossartige intellektuelle Verarbeitungskapazität zur<br />
Verfügung steht. Diese führt lediglich zu einer unendlichen Abwägung von Vor- und<br />
Nachteilen mit entsprechender Hinterfragung der gerade geltenden Wertigkeiten, so<br />
dass selbst oder gerade bei höchstem Differenzierungsgrad doch keine innerpsychische<br />
Entscheidung mehr zustande kommt, indem die Konsequenzen, nämlich das Aushalten<br />
der damit stets provozierten Spannungen als zu gravierend empfunden und damit als zu<br />
grosses Risiko vermieden wird, womit eigenständige Entscheidungen ebenfalls<br />
erschwert werden und der Betreffende durch Verharren zum Spielball äusserer Kräfte<br />
wird, zumindest bis der Leidensdruck dieser Situation ebenfalls unerträglich wird.<br />
Die Kompetenz, mit Ambivalenz, respektive Dilemmata, umzugehen, kann in erster<br />
Lesung also darin bestehen, dass der Einzelne eben in der Lage ist, dank seinem<br />
Weltverständnis gegenläufige Motivationen so zu gewichten, dass eine eindeutige<br />
emotionale Prägung als Resultat die Ambivalenz überwindbar macht. In zweiter Lesung<br />
beinhaltet diese Kompetenz aber auch das Erfordernis, in für diesen spezifischen<br />
Einzelmenschen typischen Lebensproblemen ein taugliches Instrumentarium bereit zu<br />
halten, um mit den alltäglichen Herausforderungen fertig zu werden. Es geht<br />
insbesondere darum, das eigene Ich-Verständnis den Erfordernissen der Umwelt<br />
anzupassen, wie dies MEAD 22 im engeren Sinne ausführte und damit einen<br />
wesentlichen Aspekt der Dilemmatoleranz, nämlich die „Ichbildung“ durch das<br />
Annehmen von Fremdem (was natürlich ein Dilemma ist) zu verbessern. Für MEAD ist<br />
das (fremde) „ICH" die Vorgabe auf die das "ICH" reagieren muss. Diese<br />
stattgefundene Reaktion fliesst sodann in das neue "ICH" als Erinnerung und Erfahrung<br />
mit ein. Mead sagt, dass es erst durch das Vorhandensein beider Phasen der Identität<br />
möglich ist, bewusste Verantwortung zu übernehmen und neue Erfahrungen zu machen,<br />
also – neu formuliert - die Dilemmatoleranz anzupassen.<br />
22 Seite 221, Mead G.H<br />
Matthyas Arter 61/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
5.3.1. Postulat der innerpsychischen Normalität als adäquate<br />
Dilemmatoleranz<br />
Die weitreichende Konsequenz aus dieser Herleitung liegt nun darin, dass es für das<br />
Verständnis von Dilemmatoleranz nicht vernünftig ist, so etwas wie eine<br />
innerpsychische Normalität zu postulieren. Der kompetente Umgang des Einzelnen mit<br />
seiner Ambivalenz darf nicht losgelöst von seinen äusseren Möglichkeiten, ein<br />
taugliches Weltbild am Vorbild anderer aufgrund seiner „Instinkte“ zu bilden, betrachtet<br />
werden. Es kann also durchaus sein, dass innerpsychisch betrachtet ein Fall von<br />
erstaunlicher Dilemmatoleranz im Sinne der ersten Lesung vorliegt, der Betreffende<br />
aber doch nicht in der Lage ist, die an ihn gestellten Herausforderungen zu bewältigen,<br />
weil die tauglichen Orientierungsmöglichkeiten nicht vorhanden waren. BLEULERS<br />
„Riss“, respektive die Unmöglichkeit zusammengehörige Gedanken (von aussen<br />
betrachtet) zusammen zu bringen, kann sowohl die Folge des einen als auch des andern<br />
sein.<br />
Ob nun aber ein Defekt „genetisch bedingt“ oder durch „die Umwelt“ provoziert wurde,<br />
ist von untergeordneter Bedeutung, wenn für Menschen nicht Leistungsziele (die<br />
evolutionspsychologisch betrachtet immer absurd sind) sondern hinreichende<br />
Dilemmatoleranz im beschriebenen Sinne gefordert wird. Es ist immerhin durchaus<br />
möglich, dass der empirische Nachweis der Veränderung des genetischen Codes<br />
gelingen wird und so mehr Licht in die Frage kommt, welche Eigenschaften und<br />
Verhaltensweisen angeboren oder erlernt und möglicherweise genetisch abgespeichert<br />
werden, so dass eine raschere Adaptation an veränderte Bedingungen möglich ist, als<br />
mit dem darwinistischen Selektionsprinzip über Mutation und Vererbung allein erklärt<br />
werden kann. Erste empirisch fundierte Erklärungsansätze, welche über spontane<br />
Mutationen der DNA hinaus gehen, also auch Veränderungen im zellulären Apparat ,<br />
der das Genom reguliert, begründen, gibt es heute, so dass auch von „erworbenen“<br />
Eigenschaften infolge Umwelteinflüssen ausgegangen werden kann, wie dies bereits im<br />
19. Jahrhundert der Biologe LAMARCK 23 theoriebasiert tat.<br />
23 In seinem Werk Philosophie Zoologique (1809) vertrat Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet,<br />
Chevalier de Lamarck die Ansicht, dass Umwelteinflüsse das Erbgut von Lebewesen verändern können.<br />
Matthyas Arter 62/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
5.3.2. Dilemmatoleranz als Erklärung beider Extrempositionen<br />
Zu unterscheiden ist zudem das Mass der Dilemmatoleranz bezogen auf die<br />
Konfliktbewältigung. Ist die Dilemmatoleranz sehr gering, wird der Betreffende<br />
gezwungen sein, Konflikten so gut es geht auszuweichen. Es ist dies grundsätzlich die<br />
schizophrene Position, indem schon gar nicht versucht wird, unter einen Hut zu bringen,<br />
was unter einen Hut gehören würde. Umgekehrt ist eine relativ grosse Dilemmatoleranz<br />
durchaus kein Garant für erfolgreiche Konfliktbewältigung, indem es dem Betreffenden<br />
gelingt, den Konflikt als solchen überhaupt auszublenden, ganz einfach dadurch, dass<br />
die vorhandene Spannung in erster Linie verdrängt wird. Hierbei handelt es sich um die<br />
manisch-depressive Position, indem sowohl in der manischen als auch in der<br />
depressiven Phase die mit der gerade aktuellen Lebensweise verbundenen Defizite<br />
schlicht ausser Acht gelassen werden.<br />
Korrekterweise müsste also die Frage nach der angemessenen Dilemmatoleranz gestellt<br />
werden. Dies scheint denn auch die weiterführende Frage im therapeutischen Prozess zu<br />
sein. Jede psychodynamische Betrachtungsweise führt zumindest indirekt auf eben<br />
diese Schlüsselfrage, nämlich wo liegen Spannungen vor, die nicht ausgehalten werden<br />
und doch bewältigt werden müssten, wenn der Betroffene sein Leiden erkennt, jedoch<br />
nicht weiss, wie er sich helfen soll.<br />
Matthyas Arter 63/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
6. Bruno K<br />
Aufgrund von wöchentlichen Sitzungen über nunmehr zweieinhalb Jahre mit Bruno K.<br />
haben sich u.a. die nachfolgend aufgezeichneten Feststellungen ergeben, welche die<br />
Basis für eine kritische Würdigung in Bezug auf seine Dilemmatoleranz ergeben sollen.<br />
Die jeweils eine Stunde dauernde Sitzung fand zunächst unter dem Arbeitstitel<br />
„Gespräch unter Studenten“ statt. Schon relativ bald suggerierte Bruno K, er würde<br />
durch mich gezwungen, an diesen Gesprächen teilzunehmen. Seither gilt als eiserne<br />
Regel, dass Bruno K. nur kommt, wenn er auf die unverzichtbare Frage, ob er nächste<br />
Woche kommen wolle, mit Ja antwortet und den neuen Termin in seiner Agenda<br />
einträgt. Zwei Mal ist es bis heute vorgekommen, dass Bruno K. sichtlich erbost das<br />
Treffen verliess, ohne einen Termin vereinbart zu haben. Er meldete sich einen Tag vor<br />
Wochenablauf per SMS, ob die Sitzung nun stattfinde oder nicht. Bruno K. lebt in einer<br />
Studentenwohngemeinschaft mit zwei Kollegen, wobei der menschliche Kontakt<br />
untereinander auf ein absolutes Minimum beschränkt zu sein scheint. Sein Interesse an<br />
Menschen ist sehr begrenzt. Ausser mit seiner engeren Familie pflegt er keine<br />
regelmässigen Kontakte. Die wöchentliche Sitzung und – nach Unterbrüchen – das<br />
wöchentliche Karatetraining, wo allerdings „trainiert und nicht gesprochen wird“<br />
(Bruno K.), bilden den einzigen direkten Bezug zur Aussenwelt. Während den sieben<br />
Semestern Studium an der Universität hat er nicht einen einzigen Kontakt geknüpft.<br />
Seinen Lebenswandel hat er so menschenfern wie möglich gestaltet. Er drehte den<br />
Tag/Nacht-Rhythmus praktisch vollständig, studierte in der Regel pro Tag eine halbe<br />
bis maximal zwei, drei Stunden und konsumierte ansonsten Fernsehen oder spielte<br />
Computergames. Seine extreme Lethargie gab Anlass zu einer medizinischen<br />
Abklärung, wobei der neurologische Befund keinerlei Auffälligkeiten zu Tage förderte.<br />
Der Arzt verschrieb eine schwache Dosierung Cipralex (10mg, später 20mg pro Tag).<br />
Das Medikament wurde zwischenzeitlich wieder abgesetzt. Bruno K wirkt heute viel<br />
aufgeweckter, an seiner Grundeinstellung, jedem erdenklichen Risiko aus dem Weg zu<br />
gehen, respektive die erforderliche Dilemmatoleranz nahe bei Null zu halten, hat sich<br />
indes kaum etwas geändert.<br />
Matthyas Arter 64/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
6.1. Umfeld, Familie<br />
Bruno K. ist das älteste von drei Kindern. Er ist heute 29 Jahre alt. Er hat eine drei Jahre<br />
jüngere Schwester und eine neun Jahre jüngere Halbschwester väterlicherseits. Der<br />
Vater ist Sudetendeutscher und wurde in einem Lager gegen Ende des zweiten<br />
Weltkrieges geboren. Die Mutter stammt aus Rom. Die Eltern lernten sich in der<br />
Schweiz kennen und leben bis heute in derselben Stadt, jedoch völlig getrennt. Kurz<br />
nach der Geburt von Bruno begann die Mutter unter Wahnvorstellungen zu leiden.<br />
Später wurde eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert. Als Bruno sechs Jahre alt<br />
war, trennten sich die Eltern. Die Mutter wurde zunächst stationär behandelt, später<br />
stabilisierte sich ihr Zustand. Sie wohnt heute selbständig und arbeitete bis zur (Früh)-<br />
Pensionierung in einer geschützten Werkstatt. Bruno besucht die Mutter jeden Samstag.<br />
Die Mutter kocht, sodann essen die beiden und sehen gemeinsam fern. Der Vater<br />
verband sich nach der Scheidung mit der Mutter des dritten Kindes, ohne jedoch zu<br />
heiraten. Die Kinder der ersten Ehe wurden indessen dem neuen Paar zugesprochen.<br />
Man lebte während zehn Jahren als fünfköpfige Familie, sodann trennte sich die Mutter<br />
des dritten Kindes und Bruno blieb mit dem Vater und seiner Schwester zurück, wobei<br />
der Vater wechselnde Partnerinnen hatte, mit welchen es laut Bruno „nie mehr zu einem<br />
wirklichen Familienleben gekommen ist“. Seine präsenteste Erinnerung an die<br />
„Familienzeit“ ist, dass es nie etwas Rechtes zu essen gegeben habe. Der Vater und die<br />
neue Gefährtin legten grossen Wert auf gesunde Ernährung, was Bruno überhaupt nicht<br />
schätzte, zumal er bis zu jenem Zeitpunkt - von der Mutter verwöhnt - praktisch nur<br />
Junk Food ass und völlig unregelmässig zu opulenten Mahlzeiten kam, immer dann,<br />
wenn es der Mutter ums Kochen war, also zuweilen auch mitten in der Nacht.<br />
6.2. Rollenverteilung<br />
Nach der Scheidung seiner Eltern kam Bruno als schwer verhaltensgestörtes Kind in<br />
den neuen Haushalt. Er konnte mit sechs Jahren nicht einmal den Sprung von der<br />
untersten Stufe einer Treppe auf den Boden wagen. Die Rolle des Sohnes, der in Sachen<br />
Mut und Talent dem Vater (Ingenieur, Berggänger und grün Alternativer) nie genügen<br />
konnte, verlegte sich auf ein Schattendasein. Die jüngere Schwester übernahm die Rolle<br />
der Rebellin schon mit zehn Jahren, was Bruno Entlastung brachte. Trotz wenigen<br />
Matthyas Arter 65/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
Freunden in der Waldorf-Schule, die er und seine Schwestern besuchten, kam es nicht<br />
wirklich zu einer Integration. Seine viel jüngere Halbschwester pflegte zwar stets eine<br />
freundschaftliche und später fürsorgliche Beziehung zu ihm, aber Geborgenheit fand er<br />
weiterhin nur bei seiner schizophrenen Mutter, nachdem diese in geschütztem Rahmen<br />
wieder psychische Stabilität erlangt hatte. Die Beziehung zur Mutter seiner<br />
Halbschwester war zeitweilig herzlich, aber nie stützend. In Brunos Herzen fand sie<br />
neben der leiblichen Mutter keinen festen Platz. Für seine fast zehn Jahre jüngere<br />
Halbschwester glaubt Bruno Vorbildcharakter zu haben, was ihn aber eher belastet, da<br />
sie ja viel intelligenter sei als er.<br />
6.3. Früheste Erinnerungen<br />
Bruno K. erinnert sich zunächst einmal an Bilder der Räume, in welcher die junge<br />
Familie lebte. An einen Apfelbaum im Garten und Möbel in der Wohnung, aber nicht<br />
an Handlungen oder Ereignisse. Einmal hätten sich die Eltern gestritten. Das wisse er<br />
noch. Das sei sehr schlimm gewesen. Er hatte Angst. Angst, dass sie sich trennen<br />
könnten. Eines Tages hätten seine Eltern einen Fernseher gekauft, da habe er sich<br />
„mega“ gefreut. Bruno war damals sechs Jahre alt.<br />
6.4. Pubertät<br />
Während der Vorpubertät muss Bruno K. zumindest von aussen betrachtet so etwas wie<br />
einen lebbaren Lebensstil gefunden haben. Er wurde als nahezu fröhliches Kind<br />
wahrgenommen und konnte sich in der Schule problemlos behaupten. In diese Zeit fällt<br />
auch die Entfaltung bemerkenswerter Talente. So zeichnete er mit Begeisterung<br />
Comicfiguren nach und konnte bald den legendären Lucky Luke in jeder erdenklichen<br />
Position verblüffend genau zeichnen. Seine musikalische Begabung wurde im Rahmen<br />
des Trompetenspiels offenbar. Vieles deutete auf eine gute Entwicklung der<br />
Persönlichkeit. Mit dem Beginn der eigentlichen Pubertät stellte sich indes eine<br />
Verunsicherung nach der andern ein. Sein Talent, Comicfiguren nachzuzeichnen, hielt<br />
er für wertlos, die Forderungen des Vaters, ein Sohn zu sein, auf den man stolz sein<br />
kann, für unerfüllbar. Die Liste der erinnerbaren Pannen ist erstaunlich lange. Als<br />
Matthyas Arter 66/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
besonders schlimm in Erinnerung ist Bruno K. der erste (und letzte) Auftritt mit seiner<br />
Trompete. Der Musiklehrer, offenbar begeistert vom Talent des jungen Künstlers,<br />
studierte mit ihm ein viel zu anspruchsvolles Stück ein, welches er sodann am Schulfest<br />
hätte auf der Bühne zum Besten geben sollen. Bruno K. stand auf der Bühne und<br />
brachte wohl Töne heraus, aber die falschen. Total beschämt verliess er die Bühne und<br />
rührte die Trompete nicht mehr an. Sehr belastend müssen auch die<br />
Schwimmbadbesuche mit dem Vater gewesen sein. Bruno konnte den Ideen des Vaters,<br />
aus ihm einen grossartigen Schwimmer zu machen, konstitutionell und aufgrund seiner<br />
minimalen Risikobereitschaft nicht folgen. In die Pubertät fallen auch die wenigen und<br />
bis heute abschliessenden Erfahrungen im Umgang mit dem anderen Geschlecht. Nach<br />
den ersten Küssen und Absagen von Mädchen, die er gerne umworben hätte, erklärte<br />
Bruno dieses Thema für sich als abgeschlossen. Zur Kompensation entwickelte er eine<br />
beträchtliche Energie, sich im Karatesport hervor zu tun. Liegestützen auf dem<br />
Handrücken bis die Hände bluteten schien ihm die adäquate Kasteiung.<br />
Die wahrscheinlich von Vater und Mutter gestützte Idee, eine akademische Laufbahn zu<br />
ergreifen, für welche die notwendige Intelligenz ohne Zweifel vorhanden wäre, gab<br />
Bruno offenbar die Motivation, die Vorbereitung auf die eidgenössische Matura mit der<br />
notwendigen Energie anzugehen. Er bestand und konnte seinen Traum, Wirtschaft zu<br />
studieren, wahr machen. Damit war er scheinbar erfolgreich über die Adoleszenz<br />
hinausgewachsen.<br />
6.5. Heutiges Umfeld<br />
Nach dem erzwungenen Abbruch des Wirtschaftsstudiums fiel Bruno in eine Krise, aus<br />
welcher er sich erst langsam erholte, als er im neu aufgenommenen Jurastudium erste<br />
Erfolge buchen konnte. Seine Belastbarkeit blieb indes derart bescheiden, dass es ihm<br />
auch im zweiten Anlauf nicht gelang, die Hürden zu nehmen, so dass er das Studium<br />
nun abbrechen musste. Zwar waren seine Leistungen fast ausreichend, was in<br />
Anbetracht seines ausgesprochen bescheidenen Arbeitseinsatzes sehr erstaunlich ist,<br />
aber ihm ist doch klar geworden, dass seine Idee, Jurist zu werden und viel Geld zu<br />
verdienen ohne viel zu riskieren, ad acta gelegt werden muss. Überraschenderweise<br />
erlebt Bruno diesen Studiumsabbruch eher als Befreiung. Allerdings ist die Angst<br />
Matthyas Arter 67/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
angesichts der Möglichkeit, das Leben nun selbst in die Hand zu nehmen viel grösser<br />
als die Lust, sich selbst zu entdecken.<br />
Immerhin ist sich Bruno K. jetzt aber bewusst geworden, dass sein Studentenleben<br />
relativiert werden muss. Er sucht – mit angezogener Handbremse – nun doch eine<br />
Anstellung, um sodann in einem Jahr eine Wirtschaftausbildung auf Hochschulniveau<br />
anzustreben. Seine Zukunftsphantasien als Ersatz für nicht gelebte Gegenwart sind<br />
dadurch etwas bescheidener geworden und zwingen doch zu Handlungen in der<br />
Gegenwart, respektive zu einer Steigerung der Dilemmatoleranz. Das ist indes für ihn<br />
mit Sicherheit ein weiter Weg.<br />
6.6. Dilemmatoleranz<br />
Bruno K. glaubt, dass er für dieses Leben bestimmt ist, das er lebt. Er glaubt, dass man<br />
gar nicht vorsichtig genug sein kann. Dass andere Menschen mehr wagen, hat mit seiner<br />
Person keinen Zusammenhang. Für ihn gilt, was MENTZOS im Zusammenhang mit<br />
einem ganz anderen Menschen vortrefflich beschreibt:<br />
„Nur gelegentlich, in Phantasien und Träumen, wird deutlich, dass er eigentlich<br />
unter dieser Selbstbeschränkung erheblich leidet, dass er die anderen um ihre<br />
Freiheit und Selbständigkeit beneidet und dass er schliesslich aufgrund dieser<br />
selbstauferlegten Frustration zunehmend aggressiver wird. Vor dieser Aggression<br />
hat er aber offenbar grosse Angst. Sie könnte ihn – sollte sie zum Ausdruck<br />
kommen -, existentiell gefährden, sie könnte auch für die ihm wichtigen Personen<br />
gefährlich werden (weil sie als ungemein stark, unbeherrschbar und destruktiv<br />
phantasiert wird). Also muss sie auch verdrängt werden. Dadurch werden aber<br />
der Druck, die Spannung und schliesslich auch die Aggressivität noch stärker.<br />
Der neurotische Circulus vitiosus ist damit geschlossen“ (MENTZOS, 2005, 137).<br />
Bruno K. sieht sich entsprechend als Menschen mit grossem Destruktionspotential. Zur<br />
Selbstverteidigung, aber auch zur Linderung der permanenten Bedrohung als Schuldiger<br />
(weil gefährlich) übt er sich in Karate.<br />
Bruno K. gesteht sich zwar ein, dass ihn manchmal das Gefühl beschleicht, schuld zu<br />
sein. Grundsätzlich sei er aber unschuldig. Und seine Lösung des Problems leuchtet ein:<br />
Matthyas Arter 68/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
„Ich habe mir abgewöhnt, mich schuldig zu fühlen“. Dies, gerade weil er als Sohn eines<br />
Deutschen, dessen Vater ein bekennender Nazi gewesen sei, sich für seine Vorfahren<br />
schämen müsste, weil sie die Juden verfolgt haben. Aber nicht nur für die Vorfahren<br />
schämt er sich, auch für den ihm überaus lästigen Sexualtrieb. „Ich zähle zu denen, die<br />
sich nicht fortpflanzen“. Leider habe er einen Sexualtrieb. Man könne wenig dagegen<br />
tun. Selbstbefriedigung verstärke das Verlangen nur, also sei es das Beste, nichts zu tun.<br />
Etwas hat im Leben von Bruno K. dennoch Bedeutung gewonnen: Sein Karatetraining.<br />
Seine Schilderungen darüber erinnern stark an die Beschreibungen von TROJE:<br />
„Heimlich nahm er als 17jähriger – in der Zeit der grössten Angst und<br />
Einsamkeit – Karate-Unterricht, um sich verteidigen zu können, um der Stärkste<br />
zu werden. Er hatte nicht viel Erfolg, aber in Gedanken konnte er tödliche Tritte<br />
austeilen, so dass er sich weniger ausgeliefert fühlte“ (TROJE in MENTZOS,<br />
2000, 173).<br />
Und weiter bemerkt TROJE dazu:<br />
„Der Konflikt, der diesen Patienten bedroht, betrifft seine psychische Existenz<br />
und seine Objekte, also die für ihn wichtigen Menschen. Er möchte wissen, wer er<br />
ist, aber er hat Angst, auf einen Niemand zu stossen, auf einen, der dadurch<br />
gekennzeichnet ist, dass er nicht wirklich der ist, den die Eltern haben wollten und<br />
lieben können. Auf der Suche nach Objekten muss er die Abhängigkeit von ihnen<br />
fürchten, denn um ihre Liebe zu bekommen, müsste er einer werden, der er nicht<br />
ist. In diesem Dilemma werden Hass oder die Freude am Erleiden (primärer<br />
Masochismus), vielleicht die intensivste Angst und jedenfalls die Wahnbildung zu<br />
Mitteln, das eigene Ich zu beschützen und doch eine Art von Beziehung zu einer<br />
Art von Objekten zu ermöglichen“ (TROJE in MENTZOS, 2000, 173).<br />
Auch wenn kein Mensch mit einem andern identisch ist, zeichnet sich hier eine<br />
bemerkenswerte Parallele ab. Bruno K. hat aufgrund der jüngsten Entwicklung, nämlich<br />
dem erzwungenen Abbruch des Studiums, zumindest die Chance, seinen Weg<br />
einzuschlagen und die unerfüllten Vorstellungen der Eltern auf die Seite zu schieben,<br />
sachte in Erwägung gezogen. Seine diesbezügliche Bereitschaft ist indes klein. Es ist<br />
ihm selbstredend nicht möglich, plötzlich die Verantwortung für sich selbst zu<br />
übernehmen: „Wenn es hart auf hart geht, sage ich, ich bin sabotiert worden!“<br />
Matthyas Arter 69/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
Es ist unschwer erkennbar, dass jede Art von Konflikt und damit das leise<br />
Schuldeingeständnis sowie die Bereitschaft, die Verantwortung zu übernehmen, von<br />
sich geschoben wird. Bruno K. hat selbst die Tatsache, dass er sein möchte, aber nicht<br />
sein kann, weitgehend auf die Seite geschoben und versucht mit einer Dilemmatoleranz<br />
von praktisch Null das Leben regelrecht hinter sich zu bringen.<br />
„Es ist masochistische Lust, die ihn vor Hass und Neid bewahrt. Gefühle, die aber<br />
während Sitzungen immer wieder ans Licht kommen. (Die masochistische Lust ist die<br />
Lösung für die verweigerte Entwicklung von Dilemmatoleranz, Anm. d. V.). Diese Art<br />
der Wunscherfüllung kann er sich selbst verschaffen“, analysiert TROJE den<br />
Sachverhalt, der auch für Bruno K. ins Schwarze trifft. Weiter behilft sich Bruno K.<br />
dort mit dem manisch-depressiven Verarbeitungsmodus wie ihn ELZER beschreibt, wo<br />
sich das Dilemma selbst bei bestmöglicher Verdrängung nicht wirksam leugnen lässt.<br />
ELZER:<br />
„Die Askese als zwanghafter Versuch, auf Triebbefriedigung zu verzichten, und<br />
die Intellektualisierung, wobei Triebwünsche grüblerisch auf komplexe Themen<br />
wie den Sinn des Lebens, Gott und die Welt, die Ungerechtigkeit verschoben<br />
werden. Darin steckt ein manisch-depressiver Verarbeitungsmodus“ (ELZER in<br />
MENTZOS, 2000, 114).<br />
Dieser Modus entspricht einer zu ausgeprägten Dilemmatoleranz, was für Bruno K.<br />
nicht passt, da er ein Meister in der Vermeidung von Spannung ist. Aber gerade deshalb<br />
ist es nur logisch, dass er die Dilemmata dort mit grosser Toleranz verarbeitet, wo dies<br />
wenig Wirkung (nach aussen) nach sich zieht. Interessant und bei Bruno K zu<br />
beobachten ist dabei, dass dieser manisch-depressive Verarbeitungsmodus sozusagen<br />
durch die Hintertüre in die schizophrene Position überführt, indem nämlich durch den<br />
faktischen Wegfall von Ich-Illusion und Selbstverständnis die Flucht in den inneren<br />
Wahn ergriffen werden muss, sei es durch Allmachtsideen oder paranoide Verfolgungsrespektive<br />
Überwachungsideen, oder mit den Worten von Bruno die permanent<br />
drohende „Sabotage“.<br />
Bruno K. lernte gezwungenermassen, “auf das Objekt emotional total zu verzichten“<br />
(wie MENTZOS sagen würde), „gleichzeitig aber zu versuchen, es instrumental zu<br />
benutzen“. „Wenn Mann und Frau Sex haben, dann weil sie das will und er das will,<br />
Matthyas Arter 70/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
mehr steckt da nicht dahinter“, glaubt Bruno, der solche Begegnungen lediglich<br />
aufgrund von Pornofilmen aus dem Internet kennt. MENTZOS weiter:<br />
Schliesslich vermeidet er habituell den emotionalen Kontakt und hütet sich davor,<br />
das Objekt emotional zu besetzen (um nicht erneut durch das antizipierte<br />
Abgestossen- und Verlassenwerden traumatisiert zu werden)“ (MENTZOS, 2000,<br />
14).<br />
Daraus entstehen nach MENTZOS je nach der besonderen, inneren und äusseren<br />
Konstellationen autistische, egopathische, so genannte gefühlskalte oder<br />
psychopathische Persönlichkeiten.<br />
Bruno K vereinigt wenig überraschend von allen diesen Ausprägungen etwas in sich.<br />
Bruno K. könnte im ersten Umgang mit dem weiblichen Geschlecht das erlebt haben,<br />
was ELZER so beschreibt:<br />
„Ich verstand Herrn R. so, dass er entsprechend seiner psychischen und<br />
körperlichen Entwicklung, das heisst unter dem inneren Druck seines sexuell<br />
reifen Körpers, sich zum ersten Mal in ein Objekt ausserhalb seiner Familie<br />
verliebte, aber in diesem Objekt unbewusst sein primäres mütterliches Objekt<br />
meinte, also mit inzestuösen und symbiotischen Wünschen konfrontiert wurde.<br />
Eine Kompromisslösung, indem er sich in ein schwesterliches Objekt (assoziiert<br />
durch die Namensgleichheit) verliebte, befreite ihn nicht von dem Inzest. Die<br />
Folge war eine schwere Regression seines Ich mit Störungen seiner<br />
Wahrnehmungs- und Denkfunktionen mit narzisstischem Rückzug von den<br />
Objekten“ (ELZER in MENTZOS, 2000, 118).<br />
Für Bruno ist das Thema Frauen abgeschlossen. Einstweilen, ist zu hoffen. Aber die<br />
Möglichkeiten, seine Dilemmatoleranz auf der einen Seite auszuweiten und auf der<br />
andern Seite einzuengen, erfordern leicht erkennbar einen ausgesprochen langen<br />
Prozess der Vertrauensbildung.<br />
Matthyas Arter 71/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
7. Carla S.<br />
7.1. Umfeld, Familie<br />
Carla S. wuchs zusammen mit ihrem zweieinhalb Jahre älteren Bruder in einer<br />
norditalienischen Grossstadt auf. Ihre Eltern leben heute noch dort zusammen. Der<br />
Vater ist 67, die Mutter ebenfalls, der Bruder 38, sie selbst 35.<br />
Ihr Bruder ist verheiratet und hat einen Sohn. Sie selbst ist ledig. Der Vater leidet<br />
rezidivierend unter depressiven Episoden abgelöst von kurzen hypomanischen Phasen.<br />
Auf die Frage, was ihre Mutter mit 20 werden wollte, antwortete Carla S. spontan<br />
„Märtyrerin“. Ihre Mutter sei auch eine Märtyrerin.<br />
Aktuell kann sie diese Rolle ausleben, indem ihr Mann zu schwach ist, um<br />
Lebensfreude zu entwickeln und sie sich entsprechend opfern muss, um den Haushalt<br />
unter Kontrolle zu behalten. Neu hinzugekommen ist die Tatsache, dass ihr Sohn schon<br />
seit längerem ein Alkoholproblem dadurch löst, dass er mit regelmässigem<br />
Kokainkonsum die Folgen des Alkoholabusus kompensiert. Der Verlust der<br />
Arbeitsstelle etwa zwei Jahre früher, verschärfte die Suchtabhängigkeit deutlich.<br />
Dennoch ist es ihm gelungen, wieder eine Stelle zu finden. Die drohende Scheidung von<br />
seiner Frau, die eben bezogene, neue Eigentumswohnung und die Anforderungen im<br />
Job, verunmöglichen eine Änderung seines Suchtverhaltens. Der Aufenthalt in einer<br />
Klinik war für ihn keine Option, weil er als Folge davon seine Entlassung aus der<br />
Arbeitsstelle befürchtete. Es war ihm erstaunlicherweise gelungen, den Missbrauch stets<br />
geheim zu halten (zwischenzeitlich ging der Bruder in die Klinik und begann mit einer<br />
kombinierten Intensivtherapie. Er wurde krankgeschrieben und bleibt vorerst für<br />
Monate in der Klinik. Wie es danach weitergeht ist noch offen).<br />
Carla S. ist die unbestritten Erfolgreiche in der Familie. Sie hat studiert, doktorierte und<br />
trat sodann Stellen im Ausland an. Sie hat sich während der letzten drei Jahre einen<br />
Platz an der Sonne im Zürcher Finanzumfeld gesichert. Sie überzeugt durch<br />
zuverlässige Leistungen und sprühende Intelligenz.<br />
Matthyas Arter 72/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
Ihr lang gehegter Kinderwunsch, der bis heute nicht in Erfüllung ging, da es ihr nicht<br />
möglich war, den „richtigen“ Mann zu finden, legte sie vor rund einem halben Jahr<br />
(einstweilen) auf Eis.<br />
Die jüngsten Entwicklungen der familiären Probleme rund um ihren Bruder stellten für<br />
sie eine schwere Belastungsprobe dar. Für sie ist unbestritten, dass sie für die Familie da<br />
sein muss, wenn diese sie braucht. Auch ein Abbrechen der erfolgreich aufgebauten<br />
Zelte in Zürich ist nicht auszuschliessen, wenn die Rückkehr nach Norditalien<br />
erforderlich sein sollte.<br />
7.2. Rollenverteilung<br />
Schon aus den kurz skizzierten aktuellen Familienzusammenhängen ist relativ klar<br />
ersichtlich, dass sich die dominierende Rolle der Frau, respektive Mutter unter den<br />
Geschwistern als verblüffend exakte Kopie wieder findet.<br />
Die Unabhängigkeit von Carla S., welche sich erfolgreich abseits vom Elternhaus eine<br />
funktionierende (um nicht zu sagen perfekte) Welt erschaffen hat, ist nur eine<br />
scheinbare. Auch wenn sie sich gegenüber ihrer märtyrerhaften Mutter in dem Sinne<br />
deutlich abzugrenzen versucht, dass sie nicht bereit ist, ohne Wenn und Aber in die<br />
Opferrolle zu schlüpfen und ihr Verhalten eher durch einen negativen Mutterkomplex<br />
geprägt scheint, kann sie doch nicht verhindern, dass sie - sollten alle Stricke reissen<br />
respektive sollte ihre Mutter nicht mehr in der Lage sein, alles unter Kontrolle zu halten<br />
- umgehend zurückkehren muss, um das Steuer der Familie selbst in die Hand zu<br />
nehmen.<br />
Ihr Bruder dagegen ist, möglicherweise aufgrund der sprühenden Intelligenz seiner<br />
Schwester, ganz bestimmt aber auch aufgrund der mangelnden respektive unglücklichen<br />
Leistungsmotivation durch den Vater, allmählich in die Rolle des (wie schon sein Vater)<br />
schutzbedürftigen Versagers geschlüpft.<br />
Die vier Familienmitglieder haben aufgrund der äusseren Umstände und der inneren<br />
Disposition ein ebenso stabiles wie unglückliches Bewertungsgefüge geschaffen, in<br />
welchem niemand mit sich selbst zufrieden sein kann, und doch jeder an Forderungen<br />
gegenüber sich selbst festhalten muss, wenngleich diese nicht erfüllbar sind.<br />
Matthyas Arter 73/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
Das Grunddilemma tritt entsprechend deutlich zutage: Der Vater ist eher in die<br />
Mutterrolle gedrängt, vermag diese aber nicht auszufüllen und verzweifelt entsprechend<br />
daran. Die Mutter sieht sich (vermutlich) nicht ungern als Opfer der Situation und erlebt<br />
das damit verbundene Leiden als Genugtuung. Sohn und Tochter möchten beide nicht<br />
den Fehler der Eltern machen, kommen aber offensichtlich nicht aus dem wenig<br />
geeigneten Wertgefüge der Familie heraus. Dem Sohn ist es zwar gelungen, das zu<br />
realisieren, was Carla S. oder eben die Tochter am Sehnlichsten wünschte, nämlich eine<br />
Familie zu gründen. Carla S. dagegen ist das gelungen, was der sehnlichste Wunsch des<br />
Sohnes ist, nämlich in Studium und Beruf erfolgreich seinen Mann zu stehen. Carla S.<br />
erwarb bereits vor dem dreissigsten Geburtstag eine Eigentumswohnung in ihrer<br />
Heimatstadt, welche sie sich leisten konnte. Sie schuf sich damit eine selbständige Basis<br />
unabhängig von ihren Eltern, welche ihr jederzeit zur Verfügung steht. Nicht ohne gute<br />
Argumente, denn sie glaubt, dass sie es keinesfalls länger als zwei Stunden mit ihren<br />
Eltern im selben Raum aushalten würde.<br />
Ihr Bruder erwarb jetzt eine luxuriöse Eigentumswohnung für „seine“ Familie, nicht<br />
weil er es sich leisten kann, sondern weil er das Gefühl hat, dies müsste doch möglich<br />
sein. Schon nach kurzer Zeit stellte ihn jedoch seine Frau vor die Haustüre, so dass er<br />
vorübergehend zu den Eltern ziehen musste.<br />
Weder die Mutter noch der Vater können wirklich verstehen, warum die Tochter das<br />
erfüllt, was der Sohn leisten sollte und der Sohn dort (zumindest nach den äusseren<br />
Gegebenheiten und nicht ohne Schwierigkeiten) reüssierte, wo man die Tochter gerne<br />
glücklich sähe, in der Brutpflege.<br />
7.3. Früheste Erinnerungen<br />
Auf die Frage, welches ihre frühesten Kindheitserinnerungen seien, differenziert Carla<br />
S., ob diese an Bilder gebunden sind, die man immer wieder sehen konnte, oder ob sie<br />
tatsächlich im Kopf gespeichert geblieben sind.<br />
Die erste, nicht bildgestützte Erinnerung, die sie erwähnt, ist ihr Spitalaufenthalt, den<br />
sie noch vor dem Kindergarten, wahrscheinlich mit vier bis fünf Jahren erlebte, da ihr<br />
die Mandeln herausgeschnitten wurden. Sie erinnert sich daran, dass man sie vor der<br />
Matthyas Arter 74/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
Operation darüber informierte, dass es hernach, wenn sie wieder aufwache, Eis geben<br />
würde. Darauf freute sie sich und genoss es in der Folge sehr.<br />
Eine zweite frühe Erinnerung stellen die wiederholten Fahrten mit der Mutter in einem<br />
grünen Auto, einem NSU Prinz (ihr war nur das Wort Prinz geblieben, die Marke nicht)<br />
zum Altersheim, wo deren Mutter ihren Lebensabend verbrachte. Diese Besuche waren<br />
ihr unangenehm, da die Grossmutter Haare am Kinn hatte und sie jeweils küsste. Zudem<br />
sei es langweilig gewesen.<br />
Als dritte Erinnerung erwähnt sie, dass sie relativ lange (6-8) des Nachts ab und zu das<br />
Bett nässte, sodann aufstand und die Mutter fragte, ob sie ins Bett der Eltern schlüpfen<br />
dürfe. Dem wurde jeweils stattgegeben – mit mässiger Begeisterung, da die Mutter ja<br />
schon ahnen konnte, dass das Bett wieder nass war.<br />
Der Vater und der Bruder finden in diesen Erinnerungen nicht statt, ausser dass sie sich<br />
nicht erinnern kann, dass der Bruder oder Vater mit zum Altersheim gekommen sei.<br />
Erinnerungen, die geblieben sind, weil es auch Bilder gibt, in deren Zusammenhang<br />
diese Geschichten immer wieder erzählt wurden, sind die folgenden.<br />
Im August ging es jeweils zwei Wochen ans Meer. Carla erinnert sich, dass sie einmal<br />
am Ende der Ferien zum Meer gingen, um die Freunde zu verabschieden. Der Vater<br />
habe dann mit der Hand das Meerwasser getätschelt. Die Mutter habe gefragt, was er da<br />
mache, warum er nicht nochmals bade. Er antwortete, dass er sich nur vom Meer<br />
verabschieden wollte.<br />
Als Erinnerung geblieben sind auch Zahlenspiele. Sie hätten in der Nacht die Wagen der<br />
Züge gezählt, die am Ferienort vorbei fuhren.<br />
Ebenfalls mit Zahlen hat die Erinnerung an Weihnachten zu tun, da ihr Bruder und sie<br />
derart viele Geschenke bekommen hätten, dass sie diese nummerierten und hernach der<br />
Reihe nach öffneten.<br />
Eine eindrückliche Erinnerung, aber da sei sie schon in der Schule gewesen, stamme aus<br />
den Ferien in den Dolomiten. Als Schulaufgabe habe man eine Zeichnung aus den<br />
Matthyas Arter 75/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
Ferien mitbringen müssen. Da habe sie die Aussicht aus der Wohnung gezeichnet – die<br />
Dolomiten.<br />
Erst jetzt erinnert sich Carla S an den Abend, da sie die Türe ihres Zimmers öffnete und<br />
direkt gegenüber in das Schlafzimmer der Eltern sah. Erst sah sie in der Dämmerung<br />
zwei Menschen nebeneinander, dann plötzlich nur noch einen. Sie hörte Keuchen,<br />
verstand aber nicht, was da vor sich ging. Ihr Bruder hätte ihr dann sagen können, dass<br />
Menschen so was machen.<br />
Sie kann sich auch an Streit der Eltern in der Küche erinnern. Die Idee, dass sich die<br />
Eltern hätten scheiden lassen können, sei unerträglich gewesen. Sie habe geweint, die<br />
Mutter sei gekommen, um sie zu trösten. Sie habe gesagt, dass keine Eltern wolle, die<br />
sich trennen.<br />
Auf die Frage, ob sie auch Erinnerungen habe mit ihrem Bruder, kommt ihr die<br />
Geschichte in den Sinn, da der Bruder sie heftig in die offene Kastentüre gestossen<br />
habe, so dass durch den Knall aufmerksam geworden der Vater auf den Plan kam.<br />
Dieser zog wie in solchen Fällen üblich, den Gürtel aus der Hose. Die beiden Kinder<br />
hätten sich nach dem Knall erschrocken angesehen und die Flucht unter das elterliche<br />
Bett ergriffen. Dort habe aber nur einer Platz finden können, so dass beide versucht<br />
hätten, den andern den Schlägen des Vaters zu überlassen.<br />
Sie habe meist mit ihrem Bruder und dessen Kollegen gespielt. Einmal habe sie ein<br />
blaues Auge abbekommen durch einen Schlag mit dem Knie, aber nicht von ihrem<br />
Bruder, sondern von einem seiner Kollegen.<br />
Mit den Grosseltern verbrachte Carla S. wenig Zeit. Diese seien relativ jung gestorben,<br />
mit etwa 70. Ihr grösstes Glück stellt dennoch die Familie dar. Alle zusammen in<br />
Frieden am Küchentisch zum Beispiel. Da sei sie jeweils glücklich gewesen. Sie sei<br />
aber überhaupt eine glückliche Natur.<br />
Weil ihre Familie die grösste Wohnung hatte, fanden die Familienfeste wie<br />
Weihnachten und Ostern jeweils bei ihnen statt. Das sei ihr aber jeweils eher zuviel<br />
Matthyas Arter 76/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
gewesen, wenngleich die erweiterte Familie nicht sehr gross sei, da der Vater ein<br />
Einzelkind sei. Die Mutter habe zwei Schwestern und einen Bruder.<br />
Das Schlimmste für sie sei Streit in der Familie und der Tod. Der Hinschied der<br />
Grosseltern sei nicht so schlimm gewesen, da ihr diese eher fremd waren, aber die Idee<br />
des Todes sei schlimm. Sie wollte sich denn auch nicht wie in Italien üblich am offenen<br />
Sarg von der toten Grossmutter verabschieden.<br />
Freundinnen, gute Freundinnen hat sie zwei. Eine aus der Gymnasialzeit, die zweite seit<br />
der Uni. Sie hat aber zu beiden wenig Kontakt, da diese nun Familie und andere<br />
Interessen haben. Carla S. verfügt über einen grossen männlichen Freundes- und<br />
Bekanntenkreis.<br />
Störend an der Mutter findet sie die religiöse Intensität. Ihre Mutter brauche die<br />
Tragödie. Anderseits hätten ihre Eltern nie etwas von ihr gefordert, hätten auch keine<br />
Grenzen gesetzt.<br />
Ihr Vater hätte wenig Selbstwertgefühl entwickelt. Obwohl er manuell sehr geschickt<br />
gewesen sei, hätte er nicht viel draus gemacht. Sie glaubt, dass sie die Intelligenz<br />
sowohl vom Vater hat als auch von der Mutter erbte, der Bruder aber eher wie die<br />
Mutter funktioniere.<br />
Sie hätten eher zurückgezogen gelebt, einmal im Monat Gäste zu Pizza, sonst nur den<br />
engen Familienkreis.<br />
Das Suchtverhalten des Bruders hat in den Augen von Carla S. die schöne Familie<br />
zerstört. Wenn er Krebs hätte, wäre das etwas anderes, aber die Sucht sei<br />
selbstverschuldet. Darüber empfindet sie Wut. „Er hat mich im Stich gelassen“ ist ihr<br />
Urteil über die Situation. Sie als Jüngste muss nun die Verantwortung für die ganze<br />
Familie tragen. Sie sieht ihre Rolle, aber sie will sie noch nicht. „Ich fürchte den Tag,<br />
da ich zurück muss“ (Carla S.). Aber Carla S. ist praktisch genug, um den Kompromiss<br />
zu suchen, eine Lösung, welche sie in Zürich bleiben lässt und die Probleme zuhause<br />
doch gelöst werden, indem sie sporadisch zum Rechten sieht.<br />
Matthyas Arter 77/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
7.4. Pubertät<br />
Mit 15, also relativ spät, bekam Carla S. ihre erste Menstruation. Im selben Jahr machte<br />
sie ihre ersten sexuellen Erfahrungen mit einem älteren Jungen, der ihr das Gefühl gab,<br />
„ein Experte zu sein“.<br />
Ihre längste Beziehung zu einem Mann überdauerte mehre Jahre und hätte in die Ehe<br />
münden können. Aber unterschiedliche Wertvorstellungen führten zum Bruch. Seither<br />
spielt die sexuelle Beziehung zu Männern eine praktische Rolle. Das Glücksgefühl sei<br />
egozentrisch. Der Mann muss über Ausdauer und ansprechende Masse verfügen. Dann<br />
hat sie ihren Spass.<br />
Sie relativiert diesen Spass durch die Tatsache, dass ihr während des Liebesspiels<br />
zuweilen das Bild der Mutter in den Sinn komme, was die Lust stark vermindere. Sie<br />
fühle sich dann schuldig.<br />
Auf die Frage, wie ihre Mutter denn ihre Sexualkontakte aufgenommen habe, kommt<br />
die klare Antwort, dass sie davon natürlich nichts wisse. Ihre Mutter hätte nie danach<br />
gefragt.<br />
Auf die Frage, ob sie denn die Mutter gefragt habe, wie das bei ihr gewesen sei, steht<br />
Carla S. Überraschung im Gesicht. Das habe sie natürlich nie gefragt.<br />
Carla S. wünscht sich, am Ende ihres Lebens sagen zu können: „Ich habe fast nichts zu<br />
bereuen“.<br />
7.5. Dilemmatoleranz durch Verdrängung und Kreativität<br />
Carla S. ist insofern ein Phänomen und den Spezifikationen von Bruno K. weitgehend<br />
entgegen gesetzt, als ihre äusseren Lebensumstände und die wirksamen inneren Werte<br />
ein Maximum an Spannung erzeugen, also ein Höchstmass an Dilemmatoleranz<br />
erfordern, respektive gravierende Verdrängungen und einen extremen Kontrollzwang<br />
notwendig machen.<br />
Es ist schon fast schmerzhaft auffallend, dass Carla S. von ihrer in der Opferrolle<br />
gefangenen Mutter kaum die notwendigen lebensbejahenden Impulse für ein tragendes<br />
Selbstverständnis bekommen konnte. Insbesondere die Rolle der hingebungsvollen,<br />
fürsorglichen Mutter wurde ihr nicht vorgelebt. Der Tod als etwas Schlimmes weist sehr<br />
Matthyas Arter 78/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
deutlich auf die Unmöglichkeit hin, sich dem vollständig hinzugeben, was gerade ist.<br />
Die Kontrolle über die Situation verlieren ist für Carla S. inakzeptabel, auch im Bett.<br />
Ein guter Mann ist nur jener, über welchen sie einen letzten Rest Kontrolle behalten<br />
kann. Es fehlt die Erfahrung des seligen Rückfalls in den Schoss der Mutter, in die nicht<br />
zu hinterfragende Geborgenheit. Carla S. konnte ein zu wenig gefestigtes Urvertrauen<br />
entwickeln, als dass sie ohne starke Idealisierungen auskommen könnte.<br />
Diese Idealisierungen sind es aber gerade, die einen narzisstisch betonten Lebensstil als<br />
angenehm und beglückend erleben lassen. Die damit verbundene innere Leere, welche<br />
sich in Phasen relativer Traurigkeit, Wut und Verzweiflung äussern kann, wird aber von<br />
Carla S. weitgehend in Schach gehalten. Nur da und dort sickert eine tiefgründige Angst<br />
vor totaler Überforderung durch. Die Idee, die Märtyrerrolle der Mutter übernehmen zu<br />
müssen, erträgt sie nur deshalb, weil sie innerlich überzeugt ist, im entscheidenden<br />
Augenblick doch noch einen passablen Ausweg zu finden. Dieser Mechanismus<br />
funktioniert auch im Bett, gerade so, wie er für einen andern Fall von MENTZOS<br />
treffend beschrieben wurde:<br />
„Die Patientin möchte begehrt werden; sie möchte auch, dass der Partner<br />
regelrecht von ihr abhängig ist – nicht, um es auszunutzen oder aus Rache,<br />
sondern weil sie sich nur auf diese Weise sicher fühlt. Die abweisenden<br />
Äusserungen des Mannes empfindet sie als narzisstische Verunsicherung.<br />
Deswegen unternimmt sie alle möglichen Anstrengungen, um ihn umzustimmen;<br />
sie geht sogar das „Risiko“ der sexuellen Erregung ein, um ihr gefährdetes<br />
narzisstisches Gleichgewicht zu stabilisieren. Hat sie dieses Ziel erreicht, findet<br />
ihr Mann sie wieder begehrenswert, so muss sie blitzartig ihre innere Einstellung<br />
und ihr Verhalten ändern. Denn jetzt taucht die andere Gefahr auf: der<br />
Autonomie- bzw. Selbstverlust innerhalb der sexuellen Erregung – und damit das,<br />
was sie am meisten fürchtet“ (Seite 115, MENTZOS S., 2005).<br />
Darunter leidet Carla S., weil sie spürt, dass sie sich selbst der glücklichen Hingabe im<br />
Wege steht und keine Mittel, respektive nicht den Mut findet, den Weg ins Dilemma,<br />
respektive zu sich selbst und ins Leben zu wagen.<br />
Über einen Schritt in die richtige Richtung konnte Carla S. indes jüngst berichten. Ihre<br />
seit einem halben Jahr dauernde Beziehung zu einem Mann, „die nur auf Sex gebaut<br />
sei und der überhaupt nicht ihrem Ideal entspreche“, sowie ihre Neugierde bezüglich<br />
Matthyas Arter 79/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
der teilweise massiven Selbstbeschränkung durch übermässige Planung, haben sie in so<br />
etwas wie die (von PIAGET dargestellte) Experimentierphase zurück versetzt. Sie lasse<br />
Pläne absichtlich platzen, um zu sehen, ob sie dies aushalte. So habe beispielsweise die<br />
für Pfingsten geplante Fahrt ans Meer mit ihrem Freund überhaupt nicht stattgefunden,<br />
weil dieser noch am Freitagabend an die Geburtstagsparty eines Freundes habe gehen<br />
wollen (ohne sie, notabene). Sie habe dann in seiner Wohnung auf ihn gewartet,<br />
natürlich in der Hoffnung, wenigstens in den frühen Morgenstunden noch sexuell auf<br />
die Rechnung zu kommen. Er sei aber offenbar sturzbetrunken gegen vier Uhr morgens<br />
nach Hause gekommen, habe aber im Wohnzimmer auf dem Boden geschlafen, weil er<br />
sich der Herausforderung im Schlafzimmer nicht mehr habe stellen wollen. Sie sei zwar<br />
sauer gewesen, aber im Verlauf des Wochenendes habe sich das wieder gelegt. Echt<br />
sauer sei sie geworden, als sie realisierte, dass ihre Periode nicht wie geplant am<br />
Dienstag einsetzte, sondern schon am Wochenende, so dass es – davon ging sie aus –<br />
nun aus diesem Grunde zu keiner lustbringenden Begegnung mehr kommen konnte. Ihr<br />
Freund habe dann allerdings gemeint, er sei nicht „fussy“ (heikel), so dass sie entgegen<br />
ihren Gewohnheiten im Bad ein Tuch holte und der Sonntag „wunderschön“ wurde.<br />
Das Beispiel ist insofern sehr passend, als es Carla S. offenbar mehr und mehr gelingt,<br />
Dilemmata zu erkennen und anzunehmen, wo zuvor nur die Perfektion als Möglichkeit<br />
in Betracht gezogen wurde. Die Tatsache, dass ein Mann sie fasziniert, der überhaupt<br />
nicht ihren Idealvorstellungen entspricht, öffnete offenbar den Blickwinkel für die<br />
eigenen Möglichkeiten. Statt Dilemmata zu verdrängen, tastet sich Carla S. in diesem<br />
Bereich offensichtlich mit Erfolg an spannungsgeladene Situationen heran und beginnt<br />
sich darüber zu freuen, dass es zwar anders kommt als man denkt, dass Leben darob<br />
aber spannungsreich und interessant wird, natürlich um den Preis, dass eine ideale Welt<br />
nicht zu haben ist.<br />
Matthyas Arter 80/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
8. Therapiekonsequenzen<br />
Die bis dahin dargestellten Sachverhalte und Ausführungen wären kaum lesenswert,<br />
hätten sie nicht ganz konkrete Auswirkungen auf das, was man als Therapieverständnis<br />
bezeichnen könnte.<br />
8.1. Paradigmawechsel<br />
Ein Therapieansatz, dessen Zielsetzung eine wie auch immer definierte „Normalität“ ist,<br />
unterscheidet sich wesentlich von einem Therapieansatz, der nach inadäquater<br />
Dilemmatoleranz forscht und bestmögliche Anpassungsmodi für den Einzelfall<br />
evaluiert. Meines Erachtens ist dieser Unterschied sogar derart schwerwiegend, dass das<br />
viel missbrauchte Wort vom Paradigmawechsel für einmal angebracht erscheint.<br />
Dieser Paradigmawechsel hat denn auch zumindest in der Entwicklung der qualitativen<br />
Forschung seinen Niederschlag gefunden, indem am Einzelfall orientiert und bezüglich<br />
der Vergleichsmasstäbe nicht länger statisch, sondern nach dynamischen<br />
Typologisierungen Vergleiche respektive Entwicklungstendenzen ermittelt werden.<br />
In dieses Konzept fügen sich die Analysen vorhandener Dilemmatoleranz im Einzelfall<br />
und das Anpassen derselben an die effektiven Erfordernisse bestens ein.<br />
Heute ist selbst aufgrund quantitativer Studien und Meta-Analysen wie sie GRAWE im<br />
grossen Stil durchführte, zumindest unbestritten, dass therapeutische Interventionen –<br />
egal welcher Schule sie entspringen – über den Faktor Empathie einen positiven Effekt<br />
haben. Damit sind aber auch die engen Grenzen deutlich geworden, welche einer an<br />
Normabweichung orientierten Therapieforschung gesetzt sind, so dass die<br />
Notwendigkeit nach einer Neuausrichtung offensichtlich wird.<br />
Noch in einem weiteren Punkt öffnet sich aber das Therapieverständnis in wohltuender<br />
Weise, wenn nicht länger nach der Norm gefragt werden muss. Wie bereits von JUNG<br />
und im Rahmen dieser Schrift weiter vorne dargelegt, ist Normalität für den<br />
Minderbegabten bereits ein hohes, kaum erreichbares Ziel, für den Überbegabten<br />
dagegen ein viel Leiden verursachendes Prokrustesbett. Der Bezug auf die vorhandene<br />
und erforderliche Dilemmatoleranz erlaubt dagegen, das Leiden für den Einzelfall zu<br />
bestimmen, also dort, wo es tatsächlich als solches erlebt wird.<br />
Matthyas Arter 81/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
Was heisst das am konkreten Beispiel?<br />
8.1.1. Symptomverschiebung<br />
Wenn beispielsweise jemand als „Messi“ mit einer (für den „Normalmenschen“ nahezu<br />
unerträglichen) Unordnung lebt, so ist es nach dem klassischen Bemühen um<br />
„Normalität“ nahe liegend, diesem Menschen durch möglichst wirksame therapeutische<br />
Interventionen zu einer besseren Kontrolle der häuslichen Ordnung zu verhelfen. Dazu<br />
eigenen sich insbesondere auch verhaltenstherapeutische Massnahmen hervorragend,<br />
indem schon nach kurzer Zeit kriteriumsbezogen deutliche Verbesserungen<br />
nachgewiesen werden können. Wie von MENTZOS 24 dargelegt, ist die Fokussierung<br />
auf Einzelsymptome und ein Verständnis derselben als voneinander unabhängige<br />
Phänomene aber nicht zweckmässig. Fällt nämlich durch eine „erfolgreiche“<br />
verhaltenstherapeutische Intervention die schutzbietende Funktion des einengenden<br />
Chaos in der Wohnung weg, kann es durchaus sein, dass die neu gewonnene<br />
Bewegungsfreiheit eine psychotische Reaktion nach sich zieht, weil der<br />
psychodynamische Hintergrund des neurotischen Phänomens ausser Acht gelassen<br />
wurde. Der Betroffene wird mit einer Dilemmatoleranzforderung (Selbstkontrolle trotz<br />
wegfallender Einengung) konfrontiert, der er nicht gewachsen ist und entsprechend wird<br />
er regredieren. Damit ist aber nichts gegen die Wirksamkeit verhaltenstherapeutischer<br />
Massnahmen gesagt, sondern vielmehr wird deutlich, dass dieselben dann sinnvoll sind,<br />
wenn gleichzeitig die Verschiebungen der hierfür notwendigen Dilemmatoleranz unter<br />
Berücksichtigung der psychodynamischen Mechanismen nicht ausser Acht gelassen<br />
werden.<br />
24 Wegen des klinischen Gewichts psychotischer Symptomatik haben nun die meisten Kliniker keine<br />
Bedenken, die Hauptdiagnose Psychose auch bei jenen Patienten zu stellen, bei denen die psychotische<br />
Symptomatik nach einer Reihe von anderen, beispielsweise neurotischen Syndromen auftaucht oder bei<br />
denen sie sogar mit neurotischen Syndromen alterniert. …Vielmehr möchte ich die Arbeitshypothese<br />
vertreten, nach der die aufeinanderfolgenden oder alternierenden Symptomatiken nicht als voneinander<br />
unabhängige „Krankheitseinheiten“, sondern am sinnvollsten als dem Patienten jeweils mögliche<br />
Reaktionsweisen aufzufassen sind. (MENTZOS, 2000, 128)<br />
Matthyas Arter 82/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
8.2. Würdigung der Dilemmatoleranz<br />
Um diesen Sachverhalt deutlich zu machen, muss zumindest ansatzweise klar werden,<br />
wie denn Dilemmatoleranz ermittelt werden soll.<br />
Ein fruchtbarer Ansatz ergibt sich aus MENTZOS 25 Modell zur Differenzierung der<br />
Subjekt-Objektbeziehung. Die Stufen Inkorporation, Introjektion und Identifikation<br />
ergeben eine qualitativ verlässliche Einstufung vorhandener Dilemmatoleranz. Dort wo<br />
die höchste Integration, die Identifikation erreicht ist, kann auch mit stabiler<br />
Dilemmatoleranz gerechnet werden. Das noch erträgliche Spannungsniveau darf<br />
entsprechend belastet werden. Wo aber der Umgang mit Objekten zur Debatte steht,<br />
welche kaum integriert sind, muss von bescheidener Dilemmatoleranz ausgegangen<br />
werden.<br />
Aus den Schilderungen von Menschen ist (wie im Falle von Bruno K. und Carla S.<br />
dargelegt) relativ verlässlich zu schliessen, wo hohe Spannungen noch oder nicht<br />
ertragen, respektive vermieden oder verdrängt werden. Das wesentliche Kriterium<br />
scheint in Übereinstimmung mit MENTZOS Modell, aber auch mit der<br />
Individuationsvorstellung von JUNG, respektive der Ich-Werdung bei FREUD letztlich<br />
der Grad eines lebbaren Selbstverständnisses zu sein.<br />
8.2.1. Problematik des Leidens<br />
Dort, wo die Integration von Selbstanteilen im Argen liegt, muss entsprechend von<br />
einer unangepassten Dilemmatoleranz, respektive einer angstbesetzten Selbstkastration<br />
25 Die Art der Internalisierung hängt also von der Art und Reife der Objektbeziehungen ab. Umgekehrt<br />
wiederum: Auch die Art der Beziehungen, die überhaupt möglich sind, hängt z.T. von der Art der früher<br />
stattgefundenen Internalisierungen ab.<br />
Inkorporationen, Introjektionen und Identifikationen sind wichtige Schritte und Teilkomponenten der<br />
Reifung. Sie finden in den entsprechenden Entwicklungsstadien bei allen Menschen statt. Die<br />
Inkorporationen „reifen“ zu Introjektionen und diese wiederum zu Identifikationen. Ist allerdings diese<br />
Reifung mangelhaft oder bleibt sie aus, so überwiegen auch beim Erwachsenen Elementen der<br />
Inkorporation oder der Introjektion, wodurch dann später eine Prädisposition und Tendenz zur<br />
Reaktivierung solcher Formen der Internalisierungen und der dazugehörigen Objektbeziehungen entsteht.<br />
Dadurch werden Internalisierungen zu pathologischen Abwehrprozessen.<br />
Allerdings sollte an dieser Stelle noch einmal daran erinnert werden, dass die Feststellung, ob es sich bei<br />
einem intrapsychischen Vorgang um eine pathologische Abwehrform oder aber um einen<br />
lebensnotwendigen Bewältigungsmechanismus handelt, von dem Wann , dem Wie und den<br />
Gesamtkontext abhängig ist. Inkorporationen und Introjektionen sind in einer bestimmten Phase der<br />
Entwicklung notwendig. Nehmen sie im späteren Leben überhand, so sind sie als Störungen, als<br />
Ausdruck eines regressiven Vorganges zu deuten. (MENTZOS, 2005, 45)<br />
Matthyas Arter 83/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
gesprochen werden, die sich in übermässigem Leiden des Betroffenen ausdrücken kann,<br />
aber nicht muss.<br />
MENTZOS:<br />
„Die meisten Autoren vertreten folgende Meinung:<br />
Die Charakterstörungen seien - im Gegensatz zum Symptom - Ich-synton (dem Ich<br />
genehm und zu ihm passend) und nicht Ich-dyston. Die Auffälligkeiten des<br />
Erlebens und Verhaltens (etwa die Rigidität und Pedanterie des neurotischen<br />
Zwangscharakters) würden subjektiv als „normale“ Charakterzüge empfunden.<br />
Es fehle die Krankheitseinsicht. Der Charakter sei in viel stärkerem Masse als das<br />
Symptom in die Umwelt integriert. Charakterbildung stelle immer einen<br />
progressiven Anpassungsversuch dar, während die Symptombildung ein<br />
regressives Phänomen sei […] Es gibt Charakterzüge (innerhalb der<br />
Charakterneurosen), die eindeutig Symptomcharakter annehmen (z.B.<br />
systematisches Sich-Verspäten), und andererseits Symptome, die eine<br />
pathologische Charakterstruktur bezeichnen (z.B. hypochondrische<br />
Charakterstruktur). Auch das Unterscheidungsmerkmal Ich-synton versus Ichdyston<br />
lässt uns oft im Stich: Es gibt Patienten, die z.B. ihre neurotisch bedingte,<br />
habituelle Passivität als sehr störend erleben und sich dagegen wehren; es gibt<br />
auf der anderen Seite konversionshysterische Patienten, die ihr Symptom als nicht<br />
besonders störend empfinden“ (MENTZOS, 2005, 86).<br />
Dieses Eingeständnis, dass „Normalität“ offensichtlich subjektiv empfunden wird,<br />
Selbstkastration als überlebenswichtiger Schutz dienen kann, verdeutlicht, wie sensibel<br />
die vorhandene, respektive gelebte Dilemmatoleranz Umweltanpassungen respektive<br />
Entwicklungsdefizite anzeigt. Was damit nicht beantwortet werden kann ist indes die<br />
Frage, ob die für ein spezifisches Phänomen verantwortliche Dilemmatoleranz nun als<br />
besonders gelungene Anpassung an die vorgefundenen Verhältnisse interpretiert werden<br />
muss, respektive subjektives Leiden im Übermass generiert.<br />
Nur im letzteren Fall ist es verantwortbar, therapeutische Hilfe anzubieten. Fehlt der<br />
Leidensdruck seitens des Betroffenen, sind Interventionen – egal welcher Art -, nicht zu<br />
verantwortende Übergriffe. Im Allgemeinen kann aber davon ausgegangen werden, dass<br />
ein Mensch sein Wohlbefinden steigern will. FROMM:<br />
Matthyas Arter 84/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
„Die Dynamik der menschlichen Natur veranlasst den Menschen, nach<br />
befriedigenderen Lösungen zu suchen, soweit eine Möglichkeit besteht, sie zu<br />
erreichen“ (FROMM, Freiheit, 189).<br />
Anders, aber auch Veränderung fordernd, präsentiert sich die Sachlage, wenn die<br />
Verhältnisse, auf welche sich der Betroffene unter Vermeidung von Leidensdruck<br />
eingestellt hat, nicht länger von der Gesellschaft geboten werden. Wenn also<br />
beispielsweise Bruno K. den Status des „ewigen Studenten“ nicht länger<br />
aufrechterhalten kann und sich die Lebensumstände dramatisch ändern müssen. Wie<br />
weiter vorne erwähnt ist es unumgänglich, dass bei Überforderung, also mangelnder<br />
Dilemmatoleranz respektive zu hohem Spannungsniveau mit einer Regression zu<br />
rechnen ist, welcher Selbstanteile zum Opfer fallen, aber immer im Bestreben,<br />
wenigstens einen Teil der Identität noch zu retten. Dies gelingt nur dann, wenn<br />
emotionale Bindungen an die Welt noch gehalten werden können. FROMM:<br />
„…der Mensch hat nicht nur seinen Geist, und er braucht nicht nur einen<br />
Rahmen, der Orientierung, um in der Welt ringsum einen Sinn zu erkennen und<br />
um sie strukturieren zu können, er hat auch ein Herz und einen Körper, die<br />
gefühlsmässig an die Welt gebunden sein wollen – an die Menschen wie an die<br />
Natur. Wie bereits erwähnt, sind die Bindungen des Tieres an die Welt<br />
vorgegeben, und seine Instinkte dienen dabei als Vermittler. Der Mensch, der<br />
durch das Bewusstsein seiner selbst und durch seine Fähigkeit, sich einsam zu<br />
fühlen, abseits steht, wäre wie ein hilfloses Stäbchen im Wind, wenn er keine<br />
gefühlsmässigen Bindungen eingehen könnte, die sein Bedürfnis befriedigen: auf<br />
die Welt bezogen und mit ihr eins zu sein“ (FROMM, Hoffnung, 66).<br />
8.3. Fahrt zwischen Skylla und Charybdis<br />
Wird nun der Fokus auf die verfügbare Dilemmatoleranz gelegt und nach<br />
Beziehungsfeldern Ausschau gehalten, für welche die Subjekt-Objekt-Differenzierung<br />
tragbarere Spannungsniveaus verspricht, so könnte verlässlicher das gelingen, was<br />
Matthyas Arter 85/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
MENTZOS 26 die Essenz des Therapieerfolges nennt, die angepasste Fahrt zwischen<br />
Skylla und Charybdis.<br />
Wenn aber die Essenz des Therapieerfolges die Fahrt zwischen Skylla und Charybdis ist<br />
und – wie weiter vorne postuliert – für jeden Menschen die vereinnahmenden Strudel an<br />
andern Orten zu lokalisieren sind, dann rückt die erforderliche Dilemmatoleranz, die<br />
immer unterschiedlich, aber auf allen Weltmeeren überlebenswichtig ist, deutlich in den<br />
Vordergrund und eine „allgemein verbindliche Taxonomie“ (STUHR U., 27 ) scheitert<br />
nicht nur in der Praxis an der Komplexität der notwendigen mehrfaktoriellen<br />
Versuchspläne, sondern auch in der Theorie, da die Vergleichsbasis trotz aller<br />
Differenziertheit ein viel zu unscharfes Bild der tatsächlich relevanten Wertungen<br />
abgeben würden, so dass die Messfehler die Tendenz haben grösser zu sein als die<br />
ermittelten Unterschiede.<br />
Aber die Fahrt zwischen Skylla und Charybdis ist auch kein wissenschaftlich messbarer<br />
Erfolg. Da dieser Erfolg notgedrungen höchst individueller Art und für alles Lebende<br />
gegeben ist, wäre er nach POPPER die Konsequenz eines synthetischen Urteils, indem<br />
jeder Einzelfall als Sonderfall einer allgemeinen Gesetzmässigkeit (die Fahrt zwischen<br />
Skylla und Charybdis) verstanden werden müsste, also nicht falsifizierbar ist. Damit<br />
handelt es sich „um einen metaphysichen Ansatz, der aus der Wissenschaft<br />
auszuschalten ist“ (POPPER K., 33). STUHR führt denn auch sinnvollerweise für die<br />
Beurteilung des Therapieerfolges respektive die Effektivitätsbewertung kein<br />
Naturgesetz, sondern vorab interne Kriterien an: Bewertungen nach subjektiven<br />
Massstäben, nach gesellschaftlichen, familiären und persönlichen Norm- und<br />
Idealvorstellungen (vgl. STUHR U., 29). Natürlich werden auch die externen Kriterien<br />
26 Das therapeutische Ziel ist eigentlich relativ einfach zu beschreiben: Es geht darum, dem Patienten zu<br />
ermöglichen, zwischen der Skylla der Objektlosigkeit und der Charybdis der Verschmelzung mit dem<br />
geliebt-gehassten Objekt hindurch die neue und positive Erfahrung zu machen, dass Objektbeziehung<br />
sogar eine Stärkung der Identität und Autonomie statt einer Schwächung bedeuten kann (dialektische<br />
Aufhebung des Grundkonfliktes). Dieses Ziel ist aber schwer zu erreichen. Dabei dürfte man die echte<br />
Überwindung der heftigen Gegenübertragung als einen essentiellen Faktor ansehen. Gelingt es dem<br />
Therapeuten, den Patienten geduldig zu begleiten, weil er den geschilderten Prozess in seiner Dynamik<br />
und Funktion verstanden hat, (und nicht weil er unter dem Druck seines therapeutischen Über-Ich seine<br />
Gegenübertragungs-Aggression blockiert, um geduldig zu bleiben), so ist schon sehr viel gewonnen.<br />
Dennoch lauern auch dabei Gefahren, so etwa eine aus diesem vermeintlichen Verständnis des Prozesses<br />
möglicherweise erwachsende „Arroganz“ und fehlende emotionale Mitbeteiligung des Therapeuten.<br />
Diese wäre aber gerade das Gegenteil dessen, was beispielsweise BENEDETTI als einen<br />
hauptsächlichen therapeutisch wirksamen Faktor ansieht. (MENTZOS, 2000 23f)<br />
Matthyas Arter 86/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
wie Effizienz und Kosten als Kriterium aufgeführt. Aber man darf darin m. E. nicht<br />
mehr als eine pragmatische Konzession an das quantitative Denken weiter<br />
Gesellschaftskreise erkennen. Wenn wir die (genial hintergründige) Bemerkung von<br />
GRAWE zur Basis nehmen, leuchtet die Fokussierung auf Dilemmatoleranz ein. Der<br />
von STUHR zitierte GRAWE schreibt:<br />
„Die an und für sich viel offenere Frage, was denn eigentlich die verschiedenen<br />
Psychotherapien bewirken, wird damit zu einer Frage von grösser oder kleiner<br />
oder besser oder schlechter, gemessen an vorgegebenen Erfolgskriterien“<br />
(STUHR U., 30).<br />
Die Crux liegt entsprechend darin, dass der Erfolg vom Messkriterium abhängig ist.<br />
Wenn es nach der Gesellschaft im Ganzen geht, ist das Messkriterium nahe bei dem,<br />
was man versucht ist als „Normalität“ zu bezeichnen. Es versteht sich von selbst, dass<br />
damit nichts weiter als ein neues Dilemma kreiert wird, weil Normalität im Einzelfall<br />
oder besser gesagt tragfähige Dilemmatoleranz des Individuums nie und nimmer mit<br />
dem zusammengeht, was die Gesellschaft übergeordnet und aus dem Augenblick heraus<br />
für wünschenswert hält. Der Einzelne ist zwar Teil einer Gesellschaft, aber in seinen<br />
Interessen derselben auch entgegengerichtet respektive in einem permanenten Konflikt,<br />
weil sich die Gesellschaft nicht so verhält, wie das Individuum sich dies wünscht und<br />
umgekehrt. Oder mit den Worten STUHRS:<br />
„Hieraus könnte man mit vorläufiger Schlüssigkeit – quasi heuristisch – die<br />
Konsequenz ziehen, dass die Forschung nach Differenziertheit in der<br />
Erfolgsbeurteilung nur sehr widersprüchlich eingelöst werden kann“ (STUHR U.,<br />
32).<br />
8.4. Mögliche Ausrichtung künftiger Erfolgsbeurteilung<br />
Auch wenn es von politischen Gesichtspunkten aus betrachtet sinnvoll erscheint,<br />
allgemein gültige Messkriterien für den Therapieerfolg zu definieren, zeigen die<br />
vorliegenden Ausführungen doch sehr deutlich, dass dies nur um den Preis einer<br />
massiven Vergewaltigung des Einzelfalles überhaupt möglich ist. Es gibt anderseits<br />
aber auch keine Patentlösung, indem weder das individuell Erfahrbare noch das<br />
gesellschaftlich Tragbare Grössen sind, die sich verlässlich definieren liessen, zumal sie<br />
Matthyas Arter 87/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
auch noch einem dauernden Wandel unterliegen und entsprechend mit einer gehörigen<br />
Unschärfe versehen sind.<br />
Dennoch ist es möglich, die das Individuum im Einzelnen belastenden Dilemmata im<br />
Rahmen professioneller Psychotherapie heraus zu destillieren, ebenso wie die<br />
Prioritäten des Betroffenen bezüglich des Abbaus schmerzlicher Spannungen für den<br />
Einzelfall passend zu setzen.<br />
Eruierbar ist zudem im Therapieverlauf – unabhängig von der Art der Therapie –<br />
inwieweit es gelingt, Dilemmata bewusst zu machen und mit denselben souverän<br />
umzugehen, also die Toleranz zu entwickeln, welche weder übermässiges Leiden<br />
verursachende Verdrängung nach sich zieht noch den Rückzug aus der äusseren Welt in<br />
die innere Isolation erzwingt. Nicht im Extrem liegt die Lösung, sondern im<br />
Bewusstsein um die lebbare Mitte, denn im Extrem lauert immer auch die grösste<br />
Gegenkraft. Dazu ZIEGLER:<br />
„Wo also die Sonne am grellsten scheint, sind die Schatten am dunkelsten und<br />
versetzen die eben gewonnene Erlösung ins Malaise. Es ist, also ob sich jede<br />
Krankheitsanfälligkeit umso gefährlicher steigerte, je selbstverständlicher die<br />
Gesundheit ist.<br />
Der Vorgang entbehrt nicht einer gewissen Erotik. Unsere Wirklichkeiten<br />
scheinen gerade in der Blüte ihres Daseins über jene Anziehungskraft zu<br />
verfügen, die die Vampire am zwingendsten aus den Grüften ruft. Herr-lich-keit in<br />
jeder Art bedeutet eine Herausforderung für alle mahrischen Regungen. So stinkt<br />
nicht nur eine schlammgestaltige Thiamat zum Himmel und verpestet den Hauch<br />
Gottes; nicht nur umgibt der Moder der Katakomben die grandiosen Märtyrer;<br />
die Seuche erfasst ebenso die Doppeladler der unsterblichen Reiche und schwächt<br />
die Sonne der Sonnenländer“ (ZIEGLER, 1983, 86).<br />
An den praktischen Schilderungen wird am ehesten klar, wo von Erfolg gesprochen<br />
werden kann und wo nicht; und vor allem, wie stark dies mit der vorhandenen<br />
Dilemmatoleranz zusammenhängt. BÖKER schreibt:<br />
„Die Therapie stand auf der Kippe: Sie bewegte sich auf dem schmalen Grat –<br />
immer direkt am Abgrund – von grösster „Nähe“, in der eigenes Denken<br />
ausgelöscht wurde, und grösster – Ernüchterung und Abstand schaffender –<br />
Fremdheit (siehe unten KESTENBERG). Der Patient konnte weder schlafen noch<br />
Matthyas Arter 88/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
sein Wachsein ertragen, er konnte weder in den Stunden sein noch ausserhalb.<br />
Um sein Ich – und sein Denken – zu retten, musste er halluzinieren. In dieser<br />
ausweglos erscheinenden Situation eines nicht-auflösbaren paradoxen Gebunden-<br />
Seins (vgl. ROTHAUPTS Beitrag über die Projektion der psychotischen<br />
Verzweiflung) handelte ich – mehr oder weniger – impulsiv: Ich begleitete<br />
Herrn N. in die sich im selben Gebäude befindende psychiatrische Poliklinik und<br />
liess ihm Neuroleptika geben“ (BÖKER in MENTZOS, 2000, 151).<br />
8.4.1. Rezepte, aber keine Patentrezepte<br />
Der Therapeut ist kein Garant für das Überschreiten respektive das Nicht-Überschreiten<br />
der noch zulässigen Toleranz. Entsprechend ist auch der Griff in die „Trickkiste“, die<br />
chemische Sedierung, wertvoll und fallweise sinnvoll. Therapieerfolg ist aber dann<br />
gegeben, wenn die Therapie weder abgebrochen werden muss noch soll und die für den<br />
spezifischen Alltag hinreichende Dilemmatoleranz erreicht wird, sei es durch<br />
Steigerung des noch erträglichen Spannungsniveaus, sei es durch Anpassung der<br />
sinnstiftenden Symbolik, sei es durch Veränderung der relevanten Umwelteinflüsse.<br />
Alle Faktoren sind im Grundsatz konfrontativ und immer dann misslungen, wenn vom<br />
Betroffenen der Therapieabbruch gewünscht wird. BÖKER:<br />
„KESTENBERG wies darauf hin, dass viele psychotische Patienten eine bereits<br />
fortgeschrittene Therapie abbrechen, und dies mit einer gewissen Befriedigung.<br />
Wir müssen annehmen, dass es sich bei solchen „paradoxen Beendigungen“<br />
(MENTZOS) um eine spezifische Lösung des in der therapeutischen Beziehung reaktualisierten<br />
Grundkonfliktes handelt“ (Fussnote BÖKER in MENTZOS, 2000,<br />
151).<br />
Eine Therapie ist entsprechend solange als erfolgreich zu betrachten, als sie vom<br />
Klienten erwünscht ist und – was dasselbe ist – eine adäquatere Dilemmatoleranz<br />
gebildet wird. Es ist nicht weiter überraschend, dass auch in diesem Umstand ein<br />
Dilemma steckt. Schliessen Therapeut und Klient eine Allianz, was aufgrund der<br />
intensiven persönlichen Auseinandersetzung möglich ist, aufgrund des konfrontativen<br />
Charakters der Begegnungen aber auch immer wieder in Frage gestellt wird, besteht die<br />
Matthyas Arter 89/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
Gefahr einer Abkapselung, einer „Folie à deux“ auf Kosten der Krankenkasse,<br />
respektive der Gesellschaft.<br />
Kommt es zu keiner intimen Verständigung zwischen Therapeut und Klient, ist die<br />
transzendente Funktion, die empathische Basis in Frage gestellt und damit eine<br />
Veränderung im Weltverständnis des Klienten unwahrscheinlich.<br />
8.4.2. Therapie als Übungsraum<br />
Vermieden werden können diese beiden Fehlentwicklungen nur dann, wenn zwischen<br />
Therapeut und Klient der Grundkonflikt, die Nähe-Distanz-Problematik, das Verhältnis<br />
von Liebe und Angst immer wieder aufs Neue erprobt und gelebt werden muss. Die<br />
zwischen Therapeut und Klient kultivierbare Dilemmatoleranz bekommt auf diese<br />
Weise Vorbildcharakter und findet mehr und mehr Anwendung in allen<br />
Lebensbereichen des Klienten (und des Therapeuten).<br />
Um dieses Spannungsverhältnis optimal zu gestalten, ist es von entscheidender<br />
Bedeutung, dass zwischen Therapeut und Klient kein Machtgefälle inszeniert wird. Es<br />
ist daher schon ein Dilemma, wie ein Therapeut bezahlt werden soll. Bezahlt die<br />
Krankenkasse und nicht der Klient, entsteht automatisch das Gefälle zwischen<br />
Therapeut und Patient, zwischen Hilfe Gebendem und Hilfe Suchendem. Dieses Setting<br />
ist zu komfortabel, als dass damit Dilemmatoleranz oder das Spannungsniveau<br />
verändert werden könnte, es sei denn, es handle sich um einen Patienten, dessen<br />
Einsicht in die eigene Pathologie weit fortgeschritten ist. Dann ist allerdings auch kein<br />
grosser Therapiebedarf mehr vorhanden.<br />
Wenn Dilemmatoleranz erlebt werden soll, müssen paritätische Verhältnisse geschaffen<br />
werden. Der Klient bezahlt den Therapeuten nicht dafür, dass er „geheilt“ wird, sondern<br />
dafür, dass er sich Zeit für diese persönliche Konfrontation nimmt und auch bereit ist, in<br />
das Weltverständnis des Gegenübers einzutauchen, wohl wissend, dass der Therapeut so<br />
wenig wie der Klient diesen Schritt machen kann, ohne seine Welt mit neuen Augen zu<br />
sehen. Die Welt mit neuen Augen sehen, heisst aber nichts Geringeres, als seine<br />
Dilemmatoleranz den konkreten Gegebenheiten anpassen, das ist zwar keine Heilkunde,<br />
aber die einzige Erfolg versprechende Überlebensstrategie.<br />
Matthyas Arter 90/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
Literaturverzeichnis<br />
• ADLER A. (1929) Lebenskenntnis, Fischer Taschenbücher<br />
• BLEULER E. Festgabe zur Einweihung der Neubauten der Universität Zürich 18.<br />
April 1914<br />
• BLEULER M. (a) Die schizophrene Geistesstörung im Lichte langjähriger Krankenund<br />
Familiengeschichten<br />
• BLEULER M. (b) BLEULER M. , Das alte und das neue Bild des Schizophrenen<br />
• DÖRNER K./ PLOG U., Irren ist menschlich, Psychiatrie Verlag, 8. Auflage, 1984<br />
• FEDERN P. (1956); Ich-Psychologie und die Psychosen, Suhrkamp, Frankfurt a.M.<br />
• FISCHER H. (1992) Beitrag RUDOLPH W. Ethnos und Kultur, Ethnologie,<br />
Einführung und Überblick, Berlin; Dietrich Reimer<br />
• FREUD S. (1910). Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci. GW VIII, S.<br />
127-211<br />
• FREUD S. (10) Triebe und Triebschicksale Gesamtwerk Band X).<br />
• FREUD S. (12), Gesamtwerk Band XII<br />
• FREUD S. (13) Das Ich und das Es, Gesamtwerk Band XIII<br />
• FREUD S. (13a) Neurose und Psychose, Gesamtwerk Band XIII<br />
• FREUD S. (15) 29. Vorlesung Gesamtwerk Band XV<br />
• FROMM E., Die Kunst des Liebens , Ullstein Materialien<br />
• FROMM E., Die Furcht vor der Freiheit, Ullstein Materialien<br />
• FROMM E. Die Revolution der Hoffnung, Klett-Cotta im Ullstein Taschenbuch)<br />
• HARTMANN F. (1964), Contribution to the Metapsychology of Schizophrenia, in<br />
Essays on Ego Psychology. Int. Univ. Press, New York 1964)<br />
• HEGEL G.W.F, Phänomenologie des Geistes, Vorrede, Reclam Universal-<br />
Bibliothek Nr.8460, 1987<br />
• JUNG C. G. (4), Gesamtwerk Band IV<br />
• JUNG C. G. (5), Gesamtwerk Band V<br />
• JUNG C. G. (8) , Gesamtwerk, Band VIII<br />
• JUNG C. G. 9/2), Gesamtwerk, Band IX/2<br />
• JUNG C. G. (10), Gesamtwerk Band X<br />
• JUNG C. G. (Praxis), Gesamtwerk Praxis der Psychotherapie.<br />
• KOHUT H./ WOLF E.(10), Die Störungen des Selbst und ihre Behandlung, in<br />
Psychologie des 20. Jah. Band X, Kindler, München<br />
• KRAUSE R., (1985), Über primäre Identifikation und ihre Abwehr, Psychoanalyse,<br />
95-120, 1985<br />
• MEAD G.H., Geist, Identität und Gesellschaft<br />
• MENTZOS S. (2000) Psychose und Konflikt, Vandenhoeck & Ruprecht<br />
• MENTZOS S. (2002) Psychodynamische Modelle in der Psychiatrie, Vandenhoeck<br />
& Ruprecht<br />
• MENTZOS S. (2005), Neurotische Konfliktverarbeitung, Geist und Psyche, Fischer<br />
Verlag, 19. Auflage 2005<br />
• NIETZSCHE F. (Betrachtungen), Unzeitgemässe Betrachtungen, Kröners<br />
Taschenbuchausgabe, Band 71, Leipzig 1930<br />
• NIETZSCHE F. (Antichrist), Kröners Taschenausgabe, Band 77, Leipzig 1930<br />
Matthyas Arter 91/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
• PIAGET J.,(1) Das Erwachen der Intelligenz beim Kinde, Gesammelte Werke 1,<br />
Studienausgabe Klett 1975<br />
• POPPER K., Logik der Forschung, Mohr Siebeck<br />
• SPITZ R., (1965) Vom Säugling zum Kleinkind, Klett-Cotta Stuttgart 1987<br />
• STUHR U. Therapieerfolg als Prozess, Asanger<br />
• TAUSK V. (1919) , Über die Entstehung des „Beeinflussungsapparates“ in der<br />
Schizophrenie. Int. Zeitschrift für ärztliche Psychoanalyse, Band 5<br />
• WINNICOTT, (1965), Reifungsprozesse und fördernde Umwelt, Fischer, Frankfurt<br />
a.M. 1974<br />
• ZIEGLER A. J.(1983), Wirklichkeitswahn, Die Menschheit auf der Flucht vor sich<br />
selbst, Schweizer Spiegel Verlag, Raben Reihe 1983<br />
Matthyas Arter 92/93 Juni 07
<strong>Masterthese</strong><br />
Dilemmatoleranz als Konfliktbewältigungsindikator im psychotherapeutisches Prozess<br />
ERKLÄRUNG<br />
Hiermit versichere ich, die vorgelegte <strong>Masterthese</strong> selbständig verfasst zu haben.<br />
Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäss aus veröffentlichten oder nicht<br />
veröffentlichten Arbeiten anderer übernommen wurden, wurden als solche<br />
gekennzeichnet. Sämtliche Quellen und Hilfsmittel, die ich für die Arbeit genützt habe,<br />
sind angegeben. Die Arbeit hat mit gleichem Inhalt bzw. in wesentlichen Teilen noch<br />
keiner Prüfungsbehörde vorgelegen.<br />
Datum:<br />
Unterschrift:<br />
Matthyas Arter 93/93 Juni 07