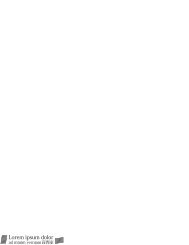S & SCHANDA Becker Büttner Held
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
S ATTLER & <strong>SCHANDA</strong><br />
R ECHTSANWÄLTE<br />
A-1010 WIEN, STALLBURGGASSE 4, TEL 533 80 80, FAX 535 60 76<br />
ÖEKV-Fachtagung „Energiemarkt im Fluss – aktive Kostensteuerung“<br />
14. Oktober 2003, Wien<br />
Dr. Reinhard Schanda<br />
Kosten des CO 2 -Emissionshandels und rechtliche Aspekte der Zertifikatszuteilung<br />
Stichworte zum Vortrag<br />
Kyoto-Protokoll<br />
Vorgeschichte des Protokolls<br />
• Rechtliche Basis ist die United Nations Framework Convention on Climate Change (FCCC, New<br />
York 1992, in Kraft seit 1994)<br />
• Diese normiert als Ziel die stabilisation of greenhouse gas concentration in the atmosphere at a<br />
level that would prevent dangerous antropogenic interference with the climate system (Art 2).<br />
• Das wichtigste Organ dieser Konvention ist die Conference of the Parties (COP).<br />
• Das Treffen in Kyoto 1997 war das dritte Treffen der COP (COP 3). Treibende Kraft für ein konkretes<br />
Ergebnis war dabei vor allem die EU.<br />
• Ergebnis dieses Treffens war das Kyoto Protokoll to the United Nations Framework Convention<br />
on Climate Change (KP).<br />
• Unterzeichnet wurde dieses internationale Ankommen bislang von 84 Staaten. Ratifiziert haben<br />
es per 5. September 2003 117 Staaten (vgl unter www.unfccc.int).<br />
• Es tritt 90 Tage nachdem (a) 55 Vertragsstaaten das Protokoll ratifiziert haben und (b) auf diese<br />
Staaten mindestens 55 % der CO 2 -Emissionen der Industrieländer von 1990 entfallen (Art 25) in<br />
Kraft. Ratifiziert wurde das Protokoll bereits von über 55 Vertragsstaaten (darunter auch von Österreich).<br />
Allerdings decken die Staaten, die bisher ratifiziert haben, nur 44,2 % der Emissionen<br />
ab. Insb mit dem angekündigten Beitritt von Russland würde das Protokoll in Kraft treten.<br />
Inhalt des Protokolls<br />
• Ziel: Reduktion der Emission von sechs Treibhausgasen (darunter CO 2 ) im Zeitraum von Anfang<br />
2008 bis Ende 2012 gegenüber dem Stand von 1990 um insgesamt mindestens 5 % (Art 3 KP).<br />
• Zur Erreichung dieses gemeinsamen Ziels dürfen die Vertragsstaaten grundsätzlich ihre jeweiligen<br />
Assigned Amounts (die sich aus dem jeweiligen Reduction Commitment bzw der Emission<br />
Limitation laut Annex B ergeben) nicht überschreiten.<br />
• Österreich hat in Annex B eine Emissionsreduktion auf 92 % des Niveaus von 1990 (also eine<br />
8%ige Reduktion) zugesagt. Auch die EU hat eine Emissionsreduktion von 8 % zugesagt.<br />
• Das Protokoll normiert allerdings drei wesentliche Ausnahmen von dieser festen Reduktionsverpflichtung:<br />
- Die Assigned Amount Units sind handelbar: Ein Vertragsstaat, der seinen Assigned Amount<br />
ansonsten überschreiten würde, kann von anderen Vertragsstaaten Assigned Amount Units<br />
zukaufen (Emissionshandel laut Art 17 KP).<br />
<strong>Becker</strong> <strong>Büttner</strong> <strong>Held</strong><br />
www.bbh-wien.at Rechtsanwälte office@bbh-wien.at<br />
Repräsentanz Wien
2<br />
- Auch Emission Reduction Units (ERUs = Emissionsreduktionseinheiten) sind auf den Assigned<br />
Amount anrechenbar. Emission Reduction Units können erworben werden wenn eine<br />
Emissionsreduktion nicht im eigenen Land sondern in einem anderen Industrieland (Annex-<br />
I-Land) verwirklich wird (Joint Implementation gem Art 6 iVM Art 3 Z 10 f KP).<br />
- Auch Certified Emission Reductions (CERs = zertifizierte Emissionsreduktionen) sind auf<br />
den Assigned Amount anrechenbar. Certified Emission Reductions können erworben werden,<br />
wenn eine Emissionsreduktion nicht im eigenen Land sondern in einem Entwicklungsland<br />
verwirklicht wird (Clean Development Mechanism gem Art 12 iVM Art 3 Z 12 f KP).<br />
• Emission Reduction Units und Certified Emission Reductions können also auf die letztlich erforderlichen<br />
Assigned Amount Units angerechnet werden.<br />
• Regeln, Modalitäten und Leitlinien für die Umsetzung dieser Mechanismen wurden 2001 auf der<br />
COP 7 als Teil der „Übereinkommen von Marrakesch“ (Marrakesh Accord) vereinbart.<br />
• Wichtig: Die Emissionszertifikate (Assigned Amount Units) nach KP müssen von Staaten erworben<br />
werden und den Organen des KP nachgewiesen werden.<br />
Burden Sharing innerhalb der EU<br />
• Das KP sieht die Möglichkeit vor, dass Vertragsstaaten vereinbaren können ihre Emissionsreduktionsverpflichtungen<br />
gemeinsam (jointly) zu erfüllen. Diesfalls müssen die jeweiligen Emissionsreduktionsziele<br />
in diesem Vertrag festgelegt werden (Art 4 KP).<br />
• Ratbeschluss vom 25.4.2002, mit dem das KP ratifiziert wurde, lautet: The European Community<br />
and its Members shall fulfill their commitments under Art 3(1) of the KP jointly, in accordance<br />
with the provisions of Art 4 thereof. The quantified emission limitation and reduction commitments<br />
agreed by the EC and its Member States for the purpose of determining the respective<br />
emission levels allocated to each of them for the first … period … are set out in Annex II (Art 2;<br />
ABl 15.5.2002 L 130/1). Nach diesem Annex II soll Österreich seine Emission um 13 % reduzieren.<br />
Diese Reduktionsziele wurden im Einklang mit Art 4 KP dem Sekretariat des FCCC notifiziert.<br />
• Offene Frage: Können sich betroffene Unternehmen auf den im Gemeinschaftsrecht geltenden<br />
allgemeinen Gleichheitssatz berufen? Gem Art 12 EGV ist im Anwendungsbereich des EGV<br />
auch jede Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit verboten. Durch das vom Rat<br />
(im Einvernehmen mit dem Mitgliedstaat Österreich) festgesetzte Burden Sharing werden österreichische<br />
Unternehmen gegenüber (zumindest manchen) anderen Unternehmen in der EU diskriminiert.<br />
Zu entscheiden hätte über diese Frage der EuGH (etwa im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens).<br />
Emissionshandel laut EU-RL<br />
Entwicklung der RL<br />
• Die RL diente ursprünglich der Umsetzung der völkerrechtlichen Verpflichtung der EU aus dem<br />
Kyoto-Protokoll, wurde aber nun unabhängig vom Inkrafttreten des KP erlassen.<br />
• Der ursprüngliche Vorschlag der Kommission stammt vom 23.10.2001. Die erste Lesung im EP<br />
erfolgte im 10.10.2002. Am 27.11.2002 legte die Kommission einen geänderten Vorschlag vor.<br />
Am 9.12.2002 (politisch) bzw am 18.3.2003 (förmlich) fasste der Rat einen gemeinsamen Standpunkt.<br />
Die zweite Lesung des EP erfolgte am 2.7.2003. Dabei wünschte das EP weitere Änderungen.<br />
Die Kommission erklärte am 18.7.2003 die Änderungswünschen des EP zu akzeptieren. Am
3<br />
22.7.2003 akzeptierte auch der Rat die Änderungswünsche des EP. Damit gilt die RL gem Art<br />
251 Abs 3 EGV als angenommen. Sie muss lediglich noch im Amtsblatt veröffentlicht werden.<br />
Inhalt der RL<br />
• Die RL sieht vor, dass bestimmte Industrieunternehmen zu einer Emissionsreduktion verpflichtet<br />
werden (wodurch ein Teil der völkerrechtlichen Verpflichtung der EU und der Mitgliedstaaten<br />
zur Emissionsreduktion auf diese Industrieunternehmen überwälzt wird).<br />
• Dazu sollen den betroffenen Industriebetrieben von der jeweiligen staatlichen Behörde Permits<br />
(Genehmigungen) und Allowances (Berechtigungen = Emissionszertifikate) zur Emission erteilt<br />
werden.<br />
• Das Permit ist anlagenbezogen und erlaubt die grundsätzliche Emission einer - quantitativ unbestimmten<br />
- Menge von CO2 aus der genehmigten Anlage. Das Permit ist mit der Verpflichtung<br />
verbunden Allowances in Höhe der tatsächlichen Gesamtemissionen der Anlage abzuführen. Abrechnungszeitraum<br />
ist das Kalenderjahr.<br />
• Die Allowances sind übertragbar und handelbar. Wer also mehr emittieren will als ihm Allowances<br />
zugeteilt werden, muss Allowances kaufen. Wer weniger emittiert, kann Allowances verkaufen.<br />
• Die Zuteilung der Allowances für die erste Periode soll zu 95 % und danach zu 90 % kostenlos<br />
erfolgen. Der Rest der Zuteilung kann also (nach Entscheidung der Mitgliedstaaten) entgeltlich<br />
erfolgen.<br />
• Die erste Periode laut EU-RL ist der ersten Periode laut KP vorgeschaltet: Während das KP die<br />
Emissionsreduktion für den Zeitraum Anfang 2008 bis Ende 2012 vorsieht, soll die erste Periode<br />
der RL von Anfang 2005 bis Ende 2007 laufen.<br />
• Möglichkeit des Pooling: Mitgliedstaaten können Anlagenbetreibern erlauben innerhalb einer<br />
activity einen Pool zu bilden. Diesfalls treffen den zu benennenden Treuhänder alle Rechte und<br />
Pflichten. Dieser Treuhänder agiert dann für die Poolmitglieder (Art 28 RL).<br />
• Wichtig: Emissionszertifikate nach der RL müssen von Unternehmen erworben und dem eigenen<br />
Staat abgeliefert werden.<br />
Umsetzung der RL in Österreich<br />
• Die RL verpflichtet lediglich die Mitgliedstaaten (nicht die Unternehmen direkt). Die Mitgliedstaaten<br />
müssen die darin vorgesehenen Regelungen innerstaatlich umsetzen, und zwar bis<br />
31.12.2003.<br />
• Aufgrund des in Österreich verfassungsrechtlich geltenden Rechtsstaatlichkeitsprinzip („Vollziehung<br />
nur auf Basis von Gesetzen“) erfordert diese Umsetzung in Österreich die Erlassung eines<br />
Gesetzes. Dieses Gesetz muss auch der Verwaltungsbehörde einen hinreichend bestimmten Rahmen<br />
vorgeben, innerhalb dessen die Behörde die Konkretisierung durch Verordnung oder Bescheid<br />
vornimmt. Das Gesetz muss die Vollziehung ausreichend determinieren.<br />
• In Deutschlang gibt bereits einen Entwurf für ein Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz und eine<br />
Verordnung zur Umsetzung der Emissionshandel-Richtlinie für Anlagen nach dem Bundes-<br />
Immissionsschutzgesetz. In Österreich gibt es bis dato noch keinen öffentlichen Gesetzesentwurf.
4<br />
Vorgaben an den Nationalen Allokationsplan und die Zertifikatszuteilung sowie Anfechtungsmöglichkeiten<br />
des Nationalen Allokationsplanes und der Zertifikatszuteilung<br />
• Die Zuteilung der Allowances laut RL erfolgt gem Nationaler Allokationspläne (NAPs).<br />
• Anforderungen an und Kriterien für den NAP gem RL (Art 9 und Annex III der RL):<br />
- Objektive und transparente Kriterien<br />
- Technische Potenziale der Anlage zur Emissionsverringerung<br />
- Keine übermäßige Bevorzugung bestimmter Unternehmen oder Sektoren<br />
- Frühzeitiges Tätigwerden (early actions) dh bereits vor dem relevanten Basiszeitraum getätigte<br />
emissionsreduzierende Investitionen müssen berücksichtigt werden<br />
- Möglichkeit für neue Unternehmen am Handelssystem teilzunehmen<br />
- „Bemerkungen“ der Öffentlichkeit müssen angemessen berücksichtigt werden (taking due account<br />
of comments from the public)<br />
- Muss Liste der Anlagen enthalten und angeben wie viel Allowances diese Anlage jeweils zugeteilt<br />
erhalten (volle Transparenz).<br />
- Vorlage des Entwurfs an die Kommission längstens am 31.3.2004 (zur Prüfung anhand der<br />
EmissionshandelsRL und des Beihilfenrechts, insb im Hinblick auf Bevorzugung österreichischer<br />
Unternehmen im Vergleich zu ausländischen Unternehmen)<br />
• Anforderungen des österreichischen Verfassungsrechtes:<br />
- Der NAP muss rechtsstaatlich überprüfbar sein; er muss daher in der Rechtsform der Verordnung<br />
ergehen.<br />
- Diese VO muss ausreichend bestimmt sein um den weiteren Vollzug ausreichend zu determinieren<br />
(Rechtsstaatlichkeitsprinzip).<br />
- Auf Basis der VO über den Nationalen Allokationsplan müssen die Zuteilungsbescheide in<br />
rechtsstaatlich überprüfbarer Form ergehen, dh als Bescheide.<br />
- Diese Bescheide können mit der Begründung angefochten werden, dass sie sich auf eine verfassungswidrige<br />
VO und/oder ein verfassungswidriges Gesetz stützen.<br />
- Inhaltlich könnte sich diese Verfassungswidrigkeit (neben dem Grundrecht auf Erwerbsausübungsfreiheit)<br />
va auf eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes stützen. Danach ist jede<br />
unsachliche Differenzierung des Gesetz- oder Verordnungsgebers verfassungswidrig. Der<br />
Gleichheitsgrundsatz wird vom VfGH extensiv interpretiert.<br />
- Danach könnte also ein Zuteilungsbescheid, demzufolge ein Anlagenbetreiber weniger<br />
Zertifikate zugeteilt bekommt als der Betreiber einer vergleichbaren Anlage, gleichheitswidrig<br />
sein.<br />
- Ebenso wäre Gleichheitswidrigkeit wohl dann gegeben, wenn ein Anlagenbetreiber, der<br />
schon vor Inkrafttreten der RL seine Emissionen durch Investitionen in Umwelttechnologie<br />
reduziert hat, weniger Zertifikate zugeteilt bekommt als sein Konkurrent, der keine<br />
vergleichbaren Investitionen getätigt hat.<br />
- Gleichheitswidrig könnte auch der Modus der (Nicht-)Berücksichtigung von zukünftigen<br />
neuen Anlagen sein. Auch diese müssen eine angemessene Möglichkeit haben zukünftig<br />
Zertifikate zu erhalten.
5<br />
Österreichisches JI/CDM Programm laut Umweltförderungsgesetz<br />
• Mit dem Budgetbegleitgesetz (BGBl I 2003/71) wurde ua auch das Umweltförderungsgesetz geändert.<br />
Das Gesetz enthält nun detaillierte Regelungen über das „österreichische JI/CDM-<br />
Programm“.<br />
• Ziel ist ein Verkauf von ERUs und CERs vom Antragsteller (Projektbetreiber) an die Republik<br />
Österreich (durch Emission Reduction Purchase Agreements – ERPAs).<br />
• ERPA als Vertragstyp: Vereinbarung über Kauf eines noch nicht existierenden Wertpapiers aus<br />
einer noch nicht errichteten Anlage auf Basis eines noch nicht in Kraft getretenen völkerrechtlichen<br />
Vertrages<br />
• Als Abwicklungsstelle für die Republik Österreich wurde gesetzlich die Kommunalkredit Austria<br />
AG bestellt.<br />
• Es steht ein Jahresbudget von EUR 36 Mio (inkl Verwaltungskosten) zur Verfügung.<br />
• Das Programm ist nicht nur für österreichische Antragsteller zugänglich, sondern für jede (physische<br />
oder juristische) Person unabhängig von der Nationalität (auch außerhalb der EU).<br />
Anrechnung von Emission Reduction Units (aus JI-Projekten) und Certified Emission Reductions<br />
(aus CDM-Projekten) auf die Allowances nach der RL<br />
• Nach der EmissionshandelsRL sollen Zertifikate aus JI- und CDM-Projekten nicht auf die Allowances<br />
anrechenbar sein.<br />
• In Begutachtung ist derzeit ein Vorschlag der Kommission vom 23.7.2993 für eine „LinkingRL“<br />
(zur Verbindung von JI und CDM einerseits und der EmissionshandelsRL andererseits;<br />
KOM[2003] 403).<br />
• Kernpunkt des RL-Vorschlages ist es, Gutschriften aus JI- und CDM-Projekten (ERUs und<br />
CERs) als äquivalent zu EU-Emissionsberechtigungen (Allowances) anzuerkennen, damit sie von<br />
Betreibern zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen in das Gemeinschaftssystem eingebracht werden<br />
können. Dazu soll der Betreiber die ERUs und CERs bei seinem Mitgliedstaat gegen Allowances<br />
eintauschen können: Der Staat erhält so (nach KP anrechenbare ERUs und CERs), das Unternehmen<br />
erhält (nach EmissionshandelsRL anrechenbare) Allowances.<br />
Zertifikate als Wertpapiere<br />
• Meinung der deutschen BAFin (Aktennotiz BAFin):<br />
- Emissionsberechtigungen (Allowances) sind Wertpapiere iSd des KWG<br />
- Der Aufsicht der BAFin (inkl Bankkonzession) unterliegen Unternehmen, die das Finanzkommissionsgeschäft<br />
betreiben oder die die Anlage-, die Abschlussvermittlung, den Eigenhandel<br />
für andere oder die Finanzportfolioverwaltung erbringen, deren Gegenstand Emissionszertifikate<br />
oder deren Derivate sind.<br />
• Übertragbarkeit dieser Beurteilung auf Österreich?<br />
• Auswirkungen auf Pooling und Clearing im Konzern?<br />
• Auswirkung auf sonstige Marktteilnehmer?<br />
Zertifikate als Kostenfaktor und sonstige offene Fragen<br />
• Aufteilung von Emissionen auf von RL betroffene Industrie einerseits und Verkehr und Haushalte<br />
andererseits?
6<br />
• Der zukünftige Zertifikatspreis ist ungewiss. Bisher wurden in Europa angeblich bereits ca<br />
350.000 t als Forwards für die Periode 2005-2007 gehandelt. Durchschnittspreis angeblich 9-10<br />
EUR/t.<br />
• Unterschiedliche Bedeutung der Zertifikatskosten je nach Wertschöpfung pro t CO 2<br />
• Wechselwirkung Permit / Betriebsanlagengenehmigung?<br />
• Handhabung neuer Marktteilnehmer und Handhabung von zukünftigem Wachstum im NAP (Reservehaltung?)<br />
Kontaktinformation:<br />
RA Dr. Reinhard Schanda<br />
Sattler & Schanda Rechtsanwälte (BBH Repräsentanz Wien)<br />
A-1010 Wien, Stallburggasse 4<br />
Tel +43 / 1 / 533 80 80<br />
Fax +43 / 1 / 535 60 76<br />
office@sattler.co.at<br />
www.sattler.co.at oder www.emissionshandel.co.at




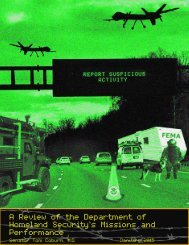


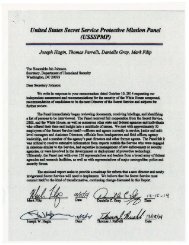

![55721335-d6fe09eb5ffdcc87dbf6c3f0b5bbda07d2261e98[1]](https://img.yumpu.com/56533583/1/186x260/55721335-d6fe09eb5ffdcc87dbf6c3f0b5bbda07d2261e981.jpg?quality=85)