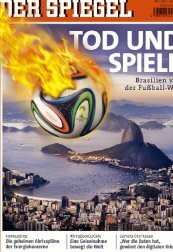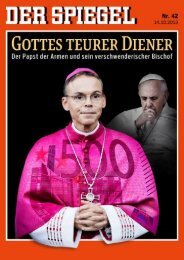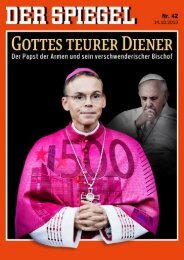DER SPIEGEL 48_2013.pdf
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
ABCDCEE<br />
<br />
<strong>48</strong><br />
ABC<br />
FEE<br />
2013<br />
<br />
• CE<br />
DCEFDCFFCBFCDFCCBCFFEF<br />
FFFCFCBCDFCFFBCCBFC<br />
FF<br />
• CFBCBFCFBBFBFCBCC<br />
BC<br />
• DECCCCCFDFBFCFFCECBC<br />
BF<br />
• DFDCFBCCBFFFCB<br />
CFBFCFFCDFFBCFFCBFCFCC<br />
FCFCCFFFFCBBCCCB<br />
<br />
• E<br />
E<br />
FFECCEFFCFFCFF<br />
• E<br />
FFEC<br />
• E<br />
FFECFBCBF<br />
• E<br />
FFECF<br />
• E<br />
ECFFCCFCDCCF<br />
FBCCBFFB<br />
• E<br />
ECFEFBFFCCFBCFFBCFC<br />
CC<br />
• E<br />
ECFEFCFBBCFDCFB<br />
CEFCBC<br />
• E<br />
ECFCFFBCCFFABC<br />
FFCCFBCCFF<br />
• E<br />
ECFCCC<br />
• E
ECFBCFBFBCFCFECFC<br />
<br />
• E<br />
FCDCFF<br />
• E<br />
FCCCEC<br />
• E<br />
FCACF<br />
• E<br />
FCCCFC<br />
• E<br />
CFBBFB<br />
• E<br />
CFBEB<br />
• E<br />
CFCFFFC<br />
• E<br />
CFCBC<br />
• E<br />
CFAB<br />
• E<br />
CFFC<br />
• E<br />
CFAB<br />
• E<br />
CFBCFFC<br />
• E<br />
FDCCFB<br />
• E<br />
BFBF<br />
• E<br />
FF<br />
• DE<br />
E<br />
FCFF<br />
• E<br />
DEFFCCCCCB<br />
• E
FCB<br />
• E<br />
EEFB<br />
• E<br />
FFC<br />
• E<br />
EDF<br />
• E<br />
CDC<br />
• E<br />
DCFFCE<br />
• E<br />
CFCCF<br />
• E<br />
BCC<br />
• E<br />
BCBFFBCBBBFC<br />
FCFBBCFFCBFBCBC<br />
• E<br />
CCCFCFCFBF<br />
FFCBFFCCFCCCCF<br />
CB<br />
• E<br />
FCCFBFABCBFBF<br />
ECFDCCFFCFF<br />
CCFBC<br />
• E<br />
BFCCCFCBC<br />
CCBCCBCFBBCCC<br />
• E<br />
CFBCFFBC<br />
BABCFBCFBCCBCC<br />
BCBC<br />
• E<br />
EBCCCBFBCB<br />
FBFFDCBFDCCFFC<br />
C<br />
• E<br />
EBCFBDBEFBCEDC<br />
CFBCFBBFCFBCFBCBDFBFF<br />
FFC<br />
• E
EDFACFCBCBFBC<br />
CDBCBFCBCFB<br />
CFFBCC<br />
• E<br />
FCBDCFFCBFBBA<br />
FFBBCCCFFCFFBC<br />
• E<br />
DCFBDFDCFFBCD<br />
FCBFFFFFCFEC<br />
CFCCFFC<br />
• DE<br />
E<br />
CFCFCC<br />
• E<br />
CC<br />
• E<br />
CCDDFFCFBC<br />
CCFFB<br />
• E<br />
DFCCCFCCFFDBF<br />
FCCFCECCDFFCCC<br />
FCFFCFCBCC<br />
• E<br />
DCFBFCFBCFB<br />
CFBFFC<br />
• CADE<br />
E<br />
D<br />
• E<br />
CCBF<br />
• E<br />
ECFCBCCEB<br />
• E<br />
DDFFBCB<br />
• E<br />
CFCF<br />
• E<br />
FCF<br />
• E
ECCFCBDFCCC<br />
FFCFCFCCBCFFCBCB<br />
FFCBFBCFFCCBBB<br />
CF<br />
• E<br />
CFCCEFFCCFBCC<br />
FCDCFFCCCBDCBFDBCB<br />
FBCFC<br />
• E<br />
DCFCECCFABCBBEFFFCBC<br />
FBFCFBFCDFCCFBCFBFBC<br />
BFCBCCBFABC<br />
• E<br />
CBDFBFFFBC<br />
CFFFFECFFFBFB<br />
FCCFFCFFCFFC<br />
• E<br />
FCEFBCFBFCFBFCFBCF<br />
CCFFFBFCCECBC<br />
• E<br />
BFCFFCCFCBCCF<br />
CFBDBFCBCFEB<br />
CFF<br />
• CE<br />
E<br />
DBC<br />
• E<br />
CB<br />
• E<br />
CBC<br />
• E<br />
CCCCCAFBEFFFB<br />
FBCCBCABC<br />
ECBCCACDB<br />
• E<br />
E<br />
FCCBCFBC<br />
• E<br />
DDCFCCC<br />
• E<br />
CACECC
• E<br />
CDB<br />
• E<br />
CF<br />
• E<br />
CFDCBFFCCCBB<br />
FFCFFFCFB<br />
DBFCFFCBCFFBCCB<br />
• E<br />
EDEFCCCFBCCCBABC<br />
ECFBCCFFCFCBFB<br />
FBCFC<br />
• E<br />
DCCCFCBCBCFC<br />
CCFBCDFCFFBCFBCFBF<br />
CCBCCCBBCECCB<br />
• E<br />
BFCFBCBFDCFFCCC<br />
FFCFCFFCCCC<br />
BFFFCFCCFF<br />
BABCCB<br />
• E<br />
FCBCECFCCFCC<br />
C<br />
• ACE<br />
E<br />
FFBFCFCFFBB<br />
C<br />
• AE<br />
E<br />
DBFCF<br />
• E<br />
FBF<br />
• E<br />
CFCECCFCCCC<br />
FBFCABCFFAFBFCBCDFCF<br />
CFFBFCFBFF<br />
• E<br />
EFCFDFBCCBCCFBFCCFF<br />
FBFCBCDBFCCFCFBCF<br />
CFFC
• CDDCE<br />
E<br />
BFCFC<br />
• E<br />
DDFFFB<br />
• E<br />
EFB<br />
• E<br />
BCF<br />
• E<br />
B<br />
• E<br />
EDFCFFFBBCCBBCFF<br />
CBCFCBCFDCCFBFFC<br />
FBBBCCBCBFCFFFFBCCCCB<br />
• E<br />
CCFCFFCFBCFCBCFBF<br />
FDFBBCFCFFDCCCFFBFFBFF<br />
CCFFC<br />
• E<br />
ECFCFBCCDFCBEFC<br />
CFFCCBCFFCFCFCC<br />
• E<br />
DCFBFFFBCCFCBFC<br />
FCCCCCFCDBCFFCC<br />
CFCBFC<br />
• E<br />
CFFCFCFBFCFBFF<br />
FCFFFCECFCCB<br />
• E<br />
FBFEFCCFDFBFCF<br />
CFDFFCCBCFBC<br />
• AE<br />
E<br />
CBC<br />
• E<br />
BC<br />
• E<br />
C<br />
• E
CC<br />
• E<br />
DBC<br />
• E<br />
FFCCCCFFC<br />
FFBFBABCCFCCC<br />
FCDEBFCFFBC<br />
<br />
• E<br />
ECFF<br />
• E<br />
BBC<br />
• E<br />
DFCCBDFCFCFFFECFFF<br />
FCBFC<br />
• E<br />
FBFBDCBFCECFCBF<br />
ABCABCFBFCFC<br />
• E<br />
DCCFFFFDCFCFFECC<br />
ECFFCCCFBFFFABCFCF<br />
BCBCFC<br />
• E<br />
DFCFC<br />
• E<br />
DBFFBFFBFCDCCFBAFFFC<br />
FCFECFFFCFEBBCEFCCCF<br />
CF<br />
• E<br />
BBCCECCCFFCFFCC<br />
EFCCCFCEBC<br />
• E<br />
<br />
BFBCDCFBCCFBCBFFCCBF<br />
FCBCBCCFCF
WERNER SCHUERING / <strong>DER</strong> <strong>SPIEGEL</strong><br />
Hausmitteilung<br />
25. November 2013 Betr.: Titel, Gleichberechtigung, <strong>SPIEGEL</strong> GESCHICHTE<br />
Vor gut einer Woche auf dem SPD-Parteitag in Leipzig beobachteten die<br />
<strong>SPIEGEL</strong>-Redakteure Horand Knaup und Gordon Repinski eine tief verun -<br />
sicherte Partei. Sie sprachen daraufhin mit Dutzenden Genossen, der Eindruck<br />
verfestigte sich: Ganz gleich, wie der Koalitionsvertrag ausfällt, der Mitte dieser<br />
Woche zwischen Union und SPD aufgesetzt werden soll – die Parteispitze fürchtet<br />
eine Niederlage beim Mitgliederentscheid. Acht <strong>SPIEGEL</strong>-Kollegen befragten nun<br />
überall in Deutschland Vorsitzende von Ortsvereinen, Kreisverbänden und Landes -<br />
vorständen. Der Tenor war stets derselbe, in Ostholstein und in Bochum, in Erfurt<br />
ebenso wie in Oberfranken: Kaum ein Sozialdemokrat kann sich für eine Große<br />
Koalition begeistern, die Parteispitze fürchtet sich offenbar zu Recht. „Die Genossen<br />
an der Basis haben ihren Wahlkampf gegen die Kanzlerin geführt“, sagt <strong>SPIEGEL</strong>-<br />
Redakteur Matthias Bartsch, „sie haben keine Lust, Angela Merkel zu einer weiteren<br />
Amtszeit zu verhelfen“ (Seite 20).<br />
Die Gleichberechtigung von Mann und Frau ist ein wichtiges<br />
Thema der Koalitionsverhandlungen – weil sie noch immer<br />
ein wichtiges Thema in Deutschland ist. Vor einer Woche, immerhin,<br />
haben sich die Unterhändler von Union und SPD auf eine gesetzliche<br />
Frauenquote geeinigt, zum ersten Mal überhaupt. Sie löst<br />
die „freiwillige Selbstverpflichtung“ ab und soll für die Aufsichtsräte<br />
börsennotierter Firmen gelten. Das Gesetz, sagt <strong>SPIEGEL</strong>-<br />
Redakteurin Susanne Amann, sei ein „Paradigmenwechsel für<br />
die deutsche Industrie“. Gemeinsam mit den Kollegen Nicola Abé,<br />
Markus Dettmer, Frank Dohmen, Dietmar Hawranek und Simone<br />
Salden hat Amann recherchiert, wie die Unternehmen es umsetzen wollen. Um<br />
Gleichberechtigung geht es auch in zwei weiteren Geschichten: Die <strong>SPIEGEL</strong>-<br />
Redakteurin Claudia Voigt untersucht in einem Essay, wie schwer es für Frauen ist,<br />
Familie und Beruf zu vereinbaren (in einer<br />
Umfrage gaben erst kürzlich 60 Prozent<br />
der Männer an, Frauen besäßen<br />
für Hausarbeit ein besonderes Talent);<br />
Ann-Katrin Müller und Ralf Neukirch<br />
interviewten zwei Frauen, die für sich<br />
persönlich eine Lösung gefunden haben:<br />
die Bundestagsabgeordneten Sylvia Pantel<br />
(CDU) und Ursula Schulte (SPD), die<br />
beiden einzigen Frauen im Deutschen<br />
Müller, Pantel, Schulte, Neukirch<br />
Die Renaissance, die Zeit zwischen dem 14. und dem<br />
16. Jahrhundert, gilt als Epoche der Genies und Ent -<br />
decker: Botticelli, Dürer und Leonardo da Vinci verehrten die<br />
Antike, zugleich richtete sich ihr Blick auf den Menschen, auf<br />
seine Gefühle. Die von Italien ausgehenden Umwälzungen in<br />
Gesellschaft und Kultur veränderten Europa. Diese Ära, die<br />
heute wie ein Laboratorium der Neuzeit erscheint, wird in der<br />
neuen Ausgabe von <strong>SPIEGEL</strong> GESCHICHTE, „Die Renaissance<br />
– Aufbruch aus dem Mittelalter“, beschrieben. Das Heft<br />
ist, auch als digitale Ausgabe, von Dienstag an erhältlich.<br />
Voigt<br />
Bundestag, die im Bundestagshandbuch<br />
als Beruf „Hausfrau“ angegeben haben<br />
(Seiten 54, 72, 156).<br />
CHRISTIAN WERNER / <strong>DER</strong> <strong>SPIEGEL</strong><br />
Im Internet: www.spiegel.de<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3 5
<strong>SPIEGEL</strong>-Titel 47/2013<br />
Briefe<br />
„Für die Beschlagnahme der Bilder gibt es<br />
keine rechtlichen Gründe. Sollte jemand<br />
Besitzansprüche stellen, so kann er dies mit<br />
einer Klage vor Gericht tun. Käme man<br />
dort auf den Gedanken, keine Verjährungsfristen<br />
anzuerkennen, müsste wohl<br />
auch die Nofretete ihre Heimreise antreten.“<br />
KLAUS FISCHER, DITZINGEN (BAD.-WÜRTT.)<br />
Ich bin tief berührt von Frau Gezers außergewöhnlichem<br />
Artikel. Es gelingt ihr,<br />
ohne jeden Anflug falscher Sentimentalität,<br />
diesem so sympathisch aus der Zeit<br />
gefallenen Herrn eine Stimme zu geben.<br />
Eine Stimme, die mir schlagartig zu Bewusstsein<br />
geführt hat, wie sehr ich bereits<br />
das System des Stärkeren, der breiten<br />
Mehrheit, verinnerlicht hatte.<br />
JÖRG HOLZWARTH, FELDAFING (BAYERN)<br />
Lasst uns für Gurlitt und seine Sammlung<br />
ein Museum bauen. Dies wäre der würdigste<br />
Umgang mit seiner Geschichte.<br />
PETER BLASIUS ERK, GSTADT AM CHIEMSEE<br />
Nr. 46/2013, Das Rätsel und der Streit<br />
um den Sensationsfund von<br />
München; Nr. 47/2013, Gespräche mit<br />
einem Phantom<br />
Ein Museum für Gurlitt!<br />
Die Person Cornelius Gurlitt eignet sich<br />
nicht als Täterfigur. Eher ist er ein Sonderling,<br />
dem die ihn umgebende Gesellschaft,<br />
leistungsbetont und hedonistisch,<br />
den Beitritt unmöglich macht. Wo ist da<br />
Schuld? Wo sind Staatsanwalt und Richter,<br />
die über eine erst noch zu findende<br />
Anklage und eine zu ermittelnde Schuld<br />
befinden müssen? Ist ihm bewusst, dass<br />
er auf einem beachtlichen Hügel aus Geld<br />
sitzt, von dem er glaubt, dass sein Vater<br />
ihn nach den Gesetzen der Nazis rechtmäßig<br />
erworben hat?<br />
WOLF P. PRANGE, BERLIN<br />
Wie Sie Ihre Recherchen zum „Fall Gurlitt“<br />
ausbreiten und dem Leser ermög -<br />
lichen, sich ein Bild von den vielen widersprüchlichen<br />
Grautönen zu machen,<br />
ist einfach vorbildlich. Die Reportage<br />
von Özlem Gezer über Cornelius Gurlitt<br />
ist ein großes Stück Journalismus: Einfühlsam<br />
und fair kommt sie dem Menschen<br />
hinter dem „Phantom“ nahe und<br />
zeigt zugleich den zeitgeschichtlichen<br />
Hintergrund. Großartig und preisverdächtig.<br />
PETER SÖTJE, BERLIN<br />
Özlem Gezer ist gelungen, was der Generalstaatsanwalt<br />
und seine Behörde versäumt<br />
haben: Sie hat Licht in diesen<br />
„Kunstskandal“ gebracht. Trotz der hysterischen<br />
Reaktion der Behörde und der<br />
Öffentlichkeit sollte weiter so verfahren<br />
werden – im Interesse aller Beteiligten.<br />
HARM VON LINTIG, ROTTWEIL (BAD.-WÜRTT.)<br />
8<br />
Hier enthüllt sich ein menschliches Drama.<br />
Es zeigt sehr sensibel das Bild eines<br />
alten Mannes und die große Liebe zu seinen<br />
Bildern. Er hat den Zugang zur realen<br />
Welt verloren. Es scheint aber, er verschließe<br />
sich nicht vor der Erkenntnis,<br />
Geraubtes, Unrechtmäßiges zurückzugeben.<br />
Es sei ihm zu gönnen, dass die Justiz<br />
nun korrekt und ohne Einflussnahme den<br />
Besitz überprüft und dem alten Mann<br />
lässt, was ihm gehört, damit er weiterhin<br />
sein Leben leben kann.<br />
SILKE GOEVERT, GÜTERSLOH<br />
Raubkunst ein zweites Mal vom Staat geraubt.<br />
Peinlich. Und wieder einmal ist es<br />
der <strong>SPIEGEL</strong>, der Licht ins Dunkel bringt<br />
und Fakten zutage fördert, um das zu<br />
korrigieren, was uns offiziell verkauft<br />
werden soll.<br />
DR. ECKHARD KUHN, ROSENGARTEN (NIE<strong>DER</strong>S.)<br />
Bild von Hans Christoph aus Gurlitt-Sammlung<br />
Nachdem die Öffentlichkeit von den Ermittlungsbehörden<br />
und der Presse ausgiebig<br />
darüber informiert wurde, nicht etwa<br />
wie schön diese Bilder sind, sondern vor<br />
allem dass sie so viel wert sind, kann der<br />
alte Herr seine Lieblinge, falls er sie zurückbekommt,<br />
wohl nur noch im kuscheligen<br />
Tresorraum einer Bank bewundern.<br />
PETER HEINRICHS, GERMERING (BAYERN)<br />
Cornelius Gurlitt besitzt die Bilder seines<br />
Vaters genauso rechtmäßig, wie das Kind<br />
eines Siedlers das Land besitzen wird,<br />
welches von seinen Vorbesitzern 19<strong>48</strong><br />
oder 1967 in Panik vor Gewalt und Vertreibung<br />
aufgegeben wurde. Jede Gesellschaft<br />
muss eine justitiable Grenze ziehen,<br />
vor der sie sich in Diskussionen, wer<br />
Täter oder Opfer war, im Interesse der<br />
Rechtssicherheit nicht mehr einlässt. Die<br />
Ansprüche der Alteigentümer an den Privatmann<br />
Gurlitt sind verjährt.<br />
JOSEF RIGA, CELLE<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3<br />
PUBLIC PROSECUTOR OFFICE'S AUGSBURG / DPA<br />
Was bis jetzt an Gemälden und so weiter<br />
veröffentlicht wurde, ist kaum mehr als<br />
Ateliermüll, bestenfalls Mittelmaß – abgesehen<br />
von einer Arbeit von Franz Marc.<br />
Mit etwas Zynismus könnte man sagen,<br />
wenn nicht noch was Besseres kommt,<br />
gebt das ganze Zeug an Gurlitt zurück.<br />
DR. LASZLO KENYERI, IMPERIA (ITALIEN)<br />
Eine einfühlsam und behutsam geschriebene<br />
Reportage, die trotzdem nichts<br />
verschweigt. Und ein Beispiel dafür, wie<br />
lange maßlose Despotie und staatlich organisierte<br />
Verbrechen nachwirken auf<br />
Menschen und Gemüter. Hier werden<br />
Wunden aufgerissen, die längst abgeheilt<br />
schienen. Schon sind die Bataillone aufgestellt,<br />
sie melden sich, die Juristen und<br />
Interessenvertreter. Gerechtigkeit, so viel<br />
steht fest, wird es nicht geben und nicht<br />
geben können, dazu ist es längst zu spät.<br />
Was sicher kommen wird, ist jahrzehntelange<br />
Juristerei. Was vielleicht bleiben<br />
wird, ist ein Momentblick auf einen Menschen,<br />
der in seiner weltentrückten Hilflosigkeit<br />
geradezu kafkaesk daherkommt,<br />
der sich fast 70 Jahre lang in einer skurril<br />
anmutenden Welt bewegt hat. Und, auch<br />
das scheint sicher, dessen Bürgerrechte<br />
eineinhalb Jahre lang in geradezu unglaublicher<br />
Weise missachtet wurden.<br />
MANFRED NOLTING, LENNESTADT (NRW)<br />
Unsäglich, wie hier auf der Asche der ermordeten<br />
Besitzer über echte und falsche<br />
oder ersessene Rechte und über die Frage<br />
diskutiert wird, ob jüdische Deutsche<br />
nach 1933 mit den Satrapen von Goebbels<br />
auf Augenhöhe diskutieren konnten. Wo<br />
bleibt der Aufschrei?<br />
WOLF THIEME, BAD BELZIG (BRANDENB.)<br />
Ohne jeden Zweifel muss jüdisches<br />
Eigentum, das die rechtmäßigen Besitzer<br />
verfolgungsbedingt verloren haben, den<br />
Erben zurückgegeben oder eine Entschädigung<br />
gefunden werden. Doch der Wertzuwachs<br />
der Bilder ist nicht das Verdienst<br />
der jüdischen Erben, sondern von Hildebrand<br />
und Cornelius Gurlitt. Das sollte<br />
eine faire Lösung bei jeder Restitution berücksichtigen.<br />
PROF. DR. DR. HANS E. MÜLLER, BRAUNSCHWEIG
Briefe<br />
Nr. 46/2013, Union und SPD<br />
verteilen Geschenke zu Lasten der<br />
jungen Beitragszahler<br />
Bitter nötiges Wahlgeschenk<br />
Dringenden Reformbedarf der Rentenanpassungen<br />
aus der schröderschen Regierungszeit<br />
als „Rentengeschenke“ zu diffamieren<br />
ist unzulässig. Rente muss – will<br />
sie gesellschaftlich legitimiert sein – zurückkehren<br />
zur Zielvorgabe der Absicherung<br />
des vorherigen Lebensstandards.<br />
DR. HARALD GROTH, DELMENHORST<br />
Wenn jemand 15-jährig begonnen hat und<br />
ohne Unterbrechung erwerbstätig war,<br />
hat er als 63-Jähriger <strong>48</strong> Jahre lang gearbeitet.<br />
Dann ist es doch nicht mehr als<br />
recht und billig, wenn dieser Mensch<br />
ohne Abzüge in Rente gehen kann. Eine<br />
Bevorzugung wie Sie in Ihrem absolut<br />
unausgewogenen Beitrag unterstellen, ist<br />
nicht gegeben. Die beabsichtigte Änderung<br />
ist überfällig und gerecht.<br />
BRUNO FISCHER, HOMBURG<br />
Der durch die kommende Altersarmut erforderliche<br />
zukünftige Finanzbedarf wird<br />
die prognostizierten 20 Milliarden Euro<br />
pro Jahr für die „Rentner-Geschenke“<br />
noch weit übertreffen. Dazu addieren sich<br />
die Milliardenzinsverluste durch die aktuelle<br />
Leitzinssenkung, die die Altersvorsorge<br />
der Bürger drastisch entwertet und<br />
die Sparer weiter massiv enteignet. Wie<br />
wäre es denn, wenn man mit der geplanten<br />
Finanztransaktionsteuer ausschließlich<br />
die Altersarmut bekämpfen würde?<br />
Da diese dank Bankenrettung ein gesamteuropäisches<br />
Problem zu werden verspricht,<br />
müsste dieser Vorschlag unter den<br />
europäischen Politikern doch konsens -<br />
fähig sein. Zudem würde er die jüngere<br />
Generation kaum belasten.<br />
PETER KLEINE, HOMBURG<br />
Recht und Gleichheit gilt für alle Mütter,<br />
und das wären drei Rentenpunkte pro<br />
Kind. Falls eine Umsetzung finanziell<br />
nicht möglich sein sollte, müsste eine allgemeine<br />
Angleichung auf zwei Rentenpunkte<br />
pro Kind für die „alten“ und die<br />
„jungen“ Mütter angestrebt werden.<br />
IDA DIETZ, MELLRICHSTADT (BAYERN)<br />
Mütter sollen sich aufopfern, bis ins hohe<br />
Alter, und ihren Anspruch auf Gleichbehandlung<br />
dem Gemeinwohl opfern – so<br />
die Tendenz Ihres Artikels. Die Basis für<br />
unser Rentensystem ist der Generationenvertrag,<br />
und der besteht aus der generativen<br />
Leistung, der Aufzucht des Nachwuchses,<br />
der dann die Alten mitversorgt.<br />
Meine drei Kinder erarbeiten die Pensionen<br />
und die guten Renten der Kinderlosen.<br />
Die eigenen Mütter gehen weitgehend<br />
leer aus.<br />
ULRIKE ADLER, GARMISCH-PARTENKIRCHEN<br />
Käme es zu der geplanten Mütterrente,<br />
stünde vielen geschiedenen Paaren neuer<br />
Streit ins Haus. Für Hunderttausende<br />
könnte der Versorgungsausgleich neu berechnet<br />
werden.<br />
HANS-JOACHIM BUCHHOLZ, KASSEL<br />
Mein Vorschlag als Mutter dreier Kinder,<br />
die vor 1992 geboren wurden, aber noch<br />
heute auf unsere Unterstützung angewiesen<br />
sind: Wenn die Erziehungsarbeit der<br />
älteren Mütter, die im Westen der Republik<br />
mangels Kinderbetreuungsmöglichkeiten<br />
auf Berufstätigkeit und eigenes Einkommen<br />
verzichten mussten, keine gleichwertige<br />
Anerkennung finden kann, dann<br />
sollte man doch für die nach 1992 geborenen<br />
Kinder auch nur einen Rentenpunkt<br />
pro Kind gutschreiben – das wäre eine andere<br />
Möglichkeit der Gerechtigkeit.<br />
Rentenempfängerin Lengies<br />
EVA-MARIA MÜLLER,<br />
MU<strong>DER</strong>SHAUSEN (RHLD.-PF.)<br />
Die Erziehungsjahre der älteren Mütter<br />
dürfen als versicherungsfremde Leistung<br />
nicht aus Beiträgen der Rentenversicherten<br />
finanziert werden. Das hat gefälligst<br />
der Staat zu tun – und zwar aus Steuern.<br />
WELF DICKFELD, BONN<br />
Wer sind die großen Verlierer der deutschen<br />
Vereinigung? Westdeutsche Mütter.<br />
Wenn man den Wert ihrer Dienstleistungen<br />
aufrechnen würde, hätten die über<br />
65-jährigen Mütter eine schöne Altersrente.<br />
Aber das wird wohl wieder nichts:<br />
Die armen Mütter haben ja keine Lobby.<br />
MARJA-LEENA SCHMÄDICKE, ECKENTAL (BAYERN)<br />
Nr. 46/2013, Ein deutscher Pazifist führt<br />
die erste Kampftruppe der Uno<br />
Bedenkliche Inflationierung<br />
Es ist schon eine merkwürdige Zuschreibung,<br />
die Sie vornehmen, wenn Sie Martin<br />
Kobler als Pazifisten bezeichnen, obwohl<br />
er die Kriege im Kosovo und in<br />
Afghanistan wohl befürwortet hat. Das<br />
passt nicht zu der Definition von Pazifismus<br />
und kommt einer bedenklichen Inflationierung<br />
dieses Begriffs gleich.<br />
THOMAS CARL SCHWOERER, FRANKFURT AM MAIN<br />
DEUTSCHE FRIEDENSGESELLSCHAFT<br />
CARSTEN KOALL / <strong>DER</strong> <strong>SPIEGEL</strong><br />
10<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3
Briefe<br />
Nr. 46/2013, Soll man Kinder im Berliner<br />
Stelenfeld toben lassen?<br />
Es gehört sich nicht<br />
Wir waren erschüttert, als wir vor kurzem<br />
sahen, dass Jugendliche (wohl aus England)<br />
dort ein Picknick abhielten und nirgendwo<br />
eine Aufsicht bat, dies bitte an<br />
diesem Ort zu unterlassen. Wie sollten<br />
wir von den Jugendlichen ein anderes<br />
Verhalten erwarten können, wenn nirgendwo<br />
ein Schild in mehreren Sprachen<br />
darauf hinweist, dass es sich hier um ein<br />
Mahnmal für ermordete Juden handelt?<br />
HELGA JAKOBS, OTTOBRUNN (BAYERN)<br />
Die Aussage „Wer ein Mahnmal baut, das<br />
für Kinder aussieht wie ein Spielplatz,<br />
muss damit leben, dass Kinder hier spielen.<br />
Hätte er das verhindern wollen, hätte er<br />
das Mahnmal anders angelegt“, zeigt das<br />
oft zu hörende Verleugnen der eigenen Inkompetenz<br />
hochmoderner Eltern. Ein einfaches<br />
„Nein“ hätte genügt. Aber so haben<br />
alle anderen Schuld. In Zukunft werden<br />
wir dies wohl noch öfter hören: „Wer einen<br />
Friedhof baut, der für Kinder aussieht<br />
wie ein Spielplatz, muss damit leben, dass<br />
Kinder hier Fußball spielen.“<br />
BERTHOLD WENDLER, BERLIN<br />
Hauke Goos entlarvt unfreiwillig die<br />
Unsicherheit und Seelenpein gebildeter<br />
Eltern bei der Erziehung. Anstatt einfach<br />
ihrem – richtigen – Bauchgefühl zu folgen,<br />
dass sich Toben im Stelenfeld schlicht<br />
nicht gehört, wird geistreich schwabuliert,<br />
was gegen ein Eingreifen spricht.<br />
STEPHAN BEZ, OEDHEIM (BAD.-WÜRTT.)<br />
Was soll das, neun und fünf (!) Jahre alte<br />
Kinder in diese Gedenkstätte zu schleppen<br />
und sich dann angeblich „unwohl“<br />
zu fühlen, wenn die dort Fangen spielen?<br />
Hätte nicht ein Elternteil mit den Kleinen<br />
woanders hingehen können? Für so eine<br />
Entscheidung genügt der gesunde Menschenverstand,<br />
dazu braucht man nicht<br />
verquaste Überlegungen zum Aura-Begriff<br />
bei Walter Benjamin anzustellen.<br />
MARGRIT STIER, MÜNCHEN<br />
Korrektur<br />
zu Heft 47/2013<br />
Seite 124, „Die haben auch noch<br />
mehr Geld“: Die bei Christie’s am 12.<br />
November für 57,3 Millionen Dollar<br />
versteigerte Abbildung einer Cola -<br />
flasche ist nicht der teuerste Andy<br />
Warhol aller Zeiten. Tags darauf erzielte<br />
Warhols „Silver Car Crash<br />
(Double Disaster)“ bei Sotheby’s in<br />
New York die Rekordsumme von<br />
mehr als 105 Millionen Dollar.<br />
Filmszene aus „Jung & Schön“<br />
Nr. 46/2013, François Ozons Film „Jung &<br />
Schön“ befeuert die Auseinandersetzung<br />
über die Abschaffung der Prostitution<br />
Warum so lustfeindlich?<br />
Wenn Sie schreiben: „Darauf muss man<br />
erst mal kommen, beim Thema Prostitution<br />
die Sorge um die männliche Lust in<br />
den Mittelpunkt zu rücken, eine eigenwillige<br />
Perspektive“, klingt das doch arg anmaßend.<br />
Glauben Sie denn, die männliche<br />
Lust sei nur so eine Laune, die man genauso<br />
gut auch lassen könnte? Sie ist eine<br />
biologische Triebkraft, die nicht so ohne<br />
weiteres durch die Ratio steuerbar ist und<br />
die ein Quell von Lebensfreude, aber auch<br />
eine verdammte Last sein kann.<br />
HOLGER MARZEWSKI, DÜSSELDORF<br />
Die Ursachen für die Prostitution sind<br />
weniger in den etwaigen Perversionen<br />
der Männer zu suchen als in der Tatsache,<br />
dass die meisten Frauen Sex mit dem Partner<br />
in etwa so betrachten, wie sie die<br />
Margarine auf den Abendbrottisch stellen.<br />
Prostitution zu verbieten würde bedeuten,<br />
dass man künstlich Kriminalität<br />
schafft, die dann im Verborgenen wühlt.<br />
HANS MAYER, DOSSENHEIM (BAD.-WÜRTT.)<br />
Warum geben Sie sich so lustfeindlich?<br />
Was sollte denn im Zentrum der Prostitutionsfrage<br />
stehen, wenn nicht die männliche<br />
Lust? Um die geht es doch dabei.<br />
DR. OLIVER BÜHRLE, STUTTGART<br />
Die Filmprotagonistin hat sich freiwillig<br />
für diese Arbeit entschieden, so wie die<br />
meisten Sexarbeiterinnen – auch wenn es<br />
viele gibt, die diese Arbeit nicht gern tun.<br />
Aber so ist das in jedem anderen Beruf<br />
auch, und für viele ist es das kleinere Übel.<br />
Warum maßen sich Frau Schwarzer und<br />
Co. an, Sexarbeit verbieten zu wollen. Gerechte<br />
Regelungen dafür: ja gern.<br />
BARBARA RUF, AUGSBURG<br />
Die Prostitution wird und muss es immer<br />
geben! Indes – die Zuhälterei muss unbedingt<br />
abgeschafft werden, und da kann das<br />
Strafmaß nicht hoch genug sein.<br />
FRIEDEL VOLLMER, ARNSBERG (NRW)<br />
Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe – bitte mit<br />
Anschrift und Telefonnummer – gekürzt und auch elektronisch<br />
zu veröffentlichen. Mail an: leserbriefe@spiegel.de<br />
WELTKINO FILMVERLEIH<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3 13
Panorama<br />
Deutschland<br />
McAllister<br />
PETER STEFFEN<br />
E U R O PAWA H L<br />
McAllister soll an<br />
die Spitze<br />
Die CDU plant, mit David McAllister als deutschem Spitzenkandidaten<br />
in die Europawahl im Mai 2014 zu ziehen. Zwar<br />
ist eine offizielle Entscheidung noch nicht gefallen, führende<br />
CDU-Politiker haben sich jedoch im Grundsatz verständigt.<br />
Auch Parteichefin Angela Merkel hat sich in einem Gespräch<br />
mit McAllister offen gezeigt. Die Frage der Spitzenkandi -<br />
datur ist in der CDU komplizierter als in anderen Parteien,<br />
da CDU und CSU bei der Europawahl nicht mit einer<br />
deutschlandweiten Liste, sondern mit Landeslisten antreten.<br />
McAllister, der gemeinsam mit CDU-Politikern um Generalsekretär<br />
Hermann Gröhe das Europawahlprogramm der<br />
Partei ausarbeitet, soll zunächst am Samstag zum Spitzenmann<br />
der Niedersachsen-CDU gewählt werden. Wie<br />
bei den Europawahlen 2004 und 2009 soll es aber auch einen<br />
deutschlandweit plakatierten Spitzenkandidaten geben.<br />
So soll McAllister der deutsche Hauptgegner von EU-Parlamentspräsident<br />
Martin Schulz von der SPD werden, der<br />
Anfang November zum Spitzenkandidaten der europäischen<br />
Sozialdemokraten gekürt wurde. Außerdem soll McAllister<br />
die europakritischen Töne aus der Schwesterpartei CSU<br />
ausgleichen. Diese dürften deutlich anschwellen, nachdem<br />
Parteichef Horst Seehofer den Anti-Euro-Rebellen Peter<br />
Gauweiler für die CSU-Spitze vorgeschlagen hat.<br />
K I N D E S M I S S B R A U C H<br />
Union will Vertreter der<br />
Opfer abschaffen<br />
Familienpolitiker der Union wollen<br />
die erst 2010 geschaffene unabhängige<br />
Stelle gegen Kindesmissbrauch in dieser<br />
Form offenbar nicht erhalten.<br />
In den Verhandlungen<br />
über eine Große Koalition<br />
überraschten CDU-Unterhändler<br />
die SPD mit dem Vorschlag,<br />
nur noch einen „Kinderrechtebeauftragten“<br />
ein -<br />
zusetzen, der unter anderem<br />
für das Thema Missbrauch zuständig<br />
wäre. Die SPD lehnt<br />
das ab. Am vorigen Donnerstag<br />
konnten sich die Parteien<br />
in der Arbeitsgruppe Familie Rörig<br />
nicht einigen. Intern heißt es, womöglich<br />
müsse Kanzlerin Angela Merkel<br />
am Ende den Streit entscheiden, wenn<br />
es zu einer Koalition kommt. Nach<br />
den Missbrauchsskandalen in der katholischen<br />
Kirche und der Odenwaldschule<br />
war die Stelle des Missbrauchsbeauftragten<br />
2010 von Union und FDP<br />
gegründet worden. Er entwickelte sich<br />
zum Bündnispartner für Betroffeneninitiativen<br />
und warf der Bundesregierung<br />
wiederholt Untätigkeit<br />
vor.<br />
Nun soll die Stelle womöglich<br />
wieder unter stärkere politische<br />
Aufsicht kommen. Der<br />
Unabhängige Beauftragte Johannes-Wilhelm<br />
Rörig spricht<br />
von einem „unverantwortlichen<br />
Signal“. Eine Abwertung<br />
der Stelle würde bedeuten,<br />
dass die Belange der Betroffenen<br />
„wieder entsorgt werden“.<br />
ROLF ZÖLLNER / EPD<br />
A T O M K R A F T<br />
Mängel bei der Kühlung<br />
Ein Gutachten von Wiener Risikoforschern<br />
stellt den Betrieb des Atomkraftwerks<br />
im schwäbischen Gundremmingen<br />
in Frage. Die Experten um den<br />
früheren Abteilungsleiter im Bundesumweltministerium<br />
Wolfgang Renneberg<br />
bemängeln die Sicherheit des Nachkühlsystems.<br />
Im Fall eines Erdbebens verfüge<br />
es nicht über genügend Notfall-Wasserkreisläufe,<br />
die eine Kernschmelze<br />
verhindern sollen. Nach dem Atomgesetz<br />
„kommt der Widerruf der Anlagengenehmigung<br />
in Betracht“, urteilen die<br />
Gutachter. Sie halten selbst eine „einstweilige<br />
Stilllegung“ für angemessen, bis<br />
der Betreiber RWE Sicherheitsnachweise<br />
vorlegen könne. Das Gutachten hatte<br />
eine Bürgerinitiative in Auftrag gegeben.<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3 15
Panorama<br />
AUSSENMINISTERIUM<br />
Comeback Steinmeier<br />
MAURIZIO GAMBARINI / DPA<br />
Kommt die Große Koalition zustande,<br />
soll Frank-Walter Steinmeier<br />
(SPD) Außenminister werden.<br />
In den Führungen von SPD<br />
und Union gibt es daran keinen<br />
nennenswerten Zweifel mehr.<br />
„Steinmeier ist gesetzt“, heißt es<br />
in hochrangigen Parteikreisen.<br />
Auch Steinmeier ließ gegenüber<br />
Vertrauten mehrfach deutlich<br />
werden, dass er sich auf eine<br />
Rückkehr ins Auswärtige Amt<br />
eingestellt hat. Dort sind seine<br />
vier Jahre (2005 bis 2009) als Minister<br />
in überwiegend guter Erinnerung.<br />
Enge Mitarbeiter Steinmeiers<br />
sind bereits auf Vorbereitungstour<br />
im Haus unterwegs.<br />
Ein Grund: Mehrere Personalien<br />
sind dringend zu klären. Dazu<br />
zählt mindestens ein Staatssekretärsposten,<br />
der Abteilungsleiter<br />
Europa und die vakanten Botschafterstellen<br />
in Tokio, Moskau<br />
und London. Wie es in einem<br />
Wahljahr üblich ist, hat Noch-<br />
Amtsinhaber Guido Westerwelle<br />
die Besetzungen im Sommer<br />
nicht mehr vollzogen, sondern<br />
überlässt sie seinem Nach -<br />
folger – der, wenn es so kommt,<br />
auch sein Vorgänger war.<br />
Die vergangene Woche war eine wichtige für die Emanzipationsbewegung<br />
in Deutschland. Bei den Koali -<br />
tionsverhandlungen kam die Arbeitsgruppe „Familie,<br />
Frauen und Gleichstellungspolitik“ überein, das Wahlrecht<br />
für weibliche Mitbürger beizubehalten. Auch das Recht, ein<br />
Fahrzeug zu lenken, soll nicht angetastet werden. Offen ist<br />
lediglich, ob ausländische Frauen für die Benutzung deutscher<br />
Autobahnen künftig eine Mautgebühr<br />
TREIBHAUS BERLIN<br />
Quote und<br />
Peitsche<br />
entrichten müssen. Ansonsten aber sehen<br />
die Beschlüsse eine Verbesserung der Entfaltungsmöglichkeiten<br />
von Frauen vor. So<br />
wird es eine Quote von 30 Prozent für Aufsichtsräte<br />
geben. Zudem wird die unterschiedliche<br />
Bezahlung von Männern und<br />
Frauen abgeschafft. Unterm Strich geht es<br />
für die deutsche Frau also voran.<br />
Etwas anders stellt sich die Lage in unserem<br />
Partnerland Saudi-Arabien dar, wo die<br />
Gleichstellung eher behutsam vorangetrieben<br />
wird. Immerhin: In Fachgeschäften für<br />
Damenunterwäsche dürfen seit neuestem<br />
nur noch Frauen die weibliche Kundschaft<br />
beraten. Das war bisher weithin Männer -<br />
sache. Saudi-arabischen Frauen ist es jedoch<br />
weiterhin verboten, Auto zu fahren. Wer dennoch fährt,<br />
kann ausgepeitscht werden. An den ohnehin nicht demokratischen<br />
Wahlen dürfen Frauen bislang nicht teilnehmen.<br />
Auch interessant: Wenn sie reisen, heiraten, zur Schule gehen,<br />
studieren oder das Gesundheitssystem nutzen wollen,<br />
benötigen saudische Frauen die Zustimmung eines männlichen<br />
Vormunds. Dieser wird, wie es sich in diesem hochtechnologisierten<br />
Mittelalterstaat gehört, bequem per SMS<br />
gewarnt, wenn seine Frau das Land verlassen möchte. Wird<br />
eine Frau vergewaltigt, muss sie vier männliche Zeugen benennen,<br />
die ihre Version bestätigen, damit der Täter verurteilt<br />
werden kann.<br />
Kurz nachdem die Arbeitsgruppe „Gleichstellung“ in Berlin<br />
ihre Erfolge verkündete, wurde im Bundeskabinett der Rüstungsexportbericht<br />
verabschiedet. Spitzenreiter<br />
bei den genehmigten Exporten deutscher<br />
Rüstungsgüter war vergangenes Jahr<br />
Saudi-Arabien, das bei einer Studie über die<br />
Situation von Frauen in der islamisch geprägten<br />
Welt gerade erst den drittschlechtesten<br />
Platz belegte – hinter dem Irak, der<br />
in der Rangliste deutscher Waffenexporte<br />
auf einen beachtlichen zweiten Platz kam.<br />
Im Gegensatz zur Gleichstellung der<br />
deutschen Frau ist eine wesentliche Begrenzung<br />
deutscher Rüstungsexporte im Koalitionsvertrag<br />
übrigens nicht vorgesehen.<br />
Man könnte jetzt fragen, warum die emanzipatorisch<br />
so fortschrittliche Bundesrepublik<br />
mit ihren Rüstungsprodukten Regime<br />
wie Saudi-Arabien bei der Kontrolle ihrer<br />
Grenzen, ihrer weiblichen Bevölkerung und damit beim Erhalt<br />
ihrer Macht unterstützt. Man könnte fragen, warum bei<br />
den Koalitionsverhandlungen keine Quote für Rüstungs -<br />
exporte festgeschrieben wird. Und warum die Rechte nichtdeutscher<br />
Frauen weiter so viel weniger zählen. Aber das<br />
wäre womöglich naiv, wenig patriotisch und insgesamt zu<br />
idealistisch gedacht.<br />
Markus Feldenkirchen<br />
16<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3
Deutschland<br />
B U N D E S W E H R<br />
Neue Rüstungspleite?<br />
Die letzte Hoffnung von Verteidigungsminister<br />
Thomas de Maizière<br />
(CDU), dem Debakel um die Auf -<br />
klärungsdrohne „Euro Hawk“ etwas<br />
Positives abzugewinnen, schwindet.<br />
Die Bundeswehr lässt auch den Verzicht<br />
auf die 360 Millionen Euro teure<br />
Si gnaltechnik Isis prüfen, die ein Teil<br />
des gescheiterten Rüstungsprojekts war.<br />
Bislang hatte man nach neuen Trägerplattformen<br />
für Isis gesucht. Nun wies<br />
Generalinspekteur Volker Wieker<br />
das Beschaffungsamt am 4. November<br />
nach Angaben des Verteidigungs -<br />
ministeriums an, „mindestens einen<br />
Lösungsvorschlag ohne die Nutzung<br />
von Isis zu erarbeiten“. Geprüft<br />
würden jetzt „marktverfügbare Produkte“,<br />
etwa ein mit einem israelischen<br />
Aufklärungssystem ausgerüsteter<br />
Gulf stream-Jet. Bis Jahresende<br />
sollen die Ergebnisse der Prüfung vorliegen.<br />
De Maizière hatte sich in der<br />
„Euro Hawk“-Affäre im Sommer mit<br />
dem Hinweis verteidigt, das Geld für<br />
Isis sei „sinnvoll investiert“, weil<br />
diese Technik auch ohne die Drohne<br />
nutzbar sei. Aber die Beschaffung<br />
einer neuen Komplettlösung könnte<br />
günstiger sein als das Festhalten<br />
an Isis.<br />
Drohne „Euro Hawk“<br />
CHAD SLATTERY<br />
A F F Ä R E N<br />
„Teures CDU-Erbe“<br />
Der Stuttgarter<br />
Abgeordnete Sascha<br />
Binder, 30<br />
(SPD), über das<br />
neue Gutachten<br />
zum EnBW-Deal<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Der Münchner Wirtschafts -<br />
wissenschaftler Wolfgang Ballwieser<br />
hat in seinem Gutachten im Auftrag<br />
der Staatsanwaltschaft Stuttgart<br />
errechnet, dass der damalige CDU-<br />
Ministerpräsident Stefan Mappus<br />
780 Millionen Euro zu viel für den<br />
Rückkauf von Anteilen am Energie -<br />
riesen EnBW vom französischen<br />
Konzern EdF gezahlt hat. Hat das<br />
Gutachten Auswirkungen auf die<br />
Schiedsklage, die das Land gegen die<br />
EdF eingereicht hat?<br />
Binder: Es zeigt auf jeden Fall, dass wir<br />
mit unserer Rückforderung von rund<br />
800 Millionen Euro richtig liegen. Die<br />
CDU muss jetzt endlich ihre Blockadehaltung<br />
in dieser Frage aufgeben.<br />
Im Untersuchungsausschuss sollten wir<br />
prüfen, ob wir erneut Zeugen befragen<br />
müssen. Weitere Akten, die bei<br />
PICTURE ALLIANCE / DPA<br />
der EdF beschlagnahmt wurden, sind<br />
angeblich schon seit zwei Wochen auf<br />
dem Weg nach Stuttgart.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Stefan Mappus war nur<br />
15 Monate lang im Amt, die<br />
Aufarbeitung seiner Amtszeit dauert<br />
nun schon zweieinhalb Jahre.<br />
Binder: Das ist in der Geschichte von<br />
Baden-Württemberg wirklich ein<br />
einmaliger Vorgang. Die CDU hat uns<br />
da ein teures Erbe hinterlassen. Der<br />
Wahlkampf-Gag von Mappus hat den<br />
Steuerzahler viel Geld gekostet: Für<br />
die von Ballwieser errechnete Summe<br />
könnte man gut 14000 Lehrer ein Jahr<br />
lang beschäftigen. Die von Mappus so<br />
gern zitierte schwäbische Hausfrau<br />
wäre entsetzt über diesen unprofessionellen<br />
Deal.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Das Gutachten war in der vergangenen<br />
Woche kaum veröffentlicht,<br />
da haben die Anwälte von Stefan<br />
Mappus und dem damaligen Morgan-<br />
Stanley-Banker Dirk Notheis es als<br />
parteiisch kritisiert.<br />
Binder: Diese Haltung überrascht mich<br />
nicht, man sieht daran, wie sehr die<br />
beiden mit dem Rücken zur Wand stehen.<br />
Einem Gutachten der Staats -<br />
anwaltschaft mangelnde Neutralität<br />
vorzuwerfen und selbstfinanzierte<br />
Gegengutachten ins Feld zu führen ist<br />
geradezu lächerlich.<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3 17
Deutschland<br />
Panorama<br />
GLADYS CHAI VON <strong>DER</strong> LAAGE / ACTION PRESS<br />
BRITTA PE<strong>DER</strong>SEN / PICTURE ALLIANCE / DPA<br />
AMIN AKHTAR / LAIF<br />
Mertesacker Loos Biolek Liefers Wenders<br />
MAURICE WEISS / OSTKREUZ<br />
HUBERT BOESL / PICTURE ALLIANCE / DPA<br />
E N T W I C K L U N G S H I L F E<br />
Mehr Geld gegen Armut<br />
Zahlreiche Prominente haben sich in<br />
einem Brief an die Parteivorsitzenden<br />
Angela Merkel, Horst Seehofer und<br />
Sigmar Gabriel gewandt, um für höhere<br />
Entwicklungshilfeausgaben zu werben.<br />
„Wir bitten Sie, sich in den laufen -<br />
den Verhandlungen zwischen CDU,<br />
CSU und SPD dafür einzusetzen, dass<br />
der Koalitionsvertrag einen starken<br />
deutschen Beitrag für den Kampf gegen<br />
extreme Armut festschreibt“,<br />
heißt es in dem Brief, „unsere Generation<br />
hat die Chance, extreme Armut<br />
praktisch zu beenden.“ Zu den Unterzeichnern<br />
zählen der Talkmaster Alfred<br />
Biolek, die Schauspieler Jan Josef<br />
Liefers und Anna Loos, der Regisseur<br />
Wim Wenders und der Fußballer Per<br />
Mertesacker. Sie verweisen in dem<br />
Schreiben auf die Wahlprogramme von<br />
Union und SPD, in denen sich die<br />
Parteien auf Mehrausgaben von bis zu<br />
einer Milliarde Euro jährlich festgelegt<br />
haben. Bisher konnten sich Union und<br />
SPD in den Koalitionsverhandlungen<br />
zwar darauf verständigen, ihre Verpflichtungen<br />
in der Entwicklungshilfe<br />
ernst zu nehmen. Spürbare Mehrausgaben<br />
für Entwicklungsländer werden<br />
jedoch eher nicht erwartet.<br />
18<br />
V E R F A S S U N G S S C H U T Z<br />
Freiraum für Scientology<br />
Das Bundesamt für Verfassungsschutz plant, die Beobachtung<br />
der Scientology-Organisation praktisch einzustellen –<br />
und verärgert damit mehrere Länder. Das Bundesamt wolle<br />
seine Prioritäten neu ordnen und daher die Beschäftigung<br />
mit Scientology „auf ein Minimum reduzieren“, heißt es in<br />
einem Schreiben an die Landesbehörden für Verfassungsschutz<br />
vom 19. Oktober. Die Bedeutung des Konzerns, der<br />
sich als Kirche ausgibt, nehme ohnehin ab. Bundesweit soll<br />
die Organisation, der im aktuellen Verfassungsschutzbericht<br />
ein „totalitärer Charakter“ attestiert wird, noch rund<br />
4000 Mitglieder haben, besonders in Großstädten. Der Ver -<br />
fassungsschutz versucht, seine Kräfte derzeit in Richtung<br />
Spionageabwehr zu bündeln;<br />
nach dem Auffliegen des<br />
Terrortrios NSU war bereits<br />
die Abteilung Rechtsextre -<br />
mismus deutlich gestärkt worden.<br />
Der Plan, Scientology<br />
aus der Beobachtung zu entlassen,<br />
trifft aber auf Gegenwehr.<br />
Niedersachsen hat<br />
Bedenken geäußert, auch<br />
Hamburg und andere Länder<br />
wollen nicht mitziehen. Scientology-Zentrale in Berlin<br />
JOCHEN ZICK / ACTION PRESS<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3<br />
F Ö D E R A L I S M U S<br />
Länder wollen 20 Milliarden vom Bund<br />
Die Reform der Finanzbeziehungen zwischen Bund und<br />
Ländern könnte für den künftigen Bundesfinanzminister sehr<br />
teuer werden. Das geht aus einem bislang unter Verschluss<br />
gehaltenen „Meinungsbild“ der Länderfinanzminister hervor.<br />
Darin fordern sie, dass der Bund ihnen ab 2020 mindestens<br />
20 Milliarden Euro pro Jahr mehr zur Verfügung stellt,<br />
als eigentlich vorgesehen war. Hintergrund: Der Solidarpakt<br />
für Ostdeutschland und andere Finanzhilfen für die Länder<br />
laufen Ende 2019 aus. Der Solidaritätszuschlag, der allein<br />
dem Bundeshaushalt zufließt, soll aber wohl bleiben.<br />
Nach Rechnung der Länder entlasten diese Effekte den<br />
Bundeshaushalt um jene 20 Milliarden Euro pro Jahr. Das<br />
wollen die Finanzminister der Länder nicht akzeptieren.<br />
„Für die Zeit ab 2020 sind Anschlussregelungen erforderlich,<br />
um den Ländern auch künftig entsprechende Mittel in Höhe<br />
von 20 Milliarden Euro jährlich zur Verfügung zu stellen“,<br />
schreiben sie in ihrer vertraulichen Stellungnahme an die<br />
Ministerpräsidenten. Nur so könne gewährleistet werden, dass<br />
sie über eine „ausreichende, den Aufgaben angemessene<br />
Finanzausstattung“ verfügten. Zusätzlich fordern die Länder<br />
eine „Lastenverschiebung“ bei den Sozialausgaben, die vor<br />
allem die Haushalte von Städten und Gemeinden belasten.<br />
Bislang beteiligt sich der Bund nur zum Teil an den insgesamt<br />
45 Milliarden Euro Sozialausgaben der Kommunen.
Titel<br />
Der Basis-Effekt<br />
Der Mitgliederentscheid der SPD wird zum unberechen -<br />
baren Risiko. Bundesweit mobilisieren die Gegner<br />
von Schwarz-Rot. Die Große Koalition kann noch vor dem<br />
Start scheitern – an einigen tausend wütenden Genossen.<br />
Dass er einen schweren Stand haben<br />
würde, hatte Michael Roth<br />
gewusst. Doch damit hatte der<br />
Generalsekretär des hessischen SPD-Landesverbands<br />
nicht gerechnet: nicht mit<br />
blanker Wut, nicht mit kaum verhohlenem<br />
Hass, nicht mit einer solchen Mauer<br />
der Ablehnung gegen das, was die SPD<br />
in Berlin plant und in Hessen gern gehabt<br />
hätte, die Große Koalition.<br />
Mehr als 300 Genossen haben sich vorigen<br />
Mittwoch in einem Frankfurter Stadtteil-Bürgerhaus<br />
versammelt. Kaum wagt<br />
Roth einen zaghaften Versuch, um für das<br />
Regierungsbündnis mit der Union zu werben,<br />
da geht es hoch her. „Das ist doch<br />
absurd, was du da sagst!“, ruft ein ergrauter<br />
Sozialdemokrat aus der Mitte des Saals.<br />
„Echt daneben!“, verstärkt dessen Sitznachbar,<br />
„Lüge!“, ruft jemand von hinten.<br />
Die Basis kocht: „Bei uns“, so der Vorsitzende<br />
eines Frankfurter SPD-Ortsvereins,<br />
„wird keiner für die Große Koalition<br />
stimmen.“ Generalsekretär Roth sinkt auf<br />
der Bühne immer mehr in sich zusammen.<br />
Und wenn einer ans Mikrofon tritt<br />
und ankündigt, der Großen Koalition<br />
nicht zuzustimmen, erhebt sich immer<br />
wieder tosender Applaus.<br />
Wie in Frankfurt geht es in diesen Tagen<br />
überall im Land auf vielen Regionalversammlungen<br />
und Ortsvereinstreffen der<br />
SPD zu. Der Mitgliederentscheid, den Parteichef<br />
Sigmar Gabriel im Sommer vorgeschlagen<br />
hatte, um der SPD den Weg in<br />
die ungeliebte Große Koalition zu ebnen,<br />
ist zum unkalkulierbaren Risiko geworden<br />
– mit weitreichenden Folgen für die<br />
Partei, für Deutschland und für Europa.<br />
Was anfangs wie eine gute Idee ausgesehen<br />
hatte, um die unwillige Basis einzubinden<br />
und die Union in den Koali -<br />
tionsverhandlungen unter Druck zu setzen,<br />
ist zum Alptraum für die Parteiführung<br />
geworden. Je näher das Ende der<br />
Koalitionsverhandlungen rückt, desto größer<br />
wird die Sorge der SPD-Spitze, dass<br />
die rund 470000 SPD-Mitglieder am Ende<br />
mehrheitlich die Zustimmung verweigern.<br />
Wenn sich 40 Prozent der Mitglieder am<br />
Votum beteiligen, reichen 100000 Neinstimmen,<br />
um in Deutschland etwas auszulösen,<br />
was man eine Staatskrise nennen<br />
müsste. Das Schicksal der Führungsmacht<br />
Europas liegt in der Hand der SPD-Basis,<br />
der es vielleicht gar nicht nur um den<br />
Koalitionsvertrag geht, sondern auch um<br />
alte Rechnungen mit ihrer Führung.<br />
Eine Prognose, wie es ausgeht, traut sich<br />
niemand mehr zu. „Unsere Mitglieder stellen<br />
eine Menge Fragen zur Großen Koalition.<br />
Das ist vollkommen berechtigt“,<br />
warnt EU-Parlamentspräsident Martin<br />
Schulz. „Wir müssen uns alle zusammen<br />
noch sehr anstrengen, die Partei mitzunehmen.<br />
Die Sache ist noch nicht gelaufen.“<br />
Er will kämpfen. Deutlicher wird SPD-Generalsekretärin<br />
Andrea Nahles bei der ersten<br />
Regionalkonferenz vergangenen Freitag<br />
in der Nähe von Stuttgart: „Wir können<br />
noch nicht sagen, ob der Koalitionsvertrag<br />
zustande kommt. Ich bin total angespannt.“<br />
Täglich erreichen die SPD-Parteizentrale<br />
schlechte Nachrichten von der Basis. Eine<br />
<strong>SPIEGEL</strong>-Recherche in 18 Bezirks- und<br />
Kreisverbänden sowie 26 Ortsvereinen von<br />
Ostholstein bis Oberfranken ergab, dass<br />
die Große Koalition in zahlreichen Parteizellen<br />
keine Mehrheit bekommen könnte.<br />
Manche sind noch unentschieden, aber viele<br />
Mitglieder sind entschlossen, ihrer Parteiführung<br />
die Gefolgschaft zu verweigern.<br />
Auch die Jusos wollen sich gegen den<br />
Koalitionsvertrag stellen. „Meine der -<br />
MARCUS SIMAITIS / PICTURE ALLIANCE / DPA<br />
SPD-Ortsverein Bochum Langendreer: Mauer der<br />
zeitige Einschätzung ist, dass es keine<br />
Mehrheit der Jusos für ein Ja zum Koalitionsvertrag<br />
geben wird“, sagt Johanna<br />
Ueker mann, die sich in zwei Wochen zur<br />
Juso-Chefin wählen lassen will. Und<br />
Klaus Barthel, Chef der Arbeitnehmer<br />
in der SPD, weigert sich, seinen Mitgliedern<br />
die Zustimmung zu empfehlen.<br />
Irritiert schauen die Nachbarn auf das<br />
Land, von dem sie Führung in Europa er-<br />
20<br />
„Unsere Funktionäre,<br />
die wochenlang Straßenwahlkampf<br />
gemacht<br />
haben, sind eher dagegen.<br />
Sie haben Angst, dass<br />
wir als SPD jetzt unter<br />
die Räder kommen.“<br />
Andreas Müller, stellv. Geschäftsführer<br />
„Unser Landesvorstand<br />
hat sich schon am<br />
25. September gegen<br />
eine Große Koalition<br />
ausgesprochen.<br />
Dieser Beschluss<br />
steht nach wie vor.“<br />
Dirk Panter, Generalsekretär<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3<br />
„Bei uns an der Basis<br />
herrscht große Skepsis.<br />
Außerdem: So wie die CSU<br />
auftritt, kann ich nur sagen:<br />
Das Gesprächsklima in Bayern<br />
ist derzeit sehr vergiftet.“<br />
Gabriele Fograscher, MdB<br />
und kommissarische Vorsitzende
Ablehnung gegen die Große Koalition<br />
warten. Seit mehr als zwei Monaten ist<br />
Berlin ohne neue Regierung. Wichtige<br />
Entscheidungen werden vertagt. Und sollten<br />
die SPD-Mitglieder den Koalitionsvertrag<br />
ablehnen, würde die Ungewissheit<br />
weitere Wochen, vielleicht Monate<br />
andauern. Am Ende stünden womöglich<br />
sogar Neuwahlen.<br />
Noch ist es nicht so weit. Aber das Erwartungsmanagement<br />
ist schwierig geworden.<br />
Für Gabriel wird es nicht leicht, die<br />
Koalitionsverhandlungen zu einem Abschluss<br />
zu bringen, den die Basis akzeptieren<br />
kann. Mindestlohn und doppelte<br />
Staatsbürgerschaft waren im Grunde<br />
schon vor Beginn der Verhandlungen eingepreist.<br />
Sie haben den Unmut nicht besänftigt,<br />
aber weitere große Trophäen werden<br />
die Sozialdemokraten nicht heimtragen.<br />
Eine zunehmend verärgerte Union<br />
ist nicht mehr zu Zugeständnissen bereit,<br />
vor allem, wenn sie Geld kosten. „Angesichts<br />
des klaren Wahlergebnisses und der<br />
damit verbundenen klaren Erwartungen<br />
unserer Wähler darf die SPD ihre Forderungen<br />
nicht überdrehen“, warnt Finanzminister<br />
Wolfgang Schäuble im <strong>SPIEGEL</strong>-<br />
Gespräch (siehe Seite 30).<br />
Wenn die SPD-Mitglieder Anfang Dezember<br />
per Briefwahl ihr Kreuz bei Ja<br />
„Die Partei ist nur für einen<br />
Politikwechsel zu haben:<br />
Flächendeckender Mindestlohn,<br />
Rentenangleichung in Ost und<br />
West, Abschaffung des Betreuungsgeldes,<br />
Bürgerversicherung, Anhebung<br />
des Spitzensteuersatzes.“<br />
Aus einem Brief an die Mitglieder<br />
„Mitregieren<br />
heißt mitgestalten,<br />
nicht regieren<br />
heißt nicht<br />
gestalten.“<br />
Roger Lewentz,<br />
Landesparteichef<br />
„Einige sind skeptisch,<br />
aber die meisten sagen<br />
doch: Wenn die Kernthemen<br />
der SPD drin<br />
sind, stimme ich dem<br />
Koalitionsvertrag zu.“<br />
Bodo Wiechmann,<br />
Vorsitzender<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3 21
Titel<br />
oder Nein machen, entscheiden sie nicht<br />
nur über das Schicksal der künftigen Regierung,<br />
sondern auch über das Schicksal<br />
ihres Vorsitzenden. Scheitert der Mitgliederentscheid,<br />
dann scheitert Parteichef<br />
Gabriel. Ein Nein der Mitglieder würde<br />
die Parteiführung hinwegfegen und die<br />
SPD in die schwerste Krise der Nachkriegsgeschichte<br />
stürzen.<br />
Aber denken die Mitglieder so weit?<br />
Entscheiden sie rational – oder sind sie<br />
einfach nur sauer, nutzen sie den Entscheid<br />
aus, ihren über Jahre angestauten<br />
Frust über die Parteiführung Luft zu machen?<br />
Die Kluft zwischen „denen da<br />
oben“ und „uns hier unten“ wurde auf<br />
dem misslungenen Parteitag in Leipzig<br />
greifbar, als die anderthalbstündige Rede<br />
des Parteivorsitzenden weitgehend ohne<br />
Applaus blieb. Beklatscht wurden nur<br />
jene Passagen, in denen Gabriel die schrödersche<br />
Basta-Politik geißelte.<br />
Im Mai noch hatten die Sozialdemokraten<br />
mit Stolz und Pomp den 150. Geburtstag<br />
ihrer Partei gefeiert. Wenige Monate<br />
später hat sie ihr altes Dilemma wieder<br />
eingeholt, ihr ewiger Konflikt zwischen<br />
Anspruch und Wirklichkeit, das Dilemma<br />
einer Partei, deren Utopie einer<br />
gerechten Gesellschaft so oft an der Wirklichkeit<br />
zerbricht. Für die Sozialdemokraten<br />
ist deshalb nicht sicher, was – frei<br />
nach Franz Müntefering – mehr Mist ist –<br />
Kompromiss oder Opposition.<br />
Die fürs Regieren notwendigen Kompromisse<br />
haben die Partei schon oft belastet.<br />
Immer wieder strafte sie dafür ihr<br />
Führungspersonal ab. Helmut Schmidt<br />
lernte diese Lektion, als er den Sozial -<br />
demokraten den Nato-Doppelbeschluss<br />
aufzwang. Gerhard Schröder versagte die<br />
Partei die Gefolgschaft, nachdem er die<br />
Agenda 2010 durchgepaukt hatte. Doch<br />
dieses Mal ist es schlimmer: Dieses Mal<br />
droht die SPD schon am Regieren zu<br />
scheitern, bevor sie überhaupt damit begonnen<br />
hat.<br />
Spätestens beim Bundesparteitag Mitte<br />
November in Leipzig wurde vielen Genossen<br />
klar, wie knapp es mit einer Zustimmung<br />
werden dürfte. Die gesamte<br />
Führung wurde bei den Vorstandswahlen<br />
abgestraft, neue Gräben brachen auf. „Es<br />
sind alle fröhlich gekommen – und sehr<br />
verunsichert nach Hause gefahren“, berichtet<br />
ein Landesvorsitzender aus Westdeutschland.<br />
Kurz vor dem Parteiabend trafen sich<br />
in den Messehallen mehrere Jusos zum<br />
Gedankenaustausch. Eigentlich sollte es<br />
um die Vorbereitung des Bundeskongresses<br />
gehen, in zwei Wochen wählen die<br />
Jusos eine neue Spitze. Doch als sich die<br />
sozialdemokratischen Nachwuchskräfte<br />
in den Konferenzräumen im ersten Stock<br />
über dem Eingangsbereich einfanden,<br />
ging es bald nicht mehr um Anträge für<br />
den Kongress. Es wurde grundsätzlich.<br />
Seit Monaten sind die Jusos auf Ablehnungskurs<br />
gegen die Große Koalition.<br />
Doch auf dem Parteitag brach sich die<br />
Unzufriedenheit bahn. Hinter verschlossenen<br />
Türen kamen sie zu einem eindeutigen<br />
Ergebnis: Große Koalition? Ohne<br />
uns. Zu wenig sei erreicht worden, zu mager<br />
die bisherigen Ergebnisse der Koali -<br />
tionsverhandlungen. „Das ist alles nicht<br />
das, was wir uns vorgestellt haben“, sagt<br />
der nordrhein-westfälische Juso-Chef<br />
Denken die SPD-Mitglieder rational? Oder wollen sie jetzt<br />
den ganzen Frust des vergangenen Jahrzehnts ablassen?<br />
Veith Lemmen, „es ist möglich, dass wir<br />
für Ablehnung plädieren.“<br />
Wie weit das die Stimmung in der ganzen<br />
Partei widerspiegelt, ist unklar. Denn<br />
eine Umfrage unter SPD-Mitgliedern hat<br />
es nicht gegeben. Vor jeder Landtagswahl<br />
ermitteln Wahlforscher zwar im Wochenoder<br />
Tagestakt das aktuelle Stimmungsbild.<br />
Doch vor dem Mitgliederentscheid,<br />
der über das Schicksal der künftigen Regierung<br />
entscheiden wird, tappen Partei<br />
und Nation im Dunkeln. Niemand weiß,<br />
ob sich in diesen Tagen nur die Gegner<br />
lautstark zu Wort melden, oder ob tatsächlich<br />
eine Mehrheit der Genossen den<br />
Koalitionsvertrag ablehnen wird.<br />
Noch nie sei er so unsicher in der Bewertung<br />
seiner Partei gewesen, sagt der<br />
Freiburger Bundestagsabgeordnete Gernot<br />
Erler, einer der erfahrensten SPD-Parlamentarier.<br />
„Wir verlassen uns auf die<br />
wohltuende Wirkung des Koalitionsentwurfs“,<br />
warnt er. „Das ist ein sehr rationales<br />
Kalkül.“ Nicht alle Mitglieder werden<br />
der Vernunft folgen.<br />
Die Nachrichten aus den Regionen, aus<br />
dem „Bauch“ der Partei, sind niederschmetternd.<br />
So hat sich beispielsweise<br />
die komplette SPD Vorderpfalz, mit Städten<br />
wie Ludwigshafen, Speyer und Frankenthal,<br />
mit einem Beschluss „eindeutig<br />
und einstimmig gegen eine Große Koalition<br />
im Bund“ ausgesprochen. Und die<br />
SPD-Bürgermeister und Landräte im<br />
Saarland ließen Gabriel in einem offenen<br />
Brief wissen, dass sie dem Koalitionsvertrag<br />
nur zustimmen würden, wenn es<br />
deutlich mehr Geld für die Kommunen<br />
gebe.<br />
In Thüringen gab der SPD-Kreisparteitag<br />
in der Landeshauptstadt Erfurt die<br />
Richtung für die Mitgliederbefragung vor:<br />
„Die Erfurter Sozialdemokratie lehnt eine<br />
Große Koalition mit der CDU/CSU ab.“<br />
Das schlechte Ergebnis der Bundestagswahl<br />
sei „kein Auftrag zur Regierungsbildung,<br />
sondern ein Auftrag zur personellen<br />
und programmatischen Erneuerung<br />
der SPD“, heißt es in der Begründung.<br />
René Lindenberg, Landesgeschäftsführer<br />
der Thüringer SPD, bezeichnet die<br />
Stimmung im ganzen Landesverband als<br />
„flächendeckend kritisch“. So hat sich der<br />
SPD-Kreisvorstand Gotha gegen eine<br />
Koalition ausgesprochen, ebenso die eher<br />
konservative SPD im Kyffhäuserkreis.<br />
Längst geht der Widerstand gegen die<br />
Große Koalition weit über den Unmut in<br />
einzelnen Ortsvereinen hinaus. Selbst<br />
Pragmatiker wie der sächsische Landesvorsitzende<br />
Martin Dulig wollen der Partei<br />
keine klare Zustimmung für den<br />
Koalitionsvertrag empfehlen. „Ich werde<br />
den Mitgliedern raten, sich mit den inhaltlichen<br />
Ergebnissen auseinanderzusetzen“,<br />
sagt Dulig. Er wolle aber nicht damit<br />
drohen, dass ein Nein Neuwahlen zur<br />
Folge habe. „Das entwertet den Mitgliederentscheid.“<br />
Noch klarer äußert sich der Vorsitzende<br />
der Arbeitnehmer-AG in der SPD<br />
(AfA), der bayerische Bundestagsabgeordnete<br />
Barthel. „Bisher lösen die Ergebnisse<br />
keine Begeisterung aus“, sagt Barthel,<br />
„selbst diejenigen, die einer Großen<br />
Koalition aufgeschlossen gegenüberstanden,<br />
sind bisher enttäuscht.“ Deshalb<br />
wird auch Barthel den AfA-Mitgliedern<br />
keine Zustimmung empfehlen.<br />
Als erster Intellektueller aus der SPD<br />
meldet sich jetzt schon Bestsellerautor<br />
Bernhard Schlink zu Wort, fordert die<br />
Genossen zum Nein gegen die Große<br />
Koalition auf und plädiert stattdessen für<br />
Rot-Rot-Grün (siehe Seite 28).<br />
Der Widerstand zeigt, wie tief die Identitätskrise<br />
der SPD inzwischen geht. Nach<br />
der knappen Wahlniederlage 2005 konnte<br />
sie mit der Union noch auf Augenhöhe<br />
22<br />
„Für die Themen<br />
Mindestlohn,<br />
Wohnungsbaupolitik<br />
und Programm der<br />
sozialen Stadt<br />
erwarten wir eine<br />
Kursänderung.“<br />
Jürgen Pohlmann, Vorsitzender<br />
„Wenn es nachher heißt,<br />
wir haben für ein paar<br />
Posten die Schwarzen<br />
an der Macht gehalten,<br />
dann ist auch noch der<br />
letzte Rest unserer Glaubwürdigkeit<br />
verspielt.“<br />
Michael Dehl, Vorsitzender<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3<br />
„Je höher die Funktion der Genossen<br />
im Land, desto stärker sind die Vorbehalte<br />
gegen eine Große Koalition abgeschliffen,<br />
aber schon auf der mittleren Funktionärsebene<br />
wandelt sich das. Auf kommunaler<br />
Ebene gibt es häufig eine gute Zusammenarbeit<br />
mit der Linkspartei.“<br />
Philipp Weis, Vorsitzender
SPD-Chef Gabriel (M.), Spitzengenossen: Prekäre Lage<br />
CDU-Chefin Merkel, Unions-Verhandlungsführer: Auch für die Kanzlerin ein Risiko<br />
Möglicher Unions-Partner Grüne: Am 6. Januar könnten die Verhandlungen beginnen<br />
STEFFI LOOS / DDP IMAGES / COMMONLENS<br />
WOLFGANG KUMM / DPA<br />
CHRISTIAN THIEL / <strong>DER</strong> <strong>SPIEGEL</strong><br />
verhandeln. Auch für die Wahlschlappe<br />
von 2009 fanden sich Gründe. Für die<br />
Niederlage am 22. September jedoch haben<br />
viele Genossen keine schlüssige Erklärung<br />
mehr. Das Wahlprogramm war<br />
eher links, und die Mitglieder wurden einbezogen.<br />
Ausgezahlt hat sich der Aufwand<br />
nicht.<br />
Stattdessen versetzte das Wahlergebnis<br />
der Partei einen Schock. „Aus einer potentiell<br />
großen Partei wurde eine halbgroße<br />
Partei ohne erkennbare Perspektive“,<br />
sagt der Parteienforscher Gerd Mielke<br />
von der Universität Mainz. Hinzu<br />
kommt, dass die einstmals enge Bindung<br />
der Mitglieder an die Partei gelitten hat.<br />
Zu viele Genossen sind unzufrieden mit<br />
ihrer politischen Heimat. Ein Großteil<br />
von ihnen ist in den siebziger und acht -<br />
ziger Jahren eingetreten, wegen Willy<br />
Brandt, Helmut Schmidt und weil sie an<br />
die großen universellen Ideen glaubten:<br />
an Frieden, Gerechtigkeit und Emanzipation.<br />
Über die Hälfte der Genossen ist<br />
mittlerweile 60 Jahre und älter.<br />
Heute neigen diese in die Jahre gekommenen<br />
Kohorten zur Rebellion. „Je älter,<br />
desto weiter links verortet sich ein SPD-<br />
Mitglied in der Selbsteinschätzung“, sagt<br />
Tim Spier, Professor an der Universität<br />
Siegen, der sich seit Jahren mit der<br />
Sozialstruktur deutscher Parteien beschäftigt.<br />
Spier spricht von einer „Radikalität<br />
des Alters“, die den Mitgliederentscheid<br />
zu einem Verdikt mit unkalkulierbarem<br />
Ausgang macht. Zumal insbesondere in<br />
den höheren Altersgruppen die Wahlbeteiligung<br />
hoch sein werde: „Die in Rente<br />
sind, werden in jedem Fall ihre Stimme<br />
abgeben.“<br />
Unberechenbar wird der Entscheid<br />
auch durch viele aktuelle Neueintritte in<br />
die Partei. Generalsekretärin Nahles hat<br />
sich in einem Schreiben an die Mitglieder<br />
noch erfreut über die Eintrittswelle gezeigt.<br />
Doch niemand weiß, wer in den<br />
vergangenen Wochen das Parteibuch erworben<br />
hat. In Wahrheit muss die Partei<br />
befürchten, dass viele Neumitglieder nur<br />
Genossen werden, um die Große Koali -<br />
tion zu verhindern.<br />
Rolf Jürgen Schmidt ist einer von ihnen.<br />
80 Jahre alt, graues Haar, grauer<br />
Strickpulli. Er ist zur Krisensitzung des<br />
Ortsvereins Schwerin-Paulsstadt im Gasthof<br />
„Das Martins“ gekommen. Vor ihm<br />
auf dem Tisch, neben der Deko aus<br />
Kunstblumen, liegt sein Parteibuch,<br />
brandneu und leuchtend rot, darauf die<br />
drei Buchstaben: SPD. Schmidt holt tief<br />
„Wir haben aus der<br />
letzten Großen Koalition<br />
gelernt. Regieren heißt,<br />
dass man vier Jahre lang<br />
Politik gestalten kann.<br />
Opposition dagegen<br />
wäre Stillstand.“<br />
Bodo Seidenthal, Vorsitzender<br />
„Wir Sozis stimmen immer<br />
mit dem Herzen ab. Nicht<br />
nur mit dem Verstand.<br />
Es gibt klare Vorbehalte<br />
gegen die Große Koalition<br />
bei uns Nürnberger SPDlern.<br />
Angela Merkel muss weg!“<br />
Olaf Schreglmann, Bezirksgeschäftsführer<br />
„Der Wechsel kam viel zu<br />
abrupt. Man kann nicht<br />
jahrelang einen politischen<br />
Gegner bekämpfen und<br />
dann von einem Tag auf den<br />
anderen auf große Freundschaft<br />
machen.“<br />
Klaus Oesterling, Vorsitzender<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3 23
Bundespräsident Gauck: Den Bundestag auflösen, bevor er die Arbeit aufgenommen hat?<br />
Luft und erklärt: „Ich bin seit ein paar<br />
Minuten Mitglied dieser Partei. Weil wir<br />
das, was da in Berlin läuft, nicht hinnehmen<br />
können.“<br />
Vor einigen Wochen sah er Gabriel im<br />
Fernsehen: Wer in die Partei eintritt,<br />
kann mitstimmen, habe der Vorsitzende<br />
erklärt. Schmidt ließ sich das nicht zweimal<br />
sagen. Den Mitgliedsantrag lud er<br />
sich gleich am folgenden Tag aus dem Internet<br />
herunter. „Eine schwarz-rote Diktatur,<br />
das geht gar nicht“, meint der Rentner.<br />
Für ihn ist klar: „Ich stimme auf jeden<br />
Fall dagegen.“ Die Große Koalition<br />
soll scheitern.<br />
Rächen könnte sich nun, dass sich der<br />
Parteivorstand für eine Briefwahl entschieden<br />
hat. Die Alternative wäre eine Stimmabgabe<br />
in den Ortsvereinen gewesen. Da<br />
hätte man noch im direkten Gespräch<br />
Überzeugungsarbeit leisten können. Doch<br />
das wollte die Parteispitze nicht. Den Ergebnissen<br />
hätte man am Ende entnehmen<br />
können, wo die besonders kritischen Genossen<br />
zu Hause sind. Und wo die Freunde<br />
der Großen Koalition.<br />
Mit einer breiten Informationskam -<br />
pagne versucht die Parteiführung nun, die<br />
Genossen zu gewinnen. Alle zwei bis drei<br />
Tage unterrichten Nahles und Gabriel in<br />
einem „Mitgliederbrief“ über den Stand<br />
der Gespräche. Doch weil das die Stimmung<br />
bisher nicht gewendet hat, erhöhte<br />
die Parteispitze ihren Einsatz für den Mitgliederentscheid.<br />
Überall im Land gibt es Regionalkonferenzen,<br />
allein Parteichef Gabriel will<br />
bundesweit an zehn Orten auftreten.<br />
Mehr noch: Die Kreisverbände und Unterbezirke<br />
laden ein, die Bundestags -<br />
abgeordneten sollen durch ihre Wahlkreise<br />
ziehen und für den Koalitionsvertrag<br />
werben. Kein Ortsverein darf unbearbeitet<br />
bleiben.<br />
Falls sich Union und SPD, wie geplant,<br />
bis zum kommenden Mittwoch auf einen<br />
Koalitionsvertrag einigen, würde spätestens<br />
am Freitag an sämtliche Mitglieder<br />
eine Sonderausgabe des „Vorwärts“ verschickt.<br />
Einziger Text: Der Koalitionsvertrag<br />
im Wortlaut. Ab 1. Dezember sollen<br />
dann die Abstimmungsunterlagen in die<br />
Post gehen. Bis Donnerstag, den 12. Dezember,<br />
muss das Antwortkuvert wieder<br />
in Berlin sein.<br />
In der Nacht von Freitag auf Samstag<br />
soll das Zählkommando, rund 400 Freiwillige<br />
stark, in einer eigens angemieteten<br />
Halle in Berlin-Kreuzberg die Arbeit<br />
aufnehmen. Das Endergebnis soll zunächst<br />
dem Parteivorstand zugehen, und<br />
dann noch am Sonntag oder Montag der<br />
Öffentlichkeit bekannt gemacht werden.<br />
Auch wenn die Stimmung aufgeheizt<br />
ist – viele Mitglieder werden ihre endgültige<br />
Entscheidung davon abhängig machen,<br />
was am Ende im Koalitionsvertrag<br />
steht. Doch die Hoffnung, dass Gabriel<br />
die Genossen mit einem satten Verhandlungserfolg<br />
überzeugen kann, ist gering.<br />
Die bisherige Ausbeute der Sozialdemokraten<br />
ist eher mager.<br />
In der Arbeitsgruppe Finanzen ließ die<br />
Union ihren potentiellen Partner fast<br />
komplett auflaufen. Jeden Vorstoß zu Änderungen<br />
des Steuerrechts wehrten Verhandlungsführer<br />
Schäuble und CSU-<br />
Wortführer Markus Söder mit dem Hinweis<br />
ab, dafür sei die Union nicht gewählt<br />
worden. Statt eine Steuertrophäe<br />
CHRISTIAN THIEL / <strong>DER</strong> <strong>SPIEGEL</strong><br />
24<br />
„In Ostholstein werden<br />
wir eine Mehrheit gegen<br />
den Koalitionsvertrag<br />
haben. Lasst uns in die<br />
Opposition gehen,<br />
denn mit dem Ergebnis<br />
gehören wir dorthin.“<br />
Lars Winter, Landtagsabgeordneter<br />
„Bei uns melden<br />
sich nur die,<br />
die kritisch zum<br />
Koalitionsvertrag<br />
stehen. Ob das die<br />
Mehrheit ist, kann<br />
ich nicht sagen.“<br />
Stefan Mix, Geschäftsführer<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3<br />
„Wir haben gegen Merkel gekämpft<br />
und sollen jetzt Federn lassen, damit<br />
sie weiter regieren kann. Nicht mit<br />
uns! Die SPD-Führung will doch nur<br />
an den Trog ran. Dabei hätte sich<br />
Gabriel besser mal mit den Grünen<br />
und den Linken an einen Tisch gesetzt.“<br />
Rudolf Malzahn, Vorsitzender
Titel<br />
erhielt die SPD nur eine blumige Formulierung<br />
im Entwurf des Koalitionsvertrags.<br />
„Unser Gemeinwesen ist auf verlässliche<br />
Steuereinnahmen angewiesen“,<br />
heißt es dort. Und: „Der dafür erforderliche<br />
gesellschaftliche Konsens beruht auf<br />
einem gerechten Steuerrecht.“<br />
Nicht viel besser sieht es in der Gesundheitspolitik<br />
aus. Hier hat die SPD<br />
gleich zwei große Ziele zur Befriedung<br />
der Basis verfehlt: wenigstens Reste ihrer<br />
Bürgerversicherung zu retten und zur paritätischen<br />
Finanzierung der Kassen zurückzukehren.<br />
Der Kompromiss, den<br />
Merkel, Seehofer und Gabriel am vergangenen<br />
Donnerstag mit CDU-Verhandlungsführer<br />
Jens Spahn und SPD-Pendant<br />
Karl Lauterbach aushandelten, lässt sich<br />
schwerlich als Erfolg der Sozialdemokraten<br />
verkaufen: Der Zusatzbeitrag wird<br />
nicht abgeschafft, sondern nur verändert.<br />
Außerdem hat die Union durchgesetzt,<br />
dass der Arbeitgeberanteil bei 7,3 Prozent<br />
eingefroren bleibt. „Gäbe es eine Mitgliederbefragung<br />
der CDU/CDU, könnte ich<br />
die Annahme gut empfehlen“, frotzelt<br />
Spahn. Selbst die SPD-Linke Hilde Mattheis<br />
bezeichnet den Kompromiss als<br />
„Pyrrhussieg“.<br />
Ernüchternd ist auch die Bilanz in der<br />
Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales – ein<br />
Bereich, der für die Sozialdemokraten<br />
noch immer das Herzstück der Regierung<br />
ist. Hier hat die Partei vieles verhandelt,<br />
aber wenig erreicht. Zwar wird ein gesetzlicher<br />
Mindestlohn kommen, und<br />
auch die geforderten 8,50 Euro werden<br />
im Koalitionsvertrag auftauchen. Doch<br />
ab wann der Mindestlohn gilt, ob es Übergangsfristen<br />
und Differenzierungen geben<br />
wird, ist offen. Und auch bei seinem<br />
Prestigeprojekt, dem vorzeitigen Ruhestand<br />
mit 63, wird Gabriel Abschläge hinnehmen<br />
müssen.<br />
Und selbst dort, wo die SPD zumindest<br />
in der öffentlichen Wahrnehmung triumphierte,<br />
setzte sich im Kleingedruckten<br />
die Union durch. Zum Beispiel bei der<br />
Frauenquote. Anders als gemeinhin wahrgenommen,<br />
müssen 2016 keineswegs 30<br />
Prozent der Aufsichtsräte weiblich besetzt<br />
sein. Vielmehr gilt ab dann nur bei<br />
Neubesetzungen eine entsprechende<br />
Quote. Angesichts der Wahlzyklen dürfte<br />
erst 2020 das angestrebte Ziel erreicht<br />
sein. So wie es im Unionswahlprogramm<br />
steht.<br />
Nicht umsonst wächst in der SPD der<br />
Unmut, dass Gabriel öffentlich nur Themen<br />
zur Bedingung für die Koalition<br />
machte, „die nichts kosten“: Mindestlohn<br />
und doppelte Staatsbürgerschaft. Es sei<br />
ein zentraler Fehler gewesen, nicht bis<br />
zum Schluss auf Steuererhöhungen bestanden<br />
zu haben.<br />
Und auf der Zielgeraden der Verhandlungen<br />
ist die Bereitschaft der Union gering,<br />
Gabriel durch neue Zugeständnisse<br />
entgegenzukommen. Im Gegenteil. Ausgerechnet<br />
jetzt zog Kanzlerin Merkel<br />
zum ersten Mal eine rote Linie für den<br />
Koalitionsvertrag. Die abschlaglose Rente<br />
mit 63 werde es mit ihr<br />
nicht geben. Sie werde<br />
„darauf achten, dass die<br />
Rente mit 67 nicht zerlöchert<br />
wird“, so Merkel.<br />
Dabei ist inzwischen<br />
auch der Union klar, dass<br />
die Gefahr eines Scheiterns<br />
beim Mitgliederentscheid<br />
real ist. „Ich glaube,<br />
dass in den nächsten<br />
14 Tagen nicht nur über<br />
den Koalitionsvertrag abgestimmt<br />
wird, sondern<br />
über die Zukunft der<br />
SPD-Parteiführung und<br />
womöglich die Zukunft<br />
der gesamten SPD“,<br />
warnt Fraktionschef Volker<br />
Kauder.<br />
Anfangs hatten die Unions-Unterhändler<br />
die Sorgen<br />
ihrer SPD-Kollegen<br />
noch als taktisches Geplänkel<br />
abgetan, das deren<br />
Verhandlungsposition<br />
stärken sollte. Entsprechend<br />
genervt reagierten<br />
Umfrage<br />
„Welche Möglichkeit<br />
einer Regierungsbildung<br />
wäre gut für Deutschland?“<br />
55<br />
CDU und CSU, wenn die Genossen immer<br />
neue Forderungen mit Blick auf den<br />
Mitgliederentscheid auf den Tisch legten.<br />
„Der Mitgliederentscheid mag gut gemeint<br />
sein“, sagt der stellvertretende<br />
CDU-Vorsitzende Thomas Strobl. „Er<br />
führt aber dazu, dass die SPD-Leute in<br />
den Verhandlungen immer nur die nächsten<br />
vier Wochen vor Augen haben und<br />
nicht die nächsten vier Jahre. Das ist<br />
schlecht.“<br />
„Dass das Schicksal unseres Landes in<br />
den Händen einiger zehntausend SPD-<br />
Mitglieder liegt, ist eine Perversion des<br />
Ergebnisses der Bundestagswahl“, sagt<br />
der Präsident des CDU-Wirtschaftsrats<br />
Kurt Lauk. „Angesichts der Probleme unseres<br />
Landes, vor allem aber der Lage in<br />
Europa, ist diese Hängepartie nicht hilfreich.“<br />
(– 11)<br />
43<br />
Veränderung<br />
zur Umfrage<br />
Anfang Oktober<br />
Koalition<br />
aus CDU/CSU<br />
und SPD<br />
Koalition aus CDU/CSU<br />
und Grünen .......................... 32<br />
Minderheitsregierung<br />
der CDU/CSU.......................25<br />
Die Stimmung ist gereizt. „Vielleicht<br />
sollten wir erst den Mitgliederentscheid<br />
der SPD machen und dann den Koa li -<br />
tionsvertrag“, lästerte CSU-General -<br />
sekretär Alexander Dobrindt. Nicht<br />
nur er hält es für einen schweren Fehler,<br />
dass die SPD die Aussicht auf das Basisvotum<br />
auch noch dazu nutzte, neue<br />
Mitglieder zu werben. „Wer, bitte schön,<br />
tritt in die SPD ein, um Angela Merkel<br />
zu wählen?“, heißt es an der Unions -<br />
spitze.<br />
Auch nach Abschluss<br />
der Verhandlungen und<br />
(+ 12)<br />
Neuwahl<br />
des<br />
Bundestags<br />
Infratest-dimap-Umfrage für das ARD-<br />
„Morgenmagazin“ vom 19./20. November;<br />
rund 1000 Befragte; Angaben in Prozent<br />
(Veränderungen in Prozentpunkten);<br />
Mehrfachnennungen möglich<br />
während des Mitgliederentscheids<br />
hat die Union<br />
nicht vor, Zurückhaltung<br />
zu üben. Die CSU-Spitze<br />
hat den gesamten Vorstand<br />
und alle Bundestagsabgeordneten<br />
für Freitag<br />
in die Münchner<br />
Hanns-Seidel-Stiftung bestellt,<br />
um das Vertragswerk<br />
zu erläutern. Von<br />
dort aus sollen dann die<br />
Christsozialen ihren Leuten<br />
vor Ort einbläuen,<br />
dass das Werk die Handschrift<br />
der Union trage.<br />
Den Preis für ein mögliches<br />
Scheitern des Mitgliederentscheids<br />
würde<br />
allerdings nicht allein die<br />
SPD bezahlen. Auch für<br />
Kanzlerin Merkel könnte<br />
es bedeuten, dass sie trotz<br />
ihres Rekordergebnisses<br />
am Ende das Kanzler amt<br />
verlassen müsste. Zunächst<br />
käme allerdings wohl noch einmal<br />
Schwarz-Grün ins Spiel. „Ab 6. Januar“,<br />
so sagt es ein Unions-Bundesminister,<br />
„würden dann die Koalitionsverhandlungen<br />
mit den Grünen beginnen.“<br />
Die zeigen sich vorerst zurückhaltend.<br />
„Wir richten uns auf vier Jahre Opposi -<br />
tion ein“, sagt der Fraktionsvorsitzende<br />
Anton Hofreiter vom linken Parteiflügel.<br />
Die Grünen wären ohnehin nicht „der<br />
billige Plan B für Frau Merkel, wenn sie<br />
mit CSU und SPD nicht klarkommt“. Tatsächlich<br />
aber wäre eine schwarz-grüne<br />
Alternative nicht so unwahrscheinlich,<br />
wie die Anführer öffentlich glauben machen<br />
wollen. In Hessen wird eine schwarzgrüne<br />
Landesregierung verhandelt, das<br />
lockert auch in Berlin die Fronten. Merkel<br />
müsste den Grünen allerdings ein attraktiveres<br />
Angebot machen als zuletzt wäh-<br />
„Natürlich verknüpfen viele<br />
das Votum über den Koalitionsvertrag<br />
auch mit den Personen<br />
im Parteivorstand. Die letzten<br />
Vorstandswahlen waren ein<br />
Warnschuss. Ich hoffe, in Berlin<br />
wurde dieser Schuss gehört.“<br />
Uwe Herwig, Vorsitzender<br />
„Hier ist die<br />
Skepsis nicht<br />
so groß, es<br />
herrscht eher<br />
Zustimmung zur<br />
Großen Koalition.“<br />
Andreas Arend,<br />
stellv. Vorsitzender<br />
„Wir haben einen Wahlkampf geführt,<br />
der die Ablösung von Merkel<br />
als Kanzlerin zum Ziel hatte. In den<br />
zwei Wochen vor dem Mitgliederentscheid<br />
wird es aber zu schaffen<br />
sein, eine klare Mehrheit für die<br />
Koalition zu organisieren.“<br />
Florian Pronold, Vorsitzender<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3 25
Titel<br />
Ende der Feindschaft<br />
Ausgerechnet Hessen – die erstaunliche Geschichte einer schwarz-grünen Annäherung<br />
Die Vergangenheit ist in<br />
eine Glasvitrine gesperrt.<br />
Auf dem Landtagsflur der<br />
hessischen Grünen, keine 20<br />
Schritte vom Büro des Fraktionschefs<br />
Tarek Al-Wazir entfernt,<br />
liegt das Mikrofon, das Joschka<br />
Fischer, der erste Umweltminister<br />
der Grünen, auf der Regierungsbank<br />
des Landesparlaments benutzt<br />
hat. Darunter steht eine kleine<br />
schwarze Porzellanfigur, sie erinnert<br />
an die Zeit des schwarzgrünen<br />
Kriegszustands. Auf dem<br />
Sparschwein steht: „Schwarzgeld“.<br />
CDU und Grüne waren lange<br />
Jahre in keinem Bundesland weiter<br />
voneinander entfernt als in<br />
Hessen. Al-Wazir gehörte zu den<br />
härtesten und scharfzüngigsten Kritikern<br />
der Union – etwa als 1999 bekanntwurde,<br />
dass die Hessen-CDU Millionenbeträge<br />
aus dunklen Quellen auf schwarzen<br />
Konten gelagert und damit unter<br />
anderem den Wahlkampf ihres damaligen<br />
Landeschefs Roland Koch finanziert<br />
hatte. Der revanchierte sich mit einem<br />
fiesen Plakat gegen den angeblichen<br />
„Links-Block“ in Hessen: „Ypsilanti, Al-<br />
Wazir und die Kommunisten stoppen“.<br />
Koch hat sich längst in die Wirtschaft<br />
verabschiedet, und die damalige SPD-<br />
Landeschefin Andrea Ypsilanti, mit der<br />
Al-Wazir 2008 tatsächlich ein rot-grünrotes<br />
Bündnis verabredet hatte, sitzt inzwischen<br />
macht- und lustlos auf einer<br />
Hinterbank ihrer Landtagsfraktion.<br />
Al-Wazir, 42, und Kochs Nachfolger<br />
Volker Bouffier, 61, haben dagegen hinbekommen,<br />
was ihnen vor wenigen Wochen<br />
kaum jemand zugetraut hatte: ein<br />
Paket zu schnüren, von dem beide hoffen<br />
dürfen, dass es bei ihren Parteifreunden<br />
alte Feindschaften vergessen macht.<br />
Viermal trafen sie sich offiziell, dann<br />
auch inoffiziell; bis Mitte Dezember wollen<br />
sie nun an einem Koalitionsvertrag<br />
Politiker Al-Wazir, Bouffier: Ungeduld trifft Langatmigkeit<br />
basteln. Kommt er zustande, wäre es –<br />
rund drei Jahre nach dem Ende der<br />
schwarz-grünen Regierung in Hamburg –<br />
die erste derartige Verbindung in einem<br />
deutschen Flächenland.<br />
Strategisch käme das Bündnis beiden<br />
Partnern entgegen, sie erschlössen sich<br />
eine neue Machtoption. Das erscheint<br />
beiden wichtig, da die Sozialdemokraten<br />
der Linken offener gegenübertreten<br />
und die FDP sich nach der Pleite bei der<br />
Bundestagswahl notgedrungen von der<br />
Rolle als Mehrheitsbeschaffer der Union<br />
emanzipiert.<br />
Wird Hessen gar zum Vorbild für den<br />
Bund? Die Abläufe könnten sich gleichen.<br />
Nach der Wahl, als die bis dato regierende<br />
schwarz-gelbe Koalition im<br />
Landtag ihre Mehrheit verlor, sah es zunächst<br />
auch in Wiesbaden nach einer<br />
Großen Koalition aus – und auch in der<br />
hessischen CDU-Spitze hieß es, die Sozialdemokraten<br />
seien den Mitgliedern<br />
eher als Partner zu vermitteln als die<br />
Grünen.<br />
Einfach wird es in Hessen nicht. Zwar<br />
bemüht sich die dortige Union um das<br />
Bild einer modernen Großstadtpartei,<br />
in Frankfurt am Main oder Darmstadt<br />
klappt das auch. Die Koalitionen<br />
mit den Grünen dort funktionieren<br />
einigermaßen reibungslos.<br />
Anders in den konservativen,<br />
ländlichen Gegenden Hessens,<br />
etwa in den katholischen CDU-<br />
Hochburgen Fulda oder Limburg:<br />
Dort ist insbesondere das liberale<br />
Familienbild der Grünen, die Offenheit<br />
gegenüber homosexuellen<br />
und bunten Lebensmodellen, eine<br />
hohe Hürde für Schwarz-Grün.<br />
Zudem fremdelten Bouffier<br />
und Al-Wazir in den Verhandlungen<br />
zeitweise stark. Nach der<br />
zweiten schwarz-grünen Sondierungsrunde<br />
Mitte Oktober wollten<br />
selbst Unionisten, die den Grünen<br />
eher nahestehen, nicht mehr an<br />
einen Erfolg glauben – so sehr sei spürbar<br />
gewesen, dass die beiden Parteichefs<br />
sich bisweilen auf die Nerven gingen.<br />
Bouffier neigt zu Langatmigkeit, Al-Wazir<br />
zu Ungeduld – eine Zusammenarbeit<br />
an einem Kabinettstisch erschien schwer<br />
vorstellbar.<br />
Mit den Sozialdemokraten flutschte<br />
es dagegen zunächst. Vor allem in einem<br />
Punkt, der CDU und Grüne besonders<br />
weit trennte, lockte die SPD mit unionsnahen,<br />
wirtschaftsfreundlichen Positionen:<br />
beim weiteren Ausbau des Frankfurter<br />
Flughafens. Im kleinen Kreis<br />
signalisierte Bouffier den Sozialdemokraten<br />
schließlich, dass er sich eine Große<br />
Koalition vorstellen könne – und<br />
SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel<br />
konnte das auch.<br />
Der Sozialdemokrat hatte allerdings<br />
ein anderes Problem. Als er Mitte November<br />
dem Bundesvorstand seine Präferenz<br />
für eine Große Koalition erläuterte,<br />
wurde dies von Parteifreunden sogleich<br />
durchgestochen. Die Folge: eine<br />
Flut von Protesten an die hessische SPD-<br />
Führung. Viele Genossen waren enttäuscht,<br />
sie hatten auf eine rechnerisch<br />
FREDRIK VON ERICHSEN / PICTURE ALLIANCE / DPA<br />
26<br />
„Wir brauchen mehr Gelder<br />
für die Städte im Ruhrgebiet.<br />
Falls das nicht erfolgreich<br />
umgesetzt wird, sind wir<br />
sehr zurückhaltend, was<br />
unsere Zustimmung zur<br />
Großen Koalition angeht.“<br />
Frank Dudda, Fraktionschef<br />
„Erst kommt das<br />
Land, dann die Partei.<br />
Auch wenn wir nur<br />
einen Teil unseres Wahlprogramms<br />
durchsetzen<br />
können, ist das gut für<br />
die Menschen.“<br />
Sebastian Macht, Vorsitzender<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3<br />
„Wir machen doch nicht<br />
den Steigbügelhalter für<br />
so einen Mist! Merkel soll<br />
eine Minderheitsregierung<br />
machen, und wir treiben<br />
sie dann aus der Opposition<br />
heraus vor uns her.“<br />
Jürgen Hennlein, Vorsitzender
SCHWARZ-GRÜN 61 Sitze<br />
CDU<br />
47<br />
Grüne<br />
14<br />
insgesamt<br />
110 Sitze<br />
SPD<br />
37<br />
FDP<br />
Linke<br />
Hessischer<br />
Landtag<br />
Sitzverteilung<br />
6<br />
6<br />
ebenfalls mögliche rot-grün-rote Koalition<br />
gesetzt.<br />
In ihrer Verzweiflung streuten Schäfer-Gümbels<br />
Leute, man könne sich ja<br />
auch noch eine rot-grüne Minderheitsregierung<br />
vorstellen, die von den Linken<br />
oder der FDP toleriert werde. Das war<br />
allerdings Unsinn. Solch wackelige Modelle<br />
hatten die Grünen in zwei Parteiratsbeschlüssen<br />
und mehreren öffentlichen<br />
Erklärungen abgelehnt.<br />
Bouffier reagierte verschnupft auf die<br />
SPD-Volte. Seine Verärgerung steigerte<br />
sich am Montag voriger Woche: Nach<br />
der letzten schwarz-roten Sondierungsrunde<br />
gab Schäfer-Gümbel – anders als<br />
angekündigt – keine klare Empfehlung<br />
für eine Große Koalition ab. Stattdessen<br />
lavierte der SPD-Chef vor den Funktionären<br />
seines Landesparteirats herum<br />
und kündigte eine Reihe von Regionalkonferenzen<br />
an: Die Genossen sollten<br />
sich noch eine Meinung bilden dürfen<br />
über ihre Präferenzen, bevor der Landesparteitag<br />
eine Entscheidung treffe.<br />
Bouffier empfand dies als Affront. Er<br />
hatte sich bereits öffentlich festgelegt,<br />
wenige Tage nach dem letzten schwarzroten<br />
Gespräch ein Angebot für Koalitionsverhandlungen<br />
zu machen. Plötzlich<br />
wusste er nicht mehr, ob Schäfer-<br />
Gümbel noch als Partner zur Verfügung<br />
stand. „Damit waren wir wieder im<br />
Spiel“, sagte ein Spitzen-Grüner am vergangenen<br />
Freitag.<br />
Die ganze vergangene Woche über<br />
ließ Bouffier seine Leute mit den Grünen<br />
sondieren, ob nicht doch noch eine<br />
Lösung beim Flughafen möglich sei. Sie<br />
einigten sich auf mehrere Punkte. Künftig<br />
soll für den Flughafen beispielsweise<br />
ein neuer „Lärmdeckel“ festgelegt werden.<br />
Der Krach von startenden und landenden<br />
Jets soll dann unterhalb der<br />
Werte liegen, die im Planfeststellungsbeschluss<br />
des Landes zum Ausbau des<br />
Flughafens für das Jahr 2020 prognostiziert<br />
wurden. Wie das zu schaffen sein<br />
soll, ist im Detail allerdings noch unklar.<br />
„Mehr hätten wir in einer Koalition<br />
mit der SPD auch nicht erreicht“, verbreitete<br />
die Grünen-Führung am Freitag.<br />
Ob das genügt, um die Parteibasis zufriedenzustellen?<br />
Kurz nachdem die<br />
Nachricht vom neuen Bündnis die Runde<br />
machte, rief eine Frankfurter Fluglärm-Bürgerinitiative<br />
schon zu einer<br />
Protestdemonstration auf: „Nein zu<br />
Schwarz-Grün“.<br />
Außerdem halten es die Grünen in<br />
Hessen nicht anders als die SPD im<br />
Bund: Ein Koalitionsvertrag muss die<br />
Gnade der Basis finden. Das soll kurz<br />
vor Weihnachten, am 21. Dezember,<br />
geschehen. Da die hessischen Grünen<br />
keine Delegierten-Parteitage haben,<br />
sondern alle Mitglieder mitentscheiden<br />
lassen, sind die Voten solcher Landesversammlungen<br />
noch schwerer kalkulierbar.<br />
Al-Wazir weiß, dass er seinen<br />
Leuten dort etwas bieten muss. „Die<br />
Verhandlungen mit der CDU werden<br />
nicht einfach“, sagt er – was eher eine<br />
Untertreibung ist.<br />
Das Gleiche gilt für Bouffier. Gerade<br />
beim Thema Flughafen hatte er sich gegenüber<br />
dem CDU-Wirtschaftsflügel<br />
festgelegt: Der Airport müsse auf jeden<br />
Fall „wettbewerbsfähig bleiben“ und<br />
Entwicklungsmöglichkeiten haben. Nun<br />
sicherte er gegenüber den Grünen zu,<br />
dass der geplante Neubau eines dritten<br />
Terminals überprüft werden solle – möglicherweise<br />
stelle sich das Projekt ja als<br />
betriebswirtschaftlich unnötig heraus.<br />
Dennoch will der Regierungschef den<br />
Schritt mit den Grünen wagen. Am vergangenen<br />
Donnerstagabend, nachdem<br />
er sich entschieden hatte, rief Bouffier<br />
zuerst Al-Wazir an. Danach verständigte<br />
er Schäfer-Gümbel, der die Neuigkeit<br />
nicht erst den Medien entnehmen sollte.<br />
Die Öffentlichkeit sollte nach Bouffiers<br />
Plan erst am Freitagabend davon erfahren,<br />
nachdem er seinen Landesvorstand<br />
und die CDU-Landtagsfraktion in Wiesbaden<br />
unterrichtet hatte.<br />
Dieses eine Mal war Schäfer-Gümbel<br />
schneller: Er plauderte bereits am Freitagmittag<br />
munter aus, dass ihm Bouffier<br />
von den schwarz-grünen Plänen berichtet<br />
habe.<br />
MATTHIAS BARTSCH<br />
rend der Sondierungen. Um endlich regieren<br />
zu dürfen, könnte sie dazu bereit<br />
sein.<br />
Sollten sich am Ende aber auch die<br />
Grünen einer Koalition mit der Union<br />
verweigern, käme Bundespräsident Joachim<br />
Gauck ins Spiel. Der müsste den<br />
neugewählten Bundestag womöglich auflösen,<br />
bevor er sein erstes Gesetz verabschiedet<br />
hat.<br />
So oder so ist Gabriel in einer prekären<br />
Lage. „Mehr Demokratie wagen!“, hatte<br />
Willy Brandt einst gefordert. Doch wenn<br />
die Genossen im Dezember feierlich seinen<br />
100. Geburtstag begehen, könnten<br />
sie ihren Mut in Sachen innerparteilicher<br />
Demokratie bereits bereuen. Denn selbst<br />
wenn die Basis mit knapper Mehrheit für<br />
eine Große Koalition votiert, wäre das<br />
für Sigmar Gabriel ein schlechtes Ergebnis.<br />
Dann müsste er eine tiefgespaltene<br />
Partei in das ungeliebte Regierungsbündnis<br />
führen – und halten.<br />
Einstweilen versucht sich Gabriel in<br />
Zweckoptimismus: „Ich bin stolz auf meine<br />
Partei, dass sie die Herausforderung<br />
des Mitgliedervotums so entschlossen<br />
angeht. Ich bin sicher: Auch in anderen<br />
Parteien wird der Ruf nach solchen Beteiligungsformen<br />
lauter werden“, sagt der<br />
Parteichef. Er will die Hoffnung nicht aufgeben,<br />
dass die SPD am Ende doch noch<br />
bereit ist für eine Vernunftentscheidung:<br />
„Wenn wir echte Verbesserungen für die<br />
Menschen erreichen, warum sollten die<br />
SPD-Mitglieder da ablehnen?“<br />
Immerhin, bei einer Versammlung am<br />
Mittwochabend vergangener Woche im<br />
Berliner Abgeordnetenhaus hatte ein Genosse<br />
schon einen Vorschlag parat: „Lasst<br />
die Verhandlungen lieber vor die Wand<br />
fahren, als der Basis einen Vertrag vorzulegen,<br />
bei dem ihr damit rechnen müsst,<br />
dass er abgelehnt wird“, riet er der Parteiführung.<br />
Eine solche Entscheidung würde der<br />
klammen SPD zwar einen Teil der gut<br />
eine Million Euro Kosten für den Mitgliederentscheid<br />
ersparen. Aber Sigmar Gabriel<br />
und Angela Merkel nicht die Frage,<br />
wann Deutschland, die Führungsmacht<br />
Euro pas, endlich eine neue Regierung bekommt.<br />
Und diese Frage interessiert deutlich<br />
mehr Menschen, als die SPD Mitglieder<br />
hat.<br />
NICOLA ABÉ, THERESA AUTHALER,<br />
MATTHIAS BARTSCH, RALF BESTE, SVEN BÖLL,<br />
MARKUS DEGGERICH, MARKUS DETTMER,<br />
CHRISTIANE HOFFMANN, FRANK HORNIG,<br />
ANNA KISTNER, HORAND KNAUP, PETER MÜLLER,<br />
GORDON REPINSKI, SIMONE SALDEN, CORNELIA<br />
SCHMERGAL, BARBARA SCHMID, STEFFEN WINTER<br />
„Ich sehe keine<br />
Handschrift der<br />
SPD in den Verhandlungen.<br />
Es<br />
war ein Fehler, Rot-<br />
Rot-Grün von vornherein<br />
abzulehnen.“<br />
Volker Marquard, Vorsitzender<br />
„Die Waiblinger SPD hat sich<br />
nach der Bundestagswahl<br />
gegen eine Große Koalition<br />
ausgesprochen. Deshalb würde<br />
es mich nicht überraschen,<br />
wenn eine Mehrheit gegen den<br />
Koalitionsvertrag stimmen würde.“<br />
Markus Mall, Sprecher des Ortsvereins<br />
„Wir empfehlen eine<br />
Minderheitsregierung<br />
unter Merkel, bei der die<br />
SPD dann aus der Opposition<br />
heraus für Themen wie den<br />
Mindestlohn Mehrheiten<br />
finden kann.“<br />
Dennis Eidner, Sprecher<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3 27
Titel<br />
D E B A T T E<br />
Großer Irrtum<br />
Warum die SPD nicht mit der Union koalieren sollte / Von Bernhard Schlink<br />
LIEBE GENOSSINNEN, LIEBE GENOSSEN,<br />
es ist nicht zu fassen, aber wahr: In wenigen Wochen entscheiden<br />
wir über das Geschick der Republik.<br />
Wenn wir für die Große Koalition entscheiden, wird unsere<br />
Partei bei der nächsten Wahl, wie bei der Wahl nach der letzten<br />
Großen Koalition, wieder verlieren. Sie mag jetzt noch so erfolgreich<br />
verhandeln, bald noch so tüchtig regieren – die Erfolge<br />
der Großen Koalition werden wieder als Erfolge Angela Merkels<br />
wahrgenommen und ihr zugutegehalten werden. Unsere<br />
Partei wird nicht noch mal elf Prozentpunkte verlieren. Dafür<br />
hat sie bereits zu viel verloren. Vielleicht fünf oder vier oder<br />
sechs?<br />
Damit wird sie nicht weit von den Grünen liegen. Die Grünen<br />
werden, auch wie bei der Wahl nach der letzten Großen<br />
Koalition, zulegen. Als Opposition werden sie die Wähler an<br />
sich binden, deren Bedürfnis nach klaren<br />
Alternativen und klarer Verantwortung die<br />
Große Koalition zuwiderläuft.<br />
Unsere Partei hat sich in Leipzig für 2017<br />
einer rot-rot-grünen Koalition geöffnet. Als<br />
ob feststünde, dass sie, von der Großen<br />
Koalition geschwächt, 2017 stark genug<br />
wäre, eine solche Koalition zu führen. Als<br />
ob 2017 nicht alles möglich wäre: eine absolute<br />
Mehrheit für CDU/CSU, eine Mehrheit<br />
für CDU/CSU und FDP sowie eine linke<br />
Minderheit oder auch Mehrheit, bei der<br />
die Grünen stärker sind als unsere Partei.<br />
Wir können gegen die Große Koalition<br />
entscheiden. Vielleicht werden CDU/CSU<br />
und die Grünen dann noch Koalitionsverhandlungen<br />
führen. Vielleicht werden sie<br />
sich sogar einigen. Aber nachdem unsere<br />
Partei die Mitglieder entscheiden lässt, müssen<br />
auch die Grünen die Mitglieder entscheiden<br />
lassen. Die Mitglieder der Grünen<br />
werden der Koalition mit der CDU/CSU<br />
nicht mehr abgewinnen als wir. Dann kommen<br />
Neuwahlen in Betracht. Neuwahlen,<br />
bei denen die Wähler und Wählerinnen, des Hin und Her überdrüssig,<br />
der CDU/CSU die absolute Mehrheit geben mögen.<br />
Daran kann unsere Partei, daran können auch die Grünen und<br />
die Linke kein Interesse haben.<br />
Ebenso kommt eine rot-rot-grüne Koalition in Betracht.<br />
Kommt sie wirklich in Betracht? Hat unsere Partei vor der<br />
Wahl eine Koalition mit der Linken nicht deutlich abgelehnt?<br />
Das hat sie. Deshalb muss sie es auch zuerst mit der CDU/CSU<br />
versuchen – bis die Mitglieder sich verweigern.<br />
Aber ist nicht die Linke für eine Koalition noch nicht reif,<br />
außen- und sicherheitspolitisch, im alten Osten voller alter Kader,<br />
im alten Westen voller realitätsblinder Ideologen? Die gibt<br />
es, aber sie wird es auch 2017 geben, und wie die Linke in den<br />
Länderkoalitionen pragmatisch war und ist, wird sie es auch<br />
in einer Koalition im Bund sein – heute mit Gysi verlässlicher<br />
als morgen mit wer weiß wem.<br />
Aber würde die Spitze unserer Partei durch unsere Ablehnung<br />
der Großen Koalition nicht so desavouiert, dass sie zur<br />
28<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3<br />
IMAGO<br />
Führung einer rot-rot-grünen Koalition gar nicht mehr fähig<br />
wäre? Die Spitze unserer Partei hat ihre Koalitionsverhandlungen<br />
von vornherein unter den Vorbehalt unserer Zustimmung<br />
oder Ablehnung gestellt – unsere Ablehnung kann sie<br />
nicht desavouieren. Die Spitze unserer Partei würde mit der<br />
Führung einer rot-rot-grünen Koalition einfach den politischen<br />
Gegebenheiten Rechnung tragen – dem Scheitern einer Großen<br />
Koalition, dem Scheitern einer schwarz-grünen Koalition und<br />
dem Gebot demokratischer Vernunft, Neuwahlen zu vermeiden,<br />
solange es eine Mehrheit gibt, die eine Regierung bilden<br />
kann.<br />
Die Mehrheit gibt es. Obwohl es leicht übersehen wird – seit<br />
der letzten Wahl hat der Bundestag eine linke Mehrheit. Die<br />
Wähler und Wählerinnen haben keine Große Koalition gewählt.<br />
Sie haben auch keine rot-rot-grüne Koalition gewählt. Wähler<br />
und Wählerinnen wählen keine Koalitionen.<br />
Sie wählen Parteien. Sie haben mehrheitlich<br />
die linken Parteien in den Bundestag<br />
gewählt, und die linken Parteien können<br />
in einer Koalition die Regierung bilden.<br />
Unter der Führung unserer Partei. Ihre<br />
Aufgabe ist es, die linken Parteien zusammenzuführen<br />
und mit ihnen eine Alternative<br />
zur gelb-schwarzen Politik zu konzipieren<br />
und zu gestalten. Die linke Politik<br />
unserer Partei kann nicht nur in Korrekturen<br />
und Modifikationen schwarzer Politik<br />
bestehen. In Leipzig hat sich diese Einsicht<br />
bereits zur Geltung gebracht. Aber wenn<br />
eine rot-rot-grüne Koalition 2017 nicht<br />
mehr ausgeschlossen ist, warum soll sie es<br />
heute sein?<br />
Weil die Wähler sich an die Vorstellung<br />
einer rot-rot-grünen Koalition erst gewöhnen<br />
müssen? Weil jetzt CDU/CSU mit Empörung,<br />
die Medien mit Häme und die<br />
Wirtschaft mit Entsetzen reagieren würden?<br />
Das alles wird 2017 auch drohen, und<br />
es wird sich jetzt wie dann bald erledigen,<br />
wenn die rot-rot-grüne Koalition vernünftig regiert. Das freilich<br />
muss sie. Schafft unsere Partei das – die Macht greifen, die Koalition<br />
formen, die Regierung bilden, den Kanzler stellen?<br />
Wenn sie es jetzt nicht schafft, schafft sie es auch 2017 nicht,<br />
und vielleicht ist jetzt ihre letzte Chance.<br />
Um sich unsere Partei als führende Kraft in einer rot-rotgrünen<br />
Koalition zu wünschen, muss man nicht ein linker Sozialdemokrat<br />
sein – ich bin keiner. Man muss nur überhaupt<br />
Sozialdemokrat sein und daran glauben, dass es noch sozialdemokratische<br />
Inhalte und Ziele, dass es noch eine sozialdemokratische<br />
Alternative, eine sozialdemokratische Politik gibt.<br />
Weil wir daran glauben, müssen wir die Chance nutzen, die<br />
wir – es ist nicht zu fassen, aber wahr – haben. Wir müssen unsere<br />
Partei auf den Weg zur rot-rot-grünen Koalition bringen,<br />
auf den sie gehört.<br />
Der Jurist und Schriftsteller Bernhard Schlink, 69, ist seit 40<br />
Jahren Mitglied der SPD.
MAURICE WEISS / OSTKREUZ<br />
S P I E G E L - G E S P R Ä C H<br />
„Die SPD darf nicht überdrehen“<br />
Finanzminister Wolfgang Schäuble, 71, über die Schwierigkeiten der SPD mit ihrem<br />
Mitgliederentscheid, den begrenzten Spielraum der Union für weitere<br />
Kompromisse bei den Koalitionsverhandlungen und schwarz-rote Freundschaften<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Herr Minister, wollen Sie die<br />
deutsche Wirtschaft zerstören?<br />
Schäuble: Nein, wie kommen Sie darauf?<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Industriepräsident Ulrich Grillo<br />
macht sich wegen der laufenden Koali -<br />
tionsgespräche „Sorgen um den Wirtschaftsstandort<br />
Deutschland“. Können<br />
Sie das verstehen?<br />
Schäuble: Ich bin mir sicher sagen zu können,<br />
dass beide, SPD und Union, sich<br />
eine erfolgreiche deutsche Wirtschaft<br />
wünschen. Sie haben nur unterschied -<br />
liche Vorstellungen davon, wie das zu bewerkstelligen<br />
ist. Die Wähler haben über<br />
die unterschiedlichen Vorstellungen, die<br />
in den Wahlprogrammen eine sehr prominente<br />
Rolle gespielt haben, vor neun<br />
Wochen geurteilt, mit einem, wie ich<br />
fand, ziemlich eindeutigen Ergebnis. Auf<br />
der Grundlage dieses Ergebnisses müssen<br />
30<br />
die beiden Parteien bei allen unterschiedlichen<br />
Vorstellungen eine gemeinsame und<br />
vernünftige Politik machen.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Eine Vorlage Ihres Ministeriums<br />
kommt zu dem Ergebnis, dass die Pläne<br />
der Großen Koalition bis zu 1,8 Millionen<br />
Jobs kosten könnten.<br />
Schäuble: Wir müssen alle möglichen Auswirkungen<br />
der Maßnahmen, die wir diskutieren,<br />
so sorgfältig wie möglich prüfen<br />
und bewerten und dann auf dieser Basis<br />
die richtigen Entscheidungen treffen. Bislang<br />
sind aber noch gar keine Entscheidungen<br />
gefallen.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Die Große Koalition diskutiert<br />
etwa darüber, einen flächendeckenden<br />
Mindestlohn von 8,50 Euro einzuführen<br />
und die Rente mit 67 zurückzudrehen.<br />
Die Union drohe deshalb „zum Paten<br />
zu werden für die Rückabwicklung der<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3<br />
Agenda 2010“, warnt Ihr Parteifreund,<br />
EU-Kommissar Günther Oettinger.<br />
Schäuble: Eine Regierung, an der die<br />
Union beteiligt ist, wird die Reformen<br />
und die Politik der vergangenen Jahre,<br />
die Deutschland eine niedrige Arbeitslosigkeit,<br />
einen hohen Beschäftigungsstand<br />
und stabiles Wachstum gebracht haben,<br />
nicht in Frage stellen. Und dazu gehört<br />
auch die Rente mit 67. Dies ist angesichts<br />
der demografischen Entwicklung unverzichtbar.<br />
Außerdem erhöhen wir das<br />
Rentenalter nur schrittweise in einem<br />
Zeitraum von 20 Jahren, da hat jeder ausreichend<br />
Zeit, sich darauf einzustellen.<br />
Die Große Koalition hat die Aufgabe, die<br />
erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung<br />
der vergangenen Jahre fortzusetzen.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Wir haben eher den Eindruck,<br />
dass die Große Koalition ihr Augenmerk
Titel<br />
darauf richtet, mehr Geld auszugeben.<br />
Die Wünsche der Fachpolitiker belaufen<br />
sich auf über 50 Milliarden Euro.<br />
Schäuble: Aus der mittelfristigen Finanzplanung<br />
bis 2017 ergibt sich der Handlungsspielraum<br />
der Großen Koalition.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Das wären nur 15 Milliarden<br />
Euro. Die SPD will Steuern erhöhen.<br />
Schäuble: Ich glaube, dass das Thema<br />
Steuererhöhungen erledigt ist. Für mich<br />
ist ganz klar: Wer jetzt die Steuern er -<br />
höht, gefährdet den wirtschaftlichen Aufschwung,<br />
und dann fehlt erst recht Geld<br />
in den öffentlichen Kassen.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Die SPD verweist auf die Finanznöte<br />
der Länder. Die dürfen schon bald<br />
keine zusätzlichen Schulden mehr machen,<br />
obwohl sie viel Geld für das Beamtenheer<br />
etwa in Schulen, Universitäten<br />
oder der Polizei aufbringen müssen. Werden<br />
Sie sich weiter taub stellen, wenn die<br />
Ministerpräsidenten Sie mit den entsprechenden<br />
Forderungen konfrontieren?<br />
Schäuble: Keineswegs. Das Thema der<br />
Reform der Bund-Länder-Beziehungen<br />
muss insgesamt angegangen werden, das<br />
sagen wir seit langem. Das betrifft die<br />
Aufgaben, aber auch die Finanzverteilung<br />
zwischen Bund, Ländern und Gemeinden.<br />
Bei allen Wünschen der Länder und Gemeinden<br />
dürfen wir aber nicht vergessen,<br />
dass der Bund die schlechteste Finanzausstattung<br />
hat. Aber wenn ich Herrn Gabriel<br />
richtig verstanden habe, sind höhere Steuern<br />
auch gar nicht sein Kernanliegen.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Sondern?<br />
Schäuble: Auf dem Leipziger Parteitag hat<br />
er zwei Bedingungen für die Bildung einer<br />
Großen Koalition genannt: einen gesetzlichen<br />
Mindestlohn und die doppelte Staatsbürgerschaft.<br />
In beiden Punkten sind wir<br />
der SPD bereits weit entgegengekommen.<br />
Und angesichts des klaren Wahlergebnisses<br />
und der damit verbundenen klaren Erwartungen<br />
unserer Wähler darf die SPD<br />
ihre Forderungen nicht überdrehen.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Wenn der Finanzspielraum so<br />
eng bemessen ist, wie Sie sagen, kann<br />
vieles von dem, was die Fachpolitiker von<br />
Union und SPD schon beschlossen haben,<br />
nicht verwirklicht werden. Sehen wir das<br />
richtig?<br />
Schäuble: Die Parteivorsitzenden von<br />
CDU, CSU und SPD und auch Unionsfraktionschef<br />
Volker Kauder haben dazu<br />
bereits das Nötige gesagt. Ich bin aber zuversichtlich,<br />
dass wir trotzdem Kompromisse<br />
finden; zumal sich die Grünen bei<br />
den Sondierungsgesprächen nach der<br />
Wahl außerstande gesehen haben, ihrer<br />
Verantwortung gerecht zu werden. Bei<br />
allem Respekt: Die Grünen werden in<br />
den nächsten Jahren ein bisschen leiser<br />
auftreten müssen als bisher. Wer sich in<br />
die Büsche schlägt, wenn es ernst wird,<br />
darf sich nicht wundern, wenn er an<br />
Glaubwürdigkeit verliert.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Auch die SPD-Spitze will nicht<br />
allein über die Koalitionsfrage entschei-<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3 31
den, sondern stattdessen<br />
ihre Mitglieder befragen.<br />
Fürchten Sie, dass die Parteibasis<br />
am Ende nein sagen<br />
könnte?<br />
Schäuble: Ich hoffe zuversichtlich,<br />
dass die Parteiführung<br />
der SPD ihre Mitglieder<br />
zu überzeugen verstehen<br />
wird. Der Mitgliederentscheid<br />
wird kein Selbstläufer,<br />
gerade auch wegen des<br />
für die SPD enttäuschenden<br />
Wahlergebnisses, aber<br />
manchmal muss man sich<br />
vor Augen führen, dass wir<br />
alle zuerst dem Land und<br />
dann der Partei dienen. Ich<br />
beneide die Kollegen nicht<br />
um ihre Aufgabe.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Nach dem SPD-<br />
Beschluss, die Parteimit -<br />
glieder zu befragen, fordern<br />
nun auch Parteifreunde von<br />
Ihnen einen Mitgliederentscheid. Werden<br />
Sie den Vorschlag unterstützen?<br />
Schäuble: Die Union hat eine reife Diskussionskultur<br />
in ihren Gremien, wir<br />
sind laufend im Gespräch miteinander,<br />
die Diskussionen von oben nach unten<br />
und umgekehrt sind bei uns stark ausgeprägt.<br />
Zudem sind die meisten unserer<br />
Abgeordneten direkt gewählt. Die reden<br />
ständig mit ihrer Basis. Auf diese Art und<br />
Weise ist die ganze Partei eingebunden.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Große Koalitionen sind gut für<br />
große Reformen, so heißt es oft. Wenn<br />
man die Ergebnisse der bisherigen Verhandlungen<br />
betrachtet, so lassen sie sich<br />
aber eher in der Schublade „kleines Karo“<br />
einordnen. In Ihrer Arbeitsgruppe zum<br />
Beispiel ist von Steuerreformen keine<br />
Rede. Ist das nicht ein bisschen wenig für<br />
eine Koalition mit einer fast 80-prozen -<br />
tigen Mehrheit im Parlament?<br />
Schäuble: Die Wähler haben entschieden,<br />
und die Parteien müssen nach der Wahl<br />
das Beste aus dieser Entscheidung und<br />
für das Land machen. Ich sehe eine ganze<br />
Reihe von wichtigen Aufgaben, bei denen<br />
Union und SPD tatsächlich viel erreichen<br />
können, wenn sie gemeinsam handeln.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Zum Beispiel?<br />
Schäuble: Um nur zwei Beispiele zu nennen:<br />
zum einen die Energiewende, die<br />
wir so fortsetzen müssen, dass wir den<br />
Anforderungen des Klimaschutzes genauso<br />
gerecht werden wie der Forderung<br />
nach sicherer und bezahlbarer Energie.<br />
Außerdem müssen wir die Aufgaben zwischen<br />
Bund und Ländern etwa in der Bildungs-<br />
und Forschungspolitik neu ordnen.<br />
Für beide Aufgaben ist eine Große Koa li -<br />
tion besonders gut geeignet, weil beide<br />
Parteien im Bund wie in den Ländern tief<br />
verankert sind.<br />
* Mit den Redakteuren Christian Reiermann und<br />
Michael Sauga im Berliner Finanzministerium.<br />
32<br />
Titel<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Sie haben einmal zu Protokoll<br />
gegeben, dass Große Koalitionen für eine<br />
Demokratie „systemisch falsch“ seien,<br />
weil die Volksparteien dann zu viel unter -<br />
einander mauscheln könnten. Gilt der<br />
Satz noch?<br />
Schäuble: Ich habe immer gesagt, dass Große<br />
Koalitionen nicht zur Dauereinrichtung<br />
werden dürfen. Ich habe aber nicht den<br />
Eindruck, dass sich Union und SPD besonders<br />
leidenschaftlich damit beschäftigen,<br />
wie sie die Große Koalition über die<br />
nächste Wahl hinaus verlängern könnten.<br />
Es gab eine Wahl, es gibt ein Ergebnis, wir<br />
haben ein Land, das eine gute und starke<br />
Regierung braucht. Die Linken kamen für<br />
uns als Partner nicht in Frage, die Grünen<br />
haben sich verweigert, also nehmen Union<br />
und SPD die Herausforderung an.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Was sind Voraussetzungen dafür,<br />
dass die Große Koalition funktioniert?<br />
Schäuble: Erstens ein gutes Programm,<br />
zweitens der Wille, vier Jahre lang mitein -<br />
ander das Land nach vorn zu bringen,<br />
und drittens das Wissen, dass wir danach<br />
wieder als demokratische Konkurrenten<br />
gegeneinander antreten.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Glauben Sie wirklich, dass die<br />
SPD vier Jahre durchhält? Die Partei<br />
könnte doch schon viel früher das Lager<br />
wechseln.<br />
Schäuble: Die Führung der SPD hat ausdrücklich<br />
erklärt: Wenn wir uns auf eine<br />
Schäuble beim <strong>SPIEGEL</strong>-Gespräch*<br />
„Ich beneide die Kollegen nicht“<br />
Koalitionäre Schäuble, Steinbrück 2008<br />
„Opposition scheint für manche einfacher, da<br />
kann man den Leuten mehr versprechen.“<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3<br />
MAURICE WEISS / OSTKREUZ<br />
HENNING SCHACHT / ACTION PRESS<br />
Große Koalition einlassen,<br />
dann für volle vier Jahre.<br />
Warum sollte ich dar an<br />
zweifeln?<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Weil die SPD auf<br />
ihrem Parteitag in Leipzig<br />
dem Zusammengehen mit<br />
der Linken Tür und Tor geöffnet<br />
hat.<br />
Schäuble: Soweit ich mich<br />
erinnere, hat es doch rotrote<br />
Koalitionen schon<br />
mehrfach gegeben, zum<br />
Beispiel viele Jahre in<br />
Berlin oder Brandenburg.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Auf Bundesebene<br />
aber waren sie bislang tabu.<br />
Schäuble: Ich habe schon<br />
vor der Wahl gesagt, dass<br />
die SPD mit Linken und<br />
Grünen zusammengehen<br />
wird, wenn es dafür reicht.<br />
Nach Einschätzung der<br />
SPD-Spitze ist die Mehrheit<br />
für ein solches Experiment in diesem<br />
Bundestag aber nicht groß genug.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Fragt sich nur, wie lange das gilt.<br />
In der vergangenen Großen Koalition gab<br />
es belastbare persönliche Achsen. Die<br />
Kanzlerin kam gut mit dem damaligen<br />
Finanzminister Peer Steinbrück zurecht,<br />
die beiden Fraktionsvorsitzenden Volker<br />
Kauder und Peter Struck wurden sogar<br />
Freunde. Gibt es Ähnliches auch in der<br />
neuen Konstellation?<br />
Schäuble: Das wird sich entwickeln. Auch<br />
die von Ihnen angeführten Beispiele bestanden<br />
ja nicht von Anfang an. Zudem<br />
hat die Kanzlerin aus dieser Zeit auch<br />
ein gutes Verhältnis zu SPD-Chef Sigmar<br />
Gabriel. Und ein paar andere waren ja<br />
auch schon in der letzten Großen Koa li -<br />
tion nicht ganz ohne Erfolg dabei. Außerdem<br />
darf man nicht vergessen, dass wir<br />
uns auch aus der Arbeit im Bundestag,<br />
ob nun auf der Seite der Regierung oder<br />
der Opposition stehend, gut kennen und<br />
immer mit Respekt begegnet sind.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: 2005 beteiligte sich die SPD an<br />
der Regierung, weil für sie die Aussage<br />
ihres Parteivorsitzenden Franz Münte -<br />
fering galt, wonach Opposition Mist sei.<br />
Heute hat man eher das Gefühl, dass große<br />
Teile der SPD lieber auf den Opposi -<br />
tionsbänken Platz nehmen würden.<br />
Schäuble: Ich teile die Einschätzung von<br />
Franz Müntefering, dass sich demokra -<br />
tische Parteien der Regierungsverantwortung<br />
stellen sollten. Opposition scheint<br />
für manche einfacher. Da kann man den<br />
Leuten viel mehr versprechen. In der Regierung<br />
muss man sich mit Einschränkungen<br />
abfinden, nicht zuletzt mit denen der<br />
Wirklichkeit. Aber wir alle gehen in die<br />
Politik, um Verantwortung zu übernehmen<br />
und um zu gestalten. Dafür muss<br />
man in der Regierung sein.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Herr Minister, wir danken Ihnen<br />
für dieses Gespräch.
Deutschland<br />
Christsoziale<br />
Aigner<br />
C S U<br />
Seehofers<br />
Mädchen<br />
Seit ihrem Wechsel nach<br />
München gelingt der<br />
CSU- Hoffnung Ilse Aigner nicht<br />
mehr viel. Zwei Männer<br />
machen ihr das Leben schwer.<br />
PETER KNEFFEL / DPA<br />
Es gibt Momente, da verlässt selbst<br />
Ilse Aigner ihre Sanftmut, wie am<br />
vergangenen Montag zum Beispiel.<br />
Das bayerische Kabinett tagte, man plauderte<br />
über die nächste Klausur tagung am<br />
Tegernsee. „Ein schöner Ort“, warf<br />
Aigner harmlos ein, schließlich ist das<br />
ihre Heimat. Prompt meldete sich Finanzminister<br />
Markus Söder, selbst Franke,<br />
und meckerte: „Es gibt in Bayern aber<br />
auch noch andere schöne Orte.“ Da reichte<br />
es Aigner. Ob Söder denn immer „das<br />
letzte Wort“ haben müsse, raunzte sie.<br />
Aber CSU-Chef Horst See hofer, so erinnern<br />
sich Teilnehmer, lächelte nur still<br />
vor sich hin.<br />
So geht es seit Wochen. Ilse Aigners<br />
vielgefeierte Rückkehr in den Freistaat<br />
ist in den Mühen der Ebene angelangt.<br />
Dort warten un gewohnte, ungeliebte Auf -<br />
gaben auf sie – und zwei testosterongesteuerte<br />
Alphamännchen: Seehofer und<br />
Söder. Der eine hat Aigner mit der Aussicht<br />
aus dem Berliner Mi nisteramt nach<br />
Bayern gelockt, sie könne seine Nachfolgerin<br />
als Ministerpräsident werden. Der<br />
andere will das Amt aber auch, und er<br />
kann beißen.<br />
Im Landtagswahlkampf kokettierte<br />
Seehofer gern mit seiner möglichen Nachfolgerin<br />
Ilse Aigner. Eine Frau an der Spitze<br />
Bayerns? Das wirkte modern und zog<br />
auch junge Wähler an, die CSU holte die<br />
absolute Mehrheit. Jetzt aber, typisch Seehofer,<br />
scheint ihm die Rivalität seiner beiden<br />
Nachfolgekandidaten gut zu gefallen.<br />
Das Rennen ist eröffnet, und Aigner<br />
muss zunächst als Wirtschaftsministerin<br />
zeigen, was sie kann. Aber gleich eine<br />
erste Personalie ging schief. Aigners Vertrauter<br />
Klaus Stöttner sollte eine Art<br />
Außenbeauftragter ihres Ministeriums<br />
werden. Als sich Widerstand dagegen regte,<br />
zog sie zurück.<br />
34<br />
Auch fremdelt sie noch merklich mit<br />
den Pflichten des neuen Amtes, wie kürzlich<br />
beim Bayerischen Finanzgipfel. In<br />
der Münchner Residenz waren Hunderte<br />
Herren in dunklem Anzug versammelt,<br />
Manager von Börse, Banken und Ver -<br />
sicherungen. Aigner tat sich schwer, las<br />
ihre Rede vom Blatt, stockend. Das Wort<br />
„Solvency II“, die komplexe EU-Reform<br />
des Versicherungsaufsichtsrechts, wollte<br />
nicht auf Anhieb gelingen, andere Versprecher<br />
folgten.<br />
Ihre eigentliche Stärke dagegen bleibt<br />
bislang im Hintergrund: Aigners Fähigkeit,<br />
auf „ganz normale“ Bürger zuzugehen,<br />
auf sie einzugehen. Dann ist sie nahbar<br />
und natürlich, und so stieg sie zu einer<br />
bayernweit hoch beliebten Politikerin auf.<br />
Bei Terminen mit den Herren in dunklem<br />
Anzug zählt das weniger. Doch diese Termine<br />
bestimmen jetzt ihren Kalender.<br />
Daran ist natürlich auch Seehofer<br />
schuld. Er bat Aigner kurz nach der Bayernwahl<br />
zum Vieraugengespräch in die<br />
Staatskanzlei und drängte sie ins Wirtschaftsministerium.<br />
Dies sei der rechte<br />
Platz, um sich als Nummer zwei im Freistaat<br />
zu positionieren, schmeichelte der<br />
CSU-Chef: Förderbescheide verteilen und<br />
dazu schöne Termine mit bayerischen<br />
Weltkonzernen von Audi bis Siemens.<br />
Für Schwierigkeiten in diesem Job<br />
sorgt der Ministerpräsident selbst. Seit<br />
Monaten fordert er, dass der Abstand von<br />
Windkraftanlagen zu Wohnhäusern das<br />
Zehnfache ihrer Höhe betragen muss.<br />
Damit sind fast alle in Bayern bereits<br />
festgelegten Standorte hinfällig, die Kommunen<br />
müssen neu planen. Anfang 2014<br />
will Aigner die neuen Pläne vorstellen,<br />
Windenergie wird dabei keine große<br />
Rolle mehr spielen. Ein ziemlich holpriger<br />
Start für die Managerin der Energiewende<br />
in Bayern.<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3<br />
Wie wenig der schwer be rechenbare<br />
Seehofer derzeit Rücksicht auf Aigner<br />
nimmt, zeigt sich auch bei den Ber liner<br />
Koalitionsgesprächen. Für die Union<br />
leitet Aigner die Verhandlungsgruppe<br />
Wirtschaft. Gemeinsam mit der SPD<br />
stellte sie ein Papier mit vielen, vor allem<br />
aber teuren Ideen zusammen. Als<br />
Aigner die Ergebnisse präsentierte, rüffelte<br />
Seehofer seine Unterhänd lerin vor<br />
versammelter Runde in demonstrativer<br />
Schärfe: „So können wir nicht weiter -<br />
machen.“<br />
Und selbst wenn Aigner im Auftrag<br />
Seehofers loszieht, ist das keine Garantie<br />
für Rückendeckung. Etwa als es darum<br />
ging, den ehemaligen CSU-Chef und Dauerquerulanten<br />
Erwin Huber als Vorsitzenden<br />
des Wirtschaftsausschusses im Landtag<br />
zu verhindern. Aigner sollte ihre Kontakte<br />
zu oberbayerischen Abgeordneten<br />
spielen lassen, um Huber „eine Beerdigung<br />
erster Klasse“ zukommen zu lassen,<br />
wie Parteifreunde frotzelten. Doch der<br />
Plan sickerte durch, auch zu Huber. Als<br />
Aigner ihn anrief – „Erwin, wir müssen<br />
reden“ –, war der bestens präpariert. Huber<br />
hatte seine Truppen gesammelt und<br />
gewann die Kampfabstimmung. Seehofer<br />
ging in Deckung, Aigner stand bedröppelt<br />
da.<br />
Mittlerweile, so scheint es, hat Aigners<br />
sonst so fröhliches Selbstvertrauen einen<br />
echten Knacks. Als sie kürzlich mit einem<br />
Kamerateam des Bayerischen Rundfunks<br />
in ihrer Heimat auf den Gipfel des Erlbergkopfs<br />
marschierte, ließ sie wissen, sie<br />
wolle in ihrer Freizeit jetzt wieder öfter<br />
ausgiebig bergwandern – zuckte aber sofort<br />
zusammen und schob aus Sorge, das<br />
könnte Seehofer missfallen, noch hinterher:<br />
„Das darf jetzt der Ministerpräsident<br />
aber nicht hören.“<br />
CONNY NEUMANN,<br />
PETER MÜLLER
Stefan Liebich, 40, könnte es sich<br />
leicht machen an diesem Nachmittag.<br />
Rund 20 Genossen haben sich<br />
am vergangenen Mittwoch bei Käse -<br />
kuchen und Kaffee in einem Hotel in Berlin-Pankow<br />
versammelt, alle offensichtlich<br />
Angehörige der Generation 60 plus.<br />
Doch anstatt über die geforderte Angleichung<br />
der Ostrenten zu dozieren, einen<br />
Wahlkampfhit der Linken, spricht der<br />
Bundestagsabgeordnete vor der Basis seines<br />
Wahlkreises gleich als Erstes ein „heißes<br />
Eisen“ an.<br />
Bisher sei es ja immer gelungen, die<br />
SPD vor sich her zu treiben, mit dem Vorwurf,<br />
sie setze keine gemeinsame linke<br />
Politik um, etwa beim Mindestlohn. Doch<br />
36<br />
L I N K E<br />
Sonderweg aus Pankow<br />
Linken-Politikerin Wagenknecht<br />
In Gregor Gysis Truppe beginnt der Kampf<br />
zwischen Fundis und Realos um die Regierungsfähigkeit.<br />
Erster Testfall wird das Programm für die Europawahl.<br />
mit der Öffnung zur Linken habe die SPD<br />
den Spieß umgedreht: „Jetzt stellen die<br />
Fragen an uns“, sagt Liebich, und eine<br />
der größten Angriffsflächen dabei sei<br />
wohl die Außen-, Europa- und Sicherheitspolitik.<br />
„Das wird schwierig“, grummelt<br />
Liebich.<br />
Schwierig ist eine Untertreibung. Bei<br />
kaum einem anderen Thema gehen die<br />
Genossen sich gegenseitig so an die Kehle<br />
wie in der Frage von Krieg und Frieden.<br />
Das war zwar schon immer so, steht<br />
aber seit dem Lockruf der SPD unter<br />
ganz neuen Vorzeichen: Reformiert die<br />
Linke ihren fundamentalen Pazifismus,<br />
um koalitionsfähig zu werden? Aktuell<br />
mobilisieren die Gralshüter der reinen<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3<br />
Lehre in Partei und Fraktion<br />
bereits gegen den Programmentwurf<br />
des Parteivorstands<br />
für die Europawahl im Mai<br />
nächsten Jahres.<br />
Schon der Entwurf des Europaprogramms,<br />
der vergangenes<br />
Wochenende im Vorstand<br />
diskutiert werden sollte, brachte<br />
die Fundis in Wallung. In einem<br />
Gegenpapier verurteilten<br />
mehrere Linke, darunter auch<br />
die Bundestagsabgeordneten<br />
Diether Dehm, Sevim Dagdelen<br />
und Wolfgang Gehrcke, das<br />
Papier als „Angriff auf die friedenspolitischen<br />
Positionen der<br />
Linken“.<br />
Da werde, so die schäumenden<br />
Fundis, der „,humanitären<br />
Intervention‘ und ihren angeblichen<br />
Segnungen“ das Wort<br />
geredet. Weil der Vorstandsentwurf<br />
auf Kritik an der Zusammenarbeit<br />
zwischen EU<br />
und Nato verzichte, werde<br />
„die bisherige friedenspolitische<br />
Orientierung auf perfide<br />
Art und Weise in Frage gestellt“.<br />
Die Empfindlichkeit der<br />
Fundis hat einen tieferen<br />
Grund. Der Kampf um Europa<br />
in der Linkspartei ist die erste<br />
große Schlacht im Ringen um<br />
den künftigen Kurs: Hin zu<br />
Rot-Rot-Grün oder ewige Opposition.<br />
Und bei beiden Optionen<br />
stellt sich die Frage: Um<br />
welchen Preis?<br />
Bei der Europawahl steht die Linke dabei<br />
vor einem doppelten Dilemma: SPD<br />
und Grüne werden künftig jede außenpolitische<br />
Wortmeldung der Linken auf<br />
die Goldwaage legen und auf Regierungsfähigkeit<br />
abklopfen. Gleichzeitig läuft<br />
die Linke Gefahr, mit einem Weichspül -<br />
programm gegenüber Europa Wähler zu<br />
verlieren.<br />
Schon bei der Bundestagswahl lockte die<br />
Euro-skeptische Alternative für Deutschland<br />
(AfD) 340000 linke Stimmen in ihr<br />
Lager. Vor allem im Osten ist für Gysis Genossen<br />
damit ein ernsthafter Konkurrent<br />
auf der Spielfläche erschienen, fast 30 Prozent<br />
der Stimmen, die die Linke verlor, kassierte<br />
die AfD.<br />
Parteichefin Katja Kipping will jedoch<br />
einen europakritischen Überbietungs -<br />
wettbewerb mit der AfD vermeiden, das<br />
sei „aussichtslos“, sagte sie intern. Die<br />
an die AfD verlorenen Stimmen, so eine<br />
Wortmeldung im Vorstand, „müssen wir<br />
schlicht abschreiben“.<br />
Die Fundis hingegen wollen die Angst<br />
vor der AfD nutzen, um ihren Kurs durchzusetzen:<br />
Die AfD müsse man „von links<br />
angreifen“, fordert Sahra Wagenknecht.<br />
Es sei schon im Bundestagswahlkampf<br />
THOMAS PETER / REUTERS
„Die friedens politische<br />
Orientierung wird<br />
auf perfide Art und Weise<br />
in Frage gestellt.“<br />
falsch gewesen, das Thema Euro nicht zu<br />
plakatieren, assistieren ihre Anhänger aus<br />
dem Fundi-Lager. Wagenknechts Lebensgefährte<br />
Oskar Lafontaine hatte bereits<br />
öffentlich über einen geordneten „Ausstieg<br />
aus dem Euro“ nachgedacht, eine<br />
These, die Wagenknecht weiterventilierte,<br />
obwohl ein Parteitag der Linken das<br />
abgelehnt hat.<br />
Der Hauptgegner von Wagenknechts<br />
Lager ist Stefan Liebich, einer der Wortführer<br />
des Realo-Flügels, der diese Woche<br />
auch zu ihrem Sprecher gewählt werden<br />
soll. Der Mann mit dem Direktmandat<br />
aus Pankow arbeitet schon seit langem<br />
an einem außenpolitischen Sonderweg<br />
für seine Partei. Er befürwortet die „Einzelfallprüfung“<br />
statt des strikten „Njet“<br />
zu jeglichem Militäreinsatz.<br />
„Darf man als Linker bei einem Abschlachten<br />
wie in Ruanda einfach zu -<br />
sehen?“, fragt er. Ist es schon ein Mili -<br />
täreinsatz, wenn die Bundeswehr zum<br />
Beispiel auf den Philippinen beim Wiederaufbau<br />
hilft? Können Blauhelme<br />
nicht tatsächlich Frieden sichern, wie auf<br />
Zypern?<br />
Liebich weiß, dass der friedenspoli -<br />
tische Fundamentalismus der Linken<br />
das dickste Brett ist, das die Partei nun<br />
zu bohren hat. „Aber wir kommen um<br />
die Diskussionen nicht herum“, sagt er.<br />
Das Thema müsse geklärt werden, bevor<br />
man über Koalitionsverhandlungen reden<br />
könne. In der Linken gilt der „Pazifismus“<br />
fast als letztes Alleinstel -<br />
lungsmerkmal, nicht nur die Fundis<br />
fürchten deshalb, dass man sich mit<br />
vorauseilendem Gehorsam gegenüber<br />
Forderungen von SPD und Grünen<br />
nach „außenpolitischer Verlässlichkeit“<br />
auch überflüssig machen könnte – und<br />
dies das eigentliche Ziel von SPD und<br />
Grünen sei.<br />
In Friedensfragen waren schon ganz<br />
andere Kaliber als Liebich in der Partei<br />
gescheitert. Bereits im Jahr 2000 versuchten<br />
Gregor Gysi und Lothar Bisky, der<br />
damaligen PDS einen neuen Kurs zu verpassen:<br />
Es sollte möglich sein, nach<br />
Einzelfallprüfung Uno-Missionen zuzustimmen.<br />
Der Parteitag in Münster lehnte<br />
empört ab – mit beinahe Zweidrittelmehrheit.<br />
In der Konsequenz traten Gysi als<br />
Fraktionschef und Bisky als Parteivorsitzender<br />
ab. Gysi sagte damals im prophetischen<br />
Zorn, es „kommt der Tag, an dem<br />
wir das korrigieren“.<br />
Der Streit über das Europaprogramm<br />
ist ein erstes Beben, das diesen Tag<br />
38<br />
Deutschland<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3<br />
Wahlkämpfer Liebich<br />
„Jetzt stellen die Fragen an uns“<br />
der Revanche ankündigt. Endgültig ent -<br />
schieden über Programm und Personal<br />
für Europa wird auf einem Parteitag im<br />
Fe bruar in Hamburg. Die Lager bringen<br />
ihre Kandidaten aber bereits in Stellung.<br />
Auffällig viele Bewerber kommen<br />
aus dem Umfeld von Sahra Wagenknecht:<br />
So ihre langjährige Büroleiterin<br />
Ruth Firmenich, sogar ihr Ex-Mann<br />
Ralph Niemeyer will für die Linke nach<br />
Europa, um, wie er in seiner Bewerbung<br />
schreibt, die „Aufklärung über die Lügen<br />
der Machterhaltungsganoven“ voranzutreiben.<br />
Auf Realo-Seite versucht unter anderen<br />
Gregor Gysis persönlicher Freund André<br />
Brie nach schwerer Krankheit ein Comeback.<br />
Er saß schon einmal für die Linken<br />
im Europaparlament, war aber beim Nominierungsparteitag<br />
2009 unter dem Gejohle<br />
der Fundis durchgefallen, er galt als<br />
zu europafreundlich.<br />
Genützt hatte es der Partei nicht: Das<br />
Wahlergebnis fiel mit 7,5 Prozent dürftig<br />
aus.<br />
Bei derzeit schon über 30 Bewer -<br />
bungen für vermutlich nur fünf bis sie -<br />
ben aussichtsreiche Listenplätze im kommenden<br />
Jahr, sagte Liebich vergangene<br />
Woche den Genossen seiner Basis ironisch,<br />
„wird es wohl nicht ohne Gemetzel<br />
gehen“.<br />
Das klingt nicht nach innerparteilichem<br />
Pazifismus.<br />
MARKUS DEGGERICH<br />
TOBIAS SEELIGER / ACTION PRESS
K R I M I N A L I T Ä T<br />
Rechts liegen<br />
gelassen<br />
Experten fordern eine Verschärfung<br />
des Strafrechts: Wer<br />
aus rechter Gesinnung handelt,<br />
soll härter belangt werden.<br />
Fatma Öztürk* versteckt sich in der<br />
Küche, als vor ihrem Imbiss der<br />
rechte Mob tobt. Ihre Tochter, sieben<br />
Jahre alt, kauert neben ihr.<br />
Drei Männer hatten kurz zuvor das türkische<br />
Lokal in Mücheln, Sachsen-Anhalt,<br />
an jenem Tag im Februar 2012 überfallen.<br />
Laut Staatsanwaltschaft schlugen sie Öztürk,<br />
traten ihren Mann nieder und drohten<br />
der Familie mit dem Tod, sollte sie<br />
den Laden nicht bis zum Geburtstag<br />
Adolf Hitlers am 20. April räumen.<br />
Fatma Öztürk vertrieb die Angreifer<br />
mit einem Messer. Doch nun hämmern<br />
Rechte erneut gegen die Tür, zerschla -<br />
gen die Scheibe. Öztürk ruft die Polizei.<br />
* Name geändert.<br />
Die Beamten hätten ihr geraten, besser<br />
Deutsch zu lernen, erzählt sie. Als endlich<br />
ein Streifenwagen eingetroffen sei,<br />
hätten die Polizisten ihren Ehemann zunächst<br />
zu einem Alkoholtest aufgefordert.<br />
Den Angriff vermerkten sie als Streit ums<br />
Rauchverbot.<br />
Erst später, als der Vorfall öffentlich<br />
bekanntwird und dann der Innenminister<br />
des Landes einschreitet, findet der offenbar<br />
rassistische Tathintergrund überhaupt<br />
Imbiss in Mücheln nach dem Überfall 2012<br />
Erwähnung. Da ist das Vertrauen der<br />
Familie Öztürk in den deutschen Staat<br />
längst zerstört. „Ich weiß nicht, warum<br />
wir all das erleben mussten“, sagt Fatma<br />
Öztürk. In dieser Woche will das Amtsgericht<br />
Merseburg sein Urteil verkünden.<br />
Politiker und Behörden versprachen<br />
Besserung, nachdem die Mordserie des<br />
Nationalsozialistischen Untergrunds 2011<br />
bekanntgeworden war. Mit aller Härte<br />
wollte der Staat fortan gegen rechtsex-<br />
ANDREAS STEDTLER<br />
R E C H T S E X T R E M E<br />
Zweiter Anlauf,<br />
dritte Fassung<br />
Nach knapp einem Jahr haben<br />
sich die Bundesländer auf einen<br />
NPD-Verbotsantrag geeinigt.<br />
Werden die 244 Seiten das<br />
Verfassungsgericht überzeugen?<br />
Da ist die Sache mit den Kondomen.<br />
Der grüne Bundestagsabgeordnete<br />
Volker Beck erhielt ein<br />
Exemplar, sein Parteifreund Konstantin<br />
von Notz ebenfalls. Dazu einen freundlichen<br />
Gruß der Jungen Nationaldemokraten,<br />
der Nachwuchsorganisation der<br />
NPD: „Für Ausländer und ausgewählte<br />
Deutsche“, so steht’s auf der Verpackung.<br />
In einem begleitenden Brief verbreiteten<br />
die Rechten ihre gewohnte Propaganda,<br />
was im Fall von Volker Beck den<br />
Vorwurf bedeutet, dass er mit seiner<br />
Politik nicht „dem Wohle des deutschen<br />
Volkes“ diene. Die Jungen Nationaldemokraten<br />
verschickten und verteilten im<br />
Bundestagswahlkampf insgesamt 5000<br />
Kondome, nicht nur an Politiker, sondern<br />
auch an Bürger, die nach Deutschland<br />
eingewandert sind. Beck verurteilt<br />
die Aktion: Dahinter stecke eine „rassenbiologische<br />
Denke, vergleichbar der<br />
NS-Ideologie im ,Dritten Reich‘“.<br />
Die Arbeitsgruppe von Bund und Ländern,<br />
die sich mit einem möglichen Verbot<br />
der NPD befasst, ist offenbar ähnlicher<br />
Ansicht. Sie beschloss Mitte Oktober,<br />
den Versand der Präservative in den<br />
Verbotsantrag aufzunehmen: als weiteren<br />
Beleg für das rassistische Agieren<br />
von Parteifunktionären. Auch die Hetze<br />
in Berlin-Hellersdorf, wo ein brauner<br />
Mob unter der Führung von NPD-Kadern<br />
Stimmung gegen eine Asylbewerberunterkunft<br />
machte, hielt die Runde<br />
für beweiskräftig.<br />
Knapp ein Jahr benötigten die Vertreter<br />
der Bundesländer, um sich auf den<br />
Inhalt des Antrags zu einigen. Nun liegt<br />
die dritte und vermutlich letzte Fassung<br />
vor. Sie soll auf der Innenministerkonferenz<br />
am 4. Dezember in Osnabrück vorgestellt<br />
werden und spätestens in der<br />
kommenden Woche beim Bundesverfassungsgericht<br />
eingehen: 244 Seiten, unterteilt<br />
in acht Unterpunkte von A bis<br />
H, mit 15 Anhängen.<br />
Das Verfahren ist derzeit wohl das<br />
heikelste Unterfangen in der deutschen<br />
Innenpolitik. Wenn der Antrag erfolgreich<br />
ist, wird erstmals seit mehr als<br />
einem halben Jahrhundert eine politische<br />
Partei in der Bundesrepublik verboten.<br />
Die NPD flöge aus den Landtagen<br />
von Mecklenburg-Vorpommern und<br />
Sachsen.<br />
Der Antrag der Länder hat drei<br />
Schwerpunkte. Viel Raum nimmt, erstens,<br />
die Rolle sogenannter Vertrauensleute,<br />
der Spitzel von Polizei und Verfassungsschutz,<br />
ein. 2003 war der damalige<br />
Bundesinnenminister Otto Schily (SPD)<br />
in Karlsruhe gescheitert, weil die NPD<br />
bis in die Führungsebenen von V-Leu -<br />
ten des Verfassungsschutzes unterwandert<br />
war.<br />
Um eine Wiederholung zu vermeiden,<br />
einigten sich Bund und Länder bereits<br />
im Frühjahr 2012 darauf, ihre etwa 20<br />
Zuträger in den oberen Etagen der<br />
rechten Partei abzuschalten. Die Ver -<br />
fahrensbevollmächtigten der Länder,<br />
die Juristen Christoph Möllers und<br />
Christian Waldhoff von der Berliner<br />
40<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3
treme Straftäter vorgehen. Doch den Erklärungen<br />
folgten kaum Reformen. Bis<br />
Ende dieser Woche prüft der EU-Ministerrat,<br />
ob unter anderen auch Deutschland<br />
genug gegen rassistische Verbrechen<br />
unternimmt, wie es europäische Beschlüsse<br />
vorsehen.<br />
Asylbewerber, Juden, Schwarze und<br />
Roma seien in Deutschland „Zielscheibe<br />
rassistisch, fremdenfeindlich oder antisemitisch<br />
motivierter Gewalttaten“, befand<br />
die Europäische Kommission gegen Rassismus<br />
und Intoleranz des Europarats<br />
2009. Rechte Gewalt werde jedoch häufig<br />
nicht als solche erkannt und verfolgt, das<br />
deutsche Strafrecht berücksichtige rassistische<br />
Tatmotive nicht ausreichend.<br />
Der Europarat rät der Bundesregierung,<br />
eine Norm in das Gesetz aufzunehmen,<br />
die einen rechten Tathintergrund<br />
ausdrücklich als straferschwerend bewertet.<br />
Internationale Gremien wie der Ausschuss<br />
der Uno für die Beseitigung der<br />
Rassendiskriminierung unterstützen die<br />
Forderung. Großbritannien und die USA<br />
haben „Hate Crime“-Gesetze erlassen,<br />
die Gruppen wie Migranten oder Homosexuelle<br />
besonders schützen.<br />
In Deutschland wird zwar die Hetze<br />
gegen Minderheiten strafrechtlich verfolgt,<br />
aber es existiert keine gesetzliche<br />
Regelung, die rassistische oder andere<br />
vorurteilsgetriebene Beweggründe ausdrücklich<br />
als straferschwerend nennt.<br />
Deutschland<br />
Verschiedene Landesregierungen haben<br />
sich mehrmals bemüht, eine Hass -<br />
kriminalitätsregelung zu etablieren. Zuletzt<br />
scheiterte eine Bundesratsinitiative<br />
im Herbst 2012 am Widerstand der Bundesregierung<br />
von Union und FDP.<br />
Im Frühjahr einigten sich die Justiz -<br />
minister der Länder auf einen neuen Anlauf:<br />
Sie wollen den Paragrafen 46 des<br />
Strafgesetzbuchs um „menschenverachtende<br />
Beweggründe“ erweitern, wie es<br />
der Europarat empfiehlt. „Hasskriminalität<br />
richtet sich nicht nur gegen Einzelne,<br />
sie richtet sich gegen die pluralistische<br />
Gesellschaft“, sagt Hamburgs Justizsenatorin<br />
Jana Schiedek, „der gesteigerte Unrechtsgehalt<br />
solcher Taten erfordert eine<br />
besondere Bestrafung.“<br />
Die Bundesregierung vertrat bislang<br />
die Ansicht, die bestehenden Gesetze<br />
reichten aus. „Rassistische und andere<br />
Formen von Hasskriminalität“ würden<br />
von deutschen Gerichten regelmäßig<br />
als „erschwerender Umstand gewertet“,<br />
heißt es in einer Antwort des Bundes -<br />
justizministe riums auf eine Anfrage<br />
der Menschenrechtsorganisation Human<br />
Rights Watch.<br />
Die Juristin Kati Lang von der Technischen<br />
Universität Dresden gelangt zu<br />
einem anderen Ergebnis. Für ihre Doktorarbeit<br />
untersuchte sie 120 Straftaten<br />
in Sachsen, die vom Landeskriminalamt<br />
als eindeutig rechtsmotiviert eingestuft<br />
worden waren. Nur in 15 Fällen wurde<br />
der rechte Tathintergrund in das Urteil<br />
einbezogen; häufig unterschlugen bereits<br />
die Staatsanwälte eine mögliche neo -<br />
nazistische Motivation der Täter. In einem<br />
Fall wurde ein schwarzer Jugendlicher<br />
als „dreckiger Nigger“ und „schwarzes<br />
Vieh“ beschimpft und mit einer<br />
Bierflasche verletzt. In der Anklage spielte<br />
das mutmaßlich rechte Motiv keine<br />
Rolle, obwohl die Angreifer der Polizei<br />
als Mitglieder der rechten Szene bekannt<br />
waren.<br />
Eine Forschungsarbeit des Max-Planck-<br />
Instituts für ausländisches und internationales<br />
Strafrecht in Freiburg lieferte 2011<br />
für Baden-Württemberg ähnliche Erkenntnisse:<br />
In nur 16 von 120 Hasskriminalitätsfällen<br />
wurden vor Gericht die<br />
menschenverachtenden Gründe der Tat<br />
strafschärfend bewertet.<br />
„Der Paragraf 46 ist zu allgemein gefasst<br />
und gehört dringend reformiert“,<br />
sagt der Hamburger Jurist Oliver Tolmein,<br />
der im vorigen Jahr als Sachverständiger<br />
im Rechtsausschuss des Bundestags zu<br />
dem Thema referierte. Als Anwalt habe<br />
er oft erlebt, wie rechtsextreme Beweggründe<br />
vor Gericht ausgeblendet würden.<br />
Dabei sei es gerade den Opfern von Hassverbrechen<br />
wichtig, als solche anerkannt<br />
zu werden, sagt Tolmein. „Gleichzeitig<br />
sitzen die Neonazis im Saal und lachen<br />
sich kaputt.“<br />
MAXIMILIAN POPP<br />
Humboldt-Universität, betonen: Ein unmittelbarer<br />
Einfluss der Behörden auf<br />
die Führung der NPD sei mittlerweile<br />
auszuschließen.<br />
Die mehr als tausend Seiten umfassende<br />
Materialsammlung wurde mehrmals<br />
bereinigt. Anfangs hatten die Länder<br />
die gesammelten Zitate, Reden und<br />
Internetbeiträge noch in mehrere Kategorien<br />
unterteilt – abhängig davon, wie<br />
sicher es war, dass die Inhalte von V-<br />
Leuten stammten oder nicht. Der neue<br />
Kurs: Nur Informationen,<br />
die zweifelsfrei<br />
ohne Quellen des Verfassungsschutzes<br />
gesammelt<br />
worden sein sollen, durften<br />
stehenbleiben. Um<br />
die Glaubwürdigkeit ihres<br />
Antrags zu erhöhen,<br />
verständigten sich die<br />
Innenminister darauf,<br />
eine Unterschrift zu leisten:<br />
als Testat, dass das<br />
Material frei von Spitzelbeiträgen<br />
ist – auch wenn<br />
Zweifel bleiben. Was<br />
passiert, wenn im Pro-<br />
* Im September.<br />
NPD-Demonstration in Gera*<br />
„Rassenbiologische Denke“<br />
zess jemand aufsteht und sich als V-<br />
Mann outet? Und gar die Autorenschaft<br />
wichtiger Belege für sich reklamiert?<br />
Den zweiten Schwerpunkt des Verbotsantrags<br />
bilden Belege, die dem<br />
Nachweis der „aggressiv-kämpferischen<br />
Grundhaltung“ der NPD dienen sollen.<br />
Etwa die Dokumentation einer Rede des<br />
Fraktionschefs im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern:<br />
„Wir wollen den<br />
Maximalschaden dieses Parteienstaates“,<br />
sagte Udo Pastörs 2009 in Saarbrücken.<br />
Der dritte Schwerpunkt<br />
ist eine juristische<br />
Argumentation: war um<br />
ein NPD-Verbot verhältnismäßig<br />
ist und damit<br />
den Grundsätzen des<br />
Europäischen Gerichtshofs<br />
für Menschenrechte<br />
in Straßburg entspricht.<br />
Die Verfahrensbevollmächtigten<br />
verweisen<br />
auf „die historische Entscheidung<br />
des Grundgesetzes<br />
für eine wehrhafte<br />
BODO SCHACKOW / DPA<br />
Demokratie als Antwort<br />
auf die Katastrophe des<br />
Nationalsozialismus“; ob<br />
die Partei auf Bundesebene<br />
nur bei 1,5 Prozent liege, wie bei<br />
der letzten Bundestagswahl, spiele dabei<br />
laut Grundgesetz keine Rolle.<br />
Werden diese Argumente das Verfassungsgericht<br />
überzeugen? Die Bundesregierung<br />
gibt sich weiter skeptisch. In<br />
den Berliner Koalitionsverhandlungen<br />
forderten zwei SPD-Innenminister, Boris<br />
Pistorius aus Niedersachsen und Ralf<br />
Jäger aus Nordrhein-Westfalen, eine<br />
mögliche schwarz-rote Bundesregierung<br />
solle sich dem Antrag noch anschließen.<br />
Auch die SPD-Bundestagsfraktion ist<br />
dafür.<br />
Doch Bundesinnenminister Hans-Peter<br />
Friedrich (CSU) blockte ab. „Das machen<br />
wir nicht, die Länder sollen mal<br />
allein verlieren“, sagte Friedrich nach<br />
Angaben mehrerer Teilnehmer. Jäger<br />
reagierte gereizt und verwies auf anderslautende<br />
Aussagen des Ministers. Friedrich<br />
wollte den Disput auf Anfrage nicht<br />
kommentieren. Er werde das Verfahren<br />
„nach Kräften unterstützen“, ließ er mitteilen.<br />
Euphorisch klingt das nicht. Die<br />
SPD-Innenminister geben sich indes zuversichtlich.<br />
„Angesichts des gesammelten<br />
Materials“, sagt Pistorius, „sind wir<br />
optimistisch.“<br />
HUBERT GUDE,<br />
JÖRG SCHINDLER, FIDELIUS SCHMID<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3 41
Feuerwehrmänner an Unfallstelle bei Bondorf 2010: „Das blöde Handy war schuld!“<br />
NONSTOPNEWS<br />
42<br />
V E R K E H R<br />
Abgelenkt<br />
Nur mal eine SMS schreiben – das kann tödlich enden. Experten<br />
gehen davon aus, dass jedes Jahr viele Menschen sterben,<br />
weil Autofahrer während der Fahrt am Handy herumfummeln.<br />
Es war Heiligabend, und die junge<br />
Frau wollte nach Hause. Doch dort<br />
kam sie nie an.<br />
Gegen 18 Uhr raste sie auf der A61 bei<br />
Kerpen mit ihrem Auto ungebremst unter<br />
einen Sattelschlepper, der vorschrifts -<br />
mäßig auf der rechten Spur unterwegs<br />
war. Nur wenige Kilometer entfernt wartete<br />
die Familie auf ihre Ankunft.<br />
Hauptbrandmeister Engelbert Schödder,<br />
51, und seine Kollegen von der Feuer wehr<br />
schnitten die Tote aus dem Klotz, der einmal<br />
ein Kleinwagen gewesen war. Sie fragten<br />
sich, wie so etwas passieren konnte.<br />
Die Sicht war gut, die Straße trocken und<br />
wenig befahren an diesem ruhigen Abend<br />
vorm Christfest 2007. Hatte die Frau einen<br />
epileptischen Anfall erlitten? War sie in<br />
einen Sekundenschlaf gefallen?<br />
Als die Tote mit dem Leichenwagen<br />
abtransportiert wurde, fand Schödder ein<br />
noch funktionstüchtiges Handy im Fußraum<br />
des Wracks. Auf dem Display war<br />
die letzte SMS zu lesen, die die Frau geschrieben<br />
hatte: „Bin gleich da“. Nun<br />
glaubte der Feuerwehrmann, die Erklärung<br />
für den rätselhaften Unfall gefunden<br />
zu haben: Die Autofahrerin hatte während<br />
der Fahrt auf ihr Handy geschaut –<br />
und so den Lkw übersehen.<br />
Feuerwehrmann Schödder ging die<br />
Tote nicht mehr aus dem Kopf. Er beschloss,<br />
etwas gegen „die gefährliche Seuche<br />
SMS-Schreiben am Steuer“ zu unternehmen.<br />
Gemeinsam mit Polizisten, Unfallopfern<br />
und Hinterbliebenen zieht er<br />
nun im Rahmen der Aktion „Crash-Kurs<br />
NRW“ durch Schulklassen. Jungen und<br />
Mädchen, die demnächst den Führerschein<br />
machen, will er für Risiken des<br />
Autofahrens sensibilisieren.<br />
In Deutschland werden jedes Jahr etwa<br />
63 Milliarden SMS geschrieben; hinzu<br />
kommt die Beschäftigung mit Facebook,<br />
Twitter und anderen Internetangeboten,<br />
die mit Smartphones möglich ist. Viele<br />
Menschen können es nicht ertragen, länger<br />
als zehn Minuten nicht auf ihr Handy<br />
zu schauen. Ihr Leben findet<br />
weitgehend auf einem Display<br />
statt, das kaum größer<br />
ist als eine Spielkarte.<br />
Gefahren, die sich außerhalb<br />
dieser Fläche zusammenbrauen,<br />
werden oft nicht mehr<br />
wahrgenommen.<br />
Es ist schon riskant, im<br />
Auto zu telefonieren, ohne<br />
die Freisprechanlage zu benutzen.<br />
Wer erwischt wird,<br />
muss deshalb ein Bußgeld<br />
zahlen, ab Mai kommenden<br />
Jahres 60 statt bisher 40 Euro.<br />
Doch mit dem Hörer am Ohr<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3<br />
Aufklärer Schödder<br />
„Eine Seuche“<br />
kann man wenigstens noch nach vorn<br />
schauen. Wer seinen Blick senkt und aufs<br />
Handy starrt, ist im Blindflug unterwegs;<br />
er übersieht Autos, die Vorfahrt haben,<br />
Radfahrer, die etwas zu weit links fahren,<br />
oder Kinder, die plötzlich auf die Straße<br />
laufen, weil sie einen Ball holen wollen.<br />
Bei Tempo 100 legt ein Autofahrer, der<br />
zwei Sekunden lang mit dem Handy<br />
spielt, 55 Meter zurück, ohne die Straße<br />
zu sehen. „Wenn ihr demnächst auch am<br />
Steuer eines Autos auf euer Handy schaut,<br />
ist das ungefähr das Rücksichts loseste,<br />
was ihr tun könnt“, ermahnt Schödder<br />
die Jugendlichen beim Crash-Kurs.<br />
Niemand weiß, wie viele Menschen in<br />
Deutschland schon ihr Leben lassen mussten,<br />
weil Autofahrer Liebesbotschaften<br />
per SMS übermittelten, mit Facebook-<br />
Freunden chatteten oder andere Dinge<br />
mit ihren Taschencomputern trieben.<br />
Es bleibt oft ungeklärt, ob ein Unfallverursacher<br />
ein Handy in der Hand hatte,<br />
als es krachte. Unfallfahrer, die überleben,<br />
schweigen oder geben vor, Opfer eines<br />
Sekundenschlafs geworden zu sein. Wer<br />
zugibt, am Steuer gesimst zu haben, muss<br />
unter Umständen mit einer empfind -<br />
lichen Strafe wegen fahrläs -<br />
siger Tötung oder Körper -<br />
verletzung rechnen. Für die<br />
Polizei wäre es in vielen Fällen<br />
möglich zu ermitteln, ob<br />
bei einem Crash ein Handy<br />
im Spiel war. Tatsächlich geschieht<br />
dies selten.<br />
Wenn überhaupt, fliegt ein<br />
Unfallfahrer nur durch Zufall<br />
auf. Jener 35-jährige Mann<br />
etwa, der nach einem Besuch<br />
JOSCHWARTZ.COM / <strong>DER</strong> <strong>SPIEGEL</strong><br />
bei einer Prostituierten in<br />
den Gegenverkehr krachte,<br />
weil er einem Bekannten –<br />
wie die Polizei annimmt – un-
Deutschland<br />
bedingt von seinen Erlebnissen vorschwärmen<br />
musste; er und ein anderer<br />
Autofahrer wurden schwer verletzt. Oder<br />
die junge Frau, die im Spätsommer 2010<br />
mit ihrem Kleinwagen nahe dem badenwürttembergischen<br />
Bondorf die Spur<br />
nicht halten konnte und mit einem entgegenkommenden<br />
Mercedes kollidierte.<br />
Sie blieb fast unverletzt, tötete aber einen<br />
Vater dreier Kinder. Beim Aussteigen rief<br />
die 23-Jährige laut Zeugen: „Das blöde<br />
Handy war schuld!“<br />
Die Amtsanwältin Maria Focken von der<br />
Hamburger Staatsanwaltschaft, die beim<br />
Deutschen Verkehrsgerichtstag aktiv ist,<br />
beschäftigt sich schon seit längerem mit<br />
den Gefahren durch Autofahrer, die sich<br />
ablenken lassen; sie geht davon aus, dass<br />
es eine „hohe Dunkelziffer“ gibt. Eine Studie<br />
der Allianz kommt zu dem Ergebnis,<br />
dass etwa 30 Prozent der Fahrzeugführer<br />
während der Fahrt Kurznachrichten lesen –<br />
und 20 Prozent sogar welche schreiben.<br />
Regelmäßig berichten Regionalzeitungen<br />
von Autofahrern, die auf trockener<br />
Straße plötzlich in den Gegenverkehr geraten<br />
sind. Oder nach rechts abgedriftet<br />
sind, obwohl kein Hindernis im Weg war.<br />
Wie der Mann, der Anfang November<br />
vor Hamburg sein Auto gegen einen<br />
Baum lenkte. Er und sein Beifahrer starben<br />
vor Ort. „Wahrscheinlich könnten<br />
viele Menschen noch leben, wenn nicht<br />
irgendeine SMS gelesen worden wäre“,<br />
sagt Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung<br />
der Deutschen Versicherer.<br />
Der Braunschweiger Verkehrspsychologe<br />
Mark Vollrath glaubt sogar, dass das<br />
Smartphone ein ähnlich großer Killer im<br />
Straßenverkehr ist wie Alkohol. Schon<br />
wenn ein Autofahrer ohne Freisprech -<br />
anlage telefoniere, steige das Unfallrisiko<br />
um das Fünffache – ähnlich wie bei einem<br />
Fahrzeugführer mit 0,8 Promille. Wer<br />
eine SMS schreibt, hat laut einer amerikanischen<br />
Studie sogar ein 23-mal so großes<br />
Risiko, einen Crash zu verursachen.<br />
„Er fährt also, als wäre er volltrunken“,<br />
sagt Vollrath.<br />
Anna Kickhäben, Friseurmeisterin aus<br />
Hittbergen bei Lüneburg, ist bisher unfallfrei<br />
geblieben, was wirklich „ein großes<br />
Glück“ ist, wie sie freimütig sagt.<br />
Während eines ADAC-Fahrsicherheitstrainings<br />
gibt sie zu, dass ihr Smartphone<br />
während der Fahrt immer auf ihrem<br />
Schoß liege und sie oft mit Freunden chatte.<br />
„Es muss ja vieles geregelt werden“,<br />
sagt sie. „Wenn ich arbeite, komme ich<br />
nicht so richtig dazu.“ Für den Fahrtrainer<br />
Gerd Schulz ein typischer Fall: „Gerade<br />
junge Fahrer machen aus ihrem Auto<br />
eine Partyzone mit lauter Musik und Dauergequassel<br />
am Handy“, sagt er.<br />
Gefährlich seien auch Geschäftsreisende,<br />
die ihr Fahrzeug als mobiles Büro benutzen:<br />
Da würden Mails gecheckt, Telefonate<br />
geführt oder Briefe diktiert – auch<br />
schon mal bei Tempo 180 und mitten auf<br />
einer vielbefahrenen Autobahn. Ein Trainingsteilnehmer<br />
habe ihm einmal berichtet,<br />
dass er Präsentationen während der<br />
Fahrt vorbereite. Das mangelnde Problembewusstsein<br />
führt der Ausbilder<br />
auch darauf zurück, dass das Thema in<br />
der öffentlichen Diskussion hierzulande<br />
bisher kaum eine Rolle spiele.<br />
Dabei sind es nicht nur die Smart -<br />
phones, die Probleme verursachen: Es<br />
sind auch die Autos selbst. Früher gab es<br />
ein paar Knöpfe, Schalter und ein Radio<br />
mit zwei Drehreglern, einen für die Frequenz,<br />
einen für die Lautstärke. Heute<br />
stecken in den Armaturenbrettern vieler<br />
neuer Modelle leistungsstarke Tablet-<br />
Computer. Hinzu kommen die Naviga -<br />
tionsgeräte, die laut Allianz-Studie etwa<br />
die Hälfte der Autofahrer auch während<br />
der Fahrt bedienen. Die Geräte erklären<br />
den Weg – aber ihre Programmierung<br />
führt wohl manchmal in die Katastrophe.<br />
In anderen Staaten wird mittlerweile<br />
viel entschlossener als in Deutschland<br />
gegen die Ablenkung am Steuer gekämpft.<br />
In der Schweiz, wo jeder zweite<br />
Autofahrer laut einer Studie Kurznachrichten<br />
am Steuer schreibt, läuft eine landesweite<br />
Kampagne. Und in den USA,<br />
wo jeder vierte Autounfall auf Handy-<br />
Nutzung zurückgehen soll, wurden an<br />
einigen Highways „Texting Zones“ eingerichtet.<br />
Dort können die Autofahrer<br />
kurz parken, wenn sie eine SMS verschicken<br />
wollen.<br />
Aufmerksamkeit erregte in den USA<br />
der Film „From one second to the next“,<br />
den der deutsche Regisseur Werner Herzog<br />
im Auftrag amerikanischer Telefon -<br />
anbieter gedreht hatte. Herzog besuchte<br />
mehrere Menschen, die bei SMS-Unfällen<br />
schwer verletzt worden waren, unter anderem<br />
einen Jungen, der nun nicht mehr<br />
laufen kann. Und er sprach mit zwei jungen<br />
Männern, die einen Unfall verursacht<br />
hatten, weil sie sekundenlang aufs Handy<br />
geschaut hatten.<br />
Einer von ihnen hatte seiner Frau während<br />
der Fahrt die Nachricht „I love you“<br />
geschrieben – und war deswegen in eine<br />
Pferdekutsche gekracht. Drei kleine<br />
Jungs starben, weil der Autofahrer im<br />
falschen Moment ein bisschen romantisch<br />
sein wollte.<br />
Einen Fall nahm Herzog nicht in seinen<br />
Film auf, weil er keine Drehgenehmigung<br />
bekam. Es ging um einen jungen Mann,<br />
der eine Kurznachricht an seine Freundin<br />
geschrieben und deswegen ein Kind auf<br />
einem Fahrrad überfahren hatte. Die<br />
Freundin war zu diesem Zeitpunkt allerdings<br />
nicht weit entfernt.<br />
Sie saß im Auto auf dem Beifahrersitz.<br />
GUIDO KLEINHUBBERT<br />
Video: Eine Testfahrt<br />
mit Smartphone<br />
spiegel.de/app<strong>48</strong>2013sms<br />
oder in der App <strong>DER</strong> <strong>SPIEGEL</strong><br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3 43
Deutschland<br />
See-Anwohner Moser<br />
THOMAS EINBERGER / ARGUM<br />
I M M O B I L I E N<br />
Wohnen auf Rädern<br />
Vor allem ältere Menschen geben ihre Wohnung auf und<br />
ziehen auf einen Campingplatz. Dort entstehen<br />
kleine Dörfer – mit Kneipe, Hort und Laternenumzug.<br />
Manfred Moser sagt, er habe sein<br />
Paradies gefunden. Es liegt nur<br />
wenige Schritte von seiner Eingangstür<br />
entfernt, ein steinernes Treppchen<br />
hinunter, schon ist er da. Er hat sich<br />
eine weiße Plastikbank vor das Paradies<br />
gestellt; bevor er sich setzt, legt er eine<br />
Decke auf die Bank. Wenn Moser dann<br />
so dasitzt und den Sonnenuntergang über<br />
dem See beobachtet, kann man ihn verstehen.<br />
„Schöner als hier krieg ich’s<br />
nicht“, sagt der 70-Jährige.<br />
Mosers Bank steht direkt am Ufer des<br />
Starnberger Sees, eine noble Adresse.<br />
Seit 15 Jahren wohnt Moser auf dem<br />
Campingplatz in Ambach, rund 40 Kilometer<br />
südwestlich von München. Ein<br />
Wohnwagen, Baujahr 1975, auf 100 Quadratmeter<br />
Stellfläche, sein Reich. Die<br />
Wohnung in Schwabing hat Moser längst<br />
aufgegeben.<br />
Für sein Paradies zahlt er pro Jahr nur<br />
2300 Euro Miete, Gas und Strom inklusive.<br />
44<br />
Trieb ihn die Not hierher? „Quatsch“,<br />
sagt Moser, „ich habe eine gute Rente.“<br />
Er wollte auf den Campingplatz ziehen,<br />
das ist ihm wichtig. „Schauen Sie, könnte<br />
ich mir den sonst leisten?“ Moser zeigt<br />
auf den Sportwagen, der auf seiner<br />
Parzelle parkt: ein silberner Mercedes<br />
SL 350, keine zehn Jahre alt.<br />
Drinnen, im Wohnwagen, ist es eng<br />
und warm, bestimmt 25 Grad. Die Sitzecke<br />
um den Esstisch hat Moser in flauschige<br />
Decken gehüllt. Dunkles Holz,<br />
grüne Häkelgardinen, heimelige Gemütlichkeit.<br />
Im Schlafzimmer stehen Weißbiergläser<br />
im Regal über dem Bett. Wenn<br />
seine Freundin aus München zu Besuch<br />
ist, schläft sie im Gästebett gegenüber,<br />
auf der rechten Seite.<br />
Video-Reportage: Die Speis<br />
und ihr Camping-Platz<br />
spiegel.de/app<strong>48</strong>2013camper<br />
oder in der App <strong>DER</strong> <strong>SPIEGEL</strong><br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3<br />
Nebenan gibt es eine kleine Toilette.<br />
„Pipi kann ich schon hier machen“, sagt<br />
Moser. Für alles Weitere muss er ein paar<br />
Meter nach oben gehen, in den Servicetrakt<br />
des Platzes. Dort stehen auch zwei<br />
Waschmaschinen, und Moser kann warm<br />
duschen. „Ich hab hier alles, was ich brauche“,<br />
sagt er.<br />
Tausende haben sich wie der Rentner<br />
Moser entschieden, dauerhaft auf einen<br />
Campingplatz zu ziehen. Die Stellflächen<br />
im Grünen entwickeln sich von Ferien -<br />
anlagen zu Wohngebieten. Sie bieten bezahlbaren<br />
Wohnraum, der besonders in<br />
Ballungsgebieten knapper wird. Auch mit<br />
einem kleinen Einkommen kann man<br />
hier sein eigener Herr sein.<br />
„Seit zehn Jahren ziehen immer mehr<br />
Camper ganz auf die Plätze“, sagt Leo<br />
Ingenlath, Vorsitzender des Fachverbands<br />
der Campingunternehmer in Nordrhein-<br />
Westfalen. Dafür sei auch das laxere<br />
Melderecht verantwortlich: Seit Mieter
JAKOB STUDNAR / <strong>DER</strong> <strong>SPIEGEL</strong><br />
THOMAS EINBERGER / ARGUM<br />
bei der Anmeldung keine Bescheinigung<br />
ihres Vermieters mehr benötigen, können<br />
sie sich prinzipiell auch auf einem Campingplatz<br />
melden.<br />
Die Plätze gelten nicht als Wohngebiete,<br />
sondern als Freizeitanlagen. Ihre Dauerbewohner<br />
werden von den Gemeinden<br />
nur geduldet. Dennoch werben Campingplätze<br />
im Internet offen mit der Möglichkeit,<br />
dort den Erstwohnsitz anzumelden.<br />
Meist machen das jene Camper, die ohnehin<br />
schon jeden Urlaub auf demselben<br />
Platz verbracht haben. Auch die Deutsche<br />
Post hat die Entwicklung erkannt<br />
und gibt Wohncampern auf ihrer Website<br />
Tipps, was sie beim Umzug auf den Platz<br />
beachten sollten.<br />
Bei Kamp-Lintfort, rund 20 Kilometer<br />
nordwestlich von Duisburg, ist eine der<br />
größten Campingwohnsiedlungen Deutschlands<br />
entstanden. Die „Freizeit-Oase Altfeld“<br />
breitet sich auf 220 000 Quadrat -<br />
metern aus und zählt über 300 Bewohner,<br />
die dort ihren Erstwohnsitz angemeldet<br />
haben. Die meisten sind älter als 50 Jahre,<br />
aber auch Familien mit Kindern wohnen<br />
hier.<br />
Der Campingplatz gleicht einem kleinen<br />
Dorf, es gibt ein Restaurant, ein<br />
Schwimmbad und sogar einen Hort. Die<br />
Parzellen haben Gas-, Wasser- und Stromanschluss.<br />
Die Vorbereitungen für die gemeinsame<br />
Silvesterfeier laufen, an St.<br />
Martin zogen die Kinder des Platzes mit<br />
ihrer Laterne an den Wohnwagen vorbei.<br />
Der Eigentümer Dietmar Harsveldt,<br />
ein braungebrannter Mittfünfziger, sieht<br />
sich als Bürgermeister, die Leute vertrauen<br />
ihm. Keine fünf Minuten kann er über<br />
seinen Platz gehen, ohne dass Mieter ihn<br />
umarmen. Harsveldt gehören insgesamt<br />
sieben Campingplätze, die meisten in<br />
Nordrhein-Westfalen. Von seinen 7000<br />
Mietern wohnten 2000 das ganze Jahr<br />
dort, sagt er. Eigentlich sei das ein gutes<br />
Geschäft. Doch die Stadt Kamp-Lintfort<br />
will den Dauercampern künftig verbieten,<br />
ihren Erstwohnsitz auf seinem Platz anzumelden.<br />
Das zuständige Bauministe -<br />
rium mache Druck.<br />
Harsveldt will sich das nicht gefallen<br />
lassen: „Ein Platz nur für Touristen würde<br />
sich hier gar nicht mehr lohnen.“ Er habe<br />
sich schon vor Jahren auf den Trend<br />
eingestellt und investiert, in größere Gasspeicher<br />
zum Beispiel. In den vergangenen<br />
fünf Jahren seien 80 neue Mieter hierher<br />
gezogen, rund ein Viertel der heutigen<br />
Bewohner.<br />
„Die Leute kommen zu mir, weil es hier<br />
sicher und ordentlich ist“, sagt Harsveldt.<br />
Hinter der Schranke, die den Platz von<br />
der Außenwelt trennt, brauche niemand<br />
Angst vor Überfällen zu haben. Seine Mieter<br />
suchten die Nähe zur Natur und eine<br />
soziale Gemeinschaft. „Ich sag immer:<br />
Wir beugen hier Depressionen vor.“<br />
Ingrid Spei ist im Februar zusammen<br />
mit ihrem Mann in die Freizeit-Oase gezogen.<br />
Die beiden sind Anfang fünfzig,<br />
der Campingplatz soll einmal ihr Altersdomizil<br />
werden. „Wir wollten raus aus<br />
der Stadt“, sagt sie. Spei arbeitet als Verkäuferin<br />
auf einem Geflügelhof, ihr Mann<br />
Dieter fährt Lkw.<br />
Zwei Eigentumswohnungen in Duisburg<br />
haben sie verkauft und von dem Erlös<br />
rund 60000 Euro in ein sogenanntes<br />
Mobilheim investiert, ein Haus auf Rädern,<br />
wie es auch in den USA beliebt ist.<br />
Die 250-Quadratmeter-Parzelle kostet mit<br />
Gas, Strom und Wasser nur 430 Euro im<br />
Monat.<br />
Mobilheime gleichen geschrumpften<br />
Vorstadthäusern: ein Stockwerk, dünne,<br />
aber isolierte Wände. Bei den Oasen-Bewohnern<br />
sind sie beliebt. In verschiedenen<br />
Farben und Variationen säumen sie<br />
Es gibt keine Vorschriften<br />
für Hecken, Fahnenmast<br />
oder Carport – jeder darf<br />
sich einrichten, wie er will.<br />
hier die Straßen, meistens von einem kleinen<br />
Garten umgeben. Es gibt keine Vorschriften<br />
für Hecken, Fahnenmast oder<br />
Carport. Jeder darf sich hier einrichten,<br />
wie er es will.<br />
Das Heim der Speis ist in einem matten<br />
Grün gestrichen. Draußen wacht ein<br />
Hund aus Porzellan, links parkt der Kleinwagen.<br />
Alles sieht sehr ordentlich aus.<br />
Drinnen fühlt man sich wie in einer gewöhnlichen,<br />
allenfalls etwas engen Wohnung.<br />
Die Speis wohnen auf 40 Quadratmetern.<br />
„Mehr brauchen wir nicht“, sagt<br />
Ingrid Spei. Sie sitzt an ihrem Esstisch,<br />
hinter ihr steht eine Sofaecke mit Flachbildfernseher.<br />
Im Haus der Speis gibt es<br />
ein Bad mit Toilette und Duschkabine,<br />
JAKOB STUDNAR / <strong>DER</strong> <strong>SPIEGEL</strong><br />
eine Küchenzeile und ein Schlafzimmer<br />
mit Doppelbett.<br />
Mobilheime stehen auf einem Fahrwerk,<br />
man kann sie mitnehmen, wohin<br />
man will. Doch Spei sagt: „Wir wollen<br />
hier nie mehr weg.“ Als ihr Mann neulich<br />
ins Krankenhaus musste, hätten die Nachbarn<br />
ihn gefahren. „Einfach so“, sagt<br />
Spei. Solch einen Zusammenhalt habe es<br />
in Duisburg nicht gegeben.<br />
Der Zukunftsforscher Horst Opaschowski<br />
spricht vom Campingplatz als<br />
„emotionaler Rückzugsecke mit Landlust-<br />
Faktor“. Steigende Mieten und Nebenkosten<br />
fräßen die stagnierenden Ein -<br />
kommen vieler Geringverdiener auf. Ein<br />
Umzug auf den Campingplatz sei eine<br />
Option, um vor dieser Entwicklung zu<br />
fliehen. „Dort spüren die Menschen weniger,<br />
dass sie eigentlich ärmer werden.“<br />
Dietmar Harsveldt sagt, dass er mit seinen<br />
Campingplätzen auch eine soziale<br />
Verantwortung trage. Er sieht sich als Retter<br />
einer Mittelklasse, die langsam, aber<br />
sicher aus den Städten herausgemobbt<br />
werde. Auf seinen Plätzen wohnen auch<br />
arme Witwen und Hartz-IV-Empfänger.<br />
Harald Forst, 58, ist einer von ihnen.<br />
Ein bulliger Mann, bärtig, tätowiert, der<br />
erzählt, dass er 1985 aus der DDR geflohen<br />
sei. Forst kam vor fünf Jahren auf<br />
den Platz. Mit seinen letzten Ersparnissen<br />
kaufte er sich eine blaue Hütte, 25 Quadratmeter<br />
groß. Das größte Möbelstück<br />
ist der riesige Flachbildfernseher. Das<br />
Sozialamt übernimmt den Großteil der<br />
Platzmiete.<br />
Forst hat eine Katze und einen Garten,<br />
in dem im Sommer die Blumen blühen.<br />
„Ich kümmere mich so gern um sie“, sagt<br />
Forst. Das Häuschen auf dem Campingplatz<br />
sei die schönste Sozialwohnung, die<br />
er je hatte. „Hier kann ich ein bisschen<br />
leben, obwohl ich nichts habe.“<br />
PHILIPP ALVARES DE SOUZA SOARES<br />
Hinweisschilder in Altfeld, Camper Moser, Ehepaar Spei: „Wir wollen hier nie mehr weg“<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3 45
B E A M T E<br />
Gehalt vom<br />
Gericht<br />
Deutsche Beamte klagen gegen<br />
ihre Besoldung. Der Europäische<br />
Gerichtshof wird ihnen<br />
vermutlich recht geben. Die<br />
Kosten gehen in die Milliarden.<br />
Das finanzielle Wohl Berlins liegt<br />
diese Woche in der Hand eines<br />
Franzosen. Yves Bot, einer von<br />
neun Generalanwälten des Europäischen<br />
Gerichtshofs (EuGH), gibt am Donnerstag<br />
bekannt, ob Berliner Beamte seiner<br />
Meinung nach falsch besoldet werden.<br />
Wenn er diese Frage mit Ja beantwortet,<br />
was als wahrscheinlich gilt, wird es<br />
teuer. Denn im Großteil der Fälle folgen<br />
die Richter mit ihrem Urteil der Linie der<br />
Generalanwälte. Nicht nur auf Berlin kämen<br />
dann Ausgaben in dreistelliger Millionenhöhe<br />
zu, sondern auf alle Länder –<br />
und den Bund. Sie müssten ihr Besoldungsrecht<br />
entsprechend den Vorgaben<br />
des EuGH ändern. Insgesamt ginge es um<br />
jährliche Mehrkosten von 3,6 Milliarden<br />
Euro, schätzt die Bundesregierung. Schadensersatzforderungen<br />
noch gar nicht eingerechnet.<br />
Das Problem: Jahrzehntelang wurden<br />
sowohl Landes- als auch Bundesbeamte<br />
vor allem nach Lebensalter in ihre Gehaltsstufen<br />
einsortiert. Berufserfahrung<br />
spielte keine wirkliche Rolle. So konnte<br />
es vorkommen, dass ein 29-Jähriger, der<br />
seinen Dienst frisch begann, sofort in Stufe<br />
5 einsortiert wurde, während ein 21-<br />
Jähriger erst acht Jahre arbeiten musste,<br />
um dieselbe Stufe und damit dasselbe Gehalt<br />
zu erreichen wie der ältere Kollege.<br />
Das galt früher auch für Staatsangestellte.<br />
2011 entschieden der in Luxemburg<br />
ansässige EuGH und auch das deutsche<br />
Bundesarbeitsgericht, dass dies Alters -<br />
diskriminierung sei und damit hinfällig.<br />
In vorauseilendem Gehorsam machte<br />
sich der Bund daran, auch sein Besoldungsrecht<br />
für Beamte zu ändern. Die<br />
meisten Länder zogen nach. Für alle Neueingestellten<br />
gilt nun Berufserfahrung als<br />
entscheidende Größe bei der Höhe des<br />
Solds. So weit, so richtig.<br />
Aber: Für „Bestandsbeamte“, also all<br />
diejenigen, die zuvor schon im Staatsdienst<br />
waren, gab es Übergangsregelungen.<br />
Bei der Zuordnung in die neuen „Erfahrungsstufen“<br />
orientierte man sich allerdings<br />
einfach am vorherigen Gehalt,<br />
die Berufserfahrung spielte wieder keine<br />
Rolle. Die Altersdiskriminierung blieb bestehen.<br />
Für Bestandsbeamte sei die Reform<br />
deswegen „reiner Etikettenschwindel“,<br />
sagt Staatsrechtsprofessor Ulrich Battis:<br />
„Das ist nichts anderes als eine verschleierte<br />
Altersstufe“. Die Gewerkschaft Erziehung<br />
und Wissenschaft und ihre Juristen<br />
sehen das ähnlich. Sie raten all ihren<br />
Mitgliedern, Widerspruch gegen die Besoldungsbescheide<br />
einzulegen.<br />
Susanne Held hat vergangenen Herbst<br />
genau das getan. Die Berliner Gymnasial -<br />
lehrerin fühlt sich diskriminiert. Statt in<br />
Stufe 8, wo sie nach Berufsjahren im neuen<br />
System eigentlich hingehöre, sei sie in<br />
der „Überleitungsstufe 7“ gelandet.<br />
83 Euro gehen ihr so jeden Monat verloren.<br />
„Das ist im Jahr ein ganz schönes<br />
Sümmchen“, auch bei den Pensions -<br />
ansprüchen. „Wie viel Berufserfahrung<br />
soll ich mir denn noch aneignen?“, fragt<br />
die 55-Jährige fassungslos. Zurzeit ruht<br />
ihr Verfahren, das Verwaltungsgericht<br />
wartet auf die Entscheidung der europäischen<br />
Richter.<br />
Da das EU-Recht im Gegensatz zum<br />
deutschen keinen Unterschied macht zwischen<br />
Angestellten und Beamten, gilt es<br />
unter Juristen als wahrscheinlich, dass<br />
der Generalanwalt die Altersdiskriminierung<br />
rügen und die Übergangsregelung<br />
als reformbedürftig ansehen wird. Schließlich<br />
hat der EuGH das schon bei den Angestellten<br />
getan.<br />
Fraglich ist, wie weit das Urteil reichen<br />
wird. Muss rückwirkend mehr gezahlt<br />
werden? Gibt es sogar Strafzahlungen?<br />
Die Anwälte fordern nicht nur, dass die<br />
Übergangsregelungen angepasst werden,<br />
sondern dass ihre Mandanten für die gesamte<br />
Zeit, in der sie diskriminiert wurden,<br />
Höchstbesoldung erhalten.<br />
Über 70000 Beamte hat das Land Berlin,<br />
Hunderte haben Widerspruch eingelegt<br />
oder direkt geklagt. 1,6 Millionen Beamte<br />
gibt es in Deutschland, der Bund<br />
beschäftigt allein rund 180000 davon. Im<br />
März nahm die Bundesregierung in einem<br />
internen Schreiben an den EuGH,<br />
das dem <strong>SPIEGEL</strong> vorliegt, Stellung und<br />
wies die „Perpetuierung der Altersdiskriminierung“<br />
von sich.<br />
Das Problem wurde aber offensichtlich<br />
für ernst genug befunden, um mögliche<br />
Folgekosten schätzen zu lassen: „insgesamt<br />
rd. 3,6 Mrd. Euro“ würde es jährlich<br />
kosten, wenn der EuGH im Sinne der Kläger<br />
entscheidet. Eine rückwirkende Nachbesoldung<br />
gar nicht mitgerechnet.<br />
Wie das finanziert werden könnte, dazu<br />
wollte sich auf Anfrage bei den betroffenen<br />
Behörden niemand äußern. Dabei<br />
ahnte die Berliner Innenbehörde schon<br />
vor zwei Jahren, was passiert, wenn man<br />
das altersdiskriminierende Besoldungsrecht<br />
nicht reformiert. Die „potentiellen<br />
Mehrkosten“ würden sich für den unmittelbaren<br />
Landesdienst auf rund 109 Millionen<br />
Euro belaufen. Dass diese Gefahr<br />
durch die Übergangsregelung nicht gebannt<br />
wurde, wollte niemand wahrhaben.<br />
Beim EuGH heißt es, der Generalanwalt<br />
könne die finanziellen Folgen für<br />
die Beklagten in seine Entscheidung mit<br />
einbeziehen. Aber er müsse nicht.<br />
ANN-KATRIN MÜLLER<br />
Staatsdiener<br />
nach Alter in Deutschland * , 2012<br />
43<strong>48</strong>3<br />
46796<br />
51064 51350<br />
45 601<br />
* ohne Zeitsoldaten und<br />
Personal in Ausbildung<br />
Quelle: Statistisches<br />
Bundesamt<br />
27 795<br />
33235<br />
insgesamt<br />
rund<br />
1,6 Mio.<br />
unter<br />
25<br />
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 <strong>48</strong> 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 und<br />
älter<br />
46<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3
Deutschland<br />
V E R B R E C H E N<br />
Die Jünger von Littleton<br />
Forscher haben typische Merkmale von Amokläufern entdeckt.<br />
Das könnte helfen, Taten zu verhindern –<br />
doch nur wenige Schulen bereiten sich auf den Ernstfall vor.<br />
Sie steckt einen USB-Stick in ihren<br />
Computer, zwei Klicks, und auf dem<br />
Bildschirm vor Britta Bannenberg<br />
erscheinen schreckliche Szenen. Sie zeigen<br />
Schüler in der Cafeteria der Columbine<br />
High School in Littleton, Colorado.<br />
Jungen und Mädchen rennen panisch<br />
durcheinander, versuchen zu flüchten,<br />
kauern sich unter Tische. Die Bilder sind<br />
mit gregorianischem Gesang unterlegt.<br />
Dann erscheinen Dylan Klebold, 17, und<br />
Eric Harris, 18. Sie stolzieren durch den<br />
Raum, aufgenommen von der Überwachungskamera.<br />
Der eine trägt ein Käppi<br />
verkehrt herum auf dem Kopf und hält<br />
eine abgesägte Flinte in der Hand. Der andere<br />
ist ebenfalls mit einem Gewehr bewaffnet<br />
und hat eine Patronentasche dabei.<br />
Klebold und Harris erschießen zwölf Mitschüler<br />
und einen Lehrer, dann sich selbst.<br />
Britta Bannenberg sitzt an ihrem<br />
Schreibtisch im Institut für Kriminologie<br />
der Universität Gießen. Die 49-jährige<br />
Professorin klickt ein weiteres Video an.<br />
Wieder Columbine, wieder diese Szenen,<br />
diesmal mit Heavy-Metal-Klängen im<br />
Hintergrund. Der martialische Auftritt<br />
der Amoktäter wird mit Bildern weinender<br />
Kinder, mit denen von Schülern in<br />
Blutlachen und Särgen gemischt.<br />
„Es sind zynische, eklige Werke“, sagt<br />
Bannenberg. Und populäre. Die Klickzahlen<br />
vieler Filme, die Unbekannte ins<br />
Netz gestellt haben, sind fünfstellig.<br />
Geben sich die Zuschauer nur einem<br />
makabren, aber folgenlosen Vergnügen<br />
hin? Wohl nicht alle. Der Massenmord<br />
im Westen der Vereinigten Staaten gefällt<br />
nicht nur Voyeuren weltweit. Er hat nachweislich<br />
junge Leute zu ähnlichen Taten<br />
inspiriert.<br />
Dieses Fazit zieht Bannenberg nach<br />
sechs Jahren Aktenstudium. Sie hat 21<br />
Amoktaten in Deutschland untersucht<br />
und viele Gemeinsamkeiten entdeckt. Nahezu<br />
alle Täter hatten sich Columbine-<br />
Videos angeschaut. Die Täter waren bis<br />
auf zwei Ausnahmen männlich, fast alle<br />
waren 13 bis 16 Jahre alt, und sie hatten<br />
Wut auf die Welt und Angst vor der Blamage<br />
im Alltag.<br />
„Amokläufe wird es immer geben“,<br />
sagt Bannenberg. Jedes Jahr werden in<br />
Deutschland viele Amokdrohungen registriert.<br />
Eine verlässliche bundesweite<br />
Statistik fehlt, Hochrechnungen kommen<br />
auf etwa 3000 Drohungen pro Jahr. Doch<br />
wer will nur Angst verbreiten, Aufmerksamkeit<br />
erregen, sich aufspielen? Und<br />
wer wird wirklich morden?<br />
GARY CASKEY / REUTERS<br />
Täter in der Columbine High School 1999<br />
Wut auf die Welt<br />
Auf der Jahrestagung der Deutschen<br />
Gesellschaft für Psychiatrie und Nervenheilkunde<br />
in Berlin wollen Experten in<br />
dieser Woche darüber diskutieren. Und<br />
Bannenberg wird die Merkmale vorstellen,<br />
die sie aus den Analysen der Einzelfälle<br />
gewonnen hat; zu diesen Merkmalen<br />
zählen die folgenden sieben.<br />
1 Gefühlsarmes Elternhaus<br />
Georg R. war 18 Jahre alt, als er im September<br />
2009 das Carolinum-Gymnasium<br />
in Ansbach betrat. Er hatte ein Ziel: so<br />
viele Schüler und Lehrer wie möglich<br />
zu töten. Er warf Brandsätze in zwei<br />
Klassenzimmer und wartete vor der Tür<br />
mit einem Beil und mehreren Messern.<br />
Als die Schüler flüchteten, schlug er zu.<br />
13 Schüler verletzte er zum Teil lebensgefährlich.<br />
Nach der Scheidung der Eltern war R.<br />
mit 14 Jahren zu seinem Vater gezogen.<br />
Dieser war 25 Jahre lang Sportschütze gewesen.<br />
Die beiden lebten nebeneinanderher,<br />
„ohne stundenlange Gespräche zu<br />
führen“, wie es der Vater ausdrückte. In<br />
den letzten Sommerferien saß der Sohn<br />
von früh bis spät vor dem Fernseher oder<br />
dem PC, jeden Tag.<br />
Solche bürgerlichen Elternhäuser fand<br />
Bannenberg bei den meisten Tätern. Es<br />
gab keine Gewalt und keine übermäßigen<br />
Aggressionen, aber es herrschte meistens<br />
eine kalte, sprachlose Atmosphäre. Die<br />
Eltern waren hilflos und konnten den<br />
Rückzug der Kinder in die Computerwelt<br />
nicht stoppen.<br />
2 Hass in Computerspielen<br />
Am 20. November 2006 betrat der 18-jährige<br />
Bastian B. seine ehemalige Schule<br />
im münsterländischen Emsdetten, er<br />
schoss wahllos auf Menschen und zündete<br />
Rauchbomben. 37 Personen wurden<br />
zum Teil schwer verletzt. Dann tötete B.<br />
sich durch einen Schuss in den Mund.<br />
Die Rekonstruktion seines Lebens ergab,<br />
dass er unter dem Namen „Re -<br />
sistanceX“ im Cyberspace unterwegs<br />
war und für „Counterstrike“ und andere<br />
Ballerspiele nur noch am Rechner saß.<br />
Er begann, vom eigenen Massaker zu<br />
träumen.<br />
„Gewaltspiele lösen nicht automatisch<br />
Gewalt aus“, sagt Bannenberg. „Aber sie<br />
bieten eine enorme Projektionsfläche.<br />
Der schwache Junge ohne Anerkennung<br />
wird zum starken männlichen Helden,<br />
vor dem andere Angst bekommen.“<br />
3 Fehlende Anerkennung<br />
Im Februar 2002 fuhr der polnischstämmige<br />
Adam L. in Bundeswehr-Tarnklei-<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3 47
Deutschland<br />
dung zu seiner ehemaligen<br />
Firma im bayerischen Eching,<br />
die ihm kurz zuvor gekündigt<br />
hatte. Dort tötete der<br />
22-Jährige mit einer Pistole<br />
vom Typ Tokarev 57 den Betriebsleiter<br />
und einen Vor -<br />
arbeiter. Danach fuhr er mit<br />
einem Taxi zur Wirtschaftsschule<br />
in Freising, die er<br />
früher besucht hatte, ermordete<br />
den Schulleiter und<br />
verletzte einen Religionslehrer<br />
schwer. Am Ende tötete<br />
sich L. durch einen Schuss in<br />
den Mund. Er galt in der<br />
Schule als vorlaut. Seinen Lehrern, die<br />
ihn von der Schule werfen wollten, soll<br />
er gedroht haben: „Ich werde Sie alle<br />
erschießen.“<br />
Bannenberg fand heraus, dass sich<br />
Amoktäter gemobbt fühlen und narzisstisch<br />
gekränkt sind. „Dies war aber oft<br />
nur deren subjektive Wahrnehmung.<br />
Die Täter ziehen daraus die Rechtfertigung<br />
für ihre Tötungsphantasien und ihre<br />
Taten.“<br />
4 Leidenschaft für Waffen<br />
Im April 2002 starben in Erfurt zwölf Lehrer,<br />
eine Sekretärin, zwei Schüler und ein<br />
Polizist. Der Täter: Robert Steinhäuser,<br />
Kriminologin Bannenberg<br />
„Eklige Werke“<br />
BERND WEISSBROD / PICTURE-ALLIANCE / DPA<br />
19 Jahre alt. Weil er ein gefälschtes<br />
ärztliches Attest<br />
vorgelegt hatte, war der<br />
Gymnasiast wenige Monate<br />
zuvor von der Schule verwiesen<br />
worden. Und stand nun<br />
ohne Hochschulreife da.<br />
Die Tat ereignete sich am<br />
Tag der letzten schriftlichen<br />
Abiturprüfungen. In einer<br />
Reisetasche trug Steinhäuser<br />
seine Waffen und die Munition.<br />
Eineinhalb Jahre zuvor<br />
war er Mitglied in einem<br />
Schützenverein geworden.<br />
Er besorgte sich einen Waffenschein<br />
und damit in den Monaten vor<br />
seinem Amoklauf unter anderem eine Pistole<br />
Glock 17; eine Pumpgun, Mossberg<br />
590, trug er auf dem Rücken.<br />
Viele Amokläufer oder deren Väter waren<br />
selbst Sportschützen. „Militärische<br />
Symbole faszinierten die Täter, und nicht<br />
wenige interessierten sich sehr für die<br />
Nazi-Zeit – ohne eine rechtsextreme Gesinnung<br />
zu haben. Dies ist eher Ausdruck<br />
ihrer Menschenverachtung“, konstatiert<br />
Bannenberg.<br />
5 Suizid- und Gewaltgedanken<br />
Im Juli 2003 hatte Florian K., 16, eine Pistole<br />
Walther PPK und einen Colt Python<br />
Magnum in seinem Rucksack. Er war an<br />
seiner Realschule in Coburg sitzengeblieben.<br />
Der langhaarige Gothic-Anhänger<br />
umrandete seine Augen mit schwarzem<br />
Kajalstift.<br />
Während des Unterrichts holte er seine<br />
Pistole hervor, zielte auf die Lehrerin, die<br />
mit dem Rücken zur Klasse an der Tafel<br />
stand, und drückte ab. Er verfehlte die<br />
Frau. Ein zweites Projektil traf die Decke.<br />
Als die Schulpsychologin Gabriele O. in<br />
das Klassenzimmer kam, wurde sie am<br />
Oberschenkel getroffen. Dann erschoss<br />
sich Florian.<br />
„Amoktäter wollen nicht nur andere<br />
töten oder zumindest schwer verletzen,<br />
ihr eigener Tod ist fast immer mitgeplant“,<br />
sagt Bannenberg.<br />
6 Persönlichkeitsstörungen<br />
Am 11. März 2009 tötete der 17-jährige<br />
Tim K. in Winnenden und Wendlingen<br />
in Baden-Württemberg 15 Menschen. Lange<br />
vor der Tat hatten sich seine Eltern<br />
Sorgen gemacht: Tim war schlecht in der<br />
Schule und zunehmend isoliert. Etwa ein<br />
Jahr vor dem Amoklauf hatte er ihnen<br />
erzählt, er glaube, manisch-depressiv zu<br />
sein.<br />
Die Eltern suchten Rat in der Kinderund<br />
Jugendpsychiatrie. Dort erzählte<br />
Tim von seinem Hass auf die Welt, er be-
ichtete von seinen Stimmungsschwankungen<br />
und seiner Vorstellung, Menschen<br />
zu töten.<br />
Amoktäter seien oft still und unzugänglich,<br />
zögen sich schließlich total in<br />
ihre eigene Welt zurück, sagt Bannenberg.<br />
Sie versuchten dann, ihr Umfeld<br />
durch hasserfüllte Äußerungen, ihre Kleidung<br />
oder Musik zu provozieren. Amoktaten,<br />
folgert die Forscherin, seien nicht<br />
unerklärlich, die Täter seien „in weitaus<br />
höherem Maße psychopathologisch auffällig<br />
als bisher angenommen“.<br />
7 Die Farbe Schwarz<br />
Der amerikanische Fernsehsender Dis -<br />
covery Channel sendete eine Dokumentation<br />
über den Amoklauf von Littleton.<br />
Schauspieler in schwarzen Roben stellten<br />
darin die Morde von Klebold und Harris<br />
nach – für deutsche Amoktäter haben die<br />
Szenen der Mörder in Schwarz Symbolcharakter.<br />
Die meisten trugen bei ihren<br />
eigenen Taten später schwarze Kleidung.<br />
Wie fast alle war auch Georg R., der<br />
Amokläufer aus Ansbach, ganz in<br />
Schwarz gekleidet. Weiß waren nur die<br />
Buchstaben auf seinem T-Shirt: „Made in<br />
School“.<br />
Schwarz spiegle die „Beschäftigung mit<br />
Gewalt und Tod“ wider, sagt Bannenberg,<br />
es zeige „die Vermischung virtueller<br />
Welten mit Tötungsphantasien und fortgeschrittene<br />
Phasen der Tatplanung“.<br />
Lässt sich mit diesem Wissen verhindern,<br />
dass die Tatplanung fortschreitet<br />
bis zur letzten, zur tödlichen Phase?<br />
Davon sind Forscher wie Britta Bannenberg<br />
überzeugt: Ihr Wissen könne helfen,<br />
potentielle Amokläufer rechtzeitig zu<br />
identifizieren. Und mehr noch: Auch<br />
manche Terroristen ließen sich so möglicherweise<br />
erkennen. „Sie sind sich von<br />
der Persönlichkeitsstruktur sehr ähnlich“,<br />
sagt Bannenberg.<br />
Zu diesem Schluss kommt auch Norbert<br />
Nedopil. Der renommierte Psych -<br />
iater aus München hat sich mit vier terroristischen<br />
Einzeltätern näher beschäftigt:<br />
dem österreichischen Briefbomber Franz<br />
Fuchs, dem norwegischen Attentäter Anders<br />
Behring Breivik, dem amerikanischen<br />
„Unabomber“ Theodor Kaczynski<br />
und mit Ernst Wagner, der vor hundert<br />
Jahren 14 Menschen tötete. „Auch sie waren<br />
Außenseiter, die von ihrer Umgebung<br />
verspottet wurden“, sagt Nedopil, „dar-<br />
aufhin haben sie sich gekränkt zurück -<br />
gezogen und in der Isolation eine enorme<br />
Wut entwickelt.“<br />
Die Fachleute hoffen nun, mit ihren<br />
Erkenntnissen die Praxis zu erreichen.<br />
Die Deutsche Polizeigewerkschaft klagt<br />
seit Jahren darüber, dass die Prävention<br />
an den Schulen mangelhaft sei. „Jede<br />
Schule braucht je nach Größe und Standort<br />
einen individuellen Sicherheitsplan,<br />
doch davon sind wir weit entfernt“, sagt<br />
der Bundesvorsitzende Rainer Wendt.<br />
Er fordert eine Verpflichtung der Schulen,<br />
regelmäßig den Ernstfall unter professioneller<br />
Anleitung zu üben, ähnlich<br />
wie bei Brandschutz oder Verkehrs -<br />
sicherheit. Es reiche nicht aus, „dass<br />
die Schulaufsichtsbehörde einen Aktenordner<br />
aushändigt, der dann in irgend -<br />
einem Regal landet“. Zudem seien So -<br />
zialarbeiter und Schulpsychologen nötig,<br />
um den Schülern „wirklich tief in die<br />
Seele schauen und helfen zu können“,<br />
sagt Wendt.<br />
Die meisten Schulen, Aufsichtsbehörden<br />
und Kultusminister zeigten jedoch<br />
wenig Interesse an Prävention, kritisiert<br />
Kriminologin Bannenberg. Allein das<br />
Wort „Amok“ schrecke dermaßen ab,<br />
dass sie „lieber den Kopf in den Sand stecken<br />
und gar nichts tun“.<br />
Anders die Schüler: Sie warnen, wie<br />
Untersuchungen gezeigt haben, oft genug<br />
ihre Lehrer, wenn sich ein Klassenkamerad<br />
plötzlich abkapselt, mit Waffen prahlt<br />
oder nur noch von Hass und Gewalt redet.<br />
Britta Bannenberg aber fragt sich,<br />
„ob diese Anzeigen überhaupt ernst genommen<br />
werden“.<br />
UDO LUDWIG,<br />
ANTJE WINDMANN
Deutschland<br />
H E S S E N<br />
Kleines<br />
Tröpfchen<br />
Der Weinbau an steilen Flussufern<br />
lohnt sich kaum noch.<br />
Jetzt will eine Hochschule das<br />
Kulturerbe retten – mit<br />
einem kuriosen Spezialfahrzeug.<br />
Der Prototyp sieht aus wie eine<br />
Kreuzung aus einem Nasa-Mondfahrzeug<br />
mit Fred Feuersteins<br />
Familienmobil aus der Steinzeit-TV-Serie<br />
„The Flintstones“: Vier oder sechs mächtige<br />
Aluminiumwalzen mit spitzen blauen<br />
Noppen, ein GPS-Empfänger und<br />
eine Fernsteuerung mit Joystick – so<br />
soll das Gefährt in Zukunft führerlos<br />
durch die steilsten Weinberge Deutschlands<br />
kraxeln.<br />
„Geisi“, wie die Forscher ihr kurioses<br />
Vehikel getauft haben, steht in zwei Ausführungen<br />
in einer Werkhalle der Geisenheim<br />
University im hessischen Rheingau.<br />
Den ganzen Sommer über haben die<br />
Techniker der auf Weinbau spezialisierten<br />
Hochschule das Gerät an den Ufern<br />
des Mittelrheintals getestet. Sie haben es<br />
mal mit zwei, mal mit drei Achsen auf<br />
Versuchsstrecken mit bis zu 80 Prozent<br />
Steigung geschickt. Und nun, am Ende<br />
der Saison, sind sie sich ziemlich sicher:<br />
Geisi könnte ihnen dabei helfen, eine der<br />
schönsten deutschen Kulturlandschaften<br />
zu retten – den Rebenanbau in den engen<br />
Talhängen von Rhein, Main, Mosel, Saale,<br />
Saar oder Neckar.<br />
Um diesen Steillagen-Weinbau steht es<br />
seit geraumer Zeit nicht gut. Die Pflege<br />
und Lese der Trauben in extremer Hanglage<br />
ist aufwendig, teuer und gefährlich.<br />
Maschinen und Traktoren, die in der Ebene<br />
zum Schneiden, Spritzen und Ernten<br />
in die Rebzeilen geschickt werden können,<br />
sind dort kaum einsetzbar.<br />
Immer mehr Winzer ziehen sich deshalb<br />
aus dem mühsamen Geschäft zurück<br />
und verlegen ihre Rebstöcke in flachere<br />
Gefilde. „1970 hatten wir in Deutschland<br />
noch 12000 Hektar echte Steillagen“, sagt<br />
Hans-Peter Schwarz, 53, der Leiter des<br />
Technikinstituts der Hochschule, „heute<br />
sind es nicht einmal mehr 8000 Hektar.“<br />
Unter echten Steillagen versteht Schwarz<br />
Weinberge mit Steigungen von 60 Prozent<br />
und mehr: „Also solche Lagen, die<br />
das Bild des Rebenanbaus in vielen Regionen<br />
Deutschlands seit Jahrhunderten<br />
geprägt haben.“<br />
Dass die sorgfältig nebeneinander aufgereihten<br />
Rebstöcke mehr und mehr einem<br />
Wildwuchs aus Büschen und Dornen<br />
52<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3<br />
Pflegeroboter „Geisi“ im Steilhang bei Rüdesheim<br />
weichen, beobachten längst auch die Regierenden<br />
mit Sorge. Am Weinbau entlang<br />
den Flüssen hänge nicht nur die Identität<br />
vieler Regionen, sondern es gehe<br />
auch, beispielsweise im Tourismus, um<br />
wichtige Arbeitsplätze, warnte das rheinland-pfälzische<br />
Wirtschaftsministerium<br />
bereits vor Jahren. Das obere Mittelrheintal<br />
verdanke seine Ernennung zum Weltkulturerbe<br />
durch die Unesco ausdrücklich<br />
den „rebenbesetzten Talhängen“. Erst<br />
durch den Weinbau werde das Gebiet<br />
„zum Inbegriff der romantischen Rheinlandschaft“.<br />
Die betroffenen Bundesländer haben<br />
daher Förderprogramme entwickelt und<br />
locken mit Beihilfen. In Hessen beispielsweise<br />
können Winzer, die sich umweltschonenden<br />
Anbaumethoden verschreiben,<br />
jährlich bis zu 2300 Euro Zuschuss<br />
pro Hektar Steillage bekommen.<br />
Die Summe sei indes kaum mehr als<br />
ein kleines Tröpfchen im großen Weinfass,<br />
betont der Geisenheimer Hochschullehrer<br />
Schwarz. Wer eine extreme Hanglage<br />
bewirtschafte, in der Pflegearbeiten<br />
nur mit Kletterei – teils mit Seilzügen gesichert<br />
– und in zeitintensiver Handarbeit<br />
erledigt werden könnten, müsse mit bis<br />
zu 1500 Arbeitsstunden pro Hektar und<br />
Weinsaison rechnen. In der Ebene, wo<br />
intensiver Traktorenbetrieb und der Einsatz<br />
automatisierter Vollernte-Fahrzeuge<br />
möglich sei, reichten für die gleiche Fläche<br />
etwa 180 Arbeitsstunden, so Schwarz:<br />
„Diesen Unterschied kann man auch mit<br />
möglicherweise höheren Preisen für Spitzenqualität<br />
aus sonnenverwöhnten Steilhängen<br />
kaum ausgleichen.“<br />
Weiterer Druck auf die Steillagen-Winzer<br />
kommt aus Brüssel. Die Europäische<br />
Union will den Weinmarkt liberalisieren<br />
und sich schrittweise von einer Regelung<br />
verabschieden, die den Winzern bisher<br />
einen komfortablen Schutzraum verschaffte.<br />
Es geht um den gesetzlichen<br />
Anbaustopp, der die Weinbaufläche in<br />
Deutschland derzeit auf etwas mehr als<br />
100000 Hektar beschränkt. Wer neu ins<br />
Geschäft mit den Trauben einsteigen will,<br />
muss entweder eine bereits bewirtschaftete<br />
Fläche übernehmen oder nachweisen,<br />
dass eine vergleichbar große Fläche in<br />
seiner Region stillgelegt wurde.<br />
Ab 2016 jedoch dürfen die Rebflächen<br />
in den EU-Mitgliedstaaten wachsen –<br />
jährlich um ein Prozent. Zusätzliche Anbaufläche<br />
bedeutet aber auch zusätzliche<br />
Konkurrenz, gerade für die Produzenten<br />
teurer Steillagen-Weine.<br />
Kletterspezialist Geisi könnte aus Sicht<br />
der Geisenheimer Önologen dazu beitragen,<br />
den Weinbau im Steilhang stärker<br />
zu rationalisieren – und die örtlichen Winzer<br />
zu ermuntern, ihre exponierten Lagen<br />
weiter zu bewirtschaften. Technikchef<br />
Schwarz und sein Team knobeln schon<br />
seit fast einem Jahrzehnt an dem Gefährt.
Im Gegensatz zu üblichen Raupenfahrzeugen<br />
soll die Geisenheimer Konstruktion<br />
durch ihren niedrigen Schwerpunkt<br />
auch im extremen Gelände nicht umstürzen<br />
– unter anderem weil der Antriebsmotor<br />
unterhalb der Achsen in den Walzenrädern<br />
eingebaut wurde.<br />
Zudem soll eine ausgefeilte Funk- und<br />
Satellitennavigation dafür sorgen, dass<br />
Geisis Bordcomputer den Weg durch die<br />
Rebzeilen ganz allein finden kann – und<br />
dabei zielgenau beispielsweise Spritzmittel<br />
versprüht oder den Reben einen groben<br />
Grundschnitt verpasst.<br />
Noch ist der Prototyp mit gut 1,70 Metern<br />
etwas zu breit, um zwischen alten,<br />
oft eng gepflanzten Rebstockzeilen einsetzbar<br />
zu sein. Deshalb will die Hochschule<br />
im kommenden Jahr zusammen<br />
mit einer süddeutschen Spezialfirma eine<br />
schlankere Version bauen. „Der Markt<br />
dafür ist da“, sagt Schwarz zuversichtlich.<br />
Bei einer Fachmesse in Stuttgart im April<br />
hätte er von Geisi „schon zehn Stück verkaufen<br />
können“.<br />
Parallel dazu tüfteln die Geisenheimer<br />
noch an Anbaumethoden, die den Arbeitsaufwand<br />
am Steilhang vermindern;<br />
beispielsweise durch ein Minimalschnittverfahren,<br />
das in Australien entwickelt<br />
wurde. Dabei werden die Reben in größeren<br />
Abständen als üblich gepflanzt und<br />
dürfen, nach einem groben Maschinenschnitt,<br />
fast ungehindert wuchern.<br />
Die ersten Erfahrungen waren ermu -<br />
tigend. Im Herbst waren die Beeren zwar<br />
etwas kleiner als bei herkömmlichen<br />
Verfahren, aber dafür gab es auch weniger<br />
Fäulnis, sagt Hochschulpräsident<br />
Hans Reiner Schultz. „Die Trauben saßen<br />
nicht so fest und kompakt aufeinander,<br />
sondern sie waren lockerer, so dass<br />
sie nach einem Regen auch besser trocknen<br />
konnten.“<br />
Ganz ausgefeilt ist das Verfahren noch<br />
nicht. „Schauen Sie hier“, sagt Schultz<br />
und zeigt an seinem Computer die Aufnahmen<br />
wild wuchernder Reben, die hinter<br />
dicken, aufgeblähten Blätterschichten<br />
kaum noch zu erkennen sind. „Für Ästhe -<br />
ten ist das nichts“, findet Schultz.<br />
Allerdings hat der Hochschullehrer<br />
auch Argumente dafür, dass die Minimalschnitt-Methode<br />
in Steillagen durchaus<br />
vorzeigbare Ergebnisse hervorbringen<br />
kann. Seit mittlerweile vier Jahren werden<br />
die Trauben, die in Kaub auf dem<br />
Versuchshang der Universität wachsen,<br />
zu Wein verarbeitet. Den Jahrgang 2012<br />
hat das hochschuleigene Weingut auf<br />
Flaschen gezogen und mit dem Namen<br />
„Kauber Rauscheley“ versehen. Es ist ein<br />
spritziger, trockener Riesling, der den<br />
interessierten Steillagen-Besitzern nun<br />
zur Verkostung angeboten werden soll.<br />
Schultz ist optimistisch: „Einen Winzer<br />
kann man vor allem von einer neuen Methode<br />
überzeugen, wenn ihm das Ergebnis<br />
schmeckt.“<br />
MATTHIAS BARTSCH<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3 53
<strong>SPIEGEL</strong>: Frau Pantel, Frau Schulte, Sie haben<br />
im Bundestagshandbuch als Beruf<br />
Hausfrau angegeben. Haben Sie dabei einen<br />
Moment gezögert?<br />
Pantel: Nein, das habe ich ganz bewusst<br />
so gemacht. Mir ist schon klar, dass die<br />
Berufsbezeichnung Hausfrau kein Renommee<br />
hat und man damit keine besondere<br />
Anerkennung bekommt. Das finde<br />
ich falsch. Ich bin ehrenamtlich eine ganze<br />
Menge unterwegs, ich führe den Haushalt,<br />
mein Mann ist berufstätig. Also<br />
schreibe ich es so auf.<br />
Schulte: Ich habe auch nicht gezögert, weil<br />
das ehrlich ist. Ich bin Hausfrau. Ich war<br />
ebenfalls ehrenamtlich tätig, ich habe Kinder<br />
großgezogen und meine alten Eltern<br />
gepflegt. Ich finde nicht, dass man sich<br />
dafür schämen muss. Man verblödet ja<br />
nicht automatisch hinter dem Herd.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Das Wort Hausfrau hat mittlerweile<br />
einen negativen Beiklang, den es<br />
54<br />
Parlamentarierinnen Schulte, Pantel<br />
Deutschland<br />
K A R R I E R E N<br />
„Das regt mich auf“<br />
Die CDU-Abgeordnete Sylvia Pantel, 52, und ihre SPD-Kollegin<br />
Ursula Schulte, 61, sind die beiden einzigen Hausfrauen im<br />
Bundestag und reden über die Vorurteile, denen sie dort begegnen.<br />
früher nicht hatte. Begegnen Ihnen die<br />
Leute manchmal mit Herablassung?<br />
Schulte: Ich bin Fraktionsvorsitzende im<br />
Kreistag gewesen und Ratsfrau. Deshalb<br />
sind mir die Leute auch nicht so begegnet,<br />
als wenn sie mich für dumm hielten. Das<br />
wäre vielleicht so, wenn ich mich allein<br />
auf den Haushalt beschränkt hätte.<br />
Pantel: Bei mir ist es ähnlich. Ich habe<br />
angefangen zu studieren, war selbständig.<br />
Ich war in der Kommunalpolitik<br />
und stellvertretende Fraktionsvorsitzende<br />
im Landschaftsverband. Bisher ist keiner<br />
auf die Idee gekommen, mich nicht<br />
ernst zu nehmen. Ich weiß natürlich<br />
nicht, was man hinter meinem Rücken<br />
spricht.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Gibt es einen Unterschied in der<br />
Reaktion von Männern und Frauen, wenn<br />
Sie Ihren Beruf nennen?<br />
Schulte: Der Unterschied liegt woanders.<br />
Ich werde immer gefragt: „Was macht<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3<br />
WERNER SCHUERING / <strong>DER</strong> <strong>SPIEGEL</strong><br />
denn Ihr Mann, wenn Sie in die große<br />
Politik nach Berlin gehen?“ Das regt mich<br />
zunehmend auf. Das würde man einen<br />
Mann nie fragen.<br />
Pantel: Da haben Sie recht. Das geht den<br />
meisten weiblichen Abgeordneten so, unabhängig<br />
vom Beruf.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Angela Merkel erklärt ihre Politik<br />
gern mit dem Bild der „schwäbischen<br />
Hausfrau“. Leuchtet Ihnen das ein?<br />
Schulte: Das ist zumindest ein Bild, mit<br />
dem viele etwas anfangen können. Auch<br />
wenn die Hausfrauen im Begriff sind auszusterben.<br />
Pantel: Wenn Frauen das Geld zusammenhalten,<br />
das der Mann nach Hause bringt,<br />
ist das auch eine Leistung. Von daher finde<br />
ich das Bild in Ordnung.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Die Autorin Birgit Kelle schreibt,<br />
früher hätten Mütter darum kämpfen<br />
müssen, wenn sie einen bezahlten Beruf<br />
ausüben wollten. Heute müssten sich die<br />
Hausfrauen rechtfertigen, wenn sie zu<br />
Hause blieben.<br />
Pantel: Im Grunde stimmt das. Ich finde<br />
das nicht gut. Wenn eine Frau sich dafür<br />
entscheidet, ist das ihr gutes Recht.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: War das bei Ihnen eine bewusste<br />
Wahl, Hausfrau zu werden?<br />
Schulte: Ich bin sehr jung überraschend<br />
schwanger geworden. Früher wurde man<br />
ja noch überraschend schwanger. Deshalb<br />
bin ich erst einmal zu Hause geblieben.<br />
Dann ging es meinen Eltern schlechter,<br />
sie wurden pflegebedürftig. Ich habe<br />
mich um sie gekümmert. Das hat sich<br />
langsam entwickelt und mich immer<br />
mehr in Anspruch genommen. Irgendwann<br />
sitzt man da drin und kommt nicht<br />
mehr raus.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Sie sind in die Sache reingerutscht?<br />
Schulte: Wir wohnten mit den Eltern zusammen.<br />
Die schiebt man dann nicht ab<br />
ins Altersheim. Auf dem Land geht das<br />
schon gar nicht. Da wird erwartet, dass<br />
die Frau alles macht, die Pflege und Betreuung.<br />
Ich bereue das nicht. Das war<br />
auch eine schöne Zeit. Aber klar ist auch,<br />
dass ich unter den Umständen nicht Abgeordnete<br />
hätte werden können. Meine<br />
Mutter ist 2011 verstorben. Mit einer pflegebedürftigen<br />
Person zu Hause hätte ich<br />
nicht kandidieren können.<br />
Pantel: Ich habe die Entscheidung bewusst<br />
getroffen. Ich hatte ein BWL-Studium begonnen,<br />
das ich abgebrochen habe, weil<br />
ich viele Kinder wollte. Ich habe selber<br />
fünf Brüder, ich wusste, was das heißt.<br />
Ich wusste, dass das auch Verzicht bedeutet.<br />
Aber es war toll, für meine Kinder<br />
zu Hause zu sein.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Was würden Sie Ihren Töchtern<br />
sagen, wenn die Ihnen eröffneten, dass<br />
sie Hausfrau werden möchte?<br />
Pantel: Ich weiß, dass unsere Töchter, egal<br />
ob nach Studium oder Berufsausbildung,<br />
eine gewisse Zeit lang Hausfrau werden<br />
möchten. Sie möchten die ersten Jahre
ihres Kindes voll miterleben<br />
und selbst beeinflussen.<br />
Sie sagten, dass sie bei<br />
ihren Geschwistern mitbekommen<br />
haben, wie schön<br />
das ist und wie schnell das<br />
vergeht.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Mit dem Beruf vor -<br />
übergehend auszusetzen<br />
ist etwas anderes, als sich<br />
für den Beruf der Hausfrau<br />
zu entscheiden.<br />
Schulte: Ich erzähle allen<br />
jungen Frauen: Macht<br />
nicht das, was ich gemacht<br />
habe. Bleibt nicht zu Hause.<br />
An meinem Beispiel<br />
könnt ihr sehen, wohin das<br />
führen könnte. Wenn ich<br />
nicht verheiratet und<br />
durch die Rente meines<br />
Mannes abgesichert wäre – oder durch<br />
die Witwenrente, falls er stirbt –, dann<br />
müsste ich von der Grundsicherung leben.<br />
Hausfrauen landen in der Altersarmut,<br />
das ist einfach so. Ich habe das auch meiner<br />
Tochter und meiner Schwiegertochter<br />
gesagt. Beide sind berufstätig. Die sehen<br />
am Beispiel ihrer Mütter, dass das nicht<br />
lustig wäre, im Alter arm zu sein.<br />
Pantel: Das neue Unterhaltsrecht hat die<br />
Absicherung von Ehefrauen massiv verschlechtert.<br />
Insofern kann man jungen<br />
Leuten, egal ob männlich oder weiblich,<br />
nicht raten, ganz aus dem Berufsleben<br />
auszusteigen. Das wäre ein schlechter<br />
Rat.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Wäre es nicht eine Aufgabe der<br />
Politik, das zu ändern? Es ist doch immer<br />
von Wahlfreiheit die Rede.<br />
Schulte: Ich glaube nicht, dass wir eine<br />
staatliche Leistung hinkriegen, die Frauen<br />
so absichert, dass sie im Alter davon angemessen<br />
leben können. Ich habe im<br />
Wahlkampf viele Frauen getroffen, die<br />
400 oder 500 Euro Rente hatten. Ich möchte<br />
nicht, dass Frauen so enden. Dafür sind<br />
die Mädchen und jungen Frauen heute<br />
auch viel zu gut ausgebildet.<br />
Es wäre doch ein Verlust<br />
für die Gesellschaft,<br />
wenn die zu Hause blieben.<br />
Pantel: Wir müssen den<br />
Menschen ermöglichen, fle -<br />
xibler zu werden. Es ist<br />
enorm schwierig, zur gleichen<br />
Zeit Kinder großzuziehen,<br />
arbeiten zu gehen,<br />
ein Haus zu bauen, Verwandte<br />
zu pflegen. Wir<br />
müssen viel mehr über Lebensarbeitszeitkonten<br />
und<br />
andere kreative Möglichkeiten<br />
nachdenken.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Etwa das Betreuungsgeld?<br />
Pantel: Sicher, es zeigt die<br />
Anerkennung für die Arbeit<br />
der Mütter. Genauso,<br />
56<br />
Deutschland<br />
„Mir ist schon klar,<br />
dass die Berufsbezeichnung<br />
Hausfrau<br />
kein Renommee hat.<br />
Das finde ich falsch.“<br />
SYLVIA PANTEL (CDU)<br />
„Ich erzähle allen<br />
jungen Frauen: Macht<br />
nicht das, was ich<br />
gemacht habe. Bleibt<br />
nicht zu Hause.“<br />
URSULA SCHULTE (SPD)<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3<br />
FOTOS: WERNER SCHUERING / <strong>DER</strong> <strong>SPIEGEL</strong><br />
wie wir das mit dem Pflege -<br />
geld gemacht haben.<br />
Schulte: Ich finde das Betreuungsgeld<br />
nicht in Ordnung.<br />
Zum einen sind 100<br />
Euro ein lächerlicher Betrag<br />
und keine Anerkennung,<br />
wie Sie es nennen.<br />
Zum anderen suggeriert es<br />
auch was Falsches, nämlich:<br />
„Bleib mal schön zu<br />
Hause.“<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Es wird jedenfalls<br />
das Problem von Haus -<br />
frauen, die im Alter von<br />
Armut bedroht sind, nicht<br />
lösen.<br />
Pantel: Nein, aber es ist<br />
nicht nichts. Wir werden<br />
auch die Rente für Mütter,<br />
die vor 1992 Kinder bekommen<br />
haben, erhöhen. Es ist nur fair, dass<br />
die Erziehung von Kindern bei der Altersvorsorge<br />
nicht einfach unter den Tisch fällt.<br />
Schulte: Die Mütterrente kann ich unterstützen.<br />
Ich finde nur falsch, dass sie aus<br />
Beiträgen bezahlt wird. Man müsste das<br />
aus Steuergeldern machen.<br />
Pantel: Da stimme ich Ihnen zu. So wird<br />
es bei der Anrechnung von Erziehungsleistungen<br />
bisher ja auch gemacht.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Stört es Sie, wie in der feministischen<br />
Debatte über Hausfrauen geredet<br />
wird?<br />
Pantel: Es stört mich, dass der Begriff so<br />
einen schlechten Ruf hat. Es gibt doch<br />
viele Frauen, die sind wegen der Kinder<br />
oder aus anderen Gründen eine Zeitlang<br />
nicht berufstätig oder nur wenig. Die sind<br />
im Hauptberuf Hausfrau. Aber die würden<br />
sich nie so nennen. Der Begriff ist<br />
stigmatisiert.<br />
Schulte: Ich bin keine Feministin. Aber<br />
wenn man weiß, wie die Wirklichkeit aussieht,<br />
dann kann man doch keiner jungen<br />
Frau sagen: Werde Hausfrau. Das muss<br />
man sich finanziell leisten können, und<br />
das können die wenigsten.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Was haben Sie<br />
denn als Hausfrau gelernt,<br />
was Ihnen nun in der Politik<br />
nützt?<br />
Pantel: Ganz einfach: Sie<br />
müssen organisieren können.<br />
Schulte: Und Konflikte aushalten.<br />
Wir waren teilweise<br />
vier Generationen unter<br />
einem Dach. Das hat mir<br />
auch als Fraktionsvorsitzender<br />
ganz gut geholfen. Das<br />
Parlament soll ja die Bevölkerung<br />
widerspiegeln. Unsere<br />
Lebenswelt gehört da<br />
rein, nicht nur die von Juristen<br />
oder Leuten aus dem<br />
Öffentlichen Dienst.<br />
INTERVIEW: ANN-KATRIN<br />
MÜLLER, RALF NEUKIRCH
Szene<br />
Was war da los,<br />
Frau Egan?<br />
Monique Egan, 20, Studentin aus Manchester,<br />
über eine verschwitzte Begegnung:<br />
„Ich trainierte am Boxsack, und<br />
auf einmal stand sie neben mir, es war<br />
ein kleiner Schock: die Königin! Zwar<br />
wusste ich, dass sie unser Jugend -<br />
zentrum besuchen würde, aber ich<br />
hätte nie damit gerechnet, ihr so nahe<br />
zu kommen. Ich wurde total nervös.<br />
Sie hat mich angesprochen und gefragt,<br />
wie lange ich schon boxe. Ich<br />
habe ihr erzählt, dass ich boxe, seit<br />
ich 16 bin, einfach so, weil es mir Spaß<br />
macht, und dass ich an der Uni in<br />
Manchester Sport studiere. Sie sagte,<br />
dass ich sehr muskulöse Arme hätte.<br />
Ich boxe zweimal die Woche hier im<br />
Jugendzentrum in Harpurhey. Es ist<br />
einer der ärmeren Stadtteile, deswegen<br />
war die Königin da. Um zu sehen,<br />
wie es den Jugendlichen hier geht. Es<br />
dauerte vielleicht eine Minute, dass<br />
sie neben mir stand, aber es war ein<br />
großer Moment. Sie ist noch kleiner,<br />
als ich sie mir vorgestellt hatte, total<br />
süß.“<br />
NIGEL RODDIS / AFP<br />
Egan, Königin Elizabeth II.<br />
Warum wollen Sie Reklame verbieten, Frau Franz?<br />
Die Autorin Sandra Franz, 33, lebt im<br />
Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg<br />
und kämpft dort für ein Verbot<br />
der Außenwerbung. Sie ist Mitglied<br />
der Initiative „Amt für Werbefreiheit<br />
und Gutes Leben“.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Frau Franz, wieso soll Werbung<br />
von den Straßen verschwinden?<br />
Franz: Niemand weiß mehr, wie die<br />
Stadt wirklich aussieht. Die Schönheit<br />
der Gebäude verschwindet. Den Fernseher<br />
oder das Radio kann ich ausschalten,<br />
auf meinem Rechner kann<br />
ich Ad-Blocker installieren. Aber auf<br />
der Straße kann ich der Werbung<br />
nicht entgehen. Künftig<br />
könnten LED-Plakate sich mit<br />
unseren Smartphones verbinden<br />
und daraufhin personalisierte<br />
Werbung schalten. Wir leben<br />
in einer freien Gesellschaft und<br />
sollten selbst entscheiden, ob<br />
wir Werbung begegnen wollen.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Warum fangen Sie in<br />
Friedrichshain-Kreuzberg damit<br />
an?<br />
60<br />
Werbewand in Berlin<br />
Franz: Zum einen natürlich, weil ich<br />
dort lebe. Aber wir halten den Bezirk<br />
insgesamt für sehr mutig – die Menschen,<br />
aber auch die Politik. Seit 2008<br />
ist es hier bereits verboten, auf Bezirksflächen<br />
für Alkohol und Tabak zu<br />
werben. Das reicht uns aber nicht. Wir<br />
wollen, dass Werbung auf Plakaten,<br />
Säulen und Haltestellen verschwindet.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Jede Stadt ist doch auf das<br />
Geld aus der Werbung angewiesen.<br />
Franz: Das stimmt. Es gibt einen Vertrag<br />
zwischen dem Bezirk und der großen<br />
Werbefirma Ströer. Für vier große Werbetafeln<br />
zahlt die Firma 240000 Euro<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3<br />
im Jahr. Damit werden Brunnen und<br />
öffentliche Toiletten finanziert. Wir<br />
versuchen trotzdem, die Stadt zu überzeugen,<br />
dass die Menschen hier<br />
glücklicher wären, wenn sie nicht ständig<br />
vorgeführt bekämen, dass ihrem<br />
Leben etwas fehlt. Wir haben bereits<br />
über tausend Unterschriften gesammelt<br />
– jetzt muss nur noch der Bezirk<br />
für uns entscheiden.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Ist das nicht reine Utopie?<br />
Franz: Wir glauben, dass man die Werbung<br />
zumindest einschränken kann.<br />
In den achtziger Jahren waren wir täglich<br />
650 Werbebotschaften ausgesetzt,<br />
heute sind es 6000. Wir wollen<br />
verhindern, dass das noch<br />
weiter zunimmt. Es gibt bereits<br />
Städte, in denen ein öffent -<br />
liches Leben fast ohne Werbung<br />
gut funktioniert. Beispiels -<br />
weise São Paulo in Brasilien.<br />
Dort hat der Bürgermeister<br />
Werbung auf den Straßen per<br />
Gesetz massiv eingeschränkt.<br />
Ich glaube nicht, dass den<br />
Menschen dort etwas fehlt.<br />
PAUL ZINKEN / PICTURE ALLIANCE / DPA
gesellschaft<br />
Fußnote vom Pornostar<br />
EinE MEldung und ihrE gEsChiChtE: Wie ein serbischer Professor einen Wissenschaftsskandal aufdeckte<br />
Dragan Ðurić, Hochschullehrer für<br />
Software-Engineering an der Universität<br />
Belgrad, ist ein eigenwilliger<br />
Dozent mit eigenwilliger Frisur. Die<br />
Seiten des Kopfes trägt er ausrasiert und<br />
am Hinterkopf einen langen Zopf. Neben<br />
seinem Schreibtisch lehnt eine E-Gitarre<br />
an der Wand.<br />
Es ist ein Dienstag im November,<br />
Ðurić sitzt in seinem Apartment in Belgrad.<br />
Vor zwei Jahren, sagt er, hörte er<br />
das erste Mal von dem Mann, der nun<br />
sein Gegner ist, dem Herausgeber einer<br />
Zeitschrift namens „Metalurgia<br />
International“. Eine Zeitschrift,<br />
so erfuhr Ðurić von Kollegen,<br />
die Wissenschaftlern ungewöhnliche<br />
Chancen gibt. Eine<br />
Zeitschrift, die offenbar jeden<br />
Artikel veröffentlicht, den man<br />
schreibt.<br />
Der Herausgeber, Gheorghe<br />
Lepădatu, ist Professor in Rumänien.<br />
Das Geschäftsmodell,<br />
das er praktiziert, basiert auf<br />
einer Veröffentlichungsgebühr:<br />
Ein Hauptautor zahlt 140 Euro,<br />
Co-Autoren zahlen jeweils 75<br />
Euro. Im Gegenzug wird der<br />
Text zügig veröffentlicht, und<br />
nach Überweisung der Summe<br />
erhält man auf Wunsch ein Zertifikat,<br />
das es möglich macht,<br />
die Publikationsgebühren von<br />
der Verwaltung der eigenen Universität<br />
erstattet zu bekommen.<br />
Man müsse nichts von Me -<br />
tallurgie verstehen, um seine<br />
Aufsätze dort unterzubringen,<br />
so erzählten die Kollegen. An -<br />
gelegt als multidisziplinäres Forum,<br />
biete die Zeitschrift auch Platz für<br />
fachfremde Publikationen.<br />
Ðurić sah sich die Zeitschrift im Internet<br />
an und zählte nach. In den Ausgaben<br />
des Jahres 2011 fand er 9 Texte von serbischen<br />
Kollegen. 2012 waren es schon<br />
rund 168. In diesem Jahr dürften es rund<br />
300 Artikel sein. Als ähnlich populär erwies<br />
sich „Metalurgia International“ bei<br />
chinesischen Wissenschaftlern.<br />
Akademische Karrieren werden in Serbien<br />
wie anderswo vor allem durch die Anzahl<br />
der Veröffentlichungen vorangetrieben.<br />
Ðurić steht noch nicht am Ende seiner<br />
akademischen Laufbahn. Er hat seinen Titel<br />
und seine Stelle auf die altmodische Art<br />
bekommen, durch wissenschaftliche Arbeit.<br />
Er hat kein Interesse daran, dass seine<br />
Arbeit entwertet wird durch Betrüger, die<br />
sich ihre Veröffent lichungen kaufen.<br />
Für Ðurić ähnelte die Zeitschrift einer<br />
Seuche, die immer mehr seiner Kollegen<br />
schwach werden ließ, und er fasste den<br />
Entschluss, „Metalurgia International“ zu<br />
bekämpfen. Nicht mit einer Klage, das<br />
war nicht aussichtsreich und auch nicht<br />
klug, denn er müsste Kollegen an den<br />
Pranger stellen, die dort veröffentlicht<br />
haben. Ðurić beschloss, den Herausgeber<br />
mit dessen eigenen Waffen zu schlagen.<br />
Đurić (l.) mit Co-Autor<br />
Von der Website laborwelt.de<br />
Ðurić setzte sich zu Hause an seinen<br />
Computer, machte ein Bier auf und begann<br />
zu tippen. Zwei Nachmittage spä -<br />
ter war der Text fertig. Ðurić verfasste<br />
ihn auf Englisch, er beginnt mit dem<br />
Satz: „Das verbesserte Verstehen und die<br />
korrekte Anwendung von Simulationsmodellen<br />
für verschiedene Domains, vom<br />
E-Government bis zum E-Learning, sind<br />
ein angemessenes Rätsel.“<br />
Fünf Seiten wird der Text später füllen,<br />
weitgehend sinnfrei, es geht angeblich<br />
um hermeneutische Heuristik, um Würfeln<br />
und die Aussagekraft des Zufalls. So<br />
erklärt es zumindest Ðurić.<br />
In den Fußnoten findet sich ein Werk<br />
von Max Weber, aus dem Jahr 2003. Außerdem<br />
werden dort Michael Jackson,<br />
Slobodan Milošević, der US-Pornostar<br />
Ron Jeremy und ein Autor namens A.S.<br />
Hole als Quellen angeführt. Ein Insiderwitz<br />
findet sich in Fußnote 20. Hier verweist<br />
Ðurić auf Alan Sokal, einen amerikanischen<br />
Physiker, der im Jahr 1996 mit<br />
einem ähnlichen Artikel die mangelnde<br />
Qualitätskontrolle in den Sozial- und<br />
Geisteswissenschaften kritisierte.<br />
Über den Text setzte Ðurić drei Fotos,<br />
sie zeigen ihn und zwei Mitautoren. Ðurić<br />
posiert mit angeklebtem Schnauzer, einer<br />
seiner Kollegen trägt eine Pe -<br />
rücke, die aus den siebziger<br />
Jahren stammen könnte, als der<br />
Afrolook in Mode war.<br />
Am nächsten Abend schickte<br />
Ðurić den Text ab, per E-Mail.<br />
Am Morgen darauf erhielt er,<br />
ebenfalls per E-Mail, die Antwort<br />
des Herausgebers. Der<br />
Text genüge den Qualitätskriterien<br />
der Zeitschrift und werde<br />
veröffentlicht, sobald 290 Euro<br />
überwiesen worden seien.<br />
Der Text fand seinen Platz in<br />
der Ausgabe 6/2013, zusammen<br />
UWE BUSE / <strong>DER</strong> <strong>SPIEGEL</strong><br />
mit 69 weiteren Artikeln, und<br />
seit dem Tag der Veröffent -<br />
lichung ist Ðurićs Leben ein<br />
anderes. Serbische und rumä -<br />
nische Politiker beschäftigen<br />
sich mit dem Skandal. Ðurić ist<br />
berühmt. Und berüchtigt.<br />
Kollegen loben ihn. Und verfluchen<br />
ihn. Manche haben sich<br />
in den vergangenen Wochen erkundigt,<br />
voller Panik, ob ihre<br />
Veröffentlichungen in „Metalurgia<br />
International“ getilgt werden<br />
können, irgendwie. „Da kann ich<br />
natürlich nicht helfen“, sagt Ðurić, „und<br />
will es auch nicht.“<br />
Die Website von „Metalurgia Inter -<br />
national“ existiert jetzt nicht mehr. Auf<br />
alle Fragen, die man an Professor Dok -<br />
tor Gheorghe Lepădatu in Rumänien<br />
richtet, nach seiner Publikationspraxis<br />
oder nach der Zukunft seines Geschäftsmodells,<br />
erhält man immer nur ein und<br />
dieselbe Antwort, per E-Mail. Die Ver -<br />
öffentlichung des Textes sei ein Fehler<br />
gewesen, aber nicht sein Fehler. Der<br />
Text sei von Unbekannten in die Datenbank<br />
geschmuggelt worden. Ob er weiter -<br />
publizieren will, schreibt der Professor<br />
nicht.<br />
Uwe Buse<br />
d e r s p i e g e l 4 8 / 2 0 1 3 61
P R O T E S T E<br />
Die Waldverbesserer<br />
Und wieder trifft im Südwesten Deutschlands ein gutgemeintes Staatsprojekt<br />
auf sturen Widerstand von Bürgern. Diesmal ist es der grün-rote<br />
Regierungsplan eines Nationalparks im Nordschwarzwald. Von Alexander Smoltczyk
Gesellschaft<br />
FOTOS: MARIA IRL / <strong>DER</strong> <strong>SPIEGEL</strong><br />
Eng und düster ragen die Fichten<br />
drüben, jenseits des Wiesengrunds,<br />
frühe Nebelfetzen in den Wipfeln,<br />
heimatverheißend – Andreas Fischer<br />
schaut nicht hin.<br />
Er weiß, wie sein Wald sich anfühlt. Wie<br />
er jeden Morgen etwas anders riecht und<br />
rauscht. Tut dem Wald kein Leid, er ist<br />
der Heimat liebstes Kleid, genau so ist es,<br />
und deswegen hat sich Andreas Fischer<br />
vier Flachbildschirme neben die Aussicht<br />
gestellt. Breit nebeneinander im leichten<br />
Rund, wie ein zweiter Horizont. Hier oben<br />
ist sein Büro, seine Schaltzentrale. Sein<br />
„War Room“. Denn Andreas Fischer, IT-<br />
Berater aus Hundsbach, Gemarkung Forbach<br />
im Tal der Murg, führt einen Kampf.<br />
Seit anderthalb Jahren, und notfalls auch<br />
noch länger. Er hat Zeit. Wie der Wald.<br />
Und um dessen Zukunft geht es.<br />
Jenseits des Hundsbacher Fichtenwalds,<br />
in Mitteltal, Gemeinde Baiersbronn,<br />
wohnt Alexander Bonde. Ein<br />
Nachbar von Andreas Fischer. Eigentlich.<br />
Aber Alexander Bonde ist inzwischen<br />
Minister im fernen Stuttgart. Auch er hat<br />
seinen Sitz auf einem Hügel, sein Büro<br />
mit schöner Aussicht. Bonde schaut hin -<br />
unter zum Hauptbahnhof, genau auf die<br />
Baustelle von Stuttgart 21. Auf jenes Projekt,<br />
dem der grüne „Minister für Länd -<br />
lichen Raum und Verbraucherschutz“<br />
nicht zuletzt diesen Schreibtisch verdankt.<br />
Bonde ist ein rundlicher Zeitgenosse,<br />
der sich eine Kuckucksuhr – in minimalistischem<br />
Design – ins Büro gehängt hat,<br />
gewöhnlich Winzerfeste besucht und gern<br />
eine Lodenjacke trägt.<br />
Für Andreas Fischer ist dieser Mann<br />
im Loden in Wahrheit ein ideologie -<br />
getriebener Öko-Diktator. Umgekehrt, so<br />
der Minister, handle es sich bei Fischer<br />
um einen gefährlichen Demagogen mit<br />
trübem Hintergrund. Gemeinsam ist beiden<br />
Herren eine gewisse Liebe zum Wald.<br />
Genauer: zum Schwarzwald. Jenem<br />
wilden Südwesten Deutschlands, durch<br />
den keine Autobahn führt, sondern meist<br />
enge, in das Nadeldickicht gekerbte Straßen,<br />
die unter Holztransportern beben.<br />
Granit und Buntsandstein, Höllental und<br />
Wutachschlucht, ein Landstrich, der an<br />
Klischees so reich ist wie an Mythen.<br />
Am 23. Oktober stand Minister Bonde<br />
vor dem Landtag von Baden-Württemberg.<br />
Zur ersten Lesung aufgerufen war der<br />
Gesetzentwurf für die Einrichtung eines<br />
Nationalparks Schwarzwald. Insgesamt<br />
10000 Hektar, das sind zehn mal zehn Kilo -<br />
meter, 0,7 Prozent des Landesforstes, sollen<br />
zurück an die Natur gegeben werden.<br />
Bonde redete über den Dreizehenspecht,<br />
den Gartenrotschwanz und den<br />
Tannenstachelbart-Pilz. Man spürte, er<br />
war nervöser als sonst. Er sprach über<br />
Bürgerbeteiligung und Pufferstreifen<br />
gegen Käferschwarm, zum Schutz der<br />
angrenzenden Privatforste. Er erwähnte<br />
auch Leute wie Andreas Fischer, Skep -<br />
tiker und Parkgegner in den Anrainergemeinden.<br />
Zum Schluss hob er die Stimme:<br />
„Es geht um ihn“, rief er in den Landtag<br />
und zog dabei ein Schwarzweißfoto hervor.<br />
Man sah zwei aufgerissene, erschrockene<br />
Augen, dazwischen einen Schnabel –<br />
„Es geht um ihn, den Sperlingskauz.“<br />
Ganz gewiss geht es nicht um eine<br />
Atommülldeponie. Oder um Braunkohle -<br />
tagebau an der Hornisgrinde. Dennoch<br />
hat das Projekt eines Nationalparks im<br />
Nordschwarzwald, nahezu unbeachtet<br />
vom Rest der Republik, zu einem Kulturkampf<br />
geführt. Zu Protesten und Widerstand<br />
gegen ein Naturschutzgroßprojekt,<br />
das von manchen in den Tälern zwischen<br />
Oberkirch und Baiersbronn als grüne Bevormundung<br />
empfunden wird.<br />
Urwald oder Nutzwald? Wenn es so<br />
einfach wäre. Und weil es stets um mehr<br />
als Bäume geht, wenn der Deutsche vom<br />
Wald redet, ist der Protest keineswegs<br />
idyllisch, sondern durchaus finster und<br />
manchmal eng.<br />
Da werden einem Parkbefürworter die<br />
Autoreifen zerstochen. Da grüßt man sich<br />
Transparent im Nordschwarzwald<br />
„Judas! Drecksau!“<br />
nicht mehr im Verein. Da wird übel nachgeredet,<br />
gedroht, gemobbt. Der Riss geht<br />
oft durch die Familien. An den Ortseinfahrten<br />
stehen Transparente, das Wort<br />
„Nationalpark“ unter rotem Verbotsbalken,<br />
genau wie die Plakate damals gegen<br />
Stuttgart 21. Nur in Grün.<br />
Als Ministerpräsident Winfried Kretschmann<br />
das Projekt in Bad Wildbad erklären<br />
wollte, sangen die Leute aus Protest:<br />
„Oh Schwarzwald, meine Heimat“, und<br />
einer brüllte: „Judas! Drecksau!“<br />
Aus Scham über seine Bürger trat ein<br />
Gemeinderat zurück. Woher nur diese<br />
Wut? Ein Revierförster aus Alpirsbach<br />
hat sogar einen Krimi geschrieben,<br />
„Mordschwarzwald“. Darin wird geschildert,<br />
wie einem Politiker eine tote Katze<br />
an die Haustür gehängt wird, bevor er<br />
selbst, gekidnappt und in einen Sack gesteckt,<br />
am Mammutbaum gehisst wird.<br />
Der Politiker ist Grüner und kommt aus<br />
Baiersbronn.<br />
Ja, der Bonde … Ob der wohl weiter<br />
hier seinen Lebensmittelpunkt haben<br />
will? Das fragt sich Andreas Fischer, oben<br />
in Hundsbach am Fichtenwald, in seinem<br />
mit Bildschirmen, Whiteboards und Jagdtrophäen<br />
vollgestellten Hauptquartier.<br />
Was er noch sagt, möchte er nicht gedruckt<br />
sehen.<br />
Andreas Fischer ist der Stratege des<br />
Widerstands gegen den Nationalpark.<br />
Sein Verein „Unser Nordschwarzwald“<br />
fürchtet, dass der Wald bald wie ein<br />
Friedhof aussehen könnte, gespickt mit<br />
grauen Fichtenleichen, weil der Borkenkäfer<br />
letztlich als Einziger von der neuen<br />
Wildnis profitieren würde.<br />
Fischer liebt sein Stück Wald und die<br />
Jagd. Aber vor allem liebt er es, der Regierung<br />
im fernen Stuttgart aufzulauern.<br />
Er hat es geschafft, eine weitverbreitete<br />
Skepsis politikfähig zu machen. Die Idee<br />
mit den Transparenten kam von ihm.<br />
Und er lud den früheren ZDF-Mann<br />
Alex ander Niemetz ein, um vom „Tugendterror“<br />
und der „grünen Bevormundungsdiktatur“<br />
zu reden. Das kam an.<br />
Denn darum ging es doch, oder?<br />
Fischer sammelt neben Jagdbüsten<br />
auch Memorabilia aus der Frühzeit des<br />
Computers. Er ist kein Schrat, und er ist<br />
leicht zu unterschätzen, weil seine Waffen<br />
Worte sind. Aber sie sind scharf: „Aus<br />
uns Laborratten machen“, „Öko-Kolonialismus“,<br />
„Ihr Käferlein kommet“. All die<br />
Parolen, die später von Waldbauern auf<br />
Traktoren herumgefahren wurden. Genau<br />
die Worte, von denen er wusste, dass sie<br />
den neuen, bürgerbewegten Herren in<br />
Stuttgart in der Seele weh tun würden<br />
und ganz besonders ihrem Minister, dem<br />
Herrn Bonde.<br />
„Dass es nicht mit Hurra durchläuft,<br />
hatten wir erwartet“, sagt, in Stuttgart,<br />
der Minister Alexander Bonde. Aber was<br />
da aus der Tiefe des ländlichen Raums<br />
kam, hat ihn doch überrascht.<br />
Künftige Nationalparks haben es an<br />
sich, eher abseits der urbanen Gebiete zu<br />
liegen. Sie werden dort geplant, wo neben<br />
dem Dreizehenspecht auch andere<br />
Modernisierungsverlierer nisten, wie in<br />
den schwärzesten Winkeln des Schwarzwalds.<br />
Plötzlich erinnerte man sich wieder,<br />
wie in Baiersbronn einmal ein geplantes<br />
Asylbewerberheim abbrannte.<br />
Die Täter wurden nie gefunden. Wenn<br />
der Wald die Seele der Deutschen ist,<br />
dann ist der nördliche Schwarzwald<br />
gewiss nicht deren aufgeklärteste Seite.<br />
Dass in Stuttgart plötzlich die Grünen<br />
herrschen, wird hier als widernatürlich<br />
empfunden. Da gibt es noch eine „Murgschifferschaft“<br />
der Waldbesitzer, ein<br />
Relikt aus der Holzflößerzeit, verfasst<br />
nach altdeutschem Recht. Aber sie ist<br />
sehr lebendig – und Andreas Fischer sitzt<br />
im Verwaltungsrat.<br />
Als Alexander Bonde sein Minister -<br />
büro erstmals betrat, im März 2011, fand<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3 63
er den „Suchraum“ für einen Nationalpark<br />
bereits vor: zwei Flächen von ins -<br />
gesamt 10000 Hektar. Das Projekt war<br />
schon in den Neunzigern von dem damaligen<br />
CDU-Minister betrieben, dann unter<br />
dem Druck der Murgschiffer, Großsäger,<br />
Waldbesitzer vertagt worden.<br />
Inzwischen hat die Bundesregierung beschlossen,<br />
dass fünf Prozent der deutschen<br />
Waldfläche ausgewildert werden sollen.<br />
Deutschland habe die Uno-Konvention<br />
zur Biodiversität unterschrieben, sagt<br />
Bonde, und: „Wir als reiche Exportnation<br />
können nicht von Brasilien verlangen,<br />
25 Prozent seines Regenwalds in Ruhe zu<br />
lassen, und selbst nicht mal 0,7 Prozent<br />
unseres Staatswalds der Artenvielfalt widmen.<br />
Wir stehen unter Beobachtung.“<br />
Ganz zu schweigen von den<br />
Erwartungen der Naturschutzlobby,<br />
von Nabu bis Greenpeace.<br />
Das waren die eigenen<br />
Leute. Die Regierung Kretschmann<br />
hat den Nationalpark im<br />
Koalitionsvertrag stehen. Sie<br />
wollte ihn. Aber keinesfalls<br />
durfte ein Geschmäckle von<br />
Arroganz der Macht aufkommen.<br />
Denn so war der CDU-<br />
Staat von Filbinger, Späth,<br />
Teufel und Mappus zusammengestürzt,<br />
unter Pfiffen der<br />
Bürger und Schmähplakaten.<br />
Die grün-rote Landesre -<br />
gierung versprach den Dialog.<br />
Im Sinne seines Vorbilds, der<br />
Philosophin Hannah Arendt,<br />
gab Kretschmann als Maxime<br />
aus: „Die Bürger werden gehört,<br />
aber nicht erhört.“<br />
Wohl selten zuvor in der<br />
Bundesrepublik wurde ein<br />
relativ einsichtiges Gesetzesvorhaben<br />
mit so viel Pedan -<br />
terie vorbereitet. Aber schließlich<br />
ging es um den Wald. Und<br />
nichts treibt den Deutschen so<br />
schnell auf die Barrikaden wie<br />
die Sorge um Bäume.<br />
Minister Bonde engagierte<br />
von der Uni Stuttgart einen<br />
Professor für Dialogik, um die Bürgerbeteiligung<br />
nach wissenschaftlichen Methoden<br />
zu organisieren. Mit einem „Cluster<br />
Forst und Holz“ und dem „Regionalen Arbeitskreis<br />
Auerhuhn“. Mit Risikoanalysen<br />
und Handlungskorridoren, mit vier Modulen,<br />
in denen die Gemeinden, Verbände,<br />
Förster, Naturschützer und Hoteliers saßen.<br />
Die Ergebnisse wurden gebündelt, zurückgespiegelt,<br />
abgeglichen, aufgenommen.<br />
Der Bürger bekam Broschüren, Kritikformulare,<br />
ein Forum im Internet zur<br />
Verfügung gestellt. Die „Arbeitsgruppe<br />
Raufußhühner“ wurde ebenso gehört wie<br />
der Spitzenkoch vom Schwarzwaldhof<br />
und der Kleinsäger aus Hinterseebach.<br />
Das abschließende Gesamtgutachten<br />
von PricewaterhouseCoopers hat 1200<br />
64<br />
Gesellschaft<br />
Seiten und kommt zu dem erwarteten Ergebnis:<br />
„Soll in Baden-Württemberg großflächiger<br />
und ungestörter Prozessschutz<br />
ermöglicht werden, gibt es keine naturschutzfachlichen<br />
Alternativen.“<br />
Doch als Ministerpräsident Kretschmann<br />
mit seinem Minister Bonde nach<br />
Bad Wildbad kam, um den Bürgern das<br />
Ergebnis ihrer Beteiligung zu erläutern –<br />
live ins Netz übertragen –, da sahen sie<br />
schon von weitem diese Sätze: „Demokratie<br />
im Klammergriff“, „Ihr Käferlein<br />
kommet“, „Kein Naturghetto für Wochenend-Ökos“.<br />
Den Ton kannten sie. An -<br />
dreas Fischer und sein Verein waren offensichtlich<br />
nicht überzeugt.<br />
„Wir haben wirklich alles gemacht“,<br />
sagt Bonde. „Alle Argumente sind auf<br />
Nationalpark-Kontrahenten*: Arbeitsgruppe Raufußhühner<br />
den Tisch gekommen. Aber es gibt kein<br />
kommunales Veto. Der Wald gehört allen<br />
Baden-Württembergern. Außerdem …“,<br />
und da wird er von seiner Kuckucksuhr<br />
unterbrochen, „noch jeder Wald-Nationalpark<br />
war anfangs heftig umstritten.<br />
Dafür geht es uns noch ziemlich gut.“<br />
In sieben umliegenden Gemeinden haben<br />
sich die Bürger mehrheitlich gegen<br />
das Projekt ausgesprochen.<br />
In Baiersbronn waren es 78 Prozent.<br />
Doch vier der sieben direkt vom Park betroffenen<br />
Gemeinderäte haben dafürgestimmt,<br />
ebenso drei Stadt- und Landkreise,<br />
egal von welcher Partei sie geleitet<br />
* Parkbefürworterin Friederike Schneider, Minister Alex -<br />
ander Bonde, Parkgegner Wolfgang Tzschupke.<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3<br />
werden. Eine Forsa-Umfrage vom August<br />
gibt an, dass gut zwei Drittel der Befragten<br />
in Region und Land nichts gegen den<br />
Nationalpark haben.<br />
Aber Demokratie ist nicht nur Mathematik.<br />
Im Gemeinderat von Freudenstadt<br />
führt Wolfgang Tzschupke die Fraktion<br />
der Freien Wähler. Er ist Forstprofessor<br />
im Ruhestand, ein Herr mit sorgfältig<br />
gestutztem Moustache, und er ist zutiefst<br />
gegen den Nationalpark: „Es bringt dem<br />
Naturschutz nichts und der Regionalwirtschaft<br />
auch nichts.“<br />
Vor ihm liegt das Gutachten, markiert<br />
mit gelben Post-it-Zeichen. Er sei „mehr<br />
der Planungstyp“, sagt Tzschupke, der<br />
Parkgegner. Trotzdem, oder gerade deswegen,<br />
ist ihm die Selbstgewissheit der<br />
Planer in Stuttgart suspekt:<br />
„Wer weiß, ob wirklich so viele<br />
Besucher noch kommen, wenn<br />
erst mal der Borkenkäfer massenhaft<br />
die Bäume tötet.“<br />
Alle reden immer von 0,7<br />
Prozent. Aber für die Gemeinde<br />
Baiersbronn ist das ein<br />
Drittel ihrer Waldfläche. Da<br />
fühlen sich die Leute klein -<br />
geredet. Und fürchten noch<br />
mehr Behörden, noch mehr<br />
Auflagen und Verbote.<br />
Nein, es gehe nicht um<br />
Gefühle. Es gehe um das, was<br />
Tzschupke „Sachargumente“<br />
nennt. Er redet von Käferschwarm,<br />
Schalenwildbestand<br />
und fichtendominierten Jungwüchsen.<br />
„Ist es klug, Wald<br />
aus der Nutzung zu nehmen,<br />
wenn wir nachwachsende Ressourcen<br />
brauchen? Artenvielfalt<br />
gibt es auch bei naturnah<br />
bewirtschafteten Wäldern.“ Es<br />
ist dem Forstwissenschaftler<br />
a. D. fast physisch unangenehm,<br />
wenn 10 000 Hektar<br />
Wald einfach so her umliegen.<br />
Wer ihm zuhört, denkt an den<br />
Satz von Robert Musil: „Ein<br />
deutscher Wald macht so etwas<br />
nicht.“<br />
Das Gesetz soll in dieser Woche verabschiedet<br />
werden und wird voraussichtlich<br />
zu Jahresbeginn in Kraft treten. Es<br />
gibt eine Übergangsfrist von 30 Jahren,<br />
damit die Holzwirtschaft sich umstellen<br />
kann. Die 27000 Festmeter Einbuße im<br />
Jahr sind nur ein Bruchteil des Einschlags<br />
von 8,5 Millionen in Baden-Württemberg.<br />
Für Tzschupke eine typisch grüne<br />
Rechnung, wie sie nur Amateuren einfällt,<br />
falschen Freunden des Waldes: „Die<br />
Holzqualität, die wir im geplanten Nationalpark<br />
haben, die kann man nicht einfach<br />
anderswoher schaffen. Die kleinen<br />
Sägen brauchen diesen Rohstoff.“<br />
Heuchelei sei dieser ganze Bürgerdialog,<br />
die Zugeständnisse ein Ablasshandel,<br />
um den Dogmatismus zu verbergen: „Es
Schwarzwald-Aussichtsplattform am Kniebis: Märchenkulisse mit Borkenkäfer<br />
FOTOS: MARIA IRL / <strong>DER</strong> <strong>SPIEGEL</strong><br />
war von vornherein alles entschieden.<br />
Das ist meine frustrierende Erfahrung“,<br />
sagt Tzschupke, und mit einem Mal passen<br />
Ton und Bild nicht mehr zusammen,<br />
dem älteren Herrn entfährt der Satz: „Solange<br />
etwas gesittet abläuft, hat man keine<br />
großen Chancen. Bei Stuttgart 21 gab’s<br />
den Runden Tisch erst nach der Eskala -<br />
tion.“ Es gibt ihn selbst in Baiersbronn,<br />
den diskreten Reiz des schwarzen Blocks.<br />
Nun ist der Nordschwarzwald, bei aller<br />
Wild- und Finsternis, kein Grand Canyon<br />
und kein Yosemite-Park, sondern eine<br />
Kulturlandschaft, seit über 500 Jahren<br />
beweidet, abgeholzt, aufgeforstet, von<br />
Silberstollen durchzogen, die Bäche mit<br />
Wehren und Becken nutzbar gemacht<br />
zum Flößen, Sägen, Fliegenfischen.<br />
Wo ursprünglich Weißtannen und Buchen<br />
standen, steht jetzt zu 70 Prozent<br />
Fichtenwald. Einen Originalzustand wiederherzustellen,<br />
ohne künstlich nachzuhelfen,<br />
würde Jahrhunderte dauern. Und<br />
wer hat schon so viel Zeit?<br />
Wolfgang Schlund. Der Wald- und Wiesenbiologe<br />
ist Leiter des Naturschutzzentrums<br />
auf dem Ruhestein, oberhalb von<br />
Baiersbronn. Einer der leidenschaftlichen<br />
Betreiber des Projekts, mit guten Aussichten,<br />
Leiter des Nationalparks zu werden.<br />
Schlund zwängt sich, offenkundig unbeeindruckt<br />
vom Regen, der in Schnüren<br />
fällt, durch das, was am ehesten einen<br />
Vorgeschmack auf „Prozessschutz“ und<br />
„Biodiversität“ gibt – den „Bannwald“<br />
um den Wilden See, an der Hornisgrinde.<br />
Vor gut hundert Jahren hat ihn die Königlich-Württembergische<br />
Forstdirektion<br />
zum Totalreservat erklärt. „Wo die Bäume<br />
noch wachsen dürfen, wie die Natur<br />
sie zwingt, aufrecht bis ins höchste Alter,<br />
dann zusammengebrochen, langsam sich<br />
auflösend, neuen Boden schaffend für ein<br />
neues Geschlecht.“ So sah es Forstmeister<br />
Otto Feucht 1922.<br />
Es ist eine Märchenkulisse draus geworden.<br />
Meterweit geht es glitschig über knotige<br />
Flachwurzeln und hartes Sandsteingeklippe,<br />
alles trieft und braust und plätschert,<br />
und doch rauscht in den Ohren nur das eigene<br />
Blut, so still und verlassen ist es hier.<br />
Einzelne Urstämme, deren Kronen sich im<br />
FRANKREICH<br />
Oberkirch<br />
Straßburg<br />
A5<br />
Karlsruhe<br />
geplanter Bad<br />
Nationalpark Wildbad<br />
Forbach<br />
Wilder See<br />
milchigen Dunst auflösen, Heidelbeerkraut,<br />
Flechten, welker Farn. Schlund erzählt vom<br />
Krummzähnigen Tannenborkenkäfer, von<br />
den 260 Arten, die in so einem Totholz-<br />
Strunk leben. Wolfgang Schlund denkt<br />
nicht in Fristen von 10 oder 20 Jahren. Er<br />
will, dass die Menschen auch im Jahr 2513<br />
noch wilden Wald erleben können.<br />
„Unsere Wälder“, sagt er, „sind allgemein<br />
zu jung. Wir brauchen ein Mosaik<br />
unterschiedlichster Stadien, von frischem<br />
Grün bis Totholz. Dazu reichen keine<br />
kleinen, weitverteilten Schutzgebiete.<br />
Wir brauchen die große Fläche.“ Und nur<br />
im nördlichen Schwarzwald gibt es noch<br />
genügend unzersiedelten Staatswald, um<br />
einen Nationalpark überhaupt möglich<br />
zu machen. Eine einmalige Chance.<br />
Die Projektgegner sagen, ein „Biosphärenreservat“<br />
oder ein „Naturpark“ hätte<br />
es auch getan. Da sind die Schutzvorschriften<br />
nicht ganz so streng, Tourismus<br />
und Forstwirtschaft könnten weitermachen<br />
wie bisher. Aber darum gehe es ja,<br />
sagt Schlund: nicht so weiterzumachen<br />
wie bisher. Ein Naturpark soll eine Kulturlandschaft<br />
schützen. Ein Nationalpark<br />
dagegen will einen möglichst ungestörten<br />
Ablauf der Naturvorgänge. Aber im<br />
Grunde will er gar nichts wollen, sondern<br />
Natur Natur sein lassen.<br />
Die Fläche gehört sowieso dem Land,<br />
niemand wird enteignet. „Die Leute kön-<br />
Hundsbach<br />
Baiersbronn<br />
Mitteltal<br />
A8<br />
A81<br />
Stuttgart<br />
20 km<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3 65
Gesellschaft<br />
nen weiterhin ihre Pilze sammeln und im<br />
Winter mit Schneeschuhen wandern“,<br />
sagt Schlund. Er hat das in über 160 Veranstaltungen<br />
den Bürgern erklärt, wieder<br />
und wieder. Woher dann diese Angst?<br />
„Ich kann verstehen, dass es manchem<br />
in der Seele weh tut, wenn so ein Stamm<br />
verrottet. Den will er holen.“<br />
Schlund versteht das Unwohlsein<br />
von manchem, wenn es „Wildtiermanage -<br />
ment“ heißt und nicht mehr „Jagd“. Es<br />
gibt ein Misstrauen gegenüber den<br />
studierten „Käferzählern“ aus Stuttgart.<br />
Da ist eine Widerborstigkeit gegenüber<br />
Eingriffen im Allgemeinen und einem<br />
gefühlten neuen Filz im Besonderen,<br />
aus Naturschutzverbänden, Grünen,<br />
Öko wissenschaftlern, Medien, der mächtiger<br />
und dichter zu werden<br />
scheint.<br />
„Wir haben vielleicht den<br />
Fehler gemacht, nicht deutlich<br />
genug zu sagen, dass es nicht<br />
um das Ob, sondern um das<br />
Wie geht. Über das Ob wird<br />
im Landtag entschieden. Wer<br />
in der Region mitmachen will,<br />
ist herzlich eingeladen.“<br />
Schlund zeigt auf einen grau<br />
aufragenden, astlosen Schaft,<br />
ein vom Käfer hingerafftes<br />
Fichtenskelett. „Aber wer hier<br />
lebt, der fragt nicht, ob ihm<br />
ein Waldbild gefällt oder nicht.<br />
Der will den Winter überstehen.<br />
Der lebt davon.“<br />
Es ist die Assel, von der<br />
Schlund spricht. Zum Beispiel.<br />
Er meint die Käfer, die Würmer<br />
und Pilzarten, die ganz<br />
andere Auffassungen von erfülltem<br />
Leben im Wald haben<br />
als Jäger und Waldbauern und<br />
die Holzwirte der Murgschifferschaft.<br />
Es ist kaum ein größerer<br />
Unterschied zu Wolfgang<br />
Tzschupke denkbar. Tzschupke gehört zur<br />
alten Schule der Forstwissenschaft. Für<br />
ihn ist der Borkenkäfer auch nach noch<br />
so viel Bürgerbeteiligung kein „Transformationsagent“<br />
wie für Schlund, sondern<br />
ein Schädling, der alles niederfrisst, wenn<br />
ihm nicht Einhalt geboten wird. Das sind<br />
zwei Konzepte, von Wald und von Welt.<br />
Mitten durch den künftigen Park geht<br />
eine alte Grenze, man findet die Mar -<br />
kierungssteine noch, zugewuchert im<br />
Bannwald. Es ist die Grenze zwischen<br />
Baden und Württemberg. Eine kulturelle<br />
Wasserscheide. Westlich liegt Baden, mit<br />
Tälern, die offen in die Rheinebene auslaufen.<br />
Das Gebiet östlich, mit seinen<br />
schluchtenartigen Tälern, ist „Pietcong“-<br />
Terrain, im Zuständigkeitsbereich der<br />
württembergischen Landeskirche. Für<br />
die Evangelikalen ist ein Nationalpark<br />
schon aus Prinzip Sünde: „Den Nordschwarzwald<br />
dem freien Spiel der Kräfte<br />
66<br />
zu überlassen entspricht nicht dem biblischen<br />
Auftrag des Bebauens und Bewahrens<br />
der Schöpfung.“ So erklärte die<br />
Landtagsabgeordnete Sabine Kurtz, Vorsitzende<br />
des Evangelischen Arbeitskreises<br />
der Landes-CDU und Gattin eines<br />
Forstdirektors.<br />
Wo fängt Natur an, wie viel Eingriff<br />
verträgt sie, und welche Natur sucht die<br />
Klientel? All diese Fragen. In den Rathäusern<br />
wird gegrübelt, im Grenzbereich<br />
von Philosophie und Fremdenverkehr.<br />
Der Park wird kommen. Am Montag<br />
vergangener Woche hat Andreas Fischer,<br />
der Kopf des Widerstands, in Stuttgart<br />
mit der CDU-Opposition zusammen einen<br />
„Bürgernationalpark“ präsentiert.<br />
Eine Light-Version, sehr viel kleiner und,<br />
Schwarzwaldbewohner*: „Ihr Käferlein kommet“<br />
vor allem: unbeschränkt jagd- und abholzbar.<br />
Aber das ist politisches Totholz.<br />
„D’r Käs’ isch gesse“, sagt ein Bürgermeister,<br />
der eigentlich gegen den Park<br />
war. Selbst Projektgegner gestehen ein,<br />
dass erstmals wieder über die Zukunft<br />
des Nordschwarzwalds nachgedacht worden<br />
ist. Denn der ist keine blühende<br />
Landschaft. Die Sägemühlen stehen im<br />
Preiskampf mit internationalen Holzkonzernen.<br />
Viele Sägereien haben bereits<br />
geschlossen, die übrigen müssen sich ihr<br />
Ökotop noch suchen.<br />
Überall gehen die Übernachtungszahlen<br />
zurück. Der Schwarzwaldmädel-Tourismus,<br />
mit seinen „Haus Petra Garni“<br />
und altdeutsch beschrifteten Hotels, läuft<br />
nicht mehr. Das Gutachten rechnet mit<br />
drei Millionen Besuchern jährlich, die der<br />
* Dreizehenspecht, Tannenstachelbart-Pilz, Borken -<br />
käfer, Gartenrotschwanz.<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3<br />
Nationalpark anlocken könnte. Das ist<br />
optimistisch („methodisch falsche Berechnungen“,<br />
sagt Wolfgang Tzschupke).<br />
Dennoch gibt es wohl kaum eine Alternative,<br />
dieser Region einen Impuls zu<br />
verpassen. Ausgerechnet in Forbach, der<br />
Gemeinde des Parkkritikers Andreas Fischer,<br />
hat ein Investor entschieden, ein<br />
Naturparkhotel zu bauen, mit Baumhäusern,<br />
Erlebnispädagogik, Wipfelpfad. Er<br />
habe nur die erste Lesung, die Rede des<br />
Ministers, abgewartet.<br />
Oben auf dem Ruhestein läuft ein Holzweg<br />
dicht am Abhang, links fällt es steil<br />
ab, schmal zwischen den Fichten sieht<br />
man unter sich die Schwarzwaldhoch -<br />
straße. Nach vorn ist alles frei, das Grundgebirge<br />
bricht ab, der Horizont weitet sich<br />
über die Rheinebene bis zu den<br />
Vogesen. „In den Leuten steckt<br />
eine alte Angst, ihren Wald<br />
weggenommen zu bekommen.<br />
Von Fremden und studierten<br />
Städtern“, sagt Friederike<br />
Schneider. „Das ist in den Köpfen.<br />
Da kommt man nicht ran.“<br />
Ihre Familie lebt seit Generationen<br />
in der Gegend. Als<br />
sie klein war, wollte Friederike<br />
Schneider den Wald retten,<br />
weil damals alle vom Wald -<br />
sterben redeten. Jetzt studiert<br />
die 23-Jährige Forstwirtschaft,<br />
jobbt ehrenamtlich als Rangerin<br />
im Bannwald und hat sich<br />
auf einer Bürgerliste in den<br />
Gemeinderat von Baiersbronn<br />
wählen lassen. Manchmal, sagt<br />
sie, sei dieses gegenseitige<br />
Angiften in der Versammlung<br />
schwer zu ertragen gewesen:<br />
„Vielleicht liegt’s wirklich an<br />
den engen Tälern.“ Jetzt spüre<br />
sie nur noch eine Müdigkeit.<br />
Man spricht möglichst nicht<br />
mehr drüber. Weil es allen zu<br />
nah geht.<br />
In der Nacht hat es zum ersten Mal<br />
geschneit. „Ich liebe den Bannwald. Ich<br />
bin so dankbar, dass jemand vor hundert<br />
Jahren beschlossen hat, dieses Stück<br />
Wald in Ruhe zu lassen.“<br />
Die Sonne steht knapp unter den Wolken<br />
und beleuchtet die Rheinebene, es<br />
geht steil hinab, vorn das Grünschwarz<br />
des Waldes, darin wie angeknipst die letzten<br />
gelbroten Buchen, ganz hinten das<br />
Elsass. Man sieht das Straßburger Münster.<br />
Es ist schon verdammt schön. „Und<br />
dann denke ich“, sagt Schneider, „wie sie<br />
es uns danken werden, die Menschen in<br />
dreihundert Jahren.“<br />
Und um die, der Sperlingskauz möge<br />
verzeihen, geht es wirklich, zu guter Letzt.<br />
HARTL/OKAPIA (L.O.); MAURITIUS IMAGES (R.O.); MATTHIAS HIEKEL / DPA (L.U.); ARCO / IMAGO (R.U.)<br />
Video: Streit<br />
im Schwarzwald<br />
spiegel.de/app<strong>48</strong>2013schwarzwald<br />
oder in der App <strong>DER</strong> <strong>SPIEGEL</strong>
THILO ROTHACKER FÜR DEN <strong>SPIEGEL</strong><br />
DE70200000000<br />
020001585<br />
HOMESTORY Warum ich mir nicht alles merken will,<br />
schon gar nicht eine 22-stellige Kontonummer<br />
In meinem Langzeitgedächtnis lagert jede Menge Kram, von<br />
dem ich nicht weiß, wie er dorthin gekommen ist: Die Hauptstadt<br />
von Französisch-Guayana heißt Cayenne, zum Beispiel.<br />
Ulmenholz wird auch „Rüster“ genannt. Pete Best war<br />
der erste Drummer der Beatles. Die millersche Zahl ist die Sieben,<br />
plus/minus zwei.<br />
Wissenschaftler sagen, dass man sich Dinge leichter merkt,<br />
wenn sie einen emotional berühren. Aber ich fand Ulmenholz<br />
nie aufregend, ich bin mir gar nicht sicher, wie eine Ulme überhaupt<br />
aussieht. Weshalb solche Fakten sich je festsetzen konnten<br />
oder was ich damit anfangen kann – keine Ahnung.<br />
Die millersche Zahl fiel mir neulich wieder ein, als ich der<br />
Hansestadt Hamburg zehn Euro fürs Falschparken per On -<br />
line-Banking überweisen wollte. Der Psychologe George A.<br />
Miller hat nämlich beschrieben, dass unser Kurzzeitgedächtnis<br />
sich gerade mal sieben Ziffern merken kann – manche Menschen<br />
schaffen neun, manche nur fünf. Das reicht, um eine<br />
Telefonnummer nachzuschlagen und zu wählen. Die Kontonummer<br />
der Bußgeldstelle aber hat 22 Stellen, 13 davon sind<br />
Nullen.<br />
Ich tippte Ziffer für Ziffer ab und stellte mir dabei meine 79-<br />
jährige Mutter vor.<br />
Hamburg hat bereits auf IBAN umgestellt, die neue Kontonummer,<br />
die ab Februar 2014 europaweit eingeführt wird. Auch<br />
meine Kontonummer wird dann 22 Stellen haben. Ich werde<br />
sie mir nicht merken. Fürs Kurzzeitgedächtnis ist sie viel zu<br />
lang, fürs Langzeitgedächtnis fehlt ihr das Emotionale.<br />
Sämtliche Speicherplätze sind im Übrigen auch schon belegt<br />
durch PINs, PUKs und Passwörter. Ich wünschte, ich könnte<br />
Französisch-Guayana löschen und Platz freischaufeln für IBAN.<br />
Die IBAN, International Bank Account Number, ist eine<br />
Idee der Europäischen Union und soll den Zahlungsverkehr in<br />
Europa vereinheitlichen und einfacher machen.<br />
Der Mensch soll maschinenlesbar<br />
sein. Gedacht<br />
war das mal umgekehrt.<br />
Jeder fünfte Deutsche ist älter als 64, viele füllen ihre Überweisungen<br />
von Hand aus. Sie werden sich über die Vereinfachung<br />
nicht freuen. Einfacher wird es in Wahrheit ja auch nur<br />
für die Maschine, die den Überweisungsträger bearbeitet. So<br />
wie der Fahrkartenautomat nicht das Leben der Kunden erleichtert,<br />
sondern das der Bahn. Die Rechenanlagen lagern<br />
hässliche Arbeit einfach aus, der Mensch muss maschinenlesbar<br />
werden. Gedacht war das mal umgekehrt.<br />
Auf IBAN, die Schreckliche, einigte sich die EU im Jahr<br />
2012. Ich habe das damals wohl gelesen, die Nachricht schaffte<br />
es aber nie ins Langzeitgedächtnis. „Aus dieser Nummer kommen<br />
Sie nicht raus“, schreibt nun die Bundesbank auf ihrer<br />
Website. Jetzt also sitze ich da, verheddere mich in den Nullen,<br />
habe meine Mutter im Kopf, wie sie den Klempner bezahlt,<br />
und denke: „Was soll der Scheiß?“<br />
Viele Sparkassen und Banken haben eine Hotline, um genau<br />
diese Frage zu beantworten. Man sollte sie nur etwas höflicher<br />
formulieren. Also, Anruf bei der Bundesbank: „Weshalb muss<br />
ich mir künftig 22 Stellen merken, um noch an mein Konto zu<br />
kommen?“<br />
Antwort: Wenn ich demnächst Geld nach Frankreich oder<br />
Portugal überweise, ist es schon am nächsten Geschäftstag da.<br />
Ein schöner Gedanke.<br />
Aber in Deutschland werden jeden Tag etwa 60 Millionen<br />
Überweisungen und Lastschriften ausgeführt, davon gehen<br />
etwa 300000 ins Ausland. Das heißt: Auf 59,7 Millionen Überweisungen<br />
steht dann eine 22-stellige Nummer, die kein Mensch<br />
braucht. Jeden Tag. „Aber“, sagt der Mann von der Bundesbank,<br />
„die Überweisungen ins Ausland sind damit billiger.“<br />
Bisher haben die Sender-Bank und die Empfänger-Bank ordentlich<br />
Gebühren kassiert. Mit IBAN zahlt der Kunde nur so<br />
viel, wie eine innerdeutsche Überweisung kosten würde. Die<br />
EU schützt mich also vor Abzocke.<br />
Das klingt großartig. Andererseits: Die EU schützt mich mittlerweile<br />
auch vor Abzocke bei den Roaming-Gebühren, wenn<br />
ich im Ausland mit dem Handy telefoniere (was übrigens häufiger<br />
vorkommt, als dass ich Geld nach Lettland schicke). Und<br />
die Roaming-Gebühren konnte die EU begrenzen, ohne dass<br />
ich im Gegenzug eine 22-stellige Telefonnummer kriege. War -<br />
um geht das bei Konten nicht?<br />
Dank George A. Miller weiß ich, dass ich nicht blöd bin,<br />
wenn ich mir meine Kontonummer nicht merke – die millersche<br />
Zahl gilt auch für klügere Köpfe. Neun Ziffern maximal, dann<br />
ist Schluss. Der Ausweg: Ich müsste eine emotionale Bindung<br />
zu meiner Kontonummer aufbauen, dann fällt das Merken ja<br />
leichter. Ich muss IBAN lieben lernen. So werde ich es auch<br />
meiner Mutter erklären. Und dann überweise ich Geld nach<br />
Spanien, Tschechien und Lettland. Weil es so einfach ist.<br />
Europa wird künftig noch einiger, sogar über die EU hinaus.<br />
Auch Norwegen macht mit, außerdem Monaco, Liechtenstein<br />
und die Schweiz. Nur: Wer überweist schon Geld nach Monaco,<br />
Liechtenstein und in die Schweiz? Das bringt man doch im<br />
Kofferraum rüber.<br />
ANSBERT KNEIP<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3 67
Trends<br />
Ramsauer<br />
INFRASTRUKTUR<br />
Sparen an Straße und Schiene<br />
WERNER SCHUERING<br />
Bundesverkehrsminister Peter Ram s -<br />
auer inszeniert sich gern als Hüter<br />
von Straßen, Schienen und Wasser -<br />
wegen. Doch in der entscheidenden<br />
Phase der Koalitionsverhandlungen<br />
entpuppte er sich als Bremser. Ursprünglich<br />
war sich die Arbeitsgruppe<br />
Verkehr aus Vertretern von Union<br />
und SPD einig, für die neue Legis la -<br />
tur periode zusätzlich elf Milliarden<br />
Euro für den Erhalt der Infrastruktur<br />
zu fordern. Selbst dieser Betrag ist eigentlich<br />
zu niedrig, da der Bund pro<br />
Jahr mindestens vier Milliarden Euro<br />
zusätzlich ausgeben müsste, um das<br />
System halbwegs in Schuss zu halten.<br />
Bis 2017 wären das 16 Milliarden Euro.<br />
Doch beim abschließenden Treffen<br />
in der vergangenen Woche weigerte<br />
sich Ramsauer nach Angaben von<br />
Teilnehmern sogar, den bescheidenen<br />
Betrag von elf zusätzlichen Milliarden<br />
schriftlich zu fixieren. Man könne<br />
nicht so unrealistische Forderungen<br />
stellen, soll der CSU-Mann argumentiert<br />
haben. Im Endbericht der Arbeitsgruppe<br />
steht nun nur noch der<br />
wachsweiche Satz: „Deshalb werden<br />
wir … deutlich erhöhte zusätz liche<br />
Haushaltsmittel bereitstellen.“ Ein Beteiligter<br />
sagt: „Die Infrastruktur fällt<br />
wohl mal wieder hinten runter.“ Das<br />
Verkehrsministerium weist den Vorwurf<br />
zurück. Ramsauer habe sich immer<br />
wieder für mehr Investitionen<br />
eingesetzt.<br />
PAUL LANGROCK / ZENIT / LAIF<br />
70<br />
ZAHL <strong>DER</strong> WOCHE<br />
10Cent<br />
statt derzeit sechs Cent pro Kilowattstunde<br />
würde die Umlage für erneuerbare<br />
Energien im Jahr 2020 nach<br />
Berechnungen des Bundesumwelt -<br />
ministeriums betragen, wenn der<br />
Ökostrom-Ausbau<br />
im gleichen Tempo<br />
weiterläuft. Ein<br />
durchschnittlicher<br />
Dreipersonenhaushalt<br />
müsste für<br />
Strom dann statt<br />
gut 80 fast<br />
100 Euro im Monat<br />
zahlen.<br />
V E R K E H R<br />
Bombardier-Chef<br />
verprellt Bahn<br />
Der neue Chef der Bombardier-Zug -<br />
sparte, Lutz Bertling, 51, brüskiert<br />
kurz nach seinem Einstieg bei dem kanadischen<br />
Konzern schon einen seiner<br />
wichtigsten Abnehmer: die Deutsche<br />
Bahn. Anfang November hatte der<br />
ehemalige EADS-Manager erklärt, er<br />
wolle den seit Jahren andauernden<br />
Rechtsstreit mit dem Bundesunternehmen<br />
wegen diverser Qualitäts- und<br />
Liefermängel so schnell wie möglich<br />
außergerichtlich beilegen. Darüber<br />
habe er bereits mit Bahn-Chef Rüdiger<br />
Grube, den er noch aus EADS-Zeiten<br />
kenne, gesprochen. Beide Seiten, so<br />
wird Bertling zitiert, strebten „eine<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3<br />
neue Partnerschaft an“ und wollten<br />
„den Streit“ zügig „bereinigen“. In<br />
Berlin weiß man allerdings nichts<br />
davon. Man sei von einer Einigung<br />
„meilenweit entfernt“, heißt es bei der<br />
Bahn. Bislang habe Bombardier „noch<br />
kein konkretes Angebot gemacht“, so<br />
ein mit dem Fall vertrauter Bahn-<br />
Manager. Der Konzern hat Bombardier<br />
in drei Verfahren in Berlin und München<br />
auf mehr als eine halbe Milliarde<br />
Euro Schadensersatz verklagt. Nach<br />
Beobachtung der Bahn sind nicht nur<br />
die Räder und Bremsen der S-Bahn-<br />
Züge aus dem Haus Bombardier<br />
schlecht konstruiert. Auch bei 200 Regionalzügen,<br />
die vor allem in Süddeutschland<br />
fahren, seien massive Probleme<br />
auf getreten. Ein weiterer Streitpunkt<br />
zwischen Bahn und Bombardier<br />
sind Probleme bei der Lieferung und<br />
der Technik von 178 Nahverkehrs -<br />
zügen des Typs Talent 2.
Wirtschaft<br />
Bitcoin Kurs der virtuellen Währung, in Euro<br />
100<br />
0<br />
Nov.<br />
2012<br />
D E V I S E N<br />
Digitale Achterbahn<br />
Jan.<br />
2013 April Aug.<br />
Es begann als niedliches Netzexperiment<br />
von ein paar Nerds, Hackern und<br />
politischen Aktivisten: 2009 wurde die<br />
Internetwährung Bitcoin erfunden. In<br />
der vergangenen Woche gab es mal<br />
wieder gigantische Kursgewinne und<br />
drastische Abstürze. Erst ging es um<br />
300<br />
200<br />
600<br />
500<br />
400<br />
Quellen: Bitcoin.de, mtgox<br />
M Ü T T E R R E N T E<br />
Experten zweifeln am Terminplan<br />
Sollten sich Union und SPD bei ihren<br />
Koalitionsverhandlungen in dieser<br />
Woche auf Verbesserungen bei der<br />
Mütterrente einigen, so hätten sie ein<br />
Problem: Die Rentenkasse könnte die<br />
höheren Bezüge nicht schon zu Beginn<br />
kommenden Jahres auszahlen.<br />
„Administrativ ist die höhere Mütterrente<br />
zum 1. Januar 2014 nicht umsetzbar.<br />
Die Abarbeitung würde mehrere<br />
Monate dauern“, heißt es in einem<br />
Positionspapier der Bundesvereinigung<br />
der Deutschen Arbeitgeberverbände.<br />
Sie hat derzeit den Vorsitz im<br />
Protestaktion auf dem Pariser Platz in Berlin<br />
17. 18. 19. 20. 21.<br />
November<br />
40 Prozent rauf, dann wieder um fast<br />
50 Prozent runter. Spekulationsgeschäfte<br />
chinesischer Anleger werden<br />
dafür verantwortlich gemacht. Doch<br />
trotz der Volatilität der Digital-Devise<br />
zeigt der Kursverlauf seit Gründung<br />
vor allem in eine Richtung: nach oben.<br />
Bundesvorstand der Rentenversicherung.<br />
Die Reform würde einen „enormen<br />
Verwaltungsaufwand“ auslösen,<br />
auf den die Kassen personell nicht vorbereitet<br />
seien, warnen die Experten.<br />
Etwa neun Millionen Konten müssten<br />
kurzfristig umgestellt werden. CDU<br />
und CSU hatten im Wahlkampf damit<br />
geworben, die Rentenansprüche von<br />
Müttern und Vätern, deren Kinder vor<br />
1992 geboren wurden, von 2014 an zu<br />
erhöhen. Dazu sollen ihre Erziehungszeiten<br />
künftig stärker berücksichtigt<br />
werden.<br />
HC PLAMBECK / LAIF<br />
KOMMENTAR<br />
Geier im Anflug<br />
Von Susanne Amann<br />
Wer glaubt, in Sachen Karstadt<br />
könne ihn nichts mehr überraschen,<br />
der unterschätzt die Phantasie von<br />
Nicolas Berggruen. Der Investor, der<br />
sich gern als Gutmensch gibt, findet<br />
immer Wege, trotz schwindender<br />
Umsätze Geld aus dem siechenden<br />
Warenhauskonzern zu ziehen.<br />
Wenn er so weitermacht, könnte er<br />
in die Wirtschaftsgeschichte eingehen:<br />
als Mann, der mit minimalem<br />
Einsatz maximalen Gewinn erzielte.<br />
Nur einen Euro zahlte Berggruen für<br />
Karstadt, weil er versprach, den maroden<br />
Konzern zu retten. Doch statt<br />
zu investieren, ließ er sich jedes Jahr<br />
aus der Kasse der Firma Millionen<br />
für die Namensrechte überweisen.<br />
Dann verkaufte er die Mehrheit an<br />
den profitablen Premium- und Sporthäusern<br />
dem Österreicher René Benko,<br />
der schon zahlreiche Karstadt-<br />
Immobilien besitzt. Berggruen selbst<br />
behielt 24,9 Prozent. Nun könnte er<br />
sich, wie das „manager magazin“<br />
enthüllte, auch noch an Benkos<br />
Karstadt-Immobilien beteiligen und<br />
so von Mieterhöhungen profitieren,<br />
die das Überleben des Kaufhaus -<br />
konzerns zusätzlich erschweren.<br />
Im Prinzip kann jeder Investor mit<br />
seinem Unternehmen machen, was<br />
er will. Doch muss er die Mitarbeiter,<br />
die um ihre Arbeitsplätze bangen, dabei<br />
auch noch verhöhnen? Und die<br />
Öffentlichkeit für dumm verkaufen?<br />
Vor gerade mal zwei Monaten<br />
schrieb Berggruen an die Belegschaft,<br />
die 300 Millionen Euro, die<br />
Benko für die Übernahme der Pre -<br />
mium- und Sportgruppe zahle, seien<br />
sein Beitrag zur Gesundung von<br />
Karstadt. Doch dieses Geld fließt<br />
eben nicht ins Unternehmen, sondern<br />
über eine komplizierte Struktur<br />
zurück an Berggruen, Benko und all<br />
die anderen Investoren, die sich wie<br />
die Geier um Karstadt zu versammeln<br />
scheinen. Die jüngste Wendung<br />
hat endgültig klargemacht, was Berggruen<br />
mit Karstadt plant – allen Dementis<br />
und Motivationsbriefen zum<br />
Trotz: ausnehmen, zerschlagen –<br />
und dann weiterziehen. Zurück bleiben<br />
rund 24000 Karstadt-Mitarbeiter,<br />
ohne deren Gehaltsverzicht in Mil -<br />
lionenhöhe der Konzern schon<br />
längst pleite wäre.<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3 71
Wirtschaft<br />
Trumpf-Chefin Leibinger-Kammülller<br />
mit Schülerinnen<br />
THEODOR BARTH / LAIF<br />
G L E I C H B E R E C H T I G U N G<br />
Ende der Männerwirtschaft<br />
Die geplante Frauenquote der Großen Koalition bereitet den Konzernen weniger<br />
Probleme, als es manche Kritiker wahrhaben wollen. Viele Firmen haben sich<br />
längst darauf eingestellt: Sie fördern Nachwuchs und holen Frauen ins Management.
Wenn Annette Widmann-Mauz es<br />
schafft, in der Online-Ausgabe<br />
des amerikanischen Magazins<br />
„New Yorker“ genannt zu werden, dann<br />
muss schon etwas Außergewöhnliches<br />
passiert sein. Die Tübinger CDU-Abgeordnete<br />
ist bislang Parlamentarische<br />
Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium<br />
und außerhalb des Fach -<br />
publikums wenig bekannt.<br />
Am Dienstag vergangener Woche aber<br />
zitierte das Blatt ausgerechnet die schwäbische<br />
Politikerin, nachdem sich die Unterhändler<br />
von Union und SPD in ihren<br />
nächtlichen Koalitionsgesprächen auf<br />
eine gesetzliche Frauenquote geeinigt hatten.<br />
Ab 2016 sollen demnach 30 Prozent<br />
der neu zu besetzenden Aufsichtsratsmandate<br />
für Frauen reserviert werden.<br />
Diese Einigung markiere, so Widmann-<br />
Mauz, einen „Kulturwandel im Inneren<br />
der Unternehmen“.<br />
Nimmt man das unmittelbar nach der<br />
Verkündung einsetzende Protestgeheul<br />
zum Gradmesser, hat Widmann-Mauz<br />
mit dieser Einschätzung wohl recht. Die<br />
staatliche Quote bedeute einen erheb -<br />
lichen Eingriff in die unternehmerische<br />
Freiheit, sie würde keine Rücksicht auf<br />
die Besonderheiten bestimmter Branchen<br />
nehmen, tönte es aus Wirtschaft und<br />
Unternehmerverbänden. Die Neuregelung<br />
gefährde die Wettbewerbsfähigkeit,<br />
es gebe schlicht nicht genügend qualifizierte<br />
Frauen, ging das Lamento weiter.<br />
Der Chef-Lobbyist der deutschen Indu -<br />
strie, BDI-Präsident Ulrich Grillo, erklärte<br />
gar, Führungspositionen sollten auch<br />
in Aufsichtsräten „nach Eignung und Leistung<br />
festgelegt werden“.<br />
Ach tatsächlich?<br />
Eine Selbstverständlichkeit, sollte man<br />
meinen, auch in Deutschland, wo Konzernführung<br />
und Konzernaufsicht jahrzehntelang<br />
von Männern dominiert waren<br />
und die Diskussion um mehr Frauen<br />
in Führungsjobs belächelt wurde. In den<br />
160 wichtigsten börsennotierten Unternehmen<br />
herrschen immer noch ernüchternde<br />
Zustände: In den Aufsichtsräten<br />
liegt der Frauenanteil bei 17,4 Prozent,<br />
unter den Vorständen finden sich gerade<br />
mal 6,1 Prozent Frauen.<br />
Die hiesigen Mitbestimmungsgesetze,<br />
die den Arbeitnehmern Mandate in den<br />
Aufsichtsräten sichern, haben den Geschlechterunterschied<br />
teilweise eingeebnet.<br />
Schließlich besetzen die Arbeitnehmer<br />
knapp 24 Prozent der 638 Sitze, die<br />
ihnen zustehen, mit Frauen. Auf der Kapitalseite<br />
sind es 13 Prozent, bei 58 der<br />
160 Unternehmen hat die Kapitalseite keine<br />
einzige Frau in den Aufsichtsgremien.<br />
Das ist der Stand, zwölf Jahre nach der<br />
freiwilligen Selbstverpflichtung der Wirtschaft.<br />
Die hatte im Jahr 2001 versprochen,<br />
den Frauenanteil zu erhöhen – eben<br />
um eine gesetzliche Regelung zu umgehen.<br />
„Hätte die Wirtschaft die freiwillige<br />
Selbstverpflichtung ernst genommen,<br />
müsste sie jetzt auch nicht so über die gesetzliche<br />
Quote heulen“, sagt Monika<br />
Schulz-Strelow, Präsidentin der Initiative<br />
für mehr Frauen in die Aufsichtsräte<br />
(FidAR). Für sie ist die Einigung ein Paradigmenwechsel:<br />
„Es geht jetzt nicht<br />
mehr um nice-to-have, sondern um neccessary-to-have.“<br />
Aufsichtsrätinnen Bagel-Trah, Achleitner<br />
Diktatur der „Goldröcke“?<br />
HENKEL / PICTURE ALLIANCE / DPA<br />
ANDREAS MÜLLER / VISUM<br />
Aber wird die Quote die deutsche Wirtschaft<br />
tatsächlich so gravierend verändern,<br />
wie die Reaktionen es vermuten<br />
lassen?<br />
Fakt ist: Der Koalitionskompromiss ist<br />
weit weniger bahnbrechend, als es den<br />
Anschein hat. So haben sich die Unterhändler<br />
von SPD und CDU lediglich<br />
dar auf geeinigt, dass ab 2016 bei Neubesetzungen<br />
von Aufsichtsräten „eine Geschlechterquote<br />
von mindestens 30 Prozent“<br />
eingehalten wird, wie es in dem<br />
von Union und SPD erarbeiteten Papier<br />
heißt. Aufgrund der Wahlzyklen wäre so<br />
im Jahr 2020 ein Drittel aller Aufsichtsräte<br />
weiblich. Außerdem betrifft die Quote<br />
ausschließlich den kleinen Kreis der börsennotierten<br />
und voll mitbestimmungspflichtigen<br />
Unternehmen.<br />
Für die viel wichtigeren Positionen im<br />
Top-Management wird es keine feste<br />
Quote geben. Stattdessen einigten sich<br />
die Unterhändler der Parteien auf eine<br />
freiwillige Selbstverpflichtung der Unternehmen<br />
– was stark an das umstrittene<br />
Modell „Flexi-Quote“ der noch amtierenden<br />
Familienministerin Kristina Schröder<br />
(CDU) erinnert. Die rund 2000 börsennotierten<br />
oder mitbestimmungspflichtigen<br />
Unternehmen müssen zwar „verbindliche<br />
Zielgrößen für die Erhöhung des Frauenanteils<br />
im Aufsichtsrat, Vorstand und in<br />
den obersten Management-Ebenen“ festlegen.<br />
Von Sanktionen bei Nichteinhaltung<br />
war vorerst nicht die Rede.<br />
So halbherzig die Koalitionspläne auch<br />
ausfallen: Tatsächlich hat die seit Jahren<br />
anhaltende Debatte um eine Frauenquote<br />
bei vielen Wirtschaftsbossen zu der Erkenntnis<br />
geführt, dass sie in Zukunft nicht<br />
mehr ohne weibliches Führungspersonal<br />
auskommen. Selbst bei Gegnern einer<br />
gesetzlichen Regelung hat dies zu einem<br />
Umdenken geführt, bei Daimler-Boss Dieter<br />
Zetsche beispielsweise.<br />
Wie viele andere Unternehmensführer<br />
ist Zetsche gegen eine Frauenquote, die<br />
der Gesetzgeber vorgibt. Aber er hat<br />
Daimler selbst ein Ziel gesetzt. Bis zum<br />
Jahr 2020 soll der Anteil der Frauen in<br />
Führungspositionen von 10 auf 20 Prozent<br />
verdoppelt werden. Als erster Auto -<br />
konzern holte Daimler mit Christine<br />
Hohmann-Dennhardt eine Frau in den<br />
Vorstand. Und Zetsche setzt die Männer<br />
auf Führungspositionen unter Druck. Wer<br />
nicht genügend Frauen befördert, dem<br />
kürzt er den Bonus. Das Gegenargument,<br />
nun würden Frauen befördert, nur weil<br />
sie Frauen sind, sei „in Summe Bullshit“.<br />
Er kenne keinen Fall, in dem eine Frau<br />
befördert wurde und sich dies hinterher<br />
als Flop herausstellte: „Bei Männern kenne<br />
ich einige solche Fälle.“<br />
Im Aufsichtsrat erfüllt Daimler zu -<br />
mindest auf der Kapitalseite schon das<br />
30-Prozent-Ziel, das nun diskutiert wird.<br />
Drei der zehn Vertreter sind weiblich: die<br />
ehemalige Nokia-Managerin Sari Baldauf,<br />
die ehemalige Nestlé-Vorstandsfrau<br />
Petraea Heynike und die Ex-Avon-Chefin<br />
Andrea Jung. Die Frauen stammen aus<br />
Finnland, Großbritannien und Kanada,<br />
das bringt zusätzlich mehr Internationalität<br />
in den Aufsichtsrat. Den Diskussionen<br />
habe dies gutgetan, sagen männliche<br />
Kontrolleure.<br />
Auch andere Großkonzerne haben<br />
längst reagiert. Als erster deutscher Dax-<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3 73
Konzern kündigte die Telekom im März<br />
2010 an, bis Ende 2015 30 Prozent der<br />
mittleren und oberen Führungspositionen<br />
mit Frauen besetzen zu wollen.<br />
Dass sich die Quote erfüllen lässt, zeigt<br />
das Beispiel Lufthansa. So hat sich der<br />
Aufsichtsrat der Fluggesellschaft per Beschluss<br />
zu einem höheren Frauenanteil<br />
verpflichtet, gleichzeitig ändert das Unternehmen<br />
gezielt seine Firmenkultur.<br />
Führungspositionen werden konzernweit<br />
so besetzt, dass sie bestimmten<br />
Kriterien gerecht werden, unter<br />
anderem Geschlecht und Nationalität.<br />
Einen anderen Weg geht der<br />
Essener Energie-Riese RWE. Der<br />
hat in seinem Aufsichtsrat auf der<br />
Kapitalseite bislang lediglich eine<br />
Frau. Per Selbstverpflichtung soll<br />
der Frauenanteil an den Führungspositionen<br />
bis 2018 verdoppelt<br />
werden. Vor allem aber gibt<br />
es bei RWE ein sehr aktives Frauennetzwerk,<br />
angetrieben von der<br />
RWE-Geschäftsführerin Marie-<br />
Theres Thiell. Sie hat dafür gesorgt,<br />
dass das Management sogar<br />
die Ziele der „Frauen in die Aufsichtsräte“-Initiative<br />
übernommen<br />
hat. RWE-Chef Peter Terium<br />
sagt: „RWE will mehr Frauen in<br />
Aufsichtsräten und im Top-Management,<br />
weil es ein wesent -<br />
liches Instrument ist, um die deutsche<br />
Wirtschaft für die Zukunft<br />
besser aufzustellen.“<br />
Für frei werdende Aufsichtsratsmandate<br />
von RWE-Töchtern<br />
sollen standardmäßig Frauen aus<br />
dem eigenen Haus vorgeschlagen<br />
werden. Das Unternehmen bietet<br />
ihnen spezielle Schulungen an.<br />
Auch Claudia Gläser hat ein<br />
solches Programm durchlaufen.<br />
Dabei ist die 44-Jährige seit elf<br />
Jahren Geschäftsführerin der Gläser<br />
GmbH, eines Mittelständlers<br />
im Bereich Hydraulik und Anlagenbau.<br />
60 Mitarbeiter dirigiert<br />
die studierte Maschinenbauerin,<br />
der Frauenanteil liegt bei etwa 40<br />
Prozent: „Ich habe immer darauf<br />
geachtet, dass wir eine gesunde<br />
Mischung haben und vor allem<br />
die besten Leute einstellen“, sagt sie. Oft<br />
hätten Frauen die besseren Abschlüsse,<br />
auch in den technischen Berufen.<br />
Gläser ist zudem Vizechefin des Verbands<br />
deutscher Unternehmerinnen<br />
(VdU) – und eine klare Befürworterin der<br />
Quote. Seit 2011 hat der VdU einen Kandidatinnenpool<br />
aufgebaut. „Um endlich<br />
das Totschlagargument zu entkräften, es<br />
gebe nicht genügend qualifizierte Frauen“,<br />
sagt Gläser. Dort lassen sich die Profile<br />
von 400 Top-Frauen in Führungs -<br />
positionen abrufen, rund 150 Managerinnen<br />
wurden in Zusammenarbeit mit der<br />
74<br />
Wirtschaft<br />
Beratungsgesellschaft PwC für die Arbeit<br />
in Aufsichtsräten geschult. „Wie viele<br />
männliche Kandidaten können das schon<br />
von sich behaupten?“, fragt Gläser.<br />
Wer mit Personalberatern spricht, dem<br />
wird schnell klar: Am Mangel qualifizierter<br />
Frauen hat es bislang nicht gelegen,<br />
dass sie nicht zum Zuge kamen. „Wir haben<br />
in den vergangenen Jahren gezielt<br />
nach Frauen gesucht, sie gefunden und<br />
den Unternehmen auch immer wieder<br />
Nachholbedarf<br />
Frauen in den Aufsichtsräten der Dax-30-Unternehmen<br />
Aufsichtsräte<br />
davon<br />
Frauen<br />
Anteil<br />
Frauen<br />
Henkel ............................16 7 44%<br />
Deutsche Telekom ........... 20 7 35%<br />
Allianz .............................12 4 33%<br />
Beiersdorf ....................... 12 4 33%<br />
Commerzbank ................. 20 6 30%<br />
Deutsche Bank ................ 20 6 30%<br />
Deutsche Lufthansa ........ 20 6 30%<br />
Deutsche Post ................. 20 6 30%<br />
Daimler ........................... 20 5 25%<br />
E.on ................................12 3 25%<br />
Münchener Rück .............20 5 25%<br />
Merck .............................. 16 4 25%<br />
SAP ................................. 16 4 25%<br />
Siemens .........................20 5 25%<br />
Deutsche Börse............... 18 4 22%<br />
BMW ...............................20 4 20%<br />
ThyssenKrupp ................. 20 4 20%<br />
Adidas ............................. 12 2 17%<br />
BASF................................ 12 2 17%<br />
Infineon Technologies ..... 12 2 17%<br />
Lanxess ........................... 12 2 17%<br />
Linde ............................... 12 2 17%<br />
Bayer............................... 20 3 15%<br />
RWE ................................20 3 15%<br />
Volkswagen ..................... 20 3 15%<br />
K+S ................................16 2 13%<br />
HeidelbergCement .......... 12 1 8%<br />
Continental ..................... 20 1 5%<br />
Fresenius ........................12 0 0%<br />
Fresenius Medical Care ..... 6 0 0%<br />
vorgeschlagen“, sagt ein Führungsmitglied<br />
einer großen Personalberatung.<br />
Aber trotz anderslautender Absichts -<br />
erklärung hätte den Job am Ende doch<br />
meistens ein Mann bekommen, nicht immer<br />
mit besserer Qualifikation. Kritiker<br />
der Quote dagegen argumentieren, es<br />
gebe zu wenige geeignete Frauen.<br />
Aufsichtsräte brauchten eine hohe<br />
Qualifikation, breite Kenntnis von Unternehmen<br />
und Wirtschaft, aber auch spezielle<br />
Kenntnisse bestimmter Bereiche,<br />
um in dem Gremium alle möglichen Aufgaben<br />
und Kontrollbereiche abbilden zu<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3<br />
Quelle:<br />
Fidar 2013<br />
Frauenanteil<br />
30%<br />
und mehr<br />
Frauenanteil<br />
unter<br />
30%<br />
Geplante Frauenquote<br />
in Aufsichtsräten<br />
ab 2016: 30%<br />
Um dieses Ziel zu<br />
erreichen, müssten<br />
in die Dax-30-Unternehmen,<br />
die unter<br />
der Quote liegen,<br />
insgesamt<br />
<strong>48</strong> Frauen<br />
aufgenommen<br />
werden*.<br />
*bei gleicher<br />
Aufsichtsratsstärke<br />
können, sagt etwa Ulrich Lehner, Ex-<br />
Henkel-Chef und mit zahlreichen Mandaten<br />
einer der einflussreichsten Aufsichtsräte<br />
der Republik.<br />
Wirklich gute Aufseher seien in so vielen<br />
Gremien vertreten, dass ein weiteres<br />
Amt wegen Überbelastung meist ausscheide,<br />
sagt Lehner. Qualifizierte Frauen<br />
– sogenannte Goldröcke – könnten sich<br />
vor lauter Anfragen kaum noch retten.<br />
Gemeint sind damit profilierte Aufsichtsrätinnen<br />
wie Simone Bagel-Trah,<br />
Ann-Kristin Achleitner oder Nicola<br />
Leibinger-Kammüller.<br />
Doch dass die Frauenquote zu<br />
einer Diktatur der „Goldröcke“<br />
führen könnte, steht nicht zu befürchten.<br />
Die Herrenriege treibt<br />
wohl eher die Sorge, die steigende<br />
Zahl weiblicher Kontrolleure<br />
könnte zum endgültigen Aus der<br />
Männerwirtschaft führen. Denn<br />
es waren ausgerechnet die Granden<br />
der alten Deutschland AG,<br />
die sich jahrzehntelang die Posten<br />
zuschanzten. Bei der Verabschiedung<br />
des Aktiengesetzes wurde<br />
die Zahl der Aufsichtsratsmandate<br />
deshalb pro Person auf zehn<br />
beschränkt.<br />
Derzeit besitzen nur zehn<br />
Vertreterinnen der Kapitalseite in<br />
den Aufsichtsräten der 160 börsennotierten<br />
Unternehmen zwei<br />
Mandate gleichzeitig, lediglich<br />
drei Frauen jeweils drei Mandate.<br />
Das geht aus einer Analyse der<br />
Personalberatung Kienbaum hervor.<br />
In den Dax-30-Konzernen<br />
haben lediglich 13 Prozent der<br />
Aufsichtsrätinnen mehr als ein<br />
Mandat – bei ihren männlichen<br />
Kollegen liegt der Anteil derzeit<br />
bei 17 Prozent.<br />
Die Herren werden sich also<br />
daran gewöhnen müssen, dass sie<br />
es künftig häufiger mit Frauen zu<br />
tun haben – auch wenn es dem<br />
ein oder anderen noch schwerfällt.<br />
So kritisierte etwa auf der<br />
Daimler-Hauptversammlung ein<br />
Fondsmanager, dass die Ex-Avon-<br />
Chefin Jung zur Aufsichtsrätin berufen<br />
wurde. Mehr automobile<br />
Kompetenz würde dem Gremium<br />
besser zu Gesicht stehen als „die kosmetische<br />
Erhöhung der Frauenquote“.<br />
Das war dann selbst Daimlers Aufsichtsratschef<br />
Manfred Bischoff zu viel.<br />
„Im Aufsichtsrat werden keine Autos gebaut“,<br />
sagte er. Andrea Jung aber könnte<br />
im Kontrollgremium ihre Erfahrungen auf<br />
dem wichtigen US-Markt einbringen. Zudem<br />
habe sie exzellente Managementkenntnisse.<br />
Das, so sollte man meinen,<br />
könnte eigentlich reichen.<br />
NICOLA ABÉ, SUSANNE AMANN,<br />
MARKUS DETTMER, FRANK DOHMEN,<br />
DIETMAR HAWRANEK, SIMONE SALDEN
EZB-Präsident Draghi<br />
Machtwort aus Frankfurt?<br />
F I N A N Z M Ä R K T E<br />
Stress beim<br />
Stresstest<br />
Europas Banken sind die größten<br />
Geldgeber ihrer Regierungen.<br />
Das berge Risiken, warnen Experten<br />
Zentralbankchef Draghi.<br />
Doch der hält ihre Studie zurück.<br />
Die Unternehmensberatung Roland<br />
Berger hat sich vergangene Woche<br />
um die Pflege der deutschitalienischen<br />
Beziehungen verdient gemacht.<br />
Sie kürte Federico Ghizzoni, Chef<br />
der italienischen Bank Unicredit, zum<br />
„Italo-German Manager of the Year“.<br />
Die Seelenmassage dürfte gutgetan<br />
haben, war doch das deutsch-italienische<br />
Verhältnis zuletzt angespannt. Ein Unicredit-Manager<br />
hatte Bundesbank-Chef<br />
Jens Weidmann vorgeworfen, Italien<br />
grundsätzlich zu misstrauen. Mit hektischer<br />
Diplomatie wurde der Graben rasch<br />
zugeschüttet. Doch es droht neuer Ärger.<br />
Unicredit gehört zu jenen Banken, die<br />
in großem Stil Staatsanleihen ihrer eigenen<br />
Regierung gekauft haben, 46 Mil -<br />
liarden Euro stehen in den Büchern. In<br />
Italien, Spanien und andernorts sind die<br />
Kreditinstitute zu den größten Finanziers<br />
ihrer Staaten aufgestiegen. Das freut die<br />
jeweilige Regierung, birgt aber Risiken.<br />
Kann ein Staat seine Kredite nicht mehr<br />
bedienen, drohen auch den Banken hohe<br />
Verluste. Ökonomen und allen voran<br />
Bundesbank-Chef Weidmann wollen deshalb<br />
die enge Verbindung zwischen Regierungen<br />
und ihren Kreditinstituten<br />
durch neue Regeln lockern.<br />
Der Vorstoß ist gut gemeint, aber er<br />
hat einen Nachteil: Er bringt klamme Banken<br />
und Krisenstaaten in die Klemme –<br />
76<br />
und die Europäische Zentralbank (EZB)<br />
in ein Dilemma. Ehe sie 2014 die Aufsicht<br />
über die Banken der Euro-Zone übernimmt,<br />
will sie deren Bilanzen prüfen,<br />
Altlasten aufräumen und untersuchen,<br />
wie gut die Geldhäuser gegen neue Turbulenzen<br />
gewappnet sind.<br />
Die Währungsbehörde will dabei testen,<br />
wie sich Verluste bei Staatsanleihen<br />
auf die Banken auswirken. Doch wie hart<br />
man die Institute dabei anfassen soll, dar -<br />
über wird in der Zentralbank gestritten.<br />
Wie politisch sensibel das Thema<br />
Staatsanleihen ist, mussten vor kurzem<br />
15 Wissenschaftler erfahren, die den bei<br />
der EZB angesiedelten Europäischen Ausschuss<br />
für Systemrisiken beraten. Dieser<br />
Ausschuss wurde Ende 2010 von der EU<br />
gegründet, um Gefahren im Finanzsystem<br />
früher zu erkennen und zu bannen.<br />
Die Wissenschaftler taten ihre Pflicht<br />
und legten dem Ausschuss Empfehlungen<br />
vor, wie die Verquickung der Banken mit<br />
ihrem Staat gelockert werden kann.<br />
Dass etwa spanische Banken vor allem<br />
spanische Anleihen und irische Institute<br />
vornehmlich irische Papiere hielten, sei<br />
ähnlich gefährlich, als würde das Geldhaus<br />
den Großteil seiner Kredite an eine<br />
einzelne Firma vergeben, urteilten die<br />
Wissenschaftler. Um solche Klumpenri -<br />
siken zu vermeiden, könnte den Banken<br />
Sept. 2013<br />
415 Mrd. €<br />
24 %<br />
Nov. 2011<br />
240 Mrd. €<br />
Italien<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3<br />
41 %<br />
WIKTOR DABKOWSKI / ACTION PRESS<br />
Anteil am Gesamtvolumen<br />
der Staatsanleihen des<br />
jeweiligen Landes<br />
299 Mrd. €<br />
Spanien<br />
165 Mrd. €<br />
beispielsweise vorgeschrieben werden,<br />
ihre Staatsanleihen auf einen vorgegebenen<br />
Anteil zu begrenzen. Eine andere<br />
Möglichkeit wäre, die Schuldtitel mit Kapital<br />
zu unterlegen. So ließen sich die Risiken<br />
zumindest auf mittlere Sicht adäquat<br />
eindämmen.<br />
Doch kämen solche Regeln für Banken,<br />
müssten sich die Staaten der europäischen<br />
Währungsunion ganz neu die Frage<br />
stellen, wie sie sich künftig finanzieren.<br />
EZB-Chef Mario Draghi sah sofort die<br />
Brisanz dieser Vorschläge. Er gab die<br />
Empfehlungen „zur Überarbeitung“ wieder<br />
an das wissenschaftliche Beratergremium<br />
zurück, in dem unter anderen die<br />
deutschen Ökonomen Martin Hellwig<br />
vom Bonner Max-Planck-Institut zur Erforschung<br />
von Gemeinschaftsgütern und<br />
Claudia Buch, Leiterin des Instituts für<br />
Wirtschaftsforschung Halle, sitzen. Die<br />
Wissenschaftler wollten den ungewöhnlichen<br />
Vorgang nicht kommentieren.<br />
Eine Grundsatzdiskussion um das<br />
riskante System der Staatsfinanzierung<br />
käme gerade jetzt zur Unzeit, sorgt man<br />
sich in Notenbankkreisen.<br />
Doch Draghi fürchtet zugleich, dass die<br />
Autorität der EZB schon vor der Übernahme<br />
der Bankenaufsicht angekratzt<br />
wäre, wenn sie die Risiken eines Staatsbankrotts<br />
beim Stresstest einfach ignorieren<br />
würde. „Wir müssen da eine Entscheidung<br />
treffen“, kündigte er im September<br />
vor dem Währungsausschuss des EU-Parlaments<br />
an, Mitte Oktober werde es eine<br />
„erste Kommunikation“ geben.<br />
Aber Banken und Regierungen warteten<br />
vergebens auf ein Machtwort aus<br />
Frankfurt zu den Staatsanleihen. Das liegt<br />
auch daran, dass Draghi im EZB-Rat keine<br />
Mehrheit dafür hat, die Risiken von<br />
Staatsanleihen in der Bilanz zu berücksichtigen.<br />
„Die Gefechtslage verläuft entlang<br />
der Betroffenheit“, sagt einer der an<br />
den Diskussionen Beteiligten.<br />
Insbesondere die Vertreter der Südländer<br />
zeigen wenig Interesse, an den bestehenden<br />
Bilanzregeln etwas zu ändern.<br />
34 Mrd. €<br />
Übermäßiger Anstieg<br />
Von den Banken gehaltene Staatsanleihen<br />
des jeweils eigenen Landes<br />
27 %<br />
Portugal<br />
23 Mrd. €<br />
zum<br />
Vergleich:<br />
Quellen: EZB, Bundesbank<br />
242 Mrd. €<br />
15 %<br />
209 Mrd. €<br />
Deutschland
Wirtschaft<br />
Bislang müssen Banken für Staatsanleihen<br />
kein Kapital zur Absicherung bereithalten,<br />
als ob es kein Risiko gäbe. Dabei<br />
hat zum Beispiel in Italien der Finanzkonzern<br />
Intesa 100 Milliarden Euro in<br />
Anleihen der eigenen Regierung angelegt.<br />
Das beeinträchtigt auch die Geldpolitik<br />
der EZB. Seit Jahren versorgt sie die Banken<br />
mit Liquidität, um die Konjunktur<br />
anzukurbeln. Doch anstatt italienischen<br />
Unternehmen Kredite zu geben, stockten<br />
die dortigen Banken ihre Bestände an<br />
staatlichen Bonds seit Ende 2011 von 240<br />
auf 415 Milliarden Euro auf.<br />
„Wir beobachten eine Ausweichreak -<br />
tion, die wir durch geldpolitische Eingriffe<br />
selbst verursacht haben“, kritisiert Weidmann.<br />
Er hält es auch aus diesem Grund<br />
für geboten, „dass wir perspektivisch<br />
Staatsanleihen so wie Unternehmensanleihen<br />
behandeln müssen“. Einer Firma<br />
dürfen nur in bestimmtem Umfang Darlehen<br />
gewährt werden, eine solche Großkreditgrenze<br />
müsste es aus Weidmanns<br />
Sicht auch für Staaten geben – für Anleihen<br />
jedes einzelnen Landes.<br />
Experten wie Daniel Gros sehen das<br />
ähnlich. „Das schlüssigste Instrument im<br />
Umgang mit Staatsanleihen wäre die Anwendung<br />
von Großkreditgrenzen“, sagt<br />
der Ökonom vom Centre for European<br />
Policy Studies, der auch dem Beirat des<br />
Ausschusses für Systemrisiken angehört.<br />
Außerdem könne es sinnvoll sein, die<br />
Schuldtitel je nach Risiko mit Kapital zu<br />
unterlegen. „Dabei sollte man sich jedoch<br />
nicht an Ratings orientieren, sondern einfach<br />
an der Höhe der Staatsschulden in<br />
Relation zur Wirtschaftsleistung.“<br />
Beim Stresstest im kommenden Jahr<br />
sollen solche grundsätzlichen Überlegungen<br />
noch keine Rolle spielen. Doch damit<br />
der Test glaubwürdig ist, muss die EZB<br />
das Staatsschuldenrisiko in irgendeiner<br />
Weise miteinkalkulieren. An den Finanzmärkten<br />
hat sich die Erkenntnis, dass<br />
Staatsanleihen für die Banken ein Risiko<br />
darstellen, ohnehin längst durchgesetzt.<br />
Die Rating-Agentur Standard & Poor’s<br />
(S&P) berücksichtigt bereits Abschläge<br />
für diese Risiken, wenn sie die Bonität<br />
von Banken beurteilt. Auch deshalb hält<br />
S&P die europäischen Kreditinstitute im<br />
Schnitt für nicht so gut mit Kapital ausgestattet,<br />
wie diese es darstellen.<br />
„Es gibt Banken, deren Risiko sich zu<br />
stark auf Staatsanleihen einzelner Länder<br />
konzentriert“, sagt S&P-Bankenanalyst<br />
Markus Schmaus. Er hält es für sinnvoll,<br />
im Stresstest mögliche Verluste bei den<br />
Staatsanleihen zu simulieren und auf entsprechenden<br />
Kapitalbedarf hinzuweisen.<br />
Doch Schmaus ist bewusst, dass es<br />
dabei um eine hochpolitische Frage geht:<br />
„Über den Schalter Staatsanleihen kann<br />
man das gesamte Stresstestergebnis ziemlich<br />
gut steuern.“<br />
MARTIN HESSE, CHRISTOPH PAULY<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3 77
Slum, Infosys-Gebäude in Bangalore<br />
I N D I E N<br />
Paradies der Bürokraten<br />
Zwei Jahrzehnte nach Beginn seines Wirtschaftswunders fällt Indien hinter den<br />
Rivalen China zurück. Die Korruption blüht, Investoren ziehen ihr<br />
Geld ab. Schafft das Land einen Neustart nach der Parlamentswahl im kommenden Jahr?
GETTY IMAGES<br />
Es rummelte und rumorte, dann<br />
schoss Indiens erste Mars-Rakete in<br />
den Himmel über dem Golf von<br />
Bengalen, einen langen Feuerstreif hinter<br />
sich herziehend. Es war einer jener seltenen<br />
Augenblicke, in denen sich Asiens<br />
drittgrößte Wirtschaftsnation von ihrer<br />
modernen Seite zeigte: Alles lief pünktlich,<br />
präzise, und am Boden jubelte Indiens<br />
Raumfahrtchef: „Keine Mission ist<br />
unmöglich für uns.“<br />
Das war Anfang November, und in<br />
zehn Monaten will die 1,2-Milliarden-<br />
Einwohner-Nation ihren eigentlichen<br />
Triumph feiern. Dann soll die selbstentwickelte<br />
Sonde den Roten Planeten erreichen<br />
und mehrmals umkreisen. Gelingt<br />
das Vorhaben, wären die Inder als<br />
vierte Raumfahrtmacht erfolgreich zum<br />
Mars vorgedrungen – nach Amerikanern,<br />
Russen, Europäern. Und vor allem: vor<br />
ihren größten Rivalen, den Chinesen.<br />
Die Weltraummission leuchtet als Hoffnungsschimmer<br />
über Indien, denn auf der<br />
Erde läuft für das Land sonst kaum noch<br />
etwas nach Plan. Der Wettlauf mit China<br />
um die Vorherrschaft in Asien, seit Jahren<br />
von westlichen Autoren als Duell zwischen<br />
Drache und Elefant farbig ausgemalt,<br />
ist ökonomisch – und damit letztlich<br />
auch geopolitisch – längst entschieden:<br />
zum Nachteil Indiens.<br />
Zwei Jahrzehnte lang wurde das in -<br />
dische Wirtschaftswunder bejubelt, nun<br />
ist es ins Stocken geraten: Das Wachstum<br />
von einst, um die zehn Prozent, hat sich<br />
mehr als halbiert. Im laufenden Jahr dürfte<br />
es wie schon im Vorjahr unter vier Prozent<br />
liegen, prognostiziert der Internationale<br />
Währungsfonds.<br />
Damit würde Indiens Volkswirtschaft<br />
nur noch halb so schnell wachsen wie die<br />
Weltfabrik China. Das Reich der Mitte<br />
schwächelt derzeit zwar auch, aber auf<br />
vergleichsweise luxuriösem Niveau. Indien<br />
dagegen steht vor der Herausforderung,<br />
seine Bevölkerung aus der Armut<br />
zu befreien. Ein Drittel der Inder müssen<br />
mit weniger als 1,25 Dollar am Tag auskommen.<br />
Ihnen können nur hohe Wachstumsraten<br />
zu Wohlstand verhelfen.<br />
Die enttäuschende Bilanz spiegelt sich<br />
auch im Wertverlust der Landeswährung<br />
wider: Seit Anfang 2013 hat die Rupie<br />
gegenüber dem Dollar gut zwölf Prozent<br />
an Wert verloren. Damit verteuern sich<br />
auch die Importe, besonders das Öl. Indiens<br />
Hunger nach diesem Rohstoff trägt<br />
die Hauptschuld an der tiefroten Handelsbilanz<br />
des Landes.<br />
Zwar hat sich die Rupie wieder etwas<br />
von den dramatischen Kurseinbrüchen<br />
des Sommers erholt: Damals flohen auch<br />
aus anderen Schwellenländern massenweise<br />
die Anleger; sie fürchteten ein Ende<br />
der lockeren Kreditpolitik der US-Notenbank.<br />
Einige der spekulativen Gelder flossen<br />
seither gar wieder zurück und trieben<br />
die Kurse der Aktienbörse in Mumbai in<br />
Wirtschaft<br />
die Höhe. Doch die Zinswende in den<br />
USA wurde nur in die Zukunft verschoben<br />
– und damit auch das mögliche böse<br />
Erwachen für Indiens Wirtschaft.<br />
Denn die indische Misere ist hausgemacht.<br />
Politiker und Bürokraten in Neu-<br />
Delhi haben es in den Jahren des Booms<br />
versäumt, genug Investoren ins Land zu<br />
locken, die Fabriken bauen und Jobs<br />
schaffen. Die Elite des Landes versäumte<br />
es, die völlig veraltete Infrastruktur zu<br />
modernisieren – durch den Bau neuer<br />
Straßen, Brücken und vor allem einer verlässlichen<br />
Stromversorgung.<br />
Stattdessen vergraulte die arrogante<br />
und zutiefst korrupte Bürokratie immer<br />
wieder ausländische Firmen: Der britische<br />
Kommunikationsmulti Vodafone wurde<br />
rückwirkend mit einer Art Sondersteuer<br />
belegt. Der südkoreanische Konzern Posco<br />
gab im Juli nach endlosen Verzögerungen<br />
entnervt den Plan auf, ein Stahlwerk<br />
für 5,3 Milliarden Dollar in Ostindien zu<br />
bauen. Im selben Monat verzichtete der<br />
indisch-luxemburgische Konzern Arcelor-<br />
Mittal auf ein ähnliches Vorhaben. Und<br />
im Oktober kündigte der australisch-britische<br />
Konzern BHP Billiton an, sich aus<br />
mehreren Projekten zur Erschließung von<br />
Öl und Gas zurückziehen zu wollen.<br />
Oft scheitern Zukunftsvorhaben im<br />
demokratischen Indien am berechtigten<br />
Widerstand von Umwelt -<br />
aktivisten, oft aber wollen<br />
lokale Bosse, Politiker und<br />
Beamte einfach nur ab -<br />
zocken.<br />
„Was Indien braucht, ist<br />
ein effektiver Staat mit<br />
einem robusteren Rechtsstaat<br />
und größerer Ver -<br />
antwortlichkeit“, fordert<br />
Gurcharan Das, der eins -<br />
tige Indien-Chef des Kon -<br />
sum gü terriesen Procter & -<br />
Gamble. Der sarkastische<br />
Titel seines Buchs lautet:<br />
„India Grows at Night“ –<br />
„Indien wächst nachts“.<br />
Also dann, wenn die Bürokraten<br />
schlafen.<br />
Gewiss, indische Unternehmer<br />
sind gewohnt, sich<br />
durch das bürokratische<br />
Dickicht zu lavieren, dessen<br />
Regeln teils noch von den<br />
britischen Kolonialherren<br />
ersonnen wurden. Doch so<br />
können sie kaum Jobs<br />
für jene zwölf Millionen<br />
Arbeitskräfte kreieren, die<br />
jährlich neu in Riesenstädte<br />
wie Delhi strömen.<br />
Es ist Vormittag in Kusumpur<br />
Pahari, dem größten<br />
Slum im Süden der<br />
Hauptstadt. Roshan Vedwal<br />
lungert mit Freunden<br />
in einer Gasse, das graue<br />
2,5<br />
2,0<br />
1,5<br />
1,0<br />
0,5<br />
15<br />
12<br />
9<br />
6<br />
3<br />
Abwasser fließt durch offene Rinnsale.<br />
Der 29-Jährige ist aufgewachsen in diesem<br />
Dschungel aus Elendshütten, hier<br />
leben und arbeiten mindestens 100000<br />
Menschen. Fließend Trinkwasser bekommen<br />
sie nur zu bestimmten Zeiten von<br />
Tanklastern zugeteilt. Auch Toiletten<br />
besitzen sie nicht, ihre Notdurft verrichten<br />
sie im Freien – wie die Hälfte aller<br />
Inder.<br />
Seit zwei Jahren sucht Vedwal einen<br />
Job, zuvor bediente er in der Kantine eines<br />
Krankenhauses. Doch nun sind Jobs<br />
Mangelware. „Ich lebe vom Geld meiner<br />
Verwandten“, berichtet Vedwal, und die<br />
arbeiten als Wachmänner oder Köche in<br />
den nahe gelegenen Villen. Die Kluft<br />
zwischen Arm und Reich ist die moderne<br />
Fortsetzung des Kastenwesens: Das Vermögen<br />
der 100 reichsten Inder entsprach<br />
2010 einem Viertel des Bruttoinlandsprodukts.<br />
Die Ärmsten sind dagegen auf Nahrung<br />
angewiesen, die der Staat an sie<br />
verteilen lässt. An diesem Tag hat die<br />
Ausgabe im Slum geöffnet, ein Knäuel<br />
Wartender hat sich gebildet. Eine Frau<br />
zeigt ihre rote Rationenkarte: „25 Kilo<br />
Weizen stehen mir zu“, schimpft sie und<br />
deutet zugleich auf ihren abgefüllten<br />
kleinen Plastiksack, „aber nur die Hälf -<br />
te habe ich bekommen.“<br />
Schwächelnder<br />
Subkontinent<br />
Wert von 100 Indischen<br />
Rupien, in Dollar<br />
2005<br />
Wirtschaftswachstum<br />
im Vergleich zum Vorjahr,<br />
in Prozent<br />
Indien<br />
China<br />
2005<br />
Quellen: Thomson Reuters<br />
Datastream; IWF; *geschätzt<br />
Doch Klagen nützen<br />
nichts, berichten Anwohner,<br />
der Zwischenhändler<br />
stecke mit der Polizei unter<br />
einer Decke. „Die Beamten<br />
kassieren kräftig mit.“<br />
Derzeit schauen viele<br />
Politiker im Slum vorbei.<br />
Sie versprechen, dass alles<br />
besser werden solle. Denn<br />
spätestens im Mai wählen<br />
die Inder ein neues Par -<br />
lament, knapp 150 Millionen<br />
dürfen zum ersten Mal<br />
abstimmen.<br />
Indien ist ein junges<br />
Land, fast 60 Prozent der<br />
Bevölkerung ist unter 30.<br />
Ökonomen begrüßen den<br />
Nachwuchs als künftige<br />
Konsumenten, sie bejubeln<br />
Indiens „demografische<br />
Dividende“, einen angeb -<br />
lichen Wettbewerbsvorteil<br />
gegenüber dem rasch alternden<br />
China. Doch wenn<br />
Indien nicht genug Jobs anbietet,<br />
vor allem für seine<br />
vielen frustrierten jungen<br />
Männer, könnte sich der<br />
vermeintliche Vorteil als demografisches<br />
Desaster entpuppen.<br />
Denn anders als China<br />
hat Indien sich vornehm<br />
von oben modernisiert: IT-<br />
Riesen wie Infosys verwan-<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3 79<br />
13<br />
13 *
80<br />
Wirtschaft<br />
Kandidat Modi: Erlöser aus kollektiver Erstarrung?<br />
delten den Subkontinent mit Software-Schmieden<br />
und Call-Centern<br />
zum Dienstleister der Welt. Davon<br />
profitierte vor allem die gut Englisch<br />
sprechende Elite: Rund 2,8 Millionen<br />
der 450 Millionen arbeitenden<br />
Inder sind im IT-Sektor beschäftigt.<br />
Doch diese Pioniere leiden nun<br />
unter der schwächelnden globalen<br />
Nachfrage. Vor allem US-Firmen zögern,<br />
weitere Dienstleistungen auszulagern.<br />
Bei Infosys in der Hightech-Metropole<br />
Bangalore brachen sie deshalb<br />
in diesem Jahr mit hehren eigenen<br />
Prinzipien und riefen Firmengründer<br />
Narayana Murthy aus dem<br />
Ruhestand zurück ins aktive Management.<br />
Die IT-Legende soll Infosys<br />
wieder flottmachen. Zwar meldet<br />
der Konzern inzwischen wieder<br />
höhere Gewinne. Doch die verdankt<br />
er vor allem dem niedrigen<br />
Wechselkurs der Rupie, der im Ausland<br />
erwirtschaftete Gewinne aufbläht.<br />
„Die triste Stimmung in der IT-<br />
Industrie drückt auf den Konsum“,<br />
sagt Ravindra Bhargava. Der Chairman<br />
des indisch-japanischen Autobauers<br />
Maruti Suzuki bittet in seine<br />
Villa im Südosten von Delhi. Ein<br />
Diener serviert Tee und Schokoladenkuchen,<br />
und der energische 79-Jährige<br />
mit der hohen Stirn nimmt sich Zeit,<br />
einmal grundsätzlich über die indische<br />
Misere zu diskutieren.<br />
Eigentlich hat Maruti Suzuki wenig<br />
Grund zu klagen. Anders als viele lokale<br />
Konkurrenten verkauft die Firma derzeit<br />
mehr Autos als im Vorjahr. Doch die neue<br />
Kundschaft reiche nicht aus, sagt Bhargava.<br />
„Unser Land kommt nicht darum her -<br />
um, eine solide industrielle Massenfertigung<br />
aufzubauen und so ausreichend Arbeitsplätze<br />
zu schaffen.“<br />
Ob Japan, Südkorea oder China – der<br />
Autoveteran weiß, dass bisher keine asiatische<br />
Wirtschaftsmacht aufgestiegen ist,<br />
ohne zuvor die industrielle Revolution<br />
gemeistert zu haben. Allein die Chinesen<br />
bauen mehr als fünfmal so viele Autos<br />
wie die Inder. Zwar stellen die Inder passable<br />
Fahrzeuge her, aber sie produzieren<br />
zu teuer. Ein wichtiger Grund: Kompliziertes<br />
Elektronikzubehör wie Chips müssen<br />
sie häufig importieren.<br />
Zwar hegen die Politiker in Delhi ehrgeizige<br />
Pläne. 2011 beschlossen sie, den<br />
Anteil der industriellen Fertigung an der<br />
gesamten Wirtschaftsleistung in zehn<br />
Jahren von 16 auf 25 Prozent zu erhö -<br />
hen. Dann würde Indien zwar weiter hinter<br />
China herhinken (30 Prozent), nur:<br />
Derzeit wächst Indiens Industrie noch<br />
langsamer als zu Beginn des großen Vorhabens.<br />
Was sich die Eliten in der Hauptstadt<br />
ausdenken, wird vor Ort oft nicht umgesetzt.<br />
In den 28 indischen Bundesstaaten<br />
regieren häufig lokale Parteien, bewilligte<br />
Fördergelder verfehlen oft die Adressaten.<br />
Auch Autoboss Bhargava macht die alltägliche<br />
Korruption für Indiens Rückständigkeit<br />
verantwortlich.<br />
Er unterscheidet zwei Arten der Ab -<br />
zocke: Eine Variante spiele auf „hoher<br />
Ebene“ – etwa wenn Politiker bei Projekten<br />
Anteile verlangen. Oder es handle<br />
sich um „alltägliche“ Korruption, wenn<br />
Bürger Beamte für Leistungen schmieren<br />
müssen, die ihnen per Gesetz zustehen.<br />
„Das nenne ich Erpressung“, sagt Bhargava.<br />
Der Maruti-Suzuki-Chairman spricht<br />
für viele Bosse, ihre Stimmung ist durchweg<br />
mies. Und daran dürfte sich in den<br />
kommenden sechs Monaten wenig ändern.<br />
Die Koalition der Kongresspartei<br />
unter Premier Manmohan Singh regiert<br />
nach neun Jahren nur noch auf Abruf.<br />
Bis zur Wahl sind von dem 81-Jährigen<br />
keine mutigen Reformen mehr zu er -<br />
warten.<br />
Im Gegenteil, der Regierungschef mit<br />
dem blauen Sikh-Turban gilt als tragische<br />
Figur des verblassten Wirtschaftswunders.<br />
Dabei gehörte der in England geschulte<br />
Ökonom Anfang der Neunziger zu jenen,<br />
die Indien nach Dekaden besonders<br />
heftiger staatlicher Gängelei für die<br />
Marktwirtschaft öffneten. Damals war er<br />
Finanzminister. Doch längst fehlt ihm die<br />
Autorität in seiner eigenen Partei. Die<br />
Landsleute langweilt er mit stocksteifen<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3<br />
Auftritten, viele verspotten ihn als<br />
„Roboter“.<br />
Indiens neue Hoffnung heißt für<br />
viele dagegen Narendra Modi. Der<br />
63-Jährige trägt einen penibel gestutzten<br />
grauen Bart und dazu fast<br />
täglich ein neues buntes Gewand,<br />
die Kurta. Er ist der Spitzenkandidat<br />
der oppositionellen Hindu-Partei<br />
Bharatiya Janata (BJP), insbesondere<br />
Wirtschaftsbosse und die urbane<br />
Jugend sehnen ihn als Erlöser aus<br />
der kollektiven Erstarrung herbei.<br />
Sein Gesellenstück als Reformer<br />
lieferte Modi im westlichen Bundesstaat<br />
Gujarat, wo er in dritter Amtszeit<br />
regiert – straff wie ein chinesischer<br />
Parteisekretär. Der Sohn eines<br />
Teeverkäufers gilt als nicht korrupt.<br />
Unter ihm wuchs die Wirtschaft des<br />
60-Millionen-Staates um die Hälfte<br />
schneller als der Durchschnitt Indiens.<br />
Als protestierende Bauern in<br />
Westbengalen beispielsweise den<br />
Bau einer Fabrik für das Kleinauto<br />
Nano des Tata-Konzerns verhinderten,<br />
holte der unternehmerfreundliche<br />
Modi das Projekt im Eiltempo<br />
nach Gujarat. Wenn es jedoch um<br />
soziale Fortschritte geht, etwa um<br />
Gesundheit oder Erziehungswesen,<br />
dann schneidet Gujarat teilweise<br />
noch schlechter ab als andere Bundes -<br />
staaten.<br />
Gleichwohl spekulieren westliche Anleger<br />
bereits darauf, dass ein möglicher<br />
Premier Modi Indien erneuern könnte.<br />
Das US-Wertpapierhaus Goldman Sachs<br />
revidierte kürzlich seine pessimistische<br />
Prognose für den Subkontinent und empfiehlt<br />
mit Blick auf Modi nun, wieder<br />
indische Aktien zu kaufen. Der Titel des<br />
Papiers ist zugleich die Botschaft: „Modifying<br />
our view“.<br />
Die Parteinahme für Modi kommt indes<br />
reichlich früh. Insbesondere bei vielen<br />
Wählern der muslimischen Minderheit ist<br />
der hinduistische Wirtschaftsreformer verhasst.<br />
In seiner Amtszeit brachen in Gujarat<br />
2002 antimuslimische Gemetzel aus,<br />
über tausend Menschen kamen dabei unter<br />
den Augen der Behörden um. Modi<br />
weigert sich bis heute, dafür die politische<br />
Verantwortung zu übernehmen.<br />
Und selbst wenn Modi in Delhi die<br />
Macht erringt: Wie der glücklose Amtsinhaber<br />
Singh müsste auch er voraussichtlich<br />
in einer Koalition um Kompromisse<br />
feilschen. Selbst in seiner BJP sträuben<br />
sich die Vertreter mächtiger Interessengruppen,<br />
die indische Wirtschaft weiter<br />
zu öffnen, beispielsweise für ausländische<br />
Supermärkte.<br />
Egal wer künftig regiert, einen Erfolg<br />
könnte Indien im Herbst 2014 wohl feiern:<br />
die Mars-Mission. Vorausgesetzt, die Sonde<br />
erreicht bis dahin ihr Reiseziel.<br />
WIELAND WAGNER<br />
AJIT SOLANKI / PICTURE ALLIANCE / AP / DPA
Wirtschaft<br />
K O N Z E R N E<br />
Monumente der Macht<br />
Die Tech-Giganten von Apple bis Amazon wollen ihre grandiosen Ambitionen<br />
in Glas und Beton verewigen: Sie bauen sich bombastische neue<br />
Firmenzentralen, in denen die traditionelle Arbeitswelt auf den Kopf gestellt wird.<br />
Wenige Wochen vor seinem Tod<br />
gab Steve Jobs noch ein letztes<br />
Wunderwerk in Auftrag. Er<br />
wusste, es würde sein Vermächtnis sein,<br />
ein Symbol seines Wirkens und Ausdruck<br />
kreativer Weltherrschaft: ein neues<br />
Hauptquartier für Apple, entworfen von<br />
Stararchitekt Norman Foster. „Das beste<br />
Bürogebäude der Welt“, kündigte Jobs<br />
bei der ersten Präsentation der Pläne an,<br />
„ein bisschen wie ein Raumschiff.“<br />
Es wird der wohl teuerste jemals gebaute<br />
Firmensitz der Welt sein, ein gigantischer<br />
kreisrunder Monolith für fünf Milliarden<br />
Dollar, kostspieliger als der zehn<br />
Jahre währende Wiederaufbau des World<br />
Trade Centers in New York.<br />
Aber nichts, was Apple dieser Tage tut,<br />
bleibt lange unangefochten, insbesondere<br />
wenn es um Symbole geht.<br />
Mark Zuckerberg, Facebook-Chef mit<br />
der Vision, die ganze Menschheit online<br />
zu vernetzen, hat den nicht minder berühmten<br />
Architekten Frank Gehry beauftragt,<br />
ein neues Hauptquartier zu schaffen.<br />
Natürlich ist auch dies nicht irgend -<br />
ein Gebäude, sondern „die größte offene<br />
Bürofläche der Welt“, wie Zuckerberg<br />
sagt, ein immenser Raum für 3400 Facebook-Mitarbeiter.<br />
Das Gebäude selbst<br />
soll verschwinden in der Landschaft, bedeckt<br />
von Bäumen und Wiesen. „Von außen<br />
wird es aussehen wie ein Hügel in<br />
der freien Natur“, sagt Zuckerberg.<br />
Amazon-Chef Jeff Bezos, ebenfalls<br />
wirtschaftlichen Weltherrschaftsplänen<br />
nicht abgeneigt, lässt unterdessen das<br />
erste Biosphären-Hauptquartier der Welt<br />
errichten: drei Dome aus Glas und Stahl,<br />
jeder ein künstliches Ökosystem mit eigenem<br />
Mikroklima und entsprechender<br />
botanischer Zone. Die Biosphären-Büros,<br />
erstellt vom preisgekrönten Architekturbüro<br />
NBBJ, sollen im Schatten eines dazugehörigen<br />
Wolkenkratzers in Seattle<br />
stehen, der künftig die Skyline der Stadt<br />
dominieren soll.<br />
Auch Google arbeitet mit NBBJ zu -<br />
sammen, „Bay View“ heißt das Projekt<br />
für ein neues, größeres Hauptquartier,<br />
schlichter in der Form, aber angeberisch<br />
vorgestellt im Glamour-Magazin „Vanity<br />
Fair“: neun durch Brücken verbundene<br />
Gebäude, die Dächer teils angelegt als<br />
NBBJ<br />
FOSTER+PARTNERS<br />
Ort Seattle<br />
Washington<br />
Architekt J. Savo/NBBJ<br />
Gebäudefläche 306 580 m 2<br />
Ort Cupertino<br />
Kalifornien<br />
Architekt Norman Foster<br />
Gebäudefläche 329 170 m 2<br />
gesamt<br />
zum Vergleich:<br />
Pentagon<br />
344 000 m 2<br />
Parklandschaften, errichtet über mehrere<br />
Hektar renaturierter Feuchtgebiete.<br />
Und gleich nebenan baut Nvidia, einer<br />
der wichtigsten Chip-Hersteller der Welt,<br />
einen enormen Firmensitz, halb Fußballstadion,<br />
halb Flughafenterminal: zwei<br />
Dreiecke aus Glas und Stahl, der Computerchip<br />
dient als Vorlage.<br />
Die Pläne, dank städtischer Planver -<br />
fah ren öffentlich einzusehen, illustriert<br />
mit detailgenauen Computersimulationen,<br />
Kostenaufstellungen und Blaupausen,<br />
lassen keine Zweifel aufkommen:<br />
Hier sollen nicht einfach Firmenzentralen<br />
entstehen, sondern Monumente. Architektonische<br />
Techno-Visionen als Re -<br />
flexion der nicht mehr aufzuhaltenden<br />
digitalen Dominanz, Ausdruck der weltweiten<br />
ökonomischen und kulturellen<br />
Vormacht stellung, die das Silicon Valley<br />
84<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3
und seine Anführer offen für sich beanspruchen.<br />
Auch wenn jedes der Unternehmen<br />
sichtbar bemüht ist, sein eigenes architektonisches<br />
Wunder zu bauen, über -<br />
wiegen deswegen doch die Gemeinsam -<br />
keiten: Alle Entwürfe versprechen eine<br />
Mischung aus idealisierter Natur und<br />
Hightech. Apple etwa will seine neue<br />
Zentrale nur mit eigenen Solar- und<br />
Windkraftanlagen versorgen.<br />
Und die Gebäude ziehen sich stets in<br />
die Breite statt in die Höhe. Denn nur so<br />
kann die perfekte Ideenschmiede entstehen,<br />
die optimale räumliche Umgebung<br />
für den möglichst produktiven digitalen<br />
Arbeiter, der weltverändernde Erfindungen<br />
am laufenden Band produziert.<br />
„Die Idee ist, die perfekte Erfinderwerkstatt<br />
zu schaffen“, sagt Zuckerberg. Die<br />
simple Logik: Wer kollaboriert, ist kreativ.<br />
Also müssen alle Abgrenzungen verschwinden,<br />
seien es Stockwerke oder Wände.<br />
Einzelbüros gibt es nicht mehr, auch<br />
nicht für das Top-Management. Die offene<br />
Spiel- und Denkfläche ist die dominierende<br />
Grundform der Digitalwirtschaft. Wer<br />
sie nicht hat, der schafft sie. Nachzügler<br />
wie Microsoft, Yahoo und SAP entkernen<br />
Gebäude, lassen Büros verschwinden.<br />
„Das alles beruht auf Verhaltenswissenschaft“,<br />
sei belegt durch zahlreiche Studien,<br />
sagt Hao Ko, Design-Direktor im<br />
Architekturbüro Gensler und zuständig<br />
für die neue Nvidia-Zentrale. Es geht<br />
darum, „eine Umgebung herzustellen, in<br />
der man sich ständig begegnet, spontane<br />
Unterhaltungen entstehen“, in der sich<br />
Ort Mountain View<br />
Kalifornien<br />
Architekt J. Hendry/NBBJ<br />
Gebäudefläche 102 200 m 2<br />
Ort Menlo Park<br />
Kalifornien<br />
Architekt Frank Gehry<br />
Gebäudefläche 137 130 m 2<br />
inkl. Bestand<br />
Manager nicht hinter verschlossenen Türen<br />
verstecken können. Mitarbeiter auf<br />
derselben Etage sähen sich praktisch jeden<br />
Tag, sagt Ko. Bei unterschiedlichen<br />
Stockwerken so gut wie nie.<br />
Also wird die traditionelle Arbeitswelt<br />
auf den Kopf gestellt: Nicht eine Fülle von<br />
Meetings müsse organisiert werden, sondern<br />
Privatsphäre. Dauerhafte Interaktion<br />
ist der Standard. Wer unbeobachtet sein<br />
NBBJ<br />
E. KATIGBAK / FACEBOOK / REUTERS<br />
will, muss sich darum bemühen. „Jeder<br />
sitzt draußen im Offenen mit Schreib -<br />
tischen, die schnell verschoben werden<br />
können, je nachdem, welche Teams sich<br />
gerade um Projekte formen“, sagt Everett<br />
Katigbak, Design-Manager bei Facebook.<br />
Es ist nicht schwer, diese totale Nähe,<br />
die fehlenden Barrieren, die Auflösung<br />
der individuellen Rückzugsräume als<br />
Ausdruck der zweischneidigen digitalen<br />
Kultur zu sehen: Das Internet schafft einerseits<br />
neue Freiheit, aber es gibt kein<br />
Recht auf Privatsphäre. Alles ist offen,<br />
vermarktbar, durchleuchtbar.<br />
Schon jetzt fehlt es den Arbeitern in<br />
den Zentralen der Tech-Konzerne an<br />
nichts, und nichts soll sie davon abhalten,<br />
bis in die Nacht und auch an den Wochenenden<br />
kreativ zu sein. Geboten wird<br />
ein Rundumservice mit Kindergarten,<br />
Hundeschule und Swimmingpool, mit<br />
Kletterwand, Pizzeria und Open-Air-<br />
Kino. Eine mobile Zahnarztpraxis sorgt<br />
für ein gesundes Gebiss, der Ölwechsel<br />
auf dem Mitarbeiterparkplatz hält das<br />
Auto in Schuss. Wer eine Pause braucht,<br />
legt sich in die „Nickerchen-Ecke“.<br />
All das versprechen auch die Neubauten,<br />
nur noch hübscher, größer, ausgeklügelter:<br />
Restaurantmeilen und Hightech-<br />
Fitnessstudios, Parkanlagen und Supermärkte.<br />
Kommt, wann ihr wollt, arbeitet,<br />
wie ihr wollt, und es gibt kostenloses Essen<br />
und Smartphones und Kinderbetreuung.<br />
Aber bitte arbeitet bis zum Umfallen,<br />
damit wir alle anderen überrennen und<br />
gemeinsam reich werden.<br />
Die All-inclusive-Anlagen von Google,<br />
Apple, Facebook und ihre geplanten Erweiterungen<br />
reflektieren deshalb exakt<br />
den Geist des Silicon Valley. Der ist ein<br />
seltsames Paradox: Er verbindet die disziplinierte<br />
Herrschaft des Marktes mit der<br />
Freiheit des kreativen Hippie-Künstlers.<br />
Die englischen Medientheoretiker<br />
Richard Barbook und Andy Cameron<br />
prägten in den neunziger Jahren dazu<br />
den Begriff von der „Kalifornischen Ideologie“:<br />
„Dieser neue Glaube hat sich<br />
durch eine bizarre Fusion aus der kulturellen<br />
Boheme von San Francisco und<br />
den High tech-Industrien des Silicon Valley<br />
gebildet.“ Entstanden ist dabei ein<br />
einzigartiger ideologischer Mischmasch<br />
aus rechtem und linkem, ultraindividualistischem<br />
und ultrakapitalistischem Gedankengut,<br />
freiheitlicher bis hin zu antistaatlicher<br />
Haltung.<br />
Hinzu kommt noch eine gute Prise<br />
Techno-Determinismus, gepredigt von<br />
jungen Gründern wie Internetmilliardären<br />
gleichermaßen: In unserer Phantasiewelt<br />
können alle reich und hip und die<br />
Welt kann ein besserer Ort werden, wenn<br />
ihr uns nur machen lasst.<br />
Larry Page etwa, Gründer und Chef<br />
von Google, verkündete im Frühjahr, er<br />
wünsche sich, „einen Teil der Welt“ zu<br />
reservieren für technische, soziale und<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3 85
Wirtschaft<br />
sonstige Experimente, um die digitale<br />
Utopie schneller zu verwirklichen. „Es<br />
gibt viele aufregende Dinge, die wir machen<br />
könnten, die aber illegal oder durch<br />
Regeln untersagt sind“, so Page. Regeln<br />
seien zwar gut, aber vielleicht könnte<br />
man einen sicheren Ort schaffen, an dem<br />
man eben doch alles darf.<br />
Aber solange niemand Page und seine<br />
Gleichgesinnten ein eigenes Google-Land<br />
überlässt, bleibt ihnen nichts anderes<br />
übrig, als sich ein herkömmliches, aber<br />
wenigstens eigenes Habitat zu schaffen.<br />
Samt firmeneigenen Buslinien, die sich<br />
durch die verstopften Autobahnen pflügen<br />
und die Mitarbeiter täglich ankarren.<br />
Stattdessen den öffentlichen Nahverkehr<br />
zu fördern kommt nicht in Frage. Dass<br />
Google nun auch ein autarkes Abwassersystem<br />
bauen will, passt ins Bild. Gezielt<br />
auch den öffentlichen urbanen Raum mit<br />
den Milliardenprojekten zu entwickeln<br />
dagegen nicht. Deswegen vielleicht erinnerte<br />
der neue Apple-Campus den Architekturkritiker<br />
des „New Yorker“ auch an<br />
das Pentagon: eine unzugängliche, abgeschirmte<br />
Welt.<br />
In der Bay Area, der Region um San<br />
Francisco und das Silicon Valley, leben<br />
die Menschen schon seit Jahrzehnten mit<br />
dieser seltsamen Ambivalenz einer Branche,<br />
die unerhörten Wohlstand und Arbeitsplätze<br />
bringt, sich aber kaum um das<br />
Allgemeinwohl schert. Steve Jobs antwortete<br />
auf die Frage, wie die Stadt Cuper -<br />
tino vom Apple-Neubau profitieren könnte:<br />
„Wir ziehen nicht weg, und ihr könnt<br />
froh sein, weiterhin hohe Steuereinnahmen<br />
zu kassieren.“<br />
Dieser bisweilen erstaunliche Autismus<br />
ist auch immer wieder in den Geschäftspraktiken<br />
zu spüren: Datenschutz? Nur<br />
so, wie wir wollen.<br />
Während nun also prächtige neue Firmensitze<br />
entstehen, wird die Region mit<br />
den Exzessen alleingelassen: mit der überlasteten<br />
Infrastruktur und explodierenden<br />
Mieten, die das Leben in San Francisco<br />
für Normalverdiener fast unmöglich machen,<br />
weil die Tech-Firmen ganze Häuserblocks<br />
für ihre Mitarbeiter anmieten<br />
und jeden Preis zahlen.<br />
Zunehmend ist eine schwelende Wut<br />
zu spüren in der ganzen Region, man<br />
schimpft auf die Techno-Hipster und ihre<br />
privaten Buslinien, die unbezahlbaren<br />
Wohnungen und explodierenden Lebenshaltungskosten,<br />
lästert über die Gigantomanie<br />
des Apple-Raumschiffs. Die offene<br />
Konfrontation gegen eine alles dominierende<br />
Industrie sucht jedoch niemand.<br />
Vergangene Woche nickte der Stadtrat<br />
von Cupertino die neue Apple-Zentrale<br />
ab. Einstimmig und genau so, wie der<br />
Konzern es sich wünschte, Fertigstellung<br />
2016. Bereits bei der Vorstellung der Entwürfe<br />
hatte der Bürgermeister verkündet:<br />
„Das Mutterschiff ist gelandet.“<br />
THOMAS SCHULZ<br />
86<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3
Turkish-Airlines-Jets auf dem Istanbuler Flughafen: Massiv Kunden aus Deutschland abgesaugt<br />
GETTY IMAGES<br />
L U F T F A H R T<br />
Ende einer<br />
Beziehung<br />
Turkish Airlines schien für<br />
die Lufthansa der ideale<br />
Partner zu sein. Stattdessen ist die<br />
Fluggesellschaft zu einer<br />
ernsten Bedrohung geworden.<br />
Eigentlich ist es nur eine Fußnote<br />
in den Regeln des Lufthansa-Viel -<br />
fliegerprogramms. Doch in Wirklichkeit<br />
sind die dürren Zeilen eine<br />
Kriegserklärung.<br />
Ab Januar 2014 schreibt die Lufthansa<br />
ihren Miles&More-Mitgliedern bei Flügen<br />
mit dem Partner Turkish Airlines nur<br />
noch 25 Prozent der Prämienpunkte als<br />
Statusmeilen gut. Je nachdem, wie viele<br />
ein Passagier hat, kann er spezielle Serviceleistungen<br />
nutzen, wie Lounges oder<br />
eine bevorzugte Abfertigung.<br />
Dass nur noch ein läppisches Meilenviertel<br />
für den Lufthansa-Status zählen<br />
soll, während bei anderen Star-Alliance-<br />
Partnern nach wie vor 100 Prozent gutgeschrieben<br />
werden, zeigt, wie unterkühlt<br />
das Verhältnis zwischen der Kranich-Linie<br />
und Turkish Airlines ist. Einst brachte<br />
Lufthansa als Mentor die Türken in das<br />
weltgrößte Airline-Bündnis Star Alliance.<br />
Heute bereuen die Konzernmanager das<br />
offenbar. Denn Turkish Airlines saugt<br />
massiv Kunden aus Deutschland ab, der<br />
Partnerstatus hilft ihr dabei.<br />
Die größte Fluglinie der Türkei ist zur<br />
ernsten Bedrohung geworden. In der Lufthansa-Zentrale<br />
denkt man schon über<br />
noch drastischere Schritte nach, etwa die<br />
Kündigung sogenannter Code-Share-Abkommen.<br />
Darunter versteht man etwa<br />
Lufthansa-Flüge wie die von Frankfurt<br />
nach San Francisco, die auch eine Turkish-Airlines-Flugnummer<br />
haben. Der<br />
türkische Partner kann dafür Plätze auf<br />
eigene Rechnung verkaufen. Die Lufthansa-Tochter<br />
Austrian Airlines hat ihre Abkommen<br />
in der vergangenen Woche bereits<br />
gekündigt.<br />
Eine derartige Eiszeit in den deutschtürkischen<br />
Beziehungen hielten Branchenkenner<br />
bis vor kurzem für undenkbar.<br />
Noch vor einem Jahr schien die Zukunft<br />
der Lufthansa im Osten zu liegen,<br />
genauer gesagt: in Istanbul. Der Kranich-<br />
Carrier plane eine enge Kooperation mit<br />
Turkish Airlines, meldeten zahlreiche<br />
Medien im In- und Ausland. Von Gemeinschaftsflügen<br />
auf bestimmten Strecken<br />
bis hin zu einer Kapitalverflechtung oder<br />
gar der Gründung einer Gemeinschaftsfirma<br />
sei alles möglich, hieß es in euphorischen<br />
Berichten.<br />
Experten priesen die Vorteile, die der<br />
geplante Schulterschluss beiden Seiten<br />
bescheren würde. Die Deutschen, hieß<br />
es, könnten mit Hilfe des aufstrebenden<br />
Bündnispartners in der Star Alliance über<br />
Istanbul zusätzliche Umsteigeverbindungen<br />
nach Asien oder Indien anbieten und<br />
so Rivalen wie der arabischen Fluglinie<br />
Emirates besser Paroli bieten. Umgekehrt<br />
könnten die Turkish-Airlines-Manager<br />
Passagieren aus dem boomenden Großraum<br />
Istanbul mit Hilfe der Lufthansa<br />
über Frankfurt zusätzliche Flüge in die<br />
USA anbieten. Daraus wird wohl nichts.<br />
Stattdessen dürfte künftig wieder jeder<br />
für sich allein kämpfen. Turkish Airlines<br />
fliegt schon jetzt von zwölf deutschen<br />
Angreifer aus dem Osten<br />
Turkish<br />
Airlines<br />
Umsatz 2012<br />
6,3 Mrd. €<br />
Lufthansa<br />
Group<br />
30,1 Mrd. €<br />
Steigerung<br />
von 2011 bis 2012<br />
Umsatz +26,0% +4,9%<br />
Passagiere +20,0%<br />
+2,4%<br />
Flugziele +18,6%<br />
+1,6%<br />
Flughäfen nach Istanbul. Ein Großteil der<br />
Passagiere ist kein „ethnischer Verkehr“,<br />
wie im Airline-Slang Fluggäste bezeichnet<br />
werden, die in ihre Heimat pendeln. Vielmehr<br />
handelt es sich um Umsteiger, die<br />
in Kleinflughäfen wie Bremen, Friedrichshafen<br />
oder Leipzig nach Istanbul starten<br />
und von dort aus in die Welt fliegen.<br />
Das ist mit Turkish Airlines oft erheblich<br />
billiger als über die Lufthansa-Drehkreuze<br />
in Frankfurt oder München und<br />
wird zudem von manchem als komforta -<br />
bler empfunden. Während die Frankfurter<br />
versuchen, jede Stellschraube zu nutzen,<br />
um ein paar Euro einzusparen, profitiert<br />
Turkish Airlines von niedrigeren Lohnkosten,<br />
günstigeren Preisen fürs Catering und<br />
Flughäfen ohne Nachtlandeverbot.<br />
Gezielt baut Turkish Airlines die Verbindungen<br />
nach Deutschland aus, es gibt<br />
Gerüchte, dass die letzten Lücken nächstes<br />
Jahr geschlossen werden sollen. Anfang<br />
vergangener Woche kam schon mal Kassel-Calden<br />
dazu. Der Rest der Republik<br />
ist ohnehin längst mit Istanbul verbunden.<br />
Die Deutschen können sich gegen den Expansionsdrang<br />
des Partners kaum wehren.<br />
Der Luftverkehr zwischen beiden Ländern<br />
ist weitgehend liberalisiert. International<br />
wächst Turkish Airlines nicht selten gezielt<br />
dort, wo Lufthansa schrumpft. Die Frankfurter<br />
strichen Gabun und Kongo aus dem<br />
Flugplan, Turkish Airlines gibt bekannt,<br />
man plane, 13 neue Ziele in Afrika anzufliegen.<br />
Selbst Platzhirsche wie Emirates<br />
könnten den türkischen Expansionsdrang<br />
– etwa auf Afrika-Strecken – zu spüren<br />
bekommen: Turkish Airlines operiert<br />
oft noch preisaggressiver als die Golflinie.<br />
Langfristig könnte es für Lufthansa sogar<br />
noch schlimmer kommen. Schon heute<br />
haben die Angreifer aus dem Osten in<br />
Frankfurt ein eigenes Umschlagzentrum.<br />
2019 soll in Istanbul der erste Abschnitt<br />
eines neuen Mega-Airports eröffnen.<br />
Nach seiner Fertigstellung soll er von 150<br />
Millionen Passagieren im Jahr benutzt<br />
werden – und eine gigantische Frachtbasis<br />
bekommen. Zumindest ein Teil der dort<br />
umgeschlagenen Güter dürfte den Deutschen<br />
verlorengehen.<br />
DINAH DECKSTEIN, MARTIN U. MÜLLER<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3 87
Wirtschaft<br />
V e r k e h r<br />
Zug nach<br />
Nirgendwo<br />
Familien und Motorradbesitzer<br />
fahren gern mit dem Autoreisezug<br />
nach Süden. Doch weil das<br />
Angebot Verlust macht, erwägt die<br />
Bahn, den Service einzustellen.<br />
Wer sich auf einer Party als Schlafwagenschaffner<br />
zu erkennen<br />
gibt, muss damit rechnen, dass<br />
sein Gegenüber mit einem blöden Witz<br />
antwortet – oder mit einem gelangweilten<br />
Gähnen. Nicht so bei Joachim holstein.<br />
Wenn der 52-jährige Zugbegleiter von<br />
seiner Arbeit erzählt, klingt es eher nach<br />
Freiheit und Abenteuer.<br />
Früher mal musste er einen Waggon<br />
bei Minustemperaturen von innen ent -<br />
eisen, inklusive der gefrorenen Getränkeflaschen.<br />
Dann knallten eine Zeitlang<br />
reihenweise während der Fahrt Autoheckscheiben<br />
weg, wenn die Fahrzeuge zu<br />
schnell befördert wurden. Die Autozug -<br />
reisenden freilich sind ihm die liebsten<br />
Gäste, weil sie so ein „angenehmes Publikum“<br />
sind, wie er findet.<br />
Doch wie lange er dieses Publikum<br />
noch betreuen darf, ist ungewiss. Derzeit<br />
rollen Nacht für Nacht Autoreisezüge von<br />
hamburg nach Lörrach oder von Berlin<br />
nach München; wer will, kann auch nach<br />
Bozen, Alessandria, Wien oder Narbonne<br />
reisen.<br />
Weil aber das Geschäft (Bahn-Slogan:<br />
„Wir machen Strecke – Sie machen Urlaub“)<br />
seit langem rote Zahlen schreibt,<br />
will der konzernvorstand jetzt reagieren.<br />
Ab Mai nächsten Jahres starten keine<br />
Autoreisezüge mehr von Berlin – die<br />
hauptstadt ist damit komplett vom Auto -<br />
zugnetz abgekoppelt. Und längst geht es<br />
im hintergrund um die existenzfrage des<br />
gesamten Angebots. Stellt die Bahn ihr<br />
Angebot ein, würde sie einem Trend folgen:<br />
Großbritannien, Belgien, Spanien,<br />
Portugal – dort haben die konzerne den<br />
Service bereits vor vielen Jahren abgeschafft.<br />
Der Fahrer döst im Liegewagen, das<br />
Auto reist im Transportanhänger mit, so<br />
lautet das vermeintlich stressfreie und um -<br />
weltfreundliche Geschäftsprinzip. Doch<br />
wirklich Geld verdient hat die Deutsche<br />
Bahn mit ihren Autoreisezügen nie. Nun<br />
wird die Zukunftsfrage akut; die Autotransportwagen<br />
sind mittlerweile so alt,<br />
dass sie nach und nach ihre Betriebs -<br />
genehmigungen verlieren. Neue zu kaufen<br />
ist schwierig. „Die Wagen werden<br />
gar nicht mehr hergestellt, man müsste<br />
88<br />
BODO MARKS / PICTURE-ALLIANCE/ DPA<br />
eine Sonderanfertigung bestellen“, sagt<br />
ein Bahn-Manager, der anonym bleiben<br />
möchte.<br />
Doch das würde sich kaum rechnen.<br />
Auf einen euro Umsatz kommen schon<br />
heute rund 1,40 euro kosten im Auto -<br />
reiseverkehr – trotz happiger Preise von<br />
manchmal mehr als tausend euro für<br />
die Beförderung eines Autos und die<br />
Schlafplätze für eine Familie. Die Aus -<br />
lastung der Züge ist meist mager, in<br />
der hochsaison liegt sie bei knapp über<br />
Strecken der Autoreisezüge<br />
Winter 2013<br />
Hamburg<br />
Düsseldorf<br />
Neu-Isenburg<br />
Hildesheim<br />
Lörrach<br />
Narbonne<br />
Frankreich<br />
Alessandria<br />
Italien<br />
Berlin<br />
d e r s p i e g e l 4 8 / 2 0 1 3<br />
München<br />
Innsbruck<br />
Österreich<br />
Wien<br />
Österreich<br />
Bozen<br />
Italien<br />
Transportwaggon im Bahnhof Hamburg-Altona<br />
60 Prozent, in den restlichen Monaten<br />
bei rund 30 Prozent.<br />
Neun Monate im Jahr könnte man die<br />
Transportwaggons gleich ganz auf dem<br />
Abstellgleis parken. Dann rollen nach<br />
Mitternacht Geisterzüge durch Deutschland.<br />
„In den drei Sommermonaten reist<br />
die hälfte aller Autoreisezug-kunden“,<br />
sagt der Bahn-Mann.<br />
Die Fahrpreise sind saftig, entsprechend<br />
überschaubar ist die klientel. Neben<br />
Oldtimer-Besitzern, die ihr Auto<br />
schonen möchten, sind es Motorradfahrer,<br />
Senioren oder Familienväter, die keinen<br />
Stress auf der Autobahn haben wollen.<br />
Für die große Masse der reisenden sind<br />
Billigflieger oft die bessere Wahl: Meist<br />
ist es günstiger, in die Ferien zu fliegen<br />
und vor Ort einen Wagen zu mieten.<br />
Nicht nur die Autoreisezüge sind unrentabel,<br />
auch das klassische Nachtzuggeschäft<br />
macht Verlust. Auch von Qualitätsproblemen<br />
spricht der Bahn-Manager.<br />
Das rangieren mit verschiedenen Zugteilen<br />
reiße die Fahrgäste manchmal aus<br />
dem Schlaf, nicht alle Wagen seien zeitgemäß<br />
ausgestattet. Laufen ihre Genehmigungen<br />
aus, stellen sich wohl bald ähnliche<br />
Fragen wie im Autoreiseverkehr:<br />
Neuanschaffung oder einstellung? Prophylaktisch<br />
schwärmt die Bahn schon mal<br />
von ganz gewöhnlichen ICe-Zügen, die<br />
nachts durch Deutschland rollen.<br />
Für Nachtschaffner holstein wäre das<br />
ein Verlust. Mit den Zügen, so glaubt er,<br />
ginge auch ein Stück reisekomfort ver -<br />
loren: „Wer einmal nachts gut bei uns<br />
geschlafen hat und am nächsten Morgen<br />
mitten in der Stadt ankommt“, schwärmt<br />
er, „will sich nicht mehr bei einer Billigfluglinie<br />
in den Sitz pressen.“<br />
Martin U. Müller
Trends<br />
Medien<br />
T V - P H Ä N O M E N E<br />
Fernsehballett<br />
vor dem Aus<br />
Das Deutsche Fernsehballett ist eines der<br />
schillernden Überbleibsel aus DDR-Zeiten;<br />
vor allem im Osten hat seine Beliebtheit die<br />
Zeitläufte überdauert: Die Gala zum<br />
50-jährigen Bestehen, „Die große Show<br />
der langen Beine“, war 2012 eine der quotenstärksten<br />
Unterhaltungssendungen des<br />
MDR-Fernsehens. Nun jedoch steht das<br />
Ensemble vor dem Aus. Der Produzent und<br />
Künstlermanager Peter Wolf, 56, der dem<br />
Sender die Truppe vor knapp zwei Jahren<br />
abgekauft hat, will den Ballettbetrieb „spätestens<br />
zum Ende des ersten Quartals 2014“<br />
einstellen. So schrieb Wolf es am 12. November<br />
in einer E-Mail an MDR-Intendantin<br />
Karola Wille. Zusagen des Senders über<br />
das Auftragsvolumen für 2014 seien nicht<br />
eingehalten worden. Ausschlaggebend für Wolfs Entscheidung<br />
sei unter anderem, dass der Sender „Die große Show<br />
der langen Beine“ anders als gedacht nicht fortsetze sowie<br />
der „Wegfall aller prestigeträchtigen ARD- und Eurovision-<br />
Formate in den vergangenen 20 Monaten“. Dazu zählen die<br />
„José Carreras Gala“, die jetzt bei Sky läuft, und die Gala<br />
von Helene Fischer, die zum ZDF gewechselt ist. Auch bei<br />
Florian Silbereisen soll das Ballett, so Wolf, künftig seltener<br />
auftreten. Der MDR erklärte auf Anfrage, es habe keine<br />
Zusage über das Auftragsvolumen 2014 gegeben, aber dem<br />
Wolf, Fernsehballerinas<br />
Fernsehballett seien Shows im Ersten wie dem MDR ange -<br />
boten worden. „Ein Fernsehballett ohne Fern sehen macht<br />
keinen Sinn“, sagt Wolf. „Hier wird DDR-Kulturgut zu<br />
Grabe getragen.“ Die TV-Auftritte seien für einen kommerziellen<br />
Erfolg entscheidend. Nur vor diesem Hintergrund<br />
habe er das Ensemble gekauft, so Wolf, der als Manager von<br />
Harald Juhnke begann und heute unter anderem Vicky Leandros<br />
und Carmen Nebel vertritt, deren ZDF-Show er auch<br />
produziert. „Die Entscheidung fällt mir nicht leicht, aber sie<br />
ist unumstößlich.“<br />
WOLFGANG WILDE<br />
P R E S S E<br />
Kurz und falsch<br />
Am vergangenen Freitag wunderte<br />
sich Daimler-Chef Dieter Zetsche über<br />
die Arbeit der Presse, und ein wenig<br />
ärgerte er sich. Die „Süddeutsche Zeitung“,<br />
die „Welt“ und das „Handelsblatt“<br />
zitierten ihn mit dem Spruch:<br />
„Ich muss keine zehn Millionen ver -<br />
dienen, ich kann auch mit fünf gut<br />
leben.“ Was ziemlich arrogant klingt.<br />
Die „Frankfurter Allgemeine“ fügte<br />
noch an, Zetsche habe zudem gesagt,<br />
er könne auch mit einer Million gut<br />
leben. Das klingt nicht viel besser. Tatsächlich<br />
hatte er auf einer Veranstaltung<br />
gesagt: „Ich muss nicht zehn Millionen<br />
verdienen, es reichen auch fünf,<br />
es reicht auch eine Million oder auch<br />
nichts.“ Es komme darauf an, wie die<br />
Eigentümer dies einschätzten. Locker<br />
wollte Zetsche sein, sympathisch<br />
wirken, und vergaß, dass Journalisten<br />
gern mal kürzen. Selbst wenn am<br />
Ende das Gegenteil dasteht.<br />
HERBY SACHS / WDR<br />
A R D<br />
Mehr Fußball<br />
Als die ARD vor einem Monat ihre<br />
Transparenzoffensive startete, gab sie<br />
sich auch ganz offen, was die ausufernde<br />
Fußballberichterstattung angeht.<br />
Zu den kritischen Fragen, denen sie<br />
„Sportschau live“ mit Gerhard Delling und Mehmet Scholl<br />
sich im Internet stellt, gehört auch diese:<br />
„Berichtet die ARD überwiegend<br />
über Fußball?“ Zur Antwort wird auf<br />
der Senderseite jedoch bloß der Anteil<br />
des Fußballs an der Live-Sportberichterstattung<br />
ausgewiesen. Im Jahr 2012<br />
waren das 97 von 444 Stunden, also<br />
knapp 22 Prozent. In dieser Statistik<br />
fehlt dann allerdings Fußballbericht -<br />
erstattung, die nicht live ist. Etwa<br />
Dutzende Stunden der nicht<br />
ganz billigen „Sportschau“.<br />
Was die ARD erst auf<br />
Nachfrage verrät: Wird die<br />
Sendung einberechnet,<br />
klettert der Anteil für 2012<br />
auf 27 Prozent. Dass man<br />
den Fußballanteil in der<br />
eigenen Statistik bewusst<br />
kleingerechnet habe, verneint<br />
jedoch der Sport -<br />
koordinator der ARD, Axel<br />
Balkausky. „Hintergrund<br />
ist, dass uns diese Frage<br />
nach dem Anteil des Fußballs<br />
an unseren Live-<br />
Sportüber tragungen oft gestellt<br />
wird.“<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3 89
P R O M I N E N T E<br />
Harald und der<br />
Herr Glööckler<br />
Im Juli machte „Bild“ einen angeblichen „Kokain-Skandal“ um den<br />
Modemacher Glööckler zum Aufmacher. Jetzt hat Glööckler das<br />
Blatt auf 500000 Euro Schmerzensgeld verklagt. Von Jürgen Dahlkamp
ARCHIV ZAURITZ<br />
Dies ist eine Geschichte über die gefährlichste<br />
Straße der Republik.<br />
Den Boulevard. Die Gesetze dieser<br />
Straße macht in Deutschland eine Zeitung.<br />
Sie entscheidet, wer über den Boulevard<br />
flanieren darf. Stolzieren darf.<br />
Und wer auf dem Boulevard stürzt.<br />
Es ist die Geschichte einer Schlagzeile.<br />
„Harald Glööckler Kokain-Skandal!“, erschienen<br />
am 1. Juli auf der Titelseite der<br />
„Bild“. Und über das Leben nach so einer<br />
Schlagzeile.<br />
Aber weil Harald Glööckler eine ziemlich<br />
komplizierte Person ist, geht es auch<br />
um zwei Charaktere, um ihren dauernden<br />
Streit: zwischen dem Harald und<br />
dem Herrn Glööckler. Und ob sich der<br />
„Harald“ endlich mal gegen den „Herrn<br />
Glööckler“ durchsetzt.<br />
Herr Glööckler, das ist der Berliner Modemacher<br />
mit dem selbstkreierten Doppel-Ö.<br />
Der mit den tätowierten Augenbrauen<br />
im Puppengesicht. Mit dem Bart,<br />
der so aussieht, als hätte er sich den mit<br />
schwarzem Edding angemalt. Wenn Harald<br />
Glööckler von „Herrn Glööckler“<br />
spricht, dann meint er den Mann mit dem<br />
Aufmerksamkeitsmangel-Syndrom im<br />
Vollstadium. Den Paradiesvogel, der alles<br />
tut, um aufzufallen, zur Marke zu werden,<br />
sich zu inszenieren: „Herr Glööckler profitiert<br />
von der Presse und die Presse von<br />
ihm“, sagt Harald Glööckler. Denn Herr<br />
Glööckler ist „Businessman“. Und wenn<br />
der Herr Glööckler das allein entscheiden<br />
könnte, professionell, pragmatisch, wie<br />
der Herr Glööckler halt so ist, dann würde<br />
er es jetzt gut sein lassen mit seiner<br />
Klage gegen die „Bild“. Sie ist ja heute<br />
wieder lieb zu ihm.<br />
Aber da gibt es eben auch noch den<br />
„Harald“. Der am liebsten seine Ruhe hätte,<br />
wenn er durch die Stadt geht, keine<br />
Autogramme, keine Fotos, der den ganzen<br />
Zirkus nur mitmacht, weil es der Herr<br />
Glööckler von ihm erwartet. Der Harald,<br />
der am Abend nur noch mit seinem Hund<br />
vorm Fernseher sitzen will und von<br />
diesem Herrn Glööckler am Tag die<br />
Schnauze voll hat. Der Harald findet das,<br />
was die „Bild“ mit ihm gemacht hat, „einfach<br />
unglaublich, unfassbar“. Und er will,<br />
dass die Zeitung so etwas nicht noch einmal<br />
macht. Nicht nur mit ihm nicht. Mit<br />
keinem.<br />
Der Harald hat sie deshalb eingereicht:<br />
die Klage beim Kölner Landgericht, über<br />
500000 Euro Schmerzensgeld. Eine der<br />
größten Summen, die je ein Promi von<br />
der „Bild“ für ihre Berichterstattung haben<br />
wollte.<br />
Dem Harald ist dabei völlig egal, was<br />
mit dem Geld passiert, er will es gar nicht<br />
haben, er hat der „Bild“ vorgeschlagen,<br />
es doch zu spenden, ans Deutsche Kinderhilfswerk.<br />
Aber zahlen, das soll sie,<br />
eine Summe, die richtig weh tut. Sogar<br />
so einem großen Verlagshaus wie Springer.<br />
Und noch vergangene Woche wollte<br />
Medien<br />
der Harald den Herrn Glööckler dazu<br />
zwingen, dass sie beide die Sache wirklich<br />
durchziehen.<br />
◆<br />
Bevor Harald Glöckler Harald Glööckler<br />
wurde, hatte er einen Jeansladen in Stuttgart.<br />
Dann begann er, Rüschen an Hemden<br />
zu nähen, Leopardenfell an Jacken,<br />
vor allem: Perlen, Pailletten, Prunk und<br />
Protz auf T-Shirts. Alles barock, bombastisch,<br />
pompös mit zwei Ö. So hieß dann<br />
auch seine Marke, verziert mit einem<br />
Krönchen. In der Haute-Couture-Szene<br />
gilt der Mann aus Maulbronn bis heute<br />
als Parvenü ohne Stil und ernstzu -<br />
nehmenden Style. Am allerverstörendsten<br />
dürfte für die Avantgarde aber sein,<br />
dass Glööckler mit Mode viel Geld verdienen<br />
will – und mon dieu! – das auch<br />
noch tut.<br />
Glööckler vergibt Lizenzen an Firmen<br />
wie Bonprix, Lidl, Bijou Brigitte, die mit<br />
„Bild“-Aufmacher vom 1. Juli 2013<br />
„Persönliches Verfolgungsinteresse“<br />
ihm, dem schrillen, schwulen Modeschöpfer,<br />
alles Mögliche und Unmögliche verkaufen:<br />
Parfums, Porzellan, Schmuck, Bilder,<br />
Gartenmöbel, sogar eine Harley im<br />
Glööckler-Glitzer-Glanz und ein Einfamilienhaus<br />
für Menschen, die in ihrem Leben<br />
sonst keine Krönung mehr zu erwarten<br />
haben. Sein Hauptgeschäft aber sind<br />
Frauen, die nachmittags vor dem Fern -<br />
seher sitzen und QVC gucken, den Verkaufssender.<br />
Denen bietet er seine Modelle<br />
bis Konfektionsgröße 52 an und betört<br />
sie mit seinen Bling-Bling-Teilen und<br />
dem Versprechen, aus jeder Hausfrau<br />
eine Prinzessin zu machen. Meist zu Preisen<br />
unter 100 Euro, bei denen die Cents<br />
hinter dem Komma ganz billig „Nimm<br />
mich“ schreien.<br />
Die „Bild“ und der Herr Glööckler waren<br />
damit eigentlich füreinander geschaffen:<br />
beide greller als die Wirklichkeit, im<br />
besten Fall gute Unterhaltung, im schlechtesten<br />
geschmacklos, schwer auszuhalten.<br />
Glööckler hat deshalb auch den Reportern<br />
von „Bild“ gern alles gezeigt: Er ließ<br />
sie in sein 1400-Quadratmeter-Penthouse<br />
an der Berliner Prachtstraße Unter den<br />
QVC<br />
Linden, wo er mit seinem Lebensgefährten<br />
Dieter Schroth lebt und arbeitet („Harald<br />
im Glööck“). Er „beichtet“ dem Blatt<br />
„sein OP-Geheimnis“ („Alle drei Monate<br />
spritzt er Botox. Jüngster Umbau: eine<br />
Komplett-Fettabsaugung“). Er zieht sich<br />
aus („Der ‚Prince of Fashion‘ nackt.“)<br />
Aber er behauptet trotzdem: „Ich war<br />
nie ein ,Bild‘-Kind, ein Promi-Geschöpf<br />
der ‚Bild‘-Zeitung. Ich habe nie da angerufen<br />
und gesagt: Ich springe heute nackt<br />
durch den Garten, macht ein Foto.“<br />
Ja, er hat immer wieder mitgemacht,<br />
es hat seiner Eitelkeit geschmeichelt, seinem<br />
Geschäft genutzt, aber er legt Wert<br />
darauf, dass er es auch ohne „Bild“ schon<br />
geschafft hatte. Und manchmal habe er<br />
auch einfach abgesagt, wenn die Reporter<br />
der Zeitung sich etwas mit ihm hätten<br />
einfallen lassen. Oder einen Satz von ihm<br />
wollten. „Ich hatte immer ein offenes Verhältnis<br />
zur ‚Bild‘.“ Kein schlechtes, kein<br />
sklavisches, eines, das er für gut genug<br />
hielt, sich wegen „Bild“ keine Sorgen machen<br />
zu müssen. Noch ein halbes Jahr<br />
vor der Kokain-Schlagzeile hatte ihn die<br />
Redaktion zur Blattkritik eingeladen; er<br />
saß neben „Bild“-Vize Alfred Draxler, er<br />
hatte das Gefühl: „Das kam gut an.“<br />
◆<br />
Am 27. Mai dieses Jahres liegt bei der<br />
Berliner Staatsanwaltschaft ein Brief in<br />
der Post, für Martin Steltner, den Pressesprecher.<br />
Er ist eineinviertel Seiten lang,<br />
auf den 24. Mai datiert und nicht unterschrieben.<br />
„Wichtiger Hinweis zu Harald<br />
Glööckler, 47 Jahre, geboren 30. Mai 1965<br />
in Maulbronn-Zaisersweiher Bekannter<br />
Deutscher Modedesigner“ steht oben,<br />
und „Promi aus Fernsehen (RTL, RTL2,<br />
VOX, u.s.w.“. Damit kann sich der<br />
Anonymus eigentlich sicher sein, dass<br />
sein Brief die gewünschte Aufmerk -<br />
samkeit bekommt. Trotzdem hat er ihn<br />
noch viermal verschickt: an die Pressestelle<br />
des Zollfahndungsamts Berlin-<br />
Brandenburg, an die Pressestelle des Berliner<br />
Polizeipräsidenten, an die Polizeiwache<br />
Abschnitt 32 in Berlin-Mitte, an<br />
das Rauschgiftdezernat des Landeskri -<br />
minalamts.<br />
Der Hinweisgeber schreibt, wie er<br />
spricht: „Kann Ihnen was sehr wichtiges<br />
mitteilen“, beginnt er, und dann: „Harald<br />
Glööckler ist Kokain abhängig er geht jeden<br />
morgen für ca. 30 min in sein schlafzimmer<br />
… Harald Glööckler zieht dann<br />
in ruhe jeden morgen sein Kokain bevor<br />
er sein Zimmer verlässt und den tag beginnt<br />
meist gleich mit rumschreien und<br />
Befehle geben an seine Mitarbeiter. ER<br />
hat das Kokain in seinem Spiegelschrank<br />
hinter der Glasschiebetür.“<br />
Das sind, keine Frage, konkrete Hinweise,<br />
denen eine Ermittlungsbehörde<br />
nachgehen sollte. Erst recht, weil der<br />
Anonymus angeblich noch viel mehr<br />
weiß: Glööcklers Bodyguard, der auch<br />
d e r s p i e g e l 4 8 / 2 0 1 3 91
92<br />
„Bild“-Text über Glööckler-Redaktionsbesuch<br />
„Das kam gut an“<br />
Lebensgefährten Schroth, Glööckler<br />
Angst, dass alles kaputtgeht<br />
als Türsteher in einem Berliner Club arbeite,<br />
besorge den Stoff, er „hat schon<br />
mehrere Anzeigen wegen Drogendelikten<br />
(Kokain)“. Das Koks hole er aus einem<br />
griechischen Restaurant im Berliner<br />
Osten, wo seine „Langjährige Freundinn“<br />
arbeite. „Aber jetzt kommt es“, kündigte<br />
der Anonymus seinen Clou an: „Der Besitzer<br />
des Restaurants heißt mit spitznamen<br />
MALAKA. Er wurde geschnappt mit<br />
4,6 Kilo Drogen und einer Machete griffbereit<br />
links neben ihm liegend in dem<br />
Pkw seines Bruders auf einem Rastplatz<br />
in Bayreuth in München (Bayern) geschnappt.“<br />
Und am Ende: „Das ist bestimmt<br />
ein sehr wichtiger, interessanter<br />
Hinweis für Sie womit ich Ihnen heute<br />
hoffentlich sehr helfen konnte. Mit<br />
Freundlichen Grüßen“.<br />
Interessant schon, aber der Schreiber<br />
hat offenbar nicht nur Probleme mit der<br />
Sprache, sondern auch mit den Fakten.<br />
Am 25. Juni fasst die Berliner Kripo das<br />
damalige Ergebnis ihrer Überprüfungen<br />
in einem 13-Seiten-Vermerk zusammen:<br />
Der Bodyguard arbeitete demnach schon<br />
seit neun Monaten nicht mehr in dem<br />
Club als Türsteher. Gegen ihn sei bisher<br />
auch nicht wegen Rauschgiftvergehen ermittelt<br />
worden. Im Gegenteil, er habe<br />
selbst 25 Anzeigen erstattet. „Hier verhält<br />
es sich vielmehr so, dass der Beschuldigte<br />
zur Aufhellung von Betäubungs -<br />
mittel delikten beitrug“, heißt es in dem<br />
Bericht.<br />
Die „Freundinn“ des Bodyguards ist in<br />
Wahrheit seit 2007 seine Frau; ob sie in<br />
dem Griechenlokal je gearbeitet hat,<br />
konnte die Kripo nicht feststellen. Der<br />
Rauschgift-Mann „Malaka“ war nicht der<br />
Besitzer des Restaurants, sondern dessen<br />
Bruder, der Koch, und erwischt wurde<br />
der nicht mit 4,6 Kilogramm Amphetaminen,<br />
sondern mit 668 Gramm. „Malaka“<br />
sei übrigens auch nicht sein Ganovenname<br />
gewesen, „Malaka“ sei nur die übliche<br />
Anrede für alles und jeden in einer gewissen<br />
Szene. So wie „Motherfucker“ im<br />
Englischen.<br />
Das alles sprach bestenfalls für eine<br />
Story vom Hörensagen, schlimmstenfalls<br />
für eine Geschichte, die sich der Anonymus<br />
zusammengebraut hatte, um Glööckler<br />
fertigzumachen. Im Kripo-Vermerk<br />
heißt es: „Betrachtet man die gemachten<br />
Angaben insgesamt, so gibt es stimmige<br />
Passagen – im Detail sind seine Angaben<br />
jedoch ungenau und teilweise falsch.“ Ob<br />
richtig sei, was er über den angeblichen<br />
Kokainkonsum von Glööckler berichte,<br />
sei „daher fragwürdig“. Und weil der<br />
Anonymus gleich fünf Dienststellen angeschrieben<br />
hatte, bei drei von ihnen die<br />
Pressestelle, kommt die Kripo eher auf<br />
andere Ideen: „Aus dieser Vehemenz<br />
lässt sich ein persönliches Verfolgungs -<br />
interesse des Anonymus schlussfolgern.<br />
Es ist daher nicht auszuschließen, dass es<br />
sich bei der Anzeige um eine reine Verleumdung<br />
handelt“, für die „die Strafverfolgungsbehörden<br />
instrumentalisiert werden<br />
sollen.“<br />
Die Polizei dachte noch über eine Razzia<br />
nach, um im Spiegelschrank nach Kokain<br />
zu suchen. Jenem Spiegelschrank,<br />
von dem Glööckler heute sagt, dass es<br />
den im Schlafzimmer gar nicht gebe –<br />
und auch nie gegeben habe.<br />
d e r s p i e g e l 4 8 / 2 0 1 3<br />
PRAWETZ / BILD ZEITUNG<br />
RONNY HARTMANN / GETTY IMAGES<br />
Aber ob ein Gericht so eine Durchsuchung<br />
genehmigt hätte? Bei dieser Beweislage?<br />
Mit dem Kripo-Vermerk vom<br />
25. Juni war die Kokain-Spur nur noch<br />
kläglich. Und sie blieb es auch. Dennoch<br />
kam die „Bild“ sechs Tage später mit ihrer<br />
Schlagzeile: „Harald Glööckler Kokain-Skandal“.<br />
Eine Schlagzeile, für die<br />
kein polizeiliches Ermittlungsergebnis<br />
sprach, wohl aber ein öffentliches Vorurteil:<br />
dass sich jeder, der Glööckler vor Augen<br />
hatte, genau so etwas vorstellen konnte.<br />
Wenn der nicht kokst, wer dann? Modebranche,<br />
Kunstfigur, Hyperventilierer.<br />
Klischee trifft Schlagzeile.<br />
◆<br />
Der 30. Juni ist ein Sonntag, Dieter<br />
Schroth sitzt vor dem Fernseher und<br />
guckt Fußball auf Sky. Was nun folgt,<br />
geht in der Version von Schroth so: Das<br />
Telefon läutet. Unterdrückte Rufnummer.<br />
Schroth lässt es klingeln, er will das Spiel<br />
sehen. Dann wieder, das Telefon. Jetzt<br />
nimmt Schroth ab. Die „Bild“: „Ist Herr<br />
Glööckler zu sprechen?“ Ist er nicht,<br />
Glööckler schwitzt im Fitnessstudio ein<br />
paar Straßen weiter. Der „Bild“-Mann<br />
fragt nach einer Mail-Adresse. Schroth<br />
sagt, er solle sich an ihr Pressebüro wenden,<br />
die würden sich um so etwas kümmern.<br />
Aber dann will er doch wissen,<br />
wor um es hier eigentlich geht.<br />
Der Anrufer spricht angeblich von einer<br />
Liste mit Berliner Promis, über die<br />
„Bild“ ein paar Tage vorher berichtet hatte.<br />
Promis, die sich mit Koks beliefern<br />
ließen. In dem Umfeld sei auch der Name<br />
Glööckler aufgetaucht, sagt der Anrufer<br />
Schroth zufolge. Ein Koks-Verdacht. Dass<br />
Glööckler gar nicht auf dieser Liste steht,<br />
sagt der Anrufer angeblich nicht.<br />
Schroth erinnert sich, wie perplex er<br />
gewesen sei: „Sie, das kann gar nicht sein,<br />
wir arbeiten seit 26 Jahren zusammen,<br />
wir haben nicht mal eine Zigarette zusammen<br />
geraucht.“ Und jetzt Koks? Unvorstellbar.<br />
Schroth ruft bei Glööcklers Medien -<br />
anwalt an. Christian-Oliver Moser hat<br />
mit solchen Krisenfällen Erfahrung, er<br />
vertritt zum Beispiel David Groenewold,<br />
den Filmproduzenten, der als Freund von<br />
Christian Wulff in die Bestechungsaffäre<br />
des Ex-Präsidenten verwickelt ist. Moser<br />
ist weit weg, er macht gerade Urlaub auf<br />
Mallorca, aber er beruhigt: Glööckler<br />
nicht zu erreichen? Noch kein Anruf<br />
beim PR-Büro? Er ist sicher: Am nächsten<br />
Tag kann da noch nichts kommen.<br />
Unvorstellbar.<br />
Abends schaut Dieter Schroth auf sein<br />
iPad, in die „Bild“-App. „Komm mal,<br />
komm mal“, ruft er zu Glööckler, der<br />
vom Sport zurück ist. Und da steht er<br />
dann doch schon, der „Kokain-Skandal“<br />
um Glööckler. Unvorstellbar.<br />
Am folgenden Morgen berichtet auch<br />
die gedruckte „Bild“ über das noch lau-
fende Ermittlungsverfahren: „Wieder ein<br />
Drogen-Skandal in der Hauptstadt!“<br />
Stand das schon fest? Ein Zeuge habe<br />
„detailliert gesagt, wann und wo der Modedesigner<br />
das Kokain gekauft haben<br />
soll“. Ein Zeuge? Gesagt? Ein anonymer<br />
Schreiber hatte einen Brief verschickt.<br />
„Es geht um den Verdacht von Drogenbesitz<br />
– möglicherweise sogar Drogenhandel!“<br />
Glööckler ein Dealer? Davon<br />
stand in dem Brief kein Wort. Und: „Der<br />
Verdacht: Bei den Lieferungen soll es um<br />
mehr als zehn Gramm Kokain gegangen<br />
sein.“ In einem Polizeivermerk vom selben<br />
Tag heißt es verwundert: „Woher die<br />
Informationen der ‚Bild‘-Zeitung stammen,<br />
ist unbekannt. Die darin beschriebenen<br />
Angaben über die Menge … sind<br />
in dem anonymen Anzeigenschreiben<br />
nicht enthalten.“<br />
In dieser Nacht zum Montag, in der die<br />
Kokain-Schlagzeile gedruckt wird, liegen<br />
Glööckler und Schroth wach. Schroth<br />
sagt, er habe gedacht, er sterbe. Die Aufregung.<br />
Das Herz. „Ich hatte Angst, alles,<br />
was wir in 26 Jahren aufgebaut haben,<br />
geht in dieser einen Nacht durch eine<br />
Lüge kaputt, und wir stehen wieder bei<br />
null.“ Glööckler ist ruhiger. „Ich hatte<br />
schon bei einer meiner Wahrsagerinnen<br />
angerufen“; sie soll ihm prophezeit haben,<br />
dass er das durchstehen werde. Aber<br />
auch er denkt an die Lizenznehmer:<br />
wenn die nun alle Verträge kündigen?<br />
Schon am frühen Morgen geben sie<br />
eine Erklärung heraus: „Das ist glatter<br />
Rufmord. Ich hatte nie etwas mit Kokain<br />
zu tun.“ Sie laden für 13 Uhr zu einer<br />
Pressekonferenz ein, in ihr Penthouse.<br />
Und sie beginnen, ihre Kunden abzutelefonieren:<br />
alles Unsinn, alles falsch, glauben<br />
Sie uns bitte. Die Kunden sagen, sie<br />
warten ab. Erst mal. Ein Discounter aber<br />
beendet am selben Tag den Schmuckverkauf<br />
– angeblich, weil das schon länger<br />
so geplant war. Ein anderer Partner, der<br />
versprochen hatte, die Ruhe zu bewahren,<br />
wird kurz darauf den Vertrag kündigen.<br />
Gegen 13 Uhr steht Glööckler im weißen<br />
Anzug vor einer Traube von Jour -<br />
nalisten, er sagt: „Ich habe in meinem<br />
Leben weder Koks berührt, Kokain konsumiert,<br />
Kokain gekauft oder Kokain verkauft.“<br />
Ende der Durchsage, Abgang. Am<br />
nächsten Tag steht der Satz auch in der<br />
„Bild“, die sich aber zunächst mal Gedanken<br />
über seinen Anzug macht: „Weiß wie<br />
die Unschuld. Und wie Kokain.“ Eine Zeile<br />
zum Hinschmelzen, eine Zeile zum<br />
Hinrichten. Und dann fragt „Bild“ noch,<br />
ob Glööckler jetzt einen Haartest macht.<br />
Haartest? Da war doch mal was. Richtig,<br />
Daum, der Fußballtrainer. Der hatte dann<br />
doch gekokst.<br />
Zwei Wochen später erlässt das Landgericht<br />
Köln eine einstweilige Verfügung<br />
gegen die „Bild“-Berichte. Und Ende Juli<br />
stellt dann die Staatsanwaltschaft Berlin<br />
ihr dümpelndes Verfahren ein, wegen<br />
94<br />
Medien<br />
EVENTPRESS RADKE<br />
d e r s p i e g e l 4 8 / 2 0 1 3<br />
„Bild“-Artikel zum Ende der Ermittlungen<br />
„Staatsanwaltschaft sicher: Alles falsch“<br />
mangelnden Tatverdachts. Eine Einstellung<br />
erster Klasse für Glööckler und seinen<br />
Bodyguard. „Bild“ titelt danach: „Harald<br />
Glööckler Staatsanwalt fegt Koks-<br />
Verdacht vom Tisch“. Und: „Jetzt – nach<br />
monatelangen Ermittlungen – ist die<br />
Staatsanwaltschaft sicher: Alles falsch“.<br />
Immerhin, die „Bild“ tut das oben auf<br />
Seite 1. Später muss sie noch eine Gegendarstellung<br />
im Innenteil veröffentlichen.<br />
Die druckt sie schon nur noch unten auf<br />
die Seite. Und mehr tut sie auch nicht.<br />
Eine Entschuldigung bei Glööckler?<br />
Blieb aus. Die Springer-Rechtsabteilung<br />
schickte ein knappes Schreiben an<br />
Glööcklers Anwalt Moser: „Die in Rede<br />
stehende Berichterstattung … ist wahr<br />
und beachtet die Vorgaben der Verdachtsberichterstattung.“<br />
Moser sieht das anders – und beruft<br />
sich dabei auf den Bundesgerichtshof:<br />
Der BGH hat im Grundsatz immer wieder<br />
entschieden, dass ein „Mindestbestand<br />
an Beweistatsachen“ vorliegen<br />
muss, bevor die Presse einen Menschen<br />
mit einem Tatverdacht an die Öffentlichkeit<br />
zerrt, identifizierbar. So ein Mindestbestand,<br />
der den Vorwurf untermauert,<br />
kann etwa eine Festnahme sein. Eine Razzia.<br />
Eine Anklage. Ein Ermittlungsschritt,<br />
aus dem Journalisten zu Recht ableiten<br />
können, dass die Staatsanwaltschaft davon<br />
ausgeht, an dem Verdacht könnte<br />
einiges dran sein.<br />
Aber ein anonymer Hinweis, der oft<br />
schon deshalb ein Ermittlungsverfahren<br />
auslöst, weil sich die Strafverfolger später<br />
nicht nachsagen lassen wollen, sie hätten<br />
etwas verschlafen? Sehr kritisch. Und davon<br />
abgesehen: Bevor der Artikel erscheint,<br />
muss der Betroffene die Gelegenheit<br />
haben, zu den Vorwürfen Stellung<br />
zu nehmen. Der Betroffene. Nicht der<br />
verdutzte Lebensgefährte.<br />
Die „Bild“ wollte zu Fragen des SPIE-<br />
GEL nicht im Einzelnen Stellung nehmen.<br />
Weil es den laufenden Rechtsstreit<br />
gebe, aber auch, weil sich viele der Fragen<br />
auf Redaktionsinterna bezögen, über
die man grundsätzlich keine Auskunft<br />
gebe. Außerdem müsse man seine Quellen<br />
schützen. Den Anonymus etwa? Keine<br />
Antwort. Ermittler? „Unsere Verdachtsberichterstattung<br />
basierte nicht<br />
nur auf einer anonymen Anzeige. Selbstverständlich<br />
waren uns weitere Einzelheiten<br />
des Ermittlungsverfahrens bekannt.“<br />
Welche? Keine Antwort. Genug<br />
für den Mindestbestand an Beweistatsachen?<br />
Die Ermittlungsakte der Staatsanwaltschaft<br />
jedenfalls gibt außer dem anonymen<br />
Schreiben nichts Belastendes her.<br />
◆<br />
Für Februar hat das Kölner Landgericht<br />
einen Termin für die Schadensersatzklage<br />
angesetzt. Moser, der Medienanwalt, sagt,<br />
dass so ein Journalismus nur aufhört,<br />
wenn es wirklich weh tut. 10 000 oder<br />
20000 Euro Schmerzensgeld, solche Summen,<br />
wie sie in Deutschland üblich sind,<br />
seien doch auf der anderen Seite gleich<br />
eingepreist. Auflagensteigerung minus<br />
Prozesskosten gleich Gewinn. Deshalb<br />
jetzt die Klage, eine halbe Million Euro.<br />
Diese Klage, die aber der Herr Glööckler<br />
eigentlich am liebsten schon wieder vergessen<br />
würde.<br />
Harald Glööckler hat ein Büchlein geschrieben<br />
über den „Medien-Skandal“,<br />
aus selbsttherapeutischen Gründen, auch<br />
wenn es kaum einer von denen gelesen<br />
hat, die die Schlagzeile in der „Bild“ gelesen<br />
haben. Die „Bild“-Auflage liegt bei<br />
2,5 Millionen, die verkaufte Buchauflage<br />
unter 10000. Jetzt muss er entscheiden:<br />
vielleicht noch jahrelang prozessieren?<br />
Kämpfen, für das Prinzip, für alle Glööck -<br />
lers, die noch kommen werden, für die<br />
Idee, dass eine Zeitung so nicht mit Menschen<br />
umgehen sollte? Herr Glööckler<br />
sagt: „Ich bin Profi, ich will nach vorn<br />
schauen, und ich will Energie nicht in<br />
schlechte Dinge investieren.“<br />
Die meisten Lizenznehmer sind geblieben,<br />
neue gekommen, die Verkäufe auf<br />
QVC haben nicht gelitten, es sieht so aus,<br />
als sei kaum etwas hängengeblieben. Am<br />
Geschäft. Herr Glööckler würde den Fall<br />
gern abhaken. Herr Glööckler sagt sogar:<br />
„Ich habe unverändert nichts gegen die<br />
‚Bild‘-Zeitung.“ Ach, dieser Herr<br />
Glööckler.<br />
Aber da ist noch der Harald, und der<br />
Harald kämpft. Denn am Harald ist mehr<br />
hängengeblieben, als der „Herr Glööckler“<br />
ihm ausreden kann. „Natürlich hat<br />
die Person Harald einen Schlag auf die<br />
Seele abbekommen“, sagt Harald Glööckler,<br />
„der Harald ist entsetzt und tief geschockt.“<br />
Der Harald hat sogar eine<br />
Nacht daran gedacht, alles zu verkaufen,<br />
wegzulaufen, ins Ausland, für immer.<br />
Jetzt muss sich herausstellen, ob er auch<br />
das andere kann: stehenbleiben. Doch so,<br />
wie Harald Glööckler sich kennt, wird<br />
am Ende wohl der Herr Glööckler wieder<br />
gegen den Harald gewinnen. ◆<br />
d e r s p i e g e l 4 8 / 2 0 1 3 95
Panorama<br />
Sandiford<br />
96<br />
I N D O N E S I E N<br />
Drei Kugeln für<br />
Großmutter<br />
Gerade acht Tage ist es her, dass der<br />
Pakistaner Mohammed Abdul Hafeez<br />
von der National Police Mobile Brigade<br />
aus seiner Zelle im Gefängnis von Tangerang,<br />
westlich von Jakarta, geholt<br />
wurde. Man habe Hafeez dann, so Beobachter,<br />
kurz nach Mitternacht zum<br />
Exekutionsort unweit des Friedhofs gebracht.<br />
Dem Delinquenten wurde eine<br />
Zielscheibe angeheftet, er hatte die<br />
Wahl, im Sitzen oder Stehen zu sterben,<br />
dann krachten Schüsse, wobei nur<br />
drei der Gewehre bei den Hinrichtungen<br />
scharf geladen sind – um die<br />
Schützen im Unklaren zu lassen, wer<br />
die tödlichen Kugeln abfeuerte. Hafeez<br />
war wegen Drogenschmuggels verurteilt<br />
worden, die Exekution war die<br />
fünfte in diesem Jahr. Vier Jahre lang<br />
hatte Jakarta nicht vollstreckt. Doch<br />
im März dieses Jahres wurden die Hinrichtungen<br />
wiederaufgenommen. Mit<br />
dieser neuen Politik würden wohl auch<br />
die Chancen für eine sehr prominente<br />
Verurteilte auf der „Death Row“, dem<br />
Todestrakt, sinken: die 57-jährige Britin<br />
Lindsay Sandiford, ebenfalls eine<br />
Drogenschmugglerin und außerdem<br />
Großmutter. Zollbeamte hatten in ihrem<br />
Koffer knapp fünf Kilogramm Kokain<br />
gefunden. Sandiford sagte, Dealer<br />
hätten ihre Kinder bedroht und sie<br />
gezwungen, die Drogen zu transportieren.<br />
Obwohl die Staatsanwaltschaft<br />
nur 15 Jahre Haft gefordert hatte, verurteilte<br />
sie ein Gericht im Januar zum<br />
Tode – was vor allem in England für<br />
Empörung sorgte. Sandiford kann jetzt<br />
noch auf einen Gnadenerlass des Präsidenten<br />
Susilo Bambang Yudhoyono<br />
hoffen. Menschenrechtler aber sagen,<br />
dass der bislang etwa fünf von sechs<br />
Gnadenersuchen abgelehnt habe.<br />
GETTY IMAGES<br />
E U R O PA<br />
Neuer Job für Barroso?<br />
José Manuel Barroso, 57, bis zum<br />
Herbst 2014 Chef der EU-Kommission,<br />
sieht sich wohl noch nicht am Ende<br />
seiner Karriere. Offenbar hätte der<br />
Portugiese gern einen anderen Brüsseler<br />
Spitzenposten. Nach <strong>SPIEGEL</strong>-Informationen<br />
kann sich Barroso vor -<br />
stellen, von der Zentrale der EU-Kommission<br />
auf der nördlichen Seite der<br />
Brüsseler Rue de la Loi ins Gebäude<br />
des Europäischen Rats auf der Süd -<br />
seite zu wechseln und dort Präsident<br />
des Europäischen Rats zu werden, der<br />
Versammlung der 28 Staats- und Regierungschefs.<br />
Diplomaten berichten,<br />
Barroso sondiere derzeit bei den Mitgliedstaaten,<br />
ob er Chancen hätte, den<br />
jetzigen Ratspräsidenten Herman Van<br />
REUTERS<br />
d e r s p i e g e l 4 8 / 2 0 1 3<br />
Rompuy zu beerben. Der Posten wird<br />
Ende 2014 frei, weil Van Rompuy nach<br />
zwei Amtszeiten ausscheiden muss.<br />
Da vieles dafür spricht, dass ein Sozialdemokrat<br />
– der Deutsche Martin<br />
Schulz – nächster Präsident der EU-<br />
Kommission wird, könnte das Amt des<br />
Ratspräsidenten aus Proporzgründen<br />
der konservativen Europäischen Volkspartei<br />
zufallen. Allerdings ist Barroso<br />
nicht der einzige Christdemokrat,<br />
der den Job gern hätte: Auch der luxemburgische<br />
Premierminister Jean-<br />
Claude Juncker würde wohl nicht<br />
ablehnen, sollte er gefragt werden. Bekommt<br />
Barroso den Posten des Ratspräsidenten<br />
nicht, könnte er sich auch<br />
vorstellen, Generalsekretär der Nato<br />
zu werden. Barrosos Sprecherin dementierte<br />
die Ambitionen ihres Chefs<br />
nicht: Barroso habe noch „keine Entscheidungen<br />
über seine Zukunft getroffen“.<br />
KOMMENTAR<br />
Fliegender Holländer<br />
Chemiewaffen-Inspekteure in Syrien<br />
Von Christoph Reuter<br />
Es sollte eine Erfolgsgeschichte werden:<br />
die zwischen den USA, Russland<br />
und dem Regime in Damaskus verhandelte<br />
Vernichtung der syrischen<br />
Chemiewaffen – auch, um alle übrige<br />
Erfolglosigkeit in diesem Krieg überdecken<br />
zu können. Diktator Baschar<br />
al-Assad stieg auf einmal vom Geächteten<br />
zum Verhandlungspartner auf.<br />
Und die zuständige Organisation für<br />
das Verbot chemischer Waffen,<br />
OPCW, erhielt schon vorab den Friedensnobelpreis.<br />
Jetzt aber droht das<br />
Chemiewaffen-Abkommen zu einem<br />
Schritt ins Nirgendwo zu werden.<br />
Zwar beschloss der OPCW-Exekutivrat,<br />
dass Syriens Regime bis zum<br />
5. Februar 2014 seine gesamten Chemiewaffen-Bestände<br />
außer Landes gebracht<br />
haben soll. Bis Ende Juni 2014<br />
sollen sie zerstört werden. Die<br />
OPCW holte sogar Ruheständler zurück,<br />
um zu bewältigen, was sie noch<br />
nie getan hat: Kampfgifte mitten in<br />
einem Bürgerkrieg einzusammeln<br />
und wegzuschaffen. Die absurde Folge:<br />
Ausgerechnet jenen Soldaten, die<br />
die Chemiewaffen zuvor einsetzten,<br />
bringen nun die OPCW-Experten das<br />
fachgerechte Verpacken, Versiegeln<br />
und Bewachen bei. Aber weder die<br />
USA noch Russland wollen die hochgiftigen<br />
Kampfstoffe entsorgen. Nachdem<br />
als letztes mögliches Entsorgerland<br />
auch Albanien ablehnte, sollen<br />
die Chemikalien nun auf hoher See<br />
unschädlich gemacht werden – auf<br />
einem Schiff mit fünf Brennöfen, bei<br />
2700 Grad. Falls das nicht funktioniert<br />
(was gut möglich ist, erprobt<br />
wurde es in großem Maßstab noch<br />
nie), könnte das größte Chemiewaffen-Arsenal<br />
des Nahen Ostens auf<br />
den Meeren herumirren wie der Fliegende<br />
Holländer. Die politische Botschaft<br />
des Westens an die Diktatoren<br />
der Welt ist schon jetzt verheerend:<br />
Sie dürfen die Bevölkerung massakrieren,<br />
aushungern und vergasen.<br />
Schlimmstenfalls handelt der Westen<br />
dann die Herausgabe der Chemie -<br />
waffen aus – und gerät dabei an den<br />
Rand der Lächerlichkeit. Weil er<br />
noch nicht einmal weiß, wohin mit<br />
den mörderischen Giften.
Ausland<br />
Straßenszene im philippinischen Tacloban<br />
AARON FAVILA / AP / DPA<br />
Zurück ins Leben. Gut zwei Wochen nachdem der tropische<br />
Wirbelsturm „Haiyan“ über die Philippinen gefegt ist,<br />
findet die Bevölkerung unter Mühen in den Alltag zurück. In<br />
der Stadt Tacloban bringt ein Rikschafahrer ein Schwein zum<br />
Markt. Seit der Katastrophe sind Wasser und Lebensmittel<br />
Mangelware: Die angelegten Vorräte waren von der Flutwelle<br />
weggerissen worden. Was zurückblieb, ist vom Salzwasser<br />
durchnässt. Tagelang versuchten die Überlebenden, Reis auf<br />
den Straßen zu trocknen, wurden aber immer wieder von<br />
starkem Regen überrascht. Eine der wenigen zuverlässigen<br />
und hygienisch unbedenklichen Nahrungsquellen sind daher<br />
die Schweine.<br />
Seit SPD und CDU in den Koalitionsverhandlungen<br />
vereinbart haben, kein<br />
Fracking zu betreiben, sorgt sich Warschau<br />
um seine Energieversorgung. In<br />
Nord- und Ostpolen wurden, Tausende<br />
Meter unter der Erde, im Schiefergestein<br />
eingeschlossene Gasvorräte<br />
aufgespürt. Die polnische Regierung<br />
fürchtet nun, Franzosen und Deutsche<br />
könnten auch auf EU-Ebene Sicherheitsregeln<br />
auf den Weg bringen, die<br />
P O L E N<br />
Angst vor den Deutschen<br />
eine Förderung durch Fracking un -<br />
rentabel machen würden. Sollten sich<br />
die Schiefergasvorkommen mit diesem<br />
chemisch-hydraulischen Verfahren<br />
nicht ausbeuten lassen, wäre der<br />
Traum wohl vorbei, das „Norwegen<br />
des Ostens“ zu werden – reich und vor<br />
allem unabhängig von Russland. Bisher<br />
bezieht Polen rund zwei Drittel<br />
seines Erdgases von dort. „In der Frage<br />
des Schiefergases sind die Deutschen<br />
keine Verbündeten“, sagte Premier<br />
Donald Tusk. In Frankreich ist<br />
das Fracking bereits verboten, in<br />
Deutschland warnen Umweltschützer,<br />
das Grundwasser könnte dadurch verschmutzt<br />
werden. Die Energiepolitik<br />
ist ein Dauerstreitpunkt zwischen den<br />
Deutschen und ihren östlichen Nachbarn.<br />
So erwägt Warschau gerade, ein<br />
neues Atomkraftwerk zu bauen – während<br />
Berlin seine Meiler stilllegt. Auch<br />
als Gastgeberland des Weltklimagipfels<br />
musste sich Polen in den vergan -<br />
genen zwei Wochen viele Vorwürfe zu<br />
seiner umweltbelastenden Energie -<br />
gewinnung aus Braunkohle anhören.<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3 97
Ausland<br />
Janukowitsch-Gegner in Kiew am vorigen Donnerstag<br />
EFREM LUKATSKY / AP / DPA<br />
E u r o pä i s c h E u n i o n<br />
Geplatzte Verlobung<br />
Mit Drohungen und Milliardenversprechen hat Wladimir putin das Wettbieten<br />
um die ukraine gewonnen – und den Westen ausgestochen. Das scheitern<br />
des Assoziierungsabkommens gefährdet die gesamte „Östliche partnerschaft“.<br />
98<br />
d e r s p i e g e l 4 8 / 2 0 1 3<br />
nach Jahren des Werbens, nach<br />
mehreren Monaten der Versprechungen<br />
und Drohungen, machte<br />
der russische präsident Wladimir putin<br />
am 9. november den entscheidenden Vorstoß.<br />
Er lud Wiktor Janukowitsch, den<br />
präsidenten der ukraine, zum Gespräch<br />
auf einen Militärflughafen bei Moskau.<br />
so geheim war das Treffen, dass die russen<br />
zunächst leugneten, es habe überhaupt<br />
stattgefunden. An diesem Tag besiegelte<br />
putin wohl das Bündnis mit der<br />
ukraine – und stach damit seine rivalen<br />
in Brüssel aus.<br />
Dabei war geplant, dass Janukowitsch<br />
am Freitag dieser Woche im litauischen<br />
Vilnius ein 900 seiten langes Assoziierungsabkommen<br />
unterschreibt, eine Art<br />
Verlobungsvertrag mit der Eu. Das jedoch<br />
hat er am vorigen Donnerstag auf<br />
unbestimmte Zeit verschoben.<br />
nach der Aufnahme des Whistle -<br />
blowers Edward snowden und der Kontrolle<br />
des syrischen Giftgases war dies der<br />
dritte sieg putins über den Westen – wenn<br />
wohl auch kein endgültiger. Denn Janukowitschs<br />
Jawort begründet eine Zweckehe,<br />
keine Liebeshochzeit mit russland.<br />
Vorausgegangen war ein monatelanges<br />
ringen zwischen Moskau und Brüssel,<br />
das an den Kalten Krieg erinnerte. Am<br />
Ende soll der russische präsident seinem<br />
Amtskollegen Janukowitsch mehrere Milliarden<br />
Euro zugesagt haben, in Form von<br />
subventionen, schuldenerlass und zollfreien<br />
importen. Dagegen stand ein Kredit<br />
der Eu über 610 Millionen Euro, den<br />
man im letzten Moment noch erhöht hatte;<br />
dazu die vage Aussicht auf einen Milliardenkredit<br />
des iWF. Janukowitsch entschied<br />
sich für putins Milliarden.<br />
Dabei hatte Angela Merkel noch in der<br />
vergangenen Woche öffentlich beteuert,<br />
die ukraine gegen russische Erpressungsversuche<br />
in schutz nehmen zu wollen,<br />
und gesagt: „Ein Vetorecht Dritter kann<br />
es nicht geben.“ Ein schöner satz, leider<br />
bedeutungslos – und viel zu spät. putin<br />
verhandelte da längst persönlich mit<br />
Janukowitsch. Der russische präsident,<br />
großgeworden in st. petersburger hinterhöfen<br />
und gestählt vom Überlebenskampf<br />
im Kreml-intrigantenstadel, kennt<br />
sich im spiel von Käuflichkeit und Liebes -<br />
entzug besser aus als die Beamten der<br />
Eu. Von den europäischen spitzenpolitikern<br />
warf dagegen keiner sein Gewicht
in die Waagschale; weder Merkel noch<br />
Kommissionspräsident José Manuel Barroso<br />
flogen nach Kiew, um den schwankenden<br />
präsidenten zu überzeugen.<br />
„ich glaube, dass der beispiellose Druck<br />
von der russischen seite ausschlaggebend<br />
war“, klagt der polnische Ex-premier und<br />
Vermittler Aleksander Kwaśniewski. „Die<br />
russen haben das ganze mögliche Arsenal<br />
genutzt.“ Elmar Brok, Vorsitzender des<br />
Auswärtigen Ausschusses im Europaparlament,<br />
sagt: „Janukowitsch hat sich alle<br />
optionen bis zuletzt offengehalten, um<br />
so viel wie möglich herauszuholen.“<br />
Es klingt die hilflosigkeit der Eu mit,<br />
die bis zum schluss auf ihre strahlwirkung<br />
setzte, auf ihr großes Versprechen<br />
von Wohlstand, Freiheit und Demokratie.<br />
Jetzt muss Brüssel zum ersten Mal erleben,<br />
dass ein Annäherungsversuch brüsk<br />
zurückgewiesen worden ist, weil der preis<br />
nicht stimmte. „Wenn Janukowitsch nicht<br />
will, dann will er eben nicht“, sagt Brok.<br />
Vor vier Jahren hatte die union der<br />
ukraine, aber auch Armenien, Aserbaidschan,<br />
Georgien, Moldau und Weißrussland<br />
eine „Östliche partnerschaft“ angetragen.<br />
Die Eu bot Zusammenarbeit,<br />
Freihandel und finanzielle Zuwendungen,<br />
im Gegenzug forderte sie demokratische<br />
reformen. Von einer historischen<br />
ostpolitik der Eu schwärmte man in<br />
Brüssel, in Anlehnung an die Annäherung<br />
Willy Brandts an die Warschauerpakt-staaten<br />
in den siebziger Jahren. Die<br />
geplanten partnerschaftsabkommen sollten<br />
reisen ohne Visum ermöglichen, Zölle<br />
senken und europäische normen einführen.<br />
Das Einzige, was sie nicht anboten,<br />
war eine Eu-Mitgliedschaft.<br />
und natürlich ging es auch darum,<br />
wenngleich weniger offen ausgesprochen,<br />
den Einfluss russlands zu begrenzen –<br />
und zu definieren, wie weit Europa in<br />
den osten reicht. Für russland steht mit<br />
der ukraine nicht nur sein geopolitisches<br />
Gewicht auf dem spiel, sondern auch genau<br />
jene region, die vor tausend Jahren<br />
der nukleus des russischen reiches war.<br />
ukraine heißt auf Deutsch „Grenzland“,<br />
die hauptstadt Kiew ist für viele die Mutter<br />
aller russischen städte.<br />
„Die ukraine ist doch gar kein staat,<br />
verstehst du das, George?“, hatte putin<br />
beim nato-Gipfel 2008 den damaligen<br />
us-präsidenten George W. Bush angefahren,<br />
weil dieser das Land in die nato<br />
holen wollte – und damit unüberhörbar<br />
den eigenen Machtanspruch markiert.<br />
Doch dann hat erst Weißrussland die<br />
hoffnungen der Eu enttäuscht und Demonstrierende<br />
niedergeknüppelt. Armenien<br />
setzte sich ab. nun ist auch die<br />
ukraine vorerst ausgeschert – das Kernland<br />
der „Östlichen partnerschaft“. Das<br />
ist eine diplomatische pleite für die Eu,<br />
die nicht nur ihren Einfluss an den öst -<br />
lichen Grenzen gefährdet, sondern an die<br />
Grundlagen ihrer Außenpolitik rührt.<br />
offiziell gescheitert ist das Abkommen<br />
mit der ukraine an der seit zwei Jahren<br />
im Gefängnis sitzenden oppositions -<br />
politikerin Julija Timoschenko. ihre Freilassung<br />
hatte die Eu zur Voraussetzung<br />
gemacht.<br />
Doch Janukowitsch wollte seine einstige<br />
Gegnerin nicht freilassen, ein entsprechendes<br />
Gesetz scheiterte vorige<br />
Woche im Kiewer parlament.<br />
Dabei schien es zunächst, als könnten<br />
sich die rationalen Argumente der Europäer<br />
gegenüber den russischen Droh -<br />
gebärden durchsetzen. Die von Moskau<br />
propagierte „Eurasische union“, heißt es<br />
in einer internen Analyse der Eu, würde<br />
die souveränität der ukraine stark einschränken.<br />
Kiew könnte fortan ohne Zustimmung<br />
Moskaus keine anderen Freihandelsabkommen<br />
mehr schließen. Eine<br />
Allianz mit Moskau habe den exklusiven<br />
charakter einer heirat, die Eu hingegen<br />
biete eine intensive Freundschaft an, die<br />
es der ukraine aber weiterhin erlaube,<br />
andere Bündnisse einzugehen.<br />
Ausgerechnet Janukowitsch, der als<br />
Kreml-Marionette galt, hat viele von der<br />
Eu geforderten reformen umgesetzt.<br />
Justizsystem und strafrecht wurden modernisiert,<br />
handelsbeschränkungen abgebaut<br />
und einige politische Gefangene<br />
freigelassen. „Er hat mehr reformen umgesetzt<br />
als die prowestliche Vorgängerregierung<br />
unter Timoschenko“, sagt ein<br />
Eu-unterhändler.<br />
Allerdings wurde die Demokratisierung<br />
vielfach nur halbherzig durchgeführt.<br />
Laut der organisation Freedom house<br />
sind die demokratischen Grundrechte in<br />
Anwärterstaaten wie der ukraine nicht<br />
gestärkt worden, im Gegenteil: Die staatliche<br />
Gängelung habe zugenommen.<br />
Trotzdem glaubte sich die Eu sicher,<br />
die ukraine für den Westen gewonnen<br />
zu haben – und vernachlässigte, dass sich<br />
da zwei Welten mit grundverschiedenen<br />
Denkweisen gegenüberstehen.<br />
Auf der einen seite sind da die Europäer,<br />
die glaubten, Kiew würde sich automatisch<br />
dem Westen zuwenden. ist<br />
nicht fast die hälfte der Bevölkerung für<br />
eine Annährung an die Eu? Leben nicht<br />
mehr ukrainische Gastarbeiter im Westen<br />
als in russland? Außerdem basierte ihre<br />
Argumentation auf wirtschaftlicher nachhaltigkeit,<br />
sie glaubten, mit langfristigen<br />
Wachstumsraten von gut sechs prozent<br />
Janukowitsch überzeugen zu können. im<br />
Gegensatz dazu würde eine Zollunion<br />
mit russland das Wirtschaftswachstum<br />
der ukraine auf lange sicht reduzieren.<br />
Präsidenten Putin, Janukowitsch bei einer Kirchenfeier: Zweckehe, nicht Liebeshochzeit<br />
Auf der anderen seite steht Wiktor<br />
Janukowitsch, der vielleicht tumb wirken<br />
mag, aber ein gerissener pokerspieler<br />
ist. sein wichtigstes Ziel ist Machtsicherung,<br />
2015 will er wiedergewählt werden,<br />
dafür braucht er eine rasche Verbesserung<br />
der wirtschaftlichen Lage. Denn die<br />
ukraine ist in die rezession gerutscht<br />
und mög licherweise bald zahlungsun -<br />
fähig. immer wieder stuften die ratingagenturen<br />
die Kreditwürdigkeit des<br />
Landes herab. Außerdem ist die ukraine<br />
abhängig vom russischen Gas, schon<br />
dreimal hat russland im Winter den<br />
hahn zugedreht.<br />
Daher braucht Janukowitsch präsident<br />
putin, der in den vergangenen Monaten<br />
unmissverständlich klargemacht hat, welche<br />
Folgen ein Assoziierungsabkommen<br />
ITAR-TASS / IMAGO<br />
d e r s p i e g e l 4 8 / 2 0 1 3 99
Ausland<br />
haben würde. im August etwa wurden<br />
sämtliche Lastwagen aus der ukraine<br />
penibel kontrolliert, die Waren über die<br />
Grenze nach russland bringen wollten.<br />
Der ukrainische oligarch Wiktor pin -<br />
tschuk durfte keine stahlrohre mehr einführen,<br />
ein Ex-Minister seine schokolade<br />
nicht verkaufen.<br />
Auf diese Weise sind die Exporte seit<br />
2011 um ein Viertel gesunken. Ein Drittel<br />
der ukrainischen Ausfuhren geht nach<br />
russland und in andere staaten der Exsowjetunion,<br />
25 prozent gehen in die<br />
Eu. Außerdem drohte russland, künftig<br />
müssten ukrainer Visa beantragen.<br />
offenbar in Absprache mit dem Kreml<br />
wandten sich dann – drei Tage nach dem<br />
Moskauer Geheimtreffen – ukrainische<br />
oligarchen an Janukowitsch, mit der Bitte,<br />
die Assoziierung mit der Eu doch um<br />
ein Jahr aufzuschieben.<br />
Der Kreml hat keine Zweifel daran<br />
gelassen, dass die schikanen dauerhaft<br />
werden könnten. sergej Glasjew, putins<br />
Berater für die wirtschaftliche reintegration<br />
der nach dem Zerfall der sowjetunion<br />
unabhängig gewordenen republiken, hatte<br />
Kiew eine „wirtschaftliche Katastrophe“<br />
prophezeit, sollte es das Abkommen<br />
mit der Eu unterzeichnen. „Die ukraine<br />
opfert ihre souveränität“, drohte er bei<br />
einer Konferenz ausgerechnet auf der<br />
Krim – ehemals russisches Gebiet.<br />
in einer der hinteren reihen saß Wladislaw<br />
surkow, ideologischer Vordenker<br />
des Kreml, der in ungnade gefallen, aber<br />
dann vor zwei Monaten von putin zurückgeholt<br />
worden war – mit der Mission,<br />
die Vorherrschaft über die staaten der<br />
Ex-sowjetunion zurückzuerobern.<br />
Wenn einer wie surkow auftaucht,<br />
heißt das: Jetzt wird mit allen Mitteln intrigiert.<br />
in russland hat surkow parteien<br />
gegründet und sterben lassen, so wie es<br />
putin nutzte. in der ukraine könnte er<br />
das Gleiche tun und unter Janukowitschs<br />
prorussischen Wählern wildern. Der präsident<br />
hätte kaum eine chance auf eine<br />
Wiederwahl.<br />
Es ist nicht bekannt, ob putin all diese<br />
Drohungen beim Treffen mit Janukowitsch<br />
aussprechen musste. Vermutlich<br />
war es gar nicht mehr notwendig. Janukowitsch<br />
hatte auch so verstanden: seine<br />
einzige chance, politisch zu überleben,<br />
ist an der seite russlands.<br />
Begleitet wurden die Drohungen zugleich<br />
von Versprechungen: putin stellte<br />
Janukowitsch Kredite, günstigere Gaspreise<br />
und schuldenerlass bei Gazprom<br />
in Aussicht, dort ist die ukraine mit 1,3<br />
Milliarden Dollar verschuldet.<br />
Wladimir putin scheint die nöte des<br />
ukrainischen präsidenten schneller erkannt<br />
zu haben als die Eu. Dabei waren<br />
sich die Experten in Brüssel durchaus dar -<br />
über im Klaren, dass die russischen Anreize<br />
„kurzfristiger“ wirken würden als<br />
die eigenen Angebote.<br />
ähnlich wie dem Assoziierungsabkommen<br />
könnte es auch einem anderen projekt<br />
ergehen: einem unter obhut der Eu<br />
fertig ausgehandelten Gasvertrag, der vorigen<br />
Freitag unterzeichnet werden sollte.<br />
Auch da war eigentlich alles beschlossen,<br />
doch dann ging es plötzlich wieder um<br />
kleine technische Details, die angeblich<br />
noch nicht geklärt seien. „Das geht jetzt<br />
schon seit über einem Jahr hin und her“,<br />
sagt einer der Verhandlungsführer genervt.<br />
Dabei hatten alle mit einem Abschluss<br />
gerechnet, weil die ukrainer sich damit<br />
aus der russischen umklammerung befreien<br />
könnten, zumal sie derzeit für russisches<br />
Gas deutlich mehr zahlen als westliche<br />
Großkunden wie der deutsche Energiekonzern<br />
rWE. Der neue Vertrag sieht<br />
vor, dass die pipelines im Eu-Land slowakei<br />
für eine schubumkehr umgebaut<br />
werden, so könnte das für Westeuropa<br />
bestimmte Gas in Zukunft auch die<br />
ukraine versorgen.<br />
Doch Janukowitsch zögert. Der Deal<br />
mit dem Westen hat einen schönheitsfehler:<br />
Wegen der nötigen umbauarbeiten<br />
könnte das Gas aus dem Westen frühestens<br />
im nächsten september fließen.<br />
Zumindest in diesem Winter wären die<br />
ukrainer erpressbar. Zudem scheinen die<br />
Verhandlungen um den neuen Vertrag<br />
Janukowitsch schon geholfen zu haben:<br />
Die russen signalisieren deutliche preisnachlässe.<br />
Es sieht so aus, als habe Janukowitsch<br />
gut gepokert, wieder einmal.<br />
nur wenige tausend ukrainer demon -<br />
strierten Ende vergangener Woche gegen<br />
Janukowitschs Abkehr von der Eu. Da<br />
half es wenig, dass der oppositionspolitiker<br />
und Boxweltmeister Vitalij Klitschko<br />
rief: „Millionen ukrainer wollen dieses<br />
Abkommen, Millionen wollen in der<br />
Eu leben und nicht nach dem recht, welches<br />
unsere regierung uns vorschlägt.“<br />
in Brüssel bemühte sich Erweiterungskommissar<br />
stefan Füle am vorigen Freitag<br />
um haltung: „Erst wenn der Gipfel<br />
offiziell beginnt, werden wir endgültig<br />
wissen, ob die ukraine nun unterzeichnen<br />
will oder nicht.“ Doch eine rasche<br />
Einigung erwartet niemand mehr. Auch<br />
Füle denkt bereits über mögliche nächste<br />
schritte nach. Allerdings ist ratlosigkeit<br />
spürbar, wenn er sagt, keinesfalls wolle<br />
man einen Wettlauf mit russland führen,<br />
es handele sich ja nicht um einen schönheitswettbewerb.<br />
Als sei das nicht längst<br />
geschehen.<br />
„Es ist schwer zu sagen, wann die Verhandlungen<br />
wiederaufgenommen werden“,<br />
sagt Vermittler Kwaśniewski. Kommendes<br />
Jahr wird erst mal das Euro -<br />
päische parlament gewählt, es wird Wechsel<br />
in der Eu-Kommission geben, und<br />
2015 ist dann die präsidentenwahl in der<br />
ukraine. „Mir scheint, die pause wird<br />
eher länger als kürzer sein.“<br />
christoph pauly, Jan puhl, Matthias schepp,<br />
Gregor peter schmitz, christoph schult<br />
100<br />
d e r s p i e g e l 4 8 / 2 0 1 3
Ausland<br />
102<br />
Zuckerrohrernte in der Provinz Kandal<br />
K A M B O D S C H A<br />
Bitterer Zucker<br />
Ausländische Agrarkonzerne nehmen jedes Jahr Tausenden<br />
Bauern ihre Felder weg – mit Hilfe der Regierung. Welche<br />
Rolle spielen deutsche Entwicklungshelfer bei dem Landraub?<br />
Es war der 19. Mai 2006, an dieses schlug es als Wanderarbeiter nach Thailand<br />
und Malaysia.<br />
Datum erinnern sich alle noch genau:<br />
Am Morgen fuhren an der Wie den Dörflern aus Chouk ergeht<br />
Nationalstraße <strong>48</strong>, die den Ort Chouk<br />
durchschneidet, Bulldozer auf. Männer<br />
des Unternehmens Khon Kaen Sugar Industrie<br />
PCL aus Thailand präsentierten<br />
den kambodschanischen Dorfbewohnern<br />
Papiere und erklärten: „Dieses Land gehört<br />
jetzt uns.“<br />
Als die Bulldozer begannen, Reisfelder<br />
zu planieren, versuchten Dutzende Bauern,<br />
sie zu stoppen. Die Polizei kam, es<br />
fielen Schüsse, eine Demonstrantin wurde<br />
verletzt. Heute wächst auf den Feldern<br />
Zuckerrohr, um die Plantage herum ist<br />
Stacheldraht gespannt. Bauer Teng Kao,<br />
53, windet sich durch Zäune, springt über<br />
Gräben und weist schließlich in die Ferne:<br />
„Da hinten, da lagen<br />
es sehr vielen Kambodschanern: Firmen<br />
und privilegierte Landsleute – oft Mitglieder<br />
der regierenden Kambodschanischen<br />
Volkspartei unter Premierminister<br />
Hun Sen – eignen sich Felder und Wälder<br />
an. Häufig sind es ausländische Unternehmen,<br />
die von der Regierung „Wirtschaftliche<br />
Landkonzessionen“ erhalten,<br />
wenn sie Grundstücke für Plantagen und<br />
Fa briken brauchen. Rund 400000 Menschen<br />
wurden seit 2003 vertrieben, schätzen<br />
kambodschanische Nichtregierungsorganisationen.<br />
Landraub ist ein weltweites Phänomen<br />
– doch in Kambodscha spielt auch<br />
die Bundesregierung eine umstrittene<br />
Rolle. Mit deutschen Steuer -<br />
meine Felder.“<br />
geldern fördere sie ein Programm,<br />
das sie ungewollt in<br />
200 Familien aus Chouk<br />
THAILAND LAOS<br />
verloren ihre Lebensgrundlage.<br />
„Wir sind nicht arm, KAMBODSCHA<br />
die Nähe der Landräuber rücke,<br />
kritisieren Menschenrechtler.<br />
wir sind jetzt sehr arm“, sagt<br />
Phnom Penh<br />
die Bäuerin Chea Sok, „drei<br />
„Wir sind auf dem Weg in<br />
Mahlzeiten am Tag kann ich<br />
VIETNAM eine Gesellschaft der Großgrundbesitzer“,<br />
klagt Lao<br />
mir nicht mehr leisten.“ Junge<br />
Leute sind inzwischen Chouk 300 km Mong Hay, ein Veteran unter<br />
weggegangen, einige ver-<br />
Kambodschas Bürgerrecht-<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3<br />
lern, der mit seinem weißen Bart aussieht<br />
wie ein Konfuzius-Gelehrter. „Die regierende<br />
Elite verbündet sich mit dem Big<br />
Business, und dann machen sie gemeinsam<br />
schnelles Geld.“ Er presst die Finger<br />
aneinander, um diese unheilige Allianz zu<br />
demonstrieren. „Es braucht nur das Land,<br />
ein paar Sägen, ein paar Traktoren“, sagt<br />
er, „und schon ist der Wald abgeholzt.“<br />
Die Unternehmen nutzen die unklare<br />
Rechtslage. Niemand weiß so recht, welches<br />
Land Privateigentum ist und welches<br />
dem Staat gehört. Tatsächlich sind die<br />
entsprechenden Dokumente seit Jahren<br />
verschwunden. Die Roten Khmer, die<br />
zwischen 1975 und 1979 herrschten, erklärten<br />
jeden Quadratzentimeter Kambodschas<br />
zu Staatseigentum.<br />
Inzwischen hat das Parlament Gesetze<br />
verabschiedet, die jedem Kambodschaner<br />
das Land zusprechen, das er mindestens<br />
fünf Jahre lang bebaut hat. Wird es ihm<br />
weggenommen, soll er entschädigt werden.<br />
Dabei, sagt Lao Mong Hay, herrsche<br />
aber „große Ungerechtigkeit. Es gibt nur<br />
schlechte Gesetze, die auch noch schlecht<br />
verwirklicht werden“.<br />
Christina Warning von der Deutschen<br />
Welthungerhilfe hat es erlebt: „In einem<br />
Dorf wurden die Leute betrunken gemacht,<br />
bis sie ihren Fingerabdruck unter<br />
einen Vertrag setzten. Als Entschädigung<br />
bekamen sie lediglich Kleidung, Medikamente,<br />
Mobiltelefone.“ Ihre Felder waren<br />
sie los.<br />
Von der Vergabe der Landkonzessionen<br />
profitiere nur eine Minderheit, meldete<br />
auch der Uno-Sonderberichterstatter<br />
für Menschenrechte in Kambodscha im<br />
vergangenen Jahr. Die Unternehmen operierten<br />
„hinter einem Schleier der Verschwiegenheit“.<br />
PRING SAMRANG / REUTERS
Das Geschehen in Kambodscha wirft<br />
aber auch die Frage auf, wieweit ausländische<br />
Entwicklungshelfer mit einem autoritären<br />
Regime zusammenarbeiten können.<br />
Der Landraub dürfte Thema der<br />
deutsch-kambodschanischen Beratungen<br />
Anfang Dezember in Phnom Penh werden.<br />
Der Grünen-Politiker Thilo Hoppe<br />
fordert, notfalls die „staatliche Zusammenarbeit<br />
auszusetzen“. Die Weltbank<br />
hat es vorgemacht: Sie stoppte bereits<br />
2011 aus Protest gegen Vertreibungen Kredite<br />
an Kambodscha.<br />
Immerhin: Kambodschas Regierung<br />
verspricht, mehr Rechtssicherheit zu<br />
schaffen. Alle Bürger sollen ihr Grund -<br />
eigentum registrieren lassen können. Dafür<br />
wird eine Katasterbehörde geschaffen.<br />
Bis Ende 2012 hatten rund zwei Millionen<br />
Menschen einen Landtitel.<br />
Beim Aufbau der Behörde erhält die<br />
Regierung Hilfe aus Deutschland. Seit<br />
2002 stehen ihr Kataster-Experten der Gesellschaft<br />
für Internationale Zusammenarbeit<br />
(GIZ) zur Seite. Doch mittlerweile<br />
seien „die Deutschen Teil des Problems<br />
geworden“, sagt Eang Vuthy von der<br />
Nichtregierungsorganisation Equitable<br />
Cambodia. Auch andere Bürgerrechtler<br />
und deutsche Entwicklungshelfer werfen<br />
der GIZ vor, Regierungschef Hun Sen nutze<br />
das Projekt nur, um den Anschein zu<br />
erwecken, die Kungeleien seien legal. Er<br />
denke nicht daran, den Bodenbesitz gerecht<br />
zu verteilen.<br />
So dürfen die Deutschen zum Beispiel<br />
nicht aufs Land reisen, um zu kontrollieren,<br />
wie die Zuteilung der Grundstückstitel<br />
umgesetzt wird. Premier Hun Sen<br />
sähe es als Einmischung in innere Angelegenheiten<br />
an, wenn die Deutschen<br />
überprüfen würden, ob ihr Projekt auch<br />
tatsächlich Gerechtigkeit schafft. „Die<br />
Deutschen müssen doch wissen, was mit<br />
ihren Steuergeldern passiert“, sagt Eang<br />
Vuthy.<br />
In einem Haus nahe des Unabhängigkeitsdenkmals<br />
in Phnom Penh sitzt der<br />
GIZ-Regionalchef Adelbert Eberhardt.<br />
Die Kritik an seinem Programm kennt er.<br />
Aber: „Wenn Sie etwas realisieren wollen,<br />
dann müssen Sie mit staatlichen Stellen<br />
zusammenarbeiten. Das bietet Angriffsflächen.<br />
Den Spagat müssen wir aushalten.“<br />
Die Vorteile des Programms, meint<br />
er, seien größer als die Nachteile: „Wir<br />
werden für sechs Millionen Menschen<br />
Rechtssicherheit schaffen, zwei Millionen<br />
haben sie schon.“<br />
Auch das Berliner Außenministerium<br />
verteidigt die Zusammenarbeit mit Hun<br />
Sen. Die Bundesregierung könne ihn ja<br />
zu nichts zwingen, befand ein Diplomat<br />
in einer internen Diskussion mit Experten<br />
in Phnom Penh über das Landprogramm.<br />
„Konstruktives Engagement“ sei besser,<br />
als die Zusammenarbeit mit ihm aufzukündigen:<br />
„Wir können nicht alles überall<br />
gleichzeitig schaffen.“<br />
Ein paar Kilometer vom örtlichen GIZ-<br />
Chef entfernt arbeitet Manfred Hornung<br />
von der Heinrich-Böll-Stiftung: „Die GIZ-<br />
Leute haben keine Belege über die zwei<br />
Millionen Landtitel. Die waren ja nicht<br />
draußen im Lande, die wissen gar nicht,<br />
was stattfindet“, sagt er.<br />
Noch umstrittener ist die Politik der<br />
EU – sie fördert indirekt die Landräuber.<br />
Seit 2009 gewährt Brüssel Kambodscha<br />
das Recht, zollfrei Zucker in die Union<br />
zu exportieren. Damit habe sich das<br />
Problem verschärft, sagt Evi Schüller, US-<br />
Juristin bei der kambodschanischen Menschenrechtsorganisation<br />
Licadho. „Tausende<br />
leiden darunter, wenn sie ihr Land<br />
für Zuckerrohrplantagen verlieren.“<br />
Das Europaparlament hat zwar 2012<br />
eine Resolution auch zum bitteren Geschäft<br />
mit dem Zucker verabschiedet. Es<br />
kritisiert darin die „schweren Menschenrechtsverletzungen<br />
im Zusammenhang<br />
mit den Landkonzessionen“. Die EU-<br />
Kommission weigert sich allerdings, die<br />
Zoll-Privilegien auszusetzen: „Sie erkennt<br />
den Bericht des Uno-Berichterstatters<br />
nicht an“, sagt Schüller, „sie will stattdessen<br />
einen vom Uno-Menschenrechtsrat<br />
in Genf. Das ist absurd.“<br />
ANDREAS LORENZ
Ausland<br />
I T A L I E N<br />
Der Ausverkauf<br />
Lange war Mailand Symbol für Wachstum und Fortschritt, für den erfolgreichen<br />
Norden des Landes. Das ist vorbei: Ausländische Investoren sichern sich<br />
die besten Adressen der Stadt, mehrere Konzernchefs stehen unter Betrugsverdacht.<br />
104<br />
Beppe Severgnini beschreibt Italien<br />
wie kaum einer sonst. Seine Bücher<br />
sind Bestseller. Auch weil sie<br />
Titel tragen wie diesen: „Überleben in<br />
Italien – ohne verheiratet, überfahren<br />
oder verhaftet zu werden“.<br />
Severgnini ist gefragt, nicht nur daheim.<br />
Selbst bei BBC und „Economist“ schätzen<br />
sie den kauzigen Kolumnisten; die<br />
britische Königin schlug ihn vor zwölf<br />
Jahren zum Ritter. An diesem regnerischen<br />
Novembertag aber sitzt der Weitgereiste<br />
in Mailand, schüttelt sein schlohweißes<br />
Haupt und sagt, er verstehe die<br />
Welt nicht mehr. „Innerhalb eines Tages<br />
haben sie meine Fußballmannschaft und<br />
den Stammsitz meiner Zeitung verkauft.“<br />
Die Zeitung, die Severgninis Kolumnen<br />
druckt, heißt „Corriere della Sera“ und<br />
ist Mailands Stolz seit 1876. Der Fußballverein,<br />
dem er drei Bücher gewidmet und<br />
sein Herz geschenkt hat, ist der F.C. Inter -<br />
nazionale, kurz Inter, gegründet 1908,<br />
mehrfacher Europapokal-Sieger und als<br />
einziger Club Italiens ununterbrochen<br />
erstklassig.<br />
Inter und „Corriere“ gehören zu Mailand<br />
wie Scala und Dom. Beziehungsweise:<br />
gehörten.<br />
Denn an diesem traurigen Novembertag<br />
meldet der „Corriere“, dass Inter nach<br />
105 Jahren in italienischem Besitz nun<br />
veräußert werde – zu 70 Prozent, an<br />
einen indonesischen Investor. Der Eigen -<br />
tümer und bisherige Inter-Präsident<br />
Massimo Moratti, Raffineriebesitzer aus<br />
bester Mailänder Familie, hatte nach Investitionen<br />
von geschätzt 1,2 Milliarden<br />
Euro genug.<br />
Zeitgleich wird auch das Ende von<br />
109 Jahren „Corriere“ in der Via Solfe -<br />
rino bekanntgegeben: Der historische<br />
Palazzo des Verlags, ein weiteres Stück<br />
Mailänder Tafelsilber, 30 000 Quadrat -<br />
meter in bester Lage, geht für 120 Millionen<br />
Euro an den US-Finanzinvestor<br />
Black stone; die bisherigen Hausherren<br />
dürfen als Mieter noch ein wenig verweilen.<br />
Ihr Stammhaus sei von den eigenen<br />
Aktionären an „Spekulanten“ verhökert<br />
worden, empörte sich die Redaktion.<br />
„Amerikaner können sich vieles kaufen,<br />
nur Geschichte nicht“, sagt Beppe<br />
Severgnini bitter. „Und das hier ist Geschichte:<br />
In diesem Gebäude haben alle<br />
geschrieben – Pasolini, Pirandello, Scia -<br />
scia und Moravia. Wir stehen hier auf den<br />
Schultern von Riesen.“<br />
Es war einer dieser Riesen, Indro Montanelli,<br />
der einst sagte, Mailand sei „die<br />
eigentliche Hauptstadt des Landes“.<br />
Denn was in der Hauptstadt der Lombardei<br />
seinen Anfang nimmt, erfasst für gewöhnlich<br />
bald ganz Italien, im Guten wie<br />
im Bösen. Das war beim Mussolini-Faschismus<br />
ab 1919 so wie auch beim Berlusconismus<br />
ein Dreivierteljahrhundert<br />
„Corriere della Sera“-Chefredakteur de Bortoli<br />
Das Ende einer liberalen Bastion<br />
später; das galt fürs Wirtschaftswunder<br />
nach dem Zweiten Weltkrieg wie für die<br />
Zerschlagung der Parteienlandschaft in<br />
den neunziger Jahren. Viele der 3200 Prozesse<br />
wegen Korruption und illegaler Parteienfinanzierung<br />
fanden damals, während<br />
der Aktion „Mani pulite“, saubere<br />
Hände, im Mailänder Justizpalast statt –<br />
es war ein Signal für das ganze Land.<br />
Ist es jetzt mehr als eine Laune des<br />
Schicksals, dass mit Inter und dem „Corriere“-Stammhaus<br />
gleich zwei der wichtigsten<br />
Institutionen Mailands fallen?<br />
Wird der Ausverkauf weiterer italienischer<br />
Marken folgen? Die traditionellen<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3<br />
MARCO DI LAURO / GETTY REPORTAGE / <strong>DER</strong> <strong>SPIEGEL</strong><br />
Modeunternehmen Gucci, Fendi, Bulgari,<br />
Valentino und Loro Piana sind bereits in<br />
ausländische Hände übergegangen. Versace<br />
bringt gerade ein Aktienpaket auf<br />
den Markt.<br />
„Der Dom von Mailand wird wahrscheinlich<br />
bald von Kanadiern gekauft“,<br />
spottete der „Corriere“ noch im September,<br />
bevor es ihn selbst traf, „und Nutella<br />
von den Pakistanern.“ In kaum ein ande -<br />
res Land der EU sind in den vergangenen<br />
Jahren so wenig ausländische Direkt -<br />
investitionen geflossen wie nach Italien<br />
– auch deshalb nimmt der Druck auf<br />
die bisher familiengeführten Unternehmen<br />
nun zu, sich für das globale Kapital<br />
zu öffnen.<br />
Doch die Angst davor ist groß. „Die<br />
Gnome von McKinsey möchten uns in<br />
ein Volk ehrwürdigster Kellner, Gitarristen,<br />
Geiger und Altenpfleger verwandeln“,<br />
klagte der Mailänder Wirtschaftsprofessor<br />
Giulio Sapelli.<br />
Der „Corriere della Sera“ ist die älteste<br />
und noch immer auflagenstärkste Zeitung<br />
des Landes. Eine liberale Bastion, der<br />
Konferenztisch ist dem Vorbild bei der<br />
Londoner „Times“ nachempfunden; in<br />
den angrenzenden Büros dunkles Holz,<br />
schwere Ledersessel, gesetzte Herren in<br />
Hemd und Krawatte.<br />
Das Verzeichnis der Anteilseigner bei<br />
der „Corriere“-Mutter RCS liest sich wie<br />
ein Best-of des überwiegend ortsansässigen<br />
Industrie- und Finanzadels. Wer sich<br />
zum Mailänder „salotto buono“ zählt, zur<br />
guten Stube, zur eng verbandelten Oberschicht<br />
in der Millionenmetropole, will<br />
beim „Corriere“ dabei sein. Fiat, Pirelli,<br />
Mediobanca, Banca Intesa, Tod’s, Benetton<br />
und Ligresti gehören zu den Aktionären.<br />
Mailands gute Stube ist eine italienische<br />
Variante der Deutschland AG – gedacht<br />
jedoch als Trutzburg. Durch inein -<br />
ander verschränkte Aktienbeteiligungen<br />
stützte man sich. Und geriet daher seit<br />
Ausbruch der Weltwirtschaftskrise gemeinsam<br />
ins Trudeln.<br />
„In unserem Verwaltungsrat saß früher<br />
das italienische Establishment; heute ist<br />
dort die geschwächte Wirtschaftsmacht<br />
dieses Landes versammelt“, sagt Fer -<br />
ruccio de Bortoli, der Chefredakteur.
Luxusgeschäft im Zentrum: Jeder zehnte der 14000 Obdachlosen ist Akademiker<br />
MARCO DI LAURO / GETTY REPORTAGE / <strong>DER</strong> <strong>SPIEGEL</strong><br />
Eine gerahmte Erstausgabe des „Corriere“<br />
vom 5. März 1876 vor sich, hadert er<br />
mit der Entscheidung, für eine Handvoll<br />
schnellen Geldes den „Corriere“-Mythos<br />
aufs Spiel zu setzen – „und durch den<br />
Verkauf des Gebäudes den Niedergang<br />
des ganzen Konzerns zu beglaubigen“.<br />
De Bortoli will bei Bedarf weiterhin,<br />
wie bisher, unfreundliche Artikel über<br />
die eigenen Aktionäre drucken. Zur<br />
Rücksicht auf Fiat und andere Teilhaber<br />
mit Milliardenumsätzen fühle er sich<br />
nicht verpflichtet: „Den ‚Corriere‘ gibt es<br />
schließlich schon länger als seine Shareholder.“<br />
Und die sorgen in jüngster Zeit<br />
oft für negative Schlagzeilen.<br />
Pirelli-Chef Mario Tronchetti Provera<br />
etwa, 2011 mit einem Jahressalär von<br />
14,5 Millionen Euro Italiens bestbezahlter<br />
Manager, wurde im Juli wegen Wirtschaftsspionage<br />
zu 20 Monaten Haft auf<br />
Bewährung verurteilt. Der schwerreiche<br />
Salvatore Ligresti steht unter Hausarrest<br />
wegen des Verdachts auf Korruption und<br />
Bilanzfälschung. Auch die Mediobanca,<br />
Herzstück der alten Italien AG, ist Gegenstand<br />
von Ermittlungen.<br />
Und dann wurde noch am 1. August<br />
der vierfache Ex-Premier und Mailänder<br />
Medienunternehmer Silvio Berlusconi<br />
erstmals rechtskräftig verurteilt – wegen<br />
Steuerbetrugs.<br />
Alle Verurteilten oder Beschuldigten<br />
bestreiten die gegen sie erhobenen Vorwürfe.<br />
Probt da also eine im Angesicht<br />
leerer Staatskassen wildgewordene Justiz<br />
den Kahlschlag? Oder zeichnet sich eine<br />
Zeitenwende ab, das Ende der postfeudalen<br />
Vorherrschaft einiger weniger Industrie-<br />
und Finanzbosse?<br />
„Mailand wurde lange Zeit als moralische<br />
Hauptstadt Italiens bezeichnet, eine<br />
Stadt mit dem nötigen Bürgersinn, um<br />
die sogenannte italienische Krankheit zu<br />
bekämpfen“, sagt Chefredakteur de Bortoli.<br />
„Wenn wir die derzeitige Krise überwinden<br />
wollen, dann muss das von Mailand<br />
ausgehen.“<br />
Wer sich im dritten Jahr anhaltender<br />
Rezession ein Bild von Mailand machen<br />
möchte, von der reichsten Großstadt Italiens,<br />
wer sich in den Luxusgalerien,<br />
Suppen küchen und dem Unicredit-Hochhaus<br />
umhört, der sieht: eine Stadt in rasantem<br />
Wandel, auf der Suche nach sich<br />
selbst.<br />
Die Krise in Mailand hat viele Gesichter.<br />
Die unvermieteten Büros in den Wolkenkratzern<br />
hinterm Garibaldi-Bahnhof<br />
gehören dazu. Aber auch die 2000 Quadratmeter<br />
in der feinen Galleria Vittorio<br />
Emanuele II, die von der klammen Stadtverwaltung<br />
an den Raststättenbetreiber<br />
„Autogrill“ vermietet werden mussten.<br />
Ein paar Schritte weiter, an der Außenwand<br />
des Mailänder Doms, werben Nespresso<br />
und Samsung für ihre Produkte.<br />
Zur Krise gehört, dass allein 2615 Mailänder<br />
Unternehmen in den vergangenen<br />
zwei Jahren ihre Werkstore schlossen und<br />
dass im „Rigolo“, dem Stammlokal vieler<br />
„Corriere“-Journalisten, abends die Hälfte<br />
der Tische frei ist. Selbst in einfacheren<br />
Trattorien gehen die Gäste inzwischen<br />
vom Salat direkt zum Kaffee über.<br />
Und gleich neben dem Restaurant<br />
„Gold“ von Dolce&Gabbana, wo zum<br />
iberischen Schwein glasierte Kastanien<br />
serviert werden, stehen ab elf Uhr die<br />
ersten Hungrigen Schlange, um bei den<br />
Kapuzinern an der Piazza Tricolore was<br />
Warmes zu kriegen. 800000 Mahlzeiten<br />
für die Ärmsten Mailands werden hier inzwischen<br />
jährlich verteilt.<br />
Wer so lange nicht warten mag, pilgert<br />
in den Süden der Stadt. Dort, gleich hinter<br />
der privaten Elite-Universität Bocconi,<br />
stehen die Ersten schon im Morgengrauen<br />
an auf der Suche nach Essen. Hier ist<br />
der Sitz von Pane quotidiano, „tägliches<br />
Brot“, einer Wohltätigkeitsorganisation,<br />
die seit 1898 hilft, den Hunger zu bekämpfen.<br />
In Mailand hat sie zwei Filialen.<br />
Hier, in der Viale Toscana, steigt jetzt<br />
ein Mann aus einem Porsche Carrera 4S,<br />
der aussieht, als hätte er sich auf dem<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3 105
Mode-Shooting in der Ladenpassage Vittorio Emanuele II: „Das hier ist Geschichte“<br />
Finanzmanager Rossi (r.) bei Essensverteilung: Im Porsche Carrera zum Spendensammeln<br />
106<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3<br />
MARCO DI LAURO / GETTY REPORTAGE / <strong>DER</strong> <strong>SPIEGEL</strong><br />
MARCO DI LAURO / GETTY REPORTAGE / <strong>DER</strong> <strong>SPIEGEL</strong><br />
Weg nach Hollywood verfahren: Gletscherbräune,<br />
Rolex, Maßgeschneidertes<br />
für mehrere tausend Euro. Es ist Luigi<br />
Rossi, im Ehrenamt verantwortlich bei<br />
Pane quotidiano. Ein Spendensammler,<br />
wie es ihn nur in Mailand geben kann.<br />
Rossi arbeitet in der Finanzbranche – das<br />
hilft, wenn es darum geht, sich jenen zu<br />
nähern, die er im Kampf gegen den Hunger<br />
braucht: Leute aus den Chefetagen<br />
der Banken, vom „Corriere“ und von der<br />
Scala, mit denen er Wohltätigkeitskonzerte<br />
veranstalten kann. Oder Manager<br />
von Beretta oder Lindt, die Wurst und<br />
Schokolade verschenken.<br />
„Als ich hier begann, kamen tausend<br />
Leute pro Tag“, sagt Rossi, er ist seit<br />
zwölf Jahren dabei. „Inzwischen kommen<br />
dreimal so viele, der größte Andrang<br />
herrscht an Samstagen, wenn die Leute<br />
ihre Kinder mitbringen.“<br />
Es sind Menschen wie Elisabetta di<br />
Rosa aus der Wohnsiedlung Montegani:<br />
eine Frau von 43 Jahren, die sich mit Putzund<br />
Näharbeiten müht, zwei Kinder und<br />
einen Enkel über die Runden zu bringen.<br />
Ihr erster Mann ist verschollen, der zweite<br />
verstorben. Sie lebt von 500 Euro im<br />
Monat; nötig wären, so sagt sie ohne Bitterkeit,<br />
zumindest 800 Euro. An diesem<br />
Morgen hat sie sich eingereiht, um Bananen<br />
und Milch zu holen, es ist der Geburtstag<br />
ihres Jüngsten.<br />
In der 1,3 Millionen Einwohner zählenden<br />
Hauptstadt der Lombardei leben laut<br />
Statistikbehörde inzwischen 225000 Menschen<br />
in Armut. 18000 Wohnungen von<br />
säumigen Zahlern in Stadt und Provinz<br />
wurden 2012 zwangsgeräumt. Es gibt nun<br />
14000 Obdachlose, jeder zehnte ist Akademiker.<br />
Unweit der Mailänder Börse, wo eine<br />
Marmorskulptur mit ausgestrecktem Mittelfinger<br />
den Niedergang der Hochfinanz<br />
bebildert, hat der Stadtrat für Handel<br />
und Tourismus sein Büro. Franco d’Alfonso<br />
machte überregional Schlagzeilen,<br />
als er im Juli, ohne die frisch verurteilten<br />
Modemacher Dolce und Gabbana namentlich<br />
zu nennen, der Stadt Mailand<br />
mehr Zurückhaltung bei der Frage nahelegte,<br />
mit wem man sich bei der Modewoche<br />
schmückt: „Wir haben es nicht nötig,<br />
uns von Steuerflüchtlingen vertreten<br />
zu lassen.“<br />
Die auf ein Milliardenvermögen geschätzten<br />
Modemacher Domenico Dolce<br />
und Stefano Gabbana, erstinstanzlich zu<br />
je 20 Monaten Bewährungsstrafe plus insgesamt<br />
400 Millionen Euro Rückzahlung<br />
verurteilt, schlossen daraufhin ihre Mailänder<br />
Boutiquen „wegen Empörung“<br />
vier Tage lang. Und Gabbana twitterte,<br />
er finde Mailands linke Stadtregierung<br />
„zum Kotzen“.<br />
Stadtrat d’Alfonso will dazu am liebsten<br />
gar nichts mehr sagen, nur so viel:<br />
Steuerbetrug in Zeiten der Krise sei „moralisch<br />
verwerflich“. Seine Stadt war bis<br />
vor kurzem mit vier Milliarden Euro verschuldet,<br />
aus Rom ist keine Hilfe zu erwarten.<br />
Die Kommune musste zwischenzeitlich<br />
sogar den Zuschuss zur Mindestrente<br />
für Bedürftige beschneiden. Mehr<br />
als 2000 Milliarden Euro Staatsverschuldung<br />
lasten schwer auf dem ganzen<br />
Land.<br />
„Italien, das ist der Garten der Welt,<br />
das klingt nach Sonne und Mandolinen“,<br />
spottet d’Alfonso. „Mailand hingegen hatte<br />
schon immer einen schlechten Ruf:<br />
Hier bei uns gibt’s nur harte Arbeit und<br />
schlechtes Wetter.“<br />
Bis auf weiteres ruhen jetzt alle Hoffnungen<br />
auf der Expo 2015, die in Mailand<br />
stattfinden soll. Über 20 Millionen Besucher<br />
werden erwartet, von mehr als drei<br />
Milliarden Euro an Investitionen ist die<br />
Rede, die das Doppelte an Umsatz garantieren<br />
sollen. Eine Initialzündung für die<br />
Stadt, eine Trendwende zum Besseren,<br />
am Ende gar für das ganze Land? Taxifahrer,<br />
Gastronomen, Hotelbetreiber hoffen<br />
darauf. In gehobenen Mailänder Hotels<br />
zahlen Besucher bereits jetzt fünf<br />
Euro Sondersteuer pro Nacht an die<br />
Stadtverwaltung.<br />
Der Startschuss für das Großereignis<br />
allerdings ging schon mal schief. Die feier -<br />
liche Präsentation der Projekte rund um<br />
die Expo durch Regierungschef Enrico<br />
Letta wurde am vergangenen Donnerstag<br />
kurzfristig abgesagt. Italiens Premier<br />
blieb lieber in Rom. Er hatte Wichtigeres<br />
zu tun.<br />
WALTER MAYR
Ausland<br />
S P I E G E L - G E S P R Ä C H<br />
„Schwierig, schmerzhaft, blutig“<br />
Der Politiker Amr Mussa über das Ringen um eine neue Verfassung,<br />
die besondere Rolle des Militärs – und darüber, warum Ägypten nach Revolution und<br />
Islamisten-Regierung nun eine Übergangsperiode von bis zu zehn Jahren braucht<br />
Mussa, 77, war unter Staatschef Husni<br />
Mubarak von 1991 bis 2001 Außenminister<br />
Ägyptens, anschließend Generalsekretär<br />
der Arabischen Liga; nach der Revolution<br />
2011 kandidierte er bei der Präsidentenwahl,<br />
die der Islamist und Muslimbruder<br />
Mohammed Mursi gewann. Nach dessen<br />
Sturz setzten die Militärs eine Übergangsregierung<br />
ein, für die der Jurist Mussa<br />
eine neue Verfassung ausarbeitet, über<br />
die zur Jahreswende ein Referendum abgehalten<br />
werden soll.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Herr Mussa, innerhalb von 60 Tagen<br />
musste Ihre Kommission eine neue<br />
Verfassung ausarbeiten. War das auf seriöse<br />
Weise zu schaffen?<br />
Mussa: Wir haben nur noch wenig Zeit,<br />
aber wir nähern uns dem Ende unserer<br />
Arbeit. Ich bin zuversichtlich, dass wir<br />
108<br />
bereits Ende dieser Woche einen ersten<br />
Entwurf ausgearbeitet haben. Dann ist<br />
immer noch eine Woche Zeit bis zum geplanten<br />
Vorstellungstermin.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Sie können die Verfassung also<br />
am 3. Dezember der Übergangsregierung<br />
von Präsident Adli Mansur vorlegen?<br />
Mussa: Ja, auch wenn wir noch zwei, drei<br />
Punkte ausdiskutieren müssen, etwa eine<br />
Quotenregelung. Einige der 50 Ausschussmitglieder<br />
wollten den Arbeitern<br />
und Bauern im Parlament eine Anzahl<br />
von Sitzen sichern. Das ist vom Tisch.<br />
Aber offen ist, ob es nicht eine Quote für<br />
Frauen und die Jugend geben sollte.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Auch Präsident Mohammed Mursi<br />
hatte eine Verfassung ausarbeiten lassen,<br />
die per Referendum angenommen<br />
wurde. Wie viele der 236 Artikel haben<br />
Sie umgeschrieben oder aufgehoben?<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3<br />
Mussa: Unsere Arbeit sollte nicht an einer<br />
bestimmten Zahl von Änderungen gemessen<br />
werden. Wir haben die ganze<br />
Ausrichtung der Mursi-Verfassung geändert.<br />
Unser Entwurf ist von einem anderen<br />
Geist geprägt. Wir haben den Frauen<br />
ihre Rechte zurückgegeben …<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: … die Mursi durch eine Stärkung<br />
der Scharia, der islamischen Rechtsordnung,<br />
eingrenzen wollte …<br />
Mussa: … und wir haben die Artikel über<br />
die Rechte und Freiheiten der Bürger neu<br />
geschrieben. Auch jene Artikel wurden<br />
geändert, die diskriminierend waren …<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: … beispielsweise gegenüber religiösen<br />
Minderheiten.<br />
Mussa: Wir haben zudem eine neue Institution<br />
aufgenommen, eine Art Anti-<br />
Diskriminierungsrat, der Fälle von Benachteiligung<br />
prüfen und dafür sorgen
wird, dass Verantwortliche zur Rechenschaft<br />
gezogen werden. Er soll kompetent<br />
besetzt werden, etwa mit hohen<br />
Richtern.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Sie stehen nicht nur zeitlich unter<br />
Druck, sondern auch durch die eigentlich<br />
Mächtigen im Lande, die Militärs.<br />
Mussa: Das Militär soll auf mich Druck<br />
ausüben? Auf unsere Verfassungsversammlung?<br />
Nein, das stimmt nicht. Das<br />
Militär betreibt Lobbyarbeit, natürlich.<br />
Wie die verschiedensten Gruppen versucht<br />
es, seine Interessen zu wahren. Aber<br />
es bevormundet uns nicht. Die Lobby -<br />
arbeit der Generäle beschränkt sich auf<br />
die Artikel, die das Militär betreffen.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Und eben damit wollen die Generäle<br />
ihre Sonderrolle festschreiben.<br />
Mussa: Es gibt keine Sonderrolle, für niemanden.<br />
Was es geben wird, sind einige<br />
AHMED HAYMAN / DPA<br />
Koptische Christen in der von Islamisten<br />
zerstörten Kirche von Dalga<br />
„Von einem anderen Geist geprägt“<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3<br />
TARA TODRAS-WHITEHILL / <strong>DER</strong> <strong>SPIEGEL</strong><br />
Artikel, die auf die gegenwärtige Situa -<br />
tion im Lande Rücksicht nehmen, die<br />
aber nur für die Übergangsperiode gelten,<br />
in der wir uns derzeit befinden.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Manche Gruppen haben eine<br />
schwache Lobby, die Militärs haben eine<br />
gewaltige. Glauben Sie wirklich, die Generäle<br />
geben ihre durch den Staatsstreich<br />
gegen Präsident Mursi gewonnene Macht<br />
wieder her?<br />
Mussa: Erstens sprechen wir nicht von einem<br />
Staatsstreich. Zweitens ist es mir<br />
egal, wie Sie es nennen. Mursi musste gehen.<br />
Punkt. Das war eine Volksbewegung,<br />
entstanden nach einem Jahr unter<br />
einer ineffizienten Regierung der Muslimbrüder,<br />
die das Land an den Rand der<br />
Katastrophe geführt haben. Eine Regierung<br />
mit solch falschen Prioritäten, die<br />
ihre eigenen Vorstellungen von einem<br />
Staat über die Interessen des Volkes stellte,<br />
konnte Ägypten nicht hinnehmen.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Mursi war ein demokratisch gewählter<br />
Präsident.<br />
Mussa: Gewählt oder nicht gewählt, Demokratie<br />
hin oder her: Mursi und die<br />
Muslimbruderschaft waren dabei, Ägypten<br />
zu ruinieren. Die Zukunft des Landes<br />
stand auf dem Spiel. Das sollten solche<br />
Experten wie Sie vom <strong>SPIEGEL</strong> doch<br />
wissen. Mursi und seine Leute haben versucht,<br />
die Macht an sich zu reißen und<br />
das ganze System zu verändern. Spätestens<br />
am 22. November vergangenen Jahres,<br />
als sich Mursi mit einem Dekret über<br />
die Gesetze stellte, müssen das auch Sie<br />
gemerkt haben.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Mursis Versuch, sich und seine<br />
Entscheidungen unantastbar zu machen,<br />
wurde weltweit verurteilt.<br />
Mussa: Danke. Aber für uns ging es um<br />
Ägyptens Zukunft. Sie als Deutsche<br />
müssten wissen, wohin das führt, wenn<br />
die Demokratie benutzt wird. So sind bei<br />
Ihnen die Nazis an die Macht gekommen.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Sie wollen doch nicht Mohammed<br />
Mursi mit Adolf Hitler vergleichen?<br />
Mussa: Richtig ist, dass Mursi unserem<br />
Land allein in seinem ersten Jahr einen<br />
so unermesslichen Schaden zugefügt hat,<br />
wie andere es in Jahrzehnten nicht geschafft<br />
hätten. Deshalb konnten wir nicht<br />
abwarten. Wir mussten handeln. Wissen<br />
Sie, was für uns zählt? Dass wir der Herrschaft<br />
der Muslimbrüder ein Ende bereitet<br />
haben. Jetzt kümmern wir uns um die<br />
Gegenwart und um unsere Zukunft …<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: … die eine Militärdiktatur sein<br />
könnte.<br />
Mussa: Nein, denn unsere Zukunft wird<br />
aufgebaut auf jener Verfassung, an der<br />
wir gerade arbeiten. Und die ist ein Bekenntnis<br />
zur Demokratie. Sie schafft die<br />
Voraussetzung für ein starkes Parlament,<br />
regelt die Rechte und Pflichten des Präsidenten<br />
und gewährt den Menschen<br />
Rechte und Freiheiten.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Wenn Sie in der Verfassung festschreiben<br />
wollen, dass der Verteidigungsminister<br />
grundsätzlich ein General sein<br />
muss, dann ist Misstrauen angebracht.<br />
Mussa: So wird das nicht in der Verfassung<br />
stehen. Aber für eine gewisse Zeit<br />
wird es so sein, dass der Verteidigungsminister<br />
ein Mann des Militärs ist. Ich<br />
sprach ja davon, dass wir uns in einer<br />
Übergangsperiode befinden.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Das würden wir gern etwas genauer<br />
erklärt bekommen.<br />
Mussa: Nein, das werde ich jetzt nicht erklären.<br />
Die Besetzung von Ministerien<br />
ist eine Angelegenheit der Regierung.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: In fast allen Demokratien muss<br />
das Militär seinen Etat detailliert offenlegen.<br />
Ihnen aber reicht es aus, wenn die<br />
Militärs die ungefähre Höhe ihres Budgets<br />
angeben. Damit entziehen sich die<br />
Offiziere weiterhin der Kontrolle.<br />
Mussa: Es wird Transparenz geben. Bestimmte<br />
Stellen, auch Parlamentarier,<br />
werden Einblick in den Militäretat er -<br />
halten.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Wollen Sie eine Kontrolle der Armee<br />
durch das Parlament einführen, wie<br />
wir sie aus Deutschland kennen?<br />
Mussa: Sie können unsere Situation nicht<br />
mit Ihrer in Deutschland vergleichen. Wir<br />
müssen hier in Ägypten behutsam vorgehen,<br />
schrittweise. Aber machen Sie sich<br />
keine Sorgen: Wir wissen, dass in einer<br />
Demokratie alle Institutionen der Regierung<br />
unterstehen müssen und einige auch<br />
der Aufsicht durch das Parlament.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Schon die Regierung von Präsident<br />
Mursi hatte den Militärs Sonderrechte<br />
in der Verfassung eingeräumt, um die<br />
Machtansprüche der Generäle zu erfüllen.<br />
Das übernehmen Sie nun.<br />
Mussa: Unsere Verfassung wird das nicht<br />
so übernehmen, aber da sind wir noch<br />
mittendrin in einer sehr harten Diskus -<br />
sion mit den Militärs.<br />
Politiker Mussa<br />
„Wir sprechen nicht von einem Staatsstreich“<br />
109
<strong>SPIEGEL</strong>: Das ist die diplomatische Formel<br />
für das, was wir vorhin „Druck durch die<br />
Militärs“ genannt haben.<br />
Mussa: Sie und andere im Westen denken,<br />
Ihr Weg sei der einzig Richtige. Aber wir<br />
Ägypter müssen unseren Weg gehen,<br />
ohne Rücksicht darauf, ob das dem einen<br />
oder anderen im Westen gefällt. Und wir<br />
gehen ihn in Richtung Demokratie.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Sie können nicht von einer Demokratie<br />
sprechen, wenn Sie der Armee<br />
das Recht einräumen, jeden Zivilisten<br />
festzunehmen, von dem sie sich angegriffen<br />
oder kritisiert fühlt.<br />
Mussa: Sie darf nicht „jeden“ festnehmen.<br />
Das ist falsch, absolut falsch, und es hat<br />
auch nichts mit unserer Verfassung zu<br />
tun. Vielleicht hat es aber damit zu tun,<br />
dass Sie etwas gegen das Militär haben?<br />
Sind Sie bei den Grünen?<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Wir haben etwas gegen Menschenrechtsverletzungen<br />
– egal, von wem<br />
sie begangen werden.<br />
Mussa: Wie leben hier in einer schwierigen<br />
Situation: Chaos, Gewalt, Wirtschafts -<br />
krise. Trotzdem wird unsere Verfassung<br />
den Anforderungen an Demokratie und<br />
Zivilgesellschaft Rechnung tragen und allen<br />
Institutionen Grenzen setzen. Aber<br />
aufgrund der besonderen Umstände brauchen<br />
wir eine Übergangsregelung.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Und die bleibt dann auf Jahrzehnte<br />
hinaus in Kraft.<br />
Mussa: Nein, die Übergangsphase wird<br />
vielleicht fünf Jahre dauern, vielleicht<br />
zehn. Doch auch während dieser Zeit<br />
werden die Grundpfeiler unserer Verfassung<br />
in Kraft bleiben.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Aber richtig ist doch, dass Ihre<br />
Verfassung die Sonderrechte für das Militär<br />
nicht einschränkt.<br />
Mussa: „Sonderrechte“ ist der falsche Begriff.<br />
Richtig ist, dass es drei oder vier<br />
Artikel geben wird, die festschreiben,<br />
dass unsere Armee eine Institution, eine<br />
Ausland<br />
Ex-Präsident Mursi (r.) im Gerichtssaal: „Er muss sich verantworten, wie Mubarak“<br />
110<br />
Säule unseres Staates ist. Ihre Verantwortung<br />
wird definiert.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Können die Generäle auch nach<br />
der neuen Verfassung noch Zivilisten vor<br />
Militärgerichten anklagen und zu Strafen<br />
verurteilen lassen, gegen die kein Einspruch<br />
zugelassen wird?<br />
Mussa: Grundsätzlich nein. Aber es wird<br />
bestimmte Ausnahmen geben, die noch<br />
nicht festgelegt sind.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Ausnahmen werden schnell zur<br />
Regel. Tatsächlich ist die Repression heute<br />
größer als unter Husni Mubarak. Allein<br />
seit dem Putsch im Juli sitzen weit<br />
über 2000 Mursi-Anhänger im Gefängnis.<br />
Wie stellen Sie sich so eine Aussöhnung<br />
mit Millionen von Muslimbrüdern<br />
vor?<br />
Mussa: Ich bezweifle sehr, dass Mursi und<br />
die Muslimbrüder so viele Millionen Anhänger<br />
haben. Und es ist auch nicht die<br />
Aufgabe des Staates, die Muslimbrüder<br />
wieder in die Politik zurückzuholen. Sie<br />
selbst müssen sich entscheiden, ob sie am<br />
Rand stehen bleiben wollen, um von dort<br />
auf uns zu schießen, oder ob sie zurück<br />
wollen in die Gesellschaft.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Wenn Sie Präsident Mursi vor<br />
Gericht stellen und Tausende ins Gefängnis<br />
stecken, müssen Sie sich doch nicht<br />
wundern, dass die Muslimbrüder dem<br />
poli tischen Betrieb fernbleiben.<br />
Mussa: Danke für Ihre Expertise. Ich würde<br />
mich freuen, wenn Sie auch über unsere<br />
Opfer sprechen würden, über jene,<br />
die von den Muslimbrüdern erschossen<br />
wurden. Sehen Sie diese andere Seite?<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Von Ausgleich und Versöhnung<br />
zu reden und zugleich Mursi anzuklagen,<br />
das widerspricht sich. Auch die EU-Außenminister<br />
fordern seine Freilassung.<br />
Mussa: Es wurde gegen Mursi ermittelt,<br />
nun bekommt er seinen Prozess und muss<br />
sich vor Gericht verantworten – so wie<br />
auch der frühere Präsident Mubarak.<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3<br />
DPA<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Müssen sich auch Militär und Sicherheitskräfte<br />
für die vielen hundert Toten<br />
verantworten, die es allein bei der<br />
brutalen Räumung der beiden islamistischen<br />
Protestlager in Kairo gab?<br />
Mussa: Ja, es hat Exzesse der Sicherheitskräfte<br />
gegeben; die werden untersucht,<br />
und die Verantwortlichen werden zur Rechenschaft<br />
gezogen. Auch beim Militär.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Der erste demokratisch gewählte<br />
Präsident im Gefängnis, die Armee als<br />
angeblicher Retter in der Not und immer<br />
wieder gewaltsame Proteste – was ist<br />
schiefgelaufen bei dem vor gut drei Jahren<br />
so euphorisch begrüßten Arabischen<br />
Frühling?<br />
Mussa: Ich nenne es nicht den „Arabischen<br />
Frühling“, das klingt sehr verklärend.<br />
Was wir erlebt haben und noch immer<br />
erleben, ist eine starke Bewegung,<br />
die genug hat von den alten Verhältnissen,<br />
die nach Veränderung ruft und ihren<br />
eigenen Weg sucht. Nun befinden wir uns<br />
in einem langwierigen Wandel, mit vielen<br />
Aufs und Abs, nicht nur in Ägypten, sondern<br />
in der ganzen arabischen Welt: Er<br />
ist schwierig, schmerzhaft, blutig. Aber<br />
die Menschen in dieser Region, die Libyer,<br />
die Syrer, die Jemeniten, sie alle verdienen<br />
eine bessere Zukunft.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Warum ist der ohnehin nicht<br />
leichte Weg zur Demokratie in dieser Region<br />
so besonders schwierig?<br />
Mussa: Weil wir es in der Auseinandersetzung<br />
mit Organisationen zu tun haben,<br />
die den Glauben instrumentalisieren, um<br />
ihre Vorstellung von einem politischen<br />
Islam, von einer großen muslimischen<br />
Nation durchzusetzen. Hinzu kommen<br />
Probleme, die von außen in die arabische<br />
Welt hineingetragen wurden, wie das Palästina-Problem.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Sie meinen damit die Gründung<br />
des Staates Israel?<br />
Mussa: Oder auch den Nuklearstreit zwischen<br />
Iran und dem Westen, dessen Lösung<br />
sich jetzt abzeichnet. Und hinter all<br />
diesen Konflikten stehen auch noch große<br />
Mächte, die wieder ihre ganz eigenen Interessen<br />
vertreten. Das Einzige, was sicher<br />
ist: In den nächsten zwei bis fünf Jahren<br />
wird sich diese Region drastisch wandeln.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Angesichts des Bürgerkriegs in<br />
Syrien und der Gewalt in Libyen fällt es<br />
schwer, an eine Wende zum Besseren zu<br />
glauben.<br />
Mussa: Zumindest für Ägypten bin ich<br />
zuversichtlich. Was Syrien anbelangt,<br />
muss sich der Westen selbst kritisieren.<br />
Ihre Regierungen sind zögerlich und haben<br />
Interessenkonflikte. Was haben die<br />
USA nicht alles angekündigt? Baschar al-<br />
Assad müsse gehen. Sie würden ihn abstrafen.<br />
Und? Jetzt reden sie über Verhandlungen<br />
in Genf. Was wird das bringen?<br />
Alle werden Zeit gewinnen, nur<br />
nicht das syrische Volk. Wenn den Menschen<br />
geholfen werden soll, sollte die<br />
Weltgemeinschaft im Uno-Sicherheits -
at die nötigen Entscheidungen treffen.<br />
Kraftvolle Entscheidungen.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Sie plädieren für ein militärisches<br />
Eingreifen gegen Präsident Assad?<br />
Mussa: Jedenfalls muss gehandelt werden.<br />
Entschlossen. Dazu muss man auch mit<br />
den Iranern sprechen. Die Iraner spielen<br />
auf beiden Seiten des Konflikts eine wichtige<br />
Rolle.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Kairo hatte in der arabischen<br />
Welt oft eine Führungsrolle. Wo sehen<br />
Sie Ihr Land in zehn Jahren, wenn es vielleicht<br />
100 Millionen Einwohner zählt?<br />
Mussa: Wenn wir das Richtige tun, werden<br />
wir wieder eine wesentliche Rolle<br />
spielen in der Region. Wir könnten eine<br />
Kraft sein, auf die man hört, als Nation<br />
mit großer „Soft Power“, die Einfluss<br />
nimmt durch ihre Kultur, gelebte Demokratie,<br />
Prinzipientreue und Verlässlichkeit,<br />
auch gegenüber unseren arabischen<br />
Brüdern in Palästina.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Auch gegenüber Israel?<br />
Mussa: Ja. Wir haben einen Friedensvertrag<br />
miteinander, und den werden wir<br />
einhalten. Daran gibt es keinen Zweifel.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Israels Sorge vor einer schleichenden<br />
Islamisierung, der irgendwann<br />
der Frieden mit Jerusalem geopfert wird,<br />
ist gleichfalls unbegründet?<br />
Mussa: Ja, das neue Ägypten soll ein moderner<br />
Staat werden. Aber natürlich können<br />
wir unsere Religion nicht beiseite -<br />
wischen.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Bleibt Ägypten ein strategischer<br />
Partner des Westens, auch wenn die<br />
Übergangsregierung gerade die Kontakte<br />
zu Moskau intensiviert?<br />
Mussa: Aber natürlich. Die Vereinigten<br />
Staaten sind die Großmacht in der Re -<br />
gion. An der Partnerschaft zu rütteln<br />
wäre sicherlich sonderbar.<br />
* Mit den Redakteuren Klaus Brinkbäumer und Dieter<br />
Bednarz in seinem Büro in Kairo.<br />
Ausland<br />
Tote Mursi-Anhänger, Trauernde in Kairo: „Es hat Exzesse der Sicherheitskräfte gegeben“<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Nachdem Washington einen<br />
Großteil seiner jährlichen Militärhilfe von<br />
1,3 Milliarden Dollar demonstrativ ausgesetzt<br />
hat, war Kairos Einladung an die<br />
russischen Minister für Außenpolitik und<br />
Verteidigung doch kein Zufall.<br />
Mussa: Russland ist ein wichtiges Land,<br />
doch es geht nicht darum, den einen<br />
durch den anderen zu ersetzen. Aber<br />
Moskau und Kairo haben gemeinsame<br />
Perspektiven, etwa im Handel, auch bei<br />
der strategischen Ausrichtung. Außerdem<br />
ist die russische Diplomatie, wie wir gerade<br />
an Syrien sehen, effektiv und zielstrebig.<br />
Wir sehen doch gerade, dass sich<br />
bei vielen Ländern strategische Partnerschaften<br />
verändern.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Sie meinen die Annäherung zwischen<br />
Iran und den USA?<br />
Mussa: Die Ausrichtungen verändern sich.<br />
Auch wir müssen sehen, wo wir stehen.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Kairo steht Iran heute näher als<br />
früher.<br />
Mussa: Wir haben immer noch unsere<br />
Probleme. Besonders das Verhältnis zwischen<br />
den arabischen Golfstaaten und<br />
Iran ist nicht frei von Spannungen und<br />
beschäftigt auch uns. Doch Ägypten verfolgt<br />
keine gegen Iran gerichtete Politik,<br />
und das sollte auch umgekehrt gelten.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Gegenüber Europa verhält sich<br />
Kairo hingegen eher distanziert, nachdem<br />
Mussa beim <strong>SPIEGEL</strong>-Gespräch*<br />
„Sind Sie bei den Grünen?“<br />
MOSAAB EL SHAMY / DPA<br />
TARA TODRAS-WHITEHILL / <strong>DER</strong> <strong>SPIEGEL</strong><br />
die EU das Vorgehen des Militärs gegen<br />
Präsident Mursi und die Muslimbrüder<br />
kritisiert hat.<br />
Mussa: Nein. Es gibt vielfältige Bindungen<br />
zwischen Europa und Ägypten: kulturell,<br />
ökonomisch, politisch. Diese Beziehungen<br />
müssen wir erhalten und ausbauen.<br />
Und ich darf daran erinnern, dass in meiner<br />
Amtszeit als Außenminister die Entwicklung<br />
einer „vierten Dimension“ vor -<br />
angetrieben wurde: die Mittelmeerunion.<br />
Wir sind Partner in diesem Raum.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Berlin liegt nicht am Mittelmeer.<br />
Mussa: Deutschland ist die führende Nation<br />
in Europa. Wir Ägypter haben großen<br />
Respekt vor dem, was Deutschland<br />
leistet, politisch wie ökonomisch. Wir<br />
hoffen sehr auf die Hilfe Ihres Landes bei<br />
der Gestaltung unserer Zukunft und werden<br />
unseren Teil dazu beitragen, dass die<br />
deutsche Hilfe effizient umgesetzt wird.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Wir dachten, die Golfstaaten seien<br />
für Ihre Außenpolitik inzwischen<br />
wichtiger als Europa.<br />
Mussa: Wir dürfen Saudi-Arabien, die<br />
Vereinigten Arabischen Emirate oder Kuwait<br />
nicht aus den Augen verlieren. Diese<br />
Länder helfen uns derzeit sehr, und das<br />
wissen wir zu schätzen.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Dank dieser Hilfe wird Ihr Land<br />
nicht abgleiten in einen Strudel aus Unruhen<br />
und religiöser Militanz?<br />
Mussa: Ich hoffe das. Die Welt sieht, was<br />
derzeit in Syrien geschieht.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Ägypten wird im Jahr 2023 also<br />
ein ziviler, demokratischer Staat sein und<br />
keine Militärdiktatur?<br />
Mussa: Seien Sie unbesorgt. Ägypten wird<br />
ein ziviler Staat sein, ganz gewiss.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Und das „zivil“ ist auch in der<br />
neuen Verfassung festgeschrieben?<br />
Mussa: Ja, das wird in der Verfassung stehen,<br />
auch wenn ich Ihnen jetzt noch nicht<br />
die genaue Formulierung sagen kann.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Das wird General Abd al-Fattah<br />
al-Sisi kaum hindern, bei der Präsidentenwahl<br />
im Frühsommer zu kandidieren.<br />
Wie einst Mubarak müsste er nur die Uniform<br />
gegen einen Anzug tauschen.<br />
Mussa: Wer für das Präsidentenamt kandiert,<br />
steht noch nicht zur Debatte. Zuvor<br />
müssen wir noch die Parlamentswahl abhalten.<br />
Aber ich glaube ohnehin nicht,<br />
dass General Sisi kandidieren wird. Zum<br />
einen habe ich von ihm nicht gehört, dass<br />
er das beabsichtige. Zum anderen macht<br />
er als Oberbefehlshaber der Armee eine<br />
wirklich gute Arbeit.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Werden Sie erneut kandidieren?<br />
Mussa: Nein, ich möchte keine Ämter<br />
mehr übernehmen, sondern meinem<br />
Land als Bürger dienen.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Wer wird die Wahl gewinnen?<br />
Mussa: Das weiß ich nicht. Aber eines<br />
kann ich Ihnen sagen: Falls General Sisi<br />
kandieren sollte, bekäme er die überwältigende<br />
Mehrheit der Stimmen.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Herr Mussa, wir danken Ihnen<br />
für dieses Gespräch.<br />
112<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3
Ausland<br />
LONDON<br />
Consommé mit Grashüpfer<br />
GLOBAL VILLAGE: Warum vier Londoner die<br />
Europäer vom Insektenessen überzeugen wollen<br />
Julene Aguirre weiß, dass der Anfang<br />
für ihre Gäste meist das Schlimmste<br />
ist. „Bereit?“, fragt sie mit hochgezogenen<br />
Augenbrauen. Dann schaltet sie<br />
den Mixer an. Innerhalb weniger Sekunden<br />
werden Hunderte Wachsmottenlarven<br />
püriert. „Das ist für Pfannkuchen“,<br />
erklärt Aguirre und schüttet die Masse<br />
durch ein Sieb, um die Larven von ihrer<br />
Chitinhülle zu trennen. Danach mischt<br />
sie Mehl und Wasser unter den Larvenbrei<br />
und schöpft alles in eine Pfanne, in<br />
der heißes Fett brutzelt.<br />
Vergisst man für einen<br />
Moment die Larven, sieht<br />
es so aus, als würde die gebürtige<br />
Mexikanerin in ihrer<br />
Küche in London einfach<br />
nur Pfannkuchen zubereiten.<br />
Lediglich der Behälter<br />
neben der Spüle, in dem<br />
sich die Überreste der Larven<br />
lila verfärben, erinnert<br />
daran, dass hier etwas anders<br />
ist.<br />
Julene Aguirre, 28, will<br />
den Menschen das Insekten -<br />
essen schmackhaft machen.<br />
Die Schwierigkeit ist allerdings,<br />
dass viele Europäer<br />
Larven, Maden und Heuschrecken<br />
für Ungeziefer<br />
halten. „Und es ekelt viele,<br />
dass die Tiere tot genauso<br />
aussehen wie lebendig“,<br />
sagt sie, während sie die<br />
Pfannkuchen wendet. „Deshalb<br />
muss sich als Erstes<br />
die Wahrnehmung ändern.“<br />
Das Insekt darf nicht aussehen wie ein<br />
Insekt, auf dem Teller sollen nicht Flügel<br />
und Köpfe zu sehen sein, sondern Speisen,<br />
die Europäer gewohnt sind.<br />
Aguirre hat daher mit drei befreundeten<br />
Designern und Ingenieuren „Ento“<br />
gegründet, abgeleitet von „Entomophagie“:<br />
Verzehr von Insekten. Ihre Mission<br />
ist es, die Krabbeltiere eines Tages sogar<br />
in britische Supermärkte zu bringen. Seit<br />
einem knappen Jahr macht Ento zudem<br />
Catering für Veranstaltungen, es geht vor<br />
allem um Aufmerksamkeit für ihr Projekt.<br />
Im August haben sie in einem temporären<br />
Restaurant drei Tage lang Fünf-Gänge-<br />
Menüs serviert, darunter eine Consommé<br />
mit Grashüpfer-Dumplings, ein Medaillon<br />
aus Wachsmottenlarven und Panna cotta<br />
mit Drohnenlarven der Honigbiene.<br />
114<br />
Köchin Aguirre: Ohne Flügel und Köpfe<br />
Die Jungunternehmer wurden für ihre<br />
Idee bereits mit mehreren Preisen ausgezeichnet.<br />
Dabei war es Zufall, dass<br />
Aguirre zur Insektenköchin wurde. Während<br />
ihres Studiums am Londoner Royal<br />
College of Art besuchte sie ein Seminar,<br />
das sich mit der schlichten Frage beschäftigte:<br />
Vor welchen Herausforderungen<br />
wird die Menschheit in Zukunft stehen –<br />
und wie werden sie sich lösen lassen?<br />
Bei ihren Recherchen stießen Aguirre<br />
und ihre Kommilitonen auf ein Problem,<br />
das die Wissenschaft seit langem beschäftigt:<br />
Im Jahr 2050 könnte es nicht mehr<br />
genug Nahrung für die Weltbevölkerung<br />
geben. Neun Milliarden Menschen werden<br />
dann auf der Erde leben, so die Pro -<br />
gnosen der Uno; der Proteinbedarf wird<br />
steigen. Aber wenn in den reichen Ländern<br />
und den aufstrebenden Regionen<br />
weiterhin so viel Fisch und Fleisch gegessen<br />
wird, werden die Anbauflächen nicht<br />
reichen, um den Rest der Welt zu ernähren.<br />
Insekten könnten die Lösung sein.<br />
Grillen verwandeln zwei Kilogramm<br />
Futter in ein Kilogramm Gewicht. Mastrinder<br />
verwandeln im Schnitt zehn Kilogramm<br />
Futter in ein Kilogramm Gewicht.<br />
Das Rind ist also fünfmal weniger effizient.<br />
Außerdem können Insekten mit<br />
Bioabfällen gefüttert werden und produzieren<br />
weniger Treibhausgase.<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3<br />
Auch für die Jungunternehmer war das<br />
Insektenessen neu. Deshalb sind sie nach<br />
der Gründung von Ento in ein Restaurant<br />
gegangen, das Insekten serviert, Käfer im<br />
Salat und gegrillte Heuschrecken. Sie merkten:<br />
Mit solchen Gerichten kriegen wir vielleicht<br />
die Abenteurer zum Insektenessen,<br />
aber nicht den Durchschnittseuropäer.<br />
Monatelang experimentierten die vier<br />
Gründer mit Rezepten: Sie buken Cracker<br />
aus Insektenmehl, brieten Burger<br />
aus Insektenfleisch, frittierten ganze Insekten<br />
zu Tempura. Mit dem Abstrakten,<br />
dem Cracker, hatte kaum<br />
ein Testesser ein Problem.<br />
„Die Menschen sind immer<br />
überrascht, dass diese Gerichte<br />
nicht abartig, sondern<br />
nicht viel anders schmecken<br />
als das, was wir sonst zu uns<br />
nehmen“, sagt Aguirre.<br />
Das gilt auch für die Pfannkuchen,<br />
die sie an diesem<br />
Abend gebacken hat: Sie<br />
sind luftig wie American Pancakes,<br />
dünn wie französische<br />
Crêpes und herzhaft wie<br />
Fleisch. Allerdings kostet der<br />
Larvenpfannkuchen auch so<br />
viel wie ein Filet Mignon.<br />
Aguirre bezieht ihre Insekten<br />
von britischen Farmen,<br />
die diese als Tiernahrung<br />
ANDREA ARTZ / <strong>DER</strong> <strong>SPIEGEL</strong><br />
züchten, etwa für Echsen.<br />
„Wir hoffen natürlich, dass<br />
sich mit steigender Nachfrage<br />
das Angebot reguliert“,<br />
sagt Aguirre. „Dann werden<br />
auch die Preise fallen.“<br />
Catering und Fünf-Gänge-Menüs sind<br />
erst der Anfang, im kommenden Jahr<br />
wollen die Unternehmensgründer in ausgewählten<br />
Cafés Lunchboxen mit Gemüse-Insekten-Würfeln<br />
verkaufen, die mit<br />
Stäbchen gegessen werden.<br />
Wenn sich die Menschen daran gewöhnt<br />
haben, hoffentlich in wenigen<br />
Jahren, will Ento Fertigprodukte für Supermärkte<br />
anbieten, Heuschrecken-Bolognese<br />
etwa.<br />
Im Jahr 2020 sollen die Supermärkte<br />
dann die Rohprodukte führen. Aguirre<br />
glaubt, dass die Europäer bis dahin ihre<br />
Essgewohnheiten verändert haben werden.<br />
„Früher konnte sich auch niemand<br />
in Europa vorstellen, rohen Fisch zu essen.<br />
Inzwischen wundert sich niemand<br />
mehr über Sushi.“ THERESA BREUER
Serie<br />
AFRIKA (II) Die digitale Revolution könnte Millionen<br />
aus der Armut befreien. Eine neue Generation von<br />
kreativen Computerexperten entwickelt Apps, die<br />
genau zugeschnitten sind auf die Bedürfnisse der<br />
Afrikaner. Zugleich wächst der Markt für Smart -<br />
phones nirgendwo schneller. In einer dreiteiligen<br />
Serie beschreibt der <strong>SPIEGEL</strong> den Wandel eines<br />
Kontinents, den der Westen schon abgeschrieben<br />
hatte. Und der jetzt Unternehmergeist und neues<br />
Selbstbewusstsein zeigt.<br />
Im Silicon Savannah<br />
Mit Handy und Internet findet der Kontinent endlich Anschluss an den Rest der Welt.<br />
118<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3
Ein Loft, hohe Fenster, Holzfußböden<br />
und an langen Tischen junge Menschen,<br />
die sich über ihre Laptops<br />
beugen: keine Nerds, sondern Frauen, die<br />
ihr Haar zu Zöpfchen geflochten haben,<br />
und Männer mit bunten T-Shirts. Sie sind<br />
Studenten, Blogger, Internetdesigner, Programmierer,<br />
nicht irgendwo in Kalifornien,<br />
sondern in der Ngong Road, Nairobi.<br />
Hier, im iHub, treffen sich jene, die am<br />
unwahrscheinlichsten aller Orte an der<br />
Zukunft des Internets arbeiten: in Afrika.<br />
Menschen wie Wesley Kirinya, 30, ein Internetunternehmer,<br />
der vor drei Jahren<br />
sein Medizinstudium abgebrochen und<br />
die Firma Leti Games gegründet hat – inzwischen<br />
beschäftigt er sechs Angestellte,<br />
in ganz Afrika.<br />
Er hat einen eineinhalb Meter langen<br />
Tisch vor den Fenstern gemietet. Solange<br />
Leti Games sich noch in der Start-up-<br />
Phase befindet, ist das hier sein Firmensitz,<br />
nur wenige Schritte entfernt von<br />
dem Café des iHub. Dort kauft er sich<br />
jetzt einen Latte macchiato, die Rechnung<br />
bezahlt er per SMS, 100 kenianische<br />
Schilling. Er tippt die Telefonnummer<br />
der Bar ein, dann eine Geheimzahl, zuletzt<br />
drückt er die Verbindungstaste: gebucht.<br />
M-Pesa heißt das Bezahlsystem, „M“<br />
steht für mobil, „Pesa“ für Bargeld in der<br />
Landessprache Kisuaheli. M-Pesa macht<br />
das Handy zugleich zum Bankkonto, zur<br />
Kreditkarte und zur Geldbörse. Erfunden<br />
wurde es in Kenia, genutzt wird es inzwischen<br />
in fast allen Entwicklungsländern.<br />
Ein Drittel der Wirtschaftsleistung in Kenia<br />
wird bereits über M-Pesa abgewickelt<br />
– während in Europa gerade mal einige<br />
Großstädte damit experimentieren, Parkgebühren<br />
per Handy zu kassieren.<br />
Kirinya programmiert Handy-Spiele,<br />
sein jüngstes Projekt heißt „Ananse“, dar -<br />
in ringt ein spinnenartiges Wesen aus der<br />
ghanaischen Mythologie mit skrupellosen<br />
Politikern. „Wir haben ,Ananse‘ in die<br />
Gegenwart gebeamt“, sagt Kirinya. Im<br />
Oktober ist das Spiel in Ghana und Kenia<br />
auf den Markt gekommen, mehr als<br />
100000-mal wurde es bisher heruntergeladen.<br />
Ab Januar soll „Ananse“ auch<br />
Geld bringen, dann verlangt Kirinya für<br />
das Download einen Dollar, Updates kos-<br />
FRE<strong>DER</strong>IC COURBET / PANOS JB RUSSELL / PANOS<br />
ROBIN HAMMOND / PANOS<br />
GEORGE OSODI / PANOS<br />
Handy-Nutzer in Afrika<br />
SVEN TORFINN / PANOS<br />
MIKKEL OSTERGAARD / PANOS<br />
SVEN TORFINN / PANOS<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3 119
ten extra und gezahlt wird natürlich per<br />
M-Pesa.<br />
Inzwischen hat Kirinya sich einen Namen<br />
in der Szene erworben, nicht nur in<br />
Afrika. Im März ist er mit Kollegen zu<br />
einer Computerspielmesse nach San Francisco<br />
geflogen. „Die haben uns Afrikaner<br />
dort absolut ernst genommen“, sagt er.<br />
„Wir fühlen uns plötzlich sehr global, endlich<br />
gehören wir dazu.“<br />
Natürlich seien die Amerikaner technisch<br />
viel weiter, sie arbeiteten unter Bedingungen,<br />
von denen er nur träumen<br />
könne. „Doch wir haben gemerkt, dass<br />
sie zu schätzen wissen, was wir mit unseren<br />
Mitteln schaffen.“ Etwa Lowtech-<br />
Spiele, wie Kirinya sie für den afrikanischen<br />
Markt entwickelt. Die Amerika -<br />
ner, sagt Kirinya, hätten sich ein wenig<br />
an ihre eigene Pionierzeit erinnert gefühlt.<br />
Zwölf Stunden am Tag arbeitet er im<br />
iHub an seiner Karriere. Manchmal auch<br />
länger, dann ist seine Frau wütend, quengeln<br />
die Kinder. Aber Kirinya hat große<br />
Träume, er sieht all die Möglichkeiten,<br />
die Afrika ihm bietet. Seine nächste Idee:<br />
Er will ein afrikanisches Nachrichten -<br />
portal für Mobiltelefone entwickeln. Anderswo<br />
wäre er vielleicht ein Phantast,<br />
hier haben seine Träume eine Chance,<br />
wahr zu werden.<br />
So sind sie alle im iHub, das ein Zukunftslabor<br />
für Kenias Computerelite<br />
sein soll, gefördert von dem Ebay-Erfinder<br />
Pierre Omidyar. 2007 ließ er das Gebäude,<br />
ein ehemaliges Einkaufszentrum,<br />
mit bezahlbaren Arbeitsplätzen und Internetcafé<br />
einrichten, gedacht als eine Art<br />
digitaler Entwicklungshilfe.<br />
Vorbild ist Indien, wo in den achtziger<br />
Jahren ein IT-Boom begann, der aus dem<br />
Entwicklungsland eine aufstrebende Nation<br />
machte, in der heute Millionen Menschen<br />
Software entwickeln, Spiele programmieren<br />
oder in Callcentern arbeiten.<br />
In Kenia trägt der Informations- und<br />
Kommunikationssektor bereits mehr als<br />
fünf Prozent zur Wirtschaftsleistung bei.<br />
Auch Weltkonzerne wie Google, Microsoft,<br />
IBM und Cisco haben inzwischen<br />
das Potential Afrikas erkannt – und sich<br />
in der Nachbarschaft des iHub ange -<br />
siedelt. Die Ngong Road heißt hier jetzt:<br />
Silicon Savannah.<br />
Das ist kein Witz, sondern Verheißung,<br />
denn Afrika südlich der Sahara ist der<br />
weltweit am schnellsten wachsende<br />
Markt für Mobiltelefone, Tablets und Laptops.<br />
Auf dem Kontinent sind schon mehr<br />
SIM-Karten in Betrieb als in Nordamerika.<br />
Fast die Hälfte der Bevölkerung von<br />
900 Millionen Menschen ist jünger als 15<br />
Jahre. Experten schätzen, dass es hier bis<br />
Serie<br />
Smartphones schaffen, was die meisten Regierungen versäumt<br />
haben: Sie ersetzen fehlende Infrastruktur.<br />
120<br />
PHIL MOORE / <strong>DER</strong> <strong>SPIEGEL</strong><br />
Internetunternehmer Kirinya in Nairobi: „Wir fühlen uns sehr global“<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3<br />
2050 mehr als eine Milliarde zusätzliche<br />
Handy-Nutzer geben wird.<br />
Mobilfunk und Internet haben in kaum<br />
zehn Jahren den Alltag vieler Afrikaner<br />
so dramatisch verändert wie zuvor nur<br />
die Unabhängigkeit von den Kolonialmächten.<br />
Damals hofften die Afrikaner,<br />
endlich zum Rest der Welt aufzuschließen.<br />
Heute, nach 50 Jahren Hunger, Kriegen<br />
und Korruption, scheint das Ziel erreichbar.<br />
Denn Smartphones schaffen,<br />
was die meisten Regierungen versäumt<br />
haben: Sie ersetzen fehlende Infrastruktur,<br />
das Haupthindernis für Entwicklung.<br />
Wo es Mobiltelefone gibt, muss man<br />
weniger Festnetzanschlüsse legen, Autobahnen,<br />
Kliniken oder Schulen bauen.<br />
Denn die Handys sind alles in einem:<br />
Bankfiliale, Wetterwarte, Arztpraxis, Atlas,<br />
Kompass, Schulbuch, Radio- und Fernsehstation.<br />
Afrikaner verschicken heute<br />
per Tastendruck Geld durch Dschungel<br />
oder Steppe; Händler vergleichen Preise;<br />
Bauern holen Klimadaten für die Ernte<br />
ein oder lassen sich vom Tierarzt beraten.<br />
Blogger und Mitglieder sozialer Netzwerke<br />
kontrollieren die Mächtigen, als Ersatz<br />
für eine freie Presse. Für all das reicht<br />
eine Mobilfunkantenne – und die bauen<br />
Unternehmen, nicht Staaten.<br />
„Es ist heute technisch leichter, ein Dorf<br />
mit einem Internetanschluss zu versorgen<br />
als mit sauberem Wasser.“ Das sagt Mo<br />
Ibrahim, der wie kaum ein anderer für<br />
die digitale Revolution in Afrika verantwortlich<br />
ist. Das Magazin „Time“ hält<br />
den Sudanesen für einen der einflussreichsten<br />
Menschen unserer Zeit.<br />
Er ist dabei, wenn sich die Mächtigen<br />
treffen, wie im vergangenen Juni, als er<br />
mit dem Sänger Bono, IWF-Präsidentin<br />
Christine Lagarde und Facebook-Chefin<br />
Sheryl Sandberg in New York über die<br />
Bekämpfung von HIV diskutierte, moderiert<br />
von Bill Clinton.<br />
1998 gründete Ibrahim seine Firma Celtel,<br />
einen der ersten Mobilfunkanbieter<br />
Afrikas. Eine Karriere als Ingenieur bei<br />
der British Telecom und als Gründer einer<br />
IT-Beratungsfirma in London hatte<br />
er da schon hinter sich. Doch das reichte<br />
ihm nicht: „Ich bin nie ganz Europäer geworden,<br />
Afrika ist einfach in mir.“ Und<br />
so warb er bei seinen Kollegen aus der<br />
Telekombranche um Risikokapital – um<br />
ausgerechnet in Afrika zu investieren.<br />
Einziger Standortvorteil damals: Mobilfunklizenzen,<br />
die in Europa und den<br />
USA für Milliardenbeträge versteigert<br />
wurden, gab es in Afrika für ein paar Millionen.<br />
Und niemand wollte sie haben –<br />
außer Mo Ibrahim.<br />
In den darauffolgenden Jahren expandierte<br />
Celtel in 13 Länder, 24 Millionen<br />
Menschen nutzten das Netz, er beschäftigte<br />
5000 Angestellte. Als Mo Ibrahim<br />
Celtel 2005 an das Mobilfunkunternehmen<br />
MTC aus Kuwait verkaufte, erhielt<br />
er 3,4 Milliarden Dollar.<br />
Der Sohn eines nubischen Baumwollhändlers<br />
hat Afrika ins IT-Zeitalter katapultiert.<br />
„Afrika ist die Zukunft“, sagt er.<br />
„Wir sind jetzt endlich Teil des globalen<br />
Prozesses.“ Er sagt das in Marrakesch,<br />
wo er als Ehrengast zu einer Tagung der
Guinea<br />
Mobilfunkverträge<br />
je 100 Einwohner, 2012<br />
unter 25<br />
Quelle: ITU<br />
Marokko<br />
Mauretanien<br />
25 bis 49<br />
50 bis 74<br />
75 bis 99<br />
100 bis 149<br />
150 und mehr<br />
keine Daten<br />
Mali<br />
Burkina<br />
Faso<br />
Ghana<br />
Algerien<br />
Tunesien<br />
Niger<br />
Nigeria Zentralafr.<br />
Republik<br />
Kamerun<br />
zum<br />
Vergleich<br />
USA<br />
98<br />
Simbabwe<br />
Deutschland<br />
131<br />
Gabun<br />
Libyen<br />
Tschad<br />
Rep.<br />
Kongo<br />
Angola<br />
Namibia<br />
Dem. Rep.<br />
Kongo<br />
Sambia<br />
Botswana<br />
Südafrika<br />
Ägypten<br />
Sudan<br />
Südsudan<br />
Uganda<br />
auf IT-Kongressen. Ihr Wissen ist geschätzt,<br />
denn afrikanische IT-Entwickler<br />
müssen besonders kreativ sein. Ihr größtes<br />
Problem: dass auf dem Kontinent bisher<br />
nur ein kleiner Teil der Telefone internetfähig<br />
ist. Aber afrikanische Programmierer<br />
haben Wege gefunden, auch<br />
aus einfachen Mobiltelefonen mehr Funktionen<br />
herauszuholen. Spezielle Programme<br />
verwandeln SMS in E-Mails. Die eingehenden<br />
Informationen werden etwa<br />
von Behörden, Hochschulen oder Banken<br />
verarbeitet und im Internet weiterverschickt.<br />
In Südafrika funktioniert das soziale<br />
Netzwerk Mxit auf diese Weise. Um an<br />
Chats teilzunehmen, Statusmeldungen<br />
oder Posts hochzuladen, versenden die<br />
mehr als sieben Millionen Nutzer lediglich<br />
Textnachrichten. Mxit bietet eigene<br />
Chatrooms, kann User aber auch mit<br />
Facebook oder Yahoo verbinden.<br />
Eine weitere erfolgreiche App aus Afrika<br />
funktioniert auf SMS-Basis: das Programm<br />
iCow. Die kenianische Farmerin<br />
Su Kahumbu hatte die Idee, eine britische<br />
Stiftung bezahlte die Entwicklung und<br />
technische Umsetzung der App.<br />
Heute melden sich Kleinbauern im ganzen<br />
Land mit dem Code *285# an – dann<br />
können sie ihre Kühe mit Alter, Rasse,<br />
Gewicht, Geschlecht und letztem Kalbungsdatum<br />
registrieren lassen. Automatisch<br />
verschickt iCow dann von Tierärzten<br />
entwickelte Ratschläge zu Futter,<br />
Krankheiten oder Fruchtbarkeitszyklen.<br />
Damit auch Analphabeten mitmachen<br />
können, funktioniert das System sogar<br />
mit Sprachnachrichten. Die Zahl der Nutzer<br />
geht in die Zigtausende.<br />
Auch kranken Menschen hilft das Internet.<br />
Kaum ein Arzt praktiziert heute<br />
noch offline, selbst in abgelegenen Orten.<br />
Sogar Dorfpraxen verschicken inzwischen<br />
ihre Laborwerte an Universitätskliniken<br />
und erhalten Diagnose und Therapievorschläge.<br />
Mit solchen Meldesystemen<br />
können Beginn und Ausbreitung<br />
einer Epidemie frühzeitig erkannt werden.<br />
Auch die Echtheit und Qualität von<br />
Medikamenten kann mit Hilfe der Mobiltelefone<br />
festgestellt werden – in Afrika,<br />
wo Tausende Menschen im Jahr an gefälschten<br />
Präparaten sterben, eine sehr<br />
wichtige Anwendung. Computerexperten<br />
aus Ghana entwickelten dazu ein einfaches<br />
Sicherheitsprogramm: Die Patienten<br />
scannen mit ihrem Handy den Strichcode<br />
auf der Verpackung oder notieren die<br />
Identifikationsnummer. Die schicken sie<br />
an eine Zentrale, wo die Echtheit der Medikamente<br />
überprüft und das Ergebnis,<br />
zusammen mit Dosierungstipps, zurückgeschickt<br />
wird. Das MPedigree genannte<br />
System wird in Westafrika von staat -<br />
lichen Gesundheitsbehörden und Pharma-Firmen<br />
unterstützt.<br />
Aber Mobiltelefone helfen in Afrika<br />
nicht nur Kranken, Bauern und Kin-<br />
Afrikanischen Entwicklungsbank eingeladen<br />
ist. Das Thema seines Vortrags an<br />
diesem Tag lautet: Der Rechtsstaat und<br />
Transparenz als Voraussetzung für Afrikas<br />
Fortschritt. Mo Ibrahim sagt, er habe<br />
Celtel aufgebaut, ohne Bestechungsgeld<br />
zu zahlen.<br />
Der Milliardär läuft allein durch das<br />
Tagungshotel, er hat es nicht nötig, mit<br />
Gefolge aufzutreten wie all die anderen<br />
afrikanischen Würdenträger. Er hält nicht<br />
Hof, seine Gesprächspartner bittet er<br />
nicht zu sich, sondern holt sie persönlich<br />
an der Rezeption ab. Und selbst der Finanzminister<br />
von Madagaskar wartet geduldig,<br />
bis er an die Reihe kommt.<br />
Mo Ibrahim sieht nicht aus wie ein<br />
schneidiger Geschäftsmann, eher wie<br />
einer, der seine Worte abwägt, wie ein<br />
Intellektueller. Er trägt eine runde Brille<br />
und unauffällige Anzüge, nur die eingestickten<br />
Initialen verraten den Maßschneider.<br />
Ab und zu klingelt sein Mobiltelefon,<br />
ein erstaunlich altes Modell von Samsung.<br />
All das passt nur wenig zu jemandem,<br />
der Wohnsitze in London und Monaco<br />
unterhält und im Hafen von Monte Carlo<br />
eine Segelyacht liegen hat. Er sei nur sehr<br />
selten zu Hause, sagt Ibrahim. Meistens<br />
reise er durch die Welt und werbe für<br />
Afrika. Seine Frau, eine Radiologin, hat<br />
sich dar an gewöhnt, Sohn und Tochter<br />
sind erwachsen.<br />
Der Milliardär hat eine Stiftung gegründet,<br />
die jedes Jahr ein Ranking aufstellt:<br />
Welche Staaten in Afrika sind gut verwaltet<br />
und regiert, welche nicht? Freie<br />
Wahlen bringen Pluspunkte, Korruption<br />
einen Malus. Außerdem vergibt die Mo-<br />
Ibrahim-Stiftung jedes Jahr einen Preis<br />
für „good governance“, fünf Millionen<br />
Eritrea<br />
Äthiopien<br />
Kenia<br />
Tansania<br />
Mosambik<br />
Malawi<br />
Dschibuti<br />
Somalia<br />
Madagaskar<br />
Dollar für einen vorbildlichen<br />
afrikanischen Politiker.<br />
Doch zum zweiten<br />
Mal in Folge befand die<br />
Jury in diesem Jahr niemanden<br />
für würdig.<br />
Wird also doch nicht<br />
alles besser in Afrika?<br />
Mo Ibrahim schüttelt den<br />
Kopf, er glaubt, dass<br />
der Kontinent sich ent -<br />
wickelt – vor allem dank<br />
Handy und Internet.<br />
„Das Mobiltelefon ist ein<br />
wichtiges Werkzeug der<br />
Zivilgesellschaft. Wenn<br />
dich ein Zöllner an der<br />
Grenze erpresst, fotografiere<br />
ihn mit deinem<br />
Handy und stelle sein<br />
Bild ins Internet. Wenn<br />
jemand dich bei einer<br />
Wahl unter Druck setzt,<br />
mach dasselbe.“<br />
Selbst Spannungen<br />
zwischen Stämmen oder<br />
Ethnien könnten überwunden<br />
werden, wenn<br />
die Menschen per Internet vernetzt sind,<br />
statt in ihren Dörfern ein isoliertes Dasein<br />
zu führen: „Je mehr wir voneinander wissen,<br />
desto schwieriger ist es, Zwietracht<br />
zu säen. Durch die moderne Kommunikation<br />
werden die Afrikaner lernen, dass<br />
es besser ist, Geschäfte miteinander zu<br />
machen, als sich zu hassen.“<br />
Der Milliardär Mo Ibrahim und der<br />
Internetunternehmer Wesley Kirinya, sie<br />
sind zwei Gesichter des neuen Afrika:<br />
Der eine ist mit einer guten Idee bereits<br />
in der Zukunft angekommen, der andere<br />
macht sich gerade erst auf den Weg – und<br />
mit ihm eine ganze Generation junger<br />
Afrikaner. Noch hat der Kontinent keinen<br />
Internetmilliardär hervorgebracht, doch<br />
das wird kommen. „Gebt uns noch ein<br />
paar Jahre“, sagt Kirinya selbstbewusst.<br />
Immer öfter sprechen schon jetzt Afrikaner<br />
nicht nur als Bittsteller auf Geberkonferenzen,<br />
sondern auch als Experten<br />
BRUNO AMSELLEM / SIGNATURES / LAIF<br />
Mobilfunk-Milliardär Mo Ibrahim<br />
Eine Stiftung und eine Yacht in Monaco<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3 121
Serie<br />
TIM FRECCIA / <strong>DER</strong> <strong>SPIEGEL</strong><br />
Schüler mit Tablets in Äthiopien: Das Internet hat den Alltag so verändert wie einst die Unabhängigkeit von den Kolonialmächten<br />
dern – auch bei Katastrophen und Kriegen<br />
können sie Leben retten. Das beste<br />
Beispiel ist eine Entwicklung der Firma<br />
Ushahidi aus Kenia, deren Büros ebenfalls<br />
im iHub-Gebäude an der Ngong<br />
Road liegen. Ushahidi bedeutet „Zeugenaussage“<br />
auf Kisuaheli, und so heißt auch<br />
das Programm, das es ermöglicht, Kämpfe,<br />
Korruption und Seuchen zu kartieren.<br />
Ushahidi stellt eine frei herunterlad -<br />
bare Software zur Verfügung, mit der interaktive<br />
Katastrophenkarten erstellt werden.<br />
Opfer, Zeugen oder Helfer können<br />
so per Kurzmitteilung Lageberichte verschicken<br />
– die Ushahidi-Software zeigt<br />
diese dann als Ereignis auf einer Landkarte<br />
an.<br />
Der Politikwissenschaftler Daudi Were,<br />
34, gehört zu jenen, die Ushahidi ent -<br />
wickelt haben. Nicht weil er so ein Technikfanatiker<br />
sei, sagt er. Sondern weil<br />
ihn die politischen Aspekte daran inter -<br />
essierten. Er war einer der bekanntesten<br />
Blogger des Landes, damals vor sechs<br />
Jahren, als Kenia einen neuen Präsidenten<br />
wählte – und in der Silvesternacht<br />
die Gewalt explodierte und sich Anhänger<br />
beider Kandidaten bekämpften. Innerhalb<br />
weniger Stunden verwandelte<br />
sich auch die Ngong Road in ein Schlachtfeld.<br />
Mehr als 1500 Menschen starben damals<br />
in Kenia.<br />
„Wir waren erschüttert“, sagt Were.<br />
„Niemand kannte das wahre Ausmaß der<br />
Gewalt – und den Verlautbarungen der<br />
Regierung war nicht zu trauen.“ Also<br />
setzte er sich mit befreundeten Program-<br />
mierern zusammen und entwickelte in<br />
nur sechs Tagen die Ushahidi-Software.<br />
Mehr als 5000 Zeugen und Opfer der Gewalt<br />
schickten ihre Erlebnisse per SMS<br />
an die Plattform.<br />
Heute gibt es im Internet rund 45000<br />
Karten auf Basis des Programms, das<br />
Daudi Were und seine Freunde damals<br />
in wenigen Nächten zusammenbastelten.<br />
Menschenrechtler, die Uno und Rettungsdienste<br />
setzen es inzwischen weltweit ein.<br />
Auch die libyschen Rebellen, die 2011 den<br />
Diktator Muammar al-Gaddafi stürzten,<br />
ließen per Ushahidi Karten von Kämpfen<br />
und Truppenbewegungen erstellen. In<br />
Mazedonien nutzt die Organisation<br />
Transparency Watch die Software, um<br />
Korruptionsfälle zu protokollieren. Der<br />
Fernsehsender al-Dschasira kartierte damit<br />
im Herbst 2011 die Verwüstungen<br />
nach einem Erdbeben in der Türkei. Und<br />
auch die von dem verheerenden Taifun<br />
„Haiyan“ auf den Philippinen angerichteten<br />
Schäden haben Wissenschaftler der<br />
Universität Heidelberg in einer Ushahidi-<br />
Karte zusammengeführt.<br />
„Diese Karten erfüllen zwei Funktionen“,<br />
sagt Were, „sie geben einen Überblick<br />
über die Größenordnung einer<br />
Krise und erlauben es zudem Hilfsmannschaften,<br />
mit Opfern und Zeugen in Verbindung<br />
zu treten. So konnte schon manches<br />
Menschenleben gerettet werden.“<br />
Das ist möglich, weil diejenigen, die<br />
einen Eintrag vornehmen, ihre Telefonnummer<br />
oder E-Mail-Adresse hinter -<br />
lassen können.<br />
Das nächste Projekt der Ushahidi-Macher<br />
heißt nun Brck, benannt nach seinem<br />
Äußeren: ein ziegelsteingroßer Apparat.<br />
Und im Inneren: ein mobiler<br />
Router, der bis zu 20 Mobiltelefone, Laptops<br />
oder Tablets mit dem Internet verbinden<br />
kann, auch in den abgeschiedensten<br />
Dörfern. Ein Akku überbrückt bis zu<br />
acht Stunden lang Stromausfälle.<br />
Derzeit reisen die Brck-Erfinder in entlegene<br />
Ecken Kenias, etwa an den Turkana-See,<br />
um die ersten Prototypen Stresstests<br />
unter extremen Bedingungen zu unterziehen.<br />
Bald soll der Klotz in Serie<br />
produziert werden.<br />
Die ersten Exemplare werden wohl in<br />
Asien hergestellt, aber Daudi Were hofft,<br />
dass die Produktion irgendwann nach Afrika<br />
verlegt werden kann. Der Brck wäre<br />
dann die erste Hardware-Komponente, die<br />
von Afrikanern auf dem Kontinent angefertigt<br />
würde. Bisher gibt es 700 Vorbestellungen,<br />
besonders interessiert sind Hilfsorganisationen<br />
und die Uno, die damit<br />
ihre Rettungsteams ausstatten wollen.<br />
Daudi Were hält die Exportchancen für<br />
hervorragend: 4,3 Milliarden Menschen<br />
auf der Welt seien noch immer nicht online.<br />
Und außerdem gelte: „Was in Afrika<br />
funktioniert, funktioniert überall.“<br />
JAN PUHL<br />
Lesen Sie im nächsten Heft:<br />
Afrikas Frauen begehren auf gegen Tabus<br />
und Männerherrschaft, sie wollen<br />
die Zukunft des Kontinents mitgestalten.<br />
122 D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3
Szene<br />
Sport<br />
D O P I N G<br />
Schweigegeld für die Ex<br />
Nachdem Lance Armstrong vor einem<br />
Jahr des Dopings überführt worden<br />
war und er den Betrug in einer US-<br />
Fernsehshow gestanden hatte, war es<br />
still um den Texaner geworden. Damit<br />
ist es vorbei. Armstrongs Vergangenheit<br />
beschäftigt derzeit intensiv Juristen<br />
und Medien. Vorigen Mittwoch<br />
stimmte der ehemalige Radprofi einem<br />
außergerichtlichen Vergleich mit der<br />
Versicherungsgesellschaft Acceptance<br />
Insurance zu, die ihm von 1999 bis 2001<br />
drei Millionen Dollar Erfolgsprämien<br />
gezahlt hatte und ihr Geld zurückverlangte.<br />
Damit verhinderte Armstrong<br />
einen Prozess, in dem heikle Fragen zu<br />
klären gewesen wären. In der Klageschrift<br />
wird unter anderem behauptet,<br />
Armstrong habe seiner Frau Kristin bei<br />
der Scheidung im Herbst 2003 zehn<br />
Millionen Dollar gezahlt, damit sie<br />
über seine Dopingaktivitäten schweige.<br />
Dazu hat er sich bislang nicht geäußert,<br />
in einem Prozess hätte er jedoch unter<br />
Eid aussagen müssen. Zwei weitere<br />
Klagen könnten ihn noch teuer zu stehen<br />
kommen: Eine andere Versicherung,<br />
SCA Promotions, hätte gern 12<br />
Millionen Dollar Prämien wieder, und<br />
Armstrongs langjähriger Teamsponsor<br />
erhält womöglich 100 Millionen zurück.<br />
Auch amerikanische Filmemacher und<br />
Journalisten widmen sich dem tief gestürzten<br />
Superstar. In den Kinos der<br />
USA ist gerade der zweistündige Dokumentarfilm<br />
„The Armstrong Lie“ von<br />
Oscar-Preisträger Alex Gibney angelaufen.<br />
Gibney geht der Frage nach,<br />
warum Armstrong so lange die Welt<br />
belügen konnte, ohne als Doper überführt<br />
zu werden. Außerdem wird im<br />
März das Buch „Cycle of Lies“ erscheinen,<br />
geschrieben von Juliet Macur. Die<br />
Reporterin der „New York Times“ kündigt<br />
an, es enthalte Neuigkeiten zu<br />
Armstrongs Fall. Die Filmrechte am<br />
Buch sind bereits verkauft.<br />
Armstrong 2004<br />
STEFANO RELLANDINI / REUTERS<br />
Mevoli vor den<br />
Cayman Islands 2012<br />
Der Amerikaner Nicholas Mevoli war<br />
ein Neuling in der Szene, vergangenes<br />
Jahr nahm er zum ersten Mal an einem<br />
Wettbewerb im Freitauchen teil, seit<br />
vorvergangenem Sonntag ist er tot. Er<br />
kam bei dem Versuch ums Leben, 72<br />
Meter tief zu tauchen, mit nur einem<br />
Atemzug und ohne Flossen. Es geschah<br />
in Dean’s Blue Hole vor der Bahamas-<br />
Insel Long Island: Nach drei Minuten<br />
und 38 Sekunden unter Wasser kam<br />
Mevoli zurück an die Oberfläche, er<br />
nahm die Schwimmbrille ab und signalisierte,<br />
alles sei okay – dann verlor<br />
er das Bewusstsein. Freitauchen, auch<br />
Apnoetauchen genannt, ist ein Sport<br />
mit vielen Disziplinen und Rekorden.<br />
„Zahlen haben meinen Kopf infiziert,<br />
und das Bedürfnis, diese Tiefen zu erreichen,<br />
wurde zur Obsession. Obsessionen<br />
können töten“, schrieb Mevoli<br />
vor zwei Monaten in einem Blog. 2005<br />
starben 21 Freitaucher, 2008 waren es<br />
schon 60, aktuelle Zahlen gibt es nicht,<br />
aber Mevolis Tod zeigt, dass das Risiko<br />
FREITAUCHEN<br />
Tödliche Tiefe<br />
noch immer unterschätzt wird. Zwei<br />
Tage bevor er starb, hatte sich Mevoli<br />
nach einem abgebrochenen Tauchgang<br />
übergeben müssen, seine Nase blutete.<br />
Trotzdem machte er weiter. In 72 Meter<br />
Tiefe wirkt ein Druck von acht Bar<br />
auf den Körper, die Lunge wird stark<br />
zusammengepresst. Blut aus den Armen<br />
und Beinen fließt in den Brustkorb,<br />
der Blutdruck steigt, Blutgefäße<br />
können überdehnen und reißen. Als<br />
Mevoli aufgetaucht sei, habe er nicht<br />
mehr richtig atmen können, sagt Barbara<br />
Jeschke, Wettkampfärztin vor Ort,<br />
die am Klinikum Sindelfingen-Böblingen<br />
arbeitet. Mevoli ist möglicherweise<br />
erstickt, weil seine Lungen nicht mehr<br />
in der Lage waren, Sauerstoff aufzunehmen.<br />
Im Krankenhaus stellten die<br />
Ärzte ein Ödem fest, 800 Milliliter Flüssigkeit<br />
zogen sie aus der Lunge. Jeschke,<br />
selbst Freitaucherin, sagt, man müsse<br />
nun versuchen zu verhindern, dass<br />
sich unerfahrene Taucher zu schnell in<br />
große Tiefen wagen.<br />
ALAMY / MAURITIUS IMAGES<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3 125
Sport<br />
T A N Z E N<br />
Kampf der<br />
Gummimänner<br />
Breakdance, der Tanzstil der New Yorker Straßengangs in<br />
den achtziger Jahren, ist bei Jugendlichen wieder<br />
schwer angesagt. Die Wettbewerbe sind artistische Spektakel,<br />
bei denen es vor allem um eines geht: Lässigkeit.<br />
JOHANN SEBASTIAN HÄNEL / <strong>DER</strong> <strong>SPIEGEL</strong> (3) (FOTOMONTAGE)
Der Preis, den Khaled Chaabi für<br />
seine Karriere als Tänzer bezahlen<br />
muss, ist eine Glatze.<br />
Berlin an einem Freitagabend, kurz<br />
nach 23 Uhr, die „B-Town Allstars“ proben<br />
im ersten Stock eines Bürogebäudes<br />
in der Nähe des Alexanderplatzes. Früher<br />
war hier mal das Fernmeldeamt der<br />
DDR-Regierung untergebracht, von der<br />
Decke hängen lose Stromkabel herunter,<br />
der Boden ist mit grünem, spiegelglattem<br />
PVC ausgelegt.<br />
Ein guter Untergrund für Breakdancer.<br />
Aus zwei Boxen dröhnen HipHop-<br />
Beats. Die Künstler, junge Kerle, durchtrainiert,<br />
Haare gestylt wie Models, schlagen<br />
Salti, verbiegen ihren Körper wie<br />
Gummimänner zum Rhythmus der Musik.<br />
Dann tritt Khaled Chaabi vor, er<br />
macht einen Kopfstand, holt Schwung<br />
und dreht sich um seine Körperachse,<br />
dreimal, fünfmal, zehnmal, wie ein<br />
menschlicher Kreisel rotiert er auf der<br />
Schädeldecke.<br />
Die Figur nennt sich Headspin, sie ist<br />
Chaabis Spezialität. Er hat den Headspin<br />
schon so oft gemacht, dass sich auf seinem<br />
Kopf eine kahle Stelle gebildet hat,<br />
so groß wie eine Untertasse. Wahrscheinlich,<br />
sagt Chaabi, werde er irgendwann<br />
gar keine Haare mehr haben.<br />
Nach einer Stunde riecht es im Probenraum<br />
nach Schweiß und verbrauchter<br />
Luft. Seit drei Monaten trainieren die<br />
Tänzer fast jeden Tag und sehr oft auch<br />
in der Nacht. Die Allstars proben für den<br />
„Battle of the Year“, die Breakdance-<br />
Weltmeisterschaft, die dieses Jahr in<br />
Deutschland ausgetragen wird.<br />
„Ich hab gehört, dass die Koreaner<br />
sechs Stunden am Tag für die WM üben“,<br />
sagt einer aus der Gruppe.<br />
„Dann müssen es bei uns eben sieben<br />
oder acht werden“, sagt Chaabi.<br />
Sie wollen den Titel nach Berlin holen.<br />
Breakdance, das ist eigentlich achtziger<br />
Jahre, die Zeit der Ghettoblaster und<br />
Jacken in Neonfarben. Damals wurde der<br />
Tanzstil in den USA populär. In den<br />
Neunzigern war er dann fast verschwunden,<br />
Breakdance war out, aber jetzt hat<br />
die Generation Facebook den Tanz wiederentdeckt.<br />
In U-Bahn-Stationen und<br />
auf Busbahnhöfen, in Tanzschulen und<br />
Jugendhäusern sieht man wieder Jugendliche<br />
jene akrobatischen Figuren üben,<br />
die den Breakdance prägen. Das Internet<br />
Tänzer der „B-Town Allstars“ aus Berlin (Fotosequenz)
Breakdance-Weltmeisterschaft in Braunschweig: Im Kopfstand über die Bühne<br />
FOTOS: JOHANN SEBASTIAN HÄNEL / <strong>DER</strong> <strong>SPIEGEL</strong><br />
ist voll mit Filmen von Tanzgruppen aus<br />
aller Welt. Selbst konservative Länder<br />
wie Saudi-Arabien und Kuwait hat die<br />
Welle erfasst.<br />
Breakdancer nennen sich B-Boys und<br />
B-Girls. In Deutschland gibt es über hundert<br />
Gruppen, Crews, die regelmäßig an<br />
Tanzwettbewerben, den sogenannten<br />
Battles, teilnehmen.<br />
Die B-Town Allstars gehören zu den<br />
Stars der Szene. Zwölf Berliner Jungs, von<br />
denen viele in den schwierigen Ecken der<br />
Stadt groß geworden sind. Einer arbeitete<br />
früher in der Druckerei, ein anderer machte<br />
eine Lehre als Maler. Jetzt sind sie alle<br />
Profitänzer, sie tragen Künstlernamen wie<br />
Snoop oder AfroKilla. Zwei von ihnen haben<br />
deutsche Wurzeln, die anderen stammen<br />
aus Marokko, Südafrika, Palästina,<br />
der Dominikanischen Republik.<br />
Ein paar Tage vor ihrem WM-Start treten<br />
die Tänzer vor dem Hotel Adlon in<br />
der Nähe des Brandenburger<br />
Tors auf. Sie wirbeln über das<br />
Pflaster wie Zirkusartisten.<br />
Passanten bleiben stehen,<br />
staunen, applaudieren, ein<br />
Rentner ruft laut: „Bravo!“<br />
Breakdance ist Ghettokunst,<br />
ein Produkt der Straßenkultur.<br />
Erfunden wurde<br />
der Tanzstil von Gangs in der<br />
New Yorker Bronx. Die Idee<br />
war, sich nicht mehr zu prügeln<br />
oder gegenseitig abzuknallen,<br />
sondern sich in Form<br />
von Tanzduellen zu messen.<br />
Das Motto des Breakdance<br />
lautet: Du kannst aus nichts<br />
alles machen.<br />
128<br />
Profitänzer Chaabi<br />
„Magischer Moment“<br />
Khaled Chaabis Künstlername ist KC1.<br />
Er stammt aus Syrien. Seine Eltern zogen<br />
kurz vor seiner Geburt von Homs nach<br />
Berlin, in einen Wohnblock im Stadtteil<br />
Wedding. Chaabi hat sieben Brüder und<br />
fünf Schwestern. Sein Vater, erzählt er,<br />
habe ihnen früh gesagt: „Kinder, ihr<br />
müsst für euch selbst sorgen.“<br />
Chaabi wuchs auf der Straße auf, ein<br />
„bad boy“, wie er sagt, er prügelte sich,<br />
klaute, hatte mehr mit Polizisten zu tun<br />
als mit Lehrern. Manche Freunde von damals<br />
sitzen heute im Gefängnis, „wegen<br />
Messerstechereien und so“, sagt Chaabi,<br />
er selbst habe „gerade noch die Kurve<br />
gekriegt“.<br />
Mit 13 Jahren sah er im Jugendzentrum<br />
zum ersten Mal eine Gruppe, die Breakdance<br />
machte. „Das war ein magischer<br />
Moment“, sagt Chaabi, „ich verstand<br />
nicht, wie ein Mensch solche Bewegungen<br />
machen kann, ohne in der Mitte auseinanderzubrechen.“<br />
Er begann<br />
zu trainieren. „In meiner<br />
Gang ging es um den<br />
schnellen Kick, das schnelle<br />
Geld. Breakdance ist genau<br />
das Gegenteil: Du brauchst<br />
viele Jahre, bis eine Figur, ein<br />
Move, klappt. Ich habe gelernt,<br />
lange an einer Sache<br />
dranzubleiben, geduldig zu<br />
sein, Frust wegzustecken.“<br />
Inzwischen verdient Chaabi<br />
mit dem Tanzen gutes<br />
Geld, er tritt mit den Flying<br />
Steps auf, einer Showtruppe,<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3<br />
die von Red Bull gesponsert<br />
wird und zu klassischer Musik<br />
tanzt. Er hatte schon Engagements<br />
überall auf der Welt, im hintersten<br />
Winkel von Australien kennt man<br />
seinen Headspin.<br />
Die Weltmeisterschaft ist für Chaabi<br />
der Höhepunkt seiner Karriere. Für<br />
Breakdancer gibt es nichts Größeres als<br />
den Battle of the Year.<br />
Ausgedacht hat sich das Event ein<br />
Deutscher. Thomas Hergenröther, 44,<br />
kommt aus Hannover, er wollte eigentlich<br />
Sport- und Englischlehrer werden,<br />
dann kam ihm die Idee mit dem Battle.<br />
Er ist jetzt Chef einer Eventagentur, die<br />
jedes Jahr die Weltmeisterschaft orga -<br />
nisiert.<br />
Früher musste Hergenröther bekiffte<br />
Tänzer von der Bühne zerren, andere zerlegten<br />
ihre Hotelzimmer. „Jetzt kommen<br />
B-Boys mit dem Rockstar-Image nicht<br />
mehr weit“, sagt er. Die Szene ist professioneller<br />
geworden, die Tänzer achten<br />
auf ihre Ernährung, manche meditieren<br />
vor der Show. „Ich sah coole Jungs hinter<br />
der Bühne weinen, nachdem sie ihren<br />
Battle verloren hatten. Das ist Hochleistungssport<br />
geworden“, sagt Hergenröther.<br />
Im vergangenen Jahr wurde die Weltmeisterschaft<br />
in Montpellier ausgetragen,<br />
das Team aus Frankreich, eine europäische<br />
Hochburg des Breakdance, holte<br />
den Titel. Diesmal hat Hergenröther die<br />
Volkswagenhalle in Braunschweig gebucht.<br />
Braunschweig? „Na ja“, sagt er, „ein<br />
bisschen Untergrund gehört zum Breakdance<br />
dazu.“<br />
Die B-Town Allstars sind mit dem Bus<br />
angereist. Schon Stunden bevor die Show<br />
beginnt, strömen die Zuschauer in die<br />
Arena. Die Halle ist ausverkauft, 8000
Berliner Tanzcrew vor dem Auftritt: Die Schwerkraft besiegen<br />
Fans aus ganz Europa, Festivalstimmung.<br />
DJs legen HipHop, Funk und Soul auf.<br />
Überall wird getanzt.<br />
Eine Crew aus Nigeria eröffnet die<br />
Show, die Tänzer springen in den Spagat,<br />
verknoten ihre Beine wie Schnürsenkel.<br />
Das Team aus Venezuela rutscht im Kopfstand<br />
über die Bühne, die Niederländer<br />
rotieren auf dem Rücken wie Flaschen<br />
beim Flaschendrehen, die Franzosen drehen<br />
in der Luft Schrauben und wirbeln<br />
mit gespreizten Beinen über den Boden<br />
als wären sie Windräder.<br />
Beim Breakdance geht es darum, die<br />
Schwerkraft zu besiegen und dabei möglichst<br />
entspannt rüberzukommen. Zwei<br />
Gruppen treten in einem Battle gegen -<br />
einander an, sie schicken abwechselnd<br />
ihre besten Tänzer nach vorn. Eine Jury<br />
bewertet die Choreografien und entscheidet<br />
am Ende über die Sieger.<br />
Erster Auftritt des deutschen Teams.<br />
Die Berliner schlagen Flickflacks, machen<br />
Überschläge. Dann kommt der Headspin<br />
von Khaled Chaabi. 42-mal rotiert er um<br />
seine Körperachse, es sieht aus, als wollte<br />
er mit seinem Schädel ein Loch in den<br />
Bühnenboden bohren.<br />
Das Publikum tobt, Hunderte heben<br />
und senken die Arme wie bei einem Hip-<br />
Hop-Konzert, andere brüllen einfach nur<br />
„Yeah“. Die Allstars kommen eine Runde<br />
weiter.<br />
Zur Jury in Braunschweig gehört auch<br />
Ken Swift, der 47-jährige New Yorker gilt<br />
als Urvater des Breakdance. „Was wir mit<br />
unserem Körper auf der Bühne zeigen,<br />
ist etwas sehr Persönliches“, sagt Swift,<br />
„es ist eine Unterschrift, die wir nicht mit<br />
einem Stift, sondern durch Bewegungen<br />
130<br />
abgeben.“<br />
Im Breakdance kommt es auf den Coolness-Faktor<br />
an. Leistung wird dort neu<br />
definiert. Bei den Battles bewerten die<br />
Juroren nicht nur die Kreativität der Tänzer,<br />
sondern vor allem die Lässigkeit, mit<br />
der die Künstler ihre Bewegungen vortragen,<br />
den Style.<br />
Wer einen guten Style hat, kann beim<br />
Battle weit kommen. Aber ohne halsbrecherische<br />
Akrobatik reicht es nicht zum<br />
Sieg.<br />
Es sind noch ein paar Minuten bis zum<br />
zweiten Auftritt der B-Town Allstars. Khaled<br />
Chaabi liegt hinter der Bühne auf einer<br />
Massagebank und lässt sich die Hüftmuskulatur<br />
von einem Physiotherapeuten<br />
durchkneten.<br />
„Alles verhärtet“, sagt er und streift mit<br />
seinem Zeigefinger vom Becken über seinen<br />
Oberschenkel, „ich merke schon, wie<br />
ich jedes Jahr ein bisschen steifer werde.“<br />
Er steigt von der Liege und fängt an,<br />
Stretching-Übungen mit einem Gummiband<br />
zu machen.<br />
Die Powermoves, so heißen die akrobatischen<br />
Elemente im Breakdance, werden<br />
immer schwieriger, immer schneller,<br />
immer spektakulärer. Es gibt Tänzer, die<br />
schaffen 20 Pirouetten am Stück – auf ihrem<br />
Ellbogen. Die Drehungen und Sprünge<br />
der Breakdancer sind inzwischen fast<br />
so anspruchsvoll wie die Übungen der<br />
Bodenturner bei Olympia.<br />
Breakdance bedeutet auch, Schmerzen<br />
ertragen zu können. Es geht nicht immer<br />
alles gut, wenn sich die Tänzer für eine<br />
Figur aus knapp zwei Meter Höhe mit<br />
Absicht auf den Rücken, die Schulter<br />
oder das Becken fallen lassen. Laut einer<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3<br />
JOHANN SEBASTIAN HÄNEL / <strong>DER</strong> <strong>SPIEGEL</strong><br />
Studie, die an der Essener Universitätsklinik<br />
entstand, kommen auf zehn Tänzer<br />
im Schnitt mehr als fünf Knochenbrüche,<br />
vor allem an Händen und Sprunggelenken.<br />
Viele B-Boys haben Brandblasen<br />
und chronisch offene Wunden auf der<br />
Haut, wegen der Drehungen.<br />
Khaled Chaabis Liste an Verletzungen<br />
ist lang: drei Knieoperationen, mehrere<br />
Bänderrisse, einige Finger ausgekugelt.<br />
Eigentlich ist er ziemlich fertig.<br />
Mit 26 Jahren hat er das beste Alter für<br />
Breakdance fast schon überschritten, doch<br />
heute, bei der Weltmeisterschaft, will er<br />
es noch mal wissen. Er streift sich einen<br />
schwarzen Ellbogenschoner über den<br />
Arm. Dann sucht er sich eine ruhige Ecke<br />
hinter der Bühne, er hält seine Hände<br />
nach oben, schließt die Augen und betet.<br />
Draußen brüllen die Zuschauer „Battle,<br />
Battle, Battle“. Im Halbfinale trifft das<br />
deutsche Team auf die Mannschaft aus<br />
Südkorea, den Top-Favoriten. In Süd -<br />
korea ist Breakdance unter Jugendlichen<br />
eine Art Volkssport, die besten Gruppen<br />
werden vom Staat finanziell gefördert.<br />
Die Deutschen tippeln und zucken<br />
über die Bühne, als würde ihnen jemand<br />
Elektroschocks versetzen. Eine gute<br />
Show. Aber die Südkoreaner springen<br />
wie Flummis über die Bühne, einer<br />
spreizt in der Luft die Beine, landet auf<br />
den Handflächen – und lächelt dabei.<br />
Die Jury stimmt mit 3:2 für Südkorea.<br />
Kurz darauf fliegen ein paar Flaschen<br />
und Stühle durch die Umkleidekabine<br />
der Berliner B-Boys. Khaled Chaabi sitzt<br />
erschöpft und niedergeschlagen auf dem<br />
Boden, er hat sich ein Handtuch um den<br />
Hals gelegt.<br />
„Wir sehen uns ja eigentlich nicht als<br />
Sportler, sondern eher als Künstler“, sagt<br />
er, „aber das tut jetzt schon verdammt<br />
weh.“<br />
Sein Blick fällt auf einen Flachbildschirm,<br />
der in der Ecke des Raumes hängt.<br />
Darauf wird das Finale übertragen, das<br />
gerade draußen beginnt. Südkorea trifft<br />
auf die Mannschaft aus den Niederlanden.<br />
Die Holländer schicken als ersten Tänzer<br />
einen kleinen Jungen nach vorn. Der<br />
Knirps macht einen Headspin und dreht<br />
dabei so schnell wie ein Wirbelsturm,<br />
dann stoppt er abrupt ab und verschränkt<br />
lässig, fast angeberisch die Arme vor dem<br />
Bauch.<br />
Chaabi, der Meister des Headspins,<br />
staunt. „Wie alt ist der denn, bitte<br />
schön?“, fragt er in den Raum.<br />
„Zwölf“, antwortet jemand neben ihm.<br />
Chaabi schüttelt den Kopf, packt seine<br />
Klamotten in seinen Rollkoffer und sucht<br />
den Ausgang.<br />
LUKAS EBERLE<br />
Video: Die „B-Town Allstars“<br />
beim Training<br />
spiegel.de/app<strong>48</strong>2013breakdance<br />
oder in der App <strong>DER</strong> <strong>SPIEGEL</strong>
F U S S B A L L<br />
Ein neuer Xavi<br />
Die schwere Verletzung des Anführers<br />
Sami Khedira trifft die<br />
Nationalelf scheinbar hart. Doch<br />
von einem WM-Aus für den Madrider<br />
könnte ihr Spiel profitieren.<br />
Sport<br />
Es war wie ein Schuss, der nach hinten<br />
losgeht, der Versuch eines Foulspiels,<br />
bei dem sich der Attackierende<br />
selbst zurichtete. Über das Malheur,<br />
das dem Nationalspieler Sami Khedira im<br />
Zweikampf mit Andrea Pirlo in der 65.<br />
Minute des Länderspiels gegen Italien<br />
passierte, wird noch immer geredet wie<br />
über ein Desaster. Bundestrainer Joachim<br />
Löw wählte einen Begriff aus der Tierschlachtung.<br />
„Ein richtiger Genickschlag“<br />
sei die niederschmetternde Verletzung<br />
Khediras für ihn und die Mannschaft, als<br />
läge da nun ein erstarrtes Kaninchen.<br />
Sami Khedira hat seine Operation gut<br />
überstanden. Die Diagnose, Innenbandriss<br />
und Riss des vorderen Kreuzbandes<br />
und damit ein Totalschaden im rechten<br />
Knie, hat jedoch den gesamten DFB-Tross<br />
seit dem vorvergangenen Wochenende in<br />
einen Schock zustand versetzt. Löw konnte<br />
sich gar nicht erinnern, wann es „eine<br />
so schwere Verletzung“ bei einem Nationalspieler<br />
zuletzt gegeben habe.<br />
Vielleicht erinnert er sich an den Vormittag<br />
des 17. Mai 2010. Damals, kurz vor<br />
der WM in Südafrika, ereilte ihn die<br />
Nachricht vom Ausmaß der Verwüstungen<br />
im Fuß Michael Ballacks: Riss des<br />
Innenbandes und Teilriss des vorderen<br />
Syndesmosebandes im rechten oberen<br />
Sprunggelenk, erlitten im englischen<br />
Pokal finale.<br />
Damals im WM-Trainingslager auf Sizilien<br />
wirkte Löw weniger niedergeschlagen<br />
als heute, wahrscheinlich weil er sofort<br />
begriff: In dem WM-Aus für den deutschen<br />
Capitano liegt auch eine Chance.<br />
Es war die Chance für den Nachrücker<br />
Khedira und für die junge Spielergeneration,<br />
die ebendieser tunesischstämmige<br />
Schwabe anführte. Spieler wie Mesut<br />
Özil, Jérôme Boateng und Khedira selbst<br />
würden sich in Ab wesenheit des dominanten<br />
Stars Ballack, der das Wort in<br />
rauer Tonart geführt hatte, besser und<br />
schneller entfalten.<br />
Es kam genau so. Könnte es jetzt wieder<br />
so kommen?<br />
Noch würde Löw der These heftig widersprechen,<br />
dass in dem mehr als wahrscheinlichen<br />
WM-K.-o. für Khedira nun<br />
wieder der Ursprung einer Vervollkommnung<br />
liegen könnte, einer belebenden<br />
Neugestaltung der Teamhierarchie und<br />
eines spielerischen Fortschritts. Zu sehr<br />
ist er daran gewöhnt, in dem Mann von<br />
Real Madrid eine sogenannte Führungsfigur<br />
zu sehen, einen Eckpfeiler des Spiels<br />
und etwas vermeintlich Unverzichtbares:<br />
das kernige Element im zentralen Mittelfeld,<br />
einen letzten Rest ehemals typisch<br />
deutscher Fußballtugenden.<br />
Man kann es auch anders sehen. Die<br />
oft beschworene Sehnsucht nach Führungsspielern<br />
in Deutschland ist nur eine<br />
Erfindung von Journalisten. Und der Leitwolf<br />
Khedira sei nun mal „ein Alphatier<br />
alter Prägung“, präsent vor allem durch<br />
Körperlichkeit und mit der Zeit zum Strategen<br />
„überhöht“, sagt ein Beobachter<br />
aus dem Umfeld der Nationalelf.<br />
Moderne Ball-Eroberer und Aufbauspieler,<br />
heutzutage auch Umschaltspieler<br />
genannt, kontrollieren das Spielzentrum<br />
eher mit Wendigkeit und Geschick, ihre<br />
Waffen sind der präzise Pass und perfekte<br />
Technik. Experten messen ihre Leistung<br />
an jenem Output, das Fußballfeuilletonisten<br />
in Spanien „Kadenz“ nennen, ein<br />
Ausdruck aus der Harmonielehre – gemeint<br />
ist die Frequenz ihrer Pässe.<br />
Khediras Verdienste sind unbestritten.<br />
Doch seine Rolle, die er ungehindert beanspruchte,<br />
war zu groß geworden. In<br />
Madrid hatte sein früherer Trainer und<br />
Förderer José Mourinho den Einfluss klar<br />
begrenzt, Khedira fielen die Aufgaben eines<br />
Zerstörers zu. „Ein Verteidiger, der<br />
als Mittelfeldspieler getarnt wird“, murrten<br />
die Kritiker, in Madrid an mehr Brillanz<br />
gewöhnt. Für das Sportblatt „Marca“<br />
ist der Deutsche heute ein „guter Assistent<br />
oder Schildknappe“, keiner, dem man<br />
die Regie überträgt.<br />
Nur im Deutschland-Trikot durfte Khedira<br />
weiter mit wehendem Haar durchs<br />
Mittelfeld pflügen. Gemessen an seinen<br />
Qualitäten war er zu wichtig.<br />
Die junge Generation braucht die starke<br />
Schulter nicht mehr. Selbst Özil, der<br />
noch bei der letzten EM seinem Gefährten<br />
Khedira auf Schritt und Tritt durchs<br />
Quartier folgte wie ein Hündchen, hat<br />
sich emanzipiert.<br />
Wie die Leichtfüßigen aufblühen, das<br />
sieht man schon jetzt an Toni Kroos. Der<br />
kreative Greifswalder, unter Trainer Pep<br />
Guardiola bei Bayern München taktisch<br />
weiter gereift, hatte zu Zeiten der Regentschaft<br />
Khediras im Nationalteam nicht<br />
mal einen festen Arbeitsplatz. Im letzten<br />
Länderspiel des Jahres, beim 1:0-Sieg in<br />
England, wurde nun erkennbar: Kroos<br />
wird ein neuer Xavi.<br />
An dem Barcelona-Star, Vorbild aller<br />
Umschaltspieler, schätzt Kroos, dass er<br />
„ohne großes Aufsehen und Spektakel<br />
immer spielbestimmend“ sei. Dem Hochbegabten<br />
von der Ostsee, von Trainer<br />
Jürgen Klinsmann einst bei Bayern missachtet<br />
und von Jupp Heynckes in Leverkusen<br />
und München geschliffen, liegt<br />
diese unauffällige Präsenz auch. Kroos<br />
sagt, er definiere sein Spiel über Pass -<br />
genauigkeit und Ballsicherheit. Egal wer<br />
am Ende seine Partner im deutschen<br />
WM-Mittelfeld sein werden, ob Ilkay<br />
Gündogan, Bastian Schweinsteiger oder<br />
Philipp Lahm: Löw bekommt ein spielstarkes<br />
und doch widerstandsfähiges<br />
Zentrum.<br />
Es sind moderne Führungsspieler.<br />
Kroos war sogar mal Deutschlands Kapitän.<br />
Bei der U-17-WM vor sechs Jahren<br />
in Südkorea kürten sie ihn zum besten<br />
Spieler des Turniers. JÖRG KRAMER<br />
Verletzter Nationalspieler Khedira, Teamkollege Kroos (l.): Die Leichtfüßigen blühen auf<br />
DINO PANATO / GETTY IMAGES<br />
ULLSTEIN BILD<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3 131
Prisma<br />
KES<br />
M E D I Z I N<br />
„Das ist Kindesmisshandlung“<br />
Vor fast einem Jahr wurde<br />
das Beschneidungs -<br />
gesetz verabschiedet.<br />
Der Präsident der Deutschen<br />
Gesellschaft für<br />
Kinderchirurgie, Bernd<br />
Tillig, 58, kritisiert die<br />
Umsetzung in der Praxis.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Das Gesetz soll minderjährigen<br />
Jungen bei einem medizinisch<br />
nicht notwendigen Eingriff „unnötige<br />
Schmerzen“ ersparen. Was heißt für<br />
Sie „unnötig“?<br />
Beschneidung bei Neugeborenem<br />
Tillig: Die Ärzte müssen dafür sorgen,<br />
dass bei der Prozedur für die Kinder<br />
keinerlei Schmerzen entstehen<br />
und auch danach eine ausreichende<br />
Schmerzbehandlung garantiert ist.<br />
Das war immer eine unserer Minimalforderungen.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Im Jüdischen Krankenhaus<br />
in Berlin verlässt man sich bei der<br />
Neugeborenen-Beschneidung in den<br />
ersten 14 Lebenstagen allein auf<br />
die Verwendung der „Emla-Salbe“,<br />
obwohl eine ausreichend betäubende<br />
Wirkung hierfür mittlerweile von<br />
MICHAEL NAGLE / NEW YORK TIMES / REDUX / LAIF<br />
Experten angezweifelt wird. Ist das<br />
vertretbar?<br />
Tillig: Nein, dieses Vorgehen erfüllt<br />
offenbar lediglich eine Alibifunktion.<br />
Dem Beschneidungsgesetz soll so<br />
Genüge getan werden, aber man missachtet<br />
die erforderliche Sorgfalt<br />
gegenüber den Kindern. Eine Beschneidung<br />
ohne Schmerzausschaltung ist<br />
aus unserer ärztlichen Sicht Kindesmisshandlung.<br />
Damit meine ich auch<br />
Beschneidungen unter ausschließlicher<br />
Verwendung dieser Salbe.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Welche Alternative wäre<br />
denkbar?<br />
Tillig: Eine Lösung des Problems kann<br />
nur von den Kollegen am Jüdischen<br />
Krankenhaus kommen. Die Krux ist:<br />
Eine Narkose, die hier eigentlich erforderlich<br />
wäre, verbietet sich, da es bei<br />
Neugeborenen keine medizinische Notwendigkeit<br />
für eine Beschneidung gibt.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Nach Angaben der Kassenärztlichen<br />
Bundesvereinigung ist die<br />
Zahl der ambulanten Beschneidungen<br />
von Jungen im Alter von null bis fünf<br />
Jahren zwischen 2008 und 2011 um<br />
34 Prozent gestiegen. Weshalb ist das<br />
Ihrer Meinung nach so?<br />
Tillig: Dafür wird es mehrere Antworten<br />
geben. Fest steht, dass eine medizinische<br />
Indikation allein nicht die<br />
Ursache sein kann. Die Daten müssen<br />
nun zunächst transparent und differenziert<br />
analysiert werden. Die Deutsche<br />
Gesellschaft für Kinderchirurgie<br />
bemüht sich um Aufklärung und ruft<br />
alle beteiligten Fachgesellschaften<br />
aus den Disziplinen Urologie und Chir -<br />
urgie zur Mithilfe auf.<br />
KOMMENTAR<br />
Schluss mit der<br />
Klimakonferenz!<br />
Von Gerald Traufetter<br />
Zu einem der Rituale bei Weltklimakonferenzen<br />
zählt der Preis „Fossil<br />
des Tages“. Das war auch in Warschau<br />
nicht anders; und die Schmäh-Auszeichnungen<br />
fielen den üblichen Verdächtigen<br />
zu: dem Kohleland Polen,<br />
dem Erdölexporteur Saudi-Arabien.<br />
Doch bislang sind die Umweltaktivisten,<br />
die jenen Preis vergeben, noch<br />
nicht auf die Idee gekommen, die<br />
Veranstaltung selbst zum Fossil zu erklären.<br />
Die Zeit wäre reif. Im EM-Stadion der<br />
polnischen Hauptstadt, in dem die<br />
Konferenz stattfand, herrschte eine<br />
gespenstische Atmosphäre. Natürlich,<br />
alle waren sich mal wieder einig:<br />
Nicht weniger als die Zukunft der<br />
Menschheit entscheide sich bei diesem<br />
Treffen. Doch über das eigentliche<br />
Ziel, nämlich Treibhausgase zu reduzieren,<br />
redet mittlerweile kaum mehr<br />
jemand.<br />
Die Klimakonferenz ist nämlich gar<br />
keine mehr. Es ist eine Konferenz zum<br />
Thema Entwicklungshilfe, denn dar -<br />
um geht es hier: um Milliarden für die<br />
Ärmsten, um sich gegen Dürren und<br />
Fluten zu schützen.<br />
Die Delegierten sind es nicht, die<br />
das Klima retten werden. Das werden<br />
Ingenieure erledigen, indem sie<br />
die Energiewende vorantreiben, das<br />
heißt auf lange Sicht erneuerbare<br />
Energien billiger machen als Kohle<br />
und Kernkraft. It’s the economy,<br />
stupid.<br />
Was Windkraft betrifft, wird diese<br />
Schwelle bald überschritten. Bei der Solarenergie<br />
spielt sich die Revolution weiter<br />
südlich ab. Dort wird von den Solarpaneelen<br />
jene Milliarde Menschen profitieren,<br />
die bislang ohne Strom lebt.<br />
Längst hat sich China auf den Weg zur<br />
Energiewende gemacht. In Warschau<br />
zählte der Generalsekretär des chinesischen<br />
Ökostrom-Verbandes genüsslich<br />
auf, in welch gigantischem Ausmaß<br />
die Volksrepublik in Sonnenenergie,<br />
Wind- und Wasserkraft investiert.<br />
Dann sagte er lächelnd, dass es keiner<br />
Einsparziele beim Kohlendioxid be -<br />
dürfe, wenn im Jahr 2050 die meiste<br />
Energie sowieso aus klimafreund -<br />
lichen Quellen stamme. Recht hat er.<br />
Die technischen Probleme der Er -<br />
neuerbaren müssen schnell gelöst werden.<br />
Doch das werden sie ganz bestimmt<br />
nicht in den überheizten Sälen<br />
der Weltklimakonferenz.<br />
132<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3
Wissenschaft · Technik<br />
Puschel am Po Ein wunderlich<br />
aussehendes Insekt überraschte<br />
ein Team von Wissenschaftlern<br />
auf ihrer Expedition<br />
durch den Regenwald Surinams:<br />
Das Tier ist etwa fünf Millimeter<br />
lang und hat einen markanten<br />
Büschel aus Wachsfäden am Hinterleib.<br />
Es machte den Forschern<br />
gleich zweimal Ärger. Erstens:<br />
Es ließ sich nicht bestimmen, ist<br />
noch zu jung dafür, im Larven -<br />
stadium der Entwicklung. Klar, es<br />
gehört zu den Zikaden, aber zu<br />
welcher Art? Zweitens: Es ließ<br />
sich nicht fangen, nur fotografieren.<br />
Jetzt wird man niemals<br />
wissen, was das Geschöpf mal<br />
wird, wenn es groß ist.<br />
p s y C h o L o g i E<br />
SMS schaden der Liebe<br />
Dass es kein guter stil ist, eine Beziehung<br />
per Telefonat zu beenden, ist bekannt.<br />
Doch auch wer meint, existentielle<br />
Fragen der partnerschaft per<br />
kurznachricht klären zu können, dürfte<br />
schlecht beraten sein. Wissen -<br />
schaftler der amerikanischen Brigham<br />
young University folgten den sMsgewohnheiten<br />
von 276 jungen Leuten,<br />
die Ehe- oder jedenfalls feste partner<br />
TEUTOPRESS / IMAGO<br />
CATERS NEWS<br />
hatten. Das Ergebnis: ständige kommunikation<br />
per sMs kann das Liebes -<br />
verhältnis im echten Leben schwächen.<br />
Über 80 prozent der Teilnehmer gaben<br />
an, mehrmals täglich mit ihrem<br />
partner über kurzbotschaften zu kommunizieren.<br />
Viele der paare schickten<br />
sich nicht nur Alltägliches, sondern<br />
auch Texte, in denen sie ihre Beziehung<br />
verhandelten. Dabei ließ sich ein<br />
Unterschied zwischen Frauen und<br />
Männern feststellen: sMs, die für Entschuldigungen,<br />
zur Entscheidungs -<br />
findung oder zur Lösung von Differenzen<br />
genutzt wurden, assoziierten<br />
Frauen mit einer schlechten Beziehungsqualität.<br />
Bei Männern führte dagegen<br />
vor allem eine hohe Zahl von<br />
Nachrichten dazu, dass sie ihre Beziehung<br />
als schlechter einschätzten.<br />
„kurznachrichten verengen den Blick<br />
und verhindern, dass man den anderen<br />
in all seinen Facetten sieht“, sagt<br />
Jonathan sandberg, einer der Autoren.<br />
Nachrichten mit kleinen Nettigkeiten<br />
wurden hingegen sowohl von Männern<br />
als auch von Frauen positiv bewertet.<br />
Dabei wurde das Absenden<br />
sogar deutlich höher eingeschätzt als<br />
das Erhalten.<br />
B i o p h y s i k<br />
Fett weg im Schlaf<br />
Fett zu verbrennen und sich dafür nicht bewegen zu müssen<br />
– das wäre der Traum vieler Menschen. Ein Eiweiß im<br />
körper könnte da helfen: Mit hilfe des proteins UCp1 hal -<br />
ten sich jedenfalls winterschlafende Tiere, aber auch Babys<br />
warm, ohne dafür einen Muskel bewegen zu müssen. UCp1<br />
findet sich beim Menschen ausschließlich im sogenannten<br />
braunen Fettgewebe. Lange dachten Wissenschaftler, dass<br />
es nach den Babyjahren verschwinde, bis sie vor einigen Jahren<br />
kleine inseln davon auch bei Erwachsenen fanden. Ein<br />
Forscherteam der Veterinärmedizinischen Universität Wien<br />
hat nun entdeckt, dass eine spezielle Aldehydverbindung<br />
das UCp1 aktivieren kann. „Fänden wir heraus, wie dieses<br />
protein reguliert werden kann, könnten wir eventuell auch<br />
die Fettverbrennung ankurbeln“, sagt Elena pohl, Biophy si -<br />
kerin an der Wiener Uni. Die Forscher hoffen, einen<br />
Ansatz zur Fettverbrennung im körper gefunden zu haben<br />
und damit langfristig Fettleibigkeit therapieren zu können.<br />
d e r s p i e g e l 4 8 / 2 0 1 3 133
Grundschülerin bei Schreibübung<br />
B I L D U N G<br />
Tiger mit „ie“<br />
Viele deutsche Schüler lernen, nach Lauten zu schreiben – oft mit katastrophalen<br />
Spätfolgen für die Orthografie. Daran dürfte sich in Zukunft wenig ändern.<br />
Etliche angehende Lehrer haben selber Schwierigkeiten mit ihrer Muttersprache.<br />
134<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3
Wissenschaft<br />
UTE GRABOWSKY (L.); DDP IMAGES (O.)<br />
Andrea Krug wollte wissen, was<br />
ihre achtjährige Tochter in der<br />
Schule eigentlich den ganzen Tag<br />
über so macht. Deshalb hospitierte sie,<br />
wie dies auch andere Eltern gelegentlich<br />
tun, im Unterricht.<br />
Zunächst war Krug (die ihren echten<br />
Namen zum Schutz der Tochter hier nicht<br />
nennen will) ziemlich begeistert. Die Kinder<br />
zeigten sich fröhlich, lernwillig und<br />
konzentriert, die Lehrerin war außer -<br />
ordentlich nett und das Thema im Sachunterricht<br />
spannend, es ging um Katzen.<br />
„Welche Katzen gibt es?“, war eine der<br />
Fragen, zu der die Kinder Antworten sammelten,<br />
die die Lehrerin dann an die Tafel<br />
schrieb. Unter „Hauskatze“, „Löwe“ und<br />
„Siamkatze“ schrieb sie „Tieger“.<br />
Tiger mit „ie“.<br />
Krug hielt die Luft an. „Um es milde<br />
auszudrücken“, sagt sie, „ich war be -<br />
fremdet.“<br />
Dass sich die Rechtschreibleistung von<br />
Schülern in den vergangenen Jahrzehnten<br />
dramatisch verschlechtert hat, belegen<br />
inzwischen mehrere Studien. Viele<br />
Experten machen das lautgetreue Schreiben<br />
in den ersten Schuljahren dafür verantwortlich.<br />
Unter viel Lob bringen die<br />
Kinder nach diesem Konzept Wörter wie<br />
„fil“ (statt „viel“) zu Papier, „ir“ („ihr“)<br />
oder „ser“ („sehr“). Eltern und Wissenschaftler,<br />
ja sogar einige Schüler fordern<br />
inzwischen die Rückkehr zu einem Unterricht,<br />
bei dem von Anfang an auf korrekte<br />
Schreibweise geachtet wird.<br />
Doch die ersten Jahrgänge fröhlicher<br />
Rechtschreibanarchisten sind inzwischen<br />
erwachsen geworden – und einige von<br />
ihnen Lehrer. Es deutet vieles darauf hin,<br />
dass etliche von ihnen gar nicht mehr die<br />
Voraussetzungen dafür mitbringen, Kindern<br />
richtiges Schreiben beizubringen.<br />
Das belegt auch eine teilweise noch<br />
unveröffentlichte Studie der Universität<br />
Duisburg-Essen: Die Forscher haben Lehramtsstudenten<br />
dreier nordrhein-westfälischer<br />
Hochschulen jeweils zwei verschiedenen<br />
Tests unterzogen. Mit dem ersten<br />
wurden die allgemeinen Sprach- und<br />
Rechtschreibfähigkeiten von fast 2900 Studenten<br />
geprüft. Dabei erwies sich jeder<br />
fünfte angehende Lehrer als stark oder<br />
sehr stark förderbedürftig.<br />
Im zweiten Test, an dem fast 300 Studenten<br />
teilnahmen, sollte ein Zeitungs -<br />
artikel mit eigenen Worten zusammen -<br />
gefasst werden. Jeder achte künftige Päd -<br />
agoge gebrauchte dabei vielfach Wörter<br />
im falschen Sinnzusammenhang, mehr<br />
als jeder dritte machte häufig Grammatikfehler.<br />
Studierende mit Migrations -<br />
hintergrund, die noch schlechter abschnitten,<br />
sind dabei nicht mitgerechnet.<br />
„Der Test war leichter als eine Abituraufgabe“,<br />
sagt Studienautor Dirk Scholten-Akoun<br />
vom Zentrum für Lehrer -<br />
bildung der Universität Duisburg-Essen.<br />
Trotzdem hätten viele Teilnehmer of -<br />
fenbar die Struktur des Zeitungstextes<br />
gar nicht verstanden. „Und Orthografie<br />
und Kommasetzung waren oft katastrophal.“<br />
Verzweifelte Studenten wenden sich<br />
gern an Peter Kruck, der als freier Lektor<br />
Seminar- und Examensarbeiten „aufpoliert“,<br />
wie er sagt. Was er, auch von Lehramtsstudenten,<br />
auf den Schreibtisch bekommt,<br />
klingt dann zum Beispiel so: „Folgedessen<br />
hat sich die Medienpädagogik<br />
in den letzten Jahren zu einer wichtigen<br />
Abteilung gereift.“ Oder so: „Vermutlicher<br />
weise sind die ankündigten Schlüsse<br />
eine vielmehr allgemeine negative Sichtweise<br />
des Fernsehverbrauchs von Kindern<br />
wiederspiegeln.“<br />
Eine <strong>SPIEGEL</strong>-Umfrage, auf die 22<br />
Hochschulen mit dem Studienangebot<br />
Grundschullehramt antworteten, ergab,<br />
dass zwar einige Universitäten Rechtschreibkontrollen<br />
im Studium durchführen<br />
– dass aber an keiner der Unis ein<br />
Rechtschreibtest vor dem Studium bestanden<br />
werden muss. „Dabei wären solche<br />
Tests eine Chance, Studenten, die Probleme<br />
haben, rechtzeitig zu erkennen und in<br />
Vorkursen auf das für Lehrer erforderliche<br />
Niveau zu bringen“, glaubt Kruck.<br />
Zwar können schwache Studenten heute<br />
an vielen Hochschulen Rechtschreibwerkstätten<br />
oder -kurse besuchen. Aber<br />
das reicht oft nicht. „Wie sollen wir diesen<br />
Studenten im universitären Rahmen noch<br />
helfen?“, fragt Albert Bremerich-Vos, Professor<br />
für Linguistik an der Universität<br />
Duisburg-Essen und Leiter der Studentenstudie.<br />
„Das müssten sie doch eigentlich<br />
alles in der Schule lernen.“<br />
Um Grundschülern Rechtschreibung<br />
und Grammatik beibringen zu können,<br />
muss man die deutsche Sprache aber<br />
nicht nur beherrschen, sondern auch verstehen.<br />
Nur wer wisse, dass die 35 häufigsten<br />
Wortbausteine 50 Prozent eines<br />
Textes ausmachen, sagt Gisela Dorst, Autorin<br />
des Sprachbuchs „Lollipop“, dem<br />
sei klar, wie wichtig es ist, diese Morpheme<br />
korrekt schreiben zu können (siehe<br />
Interview Seite 136). „Wenn ich das aber<br />
nie im Studium gelernt habe, dann bringe<br />
ich das den Schülern auch nicht bei.“<br />
Doch bei manchen Studierenden hapere<br />
es schon bei den einfachsten Fragen,<br />
sagt Bremerich-Vos. „Zum Beispiel bei<br />
der Bestimmung der Wortart oder der<br />
Satzglieder. Das sollte eigentlich spätestens<br />
in der sechsten oder siebten Klasse<br />
gemacht werden – aber es ist nicht da.“<br />
Die <strong>SPIEGEL</strong>-Umfrage ergab, dass manche<br />
Hochschulen immer noch darauf verzichten,<br />
Vorlesungen zu den Grundlagen<br />
der Sprachwissenschaft für alle Grundschullehramtsstudenten<br />
vorzuschreiben.<br />
Erst ab 2018, so die Kultusminister kon -<br />
ferenz, sollen „fachwissenschaftliche und<br />
-didaktische Studieninhalte aus den<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3 135
Fächern Deutsch und Mathematik“ für alle<br />
Studierenden verpflichtend sein.<br />
Doch selbst wenn diese Veranstaltungen<br />
an einer Universität vorgeschrieben sind,<br />
heißt das nicht, dass die angehenden Lehrer<br />
mit den dort gelehrten Inhalten auch<br />
etwas anfangen können. „Oft ist eine solche<br />
Vorlesung viel zu abstrakt“, kritisiert<br />
Günther Thomé, Sprachdidaktiker an der<br />
Goethe-Universität Frankfurt. „Viele Linguistikprofessoren<br />
verstehen nichts von<br />
Didaktik – aber andererseits die Pädagogikprofessoren<br />
auch nichts von Sprach -<br />
wissenschaft.“ Es fehle an Sprachdidaktikprofessoren.<br />
Sein Fazit: „Die Deutschlehrerausbildung<br />
ist mangelhaft.“<br />
Allerdings interessierten sich auch<br />
nicht alle Studenten für die Sprachwissenschaften,<br />
sagt Renate Valtin vom Vorstand<br />
der Deutschen Gesellschaft für<br />
Lesen und Schreiben. Wenn sie in der<br />
Vorlesung das Wort „Graphem“ erwähnt<br />
habe, berichtet die Professorin, „war bei<br />
einigen Studenten sofort die Aufmerksamkeit<br />
weg.“ Und bei der Nennung von<br />
„Graphem-Phonem-Korrespondenzen“,<br />
da muss Valtin selbst ein bisschen lachen,<br />
„sind die ersten rausgerannt“.<br />
Hinzu kommt, dass die Unis der Methode<br />
des lautgetreuen Schreibens ohne Fehlerkorrektur<br />
nicht viel entgegensetzen –<br />
auch wenn dieses Konzept von vielen Experten<br />
für die Rechtschreibkatastrophe verantwortlich<br />
gemacht wird. Nur zwei Hochschulen,<br />
Freiburg und Oldenburg, gaben<br />
in der <strong>SPIEGEL</strong>-Umfrage an, die angehenden<br />
Grundschullehrer explizit vor der entsprechenden<br />
Methode „Lesen durch Schreiben“<br />
zu warnen. Alle anderen Universi -<br />
täten teilten mit, sie würden den Studenten<br />
jenes Konzept lediglich wissenschaftlich<br />
mit seinen Vor- und Nachteilen darstellen.<br />
Aber das wappnet die zukünftigen Lehrer<br />
womöglich schlecht für die Realität:<br />
Schulen, die seit Jahren mit „Lesen durch<br />
Schreiben“ arbeiten, Fortbildungen mit charismatischen<br />
Vertretern des Konzeptes und<br />
ein Grundschulverband, der von Verfechtern<br />
dieser und ähnlicher Methoden dominiert<br />
wird und in seiner Verbandszeitschrift<br />
aggressiv gegen Gegner Stellung bezieht.<br />
Vor allem aber ist die Lautschreiberei<br />
ohne Korrektur einfach herrlich bequem<br />
im Schulalltag. Es gibt sie nun einmal:<br />
durchschnittliche und schlechte Lehrer,<br />
und „Lesen durch Schreiben“ gebe ihnen<br />
„ein quasi wissenschaftliches Alibi, sich<br />
weniger steuernd und fördernd zu engagieren“,<br />
sagt Wolfgang Steinig, Sprach -<br />
didaktiker an der Uni Siegen.<br />
Denn die Verfechter von „Lesen durch<br />
Schreiben“ gehen davon aus, dass es sich<br />
beim Schreibenlernen um einen natür -<br />
lichen Entwicklungsprozess handelt, irgendwann<br />
könne ein Schüler das dann<br />
schon. „Aber viel zu viele Kinder“, sagt<br />
Steinig, „schaffen es leider nie zu einem<br />
einigermaßen angemessenen Niveau.“<br />
VERONIKA HACKENBROCH<br />
136<br />
MATTHIAS GROPPE / <strong>DER</strong> <strong>SPIEGEL</strong><br />
„Von Mutter zu Futter“<br />
Wie bringt man Kindern die Schriftsprache von Anfang an richtig<br />
bei? Die Rechtschreibexpertin Gisela Dorst erklärt,<br />
wie wichtig es ist, schon die ganz Kleinen zu korrigieren.<br />
Dorst, 61, Lehrerin und Fachleiterin<br />
Deutsch aus Naumburg/Hessen, hält es<br />
für einen Irrweg, Kinder lange Zeit lautgetreu<br />
schreiben zu lassen, bevor erste<br />
Rechtschreibregeln eingeführt werden.<br />
Das ist bei der Lehrmethode „Lesen durch<br />
Schreiben“ und ihren Ablegern üblich,<br />
etwa bei dem vor allem in Nordrhein-<br />
Westfalen verbreiteten „Tinto“-Lehrgang,<br />
der „Rechtschreibwerkstatt“ oder Fibeln<br />
wie „Zebra“ und „Konfetti“. Die Anlauttabelle,<br />
in der jedem Buchstaben ein Gegenstand<br />
oder Tier zugeordnet ist, etwa<br />
der Igel dem I, macht es den Kindern<br />
möglich, schon früh eigene Texte zu verfassen.<br />
Ob sie orthografisch korrekt schreiben,<br />
spielt keine Rolle. Aus mehr als drei<br />
Jahrzehnten Berufserfahrung hat Dorst für<br />
das Sprachbuch „Lollipop“ ein Konzept<br />
entwickelt, mit dem die Schüler von Anfang<br />
an richtig schreiben lernen sollen.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Ihr Konzept schnitt in einer Studie<br />
um Längen besser ab als die von der<br />
Methode „Lesen durch Schreiben“ in -<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3<br />
spirierte „Rechtschreibwerkstatt“. Was<br />
macht „Lollipop“ anders?<br />
Dorst: Entscheidende Weichen werden<br />
schon am Anfang der ersten Klasse gestellt.<br />
Nie wird der falsche Eindruck<br />
erweckt, das Deutsche hätte eine laut -<br />
getreue Schreibweise, in der alles so<br />
geschrieben wird, wie es klingt. Im Gegenteil.<br />
Bei uns machen die Lehrer und<br />
Lehrerinnen von Anfang an klar: Viele<br />
Wörter schreibt man nicht so, wie sie<br />
klingen. Wer richtig schreiben will, muss<br />
etwas über die Wörter wissen.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Und das wird schon in den ersten<br />
Wochen nach dem Schulstart vermittelt?<br />
Dorst: Ja, absolut, je früher, desto besser.<br />
Die Buchstaben müssen langsam und<br />
gründlich eingeführt werden, und alle<br />
Kinder lernen zum Beispiel von Anfang<br />
an, dass ein Vokal lang oder kurz klingen<br />
kann. Beim kurzen a in „Lack“ etwa klatschen<br />
sie dann in die Hände und markieren<br />
ihn, wenn sie ihn schreiben, mit einem<br />
Punkt. Beim langen a in „Lama“<br />
hingegen ziehen sie die Hände ausein -
Technik<br />
A U T O M O B I L E<br />
Artisten<br />
des Prüfstands<br />
Nicht nur der Diesel rußt,<br />
auch Benziner stoßen Partikel aus.<br />
Filter würden helfen,<br />
aber die sind der Autoindustrie<br />
offenbar zu teuer.<br />
Vom Feind zu lernen gilt im Kriegshandwerk<br />
als Zeichen besonderer<br />
Klugheit. Die Entwickler von Benzinmotoren<br />
gingen vor gut zehn Jahren<br />
einen ähnlichen Weg: Sie entliehen der<br />
Dieseltechnik die dort bereits bewährte<br />
Direkteinspritzung des Kraftstoffs in den<br />
Zylinder.<br />
Das Prinzip wurde erneut ein Erfolg –<br />
und der Benziner dem Dieselmotor immer<br />
ähnlicher. Er übernahm dessen Tugend,<br />
die Sparsamkeit, aber auch sein<br />
Laster: Bei der Verbrennung bilden sich<br />
Rußpartikel in kritischer Menge.<br />
Der unerwünschte Effekt ist dem hohen<br />
Tempo geschuldet, mit dem sich das<br />
Benzin-Luft-Gemisch nach der direkten<br />
Einspritzung in die Brennräume der Motoren<br />
bilden muss. Es bleibt schlicht nicht<br />
genug Zeit, alle Kraftstoffmoleküle mit<br />
Sauerstoff zu vereinigen. Ins Abgas entweichen<br />
unvollständig verbrannte, mikroskopisch<br />
kleine Kohlenstoffklümpchen.<br />
138<br />
Moderner<br />
Benzin-Pkw<br />
ohne Partikelfilter<br />
600<br />
Diesel-Pkw<br />
mit Partikelfilter<br />
100<br />
Diesel-Pkw<br />
ohne Partikelfilter<br />
10 000<br />
Kampf den Krümeln<br />
Zahl der Rußpartikel in Autoabgasen,<br />
in Milliarden je gefahrenen Kilometer<br />
Den Zulieferern der Autoindustrie gab<br />
dieses Problem bereits Anlass zu einer neuen<br />
Initiative: Sie entwickelten inzwischen<br />
Prototypen von Rußfiltern für Benzinmotoren.<br />
Als Favorit gilt derzeit ein Kombi-<br />
Instrument namens Vier-Wege-Kat; es besteht<br />
in einer Verschmelzung des üblichen<br />
Drei-Wege-Katalysators, der gasförmige<br />
Gifte unschädlich macht, mit einem Filter,<br />
der den nicht minder schädlichen Schwarzstaub<br />
einfängt und geregelt verbrennt.<br />
Dies sei die günstigste Lösung, erklärt<br />
der leitende Entwickler eines großen Zulieferbetriebs,<br />
der sich offizielle Aussagen<br />
lieber verkneift. Das Thema ist delikat.<br />
Noch sieht es nicht so aus, als wollten die<br />
Autohersteller das Putzgerät überhaupt<br />
haben.<br />
Rußpartikel, so viel ist medizinisch erwiesen,<br />
können tödlich sein; sie steigern<br />
das Lungenkrebsrisiko und sind nicht<br />
ganz unschuldig an Herz-Kreislauf-Erkrankungen.<br />
Für Dieselmotoren, lange<br />
die mit Abstand größten Rußprodu zenten<br />
im Straßenverkehr, wurden deshalb inzwischen<br />
so strenge Abgasgesetze erlassen,<br />
dass Neuwagen nur noch mit Par -<br />
tikelfilter ausgeliefert werden können.<br />
Benziner mit Direkteinspritzung, seit<br />
gut zehn Jahren auf dem Markt und zunächst<br />
nicht als Rußproblem erkannt,<br />
blieben von der Vorschrift verschont. Erst<br />
2017 wird eine EU-Norm den zulässigen<br />
Höchstwert generell auf das<br />
Niveau senken, das heute<br />
schon für Diesel-Pkw gilt: 600 Milliarden<br />
Partikel pro Kilo meter.<br />
Die Zahl scheint absurd hoch, kam<br />
für den Diesel aber einer Filterpflicht<br />
gleich. Denn ohne Filter entlassen diese<br />
Motoren mehr als zehn Billionen Teilchen,<br />
mit Filter nur noch um die hundert<br />
Milliarden.<br />
Bei den betroffenen Benzinmotoren<br />
wird das nun anders aussehen: Die besten<br />
von ihnen bleiben schon heute auch ohne<br />
Filter haarscharf unter dem 600-Milliarden-Limit.<br />
Den Autokonzernen bleibt<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3<br />
also die Chance, sich günstiger aus der<br />
Affäre zu ziehen. Und die werden sie<br />
wohl nutzen.<br />
Kein einziger Hersteller hat bisher<br />
die Absicht bekundet, einen Vier-Wege-<br />
Kat oder separaten Rußfilter im Benzinauto<br />
einzuführen. Volkswagen, Daimler<br />
und BMW erklärten auf Anfrage unisono,<br />
die Hürde nach Möglichkeit mit „innermotorischen<br />
Maßnahmen“ nehmen zu<br />
wollen.<br />
Klaus Land, Leiter der Emissionszertifizierung<br />
der Daimler AG, setzt auf besonders<br />
feine „Piezo-Injektoren“ bei der<br />
Einspritzung; mit diesen, so glaubt er, ließen<br />
sich „die künftigen Gesetzesanforderungen<br />
sicher erfüllen“.<br />
Derlei Maßnahmen können jedoch unter<br />
anderem dazu führen, dass nur solche<br />
Partikel aus dem Abgas verschwinden,<br />
die größer als 23 Nanometer sind und<br />
damit ins Prüfspektrum fallen. Kleinere<br />
Rußteile bleiben bei der amtlichen<br />
Abgasmessung noch immer<br />
unberücksichtigt, sind aber<br />
nach Schätzung von Medizinern<br />
noch schädlicher, weil sie<br />
besonders tief in die Atemwege<br />
dringen. Und genau diese<br />
Minipartikel könnten durch die<br />
innermotorischen Kunstgriffe<br />
vermehrt entstehen. Eine wissenschaftliche<br />
Untersuchung im Auftrag<br />
der EU warnt ausdrücklich<br />
vor dieser Tendenz.<br />
Obendrein wird die Prüfstand-Artistik<br />
im Jahr 2017<br />
noch durch weitere neue Vorschriften<br />
erschwert. So will die<br />
EU unter dem Begriff „Real Driving<br />
Emis sions“ (RDE) Abgasmessungen<br />
an beliebig ausgewählten<br />
Autos im realen Fahr betrieb<br />
durchführen lassen, deren Ergebnisse<br />
nur um einen bestimmten (noch nicht<br />
festgelegten) Faktor von den Normangaben<br />
abweichen dürfen.<br />
Tests des ADAC und Untersuchungen<br />
im Auftrag der EU-Kommission haben<br />
bereits gezeigt, dass der Rußausstoß bei<br />
Autobahnfahrten um ein Vielfaches<br />
über dem des amtlichen Normwerts<br />
liegt. Den Realitätscheck werden die Autohersteller<br />
nur bestehen können, wenn<br />
sie sich einen entsprechend hohen Überschreitungsfaktor<br />
einräumen lassen.<br />
Doch dann wäre das ganze Projekt eine<br />
Farce.<br />
Die schon beim Diesel bewährten Filter<br />
hingegen könnten all diese Trickserei<br />
überflüssig machen. Sie fangen mehr als<br />
99 Prozent der Partikel ein. Selbst auf<br />
Messfahrt bei Vollgas bliebe ein Benzinauto<br />
mit diesem Gerät weit unter dem<br />
zulässigen Grenzwert.<br />
Ein in Großserie produzierter Rußfilter<br />
für einen Standard-Pkw kostet etwa hundert<br />
Euro – offenbar zu viel für die Autohersteller.<br />
CHRISTIAN WÜST
Wissenschaft<br />
Die Website der chinesischen<br />
Organhändler<br />
klingt fast schon poetisch:<br />
„Mehr und mehr sterbende<br />
Patienten aus der ganzen<br />
Welt kommen nach China auf<br />
der Suche nach Wiedergeburt.“<br />
Für diese Klientel bietet die<br />
Agentur unter der Internetadresse<br />
www.cntransplant.com<br />
den geeigneten Service. Chinesische<br />
Ärzte seien weltweit anerkannt,<br />
der Erfolg der Transplantationen<br />
betrage fast 100<br />
Prozent. Und vor allem: „Leben<br />
ist unbezahlbar.“<br />
Heißt das, ausländische Patienten<br />
mit entsprechend dickem<br />
Portemonnaie kommen<br />
in China tatsächlich an neue Organe?<br />
Wer dies überprüfen will,<br />
muss nur ein bereitgestelltes<br />
Formular auf der Cntransplant-<br />
Website ausfüllen – etwa mit<br />
den Daten eines fiktiven 47-jährigen<br />
Patienten namens Hartmut<br />
Schmidt, der eine neue<br />
Niere braucht, aber noch bei so<br />
guter Gesundheit ist, dass er in<br />
Deutschland wenig Chancen<br />
auf eine baldige Transplanta - Cntransplant-Internetseite: „Garantiert eine gute Niere“<br />
tion hat.<br />
Nur Stunden später antwortet ein Arzt Den ausländischen Kunden von<br />
der chinesischen Agentur, es sei „kein Cntransplant geht es da deutlich besser.<br />
Problem hier“, eine neue Niere zu bekommen,<br />
nur der Preis sei aufgrund der Agentur Herrn Schmidt, er werde „ga-<br />
In einer weiteren Mail versichert die<br />
Knappheit etwas gestiegen: 350000 Dollar,<br />
inklusive Klinikkosten und Unterbrin-<br />
werden viele internationale Patienten<br />
rantiert eine gute Niere“ bekommen. „Sie<br />
gung. Falls der Patient einen eigenen hier sehen, und die Chirurgen sind sehr<br />
Spender mitbringe, gestalte sich die Sache<br />
deutlich billiger: 55000 Dollar. Für einen ersten medizinischen Check<br />
erfahren.“<br />
Spenderorgane sind in China extrem solle er einfach nach Peking fliegen, wo<br />
knapp. Zwar liegt das Land, was die absolute<br />
Zahl von Nieren- und Lebertrans-<br />
werde: „Informieren Sie mich ein paar<br />
er auf Wunsch am Flughafen abgeholt<br />
plantationen betrifft, weltweit auf Platz Tage vor Ihrem Flug.“ Die Kosten für die<br />
zwei, hinter den USA. Inzwischen verzeichnen<br />
die zuständigen Stellen in der Hartmut Schmidt solle sie bar begleichen:<br />
Untersuchungen lägen bei 3500 Dollar,<br />
Regierung aber einen Abwärtstrend: Während<br />
2004 noch mehr als 12000 Nieren Sie im Hotel sind.“<br />
„Die Geldübergabe an mich erfolgt, wenn<br />
und Lebern verpflanzt wurden, waren es Zwar ist der Organhandel seit 2007<br />
im vorigen Jahr nur noch knapp 7900. auch in China gesetzlich verboten, doch<br />
Offiziellen Schätzungen zufolge warten der Graumarkt wird von Peking bis heute<br />
rund 1,5 Millionen Chinesen auf eine offenbar geduldet. Daher bietet die Agentur,<br />
die mit Hartmut Schmidt Hundert-<br />
Transplantation – weniger als ein Prozent<br />
der Patienten dürfen in China auf ein neues<br />
Herz, eine Niere oder Leber hoffen. Dienste unverhohlen im Internet<br />
tausende Dollar verdienen will, ihre<br />
an.<br />
140<br />
M E D I Z I N<br />
„Geldübergabe im Hotel“<br />
China will sich von der Praxis verabschieden, Organe exekutierter<br />
Strafgefangener zu transplantieren. Doch der<br />
Handel mit Nieren, Lebern und Lungen floriert noch immer.<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3<br />
International geächtet ist die chinesische<br />
Methode der Organbeschaffung:<br />
Noch heute stammen mehr als die Hälfte<br />
aller Nieren, Lebern oder Lungen, die<br />
transplantiert werden, von exekutierten<br />
Häftlingen. Insgesamt wurden in China<br />
seit 1969 nach zurückhaltender Schätzung<br />
mehr als 100000 Organe getöteten Häftlingen<br />
entnommen.<br />
Womöglich sind in China Gefangene<br />
gar auf Bestellung hingerichtet worden.<br />
So ließe sich erklären, dass angereiste<br />
Herzpatienten in anderen Ländern<br />
der Welt monatelang auf<br />
eine Transplantation warten<br />
müssen, Ausländer in China<br />
aber durchaus innerhalb von nur<br />
zwei Wochen ein neues Herz bekommen<br />
können, wie zwei israelische<br />
Patienten berichten.<br />
Eines der Grundprinzipien<br />
der Transplantationsmedizin ist<br />
die Freiwilligkeit. Angeblich<br />
stimmen auch die Gefangenen<br />
in China der Organentnahme<br />
„freiwillig“ zu, doch der Weltärztebund<br />
sowie die interna -<br />
tionale Transplantationsgesellschaft<br />
TTS erkennen dies nicht<br />
an. Gefängnisinsassen könnten<br />
nicht frei entscheiden – deshalb<br />
dürften ihre Organe grundsätzlich<br />
nicht verwendet werden.<br />
Die anrüchige Praxis führte<br />
in den vergangenen Jahren zur<br />
Isolation Chinas. Wer sich als<br />
Chirurg im Reich der Mitte mit<br />
der Transplantation von Organen<br />
Hingerichteter die Hände<br />
schmutzig macht, darf weder<br />
auf internationalen Kongressen<br />
Forschungsergebnisse präsen -<br />
tieren noch in hochrangigen<br />
Fachzeitschriften publizieren.<br />
Selbst die Reise in die USA ist<br />
erschwert: Laut US-Bundesrecht kann<br />
Personen, die an einer erzwungenen Organentnahme<br />
beteiligt waren, die Einreise<br />
verweigert werden.<br />
Aus dieser Schmuddelecke will China<br />
jetzt raus: Mehrmals verkündete der frühere<br />
Vize-Gesundheitsminister Huang Jiefu<br />
bereits, man wolle die „Abhängigkeit“<br />
von den Organen Exekutierter beenden.<br />
Langfristig bleibt China auch gar nichts<br />
anderes übrig, denn die Zahl der Hinrichtungen<br />
geht zurück. Zudem sind Strafgefangene<br />
häufig mit Hepatitis B infiziert.<br />
Bisher folgten den chinesischen Versprechungen<br />
oft keine Taten. Die jüngste<br />
Ankündigung jedoch hat den Segen von<br />
höchster Stelle: Die chinesische Gesundheitsministerin<br />
Li Bin erklärte, dass China<br />
ab Mitte nächsten Jahres gar keine Organe<br />
hingerichteter Häftlinge mehr verwenden<br />
wolle. Auch der Organhandel solle<br />
unterbunden werden.<br />
Der Schwenk passt zur Charme-Offensive,<br />
die die chinesische Regierung in die-
Zurschaustellung Strafgefangener in Ostchina 2004: Auf Bestellung hingerichtet?<br />
sen Tagen der Welt präsentiert: Umerziehungslager<br />
gehörten abgeschafft, die<br />
Ein-Kind-Politik gelockert, den Bauern<br />
sollten mehr Rechte eingeräumt werden.<br />
Für die Transplantation versprach Li<br />
Bin nicht nur den Abschied von ver -<br />
werflichen Praktiken, sondern präsentierte<br />
einen Fünfpunkteplan für ein System<br />
nach westlichen Standards: So soll es<br />
eine computergesteuerte Warteliste geben<br />
und die Organvergabe rein nach<br />
medizinischer Notwendigkeit geregelt<br />
werden. Dem Chinesischen Roten Kreuz<br />
kommt die Aufgabe zu, Organspendekampagnen<br />
im gesamten Land zu organisieren.<br />
Jede Transplantation soll künftig<br />
in einem Register erfasst und das<br />
Befinden des Empfängers in der Folge<br />
beobachtet werden.<br />
TTS feiert die chinesischen Pläne schon<br />
als Durchbruch. Zur Unterzeichnung dieser<br />
sogenannten Hangzhou-Erklärung<br />
Ende Oktober reiste der TTS-Präsident<br />
und Harvard-Professor Francis Delmonico<br />
an, auch sein designierter Nachfolger,<br />
der Australier Philip O’Connell, war zur<br />
Stelle.<br />
China brauche nun internationale Unterstützung,<br />
schreibt Delmonico in einem<br />
Bericht zur Hangzhou-Erklärung. Bereits<br />
jetzt haben TTS und die Weltgesundheitsorganisation<br />
WHO ihre Teilnahme an<br />
einer großen Transplantationskonferenz<br />
im Juni 2014 in China signalisiert. Voraussetzung<br />
sei allerdings, dass der Fünfpunkteplan<br />
umgesetzt sei und keine Organe<br />
von Hingerichteten mehr entnommen<br />
würden.<br />
Allerdings haben erst 40 von 169 lizenzierten<br />
Transplantationszentren erklärt,<br />
dass sie künftig auf Häftlingsorgane verzichten<br />
wollen. Wann die übrigen Kliniken<br />
folgen und ob es Sanktionen geben<br />
wird, wenn Kliniken sich weigern, ist ungewiss.<br />
Wie der seit Jahren gesetzlich verbotene<br />
Organhandel in der Praxis be -<br />
endet werden soll, wird ebenfalls nicht<br />
klar gesagt.<br />
AFP<br />
Wie kommt China aber nun zu Spenderorganen,<br />
wenn die Hauptquelle dafür<br />
versiegt? Wenn aus den Gefängnissen<br />
kein Nachschub mehr kommt?<br />
Als 2010 erstmals die bürgerbasierte<br />
Organspende in einem Pilotprojekt propagiert<br />
wurde, gab es zunächst klägliche<br />
Ergebnisse. Ganze 63 Organspender wurden<br />
im ersten Jahr rekrutiert. Die Sache<br />
nahm erst Fahrt auf, als das Rote Kreuz<br />
die Angehörigen von Verstorbenen im<br />
Gegenzug für eine Organspende finanziell<br />
zu unterstützen begann; mehrere<br />
tausend Dollar erhalten die Familien.<br />
In den ländlichen Regionen Chinas, wo<br />
die meisten Spender rekrutiert werden,<br />
ist das ein Vermögen. Viele Menschen<br />
dort leben unter der Armutsgrenze, mit<br />
einem Einkommen von rund 280 Euro<br />
im Jahr.<br />
So kann die Erfolgsmeldung von Ministerin<br />
Li Bin, wonach man dieses Jahr<br />
bereits 3175 Organe von 1161 verstorbenen<br />
Spendern verzeichnen könne, nicht<br />
wirklich überzeugen. „Angehörigen Geld<br />
für Organe zu bezahlen“, sagt TTS-Präsident<br />
Delmonico, „das widerspricht den<br />
Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation<br />
und der TTS.“ Dies beschädige das<br />
Vertrauen der Bevölkerung in das neue<br />
System; deshalb seien weitere Gespräche<br />
nötig, sagt Delmonico dem <strong>SPIEGEL</strong>.<br />
Es sind vor allem Mediziner aus den<br />
USA, die seit vielen Jahren die chinesische<br />
Regierung beraten: teils ganz offiziell<br />
wie Wu Youmin aus dem US-Bundesstaat<br />
New York und Michael Millis,<br />
Cheftransplanteur der University of Chicago;<br />
und teils inoffiziell, wie es der TTS-<br />
Funktionär John Fung nach eigenen Angaben<br />
tut. Alle drei Chirurgen haben an<br />
ihrer jeweiligen US-Klinik chinesische<br />
Ärzte in der Transplantationsmedizin<br />
weitergebildet. Millis hat zudem eine Kooperation<br />
seiner Uni versität mit dem Peking<br />
Union Medical College in Gang gesetzt,<br />
Wu Youmin ein Lebertransplantationsprogramm<br />
in China aufgebaut.<br />
Fung teilt auf Anfrage mit, er engagiere<br />
sich seit 20 Jahren in der Ausbildung chinesischer<br />
Transplanteure. In zwei Fällen<br />
habe er in China zu Demonstrations -<br />
zwecken bei einer Lebertransplantation<br />
assistiert. Zur Quelle der transplantierten<br />
Organe äußert er sich nicht.<br />
Auch das Deutsche Herzzentrum in<br />
Berlin (DHZB) arbeitet mit mehr als 30<br />
Krankenhäusern in China zusammen, dar -<br />
unter Transplantationskliniken. Auf die<br />
Frage, wie viele Herzen dort unter Be -<br />
teiligung von DHZB-Mitarbeitern trans -<br />
plantiert wurden und woher die Organe<br />
stammten, hat Roland Hetzer, Direktor<br />
des Herzzentrums, bis Freitag voriger Woche<br />
nicht geantwortet. Im Dunkeln bleibt<br />
auch, was man im Herzzentrum davon<br />
hält, exekutierten Strafgefangenen Organe<br />
zu entnehmen.<br />
MARKUS GRILL,<br />
MARTINA KELLER<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3 141
Anschlag auf das Heidelberger Schloss von 1693 (Animation)<br />
C O M P U T E R<br />
Inferno<br />
im Odenwald<br />
Historiker entdecken<br />
die Technik für sich: Mit Hilfe<br />
aus gefeilter Animationen<br />
lassen sie längst vergangene Baudenkmäler<br />
wiederauferstehen.<br />
Ohrenbetäubender Lärm dröhnt<br />
vom Königstuhl her durch das Tal.<br />
Nach mehreren Donnerschlägen<br />
wabern gigantische schwarzgraue Rauchsäulen<br />
durch die liebliche Gegend am Neckar.<br />
Erst als sich der beißende Schwefelrauch<br />
allmählich lichtet, wird das Ausmaß<br />
der Zerstörung sichtbar.<br />
Das über Heidelberg thronende Schloss<br />
der Wittelsbacher ist zu Klump gebombt<br />
worden. „Das muss für die Leute wie 9/11<br />
gewesen sein“, sagt der Mannheimer Historiker<br />
Alexander Schubert.<br />
Das Inferno im Odenwald legte die pfälzische<br />
Zentrale eines der wichtigsten<br />
Adelsgeschlechter Europas in Schutt und<br />
Asche.<br />
Auf Befehl des französischen Königs<br />
hatten Soldaten der royalen Armee das<br />
Fort der pfälzischen Kurfürsten gekapert<br />
und mit Minen zerlegt. Wie die spektakuläre<br />
Sprengung vor sich ging, hat freilich<br />
kein heute noch Lebender gesehen: Das<br />
Drama ereignete sich im September 1693.<br />
Doch nun zeigt ein Film die verhängnisvollen<br />
Vorgänge von einst gestochen<br />
scharf und in Farbe.<br />
144<br />
Technik<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3<br />
CES / FABERCOURTIAL<br />
Für die Ausstellung „Die Wittelsbacher<br />
am Rhein“ der Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen<br />
ließ Historiker Schubert das<br />
Heidelberger Schloss vor und während<br />
der Verwüstung durch die Truppen des<br />
Sonnenkönigs virtuell rekonstruieren. Im<br />
Vogelflug zieht der Blick des Zuschauers<br />
zunächst über den legendären Schloss -<br />
garten, der wegen seiner Pracht von den<br />
damaligen Zeitgenossen als „achtes Weltwunder“<br />
gepriesen wurde.<br />
Dann nähert sich die Kamera dem noch<br />
unversehrten Palast von schräg oben –<br />
eine Perspektive, die in dieser Weise kein<br />
Mensch je auf den vollständigen Prunkbau<br />
der Wittelsbacher genießen konnte.<br />
Die pittoreske Tour endet jäh, wenn<br />
das Bild mächtig zu rumpeln beginnt und<br />
große Teile der steinernen Feste unter der<br />
Wucht der Detonationen bersten.<br />
Die Heidelberger Ruine, Ergebnis dieses<br />
frühneuzeitlichen Militärschlags, haben<br />
voriges Jahr mehr als eine Million<br />
Besucher besichtigt. Besonders Touristen<br />
aus Amerika berauschen sich am Mythos<br />
der illustren Adelssippe, die über Jahrhunderte<br />
große Teile Deutschlands kontrollierte.<br />
Dem Haus Wittelsbach entstammen in<br />
Vergessenheit geratene Provinzfürsten<br />
wie Rudolf I., der Stammler, oder Adolf,<br />
der Redliche; in Erinnerung geblieben<br />
sind Geschichtskundigen Herrscher wie<br />
Ludwig II., der Strenge: Der impulsive<br />
Regent ließ 1256 seine Frau Maria aus Eifersucht<br />
köpfen.<br />
Nach der Sprengung plünderten Anwohner<br />
unbehelligt den prominenten<br />
Steinbruch für ihren privaten Hausbau.<br />
Mehr als 150 Jahre interessierte sich kaum<br />
jemand für Deutschlands bekannteste<br />
Schlossruine. Dann forderten wilhelminische<br />
Kulturbeamte plötzlich die Rekonstruktion<br />
des Gemäuers – es entfaltete<br />
sich eine Debatte ähnlich der über den<br />
Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses<br />
heute.<br />
Doch damals verloren die sentimentalen<br />
Lobbyisten. Um 1900 trat der Denkmalschützer<br />
Georg Dehio auf den Plan<br />
und prägte die Zukunft des zerschossenen<br />
Bauwerks mit einem Motto von zeit -<br />
untypischer Bescheidenheit: „Conserviren,<br />
nicht restauriren“.<br />
Abgesehen von dezenten Sanierungen<br />
bietet der Torso aus Sandstein am Fuß<br />
des Königstuhls noch immer jenen zernagten<br />
Anblick, den die Franzosen vor<br />
mehr als 300 Jahren geschaffen haben.<br />
Nicht wenige Feinde der Ruine träumen<br />
unvermindert davon, dass der einstige<br />
Monarchensitz im alten Glanz wieder -<br />
auferstehen möge. Da kommt die Rekonstruktion<br />
im Auftrag der Reiss-Engelhorn-<br />
Museen gerade recht – selbst wenn sie nur<br />
am Computer entstanden ist.<br />
Die digitale Neuschöpfung historischer<br />
Orte liegt im Trend medialer Geschichtsvermittlung.<br />
Das ZDF etwa möbelte seine<br />
Historienserie „Die Deutschen“ mit etlichen<br />
Sequenzen aus dem Computer auf.<br />
Verantwortlich für das TV-Spektakel war<br />
die Produktionsfirma FaberCourtial aus<br />
Darmstadt, die nun auch das Heidelberger<br />
Schloss wiederbelebte.<br />
Mit den Möglichkeiten moderner Rechner<br />
können die Erbauer virtueller Städte<br />
inzwischen faszinierend wirklichkeits -<br />
getreue Szenerien erschaffen. Noch vor<br />
wenigen Jahren ermöglichte die Technik<br />
nur eine vergleichsweise grobe Darstellung<br />
von Gebäuden und Landschaften.<br />
Anders jetzt: Kürzlich bauten die Animateure<br />
aus Darmstadt im Zuge eines<br />
größeren Projekts den historischen Altstadtkern<br />
von Konstanz am Bildschirm<br />
wieder auf und erarbeiteten dabei eine<br />
ungeheure Detailfülle: „Wir mussten uns<br />
sehr genau mit der Beschaffenheit der<br />
Dachziegel beschäftigen“, berichtet Jörg<br />
Courtial, Chef der Produktions firma.<br />
Reichtum im Detail war auch die Vorgabe<br />
für das Heidelberger Schloss. „Das<br />
sollte nicht aussehen wie ein Telespiel“,<br />
so Historiker Schubert. Diese Hürde wurde<br />
genommen. Doch steht der Film auch<br />
für historische Wahrheit?<br />
Penibel habe man selbst die Flora ums<br />
Schloss herum nach historischem Vorbild<br />
wiedererschaffen, heißt es bei FaberCourtial.<br />
Den Rauchsäulen jedoch, die aus den<br />
Mauern quellen, sei zugunsten des Effekts<br />
ein wenig nachgeholfen worden.<br />
Courtial gesteht: „Die waren damals<br />
bei den Franzosen vermutlich nicht so<br />
spektakulär wie bei uns.“<br />
FRANK THADEUSZ<br />
Animation: Die Sprengung<br />
des Heidelberger Schlosses<br />
spiegel.de/app<strong>48</strong>2013schloss<br />
oder in der App <strong>DER</strong> <strong>SPIEGEL</strong>
F O T O G R A F I E<br />
Knips-Kugeln<br />
Flächige Bilder für die Diashow<br />
sind von gestern. Eine neue<br />
Generation von Digitalkameras<br />
erstellt sphärische Panoramen.<br />
Sie drücken das Knöpfchen, wir machen<br />
den Rest“ – mit diesem Slogan<br />
revolutionierte der Kodak-Gründer<br />
George Eastman 1888 die Fotografie, indem<br />
er seinen Kunden die mühsame Filmentwicklung<br />
abnahm. Seitdem ist eine<br />
Menge geschehen in der Fototechnik. Nur<br />
der Auslöser, der musste immer noch gedrückt<br />
werden.<br />
Jetzt wird sogar das Knöpfchen überflüssig.<br />
„Panono“ heißt eine neue Kamera, die<br />
seit zwei Wochen im Netz angeboten<br />
wird. Die Panono ähnelt einem Handball<br />
aus schwarzem Plastik, gespickt<br />
mit 36 winzigen Kameras, die in genauso<br />
viele Richtungen blicken. Wirft der Fotograf<br />
den Kameraball in die Luft, löst<br />
das Teil automatisch am höchsten Punkt<br />
aus.<br />
Ergebnis: ein Kugelpanorama. Direkt<br />
unter der Kamera ist meist der Werfer zu<br />
sehen, mit ausgestreckten Händen, bereit,<br />
das teure Gerät aufzufangen. Es kostet<br />
fast 550 Dollar, wiegt 300 Gramm und<br />
kann 400 Bilder speichern.<br />
Panono ist nicht allein in der neuen<br />
Welt der Kugelsicht. Die „Theta“ des<br />
Kameraherstellers Ricoh zum Beispiel<br />
nimmt sphärische Rundumfotos auf, aller -<br />
dings nur mit zwei Linsen, die jeweils<br />
nach vorn und hinten zeigen. Diese<br />
Knauserei führt dort, wo die Einzelbilder<br />
zusammengerechnet werden, zu starken<br />
Verzerrungen.<br />
Die Lust aufs Rundumfoto ist im Fall<br />
des Panono-Erfinders Jonas Pfeil inspiriert<br />
vom Blick auf schönste Südsee -<br />
strände: „Ich hatte die Idee auf einer<br />
Urlaubsreise nach Vanuatu“, erzählt Pfeil,<br />
der inzwischen gemeinsam mit zwei Kommilitonen<br />
von der TU Berlin eine Firma<br />
gegründet hat.<br />
Noch haben die Kugelpanoramen leichte<br />
Macken, so klappt beispielsweise das<br />
Technik<br />
saubere Zusammenfügen der<br />
36 Einzelbilder an den Rändern<br />
nicht immer. Und bei schwachem<br />
Licht in Innenräumen rät<br />
Pfeil dazu, die Kugelkamera auf ein<br />
Stativ zu montieren, damit die Bilder<br />
nicht verwackeln.<br />
Dennoch haben Pfeil und seine Kollegen<br />
einen Nerv bei der Kundschaft getroffen:<br />
Nur zehn Tage nach Angebotsstart<br />
waren Bestellungen im Wert von mehr als<br />
einer viertel Million Euro eingegangen.<br />
Als er vorige Woche von Panono hörte,<br />
war Steve Hollinger nicht amüsiert. Der<br />
Erfinder aus Boston hatte schon 2012 ein<br />
Patent erhalten für eine werfbare „Kamera<br />
für Aufklärung oder Freizeit“. Sein<br />
Prototyp namens „Squito“, klein wie ein<br />
Baseball, macht nicht nur Fotos, sondern<br />
sogar Filme mit Hilfe von mehreren Hochgeschwindigkeitskameras.<br />
Bestellen kann<br />
man Squito allerdings noch nicht.<br />
Der Trend zum Kugelblick lässt sich<br />
mit den fallenden Preisen für Digital -<br />
„Panono“-Bildausschnitt mit Fotograf<br />
Eine Art außerkörperliche Erfahrung<br />
kameras erklären, aber auch mit der Verfügbarkeit<br />
von Apps und Diensten, die<br />
es ermöglichen, die vielen Einzelbilder<br />
in der Cloud zur Kugel zusammenzurechnen.<br />
Außerdem ist das größte Problem<br />
eines Kugelpanoramas gelöst: Die runden<br />
Bilder passen nicht auf Papier – und das<br />
müssen sie nun auch nicht mehr.<br />
Die Panono-Panoramen etwa betrachtet<br />
man am besten am iPad: Dreht man<br />
sich um sich selbst, dreht sich das Bild<br />
mit. Man blickt dann von oben auf sich<br />
selbst, kurz nach dem Wurf – eine Art<br />
außerkörperliche Erfahrung.<br />
„Die Sehgewohnheiten der Leute haben<br />
sich verändert“, sagt Pfeil, „durch<br />
Google Street View haben wir uns daran<br />
Panono<br />
Kugel-Fotos mit 36 Kameras,<br />
11 cm Durchmesser, 300 g,<br />
72 Megapixel, Bluetooth,<br />
USB, WLAN<br />
ca. 450 Euro<br />
gewöhnt, durch Bilder zu navigieren.<br />
Schon einjährige Kinder kapieren sofort,<br />
wie sie sich mit dem Handy durch ein<br />
Panono-Bild bewegen.“<br />
Pfeils größter Konkurrent ist „Bubl“<br />
aus Toronto. Die kanadische „Blasen“-<br />
Kamera überträgt Video und Ton per<br />
WLAN ins Internet wie eine Webcam<br />
mit Rundumblick. „Ich bin auf die Idee<br />
gekommen, als meine damals dreijährige<br />
Tochter ein Familienvideo geschaut hat,<br />
auf dem das Gesicht ihrer Oma abgeschnitten<br />
war“, erzählt Sean Ramsay,<br />
der Gründer. „Sie wischte mit der Hand<br />
über den Bildschirm, um auch die Großmutter<br />
zu sehen.“ Genau das bietet die<br />
Bubl, wie eine Art Rundum-Skype –<br />
praktisch etwa bei Wohnungsbesichti -<br />
gungen.<br />
Die Bildauflösung allerdings ist bei der<br />
Bubl eher gering, und hochwerfen sollte<br />
man sie besser auch nicht – aber das soll<br />
bald kommen. Bubl hat seit Anfang November<br />
schon rund 200000 Euro auf der<br />
Crowdfunding-Plattform Kickstarter eingeworben.<br />
Sind die Kugel-Knipser nun Revolution<br />
oder Schnickschnack? Eine Spielerei wie<br />
die Holografie oder die Kippelpostkarten,<br />
die man heute als Souvenir-Trash kauft?<br />
„Panoramen sind ein alter Hut“, sagt Hubertus<br />
von Amelunxen, Mitherausgeber<br />
des Buchs „Theorie der Fotografie“. „Es<br />
gibt sie seit rund 500 Jahren, die Hochphase<br />
lag im 19. Jahrhundert“, winkt auch<br />
der Kunsthistoriker Martin Kemp ab,<br />
Emeritus der University of Oxford. „Ich<br />
persönlich finde die Panono revolutionär!“,<br />
schwärmt dagegen Anna Gripp,<br />
Mitgründerin der Zeitschrift „Photonews“.<br />
Hinterher hat man es immer vorher gewusst.<br />
Die Firma Eastman Kodak zum<br />
Beispiel entwickelte 1975 die erste tragbare<br />
Digitalkamera: ein hässliches Ungetüm,<br />
das 30 verrauschte Pixelbildchen auf<br />
einer Musikkassette speicherte. Dies neumodische<br />
Zeugs habe keine Zukunft im<br />
Unternehmen, hieß es danach. Die Entwicklung<br />
wurde gestoppt.<br />
Voriges Jahr meldete Kodak Insolvenz<br />
an.<br />
HILMAR SCHMUNDT<br />
Alles sehende Augen<br />
Eine neue Generation von Panoramakameras<br />
Squito<br />
Kugel-Videos mit<br />
mehreren Kameras<br />
in einem tennisballgroßen<br />
Gehäuse<br />
Konzept<br />
Theta (Ricoh)<br />
Kugel-Panoramen,<br />
zwei Linsen auf einem<br />
Stativ, 13 cm hoch,<br />
ca. 95 g, USB, WLAN<br />
ca. 380 Euro<br />
Bubl<br />
Kugel-Videos mit vier<br />
Linsen auf einem Stativ,<br />
Baseballgröße, Micro-<br />
SD-Karte, USB, WLAN<br />
ca. 350 Euro<br />
146
Szene<br />
VINCENT MOSCH / IMAGEWORKSHOP<br />
V E R L A G E<br />
„Hart und schroff“<br />
Der Übersetzer und<br />
Linguist Bernd-Jürgen<br />
Fischer, 70, über<br />
seine Übertragung<br />
von Marcel Prousts<br />
Mammut-Roman<br />
„Auf der Suche nach<br />
der verlorenen Zeit“,<br />
an der er ohne Auftrag<br />
zehn Jahre lang<br />
gearbeitet hat<br />
Proust um 1900<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Herr Fischer, Sie haben auf<br />
eigene Faust alle sieben Teile des mehr<br />
als 4000 Seiten umfassenden Romanwerks<br />
„A la recherche du temps perdu“<br />
von Marcel Proust neu übersetzt.<br />
Wie kommt man auf so eine Idee?<br />
Fischer: Im Urlaub ist mir der Lesestoff<br />
ausgegangen. Das war in Saigon, und<br />
ich habe dort nichts Ver nünftiges gefunden<br />
außer der franzö sischen Ausgabe<br />
der „Suche“. Ich kannte bis dahin nur<br />
Übersetzungen und war verblüfft, wie<br />
anders mir der Ton vorkam.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Und dann haben Sie<br />
sich hingesetzt und einfach<br />
EVERETT COLLECTION / ACTION PRESS<br />
mit der eigenen Übersetzung begonnen?<br />
Fischer: Nein, das war daheim. Mich<br />
interessierte, ob ich diesen Ton ins<br />
Deutsche retten kann. Und als ich einmal<br />
angefangen hatte, kam ich nicht<br />
mehr davon los.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Sie hatten keinen Auftrag.<br />
Wie kam dann doch der Kontakt zu<br />
einem Verlag zustande?<br />
Fischer: Durch meine Frau, die Journalistin<br />
ist. Sie hat sich über meine diesbezügliche<br />
Untätigkeit geärgert und<br />
die Sache selbst in die Hand genommen.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Und bei Reclam hat man<br />
gleich zugegriffen?<br />
Fischer: Das ging dann rasch.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Sie haben auch gleich noch<br />
einen umfangreichen Anmerkungsund<br />
Erläuterungsteil mitgeliefert.<br />
Wann haben Sie den noch geschrieben?<br />
Fischer: Der ist parallel zur Über -<br />
setzung entstanden. Sie können das ja<br />
nicht den ganzen Tag machen, dann<br />
kommt nur noch Unsinn dabei raus.<br />
Also habe ich mich nachmittags in die<br />
Forschungsliteratur vertieft.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Ihre Syntax folgt dem Original<br />
strenger als frühere Übersetzungen.<br />
Hat das damit zu tun, dass Sie von<br />
Haus aus Linguist sind?<br />
Fischer: Einige vermissen eine gewisse<br />
Geschmeidigkeit, ich weiß. Für<br />
mein Gefühl haben manche Übersetzer<br />
zu sehr mit Weichzeichner ge -<br />
arbeitet, zu viel geglättet. Die Syntax<br />
von Proust ist sehr hart und schroff.<br />
Er mutet dem Leser etwas zu.<br />
KINO IN KÜRZE<br />
„Tage am Strand“ beruht auf der<br />
Erzählung „Die Großmütter“, einem Spätwerk<br />
der Mitte November verstorbenen<br />
britischen Literaturnobelpreisträgerin<br />
Doris Lessing. Der Film schildert die Geschichte<br />
zweier Freundinnen (Robin<br />
Wright, Watts in „Tage am Strand“<br />
Wright und Naomi Watts). Schon als Kinder<br />
spielten sie zusammen am Strand.<br />
Mittlerweile sind sie um die vierzig und<br />
haben halbwüchsige Söhne. Die beiden<br />
Frauen verlieben sich neu: ausgerechnet<br />
in den Sohn der jeweils anderen. Die luxemburgische<br />
Regisseurin Anne Fontaine<br />
hat diese Geschichte in Australien verfilmt;<br />
an der mondänen<br />
Côte d’Azur wäre sie<br />
aber möglicherweise<br />
besser aufgehoben<br />
gewesen. Großartig gespielt<br />
(vor allem von<br />
Robin Wright), trägt der<br />
Film schwer an der Last<br />
seiner inzestuösen Konstellation.<br />
Bis zum Ende<br />
wird der Zuschauer das<br />
Gefühl nicht los, dass<br />
hier der Stoff für eine<br />
beschwingte erotische<br />
Komödie viel zu ernst<br />
genommen wurde.<br />
CONCORDE FILMVERLEIH<br />
„The Counselor“. Selten zuvor<br />
wurden in einem Film so viele Stars geköpft<br />
wie in diesem Gewaltepos von<br />
Regisseur Ridley Scott. Brad Pitt, Cameron<br />
Diaz, Penélope Cruz, Javier Bardem<br />
und Michael Fassbender lieben<br />
und töten einander nach einem Drehbuch<br />
des Schriftstellers Cormac<br />
McCarthy. In seinem Roman „No Country<br />
for Old Men“, von Joel und Ethan<br />
Coen grandios verfilmt, hatte McCarthy<br />
bereits die Drogenkriminalität an der<br />
Grenze zwischen den USA und Mexiko<br />
thematisiert. Auch „The Counselor“<br />
spielt in dieser Region. Doch die Geschichte<br />
eines Anwalts (Fassbender),<br />
der sich mit Verbrechern einlässt, um<br />
ein Luxusleben führen zu können,<br />
kommt nur mühsam in Gang. McCarthy<br />
und Scott reihen große Auftritte<br />
ihrer Stars aneinander,<br />
das Erzähltempo ist schleppend<br />
und nicht annähernd<br />
so hoch wie die Todesrate.<br />
1<strong>48</strong><br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3
Kultur<br />
Szene aus „The Lego Movie“<br />
H O L L Y W O O D<br />
Gelbe Gefahr<br />
Hollywoods neuer Star ist noch kleiner als Tom Cruise, nämlich<br />
nur vier Zentimeter hoch, er lächelt wie erstarrt und hat<br />
gelbe Haut: Er heißt Emmet und ist ein Lego-Männchen.<br />
Die Abenteuer des Plastikzwergs stehen im Mittelpunkt des<br />
Animationsfilms „The Lego Movie“, einer Co-Produktion<br />
des US-Studios Warner Bros. mit dem dänischen Spielzeughersteller.<br />
Lego arbeitet seit Jahren mit der Filmindustrie<br />
zusammen, bislang allerdings vor allem als Lizenznehmer:<br />
Kinohelden wie Indiana Jones erobern als Lego-Figuren auch<br />
die Kinderzimmer. Die Macher des Lego-Films, der im Frühjahr<br />
2014 weltweit in die Kinos kommt, hoffen nun auf einen<br />
Erfolg nach dem Vorbild der „Transformers“. Die Plastik -<br />
roboter, hergestellt vom Spielzeugkonzern Hasbro, galten<br />
lange bei Kindern als uncool, bis im Jahr 2007 der Regisseur<br />
Michael Bay einen Actionfilm mit den Figuren inszenierte.<br />
Inzwischen werden mit „Transformers“-Produkten Milliarden<br />
umgesetzt, im Kino ebenso wie in Spielzeugläden. Auch<br />
andere Hersteller versuchen seitdem, mit Hollywoods Hilfe<br />
neue Kunden zu gewinnen. Der Barbie-Hersteller Mattel,<br />
größter Spielzeugkonzern der Welt, hat jetzt sogar ein eigenes<br />
Studio namens Playground Productions gegründet,<br />
um Filme, Fernsehserien und Computerspiele zu entwickeln.<br />
COURTESY OF WARNER BROS.<br />
L I T E R A T U R<br />
Kuckuck und Cormoran<br />
Robert<br />
Galbraith<br />
Der Ruf des<br />
Kuckucks<br />
Aus dem Englischen<br />
von<br />
Kristof Kurz, Christoph<br />
Göhler, Wulf<br />
Bergner. Blanvalet<br />
Verlag, München;<br />
640 Seiten;<br />
22,99 Euro.<br />
Lula Landry, ein berühmtes Model,<br />
stürzt vom Balkon ihrer Londoner<br />
Wohnung in den Tod. Ein tragischer<br />
Unfall? Selbstmord? Die Polizei ermittelt<br />
und erkennt auf Suizid. Der Adoptivbruder<br />
der Toten, ein Anwalt, mag<br />
das nicht glauben. Er ist sich sicher,<br />
dass seine Schwester, die ihre Freunde<br />
Kuckuck nannten, ermordet wurde,<br />
und heuert einen Privatdetektiv an.<br />
Dieser Cormoran Strike, ein Kriegs -<br />
veteran mit Beinprothese, soll das Rätsel<br />
um Lula Landry lösen. Klassischer<br />
Krimi-Stoff. Als Autor von „Der Ruf<br />
des Kuckucks“ firmiert ein gewisser Robert<br />
Galbraith. Als das Buch in Großbritannien<br />
im Frühjahr herauskam, erhielt<br />
der Autor freund liche Besprechungen.<br />
Der Verkauf hielt<br />
sich in Grenzen. Dann berichtete<br />
eine Zeitung, dass Robert<br />
Galbraith ein Pseud onym von<br />
Joanne K. Row ling sei. Der Verkauf<br />
zog deutlich an. Für die<br />
deutsche Ausgabe, die am<br />
29. November erscheint, belässt<br />
es der Verlag bei Galbraith,<br />
nicht ohne auf die wirkliche<br />
Autorin hinzuweisen. Rowling<br />
hat einen soliden, an Verdäch -<br />
tigen, Handlungssträngen und<br />
möglichen Motiven überreich<br />
ausgestatteten Roman geschrieben.<br />
Ihr Detektiv ist eine hinreichend<br />
originelle Figur mit einer<br />
patenten Aushilfssekretärin, die<br />
zu seinem Dr. Watson avanciert.<br />
In allem schimmert die<br />
gute alte englische Krimi-Tradition<br />
durch, von Arthur Conan<br />
Doyle über Dorothy L. Sayers<br />
zu P. D. James. Es scheint, als<br />
wollte die „Harry Potter“-Mil -<br />
liardärin Rowling sich und der<br />
Welt beweisen, dass sie auch<br />
dieses Genre beherrscht.<br />
Sprachlich kommt das Buch<br />
ohne übertriebene Eleganz aus,<br />
inhaltlich arbeitet es mit einem<br />
Trick. Über die Person, die aller<br />
moralischen und psychologischen<br />
Wahrscheinlichkeit nach<br />
nicht als Täter in Frage kommt,<br />
wird dem Leser erst in letzter<br />
Minute die entscheidende Information<br />
mitgeteilt. Nach den<br />
klassischen Regeln des Genres<br />
ist das ein fragwürdiges Vorgehen.<br />
Dennoch: Der Roman ist<br />
unterhaltsam und nicht ohne<br />
Charme.<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3 149
ANTON CORBIJN / CONTOUR BY GETTY IMAGES<br />
S P I E G E L - G E S P R Ä C H<br />
„Wenn es Zeit wird für Verrat“<br />
Wo endet die Loyalität gegenüber einem Staat? Ein Leben lang hat sich<br />
John le Carré mit Fragen von Moral und Treue auseinandergesetzt. Das neue Buch<br />
des Ex-Agenten wirkt wie ein Schlüsselroman zum Fall Snowden.
Kultur<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Mr. le Carré, wer ist Edward<br />
Snowden – ein Held, ein Verräter? Einer,<br />
der unser Leben sicherer gemacht hat –<br />
oder einer, der den Qaida-Terroristen in<br />
die Hände spielt, wie der Chef des britischen<br />
Auslandsgeheimdienstes meint?<br />
Le Carré: Zunächst einmal: Gut gemacht,<br />
junger Mann! Snowden hat eine für ihn<br />
sicher sehr schwierige und sein weiteres<br />
Leben bestimmende Entscheidung getroffen:<br />
Er hat Gesetze gebrochen und sei -<br />
nen Arbeitgeber verraten, um einen viel<br />
schwerer wiegenden Gesetzesbruch der<br />
NSA zu enthüllen. Ich wünschte, er bekäme<br />
dafür einen Orden oder seine Freiheit<br />
zurück.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Das wird nicht passieren.<br />
Le Carré: Stimmt. Ich denke nicht, dass er<br />
in Putins Russland gut aufgehoben ist, und<br />
ich halte es für höchst unwahrscheinlich,<br />
dass er in Deutschland oder sonst einem<br />
Staat Asyl bekommt. Es wäre eine großartige<br />
Geste Ihrer Regierung, aber dafür<br />
ist der Einfluss Washingtons zu groß.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: John Kornblum, der frühere amerikanische<br />
Botschafter in Deutschland,<br />
hat behauptet, Snowden wäre nichts passiert,<br />
hätte er sich an das amerikanische<br />
Whistleblower-Gesetz gehalten und sich<br />
an seine Vorgesetzten gewandt.<br />
Le Carré: Völliger Unsinn. Ein Geheimdienst<br />
kann schon aus Prinzip Whistleblower<br />
nicht straffrei ausgehen lassen.<br />
Also, Herr Snowden, machen Sie sich<br />
keine Illusionen! Sie werden verfolgt und<br />
wohl irgendwann geschnappt werden,<br />
denn Sie haben eine Todsünde begangen<br />
– Sie haben die US-Regierung und<br />
Corporate America wie Idioten aussehen<br />
lassen. Und die denken: Dafür ist die<br />
Todesstrafe noch zu milde.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Waren Sie überrascht, als Sie<br />
vom Ausmaß des NSA-Programms hörten,<br />
vom Abhören auch der deutschen<br />
Kanzlerin?<br />
Le Carré: Mir war bewusst, wie staubsaugerhaft<br />
die Amerikaner alles abschöpfen.<br />
Aber ich verstehe nicht, was das bringen<br />
soll, der Aufwand der Auswertung steht<br />
in keinem Verhältnis zum Ergebnis. Und<br />
JOHANNES EISELE / AFP<br />
Aktion für Snowden vor dem Reichstag in Berlin<br />
„Gut gemacht, junger Mann!“<br />
natürlich ist es illegal. Die Amerikaner<br />
scheinen bereit zu sein, ziemlich alle ihrer<br />
hart erkämpften Freiheiten aufzugeben.<br />
Wir leben in außergewöhnlichen Zeiten –<br />
und am meisten verwundert mich, wie<br />
ruhig wir all diese Ungeheuerlichkeiten<br />
hinnehmen, dieses zweitklassige Niveau<br />
unserer politischen Führung im Westen,<br />
diese drittklassige Kontrolle, die unsere<br />
Parlamentarier ausüben.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Beginnt da nicht gerade ein Umdenken?<br />
In den USA regt sich die Kritik<br />
in der Bevölkerung, die die NSA für eine<br />
Bedrohung hält. In Deutschland fordern<br />
einige Politiker und viele wichtige Persönlichkeiten<br />
des öffentlichen Lebens<br />
Asyl für Snowden.<br />
Le Carré: In meiner Heimat hält sich die<br />
Aufregung über die ganze Affäre sehr in<br />
Grenzen. Mit Ausnahme des „Guardian“<br />
hält die Presse völlig still, auch die BBC.<br />
Es gibt keine öffentliche Debatte um Geheimdienstübergriffe.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Stattdessen offene Drohungen<br />
des Premiers gegenüber Journalisten.<br />
Woran liegt das?<br />
Le Carré: Zum einen an dem fast mythischen<br />
Charakter, den bei uns der Secret<br />
Service hat. Es existiert eine unheilige<br />
Allianz zwischen den britischen Geheimdiensten<br />
und der Öffentlichkeit. Das liegt<br />
John le Carré<br />
ist der Künstlername des britischen<br />
Schriftstellers David Cornwell, 82.<br />
Seit mehr als 50 Jahren schreibt er Polit-<br />
Thriller und Agentenromane. „Der Spion,<br />
der aus der Kälte kam“ (1963) machte<br />
ihn weltberühmt. Le Carré kennt das Milieu<br />
seiner Geschichten aus eigener<br />
Anschauung: Von 1959 bis 1964 arbeitete<br />
er selbst als Agent für den britischen<br />
Geheimdienst, zeitweise in Bonn und<br />
Hamburg. Bis in die achtziger Jahre<br />
hinein prägte der Kalte Krieg le Carrés<br />
Werk; später schrieb er, nach langen<br />
Recherchen, Romane über die kriminellen<br />
Machenschaften westlicher Pharma -<br />
konzerne in Afrika („Der ewige Gärtner“),<br />
den internationalen Waffenhandel („Der<br />
Nacht-Manager“) oder über islamistischen<br />
Terrorismus („Marionetten“). Viele<br />
seiner Bücher wurden verfilmt, dar -<br />
unter „Das Russland-Haus“ oder „Dame,<br />
König, As, Spion“. Le Carrés neuer<br />
Roman „Empfindliche Wahrheit“ (Ullstein<br />
Verlag, Berlin; 392 Seiten; 24,99 Euro)<br />
weist erstaunliche Parallelen zum Fall<br />
Edward Snowden auf.<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3 151
152<br />
SAMMLUNG RICHTER / CINETEXT<br />
KINOWELT / CINETEXT<br />
Plakate von Le-Carré-Verfilmungen, Debütant le Carré 1964: „Eine grausame Zeit“<br />
auch in der engen historischen Verflechtung<br />
und der Komplizenschaft mit den<br />
USA begründet. Wir haben für die Amerikaner<br />
oft das dreckige Geschäft besorgt,<br />
beispielsweise die Informationen für den<br />
1953 von der CIA betriebenen Sturz des<br />
gewählten Ministerpräsidenten Mossadegh<br />
in Iran geliefert – etwas, was wir<br />
verdrängen, was aber kein Perser je vergessen<br />
wird. Wir waren die Lehrmeister<br />
von CIA und NSA. Und jetzt haben wir<br />
Dienste, die zu Monstern geworden sind –<br />
zu groß, zu mächtig, als dass sie noch effektiv<br />
zu kontrollieren wären.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Dann hat es Sie als ehemaligen<br />
Geheimdienstagenten Ihrer Majestät nicht<br />
überrascht, dass auch die Briten aus ihrer<br />
Berliner Botschaft deutsche Politiker ausspähen<br />
sollen?<br />
Le Carré: Überrascht hat mich allenfalls,<br />
wie ungeschickt sie sich dabei anstellen.<br />
Und natürlich ist es lachhaft, wenn all<br />
diese millionenfachen Abhörmaßnahmen<br />
mit dem Kampf gegen den Terror erklärt<br />
werden. Nein, sie hören ab, weil sie es<br />
können. Und sie bekommen niemals genug.<br />
Jeder ist a priori ein Verdächtiger.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: „Wer die Wahrheit ausspricht,<br />
begeht kein Verbrechen“, schreibt Snow -<br />
den in einem Brief an den <strong>SPIEGEL</strong>. Sie<br />
stellen Ihrem neuen Buch den Oscar-<br />
Wilde-Satz voran: „Wer die Wahrheit sagt,<br />
wird früher oder später dabei ertappt.“<br />
Le Carré: Man könnte sagen, das ergänzt<br />
sich. Ich liebe mein Land, aber mir widerstrebt<br />
seine Klassengesellschaft, diese<br />
Sozialstruktur, die sich in den letzten<br />
Jahrzehnten so gut wie gar nicht verändert<br />
hat. Es ist eine elitäre Welt, deren<br />
Herzstück das Geheime ist. Nirgendwo,<br />
mit Ausnahme vielleicht von Israel, sind<br />
Establishment und Secret Service so untrennbar<br />
miteinander verbunden.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: „Empfindliche Wahrheit“ heißt<br />
Ihr Buch, das gerade in Deutschland erschienen<br />
ist, es ist Ihr 23. Darin kommen<br />
so ziemlich alle aktuellen britischen Probleme<br />
vor, alle denkbaren Rechtsbrüche:<br />
illegale Abhörpraktiken, versuchte Verschleppung<br />
Verdächtiger, die Auslagerung<br />
kriegsähnlicher Einsätze an private Sicherheitsfirmen,<br />
ein Komplott der in London<br />
gut vernetzten amerikanischen Tea-<br />
Party-Fundamentalisten. Es geht um einen<br />
Whistleblower, um Treue und Verrat,<br />
der eine höhere Form von Treue sein<br />
kann. So nah an der Wirklichkeit, dass<br />
man denkt, es könnte ein Tatsachenbericht<br />
sein.<br />
Le Carré: Ich respektiere sehr, wenn meine<br />
Schriftstellerkollegen sich mit der Vergangenheit<br />
beschäftigen und daraus ihre<br />
Stoffe beziehen, bei mir aber geht es immer<br />
um die Gegenwart. Und ich porträtiere<br />
in meinen Romanen gern Menschen,<br />
die mir vertraut sind. In diesem Buch vor<br />
allem mich.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Wie meinen Sie das?<br />
Le Carré: Ich habe, diesmal eher im Unterbewusstsein,<br />
ein Doppelporträt meiner<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3<br />
RALPH CRANE / TIME LIFE PICTURES / GETTY IMAGES<br />
Person gezeichnet, aus unterschiedlichen<br />
Zeiten. Da ist einmal Toby Bell, Mitte<br />
dreißig, aufstrebender Stern im britischen<br />
Außenministerium. Ganz der ehrgeizige<br />
Typ, der ich in dem Alter selbst war, bis<br />
ich meine Geheimdienstkarriere mit dem<br />
Schreiben von „Der Spion, der aus der<br />
Kälte kam“ verpfuscht habe. Toby erledigt<br />
die dubiosen Jobs, weil er denkt, einer<br />
muss das ja tun. Bis er merkt, dass er<br />
seine Toleranzschwelle überschritten hat<br />
und vom guten Soldaten zum Mann im<br />
Untergrund wird.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Und der andere ist Sir Christopher<br />
Probyn, ein ebenfalls geheimdienst -<br />
erprobter Diplomat.<br />
Le Carré: Probyn wurde zum Botschafter<br />
in der Karibik befördert, weit weg von<br />
der Zentrale mit ihren vertuschten Skandalen,<br />
und genießt jetzt im ländlichen<br />
Cornwall seine Pension. Bis Probyn<br />
merkt, dass die bösen Geister der Vergangenheit<br />
ihn einholen. Ich mag seine<br />
Selbstzweifel, seine Einsicht in Fehler und<br />
wie er den Pakt mit dem Teufel akzeptiert,<br />
den er am Ende schließen muss. Ich<br />
kann mich in ihm wiedererkennen: Wir<br />
dachten, wir hätten uns erfolgreich betrogen,<br />
aber wir kamen nicht durch damit.<br />
Es gibt eine Zeit für Treue, es gibt<br />
eine Zeit für Verrat.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Waren Sie nicht selbst immer<br />
Teil des britischen Establishments, das<br />
Sie so ablehnen? Ihr Vater hat Ihnen den<br />
Besuch einer Privatschule ermöglicht.<br />
Le Carré: Na ja, meine Mutter hat uns verlassen,<br />
als ich fünf war. Ich bin mit meinem<br />
Vater aufgewachsen, der nun nicht gerade<br />
der fürsorglichste und unproblematischste<br />
aller Charaktere war. Aber dafür ein recht<br />
aufregender Mann. Graham Greene hat<br />
einmal gesagt, das Bankkonto eines jeden<br />
Schriftstellers sei seine Kindheit – so gesehen<br />
wuchs ich auf als Multi millionär. Ich<br />
konnte aus dem Vollen schöpfen.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Warum?<br />
Le Carré: Mein Vater war ein Betrüger der<br />
Sonderklasse, wurde wegen Versicherungsdiebstahls<br />
zu einer Gefängnisstrafe<br />
verurteilt. In seinen Glanzzeiten besaß<br />
er ein Rennpferd auf einem Gestüt bei<br />
Paris, er dealte mit einer Truppe von Varieté-Tänzerinnen,<br />
reiste mit einem ehemaligen<br />
Londoner Bürgermeister zum<br />
Spielen ins Casino von Monte Carlo. Er<br />
war offensichtlich so überzeugend, dass<br />
er allen alles verkaufen konnte. Aber das<br />
war nur die eine Seite, die Sonnenseite,<br />
sein steiler sozialer Aufstieg.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Und die andere?<br />
Le Carré: Zeigte sich, wenn er aufzufliegen<br />
drohte, wenn er auf der Flucht war. Vor<br />
der Polizei, vor brutalen Unterwelttypen,<br />
die eine Rechnung mit ihm offenhatten.<br />
Ich erinnere mich, dass wir manchmal<br />
alle Lichter im Haus löschen mussten, um<br />
Abwesenheit vorzutäuschen. Ein Abenteurerleben<br />
mit dem Charme des Kri -<br />
minellen, wie es die Nachbarjungs nicht
Le Carré (r.), <strong>SPIEGEL</strong>-Redakteur*<br />
„Jeder ist ein Verdächtiger“<br />
Kultur<br />
<strong>DER</strong> <strong>SPIEGEL</strong><br />
kannten. Andererseits empfand ich es<br />
als demütigend, wenn der Gerichtsvollzieher<br />
dann kam und in meinen Kleidern<br />
und Spielsachen wühlte. Ich fühlte mich<br />
schmutzig.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Wieso haben Sie eigentlich so<br />
eine Nähe zu Deutschland?<br />
Le Carré: Der Motor jedes schriftstellerischen<br />
Schaffens hat drei wesentliche<br />
Bauteile: Kindheit, Erziehung, Erfahrung.<br />
Und auf jedem dieser Bauteile<br />
steht: „Made in Germany“. Ich habe Zuflucht<br />
gesucht während meiner Zeit auf<br />
dem Internat bei der deutschen Literatur,<br />
die eine Muse für mich war. Der<br />
Bildungs roman blieb zeitlebens mein<br />
Modell, die Geschichte des Unschuldigen,<br />
der durch eine Mischung aus harten<br />
Erfahrungen und Glück seinen Weg in<br />
die Welt findet. Und dann habe ich in<br />
Oxford Deutsch studiert. Als ich später<br />
Diplomat wurde, habe ich einige der prägendsten<br />
Erfahrungen in Bonn und Hamburg<br />
gemacht – und natürlich in West-<br />
Berlin. Ich habe zwei Jahre lang in Eton<br />
Deutsch und Französisch gelehrt. Die Tätigkeit<br />
als britischer Botschaftsangehöriger<br />
mit einem Spionageauftrag des Auslandsgeheimdienstes<br />
MI6 fand ich dann<br />
reizvoller.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Sie haben sich in Bonn um mögliche<br />
sowjetische Spione gekümmert?<br />
Le Carré: Über meine genauen Aufgaben<br />
von damals darf ich auch heute noch<br />
nicht sprechen. Aber es hat Spaß gemacht.<br />
Die Jungs vom MI6 waren eine<br />
lustige Truppe, vielseitig interessiert, es<br />
war ein bisschen so, als arbeitete man bei<br />
einer tollen investigativen Zeitung.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Wurde der Geheimdienst eine<br />
Art Ersatzfamilie?<br />
Le Carré: Er war ein Refugium, ein Schutzschild,<br />
hinter dem ich mich gut verstecken<br />
konnte – ironischerweise auch ein Schutz<br />
vor der Realität. Mit der Zeit lernte ich,<br />
meinen eigenen moralischen Kompass<br />
zu finden. Ich begann zu dichten, über<br />
den Kalten Krieg und die moralische<br />
Ambivalenz der Geheimdienste, deren<br />
Arbeit sich nicht mehr in Schwarz und<br />
Weiß, die Guten hier, die Bösen da, unterscheiden<br />
ließ. Zwei Bücher. Dann<br />
schrieb ich innerhalb von fünf Wochen<br />
„Der Spion, der aus der Kälte kam“. Ich<br />
musste das anmelden. Meine Arbeitgeber<br />
haben mir die Veröffentlichung nach längerem<br />
Zögern erlaubt, allerdings nicht<br />
unter meinem Namen. Ich entschied mich<br />
für das Pseudonym John le Carré. Das<br />
klang gut.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Das ist jetzt ziemlich genau ein<br />
halbes Jahrhundert her, Ihr Weltbestseller<br />
wird aus diesem Anlass neu aufgelegt. Es<br />
war die Hoch-Zeit der Ost-West-Spionage,<br />
des großen Dramas. Trauern Sie diesen<br />
Zeiten nach?<br />
Le Carré: Ich empfinde keine Kalter-Krieg-<br />
Nostalgie. So viele ließen ihr Leben, weil<br />
sie hereingelegt und bloßgestellt wurden.<br />
Eine grausame Zeit, in der viele Ideale<br />
verraten wurden. Von allen Seiten.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Sie sind George Smiley, Ihrem<br />
fiktiven Chef und Anti-Bond, in vielen<br />
nachfolgenden Büchern treu geblieben.<br />
Und Karla, seinem großen Gegenspieler<br />
in Moskau – die beiden wurden zu Symbolfiguren<br />
des Kalten Krieges.<br />
Le Carré: Ich wollte die geheime Welt zu<br />
einem Schauplatz, zu einer Bühne für die<br />
große, nichtgeheime Welt machen. Dass<br />
ich zwischen diesen beiden Welten keine<br />
großen Unterschiede feststellen konnte,<br />
machte die Herausforderung noch verführerischer.<br />
Aber meine Protagonisten<br />
hatten ihre Zeit, und die hörte auf mit<br />
dem Ende des Kalten Krieges.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Aung San Suu Kyi, die burmesische<br />
Friedensnobelpreisträgerin, hat in<br />
ihrem jahrelangen Hausarrest, wie sie<br />
sagt, mit Ihren Büchern „Kontakt zur Außenwelt“<br />
gehalten. Der russische Premier<br />
und Ex-Auslandsspionage-Chef Jewgenij<br />
Primakow sagte Ende der neunziger Jahre<br />
einmal, Smiley sei seine Lieblingsfigur<br />
in Ihren Romanen.<br />
Le Carré: Ich habe ihn später kennengelernt.<br />
Aber Smiley war da längst Geschichte.<br />
In Smileys Abschiedsrede vor<br />
jungen Rekruten lasse ich ihn in die Zukunft<br />
blicken und sagen: Jetzt, da wir den<br />
Kommunismus besiegt haben, müssen die<br />
Auswüchse des Kapitalismus unser Ziel<br />
sein.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Sie haben sich dann mit CIA-Machenschaften<br />
in Südostasien und Mittelamerika<br />
beschäftigt, machten den Nahost-Konflikt<br />
und die Perestroika zu Ihrem<br />
Thema, beschrieben die Ausbeutung Afrikas<br />
genauso wie den internationalen<br />
Waffenhandel. Sie haben in einem Ihrer<br />
Bücher, kaum verhüllt, mit Tony Blair<br />
abgerechnet. Enttäuschte Liebe?<br />
Le Carré: Als Blair nach all den Jahren einer<br />
ausgelaugten Tory-Herrschaft Regierungschef<br />
geworden war, hatte ich mich<br />
sehr gefreut. Umso größer die Enttäuschung.<br />
Er hat uns in diesen unseligen<br />
Irak-Krieg geführt, mit Lügen, an die<br />
er womöglich sogar geglaubt hat. Er wurde<br />
zum Minnesänger des üblen George<br />
W. Bush – eine Schande für unser Land.<br />
Ich bin damals auf die Straße gegangen.<br />
Aber meine Heimat wurde eine De-facto-<br />
* Erich Follath in London.<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3 153<br />
Der digitale<br />
<strong>SPIEGEL</strong><br />
In dieser Ausgabe:<br />
Aufruhr an der Ruhr<br />
Video über die Koalitionsempörung<br />
der SPD-Basis<br />
Der Meisterregisseur<br />
Video-Spezial über die Filme von<br />
Bernardo Bertolucci<br />
Breakdance-Boom<br />
Eine Tanzstunde im Video<br />
Die neue Art zu lesen.<br />
Mit zusätzlichen Hintergrundseiten.<br />
Mit exklusiv produzierten Videos.<br />
Mit 360°-Panoramafotos, interaktiven<br />
Grafiken und 3-D-Modellen.<br />
Alles immer schon ab Sonntag 8 Uhr!<br />
<strong>DER</strong> <strong>SPIEGEL</strong><br />
Einfach scannen (z.B.<br />
mit der kostenlosen<br />
App <strong>DER</strong> <strong>SPIEGEL</strong>) und<br />
mehr erfahren – über<br />
den digitalen <strong>SPIEGEL</strong> und<br />
über unser Testangebot.<br />
SD13-107
Kultur<br />
Kolonie der USA, sie hat ihre Außenpoli -<br />
tik sklavisch an Washington gekoppelt.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Anders als Deutschland?<br />
Le Carré: Ich denke schon. Ich habe eine<br />
Art „deutsche Seele“ entwickelt.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Was Sie nicht daran hindert, auch<br />
die Deutschen hart zu kritisieren.<br />
Le Carré: Gerade Ihr Geheimdienst hat<br />
viele Leichen im Keller. Die Bundes -<br />
regierung machte unter Anleitung der<br />
Amerikaner Reinhard Gehlen, den früheren<br />
Befehlshaber Hitlers an der Ostfront,<br />
zum ersten Chef des Bundesnachrichtendienstes,<br />
Heinz Felfe, früherer SS-<br />
Mann, wurde Chef der Gegenspionage.<br />
Aber ich glaube, die Nachkriegsdeutschen<br />
haben ein natürliches Misstrauen,<br />
eine Distanz zu ihrem Geheimdienst entwickelt.<br />
Mir scheint er – trotz aller Fehler<br />
– besser kontrolliert als der amerikanische<br />
und der britische.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Sie haben immer Wert darauf gelegt,<br />
Ihre Geschichten vor Ort zu recherchieren.<br />
Sie waren in Palästina, im Ostkongo,<br />
manchmal unter Lebensgefahr.<br />
Le Carré: Es geht nicht ohne persönlichen<br />
Eindruck, wenngleich Sie mich da heroischer<br />
machen, als ich je war. Ich habe<br />
in Beirut zehn Tage mit Jassir Arafat verbracht.<br />
In Goma traf ich mich mit kongolesischen<br />
Rebellen. Die Israelis führten<br />
mir in der Negev-Wüste in einem Geheimgefängnis<br />
eine abgefangene deutsche<br />
Terroristin vor, die von einer Auschwitz-Überlebenden<br />
bewacht wurde. Aber<br />
mein beeindruckendstes Treffen war mit<br />
Andrej Sacharow in Moskau, den ich für<br />
seine Standfestigkeit im Angesicht von<br />
Gulag und KGB-Schikanen grenzenlos<br />
bewunderte.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Sie haben ein Treffen mit dem<br />
Spionagechef Markus Wolf abgelehnt,<br />
der in mancherlei Beziehung Ihrem fiktiven<br />
Sowjetspionagechef Karla ähnelte.<br />
Warum?<br />
Le Carré: Er hatte so viel Blut an den Händen.<br />
Bei aller moralischen Ambivalenz:<br />
Für mich macht es immer noch einen Unterschied,<br />
ob man für einen demokratischen<br />
Staat oder ein autoritäres Regime<br />
spioniert.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Salman Rushdie hat Sie einen<br />
„arroganten Esel“ genannt, weil Sie ihm<br />
damals nach der Fatwa „Selbstgerechtigkeit“<br />
unterstellt haben. Er warf Ihnen vor,<br />
sich de facto mit den islamistischen Hass -<br />
predigern gemeinzumachen.<br />
Le Carré: Gott sei Dank haben wir diesen<br />
Streit jetzt, nach 15 Jahren, beigelegt. Ich<br />
bewundere Salman für seine Arbeit und<br />
seinen Mut, und natürlich finde ich die<br />
Fatwa gegen ihn verwerflich. Ich respektiere<br />
seinen Standpunkt zur Religion,<br />
wenngleich er nicht meiner ist. Ich hoffe,<br />
es kommt bald zu einem Treffen.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Welche Autoren bewundern Sie<br />
noch?<br />
Le Carré: Philip Roth fiele mir ein, der<br />
auch privat ein witziger Bursche ist. Und<br />
Bestseller<br />
Belletristik<br />
1 (–) Jonas Jonasson<br />
Die Analphabetin,<br />
die rechnen<br />
konnte<br />
Carl’s Books; 19,99 Euro<br />
Ein Mädchen aus den<br />
Slums von Soweto<br />
landet als Asylsuchende<br />
in Schweden – mit<br />
einer Bombe im Gepäck<br />
2 (7) Jo Nesbø<br />
Koma<br />
Ullstein; 22,99 Euro<br />
3 (1) Khaled Hosseini<br />
Traumsammler<br />
S. Fischer; 19,99 Euro<br />
4 (4) Elizabeth George<br />
Nur eine böse Tat<br />
Goldmann; 24,99 Euro<br />
5 (3) Henning Mankell<br />
Mord im Herbst<br />
Zsolnay; 15,90 Euro<br />
6 (2) Jussi Adler-Olsen<br />
Erwartung<br />
dtv; 19,90 Euro<br />
7 (13) Horst Evers<br />
Wäre ich du, würde ich mich lieben<br />
Rowohlt Berlin; 16,95 Euro<br />
8 (8) Timur Vermes<br />
Er ist wieder da<br />
Eichborn; 19,33 Euro<br />
9 (6) Cecelia Ahern<br />
Die Liebe deines Lebens<br />
Fischer Krüger; 16,99 Euro<br />
10 (5) Stephen King<br />
Doctor Sleep<br />
Heyne; 22,99 Euro<br />
11 (9) Ferdinand von Schirach<br />
Tabu<br />
Piper; 17,99 Euro<br />
12 (11) Dan Brown<br />
Inferno<br />
Bastei; 26 Euro<br />
13 (10) Rebecca Gablé<br />
Das Haupt der Welt<br />
Ehrenwirth; 26 Euro<br />
14 (12) Ulrich Tukur<br />
Die Spieluhr<br />
Ullstein; 18 Euro<br />
15 (17) Håkan Nesser<br />
Himmel über London<br />
btb; 19,99 Euro<br />
16 (14) Robert Harris<br />
Intrige<br />
Heyne; 22,99 Euro<br />
17 (–) Suzanne Collins<br />
Die Tribute von Panem –<br />
Flammender Zorn Oetinger; 18,95 Euro<br />
18 (15) Daniel Kehlmann<br />
F<br />
Rowohlt; 22,95 Euro<br />
19 (18) Atze Schröder<br />
Und dann kam Ute<br />
Wunderlich; 19,95 Euro<br />
20 (–) Frederick Forsyth<br />
Die Todesliste<br />
C. Bertelsmann; 19,99 Euro<br />
154<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3
Im Auftrag des <strong>SPIEGEL</strong> wöchentlich ermittelt vom<br />
Fachmagazin „buchreport“; nähere Informationen und Auswahl -<br />
kriterien finden Sie online unter: www.spiegel.de/bestseller<br />
Sachbücher<br />
1 (2) Guido Maria Kretschmer<br />
Anziehungskraft<br />
Edel Books; 17,95 Euro<br />
2 (1) Christopher Clark<br />
Die Schlafwandler<br />
DVA; 39,99 Euro<br />
3 (3) Florian Illies<br />
1913 – Der Sommer des<br />
Jahrhunderts S. Fischer; 19,99 Euro<br />
4 (4) Malala Yousafzai mit Christina Lamb<br />
Ich bin Malala<br />
Droemer; 19,99 Euro<br />
5 (5) Rolf Dobelli<br />
Die Kunst des klaren Denkens<br />
Hanser; 14,90 Euro<br />
6 (9) Bronnie Ware<br />
5 Dinge, die Sterbende am meisten<br />
bereuen Arkana; 19,99 Euro<br />
7 (12) Christiane zu Salm<br />
Dieser Mensch war ich<br />
Goldmann; 17,99 Euro<br />
8 (6) Iris Radisch<br />
Camus – Das Ideal der Einfachheit<br />
Rowohlt; 19,95 Euro<br />
9 (10) Rüdiger Safranski<br />
Goethe – Kunstwerk des Lebens<br />
Hanser; 27,90 Euro<br />
10 (18) Christine Westermann<br />
Da geht noch was<br />
Kiepenheuer & Witsch; 17,99 Euro<br />
11 (8) Ruth Maria Kubitschek<br />
Anmutig älter werden<br />
Nymphenburger; 19,99 Euro<br />
12 (11) Jennifer Teege/Nikola Sellmair<br />
Amon<br />
Rowohlt; 19,95 Euro<br />
13 (7) Meike Winnemuth<br />
Das große Los<br />
Knaus; 19,99 Euro<br />
14 (14) Stephen Emmott<br />
Zehn Milliarden<br />
Suhrkamp; 14,95 Euro<br />
15 (16) Ronald Reng<br />
Spieltage<br />
Piper; 19,99 Euro<br />
16 (13) Eben Alexander<br />
Blick in die Ewigkeit<br />
Ansata; 19,99 Euro<br />
17 (–) Stefan Lukschy<br />
Der Glückliche<br />
schlägt<br />
keine Hunde<br />
Aufbau; 19,99 Euro<br />
Loriots Regieassistent<br />
plaudert aus dem<br />
Nähkästchen und erzählt<br />
von der Entstehung<br />
legendärer Sketche<br />
18 (–) Rolf Dobelli<br />
Die Kunst des klugen Handelns<br />
Hanser; 14,90 Euro<br />
19 (–) Simon Singh<br />
Homers letzter Satz<br />
Hanser; 21,50 Euro<br />
20 (–) Zlatan Ibrahimović/<br />
David Lagercrantz<br />
Ich bin Zlatan Malik; 22,99 Euro<br />
von denen, die nicht mehr unter uns sind,<br />
Thomas Mann. Ich habe ihn mal getroffen,<br />
1949 in Bern. Er hielt einen Vortrag<br />
und wurde von deutschen Studenten ausgebuht,<br />
die ihm allen Ernstes vorwarfen,<br />
durch sein Exil in Kalifornien „anglisiert“<br />
worden zu sein. Ich ging nach der Rede<br />
zu ihm. Was wollen Sie, fragte er ungehalten.<br />
Nur aus Solidarität Ihre Hand<br />
schütteln, sagte ich. Bitte, hier ist sie, sagte<br />
er. Das war’s.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Hat die Welt Fortschritte gemacht<br />
in den gut 50 Jahren, die Sie jetzt Romane<br />
schreiben?<br />
Le Carré: Wir stehen im Grunde noch immer<br />
vor ähnlichen Problemen: Wie weit<br />
können wir bei der Verteidigung unserer<br />
westlichen Bürgerrechte gehen, ohne diese<br />
Bürgerrechte im Kern zu gefährden?<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Ihre Antwort?<br />
Le Carré: Der sogenannte Krieg gegen<br />
den Terror hat vieles verschlimmert, und<br />
dass wir aus vergangenen Fehlern gelernt<br />
hätten, kann ich nicht sagen. Ich denke<br />
manchmal, es sind dieselben Männer,<br />
nur mit besserem Haarschnitt und smarteren<br />
Anzügen, die uns erklären, war -<br />
um mittelalterliche Folter-Verhörmethoden<br />
sein müssten, warum das Töten aus<br />
der Luft chirurgisch genau und risikofrei<br />
sei, obwohl es ständig „Kollateralschäden“<br />
gibt, warum Medikamente in der<br />
Dritten Welt getestet werden müssten,<br />
weil dort ein Leben angeblich nicht ganz<br />
so viel zählt. Und es regt mich wahn -<br />
sinnig auf, wenn unser Außenminister<br />
William Hague zur NSA-Affäre sagt, niemand<br />
müsse etwas befürchten, wenn er<br />
nichts Böses getan habe – ein Satz, auf<br />
den Joseph Goebbels stolz gewesen<br />
wäre!<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Wird es Roman Nummer 24<br />
geben?<br />
Le Carré: Ich habe einen Pakt mit meiner<br />
Familie geschlossen. Sie hat mir geschworen,<br />
es mir zu sagen, wenn ich nicht mehr<br />
gut schreibe. Erfolg ist kein Kriterium<br />
mehr für mich. Ich könnte heute auch<br />
Geld für die Veröffentlichung des Telefonbuchs<br />
bekommen.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Was halten Sie von folgendem<br />
Plot für Ihr neues Werk? Junger Amerikaner<br />
stiehlt geheime Daten, zieht über<br />
Hongkong nach Moskau und hält mit seinen<br />
Veröffentlichungen die Welt in Atem,<br />
dann muss er nach Ablaufen seines<br />
Visums in Sibirien untertauchen. Oder<br />
vielleicht: Ein palästinensischer Terrorist,<br />
der zum Staatsmann und Friedensnobelpreisträger<br />
geworden ist, wird kurz vor<br />
der Pensionierung von seinen Feinden<br />
mit einem geheimen, aus der Atombombenfabrik<br />
gestohlenen Material vergiftet.<br />
Die Witwe startet neun Jahre nach dem<br />
Tod eine Verfolgungsjagd.<br />
Le Carré: Bisschen weit hergeholt, beides.<br />
Aber nicht schlecht.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Mr. le Carré, wir danken Ihnen<br />
für dieses Gespräch.<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3 155
Kultur<br />
E s s a y<br />
Die große Erschöpfung<br />
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist in diesem Land immer noch ein Traum.<br />
Von Claudia Voigt<br />
Kinofilm „Eltern“*: „Ich hätte, ich sollte, ich müsste“<br />
OLIVER VACCARO<br />
Emma brüllt und zappelt, ihr Vater Konrad ist gerade von<br />
der arbeit nach Hause gekommen, in der Wohnung<br />
herrscht Chaos, das au-pair-Mädchen liegt mit schwangerschaftsübelkeit<br />
im Bett, die andere, große Tochter hat Hunger,<br />
und mit Christine, der Mutter, ist erst in stunden zu rechnen,<br />
sie arbeitet als anästhesistin im Krankenhaus. Der erschöpfte<br />
Konrad nimmt seine fünfjährige Tochter, drückt ihr<br />
einen Glasbehälter voller schokoriegel in den arm, setzt sie<br />
vor einen Laptop und schaltet irgendein Computerspiel ein.<br />
Ruhe. Wenigstens für einen augenblick.<br />
Robert Thalheims großartiger Kinofilm „Eltern“ ist Komödie<br />
und Horrorfilm in einem. Er erzählt von einer Woche aus dem<br />
Leben einer Familie mit zwei berufstätigen Eltern, er zeigt Überforderung<br />
und Liebe, streit, Vernachlässigung und Verzweiflung,<br />
er zeigt, wie es zugeht in Familien, in denen die Mutter und der<br />
Vater Vollzeit arbeiten, mindestens acht stunden täglich, fünf<br />
Tage die Woche. Irgendwann sind alle grenzen los erschöpft.<br />
In diesem Land wird seit mehr als 30 Jahren über die Vereinbarkeit<br />
von Familie und Beruf diskutiert, politisch ist das Thema<br />
längst vom Gedöns zum Dauerbrenner aufgestiegen. Und trotzdem<br />
haben Millionen Männer und Frauen das Gefühl, persönlich<br />
daran zu scheitern. Über 60 Prozent der Eltern fühlen sich<br />
durch ihren Job gestresst, das ergab eine studie der Techniker<br />
Krankenkasse, die Ende Oktober veröffentlicht wurde. Nahezu<br />
* Mit Christiane Paul (l.).<br />
156<br />
d e r s p i e g e l 4 8 / 2 0 1 3<br />
die Hälfte der Befragten leidet unter den anstrengungen durch<br />
familiäre Konflikte und unter den Belastungen der Kindererziehung.<br />
Vor allem Frauen der sogenannten sandwich-Generation,<br />
die 35- bis 45-Jährigen, kennen das Gefühl „Es ist zu viel“.<br />
Es geht vieles durcheinander bei diesem Thema: ideologische<br />
Ziele und persönliche scham, die Notwendigkeit, Geld zu verdienen,<br />
und die sehnsucht, mehr Zeit für die eigenen Kinder<br />
zu haben. Jeder von uns nimmt teil an sehr unterschiedlichen<br />
Diskussionen. Da ist das politische Gerede über das Betreuungs -<br />
geld und über Kita-Plätze. Da sind die Gespräche bei abendessen,<br />
in denen andere Eltern ihre glücklichen Kinder preisen<br />
und in feiner Bescheidenheit auf berufliche Erfolge hinweisen.<br />
Dann gibt es die streitigkeiten am heimischen Küchentisch<br />
über unerledigte schularbeiten; und schließlich ist da eine innere<br />
stimme, besonders laut in schlaflosen Nächten, die flüstert:<br />
„Ich hätte, ich sollte, ich müsste.“<br />
Für die große Erschöpfung ist nicht allein die Politik verantwortlich,<br />
diese Erschöpfung entsteht auch im Privaten. sie entsteht,<br />
weil es zu wenig erlebte Erfahrung gibt für einen alltag<br />
mit zwei berufstätigen Eltern und Kindern. Viele 40-Jährige<br />
versuchen, dieses Leben irgendwie hinzubekommen, aber ihnen<br />
fehlen die Vorbilder. sie sind oft noch in alleinverdienerfamilien<br />
groß geworden, mit klarer Rollenverteilung und einer<br />
Mutter, die mittags ein warmes Essen bereithielt.<br />
Das Thema Hausarbeit ist unendlich unattraktiv, es taugt<br />
für kein Tischgespräch, und in Beziehungen führt es garantiert
zum streit. Waschen, spülen, Putzen. auch in einem Haushalt,<br />
in dem niemand mehr eine Hausfrau ist, muss die Hausarbeit<br />
erledigt werden. Nur: von wem? Die statistik zeigt, auch<br />
bei Paaren, bei denen beide Vollzeit arbeiten, übernimmt die<br />
Partnerin den größeren Teil der Familienarbeit, das geben die<br />
Männer ganz offen zu – in einer studie zum Thema Gleichberechtigung<br />
des Instituts für Demoskopie allensbach aus diesem<br />
Herbst. Über 60 Prozent der befragten Männer glauben, dass<br />
Frauen für Hausarbeit ein besonderes Talent besäßen, und<br />
über 80 Prozent der 18- bis 44-Jährigen meinen, Frauen könnten<br />
besonders gut bügeln.<br />
Wie blöd sind wir Frauen eigentlich, dass im Jahr 2013 bei<br />
der Mehrzahl der Männer noch solche Überzeugungen herrschen?<br />
Wieso lassen wir uns um den Preis der eigenen Erschöpfung<br />
einreden, wir seien begabt für sinnlose Tätigkeiten? Einer -<br />
seits fordern wir mehr Frauen in Führungspositionen, und ande -<br />
rerseits bemühen wir uns, faltenfreie Hemden zu bügeln?<br />
Hausarbeit ist eine Frage der Organisation. Und das gilt<br />
leider für das ganze Familienleben berufstätiger Eltern. Wenn<br />
es halbwegs rundlaufen soll, muss unentwegt geplant und im<br />
Vor aus an unendlich vieles gedacht werden, damit nicht wie<br />
im Film „Eltern“ die Mutter im Krankenhaus Dienst hat und<br />
der Vater ein neues Theaterprojekt startet,<br />
während die Kinder Herbstferien haben und<br />
14 stunden am Tag beschäftigt sein wollen.<br />
Hausarbeit ist auch deshalb ein solches<br />
Reizthema, weil sie Zeit raubt, die Väter<br />
und Mütter lieber anders verbringen würden,<br />
viele von ihnen am liebsten mit ihren Kindern.<br />
Das Gefühl „Ich sehe meine Kinder zu selten“<br />
ist vermutlich der ständige Begleiter der<br />
allermeisten berufstätigen Eltern. Und es<br />
geht bei diesem Gefühl nicht nur darum, die<br />
sogenannte Quality-Time zu erfüllen, irgendwelche<br />
standards, die Kinderpsychologen in<br />
Ratgebern empfehlen, wie: „Nehmen sie sich am Geburtstag<br />
einen Tag frei.“ Es ist im großen Reden über die Vereinbarkeit<br />
von Familie und Beruf bisher viel zu kurz gekommen, wie viel<br />
spaß es macht, mit den eigenen Kindern zusammen zu sein.<br />
Dass man ihnen gern mal nach der schule die Haustür öffnet,<br />
um auf den ersten Blick zu wissen, dass die Lateinarbeit nicht<br />
so gut gelaufen ist, und um mit einer Umarmung die sache etwas<br />
leichter zu machen. Es geht darum, dass Kinder von wichtigen<br />
Dingen nie auf Knopfdruck erzählen, sondern eher so<br />
nebenbei. Und darum, dass ein gemeinsam vertrödelter Nachmittag<br />
Nähe und Glück bedeuten kann. Um es in aller Deutlichkeit<br />
zu sagen: Quality-Time ist schwachsinn. Die existiert<br />
nur auf dem Papier irgendwelcher soziologen. In Familien<br />
führt der Druck, Quality-Time miteinander verbringen zu müssen,<br />
zu anspannung und streit.<br />
Viele Familien<br />
sind heute auf zwei<br />
Einkommen<br />
an gewiesen, und in<br />
vielen dieser<br />
Familien sind die<br />
Kräfte verbraucht.<br />
Das Leben berufstätiger Eltern ist überfrachtet mit ansprüchen<br />
an sich selbst. Im Job möchten sie nicht hinter<br />
den Kollegen ohne Kinder zurückstehen; eine interessante<br />
aufgabe abzulehnen mit der Begründung, der Kindergarten<br />
habe gerade geschlossen und es bliebe einem zu wenig<br />
Zeit und Konzentration, ist nicht nur unprofessionell, sondern<br />
auch frustrierend. Und im Privaten wird besonders an Kindergeburtstagen<br />
oder in der Vorweihnachtszeit gebacken und gebastelt,<br />
um anderen Eltern zu demonstrieren, wie liebevoll<br />
man sich um die Kleinen kümmert. Den Kindern ist das meistens<br />
übrigens herzlich egal. Zurück bleiben Mütter und Väter,<br />
die während der abendnachrichten auf dem sofa einschlafen.<br />
Viele Frauen, die heute gerade dreißig sind, wollen es deshalb<br />
anders machen. schon werden unter jüngeren Frauen wieder<br />
stimmen laut, die von einem reichen Ehemann phantasieren<br />
und von kreativer arbeit daheim. In der „Frankfurter allgemeinen<br />
sonntagszeitung“ schrieb antonia Baum: „Ich wünschte,<br />
mein Mann wäre so reich, dass ich nicht arbeiten müsste<br />
und zu Hause bleiben könnte, wo ich, in ganz langsamer arbeit,<br />
Bücher schreiben würde, von denen ich nicht leben kann.“<br />
Hm. Und wenn der reiche Mann sich irgendwann in eine andere<br />
kreative Frau verliebt?<br />
Eine handfestere Idee ist, dass Vater und Mutter jeweils<br />
nur 80 Prozent arbeiten sollten, so könnte jeder von<br />
ihnen an zwei Nachmittagen zu Hause sein. Das schlechte<br />
Gewissen käme zur Ruhe, das in unserer Zeit des Über-Psycho -<br />
logisierens so verhängnisvoll sein kann: Weil über uns allen<br />
noch das biedermeierliche Ideal der deutschen Mutter schwebt,<br />
wird die Begründung für schwierige Phasen der Kinder oft in<br />
der Berufstätigkeit der Eltern gesucht.<br />
Es wäre schön, wenn die anerkennung wachsen würde für<br />
arbeitnehmer, die statt auf eine 40-stunden-Woche auf eine 32-<br />
stunden-Woche setzen, wenn Führungspositionen geteilt werden<br />
könnten und wenn die Männer dabei mitmachen würden.<br />
Kitas in ehemaligen schlecker-Märkten mit unzulänglich ausgebildeten<br />
Erzieherinnen sind jedenfalls keine Lösung. Im Gegenteil.<br />
Es erhöht die Belastung aller Eltern, wenn sie ihr Kind<br />
nicht gut untergebracht wissen. Bei den Koalitionsverhandlungen<br />
werden die großen Themen gerade wieder<br />
in kleine Kompromisse zerlegt: Einerseits<br />
soll die Teilzeitarbeit mit einem länger ausgezahlten<br />
Elterngeld gefördert werden, andererseits<br />
wird es vermutlich weiterhin das Betreuungsgeld<br />
geben. 195 Milliarden Euro werden<br />
in Deutschland jedes Jahr für Familien<br />
ausgegeben. Die Politik könnte vielen Familien<br />
mit berufstätigen Eltern das Leben erleichtern,<br />
wenn sie sich bei der Verteilung<br />
des Geldes an deren alltag im Jahr 2013 orien -<br />
tieren würde. Vielleicht könnten Horst seehofer,<br />
angela Merkel und sigmar Gabriel mal<br />
ins Kino gehen und sich „Eltern“ anschauen.<br />
Es hat sich in den vergangenen Jahren eine Kluft aufgetan<br />
zwischen der Realität und den Bildern, die davon produziert<br />
werden. Die berufstätige Mutter ist binnen eines Jahrzehnts<br />
vor allem in den städten zu einem anerkannten Rollenmodell<br />
geworden, keine Frauenzeitschrift kommt mehr ohne sie aus.<br />
Und in einer großen Umfrage für die „Brigitte“, geleitet von<br />
Jutta allmendinger, der Präsidentin des Wissenschaftszentrums<br />
Berlin für sozialforschung, zeigte sich, dass sich 76 Prozent<br />
der Männer eine Frau, die nicht berufstätig ist, an ihrer seite<br />
nicht vorstellen können.<br />
Eine große Mehrheit ist anscheinend damit einverstanden,<br />
dass auch junge Mütter Karriere machen. Doch die Probleme,<br />
zu denen das führt, möge bitte jeder selbst und daheim lösen.<br />
Das ist die eigentliche Definition jener Wahlfreiheit, die<br />
Kristina schröder als Familienministerin so unentwegt gepriesen<br />
hat. seit Jahren wird eine große Unentschlossenheit von<br />
der Politik an die Familien weitergereicht, darin liegt die wesentliche<br />
Ursache für die Erschöpfung.<br />
Familie und Beruf werden sich niemals reibungslos mitein -<br />
ander vereinbaren lassen. aber zahlreiche Familien in Deutschland<br />
sind heute auf zwei Einkommen angewiesen. Und in vielen<br />
dieser Familien sind die Kräfte verbraucht, weil die Jahre ins<br />
Land gehen, die Kinder vom Kindergarten in die Grundschule<br />
kommen und schnell größer werden, während familienpolitisch<br />
die Zeit verplempert wird. Nils Minkmar schreibt in seinem Buch<br />
„Der Zirkus“, die Politik solle den Bürgern dienen und ihr Leben<br />
leichter machen. Das gilt besonders für die Familienpolitik.<br />
In der schlussszene von „Eltern“ sagt Christine zu ihrem<br />
Mann: „Egal wie es weitergeht, ich bin dir dankbar dafür, dass<br />
du mich überredet hast, Kinder zu bekommen.“ Erschöpfung<br />
und Freude, davon ist das Grundgefühl der allermeisten berufstätigen<br />
Eltern in diesem Land geprägt. Es wäre schön, wenn<br />
die Freude überwiegen könnte.<br />
◆<br />
d e r s p i e g e l 4 8 / 2 0 1 3 157
Kultur<br />
S T A R S<br />
„Kanakt mich nicht an!“<br />
Der Schauspieler Elyas M’Barek ist dank<br />
der Schulkomödie „Fack Ju Göthe“ der Held des Jahres<br />
im deutschen Kino. Verdientermaßen.<br />
Es ist noch Dämmerstunde in der Bar<br />
des Soho House hoch oben über<br />
Berlin-Mitte an diesem Vormittag<br />
kurz nach zehn, ein paar demonstrativ<br />
muffelige Frauen und Männer kauern in<br />
Plüschsesseln und starren auf ihre Laptops<br />
oder durchs Fenster auf die regennassen<br />
Dächer der Stadt. Elyas M’Barek<br />
aber ist topgelaunt, er soll früh zu Dreharbeiten<br />
antreten und hat außerdem noch<br />
den Wecker falsch gestellt, „eine Stunde<br />
zu früh, aus Blödheit“, wie er sagt.<br />
Mit ernstem Blick und leicht erhobener<br />
Stimme hält er eine Lobrede auf das gute<br />
Benehmen. „Hände in den Hosentaschen<br />
sieht nicht gut aus“, sagt er. „Mitten im<br />
Gespräch auf dem Handy herumtippen<br />
kommt bei älteren Menschen ganz<br />
schlecht an. Ich finde Rücksicht auf solche<br />
Dinge absolut wichtig. Ich will auf keinen<br />
Fall arrogant oder unhöflich sein!“<br />
Das passt zu der menschenfreund -<br />
lichen Tageslosung, die M’Barek auf<br />
seiner Facebook-Seite noch früher an<br />
diesem Regentag an seine Fans ausge -<br />
geben hat: „Morgen! Seid nicht so scheiße<br />
zu Euren Lehrern heute! Oder zu<br />
Euren Schülern!“<br />
In Wahrheit ist Elyas M’Barek derzeit<br />
der Rotzlöffel der Nation. „Fack Ju Göthe“<br />
heißt die Schulkomödie, die Anfang<br />
November in den Kinos angelaufen ist<br />
und in nur zwei Wochen zweieinhalb Mil -<br />
lionen Zuschauer anlockte; so viele wie<br />
kaum ein deutscher Film zuvor. M’Barek<br />
spielt in dem Film den Kleingangster<br />
Zeki Müller. Der muss nach seiner Entlassung<br />
aus dem Knast feststellen, dass<br />
die Beute seines letzten Raubzugs unter<br />
einer neuen Schulturnhalle verscharrt ist.<br />
Deshalb lässt er sich als Aushilfslehrer<br />
anstellen und bringt eine Horde von rebellischen<br />
und bildungsresistenten Zehntklässlern<br />
auf Kurs – indem er ihnen selbst<br />
Streiche spielt: bierrülpsend, fäusteschwingend<br />
und mit Sprüchen wie „Ich<br />
geh jetzt eine rauchen, bevor ich einem<br />
von euch in die Fresse haue!“ oder: „Ka-<br />
nakt mich nicht an!“<br />
M’Barek ist 31 Jahre alt und hat schon<br />
öfter in deutschen Filmen die Rolle des<br />
Prolls mit Herz gespielt. Zum Beispiel<br />
einen Mann namens Cem Öztürk in der<br />
Fernsehserie und im Kinofilm „Türkisch<br />
für Anfänger“ oder den jungen Bushido<br />
in der Rapper-Biografie „Zeiten ändern<br />
158<br />
dich“. Diesmal aber heißt die Figur, die<br />
er verkörpert, Müller. Zeki Müller.<br />
„Ich finde es sehr lässig, dass sich keiner<br />
im Film über den Namen Müller wundert“,<br />
sagt M’Barek. Im realen Leben seien Familiennamen<br />
auch überschätzt. Seinen hat<br />
M’Barek vom Vater, der aus Tunesien<br />
stammt. Die Mutter ist Österreicherin. Er<br />
ist in München geboren und aufgewachsen<br />
und „100 Prozent Münchner“, sagt er.<br />
Ziemlich gesittet und unspektakulär sei es<br />
in seiner Jugend in Sendling zugegangen,<br />
keiner seiner Freunde habe sich darum gekümmert,<br />
ob die Eltern der Kumpane aus<br />
urbayerischen Familien stammten oder<br />
aus anderen Ländern. „Erst als ich beim<br />
Film anfing, war ich total überrascht, dass<br />
dort fast alle über meinen Migrations -<br />
hintergrund redeten.“<br />
So ähnlich erging es auch dem Regisseur<br />
und Drehbuchautor Bora Dagtekin,<br />
der in Hannover aufwuchs, vier Jahre<br />
älter ist als der Darsteller M’Barek, sich<br />
schon „Türkisch für Anfänger“ ausgedacht<br />
hat und nun in „Fack Ju Göthe“<br />
den klassischen deutschen Pennälerfilm<br />
(„Hurra, die Schule brennt!“) auffrischt.<br />
Uschi Glas beispielsweise, die in einigen<br />
alten Schulfilmen das süße Mädchen<br />
schlechthin verkörperte, spielt nun eine<br />
vom Burnout gepeinigte Lehrerin, die<br />
sich aus dem ersten Stock des Schulgebäudes<br />
stürzt. Katja Riemann ist als zickigdurchgeknallte<br />
Schuldirektorin zu sehen,<br />
die den zwielichtigen Zeki Müller engagiert.<br />
Karoline Herfurth spielt eine ökologisch<br />
und pädagogisch superkorrekte<br />
Referendarin, deren Herz der Held unter<br />
anderem dadurch erobert, dass er ihr<br />
beim Schwimmunterricht seine tätowierte<br />
Muskelpracht vorführt.<br />
Erwachsene Frauen und Teenagermädchen<br />
seufzen im Kollektiv in vollgepackten<br />
Kinosälen, wenn M’Barek in Bade -<br />
hose zum Beckenrand schlurft. Der Film<br />
zeige, behauptete die „Frankfurter Allgemeine“<br />
zum Start, eine „auf Frauendiskreditierung<br />
setzende Geschichte“,<br />
feiere die für kluge Lehrer undenkbare<br />
„Ranschmeißerei“ an Schüler und ein<br />
ödes „Märchenprinzenideal“. Vor allem<br />
aber sei das Werk des Regisseurs Bora<br />
Dagtekin bedauerlicherweise so schlicht,<br />
„dass niemals komische Energie entsteht“.<br />
M’Barek lacht, als man ihm die Kritiker -<br />
sätze vorliest. „Auf jeder Party gibt es<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3<br />
„Fack Ju Göthe“-Hauptdarsteller M’Barek: In<br />
einen, der grundsätzlich alles scheiße findet.<br />
In diesem Fall aber wusste ich selber<br />
schon beim Lesen des Drehbuchs, dass<br />
es ein Geniestreich ist.“<br />
Tatsächlich gelingt Dagtekin und M’Barek<br />
in „Fack Ju Göthe“ fast eine Art Epochenbruch<br />
im deutschen Kino. Mit einer<br />
Sorte Komik, die frisch ist und schnell und<br />
gnadenlos. „Fack Ju Göthe“ nimmt Themen<br />
wie Mobbing, Gewalt und computerspielbedingte<br />
Verblödung durch, als handelte<br />
es sich um lustige Small-Talk-Themen<br />
– und kommt stets zu einer noblen<br />
Schlussfolgerung: Man sieht dem Mistkerl<br />
Zeki Müller dabei zu, wie er erst seine<br />
Schüler mit Paintball-Gewehr, Türschubsern<br />
und harten Sprüchen („Chantal, heul<br />
leiser!“) das Fürchten lehrt und sie dann<br />
zu einer lehrreichen Exkursion zu Drogen -<br />
kranken und zerlumpten Kriminellen<br />
mitschleppt. Der Sozialkundeunterricht<br />
erweist sich hier als brechtianisches Lehrtheater,<br />
Furcht und Mitleid inklusive.
vollgepackten Kinosälen seufzen erwachsene Frauen und Teeniemädchen im Kollektiv<br />
Natürlich bedient sich „Fack Ju Göthe“<br />
aus dem Waffenschrank amerikanischer<br />
Highschool-Komödien wie „School of<br />
Rock“. Es wird geteert und gefedert, mit<br />
Snack-Automaten Unfug getrieben und<br />
gegen alle Regeln der moralischen Korrektheit<br />
verstoßen, dass es ein Vergnügen<br />
ist. Zugleich nimmt der Film klug und<br />
dreist ebenjene Welt aufs Korn, in der er<br />
spielt – die durch und durch sozialdemokratisierte<br />
Gegenwart des deutschen<br />
Schulalltags. „Fack Ju Göthe“ ist eine Attacke<br />
gegen die Wohlfühlpädagogik, aber<br />
auch gegen den Alarmismus, mit dem in<br />
den Lehranstalten sogenannter Problembezirke<br />
sogleich der pädagogische Notstand<br />
ausgerufen wird, wenn die Abiturientenquote<br />
unter 50 Prozent rutscht. Der<br />
Film ist ein Hohngesang auf die Gleichberechtigung<br />
der Geschlechter, die Lehrpläne,<br />
die Drogenpolitik. Und, wie der<br />
Titel andeutet, auch auf die Rechtschreibreform.<br />
M’Bareks Figur Zeki Müller wirkt in<br />
diesem Katastrophenklamauk so, als wolle<br />
er die Volten der Handlung keinesfalls<br />
ernster nehmen als unbedingt nötig. Von<br />
plötzlichem Mitleid mit den Schülern geknickt,<br />
durch die Liebe zur Lehrerkollegin<br />
zum lammfrommen Softie gezähmt,<br />
schlenzt er die Rolle des charmanten<br />
Schlitzohrs hin bis zum Happy End, als<br />
wäre er nur zufällig in diesen Schlamassel<br />
geraten. So frei von jeder sichtbaren Anstrengung,<br />
so hemmungslos von sich und<br />
der Welt begeistert, versieht derzeit kein<br />
anderer deutscher Kinoschauspieler sein<br />
Handwerk.<br />
Inzwischen zählt M’Barek neben Matthias<br />
Schweighöfer und Til Schweiger zu<br />
den Schauspielern, die beinahe automatisch<br />
ein großes Publikum anziehen.<br />
Schon „Türkisch für Anfänger“ war ein<br />
Hit, mit 2,4 Millionen Zuschauern der erfolgreichste<br />
deutsche Kinofilm im Jahr<br />
2012, demnächst wird M’Barek in der<br />
CHRISTOPH ASSMANN / CONSTANTIN FILM<br />
Bestsellerverfilmung „Der Medicus“ zu<br />
sehen sein, wenn auch nur in einer wichtigen<br />
Nebenrolle.<br />
M’Barek sagt, dass er mit Kinozuschauer -<br />
zahlen nicht viel anfangen könne. Mit<br />
den Klicks für seine Facebook-Seite sei<br />
das anders. „Die explodiert gerade. Irgendwie<br />
begreif ich das eher. Und es freut<br />
mich wirklich.“ Mehr als eine Million Face -<br />
book-Fans hat er neuerdings, vor drei Monaten<br />
waren es noch nicht halb so viele.<br />
„Hier poste ich selbst, jederzeit. Solange<br />
ich Netz habe. Herzlich willkommen!“,<br />
begrüßt er seine Facebook-Besucher. Er<br />
zeigt sich auf Fotos mit Kumpel und Bier<br />
beim Oktoberfest (Bildtext: „Bierzeltproleten“)<br />
oder mit dem Fußballer Lukas<br />
Podolski (den er vorstellt mit der Zeile:<br />
„Geil, Schweini ist auch hier!“), und er<br />
fragt seine Facebook-Gemeinde nachts<br />
um eins: „Wer hat gerade auch keinen<br />
Sex?“ Am nächsten Morgen hat er dafür<br />
fast 25000 Likes seiner Fans.<br />
Als er vor 13 Jahren, kurz vor dem Abitur,<br />
zum ersten Mal vor einer Kamera<br />
spielte, in einer kleinen Rolle für den Film<br />
„Mädchen, Mädchen“, sei das „eher ein<br />
Hobby“ gewesen. M’Barek entschied sich<br />
damals übrigens gegen eine Schauspielerausbildung,<br />
auch aus Mangel an Identifikationsfiguren:<br />
„An wen hätte ich mich<br />
halten sollen? Erol Sander war so anders,<br />
Hilmi Sözer schon eher mein Fall, Mehmet<br />
Kurtulus kam so langsam. Ansonsten<br />
gab es damals keine Menschen mit Migrationshintergrund<br />
im deutschen Film.“<br />
Einerseits will Elyas M’Barek unbedingt<br />
als deutscher Normalo durchgehen,<br />
andererseits hat er nie vergessen, dass er<br />
als Darsteller in einer Welt antrat, in der<br />
er bis heute meist den Exoten spielt. Der<br />
Schabernack, den er in seinen Filmrollen<br />
mit den krassesten Migrantenklischees<br />
treibt, dürfte auch eine Art Rache sein.<br />
Als der Schauspieler kurz nach dem<br />
sensationellen „Fack Ju Göthe“-Filmstart<br />
in der Fernsehshow „Wetten, dass ..?“ zu<br />
Gast war, regten sich der Regisseur der<br />
Sendung und ein paar Zuschauer hinterher<br />
lauthals darüber auf, dass M’Barek<br />
mitten in der Sendung auf der Gästecouch<br />
auf seinem Handy herumtippte,<br />
was schrecklich schlechte Manieren offenbare.<br />
„Ich entschuldige mich ernsthaft<br />
dafür. Aber ich bin mir keiner Schuld bewusst.<br />
Die Redaktion hatte uns Gäste aufgefordert,<br />
den ganzen Tag lang zu twittern,<br />
was das Zeug hält. Ich habe diesen<br />
Auftrag brav befolgt.“ M’Barek stöhnt.<br />
„Ich bin manchmal erschlagen davon, wie<br />
plötzlich alles, was ich sage oder tue,<br />
schrecklich wichtig genommen wird.“<br />
Um seine Zukunft mache er sich keine<br />
Sorgen. „Ich bin nicht gierig.“ Er blickt<br />
im Raum herum. Draußen regnet es<br />
immer noch. „Wenn es in 20 Jahren mit<br />
der Schauspielerei nichts mehr ist, stehe<br />
ich vielleicht im Soho House hinter der<br />
Bar.“<br />
WOLFGANG HÖBEL<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3 159
Kultur<br />
K I N O<br />
Der Freigeist<br />
Seit den Filmen „Der letzte Tango in Paris“ und „1900“ gilt Bernardo<br />
Bertolucci als Regisseur der erotischen und<br />
sozialen Utopien. Seit Jahren sitzt er im Rollstuhl. Nun dreht er wieder.<br />
Bernardo Bertolucci schaut aus dem<br />
Fenster über die Dächer von London.<br />
Er mag diesen Blick über Notting<br />
Hill, über die vielen Kirchen. „Aber<br />
finden Sie nicht auch“, sagt er nach einer<br />
Weile, „dass die Weite etwas Beunruhigendes<br />
hat?“<br />
Der 73-jährige Bertolucci hat vor einiger<br />
Zeit einen neuen Begriff geprägt:<br />
Klaustrophilie. Der Regisseur ist überzeugt,<br />
dass wahre Grenzüberschreitungen<br />
nur in geschlossenen Räumen möglich<br />
sind. Sein neuer Film „Ich und du“ spielt<br />
fast vollständig in einem Keller.<br />
Vor gut 40 Jahren drehte der aus Parma<br />
stammende Regisseur das berühmteste<br />
Kammerspiel des Kinos. In „Der letzte<br />
Tango in Paris“ erzählt er von einem<br />
Amerikaner (Marlon Brando), der mit einer<br />
knapp halb so alten Französin (Maria<br />
Schneider) in einem leeren Appartement<br />
eine sexuelle Beziehung beginnt.<br />
Bertolucci zeigt die beiden als<br />
Menschen, die nur über ihren Körper<br />
kommunizieren und miteinander<br />
schlafen, ohne den Namen des<br />
anderen zu kennen. Die Sexszenen<br />
des Films sorgten für einen Skandal,<br />
in Italien wurden Brando und Bertolucci<br />
wegen „Obszönität“ zu zwei<br />
Mo naten Gefängnis auf Bewährung<br />
verurteilt.<br />
Doch der Film machte aus Bertolucci<br />
einen Regisseur von Weltrang.<br />
Mit Robert De Niro und Gérard<br />
Depardieu drehte er 1974 das Fünf-<br />
Stunden-Epos „1900“ über den<br />
Kampf zwischen Großgrundbesitzern<br />
und Bauern in der Emilia<br />
Romagna.<br />
Der Film sei ein „Denkmal für<br />
den Kommunismus“, sagt Berto -<br />
lucci, der 1968 in die Kommunistische<br />
Partei Italiens eingetreten war.<br />
Noch heute ist er stolz darauf, aus<br />
Hollywood für dieses Projekt mehrere<br />
Millionen Dollar bekommen<br />
zu haben.<br />
Seither gilt Bertolucci als Regisseur<br />
der großen erotischen und<br />
politischen Utopien. Immer wieder<br />
stellt er sich in seinen Filmen die<br />
Frage, was wir aus unserem Leben<br />
machen würden, wenn wir uns<br />
160<br />
allen Autoritäten entziehen könnten. Er<br />
zeigt, was passiert, wenn sich Menschen<br />
alle Freiheiten nehmen.<br />
Vor zehn Jahren zog sich Bertolucci<br />
bei einem Sturz in Rom eine Rückenverletzung<br />
zu. Die nachfolgende Operation<br />
misslang, seither muss er ein Leben im<br />
Rollstuhl führen. „Diese Wohnung hier“,<br />
sagt er, „ist kein utopischer Ort wie viele<br />
der Wohnungen in meinen Filmen. Sie<br />
wurde von Notwendigkeiten diktiert.“<br />
Sie liegt im fünften Stock eines Apparte -<br />
mentgebäudes aus hellem Backstein. Die<br />
Flure und Türen sind sehr breit, er liebe<br />
es, gedankenverloren von Raum zu Raum<br />
zu fahren, erzählt Bertolucci. Er lebt hier<br />
mit seiner britischen Frau Clare Peploe,<br />
mit der er seit 1990 verheiratet ist. Sie sei,<br />
sagt er flüsternd, „die heimliche Autorin<br />
meiner Drehbücher“.<br />
Auch Peploes Bruder Mark arbeitet<br />
hier. Er schrieb mit Bertolucci an einigen<br />
Regisseur Bertolucci: „Auf Augenhöhe mit den Kindern“<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3<br />
Filmen. Die kreative Dreiecksbeziehung,<br />
die Bertolucci mit den Peploes führt,<br />
spiegelt sich in dem Film „Die Träu -<br />
mer“ (2003). Darin zieht ein amerika -<br />
nischer Student im Paris des Jahres 1968<br />
bei zwei Kinonarren ein, Bruder und<br />
Schwester.<br />
„Meine Filme haben stark mit mir zu<br />
tun“, sagt er. „Als ich den ,Letzten Tango‘<br />
drehte, ging es mir darum, Grenzen zu<br />
verletzen, egal wie. Heute sitze ich im<br />
Rollstuhl. Der Keller ist mir da einfach<br />
näher als das Penthouse. Wohl deshalb<br />
fühlte ich mich zu dem Buch von Niccolò<br />
Ammaniti hingezogen.“<br />
Ammanitis Roman, auf dem sein neuer<br />
Film basiert, spielt in Rom und erzählt<br />
von dem 14-jährigen Lorenzo (Jacopo<br />
Olmo Antinori), der sich heimlich im Keller<br />
eines Mehrfamilienhauses einquartiert.<br />
Eines Tages stöbert ihn seine ältere Stiefschwester<br />
Olivia (Tea Falco) dort auf.<br />
„Als ich erfuhr, dass ich ein Leben<br />
im Rollstuhl führen muss, dachte ich,<br />
ich würde nie mehr Filme drehen<br />
können“, erzählt er. „Ich war schon<br />
dabei, mir etwas anderes zu über -<br />
legen, vielleicht wieder Gedichte zu<br />
schreiben wie damals, als ich Anfang<br />
zwanzig war. Dann merkte ich:<br />
Diesen Stoff kriege ich hin.“<br />
Mit viel Zartgefühl beschreibt<br />
Bertolucci, wie sich Lorenzo und<br />
Olivia, die sich kaum kennen, sich<br />
aber von ihren Eltern gleichermaßen<br />
missverstanden fühlen, einander<br />
annähern. Wer in den Keller<br />
gehe, wolle in den Bauch seiner<br />
Mutter zurück, habe ihm einer seiner<br />
vielen Psycho analytiker einmal<br />
verraten, erzählt Bertolucci.<br />
Sein Werk ist von der Psychoanalyse<br />
geprägt. Fast manisch erzählt<br />
der Regisseur von inzestuösen Beziehungen,<br />
von Söhnen, die ihre<br />
Mutter begehren und ihren Vater<br />
töten. „Würdest du mit mir schlafen,<br />
wenn wir die beiden letzten Menschen<br />
auf Erden wären?“, fragt Lorenzo<br />
seine Mutter.<br />
Über 20 Jahre lang ist Bertolucci<br />
zur Analyse gegangen. Beim „Letzten<br />
Tango“ wollte er seinen damaligen<br />
Analytiker sogar mit in den<br />
GIANFILIPPO DE ROSSI / POLARIS / LAIF
SNAP-PHOTO / INTERTOPICS<br />
KOOL FILMDISTRIBUTION<br />
Bertolucci-Filme „Ich und du“, 2013, „Der letzte Tango in Paris“, 1972, „Die Träumer“, 2003: „Als würde man den Eltern beim Sex zusehen“<br />
INTERFOTO USA / SIPA / DDP IMAGES<br />
Vorspann aufnehmen, das Drehbuch entstand<br />
in weiten Teilen auf der Couch, sagt<br />
er lächelnd.<br />
Das erste Mal zur Analyse ging Bertolucci<br />
im Jahr 1969. Er hatte bereits einige<br />
Filme gedreht, die auf Festivals gezeigt<br />
wurden, aber kaum Zuschauer fanden.<br />
„Ich führte in den Filmen Monologe. Mein<br />
Analytiker brachte mir bei, mit dem Publikum<br />
zu kommunizieren.“<br />
Damals, in den späten sechziger Jahren,<br />
habe er sich zur Welt hin geöffnet, sagt<br />
er heute. Bertolucci, der aus einer großbürgerlichen<br />
Familie stammt und Sohn<br />
eines berühmten Dichters ist, hält es nicht<br />
für einen Zufall, dass er in der Zeit des<br />
Aufbruchs ein anderer Mensch wurde.<br />
Immer wieder kehrt er in seinen Filmen<br />
in das Paris jener Zeit zurück, für<br />
ihn ist es der große Sehnsuchtsort, an<br />
dem alles möglich ist. Er selbst lebte als<br />
junger Mann einige Jahre in Paris, es war<br />
eine Zeit wilder Leidenschaften, alles<br />
drehte sich um Sex, Marx und Kino.<br />
Als Bertolucci Anfang der siebziger Jahre<br />
Marlon Brando nach Paris holte, um mit<br />
ihm den „Letzten Tango“ zu drehen, hatte<br />
auch im Kino eine neue Zeitrechnung begonnen.<br />
Die Grenzen zwischen Hollywood-<br />
Mainstream und europäischem Autorenfilm<br />
schienen durch brochen, vielleicht sogar<br />
die zwischen Kunst und Pornografie.<br />
Brando sei nackt vor die Kameras getreten,<br />
erzählt Bertolucci. „Es hat ihm<br />
überhaupt nichts ausgemacht, der ganzen<br />
Welt seinen Pimmel zu zeigen. Wir wollten,<br />
dass alles völlig natürlich wirkt, geradezu<br />
unschuldig.“ Am Ende schnitt Bertolucci<br />
die Nacktaufnahmen heraus.<br />
In einer Szene zeigt er, wie Brando den<br />
Hintern von Maria Schneider mit Butter<br />
einreibt, und deutet an, dass er sie gegen<br />
ihren Willen anal penetriert. Beide Schauspieler<br />
wurden von Bertolucci erst am<br />
Drehort über den Inhalt der Szene informiert.<br />
Schneider warf dem Regisseur deshalb<br />
später vor, sie missbraucht zu haben.<br />
„Ich hatte nie die Gelegenheit, sie um<br />
Vergebung zu bitten“, sagt er über die<br />
2011 verstorbene Schauspielerin. Für fünf<br />
Jahre seien ihm damals in Italien die Bür-<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3 161
gerrechte entzogen worden, weil die Richter<br />
den Film als Pornografie einstuften.<br />
„Ich durfte nicht wählen, und ich war ein<br />
leidenschaftlicher Kommunist!“<br />
„Einen Film zu machen ist so, als würde<br />
man den eigenen Eltern beim Sex zu -<br />
sehen.“ So lautet sein Credo. Ein guter<br />
Film zeige die Figuren ständig in Situationen,<br />
in denen niemand von anderen<br />
Menschen beobachtet werden möchte.<br />
Bertolucci entwickelte eine Theorie,<br />
nach der die Positionen der Kamera den<br />
Stellungen beim Sex entsprechen. Wegen<br />
seiner Fixierung auf den Sex hielten ihn<br />
einige seiner politischen Weggefährten für<br />
einen eher dubiosen Salonkommunisten.<br />
„Bei ,Ich und du‘ erwarten viele Zuschauer,<br />
dass Lorenzo und Olivia mit -<br />
einander schlafen werden“, meint er. „Ich<br />
fand es aber viel schöner, dass die zwei<br />
einfach eng umschlungen miteinander<br />
tanzen, das war für mich ein Moment großer<br />
Innigkeit.“<br />
Seit fünf Jahrzehnten beschäftigt sich<br />
Bertolucci in seinen Filmen mit Heranwachsenden,<br />
auch „Der letzte Kaiser“,<br />
für den er zwei Oscars gewann, ist letztlich<br />
eine Entwicklungsgeschichte. Bertolucci<br />
kommt nicht weg von der Adoleszenz,<br />
in der nichts entschieden und noch<br />
alles möglich ist. Erwachsenwerden ist<br />
für ihn der Tod der Freiheit.<br />
„Meine Sicht auf die Dinge hat sich verändert,<br />
seit ich im Rollstuhl sitze, genau<br />
genommen um 30 bis 40 Zentimeter“,<br />
sagt er schelmisch. „Jetzt bin ich wieder<br />
auf Augenhöhe mit den Kindern.“<br />
Wenn Bertolucci in „Ich und du“ den<br />
Keller verlässt und sich auf die Straße<br />
begibt, lässt er den Blick seiner Kamera<br />
an den Häuserfassaden in die Höhe<br />
gleiten, bis zum Dach. Dies ist der Blick<br />
eines Mannes, der sich wieder daran<br />
gewöhnen muss, zu anderen Menschen<br />
aufzublicken.<br />
„Ich bin nicht nach Lourdes gefahren“,<br />
sagt er und steckt sich eine Zigarette an.<br />
„Doch Sie sehen einen fröhlichen Mann<br />
vor sich. Einen Film zu drehen, das ist<br />
für mich einfach das reine Glück, da wird<br />
es unwichtig, dass ich im Rollstuhl sitze.“<br />
Er erzählt von Jean Renoir, dem Sohn<br />
des Malers Auguste Renoir. Mitte der siebziger<br />
Jahre traf er ihn in Hollywood, Renoir<br />
war fast achtzig und saß im Rollstuhl.<br />
Stundenlang hätten sie sich unterhalten,<br />
erzählt Bertolucci. „Wo immer du<br />
drehst, lass stets eine Tür offen!“, habe<br />
ihm Renoir geraten.<br />
Am Ende des Gesprächs habe Bertolucci<br />
den Regisseur auf den kahlen Schädel<br />
geküsst. Renoir, sagt er, habe gerochen<br />
wie sein eigener Großvater.<br />
LARS-OLAV BEIER<br />
Video: Ausschnitte aus<br />
Bertoluccis Filmen<br />
spiegel.de/app<strong>48</strong>2013bertolucci<br />
oder in der App <strong>DER</strong> <strong>SPIEGEL</strong><br />
162<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3
Kultur<br />
Im Fernsehen war er nur noch ein<br />
seltener Gast in den letzten Jahren.<br />
Dieter Hildebrandt tourte stattdessen<br />
durch die Republik. Er las aus seinen<br />
Büchern, machte sich auf Kleinkunstbühnen<br />
über Angela Merkel<br />
lustig und genoss die Liebe seines Publikums.<br />
Weit über 80 Jahre alt, trat<br />
er Abend für Abend auf, alt geworden<br />
zwar, aber nie müde.<br />
Wer ihn dort erlebte, bekam ein<br />
neues Bild von ihm. Natürlich, er<br />
blieb der Kritiker, der Moralist,<br />
der Aufrüttler, den die<br />
Marke Hildebrandt seit je<br />
versprach. Diese Marke, die<br />
seinen Namen zum Syn -<br />
onym nahm für Kabarett<br />
in Deutschland. Doch an<br />
diesen Abenden zeigte er,<br />
dass er nicht bloß ein Grantler<br />
war, sondern auch, und<br />
vielleicht vor allem: ein<br />
Humorist.<br />
Er war keiner, der die<br />
Menschen nur belehren<br />
wollte, kein verkniffener,<br />
magenkranker Besserwisser,<br />
kein Moralapostel. Dazu hatte<br />
er viel zu viel Spaß daran,<br />
die Mächtigen zu ärgern und<br />
sein Publikum zu erheitern.<br />
Wie er an solchen Abenden<br />
etwa mit dem Gehstock<br />
in der Hand einen Rentner-<br />
Rap vorführte, rasend schnell,<br />
sicher im Rhythmus, halb<br />
bissig, halb belustigt beweisend,<br />
dass sich das Alter vor<br />
der Jugend nicht verstecken<br />
muss – das war große Kunst.<br />
In diesen Kabinettstückchen<br />
zeigte sich die leichte Seite<br />
von Hildebrandt. Seine Sucht<br />
nach Witz, auch seine Lust<br />
auf kluge Albernheit.<br />
Er konnte eben nicht nur<br />
große Politik. In seinem Programm<br />
„Ausgebucht“ plauderte<br />
er über die Frühstücke<br />
mit seiner Frau Renate und<br />
über seine Angewohnheit, ihre Fragen<br />
nach Kaffee, Ei und Marmelade hinter<br />
der Zeitung verborgen mit einem mürrischen<br />
„Jetzt nicht, vielleicht später“<br />
zu beantworten. Er drehte diese Banalität<br />
mit großer Freude immer weiter.<br />
„Kannst du mir sagen, wie spät<br />
es ist?“ – „Jetzt nicht, vielleicht später.“<br />
Er machte das sehr eigen, sehr<br />
fein und sehr komisch. Und sehr<br />
selbstironisch.<br />
Es fällt einem auf, wenn man die<br />
alten Fernsehauftritte jetzt wieder<br />
sieht, deren tagespolitische Anlässe<br />
fast vergessen sind, wie exakt sein<br />
Sprachwitz war. Die besten Szenen<br />
haben das Zeug zum Klassiker, sie<br />
funktionieren heute noch, weil Hildebrandt<br />
dieses absolute Gehör für<br />
Timing und Pointen, aber auch für<br />
Wort-Müll und Floskel-Irrsinn hatte.<br />
In einer Parodie gab er Helmut Kohl,<br />
der das Lied „Der Mond ist aufgegangen“<br />
aufsagt und den Text in einem<br />
Schwall von Phrasen ertränkt. Kurz<br />
nach Hildebrandts Tod war das Video<br />
N A C H R U F<br />
Dieter Hildebrandt<br />
1927– 2013<br />
ein Renner in sozialen Netzwerken,<br />
auch bei Menschen, die mit Kohl als<br />
Kanzler fast nichts mehr verbinden.<br />
Oder seine Version der nie gehaltenen<br />
Abschiedsrede von Herbert Wehner.<br />
Hildebrandt sah den SPD-Strategen<br />
vermutlich viel zu positiv. Der Auftritt<br />
ist ein Meisterwerk. Auch wer nie<br />
einen Satz von Wehner gehört hat,<br />
wird lachen, wenn er das heute sieht.<br />
Der Schlusssatz der angeblichen<br />
Wehner-Rede, „Ich hoffe, das Hohe<br />
Haus wird mir meine Leidenschaft<br />
verzeihen, ich hätte Ihnen die Ihre<br />
auch gerne verziehen“, ist längst ein<br />
Klassiker der komischen Kunst. Es ist,<br />
wenn es so etwas gibt, ein perfekter<br />
komischer Satz.<br />
Wie groß seine Freude am Witz<br />
war, merkte jeder, der das Glück hatte,<br />
nach einer solchen Vorstellung mit<br />
ihm, seiner Frau Renate und einer<br />
kleinen Schar seiner Freunde und Getreuen<br />
beisammenzusitzen. Da war<br />
er wie auf der Bühne. Er regte sich<br />
viel auf, und er war ständig komisch.<br />
Bei ihm war das kein Entweder-oder.<br />
Zorn und Humor<br />
waren bei ihm ein und<br />
derselbe Naturzustand, den<br />
MAX KOHR / CINETEXT<br />
musste er auf der Bühne<br />
bloß abrufen. Er musste niemanden<br />
spielen. Er war.<br />
Hildebrandt fand Politik<br />
an sich schon komisch und<br />
hat dann nur noch dafür<br />
gesorgt, dass das Publikum<br />
das Komische auch zu sehen<br />
bekommt. Vielleicht wurde<br />
er deshalb nie zum Zyniker,<br />
war er nicht verbittert, blieb<br />
sein Humor deshalb warm<br />
und menschenfreundlich.<br />
Vielleicht war er deshalb so<br />
beliebt.<br />
Dass er das Maß allen poli -<br />
tischen Humors in Deutschland<br />
war, machte es jüngeren<br />
Kollegen nicht leicht, ein<br />
eigenes Profil zu entwickeln.<br />
Er war übermächtig. Kabarett<br />
machte man entweder<br />
im Stile Hildebrandts oder<br />
als Antityp. Hildebrandts<br />
Überzeugung, dass ein Kabarettist<br />
Partei ergreifen<br />
müsse und nicht bloß ironisch,<br />
sarkastisch oder zynisch<br />
über die Dinge hinweggehen<br />
dürfe, folgten die Jüngeren<br />
nicht mehr. Er verbot<br />
ihnen, den Titel „Scheibenwischer“<br />
für etwas zu verwenden,<br />
was für ihn kein<br />
Kabarett, keine komische<br />
Kunst mehr war, sondern nur Pointen -<br />
hascherei, nur noch Comedy.<br />
Am Dienstag vergangener Woche<br />
wurde publik, dass Hildebrandt an<br />
Krebs erkrankt war.<br />
Am Mittwoch, als die Zeitungen<br />
mit der Schlagzeile „Noch bin ich<br />
nicht tot“ auf den Markt kamen, war<br />
er bereits gestorben. Zwei Wochen<br />
zuvor hatte er am Telefon erzählt,<br />
dass er im Dezember wieder auf die<br />
Bühne wolle. Möglicherweise ist er<br />
dem Tod mit einer Pointe begegnet:<br />
„Jetzt nicht, vielleicht später.“<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3 163
Kultur<br />
M Ü N C H N E R K U N S T F U N D<br />
„Empathie allein hilft nicht weiter“<br />
Der bayerische Justizminister Winfried Bausback verteidigt<br />
die umstrittene Beschlagnahme der Bilder und fordert eine Lex Gurlitt.<br />
Bausback, <strong>48</strong>, ist Juraprofessor und seit<br />
Oktober Mitglied der bayerischen Landesregierung.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Herr Bausback, hat sich die Staatsanwaltschaft<br />
Augsburg im Fall Gurlitt stets<br />
und uneingeschränkt korrekt verhalten?<br />
Bausback: Die Beschlagnahme erfolgte<br />
aufgrund eines Gerichtsbeschlusses. Das<br />
habe ich als Minister nicht zu kommentieren.<br />
Es gibt aber eine zweite Ebene,<br />
bei der es auch um unsere Verantwortung<br />
für die Aufarbeitung der Verbrechen des<br />
nationalsozialistischen Terrors geht und<br />
die für das Ansehen Bayerns und Deutsch -<br />
lands in der Welt bedeutsam ist. Und auf<br />
dieser Ebene ist seit der Beschlagnahme<br />
der Bilder 2012 zu viel Zeit vergangen,<br />
ohne dass wir bei der Klärung der Frage,<br />
woher viele dieser Werke stammen, ausreichend<br />
vorangekommen sind. Diese<br />
Aufgabe hätte von Anfang an von allen<br />
Beteiligten bei Bund und Land mit mehr<br />
Druck und Ressourcen angepackt werden<br />
sollen, keine Frage.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Wer hat das verbummelt?<br />
Bausback: Als frisch in dieses Amt gekommener<br />
Minister will ich da keine Schuldzuweisung<br />
treffen.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Bei einer Zollkontrolle aufgefallen<br />
ist Herr Gurlitt bereits im September<br />
2010. Ab wann war das Justizministerium<br />
informiert?<br />
Bausback: Es gab lange Vorermittlungen,<br />
bis es zu der Wohnungsdurchsuchung und<br />
Beschlagnahme kam. Aus der Zeit bis zur<br />
Veröffentlichung des Falles in den Medien<br />
gibt es fünf Berichte hier im Haus, von<br />
denen zwei das Ministerbüro erreicht<br />
haben, allerdings offensichtlich nicht die<br />
politische Spitze des Hauses.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Auf welche Strafvorwürfe stützt<br />
sich denn die Beschlagnahme?<br />
Bausback: Auf steuerrechtlich relevante<br />
Vorwürfe im Zusammenhang mit Kunstgegenständen.<br />
Die Bilder und anderen<br />
Dinge wurden als Beweismittel beschlagnahmt.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Eigentlich ging es ja um den Verkauf<br />
eines einzigen Bildes. Und da muss<br />
man gleich den gesamten Kunstschatz<br />
mitnehmen, den Herr Gurlitt in seiner<br />
Wohnung hatte?<br />
Bausback: Nochmals: Zu Details des Falles<br />
möchte ich schon wegen des Steuergeheimnisses<br />
und der Rechte von Herrn<br />
164<br />
Gurlitt und weil das Verfahren ja noch<br />
läuft, öffentlich keine Stellung nehmen.<br />
Generell gilt: Gegen eine solche Beschlagnahme<br />
sind Rechtsmittel möglich, die<br />
kann jeder Beschuldigte in einem Strafverfahren<br />
einlegen<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Herr Gurlitt meint, er bekomme<br />
die Bilder auch so zurück. Sind Sie froh,<br />
dass er sich immer noch keinen Anwalt<br />
genommen hat?<br />
Bausback: Es ist sein gutes Recht zu entscheiden,<br />
ob er sich anwaltlich vertreten<br />
lässt und wie er sich verteidigt.<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Sollte Herr Gurlitt bei dem Verkauf<br />
des erwähnten Bildes Steuern hinterzogen<br />
haben, wäre das verjährt – der<br />
Verkauf liegt gut 20 Jahre zurück. Auch<br />
der Vorwurf der Unterschlagung, auf den<br />
sich die Staatsanwaltschaft offenbar stützt,<br />
wäre verjährt. Wenn er fremdes Eigentum<br />
unterschlagen hat, geschah das bereits<br />
1967, da hat er die Bilder bereits geerbt.<br />
Eine Beweismittelbeschlagnahme etwa ist<br />
doch bei verjährten Straftaten unzulässig?<br />
Bausback: Die rechtliche Bewertung ist<br />
Aufgabe der Staatsanwaltschaft.<br />
Schwung statt Schärfe<br />
Ingeborg Berggreen-Merkel leitet die Taskforce, die die Herkunft der<br />
Bilder klären und den Staat vor einer Blamage bewahren soll.<br />
Juristin Berggreen-Merkel<br />
„Höflichkeit und Fairness“<br />
DOMINIK BUTZMANN / <strong>DER</strong> <strong>SPIEGEL</strong><br />
Es sind viele Fehler gemacht worden,<br />
einige von Ingeborg Berggreen-<br />
Merkel, 64. Sie gibt das zu. Die Verwaltungsjuristin<br />
soll den Staat in Schutz<br />
nehmen, sie kann das, sie kennt sich aus<br />
in der Bürokratie dieses Staates. Sie war<br />
36 Jahre lang im bayerischen Kultus -<br />
ministerium tätig. 2008 wechselte sie nach<br />
Berlin ins Kanzleramt, wo sie für Kulturstaatsminister<br />
Bernd Neumann arbeitete,<br />
zuletzt als seine Stellvertreterin. Im April<br />
2013 ging sie in den Ruhestand. Jetzt ist<br />
sie zurück.<br />
In der Sache Gurlitt haben sich viele<br />
blamiert. Vor 21 Monaten wurde die<br />
Münchner Wohnung von Cornelius Gurlitt<br />
durchsucht, wegen vermuteter Steuer -<br />
delikte, dann nahmen die Fahnder seinen
STEPHAN RUMPF / SUEDDEUTSCHER VERLAG<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Dann können Sie leider auch dem<br />
Eindruck nicht entgegentreten, dass hier<br />
ein ziemlich großer staatlicher Raubzug<br />
stattgefunden hat.<br />
Bausback: Die Beschlagnahme von Beweismitteln<br />
in einem Ermittlungsverfahren<br />
auf der Grundlage eines richterlichen<br />
Beschlusses ist für mich kein Raubzug.<br />
Die Staatsanwaltschaft hat doch nicht die<br />
Absicht, sich oder anderen die Bilder<br />
rechtswidrig zuzueignen.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Aber hier wird doch auf dem<br />
Rücken von Herrn Gurlitt deutsche Ge-<br />
schichte aufgearbeitet. Wer meint, Eigentum<br />
an diesen Bildern zu haben,<br />
müsste sich an Herrn Gurlitt wenden.<br />
Normalerweise beschlagnahmt kein<br />
Staatsanwalt ein Bild, nur weil jemand<br />
sagt, das gehört eigentlich mir. Und Sie<br />
können nur deshalb Ihre Taskforce dar -<br />
auf ansetzen, weil dieser Schatz nun in<br />
Staatshänden ist.<br />
Bausback: Beschlagnahmen erfolgen nach<br />
der Strafprozessordnung an Gegenständen,<br />
die als Beweismittel von Bedeutung<br />
sind. Sie vermischen die Ebenen.<br />
Justizminister Bausback<br />
„Komplexe Fragen, komplexe Lösungen“<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Nun sollen Bilder zurückgegeben<br />
werden, die „zweifelsfrei“ im Eigentum<br />
von Herrn Gurlitt stehen. Wird da nicht<br />
die Unschuldsvermutung umgedreht?<br />
Bausback: Im Gegenteil, dadurch werden<br />
seine Rechte gewahrt. Nicht mehr erforderliche<br />
Beweismittel sind grundsätzlich<br />
dem letzten Gewahrsamsinhaber zurückzugeben.<br />
Besteht erst einmal der Verdacht,<br />
dass Bilder immer noch anderen<br />
gehören, sieht das anders aus. Weiß die<br />
Staatsanwaltschaft, dass begründete Ansprüche<br />
Dritter etwa an Raubkunst bestehen,<br />
darf sie sie nicht dem letzten Gewahrsamsinhaber<br />
zurückgeben.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Daran äußern von uns befragte<br />
Rechtsexperten erhebliche Zweifel.<br />
Bausback: Ich gehe davon aus, dass die<br />
Rechte von Herrn Gurlitt in diesem Verfahren<br />
gewahrt werden. Es geht um<br />
komplexe Rechtsfragen, da bedarf es<br />
komplexer Lösungen. Es geht natürlich<br />
Bilderbesitz mit. Die Vorwürfe jedoch<br />
reichen schwerlich für die Beschlagnahme<br />
einer ganzen Sammlung.<br />
Der Vater des alten Mannes, Hildebrand<br />
Gurlitt, war nach dem Krieg ein<br />
geachteter Kunstvereinsleiter – aber vor<br />
1945 auch ein Händler im Dienste der<br />
Nazis. Sein Erbe, die Bilder, die er für<br />
sich persönlich zusammentrug, fand<br />
man in der Wohnung. Eine Kunsthistorikerin<br />
erforschte seinen Bilderbesitz,<br />
die Staatsanwaltschaft (in diesem Falle<br />
die Augsburger) und die Bundesregierung<br />
hielten das und alles andere an dieser<br />
Geschichte geheim. Vor drei Wochen<br />
kam alles heraus, der Unmut, gerade<br />
bei jüdischen Verbänden, ist groß.<br />
Nun soll ein ganzes Team den Bestand<br />
bearbeiten, Berggreen-Merkel leitet es.<br />
Das Team nennt sich Taskforce. Das<br />
klingt amerikanisch, zupackend. Die Juristin<br />
soll Schwung in die Sache bringen<br />
und ihr zugleich die Schärfe nehmen.<br />
Sie soll den Respekt für die Opfer deutlich<br />
machen, aber auch solche erreichen,<br />
die fast schon Mitleid mit Gurlitt haben.<br />
Und sie soll ihn selbst erreichen. Sie sagt,<br />
sie möchte Cornelius Gurlitt kennenlernen,<br />
weil das „Höflichkeit und Fairness“<br />
so gebieten würden. Sie möchte „erfahren,<br />
was er über die Herkunft dieser<br />
Kunstwerke weiß“. Gespräche seien<br />
„jetzt der beste Weg, um untereinander<br />
zu Lösungen zu kommen, die für alle<br />
tragbar sind“. Sie sagt aber auch: „Herrin<br />
des Ermittlungsverfahrens ist die<br />
Staatsanwaltschaft Augsburg.“ Und:<br />
„Die Staatsanwaltschaft ist aufgerufen,<br />
in alle Richtungen zu ermitteln, also<br />
auch zugunsten des Beschuldigten.“<br />
Indirekt arbeitet Berggreen-Merkel<br />
dem bayerischen Justizminister zu, dem<br />
die Staatsanwälte in Augsburg unterstehen.<br />
Sie selbst gehörte zu denen, die besonders<br />
frühzeitig in die Sache mit dem<br />
Fund eingeweiht waren: Die Behörde<br />
von Kulturstaatsminister Neumann wurde<br />
um Rat gefragt. Nun meint sie: „Von<br />
Bilder aus der Sammlung Gurlitt<br />
Respekt für die Opfer<br />
heute aus betrachtet, hätten danach alle<br />
beteiligten Stellen sicherlich besser kommunizieren<br />
sollen. Das muss man einräumen.“<br />
Inzwischen wird Cornelius Gurlitt in<br />
aller Öffentlichkeit vom Staat wie ein<br />
Schuldiger behandelt, obwohl es keinen<br />
Prozess gab, obwohl nicht einmal eine<br />
Anklage vorliegt.<br />
Berggreen-Merkel macht moralische<br />
Verpflichtungen geltend: „Eines muss<br />
in diesem Zusammenhang klar sein: Das<br />
grauenvolle Geschehen im ,Dritten<br />
Reich‘, das unfassbare Leid, das Morden<br />
– das verlangt, dass wir alles tun,<br />
um das wiedergutzumachen. Das bewegt<br />
mich auch persönlich zutiefst. Meine<br />
Aufgabe ist es nun, Provenienzen zu<br />
klären.“<br />
Sie sagt: „Auch Herrn Gurlitt gegenüber<br />
würde ich gern zum Ausdruck bringen,<br />
was die Herkunft seiner Bilder bedeutet<br />
und wem sie etwas bedeuten.“<br />
ULRIKE KNÖFEL, MICHAEL SONTHEIMER<br />
PUBLIC PROSECUTOR OFFICE'S AUGSBURG / DPA / VG BILDKUNST BONN, 2013 (3); PUBLIC PROSECUTOR OFFICE'S AUGSBURG / DPA (6);<br />
STAATSANWALTSCHAFT AUGSBURG / DPA (3)<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3 165
Pressekonferenz der Staatsanwaltschaft Augsburg: „Beweismittel beschlagnahmt“<br />
noch um andere Fragen, insbesondere<br />
bezüglich der Bilder, die als Raubkunst<br />
und „Entartete Kunst“ zu qualifizieren<br />
sind, und die sollten in einem Dialog<br />
gelöst werden.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: An dem Dialog mit Herrn Gurlitt<br />
hat es bisher gefehlt.<br />
Bausback: Ich denke, ich habe ein sehr<br />
deutliches Signal ausgesandt und werde<br />
mich weiter darum bemühen. Ich halte<br />
es aber für sinnvoll, dass jetzt zunächst<br />
jemand aus der Taskforce, der Kunstverstand<br />
hat, mit Herrn Gurlitt redet.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Wenn er sich weigert, der Rückgabe<br />
von Raubkunst oder unter NS-Recht<br />
enteigneter Bilder an die Erben der damaligen<br />
Opfer zuzustimmen? Selbst wenn<br />
diese weiter als Eigentümer zu gelten hätten,<br />
ihre darauf gestützten zivilrechtlichen<br />
Herausgabeansprüche verjähren nach 30<br />
Jahren. Die sind längst vorbei.<br />
Bausback: Es wäre für mich schwer erträglich,<br />
wenn man Rückgabeforderungen<br />
solcher Eigentümer nun entgegenhalten<br />
würde, dass ihre Ansprüche verjährt sind.<br />
Ich habe mein Haus deshalb einen Gesetzesvorschlag<br />
erarbeiten lassen, den wir<br />
demnächst zur Diskussion stellen wollen.<br />
Danach dürfte jemand, der beim Erwerb<br />
bösgläubig war, der also wusste, dass die<br />
Bilder oder andere Gegenstände, die er<br />
kauft oder erbt, ihrem Eigentümer abhandengekommen<br />
sind, sich nicht auf die<br />
zivilrechtliche Verjährung berufen.<br />
MARC MÜLLER / DPA<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Würde das dann auch rückwirkend,<br />
also auch für diesen Fall gelten?<br />
Bausback: Ja. Das ist verfassungsrechtlich<br />
zwar nicht unproblematisch, aber wir<br />
meinen, dass man das rechtfertigen kann.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Wollen Sie den Druck auf Herrn<br />
Gurlitt erhöhen, damit er eher nachgibt?<br />
Bausback: Nein. Ich will keinen Druck,<br />
sondern Dialog. Aber ich will ein generelles<br />
Problem anpacken, das mir am Herzen<br />
liegt. Was ich auch klarstellen möchte:<br />
Einen Kuhhandel der Art, Straffreiheit<br />
gegen Verzicht auf Bilder, wird es nicht<br />
geben. Es geht in dem Dialog um den<br />
weiteren Umgang mit den Bildern, nicht<br />
um das Strafverfahren. Ich hoffe, dass<br />
Herr Gurlitt sich dem nicht verschließt.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Vielleicht hätten Sie mehr Glück<br />
bei Herrn Gurlitt, wenn Sie mehr Verständnis<br />
für ihn aufbringen würden?<br />
Bausback: Ich kann mich als Mensch ein<br />
Stück weit in Herrn Gurlitt hineinversetzen.<br />
Aber allein Empathie zu zeigen hilft<br />
nicht weiter.<br />
<strong>SPIEGEL</strong>: Aber vielleicht hätten Sie eine<br />
Botschaft an Herrn Gurlitt?<br />
Bausback: Ich würde es anerkennen, wenn<br />
es ihm gelingen würde, zu einer konstruktiven<br />
Lösung beizutragen. Ich wünsche<br />
ihm jedenfalls, dass er die Kraft hat, mit<br />
der Situation so umzugehen, dass auch<br />
er am Ende zufrieden ist.<br />
INTERVIEW: DIETMAR HIPP, CONNY NEUMANN
Kultur<br />
Was habt ihr getan?<br />
COMIC-KRITIK: Der Zeichner Volker Reiche erzählt in einer Graphic Novel<br />
sein Leben und fragt nach der Schuld der Kriegsgeneration.<br />
Die graubraunen späten vierziger<br />
Jahre des vergangenen Jahrhunderts:<br />
Flüchtlinge in Baracken<br />
und Behelfsunterkünften, verteilt auf das<br />
kaputte Land. Verstörte Familien, traumatisierte<br />
Erwachsene, dazwischen Kinder,<br />
die sich aus alten Brettern Gewehre<br />
basteln und spielen, was<br />
alle am besten können:<br />
Krieg.<br />
Die Geschichte, die Volker<br />
Reiche in seinem<br />
autobiografischen Comic-<br />
Roman erzählt, ist alles<br />
andere als neu. Neu ist<br />
ihre Form. Der 1944 geborene<br />
Künstler, der mehr<br />
als 20 Jahre lang die „Mecki“-Geschichten<br />
für die<br />
Zeitschrift „Hörzu“ erfand,<br />
für Disney als Entenhausen-Zeichner<br />
gearbeitet<br />
hat und für die<br />
„Frankfurter Allgemeine“<br />
in seinem Strip namens<br />
„Strizz“ die aktuelle Lage<br />
kommentierte, hat sich<br />
für eine Bildergeschichte<br />
entschieden.<br />
In zwei Etappen vergegenwärtigt<br />
Reiche seine<br />
Vergangenheit, als Kind<br />
von vier bis neun Jahren<br />
und als junger Erwachsener,<br />
der seinen lange verschollenen<br />
Vater besucht.<br />
In der Gegenwart, die<br />
als Rahmenerzählung in<br />
seinem Buch „Kiesgru-<br />
ben nacht“ fungiert, diskutiert<br />
er seine Erinnerung –<br />
aller dings nicht mit Menschen,<br />
sondern mit den<br />
tierischen Protagonisten<br />
aus „Strizz“.<br />
Der schlaue, egoistische<br />
Kater namens Herr<br />
Paul, der so sanfte wie<br />
kluge Dackel namens Müller und der verträumte<br />
Hofhund namens Tassilo bilden<br />
das reflek torische Dreieck, in dem jeder<br />
Autor kämpft: die Angst zu scheitern, die<br />
der kritische Kater repräsentiert, das<br />
endlose Hin und Her der Abwägung, das<br />
der gebildete Dackel verkörpert, und die<br />
Volker Reiche: „Kiesgrubennacht. Graphic Novel“. Suhrkamp<br />
Verlag, Berlin; 232 Seiten; 21,99 Euro.<br />
naive Ermutigung, die von dem emotionalen<br />
Hofhund ausgeht.<br />
Wer will diese traurigen Geschichten<br />
hören? Worum geht es im Kern, und woher<br />
weißt du das? Und wie geht es weiter?<br />
Das sind die Fragen, die der Erzähler mit<br />
seinen Geschöpfen diskutiert und mit<br />
Graphic Novel „Kiesgrubennacht“: Angst zu scheitern<br />
denen er dem Publikum die Skrupel und<br />
Fährnisse bewusst macht, die das Ent -<br />
stehen jeder Erinnerungsliteratur, wenn<br />
sie denn gut ist, begleiten.<br />
Und gut ist alles, was wir hier sehen:<br />
die Vergegenwärtigung einer Kindheit als<br />
Kosmos aus Freuden, Gefahren und Unglück,<br />
von dem die Eltern nichts wissen<br />
und von dem sie vergessen haben, dass<br />
es ihn gibt. Die Beschreibung der Kollisionen,<br />
die daraus entstehen, und das Einsickern<br />
erster Wahrneh mungen von Fehlbarkeit<br />
der Erzieher. Die Nachzeichnung<br />
der Verstörung, die daraus folgt. Und<br />
schließlich die Kon frontation der erwachsenen<br />
Kinder mit ihren alt gewordenen<br />
Eltern, die über Generationen in Deutschland<br />
in immer derselben<br />
Frage gipfelte: Wo wart<br />
ihr während des Krieges,<br />
und was habt ihr getan?<br />
Der Vater des Ich-Erzählers<br />
war Propagandist<br />
des NS-Regimes. Reiche<br />
illustriert in seiner Graphic<br />
Novel eine von dessen<br />
Hymnen und bricht<br />
zu diesem Zweck aus der<br />
Zeichentechnik des Comics<br />
aus: keine beruhigend<br />
klaren Konturen,<br />
keine niedlichen Sprechblasen,<br />
keine mit Anmut<br />
getuschten Flächen. Stattdessen<br />
expressionistische<br />
Orgien, in denen sich die<br />
Überwältigung durch das<br />
Entsetzen im Bild wiederholt,<br />
in denen die Figuren<br />
zu groß sind für das Format<br />
und so brutal wie das<br />
Geschehen. Noch als Erwachsenen,<br />
gesteht er<br />
seinen Geschöpfen, fas -<br />
ziniert ihn nichts so sehr<br />
wie die Gewalt. Nur hat<br />
er es, moralisch beruhigend,<br />
in seinen geliebten<br />
Computerspielen ja nicht<br />
mit Menschen zu tun, sondern<br />
mit „digitalen Dä -<br />
monen“.<br />
„Es ist eine alte Geschichte,<br />
/ Doch bleibt sie<br />
immer neu, / Und wem<br />
sie just passieret, / Dem<br />
bricht das Herz entzwei.“<br />
Als Heinrich Heine diese<br />
berühmte Strophe dichtete, Anfang des<br />
19. Jahrhunderts, dachte er an die Liebe.<br />
War um man in Deutschland da an etwas<br />
ganz anderes denken kann, das hat Volker<br />
Reiche wieder gezeigt. So verständlich<br />
und klar und so eindringlich und<br />
verstörend zugleich, dass man es sich –<br />
aber wirklich nur unter anderem – als<br />
Schullektüre wünscht. Für alle Nach -<br />
geborenen.<br />
ELKE SCHMITTER<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3 167
Impressum<br />
Ericusspitze 1, 20457 Hamburg, Telefon (040) 3007-0 · Fax -2246 (Verlag), -2247 (Redaktion)<br />
HERAUSGEBER Rudolf Augstein (1923 – 2002)<br />
CHEFREDAKTEUR Wolfgang Büchner (V. i. S. d. P.)<br />
STELLV. CHEFREDAKTEURE<br />
Klaus Brinkbäumer, Dr. Martin Doerry<br />
MITGLIED <strong>DER</strong> CHEFREDAKTION<br />
Nikolaus Blome (Leiter des Hauptstadtbüros)<br />
ART DIRECTION Uwe C. Beyer<br />
Politischer Autor: Dirk Kurbjuweit<br />
DEUTSCHE POLITIK · HAUPTSTADTBÜRO Stellvertretende Leitung:<br />
Christiane Hoffmann, René Pfister. Redaktion Politik: Nicola Abé, Dr.<br />
Melanie Amann, Ralf Beste, Horand Knaup, Peter Müller, Ralf Neukirch,<br />
Gordon Repinski. Autor: Markus Feldenkirchen<br />
Redaktion Wirtschaft: Sven Böll, Markus Dettmer, Cornelia Schmergal,<br />
Gerald Traufetter. Reporter: Alexander Neubacher, Christian Reiermann<br />
Meinung: Dr. Gerhard Spörl<br />
DEUTSCHLAND Leitung: Alfred Weinzierl, Cordula Meyer (stellv.),<br />
Dr. Markus Verbeet (stellv.); Hans-Ulrich Stoldt (Panorama). Redaktion:<br />
Felix Bohr, Jan Friedmann, Michael Fröhlingsdorf, Hubert Gude,<br />
Carsten Holm, Charlotte Klein, Petra Kleinau, Guido Kleinhubbert,<br />
Bernd Kühnl, Gunther Latsch, Udo Ludwig, Maximilian Popp, Andreas<br />
Ulrich, Antje Windmann. Autoren, Reporter: Jürgen Dahlkamp, Dr.<br />
Thomas Darnstädt, Gisela Friedrichsen, Beate Lakotta, Bruno Schrep,<br />
Katja Thimm, Dr. Klaus Wiegrefe<br />
Berliner Büro Leitung: Frank Hornig. Redaktion: Sven Becker, Markus<br />
Deggerich, Özlem Gezer, Sven Röbel, Jörg Schindler, Michael Sontheimer,<br />
Andreas Wassermann, Peter Wensierski. Autoren: Stefan Berg,<br />
Jan Fleischhauer, Konstantin von Hammerstein<br />
WIRTSCHAF T Leitung: Armin Mahler, Michael Sauga (Berlin),<br />
Susanne Amann (stellv.), Marcel Rosenbach (stellv., Medien und Internet).<br />
Redaktion: Markus Brauck, Isabell Hülsen, Alexander Jung,<br />
Nils Klawitter, Alexander Kühn, Martin U. Müller, Ann-Kathrin Nezik,<br />
Jörg Schmitt, Janko Tietz. Autoren, Reporter: Markus Grill, Dietmar<br />
Hawranek, Michaela Schießl<br />
AUSLAND Leitung: Clemens Höges, Britta Sandberg, Juliane von Mittelstaedt<br />
(stellv.). Redaktion: Dieter Bednarz, Manfred Ertel, Jan Puhl,<br />
Sandra Schulz, Samiha Shafy, Daniel Steinvorth, Helene Zuber. Autoren,<br />
Reporter: Ralf Hoppe, Hans Hoyng, Susanne Koelbl, Dr. Christian<br />
Neef, Christoph Reuter<br />
Diplomatischer Korrespondent: Dr. Erich Follath<br />
WISSENSCHAFT UND TECHNIK Leitung: Rafaela von Bredow, Olaf<br />
Stampf. Redaktion: Dr. Philip Bethge, Manfred Dworschak, Marco<br />
Evers, Dr. Veronika Hackenbroch, Laura Höflinger, Julia Koch, Kerstin<br />
Kullmann, Hilmar Schmundt, Matthias Schulz, Frank Thadeusz, Christian<br />
Wüst. Autor: Jörg Blech<br />
KULTUR Leitung: Lothar Gorris, Dr. Joachim Kronsbein (stellv.).<br />
Redaktion: Lars-Olav Beier, Susanne Beyer, Dr. Volker Hage, Ulrike<br />
Knöfel, Philipp Oehmke, Tobias Rapp, Katharina Stegelmann, Claudia<br />
Voigt, Martin Wolf. Autoren, Reporter: Georg Diez, Wolfgang Höbel,<br />
Thomas Hüetlin, Dr. Romain Leick, Matthias Matussek, Elke Schmitter,<br />
Dr. Susanne Weingarten<br />
Kultur<strong>SPIEGEL</strong>: Marianne Wellershoff (verantwortlich). Tobias<br />
Becker, Anke Dürr, Maren Keller, Daniel Sander<br />
GESELLSCHAFT Leitung: Matthias Geyer, Dr. Stefan Willeke, Barbara<br />
Supp (stellv.). Redaktion: Hauke Goos, Barbara Hardinghaus, Wiebke<br />
Hollersen, Ansbert Kneip, Katrin Kuntz, Dialika Neufeld, Bettina Stiekel,<br />
Jonathan Stock, Takis Würger. Reporter: Uwe Buse, Ullrich Fichtner,<br />
Jochen-Martin Gutsch, Guido Mingels, Cordt Schnibben, Alexander<br />
Smoltczyk<br />
SPORT Leitung: Gerhard Pfeil, Michael Wulzinger. Redaktion: Rafael<br />
Buschmann, Lukas Eberle, Maik Großekathöfer, Detlef Hacke, Jörg<br />
Kramer<br />
SON<strong>DER</strong>THEMEN Leitung: Dietmar Pieper, Annette Großbongardt<br />
(stellv.). Redaktion: Annette Bruhns, Angela Gatterburg, Uwe Klußmann,<br />
Joachim Mohr, Bettina Musall, Dr. Johannes Saltzwedel, Dr.<br />
Eva-Maria Schnurr, Dr. Rainer Traub<br />
MULTIMEDIA Jens Radü; Roman Höfner, Marco Kasang, Bernhard<br />
Riedmann<br />
CHEF VOM DIENST Thomas Schäfer, Katharina Lüken (stellv.),<br />
Holger Wolters (stellv.)<br />
SCHLUSSREDAKTION Anke Jensen; Christian Albrecht, Gesine Block,<br />
Regine Brandt, Lutz Diedrichs, Bianca Hunekuhl, Ursula Junger, Sylke<br />
Kruse, Maika Kunze, Stefan Moos, Reimer Nagel, Manfred Petersen,<br />
Fred Schlotterbeck, Sebastian Schulin, Tapio Sirkka, Ulrike Wallenfels<br />
PRODUKTION Solveig Binroth, Christiane Stauder, Petra Thormann;<br />
Christel Basilon, Petra Gronau, Martina Treumann<br />
BILDREDAKTION Michaela Herold (Ltg.), Claudia Jeczawitz, Claus-<br />
Dieter Schmidt; Sabine Döttling, Susanne Döttling, Torsten Feldstein,<br />
Thorsten Gerke, Andrea Huss, Antje Klein, Elisabeth Kolb, Matthias<br />
Krug, Parvin Nazemi, Peer Peters, Karin Weinberg, Anke Wellnitz<br />
E-Mail: bildred@spiegel.de<br />
<strong>SPIEGEL</strong> Foto USA: Susan Wirth, Tel. (001212) 30759<strong>48</strong><br />
GRAFIK Martin Brinker, Johannes Unselt (stellv.); Cornelia Baumermann,<br />
Ludger Bollen, Thomas Hammer, Anna-Lena Kornfeld, Gernot<br />
Matzke, Cornelia Pfauter, Julia Saur, André Stephan, Michael Walter<br />
LAYOUT Wolfgang Busching, Jens Kuppi, Reinhilde Wurst (stellv.);<br />
Michael Abke, Katrin Bollmann, Claudia Franke, Bettina Fuhrmann,<br />
Ralf Geilhufe, Kristian Heuer, Nils Küppers, Sebastian Raulf, Barbara<br />
Rödiger, Doris Wilhelm<br />
Besondere Aufgaben: Michael Rabanus<br />
Sonderhefte: Rainer Sennewald<br />
TITELBILD Suze Barrett, Arne Vogt; Iris Kuhlmann, Gershom Schwalfenberg<br />
Besondere Aufgaben: Stefan Kiefer<br />
INTERNET www.spiegel.de<br />
REDAKTIONSBLOG spiegel.de/spiegelblog<br />
TWITTER @derspiegel<br />
FACEBOOK facebook.com/derspiegel<br />
168<br />
E-Mail spiegel@spiegel.de<br />
REDAKTIONSVERTRETUNGEN DEUTSCHLAND<br />
BERLIN Pariser Platz 4a, 10117 Berlin; Deutsche Politik, Wirtschaft<br />
Tel. (030) 886688-100, Fax 886688-111; Deutschland, Wissenschaft,<br />
Kultur, Gesellschaft Tel. (030) 886688-200, Fax 886688-222<br />
DRESDEN Steffen Winter, Wallgäßchen 4, 01097 Dresden, Tel. (0351)<br />
26620-0, Fax 26620-20<br />
DÜSSELDORF Georg Bönisch, Frank Dohmen, Barbara Schmid, Fidelius<br />
Schmid , Benrather Straße 8, 40213 Düsseldorf, Tel. (0211) 86679-<br />
01, Fax 86679-11<br />
FRANKFURT AM MAIN Matthias Bartsch, Martin Hesse, Simone Salden,<br />
Anne Seith, An der Welle 5, 60322 Frankfurt am Main, Tel. (069)<br />
9712680, Fax 97126820<br />
KARLSRUHE Dietmar Hipp, Waldstraße 36, 76133 Karlsruhe, Tel. (0721)<br />
22737, Fax 9204449<br />
MÜNCHEN Dinah Deckstein, Anna Kistner, Conny Neumann, Rosental<br />
10, 80331 München, Tel. (089) 4545950, Fax 45459525<br />
STUTTGART Büchsenstraße 8/10, 70173 Stuttgart, Tel. (0711) 664749-<br />
20, Fax 664749-22<br />
REDAKTIONSVERTRETUNGEN AUSLAND<br />
BOSTON Johann Grolle, 25 Gray Street, 02138 Cambridge, Massachusetts,<br />
Tel. (001617) 9452531<br />
BRÜSSEL Christoph Pauly, Christoph Schult, Bd. Charlemagne 45,<br />
1000 Brüssel, Tel. (00322) 2306108, Fax 2311436<br />
KAPSTADT Bartholomäus Grill, P. O. Box 15614, Vlaeberg 8018, Kapstadt,<br />
Tel. (002721) 4261191<br />
LONDON Christoph Scheuermann, 26 Hanbury Street, London E1 6QR,<br />
Tel. (0044203) 4180610, Fax (0044207) 0929055<br />
MADRID Apartado Postal Número 100 64, 28080 Madrid, Tel. (0034)<br />
650652889<br />
MOSKAU Matthias Schepp, Glasowskij Pereulok Haus 7, Office 6,<br />
119002 Moskau, Tel. (007495) 22849-61, Fax 22849-62<br />
NEU-DELHI Dr. Wieland Wagner, 210 Jor Bagh, 2F, Neu-Delhi 110003,<br />
Tel. (009111) 41524103<br />
NEW YORK Alexander Osang, 10 E 40th Street, Suite 3400, New York,<br />
NY 10016, Tel. (001212) 2217583, Fax 3026258<br />
PARIS Mathieu von Rohr, 12, Rue de Castiglione, 75001 Paris, Tel.<br />
(00331) 58625120, Fax 42960822<br />
PEKING Bernhard Zand, P.O. Box 170, Peking 100101, Tel. (008610)<br />
65323541, Fax 65325453<br />
RIO DE JANEIRO Jens Glüsing, Caixa Postal 56071, AC Urca,<br />
22290-970 Rio de Janeiro-RJ, Tel. (005521) 2275-1204, Fax 2543-9011<br />
ROM Fiona Ehlers, Walter Mayr, Largo Chigi 9, 00187 Rom, Tel.<br />
(003906) 6797522, Fax 6797768<br />
SAN FRANCISCO Thomas Schulz, P.O. Box 330119, San Francisco, CA<br />
94133, Tel. (001212) 2217583<br />
TEL AVIV Julia Amalia Heyer, P.O. Box 8387, Tel Aviv-Jaffa 61083,<br />
Tel. (009723) 6810998, Fax 6810999<br />
WARSCHAU P.O. Box 31, ul. Waszyngtona 26, PL- 03-912 Warschau,<br />
Tel. (00<strong>48</strong>22) 6179295, Fax 6179365<br />
WASHINGTON Marc Hujer, Holger Stark, 1202 National Press Building,<br />
Washington, D.C. 20045, Tel. (001202) 3475222, Fax 3473194<br />
DOKUMENTATION Dr. Hauke Janssen, Cordelia Freiwald (stellv.), Axel<br />
Pult (stellv.), Peter Wahle (stellv.); Jörg-Hinrich Ahrens, Dr. Susmita<br />
Arp, Dr. Anja Bednarz, Ulrich Booms, Dr. Helmut Bott, Viola Broecker,<br />
Dr. Heiko Buschke, Andrea Curtaz-Wilkens, Johannes Eltzschig, Johannes<br />
Erasmus, Klaus Falkenberg, Catrin Fandja, Anne-Sophie Fröhlich,<br />
Dr. André Geicke, Silke Geister, Thorsten Hapke, Susanne Heitker,<br />
Carsten Hellberg, Stephanie Hoffmann, Bertolt Hunger, Joachim Immisch,<br />
Kurt Jansson, Michael Jürgens, Tobias Kaiser, Renate Kemper-<br />
Gussek, Jessica Kensicki, Ulrich Klötzer, Ines Köster, Anna Kovac, Peter<br />
Lakemeier, Dr. Walter Lehmann-Wiesner, Michael Lindner, Dr.<br />
Petra Ludwig-Sidow, Rainer Lübbert, Sonja Maaß, Nadine Markwaldt-<br />
Buchhorn, Dr. Andreas Meyhoff, Gerhard Minich, Cornelia Moormann,<br />
Tobias Mulot, Bernd Musa, Nicola Naber, Margret Nitsche, Malte<br />
Nohrn, Sandra Öfner, Thorsten Oltmer, Dr. Vassilios Papadopoulos,<br />
Axel Rentsch, Thomas Riedel, Andrea Sauerbier, Maximilian Schäfer,<br />
Marko Scharlow, Rolf G. Schierhorn, Mirjam Schlossarek, Dr. Regina<br />
Schlüter-Ahrens, Mario Schmidt, Thomas Schmidt, Andrea Schumann-<br />
Eckert, Ulla Siegenthaler, Jil Sörensen, Rainer Staudhammer, Tuisko<br />
Steinhoff, Dr. Claudia Stodte, Stefan Storz, Rainer Szimm, Dr. Eckart<br />
Teichert, Nina Ulrich, Ursula Wamser, Peter Wetter, Kirsten Wiedner,<br />
Holger Wilkop, Karl-Henning Windelbandt, Anika Zeller<br />
LESER-SERVICE Catherine Stockinger<br />
NACHRICHTENDIENSTE AFP, AP, dpa, Los Angeles Times / Washington<br />
Post, New York Times, Reuters, sid<br />
<strong>SPIEGEL</strong>-VERLAG RUDOLF AUGSTEIN GMBH & CO. KG<br />
Verantwortlich für Anzeigen: Norbert Facklam<br />
Gültige Anzeigenpreisliste Nr. 67 vom 1. Januar 2013<br />
Mediaunterlagen und Tarife: Tel. (040) 3007-2540, www.spiegel-qc.de<br />
Commerzbank AG Hamburg<br />
Konto-Nr. 6181986, BLZ 200 400 00<br />
Verantwortlich für Vertrieb: Thomas Hass<br />
Druck: Prinovis, Dresden / Prinovis, Itzehoe<br />
VERLAGSLEITUNG Matthias Schmolz, Rolf-Dieter Schulz<br />
GESCHÄFTSFÜHRUNG Ove Saffe<br />
<strong>DER</strong> <strong>SPIEGEL</strong> (USPS No. 0154520) is published weekly by <strong>SPIEGEL</strong> VERLAG. Subscription<br />
price for USA is $ 370 per annum. K.O.P.: German Language Pub., 153 S Dean St, Englewood,<br />
NJ 07631. Periodicals postage is paid at Paramus, NJ 07652. Postmaster: Send address changes to:<br />
<strong>DER</strong> <strong>SPIEGEL</strong>, GLP, P.O. Box 9868, Englewood, NJ 07631.<br />
d e r s p i e g e l 4 8 / 2 0 1 3<br />
Service<br />
Leserbriefe<br />
<strong>SPIEGEL</strong>-Verlag, Ericusspitze 1, 20457 Hamburg<br />
Fax: (040) 3007-2966 E-Mail: leserbriefe@spiegel.de<br />
Hinweise für Informanten:<br />
Falls Sie dem <strong>SPIEGEL</strong> vertrauliche Dokumente und Informationen<br />
zukommen lassen wollen, finden Sie unter<br />
der Webadresse www.spiegel.de/briefkasten Hinweise,<br />
wie Sie die Redaktion erreichen und sich schützen.<br />
Wollen Sie wegen vertraulicher Informationen direkt<br />
Kontakt zum <strong>SPIEGEL</strong> aufnehmen, stehen Ihnen folgende<br />
Wege zur Verfügung:<br />
Post: <strong>DER</strong> <strong>SPIEGEL</strong>, c/o „Briefkasten“, Ericusspitze 1,<br />
20457 Hamburg<br />
PGP-verschlüsselte Mail: briefkasten@spiegel.de (den<br />
entsprechenden PGP-Schlüssel finden Sie unter<br />
www.spiegel.de/briefkasten)<br />
Telefon: 040-3007-0, Stichwort „Briefkasten“<br />
Fragen zu <strong>SPIEGEL</strong>-Artikeln /Recherche<br />
Telefon: (040) 3007-2687 Fax: (040) 3007-2966<br />
E-Mail: artikel@spiegel.de<br />
Nachdruckgenehmigungen für Texte, Fotos, Grafiken:<br />
Nachdruck und Angebot in Lesezirkeln nur mit schriftlicher<br />
Genehmigung des Verlags. Das gilt auch für die<br />
Aufnahme in elektronische Datenbanken und Mailboxen<br />
sowie für Vervielfältigungen auf CD-Rom.<br />
Deutschland, Österreich, Schweiz:<br />
Telefon: (040) 3007-2869 Fax: (040) 3007-2966<br />
E-Mail: nachdrucke@spiegel.de<br />
übriges Ausland:<br />
New York Times News Service/Syndicate<br />
E-Mail: nytsyn-paris@nytimes.com<br />
Telefon: (00331) 41439757<br />
Nachbestellungen<br />
<strong>SPIEGEL</strong>-Ausgaben der letzten Jahre sowie<br />
alle Ausgaben von <strong>SPIEGEL</strong> GESCHICHTE<br />
und <strong>SPIEGEL</strong> WISSEN können unter<br />
www.amazon.de/spiegel versandkostenfrei<br />
innerhalb Deutschlands nachbestellt werden.<br />
Historische Ausgaben<br />
Historische Magazine Bonn<br />
www.spiegel-antiquariat.de Telefon: (0228) 9296984<br />
Kundenservice<br />
Persönlich erreichbar Mo. – Fr. 8.00 – 19.00 Uhr,<br />
Sa. 10.00 – 16.00 Uhr<br />
<strong>SPIEGEL</strong>-Verlag, Abonnenten-Service, 20637 Hamburg<br />
Telefon: (040) 3007-2700 Fax: (040) 3007-3070<br />
E-Mail: aboservice@spiegel.de<br />
Abonnement für Blinde<br />
Audio Version, Deutsche Blindenstudienanstalt e.V.<br />
Telefon: (06421) 606265<br />
Elektronische Version, Frankfurter Stiftung für Blinde<br />
Telefon: (069) 955124-<br />
Abonnementspreise<br />
Inland: 52 Ausgaben € 218,40<br />
Studenten Inland: 52 Ausgaben € 153,40 inkl.<br />
sechsmal Uni<strong>SPIEGEL</strong><br />
Österreich: 52 Ausgaben € 234,00<br />
Schweiz: 52 Ausgaben sfr 361,40<br />
Europa: 52 Ausgaben € 273,00<br />
Außerhalb Europas: 52 Ausgaben € 351,00<br />
Der digitale <strong>SPIEGEL</strong>: 52 Ausgaben € 202,80<br />
Befristete Abonnements werden anteilig berechnet.<br />
Abonnementsbestellung<br />
bitte ausschneiden und im Briefumschlag senden an<br />
<strong>SPIEGEL</strong>-Verlag, Abonnenten-Service,<br />
20637 Hamburg – oder per Fax: (040) 3007-3070,<br />
www.spiegel.de/abo<br />
Ich bestelle den <strong>SPIEGEL</strong><br />
❏ für € 4,20 pro Ausgabe<br />
❏ für € 3,90 pro digitale Ausgabe<br />
❏ für € 0,50 pro digitale Ausgabe zusätzlich zur<br />
Normallieferung. Eilbotenzustellung auf Anfrage.<br />
Das Geld für bezahlte, aber noch nicht gelieferte Hefte<br />
bekomme ich zurück. Bitte liefern Sie den <strong>SPIEGEL</strong> an:<br />
Name, Vorname des neuen Abonnenten<br />
Straße, Hausnummer oder Postfach<br />
PLZ, Ort<br />
Ich zahle<br />
❏ bequem und bargeldlos per Bankeinzug (1/4-jährl.)<br />
Bankleitzahl<br />
Konto-Nr.<br />
Geldinstitut<br />
❏ nach Erhalt der Jahresrechnung. Eine Belehrung<br />
über Ihr Widerrufsrecht erhalten Sie unter:<br />
www.spiegel.de/widerrufsrecht<br />
Datum, Unterschrift des neuen Abonnenten<br />
SP13-001<br />
SD13-006<br />
SD13-008 (Upgrade)
Register<br />
SONNTAG, 1. 12., 23.30 – 0.15 UHR | RTL<br />
<strong>SPIEGEL</strong> TV MAGAZIN<br />
Razzia gegen Automafia<br />
Gestohlen, zerlegt und verschoben –<br />
Grenzverkehr mit geklauten Luxusautos;<br />
Vom Jugendamt abgeholt – Eine<br />
Mutter kämpft um ihre Kinder; Von<br />
Beruf Heiratsschwindler – Wenn Frauen<br />
zur Einkommensquelle werden.<br />
FREITAG, 29. 11., 8.30 – 8.55 UHR | ARTE<br />
X:ENIUS<br />
Energiesparlampe – Was steckt<br />
in ihr?<br />
An der von der EU verordneten<br />
Energiesparlampe scheiden sich die<br />
Geister. Sie wurde den Verbrauchern<br />
als stromsparende Alternative zu<br />
Glühbirnen angepriesen. Eine<br />
dreiköpfige Familie könne durch<br />
den Austausch aller Lampen 150 Euro<br />
pro Jahr sparen, so das deutsche<br />
Umweltbundesamt. Doch die<br />
Energiesparlampe hat nicht nur Vor-,<br />
sondern auch Nachteile: Ihr Licht<br />
wird von vielen als kalt empfunden,<br />
sie enthält giftiges Quecksilber<br />
und muss aufwendig entsorgt werden.<br />
Und auch die Haltbarkeit ist ein<br />
heikles Thema: Mehrere Jahre sollen<br />
Energiesparlampen nach Her -<br />
stellerangaben leuchten. Doch nicht<br />
OLED-Leuchten<br />
alle halten so lange durch. Wird<br />
der Verbraucher hinters Licht<br />
geführt? Für das Wissensmagazin<br />
X:enius geht <strong>SPIEGEL</strong> TV der<br />
Frage nach, welche Vor- und Nach -<br />
teile die Energiesparlampe hat<br />
und inwieweit Halogen-, LED- oder<br />
die neuen OLED-Lampen<br />
denkbare Alternativen sind.<br />
<strong>SPIEGEL</strong> TV<br />
<strong>SPIEGEL</strong> TV<br />
Doris Lessing, 94. Am 11. Oktober 2007<br />
erfuhr sie, dass sie den Nobelpreis für Literatur<br />
erhalten würde – beinahe ein halbes<br />
Jahrhundert nachdem ihr bestes und<br />
einflussreichstes Werk, „Das goldene Notizbuch“,<br />
1962 erschienen war. Die alte<br />
Dame, die ihr weißes Haar zu einem<br />
Knoten geschlungen hatte, eine blaue<br />
Weste im Ethnostil und solide Schuhe<br />
trug, fiel bei der Nachricht überhaupt<br />
nicht aus allen Wolken. Sie habe alle<br />
Preise bekommen, die es in Europa gebe,<br />
erteilte sie den vor ihrem Reihenhaus<br />
wartenden Journalisten freundlich Bescheid,<br />
„every bloody one“, da sei das<br />
jetzt auch nicht mehr so aufregend, und<br />
jetzt müsse sie den Taxifahrer bezahlen.<br />
In dieser Manier, ungezwungen und<br />
selbstbewusst, waren ihre Bücher geschrieben<br />
– stilistisch unaufwendig bis<br />
zur Fahrlässigkeit, aber immer beschäf -<br />
tigt mit den großen Fragen der Zeit.<br />
Die Tochter weißer Farmer in Südrho -<br />
desien war konfrontiert mit Rassismus,<br />
mit Frauenverachtung und Antisemi -<br />
tismus, sie kämpfte gegen den Stalinis -<br />
mus in der englischen kommunistischen<br />
Partei und gegen die Naturzerstörung des<br />
Kapitalismus; nichts war ihr zu groß,<br />
wenig zu gering. Nur die Belanglosigkeit<br />
selbst verstörte sie: „Inzwischen“, schrieb<br />
sie 1997, „hat es zwei Generationen gegeben,<br />
die nie über etwas anderes reden<br />
als über Einkäufe und den neuesten<br />
Klatsch, und wenn ich mit ihnen zusammen<br />
bin, frage ich mich, wie sie diese<br />
winzige, eng umgrenzte Welt ertragen<br />
können, in der sie leben.“ Lessing, die<br />
ihren ersten Ehemann und die beiden<br />
Kinder aus dieser Ehe verlassen hatte,<br />
lebte seit 1949 in London. Aus ihren<br />
Erfahrungen entstand ein geradezu<br />
schlenkerndes Werk – angelegt zwischen<br />
Märchen und Fabel, Science-Fiction, erzählendem<br />
Realismus und Gelegenheits -<br />
essay. Kein ästhetisches Projekt, sondern<br />
die Erkundung von außen und innen<br />
ihrer Existenz –die einer bemerkens -<br />
wert freien Frau. Doris Lessing starb am<br />
17. November in London.<br />
170<br />
GESTORBEN<br />
JOHN DOWNING<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3<br />
Hans-Jürgen Heise, 83. „Seit dem Verlust<br />
des Transzendenzbegriffs befindet sich die<br />
Menschheit im freien Fall. Zwar ist der<br />
Sturz noch nicht beendet, doch gleichen<br />
wir den Insassen eines<br />
abstürzenden Flugzeugs,<br />
die sich an ihre<br />
Sitze klammern – an<br />
die Haltegriffe der<br />
technischen Zivilisa -<br />
tion“, so pessimistisch<br />
beurteilte der zu den<br />
bedeutendsten Lyrikern<br />
Deutschlands gehörende<br />
Heise am<br />
Ende seines Lebens<br />
das Weltgeschehen. In Pommern geboren,<br />
zog er mit seiner Familie nach Berlin und<br />
versuchte sich im Journalismus. 1961 debütierte<br />
er mit dem die Grenzen des<br />
Wachstums voraussehenden Gedichtband<br />
„Vorboten einer neuen Steppe“. Sein Werk<br />
umfasst neben Essays und Reisebüchern<br />
rund 30 Gedichtsammlungen. Hans-Jürgen<br />
Heise starb am 13. November in Kiel.<br />
UWE PAESLER<br />
Artur Braun, 88. Die Radio-Plattenspieler-<br />
Kombination „Phonosuper SK 4“, die wegen<br />
der Abdeckhaube aus Plexiglas auch<br />
Schneewittchensarg genannt wurde, war<br />
eines der ersten Produkte einer Design-<br />
Ära, die unter der Mitwirkung des jungen<br />
Ingenieurs Mitte der Fünfziger entstand.<br />
Braun, der zusammen mit seinem Bruder<br />
das Elektrokleingeräte-Unternehmen übernommen<br />
hatte, gab der Marke ein neues<br />
Gesicht. Er setzte auf geometrisch proportionierte<br />
Formen und machte mit seinem<br />
Team die Linie zum Kultobjekt. Das Unternehmen<br />
wurde 1967 an Gillette verkauft.<br />
Artur Braun starb am 3. November.<br />
Frederick Sanger, 95. „Ich war nur ein<br />
Bursche, der in seinem Labor herumwurstelte“,<br />
sagte er 2007 über seine Arbeit.<br />
Das war British Understatement<br />
vom Feinsten. Denn der Biochemiker aus<br />
Cambridge las in Molekülen wie andere<br />
in Abenteuerromanen. In den fünfziger<br />
Jahren enthüllte er die Struktur des Insulins,<br />
dessen Mangel typisch für die Zuckerkrankheit<br />
ist. In den Siebzigern entwickelte<br />
Sanger ein Verfahren, mit dem<br />
sich die Reihenfolge der DNA-Bausteine<br />
bestimmen lässt. Die Methode wurde<br />
später für die Entschlüsselung des menschlichen<br />
Genoms eingesetzt.<br />
Sanger legte<br />
Grundlagen für das<br />
machtvolle Instrumen -<br />
ta rium der Gentechnik.<br />
Er erhielt zwei<br />
Nobelpreise, eine seltene<br />
Ehrung. Fre -<br />
derick Sanger starb<br />
am 19. November in<br />
Cambridge.<br />
DAVID LEVENSON / GETTY IMAGES
Personalien<br />
Schuld und Bühne<br />
Seit März sitzt er in Untersuchungshaft,<br />
kurz davor trat er noch im Bolschoi-<br />
Theater auf. Bald soll Pawel Dmitri -<br />
tschenko, 29, russischer Tänzer, wieder<br />
vor Gericht aussagen. Er wird beschuldigt,<br />
die Säureattacke auf den Bolschoi-<br />
Ballettchef Sergej Filin geplant und<br />
initiiert zu haben. Aus seiner Abneigung<br />
gegen Filin macht er keinen Hehl: Er<br />
hält ihn für sexuell und<br />
finanziell bestechlich,<br />
bestreitet aber, mit der<br />
Attacke etwas zu tun zu<br />
haben. Eine „moralische<br />
Mitschuld“ an dem<br />
Attentat hat Dmitri -<br />
tschenko allerdings eingeräumt.<br />
Jetzt berich tet<br />
der „Observer“ von<br />
Briefen, die Dmitri -<br />
tschenko an einen<br />
Freund geschickt habe.<br />
Einige Zeilen seien von<br />
der Zensur geschwärzt<br />
worden, berichtet die<br />
britische Zeitung. Aber<br />
es sei nachzulesen, dass<br />
Dmitritschenko misshandelt<br />
wurde: „Drei Polizisten schlugen<br />
mich, auf die Nieren, die Leber,<br />
den Kopf.“ Die Polizei streitet jedes<br />
Fehlverhalten ab. Weiter schreibe Dmitritschenko,<br />
einer der Beamten habe im<br />
Verhör gesagt: „Wir müssen dich irgendwie<br />
verurteilen. Sonst werden alle ihre<br />
Posten verlieren, weil wir dich ein halbes<br />
Jahr im Gefängnis behalten haben.“<br />
Dem einstigen Ballettstar drohen bis zu<br />
zwölf Jahre Haft.<br />
POCHUYEV MIKHAIL / ITAR-TASS / CORBIS<br />
Imeldas Kronleuchter<br />
Aus Rücksicht auf ihren Gesundheitszustand<br />
wurde der alten Dame bisher<br />
verschwiegen, welche Auswirkungen<br />
die Naturkatastrophe auf eines ihrer<br />
Lieblingsprojekte hat. Imelda Marcos,<br />
84, Diktatoren-Witwe, wird seit Anfang<br />
November wegen Erschöpfung<br />
und Diabetes in einem Krankenhaus<br />
auf den Philippinen behandelt. Das<br />
von ihr eingerichtete Museum Santo<br />
Nino Shrine in der Stadt Tacloban ist<br />
vom Taifun „Haiyan“ beschädigt worden.<br />
Das Gebäude mit 21 Räumen<br />
beherbergt Geschenke und Andenken<br />
aus aller Welt, die sich in den zwei<br />
Jahrzehnten Herrschaft ihres Mannes<br />
angesammelt hatten. Um die Exponate –<br />
Ming-Vasen, ein Messingbett aus<br />
Großbritannien, einen Kronleuchter<br />
aus Tschechien – hat sich bisher noch<br />
niemand gekümmert, die Philippiner<br />
haben dieser Tage andere Sorgen.<br />
Küchenphilosoph<br />
GNO / PICTURETANK / AGENTUR FOCUS<br />
Die Lieblingsspeise seines ehemaligen<br />
Vorgesetzten will er nicht verraten,<br />
das sei eine Frage der Diskretion, sagt<br />
Bernard Vaussion, 60. Er war 39 Jahre<br />
lang Koch im Elysée-Palast, seit kurzem<br />
ist er im Ruhestand. Präsident François<br />
Hollande würde ansonsten überall auf<br />
der Welt mit dem Gericht traktiert werden,<br />
fürchtet er. Trotz aller Loyalität:<br />
Hollandes Entscheidung, Trüffel, Hummer<br />
und Kaviar von der Palastspeisekarte<br />
zu nehmen, missbilligt Vaussion<br />
zutiefst. Das verrät er in einem Buch<br />
über seine Zeit im Einsatz für das leib -<br />
liche Wohl der Mächtigen dieser Welt.<br />
Der Verzicht, den der Sozialist Hollande<br />
aus Imagegründen verfügt habe, sei<br />
nicht nur in kulinarischer Hinsicht bedauerlich,<br />
findet der Ex-Chefkoch. Er<br />
hält die Maßnahme auch für unpatriotisch:<br />
„Das sind einheimische Produkte,<br />
wir müssen sie benutzen, wir müssen<br />
für sie werben.“ Ansonsten hat Vaussion<br />
nichts an Hollande auszusetzen, weil<br />
der „alles isst, und zwar gern und viel“.<br />
Im Gegensatz zum Vorgänger Nicolas<br />
Sarkozy, der Wein und Käse von der<br />
Tafel verbannte. „Das hat mich ganz<br />
krank gemacht“, sagt Vaussion.<br />
TED ALJIBE / AFP<br />
Prinzessin in der Kugel<br />
Alle Jahre wieder müssen Zeitungen<br />
und Zeitschriften zum Fest eine passende<br />
Aufmachung finden. Das Glamour-<br />
Magazin „Harper’s Bazaar“ wusste sich<br />
für den Titel der aktuellen Dezemberausgabe<br />
für Australien nicht anders zu<br />
helfen, als sich selbst zu zitieren. Nicole<br />
Kidman, 46, Schauspielerin, posiert wie<br />
172<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3<br />
das britische Supermodel Kate Moss,<br />
heute 39 Jahre alt, 1992 für das ame -<br />
rikanische Dezember-Heft: im Halbprofil,<br />
mit Hochsteckfrisur und in der<br />
Hand eine Schneekugel mit einer Miniaturfigur<br />
ihrer selbst. Die Kopie wird<br />
von der Fachpresse recht freundlich als<br />
Bestätigung der These gewertet,<br />
dass die neunziger Jahre modemäßig<br />
wieder en vogue seien.
Christian Weber, 67, Präsident der<br />
Bremischen Bürgerschaft, hat für das<br />
Parlamentsgebäude ein Rotwein-<br />
Verbot verhängt. Das traf als Erste die<br />
Grünen, die dort am vergangenen<br />
Freitag den 30. Geburtstag ihrer Fraktion<br />
feierten. SPD-Mann Weber<br />
wollte dem Koalitionspartner aber<br />
keinen versteckten Hinweis auf Unvereinbarkeit<br />
von Rot und Grün geben,<br />
sondern den empfindlichen hellen<br />
Teppichboden schützen, der gerade<br />
für 330000 Euro fast im gesamten Gebäude<br />
verlegt worden ist. Auch<br />
Fassbier ist nicht mehr erlaubt, und<br />
Kaffeetassen sollen nicht mehr ganz<br />
voll geschenkt werden. Im Plenarsaal<br />
selbst ist schon länger jeder Verzehr<br />
verboten, denn „das ist ein Raum, in<br />
dem man einen gewissen Stil bewahren<br />
soll“, so Webers Sprecher.<br />
John Cleese, 74, britischer Komiker,<br />
hat einen Vorschlag, wie die Deutschen<br />
beweisen könnten, dass sie doch<br />
Humor besitzen. Vergangene Woche<br />
gaben Cleese und die vier weiteren<br />
noch lebenden Mitglieder der Komikertruppe<br />
Monty Python bekannt, dass<br />
sie noch einmal gemeinsam auftreten<br />
werden, anschließend stellten sie sich<br />
online Fragen von Fans aus aller Welt.<br />
Einer wollte wissen, wie die Deutschen<br />
ihren Ruf in Sachen Humor verbessern<br />
könnten. Fußball-Fan Cleese: „Besorgt<br />
euch einen richtig schlechten Torhüter.“<br />
Jens Spahn, 33, CDU-Gesundheits -<br />
politiker, musste einen Shitstorm über<br />
sich ergehen lassen. „Mütter? Mir<br />
doch egal!“, hatte eine Hebammen-<br />
Aktivistin über dem Konterfei des<br />
CDU-Politikers getextet, das sie auf<br />
Facebook postete. Schon in den ersten<br />
zwei Stunden wurde das Foto 5000-mal<br />
geteilt. Hintergrund der Initiative: Im<br />
ersten Entwurf des Koalitions vertrags<br />
war keine Rede von den Geburts -<br />
helferinnen, die schon lange um eine<br />
finanzielle Besserstellung kämpfen.<br />
In der Arbeitsgruppe Gesundheit hatten<br />
Spahn und sein SPD-Kollege<br />
Karl Lauterbach die Hebammen-<br />
Honorare zwar kurz debattiert, konkrete<br />
Vorschläge aber nicht in ihr<br />
Papier aufgenommen – aus Platzgründen.<br />
Jede Arbeitsgruppe durfte maximal<br />
zwölf DIN-A4-Seiten abliefern.<br />
Kaum 24 Stunden nach Beginn des Internetprotests<br />
änderten die Gesund -<br />
heits politiker ihren Entwurf. Im Unterkapitel<br />
„Gesundheitsberufe“ heißt es<br />
nun, die Koalition wolle „die Situation<br />
… beobachten und für eine angemessene<br />
Vergütung sorgen“. Auf Facebook<br />
kommentierte Spahn: „Damit sich<br />
hier mal alle wieder beruhigen …“<br />
PENNIE SMITH / WARNER MUSIC<br />
Musik statt Messer<br />
Nach drei Jahren Pause vom Popgeschäft,<br />
zwei Geburten und einem Leben in<br />
Abgeschiedenheit veröffentlichte die<br />
britische Popsängerin Lily Allen, 28, vor<br />
einer Woche ihre Single „Hard Out<br />
There“. Sie wolle das Lied als feministischen<br />
Befreiungsschlag verstanden<br />
wissen, sagte sie dem „Guardian“. Eine<br />
Textzeile in dem Song lautet: „Ich<br />
muss nicht mit dem Hintern wackeln,<br />
ich habe Hirn.“ In dem dazugehörigen<br />
Videoclip inszeniert Allen sich unter<br />
anderem auf einem OP-Tisch beim Fettabsaugen,<br />
eine Situation, die sie beinahe<br />
selbst erlebt hätte: Vor einem<br />
Jahr, einige Monate nach der Geburt ihres<br />
ersten Kindes, wollte sie sich Schenkel<br />
und Hintern straffen lassen. Der<br />
Schönheitschirurg in London riet ihr zu<br />
einem Komplettprogramm mit Bauch,<br />
Hüften, Rücken und Knien. Vier Tage<br />
vor dem Operationstermin erfuhr<br />
Allen, dass sie wieder schwanger war,<br />
und sagte ab. Ihr satirisch gemeintes<br />
Musikvideo wurde binnen zwei Tagen<br />
über eine Million Mal im Internet geklickt<br />
– und provozierte viele kritische<br />
Kommentare: Das Werk sei sexistisch<br />
und rassistisch. Lily Allen tanzt darin<br />
mit dunkelhäutigen Bikinischönheiten.<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3 173
Hohlspiegel<br />
Aus den „Kieler Nachrichten“: „In der<br />
Wildnis und in der Arbeit mit den<br />
Hunden, die die Teilnehmer versorgen<br />
und trainieren, sollen die Unterrichts -<br />
inhalte in Theorie und Praxis umgesetzt<br />
werden.“<br />
Anzeige aus der „Mittelbadischen Presse“<br />
Aus dem „Mindener Tageblatt“: „Zu einem<br />
Haufen geschichtet finden Igel und<br />
Kleinstlebewesen ideale Verstecke zum<br />
Überwintern.“<br />
Aus der „Heilbronner Stimme“: „Beifall<br />
für ihren Kampf gegen sexuelle<br />
Minderheiten ist der grün-roten Koali -<br />
tion sicher.“<br />
Aus der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“:<br />
„Die ökologische Achillessehne<br />
der Plastiktüte ist ihre Langlebigkeit.“<br />
Aus dem „Wermelskirchener General-<br />
Anzei ger“: „Das soll sicherstellen, dass<br />
ein Zug bei seiner Durchfahrt noch einmal<br />
die Stromschiene vom Gerüst reißen<br />
kann – wie am 17. Oktober auf einer<br />
Länge von 260 Metern.“<br />
Aus den „Flensburger Nachrichten“<br />
Aus der „Taunus Zeitung“: „In Oberreifenberg<br />
bringen Wildschweine die Anwohner<br />
auf die Barrikaden und fordern<br />
eine Bejagung.“<br />
Aus dem „Tagesspiegel“: „Tatsächlich vermeiden<br />
viele Sprecher heute den Genitiv,<br />
indem sie ihn als Attribut nutzen: Den<br />
,Besuch vom Onkel‘ gibt es häufiger als<br />
den ,Besuch des Onkels‘.“<br />
Aus der „Frankfurter Rundschau“: Viele<br />
von ihnen mussten Zeltstädte auf der<br />
Insel Bohol verlassen, in denen sie seit<br />
einem Erdbeben im Oktober mit mehr<br />
als 200 Todesopfern lebten.“<br />
174<br />
Rückspiegel<br />
Zitate<br />
Die „Washington Post“ zum <strong>SPIEGEL</strong>-<br />
Titel „Gespräche mit einem Phantom“<br />
über Cornelius Gurlitt und das Geheimnis<br />
seiner Bilder (Nr. 47/2013):<br />
Es war sein erstes ausführliches Interview,<br />
seit der Fall vor zwei Wochen bekanntgeworden<br />
war. Gurlitt sagte dem SPIE-<br />
GEL, dass jeder etwas brauche, was er<br />
liebe: „Mehr als meine Bilder habe ich<br />
nichts geliebt in meinem Leben.“ … Nach<br />
Angaben des <strong>SPIEGEL</strong> verbrachte eine<br />
Reporterin vergangene Woche mehrere<br />
Tage mit dem Kunstsammler und sprach<br />
mit ihm.<br />
Der „Tagesspiegel“ zum selben Thema:<br />
Cornelius Gurlitt. Ein zarter Greis, schütteres<br />
Haar, kindlicher Blick, staunend,<br />
verschreckt. So ist er jetzt im <strong>SPIEGEL</strong><br />
zu sehen. Die Reporterin Özlem Gezer<br />
hat ihn letzte Woche auf einer Dreitagereise<br />
zum Arzt begleitet, erstmals spricht<br />
das Phantom. Und erweist sich als ein<br />
Mann, der die Welt nicht versteht, weil<br />
er in seiner eigenen lebt, einer vergangenen,<br />
verblichenen Zeit. Ohne Rente,<br />
ohne Krankenversicherung, ohne Freunde,<br />
ohne Fernseher, ohne Internet.<br />
Der <strong>SPIEGEL</strong> berichtete …<br />
… in Nr. 46/2013 „Eine Niere fürs Über -<br />
leben“ über syrische Flüchtlinge, die im<br />
Libanon ihre Organe verkaufen.<br />
Der libanesische Justizminister Schakib<br />
Kartbawi hat den Generalstaatsanwalt<br />
jetzt damit beauftragt, den illegalen<br />
Organhandel zu untersuchen. Drei Ermittler<br />
einer eigens gebildeten Sonderkommission<br />
der Geheimpolizei befragten<br />
<strong>SPIEGEL</strong>-Korrespondentin Ulrike Putz<br />
vergangene Woche zu ihren Recherchen.<br />
Auch Sozialminister Waïl Abu Faur bat<br />
Putz zu einem Gespräch. „Wir respektieren,<br />
dass Sie uns Ihre Quellen nicht offen -<br />
legen können“, so der Minister, „Sie<br />
wissen ja selbst am besten, wie gefährlich<br />
die Organ-Mafia ist.“<br />
… in Nr. 47/2013 „Eingefrorene Rotoren“<br />
über eine Windkraftanlage in Italien, die<br />
von der HSH Nordbank finanziert wurde<br />
und der Mafia zur Geldwäsche dienen soll.<br />
Rund 200 Beamte des Bundeskriminalamts<br />
durchsuchten vergangenen Dienstag<br />
20 Wohnungen und Büros in Deutschland<br />
und Österreich, darunter die Räume der<br />
HSH Nordbank in Hamburg und Kiel.<br />
Die Staatsanwaltschaft Osnabrück verdächtigt<br />
drei deutsche Geschäftsleute der<br />
Geldwäsche und der Unterstützung einer<br />
kriminellen Organisation im Ausland.<br />
D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3