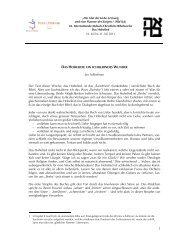1 P. Gregor Brazerol OSB In der Schatzkammer von ... - Haus Ohrbeck
1 P. Gregor Brazerol OSB In der Schatzkammer von ... - Haus Ohrbeck
1 P. Gregor Brazerol OSB In der Schatzkammer von ... - Haus Ohrbeck
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
chen fremden Völker. Gemeint ist nun <strong>der</strong> Tod als <strong>der</strong> Feind schlechthin, wie es z.B. auch Paulus<br />
in 1 Kor 15,24-26 sagt:<br />
„Danach kommt das Ende, wenn er [Christus] jede Macht, Gewalt und Kraft vernichtet hat<br />
und seine Herrschaft Gott, dem Vater, übergibt. Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle<br />
10 Feinde unter die Füße gelegt hat [Ps 110,1]. Der letzte Feind, <strong>der</strong> entmachtet wird, ist<br />
<strong>der</strong> Tod.“<br />
Die Auferstehung Jesu wird als Sieg über den Tod gedeutet (vgl. auch Hebr 1,3; 10,12f). Sie hat<br />
bei Paulus einen endzeitlichen Aspekt, denn <strong>der</strong> lebendige Gott nimmt in ihr bereits seinen Herrschaftsantritt<br />
„am Ende“ vorweg. Man beachte die Theozentrik des paulinischen Gedankengangs.<br />
Er findet seinen Höhepunkt in <strong>der</strong> Aussage 1 Kor 15,28:<br />
„Wenn ihm [Christus] dann alles unterworfen ist, wird auch er, <strong>der</strong> Sohn, sich dem<br />
unterwerfen, <strong>der</strong> ihm alles unterworfen hat, damit Gott herrscht über alles und in allem.“<br />
Damit wird deutlich, dass die christo-logische Deutung <strong>von</strong> Psalm 110 letztlich auf eine theologische<br />
Aussage zielt. Am Ende herrscht Gott „über alles und in allem.“<br />
Im Zusammenhang mit <strong>der</strong> Apostelgeschichte ist eine weitere Beobachtung bemerkenswert. Nach<br />
seiner langen Rede in Apg 7, die ein grosser heilsgeschichtlicher Rückblick ist, wi<strong>der</strong>fährt dem<br />
Diakon Stephanus eine Vision, in welcher er den Himmel offen sieht:<br />
„Er [Stephanus] aber, erfüllt vom Heiligen Geist, blickte zum Himmel empor, sah die Herrlichkeit<br />
Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen und rief: Ich sehe den Himmel offen<br />
und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen“ (Apg 7,55f).<br />
Stephanus sieht Jesus als eine himmlische Gestalt, die Eingang in den Bereich <strong>der</strong> göttlichen Herrlichkeit<br />
gefunden hat und auch an dieser Herrlichkeit Anteil besitzt. So wird verständlich, warum<br />
er bei <strong>der</strong> folgenden Steinigung sein Gebet – das wie<strong>der</strong>um ein Psalmwort ist – an Jesus richtet.<br />
Sterbend spielt er auf Ps 31,6 an: „Er aber betete und rief: Herr Jesus, nimm meinen Geist<br />
auf!“ (Apg 7, 59b). Hier ist eine bemerkenswerte Verschiebung in <strong>der</strong> <strong>In</strong>terpretation des Psalmverses<br />
geschehen. Dem Leser <strong>der</strong> Apostelgeschichte klingt Jesu Gebet am Kreuz in den Ohren, wie es<br />
das Lukasevangelium überliefert. 11 Jesus hat nach dieser Darstellung vor seinem Sterben den gleichen<br />
Psalmvers 31,6 gesprochen. Er bezog am Kreuz den „davidischen“ Text auf sich und richtete<br />
ihn an seinen Vater im Himmel („Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist“, Lk 23,46). Stephanus<br />
geht in <strong>der</strong> Anwendung des gleichen Psalmverses einen Schritt weiter und spricht das<br />
Psalmwort zum „Kyrios Jesus“. Nicht mehr Gott wird mit dem Psalmvers angesprochen, son<strong>der</strong>n<br />
Jesus, <strong>der</strong> sich zu dessen Rechten befindet. Hier wird zum ersten Mal fassbar, was für die weitere<br />
christliche Psalmeninterpretation grundlegend sein wird: Als „Kyrios“ o<strong>der</strong> „Dominus“ – hinter<br />
dem in den meisten Fällen im hebräischen Text das Tetragramm steht – kann nicht nur Gott, son<strong>der</strong>n<br />
auch Jesus Christus verstanden werden. Damit wird die Möglichkeit eröffnet, einen Psalm<br />
auch als Gebet an Jesus Christus zu richten.<br />
Das ist eine Sinn-Erweiterung o<strong>der</strong> Sinn-Verschiebung, wie sie für die christliche Psalminterpretation<br />
vor allem in <strong>der</strong> Väterzeit bis ins Mittelalter hinein typisch geworden ist. Ihren Anfang nahm<br />
diese Entwicklung in <strong>der</strong> <strong>In</strong>terpretation des hebräischen Textes in <strong>der</strong> Septuaginta, wo <strong>der</strong> Gottesname<br />
durch „Kyrios“ wie<strong>der</strong>gegeben wurde. Ein weiterer Schritt war das Bekenntnis, dass Jesus<br />
durch die Auferstehung und Erhöhung <strong>von</strong> Gott zum „Kyrios“ gemacht worden ist (vgl. Phil 2,11<br />
„Jesus Christus ist <strong>der</strong> Herr – zur Ehre Gottes, des Vaters“; vgl. auch oben Apg 2,36). Ich meine,<br />
10<br />
Die Einfügung <strong>von</strong> „alle“ geht vermutlich auf Ps 8,7 zurück; vgl. 1 Kor 15,27. <strong>In</strong> Ps 8 ist die Rede vom Menschen,<br />
<strong>der</strong> nur wenig geringer ist als Gott (elohim), und dem alles unter die Füsse gelegt ist.<br />
11<br />
Lukasevangelium und Apostelgeschichte bilden eine literarische Einheit und sind aufeinan<strong>der</strong> bezogen.<br />
5