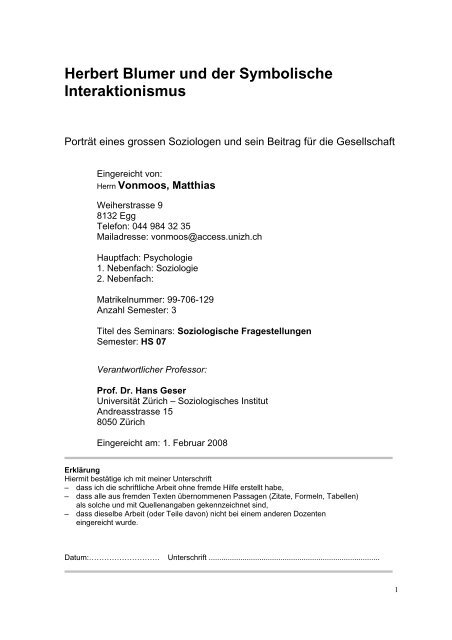Herbert Blumer und der Symbolische ... - Prof. Hans Geser
Herbert Blumer und der Symbolische ... - Prof. Hans Geser
Herbert Blumer und der Symbolische ... - Prof. Hans Geser
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Herbert</strong> <strong>Blumer</strong> <strong>und</strong> <strong>der</strong> <strong>Symbolische</strong><br />
Interaktionismus<br />
Porträt eines grossen Soziologen <strong>und</strong> sein Beitrag für die Gesellschaft<br />
Eingereicht von:<br />
Herrn Vonmoos, Matthias<br />
Weiherstrasse 9<br />
8132 Egg<br />
Telefon: 044 984 32 35<br />
Mailadresse: vonmoos@access.unizh.ch<br />
Hauptfach: Psychologie<br />
1. Nebenfach: Soziologie<br />
2. Nebenfach:<br />
Matrikelnummer: 99-706-129<br />
Anzahl Semester: 3<br />
Titel des Seminars: Soziologische Fragestellungen<br />
Semester: HS 07<br />
Verantwortlicher <strong>Prof</strong>essor:<br />
<strong>Prof</strong>. Dr. <strong>Hans</strong> <strong>Geser</strong><br />
Universität Zürich – Soziologisches Institut<br />
Andreasstrasse 15<br />
8050 Zürich<br />
Eingereicht am: 1. Februar 2008<br />
Erklärung<br />
Hiermit bestätige ich mit meiner Unterschrift<br />
– dass ich die schriftliche Arbeit ohne fremde Hilfe erstellt habe,<br />
– dass alle aus fremden Texten übernommenen Passagen (Zitate, Formeln, Tabellen)<br />
als solche <strong>und</strong> mit Quellenangaben gekennzeichnet sind,<br />
– dass dieselbe Arbeit (o<strong>der</strong> Teile davon) nicht bei einem an<strong>der</strong>en Dozenten<br />
eingereicht wurde.<br />
Datum:………………………. Unterschrift .................................................................................<br />
1
Inhaltsverzeichnis<br />
1. Einleitung <strong>und</strong> Zielsetzung................................................................................................. 3<br />
2. Biographie <strong>Herbert</strong> <strong>Blumer</strong>s .............................................................................................. 3<br />
3. Die Entstehungsgeschichte des <strong>Symbolische</strong>n Interaktionismus....................................... 4<br />
4. Der <strong>Symbolische</strong> Interaktionismus nach <strong>Herbert</strong> <strong>Blumer</strong>.................................................. 4<br />
4.1. Die drei Prämissen des <strong>Symbolische</strong>n Interaktionismus............................................ 5<br />
4.2. Die sechs Kernvorstellungen des <strong>Symbolische</strong>n Interaktionismus............................ 5<br />
a. Die Beschaffenheit <strong>der</strong> menschlichen Gesellschaft / des menschlichen Zusammenlebens... 6<br />
b. Die Beschaffenheit sozialer Interaktion................................................................................. 6<br />
c. Die Beschaffenheit von Objekten .......................................................................................... 6<br />
d. Der Mensch als handeln<strong>der</strong> Organismus ............................................................................... 6<br />
e. Die Beschaffenheit menschlichen Handelns.......................................................................... 6<br />
f. Die Verkettung von Handlungen ........................................................................................... 7<br />
4.3. Kritische Würdigung des <strong>Symbolische</strong>n Interaktionismus ........................................ 7<br />
5. Die Bedeutung des <strong>Symbolische</strong>n Interaktionismus: Schlussfolgerung ............................ 7<br />
Literaturverzeichnis.................................................................................................................... 8<br />
2
1. Einleitung <strong>und</strong> Zielsetzung<br />
Das vorliegende Forschungsprojekt ist eine Proseminararbeit im Rahmen des soziologischen<br />
Studiums an <strong>der</strong> Universität Zürich mit dem Titel: <strong>Herbert</strong> <strong>Blumer</strong> <strong>und</strong> <strong>der</strong> <strong>Symbolische</strong><br />
Interaktionismus. Porträt eines grossen Soziologen <strong>und</strong> sein Beitrag für die Gesellschaft.<br />
Etwas dezidierter ausgedrückt geht es in dieser Arbeit darum, den amerikanischen Soziologen<br />
<strong>Herbert</strong> <strong>Blumer</strong> sowie sein thematisches <strong>und</strong> philosophisches Vermächtnis, die soziologische<br />
Handlungstheorie des <strong>Symbolische</strong>n Interaktionismus, zu analysieren. Das Augenmerk richtet<br />
sich dabei insbeson<strong>der</strong>e auf Herkunft, Beschreibung <strong>und</strong> Wirkung dieses<br />
handlungstheoretischen Ansatzes 1 .<br />
In einem ersten Teil soll die Biographie <strong>Herbert</strong> <strong>Blumer</strong>s kurz dargestellt werden. Danach<br />
geht es darum, den geschichtlichen Kontext beziehungsweise die Entstehungsgeschichte des<br />
<strong>Symbolische</strong>n Interaktionismus kurz aufzuarbeiten 2 . Dies insbeson<strong>der</strong>e im Hinblick auf die<br />
unerlässliche Verknüpfung <strong>der</strong> Arbeiten <strong>Blumer</strong>s mit den Gedanken George <strong>Herbert</strong> Meads.<br />
Dem folgt eine Beschreibung des <strong>Blumer</strong>schen Ansatzes, eine kurze Verortung dessen sowie<br />
ein paar Worte zu seinem Beitrag für die Gesellschaft.<br />
2. Biographie <strong>Herbert</strong> <strong>Blumer</strong>s<br />
<strong>Herbert</strong> <strong>Blumer</strong> kam am 7. März 1900 in St. Louis zur Welt. Von 1918 bis 1922 besuchte er<br />
die Universität of Missouri, wo er nach seinem Abschluss drei Jahre im Lehrbereich tätig war.<br />
1925 dislozierte <strong>Blumer</strong> nach Chicago, um bei den dortigen Chicago Cardinals als<br />
professioneller Football-Spieler anzuheuern. Parallel dazu promovierte er an die University of<br />
Chicago in Soziologie zum Thema „Method in Social Psychology“. In dieser Zeit machte er<br />
unter an<strong>der</strong>em die Bekanntschaft des Philosophen <strong>und</strong> Psychologen George <strong>Herbert</strong> Mead,<br />
<strong>der</strong> <strong>Blumer</strong> zuerst als Schüler <strong>und</strong> danach als Kollegen nachhaltig för<strong>der</strong>te. Nach seiner<br />
Promotion 1928 trat <strong>Blumer</strong> bei Mead in Chicago eine Lehrtätigkeit als Soziologe an. Als<br />
dieser krank wurde, übernahm er dessen Vorlesung <strong>und</strong> führte sein Werk weiter. Abgesehen<br />
vom Militärdienst während des Zweiten Weltkrieges <strong>und</strong> Kurzaufenthalten an den<br />
Universitäten Michigan (1936) <strong>und</strong> Hawaii (1939, 1950-51) blieb <strong>Blumer</strong> 27 Jahre lang in<br />
Chicago, wo er nach <strong>und</strong> nach Karriere machte <strong>und</strong> schliesslich zwischen 1947 <strong>und</strong> 1952 als<br />
<strong>Prof</strong>essor amtete. 1952 wurde er <strong>Prof</strong>essor <strong>und</strong> Vorsitzen<strong>der</strong> <strong>der</strong> neu gegründeten<br />
Soziologischen Fakultät an <strong>der</strong> University of California in Berkeley. Aus dieser Funktion<br />
heraus agierte er später auch als Präsident <strong>der</strong> American Sociological Association, die ihn<br />
ihrerseits 1983 mit dem Award for Distinguished Scholarship ehrte. <strong>Herbert</strong> <strong>Blumer</strong> starb am<br />
13. April 1987 3 .<br />
1 Um die Theorie des symbolischen Interaktionismus zu skizzieren, orientiere ich mich in dieser Arbeit an<br />
<strong>Herbert</strong> <strong>Blumer</strong>s (1969) Artikel „Der methodologische Standort des <strong>Symbolische</strong>n Interaktionismus“, <strong>der</strong> zu<br />
einer Art Gründungsdokument dieser Theorie geworden ist (Abels, 2007: 44).<br />
2 Diese Arbeit fokussiert auf dem <strong>Symbolische</strong>n Interaktionismus als soziologische Theorie. Die ebenfalls von<br />
<strong>Herbert</strong> <strong>Blumer</strong> beschriebene Methodengr<strong>und</strong>lage wird in diesem Zusammenhang absichtlich nicht<br />
berücksichtigt.<br />
3 Trotz <strong>Blumer</strong>s Bekanntheit sind seine Biographien selten beziehungsweise meist sehr kurz gehalten. Eine<br />
ausführliche <strong>und</strong> übersichtliche Darstellung seines Lebenslaufes - aus <strong>der</strong> auch die obigen Angaben stammen -<br />
findet sich in Lyman & Vidich, 2000.<br />
3
3. Die Entstehungsgeschichte des <strong>Symbolische</strong>n Interaktionismus<br />
Soll dem <strong>Symbolische</strong>n Interaktionismus eine theoretische Basis gegeben werden, so lässt<br />
sich seine Entstehungsgeschichte in einem grossen <strong>und</strong> breiten Masse auffächern. Da dies in<br />
dieser Arbeit nicht möglich ist, beschränkt sich die Analyse auf die mehr o<strong>der</strong> weniger<br />
unmittelbare theoretische Herkunft. In diesem Sinne kann <strong>der</strong> <strong>Symbolische</strong> Interaktionismus<br />
als eine Art direkter Nachfolger des Pragmatismus aufgefasst werden. Diese<br />
sozialphilosophische Lehre erkannte „das Wesen des Menschen in seinem Handeln“ (Abels,<br />
2001: 158). Dieser Gr<strong>und</strong>gedanke ist die Basis <strong>der</strong> handlungtheoretischen Ansätze, die in <strong>der</strong><br />
Soziologie eine sehr bedeutende Stellung einnehmen 4 . Auch George <strong>Herbert</strong> Mead verfolgte<br />
diese Idee, indem er in seinen Arbeiten von den anthropologisch bedingten unterschiedlichen<br />
Kommunikationsarten bei Mensch <strong>und</strong> Tier ausging 5 . Während Tiere untereinan<strong>der</strong> mit <strong>und</strong><br />
schlichten Reiz-Reaktions-Schemata interagieren, gehen Menschen davon aus, dass<br />
sprachliche Äusserungen eine gemeinsame Bedeutung, einen geteilten Sinngehalt, innehaben<br />
(Zimmermann, 2006: 52). Gemäss Mead ist Kommunikation <strong>der</strong> entscheidende Faktor bei <strong>der</strong><br />
Entwicklung des Menschen hin zum sozialen Wesen, weil die menschliche Interaktion über<br />
„signifikante Symbole“ stattfindet, die Allgemeinbegriffe darstellen <strong>und</strong> somit in allen<br />
Individuen das Gleiche auslösen (Abels, 2001: 160). Das Wissen um diese geteilten<br />
Strukturen basiert darauf, dass Menschen sich in verschiedene soziale Rollen einfühlen<br />
können (Abels, 2001: 161). Soziales Handeln nach Mead besteht somit im Wesentlichen in<br />
<strong>der</strong> Übernahme von sozialen Rollen durch den Handelnden (Miebach, 2006: 25). Im Zuge<br />
dessen muss das Individuum diese Rollenmuster seines Handelns konkretisieren <strong>und</strong> sich<br />
dabei auch selbst einbringen. So ist das denkende Individuum mit <strong>der</strong> Gesellschaft<br />
prozessbedingt verwoben. Durch diese Überlegungen hat sich Mead zu einer Art Galionsfigur<br />
<strong>der</strong> interaktionistischen Schule gemacht (Miebach, 2006: 25). Dennoch sind Meads<br />
diesbezügliche Gedanken insgesamt eher unsystematisch geblieben. Nach seinem<br />
erkrankungsbedingten Ausstieg <strong>und</strong> dem kurz darauf folgenden Tod (1931) übernahm <strong>Herbert</strong><br />
<strong>Blumer</strong> (wie in Kapitel 2 erwähnt) dessen Ansatz <strong>und</strong> transformierte respektive erweiterte die<br />
Mead’schen Gedanken in das Modell des <strong>Symbolische</strong>n Interaktionismus 6 .<br />
4. Der <strong>Symbolische</strong> Interaktionismus nach <strong>Herbert</strong> <strong>Blumer</strong><br />
Basierend auf diesen Überlegungen geht <strong>Blumer</strong> <strong>der</strong> schon von Mead gestellten Fragestellung<br />
nach, wie es den Menschen gelinge, ihre Handlungen einan<strong>der</strong> anzupassen. Ausgehend von<br />
den Erklärungen Meads, wonach Individuen den Sinn ihres Handelns über gemeinsame<br />
signifikante Symbole <strong>und</strong> Rollenübernahmen erschliessen (Abels, 2001: 166), fügt <strong>Blumer</strong><br />
hinzu, dass das menschliche Zusammenleben ein sich laufend wandeln<strong>der</strong> Prozess sei „in dem<br />
Objekte geschaffen, bestätigt, umgeformt <strong>und</strong> verworfen werden. Das Leben <strong>und</strong> das Handeln<br />
von Menschen wandeln sich notwendigerweise in Übereinstimmung mit den Wandlungen, die<br />
in ihrer Objektwelt vor sich gehen“ (<strong>Blumer</strong>, 1969: 91). Dieser nur selten bewusste Prozess<br />
führt allmählich zu einer gemeinsam akzeptierten Definition einer Situation, die ihrerseits<br />
wie<strong>der</strong>um Handlungsbedingungen strukturiert (Abels, 2001: 166). Damit rückt <strong>Blumer</strong> zwei<br />
4 Handlungstheorie meint die soziologischen Theorien, „die sinnhaftes Handeln von Individuen <strong>und</strong> Gruppen in<br />
sozialen Interaktionen erklären“ (Miebach, 2006: 15). Neben den in dieser Arbeit erwähnten George <strong>Herbert</strong><br />
Mead <strong>und</strong> <strong>Herbert</strong> <strong>Blumer</strong> gehören unter an<strong>der</strong>em auch Alfred Schütz, Erving Goffmann, Harold Garfinkel o<strong>der</strong><br />
Talcott Parsons zu Autoren, die diesen Gr<strong>und</strong>gedanken weiterverfolgten.<br />
5 Mead entwickelte diese Gedanken im Rahmen einer anthropologischen Theorie <strong>der</strong> Kommunikation, die über<br />
Zeichen, Gesten <strong>und</strong> Symbole abläuft (Abels, 2001: 158).<br />
6 Erst 1937, sechs Jahre nach dem Tod Meads, erwähnte <strong>Blumer</strong> den Begriff „<strong>Symbolische</strong>r Interaktionismus“<br />
das erste Mal in seinem Artikel „Social Psychology“ (<strong>Blumer</strong>, 1937: 153).<br />
4
Elemente in den Vor<strong>der</strong>gr<strong>und</strong> seines Modells: die Interpretation des Handelnden <strong>und</strong> die<br />
Situation (Weiss, 1993: 76). <strong>Blumer</strong> baut damit auf das Thomas-Theorem auf 7 , das besagt,<br />
dass Personen nicht danach handeln, wie eine Situation objektiv ist, son<strong>der</strong>n vielmehr danach,<br />
wie sie vom Handelnden gedeutet wird. Objektivität entspricht demnach sinngemäss <strong>der</strong><br />
Annahme „it´s all in your mind“ (Weiss, 1993: 76, Feldmann, 2005: 305). Das Individuum<br />
lebt also in einer sich laufend wandelnden Welt, die höchst subjektiv wahrgenommen wird<br />
<strong>und</strong> überhaupt nur durch wechselseitige Kommunikation mit an<strong>der</strong>en Menschen erfahren<br />
beziehungsweise begründet werden kann. Diesen Mechanismus postuliert <strong>Blumer</strong> in den „drei<br />
einfachen Prämissen“ (<strong>Blumer</strong>, 1969: 81) des <strong>Symbolische</strong>n Interaktionismus.<br />
4.1. Die drei Prämissen des <strong>Symbolische</strong>n Interaktionismus<br />
Erste Prämisse: Menschen handeln gegenüber Dingen auf <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>lage <strong>der</strong> Bedeutungen,<br />
die diese Dinge für sie besitzen.<br />
Im <strong>Symbolische</strong>n Interaktionismus erhalten die Bedeutungen, die Dinge für den Menschen<br />
haben, einen eigenständigen Selbstwert. „Dinge“ meint alles vom Menschen Wahrnehmbare<br />
(physische Objekte, Institutionen, Ideale etc.). Alle diese Dinge haben also keine Bedeutung<br />
an sich, son<strong>der</strong>n sie erlangen diese erst, indem die Menschen ihnen einen eigentlichen Sinn<br />
geben <strong>und</strong> sich entsprechend verhalten (Abels, 2001: 167).<br />
Zweite Prämisse: Die Bedeutung <strong>der</strong> Dinge entsteht durch soziale Interaktion.<br />
Die Bedeutung eines Dinges wird im <strong>Symbolische</strong>n Interaktionismus nicht einfach als<br />
gegeben betrachtet, son<strong>der</strong>n sie ergibt sich aus dem Interaktionprozess zwischen<br />
verschiedenen Personen. Bedeutungen sind daher „soziale Produkte“, die erst im ständigen<br />
Wechsel zwischen Situationsdefinition <strong>und</strong> Handeln geschaffen werden (<strong>Blumer</strong>, 1969: 81).<br />
Dritte Prämisse: Die Bedeutungen werden durch einen interpretativen Prozess, den die<br />
Person in ihrer Auseinan<strong>der</strong>setzung mit den ihr begegnenden Dingen benutzt, gehandhabt<br />
o<strong>der</strong> abgerän<strong>der</strong>t.<br />
Dieser Interpretationsprozess erfolgt in zwei Schritten: Zuerst zeigt sich <strong>der</strong> Handlende selbst<br />
die Gegenstände an, auf die er sein Handeln ausrichtet. Weiter ordnet <strong>und</strong> strukturiert er diese<br />
Dinge, indem er ihnen eine Bedeutung verleiht. <strong>Blumer</strong> (1969: 84) spricht von einem<br />
„formenden Prozess“, in dem <strong>der</strong> Handelnde mit sich selbst interagiere. Der Gebrauch von<br />
Bedeutungen ist somit weit mehr als nur die Anwendung eines Etiketts. Vielmehr ist die<br />
„innere Kommunikation jedes Beteiligten die Reaktion auf die innere Beteiligung jedes<br />
an<strong>der</strong>en Beteiligten“ (Abels, 2007: 47). Das Ergebnis ist eine gemeinsame symbolische<br />
Definition <strong>der</strong> Situation.<br />
4.2. Die sechs Kernvorstellungen des <strong>Symbolische</strong>n Interaktionismus<br />
Da <strong>der</strong> <strong>Symbolische</strong> Interaktionismus auf diesen drei Gr<strong>und</strong>sätzen beruht, ist er<br />
notwendigerweise gezwungen, ein analytisches Schema <strong>der</strong> menschlichen Gesellschaft <strong>und</strong><br />
des menschlichen Verhaltens zu entwickeln, das für ihn charakteristisch ist (<strong>Blumer</strong>, 1969:<br />
85). <strong>Blumer</strong> benutzte dazu sechs Kernvorstellungen:<br />
7 William Isaac Thomas begründete 1928 das Thomas-Phänomen, das besagt „if men define situations as real,<br />
they are real in their consequences“ (Esser, 2001: 63).<br />
5
a. Die Beschaffenheit <strong>der</strong> menschlichen Gesellschaft / des menschlichen Zusammenlebens<br />
Menschliche Gruppen bestehen aus handelnden Personen, wobei sie – wenn man es ganz<br />
genau nimmt - eigentlich nur aus Handlungen bestehen (<strong>Blumer</strong>, 1969: 85). Denn sowohl<br />
Gruppen als auch Gesellschaften existieren aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> reziproken Abstimmung <strong>der</strong><br />
Aktivitäten ihrer Mitglie<strong>der</strong> <strong>und</strong> müssen in Handlungskategorien erfasst werden. Ein<br />
Gr<strong>und</strong>prinzip des <strong>Symbolische</strong>n Interaktionismus lautet deshalb, jeglicher empirisch<br />
orientierte Entwurf einer menschlichen Gesellschaft habe vollumfänglich zu berücksichtigen,<br />
dass menschliche Gesellschaft aus Personen bestehe, die sich an Handlungen beteiligen<br />
(<strong>Blumer</strong>, 1969: 85f).<br />
b. Die Beschaffenheit sozialer Interaktion<br />
Eine Gesellschaft besteht aus Individuen, die miteinan<strong>der</strong> interagieren. Menschliches<br />
Verhalten wird im Rahmen dieses Interaktionsprozesses wechselseitigen Verhaltens zwischen<br />
Handelnden geformt. Gemäss Mead erfolgt dies durch wechselseitige Rollenübernahme.<br />
„Einfach ausgedrückt, müssen Menschen, die miteinan<strong>der</strong> interagieren, darauf achtgeben, was<br />
<strong>der</strong> jeweils an<strong>der</strong>e tut o<strong>der</strong> tun will“ (<strong>Blumer</strong>, 1969: 87).<br />
Zu unterscheiden ist dabei zwischen nicht-symbolischer Interaktion, bei <strong>der</strong> eine Handlung<br />
unreflektiert durch Gegenhandlung beantwortet wird (beispielsweise ein Boxer <strong>der</strong> reflexartig<br />
zurückschlägt) <strong>und</strong> symbolischer Interaktion, die eine Interpretation von etwas beinhaltet<br />
(nach Mead ist symbolische Interaktion eine Präsentation von Gesten <strong>und</strong> eine Reaktion auf<br />
die Bedeutung <strong>der</strong>selben).<br />
c. Die Beschaffenheit von Objekten<br />
„Zu den Objekten ist alles zählen, was angezeigt werden kann, alles, auf das man hinweisen<br />
o<strong>der</strong> auf das man sich beziehen kann“ (<strong>Blumer</strong>, 1969: 90). In diesem Zusammenhang können<br />
drei Kategorien unterschieden werden: physikalische Objekte (Stift, Baum), soziale Objekte<br />
(Präsident, Mutter) <strong>und</strong> abstrakte Objekte (Moralische Prinzipien, Ehrgefühl).<br />
Selbstverständlich ist die Bedeutung <strong>der</strong> Objekte für verschiedene Personen höchst<br />
unterschiedlich, sind sie doch jeweils ihrerseits die Produkte menschlichen Handelns (Abels,<br />
2001: 169). <strong>Blumer</strong> (1969: 91) schreibt, dass wenn man das Handeln von Menschen verstehen<br />
wolle, man notwendigerweise ihre Welt von Objekten bestimmen müsse (Welches Auto fährt<br />
jemand? Kleidet sich eine Person gut?). Die Beschaffenheit eines Objektes selbst ergibt sich<br />
aus dem Interaktionsprozess <strong>und</strong> besteht aus <strong>der</strong> Bedeutung, die ein Objekt für eine Person<br />
hat.<br />
d. Der Mensch als handeln<strong>der</strong> Organismus<br />
Hierbei geht es um den Begriff des „Selbst“. Damit wir auf (nicht-)symbolischer Ebene<br />
agieren können, brauchen wir ein Selbst, das heisst, wir müssen uns selbst zum Gegenstand<br />
unserer eigenen Handlungen machen können. Wir setzen uns mit allem auseinan<strong>der</strong> <strong>und</strong> sind<br />
entsprechend handelnde, agierende Organismen.<br />
e. Die Beschaffenheit menschlichen Handelns<br />
Das Handeln bekommt aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> oben genannten Fähigkeiten des Menschen sich selbst<br />
etwas anzuzeigen einen ganz spezifischen Charakter. Will <strong>der</strong> Mensch handeln, so muss er<br />
zuerst die Welt interpretieren, also sozusagen mit den Situationen fertig werden. Auf mehrere<br />
Personen bezogen bedeutet dies, dass kollektives Handeln immer das Ergebnis eines<br />
interpretativen Interaktionsprozesses darstellt.<br />
6
f. Die Verkettung von Handlungen<br />
Aus den bisherigen Kernannahmen ergibt sich, dass eine Interaktion mehr ist als bloss die<br />
Summe <strong>der</strong> einzelnen Handlungen. Erst durch die permanente Wechselwirkung ergibt sich<br />
<strong>der</strong> ganz „spezifisch eigenständige Charakter“ einer gemeinsamen Handlung (<strong>Blumer</strong>, 1969:<br />
97). Die Verkettung wird insofern verkompliziert, als Handeln sich teilweise in komplexen<br />
Netzwerken vollzieht <strong>und</strong> zudem, wann immer gemeinsame Handlungen entstehen, diese<br />
nicht zuletzt auch aus dem Hintergr<strong>und</strong> früherer Handlungen <strong>der</strong> Teilnehmer hervorgehen.<br />
Entsprechend den bisherigen Erläuterungen ist es auch <strong>der</strong> soziale Prozess, <strong>der</strong> Regelungen<br />
schafft <strong>und</strong> aufrechterhält, <strong>und</strong> nicht umgekehrt die Regeln, die das Zusammenleben<br />
ermöglichen (<strong>Blumer</strong>, 1969: 97).<br />
4.3. Kritische Würdigung des <strong>Symbolische</strong>n Interaktionismus<br />
Das eine Theorie wie <strong>der</strong> <strong>Symbolische</strong> Interaktionismus nicht frei von Kritik sein kann, ist<br />
selbstverständlich. Wie aus <strong>der</strong> Beschreibung hervorgeht, ist <strong>der</strong> Ansatz sehr auf das<br />
Individuum beschränkt, weshalb man auch von einem mikrosoziologischen Ansatz spricht,<br />
<strong>der</strong> schon sehr nahe bei <strong>der</strong> Psychologie liege. Wo genau <strong>der</strong> Ansatz nun zu verorten sei, ist<br />
ein eher untergeordnetes Problem. Wesentlich schwerer wiegt da <strong>der</strong> Vorwurf, wonach<br />
<strong>Blumer</strong> in seiner Theorie etwas sehr Elementares unbeantwortet lasse, nämlich die Frage,<br />
wann Handlungen auftreten würden. Was sie sind <strong>und</strong> in welcher Form sie auftreten, das ist<br />
klar. Offen bleibt aber, weshalb Handlungen überhaupt auftreten, das heisst aus welchen<br />
Beweggründen etwas überhaupt symbolisch wird.<br />
Zudem stellt sich die Frage, wie in einem komplexen Netzwerk die stete Interaktion<br />
respektive Bedeutungsfindung genau vor sich gehen soll. Eine Simplifizierung, die aber fast<br />
allen sozialwissenschaftlichen Theorien inhärent ist <strong>und</strong> dadurch aber das Reflektieren<br />
darüber überhaupt erst möglich macht.<br />
5. Die Bedeutung des <strong>Symbolische</strong>n Interaktionismus: Schlussfolgerung<br />
Trotz den erwähnten Kritikpunkten, <strong>der</strong>en Liste je nach theoretischem Ansatz sicher noch<br />
weiter verlängert werden könnte, ist doch festzuhalten, dass <strong>Herbert</strong> <strong>Blumer</strong> mit dem<br />
<strong>Symbolische</strong>n Interaktionismus die Formulierung eines Ansatzes gelungen ist, <strong>der</strong> weit über<br />
die soziologischen Grenzen hinaus wirkt. Das Faktum, dass Mead Psychologe war <strong>und</strong> auch<br />
die erste Erwähnung des <strong>Symbolische</strong>n Interaktionismus unter dem Titel „Social Psychology“<br />
publiziert wurde, deutet bereits an, dass <strong>der</strong> Ansatz insbeson<strong>der</strong>e in <strong>der</strong> Psychologie fest<br />
verankert ist. Speziell in <strong>der</strong> Sozialpsychologie, in <strong>der</strong> es um Prozesse innerhalb <strong>und</strong> zwischen<br />
Gruppen geht sowie <strong>der</strong> Entwicklungspsychologie mit den Aspekten <strong>und</strong> Dimensionen des<br />
Selbst (Von Mathe, 2005: 44, Lorenz, 2007) o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Wahrnehmungspsychologie (Marx,<br />
2006) spielt <strong>der</strong> symbolische Interaktionismus eine grosse Rolle (Helle, 2001). Auch aus <strong>der</strong><br />
praktischen Kommunikationswelt wie beispielsweise den Werbestrategien (Kolbe, 2002) o<strong>der</strong><br />
<strong>der</strong> theoretischen Kommunikationswissenschaft <strong>und</strong> selbstredend <strong>der</strong> Soziologie ist <strong>der</strong><br />
symbolische Interaktionismus kaum wegzudenken - zu gross ist das Erklärungspotential. Die<br />
Idee, <strong>der</strong> Interaktion einen <strong>der</strong>art bedeutsamen Stellenwert zuzugestehen, ist nicht zuletzt auch<br />
im Hinblick auf die stetig zunehmende Vernetzung <strong>und</strong> die damit einhergehende Wichtigkeit<br />
<strong>der</strong> praktischen Kommunikation zu schätzen.<br />
7
Literaturverzeichnis<br />
Abels, Heinz (2001). Einführung in die Soziologie. Die Individuen in ihrer Gesellschaft. Band 2.<br />
Wiesbaden: Westdeutscher Verlag GmbH.<br />
Abels, Heinz (2007). Interaktion, Identität, Präsentation. Kleine Einführung in interpretative Theorien<br />
<strong>der</strong> Soziologie. 4. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.<br />
<strong>Blumer</strong> <strong>Herbert</strong> (1937). Social Psychology. In: Schmidt, Emerson Peter (Hrsg.) (1937). Man and<br />
Society. A Substantive Introduction to the Social Science. New York: Prentice-Hall, Inc., 144-<br />
198. Online im Internet: http://www.brocku.ca/MeadProject/<strong>Blumer</strong>/<strong>Blumer</strong>_1937.html [Stand:<br />
24.01.2008].<br />
<strong>Blumer</strong>, <strong>Herbert</strong> (1969). Der methodologische Standort des <strong>Symbolische</strong>n Interaktionismus. In:<br />
Arbeitsgruppe Bielefel<strong>der</strong> Soziologen (Hrsg.) (1973). Alltagswissen, Interaktion <strong>und</strong><br />
gesellschaftliche Wirklichkeit. Band I. Opladen: Westdeutscher Verlag, 80-148 [80-101].<br />
Esser, Hermut (2001). Soziologie. Spezielle Gr<strong>und</strong>lagen. Band 1: Situationslogik <strong>und</strong> Handeln.<br />
Frankfurt am Main: Campus Verlag.<br />
Feldmann, Klaus (2005). Soziologie kompakt. Eine Einführung. 3. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für<br />
Sozialwissenschaften.<br />
Helle, Horst Jürgen (2001). Theorie <strong>der</strong> symbolischen Interaktion. Ein Beitrag zum verstehenden<br />
Ansatz in Soziologie <strong>und</strong> Sozialpsychologie. 3. Auflage. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.<br />
Kolbe, Andreas (2002). Werbestrategien <strong>und</strong> <strong>Symbolische</strong>r Interaktionismus. München: GRIN Verlag.<br />
Lorenz, Stefan (2007). <strong>Symbolische</strong>r Interaktionismus- eine Sozialisationstheorie. München: GRIN<br />
Verlag.<br />
Lyman, Stanford M. <strong>und</strong> Arthur J. Vidich (2000). Selected works of <strong>Herbert</strong> <strong>Blumer</strong>. A public<br />
philosophy for mass society. Urbana, Illinois: University of Illinois Press.<br />
Marx, Wolfgang (2006). Theorie <strong>der</strong> Wirklichkeit. Essays. 3. Auflage. Bozen, Innsbruck, Wien,<br />
München: Edition Sturzflüge (Studienverlag).<br />
Miebach Bernd (2006). Soziologische Handlungstheorie. Eine Einführung. Wiesbaden: VS Verlag für<br />
Sozialwissenschaften.<br />
Von Mathe, Thomas (2005). Medizinische Soziologie <strong>und</strong> Sozialmedizin. Idstein: Schulz-Kirchner<br />
Verlag.<br />
Weiss, Hilde (1993). Soziologische Theorien <strong>der</strong> Gegenwart. Darstellung <strong>der</strong> grossen Paradigmen.<br />
Wien: Springer-Verlag.<br />
Zimmermann, Peter (2006). Gr<strong>und</strong>wissen Sozialisation. Einführung zur Sozialisation im Kindes- <strong>und</strong><br />
Jugendalter. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.<br />
8