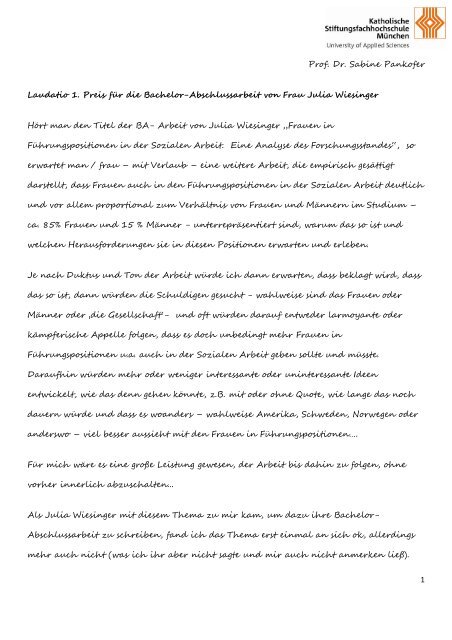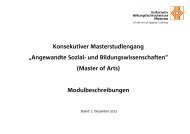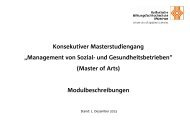1 Prof. Dr. Sabine Pankofer Laudatio 1. Preis für die Bachelor ...
1 Prof. Dr. Sabine Pankofer Laudatio 1. Preis für die Bachelor ...
1 Prof. Dr. Sabine Pankofer Laudatio 1. Preis für die Bachelor ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. <strong>Sabine</strong> <strong>Pankofer</strong><br />
<strong>Laudatio</strong> <strong>1.</strong> <strong>Preis</strong> <strong>für</strong> <strong>die</strong> <strong>Bachelor</strong>-Abschlussarbeit von Frau Julia Wiesinger<br />
Hört man den Titel der BA- Arbeit von Julia Wiesinger „Frauen in<br />
Führungspositionen in der Sozialen Arbeit. Eine Analyse des Forschungsstandes“, so<br />
erwartet man / frau – mit Verlaub – eine weitere Arbeit, <strong>die</strong> empirisch gesättigt<br />
darstellt, dass Frauen auch in den Führungspositionen in der Sozialen Arbeit deutlich<br />
und vor allem proportional zum Verhältnis von Frauen und Männern im Studium –<br />
ca. 85% Frauen und 15 % Männer - unterrepräsentiert sind, warum das so ist und<br />
welchen Herausforderungen sie in <strong>die</strong>sen Positionen erwarten und erleben.<br />
Je nach Duktus und Ton der Arbeit würde ich dann erwarten, dass beklagt wird, dass<br />
das so ist, dann würden <strong>die</strong> Schuldigen gesucht - wahlweise sind das Frauen oder<br />
Männer oder ‚<strong>die</strong> Gesellschaft‘- und oft würden darauf entweder larmoyante oder<br />
kämpferische Appelle folgen, dass es doch unbedingt mehr Frauen in<br />
Führungspositionen u.a. auch in der Sozialen Arbeit geben sollte und müsste.<br />
Daraufhin würden mehr oder weniger interessante oder uninteressante Ideen<br />
entwickelt, wie das denn gehen könnte, z.B. mit oder ohne Quote, wie lange das noch<br />
dauern würde und dass es woanders – wahlweise Amerika, Schweden, Norwegen oder<br />
anderswo – viel besser aussieht mit den Frauen in Führungspositionen….<br />
Für mich wäre es eine große Leistung gewesen, der Arbeit bis dahin zu folgen, ohne<br />
vorher innerlich abzuschalten...<br />
Als Julia Wiesinger mit <strong>die</strong>sem Thema zu mir kam, um dazu ihre <strong>Bachelor</strong>-<br />
Abschlussarbeit zu schreiben, fand ich das Thema erst einmal an sich ok, allerdings<br />
mehr auch nicht (was ich ihr aber nicht sagte und mir auch nicht anmerken ließ).<br />
1
Schließlich ist eine BA-Arbeit ja eine Art wissenschaftlicher Etüde – egal zu welchem<br />
Thema, bei dem eine breite Recherche und <strong>die</strong> komprimierte Kompilation, d.h. <strong>die</strong><br />
Zusammenstellung relevanter wissenschaftlicher Erkenntnisse, eine der Hauptaufgaben<br />
ist. Da ich Julia Wiesinger aber schon eine Weile kannte, erhoffte ich mir mehr als<br />
eine Etüde. Und ich wurde belohnt!<br />
Julia Wiesinger erfreute mich von Anfang an mit einer kreativen und deutlich<br />
spannenderen Herangehensweise und Fragestellung als <strong>die</strong> oben beschriebene: sie<br />
wollte nicht eine weitere Untersuchung erstellen, <strong>die</strong> <strong>die</strong> spezifischen<br />
Herausforderungen von Frauen in Führungspositionen in der Sozialen Arbeit<br />
appellativ herausarbeitete, sondern wollte <strong>die</strong> viel spannendere Frage bearbeiten, wie<br />
und was zu <strong>die</strong>sem Themenfeld im deutschsprachigen Raum zu <strong>die</strong>sem Thema gedacht<br />
und geforscht wird und wie sich das Gedachte und Geforschte auf <strong>die</strong> Konstruktion<br />
einer Wirklichkeit von Geschlechterungerechtigkeit in der Sozialen Arbeit<br />
niederschlägt.<br />
D.h. im weitesten Sinne wollte sie eine Diskursanalyse erstellen, welche<br />
Konstruktionen von Wirklichkeit <strong>die</strong>sen Diskursen zugrunde liegen und was man<br />
oder frau <strong>die</strong>sen Diskursen entgegensetzen kann, muss oder sollte, damit tatsächlich<br />
das große Thema Geschlechtergerechtigkeit im Berufsfeld der Sozialen Arbeit<br />
angegangen werden kann.<br />
Damit nahm sich Julia Wiesinger ein Thema vor, das bisher in <strong>die</strong>ser Form meines<br />
Wissens kaum bearbeitet wurde und einen wirklich spannenden querliegenden Blick<br />
erzeugt: nicht der Mangel von Frauen in Führungspositionen in der Sozialen Arbeit<br />
sollte im Fokus stehen, sondern welcher Blick auf Frauen in Führungspositionen in<br />
der Sozialen Arbeit eine Forschungslandschaft erzeugt, <strong>die</strong> mehr beklagend als<br />
motivierend ausgerichtet ist.<br />
2
Ziel der <strong>Bachelor</strong>arbeit war es also, über eine Zusammenschau des Forschungsstandes<br />
zum Thema Frauen in Führungspositionen in der Sozialen Arbeit und ein Verweben<br />
der Ergebnisse von bestehenden Forschungsschwerpunkten, aber auch Leerstellen<br />
aufzuzeigen und kritisch zu hinterfragen.<br />
Analyse und Reflexion des Forschungsstandes ermöglichten es dann, zum einen<br />
Richtungen <strong>für</strong> zukünftige Forschung darzulegen und zum anderen den gegenwärtigen<br />
Forschungsstand und seine Auswirkungen zu interpretieren.<br />
Darin liegt <strong>die</strong> Besonderheit <strong>die</strong>ser Arbeit: Julia Wiesinger erzeugt darin ständig und<br />
immer wieder neue Ebenen der Analyse und entwickelt damit einen ganz<br />
eigenständigen Blick auf ein gesellschaftlich hoch relevantes Thema: <strong>die</strong> Teilhabe von<br />
Frauen – auch in der Sozialen Arbeit – an der Macht.<br />
Wie ging sie <strong>die</strong>se ambitionierte Aufgabe an?<br />
Aus einer Metaperspektive und unter Einbeziehung aktuellster empirischer<br />
Untersuchungen untersucht sie <strong>die</strong> Implikationen, Bedeutungen und Auswirkungen<br />
des Forschungsstandes daraufhin, wie führende und leitende Frauen in der Sozialen<br />
Arbeit wahrgenommen werden.<br />
Zur Bearbeitung und Betrachtung der übergeordneten Fragestellung teilte sie <strong>die</strong><br />
Analyse der Forschungsberichte in zwei Themenkomplexe auf:<br />
„<strong>1.</strong> Forschungen zum Frauenanteil in der Sozialen Arbeit, v.a. in Führungspositionen<br />
Sie fragte sich: Was gibt es <strong>für</strong> quantitative Untersuchungen zu Geschlechterverhältnis<br />
und -verteilung im Berufsfeld der Sozialen Arbeit? Auf welches Zahlenmaterial<br />
können sich <strong>die</strong>se stützen? Lassen <strong>die</strong> Zahlen tatsächlich Rückschlüsse auf das<br />
3
Verhältnis von Frauen und Männern in Führungspositionen in der Sozialen Arbeit<br />
zu?<br />
2. Forschungen zu Sozialarbeiterinnen im Aufstieg und in Führungspositionen<br />
Dazu untersuchte sie, wie in bisherigen qualitativen Untersuchungen und<br />
theoretischen Analysen im Themenfeld „Sozialarbeiterinnen in Führungspositionen“<br />
geforscht wurde, in welche Richtungen der Forschungsblick hauptsächlich gelenkt<br />
wird, bzw. durch welche „Brillen“ das Thema betrachtet und welche Theorien zur<br />
Erklärung herangezogen werden.<br />
Dabei stellte sie <strong>die</strong> folgenden Fragen:<br />
Was <strong>für</strong> Forschungsfragen werden gestellt? Welche inhaltlichen bzw. thematischen<br />
Forschungsschwerpunkte zeigt der gegenwärtige Forschungsstand? Wo weisen Ergebnisse<br />
<strong>die</strong>ser Forschungsschwerpunkte in <strong>die</strong>selbe Richtung, wo gibt es Widersprüche? Welche<br />
Fragen wurden bisher vernachlässigt? Was wird durch <strong>die</strong> Art der Forschung<br />
ermöglicht, was wird verhindert?<br />
Das sind bereits sehr spannende und interessante Fragen, doch sie ging noch weiter. Als<br />
Ziel der Arbeit wollte sie Aussagen dazu gewinnen, was <strong>für</strong> ein Bild von<br />
Sozialarbeiterinnen und von Geschlechterforschung der gegenwärtige Forschungsstand<br />
zeichnet und wie <strong>die</strong>ser Forschungsstand in seiner Bedeutung verstanden und<br />
interpretiert werden kann.<br />
Sie wollte darüber hinaus wissen, wie man in Zukunft forschen müsste, mit welchen<br />
Ansatzpunkten und Fragen, damit sich welche Auswirkungen auf <strong>die</strong> Realität<br />
entwickeln können, bzw. welche Strategien und Maßnahmen zur Veränderung möglich<br />
sein können, tatsächlich mehr Frauen in der Sozialen Arbeit in Führungspositionen<br />
zu bringen.<br />
Und <strong>die</strong>s nicht aus reinem Selbstzweck: „Die Soziale Arbeit muss sich schon aufgrund<br />
4
ihres ethischen Selbstverständnisses mit Fragen der Geschlechtergerechtigkeit auch im<br />
eigenen Berufsfeld auseinandersetzen.“<br />
Julia Wiesinger weist auf der Basis relevanter Stu<strong>die</strong>n einen fatalen<br />
Rückkopplungseffekt von Forschung nach: In allen Forschungsprojekten wird nur<br />
konstatiert, dass es in der Sozialen Arbeit weniger Frauen in Führungspositionen gibt.<br />
Nur das wird erforscht - und damit werden <strong>die</strong>se Forschungsergebnisse zu einer Art<br />
Wahrheit. Dies zu dekonstruieren und dadurch neue Perspektiven – in der Forschung<br />
und in der Selbstwahrnehmung von Frauen in Führungspositionen in der Sozialen<br />
Arbeit – zu ermöglichen, darin liegt das innovative Potenzial <strong>die</strong>ser in vielerlei<br />
Hinsicht ungewöhnlichen und weit überdurchschnittlichen <strong>Bachelor</strong>arbeit.<br />
Julia Wiesinger traute sich dabei etwas und entwickelt als Ergebnis ihrer Analyse<br />
insgesamt drei starke Thesen und Bilder:<br />
Das erste Bild heißt: Forschung als Mosaik<br />
Forschung kann als Mosaik betrachtet werden, das <strong>für</strong> jeden Betrachter und jede<br />
Betrachterin ein spezielles Bild ergibt, das Mosaik variiert also je nach BetrachterIn.<br />
Julia Wiesingers äußerst kritisches Resümee der Betrachtung des Mosaikes „Frauen in<br />
Führungspositionen in der Sozialen Arbeit“ sieht so aus:<br />
„Das Mosaik des Forschungsstandes erzeugt aus meiner Sicht ein Bild, wonach Sozialarbeiterinnen<br />
daran gehindert werden, den ihnen rechtmäßig zustehenden Anteil<br />
an Entscheidungsmacht auszuüben, da ihnen Barrieren den Weg in <strong>die</strong> da<strong>für</strong><br />
notwendigen Positionen versperren. Diese Barrieren sind zu einem großen Teil von den<br />
Sozialarbeiterinnen selbst geschaffen, sie behindern sich also selbst auf dem Weg nach<br />
oben und weisen Defizite in der Aufstiegskompetenz auf. Teilweise erzeugt bzw.<br />
verfestigt der Forschungsstand damit stereotype Bilder wie das der fleißigen Basis- und<br />
Beziehungsarbeiterin, <strong>die</strong> noch viel mehr könnte, aber ihr Licht zu sehr unter den<br />
5
Scheffel stellt und zu schüchtern ist, um sich neben den männlichen Kollegen durchzusetzen.<br />
Es bleibt ein Eindruck von Sozialarbeiterinnen, <strong>die</strong> aus Angst vor<br />
Beziehungsverlust oder vor dem Umgang mit Macht vor Führungspositionen<br />
zurückschrecken und ein Bild von männlichen Sozialarbeitern, <strong>die</strong> sich in einem<br />
„Sonderstatus“ sehen und ganz selbstverständlich Führung <strong>für</strong> sich beanspruchen.“<br />
(57)<br />
Und weiter:<br />
„Es stellt sich <strong>die</strong> Frage, wie man der Reproduktion von Geschlechterstereotypen, <strong>die</strong><br />
sich ja als Erscheinungen im Forschungsfeld durchaus so präsentieren können,<br />
entgehen und <strong>die</strong> Untertöne reduzieren kann. Hilfreich könnte hier <strong>die</strong> aus dem<br />
systemischen Denken stammende Frage nach dem Systemgewinn sein, der zum Erhalt<br />
der derzeitigen Situation motiviert. Also etwa <strong>die</strong> Frage, warum Frauen aktiv,<br />
gewissermaßen als „Täterin“ und nicht als „Opfer“, Führung nicht übernehmen. Erst<br />
dadurch können Gewinne wie z.B. Rollensicherheit durch das nahe Beieinanderliegen<br />
von Berufs- und Geschlechtsrolle betrachtet werden und <strong>die</strong> soziale Konstruktion<br />
solcher Rollen rückt in den Blick. Natürlich muss auch der Systemgewinn <strong>für</strong> Männer<br />
betrachtet werden. Dies soll tatsächliche Barrieren nicht verharmlosen, sondern den<br />
Blick erweitern.“ (58)<br />
Das ist schon mal knackig und pointiert. Und es geht noch weiter:<br />
Julia Wiesinger sagt, dass Forschung zu <strong>die</strong>sem Thema als ein „Schlachtfeld der<br />
Bewertungen“ begriffen werden kann:<br />
„Das Feld der Geschlechterforschung ist durchzogen von politischen<br />
Auseinandersetzungen und Kampflinien. Die Art, wie hier geforscht wird, welche<br />
Schwerpunkte gesetzt werden und welche „Brillen“ bei der Betrachtung verwendet<br />
werden, ist nicht neutral, sondern Teil einer Positionierung der WissenschaftlerInnen.<br />
6
Dies gilt natürlich auch <strong>für</strong> andere Forschungsfelder, jedoch zeigt es sich in der<br />
Geschlechterforschung besonders ausgeprägt. Die Forschung wird zum Schlachtfeld, auf<br />
dem ein Teil des Kampfes um <strong>die</strong> „wahren“ Geschlechtsunterschiede, das Wesen von<br />
Männern und Frauen und <strong>die</strong> „richtige“ Art des Zusammenlebens ausgetragen<br />
wird.“(59)<br />
Das muss immer bedacht werden, wenn man oder frau Forschungen zum Thema<br />
Geschlecht analysiert.<br />
Und als letzte These:<br />
Forschung und Forschungsergebnisse zum Thema „Frauen in Fürhungspostionen in<br />
der Sozialen Arbeit“ haben massive Auswirkungen auf Sozialarbeiterinnen: das<br />
konstruierte Bild wird als Wahrheit und Realität gesehen und wirkt dadurch<br />
systemstabilisierend. Erneut ein Zitat:<br />
„Barrieren wie etwa Ängste von Frauen im Umgang mit Macht, <strong>die</strong> Bevorzugung<br />
<strong>für</strong>sorglicher Arbeit direkt mit KlientInnen oder <strong>die</strong> Angst vor Einsamkeit werden als<br />
Aufstiegshindernisse ständig wiederholt und zitiert, dringen in Denken und Handeln<br />
von Frauen und Männern ein und erzeugen so erst <strong>die</strong> Wirkung einer Barriere. Sind<br />
auch bestimmte Phänomene tatsächlich gegeben, so werden sie doch erst durch den<br />
Diskurs, durch <strong>die</strong> Sprache zu „Barrieren“ gemacht. Geschlechtsunterscheidungen<br />
werden durch Wissenschaft und Forschung hervorgebracht und nach Möglichkeit<br />
naturalisiert.“ (60)<br />
Julia Wiesinger arbeitet hier mit Judith Butlers Begriff der ‚Gender trouble’ – auf<br />
Deutsch: ‚Geschlechterverwirrung’, der bezogen auf <strong>die</strong> Situation von Frauen in der<br />
Sozialen Arbeit so beschrieben werden kann:<br />
„Die Geschlechter-Verwirrung resultiert aus Widersprüchlichkeiten und<br />
gegensätzlichen Informationen, denen Sozialarbeiterinnen ausgesetzt sind: Auf der<br />
7
einen Seite sehen sie, dass in der Sozialen Arbeit viele Frauen arbeiten, dass sie also<br />
in einem von Frauen dominierten Beruf tätig sind. Die Schlussfolgerung lautet: Es<br />
müsste doch eigentlich kein Problem sein, hier den Aufstieg zu schaffen. Auf der<br />
anderen Seite merken sie in ihrem Berufsfeld, dass Männer schneller<br />
Führungspositionen besetzen und bekommen durch den wissenschaftlichen Diskurs<br />
vermittelt, dass es <strong>für</strong> sie selbst Barrieren gibt.“<br />
Die daraus entstehende Geschlechter-Verwirrung kann einerseits Verunsicherung<br />
hervorrufen, andererseits bieten widersprüchliche und gegenläufige Diskurse <strong>die</strong><br />
Möglichkeit, mit der „einen“ Geschlechtsidentität zu brechen, weshalb Julia Wiesinger<br />
in Anlehnung an Butler zur Geschlechter-Verwirrung anstiften möchte mit der<br />
Schlussfolgerung:<br />
„So wird Geschlechter-Verwirrung und <strong>die</strong> Vervielfältigung von Möglichkeiten zur<br />
Chance, Zwänge abzubauen und Spielraum zu erobern <strong>für</strong> alternative<br />
Geschlechtsidentitäten und Lebensmodelle.“(61)<br />
Dieses Verständnis regt dazu an, durch Dekonstruktion Raum <strong>für</strong> Veränderungen zu<br />
erschließen:<br />
„In Zukunft wird es in Forschung und Praxis Sozialer Arbeit darum gehen, das<br />
selbstkritische Potential weiter zu nutzen, um mehr Geschlechtergerechtigkeit im<br />
Berufsfeld zu erreichen. Gleichzeitig sollte <strong>die</strong> kritische Selbstreflexion dort noch<br />
ausgebaut werden, wo es um <strong>die</strong> Frage nach den Auswirkungen von Forschung auf <strong>die</strong><br />
Praxis geht. ForscherInnen sollten sich bewusst sein, dass ihre Forschung nicht<br />
folgenlos bleibt, sondern Teil eines Diskurses wird, der in vielfältiger Art und Weise<br />
Rückwirkungen auf <strong>die</strong> Praxis der Sozialen Arbeit hat. In <strong>die</strong>sem zirkulären<br />
Verständnis bildet Forschung nicht nur Wirklichkeit ab, sondern beeinflusst sie auch,<br />
und Wirklichkeit hat ihrerseits Einfluss auf <strong>die</strong> Forschung.<br />
Die Chance liegt <strong>für</strong> Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler darin, <strong>die</strong><br />
8
Rückwirkungen auf <strong>die</strong> Praxis zu nutzen, um in dekonstruktivistischer Manier<br />
Geschlechterrollen und –zuweisungen in Frage zu stellen, <strong>die</strong> Geschlechterordnung<br />
aufzubrechen und <strong>die</strong> Vielfalt an Geschlechtsidentitäten aufzuzeigen.<br />
So wird Raum <strong>für</strong> Veränderungen in der Sozialen Arbeit und darüber hinaus<br />
erschlossen. Veränderungen – das bedeutet nicht nur gleiche Zugangschancen der<br />
Geschlechter zu Entscheidungspositionen, sondern auch das Zulassen vielfältiger<br />
Alternativen an Berufs- und Lebenswegen <strong>für</strong> Frauen und <strong>für</strong> Männer.“ (62)<br />
Dem ist aus meiner Sicht nichts mehr hinzuzufügen.<br />
Julia Wiesinger hat sich nach dem Studium der Sozialen Arbeit entschieden, ein<br />
Soziologiestudium an der Universität Freiburg anzuschließen.<br />
Liebe Julia, ich wünsche Dir, dass Du auch <strong>die</strong>ses Studium <strong>für</strong> Deine Entwicklung so<br />
nutzt wie Du das mit dem Studium der Sozialen Arbeit getan hast. Auch dort – so<br />
hoffe ich – wirst Du mit Deinen Gedanken hoffentlich konstruktive Verwirrung<br />
erzeugen – das wünsche ich Dir und Deinen Lehrenden, damit auch <strong>die</strong>se so schöne<br />
und spannende Arbeiten lesen dürfen, wie es <strong>die</strong> Zweitkorrektorin <strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Hanne<br />
Schaffer und ich durften.<br />
Wir wünschen Dir, liebe Julia, alles Gute und gratulieren Dir sehr herzlich zu<br />
<strong>die</strong>sem ersten <strong>Preis</strong>.<br />
9