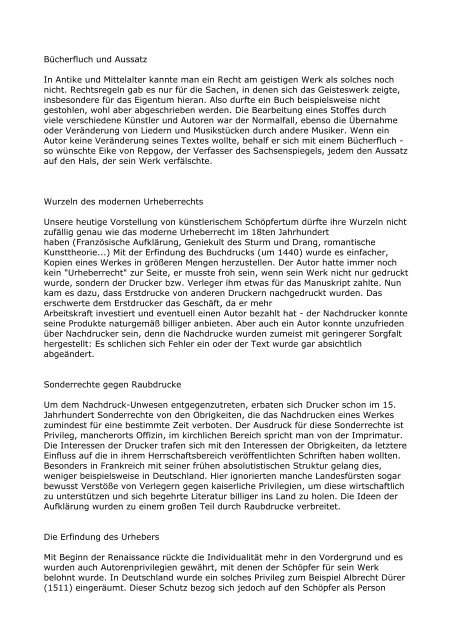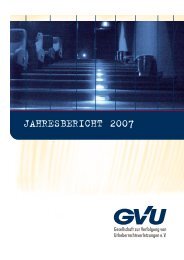Bücherfluch und Aussatz In Antike und Mittelalter kannte man ... - GVU
Bücherfluch und Aussatz In Antike und Mittelalter kannte man ... - GVU
Bücherfluch und Aussatz In Antike und Mittelalter kannte man ... - GVU
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Bücherfluch</strong> <strong>und</strong> <strong>Aussatz</strong><br />
<strong>In</strong> <strong>Antike</strong> <strong>und</strong> <strong>Mittelalter</strong> <strong>kannte</strong> <strong>man</strong> ein Recht am geistigen Werk als solches noch<br />
nicht. Rechtsregeln gab es nur für die Sachen, in denen sich das Geisteswerk zeigte,<br />
insbesondere für das Eigentum hieran. Also durfte ein Buch beispielsweise nicht<br />
gestohlen, wohl aber abgeschrieben werden. Die Bearbeitung eines Stoffes durch<br />
viele verschiedene Künstler <strong>und</strong> Autoren war der Normalfall, ebenso die Übernahme<br />
oder Veränderung von Liedern <strong>und</strong> Musikstücken durch andere Musiker. Wenn ein<br />
Autor keine Veränderung seines Textes wollte, behalf er sich mit einem <strong>Bücherfluch</strong> -<br />
so wünschte Eike von Repgow, der Verfasser des Sachsenspiegels, jedem den <strong>Aussatz</strong><br />
auf den Hals, der sein Werk verfälschte.<br />
Wurzeln des modernen Urheberrechts<br />
Unsere heutige Vorstellung von künstlerischem Schöpfertum dürfte ihre Wurzeln nicht<br />
zufällig genau wie das moderne Urheberrecht im 18ten Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
haben (Französische Aufklärung, Geniekult des Sturm <strong>und</strong> Drang, ro<strong>man</strong>tische<br />
Kunsttheorie...) Mit der Erfindung des Buchdrucks (um 1440) wurde es einfacher,<br />
Kopien eines Werkes in größeren Mengen herzustellen. Der Autor hatte immer noch<br />
kein "Urheberrecht" zur Seite, er musste froh sein, wenn sein Werk nicht nur gedruckt<br />
wurde, sondern der Drucker bzw. Verleger ihm etwas für das Manuskript zahlte. Nun<br />
kam es dazu, dass Erstdrucke von anderen Druckern nachgedruckt wurden. Das<br />
erschwerte dem Erstdrucker das Geschäft, da er mehr<br />
Arbeitskraft investiert <strong>und</strong> eventuell einen Autor bezahlt hat - der Nachdrucker konnte<br />
seine Produkte naturgemäß billiger anbieten. Aber auch ein Autor konnte unzufrieden<br />
über Nachdrucker sein, denn die Nachdrucke wurden zumeist mit geringerer Sorgfalt<br />
hergestellt: Es schlichen sich Fehler ein oder der Text wurde gar absichtlich<br />
abgeändert.<br />
Sonderrechte gegen Raubdrucke<br />
Um dem Nachdruck-Unwesen entgegenzutreten, erbaten sich Drucker schon im 15.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert Sonderrechte von den Obrigkeiten, die das Nachdrucken eines Werkes<br />
zumindest für eine bestimmte Zeit verboten. Der Ausdruck für diese Sonderrechte ist<br />
Privileg, <strong>man</strong>cherorts Offizin, im kirchlichen Bereich spricht <strong>man</strong> von der Imprimatur.<br />
Die <strong>In</strong>teressen der Drucker trafen sich mit den <strong>In</strong>teressen der Obrigkeiten, da letztere<br />
Einfluss auf die in ihrem Herrschaftsbereich veröffentlichten Schriften haben wollten.<br />
Besonders in Frankreich mit seiner frühen absolutistischen Struktur gelang dies,<br />
weniger beispielsweise in Deutschland. Hier ignorierten <strong>man</strong>che Landesfürsten sogar<br />
bewusst Verstöße von Verlegern gegen kaiserliche Privilegien, um diese wirtschaftlich<br />
zu unterstützen <strong>und</strong> sich begehrte Literatur billiger ins Land zu holen. Die Ideen der<br />
Aufklärung wurden zu einem großen Teil durch Raubdrucke verbreitet.<br />
Die Erfindung des Urhebers<br />
Mit Beginn der Renaissance rückte die <strong>In</strong>dividualität mehr in den Vordergr<strong>und</strong> <strong>und</strong> es<br />
wurden auch Autorenprivilegien gewährt, mit denen der Schöpfer für sein Werk<br />
belohnt wurde. <strong>In</strong> Deutschland wurde ein solches Privileg zum Beispiel Albrecht Dürer<br />
(1511) eingeräumt. Dieser Schutz bezog sich jedoch auf den Schöpfer als Person
(Persönlichkeitsrecht) <strong>und</strong> brachte den Urhebern noch keine Einnahmen. Angeknüpft<br />
wurde auch weiterhin am Werk als einer Sache. Mitte des 16. Jahrh<strong>und</strong>erts wurden<br />
Territorialprivilegien eingeführt, die allgemeine Nachdruckverbote in einem<br />
bestimmten Gebiet für einen begrenzten Zeitraum darstellten. Als die Verleger dazu<br />
Übergingen, den Autoren Honorare zu zahlen, bildete sich die Überzeugung, ihnen<br />
(den Verlegern) würde damit ein ausschließliches gewerbliches Schutzrecht zustehen<br />
(Lehre vom Verlagseigentum), auch wenn sie kein Privileg für ein Werk besaßen. Der<br />
Nachdruck wurde daher verboten, wenn die Rechte vom Autor erworben worden<br />
waren.<br />
Das Copyright entsteht<br />
Erstmals im 18. Jahrh<strong>und</strong>ert wurde über eigentumsähnliche Rechte an geistigen<br />
Leistungen (<strong>und</strong> das Phänomen des immateriellen Besitzes) theoretisiert. <strong>In</strong> einem<br />
englischen Gesetz von 1710, dem so genannten Statute of Anne, wurde als erstes ein<br />
ausschließliches Vervielfältigungsrecht des Autors anerkannt. Dieses Recht traten die<br />
Autoren dann an die Verleger ab. Nach Ablauf der vereinbarten Zeit fielen alle Rechte<br />
wieder an den Autor zurück. Das Werk musste im Register der Buchhändlergilde<br />
eingetragen werden <strong>und</strong> es musste mit einem Copyright-Vermerk versehen werden,<br />
damit es geschützt war. <strong>In</strong> den Vereinigten Staaten wurde dieses Verfahren 1795<br />
eingeführt (das Erfordernis der Registrierung wurde in England jedoch 1956 <strong>und</strong> in<br />
den Vereinigten Staaten 1978 wieder abgeschafft). Überwiegend wurde die Idee vom<br />
geistigen Eigentum mit der Naturrechtslehre begründet. Auch in Frankreich wurde in<br />
zwei Gesetzen von 1791 <strong>und</strong> 1793 ein Propri‚t‚ litt‚raire et artistique (?) eingeführt. <strong>In</strong><br />
Preußen kam es zu einem entsprechenden Schutz im Jahre 1837. Die<br />
B<strong>und</strong>esversammlung (Deutscher B<strong>und</strong>) beschloss ebenfalls 1837 eine 10-jährige<br />
Schutzfrist seit Erscheinen des Werkes, die 1845 auf 30 Jahre nach dem Tode des<br />
Urhebers (post mortem auctoris) verlängert wurde. 1857 wurde im Norddeutschen<br />
B<strong>und</strong> ein allgemeiner Urheberrechtsschutz eingeführt, der 1871 vom Deutschen Reich<br />
übernommen <strong>und</strong> später weiter ausgebaut wurde. Im Dritten Reich galt der Urheber<br />
lediglich als "Treuhänder des Werks" für die Volksgemeinschaft.<br />
(Quelle: unter Verwendung von Material aus Wikipedia)