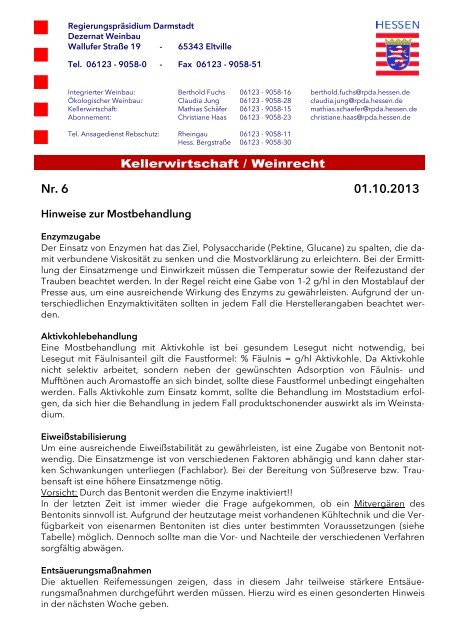Info zu Kellerwirtschaft / Weinrecht 6-2013 - Bergsträßer Wein
Info zu Kellerwirtschaft / Weinrecht 6-2013 - Bergsträßer Wein
Info zu Kellerwirtschaft / Weinrecht 6-2013 - Bergsträßer Wein
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Regierungspräsidium Darmstadt<br />
Dezernat <strong>Wein</strong>bau<br />
Wallufer Straße 19 - 65343 Eltville<br />
Tel. 06123 - 9058-0 - Fax 06123 - 9058-51<br />
Integrierter <strong>Wein</strong>bau: Berthold Fuchs 06123 - 9058-16 berthold.fuchs@rpda.hessen.de<br />
Ökologischer <strong>Wein</strong>bau: Claudia Jung 06123 - 9058-28 claudia.jung@rpda.hessen.de<br />
<strong>Kellerwirtschaft</strong>: Mathias Schäfer 06123 - 9058-15 mathias.schaefer@rpda.hessen.de<br />
Abonnement: Christiane Haas 06123 - 9058-23 christiane.haas@rpda.hessen.de<br />
Tel. Ansagedienst Rebschutz: Rheingau 06123 - 9058-11<br />
Hess. Bergstraße 06123 - 9058-30<br />
Nr. 6 01.10.<strong>2013</strong><br />
Hinweise <strong>zu</strong>r Mostbehandlung<br />
Enzym<strong>zu</strong>gabe<br />
Der Einsatz von Enzymen hat das Ziel, Polysaccharide (Pektine, Glucane) <strong>zu</strong> spalten, die damit<br />
verbundene Viskosität <strong>zu</strong> senken und die Mostvorklärung <strong>zu</strong> erleichtern. Bei der Ermittlung<br />
der Einsatzmenge und Einwirkzeit müssen die Temperatur sowie der Reife<strong>zu</strong>stand der<br />
Trauben beachtet werden. In der Regel reicht eine Gabe von 1-2 g/hl in den Mostablauf der<br />
Presse aus, um eine ausreichende Wirkung des Enzyms <strong>zu</strong> gewährleisten. Aufgrund der unterschiedlichen<br />
Enzymaktivitäten sollten in jedem Fall die Herstellerangaben beachtet werden.<br />
Aktivkohlebehandlung<br />
Eine Mostbehandlung mit Aktivkohle ist bei gesundem Lesegut nicht notwendig, bei<br />
Lesegut mit Fäulnisanteil gilt die Faustformel: % Fäulnis = g/hl Aktivkohle. Da Aktivkohle<br />
nicht selektiv arbeitet, sondern neben der gewünschten Adsorption von Fäulnis- und<br />
Mufftönen auch Aromastoffe an sich bindet, sollte diese Faustformel unbedingt eingehalten<br />
werden. Falls Aktivkohle <strong>zu</strong>m Einsatz kommt, sollte die Behandlung im Moststadium erfolgen,<br />
da sich hier die Behandlung in jedem Fall produktschonender auswirkt als im <strong>Wein</strong>stadium.<br />
Eiweißstabilisierung<br />
Um eine ausreichende Eiweißstabilität <strong>zu</strong> gewährleisten, ist eine Zugabe von Bentonit notwendig.<br />
Die Einsatzmenge ist von verschiedenen Faktoren abhängig und kann daher starken<br />
Schwankungen unterliegen (Fachlabor). Bei der Bereitung von Süßreserve bzw. Traubensaft<br />
ist eine höhere Einsatzmenge nötig.<br />
Vorsicht: Durch das Bentonit werden die Enzyme inaktiviert!!<br />
In der letzten Zeit ist immer wieder die Frage aufgekommen, ob ein Mitvergären des<br />
Bentonits sinnvoll ist. Aufgrund der heut<strong>zu</strong>tage meist vorhandenen Kühltechnik und die Verfügbarkeit<br />
von eisenarmen Bentoniten ist dies unter bestimmten Vorausset<strong>zu</strong>ngen (siehe<br />
Tabelle) möglich. Dennoch sollte man die Vor- und Nachteile der verschiedenen Verfahren<br />
sorgfältig abwägen.<br />
Entsäuerungsmaßnahmen<br />
Die aktuellen Reifemessungen zeigen, dass in diesem Jahr teilweise stärkere Entsäuerungsmaßnahmen<br />
durchgeführt werden müssen. Hier<strong>zu</strong> wird es einen gesonderten Hinweis<br />
in der nächsten Woche geben.
Zusatz im Moststadium Bentonit Mitvergären Zusatz im <strong>Wein</strong>stadium<br />
+ Aromaschonend<br />
→ sekundäre Aromastoffe<br />
noch nicht vorhanden<br />
+ Besserer Kontakt, daher<br />
meist keine Nachschönung<br />
im <strong>Wein</strong> mehr notwendig<br />
+ Keine Nährstoffproblematik<br />
+ Geringerer pH-Wert<br />
→ bessere Wirksamkeit<br />
+ Unterstüt<strong>zu</strong>ng der<br />
Sedimentation<br />
+ Geringerer Zeitaufwand<br />
→ Abtrennung erfolgt mit<br />
dem 1. Abstich<br />
+ evtl. bessere Klärung nach<br />
Gärende<br />
+ Genaue Bedarfsermittlung<br />
möglich<br />
+ Reduzierung biogener<br />
Amine im <strong>Wein</strong><br />
+ Unterstüt<strong>zu</strong>ng der Klärung<br />
bei <strong>Wein</strong>en mit Klärschwierigkeiten<br />
- Abreicherung des Thiamins<br />
→ Zugabe erforderlich<br />
- Erhöhter Zeitaufwand<br />
→ Einwirkzeit der Enzyme<br />
bedenken!<br />
- Genaue Bedarfsermittlung<br />
nicht möglich<br />
→ evtl. Nachschönung im<br />
<strong>Wein</strong> erforderlich<br />
- Keine Reduzierung von biogenen<br />
Aminen im <strong>Wein</strong><br />
- Abreicherung des Thiamins<br />
→ Zugabe erforderlich<br />
- Erhöhung des Eisengehalts<br />
→ <strong>zu</strong> lange Gärdauer und<br />
langes Lager auf der<br />
Vollhefe vermeiden!<br />
- <strong>zu</strong>nehmendes Risiko von<br />
Eisen-Phosphat-Trübungen<br />
bei gleichzeitigem Einsatz<br />
von DAP (bei hohen Gaben)<br />
- Bindung von Aromastoffen,<br />
die während der Gärung<br />
gebildet werden<br />
- Adsorption von positiven<br />
<strong>Wein</strong>inhaltsstoffen<br />
→ Aroma- und Farbverluste<br />
- höherer pH-Wert<br />
→ geringere Wirksamkeit<br />
Möglichkeiten der Mostvorklärung<br />
Die Sedimentation als traditionelle Methode ist nach wie vor sehr verbreitet und liefert in<br />
Verbindung mit dem Einsatz von Enzymen und Klärhilfsmitteln (z.B. Kieselsol/Gelatine) gute<br />
Ergebnisse. Der Nachteil der Sedimentation könnte in dem erhöhten Zeitbedarf gesehen<br />
werden, welcher von Faktoren wie Temperatur, Trubgehalt sowie Viskosität des Mostes abhängig<br />
ist.<br />
Auch die Filtration mittels Hefe- oder Kieselgurfilter ist in einigen Betrieben <strong>zu</strong> finden. Beim<br />
Einsatz des Kieselgurfilters ist darauf <strong>zu</strong> achten, dass nicht <strong>zu</strong> scharf filtriert wird, da sonst<br />
Gärstockungen auftreten können.<br />
Als Zeit einsparendes Verfahren hat sich die Flotation auch in klein- und mittelständigen Betrieben<br />
durchgesetzt. Insbesondere bei Jahrgängen mit belastetem Lesegut in Verbindung<br />
mit hohen Temperaturen während der Traubenlese (siehe 2011) ist die Flotation sinnvoll,<br />
um rasch vor<strong>zu</strong>klären und damit ein vorzeitiges Angären der Moste <strong>zu</strong> verhindern.<br />
Termine: 26.10.<strong>2013</strong>: LWP-Veranstaltung „<strong>Wein</strong>genuss im Kloster“ im Kloster Eberbach<br />
Mathias Schäfer, <strong>Kellerwirtschaft</strong>licher Berater Tel: 06123 - 905815