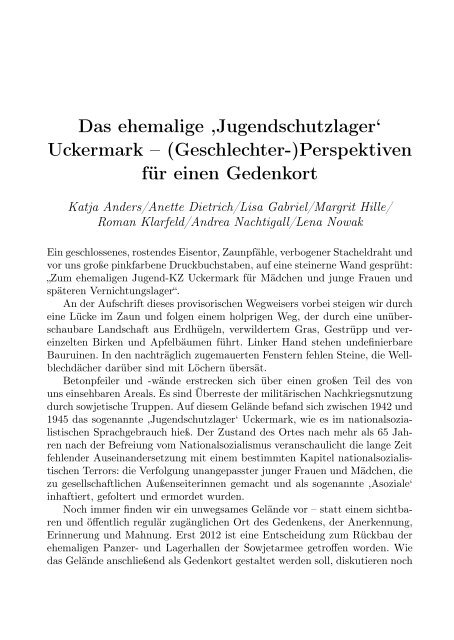Jugendschutzlager' Uckermark – (Geschlechter-)Perspektiven
Jugendschutzlager' Uckermark – (Geschlechter-)Perspektiven
Jugendschutzlager' Uckermark – (Geschlechter-)Perspektiven
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Das ehemalige ‚Jugendschutzlager‘<br />
<strong>Uckermark</strong> <strong>–</strong> (<strong>Geschlechter</strong>-)<strong>Perspektiven</strong><br />
für einen Gedenkort<br />
Katja Anders/Anette Dietrich/Lisa Gabriel/Margrit Hille/<br />
Roman Klarfeld/Andrea Nachtigall/Lena Nowak<br />
Ein geschlossenes, rostendes Eisentor, Zaunpfähle, verbogener Stacheldraht und<br />
vor uns große pinkfarbene Druckbuchstaben, auf eine steinerne Wand gesprüht:<br />
„Zum ehemaligen Jugend-KZ <strong>Uckermark</strong> für Mädchen und junge Frauen und<br />
späteren Vernichtungslager“.<br />
An der Aufschrift dieses provisorischen Wegweisers vorbei steigen wir durch<br />
eine Lücke im Zaun und folgen einem holprigen Weg, der durch eine unüberschaubare<br />
Landschaft aus Erdhügeln, verwildertem Gras, Gestrüpp und vereinzelten<br />
Birken und Apfelbäumen führt. Linker Hand stehen undefinierbare<br />
Bauruinen. In den nachträglich zugemauerten Fenstern fehlen Steine, die Wellblechdächer<br />
darüber sind mit Löchern übersät.<br />
Betonpfeiler und -wände erstrecken sich über einen großen Teil des von<br />
uns einsehbaren Areals. Es sind Überreste der militärischen Nachkriegsnutzung<br />
durch sowjetische Truppen. Auf diesem Gelände befand sich zwischen 1942 und<br />
1945 das sogenannte ‚Jugendschutzlager‘ <strong>Uckermark</strong>, wie es im nationalsozialistischen<br />
Sprachgebrauch hieß. Der Zustand des Ortes nach mehr als 65 Jahren<br />
nach der Befreiung vom Nationalsozialismus veranschaulicht die lange Zeit<br />
fehlender Auseinandersetzung mit einem bestimmten Kapitel nationalsozialistischen<br />
Terrors: die Verfolgung unangepasster junger Frauen und Mädchen, die<br />
zu gesellschaftlichen Außenseiterinnen gemacht und als sogenannte ‚Asoziale‘<br />
inhaftiert, gefoltert und ermordet wurden.<br />
Noch immer finden wir ein unwegsames Gelände vor <strong>–</strong> statt einem sichtbaren<br />
und öffentlich regulär zugänglichen Ort des Gedenkens, der Anerkennung,<br />
Erinnerung und Mahnung. Erst 2012 ist eine Entscheidung zum Rückbau der<br />
ehemaligen Panzer- und Lagerhallen der Sowjetarmee getroffen worden. Wie<br />
das Gelände anschließend als Gedenkort gestaltet werden soll, diskutieren noch
(<strong>Geschlechter</strong>-)<strong>Perspektiven</strong> für einen Gedenkort 7<br />
immer die involvierten Interessengruppen und politischen Akteur_innen 1 in<br />
einem Gremium, das sich „<strong>Uckermark</strong>-AG“ nennt.<br />
Dieser einleitende Text der „Forschungswerkstatt <strong>Uckermark</strong>“ soll den historischen<br />
Hintergrund des ehemaligen ‚Jugendschutzlagers’ <strong>Uckermark</strong> beleuchten,<br />
die aktuellen Konflikte um und <strong>Perspektiven</strong> auf einen potenziellen Gedenkort<br />
darstellen und zugleich unseren (geschlechterpolitischen) Zugang sowie<br />
unsere Positionierung dazu klären. Im Folgenden wird zunächst die Geschichte<br />
des ehemaligen ‚Jugendschutzlagers’ rekonstruiert. Dabei geht es zugleich um<br />
die Annäherung an die aktuellen Debatten und Gedenkpraxen verschiedener<br />
Initiativen auf dem Gelände.<br />
Ein Exkurs zum Thema Nationalsozialismus, Gedächtnis und Geschlecht<br />
befasst sich im Anschluss daran mit der Frage, welche Rolle die Kategorie<br />
Geschlecht für die Geschichte des Nationalsozialismus und deren Interpretation<br />
bzw. Repräsentation spielt. Dieser verdeutlicht die Verschränkung von Geschlecht<br />
mit der Kategorie ‚Asozial‘ und der daran geknüpften Verfolgungspraxis.<br />
Auch für die Nachgeschichte nach 1945, die Kontinuitäten der Ausgrenzung<br />
und das Verschweigen der Verfolgung sogenannter ‚Asozialer’ im Kontext der<br />
deutschen Erinnerungspolitik erweist sich die Kategorie Geschlecht als relevant.<br />
Insofern eröffnen sich über eine solche Lesart Anknüpfungspunkte und<br />
<strong>Perspektiven</strong> für den Umgang mit dem Gelände des ehemaligen ‚Jugendschutzlagers‘<br />
<strong>Uckermark</strong>.<br />
Daran anschließend nähern wir uns der spezifischen Erinnerungspraxis des<br />
ehemaligen ‚Jugendschutzlagers’ <strong>Uckermark</strong> seit den 1950er Jahren und damit<br />
zugleich den konfligierenden Positionen zum Umgang mit der Geschichte und<br />
dem Ort an.<br />
1 Der Unterstrich verweist auf Subjektpositionen jenseits der heteronormativen Zweigeschlechtlichkeit.<br />
Die Frage nach der Verwendung des Unterstrichs für die Zeit des Nationalsozialismus<br />
wurde in unserer Gruppe kontrovers diskutiert, da es problematisch erscheint,<br />
heutige geschlechterpolitische Interventionen auf den Nationalsozialismus mit seinen<br />
spezifischen geschlechtlichen und ideologischen Ausprägungen zu übertragen. Dennoch<br />
haben wir uns für eine Verwendung des Unterstrichs entschieden, um den zweigeschlechtlichheteronormativen<br />
Konstruktionscharakter von Subjektivität generell (aus heutiger Perspektive)<br />
zu betonen. Die Texte dieses Bandes gehen jedoch unterschiedlich mit der Frage der<br />
Benennung und Repräsentation von Geschlecht bzw. dem Einsatz einer „geschlechtergerechten“<br />
Sprache um, was (auch) verschiedene geschlechterpolitische Herangehensweisen widerspiegelt<br />
und aus diesem Grunde von uns nicht vereinheitlicht wurde.
8 Anders/Dietrich/Gabriel/Hille/Klarfeld/Nachtigall/Nowak<br />
Das ‚Jugendschutzlager‘ <strong>Uckermark</strong> <strong>–</strong> Geschichte<br />
und Gedenken<br />
Neben dem Jugend-Konzentrationslager in Moringen, in dem männliche Jugendliche<br />
inhaftiert wurden, sowie dem sogenannten ‚Jugendverwahrlager Litzmannstadt’<br />
(Łódź), einem polnischen Konzentrationslager, in dem hauptsächlich<br />
polnische Kinder von Zwangsarbeiter_innen gefangen gehalten wurden,<br />
war das ‚Jugendschutzlager‘ <strong>Uckermark</strong> eines von insgesamt drei NS-<br />
Konzentrationslagern speziell für Jugendliche und Kinder. Hier wurden verschiedene<br />
Häftlingsgruppen interniert: Zum größten Teil waren das Mädchen<br />
und junge Frauen, die als ‚asozial‘ kategorisiert wurden und die meist schon länger<br />
den verschiedenen Institutionen des NS „Fürsorgesystems“ ausgesetzt waren.<br />
Weiter handelte es sich bei den jungen Häftlingen um Frauen aus Gestapo-<br />
Haft sowie ab 1943 auch um politische Häftlinge. Bekannt und vergleichsweise<br />
gut dokumentiert ist dazu die Geschichte der Gruppe von Mädchen und jungen<br />
Frauen aus Slowenien, die Partisan_innen unterstützt oder anders politischen<br />
Widerstand geleistet hatten. Auch aus „rassischen“ Gründen verfolgte Jugendliche<br />
wurden in <strong>Uckermark</strong> inhaftiert. 2<br />
Nachdem im Juni 1942 die ersten weiblichen Jugendlichen in das ‚Jugendschutzlager‘<br />
<strong>Uckermark</strong> deportiert wurden, waren bis 1945 schätzungsweise bis<br />
zu 1200 Mädchen und Frauen in dem sogenannten ‚Jugendschutzlager‘ inhaftiert.<br />
Exakte Zahlen sind bei der dürftigen Quellenlage nicht zu ermitteln. 3<br />
2 Martin Guse folgend waren die Haftgründe im Jugend-KZ <strong>Uckermark</strong> „äußerst vielschichtig<br />
und reichten von pädagogischen Bankrotterklärungen (‚Unerziehbarkeit‘, ‚Renitenz‘, Kriminalität,<br />
‚sexuelle Verwahrlosung‘) bis zum Vorwurf der ‚Arbeitsverweigerung‘, ‚Arbeitsbummelei‘<br />
oder ‚Sabotage‘. Unter Federführung des Referates ‚Weibliche Kriminalpolizei‘ beim<br />
RKPA inhaftierte die deutsche Polizei aus eugenischen (Behinderte, Zwangssterilisierte) und<br />
rassischen Gründen. So verweisen diverse Aktenunterlagen und zudem auch die Aussagen<br />
ehemaliger Häftlinge des Lagers darauf, dass in größerer Zahl auch junge Sintezza und<br />
als ‚Judenmischlinge‘ verfolgte Mädchen in <strong>Uckermark</strong> inhaftiert wurden. Gestapo und SS<br />
wiederum richteten ihre Verfolgungsmechanismen gegen ‚Widersetzlichkeit‘ und konkrete<br />
Widerstandshandlungen Jugendlicher.“, Martin Guse, Das Jugend-KZ <strong>Uckermark</strong> (1942-<br />
1945), Haftgründe, online unter http://www.martinguse.de/jugend-kz/uckhaftgruende.htm<br />
(aufgerufen am 22.5.2012). Bei den aus rassischen Gründen verfolgten handelte es sich laut<br />
Bernhard Strebel um „weibliche Jugendliche, die [. . . ] mit Vermerken eingewiesen wurden<br />
wie: ‚Halbjüdin‘, ‚Judenmischling‘, ‚Zigeunerin‘, ‚Zigeunermischling‘ und ‚Marokkanermischling‘“,<br />
Bernhard Strebel, Das KZ Ravensbrück, Geschichte eines Lagerkomplexes, Paderborn<br />
u.a. 2003, S. 369.<br />
3 Vgl. Strebel, KZ Ravensbrück, S.365. Angaben zu Todeszahlen im ‚Jugendschutzlager‘<br />
<strong>Uckermark</strong> sind ebenfalls kaum möglich, vgl. ebd. S. 509.
(<strong>Geschlechter</strong>-)<strong>Perspektiven</strong> für einen Gedenkort 9<br />
Mit dem sich abzeichnenden Kriegsende wurde das ‚Jugendschutzlager‘<br />
schließlich im Januar 1945 weitestgehend aufgelöst und ein großer Teil der Inhaftierten<br />
in das nahe gelegene Frauenkonzentrationslager Ravensbrück überstellt.<br />
Auf demselben Gelände wurde anschließend ein Bereich abgetrennt und<br />
in ein „Tötungslager“ 4 umgewandelt.<br />
Hier wurden in den letzten Monaten bis zur Befreiung durch die Sowjetarmee<br />
im April 1945 im Konzentrationslager Ravensbrück selektierte Häftlinge<br />
durch systematische Unterversorgung und Appellstehen sowie durch Giftinjektionen<br />
ermordet. Mehrere tausend Menschen wurden aus dem „Tötungslager“<br />
in die Gaskammer des KZ Ravensbrück transportiert. 5<br />
Nach 1945 wurde der historische Ort des ‚Jugendschutzlagers‘ <strong>Uckermark</strong><br />
vernachlässigt. Damit ging eine jahrzehntelange Marginalisierung der hier inhaftierten<br />
Verfolgtengruppen im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus<br />
einher. So steht der Ort nicht nur für die Inhaftierung von (weiblichen) Jugendlichen<br />
in nationalsozialistischen Konzentrationslagern, sondern insbeson-<br />
4 Wir haben uns entschieden, den in diesem Zusammenhang häufig verwendeten Begriff des<br />
Vernichtungslagers nicht zu verwenden. Er ist unseres Erachtens zu fest mit den Konzentrationslagern<br />
der Aktion Reinhardt verbunden, die von den Nationalsozialisten in Polen<br />
und Weißrussland speziell zur Ermordung der europäischen Jüdinnen und Juden eingerichtet<br />
wurden. Der andernorts verwandte Begriff des ,Sterbelagers‘ wird demgegenüber jedoch wiederum<br />
der Tatsache nicht gerecht, dass in der Folgenutzung des Jugendkonzentrationslagers<br />
für Mädchen und junge Frauen aktiv getötet wurde. Wenn wir uns nun für den Begriff des<br />
,Tötungslagers‘ entschieden haben, dann mit dem Bewusstsein, dass auch diese Bezeichnung<br />
letztlich ein Behelfskonstrukt ist um kurz zu benennen, was eigentlich in seinen Einzelheiten<br />
beschrieben werden müsste.<br />
5 Zu den in der „Todeszone“ Inhaftierten und Ermordeten liegen kaum Zahlen vor. Laut Simone<br />
Erpel wird es „trotz intensiver Recherche [...] schwierig sein, über die vorsichtige Schätzung<br />
hinaus, die von mindestens 5000 Ermordeten ausgeht, sich der reale [sic!] Opferzahl<br />
zu nähern.“ Erpel und Strebel führen verschiedene Angaben auf: Der letzte Lagerkommandant<br />
des KZ Ravensbrück Fritz Suhren gab an, dass das ‚Jugendschutzlager‘ 8000 Plätze<br />
besaß und ungefähr 1500 Frauen vergast wurden. Schutzhaftlagerführer Johann Schwarzhuber<br />
sprach von 2300 bis 2400 und der SS-Arzt Percival Treite von 5000 selektierten Frauen.<br />
Die Ravensbrück-Überlebende Anise Postel-Vinay kam in ihrer Untersuchung hingegen auf<br />
schätzungsweise 5000 bis 6000 Getötete im Frühjahr 1945. Die als Stubenälteste in die „Todeszone“<br />
strafversetzte Kazimiera Warzynska schätzte die Zahl der nach <strong>Uckermark</strong> verlegten<br />
Frauen auf 6500, von denen etwa 4000 in die Gaskammer transportiert und 1557 am 14.<br />
April lebend in das Hauptlager zurückgebracht worden seien. Wanda Kiedrzyńska kommt<br />
unter Bezug auf Berichte ehemaliger polnischer Häftlinge in der Todeszone auf mindestens<br />
8000 dort Inhaftierte. Die Überlebende Hilde Boy-Brandt gab an, dass allein im Januar 1945<br />
3672 kranke Häftlinge aus dem Stammlager Ravensbrück für die „Todeszone“ selektiert worden<br />
seien, vgl. Simone Erpel, Das „Jugendschutzlager“ <strong>Uckermark</strong> als Vernichtungslager, in:<br />
Katja Limbächer/Maike Merten/Bettina Pfefferle (Hg.), Das Mädchenkonzentrationslager<br />
<strong>Uckermark</strong>, Münster 2005, S. 215-227 und Strebel, KZ Ravensbrück, S. 475 und 485f.
10 Anders/Dietrich/Gabriel/Hille/Klarfeld/Nachtigall/Nowak<br />
dere für die Gruppe der als ‚asozial‘ Verfolgten. Dieser wurde in der Nachkriegszeit<br />
insgesamt wenig Aufmerksamkeit und Anerkennung zuteil. Als Häftlingsgruppe<br />
haben die Betroffenen bis heute keine politische Interessenvertretung,<br />
die soziale Stigmatisierung hält mitunter immer noch an.<br />
Für die Erinnerung und<br />
Aufarbeitung der Geschichten<br />
des ehemaligen Mädchenkonzentrationslagers<br />
<strong>Uckermark</strong><br />
waren deshalb selbstorganisierte<br />
Initiativen und<br />
Netzwerke besonders wichtig.<br />
Auf deren Engagement<br />
ist maßgeblich zurückzuführen,<br />
was heute als Markierung<br />
und Gestaltung des Geländes<br />
überhaupt zu finden<br />
ist.<br />
Zu nennen sind hier vor<br />
allem die „Initiative für einen<br />
Gedenkort ehemaliges KZ<br />
<strong>Uckermark</strong> e. V./Netzwerk“ (im Folgenden: Netzwerk) 6 , sowie die in unterschiedlicher<br />
Besetzung jährlich von FrauenLesbenTransgender-Gruppen organisierten<br />
Bau- und Begegnungscamps auf dem Gelände, neben einzelnen engagierten<br />
Wissenschaftler_innen, die sich der Aufarbeitung der Geschichte im<br />
akademischen Rahmen widmen.<br />
Von den genannten selbstorganisierten politischen Initiativen gehen Spendengesuche,<br />
Kampagnen und Öffentlichkeitsarbeit aus. Außerdem wurde über<br />
die Jahre die materielle Gestaltung eines Gedenkortes auf dem ehemaligen Lagergelände<br />
initiiert und vorangebracht.<br />
Informationstafeln, die im Rahmen der Baucamps aufgestellt wurden, beschildern<br />
nun einen begehbaren Abschnitt des ansonsten kaum überschaubaren<br />
und unzugänglichen Areals, auf dem sich einst das Lager befand. Zudem wurde<br />
eine Gruppe fast durchsichtiger Skulpturen installiert, die so genannten Maschas.<br />
Dies sind aus Maschendraht gewirkte, lebensgroße Figuren, die oft erst<br />
beim zweiten Hinsehen erkennbar werden. Sie symbolisieren die unbekannten<br />
6 Zur Entstehungsgeschichte und dem Selbstverständnis des Netzwerks:<br />
http://www.gedenkort-kz-uckermark.de/info/chronik4-gedenkort.htm (aufgerufen am<br />
20.06.2012).
(<strong>Geschlechter</strong>-)<strong>Perspektiven</strong> für einen Gedenkort 11<br />
Opfer und sind für unser Verständnis ebenfalls Metapher der fehlenden Sichtbarkeit<br />
und des wenigen Wissens über die Geschichte, die hier stattgefunden<br />
hat. Neben dieser Installation wurde 2009 auf dem Gelände des ehemaligen<br />
Lagers auf Initiative des Netzwerkes ein Gedenkstein mit der Aufschrift: „Im<br />
Gedenken an die Gefangenen, Gefolterten und Ermordeten des Jugendkonzentrationslagers<br />
für Mädchen und junge Frauen und späteren Vernichtungslagers<br />
<strong>Uckermark</strong> 1942<strong>–</strong>1945. Ihr seid nicht vergessen! Nie wieder Faschismus!“ errichtet.<br />
Dieser resultierte aus dem Wunsch einiger Überlebender, die ihre Vorstellungen<br />
in die Gestaltung des Gedenkens einbringen konnten. Der Gedenkstein<br />
wurde im Rahmen der Gedenkfeier zum 64. Jahrestag der Befreiung des ehemaligen<br />
Jugendkonzentrationslagers für Mädchen und junge Frauen enthüllt. Auch<br />
von der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück gingen und gehen immer wieder<br />
Initiativen aus, das Lager <strong>Uckermark</strong> für die Öffentlichkeit zugänglich machen<br />
zu wollen und es in die eigene Gedenkpraxis einzubeziehen. So wird es z. B.<br />
einen eigenen Ausstellungsbereich zum ehemaligen ‚Jugendschutzlager‘ <strong>Uckermark</strong><br />
in der 2013 eröffnenden neuen Hauptausstellung geben.<br />
Das Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers zu einem möglichen Ort<br />
des Erinnerns und Gedenkens umzugestalten und dadurch dessen vergessene<br />
Opfer anzuerkennen, war von Beginn an ein von vielen Akteur_innen geteiltes,<br />
jedoch nicht minder kontrovers diskutiertes Anliegen. Im Januar 2012 kam es<br />
zu einer vertraglichen Einigung, bei der das Grundstück des ehemaligen Lagergeländes<br />
an das Land Brandenburg übertragen wurde und nun die Konversion<br />
des Geländes, also der Rückbau der Militärruinen, zu erwarten ist. Die Lösung<br />
eines langen Konfliktes, der die Nutzbarkeit des Geländes zum Gegenstand<br />
hatte, scheint damit in greifbare Nähe gerückt zu sein. 7<br />
All dieses Engagement findet nicht im leeren Raum, sondern im Kontext der<br />
(institutionalisierten) Erinnerungspolitik der Bundesrepublik nach 1945 statt.<br />
Diese stellt insofern einen Bezugsrahmen für politische Auseinandersetzungen<br />
um Formen und Inhalte des Gedenkens dar, von der sich ein Teil der oben<br />
genannten Akteur_innen explizit kritisch distanziert. Zudem sehen sich auf<br />
der anderen Seite die verschiedenen in den Gedenkort <strong>Uckermark</strong> involvierten<br />
7 Die Beantragung von EU-Fördergeldern für die Konversionsmaßnahmen erforderte die Veräußerung<br />
des Geländes von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben an eine neue Eigentümerin.<br />
Die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten sah sich jedoch nicht in der Lage,<br />
das Gelände zu übernehmen und zu unterhalten. Im Januar 2012 wurde schließlich der<br />
städtebauliche Vertrag zwischen dem brandenburgischem Ministerium für Infrastruktur und<br />
Landwirtschaft (MI) als neuem Eigentümer, der Vorbesitzerin, der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben<br />
(BIMA) sowie der Stadt Fürstenberg als zukünftige Bauherrin unterzeichnet<br />
und damit die Ausschreibung der Konversionsmaßnahmen möglich gemacht.
12 Anders/Dietrich/Gabriel/Hille/Klarfeld/Nachtigall/Nowak<br />
Institutionen und politischen Entscheidungsträger_innen mit eher unkonventionellen<br />
Zugängen konfrontiert, Gedenken und Entschädigung für eine marginalisierte<br />
Opfergruppe einzufordern. So entstanden über die Jahre nicht nur<br />
Dokumentationen von Überlebenden-Berichten und ein Mosaik an Tafeln, Installationen<br />
und Steinen auf dem Gelände selbst; vielmehr entwickelten sich im<br />
Umfeld des Gedenkens an das Lager in der <strong>Uckermark</strong> in fast noch umfangreicherem<br />
Maße politische Konflikte und Debatten sowie historische Kontroversen.<br />
Diese spiegeln sich nicht nur in der Unwegsamkeit des ehemaligen Lagers, sie<br />
verweisen auch auf den wenig geradlinigen Prozess des Gedenkens an die Opfer<br />
des sogenannten ‚Jugendschutzlagers‘ <strong>Uckermark</strong>. Der Titel dieses Buches<br />
„Unwegsames Gelände“ benennt insofern nicht nur die Topographie des Geländes,<br />
die Schwierigkeit der (politischen, ökonomischen) Umsetzung eines Gedenkortes,<br />
die Konflikte um die ‚richtige‘ Gestaltung eines solchen Ortes bzw. die<br />
‚richtige‘ Form des Gedenkens an die Opfer, sondern darüber hinaus die Entstehung<br />
dieses Sammelbandes, die fast an den politischen Auseinandersetzungen<br />
gescheitert wäre.<br />
Unsere eigene Motivation, uns als Forschungswerkstatt im zunächst universitären<br />
Rahmen mit dem ehemaligen ‚Jugendschutzlager‘ <strong>Uckermark</strong> zu beschäftigen,<br />
war von dem politischen Anliegen geprägt, dem bislang weitestgehend<br />
vergessenen bzw. vergessen gemachten Ort des ehemaligen Konzentrationslagers<br />
für Mädchen und junge Frauen und späteren Tötungslagers zu einer<br />
größeren Sichtbarkeit und damit politisch-gesellschaftlichen Anerkennung zu<br />
verhelfen. Bei unseren Recherchen zeigte sich, dass die Geschichte der Verfolgung,<br />
Ausgrenzung und Disziplinierung von Marginalisierten und Unangepassten<br />
und als ‚asozial‘ Klassifizierten in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung<br />
mit dem Nationalsozialismus nach wie vor eine untergeordnete Rolle<br />
spielt und nur unzureichend erforscht ist. Zugleich ist die Quellenlage zum<br />
Jugendkonzentrationslager <strong>Uckermark</strong> sehr lückenhaft und lässt bis heute zu<br />
vielen Fragen nur Vermutungen zu. Angesichts der Aktualität der Diskussionen<br />
über den Umgang mit dem Gelände verlagerte sich der Fokus unserer Arbeit<br />
von der historischen Forschung zu erinnerungspolitischen Fragen. Am aktuellen<br />
Konflikt um die Verantwortung für das ehemalige Lagergelände und die<br />
Gestaltung sowie Ausrichtung eines möglichen Gedenkortes sind eine Vielzahl<br />
von Akteur_innen mit unterschiedlichen Positionen zu Form und Politik des<br />
Gedenkens beteiligt, die über den spezifischen Kontext „<strong>Uckermark</strong>“ hinausweisen.<br />
Wir entschieden uns mit diesem Sammelband eine Plattform zu schaffen,<br />
in der die divergierenden, z.T. unvereinbaren Positionen der beteiligten<br />
Akteur_innen nebeneinander stehen können und dokumentiert sind und be-
(<strong>Geschlechter</strong>-)<strong>Perspektiven</strong> für einen Gedenkort 13<br />
gannen uns mit den Kontroversen über die Schaffung eines gegenwärtigen und<br />
zukünftigen Gedenkortes <strong>Uckermark</strong> auseinanderzusetzen. Vor die Erschließung<br />
der Lagergeschichte schob sich also der Blick auf die Frage nach einem angemessenen<br />
Umgang mit den historischen Ereignissen aus heutiger Perspektive,<br />
also Fragen nach Erinnern, Gedenken, Anerkennen und Entschädigen. Insofern<br />
begreifen wir den vorliegenden Band ebenfalls als Ort und Teil eines mosaikwenn<br />
nicht bruchstückhaften Gedenkens an das ehemalige Mädchenkonzentrationslager.<br />
Sein Zustandekommen selbst wurde dabei durch die gedenkpolitischen<br />
Konflikte geprägt. So gestaltete sich die Herausgabe der konfligierenden<br />
Positionen in einem Band als mühselig und erforderte immer wieder langwierige<br />
Verhandlungen und Diskussionen mit den Beteiligten, v.a. mit Geldgeber_innen<br />
und Verlagen. Der Streit um verschiedene politische Ansichten und<br />
Positionierungen ging schließlich so weit, dass wir <strong>–</strong> damit der Sammelband<br />
auch tatsächlich mit allen Artikeln und einer möglichst großen Bandbreite an<br />
Positionen bzgl. des (Gedenk-)Ortes <strong>Uckermark</strong> erscheinen konnte <strong>–</strong> zu einem<br />
unabhängigen Verlag wechselten. Damit verloren wir jedoch nicht nur Zeit,<br />
sondern auch die zugesicherte Finanzierung.<br />
Nationalsozialismus, Gedenken und Geschlecht<br />
Unsere Motivation und Herangehensweise an das Thema waren von Beginn<br />
an von einer gendertheoretischen und feministischen Perspektive geprägt. Dies<br />
scheint im Kontext des KZ <strong>Uckermark</strong> <strong>–</strong> einem Lager, das speziell für Mädchen<br />
und junge Frauen errichtet wurde, unmittelbar überzeugend und naheliegend.<br />
Grund dafür, dass eine geschlechtsbezogene Herangehensweise an das ehemalige<br />
Jugend-KZ <strong>Uckermark</strong> (ähnliches gilt auch für das Frauen-KZ Ravensbrück)<br />
offensichtlich keine Irritationen oder grundsätzlichen Einwände provoziert,<br />
scheint jedoch vor allem ein verkürztes Verständnis von „Gender“ zu sein,<br />
das dieses primär mit Frauen und Mädchen identifiziert und nur bestimmte<br />
vergeschlechtlichte Strukturen in den Blick nimmt.<br />
Eine systematische Einbeziehung der Kategorie Geschlecht in eine Auseinandersetzung<br />
mit Nationalsozialismus und Holocaust sowie der Erinnerung<br />
an ein historisches Geschehen ist keineswegs so selbstverständlich, wie es hier<br />
scheint. Die Kategorie Geschlecht spielt in wissenschaftlichen Debatten ebenso<br />
wie in den NS-Gedenkstätten nur eine marginale oder gar keine Rolle, wenn es<br />
zum Beispiel um die männlichen Verfolgten und Inhaftierten des Nationalsozialismus<br />
geht (so z. B. in der Auseinandersetzung mit dem ehemaligen Jugend-
14 Anders/Dietrich/Gabriel/Hille/Klarfeld/Nachtigall/Nowak<br />
KZ Moringen, das speziell für männliche Jugendliche vorgesehen war). Zudem<br />
bedarf ein geschlechterbezogener Ansatz einer sorgfältigen Begründung. Angesichts<br />
der Verbrechen des NS erscheint eine geschlechtertheoretische oder gar<br />
feministische Perspektive nebensächlich, zum Teil sogar problematisch und unangemessen.<br />
So besteht die Gefahr, dass durch eine alleinige Fokussierung auf<br />
die Kategorie Geschlecht im Kontext von Nationalsozialismus und Holocaust<br />
weitaus bedeutsamere Kategorien wie „Rasse“ in den Hintergrund rücken. 8 Die<br />
Tatsache, dass <strong>Geschlechter</strong>konstruktionen stets von Rassifizierungsprozessen<br />
begleitet und überformt werden, die sich insbesondere im Zusammenhang mit<br />
dem Nationalsozialismus im Hinblick auf die Diskriminierungs- und Verfolgungsgeschichte<br />
als weitaus wirkungsmächtiger erwiesen haben, zeigt, dass ein<br />
gendertheoretischer Ansatz nicht isoliert angewendet werden kann. „Geschlecht“<br />
muss vielmehr als interdependente Kategorie verstanden werden, die stets von<br />
anderen Strukturkategorien durchdrungen ist bzw. in Wechselwirkung mit diesen<br />
hervorgebracht wird. 9<br />
Ansätze aus dem Bereich der feministischen und Gender-Forschung belegen<br />
seit Jahren die Bedeutung der Kategorie Geschlecht für das Funktionieren<br />
des Nationalsozialismus insgesamt. Der Nationalsozialismus war deutlich geschlechtsspezifisch<br />
organisiert. Auch bei der Propagierung und Durchsetzung<br />
der nationalsozialistischen Ideologie spielte die Kategorie Geschlecht eine zentrale<br />
Rolle, z. B. in Konstruktionen von antisemitischen und rassistischen Feindbildern,<br />
der „Nation“ und „Volksgemeinschaft“ sowie den damit verbundenen<br />
rassifizierten Sexual- und Moralvorstellungen. Aber auch in den Repräsenta-<br />
8 So gab es beispielsweise innerhalb der Frauenforschung Stimmen, die den NS in erster Linie<br />
als ‚Extremform des Patriarchats‘ analysierten, und dadurch der Kategorie Geschlecht<br />
Vorrang gegenüber anderen Kategorien einräumten. Damit einher ging die implizite Gleichsetzung<br />
aller Frauen als Patriarchatsopfer, was jedoch die Differenzen zwischen (z. B. ‚jüdischen‘<br />
und ‚arischen‘) Frauen sowie die aktive Beteiligung und Täterinnenschaft von Frauen<br />
innerhalb des NS aus dem Blickfeld verschwinden ließ. Die Debatte um die feministische Auseinandersetzung<br />
mit dem NS und weiblicher Täter- bzw. Mittäterschaft wurde in Deutschland<br />
unter dem Stichwort ‚Historikerinnenstreit‘ bekannt. Vgl. Christine Herkommer, Frauen<br />
im Nationalsozialismus <strong>–</strong> Opfer oder Täterinnen? Eine Kontroverse der Frauenforschung im<br />
Spiegel feministischer Theoriebildung und der allgemeinen historischen Aufarbeitung der<br />
NS-Vergangenheit, München 2005; Frauen gegen Antisemitismus: Der Nationalsozialismus<br />
als Extremform des Patriarchats. Zur Leugnung der Täterschaft von Frauen und zur Tabuisierung<br />
des Antisemitismus in der Auseinandersetzung mit dem NS, in: Beiträge zur<br />
feministischen Theorie und Praxis 35/1993, S. 77-89.<br />
9 Zur Konzeptionalisierung von Geschlecht als interdependenter Kategorie vgl. Katharina<br />
Walgenbach/Gabriele Dietze/Antje Hornscheidt/Kerstin Palm, Geschlecht als interdependente<br />
Kategorie. Neue <strong>Perspektiven</strong> auf Intersektionalität, Diversität und Heterogenität,<br />
Opladen/Farmington Hills 2007.
(<strong>Geschlechter</strong>-)<strong>Perspektiven</strong> für einen Gedenkort 15<br />
tionen und Erinnerungen an den Nationalsozialismus nach 1945, insbesondere<br />
wenn es um Fragen von Täter_innenschaft, Opferstatus und Schuld geht, spielt<br />
die Kategorie Geschlecht eine maßgebliche Rolle. So lässt sich fragen: Inwiefern<br />
ist das Erinnern und Gedenken an die NS-Vergangenheit geschlechtlich<br />
strukturiert? Gibt es ein geschlechtsspezifisches Erinnern? Welche unterschiedlichen<br />
Funktionen erfüllt die Kategorie Geschlecht im Rahmen der verschiedenen<br />
Erinnerungsdiskurse, -politiken und -praxen? Wie sind Vorstellungen von<br />
Täterschaft und Mittäterschaft strukturiert? Wer darf sich auf die Opfer berufen<br />
und mit welcher Intention? Diese Fragen werden insbesondere im Kontext<br />
des Erinnerns an das Mädchen-KZ <strong>Uckermark</strong> relevant, da sich einige der Akteur_innen<br />
explizit als feministisch begreifen <strong>–</strong> und insofern auch die von ihnen<br />
vertretene Form des Gedenkens feministisch ausgerichtet ist.<br />
Um an der Relevanz und damit einer Einbeziehung von „Geschlecht“ als<br />
einer bedeutsamen Kategorie zur Analyse von Nationalsozialismus und Holocaust,<br />
die über die personelle Ebene von Mädchen und Frauen hinausweist,<br />
festzuhalten, bedarf es zunächst einer Differenzierung der verschiedenen Ebenen<br />
sowie einer kritischen Betrachtung dessen, was durch die gender-spezialisierte<br />
Perspektive jeweils in den Blick genommen werden soll und kann <strong>–</strong> und welche<br />
Sichtverluste und Ausblendungen damit möglicherweise einhergehen. Es lassen<br />
sich zunächst grob drei Ebenen unterscheiden, bei denen Geschlecht im Kontext<br />
einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus <strong>–</strong> besonders<br />
in Bezug auf das Lager <strong>Uckermark</strong> <strong>–</strong> in je eigener Weise relevant werden kann:<br />
Erstens: die personelle, individuelle Ebene: Hierzu zählen die Opfer des<br />
Nationalsozialismus und ihre unterschiedlichen (geschlechtsspezifischen) Erfahrungen<br />
von Diskriminierung und Verfolgung ebenso wie die Täter_innen, ihre<br />
biografischen Hintergründe und individuellen (geschlechtsspezifischen) Sichtweisen<br />
und Motivationen, aber auch die in der Gegenwart Handelnden, die sich<br />
aus heutiger Perspektive mit der Vergangenheit und der Erinnerung an diese<br />
beschäftigen.<br />
Zweitens: die strukturelle Ebene der nationalsozialistischen Institutionen,<br />
Gesetze, Verfolgungsgründe, „Rasse“-Definitionen, vergeschlechtlichten Handlungsfelder<br />
und -spielräume sowie Karriere- und Aufstiegschancen etc. sowie<br />
die damit verbundenen, teilweise bis in die Gegenwart reichenden Kontinuitäten<br />
der Diskriminierung und Ausgrenzung z. B. von als ‚asozial‘ Stigmatisierten.<br />
Drittens: die Ebene der gesellschaftlichen Diskurse und Repräsentationen,<br />
Metaphern und Symboliken, die in einem spezifischen historischen Kontext<br />
relevant werden <strong>–</strong> hierzu gehören beispielsweise die antisemitischen Diskurse<br />
und Klischeebilder des Nationalsozialismus, Repräsentationen von „Nation“ und
16 Anders/Dietrich/Gabriel/Hille/Klarfeld/Nachtigall/Nowak<br />
„Volksgemeinschaft“ usw., die über vergeschlechtlichte Metaphern repräsentiert<br />
und plausibilisiert werden. Zu dieser Ebene zählen auch die Erinnerungsdiskurse<br />
und -politiken der Gegenwart, ihre Auslassungen und Überblendungen sowie<br />
politische, pädagogische und künstlerische Formen, Entwürfe und „Trends“<br />
des Erinnerns und Gedenkens, die jeweils Spezifisches hervorheben oder z. B.<br />
bestimmte Personen oder Personengruppen in den Vordergrund rücken, die<br />
als „erinnerungswürdig“ gelten. Grundlegend ist in diesem Kontext die (feministische)<br />
Erkenntnis, dass die Repräsentationen der NS-Vergangenheit, zum<br />
Beispiel Darstellungen und Deutungen von Täter_innenschaft, immer auch<br />
geschlechtlich strukturiert sind.<br />
Dabei gilt es zwischen den historischen Ereignissen selbst und der Ebene<br />
der Repräsentationen, Deutungen und Bilder zu unterscheiden. Im Zuge poststrukturalistischer<br />
und konstruktivistischer Ansätze hat sich die Erkenntnis<br />
durchgesetzt, dass ein unmittelbarer Zugriff auf die Geschichte unmöglich ist.<br />
Auch historische (ebenso wie feministische) Arbeiten eröffnen demnach keinen<br />
unverstellten, objektiven Blick auf die Geschichte, wie sie „wirklich“ war, sondern<br />
betreiben vielmehr eine aktive Aneignung und Deutung der historischen<br />
Ereignisse, die zwangsläufig Schwerpunkte setzt, Interpretationen vornimmt,<br />
Identifikationen beinhalten kann und die Ereignisse oder auch nur bestimmte<br />
Aspekte von einem heutigen Standpunkt aus betrachtet und ihnen Bedeutung<br />
verleiht. Das heißt, Erinnerung und kollektives Gedächtnis, also die Frage, was<br />
überhaupt und in welcher Form erinnert werden soll und Einzug in das kollektive<br />
Gedächtnis einer Gesellschaft hält, sind stets umkämpft und in Bewegung,<br />
sie werden innerhalb gesellschaftspolitischer, diskursiver, häufig medial<br />
vermittelter Aushandlungsprozesse immer wieder neu festgelegt. Begriffe wie<br />
„doing memory“ (Meike Penkwitt) oder „doing history“ (Harald Welzer) tragen<br />
einem solchen Verständnis von Erinnern und Gedächtnis als einem aktiven<br />
Herstellungsprozess Rechnung. Übertragen auf feministische Ansätze, die die<br />
Vergangenheit aus einer <strong>Geschlechter</strong>perspektive beleuchten und mit spezifischen<br />
Deutungen versehen, könnte daher auch von einem „doing feminism“<br />
gesprochen werden.<br />
Die Kategorie Geschlecht spielt in diesen Aushandlungsprozessen insofern<br />
eine zentrale Rolle, da sie sowohl die Wahrnehmung als auch die Darstellung<br />
des historischen Geschehens (mit) strukturiert. Nicht nur Wer und Was, auch<br />
Wie erinnert wird, ist entlang geschlechtlicher Zuschreibungen organisiert <strong>–</strong><br />
womit im Rahmen der zweigeschlechtlichen Ordnung stets ein hierarchisches<br />
Verhältnis impliziert ist. Das bipolare Zuordnen der Vergangenheit nach Geschlecht<br />
funktioniert insgesamt als eine „verborgene Praxis der Bedeutungszu-
(<strong>Geschlechter</strong>-)<strong>Perspektiven</strong> für einen Gedenkort 17<br />
weisung“. 10 Meike Günther (in diesem Band) spricht deshalb in Anlehnung an<br />
Brigitte Dehne von Geschlecht als einem „Regulator“, der die Erinnerung und<br />
die mit ihr einhergehenden Theorien, Alltagsvorstellungen, Begriffe, Normierungen<br />
etc. mit einem symbolischen Wert auflädt, ohne dass diese Prozesse<br />
jedoch selbst unbedingt explizit würden.<br />
Arbeiten insbesondere aus dem Bereich der Kulturwissenschaften haben die<br />
spezifische Bedeutung und Wirksamkeit von <strong>Geschlechter</strong>bildern in den Darstellungen<br />
und Deutungen des Nationalsozialismus rekonstruiert und dabei vor<br />
allem auf deren entlastende Funktionen aufmerksam gemacht. 11 Silke Wenk<br />
und Insa Eschebach formulieren als übergreifende These: „Wenn <strong>Geschlechter</strong>bilder<br />
[. . . ] Darstellungen historischer Ereignisse strukturieren, ist der Effekt<br />
eine Naturalisierung von Geschichte. Die konkreten, historisch benennbaren<br />
Ereignisse werden zu Manifestationen einer natürlich gegebenen Ordnung beziehungsweise<br />
zu deren Umkehrung umartikuliert. Das Besondere, das Außergewöhnliche<br />
und Entsetzen Erregende droht ‚gezähmt‘ und damit normalisiert<br />
zu werden.“ 12 Mit anderen Worten: Indem sich „Geschlecht“ als Folie über die<br />
historischen Ereignisse legt, kann das Geschehen plausibel gemacht werden. Geschlecht<br />
trägt somit zur Wiederherstellung der Ordnung und Beruhigung bei<br />
<strong>–</strong> was häufig den Effekt einer Schuldabwehr und -entlastung erfüllt. So werden<br />
Stereotype und Metaphern von Geschlecht zum Beispiel auf die Wahrnehmung<br />
der Opfer und Täter_innen des NS übertragen und zur Erklärung ihrer Taten<br />
herangezogen. Täterschaft wird dabei zumeist „männlich“ gedacht <strong>–</strong> wodurch<br />
Täterinnen dem Blick entzogen werden. Sind Frauen überhaupt als Täterinnen<br />
benannt, werden sie häufig entlang geschlechtlicher Klischees und Stereotype<br />
präsentiert, z. B. als fehlgeleitete Ausnahme und „unweibliche“ Exzesstäterin<br />
und Bestie. 13 <strong>Geschlechter</strong>bilder können aber auch zur Charakterisierung des<br />
NS-Systems als Ganzes dienen. Wie Insa Eschebach und Silke Wenk darlegen,<br />
kann die symbolische Feminisierung des Faschismus die „Selbstviktimisierung“<br />
10 Katrin Hoffmann-Curtius, Feminisierung des Faschismus, in: Claudia Keller/LiteraturWERKstatt<br />
Berlin (Hg.), Die Nacht hat zwölf Stunden, dann kommt<br />
schon der Tag. Antifaschismus: Geschichte und Neubewertung, Berlin 1996, S. 45<strong>–</strong>69, hier<br />
S. 51.<br />
11 Vgl. stellvertretend die Beiträge in Insa Eschebach/Sigrid Jacobeit/Silke Wenk (Hg.), Gedächtnis<br />
und Geschlecht, Deutungsmuster in Darstellungen des nationalsozialistischen Genozids,<br />
Frankfurt a. M./New York 2002.<br />
12 Silke Wenk/Insa Eschebach, Soziales Gedächtnis und <strong>Geschlechter</strong>differenz. Eine Einführung,<br />
in: Eschebach/Jacobeit/Wenk (Hg.), Gedächtnis und Geschlecht, S. 13<strong>–</strong>38, hier S.<br />
22.<br />
13 Vgl. auch Anette Kretzer, NS-Täterschaft und Geschlecht: Der erste britische Ravensbrück-<br />
Prozess 1946/47 in Hamburg, Berlin 2009.
18 Anders/Dietrich/Gabriel/Hille/Klarfeld/Nachtigall/Nowak<br />
der Tätergesellschaft begünstigen: Ist das deutsche „Volk“, das die Nationalsozialisten<br />
an die Macht brachte, über die Zuordnung zum Weiblichen einmal<br />
auf der Seite des Schwachen platziert, so lässt es sich als „Opfer“ beschreiben:<br />
verführt und vergewaltigt. 14<br />
Überträgt man die verschiedenen Dimensionen von Geschlecht im Kontext<br />
des Nationalsozialismus auf die Frage nach einem „angemessenen“ Erinnern und<br />
Gedenken an das ehemalige ‚Jugendschutzlager‘ <strong>Uckermark</strong> bzw. die konkrete<br />
Umsetzung und Gestaltung eines (zukünftigen) Gedenkortes, kristallisieren sich<br />
weitere Diskussionspunkte heraus, die auch die Arbeit an diesem Buch und<br />
unsere Diskussionen im Vorfeld begleitet haben.<br />
Für <strong>Uckermark</strong> ergibt sich insofern eine besondere Situation, als das Gedenken<br />
und Erinnern von vielen Akteur_innen selbst als explizit „feministisch“<br />
definiert wird. Was aber genau ist darunter zu verstehen und wie unterscheidet<br />
sich ein „feministisches Erinnern“ von anderen Erinnerungsformen? Wie<br />
Corinna Tomberger, Lisa Gabriel und Lena Nowak in diesem Band argumentieren,<br />
kann auch eine dezidiert feministische Herangehensweise an Gedenken<br />
und Erinnern problematische Ausblendungen oder Umdeutungen hervorbringen.<br />
Kritisch wird dabei vor allem ein „parteilicher“ oder auch „identifikatorischer“<br />
Zugang diskutiert, der auf der einen Seite Interesse wecken und damit<br />
individuelle Zugänge und politisches Engagement überhaupt erst ermöglichen<br />
kann, andererseits jedoch Gefahr läuft, die vergangenen Ereignisse oder Stimmen<br />
der Überlebenden für gegenwärtige Anliegen zu instrumentalisieren. Eigene<br />
(feministische) Identifikationen können also problematische Überblendungen<br />
beinhalten.<br />
Andererseits stellt eine feministische Parteinahme eine notwendige Intervention<br />
in tradierte, sexistische Wahrnehmungsmuster dar, die mit dazu geführt<br />
haben, dass das Lager <strong>Uckermark</strong> und die Geschichten seiner Opfer vergessen<br />
gemacht wurden. Kontinuitäten der Stigmatisierung und Sexualisierung<br />
sogenannter ‚asozialer‘ Mädchen und Frauen haben dazu beigetragen, dass sie<br />
und ihre Geschichten bis heute gesellschaftlichen Tabuisierungen und Abwertungen<br />
unterliegen. Feministische Erinnerungspolitiken verfolgen erklärterweise<br />
das Ziel, patriarchale Strukturen und Sexismus damals und heute zu thematisieren,<br />
Kontinuitäten und Differenzen sichtbar zu machen und damit die sexistischen<br />
Wahrnehmungsmuster selbst zu durchbrechen, indem (in der Tradition<br />
der frühen Frauenforschung) eine „vergessene Frauen- und Mädchengeschichte“<br />
14 Wenk/Eschebach, Soziales Gedächtnis, in: Eschebach/Jacobeit/Wenk, Gedächtnis und Geschlecht,<br />
S. 26. Vgl. auch Hoffmann-Curtius, Feminisierung.
(<strong>Geschlechter</strong>-)<strong>Perspektiven</strong> für einen Gedenkort 19<br />
jenseits der androzentrischen Geschichtsschreibung sichtbar gemacht wird (vgl.<br />
für einen dezidiert feministischen Zugang auch den Beitrag von Mona Büren,<br />
Vivien Laumann, Ellen Reitnauer und Katharina Voß in diesem Band). Ein feministischer<br />
Ansatz, der sich im weiteren Sinne als Gesellschaftskritik versteht,<br />
kann zudem die Problematiken, die mit staatlichen Erinnerungsdiskursen und<br />
-politiken generell verbunden sind, sichtbar machen (vgl. auch den Artikel von<br />
Sylvia Degen und Claudia Krieg in diesem Band).<br />
Nicht nur auf Seiten der unterschiedlichen Akteur_innen, sondern auch im<br />
Hinblick auf eine Thematisierung der Verfolgungsgründe wird die Kategorie<br />
„Geschlecht“ im Kontext von <strong>Uckermark</strong> relevant. So hat die nationalsozialistische<br />
Verwendung der Kategorie ‚asozial‘ deutlich geschlechtliche Implikationen,<br />
die auch nach 1945 eine Thematisierung der Verfolgungsgründe sowie eine Anerkennung<br />
der als ‚asozial‘ Verfolgten erschwert und behindert haben.<br />
Auch im Hinblick auf die Umsetzung und Gestaltung eines Gedenkortes<br />
<strong>Uckermark</strong>, wie z. B. die hypothetische Einrichtung einer Gedenkstätte <strong>Uckermark</strong>,<br />
die Erarbeitung geeigneter pädagogischer Konzepte und Bildungsmaterialien<br />
oder aber die Thematisierung des ehemaligen Lagers <strong>Uckermark</strong> im Rahmen<br />
von Ausstellungen, wie z. B. der neuen Hauptausstellung der Mahn- und<br />
Gedenkstätte Ravensbrück stellt sich für uns die Frage nach dem Zusammenhang<br />
von Geschlecht und Erinnerung. Zu diskutieren wäre aus der Perspektive<br />
einer gendersensiblen Gedenkstättenpädagogik neben der Frage der Gestaltung<br />
auch die der Rezeption <strong>–</strong> etwa die Frage nach einem „geschlechtsspezifischen“<br />
Zugang auf Seiten derer, die künftig eine Ausstellung, Gedenkstätte oder Bildungsveranstaltung<br />
besuchen. Wie Meike Günther in diesem Band ausführt, ist<br />
der Zugang zur Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit<br />
generell abhängig von dem spezifischen Hintergrund, der Lebenssituation<br />
und gesellschaftlichen wie politischen Verortung und Motivation der Einzelnen.<br />
Lässt sich deshalb aus der Tatsache, dass in <strong>Uckermark</strong> (bis zur Umwandlung<br />
in ein ‚Tötungslager‘ 1945) ausschließlich Mädchen inhaftiert waren, eine besondere<br />
„Chance“ ableiten, die nun besonders den jugendlichen Gedenkstättenbesucherinnen<br />
einen Einstieg ins Thema ermöglichen könnte? Oder liegt<br />
in einem solchermaßen auf individuelle und biografische Zugänge verkürzten<br />
Gender-Ansatz nicht gerade die Gefahr, auf die auch Günther in ihrem Beitrag<br />
hinweist, gegenwärtige Weiblichkeitskonstruktionen über die Vergangenheit zu<br />
legen und damit zu universalisieren? Diskutiert werden könnte in diesem Zusammenhang<br />
auch das pädagogische Konzept der KZ-Gedenkstätte Moringen,<br />
das, da es sich ebenfalls um ein ehemaliges Jugendkonzentrationslager handelt,<br />
möglicherweise auch für einen Gedenkort <strong>Uckermark</strong> Anregungen bereithält.
20 Anders/Dietrich/Gabriel/Hille/Klarfeld/Nachtigall/Nowak<br />
Das dort umgesetzte Konzept scheint sich jedoch auf ähnliche Analogiebildungen<br />
<strong>–</strong> wenn auch nicht in Bezug auf Geschlecht <strong>–</strong> zu berufen, die primär die<br />
Gemeinsamkeiten zwischen Gestern und Heute in den Vordergrund stellen. So<br />
heißt es in der Selbstdarstellung der Gedenkstätte: „Moringen ist vor allem ein<br />
Lernort für Jugendliche“, der in erster Linie diesen <strong>–</strong> da die damals Inhaftierten<br />
Jugendliche waren <strong>–</strong> „sehr direkte Zugänge“ zur NS-Geschichte ermögliche, da<br />
sie „unmittelbar“ an ihre eigene soziale Situation anknüpften. 15 Darüber hinaus<br />
wäre zu überlegen, wie eine „geschlechtergerechte“ Repräsentation der Vergangenheit<br />
in einer Ausstellung oder in pädagogischen Materialien gewährleistet<br />
werden könnte. In den Blick kommen dabei nicht nur die Formen und Ziele von<br />
Erinnerung und Gedenken, sondern auch ausgewählte Inhalte und Gegenstände<br />
wie Fotos oder Dokumente, anhand derer der Vergangenheit gedacht werden<br />
soll. 16<br />
Wie könnte also die Geschichte an einem möglichen Gedenkort <strong>Uckermark</strong><br />
didaktisch gestaltet und pädagogisch vermittelt werden? Macht es Sinn, im<br />
Kontext der ‚Jugendschutzlager‘ an die aktuellen Lebensrealitäten von Jugendlichen<br />
und jungen Erwachsenen anzuknüpfen, um sie für das Thema zu<br />
interessieren? Wie kann die Geschlechtsspezifik der Kategorie ‚asozial‘ und der<br />
Verfolgungsgeschichte der so Klassifizierten aufgearbeitet und vermittelt werden,<br />
ohne angesichts der Kontinuitäten nach 1945 in simplifizierende Vergleiche<br />
15 So heißt es auf der Webseite der KZ-Gedenkstätte Moringen unter der Überschrift „Moringen<br />
ist vor allem ein Lernort für Jugendliche“: „Jugendliche stoßen hier auf sehr direkte<br />
Zugänge zur NS-Geschichte, die sich unmittelbar ausgehend von ihrer eigenen sozialen<br />
Situation eröffnen. An der Geschichte des Jugend-KZ kann die Entstehung und<br />
Wirkung von Vorurteilsstrukturen und Ausgrenzungsmechanismen beschrieben werden.<br />
Eine Auseinandersetzung mit Häftlingsbiographien unterstützt dabei den inhaltlichen Zugang<br />
im Rahmen der Führung. Ein besonderer Schwerpunkt gilt der Arbeit mit sozial<br />
benachteiligten Jugendlichen und jungen Erwachsenen.“ Vgl. http://www.gedenkstaettemoringen.de/gedenkstaette/fuhrungen/fuhrungen.html<br />
(aufgerufen am 20.06.2012). Wie<br />
dieser Abschnitt aus der Selbstdarstellung der Gedenkstätte nahelegt, scheint der „direkte<br />
Zugang zur NS-Geschichte“ und der daraus abgeleitete Lernerfolg nicht nur aus einer ähnlichen<br />
Altersstruktur der Jugendlichen zu resultieren, sondern auch aus einem ähnlichen<br />
sozialen Status der Gedenkstättenbesucher_innen und den ehemals Inhaftierten abgeleitet<br />
zu werden. So werden speziell „sozial benachteiligte“ Jugendliche angesprochen, verbunden<br />
mit dem Hinweis, dass in dem ehemaligen Jugend-KZ Moringen überwiegend als ‚Asoziale‘<br />
oder ‚Kriminelle‘ stigmatisierte Jugendliche inhaftiert waren.<br />
16 Irit Rogoff und Kathrin Hoffman-Curtius haben zum Beispiel für die Versuche, den Nationalsozialismus<br />
über Weiblichkeitsmetaphern zu visualisieren, die Formulierung „Feminisierung<br />
des Faschismus“ geprägt; vgl. Irit Rogoff, Von Ruinen zu Trümmern. Die Feminisierung<br />
des Faschismus in deutschen historischen Museen, in: Silvia Baumgart, et al. (Hg.),<br />
Denkräume zwischen Kunst und Wissenschaft. 5. Kunsthistorikerinnentagung in Hamburg,<br />
Berlin 1993, S. 258-285; Kathrin Hoffmann-Curtius, Feminisierung.
(<strong>Geschlechter</strong>-)<strong>Perspektiven</strong> für einen Gedenkort 21<br />
zu verfallen, die heutige <strong>Geschlechter</strong>konstruktionen auf die Geschichte projizieren<br />
und dichotome <strong>Geschlechter</strong>konstruktionen zu reproduzieren und zu verfestigen<br />
drohen? Meike Günther schlägt in ihrem Beitrag eine intersektionale<br />
Herangehensweise vor, die diese Fallstricke umgehen könnte. Anhand der Impulse<br />
der theoretischen Auseinandersetzungen um Intersektionalität zeigt sich,<br />
wie aktuelle Debatten um Geschlecht den Blick auf die Geschichte und den<br />
Umgang mit ihr prägen bzw. verändern können. Eine (kritische) Auseinandersetzung<br />
mit Geschlecht als Struktur- und Analysekategorie, die wir als Herausgeber_innen<br />
dieses Bandes führen wollen, verweist auf die eingangs ausgeführten<br />
unterschiedlichen Herangehensweisen sowie die vielschichtigen Ebenen der<br />
Kategorie Geschlecht in der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus.<br />
Diese verschiedenen <strong>Perspektiven</strong> und Dimensionen von Geschlecht zeigen sich<br />
explizit wie implizit auch in den Beiträgen dieses Bandes, wobei nur ein Teil<br />
der Beiträge die Kategorie einbezieht.<br />
Die Kategorie ‚asozial‘<br />
Eine geschlechtersensible Herangehensweise erweist sich in der Auseinandersetzung<br />
mit der nationalsozialistischen Kategorie „Asozialität“ als unerlässlich,<br />
um die Konstruktions- und Ausgrenzungsmechanismen der nationalsozialistischen<br />
„Rassen“- und Sozialpolitik nachvollziehen zu können. Die Kategorie weist<br />
vergeschlechtlichte Aspekte auf, an sie waren verschiedene Männlichkeits- und<br />
Weiblichkeitsvorstellungen geknüpft. Während zunächst vor allem Bettler als<br />
‚asozial‘ verfolgt wurden, waren es ab 1940 vorrangig junge, sexuell „unangepasste“<br />
Frauen, sodass von einer „Feminisierung der ‚Asozialen‘-Verfolgung“ 17<br />
gesprochen werden kann.<br />
Bei der Definition der Kategorie ‚Asozial‘ im Nationalsozialismus konnte<br />
auf ältere gesellschaftspolitische Debatten zur Ausgrenzung vermeintlich unangepasster<br />
Menschen zurückgegriffen werden. „Weder die Definition der ‚Asozialität‘<br />
noch die Verfolgung der ‚Asozialen‘ waren Erfindungen der Nationalsozialisten.<br />
Die Armenzählungen der Vormoderne unterschieden immer schon<br />
17 Annette Eberle, Häftlingskategorien und Kennzeichnungen, in: Wolfgang Benz/Barbara<br />
Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager.<br />
Band 1: Die Organisation des Terrors, München 2005, S. 91<strong>–</strong>109, hier S. 97. Während<br />
der sogenannten „Aktion Arbeitsscheu Reich“, bei der im April und Juni 1938 über 10000<br />
Personen als „Asoziale“ in Konzentrationslagern inhaftiert wurden, war der Anteil der Frauen<br />
noch sehr gering.
22 Anders/Dietrich/Gabriel/Hille/Klarfeld/Nachtigall/Nowak<br />
zwischen Arbeitswilligen und Müßiggängern.“ 18 Bereits in der Weimarer Republik<br />
wurden rassenhygienische und erbbiologische Deutungsmuster herangezogen,<br />
um die behauptete Verwahrlosung von Jugendlichen mit der angenommenen<br />
Vererbung von Charaktereigenschaften zu erklären. 19 Seit 1918 wurden<br />
im Rahmen der Vereinheitlichung der reichsweiten Fürsorgegesetzgebung die<br />
Einführung eines „Bewahrungsgesetzes“ und sogenannte Bewahranstalten für<br />
unerziehbare Jugendliche diskutiert. 20 Diese Aspekte von Vorgeschichte und<br />
Kontinuitäten der Ausgrenzung vermeintlich unangepasster Jugendlicher und<br />
der Konstruktion der Kategorie ‚asozial‘ arbeitet Christa Schikorra in diesem<br />
Band anhand von zwei sozialpolitischen Vordenkerinnen, Hilde Eiserhardt und<br />
Lilly Zarncke, von der Weimarer Republik bis in die Nachkriegsgeschichte der<br />
Bundesrepublik auf.<br />
Unter dem NS-Regime kam es<br />
zu einer Verschärfung der Ausgrenzung<br />
der nun als ‚gemeinschaftsfremd‘<br />
Klassifizierten. 21 Eine eindeutige<br />
juristische Definition der Kategorie<br />
‚asozial‘ gab es jedoch nicht, vielmehr<br />
unterlag sie einem Wandlungsprozess.<br />
Insgesamt blieb die Zuordnung<br />
zur Kategorie ‚asozial‘ diffus.<br />
Sie stellte eine „von außen auferlegte<br />
extrem abwertende Sammelbezeichnung<br />
für abweichendes Verhalten unterschiedlichster<br />
Form“ dar. 22 Damit<br />
waren sowohl die Zuordnung zu die-<br />
18 Wolfgang Ratze, Die Rolle der Verwaltung bei der Vernichtung „asozialen“ Lebens, in:<br />
telegraph (Berlin 2008) 116/117, S. 75<strong>–</strong>102, hier S. 75.<br />
19 Regina Fritz, Die „Jugendschutzlager“ <strong>Uckermark</strong> und Moringen im System nationalsozialistischer<br />
Jugendfürsorge, in: Ernst Berger (Hg.), Verfolgte Kindheit. Kinder und Jugendliche<br />
als Opfer der NS-Sozialverwaltung, Wien 2007, S. 303<strong>–</strong>326, hier S. 305.<br />
20 Christa Schikorra, Über das Zusammenspiel von Fürsorge, Psychiatrie und Polizei bei der<br />
Disziplinierung auffälliger Jugendlicher, in: Thomas Beddies/Kristina Hübener (Hg.), Kinder<br />
in der NS-Psychiatrie, Berlin 2004, S. 86<strong>–</strong>106.<br />
21 Fritz, Die „Jugendschutzlager“, S. 305 f. Auch das sogenannte Gemeinschaftsfremdengesetz<br />
scheiterte zunächst aufgrund der Kompetenzstreitigkeiten von Polizei und Justiz und wurde<br />
wegen des Kriegsgeschehens nie verabschiedet. Etwa eine Million Menschen wären von dem<br />
Gesetz betroffen gewesen.<br />
22 Wolfgang Ayaß, Nicht der Einzelne zählte . . . „Gemeinschaftsfremd“ im nationalsozialistischen<br />
Österreich, in: Verein zur Förderung des DOWAS (Hg.), Aus so krummem Holze, als
(<strong>Geschlechter</strong>-)<strong>Perspektiven</strong> für einen Gedenkort 23<br />
ser Kategorie wie auch die Verfolgungspraxis für Jugendliche, Frauen, Männer<br />
und zum Teil ganze Familien, die die gesellschaftlichen Normen in irgendeiner<br />
Weise verletzten, willkürlich. 23<br />
Vermeintlich abweichendes Sozialverhalten galt als Ausdruck „minderwertiger“<br />
Erbanlagen. Dennoch blieb ein Spannungsverhältnis zwischen der angenommenen<br />
Unveränderlichkeit sozialen Verhaltens aufgrund von dessen angeblicher<br />
Vererbung und einer angestrebten „Besserungsfähigkeit“ bzw. Erziehbarkeit<br />
bestehen. Als nicht-„arisch“ klassifizierte Jugendliche, also z. B. Juden,<br />
Roma und Sinti und Schwarze, galten im Nationalsozialismus jedoch als grundsätzlich<br />
nicht „erziehungswürdig“ und „unverbesserlich“ und sollten aus der öffentlichen<br />
Erziehung ausgeschlossen werden. 24 Mit der Konstruktion und Ausgrenzung<br />
vermeintlich unsittlicher, verwahrloster ‚Asozialer‘ war der Entwurf<br />
einer „Volksgemeinschaft“ verbunden, die als sittlich, ordentlich und diszipliniert<br />
vorgestellt wurde (vgl. den Beitrag von Dörthe Schulz und Roman Klarfeld<br />
in diesem Band).<br />
Der Erlass zur „Vorbeugenden Verbrechensbekämpfung durch die Polizei“<br />
von 1937 bildete eine der juristischen Grundlagen für die nun systematisch<br />
einsetzende Einweisung von als ‚asozial‘ Kategorisierten in Konzentrationslager.<br />
25 1938 bildeten ‚Asoziale‘ mit Abstand die größte Häftlingsgruppe in den<br />
Konzentrationslagern. 26 Jedoch waren die Haftgründe im Einzelnen sehr unterschiedlich,<br />
was die Herausbildung einer gemeinsamen Gruppenidentität und<br />
Strukturen der Solidarität in den Lagern erschwerte. Zudem umfasste die Häftworaus<br />
der Mensch gemacht ist, kann nichts ganz Gerades gezimmert werden. [30 Jahre<br />
DOWAS Innsbruck], Innsbruck 2006, S. 77<strong>–</strong>87, hier S. 77.<br />
23 Anhand des Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück weist Christa Schikorra nach, dass<br />
unter den als ‚asozial‘ inhaftierten Frauen Roma und Sinti waren, zudem fand sie vereinzelte<br />
Hinweise auf polnische, jüdische, afrikanische und asiatische sowie lesbische Frauen.<br />
Vgl. Christa Schikorra, Kontinuitäten der Ausgrenzung. „Asoziale“ Häftlinge im Frauen-<br />
Konzentrationslager Ravensbrück, Berlin 2001, S. 10 f.<br />
24 Dazu ein nicht veröffentlichter Runderlass des Innenministers vom 21. Juli 1939, vgl. Kuhlmann,<br />
Heimerziehung im Nationalsozialismus, in: Eckhart Knab/Werner Nickolai/Norbert<br />
Scheiwe (Hg.), Für die Zukunft lernen, Freiburg 2000, S. 15. Diese als nicht-„arisch“ definierten<br />
Jugendlichen wurden in gesonderte Einrichtungen oder nach Auschwitz gebracht.<br />
25 Zu den rechtlichen Grundlagen und der Vorgeschichte vgl. Christa Schikorra, Kontinuitäten.<br />
Zur Definition des Personenkreises, der als ‚asozial‘ kategorisiert wurde, vgl. Christa<br />
Paul, Frühe Weichenstellung. Zum Ausschluss ‚asozialer‘ Häftlinge von Ansprüchen auf besondere<br />
Unterstützungsleistungen und auf Entschädigung, in: Katharina Stengel/Werner<br />
Konitzer (Hg.), Opfer als Akteure. Interventionen ehemaliger NS-Verfolgter in der Nachkriegszeit,<br />
Frankfurt a. M. 2008, S. 67<strong>–</strong>86, hier S. 68.<br />
26 Im Oktober 1938 machten die als ‚asozial‘ Inhaftierten etwa 70 % der Häftlinge in Konzentrationslagern<br />
aus, vgl. Eberle, Häftlingskategorien, S. 97.
24 Anders/Dietrich/Gabriel/Hille/Klarfeld/Nachtigall/Nowak<br />
lingskategorie keinen gemeinsamen Hintergrund oder positiven Bezugspunkt<br />
wie z. B. bei politischen Häftlingen. 27<br />
Ab 1940 wurden schließlich Arbeitserziehungslager und sogenannte ‚Jugendschutzlager‘<br />
errichtet, darunter 1942 das ‚Jugendschutzlager‘ <strong>Uckermark</strong>. Die<br />
Kriminalpolizei arbeitete bei der Einweisung von Jugendlichen in Konzentrationslager<br />
mit Gesundheitsämtern, Fürsorgeeinrichtungen und Arbeitsämtern<br />
zusammen. „Ausschlaggebend für eine Inhaftierung war das Abweichen von<br />
herrschenden gesellschaftlichen Normen. [. . . ] Ob ein Fürsorgezögling in ein<br />
‚Jugendschutzlager‘ eingewiesen wurde oder weiterhin der Fürsorgeerziehung<br />
anheimfiel, hing vom Ermessen der FürsorgerInnen, PolizeibeamtInnen oder<br />
GutachterInnen ab.“ 28 Für die Einweisung wurden dabei verschiedenste „Vergehen“<br />
herangezogen, wie z. B. „die Weigerung, der HJ oder dem BDM beizutreten,<br />
Ausschluss aus der HJ, ‚Arbeitsbummelei‘, Sabotage, ‚Unerziehbarkeit‘,<br />
‚Kriminalität‘, ‚Sittliche Verwahrlosung‘, ‚Rassenschande‘ und Homosexualität.<br />
Aber auch eugenische (Behinderte, Zwangssterilisierte), religiöse (Zeugen<br />
Jehovas) oder ‚rassische‘ (Juden, Sinti und Roma) Gründe konnten zu einer<br />
Inhaftierung führen“. 29<br />
Robert Ritter, führender NS-Rassentheoretiker, leitete die „Rassenhygienische<br />
und Bevölkerungsbiologische Forschungsstelle“ im Reichsgesundheitsamt,<br />
1941 übernahm er die „Kriminalbiologische Forschungsstelle“ und 1942 das „Kriminalbiologische<br />
Institut“ im Reichssicherheitshauptamt. Gemeinsam mit seiner<br />
Assistentin Eva Justin war er maßgeblich für die Erfassung und Klassifizierung<br />
von Roma und Sinti zuständig, die über deren Deportation, Zwangssterilisierung<br />
und Ermordung entschieden. Zudem beschäftigte er sich mit der Vorbereitung<br />
des „Gemeinschaftsfremdengesetzes“. In diesem Kontext begutachteten<br />
er und Justin Jugendliche in den Lagern Moringen und <strong>Uckermark</strong> und entschieden,<br />
ob diese „erziehbar“ oder „unerziehbar“ seien. Auf dieser Grundlage<br />
wurden sie nach einem von Ritter entworfenen System verschiedenen Blocks zugeteilt,<br />
die zugleich über ihre Überlebenschancen entschieden. 30 Dörthe Schulz<br />
und Roman Klarfeld setzen sich in ihrem Beitrag mit der Debatte um Täter_innenschaft<br />
auseinander und arbeiten unter anderem die Biographien von<br />
27 Auch nach 1945 verfügte die ehemalige Häftlingsgruppe der ‚Asozialen‘ über keinerlei Lobby,<br />
was die Auseinandersetzungen um Entschädigung weiter erschwerte und ebenso dazu<br />
beitrug, dass ihre Leidensgeschichten bei der Aufarbeitung des Nationalsozialismus kaum<br />
Berücksichtigung fanden.<br />
28 Fritz, Die „Jugendschutzlager“, S. 311.<br />
29 Ebd., S. 311 f.<br />
30 Vgl. Fritz, Die „Jugendschutzlager“, S. 323 ff.
(<strong>Geschlechter</strong>-)<strong>Perspektiven</strong> für einen Gedenkort 25<br />
Robert Ritter und Eva Justin auf, die im ‚Jugendschutzlager‘ <strong>Uckermark</strong> ihre<br />
Forschung zu angeblicher Vererbung von kriminellen Handlungen betrieben.<br />
Bei den als ‚asozial‘ in Konzentrationslager Eingewiesenen unterschieden<br />
sich die Zuschreibungen für Mädchen bzw. Frauen von denen für Jungen bzw.<br />
Männer: Bei weiblichen gab es, anders als bei männlichen, den Haftgrund der<br />
„sexuellen Verwahrlosung“. Darunter wurden zum Beispiel Mädchen und Frauen<br />
mit Geschlechtskrankheiten gefasst. 31 Viele wurden wegen sogenannter Rassenschande,<br />
etwa Liebesverhältnissen mit „Fremdarbeitern“, inhaftiert. 32 Häufig<br />
wechselnder Geschlechtsverkehr, Prostitution und Geschlechtskrankheiten galten<br />
als Indiz für einen „liderlichen Lebenswandel“, „moralischen Schwachsinn“<br />
oder „sexuelle Verwahrlosung“. 33 „Nicht das einzelne Delikt oder der konkrete<br />
Tatvorwurf waren für das Urteil ‚asozial‘ ausschlaggebend, sondern die zum<br />
Charakter oder zur Anlage erklärten sozialen Normabweichungen der einzelnen<br />
Frau. Die einmal zum Sozialcharakter und zur erblichen Anlage erklärten Verfehlungen<br />
konnten deshalb auch nicht widerlegt werden.“ 34 Diesbezüglich äußerte<br />
sich auch die Leiterin des Lagers <strong>Uckermark</strong>, Lotte Toberentz: „Der Typ<br />
des kriminellen und asozialen Mädchens ist einheitlicher geprägt [im Vergleich<br />
zu männlichen Jugendlichen]. Ursache und Art des Entgleitens sind immer wieder<br />
entscheidend bedingt durch Triebhaftigkeit, die in Verbindung mit Hemmungslosigkeit<br />
und Minderbegabung zur sexuellen Verwahrlosung führt.“ 35<br />
Die Literatur, die den Zusammenhang zwischen der Kategorie ‚asozial‘ und<br />
Weiblichkeit herstellt, erweckt jedoch den Eindruck, dass alle Mädchen und<br />
Frauen, die nicht dem nationalsozialistischen Weiblichkeitsideal entsprachen,<br />
den Bestand der Volksgemeinschaft gefährdeten und daher ausgegrenzt und<br />
verfolgt wurden. Doch genau diese Verengung auf die Kategorie Geschlecht<br />
birgt die Gefahr, andere Aspekte zu überblenden und damit unsichtbar zu<br />
machen. Bei der Kategorie ‚asozial‘ spielen hinsichtlich der Interpretation sozialen<br />
Verhaltens auch „Rassen“- und Klassenkonstruktionen eine wesentliche<br />
Rolle, ebenso Vorstellungen und Ideale von Leistungsfähigkeit. Wenngleich Ge-<br />
31 Vgl. ebd., S. 313.<br />
32 Carola Kuhlmann, Heimerziehung, S. 7<strong>–</strong>20, hier S. 14.<br />
33 Netzwerk Initiative Gedenkort ehemaliges KZ <strong>Uckermark</strong>, Das Konzentrationslager für<br />
Mädchen und junge Frauen <strong>Uckermark</strong>, in: telegraph (Berlin 2008) 116/117, S. 64<strong>–</strong>67, hier<br />
S. 64.<br />
34 Schikorra, Kontinuitäten, S. 58 f.<br />
35 Lotte Toberentz zitiert nach Christa Schikorra, Die Landesanstalt Görden und das „Jugendschutzlager“<br />
<strong>Uckermark</strong>. Die Bedeutung von Rassenhygiene für die Inhaftierung weiblicher<br />
Jugendlicher, in: Limbächer/Merten/Pfefferle, Mädchenkonzentrationslager, S. 63<strong>–</strong>78, hier<br />
S. 71; vgl. Fritz, Die „Jugendschutzlager“, S. 313.
26 Anders/Dietrich/Gabriel/Hille/Klarfeld/Nachtigall/Nowak<br />
schlecht in der Auslegung von ‚Asozialität‘ wirksam wird, ist dies nicht der<br />
einzige Aspekt der Definition und Verfolgung. Mädchen und Frauen wurden<br />
nicht nur sexualisierte und vergeschlechtlichte Attribute zugewiesen, sie wurden<br />
auch als ungebildet, faul, ungezogen und kriminell bezeichnet, was auf eine<br />
ökonomische Deklassierung verweist. Zudem muss in der Erforschung der Alltagsgeschichte<br />
stärker zwischen einem propagierten Weiblichkeitsbild, und der<br />
gesellschaftlich lebbaren Praxis unterschieden werden, die durchaus divergentere<br />
<strong>Geschlechter</strong>entwürfe tolerierte. 36<br />
Die Konstruktion von ‚Asozialität‘ kann demnach als ein Teil der nationalsozialistischen<br />
(vergeschlechtlichten) „Rassen“-Politik verstanden werden, die<br />
den „arischen“ Volkskörper definiert und aufwertet und „Minderwertige“ nach<br />
rassenhygienischen Vorstellungen ausschließt. An Fürsorgezöglingen in Heimen<br />
und in Arbeitshäusern sowie an als ‚asozial‘ stigmatisierten KZ-Häftlingen wurden<br />
Zwangssterilisationen vorgenommen, was vor allem Mädchen und Frauen<br />
der Sinti und Roma betraf, zudem nahmen KZ-Ärzte und Ärztinnen medizinische<br />
Versuche an ‚Asozialen‘ mit Geschlechtskrankheiten vor. 37 Insofern waren<br />
nicht nur die Einweisungsgründe vergeschlechtlicht, sondern auch die Haftbedingungen<br />
im Konzentrationslager. Christa Schikorra arbeitet zudem aus Aktenbeständen<br />
der Kriminalpolizei heraus, dass die Mehrzahl der in polizeiliche<br />
Vorbeugehaft genommenen Frauen, die keine Prostituierten waren, aus dem<br />
proletarischen Milieu kam. 38 Insofern beinhaltete die Kategorie ‚asozial‘ sowohl<br />
vergeschlechtlichte, „rassische“ und klassenspezifische Konstruktionen. Als Begründung<br />
der Verwahrlosung bei männlichen Jugendlichen wurden hingegen<br />
vor allem rechtliche Tatbestände und Vorstrafen angeführt, das heißt, Jungen<br />
wurden im ehemaligen ‚Jugendschutzlager‘ Moringen vor allem als „kriminell“<br />
inhaftiert. 39 Eine detailliertere Analyse, welche Männlichkeitskonstruktionen<br />
sich bei den als ‚asozial‘ diskriminierten und verfolgten Jungen fanden, steht<br />
jedoch noch aus.<br />
In den Konzentrationslagern waren ‚Asoziale‘ Stereotypisierungen von Seiten<br />
anderer Häftlinge und Häftlingsgruppen ausgesetzt; Insa Eschebach zeigt<br />
dies in ihrem Artikel am Beispiel des KZ Ravensbrück. Die Stigmatisierung von<br />
Menschen als ‚asozial‘ geht jedoch weit über die NS-Zeit hinaus. Nach Kriegsende<br />
blieb die abwertende Stereotypisierung der ehemals als ‚asozial‘ Verfolgten<br />
36 Vgl. Dagmar Herzog, Die Politisierung der Lust: Sexualität in der deutschen Geschichte<br />
des 20. Jahrhunderts, München 2005.<br />
37 Vgl. Schikorra, Kontinuitäten, S. 170 ff.<br />
38 Vgl. ebd., S. 105 ff.<br />
39 Vgl. Fritz, Die „Jugendschutzlager“, S. 313.
(<strong>Geschlechter</strong>-)<strong>Perspektiven</strong> für einen Gedenkort 27<br />
bzw. der als solche Definierten bestehen. Viele der ehemals Inhaftierten erlebten<br />
fortgesetzte Internierung und Entmündigung in Heimen der BRD und<br />
der DDR. Ihre Geschichten blieben weitestgehend unbekannt und tabuisiert,<br />
sodass von einer „vergessenen Opfergruppe“ gesprochen werden kann. 40 Lisa<br />
Gabriel greift in ihrem Beitrag die Traumatisierung der ehemaligen weiblichen<br />
‚asozialen‘ Häftlinge und deren anhaltende Diskriminierung in der deutschen<br />
Nachkriegsgesellschaft auf und untersucht die Schwierigkeit des Sprechens angesichts<br />
ihrer tabuisierten Geschichten. Bis in die 1980er-Jahre erhielt diese<br />
Verfolgtengruppe nahezu keinerlei Entschädigung <strong>–</strong> ebenso wie ihre Geschichten<br />
lange kein Gehör fanden. 41<br />
<strong>Uckermark</strong> als (Gedenk-)Ort<br />
Die Unsichtbarkeit dieser Opfergruppe schlägt sich auch im institutionalisierten<br />
Gedenken bzw. in Gedenkstätten nieder, so dass die Geschichte der als<br />
‚asozial‘ verfolgten Mädchen und jungen Frauen sowie überhaupt die Existenz<br />
der nationalsozialistischen ‚Jugendschutzlager‘ bis heute wenig bekannt sind.<br />
„<strong>Uckermark</strong>“ steht heute vielmehr für eine idyllische Region in Brandenburg,<br />
in der Naherholung, Naturerlebnis und Fahrradfahren großgeschrieben werden.<br />
Dass einer der beliebten Rad- und Wanderwege unmittelbar an der ehemaligen<br />
Lagergrenze vorbeiführt, ist kaum bekannt. Außer den in Eigeninitiative angebrachten<br />
provisorischen Aufschriften und Schildern sowie einem Infokasten am<br />
Wegesrand weist bis heute nichts auf die Bedeutung und frühere Funktion des<br />
Geländes hin, das so als historischer Ort unerkannt bleibt.<br />
Während ein kleiner Teil des ehemaligen Konzentrationslagers Ravensbrück<br />
1959 als Mahn- und Gedenkstätte gestaltet wurde, ist das Gelände des ehemaligen<br />
Jugendkonzentrationslagers <strong>Uckermark</strong> an die sowjetische Armee übergeben<br />
worden. Wann genau die militärische Nutzung und Bebauung begann,<br />
lässt sich nicht mehr feststellen, da es keine entsprechenden Aufzeichnungen<br />
gibt. Fest steht jedoch, dass das Gelände bis 1959 noch keine militärische Verwendung<br />
fand <strong>–</strong> während das Gebiet des ehemaligen KZ Ravensbrück zu diesem<br />
Zeitpunkt bereits von der Sowjetarmee genutzt wurde. 42<br />
40 Zur Kontinuität der Ausgrenzung und Diskriminierung vgl. Schikorra, Kontinuitäten, S.<br />
212 ff. und 237 ff.<br />
41 Vgl. Paul, Weichenstellungen.<br />
42 Vgl. Sigrid Jacobeit, Zur Geschichte des Jugend-Konzentrationslagers <strong>Uckermark</strong> im Gesamtkonzept<br />
der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück/Stiftung Brandenburgische Ge-
28 Anders/Dietrich/Gabriel/Hille/Klarfeld/Nachtigall/Nowak<br />
Die Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück bemühte sich seit den 1960er-<br />
Jahren immer wieder vergeblich um eine Erforschung und später auch um eine<br />
Nutzung und Gestaltung des benachbarten Geländes <strong>Uckermark</strong> (vgl. zum<br />
Umgang mit dem Gelände nach 1945 und zu den verschiedenen künstlerischen<br />
Entwürfen zur Gestaltung des Areals den Beitrag von Insa Eschebach in diesem<br />
Band). 43 Trotz dieses Engagements geriet der historische Ort <strong>Uckermark</strong><br />
jedoch weitestgehend in Vergessenheit, das Gelände blieb sich selbst überlassen.<br />
Erst nach der deutschen „Wiedervereinigung“ kam wieder Bewegung in die<br />
Debatte. Nach einer Begehung des Geländes am 19. September 1991 verfasste<br />
das Internationale Ravensbrück-Komitee ein Thesenpapier, in dem die Wichtigkeit<br />
des Geländes des Jugendkonzentrationslagers für die Neukonzeption der<br />
Gedenkstätte Ravensbrück betont wurde. 44 Seit 1992 zeigte die Mahn- und Gedenkstätte<br />
Ravensbrück die von Martin Guse und Andreas Kohrs konzipierte<br />
Wanderausstellung „Wir hatten noch gar nicht angefangen zu leben“. 45 Diese<br />
Ausstellung thematisierte anhand der Beispiele Moringen und <strong>Uckermark</strong> die<br />
Jugendkonzentrationslager erstmals explizit. 46<br />
Die Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück schrieb im Herbst 1997 gemeinsam<br />
mit der Stadt Fürstenberg einen internationalen landschaftsplanerischen<br />
Ideenwettbewerb zur Gestaltung des ehemaligen Lagergeländes <strong>Uckermark</strong> aus.<br />
Der erste Preis ging an einen Entwurf, der ein blaues Blumenfeld vorsah. 47 Dafür<br />
sollten die Bauten des sowjetischen Militärs abgetragen werden, da sie für<br />
das Gedenken und die historische Forschungsarbeit als unnötig erachtet wurden.<br />
Andere Überbauungen und bauliche Veränderungen aus der Zeit nach<br />
1945 sollten jedoch erhalten bleiben, um die Relikte aus den unterschiedlichen<br />
Zeiten sichtbar zu machen. 48 Der Entwurf wurde nicht umgesetzt, da historidenkstätten,<br />
in: Limbächer/Merten/Pfefferle, Mädchenkonzentrationslager, S. 232<strong>–</strong>239,<br />
hier S. 233.<br />
43 Vor allem Martha Engel, die damalige Direktorin der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück,<br />
setzte sich dafür ein, dass die Denkmalbehörde das von Unrat übersäte Gelände<br />
räumt und eine historische Forschung ermöglicht. Vgl. Jacobeit, Zur Geschichte des Jugend-<br />
Konzentrationslagers <strong>Uckermark</strong>, S. 233 f.<br />
44 Vgl. Jacobeit, Zur Geschichte des Jugend-Konzentrationslagers <strong>Uckermark</strong>, S. 234.<br />
45 Vgl. Matthias Antkowiak/Angelika Meyer, Der wiederentdeckte Ort <strong>–</strong> archäologische Ausgrabungen<br />
in <strong>Uckermark</strong>, in: Limbächer/Merten/Pfefferle, Mädchenkonzentrationslager, S.<br />
219<strong>–</strong>231, hier S. 225 f.<br />
46 Vgl. http://www.martinguse.de/wander/index.htm (aufgerufen am 20.06.2012).<br />
47 Vgl. Stefanie Oswalt/Philipp Oswalt, Entwurf zur Gestaltung der erweiterten Gedenkstätte<br />
Ravensbrück, in: Limbächer/Merten/Pfefferle (Hg.), Mädchenkonzentrationslager,<br />
S. 240<strong>–</strong>252, hier S. 240.<br />
48 Vgl. ebd., S. 243 f.
(<strong>Geschlechter</strong>-)<strong>Perspektiven</strong> für einen Gedenkort 29<br />
sche und archäologische Vorarbeiten notwendig gewesen wären und niemand<br />
die finanzielle Verantwortung übernahm. 49 Zudem äußerte u. a. die Lagergemeinschaft,<br />
die nicht in die Ausschreibung und Konzeption des Wettbewerbs<br />
einbezogen worden war, Kritik an der Herangehensweise und plädierte dafür,<br />
die historische Forschung an den Anfang zu stellen. So umfasst das Gebiet,<br />
für das der Wettbewerb ausgeschrieben war, nicht einmal das ganze Gelände<br />
des ehemaligen Jugendkonzentrationslagers. 50 In diesem Zusammenhang problematisierte<br />
die Lagergemeinschaft die Symbolik des Blumenbeetes, da diese<br />
Form des Gedenkens eine weitere Überdeckung der Geschichte darstelle, und<br />
forderte stattdessen die Erforschung, Freilegung und Erhaltung der noch vorhandenen<br />
Spuren. 51<br />
Seit 1997 finden regelmäßig Workcamps bzw. Baucamps statt, deren Ziel<br />
es ist, die Geschichte des Jugendkonzentrationslagers aufzuarbeiten und den<br />
historischen Ort wieder sichtbar zu machen, wobei die Herangehensweisen im<br />
Einzelnen so verschieden wie die Initiator_innen sind. 52 Da es zunächst keine<br />
genauen Kenntnisse über Lage und Größe des ehemaligen ‚Jugendschutzlagers‘<br />
und späteren Tötungslagers gab, war es für die teils internationalen Workcamps<br />
zuallererst wichtig, den Ort zu erkunden und „wiederzuentdecken“. 53 Das erste<br />
FrauenLesben-Baucamp wurde 1997 von Frauen aus der Lagergemeinschaft<br />
Ravensbrück initiiert und organisiert. Während dieses ersten Camps wurde<br />
mithilfe eines Archäologen auf dem Gelände gearbeitet. Bereits freigelegte Barackenfundamente<br />
wurden dokumentiert, ein weiteres konnte freigelegt werden.<br />
Die Funde mussten jedoch am Ende wieder zugeschüttet werden, da kein<br />
Geld für eine fachgerechte Erhaltung vorhanden war. Um die Öffentlichkeit<br />
zu informieren, stellten die Teilnehmenden Tafeln mit Hintergrundinformationen<br />
und Plänen, die das Gelände erläutern, in dessen unmittelbarer Nähe auf.<br />
Seit 2002 finden die FrauenLesben-Baucamps bzw. FrauenLesbenTransgender-<br />
Baucamps, wie sie seit 2003 heißen, regelmäßig einmal im Jahr statt. Sie haben<br />
sich die Gestaltung des Geländes durch Beschilderungen, Rundgänge, Bereitstellung<br />
von Informationsmaterial etc. sowie deren Instandhaltung zur Aufgabe<br />
49 Vgl. ebd., S. 249 f.<br />
50 Vgl. Rosel Vadehra-Jonas, Das Jugendschutzlager heute aus der Sicht der Lagergemeinschaft<br />
Ravensbrück/Freundeskreis, in: Limbächer/Merten/Pfefferle, Mädchenkonzentrationslager,<br />
S. 253<strong>–</strong>266, hier S. 262.<br />
51 Vgl. Bixi Erhardt/Viola Klarenbach, Für eine lebendige Gedenkstätte am authentischen<br />
Ort: Wie geht es weiter mit dem <strong>Uckermark</strong>-Gelände?, in: Limbächer/Merten/Pfefferle,<br />
Mädchenkonzentrationslager, S. 267<strong>–</strong>280, hier S. 276.<br />
52 Vgl. Antkowiak/Meyer, Der wiederentdeckte Ort, S. 219.<br />
53 Vgl. ebd., S. 226.
30 Anders/Dietrich/Gabriel/Hille/Klarfeld/Nachtigall/Nowak<br />
gemacht (zur Geschichte und politischen Ausrichtung der Baucamps vgl. ausführlich<br />
die Beiträge von Degen/Krieg sowie Büren/Laumann/Reitnauer/Voß<br />
in diesem Band). Auf Initiative des Netzwerks wurde außerdem der bereits<br />
genannte Gedenkstein errichtet.<br />
Formen und Politiken des Gedenkens<br />
Spätestens als das ehemalige Lagergelände in den 1990er Jahren wieder zugänglich<br />
wurde, stellte sich die Frage nach Form und Inhalt des Gedenkens an<br />
die im Lager <strong>Uckermark</strong> inhaftierten Mädchen und Frauen sowie der konkreten<br />
Gestaltung des (Gedenk-)Ortes. Die Engagierten und Interessierten nähern<br />
sich dem Themenkomplex dabei aus sehr verschiedenen <strong>Perspektiven</strong> und Hintergründen,<br />
wie auch die Aufsätze dieses Bandes zeigen. Die Folge sind kontrovers<br />
geführte Debatten darüber, in welcher Form der Opfer vor Ort gedacht<br />
werden kann und soll: Wer gedenkt wie, wem und wo? Wie politisch, wie wissenschaftlich,<br />
wie parteilich bzw. wie (gesellschafts)kritisch muss oder darf die<br />
Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus sein? Angesichts der anstehenden<br />
Konversion des Geländes und der damit näher rückenden Möglichkeit<br />
einer konkreten Gestaltung des Geländes bekommen diese seit Jahren geführten<br />
Debatten nun aber besondere Relevanz und Aktualität. Zugleich sind sie<br />
nicht spezifisch für das Gedenken im Kontext des ehemaligen ‚Jugendschutzlagers‘<br />
bzw. Jugend-KZ <strong>Uckermark</strong>, sondern berühren generell erinnerungspolitische<br />
Aspekte.<br />
Diese Fragen verweisen dabei nicht zuletzt auf die verschiedenen individuellen,<br />
wissenschaftlichen und politischen Hinter- und Beweggründe der Engagierten,<br />
Forschenden und Autor_innen, die Geschichte des Jugendkonzentrationslagers<br />
aufzuarbeiten und wachzuhalten. So ist die Solidarität mit den Opfern,<br />
die Thematisierung ihrer Leidensgeschichte, die Benennung der Täter_innen<br />
ebenso wie der gesellschaftlichen bzw. institutionellen Ursachen, genauso wie<br />
die Kritik an gegenwärtiger Sozialpolitik oder erinnerungspolitischen Diskursen<br />
wichtiger Bestandteil eines gesellschaftskritischen Politikverständnisses, das<br />
jedoch in wissenschaftlichen oder staatlichen Institutionen meist wesentlich seltener<br />
(explizit) zu finden ist als in autonom organisierten Zusammenhängen. 54<br />
So zeigt z. B. die Beschäftigung mit der Kategorie ‚asozial‘, dass die Geschichte<br />
54 Ein Beispiel für die Verknüpfung von NS-Geschichte mit aktuellen Formen sozialer Ausgrenzung<br />
ist der Sammelband „ausgesteuert, ausgegrenzt . . . angeblich asozial“, der die<br />
historische Forschung zum Komplex der „Asozialität“ mit einer politischen Gesellschafts-
(<strong>Geschlechter</strong>-)<strong>Perspektiven</strong> für einen Gedenkort 31<br />
des Nationalsozialismus sich durchaus für eine Thematisierung von Kontinuitäten<br />
in der Sozialpolitik von BRD und DDR bis heute eignet, wobei zugleich<br />
<strong>–</strong> angesichts der Gefahr unpassender und verharmlosender Analogiebildungen<br />
<strong>–</strong> aber auch Brüche sichtbar gemacht werden müssen. Teil der Auseinandersetzung<br />
und zugleich Ausdruck der konfligierenden Herangehensweisen und Motivationen<br />
der Beteiligten ist auch eine ungleiche Einbeziehung und Bewertung<br />
der Frage nach dem angemessenen Grad der Empathie bzw. „Identifikation“<br />
mit den Opfern. Ein weiterhin offener Diskussionspunkt ist, inwiefern die in<br />
<strong>Uckermark</strong> inhaftierten Mädchen ein Subjekt feministischer Geschichtspolitik<br />
sind oder sein sollten und inwieweit es dabei zu Formen der Aneignung oder gar<br />
Instrumentalisierung kommt (vgl. dazu den Beitrag von Corinna Tomberger in<br />
diesem Band).<br />
Die Diskussionen um die<br />
Formen des Gedenkens beziehen<br />
sich aber auch auf den<br />
konkreten Ort: Wie soll das<br />
ehemalige Lagergelände gestaltet<br />
werden und wer darf<br />
dies?<br />
Dabei steht die bereits<br />
sichtbare Gestaltung des<br />
Ortes durch die autonomen<br />
FrauenLesbenTransgender-<br />
Bau- und Begegnungscamps<br />
neben Positionen der Mahnund<br />
Gedenkstätte Ravensbrück,<br />
die die Erinnerung an<br />
das ehemalige ‚Jugendschutzlager‘<br />
zunehmend in ihre Ausstellungen und das Besucherleitsystem integriert.<br />
Überlebende fordern eine Übernahme des ehemaligen Lagergeländes durch die<br />
Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück, die zurzeit jedoch nicht geplant ist.<br />
Daneben stehen Vorschläge von Künstler_innen zum gestalterischen Umgang<br />
mit dem Gelände (vgl. z. B. den Beitrag von Dominique Hurth in diesem<br />
Band), die nicht immer mit den Wünschen von Überlebenden und den engakritik<br />
und praktischen Forderungen in der Gegenwart verbindet; vgl. Anne Allex/Dietrich<br />
Kalkan (Hg.), ausgesteuert, ausgegrenzt . . . angeblich asozial, Neu-Ulm 2009.
32 Anders/Dietrich/Gabriel/Hille/Klarfeld/Nachtigall/Nowak<br />
gierten Gruppen übereinstimmen. 55 Der vom Netzwerk „Initiative für einen<br />
Gedenkort ehemaliges KZ <strong>Uckermark</strong> e. V.“ gegebene Anstoß zur Errichtung<br />
des Gedenksteins vor Ort reaktiviert Hurth zufolge mit der Form des klassischen<br />
Gedenksteins sowie der Wortwahl der Inschrift eher eine konservative<br />
Gedenkpolitik, als dass sie die gängigen künstlerischen Auseinandersetzungen<br />
aufgreift. Hier werden erneut die unterschiedlichen Herangehensweisen und<br />
Prioritätensetzungen deutlich: Während das <strong>Uckermark</strong>-Netzwerk mit dem<br />
Gedenkstein Wünsche von Überlebenden möglichst schnell realisieren wollte,<br />
um noch zu ihren Lebzeiten einen Ort des Gedenkens und des Trauerns zu<br />
schaffen, steht dies den institutionalisierten und bürokratischen Abläufen in<br />
einer Gedenkstätte wie auch den gegenwärtigen künstlerischen und didaktischen<br />
„Standards“ und Vorgaben eines gängigen Ausschreibungsverfahrens<br />
entgegen. Zunehmend werden auch wieder archäologische Überlegungen in die<br />
Diskussion um das Gelände einbezogen und neue Grabungen veranlasst. 56<br />
Die Debatten entzünden sich zudem an der Frage, wie (staatlich) institutionalisiert<br />
bzw. autonom und wie politisch, gesellschaftskritisch und parteilich<br />
Gedenken sein kann und sollte. Ihrem Selbstverständnis entsprechend<br />
wollen die Bau- und Begegnungscamps vor Ort eine Form des antifaschistischen<br />
feministischen Gedenkens etablieren, das sie als „offen“ definieren (vgl.<br />
Büren/Laumann/Reitnauer/Voß in diesem Band). Sie grenzen sich damit von<br />
einem „staatlichen“ Gedenken ab, das sie in den Gedenkstätten verwirklicht<br />
sehen, in denen das historische Geschehen musealisiert werde und das die Auseinandersetzung<br />
mit der Geschichte des Nationalsozialismus für die Bildung<br />
einer nationalen Identität im vereinten Deutschland instrumentalisiere (vgl.<br />
Degen/Krieg in diesem Band).<br />
55 Für einen früheren Vorschlag zur künstlerischen Gestaltung vgl. Oswalt/Oswalt, Entwurf<br />
zur Gestaltung der erweiterten Gedenkstätte Ravensbrück.<br />
56 Im Jahr 2009 führte die Archäologin Dorte Andersen Sondierungsgrabungen durch.
(<strong>Geschlechter</strong>-)<strong>Perspektiven</strong> für einen Gedenkort 33<br />
Auf dem <strong>Uckermark</strong>-Forum 2008, bei dem ein Austausch über die entstandenen<br />
Gedenkformen stattfand, wurde nicht nur hinterfragt, wie offen „offenes<br />
Gedenken“ sein kann, sondern auch, inwiefern eine Trennung zwischen diesem<br />
und „staatlichem“ Gedenken überhaupt sinnvoll oder angebracht ist. Eine zentrale<br />
Frage war und ist, inwieweit von staatlich finanziertem und damit reglementiertem<br />
Gedenken gesprochen werden kann oder muss und wie sich dies an<br />
Orten und in Formen des Gedenkens äußert. Welche Beziehung gehen Politik<br />
und Gedenken jeweils ein? Die Diskussion um den vom <strong>Uckermark</strong>-Netzwerk geforderten<br />
„antifaschistischen“ Zugang bzw. die staats- und herrschaftskritische<br />
Zielsetzung des Gedenkens, wie sie beim <strong>Uckermark</strong>-Forum 2009 geführt wurde,<br />
knüpft an diese Fragen an. Ob Gedenkstätten damit automatisch ‚staatstragend‘<br />
und durch ihre Musealisierung ‚statisch‘ sind, lässt sich jedoch angesichts<br />
des politischen Selbstverständnisses der Mitarbeiter_innen, der internen politischen<br />
und wissenschaftlichen Debatten um erinnerungspolitische Themen<br />
und die Ausgestaltung des Gedenkens, sowie den sich wandelnden Ausstellungskulturen,<br />
Führungskonzepten und pädagogischen Materialien gerade in<br />
Ravensbrück nicht eindeutig beantworten und bleibt ambivalent.
34 Anders/Dietrich/Gabriel/Hille/Klarfeld/Nachtigall/Nowak<br />
Die einzelnen Gedenkinitiativen haben jedoch einen unterschiedlichen Zugang<br />
zu Ressourcen und finden damit auch ungleiche Bedingungen zur Realisierung<br />
ihrer Anliegen vor. Dies wurde während des <strong>Uckermark</strong>-Forums 2008<br />
unter anderem im Hinblick auf die Beschilderung des ehemaligen Lagergeländes<br />
diskutiert. Wird einem institutionell eingebetteten Besucherleitsystem der<br />
Gedenkstätte mehr Autorität zugesprochen als den mit einfachen Mitteln von<br />
Baucamps hergestellten Informationstafeln? Die Beseitigung von Vandalismusschäden<br />
auf dem Gelände fällt einer auf Spenden angewiesenen Initiative finanziell<br />
und organisatorisch schwerer als einer staatlich abgesicherten Gedenkstätte.<br />
Letztere erfährt in der Öffentlichkeit womöglich mehr Anerkennung<br />
und wird in historischen und pädagogischen Fragen eher zurate gezogen als<br />
dezentral vernetzte Engagierte. Andererseits ist eine Initiative unabhängiger<br />
und kann schneller und unbürokratischer entscheiden und Projekte realisieren,<br />
wie beispielsweise die schnelle Errichtung des Gedenksteins auf dem Gelände<br />
des ehemaligen ‚Jugendschutzlagers‘ gezeigt hat. Nicht zuletzt stellt sich unabhängig<br />
von dem Aspekt des Macht- und Ressourcenzugangs die Frage, ob es<br />
nicht gerade wichtig ist, dass auch der deutsche Staat in Form von Gedenkstätten<br />
politische Verantwortung für die NS-Verbrechen übernimmt und so zu<br />
einer Anerkennung und Entschädigung der Opfer beiträgt. Eine Trennung zwischen<br />
„offenem“ und „staatlichem“ Gedenken, die Gedenkstätten pauschal auf<br />
Seiten nationalstaatlicher Identitätsbildung verortet, verkennt das politische<br />
Selbstverständnis bzw. das über berufliche Pflichterfüllung hinausgehende Engagement<br />
von vielen in Gedenkstätten Arbeitenden für gesellschaftskritische<br />
Gedenkformen. 57 Zudem blendet eine solche Polarisierung die wichtige Rolle<br />
der Überlebenden sowie unabhängiger Akteur_innen und deren pädagogische<br />
Arbeit aus. Trotzdem ist die von dem Konzept des „offenen“ Gedenkens angestoßene<br />
Überlegung wichtig, wie man sich angesichts des aktuellen deutschen<br />
Erinnerungsdiskurses politisch positionieren will, der mit Stolz auf die deutsche<br />
Aufarbeitung der NS-Vergangenheit verweist, sich als geläuterte Nation<br />
darstellt und darüber hinaus gegenwärtige politische Entscheidungen mit einem<br />
Verweis auf die Lehren aus der Vergangenheit legitimiert.<br />
57 Vgl. die Auseinandersetzung um Besucherführungen durch einen Bundeswehrangehörigen<br />
in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme im Jahr 2008. Das Beispiel eines pädagogischen Mitarbeiters<br />
der Gedenkstätte, der sich aus Protest gegen Führungen durch Bundeswehrangehörige<br />
weigerte, Führungen für diese Besuchergruppe durchzuführen, zeigt, dass sich auch<br />
Gedenkstättenmitarbeiter_innen politisch gegen Instrumentalisierungen von Geschichte<br />
positionieren. Seine anschließende Sperrung beim Museumsdienst beweist aber auch, dass<br />
diese innerhalb institutioneller Hierarchien nicht immer durchgesetzt werden können.
(<strong>Geschlechter</strong>-)<strong>Perspektiven</strong> für einen Gedenkort 35<br />
Geht es jedoch um die konkrete Gestaltung des ehemaligen Lagergeländes<br />
als Mahn- und Gedenkort, an dem auch historisches Wissen über das Mädchenkonzentrationslager<br />
vermittelt werden soll, erscheinen die Diskussionen um<br />
„Gedenkstolz“ und unzulässige historische Gleichstellungen zunächst weniger<br />
relevant. Wenn aber die Geschichte des Ortes nach 1945 in das Gedenken einbezogen<br />
werden soll, stellen sich die erinnerungspolitischen Fragen durchaus:<br />
Was ist an der aktuellen deutschen Gedenkpolitik problematisch? Wie kann<br />
eine Kritik an einer nationalistischen Vereinnahmung des Gedenkens am historischen<br />
Ort formuliert werden? Inwiefern sollte sie dort zum Beispiel in einer<br />
Ausstellung oder in der pädagogischen Arbeit angesprochen werden? Wie kann<br />
sie so thematisiert werden, dass das eigentliche Anliegen, an die Geschehnisse<br />
während des Nationalsozialismus zu erinnern, nicht dahinter zurücktritt oder<br />
für aktuelle politische Auseinandersetzungen instrumentalisiert wird? Wie kann<br />
also ein Gedenken aussehen, das Kritik an einem deutschen Selbstbild der moralisch<br />
geläuterten Nation integriert, ohne die Unterschiede zwischen historischem<br />
und gegenwärtigem Geschehen zu verwischen und die Geschichte wiederum zu<br />
instrumentalisieren?<br />
Neben den Formen des Gedenkens ist das Vokabular dessen, was beschrieben<br />
werden soll, selbst zu einem umkämpften Feld geworden. Die verschiedenen<br />
Benennungen und damit auch Deutungen und Bewertungen der Ereignisse auf<br />
dem <strong>Uckermark</strong>-Gelände machen zugleich unterschiedliche Prioritäten und <strong>Perspektiven</strong><br />
deutlich. Die Debatten entzünden sich dabei vor allem um die Frage,<br />
ob das Lager als „Jugend- bzw. Mädchenkonzentrationslager“ oder unter Verwendung<br />
des historischen Begriffs als ‚Jugendschutzlager‘ zu benennen sei. Sylvia<br />
Degen und Claudia Krieg führen in diesem Band aus, dass die Verwendung<br />
des Begriffs „Konzentrationslager“ für ein politisches Anliegen der Anerkennung<br />
und der Kritik an der Reproduktion nationalsozialistischer und euphemistischer<br />
Sprache stehe. Matthias Heyl argumentiert, ebenfalls im vorliegenden<br />
Band, dass ‚Jugendschutzlager‘ der historisch genaue Begriff sei. Wird dieser<br />
zudem in Anführungszeichen gesetzt, werde der euphemistische Charakter<br />
der nationalsozialistischen Sprache sichtbar gemacht und deren Dekonstruktion<br />
ermöglicht. Allerdings ist an der konkreten Ausführung an der Stele im Wegeleitsystem<br />
in Ravensbrück nicht nur das Wort ‚Jugendschutzlager‘, sondern<br />
die gesamte Bezeichnung ‚Jugendschutzlager <strong>Uckermark</strong>‘ in (doppelte) Anführungszeichen<br />
gesetzt. So verfehlen diese u.E. gerade ihren Zweck, weil sie nicht<br />
die verharmlosende Bezeichnung des Lagertyps ‚Jugendschutzlager‘ im Speziellen<br />
problematisieren, sondern lediglich den im Nationalsozialismus geprägten<br />
Eigennamen eines einzelnen Lagers in der <strong>Uckermark</strong> als Ganzes hervorheben.
36 Anders/Dietrich/Gabriel/Hille/Klarfeld/Nachtigall/Nowak
(<strong>Geschlechter</strong>-)<strong>Perspektiven</strong> für einen Gedenkort 37<br />
Wir gehen davon aus, dass letztlich der jeweilige Verwendungskontext die<br />
eine oder andere Bezeichnung plausibel werden lässt und somit die Frage nach<br />
der „korrekten“ Begriffswahl stets kontextabhängig ist und immer wieder aufs<br />
Neue entschieden werden muss. Das Plädoyer für die Benennung als „Konzentrationslager“<br />
stellt beispielsweise die politische und gesellschaftliche Anerkennung<br />
der dort Inhaftierten als Opfer des Nationalsozialismus in den Vordergrund und<br />
ist deswegen auch in Entschädigungsbelangen von großer Relevanz. Der Zusatz<br />
„für Mädchen und junge Frauen“ zielt darauf ab, Mädchen- und Frauengeschichte<br />
sichtbar zu machen. Der Begriff ‚Jugendschutzlager‘ macht es andererseits<br />
möglich, <strong>Uckermark</strong> in das System der Fürsorge- und Gesundheitspolitik des<br />
Nationalsozialismus einzuordnen und damit die Spezifik dieses Lagers innerhalb<br />
des KZ-Systems ebenso wie die verklärende Wortwahl kritisch hervorzuheben.<br />
Um eine angemessene Benennung der Geschehnisse nach der Auflösung des Jugendkonzentrationslagers,<br />
der Nutzung des Geländes zur gezielten Tötung von<br />
Häftlingen aus dem KZ Ravensbrück, wird ebenfalls gerungen. Hier kreist die<br />
Debatte vor allem um die Begriffe „Sterbe-“ versus „Vernichtungs-“ oder „Tötungslager“.<br />
Diese Debatte greift Verena Buser in ihrem Beitrag auf und nähert<br />
sich den Begriffen über die Kontextualisierung der Geschichte <strong>Uckermark</strong>s in<br />
die Endphase des Konzentrationslagersystems an.<br />
Die zahlreichen Konfliktlinien um das Gedenken in und an <strong>Uckermark</strong> lassen<br />
sich nicht ohne weiteres auflösen. Doch kann ein Nachdenken über die verschiedenen<br />
Formen des Gedenkens helfen, die eigene Herangehensweise kritisch zu<br />
reflektieren, und in Erinnerung zu rufen, an wen sich das Gedenken richtet und<br />
mit welcher Intention dieses erfolgen soll. Wer wird zu einer Auseinandersetzung<br />
mit der Geschichte und zu einem Gedenken an die Opfer eingeladen oder<br />
auch ausgeschlossen? Und welches Wissen (also welche Gegenstände, welche<br />
Personengruppen, welche Orte, welche Ereignisse etc.) werden jeweils in den<br />
Vordergrund gestellt und welche anderen Bestandteile des Wissens dadurch<br />
wiederum unsichtbar gemacht?<br />
Die Frage nach Art und Weise des Gedenkens schließt auch die Bedeutung<br />
des historischen Ortes selbst für die Gedenkpraxis ein. Zu überlegen wäre in diesem<br />
Zusammenhang nicht nur, wie dieser gestaltet werden kann, sondern auch,<br />
welchen Stellenwert der Ort des Geschehens für die Vermittlung der Geschichte<br />
hat. Welche Bedeutung kommt dem Gelände des ehemaligen ‚Jugendschutzlagers‘<br />
<strong>Uckermark</strong> als „authentischem“ Ort im Gedenken überhaupt zu <strong>–</strong> vor<br />
allem angesichts der Tatsache, dass hier kaum noch Spuren aus der Lagerzeit<br />
zu finden sind?
38 Anders/Dietrich/Gabriel/Hille/Klarfeld/Nachtigall/Nowak<br />
Einerseits kann der Ort heutigen Besucher_innen einen wichtigen Einblick<br />
in die Topografie der Verbrechen des Nationalsozialismus vermitteln. Mehr<br />
noch, und vielleicht sogar an erster Stelle, macht er doch sehr eindrücklich<br />
den Umgang mit diesem speziellen Lager(typus) nach 1945 und das Vergessen<br />
seiner spezifischen Geschichte und Opfer sichtbar.<br />
Um das Ausmaß der Verbrechen zu erfassen, kann jedoch andererseits auch<br />
eine Dezentralisierung des Gedenkens sinnvoll sein, die sich an den Biografien<br />
und Erlebnissen der in <strong>Uckermark</strong> inhaftierten Mädchen und Frauen orientiert.<br />
Dass Jugendfürsorgeeinrichtungen, Arbeitshäuser, Polizei und Behörden<br />
in die Verbrechen involviert waren, könnte eine Gedenkstätte in <strong>Uckermark</strong><br />
zwar thematisieren, ist an diesen Einrichtungen selbst meist jedoch weitgehend<br />
unsichtbar. Wünschenswert wäre eine Auseinandersetzung an den (ehemaligen)<br />
Standorten selbst, die eine Auseinandersetzung der heute dort Tätigen mit der<br />
Geschichte „ihrer“ Institution und deren Verstrickungen in die NS-Politik sowie<br />
die Übernahme von Verantwortung allgemein befördern könnte (siehe den<br />
Beitrag von Lena Nowak in diesem Band).<br />
Eine Dezentralisierung des Gedenkens bedeutet für uns auch, die Debatten<br />
um das ehemalige ‚Jugendschutzlager‘ <strong>Uckermark</strong> ernst zu nehmen, weiterzuführen<br />
und selbst als Teil des Gedenkens zu verstehen. In diesem Sinne begreifen<br />
wir diese Veröffentlichung als Teil des Gedenkens und als Ort, an dem dieses<br />
stattfindet.<br />
Die hier nur kursorisch angerissenen diversen Herangehensweisen und politischen<br />
Positionen rund um den Umgang mit dem ehemaligen Lager <strong>Uckermark</strong><br />
werden in den Aufsätzen dieses Buches weiter vertieft.<br />
Das Buch gliedert sich in drei Teile: Der erste und größte Abschnitt widmet<br />
sich den aktuellen Kontroversen um <strong>Uckermark</strong> als Gedenkort und lässt<br />
unterschiedliche Akteur_innen zu Wort kommen. Der zweite Teil enthält Beiträge,<br />
die sich mit einem gendertheoretischen und feministischen Zugang bzw.<br />
der Bedeutung und Konzeptualisierung von „Geschlecht“ im Kontext von Erinnerung<br />
und Gedächtnis am Beispiel des Lagers <strong>Uckermark</strong>, aber auch darüber<br />
hinaus, beschäftigen. Der dritte Abschnitt versammelt historische Beiträge zu<br />
Vordenker_innen und (Mit)täter_innen.