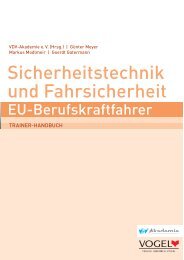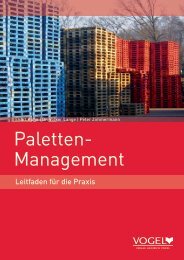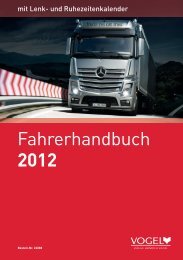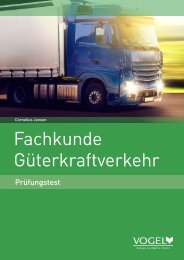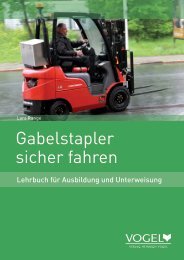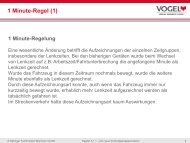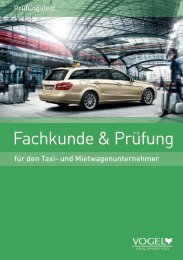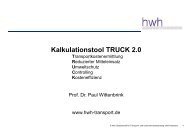Musterseiten als PDF - Verlag Heinrich Vogel
Musterseiten als PDF - Verlag Heinrich Vogel
Musterseiten als PDF - Verlag Heinrich Vogel
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Inhaltsverzeichnis<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
Die im Inhaltsverzeichnis angegebenen Zahlen 2/1 bedeuten, daß Sie den Text im Register 2<br />
auf Seite 1 finden.<br />
Stichwortverzeichnis<br />
Register 1 – Sicherheit bei der Beförderung gefährlicher Güter<br />
Allgemeine Grundsätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/1<br />
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/3<br />
Doppelte Sicherheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/4<br />
Kooperatives Verhalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/5<br />
Register 2 – Gefahrgutbeauftragtenrecht<br />
(Register 2a und 2b sind derzeit nicht besetzt)<br />
Gefahrgutbeauftragtenverordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2c/1<br />
§ 1 Bestellung von Gefahrgutbeauftragten . . . . . . . . . . . . . . . . . 2c/1<br />
§ 2 Anforderungen an Gefahrgutbeauftragte . . . . . . . . . . . . . . . . 2c/8<br />
§ 3 Schulungsanforderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2c/10<br />
§ 4 Dauer der Schulungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2c/10<br />
§ 5 Prüfungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2c/11<br />
§ 6 Sonstige Schulungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2c/12<br />
§ 7 Pflichten der Unternehmer oder Inhabervon Betrieben . . . . . . . . . . . 2c/13<br />
§ 8 Inkrafttreten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2c/17<br />
Ermittlung der Verantwortlichen und der zu überwachenden Personen im Unternehmen 2c/26<br />
Amtliche Begründung zur GbV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2d/1<br />
Hinweise zur Anwendung der GbV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2e/1<br />
Rahmenlehrplan Besondere Schulung der Gefahrgutbeauftragten . . . . . . . 2f/1<br />
Verordnung über die Prüfung von Gefahrgutbeauftragten . . . . . . . . . 2g/1<br />
Register 3 – Für alle Verkehrsträger relevante Regelwerke<br />
Überblick über internationale Regelwerke für den Gefahrguttransport . . . . . 3/1<br />
Gliederung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/1<br />
Das System der Vereinten Nationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/2<br />
Paneuropäische Gefahrgutvorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/4<br />
1. Straßenverkehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/4<br />
2. Eisenbahnverkehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/7<br />
3. Binnenschiffahrt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/8<br />
Seeverkehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/10<br />
Luftverkehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/11<br />
Die Rolle der Europäischen Kommission . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/12<br />
Schlussbemerkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/27<br />
Übersicht Gefahrgutvorschriften und Institutionen . . . . . . . . . . . . . . 3/28<br />
EL 24 Juni 2005 5
Inhaltsverzeichnis<br />
Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter . . . . . . . . . . . . . 3.1/1<br />
§ 1 Geltungsbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1/1<br />
§ 2 Begriffsbestimmungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1/2<br />
§ 3 Ermächtigungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1/3<br />
§ 4 Anhörung von Sachverständigen und der beteiligten Wirtschaft . . . . . . . 3.1/4<br />
§ 5 Zuständigkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1/4<br />
§ 6 Allgemeine Ausnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1/5<br />
§ 7 Sofortmaßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1/6<br />
§ 7b Beirat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1/7<br />
§ 8 Sicherungsmaßnahmen, Zurückweisen von Gefahrguttransporten . . . . . . 3.1/7<br />
§ 9 Überwachung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1/8<br />
§ 10 Ordnungswidrigkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1/11<br />
§ 11 Strafvorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1/12<br />
§ 12 Kosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1/12<br />
Register 4 – Sonstige Vorschriften und Gesetze<br />
Abfallrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1<br />
1. Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1/1<br />
2. Das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) . . . . . . . . . 4.1/2<br />
2.1 Der Abfallbegriff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1/2<br />
2.2 Verwertung und Beseitigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1/3<br />
2.3 Überlassungspflichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1/4<br />
2.4 Abfallwirtschaftskonzepte und Abfallbilanzen . . . . . . . . . . . . . . 4.1/4<br />
2.5 Produktverantwortung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1/4<br />
2.6 Überwachung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1/5<br />
2.7 Betriebsorganisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1/5<br />
3. Verordnungen zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz . . . . . . . . . 4.1/6<br />
3.1 Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis<br />
(Abfallverzeichnis – Verordnung – AVV) . . . . . . . . . . . . . . . 4.1/7<br />
3.2 Verordnung über die Nachweisführung bei der Entsorgung von Abfällen<br />
(Nachweisverordnung – NachwV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1/7<br />
3.2.1 Entsorgung von gefährlichen Abfällen . . . . . . . . . . . . . 4.1/8<br />
3.2.1.1 Vorabkontrolle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1/8<br />
3.2.1.2 Verbleibskontrolle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1/12<br />
3.2.2 Entsorgung von nicht gefährlichen Abfällen . . . . . . . . . . . 4.1/14<br />
3.2.3 Führen von Registern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1/14<br />
3.2.4 Elektronische Führung von Abfallnachweisen . . . . . . . . . . . 4.1/15<br />
6 EL 27 Januar 2007
Inhaltsverzeichnis<br />
3.3 Verordnung zur Transportgenehmigung<br />
(Transportgenehmigungsverordnung – TGV) . . . . . . . . . . . . . . 4.1/16<br />
3.4 Verordnung über Entsorgungsfachbetriebe . . . . . . . . . . . . . . . 4.1/16<br />
Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1/16<br />
Bundesimmissionsschutzgesetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2<br />
Zweck des Gesetzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2/1<br />
Begriffsbestimmungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2/1<br />
Genehmigungsbedürftige Anlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2/2<br />
Nicht genehmigungsbedürftige Anlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2/2<br />
TA-Luft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2/2<br />
Störfall-Verordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2/3<br />
Immissionsschutzbeauftragter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2/3<br />
Ordnungswidrigkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2/3<br />
Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2/4<br />
Wasserhaushaltsgesetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3<br />
Geltungsbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3/1<br />
Grundsatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3/1<br />
Gewässerbenutzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3/1<br />
Abwassereinleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3/1<br />
Wasserschutzgebiete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3/2<br />
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen . . . . . . . . . . . . 4.3/2<br />
Wassergefährdende Stoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3/4<br />
Fachbetriebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3/5<br />
Gewässerschutzbeauftragte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3/5<br />
Ordnungswidrigkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3/6<br />
Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3/6<br />
Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre<br />
Gefahr (Atomgesetz) sowie Verordnung über den Schutz vor Schäden durch<br />
ionisierende Strahlen (Strahlenschutzverordnung) . . . . . . . . . . . . . 4.4<br />
§ 1 Atomgesetz – Zweckbestimmung des Gesetzes . . . . . . . . . . . . . 4.4/1<br />
§ 4 Atomgesetz – Beförderung von Kernbrennstoffen . . . . . . . . . . . . 4.4/2<br />
§ 4b Atomgesetz – Beförderung von Kernmaterialien in besonderen Fällen . . . . . 4.4/3<br />
§ 8 Strahlenschutzverordnung – Beförderung radioaktiver Stoffe . . . . . . . . 4.4/4<br />
§ 9 Strahlenschutzverordnung – Genehmigungsfreie Beförderung . . . . . . . . 4.4/4<br />
§ 10 Strahlenschutzverordnung – Genehmigungsvoraussetzungen für die Beförderung . 4.4/5<br />
§ 38 Strahlenschutzverordnung – Vorbereitung der Schadensbekämpfung bei<br />
Unfällen und Störfällen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4/7<br />
§ 77 Strahlenschutzverordnung – Abgabe radioaktiver Stoffe . . . . . . . . . . 4.4/8<br />
§ 79 Strahlenschutzverordnung – Abhandenkommen radioaktiver Stoffe . . . . . . 4.4/8<br />
§ 23 Atomgesetz – Zuständigkeit des Bundesamtes für Strahlenschutz . . . . . . . 4.4/8<br />
EL 27 Januar 2007 7
Inhaltsverzeichnis<br />
Register 5 – Verantwortungsbereich und Haftung<br />
1. Straftaten gegen die Umwelt im Zusammenhang mit Gefahrguttransporten . . 5.1/1<br />
§ 328 StGB – Unerlaubter Umgang mit radioaktiven Stoffen und anderen Stoffen<br />
und Gütern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1/1<br />
§ 330 StGB – Besonders schwerer Fall einer Umweltstraftat . . . . . . . . . . 5.1/2<br />
§ 330d StGB – Begriffsbestimmungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1/2<br />
2. Strafverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1/4<br />
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2<br />
§ 1 OWiG – Begriffsbestimmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2/1<br />
§ 15 OWiG – Notwehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2/1<br />
§ 16 OWiG – Rechtfertigender Notstand . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2/1<br />
§ 228 BGB – Notstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2/2<br />
§ 229 BGB – Selbsthilfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2/2<br />
§ 858 BGB – Verbotene Eigenmacht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2/2<br />
§ 859 Abs. 1 und 2 BGB – Besitzwehr und Besitzkehr . . . . . . . . . . . . 5.2/2<br />
§ 904 BGB – Notstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2/2<br />
§ 12 OWiG – Verantwortlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2/3<br />
§ 11 OWiG – Irrtum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2/3<br />
§ 9 OWiG – Handeln für einen anderen . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2/5<br />
§ 65 OWiG – Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2/5<br />
§ 66 OWiG – Inhalt des Bußgeldbescheides . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2/6<br />
§ 67 OWiG – Form und Frist (des Einspruchs) . . . . . . . . . . . . . . . 5.2/7<br />
§ 68 OWiG – Zuständiges Gericht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2/7<br />
§ 79 OWiG – Rechtsbeschwerde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2/8<br />
§ 130 OWiG – Verletzung der Aufsichtspflichten in Betrieben und Unternehmen . . . 5.2/8<br />
3. Verkehrsträgerspezifische zivilrechtliche Haftung mit und ohne Verschulden . . . 5.3<br />
8 EL 24 Juni 2005
Inhaltsverzeichnis<br />
Register 6 – Gefahrgutbeförderung auf der Straße<br />
Aufbau und Anwendungsbereiche von GGVSE/ADR . . . . . . . . . . 6/1<br />
Die Anlagen A und B des ADR . . . . . . . . . . . . . . . . . 6/2<br />
Anwendung der Vorschriften – orientiert am Aufbau der Tabelle A . . . . . 6.1/1<br />
Erläuterung der Tabelle A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1/1<br />
Spalte (1) „UN-Nummer“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1/4<br />
Spalte (2) „Benennung und Beschreibung“ . . . . . . . . . . . . . 6.1/4<br />
Spalte (3a) „Klasse“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1/4<br />
Klassifizierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1/5<br />
Tabelle der überwiegenden Gefahr . . . . . . . . . . . . . 6.1/6<br />
Spalte (3b) „Klassifizierungscode“ . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1/7<br />
Verzeichnis der Sammeleintragungen . . . . . . . . . . . . 6.1/7<br />
Spalte (4) „Verpackungsgruppe“ . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1/9<br />
Spalte (5) „Gefahrzettel“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1/9<br />
Spalte (6) „Sondervorschriften“ . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1/10<br />
Spalte (7a) „Begrenzte Mengen“ . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1/10<br />
Tabelle LQ-Codes . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1/11<br />
Spalte (7b) „Freigestellte Mengen“ . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1/12<br />
Spalten (8), (9a) und (9b) „Verpackung“ . . . . . . . . . . . . . . 6.1/12<br />
Spalte (8) „Anweisungen“ . . . . . . . . . . . . . . . 6.1/12<br />
Systematik der Verpackungsanweisungen . . . . . . . 6.1/12<br />
allgemeine Verpackungsanweisungen P 001 bis P 099 . . . 6.1/13<br />
klassenspezifische Verpackungsanweisungen . . . . . . 6.1/13<br />
Besonderheit Klasse 7 . . . . . . . . . . . . . 6.1/14<br />
Beispiele für Verpackungsanweisungen . . . . . . . . 6.1/14<br />
klassenspezifische Anwendung IBC 620 (Klasse 6.2) . . . . 6.1/15<br />
Allgemeines zu Verpackungen . . . . . . . . . . 6.1/16<br />
Codierungssystem für Verpackungen . . . . . . . . 6.1/16<br />
Verpackungsarten . . . . . . . . . . . . . . 6.1/17<br />
weitere Verpackungscodierungen . . . . . . . . . 6.1/26<br />
Beispiel für die Auswahl einer Verpackung . . . . . . . 6.1/26<br />
Verpackung von Gasen . . . . . . . . . . . . 6.1/27<br />
Großpackmittel (IBC) . . . . . . . . . . . . . 6.1/27<br />
Großverpackungen . . . . . . . . . . . . . . 6.1/31<br />
Spalte (9a) „Sondervorschriften“ . . . . . . . . . . . . . 6.1/31<br />
Spalte (9b) „Zusammenpackung“ . . . . . . . . . . . . . 6.1/31<br />
Spalten (10) und (11) „ortsbewegliche Tanks und Schüttgutcontainer“ . . . . . . 6.1/32<br />
Anweisungen für ortsbewegliche Tanks . . . . . . . . . . . 6.1/33<br />
Spalten (12) und (13) „ADR-Tanks“ . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1/36<br />
Spalte (13) „Sondervorschriften“ . . . . . . . . . . . . . 6.1/39<br />
Spalte (14) „Fahrzeug für die Beförderung in Tanks“ . . . . . . . . . . . 6.1/40<br />
Tabelle technische Merkmale . . . . . . . . . . . . . . 6.1/41<br />
Tanks auf Fahrzeugen . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1/43<br />
EL 29 Dezember 2008 9
Inhaltsverzeichnis<br />
Spalte (15) „Beförderungskategorie/(Tunnelbeschränkungscode)“ . . . . . . . 6.1/45<br />
Beförderungskategorie . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1/45<br />
Mustervordruck zur Errechnung der Freigrenze nach 1.1.3.6.3 . . . . 6.1/47<br />
Tunnelbeschränkungscode . . . . . . . . . . . . . . . 6.1/47<br />
Spalten (16), (17), (18) und (19) „Sondervorschriften für die Beförderung“ . . . . 6.1/50<br />
Spalte (16) „Versandstücke“ . . . . . . . . . . . . . . 6.1/50<br />
belüftbare Aufbauten . . . . . . . . . . . . . 6.1/51<br />
kühlbare Aufbauten . . . . . . . . . . . . . 6.1/51<br />
Laderaumtemperierung . . . . . . . . . . . . 6.1/51<br />
Spalte (17) „lose Schüttung“ . . . . . . . . . . . . . . 6.1/52<br />
Spalte (18) „Be- und Entladung, Handhabung“ . . . . . . . . . 6.1/52<br />
Zusammenladung . . . . . . . . . . . . . . 6.1/53<br />
Vorsichtsmaßnahmen bei Nahrungs-, Genuss- und<br />
Futtermitteln . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1/54<br />
Begrenzungen . . . . . . . . . . . . . . . 6.1/54<br />
Handhabung und Verstauung . . . . . . . . . . . 6.1/55<br />
Reinigung nach dem Entladen . . . . . . . . . . 6.1/55<br />
Rauchverbot . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1/55<br />
Maßnahmen zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung . . 6.1/55<br />
Spalte (19) „Betrieb“ . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1/56<br />
Spalte (20) „Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr“ . . . . . . . . . . 6.1/56<br />
Begleitpapiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3/1<br />
Beförderungspapier für die Beförderung gefährlicher Güter und damit<br />
zusammenhängende Informationen . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3/1<br />
Allgemeine Angaben, die im Beförderungspapier enthalten sein müssen . . 6.3/1<br />
Form und Sprache . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3/4a<br />
Beispiele für ein Beförderungspapier (Lieferschein, CMR-Frachtbrief,<br />
IMO-Erklärung, Formular für die multimodale Beförderung gefährlicher<br />
Güter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3/4b<br />
Befreiung vom Beförderungspapier . . . . . . . . . . . . 6.3/8<br />
Verzicht auf Angaben im Beförderungspapier . . . . . . . . . 6.3/8<br />
Schriftliche Weisungen (Unfallmerkblätter) . . . . . . . . . . . . . 6.3/9<br />
Zulassungsbescheinigung für Fahrzeuge . . . . . . . . . . . . . . 6.3/14<br />
Fahrweg und <strong>Verlag</strong>erung (§ 7 GGVSE) . . . . . . . . . . . . . . 6.3/17<br />
Ausnahmegenehmigung nach § 5 GGVSE . . . . . . . . . . . . . . 6.3/23<br />
ADR-Bescheinigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3/25<br />
Beförderungsgenehmigung nach Atomgesetz . . . . . . . . . . . . . 6.3/28<br />
Gefahrzettel und Kennzeichnung . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4/1<br />
Bezettelung von Versandstücken . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4/1<br />
Gefahrzettelmuster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4/2<br />
Ausrichtungspfeile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4/6a<br />
Verpackungsspezifikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4/6b<br />
10 EL 27 Januar 2007
Inhaltsverzeichnis<br />
Kennzeichnung der Fahrzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4/7<br />
Orangefarbene Tafeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4/7<br />
Anbringung von orangefarbenen Tafeln . . . . . . . . . . . . . . . 6.4/9<br />
Bezettelung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4/11<br />
Verantwortlichkeiten bei Kennzeichnung und Bezettelung. . . . . . . . . . 6.4/12<br />
Zusammenpack- und Zusammenladeverbote . . . . . . . . . . . . 6.5<br />
Fahrzeugausrüstung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.6/1<br />
Checkliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.6/1<br />
Feuerlöscher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.6/3<br />
Pflichten und Verantwortlichkeiten in der Transportkette . . . . . . . . 6.7<br />
Ordnungswidrigkeiten und Bußgelder . . . . . . . . . . . . . . 6.8<br />
Sonstiges (Bekanntmachungen/Richtlinien,<br />
Gefahrgut-Ausnahmeverordnung) . . . . . . . . . . . . . . . . 6.9<br />
Register 7 – Gefahrgutbeförderung auf der Schiene<br />
1 Vorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1/1<br />
1.1 Gefahrgutbeförderungsgesetz . . . . . . . . . . . . . . . 7.1/1<br />
1.2 Gefahrgutverordnung Eisenbahn GGVE . . . . . . . . . . . 7.1/2<br />
1.3 Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahn (GGVSE) . . . . . . . 7.1/2<br />
1.4 RID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1/3<br />
1.5 Ergänzende Regelungen für bestimmte Verkehre . . . . . . . . . 7.1/4<br />
2 Inhaltsübersicht Anlage A des RID . . . . . . . . . . 7.2/1<br />
3 Klassifizierung . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3/1<br />
3.1 Klasseneinteilung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3/1<br />
3.2 Stoffe und Gegenstände . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3/1<br />
3.3 Grundsätze der Klassifizierung . . . . . . . . . . . . . . 7.3/1<br />
3.4 Freistellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3/3<br />
3a Verzeichnis der gefährlichen Güter (Erläuterungen) . . . 7.3a/1<br />
4 Verpackungen/Wagen . . . . . . . . . . . . . . . 7.4/1<br />
4.1 Bau- und Prüfvorschriften für Verpackungen, IBC und Großverpackungen . 7.4/1<br />
4.2 Verwendung von Verpackungen, einschließlich Großpackmittel (IBC)<br />
und Großverpackungen (Kapitel 4.1 RID) . . . . . . . . . . . 7.4/1<br />
EL 29 Dezember 2008 11
Inhaltsverzeichnis<br />
4.3 Kesselwagen und Tankcontainer . . . . . . . . . . . . . . 7.4/3<br />
4.4 Bauarten der Kesselwagen und Tankcontainer . . . . . . . . . . 7.4/5<br />
4.5 Verwendung von Kesselwagen, Tankcontainern und MEGC . . . . . 7.4/8<br />
4.6 Beförderung in loser Schüttung . . . . . . . . . . . . . . 7.4/9<br />
4.7 Durchführung und gegenseitige Anerkennung von Prüfungen . . . . . 7.4/11<br />
5 Kennzeichnung, Beschriftung . . . . . . . . . . . . 7.5/1<br />
5.1 Allgemein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5/1<br />
5.2 Kennzeichnung von Versandstücken . . . . . . . . . . . . 7.5/1<br />
5.3 Bezettelung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5/2<br />
5.3.1 Gefahrzettel (Anforderungen und Anbringung) . . . . . . . . . 7.5/2<br />
5.3.2 Großzettel (Placards) . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5/5<br />
5.3.3 Orangefarbene Tafeln . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5/7<br />
5.3.4 Besondere Kennzeichnungen . . . . . . . . . . . . . . . 7.5/8<br />
6 Dokumentation . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.6/1<br />
6.1 Beförderungspapier . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.6/1<br />
6.2 Multimodale Beförderungen . . . . . . . . . . . . . . . 7.6/3<br />
6.3 Gebrochene Verkehre . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.6/6<br />
6.4 Container – Packzertifikat . . . . . . . . . . . . . . . . 7.6/7<br />
6.5 Schriftliche Weisungen (Unfallmerkblätter) . . . . . . . . . . 7.6/7<br />
7 Gefahrgut im Kombinierten Ladungsverkehr [KLV] . . . . 7.7/1<br />
7.1 Huckepackverkehr (Unterabschnitt 1.1.4.4) . . . . . . . . . . 7.7/1<br />
7.2 Übersicht über die Verantwortlichen bei der Beförderung im KLV . . . . 7.7/2<br />
7.3 Kennzeichnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.7/2<br />
8 Materialien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.8/1<br />
Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahn – GGVSE . . . . . . . 7.8/1<br />
2. RID-Ausnahmeverordnung . . . . . . . . . . . . . . . 7.8/15<br />
Auszug Liste Unfallmerkblätter . . . . . . . . . . . . . . 7.8/19<br />
RID-Güter-Übereinkommen . . . . . . . . . . . . . . . 7.8/22<br />
CIM-Frachtbrief, TVA 47/99 . . . . . . . . . . . . . . . 7.8/25<br />
Register 8 – Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen<br />
1 Vorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1/1<br />
1.1 Internationales Übereinkommen von 1974 zum Schutz des menschlichen<br />
Lebens auf See (International Convention Safety of Life at Sea-SOLAS) . . 8.1/1<br />
1.2 Aufbau des IMDG-Codes . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1/3<br />
1.3 Erläuterung der Gefahrgutliste am Beispiel . . . . . . . . . . . 8.1/14<br />
12 EL 30 Mai 2009
Inhaltsverzeichnis<br />
2 Klassifizierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2/1<br />
2.1 Klasseneinteilung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2/1<br />
2.2 Klassifizierung von Lösungen und Mischungen . . . . . . . . . 8.2/3<br />
2.3 Sammelbezeichnungen für gefährliche Güter . . . . . . . . . . 8.2/4<br />
2.4 Klassifizierungshilfen durch deutsche Fachbehörden . . . . . . . . 8.2/5<br />
3 Umschließungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.3/1<br />
3.1 Verpackungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.3/1<br />
3.1.1 Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.3/1<br />
3.1.2 Voraussetzungen für Verpackungen . . . . . . . . . . . . . 8.3/1<br />
3.1.3 Prüfung und Zulassung von Verpackungen . . . . . . . . . . . 8.3/2<br />
3.1.4 Einteilung der gefährlichen Stoffe und Gegenstände . . . . . . . . 8.3/2<br />
3.1.5 Verpackungen für die Klassen 1, 2, 5.2, 6.2 und 7 . . . . . . . . . 8.3/2<br />
3.1.6 Verpackungsarten und -codes . . . . . . . . . . . . . . . 8.3/4<br />
3.1.7 Verpackungscodierungen . . . . . . . . . . . . . . . . 8.3/6<br />
3.1.8 Zugelassene Verpackung – Anwendung des IMDG-Codes . . . . . . 8.3/6<br />
3.1.9 ADR-/RID-Verpackungen. . . . . . . . . . . . . . . . 8.3/14<br />
3.1.10 Verwendung gleichwertiger Verpackungen . . . . . . . . . . . 8.3/14a<br />
3.1.11 Zusammenpackung – § 9 GGVSee . . . . . . . . . . . . . 8.3/14a<br />
3.2 INTERMEDIATE BULK CONTAINERS (IBC) – Großpackmittel. . . . 8.3/15<br />
3.2.1 Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.3/15<br />
3.2.2 Prüfung und Zulassung von Großpackmitteln . . . . . . . . . . 8.3/16<br />
3.2.3 Codierungssystem (Kennzeichnung) von IBC . . . . . . . . . . 8.3/17<br />
3.2.4 Verwendung von Großpackmitteln (IBC) . . . . . . . . . . . 8.3/19<br />
3.2.5 Verpackungsanweisungen für Großpackmittel (IBC) . . . . . . . . 8.3/20<br />
3.2.6 Großverpackungen – Large Packagings . . . . . . . . . . . . 8.3/23<br />
3.3 Ortsbewegliche Tanks und Straßenfahrzeuge . . . . . . . . . . 8.3/27<br />
3.3.1 Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.3/27<br />
3.3.2 Verwendung ortsbeweglicher Tanks . . . . . . . . . . . . . 8.3/27<br />
3.3.3 Vorschriften für die Bauart, den Bau, die Überprüfung und das Prüfen von<br />
ortsbeweglichen Tanks . . . . . . . . . . . . . . . . 8.3/27<br />
3.3.4 Vorschriften für Straßentankfahrzeuge . . . . . . . . . . . . 8.3/30<br />
3.3.5 Vorschriften für Tanks für die Beförderung fester Stoffe . . . . . . . 8.3/31<br />
3.3.6 Verwendung ortsbeweglicher Tanks (Kapitel 4.2 IMDG-Code) . . . . . 8.3/31<br />
3.3.7 Verwendung von Schüttgut-Containern . . . . . . . . . . . . 8.3/41<br />
3.3.8 Vorschriften für Auslegung, Bau, Besichtigung und Prüfung von<br />
Schüttgut-Containern . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.3/41<br />
3.3.9 Verwendung von Gascontainern mit mehreren Elementen (MEGC) . . . 8.3/42<br />
4 Kennzeichnung, Plakatierung, Beschriftung . . . . . . 8.4/1<br />
4.1 Versandstücke – Kennzeichnung (Label) . . . . . . . . . . . 8.4/1<br />
4.2 Beförderungseinheiten . . . . . . . . . . . . . . . . 8.4/2<br />
EL 30 Mai 2009 13
Inhaltsverzeichnis<br />
5 Beförderungspapiere . . . . . . . . . . . . . . . 8.5/1<br />
5.1 Beförderungsdokument . . . . . . . . . . . . . . . . 8.5/1<br />
5.2 Beförderungspapier, besondere Liste, Stauplan . . . . . . . . . 8.5/6<br />
5.3 Container-Packzertifikat/Fahrzeugbelade-Erklärung . . . . . . . . 8.5/7<br />
6 Durchführung der Beförderung . . . . . . . . . . . 8.6/1<br />
6.1 Verladung gefährlicher Güter (§ 7 GGVSee) . . . . . . . . . . 8.6/1<br />
6.2 Unterrichtung der Schiffsführung und der Besatzung . . . . . . . . 8.6/1<br />
6.3 Stauung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.6/2<br />
6.4 Trennung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.6/3<br />
6.5 Ausnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.6/8<br />
7 Verantwortlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . 8.7/1<br />
Verantwortlichkeiten, Ordnungswidrigkeiten (§§ 9, 10 GGVSee) . . . . 8.7/1<br />
8 Sonstiges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.8/1<br />
8.1 Emergency Response Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods –<br />
Group Emergency Schedules (EmS-Guide) . . . . . . . . . . 8.8/1<br />
8.2 Medical First Aid Guide for Use In Accidents Involving Dangerous<br />
Goods (MFAG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.8/2<br />
8.3 Beförderung Gefährlicher Güter in begrenzten Mengen . . . . . . . 8.8/3<br />
8.4 Freigestellte Mengen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.8/5<br />
8.5 Meeresschadstoffe „Marine Pollutant“ . . . . . . . . . . . . 8.8/6<br />
8.6 Beförderung von Abfällen . . . . . . . . . . . . . . . 8.8/10<br />
8.7 International Ship and Port Facility Code (ISPS) . . . . . . . . . 8.8/11<br />
8.8 Verkehrsrechtliche Sonderregelungen . . . . . . . . . . . . 8.8/15<br />
8.8.1 Memorandum of Understanding (MOU) „Ostsee-Memorandum“ . . . . 8.8/15<br />
8.8.2 Beförderung gefährlicher Güter auf Fährschiffen in der Küstenschifffahrt . . 8.8/19<br />
8.9 Hafensicherheitsvorschriften . . . . . . . . . . . . . . . 8.8/20<br />
8.10 Schiffseitige Dokumentation (Document of Compliance –<br />
„SOLAS-Bescheinigung“) . . . . . . . . . . . . . . . 8.8/23<br />
8.11 Internationaler Code für die sichere Beförderung von verpackten bestrahlten<br />
Kernbrennstoffen, Plutonium und hochradioaktiven Abfällen mit<br />
Seeschiffen (INF-Code) . . . . . . . . . . . . . . . . 8.8/25<br />
9 Beförderung gefährlicher Güter mit Tankschiffen . . . . 8.9/1<br />
9.1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.9/1<br />
9.2 Anzuwendende Rechtsvorschriften . . . . . . . . . . . . . 8.9/1<br />
9.3 Besondere Betriebsvorschriften . . . . . . . . . . . . . . 8.9/2<br />
9.4 Mindestanforderungen und Positiv-Liste der zu befördernden Massengüter<br />
(IBC-Code, Kapitel 17 bis 19) . . . . . . . . . . . . . . 8.9/4<br />
9.5 Verhinderung der Meeresverschmutzung durch Internationale Übereinkommen<br />
(Marine Pollution 73/78) . . . . . . . . . . . . . 8.9/4<br />
14 EL 30 Mai 2009
Inhaltsverzeichnis<br />
9.5.1 Marpol 73/78 Annex/Anlage I . . . . . . . . . . . . . . 8.9/5<br />
9.5.2 Marpol 73/78 Annex/Anlage II . . . . . . . . . . . . . . 8.9/6<br />
Register 9 – Gefahrgutbeförderung auf Binnenwasserstraßen<br />
Vorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9/1<br />
Internationaler Binnenschiffsverkehr . . . . . . . . . . . . . . . . 9/4<br />
ADN/ADNR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9/4<br />
„Mannheimer-Akte“, ZKR – Zentral-Kommission für Rhein-Schifffahrt . . . . . 9/7<br />
ADNR und Gefahrgutverordnung – Binnenschifffahrt . . . . . . . . . . 9/9<br />
Übersicht über die Rechtsvorschriften . . . . . . . . . . . . . . . 9/10<br />
Bundeswasserstraßen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9/11<br />
Aufbau der GGVBinSch/des ADNR . . . . . . . . . . . . . . . . 9/13<br />
Aufbau der Anlage zum ADNR (Inhaltsverzeichnis) . . . . . . . . . . . 9/14<br />
Beispiel eines Abschnittes im ADNR . . . . . . . . . . . . . . . 9/24<br />
Freistellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9/25<br />
Anordnungen vorübergehender Art . . . . . . . . . . . . . . . . 9/27<br />
Gleichwertigkeit und Abweichungen . . . . . . . . . . . . . . . 9/27<br />
Ausnahmegenehmigungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9/28<br />
Zuständigkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9/28<br />
Klassifizierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1<br />
Gefährliche Güter nach dem ADNR . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1/1<br />
Klasseneinteilung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1/1<br />
Unterteilung in den einzelnen Klassen . . . . . . . . . . . . . . . 9.1/2<br />
Stoffe und Gegenstände . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1/9<br />
Mischungen – Lösungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1/9<br />
Grundsätze der Klassifizierung . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1/10<br />
Arten von Eintragungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1/10<br />
Gefahrengrade/Verpackungsgruppen . . . . . . . . . . . . . . . 9.1/11<br />
Weitere Unterteilung beim Tankschifftransport . . . . . . . . . . . . 9.1/11<br />
Klassifizierung von Abfallstoffen . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1/11<br />
Verantwortlichkeit für die Klassifizierung . . . . . . . . . . . . . . 9.1/12<br />
Gefahreigenschaften von Stoffen, Lösungen, Mischungen . . . . . . . . . 9.1/12<br />
Eigenschaften von Gefahrgütern . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1/17<br />
Verpackungsvorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2<br />
Kennzeichnung und Beschriftung . . . . . . . . . . . . . . . . 9.3<br />
Zutritts- und Rauchverbot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.3/1<br />
Warnzeichen für begaste Straßenfahrzeuge, Wagen, Container oder Tanks . . . . 9.3/1<br />
Kennzeichnung von Schiffen mit blauen Lichtern oder Kegeln . . . . . . . . 9.3/1<br />
Kennzeichnung von Schiffen mit orangefarbenen Warntafeln . . . . . . . . 9.3/6<br />
Bezettelung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.3/6<br />
EL 30 Mai 2009 15
Inhaltsverzeichnis<br />
Zusammenladeverbote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.3/8<br />
Dokumentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4<br />
Urkunden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4/1<br />
Beförderungspapier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4/2<br />
Zulassungszeugnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4/5<br />
Formular für die multimodale Beförderung . . . . . . . . . . . . . . 9.4/6<br />
Schriftliche Weisungen (Unfallmerkblätter) . . . . . . . . . . . . . 9.4/7<br />
Prüfung des Nachlenzsystems . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4/9<br />
Prüfliste ADNR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4/9<br />
Ladungsbuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4/9<br />
Stauplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4/10<br />
Bescheinigung über die Ausbildung der Sachkundigen . . . . . . . . . . 9.4/10<br />
Schiffssicherungsmerkblatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4/12<br />
Beförderungsvorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5<br />
Zulässigkeit der Beförderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5/1<br />
Übergangsvorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5/1<br />
Freistellungen im Zusammenhang mit der Freimenge an Bord von Schiffen . . . . 9.5/1<br />
Begrenzung der beförderten Mengen . . . . . . . . . . . . . . . 9.5/2<br />
Verstauen/Stauplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5/5<br />
Zusammenladeverbote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5/7<br />
Prüfliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5/8<br />
Stillliegen von Schiffen, die gefährliche Güter befördern . . . . . . . . . 9.5/8<br />
Hafenordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5/10<br />
Lade- und Löschstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5/10<br />
Reinigen/Entgasen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5/11<br />
Schiffstypen und Ausrüstung der Schiffe . . . . . . . . . . . . . . 9.5/12<br />
Klassifikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5/16<br />
Meldepflicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5/17<br />
Materialien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.6<br />
GGVBinSch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.6/1<br />
Muster eines Beförderungspapiers (Schiffsladeschein) . . . . . . . . . . 9.6/25<br />
Formular für die multimodale Beförderung . . . . . . . . . . . . . 9.6/26<br />
Zulassungszeugnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.6/28<br />
Prüfliste ADNR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.6/35<br />
Nachweis über die Prüfung des Nachlenzsystems . . . . . . . . . . . 9.6/40<br />
Register 10 – Gefahrgutbeförderung im Luftverkehr<br />
1. Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/1<br />
2. Einstieg in die Gefahrgut-Vorschriften . . . . . . . . . . . . . 10/4<br />
2.1 Gliederung der IATA-DGR . . . . . . . . . . . . . . . . 10/4a<br />
16 EL 30 Mai 2009
Inhaltsverzeichnis<br />
2.2 Anwendung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/4b<br />
2.3 Begrenzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/4b<br />
2.4 Einstieg in die DGR-Regeln . . . . . . . . . . . . . . . . 10/4d<br />
2.5 Was sind gefährliche Güter? . . . . . . . . . . . . . . . . 10/6<br />
3. Sonstige gesetzliche Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . 10/8<br />
Zulassung zur Beförderung . . . . . . . . . . . . . . . . 10/8<br />
Luftverkehrsgesetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/8<br />
Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung . . . . . . . . . . . . . 10/9<br />
Bekanntmachung über die Beförderung gefährlicher Güter einschließlich<br />
Waffen im Luftverkehr durch Luftfahrtunternehmen . . . . . . . . 10/10<br />
Erlaubnis zur Beförderung gefährlicher Güter im Luftverkehr<br />
durch Luftfahrtunternehmen . . . . . . . . . . . . . . . 10/15c<br />
4. Begrenzung von Gefahrgut auf Flugzeugen . . . . . . . . . . . . 10/16<br />
5. Ausnahmebestimmungen von Regierungen und Luftverkehrsgesellschaften . . 10/19<br />
6. Klassifizierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/21<br />
7. Verpackungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/24<br />
7.1 Verpackung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/24<br />
7.2 Zusammenpackung/Trenngebote . . . . . . . . . . . . . . . 10/24a<br />
7.3 Polstermaterial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/24b<br />
7.4 Absorptionsmaterial . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/24b<br />
7.5 Auswahl der richtigen Verpackung . . . . . . . . . . . . . . 10/24c<br />
7.6 Verpackungsspezifikation und Prüfverfahren . . . . . . . . . . . 10/24d<br />
7.7 Vorbereitung zum Versand . . . . . . . . . . . . . . . . 10/24g<br />
8. Kennzeichnung, Beschriftung . . . . . . . . . . . . . . . . 10/29<br />
8.1 Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/29<br />
8.2 Markierung und Kennzeichnung . . . . . . . . . . . . . . . 10/30<br />
8.3 Quick Reference Guide . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/32<br />
9. Dokumente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/33<br />
9.1 Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/33<br />
9.2 AIRWAY BILL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/33<br />
9.3 Shipper’s Declaration . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/35<br />
10. Abfertigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/37<br />
Anhang<br />
1 Shipper’s Declaration – Formblatt . . . . . . . . . . . . . . 10/41<br />
2 Beispiele korrekt ausgestellter Shipper’s Declarations . . . . . . . . 10/42<br />
3/4 (derzeit nicht besetzt)<br />
5 Annahme-Kontrollblatt (Muster) . . . . . . . . . . . . . . . 10/48<br />
6 Annahme-Kontrollblatt für radioaktive Stoffe (Muster) . . . . . . . . 10/49<br />
7 Notification to Captain (Muster) . . . . . . . . . . . . . . . 10/50<br />
8 Abweichungen der Staaten und der Fluggesellschaften . . . . . . . . 10/51<br />
EL 30 Mai 2009 17
GbV 1999<br />
Verordnung über die Bestellung von<br />
Gefahrgutbeauftragten und die Schulung<br />
der beauftragten Personen in Unternehmen<br />
und Betrieben (Gefahrgutbeauftragtenverordnung<br />
– GbV)<br />
in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. März 1998<br />
(BGBl. I S. 648),<br />
zuletzt geändert durch Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407)<br />
2 c<br />
§ 1 Bestellung von Gefahrgutbeauftragten<br />
(1) Unternehmer und Inhaber eines Betriebes, die an der Beförderung gefährlicher Güter<br />
mit Eisenbahn-, Straßen-, Wasser- oder Luftfahrzeugen beteiligt sind, müssen mindestens<br />
einen Gefahrgutbeauftragten schriftlich bestellen. Werden mehrere Gefahrgutbeauftragte<br />
bestellt, so sind deren Aufgaben nach Anlage 1 schriftlich festzulegen.<br />
(2) Die Funktion des Gefahrgutbeauftragten kann<br />
1. von einem Mitarbeiter des Unternehmens oder Betriebes, dem auch andere Aufgaben<br />
übertragen sein können,<br />
2. von einer dem Unternehmen oder Betrieb nicht angehörenden Person oder<br />
3. vom Unternehmer oder Inhaber eines Betriebes<br />
wahrgenommen werden. Nimmt der Unternehmer oder Inhaber eines Betriebes die Funktion<br />
des Gefahrgutbeauftragten selbst wahr, ist eine schriftliche Bestellung nicht erforderlich.<br />
(3) Der Unternehmer oder Inhaber des Betriebes muss im Unternehmen oder Betrieb und<br />
auf Verlangen auch der zuständigen Überwachungsbehörde den Namen des Gefahrgutbeauftragten<br />
bekanntgeben.<br />
(4) Die zuständige Überwachungsbehörde kann anordnen, dass Unternehmer oder Inhaber<br />
von Betrieben, die von der Bestellung eines Gefahrgutbeauftragten nach § 1b befreit sind,<br />
einen Gefahrgutbeauftragten bestellen müssen, wenn im Unternehmen oder Betrieb wiederholt<br />
oder schwerwiegend gegen Vorschriften verstoßen wurde, deren Einhaltung nach dem<br />
Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter oder nach den aufgrund dieses Gesetzes<br />
erlassenen Rechtsvorschriften dem Unternehmer oder Inhaber des Betriebes obliegt.<br />
(5) Die zuständige Überwachungsbehörde kann die zur Einhaltung dieser Verordnung<br />
erforderlichen Anordnungen treffen. Sie kann insbesondere die Abberufung des bestellten<br />
Gefahrgutbeauftragten und die Bestellung eines anderen Gefahrgutbeauftragten verlangen,<br />
wenn die Voraussetzungen des Absatzes 4 vorliegen.<br />
Hinweise des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen zu § 1 (Siehe unter Abschnitt 2e)<br />
1.1 Bestellung mehrerer Gefahrgutbeauftragter<br />
1.2 Behördliche Anordnung der Bestellung von Gefahrgutbeauftragten<br />
EL 30 Mai 2009 1
3.1 Gefahrgutbeförderungsgesetz<br />
6. die Beförderungsgenehmigungen, die Beförderungs- und Begleitpapiere,<br />
7. die Auskunft-, Aufzeichnungs- und Anzeigepflichten,<br />
8. die Besetzung und Begleitung der Fahrzeuge,<br />
9. die Befähigungsnachweise, auch in den Fällen des § 5 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2,<br />
10. die Mess- und Prüfverfahren,<br />
11. die Schutzmaßnahmen für das Beförderungspersonal,<br />
12. das Verhalten und die Schutz- und Hilfsmaßnahmen nach Unfällen mit gefährlichen Gütern,<br />
13. bei der Beförderung beteiligte Personen, einschließlich ihrer ärztlichen Überwachung und Untersuchung,<br />
des Erfordernisses von Ausbildung, Prüfung und Fortbildung sowie zur Festlegung<br />
qualitativer Anforderungen an Lehrgangsveranstalter und Lehrkräfte,<br />
14. Beauftragte in Unternehmen und Betrieben, einschließlich des Erfordernisses von Ausbildung,<br />
Prüfung und Fortbildung sowie zur Festlegung qualitativer Anforderungen an Lehrgangsveranstalter<br />
und Lehrkräfte,<br />
15. Bescheinigungen und Meldepflichten für Abfälle, die gefährliche Güter sind,<br />
16. die Stellen für Prüfung und Zulassung einschließlich Konformitätsbewertung der Verpackung nach<br />
Nummer 2 sowie der Beförderungsbehältnisse und Fahrzeuge nach Nummer 4,<br />
17. die Geltung von Bescheiden über Zulassung und Prüfung der Verpackung nach Nummer 2 sowie<br />
der Beförderungsbehältnisse und Fahrzeuge nach Nummer 4, die in einem anderen Mitgliedstaat<br />
der Europäischen Union oder des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in<br />
Drittstaaten ausgestellt sind,<br />
18. die Zusammenarbeit und den Erfahrungsaustausch der mit Aufgaben der Zulassung einschließlich<br />
Konformitätsbewertung und Prüfung betrauten Behörden und Stellen,<br />
soweit dies zum Schutz gegen die von der Beförderung gefährlicher Güter ausgehenden Gefahren und<br />
erheblichen Belästigungen erforderlich ist. Die Rechtsverordnungen nach Satz 1 haben den Stand der<br />
Technik zu berücksichtigen. Das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1<br />
des Grundgesetzes) wird nach Maßgabe des Satzes 1 Nr. 13 eingeschränkt. In den Rechtsverordnungen<br />
nach Satz 1 kann auch geregelt werden, dass bei der Beförderung gefährlicher Güter eine zusätzliche<br />
haftungsrechtliche Versicherung abzuschließen und nachzuweisen ist.<br />
(2) Rechtsverordnungen und allgemeine Verwaltungsvorschriften nach Absatz 1 können auch zur<br />
Durchführung oder Umsetzung von Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaften und zur Erfüllung<br />
von Verpflichtungen aus zwischenstaatlichen Vereinbarungen erlassen werden. Rechtsverordnungen<br />
nach Absatz 1 Satz 1, die der Verwirklichung neuer Erkenntnisse hinsichtlich der internationalen<br />
Beförderung gefährlicher Güter auf dem Gebiet der See- und Binnenschiffahrt dienen sowie Rechtsverordnungen<br />
zur Inkraftsetzung von Abkommen nach Artikel 5 § 2 des Anhanges B des Übereinkommens<br />
über den internationalen Eisenbahnverkehr vom 9. Mai 1980 (COTIF-Übereinkonunen.<br />
BGBl. 1985 II S. 132), erlässt das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung ohne<br />
Zustimmung des Bundesrates; diese Rechtsverordnungen bedürfen jedoch der Zustimmung des Bundesrates,<br />
wenn sie die Einrichtung der Landesbehörden oder die Regelung ihres Verwaltungsverfahrens<br />
betreffen.<br />
(3) (weggefallen)<br />
(4) Soweit Sicherheitsgründe und die Eigenart des Verkehrsmittels es zulassen, soll die Beförderung<br />
gefährlicher Güter mit allen Verkehrsmitteln einheitlich geregelt werden.<br />
(5) In den Rechtsverordnungen nach Absatz 1 sind Ausnahmen für die Bundeswehr, in ihrem Auftrag<br />
hoheitlich tätige zivile Unternehmen, ausländische Streitkräfte, die Bundespolizei und die Polizeien,<br />
die Feuerwehren, die Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes sowie die Kampfmittelräumdienste<br />
der Länder oder Kommunen zuzulassen, soweit dies Gründe der Verteidigung, polizeiliche<br />
4 EL 31 August 2009
Abfallrecht 4.1<br />
Abfallrecht<br />
1. Einleitung<br />
Erheblich steigende Abfallmengen und geringer werdender Deponieraum sowie das Bekanntwerden<br />
von durch Abfallablagerungen hervorgerufene schädliche Umwelteinwirkungen (Bodenund<br />
Grundwasserverunreinigungen, Geruchsbelästigungen) machten eine geordnete Abfallbeseitigung<br />
unumgänglich. Im Juni 1972 trat <strong>als</strong> eines der ersten Umweltgesetze das Abfallbeseitigungsgesetz<br />
(AbfG) des Bundes in Kraft. Vor diesem Zeitpunkt gab es für die Beseitigung von<br />
Abfällen vereinzelte und verstreute Regelungen (z. B. Kommunale Satzungen). Gewerbe- und<br />
Industrieabfälle waren dam<strong>als</strong> von der kommunalen Entsorgung ausgeschlossen.<br />
Das Abfallbeseitigungsgesetz beschränkte sich auf die Abfallbeseitigung und enthielt keine Rangfolge<br />
zwischen Vermeidung und Verwertung von Abfällen. In den folgenden Jahren bis 1985 wurden<br />
vor allem neue Regelungen für den Bereich Abfalltransport, grenzüberschreitender Abfalltransport<br />
und Kontrolle der Abfallerzeugungs-, Behandlungs- und Beseitigungsanlagen erlassen.<br />
Auslöser waren einige Müllskandale, wie z. B. die „Seveso-Abfälle“ sowie die bislang gemachten<br />
Erfahrungen aus dem praktischen Vollzug des Gesetzes.<br />
Dies führte auch zu der Erkenntnis, dass allein Regelungen über die Beseitigung der Abfälle nicht<br />
ausreichen, um die steigenden Abfallmengen zu beherrschen. Damit wurde im November 1986<br />
aus dem Abfallbeseitigungsgesetz das Gesetz über die Vermeidung und Entsorgung von Abfällen<br />
(Abfallgesetz – AbfG). In diesem Gesetz wurde erstmalig der Vorrang der Abfallvermeidung und<br />
der Abfallverwertung vor der Abfalldeponierung verankert. Wichtige Änderungen waren die Aufnahme<br />
der Altölentsorgung sowie die Regelung der Kennzeichnungs- und Rücknahmepflichten.<br />
In wesentlichen Punkten war das alte Abfallgesetz jedoch nicht mehr praktikabel und entsprach<br />
auch nicht mehr den politischen Zielsetzungen des Bundes. Insbesondere bei der Differenzierung<br />
zwischen Wirtschaftsgut und Abfall gab es beim Vollzug des Gesetzes zahlreiche Probleme.<br />
Darüber hinaus beabsichtigte die Bundesregierung eine Abkehr vom Vorrang der kommunalen<br />
Abfallentsorgung weg zu einer Produktverantwortung des Gewerbes und der Industrie. Außerdem<br />
war es erforderlich, das nationale Abfallrecht den europäischen Vorgaben anzupassen.<br />
Im Oktober 1996 ist daraufhin das neue Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG)<br />
sowie das sogenannte untergesetzliche Regelwerk in Kraft getreten.<br />
Im Zuge des am 02. August 2001 in Kraft getretenen Gesetzes zur Umsetzung der UVP-Änderungsrichtlinie,<br />
der IVU-Richtlinie und weiterer EG-Richtlinien zum Umweltschutz („Artikelgesetz“)<br />
wurde auch das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes geändert.<br />
Seit dem 01. Januar 2002 gilt die Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung<br />
– AVV).<br />
Nachdem im Juli 2006 das Gesetz zur Vereinfachung der abfallrechtlichen Überwachung in Kraft<br />
getreten ist, wurde am 26. Oktober 2006 die zugehörige Verordnung zur Vereinfachung der abfallrechtlichen<br />
Überwachung im Bundesgesetzblatt verkündet.<br />
Ziel der aktuellen Novelle war insbesondere<br />
– die Anpassung der bisherigen abfallrechtlichen Überwachung an die Begrifflichkeiten und<br />
Überwachungsvorgaben des EG-Rechts<br />
– die Nutzung des elektronischen Abfall-Nachweis-Verfahrens (eANV) mit modernen<br />
Kommunikationstechniken<br />
EL 27 Januar 2007 1
4.1 Abfallrecht<br />
mindestens 75% erzielt wird, entstehende Wärme selber genutzt oder an Dritte abgegeben wird<br />
und die im Rahmen der Verwertung anfallenden weiteren Abfälle möglichst ohne weitere Behandlung<br />
abgelagert werden können. Trifft eines der Kriterien nicht zu, liegt keine Verwertung,<br />
sondern eine Abfallbeseitigung vor.<br />
2.3 Überlassungspflichten<br />
Gemäß § 13 Abs. 1 Satz 1 sind die Besitzer von Abfällen aus privaten Haushaltungen verpflichtet,<br />
diese dem nach Landesrecht öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (Kreise und Städte) zu überlassen,<br />
soweit sie zu einer Verwertung nicht in der Lage sind oder diese nicht beabsichtigen. Diese<br />
Überlassungspflicht gilt auch für Erzeuger und Besitzer von Abfällen zur Beseitigung aus anderen<br />
Herkunftsbereichen, soweit sie diese nicht in eigenen Anlagen beseitigen oder überwiegende<br />
öffentliche Interessen (z. B. Gefährdung der Entsorgungssicherheit durch nicht ausgelastete<br />
kommunale Anlagen) eine Überlassung erfordern. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass Abfälle<br />
zur Verwertung nicht zu überlassen sind. Gleiches gilt für Erzeuger von Abfällen zur Beseitigung,<br />
die über eine eigene Entsorgungsanlage verfügen.<br />
Eine Überlassungspflicht gegenüber den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern besteht nicht,<br />
soweit Dritten oder privaten Entsorgungsträgern Pflichten übertragen worden sind.<br />
Darüber hinaus besteht keine Überlassungspflicht für Abfälle,<br />
• die einer Rücknahme- oder Rückgabepflicht aufgrund einer Rechtsverordnung (z. B. Verpackungsverordnung)<br />
unterliegen, soweit die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger nicht an<br />
der Rücknahme mitwirken,<br />
• die in Wahrnehmung der Produktverantwortung freiwillig zurückgenommen werden, soweit<br />
dem zurücknehmenden Hersteller oder Vertreiber ein Freistellungs- oder Feststellungsbescheid<br />
erteilt worden ist<br />
sowie für nicht gefährliche Abfälle<br />
• die durch gemeinnützige Sammlung einer ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung zugeführt<br />
werden,<br />
• die durch gewerbliche Sammlung einer ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung zugeführt<br />
werden, soweit dies den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern nachgewiesen wird<br />
und nicht überwiegende öffentliche Interessen entgegenstehen.<br />
2.4 Abfallwirtschaftskonzepte und Abfallbilanzen<br />
Die Verordnung über Abfallwirtschaftskonzepte und Abfallbilanzen wurde aufgehoben.<br />
Lediglich die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger sind noch verpflichtet, Abfallwirtschaftskonzepte<br />
und Abfallbilanzen über die Verwertung und die Beseitigung der in ihrem Gebiet<br />
anfallenden und ihnen zu überlassenden Abfälle zu erstellen. Behördliche Anordnungen im<br />
Einzelfall bleiben davon unberührt.<br />
2.5 Produktverantwortung<br />
Konkretisierungen zur Abfallvermeidung enthält der § 22 KrW-/AbfG „Produktverantwortung“.<br />
Danach sind Erzeugnisse so zu gestalten, dass bei deren Herstellung und Gebrauch das Entstehen<br />
von Abfällen vermindert wird und nach ihrem Gebrauch eine umweltverträgliche Verwertung und<br />
Beseitigung sichergestellt ist. In einer noch zu erstellenden Rechtsverordnung wird festgelegt,<br />
4 EL 27 Januar 2007
Abfallrecht 4.1<br />
Handhabung der Begleitscheine bei „Einzelentsorgung“<br />
(gefährliche Abfälle)<br />
Handhabung der Begleitscheine/Übernahmescheine bei Sammelentsorgung<br />
(gefährliche Abfälle)<br />
EL 27 Januar 2007 13
4.4 Atomgesetz/Strahlenschutzverordnung<br />
§ 16 Strahlenschutzverordnung<br />
Genehmigungsbedürftige Beförderung<br />
(1) Die Beförderung von sonstigen radioaktiven Stoffen nach § 2 Abs. 1 des Atomgesetzes oder<br />
von Kernbrennstoffen nach § 2 Abs. 3 des Atomgesetzes auf öffentlichen oder der Öffentlichkeit<br />
zugänglichen Verkehrswegen bedarf der Genehmigung. Eine erteilte Genehmigung erstreckt sich<br />
auch auf die Teilstrecken eines Beförderungsvorgangs, der nicht auf öffentlichen oder der Öffentlichkeit<br />
zugänglichen Verkehrswegen stattfindet, soweit für diese Teilstrecken keine Umgangsgenehmigung<br />
vorliegt.<br />
(2) Eine Genehmigung nach § 4 Abs. 1 des Atomgesetzes kann sich auch auf eine genehmigungsbedürftige<br />
Beförderung radioaktiver Stoffe nach Absatz 1 erstrecken, soweit es sich um denselben<br />
Beförderungsvorgang handelt; soweit eine solche Erstreckung erfolgt, ist eine Genehmigung nach<br />
Absatz 1 nicht erforderlich.<br />
(3) Die Genehmigung kann dem Absender, dem Beförderer oder demjenigen erteilt werden, der<br />
es übernimmt, die Versendung oder Beförderung zu besorgen. Sie ist für den einzelnen Beförderungsvorgang<br />
zu erteilen, kann jedoch einem Antragsteller allgemein auf längstens drei Jahre<br />
erteilt werden, soweit die in § 1 Nr. 2 bis 4 des Atomgesetzes bezeichneten Zwecke nicht entgegenstehen.<br />
(4) Bei der Beförderung ist eine Ausfertigung oder eine amtlich beglaubigte Abschrift des Genehmigungsbescheids<br />
mitzuführen. Die Ausfertigung oder Abschrift des Genehmigungsbescheids ist<br />
der für die Aufsicht zuständigen Behörde oder den von ihr Beauftragten auf Verlangen vorzuzeigen.<br />
(5) Die Bestimmungen des Genehmigungsbescheids sind bei der Ausführung der Beförderung<br />
auch vom Beförderer, der nicht selbst Inhaber der Genehmigung ist, zu beachten.<br />
(6) Die für die jeweiligen Verkehrsträger geltenden Rechtsvorschriften über die Beförderung<br />
gefährlicher Güter bleiben unberührt.<br />
§ 17 Strahlenschutzverordnung<br />
Genehmigungsfreie Beförderung<br />
(1) Die Beförderung von<br />
1. Stoffen der in Anlage I Teil B genannten Art oder von Stoffen, die von der Anwendung der Vorschriften<br />
für die Beförderung gefährlicher Güter befreit sind,<br />
2. sonstigen radioaktiven Stoffen nach § 2 Abs. 1 des Atomgesetzes oder Kernbrennstoffen nach<br />
§ 2 Abs. 3 des Atomgesetzes, soweit diese nicht bereits von Nummer 1 erfasst werden, unter den<br />
Voraussetzungen für freigestellte Verstandstücke nach den Vorschriften für die Beförderung<br />
gefährlicher Güter,<br />
3. sonstigen radioaktiven Stoffen nach § 2 Abs. 1 des Atomgesetzes oder Kernbrennstoffen nach<br />
§ 2 Abs. 3 des Atomgesetzes, ausgenommen Großquellen im Sinne des § 23 Abs. 2 des Atomgesetzes,<br />
a) nach der Gefahrgutverordnung See oder<br />
b) mit Luftfahrzeugen und der hierfür erforderlichen Erlaubnis nach § 27 des Luftverkehrsgesetzes<br />
4 EL 30 Mai 2009
OWIG 5.2<br />
§ 9 OWiG<br />
Handeln für einen anderen<br />
(1) Handelt jemand<br />
1. <strong>als</strong> vertretungsberechtigtes Organ einer juristischen Person oder <strong>als</strong> Mitglied eines solchen<br />
Organs,<br />
2. <strong>als</strong> vertretungsberechtigter Gesellschafter einer rechtsfähigen Personengesellschaft oder<br />
3. <strong>als</strong> gesetzlicher Vertreter eines anderen,<br />
so ist ein Gesetz, nach dem besondere persönliche Eigenschaften, Verhältnisse oder Umstände<br />
(besondere persönliche Merkmale) die Möglichkeit der Ahndung begründen, auch auf den<br />
Vertreter anzuwenden, wenn diese Merkmale zwar nicht bei ihm, aber bei dem Vertretenen<br />
vorliegen.<br />
(2) Ist jemand von dem Inhaber eines Betriebes oder einem sonst dazu Befugten<br />
1. beauftragt, den Betrieb ganz oder zum Teil zu leiten, oder<br />
2. ausdrücklich beauftragt, in eigener Verantwortung Aufgaben wahrzunehmen, die dem<br />
Inhaber des Betriebes obliegen,<br />
und handelt er auf Grund dieses Auftrages, so ist ein Gesetz, nach dem besondere persönliche<br />
Merkmale die Möglichkeit der Ahndung begründen, auch auf den Beauftragten anzuwenden,<br />
wenn diese Merkmale zwar nicht bei ihm, aber bei dem Inhaber des Betriebes vorliegen. Dem<br />
Betrieb im Sinne des Satzes 1 steht das Unternehmen gleich. Handelt jemand auf Grund eines<br />
entsprechenden Auftrages für eine Stelle, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt,<br />
so ist Satz 1 sinngemäß anzuwenden.<br />
(3) Die Absätze 1 und 2 sind auch dann anzuwenden, wenn die Rechtshandlung, welche die<br />
Vertretungsbefugnis oder das Auftragsverhältnis begründen sollte, unwirksam ist.<br />
Nach § 9 Abs. 2 OWiG kann z. B. ein Niederlassungsleiter (Betriebsleiter) oder ein Abteilungsleiter<br />
oder ein entsprechend beauftragter Disponent, der Pflichten seines Betriebsinhabers nach<br />
der GGVSEB (z. B. dessen Pflichten <strong>als</strong> Verlader und Absender) eigenverantwortlich wahrzunehmen<br />
hat, wegen der Verletzung von bußgeldbewehrten Verlader- bzw. Absenderpflichten nach der<br />
GGVSEB mit einem Bußgeld belegt werden, obwohl der Betriebsleiter, der Abteilungsleiter und<br />
der Disponent weder Verlader noch Absender sind; dies ist und bleibt der Betriebsinhaber.<br />
In den Fällen, in denen der Unternehmer/Betriebsinhaber seine mit Bußgeld oder Strafe bewehrten<br />
öffentlich-rechtlichen Pflichten durch andere – eigenverantwortlich oder nicht eigenverantwortlich<br />
– erfüllen lässt, kann bei Verletzung dieser Pflichten durch die anderen, auch der Unternehmer<br />
/ Betriebsinhaber im Rahmen des OWiG belangt werden. Unterlässt dieser nämlich vorsätzlich<br />
oder fahrlässig Aufsichtsmaßnahmen, die erforderlich sind, um in dem Betrieb oder Unternehmen<br />
Zuwiderhandlungen gegen Pflichten zu verhindern, die den Betriebsinhaber/Unternehmer<br />
treffen und deren Verletzung mit Strafe oder Geldbuße bedroht ist, handelt er ordnungswidrig,<br />
wenn eine solche Zuwiderhandlung begangen wird, die durch gehörige Aufsicht hätte verhindert<br />
werden können (§ 130 Abs. 1 Satz 1 OWiG).<br />
§ 65 OWiG<br />
Allgemeines<br />
Die Ordnungswidrigkeit wird, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, durch Bußgeldbescheid<br />
geahndet.<br />
EL 30 Mai 2009 5
5.2 OWIG<br />
Nach § 17 Abs. 1 OWiG beträgt die Geldbuße mindestens fünf Euro und, wenn das Gesetz nichts<br />
anderes bestimmt, höchstens eintausend Euro. Das Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter<br />
hat zu der Höchstgrenze eine besondere Regelung getroffen (§ 10 Abs. 2). Danach können<br />
grundsätzlich Ordnungswidrigkeiten aufgrund von Rechtsverordnungen nach § 3 (GGVSEB, GGV-<br />
See, Gefahrgutbeauftragten-Verordnung), § 7 Abs. 1 Satz 1 oder § 7 Abs. 2 (Sofortmaßnahmeverordnungen)<br />
des Gesetzes sowie im Zusammenhang mit Verstößen gegen vollziehbare Untersagungen<br />
oder Auflagen im Rahmen von § 7 oder § 8 des Gesetzes mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend<br />
Euro geahndet werden. Für Ordnungswidrigkeiten, die Verstöße im Rahmen von § 9 –<br />
Überwachung durch die Behörden – darstellen, beträgt die Höchstgrenze eintausend Euro.<br />
Die gesetzlichen Höchstgrenzen der Bußgelder haben Bedeutung für die Verjährung der Verfolgung<br />
der Ordnungswidrigkeiten. Nach § 31 Abs. 2 Nr. 1 OWiG verjährt die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten,<br />
die mit Geldbuße im Höchstmaß von mehr <strong>als</strong> fünfzehntausend Euro bedroht sind, in<br />
drei Jahren und nach § 31 Abs. 2 Nr. 3 OWiG die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, die mit<br />
Geldbuße im Höchstmaß von bis zu eintausend Euro bedroht sind, in sechs Monaten.<br />
Grundlage für die Zumessung der Geldbuße im Einzelfall sind die Bedeutung der Ordnungswidrigkeit<br />
und der Vorwurf, der den Täter trifft (§ 17 Abs. 3 Satz 1 OWiG). Auch die wirtschaftlichen Verhältnisse<br />
des Täters kommen in Betracht; bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten bleiben sie<br />
jedoch in der Regel unberücksichtigt (§ 17 Abs. 3 Satz 2 OWiG).<br />
Die Geldbuße soll nach § 17 Abs. 4 Satz 1 OWiG den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus<br />
der Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. Reicht das gesetzliche Höchstmaß (siehe oben)<br />
nicht aus, so kann es überschritten werden (§ 17 Abs. 4 Satz 2 OWiG).<br />
Für den Bereich der Ordnungswidrigkeiten gilt das sog. Opportunitätsprinzip (§ 47 Abs. 1 OWiG).<br />
Danach liegt die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten im pflichtgemäßen Ermessen der Verfolgungsbehörden.<br />
Diese können in begründeten Fällen, z. B. wenn kein öffentliches Interesse an<br />
der Verfolgung besteht, von der Ahndung mit einer Geldbuße absehen und das Verfahren einstellen.<br />
Für die Verfolgung der Ordnungswidrigkeiten ist die Verwaltungsbehörde zuständig (§ 35 Abs. 1<br />
OWiG). Gegen den Bußgeldbescheid kann innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Zustellung<br />
Einspruch bei der Verwaltungsbehörde eingelegt werden. Über den Einspruch entscheidet das<br />
zuständige Amtsgericht (§ 68 Abs. 1 OWiG). Gegen dessen Entscheidung (Urteil oder Beschluss)<br />
ist unter den Voraussetzungen der §§ 79, 80 OWiG Rechtsbeschwerde beim zuständigen Oberlandesgericht<br />
zulässig.<br />
§ 66 OWiG<br />
Inhalt des Bußgeldbescheides<br />
(1) Der Bußgeldbescheid enthält<br />
1. die Angaben zur Person des Betroffenen und etwaiger Nebenbeteiligter,<br />
2. den Namen und die Anschrift des Verteidigers,<br />
3. die Bezeichnung der Tat, die dem Betroffenen zur Last gelegt wird, Zeit und Ort ihrer<br />
Begehung, die gesetzlichen Merkmale der Ordnungswidrigkeit und die angewendeten<br />
Bußgeldvorschriften,<br />
6 EL 30 Mai 2009
Anwendung der Vorschriften 6.1<br />
Spalte (7b)<br />
„Freigestellte Mengen“<br />
Freigestellte Mengen<br />
3.5.1.2<br />
(7b)<br />
E2<br />
Spalte (7b) enthält seit dem ADR 2009 den neuen Code für die „Freigestellten Mengen“ in Form<br />
der Angabe E0, E1, E2, E3, E4 oder E5. Die Bedingungen für die Freigestellten Mengen finden<br />
sich im neu aufgenommen Kapitel 3.5. Die Mengenbegrenzungen pro Innenverpackung und pro<br />
Packstück ergeben sich aus der folgenden Tabelle:<br />
Maximale Nettomenge<br />
Maximale Nettomenge<br />
pro Innenverpackung<br />
pro Außenverpackung (Packstück)<br />
(in Gramm für Feststoffe bzw. (in Gramm für Feststoffe bzw.<br />
Code ml für Flüssigkeiten und Gase) ml für Flüssigkeiten und Gase)<br />
E0<br />
Nicht erlaubt <strong>als</strong> freigestellte Menge<br />
E1 30 1000<br />
E2 30 500<br />
E3 30 300<br />
E4 1 500<br />
E5 1 300<br />
Wenn Versandstücke mit freigestellten Mengen die Bedingungen des Kapitels 3.5 erfüllen, unterliegen<br />
sie keinen weiteren Vorschriften.<br />
Die Verpackung muss aus Innenverpackung, Zwischenverpackung und Außenverpackung bestehen.<br />
Bei Flüssigkeiten muss zwischen Innen- und Zwischenverpackung genügend Absorptionsmaterial<br />
eingefüllt werden, um den gesamten Inhalt im Falle einer Leckage aufzusaugen.<br />
Die versandfertige Verpackung muss in der Lage sein, nachweislich einen Falltest aus 1,80 m<br />
Höhe zu überstehen, eine UN-Verpackungscodierung ist aber formal nicht erforderlich. Stellt sich<br />
in der Praxis jedoch die Frage, wie man diesen Test anderweitig nachweisen will. Die wenigsten<br />
Firmen dürfen eine geeignete Anlage für Fallversuche haben.<br />
Jedes Versandstück muss mit dem neuen Kennzeichnen gemäß Abbildung, welches mindestens<br />
10 x 10 cm groß sein muss, markiert werden.<br />
*<br />
**<br />
EL 30 Mai 2009 11
Vorschriften 6<br />
Gefahrgutbeförderung auf der Straße<br />
Aufbau und Anwendungsbereiche von GGVSEB/ADR<br />
Ein guter Teil der Unterschiede zwischen Straße und Schiene ist durch die mit der Neustrukturierung<br />
verbundene Angleichung weggefallen. Dennoch gibt es weiterhin Unterschiede<br />
und Besonderheiten für den Schienenverkehr, weswegen in diesem Werk die Unterteilung in<br />
Straßentransport (Register 6) und Transport auf der Schiene (Register 7) beibehalten<br />
wird.<br />
Im Zusammenhang mit der Neustrukturierung von ADR und RID sind GGVS und GGVE zu einer<br />
Vorschrift zusammengefasst worden. Diese Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahn (GGV-<br />
SEB) regelt die innerstaatliche, grenzüberschreitende und innergemeinschaftliche (von und nach<br />
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union) Beförderungen gefährlicher Güter auf der Straße und<br />
der Schiene. Sie umfasst 11 Paragraphen mit den Anlagen 1 bis 3. In der GGVSE wird an mehreren<br />
Stellen auf die Aussagen der zum ADR gehörenden Anlagen A und B verwiesen. Diese Anlagen<br />
sind damit ebenso rechtsverbindlich.<br />
Die GGVSE 2007 enthält folgende Paragraphen:<br />
§ 1 – Geltungsbereich<br />
§ 2 – Begriffsbestimmungen<br />
§ 3 – Zulassung zur Beförderung<br />
§ 4 – Allgemeine Sicherheitspflichten<br />
§ 5 – Ausnahmen<br />
§ 6 – Zuständigkeiten<br />
§ 7 – Fahrweg und <strong>Verlag</strong>erung im Straßenverkehr<br />
§ 8 – Schriftliche Weisungen im Schienenverkehr<br />
§ 9 – Pflichten<br />
§ 10 – Ordnungswidrigkeiten<br />
§ 11 – Übergangsbestimmungen<br />
– Anlage 1 Gefährliche Güter, für deren innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung<br />
§ 7 gilt<br />
– Anlage 2 Abweichungen von den Teilen 1 bis 7 des ADR und RID und Teilen 8 und 9 des<br />
ADR für innerstaatliche Beförderungen<br />
– Anlage 3 Nicht oder beschränkt zu benutzende Autobahnstrecken mit kennzeichnungspflichtigen<br />
Beförderungseinheiten nach Abschnitt 5.3.2 ADR bei innerstaatlichen<br />
und grenzüberschreitenden Beförderungen<br />
Mit den Änderungen im Jahr 2009 wurde die GGVSE nun um den Verkehrsträger Binnenschifffahrt<br />
erweitert zur GGVSEB. Die neue Gliederung der GGVSEB sieht nun folgendermaßen aus:<br />
§ 1 Geltungsbereich<br />
§ 2 Begriffsbestimmungen<br />
§ 3 Zulassung zur Beförderung<br />
§ 4 Allgemeine Sicherheitspflichten<br />
§ 5 Ausnahmen<br />
EL 30 Mai 2009 1
Inhaltsübersicht Anlage A des RID 7.2<br />
2 Inhaltsübersicht Anlage A des RID<br />
(Stand: 14. RID-Änderungsverordnung)<br />
Das RID ist in insgesamt 7 Teile untergliedert. Jeder Teil ist in Kapitel bzw. jedes Kapitel in<br />
Abschnitte und Unterabschnitte gegliedert.<br />
Die Teile 1 bis 7 bilden die Anlage A. Eine Anlage B gibt es im Gegensatz zum ADR nicht.<br />
Die Teile 1–7 sind mit dem ADR weitestgehend identisch. Unterschiede sind verkehrsträgerspezifisch.<br />
Die Gliederung des RID ist themenspezifisch geordnet, z. B. Klassifizierung, Versand,<br />
Beförderung.<br />
Das Herzstück bildet das Kapitel 3.2. In diesem Kapitel befindet sich in der Tabelle A das<br />
komplette Verzeichnis aller gefährlichen Güter. Das Stoffverzeichnis ist in einer 20-spaltigen<br />
Tabelle für jeden Stoff dargestellt und enthält im Wesentlichen Codes <strong>als</strong> Hinweis für<br />
die Anwendung der betreffenden Vorschriften. Den Zugang zur Anwendung der Vorschriften<br />
eröffnet die UN-Nr. (z. B. aus dem Sicherheitsdatenblatt).<br />
Darüber hinaus findet sich in der Tabelle B ein Verzeichnis der gefährlichen Güter in alphabetischer<br />
Reihenfolge. Dieses ermöglicht es über die namentliche Bezeichnung die zutreffende<br />
UN-Nummer zu finden.<br />
EL 29 Dezember 2008 1
7.2 Inhaltsübersicht Anlage A des RID<br />
5.3 Anbringen von Großzetteln (Placards) sowie Kennzeichnungen<br />
5.3.1 Anbringen von Großzetteln (Placards)<br />
5.3.1.1 Allgemeine Vorschriften<br />
5.3.1.2 Anbringen von Großzetteln (Placards) an Großcontainern, MEGC, Tankcontainern und<br />
ortsbeweglichen Tanks<br />
5.3.1.3 Anbringen von Großzetteln (Placards) an Tragwagen, auf denen Großcontainer,<br />
MEGC, Tankcontainer oder ortsbewegliche Tanks befördert werden, und an<br />
Tragwagen, die für den Huckepackverkehr verwendet werden<br />
5.3.1.4 Anbringen von Großzetteln (Placards) an Wagen für die Beförderung in loser<br />
Schüttung, Kesselwagen, Batteriewagen und Wagen mit abnehmbaren Tanks<br />
5.3.1.5 Anbringen von Großzetteln (Placards) an Wagen, in denen nur Versandstücke befördert<br />
werden<br />
5.3.1.6 Anbringen von Großzetteln (Placards) an leeren Kesselwagen, Batteriewagen,<br />
MEGC, Tankcontainern und ortsbeweglichen Tanks sowie an leeren Wagen<br />
und Großcontainern für die die Beförderung in loser Schüttung<br />
5.3.1.7 Beschreibung der Großzettel (Placards)<br />
5.3.2 orangefarbene Kennzeichnung<br />
5.3.2.1 Allgemeine Vorschriften für die orangefarbene Kennzeichnung<br />
5.3.2.2 Beschreibung der orangefarbenen Tafeln<br />
5.3.2.3 Bedeutung der Nummern zur Kennzeichnung der Gefahr<br />
5.3.3 Kennzeichen für Stoffe, die in erwärmtem Zustand befördert werden<br />
5.3.4 Rangierzettel nach Muster 13 und 15<br />
5.3.4.1 Allgemeine Vorschriften<br />
5.3.4.2 Beschreibung der Rangierzettel nach Muster 13 und 15<br />
5.3.5 Orangefarbener Streifen<br />
5.3.6 Kennzeichen für umweltgefährdende Stoffe<br />
5.4 Dokumentation<br />
5.4.1 Frachtbrief für die Beförderung gefährlicher Güter und damit zusammenhängende<br />
Informationen<br />
5.4.1.1 Allgemeine Angaben, die im Frachtbrief enthalten sein müssen<br />
5.4.1.2 Zusätzliche oder besondere Angaben für bestimmte Klassen<br />
5.4.1.3 (bleibt offen)<br />
5.4.1.4 Form und zu verwendende Sprache<br />
5.4.1.5 Nicht gefährliche Güter<br />
5.4.2 Container-Packzertifikat<br />
5.4.3 (bleibt offen)<br />
5.4.4 Beispiel eines Formulars für die Beförderung gefährlicher Güter<br />
5.5 Sondervorschriften<br />
5.5.1 (gestrichen)<br />
5.5.2 Sondervorschriften für begaste Wagen oder Container<br />
Teil 6<br />
Bau- und Prüfvorschriften für Verpackungen,<br />
Großpackmittel (IBC), Großverpackungen, ortsbewegliche Tanks,<br />
Metalltanks und Tankcontainer aus faserverstärkten Kunststoffen<br />
6.1 Bau- und Prüfvorschriften für Verpackungen<br />
6.1.1 Allgemeines<br />
6.1.2 Codierung für die Bezeichnung des Verpackungstyps<br />
8 EL 29 Dezember 2008
Vorschriften 8.1<br />
Beförderung gefährlicher Güter<br />
mit Seeschiffen<br />
1. Vorschriften<br />
1.1 Internationales Übereinkommen von 1974 zum Schutze des<br />
menschlichen Lebens auf See<br />
(International Convention Safety of Life at Sea – SOLAS)<br />
Seit Anfang dieses Jahrhunderts haben die seefahrttreibenden Nationen zur Sicherung der Seefahrt<br />
internationale Übereinkommen abgeschlossen, die im Laufe der Jahrzehnte ständig den Erfahrungen<br />
in der Seefahrt und den technischen Entwicklungen im Schiffbau angepasst wurden.<br />
Das SOLAS-Übereinkommen 1974 umfasst folgende Kapitel:<br />
Kap. I Allgemeine Bestimmungen, Besichtigungen, Zeugnisse, Unfälle<br />
Kap. II Bauart der Schiffe<br />
Stabilität und elektrische Anlagen<br />
Brandschutz, Feueranzeige, Feuerlöschung<br />
Kap. III Rettungsmittel und -vorrichtungen<br />
Kap. IV Funkverkehr<br />
Kap. V Sicherung der Seefahrt<br />
Kap. VI Beförderung von Ladung<br />
Kap. VII Beförderung gefährlicher Güter<br />
Kap. VIII Reaktorschiffe<br />
Kap. IX Maßnahmen zur Organisation eines sicheren Schiffsbetriebs<br />
Kap. X Sicherheitsmaßnahmen für Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge<br />
Kap. XI Besondere Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit der Schiffahrt (ISPS-Code,Anlagen<br />
A und B)<br />
Kap. XII Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen für Massengutschiffe<br />
Kapitel VII legt die Grundsätze über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen fest, und<br />
zwar<br />
Teil A – Beförderung gefährlicher Güter in verpackter Form<br />
Teil A-1 – Beförderung gefährlicher Güter in fester Form <strong>als</strong> Massengut<br />
Teil B – Bauart und Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher flüssiger Chemikalien<br />
<strong>als</strong> Massengut<br />
Teil C – Bauart und Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung verflüssigter Gase <strong>als</strong> Massengut<br />
EL 30 Mai 2009 1
8.1 Vorschriften<br />
Das 34. Amendment enthält die eigentlichen materiellen Vorschriften für die Beförderung<br />
gefährlicher Güter in den Bänden 1 und 2. Es umfasst sieben Teile, 2 Anhänge sowie das<br />
alphabetische Gefahrgutverzeichnis. Die einzelnen Teile sind in Kapitel, Abschnitte und<br />
Unterabschnitte gegliedert. Dazu gibt es einen Ergänzungsband, das sogenannte Supplement<br />
(Band 3). Dieser Band enthält Notfallmaßnahmen (EmS), Erste-Hilfe-Maßnahmen<br />
(MFAG), Meldeverfahren (Reporting Procedures), CTU-Packrichtlinien, Verwendung von<br />
Pestiziden in Schiffen (Use of Pesticides in Ships), den INF-Code sowie Entschließungen<br />
und Rundschreiben des Schiffsicherheitsausschusses.<br />
1.2.1 Gliederung des IMDG-Codes<br />
Teil 1 Allgemeine Vorschriften, Begriffsbestimmungen und Schulung (Band 1)<br />
Dieser Teil besteht aus 4 Kapiteln.<br />
Kapitel 1.1 enthält allgemeine Vorschriften zur Anwendung und Umsetzung des Codes sowie<br />
einen Abdruck des Kapitel VII Teil A des Internationalen Übereinkommens von 1974 zum<br />
Schutz des menschlichen Lebens auf See (SOLAS 1974), das auf den IMDG-Code verweist.<br />
Ebenfalls abgedruckt ist die Anlage III des Internationalen Übereinkommens von 1973 zur<br />
Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe, in der Fassung des Protokolls von 1978<br />
(MARPOL 73/78). Die Anlage III enthält Regeln zur Verhütung der Verschmutzung der<br />
Meere durch Schadstoffe, die in verpackter Form mit Seeschiffen befördert werden. Hier ist<br />
bestimmt, dass dies für jene Stoffe gilt, die im IMDG-Code <strong>als</strong> Meeresschadstoffe bezeichnet<br />
werden. Die nicht zur Beförderung zugelassenen Güter sind im Abschnitt 1.1.3 aufgeführt.<br />
Die Sondervorschriften über den Transport radioaktiver Stoffe wurden im neuen Kapitel 1.5<br />
aufgenommen.<br />
Kapitel 1.2 enthält die Begriffsbestimmungen, Tabellen der Maßeinheiten und Umrechnungstabellen<br />
sowie das Verzeichnis der Abkürzungen. Die hier definierten Begriffe stehen<br />
im Einklang mit den im Code verwendeten Begriffen.<br />
Kapitel 1.3 behandelt die Schulung des am Gefahrguttransport beteiligten Landperson<strong>als</strong>.<br />
Für dieses wird die aufgabenbezogene Aus- und Fortbildung empfohlen. Die Verpflichtung<br />
zur Schulung des Landperson<strong>als</strong> ergibt sich aus § 4 Abs. 12 Gefahrgutverordnung See<br />
(GGVSee). Die Ausbildung von Offizieren und Besatzungsmitgliedern, die für den Gefahrgutumschlag<br />
auf Tankschiffen verantwortlich sind, wird im STCW-Code geregelt. Auf allen<br />
anderen Seeschiffen, die Bundesflagge führen und gefährliche Güter befördern, müssen der<br />
Kapitän sowie der Ladungsoffizier über eine Schulungsbescheinigung nach Gefahrgutbeauftragtenverordnung<br />
verfügen, deren Ausstellungsdatum nicht länger <strong>als</strong> 5 Jahre zurückliegt<br />
(siehe § 4 Abs. 11 GGVSee).<br />
Kapitel 1.4. Die Vorschriften sollen die Sicherung (Gefahrenabwehr) gefährlicher Güter bei<br />
der Beförderung auf See gewährleisten.<br />
Das Kapitel enthält allgemeine Vorschriften für Unternehmen, Schiffe und Hafenanlagen,<br />
allgemeine Vorschriften für das Landpersonal sowie Vorschriften für die Beförderung gefährlicher<br />
Güter mit hohem Gefahrenpotenzial. Im Amdt. 34-08 wurden Gefahrgüter der<br />
Unterklasse 1.4 neu aufgenommen, und zwar die UN-Nummern 0104, 0237, 0255, 0267,<br />
0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456, 0500. Es hat bis auf die in Unterabschnitt<br />
1.4.1.1 erhobene Forderung, die einschlägigen Vorschriften des Kapitels XI-2 von SOLAS<br />
74 und den Internationalen Code für die Gefahrenabwehr auf Schiffen und in Hafenanlagen<br />
(ISPS-Code/in Kraft seit 1.07.2004) in Unternehmen, Hafenanlagen und auf Schiffen, die<br />
an der Beförderung gefährlicher Güter beteiligt sind, umzusetzen, Empfehlungscharakter.<br />
4 EL 30 Mai 2009
8.1 Vorschriften<br />
Kapitel 5.1 enthält allgemeine Vorschriften zur Verwendung von Umverpackungen, Ladeeinheiten<br />
(Unit Loads) und leeren ungereinigten Verpackungen. Ein großer Teil des Kapitels<br />
ist den allgemeinen Vorschriften zu Klasse 7 gewidmet.<br />
Kapitel 5.2 regelt die Beschriftung, Markierung und Kennzeichnung von Versandstücken<br />
einschließlich Großpackmitteln (IBC). Die Muster der Kennzeichen (Gefahrzettel) sind<br />
ebenfalls in diesem Kapitel enthalten. Der IMDG-Code enthält den Hinweis, dass Versandstücke<br />
mit gefährlichen Stoffen, die geringere Gefahrengrade aufweisen, von den Kennzeichnungsvorschriften<br />
ausgenommen werden können. In diesen Fällen ist in der Spalte 6<br />
der Gefahrgutliste die Sondervorschrift 29 angegeben. Bei einigen Stoffen muss jedoch das<br />
Versandstück, wie in der Sondervorschrift angegeben, beschriftet werden (Beispiele siehe<br />
5.2.2.1.2.1 IMDG-Code).<br />
Mit dem 34. Amdt. wird die Kennzeichnung von<br />
– allen Kryo-Behältern mit Ausrichtungspfeilen vorgeschrieben,<br />
– eine neue Kennzeichnung für die „Excepted Quantities“ eingeführt,<br />
– ein neues Placard/Label für Meeresschadstoffe/umweltgefährdende Stoffe eingeführt<br />
(s. a. Register 8.4).<br />
Zwecks besserer Unterscheidung gegenüber dem Kennzeichen für die Klasse 5.1 wurde<br />
auch das Kennzeichen für die Klasse 5.2 geändert (abgebildet in Register 8.4). Dieses ist<br />
jetzt in der oberen Hälfte rot mit schwarzer oder weißer Flamme. Das alte Kennzeichen darf<br />
allerdings bis zum 1.01.2011 weiter verwendet werden.<br />
Kapitel 5.3 bestimmt die Plakatierung und Markierung von Beförderungseinheiten. Anweisungen<br />
über das Anbringen von Placards und Markierungen sowie das Beschriften von<br />
Beförderungseinheiten sind enthalten. Auch das Anbringen von Warnzeichen an geschlossenen<br />
begasten Beförderungseinheiten wird in diesem Kapitel geregelt.<br />
Kapitel 5.4 beschreibt die Dokumentation. Angaben zum Inhalt und zur Form der Beförderungspapiere<br />
und zum Containerpackzertifikat können diesem Kapitel entnommen werden.<br />
Die Reihenfolge der Angaben über die gefährlichen Güter im Beförderungspapier ist<br />
verbindlich vorgeschrieben. Anzugeben sind: die UN-Nummer mit den Buchstaben UN<br />
davor; der richtige technische Name; die Klasse der Hauptgefahr; gegebenenfalls die Klasse(n)<br />
der Zusatzgefahr(en) in Klammern und die Verpackungsgruppe. Weiter wird auf das<br />
besondere Verzeichnis (Liste) nach SOLAS und die erforderliche Angabe von Notfallmaßnahmen<br />
verwiesen.<br />
Das 34. Amendment schreibt jetzt die Eintragung der Trenngruppe verbindlich vor. Werden<br />
„Freigestellte Mengen“ transportiert, muss auch dieses im Beförderungspapier vermerkt<br />
werden. Beim Transport von IBC oder ortsbeweglichen Tanks, deren Datum der wiederkehrenden<br />
Prüfung überschritten worden ist, muss dieser Umstand mit einem vorgeschriebenen<br />
Vermerk eingetragen werden. Für das Container-/Fahrzeugpackzertifikat gilt bei<br />
elektronischer Übermittlung zukünftig, dass die Angabe des Namens der verantwortlichen<br />
Person in Großbuchstaben ohne Unterschrift erfolgen darf.<br />
Teil 6 Vorschriften für den Bau und das Prüfen von Verpackungen, IBC,<br />
Großverpackungen, ortsbeweglichen Tanks und Straßenfahrzeugen (Band 1)<br />
Acht Kapitel sind Bau- und Prüfvorschriften für Verpackungen, IBC, Großverpackungen,<br />
ortsbeweglichen Tanks und Straßenfahrzeugen gewidmet. Ein weiteres Kapitel behandelt<br />
Tanks zur Beförderung fester Stoffe.<br />
8 EL 30 Mai 2009
Vorschriften 9<br />
ADNR und Gefahrgutverordnung – Binnenschifffahrt<br />
ADNR und GGVBinSch*)<br />
Die „Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf dem Rhein“ (ADNR) regelt die<br />
Beförderung gefährlicher Güter auf dem Rhein. Das ADNR wurde von der Zentral-Kommission<br />
für Rhein-Schifffahrt (ZKR) beschlossen.<br />
Das ADNR wurde durch die „ADNR-Einführungsverordnung“ 1971 in deutsches Recht übernommen<br />
und auf die Mosel und die übrigen Bundeswasserstraßen, mit Ausnahme der Donau, ausgedehnt.<br />
Die „ADNR-Einführungsverordnung“, die jetzt <strong>als</strong> „Gefahrgutverordnung-Binnenschifffahrt“<br />
(GGVBinSch) bezeichnet wird, wurde inzwischen mehrm<strong>als</strong> geändert. Mit der 8. Änderungsverordnung<br />
ist die Ausdehnung auf den deutschen Streckenteil der Donau erfolgt.<br />
Die Änderungsverordnung zum ADNR, mit der die Umstrukturierung der Vorschriften und damit<br />
eine Angleichung an die umstrukturierten Vorschriften des ADR/RID und IMDG Codes erfolgt,<br />
ist für den Rhein und die Mosel mit Wirkung zum 1. Januar 2003 in Kraft getreten (BGBl. II<br />
S. 648). Die Inkraftsetzung für die übrigen schiffbaren Binnengewässer erfolgt durch die Gefahrgutverordnung<br />
Binnenschifffahrt.<br />
Geltungsbereich des ADNR/der GGVBinSch<br />
Das ADNR gilt für die Schifffahrt auf dem Rhein (von Basel bis zu den Rheinmündungs-Häfen).<br />
Das ADNR gilt auch für Seeschiffe, die auf dem Rhein fahren. Falls Seeschiffe bestimmte Vorschriften<br />
des ADNR nicht einhalten können, benötigen sie eine Sondergenehmigung (Sg).<br />
Mit der Verordnung zur Neufassung der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf<br />
dem Rhein (ADNR) und zur Neufassung der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter<br />
auf der Mosel vom 12. Juli 2003 (BGBl. II S. 648) wurde das von der Zentralkommission<br />
beschlossene ADNR 2003 für den Rhein und die Mosel eingeführt.<br />
Die Ausdehnung der Gültigkeit auf die übrigen schiffbaren Binnengewässer Deutschlands erfolgt<br />
mit der Gefahrgutverordnung Binnenschifffahrt. Wegen der verzögerten Rechtsetzung hatte das<br />
BMVBW im Verkehrsblatt Seite 574 eine Duldungsregelung bekannt gemacht, damit bereits ab<br />
diesem Zeitpunkt das ADNR 2003 auch auf diesen Binnengwässern angewendet werden kann und<br />
keine unterschiedlichen Regelungen für den Gefahrguttransport mit Binnenschiffen für den<br />
Bereich Rhein-Mosel und die übrigen Binnengewässer angewendet werden müssen.<br />
Auf der Donau, bei der es sich um eine internationale Wasserstraße handelt, fand in der Vergangenheit<br />
Kapitel 17 der „Donau-Schifffahrtspolizei-Verordnung“ Anwendung. Ausländische Schiffe<br />
wurden durch eine so genannte Verbalnote aufgefordert, den Sicherheitsstandard der auf dem<br />
Rhein durch das ADNR gewährleistet ist, einzuhalten. Mit der 8. Verordnung zur Änderung der<br />
GGVBinSch vom 7. April 1992 (BGBl. I S. 860) ist die Ausdehnung des ADNR auf den deutschen<br />
Streckenteil der Donau erfolgt.<br />
*) Der Text der GGVBinSch ist im Abschnitt 9.6 abgedruckt.<br />
EL 22 Januar 2004 9
Gefahrgut im Luftverkehr 10<br />
Gefahrgutbeförderung im Luftverkehr<br />
1. Einführung<br />
Alle Beteiligten der Transportkette – Absender, Agenten (Spediteure), Beförderer, Abfertigungsgesellschaften,<br />
Empfänger – sind gleichermaßen gefordert, wenn es um die sichere Beförderung<br />
gefährlicher Güter geht.<br />
Im Bereich Luftverkehr hat bereits zu Anfang der 50er Jahre die Dachorganisation der Luftverkehrsgesellschaften<br />
IATA erkannt, dass eine einheitliche Regelung geschaffen werden musste, um<br />
größtmögliche Sicherheit beim Gefahrgut-Transport zu gewährleisten. Diese ersten Gefahrgutvorschriften<br />
im Luftverkehr hatten <strong>als</strong> Basis weitgehend die dam<strong>als</strong> gültigen US-Richtlinien, und waren<br />
anfänglich nur durch IATA-Resolution bindend für die Mitglieder dieser Organisation. Im Laufe der<br />
Jahre machten zahlreiche Länder diese IATA-Regeln allerdings durch regierungsseitige Anerkennung<br />
zur Vorschrift beim Lufttransport gefährlicher Güter von/nach/über ihr Hoheitsgebiet sowie für<br />
die weltweite Beförderung auf Luftfahrzeugen mit ihrer nationalen Kennung.<br />
Erst Mitte der 70er Jahre erkannten die Vereinten Nationen (UN) die Notwendigkeit, für alle Verkehrsträger<br />
möglichst einheitliche Gefahrgutvorschriften zu schaffen. Es wurde ein sog. „UN Committee of<br />
Experts“ ins Leben gerufen, das für den internationalen Verkehr Empfehlungen erarbeitete, die verkehrsträgerübergreifend<br />
allgemeine Gültigkeit bekommen sollten. Hierzu gehören z. B. die Themen<br />
Klassifizierung von Gefahrgut, Packmittelstandards, Verträglichkeit unterschiedlicher Materialien<br />
beim Zusammenpacken oder -laden u. a. m. Die Umsetzung dieser UN-Empfehlungen in die verkehrsträgerspezifische<br />
Praxis blieb dann den jeweiligen internationalen Gremien vorbehalten.<br />
So hat für den Bereich Luft die Dachorganisation des Internationalen Zivilen Luftverkehrs ICAO ein<br />
Regelwerk erarbeitet, die sog. „Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods<br />
by Air“, das voll auf den UN-Empfehlungen aufbaut. Nach Ratifizierung des „ICAO Annex 18“<br />
durch die Bundesrepublik Deutschland lösten diese „ICAO Technical Instructions“ am 1. Januar<br />
1983 die alten IATA-RAR <strong>als</strong> regierungsseitige Vorschrift ab.<br />
Trotzdem findet man heute in der Praxis fast ausschließlich die „IATA Dangerous Goods Regulations“<br />
(IATA-DGR), was viele Benutzer verwirrt. Dazu muss man wissen, dass das IATA-Handbuch<br />
<strong>als</strong> sog. „Field Document“ anerkannt wird, solange es keine Abweichungen von den ICAO Technical<br />
Instructions beinhaltet. Es bietet dem Anwender im deutschsprachigen Raum zudem den Vorteil,<br />
dass es im Gegensatz zu den ICAO T.I. in deutscher Sprache erscheint.<br />
ICAO-Annex 18 verpflichtet die national zuständigen Behörden der Mitgliedsländer, in ihrem Zuständigkeitsbereich<br />
die ICAO-Gefahrgutvorschriften (wie schon erwähnt, niedergelegt in den „Technical<br />
Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air“) zu „enforcen“, d. h., ihre Einhaltung<br />
zu überwachen.<br />
Diese Überwachung erfolgt in der Bundesrepublik Deutschland durch das LBA (Luftfahrt-Bundesamt).<br />
In Abs. 8 heißt es dazu wörtlich:<br />
„Die Aufsicht (Überwachung) über die Beförderung gefährlicher Güter im Luftverkehr obliegt der<br />
Erlaubnisbehörde. Sie erstreckt sich auf alle in den nationalen Vorschriften und internationalen<br />
Bestimmungen erfassten Teilbereiche des Gefahrguttransports, insbesondere auf die<br />
– Deklaration des Gefahrguts,<br />
– Zulässigkeit für den Lufttransport,<br />
– Begrenzung der Nettomengen pro Packstück,<br />
EL 22 Januar 2004 1
Gefahrgut-Vorschriften 10<br />
rungsvorganges ausgesetzt wird. Nur so wird er in die Lage versetzt, gewisse Anforderungen aus<br />
den „Allgemeinen Verpackungsrichtlinien“ zu verstehen. Aus diesen Transportgegebenheiten seien<br />
hier besonders erwähnt:<br />
a) Temperaturschwankungen<br />
Sie können im Bereich von ca. –40 °C bis +55 °C liegen.<br />
b) Druckminderungen<br />
Gegeben durch die Flughöhe ist es unausweichlich, dass es selbst in druckausgeglichenen<br />
Laderäumen zu Druckminderungen kommt. Man muss im Luftverkehr mit einem Druckabfall<br />
um bis zu ca. 68 kPa außerhalb eines hermetisch verschlossenen Behältnisses rechnen.<br />
c) Schwingungskräfte<br />
Bei Beschleunigungs- und Bremskräften sowie bei Turbulenzen während des Fluges wirken<br />
starke Kräfte auf die Packmittel ein. (Im Extremfall bis zu 8 g!)<br />
Große Temperaturschwankungen können verursachen, dass ein Versandgut während des Transportes<br />
(evtl. mehrfach) seinen Aggregatzustand verändert. So ist es möglich, dass eine Flüssigkeit<br />
während des Transportes nicht zu jeder Zeit flüssig ist.<br />
Ein Packmittel (bes. Kunststoff) kann durch niedrige Temperaturen sehr spröde werden.<br />
Veränderter Druck außerhalb verschlossener Bebältnisse kann zu Leckagen des Inhaltes führen. Ein<br />
altbekannter Standardfehler bei der Vorbereitung zum Lufttransport ist so z. B. der Einsatz von ungesicherten<br />
Eindruckdeckeln (Farbdosen!). Die allgemeinen Verpackungsrichtlinien für den Gefahrgutversand<br />
verbieten die Anwendung solcher nicht zusätzlich gesicherter Reibungsverschlüsse.<br />
Um sich und seine Mitarbeiter vor Regressansprüchen der Beförderer einerseits, andererseits vor<br />
Strafen wegen Gefährdung der Transportsicherheit zu schützen, sind hier umfassende Kenntnisse<br />
gefordert, die man nur in einer intensiven Schulung erwerben kann.<br />
2.1 Gliederung der IATA-DGR<br />
Die IATA-DGR gliedert sich in 10 Abschnitte und 9 Anhänge mit folgenden Inhalten:<br />
Abschnitt 1<br />
Abschnitt 2<br />
Abschnitt 3<br />
Abschnitt 4<br />
Abschnitt 5<br />
Abschnitt 6<br />
Abschnitt 7<br />
Abschnitt 8<br />
Abschnitt 9<br />
Abschnitt 10<br />
Anwendung<br />
Begrenzungen<br />
Klassifizierung<br />
Identifizierung<br />
Verpacken<br />
Verpackungsspezifikationen und Prüfverfahren<br />
Markierung und Kennzeichnung<br />
Dokumentation<br />
Abfertigung<br />
Radioaktive Stoffe<br />
EL 29 Dezember 2008<br />
4a