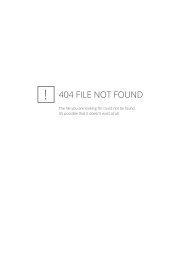Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>AHF</strong><br />
Arbeitsgemeinschaft historischer Forschungseinrichtungen<br />
in der Bundesrepublik Deutschland e.V.<br />
<strong>AHF</strong>-<strong>Information</strong> Nr. 135 vom 08.10.2013<br />
Das Auswärtige Amt in der NS-Diktatur –<br />
Forschungsstand, Forschungskontroversen, Forschungsdesiderate<br />
Akademie für Politische Bildung Tutzing in Kooperation<br />
mit dem Institut für Zeitgeschichte München-Berlin<br />
Tutzing, 21. bis 23. Juni 2013<br />
Die 2010 erschienene Studie "Das Amt und die Vergangenheit" hat weit über die Kreise der Geschichtswissenschaft<br />
hinaus großes Aufsehen erregt. Die unter Joschka Fischer als damaligem Außenminister im Jahr<br />
2005 initiierte und von einer unabhängigen Historikerkommission erstellte Arbeit hat neben Zuspruch viel<br />
Kritik erfahren. Der Disput, der sowohl fachwissenschaftlich als auch publizistisch in einer Vielzahl von<br />
Medien ausgetragen wurde, kreiste u.a. um die Frage, inwieweit das Auswärtige Amt in die Politik des<br />
"Dritten Reichs" involviert war, ja gleichsam vorauseilend die nationalsozialistische Politik der Gewalt gegen<br />
Juden und den Holocaust aktiv mitgeplant und -gestaltet hat. Die Bandbreite der Diskussion reichte darüber<br />
hinaus von der Kritik an methodischen Aspekten über Fragen der Quellenauslegung bis zum Vorwurf der<br />
"Geschichtspornografie", der von Sönke Neitzel mit Blick auf eine vermeintliche Sensationsgier der Historikerkommission<br />
vorgebracht wurde. 1 Dem Streit gehörten neben historiographischen Kritikpunkten zugleich<br />
geschichtspolitische Aspekte an, deren polemische Stoßrichtung eine sachliche und argumentativ<br />
untermauerte Diskussion mitunter unmöglich machte. An die Stelle forschungsintensiver<br />
Auseinandersetzungen traten publizistisch scharf geführte Wortgefechte, Rechtfertigungsversuche und<br />
Diskussionen auf benachbarten Feldern, so etwa mit Blick auf die Rolle des Archivs des Auswärtigen Amts.<br />
Ein vitaler Diskurs jedoch, von dem etwa geschichtswissenschaftliche Impulse ausgegangen wären, hatte sich<br />
nicht ausgebreitet. Dieser Umstand wurde von Michael Mayer von der Akademie für Politische Bildung<br />
Tutzing und Johannes Hürter vom Institut für Zeitgeschichte München-Berlin zum Anlass genommen, zur<br />
Tagung "Das Auswärtige Amt in der NS-Diktatur" einzuladen, die als Bestandsaufnahme zu Forschungsstand,<br />
-kontroversen und -desideraten gedacht war, ohne einmal mehr die vorherigen Grabenkämpfe der<br />
Debattenteilnehmer, von denen zahlreiche anwesend waren, neu zu entfachen. Ziel der Tagung war vielmehr,<br />
die Ergebnisse der Studie wissenschaftlich zu prüfen und weiterzuentwickeln. Die Sektionseinteilung orientierte<br />
sich an den Kernpunkten der fachlichen Kritik. Die erste fokussierte die personale Struktur des Auswärtigen<br />
Amts unter dem Blickpunkt von Kontinuität und Diskontinuität. In der zweiten Sektion rückte die<br />
Politik des Auswärtigen Amts, mithin das Kerngeschäft in den Vordergrund, dessen Anteil an der<br />
Expansions- und Eroberungspolitik des "Dritten Reichs" gewichtet werden sollte. Die dritte Sektion führte zur<br />
Frage, inwieweit das Auswärtige Amt in die Gewalt und Verbrechen des NS-Staats involviert war – ein<br />
Aspekt, dem in der Studie viel Gewicht gegeben wurde, wonach dem Auswärtigen Amt eine zentrale Rolle in<br />
der Ermordung der europäischen Juden zugekommen sei. In einer abschließenden Podiumsdiskussion wurde<br />
auf die vorhergehende Debatte zurückgeblickt, um diese in generelle Fragen nach Erinnerungskultur und<br />
Geschichtsbildern einzuordnen.<br />
1<br />
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-75476918.html
<strong>AHF</strong>-<strong>Information</strong> Nr. 135 vom 08.10.2013 2<br />
Die erste Sektion eröffnete Martin Kröger (Berlin). In seiner Darstellung behandelte er die Struktur und<br />
Entwicklung des mittleren und höheren Diensts im Auswärtigen Amt. Dessen Mitarbeiteranzahl habe im<br />
Verlauf seiner Geschichte und auch während des Zweiten Weltkriegs konstant zugenommen. Exakte quantitative<br />
wie qualitative Aussagen über die personale Organisation seien jedoch aufgrund der mangelhaften<br />
Aktenlage nur bedingt möglich, weil die einschlägigen Unterlagen der Personal- und Verwaltungsabteilung<br />
aufgrund von Kriegsschäden nur noch als Restbestände vorhanden seien. Es könne aber festgehalten werden,<br />
dass sowohl im gehobenen als auch im höheren Dienst die Zahl der NSDAP-Beitritte seit 1933 zunächst<br />
exponentiell angestiegen und bis 1939 wieder abgeebbt sei. Im höheren Dienst sei indes – anders als für den<br />
gehobenen Dienst – für die Jahre ab 1937 eine Zunahme von solchen Mitarbeitern festzustellen, die über<br />
Institutionen der NSDAP, z.B. die Dienststelle Ribbentrop, in das Auswärtige Amt gelangten, da zuvor gültige<br />
Einstellungskriterien im höheren Dienst nicht mehr beachtet worden seien.<br />
Annette Schmidt-Klügmann (Marburg) referierte in ihrem Vortrag über Bernhard von Bülow, Friedrich Gaus<br />
und Hans-Heinrich Dieckhoff als leitende Beamte des Auswärtigen Amts im Spannungsfeld zwischen<br />
Kontinuität und Anpassung an die NS-Politik in den ersten Jahren nach 1933. Sie stellte heraus, dass die<br />
Amtsleitung zunächst versuchte, eine eigene, sich von den Nationalsozialisten deutlich unterscheidende Revisionslinie<br />
durchzusetzen, sich dann aber zunehmend den aggressiven außenpolitischen Methoden Hitlers<br />
anglich, indem sie diese abschirmte und rechtfertigte. Diese beiden Tendenzen wurden am Beispiel der<br />
Ostpolitik und der Rheinlandpolitik veranschaulicht. Dem Erfolg der Methoden Hitlers hatten Revisionspolitiker<br />
wie Bülow, Gaus und Dieckhoff wenig entgegenzusetzen. Als Folge ihrer Anpassung leistete die<br />
Amtsleitung nicht nur der Aggressionspolitik Vorschub, sondern auch den weiterreichenden verbrecherischen<br />
Zielen des NS-Regimes. Der Vortrag endete mit dem Hinweis auf die Notwendigkeit differenzierter<br />
biographischer Untersuchungen, um den Grad der Freiwilligkeit in diesem Prozess genauer austarieren zu<br />
können.<br />
Die Personalpolitik der Außenminister Konstantin von Neurath und Joachim von Ribbentrop stellte Lars<br />
Lüdicke (Potsdam) vor. Mit Hitler als neuem Reichskanzler habe sich die personale Zusammensetzung des<br />
Auswärtigen Amts nur sehr gering verändert. Das Ministerium habe im Gegenteil einen weitgehend<br />
homogenen Beamtenkörper dargestellt, von dem ein Großteil der aktiven Spitzendiplomaten bereits im<br />
Kaiserreich aktiv gewesen sei. In den frühen Jahren der NS-Diktatur seien nur wenige Quereinsteiger in das<br />
Auswärtige Amt gelangt, da die hohe Qualifikation für den auswärtigen Dienst der Gleichschaltung entgegenstand.<br />
Der Beitritt zur NSDAP sei darüber hinaus nur begrenzt aussagekräftig, wie das Beispiel<br />
Friedrich-Werner von der Schulenburgs zeige. Auch nach der Ernennung Ribbentrops zum Außenminister<br />
sei es zu keiner Einberufungs- oder Entlassungswelle von Mitarbeitern gekommen. Erst im Krieg und besonders<br />
ab 1943 habe Ribbentrop die Personalstruktur essenziell umgebaut, wodurch die vorherigen traditionellen<br />
Karrierewege in das Auswärtige Amt ihre Bedeutung zugunsten von Seiteneinsteigern verloren hätten.<br />
Rainer Blasius (Frankfurt a.M.) fokussierte in seiner Schilderung die Erinnerungspolitik des Auswärtigen<br />
Amts zum 20. Juli 1944. Zum Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime sei nach Kriegsende auch<br />
Ernst von Weizsäcker gezählt worden, dessen Nimbus in die Zeit des Wilhelmstraßen-Prozesses<br />
zurückreiche, in dem der ehemalige Staatssekretär des Auswärtigen Amts von seinen Verteidigern zu einem<br />
Mann des Widerstands stilisiert worden sei. Dieser Anschein habe sich ebenfalls auf das Auswärtige Amt<br />
übertragen und jenen positiven Traditionsstrang konstituiert, demzufolge das Ministerium von Ribbentrops<br />
Gefolgsleuten unterwandert worden, im Kern aber rechtschaffen und ein "Hort des Widerstands" gewesen sei.<br />
Problematisch und gleichermaßen brisant sei seit 1945 der Umstand gewesen, wer in der Gedenkpraxis des<br />
Auswärtigen Amts zum Widerstand gerechnet wurde. Dazu seien Personen wie etwa Rudolf von Scheliha zu<br />
zählen, dessen Name sich zwar nunmehr auf einer Gedenktafel befinde, dem aber bis zur Jahrtausendwende
<strong>AHF</strong>-<strong>Information</strong> Nr. 135 vom 08.10.2013 3<br />
eine Ehrung verwehrt geblieben sei. Nach wie vor stehe indes eine Ehrung beispielsweise für die 1942<br />
hingerichtete Ilse Stöbe aus.<br />
Georges-Henri Soutou (Paris) verglich die deutsche und französische Diplomatie der Jahre 1933 bis 1945.<br />
Obwohl sich das Deutsche Reich und Frankreich in ihrer Innen- wie Außenpolitik grundsätzlich voneinander<br />
unterschieden hätten, seien sich die Diplomaten beider Länder hinsichtlich ihrer sozialen Stellung und ihrer<br />
politischen Disposition ähnlich gewesen. Als Verfechter vom Primat der Außenpolitik, wie Soutou ausführte,<br />
seien diese ab 1933 bzw. ab 1940 mit zwei grundlegenden Herausforderungen konfrontiert gewesen. Wie weit<br />
prägte erstens die Ideologie die auswärtige Politik, konnten zweitens Beamte einem Staat dienen, in dem die<br />
traditionellen bürgerlichen Werte negiert wurden? Gemein war beiderseits des Rheins, so betonte Soutou z.B.<br />
mit Blick auf Ernst von Weizsäcker in Berlin und Charles Rochat in Vichy, dass viele Diplomaten das Amt, für<br />
das sie arbeiteten, und dessen Organisation höher gewichteten als die persönliche Verantwortung im<br />
politischen Geschehen.<br />
Die zweite Sektion leitete Marie-Luise Recker (Frankfurt a.M.) mit einem Vortrag zu Ergebnissen und<br />
Perspektiven der Forschung zur Außenpolitik des Auswärtigen Amts ein. Diese könne als gut erforscht gelten,<br />
seien doch bereits frühzeitig zentrale Quellen zum Verlauf der Außenpolitik durch umfangreiche Akteneditionen<br />
verfügbar gewesen. Nach Recker kann die Meinung von der Dialektik traditioneller Revisions- und<br />
NS-Lebensraumpolitik als etabliert gelten. Darüber hinaus habe sich für das Gros der Forschung nichts an der<br />
Ansicht geändert, dass Hitler in der Außenpolitik gegenüber anderen Akteuren eine ausschlaggebende Rolle<br />
zugekommen sei. Recker skizzierte ferner die These vom »Niedergang« des Auswärtigen Amts, derzufolge<br />
dieses seit 1933 immer mehr an Einfluss einbüßen musste. Eng damit sei das Forschungsfeld zu Kontinuität<br />
und Neuansatz in der Außenpolitik des NS-Staats verbunden gewesen. Studien gleichwohl, die die Kriegsjahre<br />
in den Blick nehmen, seien demgegenüber unterrepräsentiert, was Recker zufolge einem klassischen<br />
Verständnis von Außenpolitik als Beziehung von souveränen Staaten geschuldet ist. Ein Desiderat der<br />
Forschung mache Recker ebenso in der kaum erforschten Kontinuitätslinie der organisatorischen und<br />
personalen Struktur des Auswärtigen Amts vom Beginn des 20. Jahrhunderts aus. Auch kulturgeschichtliche<br />
Annäherungen, etwa die Frage nach einem nationalsozialistischen Verhandlungsstil oder Inszenierungen von<br />
Staatsbesuchen, seien weitere zentrale Forschungsfelder, denen nachgegangen werden müsse.<br />
Über die Politik des Auswärtigen Amts bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs referierte Wolfgang Michalka<br />
(Heidelberg). Der Nichtangriffspakt zwischen dem Deutschen Reich und Polen habe 1934 zwar eine deutliche<br />
Abkehr von der traditionellen Revisionspolitik bedeutet, mit dem sich Hitler über die Interessen der<br />
Reichswehr, Wirtschaft und insbesondere des Auswärtigen Amts hinweggesetzt habe, wie Michalka darlegte.<br />
Nichtsdestotrotz habe bis zum eigentlichen Fernziel Hitlers, der "Eroberung von Lebensraum im Osten", eine<br />
Teilidentität in der außenpolitischen Stoßrichtung zwischen der konservativen Elite und dem »Führer«<br />
bestanden. Der zentrale Unterschied indes habe in der Wahl der Mittel gelegen, denn spätestens seit 1937 sei<br />
evident gewesen, dass Hitler vor einem Krieg nicht zurückschrecke. Dabei hatte nach Michalka Joachim von<br />
Ribbentrop einen nicht unerheblichen Anteil daran, dass Hitler sich seitdem auch von seinem ursprünglich<br />
erhofften Bündnispartner Großbritannien ab- und sich zur Sowjetunion hinzuwenden begann. Bedeutsam<br />
für die Forschung sei, einzelne Entscheidungsträger in der Polykratie von Personen und Ressorts zu<br />
fokussieren, schließlich sei durch diese die deutsche Außenpolitik nicht unerheblich dynamisiert worden.<br />
Die Nordeuropapolitik des Auswärtigen Amts während des Zweiten Weltkriegs nahm Michael Jonas (Hamburg)<br />
in den Blick. Er skizzierte die Komplexität des nordeuropäischen Raums als Panorama aus divergierender<br />
Außenpolitik, der paradigmatisch für ganz unterschiedliche Modi von Bilateralität im Krieg, mithin<br />
für die Bündnis-, Expansions- und Besatzungspolitik des Deutschen Reichs stehen könne. Die Nordeuropapolitik<br />
des Auswärtigen Amts, namentlich des Referats VI für Skandinavien der Politischen Abteilung unter<br />
Werner von Grundherr hatte nach Jonas daher mit ganz unterschiedlichen Erfordernissen umzugehen. War
<strong>AHF</strong>-<strong>Information</strong> Nr. 135 vom 08.10.2013 4<br />
in Dänemark unter Werner Best als Reichsbevollmächtigtem eine milde Variante der Bündnisverwaltung<br />
installiert worden, trat in Norwegen eine deutlich schärfere Okkupationspolitik zu Tage, während das Beispiel<br />
Finnland den komplexesten Fall darstellt: ein heterogenes Beziehungsgeflecht, wie Jonas bekräftigte, in dem<br />
der deutsche Gesandte Wipert von Blücher eine Art von Alternativpolitik zu initialisieren wusste. Wie Jonas<br />
betonte, könne damit eine verengte Perspektive von vergröberten Idealtypen nationalsozialistischer<br />
Gewaltherrschaft aufgebrochen und erweitert werden.<br />
Das Verhältnis zwischen dem Auswärtigen Amt und dem Reichssicherheitshauptamt (RSHA) skizzierte<br />
Magnus Brechtken (München) innerhalb der dritten Sektion zum Auswärtigen Amt und den NS-Verbrechen.<br />
Brechtken verwies darauf, dass in der Regelung der sogenannten "Judenfrage" bis zum Krieg keine einheitliche<br />
Politik existiert habe. In der Interessendivergenz der unterschiedlichen Akteure habe das Auswärtige<br />
Amt indes nur eine untergeordnete Rolle gespielt, wenn es darum ging, die operative Handlungsdominanz zu<br />
gewinnen. Stärker in den Fokus rückte Brechtken das SD-Hauptamt, das eine praktische Lösung der<br />
"Judenfrage" befolgt habe. So entstamme der erstmals im Sommer 1938 gefallene Begriff der "Endlösung"<br />
gleichfalls einem SD-internen Papier. Im Prozess der Radikalisierung habe das Auswärtige Amt eher eine<br />
instrumentell-kooperative Funktion erfüllt. Die Bildung des RSHA sei eine organisatorische Antwort auf jene<br />
neue ideologische "Herausforderung" gewesen. Brechtken regte deshalb an, dass eine adäquate Bewertung<br />
einer Behörde nur in multi-institutionaler Perspektive möglich sei. Ihm zufolge ist eine solcherart integrierte<br />
Geschichte des Auswärtigen Amts nach wie vor ein Desiderat der Forschung.<br />
Michael Mayer (Tutzing) beleuchtete die deutsche Botschaft in Paris vor dem Hintergrund der NS-Politik im<br />
besetzten Frankreich. Dieses könne als Sonderfall der deutschen Besatzungsherrschaft in Europa gelten, da<br />
die Botschaft des Deutschen Reichs hier über vergleichsweise weitreichende Kompetenzen verfügte und, wie<br />
Mayer darlegte, eine tragende Säule der deutschen Okkupation war. Gleichwohl könne – entgegen der Studie<br />
der Historikerkommission – keine Rede davon sein, dass das Auswärtige Amt für Verfolgung, Deportation<br />
und Mord von Juden maßgebende Impulse gesetzt habe. Entscheidend war nach Mayer die Militärverwaltung,<br />
die über das letzte Wort in der Durchsetzung von antisemitischen Maßnahmen verfügt habe.<br />
Darüber hinaus sei die Deportation der Juden von der Zustimmung der Vichy-Regierung abhängig gewesen.<br />
Hier hatten für die deutsche Botschaft politische Erwägungen, etwa der Erhalt der Kollaborationsbereitschaft,<br />
größere Bedeutung als die Umsetzung des Holocaust. Entscheidend vorangetrieben wurde dieser, so Mayers<br />
Fazit, vom Auswärtigen Amt daher nicht.<br />
Über das Auswärtige Amt und den Holocaust referierte Moshe Zimmermann (Jerusalem). Im Vergleich zur<br />
Studie, an der Zimmermann als Mitglied der Historikerkommission beteiligt gewesen war, fiel sein Urteil<br />
darüber, inwieweit das Auswärtige Amt an den Verbrechen gegen Juden beteiligt war, milder aus. Es habe, so<br />
Zimmermann, innerhalb des Ministeriums verschiedene Grauschattierungen des Antisemitismus gegeben.<br />
Sicher sei, dass die Haupttäter des Holocaust nicht im Auswärtigen Amt angesiedelt gewesen seien. Dennoch<br />
sei festzustellen, dass hier ein antisemitischer "state of mind" vorgeherrscht habe – mit der Konsequenz, dass<br />
Diplomaten und andere Mitarbeiter des Auswärtigen Amts die Verbrechen gegen Juden toleriert, abgeschirmt,<br />
ja teilweise vorangetrieben hätten. Ebenfalls müsse man den Blick auf die Auslandsvertretungen des<br />
Auswärtigen Amts werfen, die als Teil des Gesamtapparates anti-jüdisch eingestellt gewesen seien und<br />
entsprechende Maßnahmen gegen Juden mitgetragen hätten, obgleich sie, dies das Fazit Zimmermanns, als<br />
Diplomaten vor Ort über nahen Kontakt zum Rest der Welt verfügten, mithin weniger von der NS-<br />
Propaganda beeinflusst hätten sein müssen.<br />
Den Anteil des Auswärtigen Amts, die nationalsozialistische Politik auch abseits des Holocaust<br />
durchzusetzen, betrachtete Sebastian Weitkamp (Esterwegen). Dies sei ein weniger beachtetes Feld als die<br />
Mitwirkung am Holocaust, obgleich beispielsweise im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess die Beteiligung<br />
des Auswärtigen Amts am Holocaust eine eher untergeordnete Rolle gespielt habe. Der Vorwurf habe sich in
<strong>AHF</strong>-<strong>Information</strong> Nr. 135 vom 08.10.2013 5<br />
erster Linie dahin gerichtet, dass das Auswärtige Amt bei der Planung eines Angriffskrieges mitgewirkt habe.<br />
Dieses habe auch die Kriegsführung selbst dergestalt unterstützt, indem es im Ausland eine intensive Presse-<br />
Arbeit betrieben habe und an der Besatzungspolitik beteiligt gewesen sei. Als Instrument der NS-Führung sei<br />
das Auswärtige Amt den verbrecherischen Richtlinien der NS-Gewaltpolitik weitgehend gefolgt und habe eng<br />
mit anderen Institutionen, auch der SS, dem SD und der Sicherheitspolizei, zusammengearbeitet. Gängige<br />
Praxis war nach Weitkamp die konkrete Durchführung durch das RSHA und die SS, während das Auswärtige<br />
Amt diese Verbrechen unterstützte und auch außenpolitisch abzuschirmen versuchte.<br />
Im Vortrag Hans-Jürgen Döschers (Osnabrück) wurde für die Rolle ehemaliger Diplomaten nach 1945 das<br />
Beispiel des SS-Angehörigen Bernd Gottfriedsen dargelegt. 1937 wurde Gottfriedsen in die SS aufgenommen<br />
und stieg dort unter der Protektion Ribbentrops bis zum SS-Sturmbannführer auf. Im Auswärtigen Amt, wo<br />
er 1942 ohne Prüfung sogar zum Legationsrat I. Klasse befördert wurde, übernahm er die Verwaltung des<br />
Gold- und Devisenfonds und war am Raub von Kulturgütern in besetzten Gebieten beteiligt. Nach dem<br />
Kriegsende hatte sich Gottfriedsen vor der Spruchkammer in Bielefeld dafür zu verantworten, Mitglied der SS<br />
und im Wissen um deren Verbrechen gewesen zu sein. Nach einer milden Strafe, bedingt durch die Hilfe und<br />
Aussagen zweier Freunde aus der NS-Zeit, beantragte Gottfriedsen 1952 seine Wiederverwendung im Auswärtigen<br />
Amt. Doch der Antrag wurde abgelehnt. Er habe, so die Begründung des zuständigen Referatsleiters<br />
in Personalfragen, keine diplomatisch-konsularische Prüfung abgelegt gehabt und sei nur wegen seiner engen<br />
Verbindung zur NSDAP in das Auswärtige Amt gelangt. Trotz seines Widerspruchs blieb man dort bei der<br />
Entscheidung, Gottfriedsen nicht wiederzuverwenden. 1954 bewarb sich dieser daher bei der privaten evangelischen<br />
Christian-Schule in Hermannsburg und wurde vor seiner Pensionierung 1976 noch zum Oberstudienrat<br />
ernannt. Das Beispiel zeige, dass es für die Wiederverwendung von Diplomaten Grenzen gab. Viele<br />
Ehemalige jedoch hätten durch anderweitige Unterstützung, auch der Kirchen, zu neuen Karrieren gefunden.<br />
Die abschließende Podiumsdiskussion zwischen Johannes Hürter, Michael Mayer, Hans Mommsen sowie den<br />
beiden Kommissionsmitgliedern Eckart Conze und Moshe Zimmermann eröffnete Tagungsleiter Mayer mit<br />
seinem Resümee, dass drei Kernfragen der Debatte, die seit dem Erscheinen der Studie kontrovers diskutiert<br />
wurden, im Verlauf der Tagung geklärt worden und eindeutig zu verneinen seien. Dies seien die Fragen, ob<br />
das Auswärtige Amt tonangebend in den Entscheidungsprozess zum Holocaust involviert gewesen sei, ob<br />
zwischen dem Auswärtigen Amt und dem Reichssicherheitshaupt eine gleichwertige Beziehung bestanden<br />
und ob das Auswärtige Amt entscheidende Impulse im Holocaust gegeben habe.<br />
Für Eckart Conze indes ist der Diskurs um das Auswärtige Amt nicht zu Ende. Ihm zufolge setzt die wissenschaftliche<br />
Diskussion erst ein. Er beobachte, dass die Studie das wissenschaftliche Interesse an weiterer<br />
Forschung angeregt habe. Diese gehe mittlerweile weit über die alte Apologetik vorheriger Jahre hinaus und<br />
analysiere das Auswärtige Amt vor dem Hintergrund eines anderen Verständnisses von Staatlichkeit, die<br />
nicht nur auf den Bedeutungsverlust der Diplomatie abhebe, sondern neue Interessenfelder und Desiderate<br />
ausfindig mache.<br />
Johannes Hürter hob hinsichtlich der Debatte der letzten Jahre darauf ab, dass für ihn die Nachwirkung einer<br />
defizitären Streitkultur vorhanden bleibe. Bezug nehmend auf seinen Rezensionsaufsatz, in dem er vor allen<br />
Dingen kritisiert habe, dass die diplomatische Elite als homogener Block ohne diachronen Transformationsprozess<br />
dargestellt werde, warf Hürter ein, dass sein Beitrag lediglich als Impuls zur Verwissenschaftlichung<br />
einer hitzig geführten Auseinandersetzung intendiert war. Vorgeworfen worden sei ihm aber, er habe eine<br />
politische Agenda verfolgt. Die rege Forschung zur Diplomatie sei darüber hinaus nicht nur der Studie selbst,<br />
sondern insbesondere auch der Debatte um diese zu verdanken.<br />
Die gleiche Stoßrichtung schlug Hans Mommsen ein. In der Studie sei zu einseitig fokussiert worden, inwieweit<br />
das Auswärtige Amt am Holocaust beteiligt gewesen sei. Er hätte sich gewünscht, dass das Blickfeld
<strong>AHF</strong>-<strong>Information</strong> Nr. 135 vom 08.10.2013 6<br />
erweitert worden wäre und gleichzeitig andere NS-Verbrechen ins Blickfeld gerückt worden wären. Auch sei<br />
die Rolle des Widerstands im Auswärtigen Amt, wie Mommsen kritisierte, vergleichsweise heruntergespielt<br />
worden.<br />
Moshe Zimmermann dagegen versuchte, die Diskussion ebenso auf erinnerungspolitische Aspekte zu lenken.<br />
Er sei der Meinung, dass geschichtliche Erinnerung immerzu einer Auffrischung bedarf. Das, was man kenne,<br />
sei stets im Begriff zu erodieren. So sei beispielsweise der Reisekostenbericht Rademachers bereits seit<br />
längerem bekannt gewesen. Doch habe dieser erst jetzt durch die Studie für großes Aufsehen gesorgt. Daneben<br />
sei es für die Forschung bedeutsam, einen anderen Blickwinkel einzunehmen. Es war nicht das Auswärtige<br />
Amt im "Dritten Reich", sondern das Auswärtige Amt des "Dritten Reichs". Es sei nicht die Rede<br />
davon, dass das Auswärtige Amt den Holocaust initiiert habe. Doch die Bereitschaft und das Mitwissen zur<br />
Ermordung der Juden seien vorhanden gewesen. Man könne, um den Sachverhalt auf einen Nenner zu<br />
bringen, von "Hitlers willigen Abschirmern" sprechen.<br />
Insgesamt wurde die dreitägige Tagung der anfänglich von Michael Mayer vorgebrachten Intention, die<br />
mitunter von politischer Motivation und polemischer Schärfe beeinflusste Debatte um "Das Amt und die<br />
Vergangenheit" auf eine ausschließlich wissenschaftliche Diskussionsebene zu stellen, voll gerecht. Die Tagung<br />
erfüllte dabei die beiden Ansprüche, eine Retrospektive auf den vorherigen Diskurs einzunehmen und<br />
neue Perspektiven für die Forschung aufzuzeigen. Im rein wissenschaftlichen Klima der Konferenz wurden<br />
zahlreiche Desiderate deutlich gemacht, die durch die Studie der Historikerkommission nicht oder nur in<br />
Teilen angerissen worden sind. Dazu gehören mentalitätsgeschichtliche Herangehensweisen oder auch Verbrechen<br />
abseits des Holocaust, in die das Auswärtige Amt involviert war. Es bleibt zu wünschen, dass sich die<br />
Aufforderung Johannes Hürters erfüllen wird: "Gehen Sie forschen!"<br />
Kontakt:<br />
Jan Zinke<br />
Historisches Seminar, Westfälische Wilhelms-Universität Münster<br />
E-Mail: jan.zinke@uni-muenster.de<br />
Jan Zinke (Münster)<br />
Konferenzübersicht:<br />
Sektion 1: Das Personal des Auswärtigen Amts. Kontinuitäten und Diskontinuitäten<br />
Martin Kröger (Berlin): Personalstruktur und Personalentwicklung im Mittleren und Höheren Dienst<br />
Annette Schmidt-Klügmann (Marburg): Bernhard von Bülow, Friedrich Gaus, Hans-Heinrich Dieckhoff. Die<br />
Amtsleitung zwischen Kontinuität und Anpassung<br />
Lars Lüdicke (Potsdam): Die Personalpolitik der Minister Neurath und Ribbentrop<br />
Rainer Blasius (Frankfurt): Der 20. Juli in der Erinnerungspolitik des Auswärtigen Amts<br />
Georges-Henri Soutou (Paris): Amt und Verantwortung. Diplomaten in Deutschland und Frankreich 1933-<br />
1945
<strong>AHF</strong>-<strong>Information</strong> Nr. 135 vom 08.10.2013 7<br />
Sektion 2: Das außenpolitische Kerngeschäft des Auswärtigen Amts<br />
Marie-Luise Recker (Frankfurt): Die Außenpolitik des Auswärtigen Amts. Ergebnisse, Probleme und Perspektiven<br />
der Forschung<br />
Wolfgang Michalka (Heidelberg): Das Auswärtige Amt und der Weg in den Krieg<br />
Michael Jonas (Hamburg): Die Nordeuropapolitik des Auswärtigen Amts im Zweiten Weltkrieg<br />
Sektion 3: Das Auswärtige Amt und die NS-Verbrechen<br />
Magnus Brechtken (München): Das Auswärtige Amt und das Reichssicherheitshauptamt<br />
Michael Mayer (Tutzing): Die Deutsche Botschaft Paris und die NS-Unrechtspolitik im besetzten Frankreich<br />
Moshe Zimmermann (Jerusalem): Das Auswärtige Amt und der Holocaust<br />
Sebastian Weitkamp (Esterwegen): Die Unterstützung des Auswärtigen Amts bei der Durchsetzung der NS-<br />
Gewaltpolitik abseits des Holocaust<br />
Hans-Jürgen Döscher (Osnabrück): Neue Forschungen zum Auswärtigen Amt vor dem Hintergrund älterer<br />
Befunde<br />
Podiumsdiskussion: Vom Nutzen und Nachteil eines Historikerstreits: Was bleibt von der Debatte über "Das<br />
Amt"?<br />
Empfohlene Zitierweise / recommended citation style:<br />
<strong>AHF</strong>-<strong>Information</strong>. 2013, Nr.135<br />
URL: http://www.ahf-muenchen.de/Tagungsberichte/Berichte/pdf/2013/135-13.pdf<br />
Die Rechte für den Inhalt liegen bei den jeweiligen Autoren. Die Rechte für die Form dieser Veröffentlichung liegen bei der<br />
Arbeitsgemeinschaft historischer Forschungseinrichtungen in der Bundesrepublik Deutschland e.V.<br />
<strong>AHF</strong>, Schellingstraße 9, 80799 München<br />
Telefon: 089/13 47 29, Fax: 089/13 47 39<br />
E-Mail: info@ahf-muenchen.de<br />
Website: http://www.ahf-muenchen.de