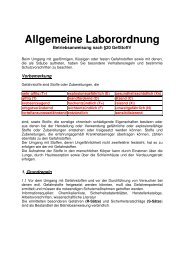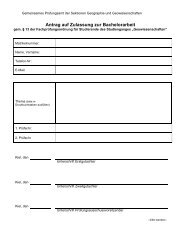Geologie am Ostrand der Ela-Decke zwischen Val d'Urezza und ...
Geologie am Ostrand der Ela-Decke zwischen Val d'Urezza und ...
Geologie am Ostrand der Ela-Decke zwischen Val d'Urezza und ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Geologie</strong> <strong>am</strong> <strong>Ostrand</strong> <strong>der</strong> <strong>Ela</strong>-<strong>Decke</strong> <strong>zwischen</strong> <strong>Val</strong><br />
<strong>d'Urezza</strong> <strong>und</strong> Schanf -Dolomit<br />
ANNA SOPHIE WELLMANN<br />
Kartierung: 38 S.<br />
Kurzfassung:<br />
Im Sommer des Jahres 2002 wurde eine Geländeaufnahme <strong>der</strong> unter- <strong>und</strong> oberostalpinen<br />
Einheiten <strong>am</strong> <strong>Ostrand</strong> <strong>der</strong> <strong>Ela</strong>-<strong>Decke</strong> <strong>zwischen</strong> dem <strong>Val</strong> d´Urezza <strong>und</strong> dem Dolomit von S-chanf<br />
im Maßstab 1:10.000 durchgeführt. Im Kartiergebiet sind das Kristallin <strong>der</strong> Silvretta-<strong>Decke</strong>,<br />
sedimentäre Einheiten <strong>der</strong> <strong>Ela</strong>-<strong>Decke</strong> sowie Sedimente <strong>der</strong> S-charl-<strong>Decke</strong> aufgeschlossen.<br />
Darüber hinaus treten Sedimente <strong>der</strong> Subsilvrettiden Linsen auf. Die <strong>Ela</strong>-<strong>Decke</strong> lässt sich in<br />
den <strong>Ela</strong>-Oberbau <strong>und</strong> den <strong>Ela</strong>-Unterbau unterteilen, wobei <strong>der</strong> Oberbau diskordant auf dem<br />
Unterbau aufliegt. Auch die S-chanf-<strong>Decke</strong> ist in einen Ober- <strong>und</strong> einen Unterbau unterteilt, es<br />
ist jedoch nur <strong>der</strong> Oberbau im untersuchten Gebiet aufgeschlossen. Die Einheiten <strong>der</strong> S-charl-<br />
<strong>Decke</strong> sind an einer flachen, ostsüdöstlich einfallenden Störung auf die <strong>Ela</strong>-<strong>Decke</strong><br />
aufgeschoben.<br />
Die Einheiten des <strong>Ela</strong>-Oberbaus weisen Merkmale zweier alpiner Orogenesephasen auf.<br />
Zunächst erfolgte in <strong>der</strong> kretazischen Trupchun-Phase eine <strong>Decke</strong>nstapelung <strong>der</strong> Ostalpinen<br />
Einheiten, welche sich im Kartiergebiet in isoklinalen (D1) Falten mit liegenden Faltenachsen<br />
zeigt. In dieselbe Phase fällt die Entstehung <strong>der</strong> Aufschiebung des <strong>Ela</strong>-Oberbaus auf den <strong>Ela</strong>-<br />
Unterbau. In <strong>der</strong> spätkretazischen Ducan-<strong>Ela</strong>-Phase fand eine Extension des <strong>Decke</strong>nstapels<br />
statt <strong>und</strong> die D1-Falten wurden durch Abschiebungen überprägt. Im frühen Tertiär setzte mit<br />
erneuter Kollisionstektonik die zweite Orognesephase ein. In diese Phase fällt die Aufschiebung<br />
des Oberbaus <strong>der</strong> S-charl-<strong>Decke</strong> auf die <strong>Ela</strong>-<strong>Decke</strong>. Hinweise auf weitere Deformationsphasen,<br />
wie sie für die Albula-Querzone belegt werden konnten, wurden im Kartiergebiet nicht<br />
gef<strong>und</strong>en.
Karbonatfällungskinetik in Fe 0 -Säulen.<br />
ANNA SOPHIE WELLMANN<br />
Laborarbeit: 94 Seiten<br />
Kurzfassung:<br />
Ziel <strong>der</strong> Arbeit war die Untersuchung <strong>der</strong> Einflüsse unterschiedlicher Karbonatgehalte in den<br />
Versuchslösungen einerseits <strong>und</strong> verschiedenen Durchflussgeschwindigkeiten an<strong>der</strong>erseits auf<br />
das Abbauverhalten von TCE an Fe 0 . Zur Untersuchung <strong>der</strong> Zus<strong>am</strong>menhänge <strong>zwischen</strong> <strong>der</strong><br />
Fällung von TIC in Fe 0 -Säulen <strong>und</strong> dem Abbau von TCE wurde ein dreimonatiger Versuch mit<br />
insges<strong>am</strong>t sechs Fe 0 -Säulenversuchen durchgeführt.<br />
Die Säulenversuche wurden mit künstlichen Versuchswässern durchströmt, denen die<br />
gleichen Konzentrationen an TCE <strong>und</strong> unterschiedliche Gehalte an gelöstem TIC zudotiert<br />
waren. An jeweils zwei <strong>der</strong> Säulenversuche wurden unterschiedliche Durchflussgeschwindigkeiten<br />
angelegt. Zwei Versuchssäulen dienten als Referenzsysteme, von denen<br />
das eine ohne gelöstes Tic <strong>und</strong> das an<strong>der</strong>e ohne TCE in <strong>der</strong> Zulauflösung betrieben wurden.<br />
Es zeigte sich, dass die Zugabe von TIC den Abbau von TCE im Zeitraum <strong>der</strong><br />
Untersuchungen positiv beeinflusste. Alle Säulenversuche denen TIC zugegeben wurde,<br />
wiesen höhere TCE-Abbauraten auf als das karbonatfreie System. Darüber hinaus erzeugte<br />
eine Zugabe von 6,0 mmol/l TIC in die Versuchslösung höhere TCE-Abbauraten als die Zugabe<br />
von 2,5 mmol/l. Es zeigte sich außerdem, dass die Festlegung von Karbonaten nicht, wie<br />
zunächst vermutet, zu einer Passivierung <strong>der</strong> Fe 0 -Säulen führte, son<strong>der</strong>n in dem System mit <strong>der</strong><br />
höchsten Karbonatfracht sogar eine Steigerung <strong>der</strong> TCE-Abbauraten mit zunehmen<strong>der</strong><br />
Versuchslaufzeit auftrat.