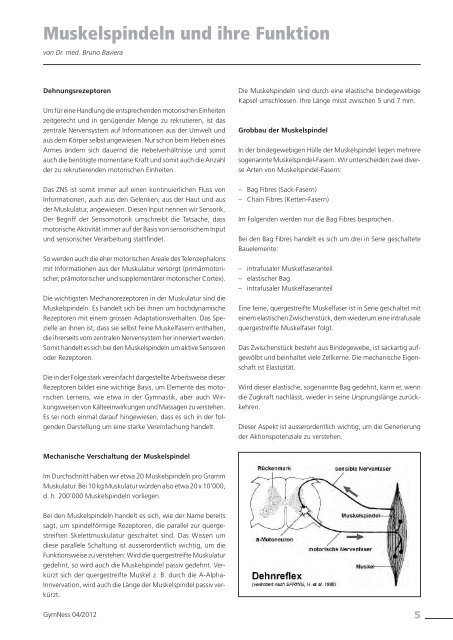Muskelspindeln und ihre Funktion - BGB Schweiz
Muskelspindeln und ihre Funktion - BGB Schweiz
Muskelspindeln und ihre Funktion - BGB Schweiz
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Muskelspindeln</strong> <strong>und</strong> <strong>ihre</strong> <strong>Funktion</strong><br />
von Dr. med. Bruno Baviera<br />
Dehnungsrezeptoren<br />
Um für eine Handlung die entsprechenden motorischen Einheiten<br />
zeitgerecht <strong>und</strong> in genügender Menge zu rekrutieren, ist das<br />
zentrale Nervensystem auf Informationen aus der Umwelt <strong>und</strong><br />
aus dem Körper selbst angewiesen. Nur schon beim Heben eines<br />
Armes ändern sich dauernd die Hebelverhältnisse <strong>und</strong> somit<br />
auch die benötigte momentane Kraft <strong>und</strong> somit auch die Anzahl<br />
der zu rekrutierenden motorischen Einheiten.<br />
Das ZNS ist somit immer auf einen kontinuierlichen Fluss von<br />
Informationen, auch aus den Gelenken, aus der Haut <strong>und</strong> aus<br />
der Muskulatur, angewiesen. Diesen Input nennen wir Sensorik.<br />
Der Begriff der Sensomotorik umschreibt die Tatsache, dass<br />
motorische Aktivität immer auf der Basis von sensorischem Input<br />
<strong>und</strong> sensorischer Verarbeitung stattfindet.<br />
So werden auch die eher motorischen Areale des Telenzephalons<br />
mit Informationen aus der Muskulatur versorgt (primärmotorischer,<br />
prämotorischer <strong>und</strong> supplementärer motorischer Cortex).<br />
Die wichtigsten Mechanorezeptoren in der Muskulatur sind die<br />
<strong>Muskelspindeln</strong>. Es handelt sich bei ihnen um hochdynamische<br />
Rezeptoren mit einem grossen Adaptationsverhalten. Das Spezielle<br />
an ihnen ist, dass sie selbst feine Muskelfasern enthalten,<br />
die <strong>ihre</strong>rseits vom zentralen Nervensystem her innerviert werden.<br />
Somit handelt es sich bei den <strong>Muskelspindeln</strong> um aktive Sensoren<br />
oder Rezeptoren.<br />
Die in der Folge stark vereinfacht dargestellte Arbeitsweise dieser<br />
Rezeptoren bildet eine wichtige Basis, um Elemente des motorischen<br />
Lernens, wie etwa in der Gymnastik, aber auch Wirkungsweisen<br />
von Kälteeinwirkungen <strong>und</strong> Massagen zu verstehen.<br />
Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass es sich in der folgenden<br />
Darstellung um eine starke Vereinfachung handelt.<br />
Die <strong>Muskelspindeln</strong> sind durch eine elastische bindegewebige<br />
Kapsel umschlossen. Ihre Länge misst zwischen 5 <strong>und</strong> 7 mm.<br />
Grobbau der Muskelspindel<br />
In der bindegewebigen Hülle der Muskelspindel liegen mehrere<br />
sogenannte Muskelspindel-Fasern. Wir unterscheiden zwei diverse<br />
Arten von Muskelspindel-Fasern:<br />
– Bag Fibres (Sack-Fasern)<br />
– Chain Fibres (Ketten-Fasern)<br />
Im Folgenden werden nur die Bag Fibres besprochen.<br />
Bei den Bag Fibres handelt es sich um drei in Serie geschaltete<br />
Bauelemente:<br />
– intrafusaler Muskelfaseranteil<br />
– elastischer Bag<br />
– intrafusaler Muskelfaseranteil<br />
Eine feine, quergestreifte Muskelfaser ist in Serie geschaltet mit<br />
einem elastischen Zwischenstück, dem wiederum eine intrafusale<br />
quergestreifte Muskelfaser folgt.<br />
Das Zwischenstück besteht aus Bindegewebe, ist sackartig aufgewölbt<br />
<strong>und</strong> beinhaltet viele Zellkerne. Die mechanische Eigenschaft<br />
ist Elastizität.<br />
Wird dieser elastische, sogenannte Bag gedehnt, kann er, wenn<br />
die Zugkraft nachlässt, wieder in seine Ursprungslänge zurückkehren.<br />
Dieser Aspekt ist ausserordentlich wichtig, um die Generierung<br />
der Aktionspotenziale zu verstehen.<br />
Mechanische Verschaltung der Muskelspindel<br />
Im Durchschnitt haben wir etwa 20 <strong>Muskelspindeln</strong> pro Gramm<br />
Muskulatur. Bei 10 kg Muskulatur würden also etwa 20 x 10'000,<br />
d. h. 200'000 <strong>Muskelspindeln</strong> vorliegen.<br />
Bei den <strong>Muskelspindeln</strong> handelt es sich, wie der Name bereits<br />
sagt, um spindelförmige Rezeptoren, die parallel zur quergestreiften<br />
Skelettmuskulatur geschaltet sind. Das Wissen um<br />
diese parallele Schaltung ist ausserordentlich wichtig, um die<br />
<strong>Funktion</strong>sweise zu verstehen: Wird die quergestreifte Muskulatur<br />
gedehnt, so wird auch die Muskelspindel passiv gedehnt. Verkürzt<br />
sich der quergestreifte Muskel z. B. durch die A-Alpha-<br />
Innvervation, wird auch die Länge der Muskelspindel passiv verkürzt.<br />
GymNess 04/2012 5
Es scheint, dass vor allem die Kettenfasern über <strong>ihre</strong> nervösen<br />
Afferenzen (Informationen zum zentralen Nervensystem hin)<br />
Informationen über den momentanen Längenzustand vermitteln.<br />
Die Bag-Fasern (Sack-Fasern) dienen vor allem dazu, das zentrale<br />
Nervensystem über Muskellängenveränderungen zu informieren.<br />
Je schneller ein Muskel seine Länge verändert, umso mehr reagiert<br />
die Muskelspindel auf diesen Reiz. Bei einer schnellen Muskeldehnung<br />
<strong>und</strong> somit auch Muskelspindeldehnung werden viele<br />
Aktionspotenziale generiert. Verkürzt sich die Skelettmuskulatur,<br />
d. h. die extrafusalen Muskelfasern, nimmt die Erregungsfrequenz<br />
aus der Muskelspindel ab.<br />
Je schneller der Muskel seine Länge verändert, umso grösser<br />
sind die Differenzen der Aktionspotenzialmuster.<br />
Gamma-Schlaufe<br />
Bei den intrafusalen Teilstücken handelt es sich um quergestreifte<br />
feine Muskelfaseranteile. Sie sind kontraktil <strong>und</strong> etwas plastisch.<br />
Plastizität in diesem Zusammenhang bedeutet, dass sie etwas<br />
länger werden, wenn dauernd an ihnen gezogen wird. Zudem<br />
sind sie als Muskelfasern kontraktil, d. h., sie können auf die<br />
Veranlassung einer entsprechenden Innervation Kraft erzeugen.<br />
Diese Kraft können sie entwickeln, indem sie länger werden,<br />
gleich lang bleiben oder sich verkürzen.<br />
Es sei jetzt schon darauf hingewiesen, dass bei einer passiven<br />
Dehnung der Muskelspindel sämtliche Faseranteile gedehnt werden,<br />
also die beiden intrafusalen Muskelfaserstücke sowie der<br />
Bag.<br />
Zusatzinformation für Interessierte<br />
Neben den Bag-Fasern (Sack-Fasern) enthält die Muskelspindel<br />
auch sogenannte Chain-Fasern (Kettenfasern). Diese Kettenfasern<br />
bestehen nur aus intrafusaler Muskulatur <strong>und</strong> enthalten keinen<br />
elastischen Bag. Es wird angenommen, dass <strong>ihre</strong> <strong>Funktion</strong>sweise<br />
dazu dient, das zentrale Nervensystem über den Längenzustand<br />
des Muskels zu informieren (statische <strong>Funktion</strong>).<br />
Informationen aus der Muskelspindel<br />
Höchstwahrscheinlich informieren die <strong>Muskelspindeln</strong> das zentrale<br />
Nervensystem über drei Phänomene:<br />
– Längenzustand der Muskulatur<br />
– Längenveränderung der Muskulatur<br />
– Geschwindigkeit der Längenveränderung der Muskulatur<br />
Der funktionelle Sinn der Muskelspindel wird erst klar, wenn wir<br />
den Einbau der Muskelspindel im Muskel <strong>und</strong> seine nervösen<br />
Verbindungen mit dem zentralen Nervensystem verstehen.<br />
Im Vorderhorn des Rückenmarks befinden sich viele kleine Motoneuronen.<br />
Ihre efferenten Axone innervieren die intrafusalen<br />
quergestreiften Muskelfaseranteile. Diese Motoneuronen werden<br />
Gamma-Motoneuronen genannt. Die <strong>Muskelspindeln</strong> werden<br />
durch zwei verschiedene Arten von Gamma-Motoneuronen<br />
innerviert. Die eine Art führt zu einer Verkürzung der intrafusalen<br />
Muskulatur, die andere Art führt zu einer Tonuserhöhung ohne<br />
Verkürzung.<br />
Diese Art der Innervation wird Gamma-Innervation genannt.<br />
Um den Bag (Sack) der Muskelspindel winden sich feine Nervenfasern.<br />
Sie werden Іa-Fasern genannt. Sie gehören zu den<br />
schnellsten Nervenfaserntypen, die wir besitzen.<br />
Wird aus irgendeinem Gr<strong>und</strong> der Bag gedehnt, <strong>und</strong> das ist die<br />
wichtigste Feststellung in diesem Zusammenhang, entstehen im<br />
la-System Aktionspotenziale. Diese werden über die Іa-Fasern<br />
über das Hinterhorn auf die A-Alpha-Motoneuronen des entsprechenden<br />
Muskels umgeschaltet.<br />
Es ist wichtig festzuhalten, dass die la-afferenten Fasern auf<br />
sämtliche A-Alpha-Motoneuronen des entsprechenden Muskels<br />
projizieren. Zudem gibt es auch noch Verschaltungen zu den<br />
sogenannten Synergisten des Ursprungmuskels.<br />
Hier zeichnen sich bereits die ersten Glieder eines sogenannten<br />
Eigenreflexes ab.<br />
Die Axone der A-Alpha-Motoneuronen verlassen das Vorderhorn.<br />
Ihre Fasern verlaufen in der vorderen Wurzel, münden in den<br />
Spinalnerv ein <strong>und</strong> innervieren die entsprechenden Muskelfasern<br />
entsprechend <strong>ihre</strong>r Kollateralisierung (motorische Einheit).<br />
6 GymNess 04/2012
Mit dem Begriff der Gamma-Schlaufe wird folgende physiologische<br />
Verschaltung umschrieben:<br />
– Efferente A-Gamma<br />
– Afferente la<br />
– Efferente A-Alpha<br />
Diese Gamma-Schlaufe wird in der Motorik-Literatur auch kurze<br />
Schlaufe oder Short-Loop genannt. Short-Loop bezieht sich auf<br />
die Long-Loop, d. h. die Verbindungen zwischen dem Rückenmark<br />
mit den aufsteigenden Bahnen, der zentralnervösen höheren<br />
Verarbeitung <strong>und</strong> den deszendierenden Systemen wieder auf<br />
das Rückenmark zurück. Nebenbei sei bemerkt, dass die Long-<br />
Loops nicht immer länger sein müssen als die Short-Loops.<br />
Aktivität der Muskelspindel bei passiver Dehnung des<br />
Muskels<br />
Wird durch die Gravitation oder die Kraft des Antagonisten ein<br />
Muskel gedehnt, werden die zu ihm parallel geschalteten <strong>Muskelspindeln</strong><br />
ebenfalls gedehnt. Im Innern der Muskelspindel führt<br />
das zu einer Dehnung der zwei intrafusalen Muskelfaseranteile<br />
sowie des Bags.<br />
Die Dehnung des Bags ist der adäquate Reiz für das Generieren<br />
von Aktionspotenzialen im la-System. Je schneller der Muskel<br />
gedehnt wird, umso mehr Aktivität entsteht im la-System. Dieses<br />
Verhalten nennen wir dynamisches Rezeptorverhalten. Wird der<br />
Muskel ganz langsam gedehnt, erfolgt nur eine leichte Zunahme<br />
von Aktionspotenzialen.<br />
Bleibt der Muskel nach der Dehnung in der gedehnten Stellung,<br />
verändert sich das Innere der Muskelspindel. Bei anhaltendem<br />
Dehnreiz zieht sich der elastische Bag etwas zusammen, <strong>und</strong> die<br />
intrafusalen Muskelfasern werden etwas länger. Dadurch nimmt<br />
bei gleichbleibender Muskellänge die Länge des intrafusalen<br />
Bags ab. Diese Längenabnahme des Bags führt zu einer Abnahme<br />
der Aktionspotenzialfrequenz im la-System. Diese Abnahme der<br />
Erregungsfrequenz bei gleichbleibendem Reiz nennt man Adaptation.<br />
Im gedehnten Zustand adaptieren die <strong>Muskelspindeln</strong>.<br />
Wird die Muskelspindel sehr schnell gedehnt, <strong>und</strong> somit auch<br />
der Bag, entsteht ein Schwall (Burst) von Erregungen im la-<br />
System. Diese Afferenzen projizieren auf den A-Alpha-Motoneuronen-Pool<br />
im Vorderhorn. Diese schwallartige Aktivierung<br />
(EPSP's) des A-Alpha-Motoneuronen-Pools führt zu einer kurzfristigen<br />
Aktivierung des gedehnten Muskels. Eine Muskelzuckung<br />
entsteht. Das ist das Bild, das entsteht, wenn der Arzt<br />
einen kurzen Schlag mit dem Reflexhammer auf die entsprechende<br />
Sehne oder die entsprechenden Bänder ausübt (Monosynaptischer<br />
Reflex).<br />
Zusatzinformation für Interessierte<br />
Die Muskelspindelfasern sind neben der la-Innervation noch mit<br />
einem zweiten Nervenfasertyp innerviert. Diese Nervenfasern<br />
sind II-Fasern <strong>und</strong> haben eine etwas langsamere Erregungsfortpflanzungs-Geschwindigkeit.<br />
Die II-Fasern beginnen an der intrafusalen<br />
Muskulatur. Es scheint, dass <strong>ihre</strong> Information eher eine<br />
statische ist, d. h. dass sie über die effektive Muskellänge Auskunft<br />
gibt <strong>und</strong> weniger über die Muskellängen-Veränderung.<br />
Die II-Fasern endigen ebenfalls auf Rückenmarksebene <strong>und</strong> projizieren<br />
auf den A-Alpha-Motoneuronen-Pool.<br />
Wichtige Verbindungen auf Rückenmark-Ebene<br />
Es ist ausserordentlich wichtig festzuhalten, dass die Ia- <strong>und</strong> II-<br />
Fasern über Interneuronen auf Rückenmarksebene noch eine<br />
Vielzahl von weiteren Verbindungen eingehen. So werden sämtliche<br />
Informationen aus den <strong>Muskelspindeln</strong> über nachgeschaltete<br />
Zellen der aufsteigenden Systeme den höheren ZNS-Ebenen vermittelt.<br />
Die Ia-Afferenzen hemmen auf den entsprechenden Rückenmarkssegmenten<br />
über Interneurone die Aktivität der antagonistischen<br />
Muskulatur.<br />
Über noch komplexere Verschaltungen werden die Alpha-Motoneuronen<br />
der gegenüberliegenden Körperseiten reziprok aktiviert.<br />
Aktivität aus den <strong>Muskelspindeln</strong> der Flexoren aktivieren in einem<br />
gewissen Mass die Extensoren der Gegenseite. Diese antagonistischen<br />
Verknüpfungen führen auf einer höheren Ebene zum<br />
sogenannten Lokomotionsmuster. Lokomotion bedeutet ja<br />
gegenseitiges gekreuztes Bewegen der oberen Extremitäten <strong>und</strong><br />
wiederum nach unten gekreuztes Aktivieren der unteren Extremitäten.<br />
Eine weitere Verknüpfung der Ia-Afferenzen führt zu einer Verbindung<br />
mit dem spinalen (Rückenmark) Schmerzsystem. Die<br />
Erregungsmuster aus dem Ia-System können die Aktivität von<br />
Schmerzafferenzen auf die nachgeschalteten Rückenmarksneurone<br />
hemmend beeinflussen. Dieser Einfluss findet auf den sogenannten<br />
WDR (Wide Dynamic Range Neuronen) statt. Diese<br />
Hemmung von Schmerzwahrnehmungen auslösenden Systemen<br />
ist unter dem Namen der Gate-Control bekannt geworden.<br />
Bleibt die Muskelspindel eine gewisse Zeit in <strong>ihre</strong>r Länge unverändert,<br />
pendelt sich das Afferenzmuster im la-System auf einem<br />
gewissen Niveau ein. Die resultierende Erregungsfrequenz gibt<br />
nun eine Information über die effektive momentane Länge des<br />
Muskels (Statischer Zustand).<br />
GymNess 04/2012<br />
7
Aktivität der <strong>Muskelspindeln</strong> in Bewegungssituationen<br />
Bis anhin haben wir die <strong>Funktion</strong>sweise der sogenannten passiven<br />
Muskelspindelfunktion besprochen. Im Verlaufe von Bewegungen,<br />
Handlungen, insbesondere aber während dem motorischen<br />
Lernen oder aber der motorischen Auseinandersetzung mit einer<br />
nicht antizipierbaren Umgebung hat die aktive Muskelspindel<br />
eine grosse Bedeutung.<br />
Handlungen setzen immer eine Antizipation des eigenen Körperzustandes<br />
sowie der Umgebung voraus. Diese Antizipation<br />
findet auch über den sensorischen Input aus dem Ia- <strong>und</strong> II-<br />
System statt. Auf der Gr<strong>und</strong>lage der sensorischen Verarbeitung<br />
werden dann in den motorischen Arealen unseres Gehirns die<br />
deszendierenden Systeme so aktiviert, dass die beabsichtigte<br />
Handlung stattfinden kann.<br />
In diesem Sinn können modellartig drei verschiedene motorische<br />
Situationen unterschieden werden:<br />
– Widerstände grösser als erwartet<br />
– Widerstände kleiner als erwartet<br />
– Widerstände gleich gross wie erwartet<br />
Widerstand grösser als erwartet<br />
Stellen wir uns eine motorische Situation vor, in der wir ein<br />
Gewicht anheben wollen. Unsere motorischen Programme führen<br />
zur Aktivierung einer gewissen Anzahl von motorischen Einheiten.<br />
Da der Widerstand durch das Gewicht jedoch grösser ist als<br />
erwartet, werden vorerst zu wenig motorische Einheiten rekrutiert.<br />
Da über die deszendierenden Programme aber auch die<br />
Gamma-Motoneuronen aktiviert werden, findet in der intrafusalen<br />
Muskulatur eine Muskelverkürzung statt. Diese Muskelverkürzung<br />
bei gleichbleibender Muskelspindellänge führt nun<br />
zu einer Dehnung des elastischen Bags. Diese Bag-Dehnung<br />
führt <strong>ihre</strong>rseits nun wieder zu einer Zunahme der Aktionspotenziale<br />
im Ia-System. Über diese Ia-Afferenzen auf dem Alpha-<br />
Motoneuronen-Pool werden nun zusätzliche A-Alpha-Motoneuronen<br />
aktiviert. So kann durch die zunehmende Rekrutierung<br />
von motorischen Einheiten quasi auf spinaler Ebene eine Nachregulierung<br />
der Kraftentwicklung stattfinden.<br />
Widerstand kleiner als erwartet<br />
Erfolgt über die absteigenden Systeme ein Informationsmuster, das<br />
mehr motorische Einheiten erregt als eigentlich benötig würden,<br />
führt das zu einer plötzlichen Muskelverkürzung. Durch die plötzliche<br />
Verkürzung wird die zum Muskel parallel geschaltete Muskelspindel<br />
plötzlich verkürzt. In der Muskelspindel drin führt das zu einer Verkürzung<br />
des elastischen Bags mit einer konsekutiven Abnahme der<br />
Erregungsfrequenz im Ia-System. Da nun aktivitätsfördernde Einflüsse<br />
auf den Alpha-Motoneuronen-Pool wegfallen (weniger EPSP's) werden<br />
nun auch weniger motorische Einheiten überschwellig erregt.<br />
Die Folge ist eine Kraftabnahme. Auch hier wiederum ein Nachstelleffekt<br />
auf der Gr<strong>und</strong>lage eines sensorischen Inputs.<br />
8<br />
Es sei festgehalten, dass in Ruhezuständen die <strong>Muskelspindeln</strong><br />
eine gewisse Ruheaktivität im Ia-System generieren. Findet nun<br />
eine plötzliche Muskelspindelentlastung, d. h. eine Muskelspindelverkürzung<br />
statt, kann es sein, dass die Erregungsfrequenz<br />
im Ia-System unter die Ruhefrequenz oder sogar auf Null abfällt.<br />
Diese kurz dauernde Pause an Erregungen wird Spindelpause<br />
genannt. Während der Spindelpause erhalten die A-Alpha-Motoneuronen<br />
auf Rückenmarksebene keine fördernden Einflüsse<br />
aus der Muskelspindel. In diesem Zustand der geringsten Innervation<br />
sind die Muskelfasern wenig aktiv <strong>und</strong> können in dieser<br />
Phase gut gedehnt werden. Von diesem Prinzip macht die Methode<br />
der postisometrischen Relaxation Gebrauch.<br />
Widerstand gleich gross wie erwartet<br />
Wurden Handlungen mehrere Tausend Male geübt <strong>und</strong> sind<br />
sozusagen automatisiert, gelingt es, den oberen Ebenen des<br />
Nervensystems über <strong>ihre</strong> deszendierende Beeinflussung dem A-<br />
Alpha- <strong>und</strong> Gamma-Motoneuronen-Pool eine situationsgerechte<br />
Aktivierung zuzuführen.<br />
Alpha-Motoneuronen <strong>und</strong> Gamma-Motoneuronen werden so<br />
weit aktiviert, dass die extrafusale Muskelverkürzung parallel<br />
mit der intrafusalen Muskelverkürzung abläuft. Verkürzt sich<br />
nun die Muskelspindellänge als Ganzes <strong>und</strong> verkürzen sich in<br />
ihr die intrafusalen Muskelfasern, bleibt der Längenzustand des<br />
Bags gleich gross. Eine gleichbleibende Länge des Bags führt<br />
aber zu keiner Veränderung des Afferenzflusses im Ia-System.<br />
Weder eine Zunahme noch eine Abnahme dieses Afferenzflusses<br />
ist aber nötig, da die übergeordneten Systeme zu einer korrekten<br />
Aktivierung von motorischen Einheiten geführt haben.<br />
Während des motorischen Lernens ist ein wichtiges Ziel, dass<br />
die deszendierende Aktivierung von A-Gamma- <strong>und</strong> A-Alpha-<br />
Motoneuronen parallel verläuft. So sind in der Folge keine<br />
peripheren Nachstellungsanforderungen mehr nötig. Solche<br />
Bewegungsabläufe sind auch schnell möglich, da die Bewegungs -<br />
programme nicht immer wieder nachgestellt werden müssen.<br />
Das Rückführen der Ia-Muster über die aufsteigenden Systeme<br />
bis in die motorischen Areale des Gehirns, die entsprechende<br />
Generierung der adäquaten Aktivitätsmuster <strong>und</strong> deren Übermittlung<br />
über die deszendierenden Systeme bis zum A-Alpha-<br />
Motoneuronen-Pool dauert etwas weniger als 1 Sek<strong>und</strong>e. Deshalb<br />
sind Menschen, die neue Bewegungen lernen müssen, oder<br />
Menschen mit Hirnschädigungen in <strong>ihre</strong>r motorischen Performance<br />
verlangsamt.<br />
Muskelspindel <strong>und</strong> Massage<br />
Während den klassischen Massagen werden mechanische Kräfte<br />
von aussen über die Haut auch auf die Muskelgewebe appliziert.<br />
Seit urdenklichen Zeiten wird die Massage auch zur Tonus- (Spannungs-)<br />
Beeinflussung der Skelettmuskulatur verwendet. Die<br />
Physiologie der Muskelspannung ist komplex <strong>und</strong> vielschichtig.<br />
In diesem Zusammenhang muss dennoch zwischen einem visko -<br />
GymNess 04/2012
elastischen Tonus <strong>und</strong> einem Innervationstonus unterschieden<br />
werden. Der Innervationstonus wird gelegentlich auch als kontraktile<br />
Aktivität bezeichnet. Der viskoelastische Tonus setzt sich aus<br />
den Materialeigenschaften der Strukturen des Muskelgewebes<br />
zusammen. So enthält der Muskel viele bindegewebige Anteile<br />
(kollagene Fasern), die durch <strong>ihre</strong> räumliche Anordnung eine<br />
gewisse Elastizität aufweisen. Sind diese bindegewebigen Anteile<br />
<strong>und</strong> auch die elastischen Anteile der Sarkomere nicht genügend<br />
gleitfähig, resultiert eine übermässige Muskelsteifigkeit. Diese<br />
Muskelsteifigkeit kann auch als passive Muskelsteifigkeit bezeichnet<br />
werden, da sie nicht die Folge einer Aktivierung von motorischen<br />
Einheiten ist.<br />
Der kontraktile Tonus, der Innervationstonus oder der aktive<br />
Tonus ist das Resultat einer Aktivität der motorischen Einheiten.<br />
Tonisierende Massage<br />
Ist ein Muskel aus irgendwelchen Gründen zu schlaff, d. h. zu<br />
wenig aktiviert, d. h. zu wenig tonisch, kann eine tonisierende<br />
Massage angezeigt sein. Auf der Gr<strong>und</strong>lage der Kenntnisse der<br />
<strong>Funktion</strong>sweise der passiven Muskelspindel kann nun eine kräftige<br />
<strong>und</strong> schnelle Dehnung durch die entsprechenden Massagegriffe<br />
zu einer Aktivierung der <strong>Muskelspindeln</strong> führen. Durch die Dehnung<br />
der Bag-Abschnitte entstehen vermehrt Afferenzen im Ia-<br />
System <strong>und</strong> somit eine zusätzliche Aktivierung des A-Alpha-<br />
Motoneuronen-Pools. Inwieweit diese Massage jedoch zu einer<br />
anhaltenden Tonisierung führen kann, ist fragwürdig.<br />
Durch die entsprechende Massage kann jedoch über die Afferenzen<br />
aus der Muskelspindel auch eine verbesserte Repräsentation des<br />
entsprechenden Muskelgebietes im Nervensystem stattfinden.<br />
Diese verbesserte Repräsentation kann möglicherweise die Ursache<br />
einer besseren willkürlichen Tonusgenerierung sein.<br />
Kälteeinwirkung <strong>und</strong> Tonusbeeinflussung<br />
Kälteeinwirkung <strong>und</strong> Tonussenkung<br />
Möglicherweise werden die A-Gamma-Motoneuronen über die<br />
Kältefasern (A-Delta-Fasern) gehemmt. Über die Hemmung des<br />
A-Gamma-Systems wäre eine Entlastung der intrafusalen Muskelfasern<br />
die Folge, was konsekutiv zu einer Entdehnung der Bag-<br />
Anteile führen würde. So entstünde weniger Aktivität im<br />
Ia-System <strong>und</strong> somit eine geringere Aktivierung des A- Al pha-<br />
Motoneuronen-Pools. Eine Tonusabnahme wäre die Folge. Allerdings<br />
kann solch ein Prozedere nur Erfolg haben, wenn der<br />
gesamte Organismus in einer positiven Wärmebilanz ist. Die<br />
hypothalamischen <strong>und</strong> spinalen thermoregulatorisch aktiven<br />
Strukturen müssten durch eine vorgängige Wärmeapplikation<br />
ruhig gestellt werden. So würden die thermoregulatorischen<br />
Einflüsse zur Wärmeproduktion auf die A-Alpha-Motoneuronen<br />
wegfallen.<br />
Kälteeinwirkung <strong>und</strong> Tonuserhöhung<br />
Bei nachhaltiger <strong>und</strong> grossflächiger Kälteeinwirkung überwiegt<br />
aber der Muskeltonus erhöhende Effekt. Die Kältefasern (A-Delta-Fasern)<br />
haben einen aktivitätsfördernden Einfluss (EPSP's) auf<br />
die Alpha-Motoneuronen.<br />
Muskeltonus steigernd wäre somit eine schnelle <strong>und</strong> kräftige<br />
Massage mit einer zusätzlichen Kälteeinwirkung. Detonisierend<br />
wären eher langsame feinere Massagen unter Beihilfe einer vorangehenden<br />
Wärmeapplikation.<br />
Detonisierende Massagen<br />
Da die Massageeinwirkung immer das ganze Muskelgewebe<br />
betrifft, werden zur Lockerung der viskoelastischen Steifigkeit<br />
immer auch die <strong>Muskelspindeln</strong> aktiviert. Soll nun ein Muskel<br />
mit erhöhtem Tonus detonisiert werden, müssen die Massagegriffe<br />
den Aktivitätszustand der <strong>Muskelspindeln</strong> berücksichtigen.<br />
Da jede Dehnung zu einer Aktivitätszunahme auf den Alpha-<br />
Motoneuronen-Pool führt, muss diese Aktivitätszunahme so<br />
gering wie möglich gehalten werden. Somit sind langsame <strong>und</strong><br />
anhaltende Massagegriffe zur Detonisierung notwendig.<br />
Hypothetisch wäre analog zur postisometrischen Relaxation auch<br />
eine starke Aktivierung durch kräftige <strong>und</strong> schnelle Massagegriffe<br />
denkbar. Dadurch würde nach einer maximalen Aktivierung der<br />
<strong>Muskelspindeln</strong> (passiv) <strong>und</strong> nach einer kurzen Dehnpause eine<br />
Muskelspindelpause einsetzen. In dieser Muskelspindelpause ist<br />
der kontraktile Aktivitätszustand der Muskulatur verringert. In<br />
dieser kurzen Zeitspanne ist eine zusätzliche Dehnung <strong>und</strong> Mobilisation<br />
der bindegewebigen Anteile des Muskels möglich.<br />
GymNess 04/2012 9