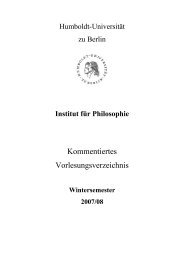HENRI BERGSON: ARBEIT AM BILD
HENRI BERGSON: ARBEIT AM BILD
HENRI BERGSON: ARBEIT AM BILD
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Markus Wild / Stephan Schmid (Basel):<br />
Henri Bergsons Arbeit am Bild: »une image qui est presque matière en<br />
ce qu’elle laisse encore voir, et presque esprit en ce qu’elle ne se laisse<br />
plus toucher«<br />
Es gibt eine zarte Empirie, die sich mit dem Gegenstand<br />
innigst identisch macht und dadurch zur eigentlichen<br />
Theorie wird. (Goethe, Maximen und Reflexionen, Nr.<br />
509)<br />
»Es ist an der Zeit, Bergson wieder zu lesen.« 1 Eine Reihe neuerer Publikationen gibt der<br />
Aufforderung Recht. 2 Wir schliessen uns an. Allerdings, so warnt ein Kommentator, müsse<br />
man die Frage stellen, welches Bild Henri Bergsons zur Debatte stehe. 3 In diesem Beitrag<br />
steht jedoch zunächst weniger ein bestimmtes Bild Bergsons zur Debatte, als vielmehr das<br />
Bild bei Bergson; und zwar sein Gebrauch von Bildern, seine Arbeit am Bild. Auch hier<br />
müssen wir einschränken: Es geht uns weniger um den von Bergson – vor allem in Materie<br />
und Gedächtnis – entwickelten epistemischen Bildbegriff, der späterhin oft diskutiert und<br />
variiert worden ist: als Zeit-, Bewegungs-, Wahrnehmungs- oder Gedächtnis-Bild. Vielmehr<br />
geht es um Bergsons, wie wir es nennen wollen, intuitiven Bildbegriff. An der spezifisch<br />
philosophischen Intuition gewinnt Bergson primär seine Bilder. Die Arbeit an und mit diesen<br />
Bildern erweitert den intuitiven Bildbegriff zum argumentativen und methodischen. 4<br />
Es ist an der Zeit, Bergson wieder zu lesen. Weshalb wieder? Bergson gehörte zu den<br />
einflussreichsten Philosophen des vergangenen Jahrhunderts. Die öffentliche<br />
1 M. Vrhunc: Bild und Wirklichkeit. Zur Philosophie Henri Bergsons, München: Wilhelm Fink, 2002, 11.<br />
2 K. Ansell Pearson: Philosophy and the Adventure of the Virtual. Bergson and the Time of Life, London / New<br />
York: Routledge, 2002; M. Vrhunc (op. cit.); J. Mullarkey (ed.): The New Bergson, Manchester University Press,<br />
1999; F. Cossutta (éd.): Lire Bergson: ‚Le possible et le réel‘, Paris: PUF, 1998; F. C. T. Moore: Bergson.<br />
Thinking Backwards, Cambridge University Press, 1996; F. Burwick & P. Douglas (eds.): The Crisis in<br />
Modernism: Bergson and the Vitalist Controversy, Cambridge University Press, 1992; H. Hude: Bergson (I &<br />
II), Paris: édition universitaire, 1989; A. R. Lacey: Bergson, London / New York: Routledge, 1989; A. C.<br />
Papanicolaou & P. A. Y. Gunter (eds.): Bergson and Modern Thought. Towards a Unified Science, Chur:<br />
Harwood Academic Publishers, 1987; L. Kolakowski: Henri Bergson. Ein Dichterphilosoph, München: Piper,<br />
1985. Ein kreatives Interesse an Bergson durchzieht das Werk von G. Deleuze, vgl. insbesondere G. Deleuze:<br />
Bergson zur Einführung, Hamburg: Junius, 1989; G. Deleuze: Das Bewegungs-Bild, Kino 1, Frankfurt a. M:<br />
Suhrkamp, 1989; Das Zeit-Bild, Kino 2, Frankfurt a. M: Suhrkamp, 1991. Es ist bedauerlich, dass M. Vrhunc in<br />
ihrer lesenswerten Studie die angelsächsische Forschung wenig berücksichtigt.<br />
3 »[W]e must always ask which image of Bergson is under consideration«, S. Schwartz: »Bergson and the<br />
Politics of Vitalism«, in: F. Burwick & P. Douglas (op. cit.) 303.<br />
4 Wir zitieren Bergson in deutscher Übersetzung mit Sigeln nach folgenden Ausgaben: ZF = Zeit und Freiheit,<br />
Hamburg: Europäische Verlagsanstalt, 1994 (Essai sur les données immédiates de la conscience). MG =<br />
Materie und Gedächtnis. Eine Abhandlung über die Beziehung zwischen Körper und Geist, Hamburg: Felix<br />
Meiner, 1991 (Matière et mémoire). L = Das Lachen, Jena: E. Diederichs, 1921 (Le rire). SE = Schöpferische<br />
Entwicklung, Jena: E. Diederichs, 1912 (L’évolution créatrice). DSW = Denken und schöpferisches Werden:<br />
Aufsätze und Vorträge, Hamburg: Europäische Verlagsanstalt, 1993 (La pensée et le mouvement). Für den<br />
französischen Text verweisen wir nach dem Sigel und der Seitenangabe der genannten deutschen Ausgaben auf<br />
die Oeuvres (textes annotés par A. Robinet; introd. par H. Gouhier), Paris: PUF, 1970.<br />
1
Aufmerksamkeit, die er auf sich zog, sucht seines gleichen. Einige Schlaglichter mögen dies<br />
veranschaulichen: Seine Gastvorlesung an der Columbia University 1913 soll den ersten<br />
Verkehrsstau in New York verursacht haben; 5 John Dewey stellte 1919 einer chinesischen<br />
Studentenschaft Bergson – nebst William James und Bertrand Russell – als einer der<br />
wichtigsten zeitgenössischen Philosophen vor; 6 Heinrich Rickert sah 1920 in Bergson den<br />
einschlägigen Stichwortgeber der modischen ›Lebensphilosophie‹; 7 1927 wurde Bergson der<br />
Nobelpreis für Literatur verliehen; für den Logischen Positivismus wurde Bergson zum<br />
Inbegriff jener unwissenschaftlichen, intuitionistischen und irrationalen Metaphysik, die es<br />
durch logische Analyse der Sprache zu überwinden galt. 8 Der englische Philosoph Thomas<br />
Ernest Hulme brachte den Einfluss Bergsons mit einem Vergleich zum Ausdruck: »If I<br />
compare my nightmare to imprisonment in a cell, then the door of that cell was for the first<br />
time thrown open.« 9 Hulmes Alptraum bezieht sich auf die intellektuelle Situation um 1910.<br />
Spätestens nach 1945 aber schwindet die Anerkennung Bergsons rapide. 10 Charles Péguy<br />
äusserte schon früher die Ansicht, die Menschen hätten es Bergson nicht verziehen, dass er sie<br />
befreit habe. 11 Hulme und Péguy fassen die Popularität und das Verklingen des Bergsonismus<br />
in ein Bild. Sie bezeichnen damit zugleich einen der vielen Faktoren der euphorisierenden<br />
Wirkung Bergsons und der teilweise heftigen Kritik an ihm: sein Gebrauch von Vergleichen<br />
und Bildern. Bergson ist – unter anderem – seinem systematischen und methodischen<br />
Gebrauch von Bildern und der philosophischen Bilderjagd des 20. Jahrhunderts zum Opfer<br />
gefallen. Einer der hartnäckigsten Kritiker Bergsons, Bertrand Russell, meinte feststellen zu<br />
können, dass sich in Bergsons Werken mehr Vergleiche finden würden als bei allen ihm<br />
bekannten Dichtern und – so suggeriert Russell maliziös – die Vergleiche seien<br />
unvergleichlich viel schlechter. 12 Russell wiederholte damit einen Topos, der sich sowohl bei<br />
Kritikern als auch bei vorsichtigeren Verehrern Bergsons durchgesetzt hatte: In Bergsons<br />
Werken finden sich Bilder anstelle von Argumenten und Vergleiche, welche den Job<br />
5 Zum Einfluss Bergsons in den USA vgl. T. Quirk: Bergson and American Culture. The Worlds of Willa<br />
Carther and Wallace Stevens, North Carolina University Press, 1990.<br />
6 Vgl. J. Dewey: The Middle Works, vol. 12, Carbondale / Edwardsville: Southern Illinois University Press &<br />
London / Amsterdam: Feffer & Simons, 1982, 221-235.<br />
7 H. Rickert: Die Philosophie des Lebens. Darstellung und Kritik einer philosophischen Modeströmung unserer<br />
Zeit, Tübingen, 1920, 20.<br />
8 Vgl. M. Schlick: Allgemeine Erkenntnistheorie, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1979, 101-115 (1925); R. Carnap:<br />
Der logische Aufbau der Welt, Hamburg: Meiner, 1961, 258-9 (1928); R. von Mises: Kleines Lehrbuch des<br />
Positivismus, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1990, 123-8 (1939).<br />
9 T. E. Hulme: »Notes on Bergson«; zitiert nach T. Quirk (op. cit.) 82.<br />
10 Zur Kritik an Bergson in der französischen Philosophie der 30’er-Jahre vgl. J. Hyppolite: Figures de la pensée<br />
philosophiques (Bd. 1), Paris: PUF, 1971, 443-498 und G. Gutting: French Philosophy in the Twentieth Century,<br />
Cambridge: Cambridge University Press, 2001, Kap. 4.<br />
11 Vgl. Kolakowski (op. cit.) 12-13.<br />
12 B. Russell: History of Western Philosophy, London: Routledge, 1996, 761 & 764.<br />
2
diskursiver Erörterungen übernehmen. 13 Noch 1977 greift ein Kommentator diesen Topos auf,<br />
um ihn zurückzuweisen:<br />
Car l’image, il [Bergson] l’a maintes fois répété et s’est longuement expliqué là-dessus<br />
dans l’Introduction à la métaphysique et L‘intuition philosophique, lui paraissait mieux<br />
correspondre à un certain aspect des choses et de la pensée que le concept abstrait. Mais il<br />
n’a jamais fait de l’image une preuve et n’a jamais entendu la donner pour une<br />
démonstration. 14<br />
Doch angemessener ist es zu sagen, dass es in einem gewissen Sinne richtig ist zu behaupten,<br />
Bergson setze Bilder an die Stelle von Argumenten oder Definitionen. Das ist unsere These,<br />
die wir im folgenden darlegen möchten.<br />
In einem ersten Abschnitt (Bilderjagd) werden wir auf einige Verwendungen von ‚Bild‘<br />
hinweisen und insbesondere skizzieren, was wir als ›philosophische Bilderjagd‹ im 20. Jh.<br />
bezeichnen. Im Abschnitt II (Die falschen Bilder der Metaphysik: Übertragung vom Raum auf<br />
die Zeit) wenden wir uns Bergsons Kritik falscher oder irreführender Bilder in der<br />
philosophischen Tradition zu und zeigen, inwiefern sich Bergson an der philosophischen<br />
Bilderjagd beteiligt. Abschnitt III (Das intuitive Bild: Produktion und Vermittlung) entwickelt<br />
Bergsons konkrete Arbeit am Bild – im Sinne des intuitiven Bildbegriffs – in mikroskopischer<br />
Perspektive vor dem Hintergrund seiner Unterscheidung zwischen Intuition und Analyse. Im<br />
Abschnitt IV (Das argumentative Bild: Metaphysik und Recoupage) erörtern wir genauer<br />
unsere These, dass es in gewissem Sinne richtig ist, dass Bergson Bilder an die Stelle von<br />
Argumenten setze. Der Abschnitt V (Das methodische Bild: Familienähnlichkeiten am<br />
Beispiel von Das Lachen) zeigt Bergsons Arbeit am Bild – im Sinne des methodischen<br />
Bildbegriffs – in makroskopischer Perspektive am Beispiel des kleineren Werks Das Lachen<br />
und stellt einige Beziehungen zum späten Wittgenstein her. Schliesslich weisen wir im letzten<br />
Abschnitt darauf hin, dass unsere Darstellung von Bergsons Arbeit am Bild Anlass zu einem<br />
revidierten Bild Bergsons gibt (Schluss: Bergsons Bilder und das Bild Bergsons).<br />
13 W. Durants populäres Buch Grosse Denker von 1926 fasst den Topos wie folgt zusammen: »Wenn Bergson<br />
gelegentlich unverständlich bleibt, so liegt das am verschwenderischen Reichtum seiner Bilder, seiner Analogien<br />
und Beispiele; er besitzt eine fast semitische Leidenschaft für Metaphern und bringt es gelegentlich fertig,<br />
geniale Vergleiche an Stelle von Beweisen zu setzen. Man muss sich vor diesem Bilderfabrikanten in acht<br />
nehmen...«, W. Durant: Grosse Denker, Zürich, 1930, 441-2.<br />
14 J. Theau: La philosophie française dans la première moitié du XXe siècle, Ottawa: éditions de l'université,<br />
1977, 94-5.<br />
3
I. Bilderjagd<br />
Der Ausdruck ›Bild‹ kennt zahlreiche Verwendungen. 15 Wir bezeichnen damit Artefakte (z.B.<br />
Gemälde), natürliche Abbilder (z.B. Schatten), mentale Repräsentationen (z.B. Erinnerungen),<br />
das Abhängigkeitsverhältnis zum Original (z.B. ›das ist ein Abbild von X‹), normative Muster<br />
(z.B. Vorbilder), allgemeine Orientierungen (z.B. ›sich ein Bild der Situation machen‹) und<br />
schliesslich Sprachbilder (Tropen und Figuren). Für die Philosophie sind alle diese<br />
Verwendungsweisen einschlägig, als Gegenstand der Reflexion einerseits (z.B. der<br />
Bildbegriff in der Kunstphilosophie, das platonische Verhältnis von Urbild und Abbild) oder<br />
als Mittel der Reflexion andererseits. Bemerkenswert ist, dass sich zentrale philosophische<br />
Sprachbilder oft an den übrigen Verwendungsweisen von ›Bild‹ orientieren, denn Gemälde,<br />
Schatten oder die neuzeitliche Explikation mentaler Repräsentationen als Bilder sind zentrale<br />
Sprachbilder der philosophischen Tradition. Aber die Philosophie steht diesem Mittel der<br />
Reflexion auch argwöhnisch gegenüber. Wir verweisen auf drei Momente, welche den letzten<br />
Typus der Verwendung von ›Bild‹ betreffen, das ›Sprachbild‹. (i) Die Philosophie bezieht, in<br />
Abgrenzung zur Literatur, einen gewichtigen Anteil ihres Selbstverständnisses gerade aus<br />
dem Verzicht auf Sprachbilder zugunsten eines argumentativen Diskurses. Das der Vorbehalt<br />
Russells (und anderer) gegenüber Bergson. (ii) Die Metaphysik wird der unumgänglichen<br />
Metaphorizität verdächtigt 16<br />
und als misslungene Dichtung mit überzogenen<br />
Erkenntnisansprüchen abgetan. So die Verortung Bergsons (und anderer) durch den<br />
Logischen Positivismus. (iii) Schliesslich gibt es in der Philosophie des 20. Jh. eine Art<br />
Bilderjagd auf Götzenbilder, auf irreführende Bildfelder, auf ein Bild, das uns gefangen hält 17<br />
(wiederum das Bild der Gefangenschaft), welches die philosophische Reflexion vor immer<br />
gleiche Sackgassen, falsche Gegensätze und Scheinprobleme führt. Nehmen wir als Beispiel<br />
die berühmte Kritik das amerikanischen Philosophen Richard Rorty an der neuzeitlichen<br />
Philosophie:<br />
Nicht Sätze, sondern Bilder, nicht Aussagen, sondern Metaphern dominieren den grössten<br />
Teil unserer philosophischen Überzeugungen. Das Bild, das die traditionelle Philosophie<br />
15 Vgl. dazu J. Steinbrenner & U. Winko: »Bilder in der Philosophie & in anderen Künsten & Wissenschaften«,<br />
in: dies. (Hg.): Bilder in der Philosophie & in anderen Künsten & Wissenschaften, Paderborn: Ferdinand<br />
Schöningh, 1997, 13-40. Der systematische Versuch einer Typologie, Bestimmung und Funktionsanalyse von<br />
Bildern mit zahlreichen Bezügen zu Bergson findet sich bei J. - J. Wunenberger: Philosophie des images, Paris:<br />
PUF, 1997.<br />
16 Vgl. dazu B. Hilmer: »Metaphysik und Metapher«, in: U. J. Wenzel (Hg.): Vom Ersten und Letzten.<br />
Positionen der Metaphysik in der Gegenwartsphilosophie, Frankfurt a. M.: Fischer, 1998, 111-130.<br />
17 Vgl. L. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, § 115: »Ein Bild hielt uns gefangen. Und heraus<br />
konnten wir nicht, denn es lag in unserer Sprache, und sie schien es uns nur unerbittlich zu wiederholen.« M.<br />
Vrhunc (op. cit.) 134 zitiert diesen Paragraphen als Motto ihres dritten Kapitels. Leider versäumt sie es,<br />
Beziehungen zwischen Wittgenstein und Bergson fruchtbar zu machen. Wir werden dies ansatzweise in<br />
Abschnitt V versuchen.<br />
4
gefangenhält, ist das Bild vom Bewusstsein als einem grossen Spiegel, der verschiedene<br />
Darstellungen enthält – einige davon akkurat, andere nicht – und mittels reiner,<br />
nichtempirischer Methoden erforscht werden kann. Ohne eine Idee des Bewusstseins als<br />
Spiegel hätte sich eine Bestimmung der Erkenntnis als Genauigkeit der Darstellung nicht<br />
nahegelegt. Ohne sie wiederum wäre die Strategie von Descartes bis Kant – sozusagen<br />
durch Prüfen, Reparieren und Polieren des Spiegels zu immer akkurateren Darstellungen<br />
zu gelangen – nicht sinnvoll gewesen. 18<br />
Mentale Repräsentationen als (Ab)Bilder realer Dinge auffassen, die Bilder im Geist analog<br />
zu materiellen Dingen verstehen, 19 den Geist als Spiegel oder inneres Theater sich vorstellen –<br />
das wird in der Philosophie des 20. Jahrhunderts in der einen oder anderen Form als zentrales,<br />
aber falsches philosophisches Bild identifiziert, als »Welt-bild« im Sinne Martin Heideggers:<br />
die Welt (repräsentiert) als Bild. 20 Was aber ist zu tun, wenn das irreführende Bild identifiziert<br />
ist? Kann man es so einfach loswerden, wenn unser Denken so lange darin gefangen gewesen<br />
ist? Bleibt es darin gefangen? Wie und durch welche Mittel befreit sich das Denken aus seiner<br />
imaginären Gefangenschaft und womit und in welche Freiheit wird es entlassen? Bergson ist<br />
gerade hier originell, denn sein Gedanke könnte so formuliert werden: Wenn es Bilder gibt,<br />
die unser Denken gefangen halten, dann muss es auch Bilder geben, die unser Denken<br />
befreien. Bergson verwendet Bilder auf komplexe, dynamische und verzweigte Weise, in<br />
kritischer aber auch in konstruktiver Absicht. Er kritisiert die Metaphysik, insofern sie auf<br />
falschen Bilder und Übertragungen beruht und er nimmt damit teil an der Bilderjagd der<br />
modernen Philosophie. Dennoch bleiben Bilder im Bergsonismus unabdingbare Bestandteile<br />
einer erneuerten Metaphysik und Erkenntnistheorie. Philosophie, so meinen wir, ist nach<br />
Bergson Arbeit am Bild, und insofern ist es in gewissem Sinne richtig zu behaupten, Bergson<br />
setze Bilder an die Stelle von Argumenten oder Definitionen.<br />
18 R. Rorty: Der Spiegel der Natur. Eine Kritik der Philosophie, Suhrkamp: Frankfurt a. M., 1981, 22. Rorty hat<br />
eine führende Rolle in der Wiederentdeckung der klassischen amerikanischen Pragmatisten W. James und J.<br />
Dewey übernommen, die derjenigen von G. Deleuze für Bergson gleich kommt. James und Bergson standen in<br />
regem Kontakt und haben je übereinander geschrieben. Angesichts der zahlreichen Übereinstimmungen<br />
zwischen James und Bergson dürfte es nicht verwundern, dass sich der gegenwärtigen ›Renaissance des<br />
Pragmatismus‹ eine ›Renaissance des Bergsonismus‹ zur Seite stellen könnte.<br />
19 Vgl. J. - P. Sartre: »Die Imagination«, in: Die Transzendenz des Egos. Philosophische Essays 1931-1939,<br />
Reinbek b. Hamburg: Rowohlt, 1982, 97-254.<br />
20 Vgl. M. Heidegger: »Das Zeitalter des Weltbilds«, in: Holzwege, Frankfurt a.M.: Vittorio Klostermann, 1977,<br />
75-95.<br />
5
II.<br />
Die falschen Bilder der Metaphysik: Übertragung vom Raum auf die Zeit<br />
Bergson ist gegenüber Sprachbildern – Metaphern, Vergleichen und Analogien – keineswegs<br />
unkritisch, im Gegenteil. Seine Kritik an der Metaphysik kann als eine Kritik an falschen<br />
Übertragungen verstanden werden und deshalb ist Bergson gerade Metaphern gegenüber<br />
skeptisch. Metaphern können – trotz des unübersichtlichen Angebots an Metapherntheorien –<br />
basal und sinngemäss als Übertragungen verstanden werden. Allerdings reicht die einfache<br />
aristotelische Definition der Metapher als »Übertragung eines fremden Nomens [...] gemäss<br />
der Analogie« 21 nicht aus, um Bergsons Skepsis zu verstehen. Es braucht eine erweiterte<br />
Übertragungstheorie, denn es geht um die Übertragung eines ganzen Schemas oder Sets von<br />
Prädikaten einer Sphäre in eine andere Sphäre. 22 Das ist die Pointe von Nelson Goodmans<br />
Definition der »Metapher als eine[r] kalkulierte[n] Kategorienverwechslung«. 23 Ein einfaches<br />
Beispiel: ›Der Mensch ist ein Tier‹. Unter einem zoologischen Blickwinkel ist das strikt wahr.<br />
Als Ausdruck einer pessimistischen Anthropologie jedoch wird ein Set von Prädikaten aus der<br />
Sphäre des Tiers (z.B. Wildheit, Triebsteuerung, Natürlichkeit des Kampfes, männliche<br />
Dominanz, usw.) auf die Sphäre des Menschen übertragen. Diese Übertragung exemplifiziert<br />
drei wichtige Elemente einer falschen Übertragung: sie pickt ein fragwürdiges Set von<br />
Prädikaten heraus, sie übersieht reale Differenzen, aber sie orientiert sich an der strikten<br />
Wahrheit der zoologischen Perspektive. Für Bergsons Kritik falscher Übertragungen nun ist<br />
das zweite Element das wichtigste. 24<br />
Eines der Grundmotive des Bergsonismus besteht in der wiederholten Artikulation einer<br />
realen Differenz zwischen räumlicher Ausdehnung und zeitlicher Dauer (»durée«). 25 Bergsons<br />
Kritik an falschen Übertragungen richtet sich daher wiederholt gegen die Übertragung eines<br />
21 Die bekannte Definition aus der Poetik, 1457a33, des Aristoteles.<br />
22 Vgl. N. Goodman: Sprachen der Kunst. Entwurf einer Symboltheorie, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1995, 75 &<br />
83-84; ders. Vom Denken und anderen Dingen, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1987, 112.<br />
23 N. Goodman: Sprachen der Kunst. Entwurf einer Symboltheorie, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1995, 77.<br />
24 Vgl. dazu D. Deleuze (op. cit., 1989) 34-45. Deleuze formuliert dies als eine von drei methodischen Regeln<br />
des Bergsonismus: »ZWEITE REGEL: Gegen den Schein ankämpfen, die wahren Wesensunterschiede<br />
[différences de nature] oder die natürliche Einteilung des Wirklichen [articulations du réel] zu ihrem Recht<br />
kommen lassen.« (ebd., 34).<br />
25 Die Dauer ist ein Schlüsselbegriff in der Philosophie Bergsons. Sie ist ein Gegenbegriff zur Zeit, die aus einer<br />
Verräumlichung unseres Denkens – einer falschen Metapher – hervorgeht: Die Zeit assoziieren wir gemeinhin<br />
mit einer unendlichen Gerade im Raum, einem Zeitstrahl, oder etwa den Räumen, die ein Uhrenzeiger während<br />
eines bestimmten Zeitintervalls durchmisst. Die Zeit ist unser analytisches Verständnis der Dauer: »Wenn wir<br />
die Vorstellung der Zeit bilden wollen, so ist es in Wirklichkeit ein Raum, der sich uns darstellt« (DSW, 25 /<br />
1256). Im Gegensatz dazu stellt die Dauer ein unendliches in sich übergreifendes Fliessen dar, »eine unteilbare<br />
Kontinuität« (DSW, 26 / 1257) – ein steter Fluss des Werdens und der Veränderung. Sie ist »ein Werdendes und<br />
sogar der Grund von allem übrigen Werden« (DSW, 23 / 1254). Die Dauer kann in ihrem dynamischen Wesen<br />
von der Intelligenz nicht erfasst werden, da diese als Organ der Analyse zergliedernden Charakter hat und somit<br />
dieses unteilbare Ganze der Dauer in statische Einzelteile – z.B. Zeitintervalle – zerlegt. In diesem Sinne entzieht<br />
sich die Dauer auch jeder quantitativen Messmethode. Sie ist allein der Intuition zugänglich und bildet mit ihr<br />
zusammen die Grundlage des bergsonschen Metaphysikkonzeptes (vgl. Abschnitt III).<br />
6
Sets von Prädikaten aus der quantitativen Sphäre der räumlichen Ausdehnung auf die<br />
qualitative Sphäre der zeitlichen Dauer. Diese Übertragung nämlich beherrsche die ganze<br />
abendländische Metaphysik:<br />
Durch die ganze Geschichte der Philosophie hindurch sind Zeit und Raum auf dieselbe<br />
Ebene gestellt und wie Dinge derselben Art behandelt worden. Man untersucht dann eben<br />
nur den Raum, bestimmt seine Natur und seine Funktion und überträgt [transporte] die<br />
gefundenen Ergebnisse auf die Zeit. (DSW, 24 / 1256) 26<br />
Die wichtigsten Prädikate der Raum-Sphäre sind – laut Bergson – Koexistenz, Homogenität,<br />
Reversibilität und Separabilität. Ganz im Gegensatz dazu – so Bergson – muss die Zeit-<br />
Sphäre, die Dauer, als sukzessiv, heterogen, irreversibel und kontinuierlich beschrieben<br />
werden. Werden nun die Prädikate der Raum-Sphäre auf die Zeit-Sphäre übertragen, so<br />
entsteht ein – wie Bergson sagt – »Bastardbegriff« (ZF, 76 / 66) der Zeit und dieser<br />
Bastardbegriff entspricht dem gewöhnlichen Zeitbegriff des Commen-sense, der modernen<br />
Naturwissenschaft und der klassischen Metaphysik: »[K]urz, wir projizieren die Zeit in den<br />
Raum, wir drücken die Dauer durch Ausgedehntes aus, und die Sukzession nimmt für uns die<br />
Form einer stetigen Linie oder Kette an, deren Teile sich berühren, ohne sich zu<br />
durchdringen.« (ZF, 78 / 68) Im Bild der Zeit als einer Linie verortet Bergson diesen<br />
fundamentalen Kategorienfehler und deshalb greift er auch immer wieder auf die Paradoxa<br />
des Zenon zurück. Das Paradox von Achilleus und der Schildkröte oder das Paradox des<br />
unbeweglichen Pfeils entstehen durch eine falsche Übertragung von Prädikaten der Raum-<br />
Sphäre auf die Zeit-Sphäre, als gelebte Zeit oder Dauer, so dass sich letztere räumlichgeometrisch<br />
als Linie darstellt. 27 Die einzelnen Punkte einer Linie sind alle zugleich präsent<br />
(Koexistenz), sie unterscheiden sich qualitativ nicht voneinander (Homogenität), man kann<br />
die Linie vor- und zurück verfolgen (Reversibilität) und die Punkte lassen sich von einander<br />
trennen (Separabilität). Nichts von dem – so Bergson – trifft auf die Zeit als Dauer zu. Ein<br />
weiteres falsches Bild ist die Vorstellung der Zeit als einer Uhr, beispielsweise als Sanduhr:<br />
»[E]s ist nicht leicht, dem Bilde der Sanduhr zu entgehen, wenn man an die Zeit denkt.« (SE,<br />
24 / 509) 28 Auch hier treffen die soeben auf das Bild der Linie angewendeten Prädikate zu.<br />
Durch diese Übertragung wird das Wesen der Zeit, als gelebte Zeit oder Dauer, verfälscht und<br />
eine reale Differenz ignoriert. Dieses fundamental falsche Bild hat für Bergson Auswirkungen<br />
auf wichtige metaphysische und wissenschaftliche Themen, die wir hier nur stichwortartig<br />
andeuten: Zeit, Freiheit, Bewusstsein, Erkenntnis, Erinnerung, Evolution und Leben. Jeder<br />
26 Eine kritische Darstellung dieser Geschichte gibt Bergson im letzten Kapitel von Die schöpferische<br />
Entwicklung.<br />
27 Zum Verhältnis Bergsons zu den Paradoxa des Zenon vgl. H. Gouhier: Bergson et l’histoire de la pensée<br />
occidentale, Vrin: Paris, 1989, 23-34; A. R. Lacey (op. cit.) 32-38.<br />
28 Vgl. auch ZF, 82-84 / 71-74.<br />
7
dieser Themenbereiche und die in ihnen sich stellenden Scheinprobleme im Gefolge der<br />
falschen Übertragung vom Raum auf die Zeit analysiert Bergson sukzessive in seinen<br />
Werken.<br />
Wir haben zu Beginn dieses Abschnitts das Problem metaphorischer Übertragungen am<br />
Beispiel von ›Der Mensch ist ein Tier‹ kurz veranschaulicht und drei Elemente der<br />
Übertragung hervorgehoben. Was ist mit dem ersten und dem dritten Element bei Bergson?<br />
Bergson ist der Ansicht, dass Koexistenz, Homogenität, Reversibilität und Separabilität reale<br />
Prädikate der räumlichen Ausdehnung sind - das im Gegensatz zum ersten Element unseres<br />
Beispiels, in welchem fragwürdige Prädikate übertragen werden. Bemerkenswert ist hier<br />
folgendes: Bergson hält die genannten Prädikate, wenn sie auf Räumliches oder<br />
Ausgedehntes, kurz: auf die Materie angewendet werden für zutreffend, für wahr. Ihre<br />
metaphorische Anwendung auf die Zeit, auf das Bewusstsein und das Leben jedoch hält<br />
Bergson für unzutreffend, für falsche Übertragung. Damit ist aber auch gesagt, dass nicht nur<br />
assertorische Aussagen einen Wahrheitswert haben, d.h. wahr oder falsch sein können,<br />
sondern auch metaphorische Aussagen können wahr oder falsch sein.<br />
Bergson ist weiter der Ansicht, dass sich sowohl die verräumlichte Zeit (der »Bastardbegriff«<br />
der Zeit) als auch der Raum messen und quantifizieren lassen. Von daher die Tendenz, Zeit<br />
ganz und gar dem Raum anzugleichen – das entspricht dem dritten Element unseres Beispiels.<br />
Nichts an den Raum-Vorstellungen des Common-sense, der Naturwissenschaften und der<br />
Metaphysik, insofern sie die ausgedehnte Materie betreffen, steht für Bergson in Frage. Er<br />
erhebt jedoch vehement Einspruch gegen die Übertragung dieser Raum-Vorstellung auf die<br />
Dauer (und damit auf das Bewusstsein und das Lebendige). Diese Übertragung schafft Bilder,<br />
die unser Denken gefangen halten.<br />
Der negative Teil der Arbeit am Bild besteht in der Abarbeitung falscher Übertragungen. Im<br />
Vortrag Die philosophische Intuition (DSW, 126-148 / 1345-1362) legt Bergson dar, dass der<br />
erste Schritt der philosophischen Intuition gleichfalls negativ ist. Er vergleicht sie mit dem<br />
Daimonion des Sokrates, »das diesen nur vor falschen Entscheidungen zurückhält, ihn jedoch<br />
nie zu Entscheidungen anhält«. Bergson spricht von einer »einzigartigen Macht der<br />
Verneinung«, die in der Intuition – genauer: im intuitiven Bild, »immanente à l’intuition ou à<br />
son image« – stecke (DSW, 129 / 1348). Sie vermittelt das Gefühl, dass etwas ›nicht stimmt‹,<br />
dass etwas ›falsch läuft‹, dass Themen unter falschen Gesichtspunkten angegangen werden<br />
und die so entstehenden Probleme Scheinprobleme sind. Im Erkennen der falschen<br />
Übertragungen, die uns gefangen halten, übt die philosophische Intuition ihre negative Kraft<br />
in elaborierter Weise aus. Wodurch aber werden die befreienden Bilder geschaffen? Bergsons<br />
8
positive Antwort, wie wir im folgenden Abschnitt darlegen, lautet ebenfalls: durch die<br />
Intuition.<br />
III.<br />
Das intuitive Bild: Produktion und Vermittlung<br />
In der 1903 erschienenen Einführung in die Metaphysik (DSW, 180-225 / 1392-1432)<br />
unterscheidet Bergson zwei Arten der Erkenntnis: relative und absolute Erkenntnis;<br />
alltägliche und naturwissenschaftliche Erkenntnis einerseits, metaphysische Erkenntnis<br />
andererseits. Erstere gewinnt man mit Hilfe der Analyse, letztere mit Hilfe der Intuition. 29<br />
Analytische Erkenntnis ist stets relativ: Sie operiert mit Symbolen und ist<br />
gesichtpunktsabhängig. Im Gegensatz dazu ist intuitive Erkenntnis absolut: Sie ist wesentlich<br />
asymbolisch und hängt von keinem Gesichtspunkt ab. Während sich analytische Erklärungen<br />
der Naturwissenschaft in einer Unzahl von Begriffen und Symbolen verlieren und umso mehr<br />
begrifflichen Aufwand betreiben müssen, je genauer sie die einfache, ungeteilte, individuelle<br />
Besonderheit eines Gegenstandes zu fassen versuchen, 30 gelingt es der Intuition genau diese<br />
unaussprechliche ungeteilte Einfachheit eines Gegenstandes als Einheit zu erfassen. Genau<br />
um diese Einfachheit geht es Bergson in seinem metaphysischen Programm. Gerade in dieser<br />
einfachen Ungeteiltheit besteht auch das Absolute eines Gegenstandes, das gerade deshalb<br />
nicht begrifflich erfasst werden kann, weil die Begriffe als Instrument der Analyse immer<br />
verallgemeinern, etwas immer nur relativ - in Abgrenzung oder Anlehnung zu etwas anderem<br />
- erfassen können, doch nicht die Einzigartigkeit eines Gegenstandes. 31 Dieses Einfache oder<br />
Absolute eines Gegenstandes, zu dem die Analyse nie gelangen kann, ist etwas von allen<br />
aufzählbaren Bestandteilen und Eigenschaften wesentlich Verschiedenes. Bergson<br />
veranschaulicht dies mit dem Bild des Auges:<br />
29 Der Gegensatz zweier Arten von Erkenntnis hat eine lange philosophische Tradition, von der sich Bergson<br />
jedoch immer wieder abzusetzen versucht. Das gilt insbesondere für die romantische Philosophie eines Schelling<br />
oder Schopenhauer. 1901 und also zeitgleich mit Bergson hat Benedetto Croce den Unterschied zwischen<br />
Intuition und diskursiver Erkenntnis an den Anfang seiner Ästhetik gestellt, nämlich in: Ästhetik als<br />
Wissenschaft vom Ausdruck und allgemeine Sprachwissenschaft (nach der 6. erw. ital. Aufl. übertr. v. H. Feist<br />
und R. Peters), Tübingen: J. C. B. Mohr, 1930 (= Gesammelte philosophische Schriften in deutscher<br />
Übertragung; Bd. 1). Allerdings entfernt sich Croces Unterscheidung von Intuition und Begriff schnell von<br />
Bergsons Unterscheidung, denn Croce erhebt die Intuition als Anschauung zum Inbegriff der Kunst. Da Kunst<br />
für Croce primär Expression ist, lautet die Formel: Was intuitiv erfasst wird, kann auch ausgedrückt werden.<br />
Demgegenüber verhält sich Bergsons Intuition zum Ausdruck problematisch und sie ist auch nicht mit der<br />
Anschauung gleichzusetzen.<br />
30<br />
Der begriffliche Aufwand einer analytischen Untersuchung verhält sich reziprok zur angestrebten<br />
Präzisierung. D.h. je genauer ein Gegenstand beschrieben werden will, desto mehr Begriffe sind nötig. Je<br />
präziser die an sich ungeteilte Ein- und Einfachheit eines Gegenstandes erfasst werden will, desto mehr<br />
begriffliches Material muss dazu verwendet werden.<br />
31 Diese ungeteilte Einfachheit auszudrücken gelingt den Begriffen nicht, weil sie Dinge durch ihre<br />
zergliedernde Eigenschaft stets approximativ erfassen und wesentlich Definitionscharakter haben (vgl. dazu<br />
Anm. 37).<br />
9
Zwei Dinge sind es, die bei einem Organ wie dem Auge in gleicherweise frappieren: die<br />
Vielseitigkeit des Baus und die Einfachheit der Funktion. Das Auge setzt sich aus<br />
deutlich geschiedenen Teilen, wie Skelera, Hornhaut, Retina, Linse und so weiter<br />
zusammen. Bei jeden dieser Teile geht das Detail ins Grenzenlose. Um nur von der<br />
Retina zu sprechen, so umfasst sie bekanntlich übereinanderliegende Schichten nervöser<br />
Elemente, multipolare, bipolare und Sehzellen, deren jede ihre Besonderheit besitzt und<br />
unzweifelhaft einen äusserst vielgliedrigen Organismus bildet, und doch ist auch dies<br />
noch ein vereinfachtes Schema des feinen Baus dieses Häutchens. Aus unzähligen<br />
Maschinen also, deren jede von äusserster Kompliziertheit ist, setzt sich die Maschine des<br />
Auges zusammen. Dennoch ist das Sehen ein einfacher Vorgang. (SE, 93-4/570)<br />
Das Sehen selbst ist ein an sich einfacher und ungeteilter Akt und kann als solcher nicht aus<br />
der Analyse des Auges mit seinen Bestandteilen erklärt werden. Ganz analog dazu erklärt<br />
Bergson die Kompliziertheit mancher philosophischen Lehre. Auch ihnen liegt ein solch<br />
einfacher Gedanke zu Grunde, der gerade seiner Einfach- und Einzigartigkeit wegen nie hat<br />
ausgesprochen werden können.<br />
In diesem Punkt liegt irgend etwas so Einfaches, so unendlich Einfaches, so<br />
aussergewöhnlich Einfaches, dass es dem Philosophen niemals gelungen ist, es<br />
auszudrücken. Und darum hat er sein ganzes Leben lang darüber gesprochen. [...] Die<br />
ganze Kompliziertheit seiner Lehre, die bis ins Unendliche gehen würde, bedeutet also<br />
nur die Inkommensurabilität zwischen seiner einfachen Grund-Intuition und den<br />
Ausdrucksmitteln, über die er verfügte. (DSW, 127-8 / 1347)<br />
Das Erfassen dieser Einfachheit bleibt alleine der Intuition vorbehalten. Sie wird somit zur<br />
Methode der Metaphysik schlechthin. Sie erfasst das Innere eines Gegenstandes, indem sie<br />
sich in einem Akt der Sympathie 32 in den Gegenstand selbst hineinversetzt, und vermag<br />
dadurch Subjekt und Objekt zu identifizieren. Durch diese Identifikation wird der<br />
Gesichtspunkt aufgehoben, die Erkenntnis verliert ihre Relativität und wird absolut.<br />
Bergsons Metaphysik geht von einer Intuition der Dauer aus. Ausgehend von dieser basalen<br />
Intuition können alle weiteren Gegenstände in ihrer Absolutheit erfasst werden. Diese<br />
Intuition kann jedoch nicht begrifflich umschrieben werden 33 : Der Mensch muss sie selbst<br />
erfahren. Als intelligenzbestimmtes Wesen muss er erst zu dieser Intuition geführt werden.<br />
Sie muss ihm vermittelt werden. Diese Vermittlung findet mit Hilfe von Bildern statt, obwohl<br />
sich die Intuition selbst letztlich nicht in einem Bild erschöpft. Dieses vermittelnde Bild nennt<br />
Bergson in Die philosophische Intuition »image intermédiaire«. 34 In diesem besonderen Bild<br />
32 »Wir bezeichnen hier als Intuition die Sympathie, durch die man sich in das Innere eines Gegenstandes<br />
versetzt, um mit dem was er Einzigartiges und infolgedessen Unaussprechliches an sich hat, zu koinzidieren«<br />
(DSW, 183 / 1395). Es sollen hier nicht die Folgen eines solchen Intuitionsverständnisses erörtert werden, die in<br />
logischer Konsequenz auf eine Art Panpsychismus auslaufen: Denn die Sympathie, ist auf »ein Inneres,<br />
sozusagen einen Seelenzustand« (DSW, 181 / 1393) des absolut zu erfassenden Gegenstandes angewiesen.<br />
33 Denn genau dann wäre sie wieder analytisch, was sie angesichts ihrer metaphysischen Aufgabe gerade nicht<br />
sein soll. Wie im zuvor aufgeführten Beispiel ist nur die Intuition dazu fähig, das Sehen des Auges als einfachen<br />
Akt wahrzunehmen. Die Analyse könnte lediglich die einzelnen Bestandteile des Auges aufzählen, aufgrund<br />
deren Kenntnis jedoch das Sehen nicht erfasst werden könnte. Die Intuition ist etwas von der Begrifflichkeit<br />
wesentlich Verschiedenes.<br />
34 An anderen Stellen spricht Bergson auch von einem »image médiatrice«.<br />
10
esteht die grösst mögliche Nähe zur Intuition. Es erfasst diese unaussprechliche Einfachheit<br />
der Intuition am besten, da es »wie ein Schatten« dieser Intuition ist.<br />
Aber was wir erfassen und festlegen können, das ist ein gewisses, zwischen der<br />
Einfachheit der philosophischen Intuition und der sie ausdrückenden Fülle der<br />
Abstraktionen vermittelndes Bild [image intermédiaire], ein flüchtig aufleuchtendes Bild,<br />
welches vielleicht ihm selber unbewusst, ihm dauernd nachgeht, ihn wie ein Schatten<br />
durch alle Windungen seines Gedankens verfolgt, und das, wenn es auch nicht die<br />
Intuition selbst ist, sich ihr sehr viel mehr annähert als der begrifflich Ausdruck, der<br />
notwendigerweise symbolisch ist, auf den die Intuition zurückgreifen muss, um sog.<br />
›Erklärungen‹ darzubieten. (DSW, 128 / 1347)<br />
Die ganze Anstrengung der Metaphysik besteht somit darin solche »images intermédiaires«<br />
zu entwerfen, die zu der fundamentalen Intuition der Dauer führen. Die Bildproduktion wird<br />
zur Hauptaufgabe der Philosophie.<br />
Demjenigen der nicht fähig wäre, die sein Wesen aufbauende Dauer intuitiv selbst zu<br />
erfassen, würde man sie weder durch Begriffe noch durch Bilder vermitteln können. Die<br />
einzige Aufgabe des Philosophen beschränkt sich hier darauf, zu einer gewissen geistigen<br />
Anstrengung anzuregen, die bei den meisten Menschen durch die praktischen<br />
Denkgewohnheiten gehindert wird. Nun hat das Bild wenigstens den Vorteil, dass es uns<br />
im Bereich des Konkreten belässt. Kein Bild kann die unmittelbare Intuition der Dauer<br />
ersetzen, aber viele verschiedenartige Bilder, die den verschiedensten Bereichen der<br />
Dinge entlehnt werden, können durch die Konvergenz der Wirkung [par la convergence<br />
de leur action] das Bewusstsein auf den Punkt hinlenken, wo eine gewisse Intuition<br />
möglich ist. (DSW, 187-8 / 1399)<br />
Die verschiedenen Bilder sollen die Intuition durch die »Konvergenz ihrer Wirkung« anregen.<br />
Sie müssen sich in ihrer Wirkung überlappen. Die Notwendigkeit der verschiedenartigen<br />
Bilder, die aus verschiedenen Richtungen in der Intuition konvergieren sollen, erklärt sich<br />
auch in der Schattenhaftigkeit des »image intermédiaire«:<br />
Sehen wir uns den Schatten einmal näher an: wir werden aus ihm die Haltung des<br />
Körpers, der ihn wirft, erraten, und wenn wir uns sehr bemühen die Haltung<br />
nachzuahmen, oder besser noch, uns in sie hineinzuversetzen, so werden wir, so weit das<br />
möglich ist” zur Intuition gelangen. (DSW, 128 / 1347)<br />
Die Gestalt eines Körpers kann umso besser aufgrund der Form seiner Schatten erschlossen<br />
werden, je grösser die Kenntnis vielfältiger und verschiedenartiger Schatten durch eine<br />
unterschiedliche Beleuchtung ist.<br />
Damit die Bilder ihre Funktion der Intuitionsvermittlung übernehmen können, müssen sie<br />
eine gewisse Leistung vollbringen: Diese besteht in der Produktion von Gemeinsamkeiten.<br />
Denn eine konvergente Wirkung ist auf solche Gemeinsamkeitsleistung angewiesen.<br />
Bergsons Beispiele selbst belegen, dass zwischen den Bildern keine thematische<br />
Gemeinsamkeit besteht. Im Gegenteil gerade solche Gemeinsamkeiten sollen vermieden<br />
werden. 35 Die Gemeinsamkeit ist vielmehr struktureller Art und zeigt sich in der inhaltlichen<br />
35 Bergson meint, dass die verschiedenartigen Bilder »den verschiedensten Bereiche der Dinge« (DSW, 187 /<br />
1399) entlehnt werden sollen.<br />
11
Gliederung seiner »images intermédiaires«, durch die Unterteilung seiner Bilder in ein<br />
Positivum und in ein Negativum. Untersuchen wir dies an Bergsons Beispielen direkt. Das<br />
erste Bild stammt aus dem Alltag. Es soll die Dauer anhand der persönlichen Erfahrung des<br />
eigenen fliessenden Bewusstseinsstrom, die sich im Bild eines Rouleaus manifestiert,<br />
anregen.<br />
Es ist, wenn man so will, wie das Abrollen eines Rouleaus, denn es gibt kein Lebewesen,<br />
das sich nicht allmählich am Ende seiner Rolle ankommen fühlt [qui ne se sente arriver<br />
peu à peu au bout de son rôle]; und Leben besteht im Altern. Aber es ist ebenso auch ein<br />
beständiges Aufrollen wie beim Faden auf einem Knäuel, denn unsere Vergangenheit<br />
folgt uns, sie wächst unaufhörlich mit der Gegenwart, die sie unterwegs aufnimmt [...].<br />
Im Grunde genommen handelt es sich weder um ein Aufrollen noch um ein Abrollen,<br />
denn beide Bilder rufen die Vorstellungen von Linien und Flächen wach, deren Teile<br />
untereinander homogen und vertauschbar sind. (DSW, 185-6 / 1397-8) 36<br />
In positivem Sinne soll die Dauer durch das Gefühl eines im steten qualitativen Wandel<br />
befindenden Bewusstseins dargestellt werden: Eine Rolle die bei jeder neuen Umdrehung<br />
sämtliche schon vollzogenen Umdrehungen mit sich führt. Dagegen soll von diesem »image<br />
intermédiaire« die geometrische resp. räumliche Anschauung abstrahiert werden. Indem<br />
Bergson das Negativum seines Bildes expliziert, schärft er das Bewusstsein für falsche Bilder<br />
resp. deren falsche Übertragung und schliesst damit offensichtlich an die Bekämpfung<br />
falscher Metaphern an, die wir im zweiten Abschnitt beschrieben haben.<br />
Das zweite Bild stammt aus der Optik.<br />
Man muss also das Bild eines Spektrums mit 1000 Nuancen wachrufen, mit<br />
unmerklichen Übergängen, die von einem zum anderen führen. Ein Gefühl, das dieses<br />
Spektrum durchliefe, indem es nacheinander von jeder dieser Nuancen gefärbt würde,<br />
würde graduelle Veränderungen empfinden, von denen jede die folgende ankündigte und<br />
alle vorhergehenden in sich zusammenfasste, wobei allerdings die aufeinanderfolgenden<br />
Nuancen des Spektrums äusserlich zueinander blieben, weil sie Raum einnehmen und<br />
sich so nebeneinander reihen. Die reine Dauer jedoch schliesst jede Vorstellung des<br />
Nebeneinanders, einer gegenseitigen Äusserlichkeit und Ausdehnung aus. (DSW, 186 /<br />
1398)<br />
Der positive Teil dieses Bildes versucht die Intuition der Dauer mit Hilfe der Vorstellung<br />
eines unmittelbaren, momentanen, rein qualitativen Erlebnisses anzuregen. Der negative Teil<br />
besteht aus einer Einschränkung am Ende: In ihr gibt Bergson die noch bestehende Differenz<br />
zwischen dem illustrierenden Bild und der reinen Dauer an.<br />
36 Bergson gebraucht dieses etwas merkwürdige Bild des Rouleaus auch oft in SE. Dort allerdings weist er das<br />
Bild der absteigenden Tendenz der Materie (im Gegensatz zur aufsteigenden Tendenz des élan vital) innerhalb<br />
der Evolution des Lebens zu (vgl. SE, 17 / 503). Dieses Bild der Materie zuweisen bedeutet, es dem Raum<br />
zuweisen. Bergson bedient sich dabei gerne eines Wortspieles, denn »arriver au bout de son rouleau / rôle«<br />
bedeutet so viel als: am Ende seiner Weisheit, seines Lateins ankommen. Genau das aber passiert dem<br />
räumlichen Denken, der Analyse, wenn es auf die Zeit, auf das Bewusstsein oder das Leben stösst (vgl. SE, 216-<br />
217 / 675).<br />
12
Das unmittelbar anschliessende Bild stammt aus der Mechanik und versucht die Intuition der<br />
Dauer strukturanalog zu vermitteln.<br />
Stellen wir uns ein unendlich kleines Gummiband vor, das, wenn es möglich wäre, in<br />
einem mathematischen Punkt zusammengezogen wäre. Ziehen wir es allmählich<br />
auseinander, sodass aus dem Punkt eine stetig sich verlängernde Linie hervorgeht.<br />
Richten wir dabei unsere Aufmerksamkeit nicht auf die Linie als Linie, sondern auf die<br />
Kraft, die sie entstehen lässt. Erwägen wir, dass diese angespannte Energie trotz ihrer<br />
Dauer unteilbar ist, wenn man annimmt, dass sie sich ohne Aufenthalt auswirkt, dass,<br />
wenn man einen Ruhepunkt einschiebt, man aus der einen Handlung zwei macht, von<br />
denen jede wieder unteilbar wäre, dass niemals der die Bewegung erzeugende Akt teilbar<br />
ist, sondern nur die unbewegliche Linie, die sie als eine Spur im Raume gleichsam hinter<br />
sich zurücklässt. Machen wir uns schliesslich ganz frei von dem Raum, der die<br />
Bewegung unterspannt um nur die Bewegung selbst, den Akt der Spannung oder<br />
Entspannung, kurz, die reine Bewegung ins Auge zu fassen. Diesmal haben wir schon ein<br />
getreueres Bild unserer Entwicklung in der Dauer. (DSW, 186-187 / 1398)<br />
Der negative Teil besteht in diesem Falle wiederum aus der am Ende angefügten<br />
Einschränkung, die auf den Unterschied zwischen seinem Bild und wirklichen Dauer<br />
verweist. Es ist wie im ersten und zweiten Bild eine Aufforderung, die Vorstellung des<br />
Raumes aufzugeben, weil die Dauer - im Gegensatz zur Zeit - mit dem Raum nichts zu tun<br />
hat. Im positiven Sinne soll die Intuition der Dauer durch die Vorstellung einer Kraft oder<br />
Spannung als solche hervorgerufen werden.<br />
Während sich die negativen Teile dieser Bilder explizit überschneiden, besteht zwischen den<br />
positiven Teilen der Bilder lediglich eine implizite Gemeinsamkeit: Diese Beispiele<br />
suggerieren das Gefühl einer einfachen Ungeteiltheit. Bergsons intuitionsvermittelnde Bilder<br />
produzieren demnach in ihrer konvergenten Wirkung Gemeinsamkeiten, die auf einen<br />
bestimmten Punkt hin zu verweisen scheinen: auf eine Erfahrung einer ungeteilten<br />
Einfachheit losgelöst von jeglicher räumlicher Anschauung.<br />
Bergson scheint an seinen Bildern regelrecht zu arbeiten: Er präzisiert sie, baut sie aus, stellt<br />
sie unter einander in Abhängigkeit und schafft Bezüge unter ihnen, die selbst wieder<br />
Rückwirkungen auf sie ausüben. Sein Umgang mit Bildern erweist sich nicht bloss als<br />
Exemplifikation seiner Theorie, sondern als Bilderarbeit. Mit Hilfe dieser Bilderarbeit zieht<br />
Bergson den Rezipienten explizit mit in den Text ein. In seinen Bilder legt er durch die<br />
Angabe ihrer positiven und negativen Teile deren Produktionsplan offen: Er zeigt, wie sie<br />
konstruiert sind und auf was sie abzielen. Damit legt Bergson eine Tendenz fest, die als<br />
Anweisung zur eigenen Bildproduktion dient. Genau dieser seinen Bildern inhärente<br />
Produktionsplan befähigt den Rezipienten die Bilder in sich weiter zu verarbeiten, sich ihrer<br />
Wirkung hinzugeben und dadurch zur Intuition zu gelangen. Seine Bildproduktion ist also ein<br />
wesentlicher Bestandteil der Intuitionsvermittlung, bei der sich die klare Grenze zwischen<br />
Rezipient und Produzent auflöst. Bergson produziert seine Bilder nicht zuerst alleine und legt<br />
13
sie anschliessend der Leserin vor, damit diese Bilder in ihr die Intuition der Dauer vermitteln.<br />
Im Gegenteil, er vermittelt sie, indem und während er sie produziert. In der Bilderarbeit findet<br />
die Vermittlung produktiv statt: Die Intuition wird gerade dadurch vermittelt, dass in der<br />
Bildproduktion die Tendenz zum angestrebten Punkt, an dem man zur Intuition der Dauer<br />
gelangen kann, angezeigt wird. Ansonsten müsste die Intuition nicht dadurch vermittelt<br />
werden, indem die Produktion des Bildes selbst im Text stattfindet. Bergson könnte bloss<br />
Beispiele nennen.<br />
Bergsons Bilderarbeit, seine selbstbewusste Produktion von Bildern, die auf etwas zielen, das<br />
selbst nicht Bild und nicht Sprache sein kann, nämlich die Intuition, verweist auf ein<br />
ästhetisches Phänomen der selbstbewussten literarischen Moderne. In ihr geht es nicht nur<br />
darum, Bedeutungen zu erzeugen, sondern die Erzeugung von Bedeutungen selbst<br />
offenzulegen, nicht nur auf das Was, das Signifikat, zu zielen, sondern auf das Wie, das<br />
Signifizieren selbst. Das Signifizieren selbst in der Bilderarbeit trifft freilich das intentierten<br />
Signifikat nicht, der sich der sprachlichen Erfassung entzieht. Die Bilder können lediglich auf<br />
die Intuition verweisen. Bergson konzentriert diesen Prozess des Signifizierens jedoch auf die<br />
Bilderarbeit, keineswegs aber auf seinen Sprachgebrauch schlechthin. Sein argumentativer<br />
Sprachgebrauch ist direkt und referentiell. Um eine Unterscheidung von Paul de Man<br />
aufzunehmen: Bergsons diskursiver Stil ist semantisch (auf das Was der Bedeutung gerichtet),<br />
seine Bilderarbeit aber semiologisch (auf das Wie des Bedeutens – oder: Andeutens –<br />
gerichtet). 37<br />
IV.<br />
Das argumentative Bild: Metaphysik und Recoupage<br />
Die Bilderarbeit nimmt in Bergsons Projekt der Metaphysik einen wichtigen Stellenwert ein.<br />
In gewissem Sinne verweist ein solcher Umgang mit Bildern auf Argumentationscharakter.<br />
Die Bilder bleiben nicht nur illustrative Begleiterscheinungen im Text, welche die Theorie<br />
veranschaulichen sollen, sondern sie nehmen eine konstitutive Rolle in Bergsons<br />
Argumentation ein. Ja, die Bilder sind in gewissem Sinne die Argumente seiner Metaphysik,<br />
da diese wesentlich auf der Intuition der Dauer beruht, die wiederum erst durch Bilder<br />
vermittelt werden kann. Eingangs stellten wir die These auf, das Bergsons Bilder in gewissem<br />
37 Vgl. P. de Man: Allegories of Reading. Figural Language in Rousseau, Nietzsche, Rilke, and Proust, New<br />
Haven: Yale University Press, 1979, 5.<br />
14
Sinne als Argumente verstanden werden können. Eine solche Auffassung ist nicht problemlos<br />
und verlangt nach einer genauen Spezifizierung. Vordergründig handelt es sich bei den<br />
Bildern Bergsons nicht um Argumente:<br />
Erstens sind sie keine Argumente im logischen Sinne. Denn logische Argument kennzeichnen<br />
sich dadurch, dass sie in sich Bestandteile enthalten, welche die logischen Funktionen von<br />
Prämissen und Konklusionen übernehmen. Solche Bestandteile sind bei Bergsons Bildern<br />
nicht - auch nicht strukturell - auszumachen.<br />
Zweitens sind die Bilder keine Argumente in Bergsons Philosophie, da er ja selbst<br />
argumentiert. Es würde Bergsons Anstrengungen nicht gerecht werden, seinen<br />
Argumentationsgang zu missachten und stattdessen diese Funktion seinen Bildern<br />
zuzusprechen.<br />
Drittens ist ein Argument immer mit einem Urteil verbunden und ist daher wesentlich<br />
begrifflich. Das Argument gehört daher qua Begrifflichkeit in den Bereich der Analyse, dem<br />
sich das Bild hingegen durch seine Unbegrifflichkeit gerade entzieht.<br />
Jedoch ist es gerade diese Unbegrifflichkeit der Bilder, die ihnen unter besonderen<br />
Umständen argumentativen Charakter verleihen: Im Rahmen seiner Metaphysik übernehmen<br />
Bilder durchaus die Funktion von Argumenten, insofern man unter einem Argument ein<br />
strukturelles Element eines Beweisganges versteht. Da metaphysische Erkenntnis – die<br />
Erkenntnis des Absoluten – in Bergsons Konzeption wesentlich unbegrifflich 38 ist und auf der<br />
Intuition beruht, deren Vermittlung durch die Bilderarbeit stattfindet, geht die Metaphysik<br />
Bergsons aus Bildern und der Arbeit an ihnen hervor. Die Bilderarbeit wird somit zur<br />
eigentlichen Argumentation der Metaphysik Bergsons. 39<br />
Im grösseren Umkreis der Philosophie Bergsons erhalten die Bilder zusätzlich argumentativen<br />
Charakter, insofern sie strukturelle Bedingungen für richtige Prämissen schaffen. Will<br />
heissen: In seiner Metaphernkritik (vgl. Abschnitt II) wehrt sich Bergson gegen den falschen<br />
Gebrauch von Bildern. Viele Aporien und Missverständnisse der Philosophie rühren seiner<br />
Meinung nach von einer falschen Übertragung der Bilder her. 40 Bei solchen Problemen ist es<br />
gerade wichtig, das richtige Bild zu finden. Denn erst aufgrund des richtigen Bildes kann der<br />
38 Die Begriffe sind im Bereich der Analyse angesiedelt und daher ungeeignet zu metaphysischer Erkenntnis.<br />
Wie alle analytischen Instrumente operieren sie approximativ, d.h. sie versuchen Einzigartigkeit durch<br />
Anhäufung immer weiter spezifizierender Begriffe zu fassen. »[D]er Begriff verallgemeinert in demselben<br />
Masse wie er abstrahiert. Der Begriff kann eine bestimmte Eigenschaft nur dadurch symbolisieren, dass er sie<br />
einer Unzahl von Dingen beilegt. Er entstellt sie also mehr oder weniger durch die Ausdehnung, die er ihr gibt.<br />
[...] Die verschiedenen Begriffe, die wir von den Eigenschaften eines Dinges bilden, beschreiben so um dieses<br />
herum ebenso viele immer weiter um sich greifende Kreise, von denen keiner mit dem Dinge sich selbst deckt.«<br />
(DSW, 189 / 1400-1401) In diesem Sinne sind sprachliche Argumente in Bergsons Metaphysik von vornherein<br />
ausgeschlossen. (Vgl. zur Unbegrifflichkeit des Absoluten auch Anm. 30).<br />
39 Wenn in seiner unbegrifflich angelegten Metaphysik überhaupt ein Argumentationsgang angelegt sein soll, so<br />
besteht dieser am ehesten in seiner spezifischen Verwendungsweise des intuitiven Bildes.<br />
15
Gegenstand auch richtig angegangen und untersucht werden. In diesem Sinne ist jede<br />
Argumentation von einem ihr zu Grunde liegenden Bild geprägt, von dessen Richtigkeit der<br />
Erfolg der daraus geschlossenen Folgerungen abhängt. Das Bild kann also in Bergsons<br />
Philosophieren generell als argumentative Grösse gesehen werden – wo nicht selbst als<br />
Argument, wie z.B. in seiner Metaphysik, so doch als eine jeder Argumentation impliziten<br />
Voraussetzung.<br />
Die Wichtigkeit der richtigen Bilderwahl demonstriert Bergson selbst in seinem<br />
Philosophieren: Auf einzigartige Weise vermag er immer wieder scheinbar widersprüchliche<br />
und gegensätzliche Anschauungen der Philosophie als je verschiedene Interpretationen eines<br />
ihnen zu Grunde liegenden Bildes zu verstehen und damit zu vereinen. Dieses Vorgehen<br />
nennt der Leszek Kolakowski »recoupage«. 41 Scheinbare Gegensätzlichkeiten lösen sich dabei<br />
als unterschiedliche Auslegungen eines ihnen implizit zu Grunde liegenden Bildes auf. Die<br />
Recoupage ermöglicht ihm, sämtliche Divergenzen zweier widersprechender Systeme als<br />
Produkt einer falschen, geteilten Annahme zu verstehen, die sich bereits in ihrer falsch<br />
gestellten Frage zeigt 42 . In Materie und Gerdächtnis überwindet Bergson den scheinbar<br />
unüberbrückbaren Gegensatz von Realismus und Idealismus dadurch, dass er ihnen das<br />
(intuitive) Bild des (epistemischen) Bildes zu Grunde legt. 43 In der Schöpferische Entwicklung<br />
40 Bergson formuliert diese These in seinem Vorwort zu Zeit und Freiheit in einer rhetorischen Frage: »Es liesse<br />
sich jedoch die Frage aufwerfen, ob nicht die unübersteiglichen Schwierigkeiten, die gewisse philosophische<br />
Probleme bieten, daher kommen, dass man dabei beharrt, die Erscheinungen, die keinen Raum einnehmen, im<br />
Raume nebeneinander zu ordnen, und ob sich der Streit nicht oft dadurch beenden liesse, dass man von den allzu<br />
groben Bildern abstrahiert, um die er sich abspielt« (ZF, 7 / 4).<br />
41 Vgl. L. Kolakowski (op. cit.) 13-14. Kolakowski stellt die Recoupage Bergsons als Hinterfragen der<br />
Gemeinsamkeit zweier entgegengesetzten Systeme dar. Sie sei dadurch gekennzeichnet, dass Bergson sich<br />
fragte, »an welchem Punkte sie (die beiden Systeme) sich kreuzten, das heisst, was ihnen gemeinsam war.<br />
Daraufhin zeigte er, dass beide eine falsche Annahme teilten [...]. Auf diese Weise brachte er sich in die Lage,<br />
das Problem an seiner Wurzel zu packen« (ebd.). Kolakowski vertritt also die Ansicht, Bergson sei durch die<br />
Analyse der beiden Systeme auf die ihnen zu Grunde liegende Gemeinsamkeit gestossen. Die Recoupage besteht<br />
dabei in der vereinigenden Textanalyse. Wir hingegen sind der Meinung, dass erst das Setzen eines Bildes –<br />
einer neuen strukturellen Bedingung für Prämissen – diese Recoupage ermöglicht. Das fundamentale Bild wird<br />
nicht induktiv über die Gemeinsamkeit der Systeme erschlossen, sondern die beiden Systeme werden als<br />
deduktiv einseitig gefolgerte Auslegungen dieses Bildes erfasst. Somit wird das Bild zur wichtigsten<br />
argumentativen Kraft seiner Recoupage.<br />
42 Gerade dieses Phänomen der Recoupage, die falsche Prämissen als Ausdruck eines falsch verstandenen oder<br />
an sich falschen Bildes entlarvt, verweist auf die argumentative Grösse, die dem Bild im Rahmen einer<br />
strukturellen Bedingung für richtige Prämissen zukommt: Die richtigen Prämissen können nur aufgrund eines<br />
richtigen Bildes entwickelt werden.<br />
43 In seiner in Materie und Gedächtnis ausgeführten Theorie der Wahrnehmung geht Bergson von dem für uns<br />
und für den gesunden Menschenverstand immer schon gegebenen aus: Von der Welt wie sie uns a priori<br />
erscheint – von einer Ansammlung von Bildern (vgl. MG, 1 / 169). Aus diesen Bildern besteht die ganze Welt:<br />
Sie erscheint uns grundsätzlich in zwei verschiedenen Bildsystemen. Im einen sind Bilder a-zentrisch oder<br />
ungeordnet, stehen in kausaler Abhängigkeit zu einander und sind Naturgesetzen unterworfen. Es sind dies die<br />
Bilder, die man gewöhnlich Dinge der Welt nennt. Im anderen sind sie konzentrisch um ein ausgezeichnetes Bild<br />
– mein Leib – angeordnet und sie ändern sich, sobald dieses ausgezeichnete Bild seine Lage verändert. Diese<br />
Bilder werden gemeinhin Wahrnehmungen der Welt genannt. Die Widersprüchlichkeit oder die Inkompatibilität<br />
von Realismus und Idealismus diagnostiziert Bergson in ebendieser dualen Erscheinungsweise der Welt: Der<br />
Realist bezieht sich in seinen Erklärungen auf die Wissenschaft, der gemäss alle Bilder in einer Ebene kausal<br />
16
geschieht dasselbe mit dem Gegensatz zwischen Finalismus und Mechanismus. Für diese<br />
Recoupage verwendet Bergson das Bild des élan vital – der ›Lebensschwungkraft‹, die für<br />
den Bergsonismus schon fast emblematisch wurde. Der Grundirrtum der beiden<br />
Erklärungsansätze Finalismus und Mechanismus entdeckt Bergson in ihrer Unfähigkeit die<br />
Dauer zu erkennen, was sich in der ihnen gemeinsamen deterministischen Konsequenz<br />
äussert: In der Zweckmässigkeitslehre<br />
wie in der mechanistischen Hypothese, wird vorausgesetzt, es sei alles gegeben. So<br />
angegeben ist der Finalismus nur ein umgekehrter Mechanismus. Ihn beseelt das gleiche<br />
Postulat; mit dem einzigen Unterschied nur, dass er die Leuchte, mit der er unsere<br />
endlichen Intelligenzen auf ihrer Wanderung durch das ganz und gar scheinhafte<br />
Nacheinander der Dinge führen will, vor uns statt hinter uns aufpflanzt. [...] Einer wie der<br />
andere lehnt es ab, im Fluss der Dinge oder auch nur in der Entwicklung des Lebens eine<br />
unvorhersehbare Schöpfung von Form zu erblicken. (SE, 45 & 51 / 528 & 533)<br />
Das Bild des élan vital ermöglicht Bergson die beiden widersprüchlichen Systeme als<br />
Konsequenz einer einseitigen Interpretation dieser ›Lebensschwungkraft‹ zu sehen. Er<br />
erkennt, dass Finalismus und Mechanismus »beide im Grunde nur Gesichtspunkte des<br />
menschlichen Geistes sind« (SE, 95 / 571). 44 So legt der Finalismus in der<br />
Entwicklungsgeschichte eines Organs sein Augenmerk auf dessen Funktion, dessen<br />
Verwirklichung ihm als einfacher Plan schon immer vorgeschwebt hat, während der<br />
Mechanismus dieselbe Entstehung aus dem Aufbau seiner Bestandteile zu erklären versucht 45 .<br />
Doch beide verkennen den jeder Entwicklung zu Grunde liegenden Akt des élan vital.<br />
Bergson veranschaulicht dessen Wirkungsweise mit einem Bild einer durch Eisenspäne<br />
gleitenden Hand.<br />
angeordnet sind. Er gerät jedoch in Konflikt, sobald er unsere Wahrnehmungen erklären muss, bei der sich<br />
Bilder zentrisch anzuordnen scheinen. Im Gegensatz dazu geht der Idealist vom Bewusstsein, dem System der<br />
zentrisch angeordneten Bilder aus. Er gerät in Verlegenheit, sobald objektive Kriterien aufstellen soll oder wenn<br />
er versucht über die äussere Welt Prognosen anzustellen, weil er damit auf eine kausale Ordnung der Bilder<br />
zurückgreifen müsste (vgl. MG, 229 / 361).<br />
44 Das weist wiederum auf Bergsons grundlegende Unterscheidung zwischen absoluter (intuitiver) und relativer<br />
(wissenschaftlicher, alltäglicher) Erkenntnis (vgl. Abschnitt III). Letztere ist gesichtspunktabhängig und zwar<br />
vom Gesichtspunkt des Menschen abhängig. Die Medien der Intelligenz und der Analyse – Wahrnehmung,<br />
Verstand, Wissenschaft, Sprache – sind Gesichtspunkte des menschlichen Geistes. Demgegenüber ist die<br />
metaphysische Erkenntnis absolut, sie erfolgt von keinem Gesichtspunkt aus, sie ist – um eine Wendung des<br />
amerikanischen Philosophen Thomas Nagel aufzunehmen – eine View From Nowhere. Bergsons Intuition sollen<br />
auch dazu dienen, diesen Ort ohne Gesichtspunkt zu erreichen. Die intuitiven Bilder dienen dazu, die<br />
gewöhnliche Richtung des menschlichen Gesichtspunkts umzukehren, sozusagen dessen habituelle<br />
Blickrichtung umzuwenden. Das ist der Grundgedanke, den F. C. T. Moore (op. cit.) bei Bergson verfolgt:<br />
»thinking backwards«. (»Philosopher consiste à invertir la direction habituelle de la pensée.«). Die intuitiven<br />
Bilder dienen jedoch auch dazu, den menschlichen Gesichtspunkt zu überschreiten und über ihn hinauszudenken.<br />
Das ist der Grundgedanke, den K. Ansell Pearson (op. cit) bei Bergson verfolgt: »to think beyond the human<br />
condition«.<br />
45 Die Entwicklung eines so komplexen Organs wie das Auge erklärt der Finalismus mit dessen Funktion, die als<br />
Einheit erscheint: Das Auge sei so entstanden, damit man sehen könne. Der Mechanismus erklärt sie, indem sie<br />
auf seine Bestandteile verweist, deren Anzahl sich jedoch je nach Genauigkeit der Analyse beliebig vergrössert.<br />
Während sich diese Bestandteile des Auges nach mechanistischer Theorie spontan nach den Grundsätzen der<br />
Mutation und Selektion nach und nach herausgebildet haben, versieht der Finalismus zur Garantie dieses<br />
einfachen Resultats diese Entstehung noch mit einem organisierenden Plan (vgl. SE, 94 / 569).<br />
17
Stellt man sich dagegen vor, dass auch die Hand, statt durch Luft zu durchgleiten, sich<br />
durch Eisenfeilicht schiebe, der sich zusammendrängt und im Mass ihres Vordringens<br />
Widerstand leistet, dann würde die Kraft meiner Hand, in einem bestimmten Moment<br />
erlahmen, und in demselben Moment würde die Eisenkörner zu einer bestimmten Form,<br />
zur Form eben der innehaltenden Hand und eines Teils ihres Armes zusammengerückt<br />
und geordnet haben. Angenommen nun Hand und Arm wären unsichtbar geblieben.<br />
Würden dann die Zuschauer den Grund der Gruppierung in den Eisenfeilspänen und in<br />
inneren Kräften der Masse selbst suchen? Wobei die einen die Lage jedes Körnchens auf<br />
die Wirkung zurückführen würden, die es von seinem Nachbarkörnchen erfährt: dies<br />
wären die Mechanisten; während andere behaupten würden, dass ein Gesamtplan über die<br />
elementaren Wirkungen gewacht habe; dies wären die Finalisten. Die Wahrheit aber ist,<br />
dass bloss ein unsichtbarer Akt existiert hat, jener der Hand, der das Eisenfeilicht teilte:<br />
die unerschöpfliche Zerlegtheit der Körnchenbewegung ebenso wie das Gesetz ihrer<br />
schliesslichen Gruppierung ist gewissermassen nur ein negativer Ausdruck dieser<br />
ungeteilten Bewegung [...]. (SE, 100 / 575-576)<br />
Das ›richtige‹ Bild – das Bild des élan vital – ist in diesem Falle die Bedingung dafür, dass<br />
die phänomenalen Vorgänge korrekt erklärt und verstanden werden können. Ohne dieses<br />
muss man unweigerlich in einen Mechanismus oder Finalismus verfallen. Dieses richtige Bild<br />
ist zugleich die Grundlage der Recoupage: Das fundamentale Bild wird nicht durch die beiden<br />
gegensätzlichen Systeme induziert, diese werden vielmehr ausgehend von demselben<br />
deduziert. 46 In diesem Sinne ist auch Bergsons eindrücklichstes Argumentationsmuster der<br />
Recoupage wesentlich vom Bild abhängig. Sie kann erst stattfinden, nachdem ein geeignetes<br />
Bild eingeführt worden ist, das die beiden zu überwindenden Systeme durch eine gemeinsame<br />
Grundlage zu vereinen vermag. Denn gerade weil das richtige Bild – als strukturelle<br />
Bedingung für richtige Prämissen – nicht vorhanden war, verfingen sich die beiden<br />
konkurrenzierenden Systeme in unüberwindbaren Schwierigkeiten und Differenzen,<br />
insbesondere weil beide in ihrem Rahmen plausibel, jedoch in ihren einseitig verfassten<br />
Bildern selbst gefangen waren.<br />
Die argumentative Kraft, die in Bergsons Bildern steckt, lässt sie unter einem neuen<br />
Gesichtspunkt erscheinen: Das intuitive Bild, das zunächst zur metaphysischen Erkenntnis<br />
dient, übernimmt im Bereich der Metaphysik oder in der Recoupage wichtige Funktionen<br />
seiner Argumentation und wird dabei wesentlicher Bestandteil der Methode Bergsons.<br />
46 So kann Bergson Realismus und Idealismus erst tiefgründig miteinander vereinen, nachdem er für seine<br />
Wahrnehmungstheorie das Bild des (epistemischen) Bildes eingeführt hat. Erst nach dem Setzen dieser<br />
fundamentalen Bedingung können diese beiden Systeme als je verschiedene Deutungen dieses Bildes gesehen<br />
werden. Denn die Tatsache, dass es sich bei den verschiedenen kontradiktorischen Systemen um einseitige<br />
Interpretationen des ihnen zu Grunde liegenden Bildes handelt, ist offensichtlich und bestechend einfach<br />
einzusehen, sobald das Bild nur gesetzt ist. Zu dieser Einsicht ist auch ein Realist und Idealist fähig. Nur muss zu<br />
dieser Einsicht das entsprechende Bild bereits vor der Recoupage eingeführt werden.<br />
18
V. Das methodische Bild: Familienähnlichkeiten am Beispiel von Das Lachen<br />
Die grossen Werke Bergsons werden weniger mit Hilfe einer (oder mehrerer) zentralen(r)<br />
These(n) strukturiert, als vielmehr entlang eines zentralen Bildes (»image centrale«). Gemäss<br />
Bergsons Methode und seiner Theorie der Intuition ist das wenig verwunderlich. Ein Bild ist<br />
ein Nukleus, dem die Energien der philosophischen Reflexion Bergsons für einem<br />
bestimmten Problembereich entströmen und in dem sie sich immer wieder konzentrieren. Das<br />
zentrale Bild für Zeit und Freiheit ist der Gegensatz zwischen einem ›oberflächlichen<br />
Krusten-Ich‹ und einem ›tiefen Zeit-Ich‹ (ZF, 93-97 & 171 / 82-86 & 151); 47 dasjenige für<br />
Materie und Gedächtnis ist das Bild des Bildes selbst; dasjenige für Schöpferische<br />
Entwicklung ist das Bild des élan vital; 48 schliesslich durchzieht Die beiden Quellen der<br />
Moral und der Religion das Bild der geschlossenen und der offenen Gesellschaft. Im<br />
Folgenden wollen wir die methodische Funktion des Bildes bei Bergson an Das Lachen<br />
exemplifizieren und seine Arbeit am Bild in einer makroskopischen Perspektive, im<br />
Unterschied zur an Einführung in die Metaphysik exemplifizierten mikroskopischen<br />
Perspektive (Abschnitt III), darstellen. Das Lachen, oft als Gelegenheitsarbeit vernachlässigt,<br />
versammelt in hervorragender Weise zentrale Momente des Bergsonismus. 49 Wir werden<br />
jedoch weniger die inhaltlichen als die methodischen Momente hervorheben.<br />
Bergson macht in Das Lachen von Anfang an deutlich, dass es nicht um eine Definition des<br />
Komischen geht, »dass es uns fern liegt, das Wesen des Komischen [la fantaisie comique] in<br />
eine Definition zu zwängen. Wir sehen in ihm vor allem etwas Lebendiges.« (L, 5 / 387) 50 Er<br />
hält dafür, dass Definitionen (mit notwendigen und hinreichenden Bedingungen versehen)<br />
hier fehl am Platz sind. Dieser Punkt ist von Kritikern oft übersehen worden. 51 Allerdings<br />
setzen die Fragen, mit denen Bergson das erste Kapitel eröffnet, die Leserschaft auf eine<br />
falsche Fährte. Denn es macht den Anschein, als wolle Bergson die klassische sokratische<br />
Was-ist-X-Frage nach der Essenz des Lachens und des Komischen beantworten. 52 Doch das<br />
47 Vgl. H. Hude (op. cit., Bd. I) 151-3.<br />
48 Vgl. J. Theau (op. cit.) 94-95; K. Ansell Pearson (op. cit.) Kap. 5: »The élan vital as an image of thought:<br />
Bergson and Kant on finality«.<br />
49 Vgl. F. C. T. Moore (op. cit) 66-90.<br />
50 Der Titel des Appendix zu Das Lachen lautet: »Sur les définitions du comique, et sur la méthode suivie dans<br />
ce livre.« Zu beachten ist, dass Bergson nicht vom »Wesen des Komischen«, sondern von »la fantaisie comique«<br />
spricht. Das steht in Übereinstimmung mit unserer anti-essentialistischen Deutung von Das Lachen.<br />
51 Ein frappierendes Beispiel ist B. Russells Kritik, die in folgendem Witz kulminiert: Bergson betrachtet das<br />
Lachen als eine Reaktion auf die Mechanisierung von Lebendigem; Bergson zwängt das Lachen (immerhin ein<br />
ausgezeichnetes Phänomen des Lebendigen) in Das Lachen in eine mechanische Definition; also ist Bergsons<br />
Buch zum lachen (oder lächerlich). Das mag als Beispiel für Russells Humor hingehen, verfehlt aber<br />
vollkommen Bergsons Intentionen; vgl. B. Russell: »A Professor’s Guide to Laughter« von 1912, in: The<br />
Collected Papers of Bertrand Russell, vol. 6, Routledge: London, 1992, 309-312.<br />
52 Vgl L, 1 / 387 : »Was ist das Wesen des Lachens ? Was liegt allem Lächerlichen zugrunde ? Was haben [...]<br />
gemeinsam ? Wie destillieren wir die Substanz heraus, die so verschiedenen Dingen das gleiche, bisweilen<br />
19
Gegenteil ist der Fall. Bergson geht von einem zentralen Bild aus: »unser zentrales Bild [...]:<br />
Mechanisches als Überzug, als Kruste über Lebendigem [notre image centrale: du mécanique<br />
plaqué sur du vivant].« (L, 41 / 414) Das Komische wird laut Bergson durch die<br />
Mechanisierung von Lebendigem (nicht definiert, sondern) produziert 53 und das Lachen ist<br />
gleichsam die bestrafende Reaktion auf diesen Prozess. Bergson führt dieses Bild (oder<br />
»Leitmotiv«; L, 18 / 397) an früher Stelle ein und entwickelt es im weiteren Verlauf des<br />
Werks, um stets wieder darauf zurück zu kommen. Wie entwickelt Bergson das »image<br />
centrale«?<br />
Am Beispiel einer Person, deren Körper in einer komischen Pose erstarrt, gibt Bergson<br />
folgende methodische Anweisung:<br />
Man sehe einmal mit dem Auge und lasse alle Reflexion und vor allem alles<br />
Raisonnement beiseite. Wenn wir alles vergessen, was wir wissen, und auf den<br />
unmittelbaren, den ursprünglichen, naiven Eindruck zurückgehen, dann kommen wir<br />
sicher zu einer Vorstellung dieser Art. (L, 19-20 / 398) 54<br />
Wir sehen, so Bergson, dass Körper komisch in dem Masse sind, als ihre Posen, Gesten und<br />
Bewegungen uns an einen simplen Mechanismus erinnern (wo wir eine lebendige oder<br />
spontane Bewegung erwartet hätten). 55 Es ist wichtig, dass Bergson hier sagt »erinnert an<br />
[nous fait penser à]« (L, 23 / 401), denn er entwickelt das »image central« anhand weiterer<br />
Bilder, die mit dem ursprünglichen Bild eine gewisse Ähnlicheit oder Verwandtschaft<br />
aufweisen. Im Kapitel 1 (das die Komik der Formen und Bewegungen behandelt) geht<br />
Bergson den folgenden Bildern nach: Das Bild des verkleideten Körpers, 56 das Bild der im<br />
Körper eingeschlossenen Seele, das Bild einer Person als Sache. Im Kapitel 2 (das die<br />
Situations- und die Sprachkomik behandelt) entwickelt Bergson den folgenden Bilder-<br />
Dreischritt: der Springteufel, die Marionette, der Schneeball(effekt), 57 um schliesslich auf<br />
abstraktere und generelle Strukturen des Komischen zu kommen, welche sowohl komische<br />
Situationen als auch das komische Sprechen beherrschen können: die Repetition, die<br />
Inversion und die Interferenz von Serien (L, 80 / 443). Diese Weiterentwicklungen des<br />
zentralen Bildes werden durch Bergson stets an einer Vielzahl empirischer (alltäglicher und<br />
aufdringlich starke, bisweilen ganz diskrete Aroma verleiht [Quelle distillation nous donnera l’essence, toujours<br />
la même]?« Man sieht in der letzten Frage, wie Bergson mit dem Essentialismus in der Doppelbedeutung von<br />
Aroma / Essenz spielt.<br />
53 Vgl. L, 484 : »J’ai tenté quelque chose de tout différent. J’ai cherché dans la comédie, dans la farce, dans l’art<br />
du clown, etc., les procédés de fabrication du comique.« Der Appendix ist in der deutschen Ausgabe nicht<br />
übersetzt worden, da er aus einer späteren Auflage stammt.<br />
54 Der Charakter einer methodischen Anweisung zeigt sich im Original besser: »Tâchez de voir avec vos yeux<br />
seulement. Ne réfléchissez pas et surtout ne raisonnez pas. Effacez l’aquis; allez à la recherche de l’impression<br />
naïve, immédiate, originelle.«<br />
55 Vgl. L, 22-23 / 400 ; ein ausgezeichnetes Beispiel stellt Chaplin in Modern Times dar.<br />
56 Vgl. zu diesem Bild SE, 6 / 493.<br />
57 Vgl. zu diesem Bild SE, 9 / 496.<br />
20
literarischer) Beispiele exemplifiziert. Dadurch entstehen Anwendungen, Ausdehnungen und<br />
Modifikationen des ursprünglichen, zentralen Bildes.<br />
Diese unterschiedlichen Triaden scheinen weit entfernt vom ursprünglichen zentralen Bild zu<br />
sein. Bergson gibt das zu und erläutert:<br />
All das ist vom Urgrund des Lachens [cause originelle] ziemlich entfernt. Manche<br />
komische Erscheinung, die an sich unerklärlich ist, wird in der Tat nur durch ihre<br />
Ähnlichkeit [ressemblance] mit einer anderen verstanden, die ihrerseits nur durch ihre<br />
Verwandtschaft [parenté] mit einer dritten komisch wirkt, und so geht das lange weiter,<br />
[...] Durch welchen Druck, welchen seltsamen stoss gleitet das Komische so von Bild zu<br />
Bild [d’image en image], immer weiter weg von seinem Ursprung [point d’origine], bis<br />
es sich in unendich fernen Analogien bricht und verliert ? Aber wir fragen ja auch :<br />
welche Kraft teilt die Äste des Baumes in Zweige, die Wurzeln in Würzelchen ? Ein<br />
strenges Gesetz nötigt jede lebendige Energie, in der kurzen Zeit, die ihr gegeben ist, sich<br />
soviel Raum zu erobern [couvrir], wie sie irgend kann. (L, 46 / 417-418)<br />
Ein rhizomartiges Geflecht der Ähnlichkeit und Verwandtschaft verbindet die verschiedenen<br />
Formen des Komischen mit dem ursprünglichen, zentralen Bild. 58 Die von uns<br />
hervorgehobenen Momente – der Verzicht auf die Definition, die methodische Anweisung,<br />
das »image centrale«, die Entwicklung von weiteren Bildern, die Exemplifizierng anhand<br />
zahlreicher Beispiele, die Betonung organischer Ähnlichkeiten und Verwandtschaften, die<br />
stete Rückkehr zum zentralen Bild – veranschaulichen aufs beste Bergsons Methode der<br />
Intuiton.<br />
Erstaunlicherweise liegt hier ein Vergleich mit dem späten Wittgenstein auf der Hand. In den<br />
Philosophischen Untersuchungen lenkt Wittgenstein unsere Aufmerksamkeit auf die<br />
verschiedenen Spiele (Brett-, Karten-, Ball-, Kampfspiele, usw.):<br />
Was ist allen diesen gemeinsam? – Sag nicht: »Es muss ihnen etwas gemeinsam sein,<br />
sonst hiessen sie nicht ›Spiele‹« - sondern schau, ob ihnen allen etwas gemeinsam ist. –<br />
Denn wenn du sie anschaust, wirst du zwar nicht etwas sehen, was allen gemeinsam<br />
wäre, aber du wirst Ähnlichkeiten, Verwandtschaften, sehen, und zwar eine ganze Reihe.<br />
Wie gesagt: Denk nicht, sondern schau! [...] Ich kann diese Ähnlichkeit nicht besser<br />
charakterisieren als durch das Wort »Familienähnlichkeiten«; denn so übergreifen und<br />
kreuzen sich die verschiedenen Ähnlichkeiten, die zwischen den Gliedern einer Familie<br />
bestehen... 59<br />
Wittgensteins methodische Anweisung (»Denk nicht, sondern schau!«) ist dieselbe, die<br />
Bergson gibt (»Tâchez de voir avec vos yeux seulement. Ne réfléchissez pas et surtout ne<br />
raisonnez pas.«). Der Unterschied besteht freilich darin, dass Bergson diese Anweisung als<br />
Beitrag zur metaphysischen Intuition versteht und nicht – wie Wittgenstein – als eine<br />
Aufmerksamkeit auf den alltäglichen Sprachgebrauch, der durch den philosophischen irritiert<br />
58 Bergsons Ausführungen bleiben jedoch der Frage gegenüber ambivalent, ob dieses Geflecht eine Erscheinung<br />
in der Produktion oder in der Rezeption des Komischen ist. Die Formulierung »nous fait penser à« lässt auf<br />
letzteres schliessen, die Formulierung »les procédés de fabrication du comique« hingegen auf ersteres. Eine ganz<br />
ähnliche Ambivalenz lässt sich in der im dritten Abschnitt dargestellten Arbeit am intuitiven Bild ausmachen.<br />
59 Philosophische Untersuchungen, §§ 66 & 67.<br />
21
wird. 60 Worin besteht Wittgensteins Pointe, auf die er mit seinem Begriff der<br />
»Familienähnlichkeit« hinaus möchte? Worin besteht, wie Wittgenstein sagt, »grosse Frage,<br />
die hinter allen diesen Betrachtungen steht«? Wittgenstein meint, er wolle darauf verzichten<br />
»etwas anzugeben, was allem, was wir Sprache nennen, gemeinsam ist«. Stattdessen ist<br />
»diesen Erscheinungen garnicht Eines gemeinsam«, sondern sie »sind miteinander in vielen<br />
verschiedenen Weisen verwandt«. 61 Bergson meint, dass es nichts gibt, was dem Lachen oder<br />
den Formen des Komischen (der Komik von Gesten, Posen, Bewegungen, Situationen,<br />
Äusserungen oder Charakteren, usw.) im Sinne einer Definition mit notwendigen und<br />
hinreichenden Bedingungen gemeinsam ist, sondern es gibt Ähnlichkeiten und<br />
Verwandtschaften. Im Unterschied zu Wittgensteins striktem Anti-Essentialismus, ist<br />
Bergsons Ablehnung der Definition nicht anti-essentialistisch. Vielmehr geht sie von der<br />
Unterscheidung zweier Erkenntnisarten, der Intuition und der Analyse, aus. Die Analyse, die<br />
definitorisch vorgeht, findet gerade keinen Zugang zur Essenz der Dinge und die Essenz<br />
zeichnet sich auch nicht durch den von den Einzelphänomenen abstrahierten kleinsten Nenner<br />
aus (das Gemeinsame). Vielmehr vermag die in der Intuition erfasste Essenz zur Produktion<br />
eines »image centrale« anzuregen, das dann in weitere Bilder weiterentwickelt werden kann,<br />
welche auf »Familienähnlichkeiten« beruhen. Bergson möchte, im Unterschied zu<br />
Wittgenstein, nicht keine Metaphysik betreiben, sondern eine in seinen Augen angemessenere<br />
Metaphysik. Aus diesen Gründen vertraut Bergson den Bildern und betrachtet sie nicht, wie<br />
Wittgenstein, primär als philosophische Vexierbilder, die unser Denken gefangen halten.<br />
Bergsons Gedanke kann – wie gesagt – so formuliert werden: Wenn es Bilder gibt, die unser<br />
Denken gefangen halten, dann muss es auch Bilder geben, die unser Denken befreien. Für<br />
Bergson besteht der entscheidende Unterschied dieser befreienden Bilder gegenüber den<br />
durch ihn kritisierten Bilder gerade in ihrer Entwicklungsfähigkeit und ihrer Fähigkeit, einen<br />
Bereich methodisch zu strukturieren. In Das Lachen spricht Bergson von einer Beweglichkeit<br />
der Intelligenz, die »sich genau nach den beweglichen Umständen richtet [se règle<br />
exactement sur la mobilité des choses]«. (L, 123 / 475) Dass Bergson hier von Genauigkeit<br />
oder Exaktheit spricht, ist kein Zufall. Es handelt sich um jene Exaktheit oder Präzision<br />
(»précision«), welche er zu Beginn der grossen Einleitung zu Denken und schöpferisches<br />
Werden (DSW, 21-27 / 1253-1254) der Philosophie gegenüber einklagt. 62 In Das Lachen<br />
60 Vgl. ebd., §§ 11 & 38.<br />
61 Ebd., § 65.<br />
62 Vgl. F. C. T. Moore (op. cit.) 14-17 zu Bergsons Begriff der Präzision im Kontrast zu Descartes, dessen<br />
Kriterium der klaren und deutlichen Idee formal gleichgültig gegenüber dem Gegenstand verhält und analytisch<br />
durch das Vorgehen der Auflösung eines Problems in seine einfachen Bestandteile bestimmt ist: »Precision<br />
would become a matter of pure methodology: a style of thought« (ebd., 14). Demgegenüber ist Bergsons<br />
Präzision »a matter of adequacy to the subject-matter« (ebd., 16).<br />
22
spricht Bergson von einem bestimmten komischen Charaktertyp, der einer Logik des<br />
Absurden folge, vom »Typ eines Menschen, der einer einzigen Idee nachgeht«. (L, 124 / 476)<br />
Dieser Typ zeichne sich dadurch aus, dass er die Dinge nach einer Idee – oder: nach einer<br />
Definition – modelliert und nicht die Ideen nach den Dingen. Die exemplarische Gestalt<br />
dieser »folie normale« stellt sich für Bergson in Don Quichote dar. (ebd.) Wer nach dem<br />
Komisch-Gemeinsamen im Sinne einer Definition mit notwendigen und hinreichenden<br />
Bedingungen sucht, betreibt philosophische Donquichotterie. Bergson deutet hier – und an<br />
anderen Stellen in Das Lachen – an, dass seine Figuren des Komischen als implizite Kritik an<br />
bestimmten falschen Problemstellungen und Methoden der Philosophie gelesen werden<br />
können. Denn die falschen Bilder der Philosophie lassen sich um dasselbe »image centrale«<br />
gruppieren, wie das Komische, nämlich als als Überzug, als Kruste über Lebendigem, als »du<br />
mécanique plaqué sur du vivant«. 63<br />
VI.<br />
Schluss: Bergsons Bilder und das Bild Bergsons: »rien de mystérieux«<br />
Wir sind dem intuitiven Bild Bergsons gefolgt und haben dessen Bearbeitungen im<br />
methodischen und argumentativen Bild aufgezeigt. Dies im Unterschied, aber nicht im<br />
Gegensatz, zu den Studien, die sich auf Bergsons epistemischen Bildbegriff (als Zeit-,<br />
Bewegungs-, Wahrnehmungs- oder Gedächtnis-Bild) konzentrieren. 64 Wir haben aufgezeigt,<br />
in welchem Sinne es richtig ist zu behaupten, dass Bergson Bilder anstelle von Argumenten<br />
und Definitionen verwendet. Wir haben Bergsons Bilderarbeit in den Kontext der<br />
philosophischen Bilderjagd des 20. Jahrhunderts gestellt. Beides im Unterschied und im<br />
Gegensatz zu den philosophischen Verächtern Bergsons. Wir haben das Bild und die Arbeit<br />
an ihm in die Nähe der philosophischen Intuition und damit ins Zentrum des Bergsonismus<br />
gerückt. Dies ganz im Sinne von Bergson selbst, wie die oft zitierte Briefstelle an Harald<br />
Höffding belegt. 65 Welches Bild Bergsons entsteht so? 66<br />
Die bergsonsche Intuition – genauer: deren Gegensatz zur Analyse – stellt ein zentrales<br />
Problem in der Rezeption Bergsons dar. Von seinen Anhängern wurde sie als grosse<br />
63 Man vergleiche dazu nur, was Bergson über die drei ersten aus diesem ursprünglichen Bild weiterentwickelten<br />
Bilder (das Bild des verkleideten Körpers, der im Körper eingeschlossenen Seele und einer Person als Sache)<br />
schreibt: L, 28-46/404-418.<br />
64 Vgl. etwa M. Vrhunc (op. cit.), G. Deleuze (op. cit., 1989 & 1991), F. C. T. Moore (op. cit.).<br />
65 In H. Bergson : Mélanges (textes publiés et annotés par A. Robinet avec la collaboration de M.-R. Mossé-<br />
Bastide, M. Robinet et M. Gauthier ; avant propos par H. Gouhier), Paris: PUF, 1972, 1148: »[...] le centre<br />
même de la doctrine: l’intuition de la durée«.<br />
66 Wir haben zu Beginn auf diese Frage von S. Schwartz hingewiesen: »[W]e must always ask which image of<br />
Bergson is under consideration”, S. Schwartz: ”Bergson and the Politics of Vitalism«, in: F. Burwick & P.<br />
Douglas (op. cit.) 303.<br />
23
Befreiung von der Moderne gefeiert, als Lebensphilosophie mit transzendenten (mystischen<br />
und religiösen) Einschlägen, die hoch über den praktischen und naturwissenschaftlichen<br />
Niederungen bloss diskursiver, analytischer Erkenntnis stehe. 67 All das im Gegensatz zu<br />
Bergsons moderatem Modernismus, zu seiner Beteuerung der Immanenz der Intuition und<br />
seiner Betonung der Gleichwertigkeit intuitiver und analytischer Erkenntnis. Bergsons Gegner<br />
nahmen ihn aus demselben Blickwinkel wahr wie die Anhänger, nur mit umgekehrten<br />
Vorzeichen: als anti-modernistischen, anti-wissenschaftlichen, reaktionären, irrationalen<br />
Metaphysiker, der über ein ominöses Erkenntnisorgan, Intuition oder Instinkt genannt,<br />
verfügt. 68 Hier haben wir das Bild Bergsons als eines neuen Mystikers oder als eines neuen<br />
Irrationalisten. Bereits eingangs haben wir darauf hingewiesen, dass diese entgegengesetzte<br />
Bewertung Bergsons unter anderem mit seiner Verwendung von Bildern zu tun hat und dass<br />
Bergson schliesslich mit zu den Opfern der philosophischen Bilderjadg des 20. Jh. gehört<br />
(Abschnitt I). Zugleich kann aber nochmals hervorgehoben werden, dass Bergson selbst an<br />
dieser Jagd teilnimmt, ja sie mitinitiiert (Abschnitt II) und mit der Recoupage eine darauf<br />
aufbauende, genuin philosophische Methode praktiziert (Abschnitt IV).<br />
Positiv oder negativ ist in den beiden extremen Bewertungen der Gegensatz zwischen<br />
intuitiver und analytischer Erkenntnis (oder Intellekt) zentral. 69 Bergson, der sich selber als<br />
einen Dualisten besonderer Art bezeichnet, ist auch epistemologisch Dualist. Wie kann der<br />
scharfe Gegensatz überwunden werden? Man kann eine Arbeitsteilung vorschlagen. In der<br />
schwachen Version ist die Intuition die kreative Vorstufe der Analyse; oder wie der<br />
Wissenschaftstheoretiker Henri Poincaré es formuliert: »C’est par logique qu’on démontre,<br />
c’est par l’intuition qu’on invente.« 70 Man kann darauf hinweisen, dass die Intuition sehr wohl<br />
am Anfang eines Erkenntnisprozesses stehen kann und wissenschaftlichen Entdeckungen<br />
schwer nachvollziehbare psychische Prozesse zugrunde liegen mögen. Die Überprüfung der<br />
Resultate aber ist eine Sache des diskursiven und logischen Denkens. 71 In einer stärkeren<br />
Version hingegen ist die Intuition Zugriff auf das Wahre, auf die Realität; oder wie Edouard<br />
Le Roy, ein Schüler Bergsons, es formuliert:<br />
67 In aller Klarheit bei F. Meyer: Pour connaître la pensée de Bergson, Grenoble: Les Editions Françaises<br />
Nouvelles, 1944, 85: Die Intuition sei »connaissance plus parfaite que la connaissance mécanistique et<br />
symbolique.«<br />
68 Stellvertretend, wie fast immer, die Malice von B. Russell (op. cit.) 756 & 758: »The main effect of Bergsons<br />
philosophy was conservative, and it harmonized easily with the movement which culminated in Vichy. But<br />
Bergson’s irrationalism made a wide appeal [...] in the main intellect is the misfortune of man, while instinct is<br />
seen at its best in ants, bees, and Bergson.«<br />
69 Vgl. P. A. Y. Gunter: »The Dialectic of Intuition and Intellect: Fruitfulness as a Criterion« in: A. C.<br />
Papanicolaou / P. A. Y. Gunter (op. cit.) 3-18.<br />
70 H. Poincaré: Science et méthode, Paris: E. Flammarion, 1924, 137.<br />
71 Für eine klare Formulierung dieser Ansicht, ganz ohne Bezug auf Bergson, vgl. H. Reichenbach: Elements of<br />
Symbolic Logic, New York: Macmillan, 1947, § 1.<br />
24
Il n’y a connaissance de l’immédiat que par intuition: et, réciproquement, l’intuition est<br />
toujours connaissance de l’immédiat. De là résulte – remarque d’importance capitale –<br />
que toute vraie intuition es nécessairement une intuition vraie. 72<br />
Die Analyse bleibt dem gegenüber in ihren Begriffen stecken, sie gelangt nicht über den<br />
Gesichtspunkt des Körpers, des praktischen Lebens, der Wissenschaft und der Sprache<br />
hinaus. Hier haben wir das Bild Bergsons als eines anspruchslosen Erkenntnispyschologen<br />
oder als eines anspruchsvollen Metaphysikers.<br />
Aber genau so wenig, wie Bergson der extremen Vereinnahmung einiger seiner Anhänger und<br />
der pauschalen Ablehnung einiger seiner Gegner und ihrer Verschärfung des Gegensatzes von<br />
Intuition und Analyse überlassen werden kann, sollte man den der Entschärfung des<br />
Gegensatzes im Sinne einer schwach oder stark interpretierten Arbeitsteilung beipflichten.<br />
Einige Interpreten entschärfen den Gegensatz auch dadurch, dass sie die Intuition und die<br />
Bilder Bergsons gleichsam übersehen und sich seinen diskuriven Erörterungen zuwenden<br />
oder indem sie die Intuition 73 und ihre Bilder intellektualisieren und aus der Intuition eine<br />
regelgeleitete Methode extrahieren (die sich so nicht einmal in den Naturwissenschaften<br />
findet). 74<br />
Keines dieser Bergsonbilder ist unser Bergsonbild. Wir haben Bergson als einen Philosophen<br />
zu charakterisiernen versucht, der mit und an Bildern arbeitet. Nicht der Gegensatz zwischen<br />
Intuition und Analyse ist für unser Verständnis von Bergson. leitend, auch nicht seine<br />
zentralen Gedanken der Realität der durée, oder des epistemischen Bildes oder der<br />
schöpferischen Entwicklung, sondern vielmehr das Bild selber. Denn mit und in Bildern<br />
spricht Bergson in den Gegensatz von Intuition und Analyse hinein und mit Bildern bewegt er<br />
seine zentralen Gedanken vorwärts und entwickelt sie. Es geht also nicht darum, den<br />
Gegensatz zwischen Analyse und Intuition zu verschärfen oder zu entschärfen. Vielmehr geht<br />
es darum zu sehen, dass Bergson sich stets in diesem Gegensatz bewegt und ihn immer schon<br />
überbrückt, nämlich mit dem intuitiven Bild – »une image qui est presque matière en ce<br />
qu’elle laisse encore voir, et presque esprit en ce qu’elle ne se laisse plus toucher« (DSW, 137<br />
/ 130) – und der Arbeit an ihm.<br />
Wie Bergson mit und an Bildern arbeitet, haben wir gezeigt. Nicht aufgezeigt wurde der<br />
andere Teil dieser Arbeit, den Bergson immer wieder betont. Er besteht in der<br />
Materialkenntnis eines wissenschaftlichen Gebietes. Die Intuition hat »nichts<br />
Geheimnisvolles an sich [rien de mystérieux]« (DSW, 224 / 1431). Sie erfolgt vielmehr aus<br />
72 Edouard Le Roy: La pensée intuitive, Paris: Boivin, 1929-1930, _______________<br />
73 Exemplarisch F. C. T. Moore (op. cit.).<br />
74 Das der Vorschlag von G. Deleuze (op. cit., 1989); zum Problem der wissenschaftlichen Methode vgl. P.<br />
Feyerabend: Wider den Methodenzwang, Suhrkamp: Frankfurt a. M., 1976.<br />
25
der intensiven Beschäftigung mit einem Gegenstand, aus einem sich Vertiefen in die zu<br />
untersuchende Materie. Sie ist also mit einer Anstrengung verbunden und liegt nicht in einer<br />
blossen, müssigen Betrachtung. Die Intuition gelingt nicht, »wenn man nicht durch eine<br />
lange Vertrautheit mit ihren oberflächlichen Bekundungen ihr Vertauen gewonnen hat«.<br />
(DSW, 225 / 1432) Die Intuition ist aber nicht lediglich eine synthetische Gesamtschau eines<br />
Gebiets, wie Bergson mit einem Bild erläutert:<br />
Aber auch wenn man nur durch gesättigte Materialkenntnis zur metaphysischen Intuition<br />
vordringen kann, so ist sie doch etwas ganz andersartiges als das Resumé oder die<br />
Synthese dieser Erkenntnisse. Sie unterscheidet sich davon, wie der Bewegungsantrieb<br />
sich von dem Weg unterscheidet, den das bewegte Ding durchläuft, wie die Spannung der<br />
Feder sich unterscheidet von der sichtbaren Bewegung des Pendels. (ebd.)<br />
Aus der materiellen Beschäftigung mit einem Gebiet erst entsteht die Intuition und aus ihr das<br />
Bild. Durch die Arbeit am Bild arbeitet Bergson von Neuem ein Gebiet – das Bewusstsein,<br />
das Gedächtnis, die Evolution, das Komische – durch und strukturiert es mithilfe von Bildern.<br />
Das Ziel besteht darin, einen neuen Gesichtspunkt für die Forschung anzuregen, der sich aus<br />
einer Intimität mit dem Wirklichen – der »zarten Empirie« – speist.<br />
Man kann das Bild, das wir von Bergson entwerfen, als dasjenige eines Arbeiters und seine<br />
Arbeit als Ikonopoiesis ansprechen. Bergson ist ein Philosoph, der sich durch das empirische<br />
Material, die Diskurse des Wissens seiner Zeit, durcharbeitet und es im Bild ver-, um- und<br />
bearbeitet. Man könnte hier von einer ›Poetik des Wissens‹ sprechen. Nicht aber haben wir<br />
dieses Wissen thematisiert, das Bergsons Bilder durcharbeiten. Wir haben hier versucht, die<br />
Grundstruktur dieser Poetik im intuitiven, argumentativen und methodischen Bild und die<br />
kritischen Ansätze in der Ablehnung der Übertragung und in der Anwendung der Recoupage<br />
aufzuzeigen.<br />
Markus Wild & Stephan Schmid<br />
Philosophisches Seminar<br />
Universität Basel<br />
26