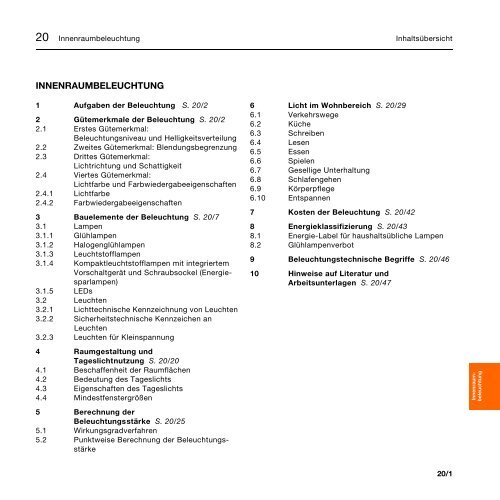Musterseiten RWE Bau-Handbuch
Musterseiten RWE Bau-Handbuch
Musterseiten RWE Bau-Handbuch
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
20 Innenraumbeleuchtung<br />
Inhaltsübersicht<br />
INNENRAUMBELEUCHTUNG<br />
1 Aufgaben der Beleuchtung S. 20/2<br />
2 Gütemerkmale der Beleuchtung S. 20/2<br />
2.1 Erstes Gütemerkmal:<br />
Beleuchtungsniveau und Helligkeitsverteilung<br />
2.2 Zweites Gütemerkmal: Blendungsbegrenzung<br />
2.3 Drittes Gütemerkmal:<br />
Lichtrichtung und Schattigkeit<br />
2.4 Viertes Gütemerkmal:<br />
Lichtfarbe und Farbwiedergabeeigenschaften<br />
2.4.1 Lichtfarbe<br />
2.4.2 Farbwiedergabeeigenschaften<br />
3 <strong>Bau</strong>elemente der Beleuchtung S. 20/7<br />
3.1 Lampen<br />
3.1.1 Glühlampen<br />
3.1.2 Halogenglühlampen<br />
3.1.3 Leuchtstofflampen<br />
3.1.4 Kompaktleuchtstofflampen mit integriertem<br />
Vorschaltgerät und Schraubsockel (Energiesparlampen)<br />
3.1.5 LEDs<br />
3.2 Leuchten<br />
3.2.1 Lichttechnische Kennzeichnung von Leuchten<br />
3.2.2 Sicherheitstechnische Kennzeichen an<br />
Leuchten<br />
3.2.3 Leuchten für Kleinspannung<br />
4 Raumgestaltung und<br />
Tageslichtnutzung S. 20/20<br />
4.1 Beschaffenheit der Raumflächen<br />
4.2 Bedeutung des Tageslichts<br />
4.3 Eigenschaften des Tageslichts<br />
4.4 Mindestfenstergrößen<br />
5 Berechnung der<br />
Beleuchtungsstärke S. 20/25<br />
5.1 Wirkungsgradverfahren<br />
5.2 Punktweise Berechnung der Beleuchtungsstärke<br />
6 Licht im Wohnbereich S. 20/29<br />
6.1 Verkehrswege<br />
6.2 Küche<br />
6.3 Schreiben<br />
6.4 Lesen<br />
6.5 Essen<br />
6.6 Spielen<br />
6.7 Gesellige Unterhaltung<br />
6.8 Schlafengehen<br />
6.9 Körperpflege<br />
6.10 Entspannen<br />
7 Kosten der Beleuchtung S. 20/42<br />
8 Energieklassifizierung S. 20/43<br />
8.1 Energie-Label für haushaltsübliche Lampen<br />
8.2 Glühlampenverbot<br />
9 Beleuchtungstechnische Begriffe S. 20/46<br />
10 Hinweise auf Literatur und<br />
Arbeitsunterlagen S. 20/47<br />
Innenraumbeleuchtung<br />
20/1
20 Innenraumbeleuchtung<br />
Gütemerkmale<br />
INNENRAUMBELEUCHTUNG<br />
1 Aufgaben der Beleuchtung<br />
Die Beleuchtung soll gute Sehbedingungen schaffen, zum<br />
physischen und psychischen Wohlbefinden des Menschen<br />
beitragen, und sie soll helfen, Unfälle zu verhüten.<br />
In stimmungsbetonten Räumen, im Wohnbereich sowie<br />
in Räumen für kulturelle und repräsentative Zwecke hat<br />
die Beleuchtung in besonderem Maße Fragen der Ästhetik<br />
und Behaglichkeit zu berücksichtigen.<br />
In Arbeitsräumen ist gute Beleuchtung die Voraussetzung<br />
für eine einwandfreie, sichere und leichte Erledigung<br />
der gestellten Aufgaben. Sie entwickelt die volle<br />
Leistungsbereitschaft und wirkt vorzeitiger Ermüdung<br />
entgegen. Damit beeinflusst sie das Arbeitsergebnis.<br />
In Eingängen, Fluren und Treppenhäusern muss die Beleuchtung<br />
vor allem zum gefahrlosen und sicheren Verkehrsablauf<br />
beitragen.<br />
Die Beleuchtung muss diese zweckbestimmten Aufgaben<br />
erfüllen und sich gleichzeitig in ein gestalterisches<br />
Konzept einfügen. Es ist vorteilhaft, dies bereits im frühen<br />
Planungsstadium zu berücksichtigen, da zu späte<br />
Bemühungen um eine bessere Beleuchtung gewöhnlich<br />
mit erheblichen baulichen Änderungen und finanziellem<br />
Aufwand verbunden sind.<br />
Viel Licht bedeutet noch keine gute Beleuchtung. Es<br />
gibt mehrere Gütemerkmale, die abhängig vom Anwendungsgebiet<br />
gleich wichtig oder sogar noch<br />
wichtiger sind.<br />
2 Gütemerkmale der Beleuchtung<br />
In Anlehnung an die Norm DIN EN 12464 [1] sind allgemein<br />
vier Hauptgesichtspunkte aufzuführen, nach denen<br />
die Güte einer Beleuchtung zu beurteilen ist.<br />
2.1 Erstes Gütemerkmal:<br />
Beleuchtungsniveau und Helligkeitsverteilung<br />
Das Niveau der Beleuchtung wird durch die mittlere,<br />
vorzugsweise horizontale Beleuchtungsstärke *) im<br />
beurteilten Raumbereich und durch ihre Gleichmäßigkeit<br />
beschrieben. Während im gewerblichen Bereich die<br />
Norm, die Arbeitsstättenregel sowie Schriften der Berufsgenossenschaften<br />
bestimmten Tätigkeiten konkrete<br />
Beleuchtungsstärken verbindlich zuordnen, können für<br />
den Wohnbereich lediglich Erfahrungswerte empfohlen<br />
werden, häufig in Analogie zu den Normwerten für vergleichbare<br />
Tätigkeiten, Bild 20-1.<br />
Empfohlene<br />
Beleuchtungsstärke<br />
in Lux<br />
Charakterisierung<br />
der<br />
Sehaufgabe<br />
Zuordnung von<br />
Räumen und<br />
Tätigkeiten im<br />
Wohnbereich<br />
10 – 50 Orientierung Garderobe, Diele,<br />
Flure und Treppen<br />
300 – 1000 Normale Sehaufgaben;<br />
kleine Details<br />
mit mittleren<br />
Kontrasten<br />
1000 – 2000 Schwierige<br />
Sehaufgaben;<br />
kleine Details<br />
mit geringen<br />
Kontrasten<br />
50 – 300 Leichte<br />
Sehaufgaben;<br />
große Details<br />
mit hohen Kontrasten<br />
Allgemeinbeleuchtung,<br />
Schlafraum,<br />
Wohnraum, Kinderzimmer,<br />
Bad<br />
Küche, Hausarbeiten,<br />
Körper-,<br />
Wäschepflege,<br />
Schreiben, Lesen,<br />
Basteln<br />
Nähen, feine<br />
Hand- und Bastelarbeiten,<br />
Zeichnen<br />
Größe der<br />
beleuchteten<br />
Fläche<br />
Ganzer<br />
Raum<br />
Ganzer<br />
Raum<br />
Arbeits-<br />
Bereich/<br />
-Tisch<br />
Kleiner<br />
Arbeitsbereich<br />
20-1 Empfohlene Beleuchtungsstärken im Wohnbereich<br />
*) Definition der beleuchtungstechnischen Begriffe siehe Abschnitt 9.<br />
20/2
20 Innenraumbeleuchtung<br />
Gütemerkmale<br />
Da unser Auge nicht unmittelbar die Beleuchtungsstärke,<br />
sondern nur das von den Gegenständen reflektierte Licht<br />
bewerten kann, spielt das Reflexionsverhalten der beleuchteten<br />
Flächen eine große Rolle. Dunkle Flächen erfordern<br />
höhere Beleuchtungsstärken als helle Flächen,<br />
damit das Auge den gleichen Helligkeitseindruck<br />
(Leuchtdichte *) ) wahrnimmt.<br />
100%<br />
90%<br />
Sehschärfe<br />
70%<br />
50%<br />
Die erforderliche Leuchtdichte steigt mit der Schwierigkeit<br />
der Sehaufgabe. Diese ist von der Größe des betrachteten<br />
Details, des Kontrastes (Leuchtdichteunterschied)<br />
und der Geschwindigkeit des Sehvorgangs<br />
abhängig. Zu berücksichtigen sind außerdem die Dauer<br />
der Seharbeit, das Alter der beteiligten Personen, die Tageslichtverhältnisse<br />
sowie der Einfluss auf die Leistung<br />
und Leistungsbereitschaft, auch bei sehunabhängigen<br />
Tätigkeiten, Bilder 20-2 bis 20-4.<br />
Große Leuchtdichteunterschiede im Gesichtsfeld infolge<br />
schlecht abgeschirmter Lampen, heller Fensterflächen,<br />
Spiegelungen, ungleichmäßiger Ausleuchtung und stark<br />
unterschiedlicher Reflexionsverhältnisse von Mobiliar,<br />
Von der Schwierigkeit der Sehaufgabe<br />
hängen die Anforderungen<br />
an die Güte der Beleuchtung ab,<br />
insbesonders auch das Beleuchtungsniveau.<br />
Die Sehaufgabe ist desto schwieriger,<br />
je geringer der Kontrast ist, je kleiner<br />
das Sehobjekt ist und je schneller<br />
das Sehobjekt wahrgenommen<br />
werden muß.<br />
So ist eine schwarze Schrift auf<br />
weißem Papier leichter lesbar als<br />
eine gleiche Schrift auf grauem<br />
Untergrund. Mit höherem Beleuchtungsniveau<br />
kann man nachhelfen.<br />
Von der Schwierigkeit der Sehaufgabe<br />
hängen die Anforderungen<br />
an die Güte der Beleuchtung ab,<br />
insbesonders auch das Beleuchtungsniveau.<br />
Die Sehaufgabe ist desto schwieriger,<br />
je geringer der Kontrast ist, je kleiner<br />
das Sehobjekt ist und je schneller<br />
das Sehobjekt wahrgenommen<br />
werden muß.<br />
So ist eine schwarze Schrift auf<br />
weißem Papier leichter lesbar als<br />
eine gleiche Schrift auf grauem<br />
Untergrund. Mit höherem Beleuchtungsniveau<br />
kann man nachhelfen.<br />
20-2 Auf weißem Grund ist die Schrift leichter zu lesen als<br />
auf grauem. Ein geringerer Kontrast erfordert daher<br />
eine höhere Beleuchtungsstärke<br />
20-3 Die Schriftgröße beeinflusst<br />
die Schwierigkeit<br />
der Sehaufgabe.<br />
Kleine Details verlangen<br />
eine besonders gute<br />
Beleuchtung<br />
20J. 40J. 60J. 80J.<br />
20-4 Ältere Menschen<br />
brauchen eine bessere<br />
Beleuchtung als<br />
jüngere, da die<br />
Sehschärfe mit dem<br />
Alter nachlässt<br />
Decke und Wänden können störend und ermüdend wirken.<br />
Im ungünstigsten Fall vermindern sie das Sehvermögen.<br />
Andererseits erzeugt eine völlig gleichmäßige<br />
Leuchtdichteverteilung einen monotonen Raumeindruck.<br />
Eine zweckmäßige Allgemeinbeleuchtung ermöglicht<br />
gleich gute Sehverhältnisse und eine ausgeglichene<br />
Leuchtdichteverteilung im gesamten Raum. Selbstverständlich<br />
können besondere Sehaufgaben in einzelnen<br />
Raumzonen oder auch Akzente, die der Gestaltung des<br />
Raumes dienen, eine separate Beleuchtungsart erfordern.<br />
Die Anpassung des Sehsinns an stark abweichende<br />
Leuchtdichte-Niveaus benötigt Zeit und Energie. Für<br />
abwechselnd betretbare, benachbarte Räume (wie Arbeitsraum<br />
und angrenzenden Flur) und für solche, die ins<br />
Freie führen, ist daher eine geeignete Anpassung der<br />
Leuchtdichteverhältnisse zu empfehlen.<br />
2.2 Zweites Gütemerkmal: Blendungsbegrenzung<br />
Innenraumbeleuchtung<br />
*) Definition der beleuchtungstechnischen Begriffe siehe Abschnitt 9.<br />
Blendung kann die Sehfunktion deutlich messbar herabsetzen<br />
(physiologische Blendung). Dieses Phänomen ist<br />
20/3
20 Innenraumbeleuchtung<br />
Gütemerkmale<br />
bei fehlendem Sonnenschutz allgemein bekannt. Schon<br />
geringe Blendung kann als störende Ablenkung empfunden<br />
werden, die Konzentrationsfähigkeit vermindern und<br />
so das Wohlbefinden herabsetzen (psychologische Blendung).<br />
Nach Art ihrer Ursache unterscheidet man zwischen Direktblendung<br />
und Reflexblendung.<br />
Beim unmittelbaren Blick auf selbstleuchtende Flächen,<br />
z. B. unzureichend abgeschirmte Lampen, kann eine Direktblendung<br />
auftreten. Die Blendungsempfindlichkeit<br />
steigt mit den Leuchtdichten und der Größe der im Blickfeld<br />
befindlichen leuchtenden Flächen. Sind deren Hintergrund<br />
und die Umgebung dunkel, wird die Blendwirkung<br />
verstärkt. Außerdem ist die Lage der leuchtenden<br />
Flächen im Gesichtsfeld von Bedeutung. Bei der üblichen<br />
horizontalen Blickrichtung liegt der kritische Blickwinkelbereich<br />
zwischen 0 und 55 Grad, Bild 20-5.<br />
In besonderen Fällen, z. B. bei der Beleuchtung festlicher<br />
Räume oder Eingangsbereiche, können höhere Leuchtdichten<br />
und Kontraste zur Umgebung auch akzeptiert<br />
oder erwünscht sein, wenn sie nicht von einer Aufgabe<br />
ablenken, sondern als brillantes und belebendes Element<br />
dienen (z. B. beim Kronleuchter).<br />
Reflexblendung wird durch störende Reflexe auf<br />
blanken Oberflächen verursacht, z. B. auf Tischplatten,<br />
Bildern, Glasscheiben oder anderen glänzenden Materialien.<br />
Sie lässt sich oftmals durch Festlegen einer geeigneten<br />
Lichteinfallsrichtung vermeiden, Bild 20-6.<br />
45°<br />
20-5 Beispiel für Direktblendung<br />
richtig<br />
falsch<br />
Arbeitsflächen, Papier, Schriften, Bildschirme, Tastaturen<br />
von Schreibmaschinen oder Computern und dergleichen<br />
sollen möglichst matte Oberflächen haben. Sind Leuchten<br />
so angeordnet, dass sie störende Lichtreflexe erzeugen<br />
können, sollen sie in den betreffenden Ausstrahlungsbereichen<br />
möglichst geringe Leuchtdichten haben.<br />
Häufig wird unbewusst versucht, die Reflexblendung<br />
durch Änderung der Blickrichtung und der Körperhaltung<br />
zu vermeiden. Kurzfristig kann dies zu Verspannungen<br />
und Kopfschmerzen, langfristig zu Haltungsschäden führen.<br />
20-6 Beispiel für Reflexblendung und ihr Vermeiden durch<br />
richtiges Anordnen der Leuchte<br />
20/4
20 Innenraumbeleuchtung<br />
Gütemerkmale<br />
2.3 Drittes Gütemerkmal:<br />
Lichtrichtung und Schattigkeit<br />
Die Oberflächenbeschaffenheit und die körperlichen Formen<br />
von Gegenständen lassen sich meist nur mit Hilfe<br />
von Schattenbildung erkennen. Eine gleichförmige Beleuchtung<br />
von allen Seiten oder eine sehr gleichmäßige<br />
Indirektbeleuchtung lassen keine oder nur geringe Schattenbildung<br />
zu. Die Oberflächen wirken dann glatt und<br />
strukturlos; Gegenstände und auch der gesamte Raum<br />
werden als flach und eintönig erlebt. Um dies zu vermeiden<br />
ist eine Hauptlichtrichtung anzustreben, Bild 20-7.<br />
2.4 Viertes Gütemerkmal:<br />
Lichtfarbe und Farbwiedergabeeigenschaften<br />
Die Farbe des Lichts und die Farben der Körper und Flächen<br />
im Raum tragen zum Erkennen unserer Umwelt bei.<br />
Sie haben aber zugleich psychophysische Wirkungen<br />
und beeinflussen die Stimmung des Menschen. Es sind<br />
die beiden Merkmale Lichtfarbe und Farbwiedergabeeigenschaft,<br />
deren richtige Beurteilung Voraussetzung<br />
für Behaglichkeit und einwandfreies Farberkennen ist.<br />
2.4.1 Lichtfarbe<br />
Die Lichtfarbe lässt sich als Sinneseindruck beschreiben,<br />
mit dem ein weißes Objekt vom Betrachter wahrgenommen<br />
wird. Die für allgemeine Beleuchtungszwecke verwendeten<br />
Lichtfarben lassen sich in drei nicht scharf<br />
voneinander trennbare Gruppen einteilen. Jeder Lichtfarbe<br />
wird eine sogenannte „ähnlichste Farbtemperatur“<br />
zugeordnet, die jedoch allgemein nicht mit der tatsächlichen<br />
Temperatur der Lichtquelle identisch ist.<br />
Warmweiße zu Gelb/Rot tendierende Lichtfarben, ww<br />
(ähnlichste Farbtemperatur < 3300 K)<br />
20-7 Erkennbarkeit der Kugelform unter schattenloser und<br />
gerichteter Beleuchtung<br />
Neutralweiße Lichtfarben, nw<br />
(ähnlichste Farbtemperatur im Bereich 3300 K bis 5300 K)<br />
Tageslichtweiße zu Blau tendierende Lichtfarben, tw<br />
(ähnlichste Farbtemperatur > 5300 K)<br />
Der Verlauf der Schattenränder soll in der Regel weich<br />
sein. Die Qualität der Schattenränder wird wesentlich<br />
durch die Größe der Lampe bzw. der leuchtenden Teile<br />
der Lampe und Leuchte bestimmt. Bei gleichem Beleuchtungsabstand<br />
erzeugt die Wendel einer klaren<br />
Glühlampe einen sehr harten Schatten, die leuchtende<br />
Oberfläche einer Kompaktleuchtstofflampe einen weicheren<br />
Schatten und eine opale Kugelleuchte einen sehr<br />
weichen Schatten, der u. U. nicht mehr erkennbar ist.Tiefe<br />
und harte Schlagschatten beeinträchtigen die Erkennbarkeit<br />
und Sicherheit, z. B. in Gängen und auf Treppen.<br />
Die Lichtfarbe der Lichtquellen ist für den jeweiligen Anwendungsbereich<br />
nach verschiedenen Gesichtspunkten<br />
wählbar. Es wird jedoch empfohlen, folgende Beziehung<br />
zu beachten:<br />
Warmweiße Lichtfarben sind vorzugsweise am Abend<br />
und bei niedrigen Beleuchtungsstärken (bis 300 lx) angebracht.<br />
Sie gehören vorwiegend in Räume, die der Entspannung<br />
dienen oder festlichen Charakter haben. Entsprechend<br />
der Lichtfarbe von Glühlampen werden sie im<br />
Wohnbereich bevorzugt.<br />
Innenraumbeleuchtung<br />
20/5
20 Innenraumbeleuchtung<br />
Gütemerkmale<br />
Neutralweiße Lichtfarben sind für höhere Beleuchtungsstärken<br />
vornehmlich zur Unterstützung von Arbeiten<br />
geeignet (ab etwa 300 lx). Sie sollten in Arbeitsräumen<br />
verwendet werden und lassen sich auch besser mit<br />
Tageslicht kombinieren als warmweiß.<br />
Tageslichtweiße Lichtfarben sollten in erster Linie zur<br />
Ergänzung des Tageslichtes bei hohen Beleuchtungsstärken<br />
(mehr als 500 lx) eingesetzt werden. Sie unterstreichen<br />
eine kühle Arbeitsatmosphäre. Nach dem momentanen<br />
Stand der Erkenntnis wirken Lichtfarben mit hohem<br />
Blauanteil aktivierend und sind geeignet, unsere innere<br />
Uhr zu beeinflussen. Tageslichtweiße aber auch neutralweiße<br />
Lichtfarben sollten daher nicht leichtfertig in<br />
Räumen eingesetzt werden, die am Abend und in der<br />
Nacht genutzt werden – z. B. Bad, Flure und Schlafräume.<br />
Allein die Wahl der Lichtfarbe reicht nicht aus für „gutes“<br />
Licht. Das Licht muss zusätzlich über angemessene<br />
Farbwiedergabeeigenschaften verfügen.<br />
2.4.2 Farbwiedergabeeigenschaften<br />
Die Farbwiedergabeeigenschaften einer Lichtquelle beschreiben<br />
deren Fähigkeit, Farben möglichst „natürlich“<br />
erscheinen zu lassen. Das farbige Aussehen beleuchteter<br />
Objekte wird nicht allein durch deren Materialeigenschaften,<br />
sondern in gleicher Weise durch die spektrale Strahlungsverteilung<br />
der beleuchtenden Lichtart beeinflusst.<br />
Farbanteile, die im Spektrum des Lichts nicht enthalten<br />
sind, können auch die entsprechende Körperfarbe nicht<br />
zur Geltung bringen. Die Farbe eines Objektes wirkt dann<br />
unnatürlich oder ungewohnt.<br />
Tageslicht und Glühlampen haben von Natur aus sehr gute<br />
Farbwiedergabeeigenschaften, weil in ihnen nahezu alle<br />
Farbkomponenten vertreten sind. Andere künstliche Lichtquellen<br />
wie Leuchtstofflampen oder LEDs haben zumeist<br />
etwas schlechtere Farbwiedergabeeigenschaften, da einzelne<br />
Farbanteile überproportional vertreten sind und andere<br />
fast fehlen. Man spricht in diesem Zusammenhang<br />
von einem „diskontinuierlichem Spektrum“, Bild 20-8.<br />
a)<br />
b)<br />
20-8 Beispiel für Lichtquellen (Leuchtstofflampen)<br />
gleicher Lichtfarbe, aber unterschiedlicher<br />
Farbwiedergabeeigenschaft infolge der<br />
Strahlungsverteilung:<br />
a) warmweiß, Dreibandenleuchtstoff,<br />
Farbwiedergabeindex R a > 80<br />
b) warmweiß de luxe, Farbwiedergabeindex R a > 90c<br />
Die Farbwiedergabeeigenschaften von Lichtquellen werden<br />
auf der Basis von acht Testfarben durch einen Farbwiedergabe-Index<br />
R a gekennzeichnet und in Stufen eingeteilt,<br />
Bild 20-9.<br />
R a Anspruch Anwendung Lampenbeispiel<br />
> 90 Sehr hoch Esstisch,<br />
Anstrahlung<br />
von Gemälden<br />
Glühlampe, Halogenlampe,<br />
(R a = 100) deLuxe Leuchtstofflampe<br />
(R a 93)<br />
> 80 Hoch Arbeiten Leuchtstofflampe, Kompaktleuchtstofflampe<br />
> 70 mittel Flur, Lesen LED<br />
20-9 Kennzeichnung von Farbwiedergabeeigenschaften<br />
durch den Farbwiedergabe-Index<br />
20/6
20 Innenraumbeleuchtung<br />
Lampen<br />
Brennlage abhängt, Bild 20-21. Beim Einsatz in Fluren,<br />
Treppenhäusern oder anderen Räumen, in denen die Beleuchtung<br />
häufig ein- und ausgeschaltet wird, sollten<br />
ausschließlich EVGs mit Warmstart eingesetzt werden.<br />
3.1.4 Kompaktleuchtstofflampen mit integriertem<br />
Vorschaltgerät und Schraubsockel<br />
(Energiesparlampen)<br />
Kompaktleuchtstofflampen mit integriertem Vorschaltgerät<br />
und Schraubsockel wurden als energiesparender<br />
Ersatz für Glühlampen entwickelt und werden daher oft<br />
als „Energiesparlampen“ bezeichnet. Bei vergleichbarem<br />
Lichtstrom benötigen sie nur etwa ein Viertel der Glühlampenleistung.<br />
Die höheren Anschaffungskosten können<br />
durch die reduzierten Energiekosten und eine längere<br />
Lampenlebensdauer ausgeglichen werden [5].<br />
Funktionsweise: Das Funktionsprinzip der Kompaktleuchtstofflampen<br />
ist das Gleiche wie bei den stabförmigen<br />
Leuchtstofflampen.<br />
Lichttechnische Daten: Lichtausbeute 40 bis 65 lm/W;<br />
Lichtfarbe extra warmweiß; bedingt gute Farbwiedergabeeigenschaften.<br />
Die Temperaturabhängigkeit des Lichtstroms<br />
ist vergleichbar mit Kompaktleuchtstofflampen.<br />
Elektrotechnische Daten: Die Anschlussleistungen liegen<br />
– mit geringfügigen Ausnahmen – unter 25 W und<br />
entsprechen dem auf der Lampe angegebenen Wert. Die<br />
Lampen enthalten üblicherweise eine elektronische<br />
Schaltung als Vorschalt- und Zündgerät. Es werden aber<br />
auch Lampen mit konventionellem Vorschaltgerät und<br />
Glimmzünder angeboten. In der Regel können Kompaktleuchtstofflampen<br />
mit integriertem Vorschaltgerät nicht<br />
gedimmt werden.<br />
<strong>Bau</strong>formen: Kompaktleuchtstofflampen mit E14- oder<br />
E27-Schraubsockel sind in sehr unterschiedlichen <strong>Bau</strong>formen<br />
und Leistungsstufen verfügbar. Ring- oder kugelförmige<br />
Lampen können beleuchtungstechnische bzw.<br />
gestalterische Vorteile bieten. Auswahl einiger Daten siehe<br />
Bild 20-22.<br />
Lichtstrom<br />
100<br />
%<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
Kompakt-Leuchtstofflampe<br />
z.B. 7W, 9W, 11W<br />
0<br />
-10 0 10 20 30 40 50 °C 60<br />
Umgebungstemperatur der Lampe<br />
Lampen Nennleistung<br />
in Watt<br />
Lichtstrom<br />
in Lumen<br />
Lichtausbeute<br />
in lm /W<br />
5 240 48,0<br />
7 400 57,1<br />
11 600 54,5<br />
15 900 60,0<br />
20 1200 60,0<br />
23 1500 65,2<br />
27 1800 66,7<br />
33 2250 68,2<br />
Innenraumbeleuchtung<br />
20-21 Lichtstrom von Kompaktleuchtstofflampen in<br />
Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur<br />
und der Brennlage<br />
20-22 Daten für Kompaktleuchtstofflampen mit integriertem<br />
elektronischen Vorschaltgerät und E27-Schraubsockel.<br />
Länge und Durchmesser variierten mit Hersteller<br />
20/15
20 Innenraumbeleuchtung<br />
Lampen<br />
Mittlere Lebensdauer: etwa 8000 Stunden. Bei Lampen<br />
mit konventionellem Vorschaltgerät und Glimmzünder<br />
verkürzt sich die Lebensdauer mit zunehmender Schalthäufigkeit<br />
erheblich; Lampen mit elektronischem Vorschaltgerät<br />
zeigen je nach Ausführung ein günstigeres<br />
Verhalten. Für den Einsatz in Treppenhäusern eignen sich<br />
jedoch ausschließlich entsprechend gekennzeichnete Typen<br />
(Warmstart). Die Spannungsabhängigkeit der Lebensdauer<br />
ist gering.<br />
Anwendungsbereich: Jegliche Art der Allgemeinbeleuchtung,<br />
in Arbeitsräumen, eingeschränkt auch in<br />
Wohnräumen (nicht dimmbar!). Wirtschaftlich sinnvoll ist<br />
der Einsatz besonders dort, wo die Lampen jährlich hohe<br />
Betriebsdauern mit mehr als etwa 500 Stunden erreichen.<br />
Anwendungshinweise: Zum erfolgreichen Einsatz müssen<br />
die besonderen, z. T. von der Glühlampe abweichenden<br />
Eigenschaften bekannt sein. Empfehlenswert ist das<br />
Testen verschiedener Lampen.<br />
Aufgrund des Größen- und Gewichtsunterschieds passt<br />
nicht jede Lampe in jede Leuchte; damit verbunden kann<br />
die direkte Sicht auf das Leuchtmittel aufgrund unvollständiger<br />
Abschirmung im Substitutionsfall zu störender<br />
Blendung führen.<br />
Die Lichtstärkeverteilung ist anders als bei der Glühlampe,<br />
sodass sich in wichtigen Raumbereichen eventuell<br />
eine geringere Beleuchtungsstärke ergibt. Als Ersatz für<br />
weitgehend frei strahlende klare Glühlampen, z. B. in<br />
Kronleuchtern, ist die Kompaktleuchtstofflampe aus gestalterischen<br />
Gründen ungeeignet.<br />
Die Farbwiedergabeeigenschaften sind – trotz ähnlicher<br />
Lichtfarbe – weniger gut als die der Glühlampe, Bild<br />
20-23.<br />
Reflektorglühlampen lassen sich beleuchtungstechnisch<br />
nur stark eingeschränkt durch Kompaktleuchtstofflampen<br />
mit Reflektor ersetzen, da diese ausschließlich für<br />
sehr breite Lichtverteilungen zur Verfügung stehen.<br />
a)<br />
b)<br />
20-23 Lichtspektrum einer Glühlampe (a) und einer<br />
Kompaktleuchtstofflampe (b) mit integriertem<br />
Vorschaltgerät und Schraubsockel<br />
3.1.5 LEDs<br />
Licht emittierende Dioden, sogenannte LEDs sind seit<br />
gut 50 Jahren als farbige Anzeige- und Signallampen von<br />
Haushaltsgeräten, Radios und Fernsehern vertraut. Seit<br />
gut 10 Jahren haben sie auch als Quellen für weißes Licht<br />
Ihren Einzug in die Beleuchtungstechnik angetreten. Hier<br />
eröffnen Sie aufgrund ihres sehr kleinen und sehr hellen<br />
Lichtpunktes neue Möglichkeiten in der Gestaltung von<br />
Licht und Leuchten. Ständige Verbesserungen der Effizienz,<br />
Farbwiedergabe und die fast unbegrenzte Farbwahl<br />
ließ die LED zur „Lichtquelle der Zukunft“ avancieren.<br />
Funktionsweise: Die LED besteht aus einem Halbleiterkristall<br />
mit zwei unterschiedlich leitenden Bereichen. Legt<br />
man zwischen dem n-leitenden Bereich mit Elektronen-<br />
Überschuss und dem p-leitenden Bereich mit Elektronen-<br />
Mangel eine Gleichspannung an, so kommt es an der<br />
Trennschicht zwischen den beiden Bereichen zu einem<br />
Ausgleich. Bei diesem Rekombinationsprozess wird elektromagnetische<br />
Strahlung im sichtbaren Bereich erzeugt.<br />
Diese Strahlung wird nur in einem schmalen Wellenlän-<br />
20/16
20 Innenraumbeleuchtung<br />
Lampen<br />
genbereich abgegeben; dies bedeutet, dass die LED Licht<br />
in einer intensiven, stark gesättigten Farbe abgibt. Hierbei<br />
bestimmt das verwandte Halbleitermaterial den Farbton:<br />
rot, grün, blau, gelb oder orange. Alle anderen Farben,<br />
auch weiß, lassen sich durch die Kombination mehrerer<br />
LEDs erzeugen. Die unterschiedlichen Weißtöne können<br />
aus RGB (Rot, Grün, Blau) oder RGBY (Rot, Grün, Blau,<br />
Gelb) erzeugt werden. Da jedoch die einzelnen LED-Typen<br />
während ihrer Lebensdauer einen unterschiedlichen Rückgang<br />
ihrer Lichtausbeute aufweisen, bleibt der einmal eingestellte<br />
Farbton nicht stabil und muss unter Umständen<br />
aufwendig nachgeregelt werden. Als Alternative zur Erzeugung<br />
von weißem Licht mit LEDs hat sich die Konversionsmethode<br />
etabliert. Ähnlich wie bei der Leuchtstofflampe<br />
wird hier ein Teil des Lichtes einer blauen LED mit<br />
einem Leuchtstoff in breitbandiges gelbrötliches Licht umgewandelt.<br />
Zusammen mit der restlichen blauen Ausgangsstrahlung<br />
ergibt sich weißes Licht, Bild 20-24. Je<br />
mehr blaue Ausgangsstrahlung mit dem Leuchtstoff umgewandelt<br />
wird, umso rötlicher ist der Weißton und umso<br />
geringer ist die Lichtausbeute.<br />
Der LED-Halbleiterkristall ist aufgrund seiner geringen<br />
Größe nur in der Lage, eine sehr kleine elektrische Leistung<br />
aufzunehmen. Begrenzend wirkt hierbei u. a. die<br />
Wärme. Da mit steigender Temperatur an der Sperrschicht<br />
sowohl die Lichtausbeute wie auch die Lebensdauer<br />
sinkt, ist gerade bei LEDs im oberen Leistungssegment<br />
eine sehr schnelle Ableitung der Wärme wichtig.<br />
weißes Licht<br />
Reflektor<br />
LED-Chip<br />
Innenraumbeleuchtung<br />
Konversionsschicht<br />
blaues Licht<br />
Lichttechnische Daten: Die Lichtausbeute ist eines der<br />
ständigen Optimierungsziele. Bei Drucklegung sind Werte<br />
von 50 lm/W im Betriebzustand typisch. Es ist aber zu<br />
erwarten, dass sich die Lichtausbeute in absehbarer Zeit<br />
bis in den Bereich der Leuchtstofflampe (100 lm/W) steigern<br />
lässt – abhängig von Lichtfarbe und Farbwiedergabeeigenschaft.<br />
Elektrotechnische Daten: Für den Betrieb von LEDs ist<br />
eine Gleichstromversorgung über Konverter nötig. Diese<br />
sind in der Regel auf die zugehörige LED-Leuchte oder<br />
das LED-Modul-System abgestimmt. Prinzipiell wird zwischen<br />
Konstantstrom- und Konstantspannungs-Versorgung<br />
unterschieden. LED-Lampen als Glühlampen-Ersatz<br />
und LED-Leuchten verfügen in der Regel bereits<br />
über einen integrierten Konverter, sodass der Netzbetrieb<br />
möglich ist. LEDs lassen sich gut dimmen. Hierfür<br />
sind allerdings spezielle, auf das jeweilige System abgestimmte<br />
Steuermodule nötig.<br />
<strong>Bau</strong>formen: Da die Entwicklung der LED als Quelle weißen<br />
Lichtes noch relativ jung ist, haben sich typische<br />
<strong>Bau</strong>formen noch nicht etablieren können. Allen LED-<br />
Lichtquellen ist aber gemeinsam, dass der Licht abstrahlende<br />
LED-Halbleiterkristall sehr klein ist, der zugehörige<br />
<strong>Bau</strong>körper mitsamt des Kühlkörpers aber einen relativ<br />
hohen Platzbedarf hat.<br />
Anwendungsbereich: Da die einzelne LED nur mit einer<br />
relativ geringen Leistung (0,5 – 3 W) betrieben werden<br />
darf, ist sie kostengünstig überall dort einsetzbar, wo<br />
eine relativ kleine Fläche beleuchtet werden soll (z. B.<br />
Arbeitsplatz- oder Lese-Leuchte). Aufgrund ihres kleinen<br />
Lichtpunktes lässt sich die LED leicht mit effektiven Linsen<br />
versehen und so in der Akzentbeleuchtung für Bilder,<br />
Skulpturen und Vitrinen einsetzen. Gegen den Einsatz in<br />
der Allgemeinbeleuchtung von Arbeits- und Wohnräumen<br />
sprechen zz. noch die große Anzahl der hierfür benötigten<br />
LEDs und der damit verbundene Preis.<br />
20-24 Blaue LED mit Konversionsschicht für weißes Licht<br />
Anwendungshinweise: Sollen LEDs als Ersatz für andere<br />
Lampen/Leuchten eingesetzt werden, so sollten sie<br />
20/17
20 Innenraumbeleuchtung<br />
Tageslicht<br />
P 1,2<br />
a<br />
2<br />
a<br />
0,85m<br />
Schnitt A-A<br />
b=2-8m<br />
b F<br />
1,35m<br />
a<br />
0,85m 2,50m<br />
1m<br />
A<br />
P 1<br />
A<br />
P 2<br />
20-32 Beispiel für Mindestfensterbreiten nach DIN 5034<br />
0 1 2 3 4 5 6 7 8m<br />
1m<br />
Grundriss<br />
20-31 Lage der Bezugspunkte in DIN 5034 Teil 1<br />
Verbauungswinkel = 0°<br />
15°<br />
30°<br />
45°<br />
b F/b=<br />
55%<br />
55-100%<br />
n.a.<br />
ten Verbauungswinkel (Bezugspunkt Fenstermitte) berücksichtigt.<br />
Noch nicht vorhandene, aber baurechtlich<br />
mögliche Gebäude sollten vorausschauend in die Planung<br />
einbezogen werden. Die Brüstungshöhe beträgt<br />
0,85 m, die Oberkante des Fensters liegt 0,30 m unter<br />
der Raumhöhe aber mindestens 2,20 m über dem Fußboden.<br />
Eine Fensterposition in Wandmitte erhöht die<br />
Gleichmäßigkeit der Beleuchtung. Lichtschwächend wird<br />
Doppelverglasung mit hellem Flachglas angenommen.<br />
Um eine angemessene Sichtverbindung ins Freie zu gewährleisten,<br />
soll der prozentuale Anteil der Fensterbreite<br />
an der Raumbreite nicht weniger als 55 % betragen. Dabei<br />
wird praxisgerecht angenommen, dass nach Einbau der<br />
Fensterrahmen und -flügel einschließlich Versprossung eine<br />
durchsichtige Fläche von 70 % verbleibt. Die Maße für<br />
Fensterhöhe und -breite beziehen sich auf den Rohbau.<br />
Im Folgenden wird ein Überblick für eine typische Wohnraumsituation<br />
bei einer Raumhöhe von 2,50 m und einer<br />
Teil 4. Die prozentuale Mindestfensterbreite für<br />
Wohnräume soll im Rohbau nicht weniger als 55 %<br />
der Raumbreite betragen. Bei großer Raumtiefe und<br />
hohem Verbauungswinkel kann gegebenenfalls sogar<br />
eine Fensterbreite von 100 % nicht mehr ausreichend<br />
(n. a.) sein.<br />
Fensterhöhe von 1,35 m gegeben. Die Angaben der<br />
relativen Mindestfensterbreite sind vereinfacht dargestellt;<br />
die exakten Werte sind der Norm zu entnehmen,<br />
Bild 20-32.<br />
Beispiel 1: Bei 0° Verbauungswinkel ist bis zu einer<br />
Raumtiefe von a = 6 m eine relative Fensterbreite von<br />
55 % ausreichend.<br />
Beispiel 2: Bei 30° Verbauungswinkel genügt eine relative<br />
Mindestfensterbreite von 55 % nur, wenn der Raum nicht<br />
tiefer als 4,5 m ist. Bei Raumtiefen oberhalb von 6,5 m<br />
wäre sogar eine Fensterbreite von 100 % nicht mehr<br />
20/24
20 Innenraumbeleuchtung<br />
Berechnung der Beleuchtungsstärke<br />
ausreichend. Die Mindestfensterbreiten für Raumtiefen<br />
zwischen 4,5 m und 6,5 m sind der Norm zu entnehmen.<br />
5 Berechnung der Beleuchtungsstärke<br />
Lichtplaner können auf Berechnungsverfahren zurückgreifen,<br />
wenn in einem bestimmten Raumbereich eine<br />
vorgegebene Beleuchtungsstärke (Definition siehe Abschnitt<br />
9) eingehalten werden soll. Die Lampen- und<br />
Leuchtenhersteller stellen für ihre Produkte die dazu erforderlichen<br />
Angaben zur Verfügung. Für die Wohnraumbeleuchtung<br />
werden solche Berechnungen in aller Regel<br />
nicht durchgeführt; für Zweckbauten, z. B. Bürogebäude,<br />
sind sie häufig unumgänglich.<br />
Die beiden nachfolgend für den Einsatz von Leuchten<br />
vorgestellten Rechenverfahren sollen lediglich einen<br />
Einblick in die beleuchtungstechnische Planung geben.<br />
Dem professionell tätigen Planer stehen hierfür Rechenprogramme<br />
zur Verfügung.<br />
5.1 Wirkungsgradverfahren<br />
xionsgraden von Decke, Wänden und Boden sowie der<br />
Lichtstärkeverteilung der Leuchte ab.<br />
Für häufig vorkommende Leuchten sind η LB und η R tabelliert.<br />
In diesen Tabellen ist der Raumindex<br />
mit a = Raumtiefe, b = Raumbreite, h = Leuchtenhöhe<br />
über Arbeitsebene, Bild 20-33.<br />
Schließlich ergibt sich für eine gewählte Beleuchtungsstärke<br />
die erforderliche Lampenzahl zu<br />
n =<br />
η B = η LB · η R<br />
k =<br />
a · b<br />
h(a + b)<br />
A · E<br />
Φ La · η R · η LB ·<br />
oder – bei bekannter Lampenzahl – die mittlere Beleuchtungsstärke<br />
zu<br />
n · Φ<br />
E = La · η R · η LB ·<br />
A<br />
Das Wirkungsgradverfahren ist eine Methode, mit der<br />
sich Anzahl und Watttage der einzusetzenden Lampen<br />
bzw. Leuchten überschlägig ermitteln lassen. Die Berechnung<br />
der mittleren Beleuchtungsstärke E in einem<br />
Raum erfolgt hierbei für eine waagrechte, den gesamten<br />
Raum ausfüllende Fläche A (Nutzfläche) in 0,75 m Höhe<br />
über dem Boden. Auch andere Höhen können eingesetzt<br />
werden. Die Fläche A erhält direktes Licht von den im<br />
Raum verteilten Lichtquellen, aber auch durch Mehrfachreflexion<br />
an Wänden, Decke und Fußboden.<br />
Der Beleuchtungswirkungsgrad η B gibt an, wie viel von<br />
der Lichtleistung der Lampen die Leuchte verlässt und<br />
insgesamt auf die Nutzfläche fällt. Er setzt sich aus dem<br />
Leuchtenbetriebswirkungsgrad η LB sowie dem Raumwirkungsgrad<br />
η R zusammen. Der Raumwirkungsgrad η R<br />
hängt von der Raumgeometrie (Raumindex k), den Refle-<br />
E : mittlere Beleuchtungsstärke in lx<br />
A: Raumgrundfläche in m 2<br />
Φ La : Lichtstrom einer Lampe in lm<br />
n: Zahl der Lampen im Raum<br />
WF Wartungs-Faktor – berücksichtigt Lichtverlust<br />
durch Alterungs- und Verschmutzung<br />
von Lampe, Leuchte und Raum und kann im<br />
Wohnhaus mit 0,75 angenommen werden<br />
η LB : Leuchtenbetriebswirkungsgrad, tabelliert<br />
η R : Raumwirkungsgrad, tabelliert<br />
Beispiel: In einem Bastel- und Hobbyraum soll mit Spiegelrasterleuchten<br />
(engstrahlend) eine mittlere Beleuchtungstärke<br />
von 500 lx (normale Sehaufgaben) realisiert<br />
werden. Jede Leuchte ist mit zwei stabförmigen 28 W<br />
Leuchtstofflampen, Durchmesser 16 mm, Lichtfarbe<br />
Innenraumbeleuchtung<br />
20/25
20 Innenraumbeleuchtung<br />
Berechnung der Beleuchtungsstärke<br />
Lichtstärkeverteilungskurven<br />
direkt;<br />
stark gerichtet<br />
90°<br />
Reflexionsgrade<br />
Beispiele für Leuchten<br />
Decke 0,8 0,5 0,3 0 Darstellunbetriebs-<br />
Leuchtentyp Leuchten-<br />
Wände 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3 0<br />
wirkungs-<br />
grad η Boden 0,3 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,1 0<br />
LB<br />
Raumindex<br />
k Raumwirkungsgrad η R in %<br />
Spiegelraster<br />
eng strahlend<br />
60<br />
direkt;<br />
tief strahlend<br />
60°<br />
30°<br />
0,6<br />
1,0<br />
1,5<br />
61<br />
80<br />
95<br />
58<br />
75<br />
86<br />
54<br />
73<br />
88<br />
52<br />
69<br />
82<br />
59<br />
76<br />
90<br />
57<br />
73<br />
84<br />
53<br />
70<br />
84<br />
51<br />
68<br />
80<br />
51<br />
67<br />
79<br />
46<br />
62<br />
75<br />
Spiegelreflektor<br />
einlampig<br />
2,0 102 91 96 87 95 89 91 86 84 80<br />
Rundreflektor<br />
3,0 111 97 106 95 103 95 99 92 91 87<br />
eng strahlend<br />
5,0 119 102 115 100 109 98 106 97 96 92<br />
Raumindex<br />
k Raumwirkungsgrad η R in %<br />
Wanne<br />
prismatisch<br />
80<br />
75<br />
65<br />
90°<br />
60°<br />
30°<br />
direkt;<br />
breit strahlend<br />
90°<br />
60°<br />
30°<br />
0,6<br />
1,0<br />
1,5<br />
52<br />
73<br />
89<br />
49<br />
67<br />
81<br />
43<br />
64<br />
81<br />
42<br />
60<br />
75<br />
49<br />
69<br />
83<br />
48<br />
65<br />
78<br />
42<br />
61<br />
77<br />
41<br />
59<br />
73<br />
41<br />
58<br />
72<br />
35<br />
52<br />
66<br />
Grobraster<br />
weiß,<br />
Spiegelraster<br />
2,0 97 86 89 81 90 83 84 79 78 73 Spiegelreflektor,<br />
3,0 107 94 101 90 99 91 94 88 86 81<br />
5,0 116 100 111 97 106 96 102 94 93 88<br />
mehrlampig<br />
Raumindex<br />
k Raumwirkungsgrad η R in %<br />
Wanne<br />
opal<br />
0,6 47 45 38 37 45 43 37 36 36 29<br />
Reflektor<br />
1,0 67 62 58 54 63 60 55 53 52 45<br />
weiß<br />
1,5 84 76 75 69 78 73 71 68 66 60<br />
2,0 93 83 84 77 86 80 79 75 73 67 Opalglasscheibe,<br />
3,0 104 91 98 87 96 88 91 84 83 77<br />
5,0 114 98 109 95 104 94 100 92 90 86<br />
Glühlampe<br />
60<br />
70<br />
50<br />
70<br />
50<br />
20-33 Raumwirkungsgrade für verschiedene Leuchten<br />
warmweiß 830, Lichtstrom jeweils 2600 lm, bestückt. Die<br />
Reflexionsgrade der Raumbegrenzungsflächen werden<br />
abgeschätzt auf: Decke 0,8, Wände 0,3 und Boden 0,3.<br />
Die Raummaße sind: Raumtiefe a = 4 m, Raumbreite<br />
b = 4 m, Raumhöhe 2,75 m. Die Leuchtenhöhe über der<br />
Nutzebene beträgt h = 2 m.<br />
Der Raumindex berechnet sich zu k ≈ 1, entsprechend<br />
entnimmt man den Tabellen einen Raumwirkungsgrad<br />
von 73 %; der Betriebswirkungsgrad der Leuchten beträgt<br />
70 %. Der Wartungsfaktor lässt sich für im Wohnhaus<br />
typische Lampen, Leuchten und Wartungsintervalle<br />
durch den Wert 0,75 abschätzen. Für den kommerziellen<br />
20/26