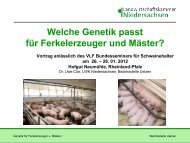Heft_Ausbildung_Block_1_2.pdf - DLR Eifel
Heft_Ausbildung_Block_1_2.pdf - DLR Eifel
Heft_Ausbildung_Block_1_2.pdf - DLR Eifel
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Ausbildung</strong><br />
zum<br />
Botschafter<br />
der Mittel<br />
ittelrhein<br />
heinkirschen<br />
irschen<br />
am 16.06 + 17.06.2012 in Filsen (<strong>Block</strong> 1 + 2)
Inhalt<br />
1. Programm<br />
2. Einführung<br />
3. Ergebnisse<br />
4. Pomologie<br />
5. Sortentafel<br />
6. Sorten-Empfehlungslisten<br />
7. Geschichte des Kirschanbaus<br />
<strong>Ausbildung</strong> „Botschafter der Mittelrheinkirschen“ 16.u.17.06.2012 in Filsen
<strong>Block</strong> 1<br />
Projekt<br />
Mittelrheinkirschen und Sortenkunde<br />
Samstag, den 16.06.2012<br />
Ort: Pfarrgemeindehaus Filsen<br />
10.00 – 14.00 Uhr<br />
(inkl. 30 min. Mittagspause)<br />
Projekt Mittelrheinkirschen und<br />
theoretische Einführung in die<br />
Sortenkunde<br />
14.00 – 17.00 Uhr<br />
Praxisteil<br />
„Pomologie und Kirschgenuss<br />
<strong>Block</strong> 2<br />
Kirschwiesenexkursion mit<br />
Sortenerkennung und Kirschgenuss<br />
Sonntag, den 17.06.2012<br />
Treffpunkt:<br />
Besucherparkplatz Ortseingang Filsen<br />
10.00 – 15.00 Uhr<br />
(inkl. 30 min. Mittagspause)<br />
Kirschwiesenexkursion im Kirschanbaugebiet<br />
Filsen und Osterspai<br />
Die Blöcke können auch einzeln wahrgenommen werden!<br />
<strong>Block</strong> 3<br />
Baumpflege Mittelrheinkirschen<br />
wird noch bekannt gegeben<br />
(ca. ½ Tag am Wochenende<br />
im Herbst 2012)<br />
Treffpunkt:<br />
Besucherparkplatz Ortseingang Filsen<br />
Standortwahl, Wahl des Baumtyps,<br />
Sortenwahl, Pflanzung und<br />
Pflanzschnitt bei Jungbäumen,<br />
Schnittregeln bei Kirschen
Programm<br />
zur <strong>Ausbildung</strong><br />
„Botschafter der<br />
Mittelrheinkirsche“<br />
Durch die <strong>Ausbildung</strong> führen:<br />
Dr. Annette Braun-Lüllemann<br />
Sabine Haas (ADD Trier)<br />
Frank Böwingloh (<strong>DLR</strong> Westerwald-Osteifel)<br />
<strong>Ausbildung</strong>sinhalte:<br />
Die <strong>Ausbildung</strong>sblöcke 1 und 2 gliedern sich<br />
in einen theoretischen und einen praktischen<br />
Teil mit anschließender Kirschwiesenexkursion.<br />
Als Einführung werden die bisherigen<br />
Aktivitäten im Modellprojekt "Mittelrheinkirsche"<br />
vorgestellt sowie die historische<br />
Entwicklung des Kirschanbaus und der<br />
Kirschsorten im Mittelrheintal erläutert. Es<br />
werden die begonnenen und geplanten<br />
Maßnahmen zur Sortenerhaltung und<br />
regionalen Inwertsetzung der Mittelrheinkirschen<br />
vorgestellt.<br />
Im anschließenden praktischen Teil<br />
"Pomologie und Kirschgenuss" wird das<br />
Sortenwissen zu den charakteristischen<br />
Regionalsorten des Mittelrheintales vermittelt.<br />
Vorgestellt werden die sortentypischen<br />
Charakteristika der Früchte mit ihren<br />
Verwendungsmöglichkeiten und Anbaueigenschaften.<br />
Probieren erwünscht! Die<br />
erlernten Sortenkenntnisse werden in einer<br />
Kirschwiesenexkursion vertieft, in der weitere<br />
sortentypische Merkmale zum Baumwuchs<br />
und -habitus erläutert sowie der landschaftsprägender<br />
Charakter und die<br />
Geschmacksvielfalt erlebt werden können.<br />
Im <strong>Ausbildung</strong>sblock 3 wird anschließend die<br />
Baumpflege der Mittelrheinkirschen<br />
vorgestellt.<br />
Bitte kurze Rückbestätigung an ADD Trier,<br />
Referat 44, Anja Hennen<br />
Tel.: 0651/9494-540 o. a.hennen@add.rlp.de<br />
Vermittlungsziel:<br />
Als "Botschafter der Mittelrheinkirsche" werden<br />
Sie in der Lage sein Grundlagen zur<br />
historischen und aktuellen Situation des<br />
Kirschanbaus am Mittelrhein weiterzugeben.<br />
Sie werden die Antworten auf die Fragen zur<br />
Mittelrheinkirsche wissen, die wichtigsten<br />
Regionalsorten in ihren Frucht- und<br />
Baummerkmalen erkennen und Informationen<br />
zur Anbaueignung und<br />
Verwendungsmöglichkeiten vermitteln können.<br />
Sie helfen somit das Wissen um die<br />
Mittelrheinkirschen weiterzutragen und in der<br />
Region zu verankern<br />
2<br />
1<br />
1<br />
Treffpunkt 1. Tag 2 Treffpunkt 2. Tag
<strong>Ausbildung</strong> „Botschafter der Mittelrheinkirsche“<br />
- <strong>Block</strong> 1 – Mittelrheinkirschen und Sortenkunde<br />
Teil 2:<br />
Projektbausteine Mittelrheinkirschen<br />
1. Ausgangslage und Projektanfang<br />
2. Organisation<br />
3. Bezugsraum<br />
4. Erste Auswirkungen<br />
5. Ausblick<br />
Folie 1<br />
Ausgangslage und Projektanfang<br />
Welterbegebiet seit 2002<br />
• nur noch wenige Landnutzer<br />
• starke Besitzzersplitterung<br />
• zunehmende Bewaldung<br />
• typische Landschaftbilder verschwinden<br />
• wenige regionale Produkte (Produktion/Veredelung)<br />
• touristische Infrastruktur wie 50er/60er Jahre<br />
• kaum spürbare regionale Identität<br />
• bedrohte Vielfalt (Biodiversität)<br />
<strong>DLR</strong> 2008<br />
• Umfassende/ effiziente Vorbereitung:<br />
AG Mittelrheinkirschen/ Machbarkeitsstudie<br />
PU Filsen 2006<br />
• Erste Überlegungen Wiederbelebung Obstanbau<br />
zur Erhaltung der Kulturlandschaft (Nutzungskonzeption)<br />
Folie 2
Organisation - Zeitlicher Ablauf der Projektbausteine seit 2008<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Fruchtkartierung,<br />
Dokumentation,<br />
Sichtung Sortensammlungen<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Reiserschnitt, Veredlung +<br />
Reisermuttergarten Bonn, Veredlung +<br />
Anzucht ausgew. Baumschule<br />
Anzucht Baumschulen<br />
Pflanzung in Sortimentsgärten<br />
Empfehlungslisten, Sortenbroschüre, Website MRK<br />
Fertige Bäume für Pflanzaktionen MGdF<br />
Pflege und Nutzung Streuobstwiesen<br />
<br />
<br />
<br />
Vorü. Produktentwicklung<br />
Vorstudie<br />
Inwertsetzung<br />
(ViTour)<br />
Zweckverband WOM<br />
Umsetzung Netzwerk und Maßnahmen<br />
(gepl. üb. Hotspot BFN, bis 2018 oder Leader bis Sept.2015 )<br />
Umsetzung Vermarktung<br />
(geplant über Leader)<br />
<br />
<br />
Landentwicklung (<strong>DLR</strong> Westerwald-Osteifel und Rhein-Nahe-Hunsrück)<br />
Flächenzuteilung, Wege-Gewässerplan<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Vorbereitung Umsetzung Landentwicklung Umsetzung Vorhaben Partner Transfer<br />
Folie 3<br />
Bezugsraum - Welterbegebiet<br />
Filsen 1742<br />
Filsen 1875<br />
Filsen, Kamp u. Boppard 1951<br />
Folie 4
Erste Auswirkungen– Partnerschaften und Darstellung<br />
Presse und<br />
Obstanbauer<br />
Internet<br />
Wanderführer<br />
Gastronomie<br />
LAG<br />
<strong>DLR</strong>s, ADD,<br />
RLP<br />
Botschafter<br />
Zweckverband<br />
National<br />
International<br />
Folie 5<br />
Erste Auswirkungen – Rahmenplanungen / Strategien<br />
Biodiversitätsstrategie<br />
Strategiepapier Entwicklung<br />
der ländlichen Räume<br />
Handlungsprogramm<br />
Welterbe Oberes Mittelrheintal<br />
Kulturlandschaftsentwicklungskonzept<br />
Welterbegebiet Oberes Mittelrheintal<br />
Masterplan<br />
Masterplan<br />
Welterbe Oberes Mittelrheintal<br />
Masterplan<br />
Welterbe Oberes Mittelrheintal<br />
Tourismusstrategie<br />
Romantischer Rhein<br />
Folie 6
Erste Auswirkungen – Beispiel National „BUGA Koblenz“<br />
Imagegewinn mit starkem Nachklang<br />
• > 3.500.000 Besucher<br />
(> 600.000 Besucher b. den Mittelrheinkirschen (5.000 -10.000 Besucher/ Tag)<br />
• Highlights: Kirsch-Automat (22.000 verkaufte Probiertütchen 15g)<br />
20-Sortenbaum<br />
Kirschsitze<br />
Image Filme<br />
Landschaftsmodell Kirschorte/-sorten<br />
Spuckwettbewerb<br />
Aktionstage<br />
Folie 7<br />
Erste Auswirkungen – Beispiel „Aktuelle Presse“<br />
Kirschwochen der Welterbe-Gastgeber 2012<br />
Folie 8
Ausblick – Kirschenlandschaft im Welterbe<br />
Spezialitätenmarke mit<br />
Verbindung zur Kultur- und<br />
Naturlandschaft<br />
Mit gutem Gewissen und Wissen Essen !<br />
Eine Kirschregion wird sichtbar !<br />
Raumplanung<br />
<br />
Integration in touristische<br />
Angebote und Planungen<br />
Erleben und begehen ! Das ist unsere Art !<br />
Identitätsprozess auf<br />
kommunaler Ebene<br />
Folie 9<br />
Ausblick – Kirschenlandschaft im Welterbe<br />
Alleinstellungsmerkmal,<br />
Marketing<br />
Einmalige Kulturlandschaft mit Kirschen !<br />
Vielfältiger (Sorten)-Kirschanbau !<br />
Regionalvermarktung -<br />
Hobby-, Neben-, und<br />
Haupterwerb<br />
Netzwerk für<br />
Kommunikation,<br />
Organisation, Pflege und<br />
Bildung<br />
Wegweiser Kirsche ! Echt, Authentisch und Transparent !<br />
Sortensicherung und<br />
Vermehrung; von der<br />
Pflanzung bis zum Teller<br />
Folie 10
Das Gesamtkonzept trägt erste (rote) Früchte !<br />
Danke für Ihre Aufmerksamkeit !<br />
Folie 11
<strong>Ausbildung</strong> "Botschafter der Mittelrheinkirsche"<br />
<strong>Block</strong> 1: Mittelrheinkirschen und Sortenkunde<br />
Projektergebnisse Modellvorhaben "Mittelrheinkirsche"<br />
Projekt im Auftrag des Landes Rheinland Pfalz, Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier<br />
Dr. Annette Braun-Lüllemann<br />
Gliederung<br />
1. Überblick über die geschichtl. Entwicklung des Steinobstanbaus<br />
2. Ausgangssituation, Projektziele<br />
3. Erfassungsmethodik (teilweise, s. a. Anschlußvortrag Sortenkunde)<br />
4. Ergebnisse, Vorstellung einiger Regionalsorten<br />
5. Bewertung des aufgefundenen Sortiments<br />
6. Sortensicherungsmaßnahmen<br />
<strong>Ausbildung</strong> "Botschafter der Mittelrheinkirsche" <strong>Block</strong> 1: Mittelrheinkirschen und Sortenkunde<br />
Dr. Annette Braun-Lüllemann
Geschichtliche Bedeutung des Steinobstanbaus<br />
<br />
<br />
<br />
Erste Obstgärten und Kirschen bereits im Spätmittelalter Verwendung zum Eigenverbrauch<br />
Ab Ende des 18. Jahrhunderts zunehmender Süßkirschanbau in Bad Salzig,<br />
gefördert durch die französische und nachfolgende preußische Verwaltung<br />
Blüte des Kirschanbaus Ende des 19. Jahrhunderts bis Anfang der 1960er Jahre<br />
Süßkirschen als Nachfolgekultur des Weinbaus, Anbau auch auf Steilhanglagen<br />
Schwerpunkt nördl. Bereich des Mittelrheintals Brey bis Hirzenach, Lahnstein bis Wellmich)
Zentner<br />
6000<br />
4000<br />
2000<br />
0<br />
1886-1899<br />
(1938)<br />
1954-1971<br />
Datenquelle: MONSCHAUER (2005)<br />
Die durchschnittliche Kirschernte (Süß- und Sauerkirschen) in Zentnern<br />
Einzugsbereich Obst-Absatzgen. Rhein-Lahn<br />
<strong>Ausbildung</strong> "Botschafter der Mittelrheinkirsche" <strong>Block</strong> 1: Mittelrheinkirschen und Sortenkunde<br />
Dr. Annette Braun-Lüllemann<br />
Das vorläufige (?) Ende des Steinobstanbaus in den 1960er Jahren<br />
Ursachen<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Handel verlangte nach größeren Partien einheitlicher Ware, regionale<br />
Mittelrheinsorten waren größtenteils nicht mehr absetzbar<br />
Konkurrenz von Einfuhren aus Südeuropa<br />
Anbauprobleme: Bodenmüdigkeit, Krankheiten<br />
Steigende Haupterwerbseinkommen, sinkende Obsterlöse<br />
Verändertes Freizeitverhalten<br />
Folge: Aufgabe oder Umstrukturierung<br />
<br />
<br />
Brachfallen der Steinhänge<br />
Sortimentsreduktion auf wenige, dunkle, festfleischige,<br />
überwiegend spätreifende Sorten<br />
<strong>Ausbildung</strong> "Botschafter der Mittelrheinkirsche" <strong>Block</strong> 1: Mittelrheinkirschen und Sortenkunde<br />
Dr. Annette Braun-Lüllemann
Ausgangssituation<br />
Methodik: Erfassung des noch vorhandenen Sortenwissens<br />
Gewinnung von Informanten durch:<br />
Mund zu Mund-Propaganda<br />
Presseaufruf<br />
Radio-, TV-Berichte<br />
Kirschenfest Filsen<br />
<br />
Über 40 Informanten befragt<br />
Methodik bei den Interviews<br />
Gezielte Abfrage zu Sortenkenntnissen (Sortenliste)<br />
Bezug der Informanten zum Steinobst:<br />
Nebenerwerbsanbauer<br />
Erwerbsanbauer<br />
Brenner<br />
Sammelstelleninhaber (ehemalig)<br />
Baumschulbesitzer (ehemalig)<br />
Gartenbesitzer<br />
<strong>Ausbildung</strong> "Botschafter der Mittelrheinkirsche" <strong>Block</strong> 1: Mittelrheinkirschen und Sortenkunde<br />
Dr. Annette Braun-Lüllemann
Projektziele<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Grundlagenarbeit: Erfassung und Identifizierung der vorhandenen<br />
Steinobstsorten<br />
Sortendokumentation (Baumstandorte, Fotodokumentation)<br />
Sortensicherung<br />
Aktivierung des Steinobstanbaus mit alten Regionalsorten<br />
Entwicklung regionaler Obstspezialitäten<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Verwendung in der Gastronomie<br />
Förderung der Vermarkung<br />
Wissenstransfer und Inwertsetzung in die Region<br />
Erhaltung des Landschaftsbildes<br />
Untersuchungsphasen Modellprojekt<br />
2009: Schwerpunktraum Filsen: Sortenerfassung aller Steinobstarten,<br />
stichpunktartig übriges Welterbegebiet<br />
2010: Schwerpunkt linke Rheinseite: Sortenerfassung Kirsche<br />
2011: Schwerpunkt Randbereiche des Welterbes (Trechtingshausen,<br />
Lahnstein): Sortenerfassung Kirsche<br />
Schwerpunkt Öffentlichkeitsarbeit:<br />
BUGA-Ausstellungsbeitrag, Buntes Klassenzimmer,<br />
Aktionstage, Mittelrheinkirschen-Homepage<br />
2012: Schwerpunkt Dokumentation/ Wissenstransfer:<br />
Regionale Sortenbroschüre,<br />
<br />
(Grundlagen in Historie, Regionalsorten, Baumschnitt/-pflege)
Untersuchtes Artenspektrum / -zeitraum:<br />
Süßkirschen (2009-2011)<br />
Sauerkirschen (2009-2011)<br />
Bastardkirschen (2009-2011)<br />
Pflaumen (2009)<br />
incl. Mirabellen, Reneclauden, Zwetschgen<br />
Aprikosen (2009)<br />
Pfirsiche (2009)<br />
<strong>Ausbildung</strong> "Botschafter der Mittelrheinkirsche" <strong>Block</strong> 1: Mittelrheinkirschen und Sortenkunde<br />
Dr. Annette Braun-Lüllemann<br />
Brey<br />
Untersuchungsraum<br />
Lahnstein<br />
Siebenborn<br />
Kehlbach<br />
Bad Salzig<br />
Filsen<br />
Weiler Rheinbay<br />
Kamp<br />
Holzfeld<br />
Kestert,<br />
St. Goarshausen<br />
Manubach,<br />
Neurath,<br />
Trechtinghausen<br />
Reitzenhain
Ergebnisse der Erfassungen<br />
Untersuchte Bäume im Welterbe Oberes Mittelrheintal (1773 Bäume)<br />
44 / 2,5% 145 / 8% Süßkirschen<br />
7 / 0,5%<br />
280 / 16%<br />
152 / 9%<br />
1145 / 64%<br />
Sauerkirschen<br />
Bastardkirschen<br />
Pflaumen<br />
Aprikosen<br />
Pfirsiche<br />
Erfasste Sorten im Welterbe Oberes Mittelrheintal (149)<br />
9 / 6%<br />
40 / 27%<br />
18/ 12%<br />
68 / 45 %<br />
Süßkirschen<br />
Sauerkirschen<br />
Bastardkirschen<br />
Pflaumen<br />
Aprikosen<br />
Pfirsiche<br />
4 / 3%<br />
10 / 7%<br />
<strong>Ausbildung</strong> "Botschafter der Mittelrheinkirsche" <strong>Block</strong> 1: Mittelrheinkirschen und Sortenkunde<br />
Dr. Annette Braun-Lüllemann<br />
Ergebnisse der Erfassungen: Schwerpunktraum Filsen
Ergebnisse der Erfassungen - Süßkirschen<br />
Ergebnisse<br />
Ca. 1150 Bäume verifiziert<br />
68 Sorten<br />
49 alte pomologisch beschr. Sorten<br />
1 moderne Sorte<br />
18 bisher nicht zuordenbare Sorten<br />
(Arbeitstitel)<br />
14 Unterlagen bzw. Sämlinge<br />
Potential:<br />
Vorstudie 95 Sortennamen<br />
Nach heutiger Einschätzung<br />
viele Synonyme. max.<br />
60 - 70 eigenständige Sorten<br />
<strong>Ausbildung</strong> "Botschafter der Mittelrheinkirsche" <strong>Block</strong> 1: Mittelrheinkirschen und Sortenkunde<br />
Dr. Annette Braun-Lüllemann<br />
Ergebnisse der Erfassungen - Süßkirschen<br />
Verbreitung/Gefährdung der Sorten<br />
Gefährdungs<br />
-grad<br />
Verbreitung/Gefährdung<br />
Erklärung<br />
1 sehr selten /<br />
vom Aussterben bedroht<br />
Nur ein Baum (oder mehrere abgängige Bäume an<br />
einem Standort) der Sorte bisher deutschlandweit<br />
bekannt<br />
2 selten / stark gefährdet Regionalsorte: Bis 20 Bäume im Mittelrheintal<br />
bekannt (oder nur abgängige Bäume vorhanden)<br />
Überregional verbreitete Sorte: Deutschlandweit<br />
stark gefährdete Sorte<br />
3 mäßig verbreitet /<br />
gefährdet<br />
Regionalsorte: Im Mittelrheintal noch mäßig<br />
verbreitet bis verbreitet ( dann jedoch ganz<br />
überwiegend nur noch auf Altbäumen vorhanden)<br />
Überregional verbreitete Sorte: Deutschlandweit<br />
gefährdete Sorte<br />
4 verbreitet Überregionale Standardsorte (auch wenn im<br />
Mittelrheintal nicht sehr verbreitet)
Ergebnisse der Erfassungen - Süßkirschen<br />
Gefährdung:<br />
Über zwei Drittel der Sorten gefährdet<br />
fast ein Viertel vom Aussterben bedroht<br />
22%<br />
31%<br />
25%<br />
22%<br />
Gefährdungsgrad<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
Regionalität:<br />
Über ein Drittel der aufgefundenen Sorten vermutlich Regionalsorten<br />
(Vgl. Anbaugebiet Witzenhausen > 5 % Regionalsorten)<br />
<br />
<br />
Sehr stark ausgeprägte Regionalität des mittelrheinischen Sortiments<br />
Nicht alle Regionalnamen sind Regionalssorten <br />
<strong>Ausbildung</strong> "Botschafter der Mittelrheinkirsche" <strong>Block</strong> 1: Mittelrheinkirschen und Sortenkunde<br />
Dr. Annette Braun-Lüllemann<br />
Ergebnisse der Erfassungen - Süßkirschen<br />
Sorten, die sich Mitte des 20. Jahrhunderts im Anbau befanden<br />
(Empfehlungsliste Landwirtschaftskammer<br />
Alle Sorten aufgefunden<br />
a) Regionalsorten<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
b) Überregional verbreitete Sorten<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Geisepitter (Schwerpunkt rechte Rheinseite)<br />
Bopparder Krächer (Schwerpunkt linke Rheinseite)<br />
Hängige<br />
Simonis (Schwerpunkt linke Rheinseite)<br />
Große Prinzessin<br />
Große Schwarze Knorpelkirsche<br />
Hedelfinger<br />
Jaboulay<br />
Kassins Frühe<br />
Schneiders Späte Knorpel/Kaiser Franz/Zeppelin<br />
Souvenir de Charmes<br />
Rheinhessen-Nassau, Erzeuger Großmarkt<br />
Obst und Gemüse Koblenz, Obst-<br />
Absatzgenossenschaft Rhein-Lahn)<br />
Bopparder Krächer<br />
Jaboulay<br />
<strong>Ausbildung</strong> "Botschafter der Mittelrheinkirsche" <strong>Block</strong> 1: Mittelrheinkirschen und Sortenkunde<br />
Dr. Annette Braun-Lüllemann
Ergebnisse der Erfassungen - Süßkirschen<br />
Alte Regionalsorten, die vermutlich Mitte des 20. Jahrhunderts bereits im<br />
Verschwinden waren<br />
Noch Zeitzeugen vorhanden, die die Sorten kannten:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Bachs Nikeläse<br />
Christkindscher (vermutl. linke Rheinseite)<br />
Geld(k)lose (Syn. Valentinsche?)<br />
Bopparder Frühe (vermutl. linke Rheinseite)<br />
Heils Frühe/Heilepitter (vermutl. rechte Rheinseite)<br />
Heidelberger (bunt, Quelle D. Dähne)<br />
Höppches<br />
Kesterter Schwarze<br />
Lauster Jakob (vermutl. linke Rheinseite)<br />
Nahlschmieds (vermutl. linke Rheinseite)<br />
Spanische<br />
Valentinsche (Syn. Geld(k)lose?)<br />
Heute offensichtlich nicht mehr bekannt:<br />
<br />
<br />
<br />
Apollone (schon 1929 kaum noch vorhanden)<br />
Camper Frühe Schwarze (Baumschule Lehnert)<br />
Hävels (schon 1929 kaum noch vorhanden)<br />
Spanische<br />
<strong>Ausbildung</strong> "Botschafter der Mittelrheinkirsche" <strong>Block</strong> 1: Mittelrheinkirschen und Sortenkunde<br />
Dr. Annette Braun-Lüllemann<br />
Geisepitter<br />
Ergebnisse der Erfassungen - Süßkirschen<br />
Beispiele bedeutsamer Sorten für die Region<br />
Im Mittelrheintal noch relativ häufig<br />
Als sehr beschränkt angebaute Regionalsorte<br />
als gefährdet einzustufen<br />
Verbreitungsschwerpunkt auf der rechten Rheinseite<br />
In der Region noch bekannte Sorte<br />
Nur mittelstarkes Wachstum (für kleinere Gärten)<br />
Robust, vital<br />
Sehr frühreifende, mittelgroße, lachend bunte Frucht<br />
Hoher Säureanteil<br />
Verwendungsmöglichkeiten:<br />
<br />
<br />
Kompott<br />
Konfitüre<br />
<strong>Ausbildung</strong> "Botschafter der Mittelrheinkirsche" <strong>Block</strong> 1: Mittelrheinkirschen und Sortenkunde<br />
Dr. Annette Braun-Lüllemann
Ergebnisse der Erfassungen - Süßkirschen<br />
Beispiele bedeutsamer Sorten für die Region<br />
Kesterter Schwarze<br />
Bereits seit Mitte des 19. Jahrhunderts bekannt<br />
Stark gefährdet (vier z. T. abgängige Bäume)<br />
<br />
Riesige, imposante Landschaftsbäume<br />
Robust, vital<br />
Sehr süße, stark aromatische Frucht<br />
(wurde früher zum Süßen verwendet)<br />
Vielfältige Verwendungsmöglichkeiten:<br />
Trocknen<br />
Konfitüre<br />
Brennzwecke, Einlegen in Alkohol<br />
Färbung<br />
Frischverzehr<br />
Landschaftsbaum<br />
<strong>Ausbildung</strong> "Botschafter der Mittelrheinkirsche" <strong>Block</strong> 1: Mittelrheinkirschen und Sortenkunde<br />
Ergebnisse der Erfassungen -<br />
Dr. Annette Braun-Lüllemann<br />
Anschauungsunterricht in Sachen Sortenentstehung<br />
Spontan entstandene neue Sorte in einer wilden Hecke<br />
Robuster, starkwachsender Baum<br />
(nach Dönissens Gelber Knorpel)<br />
Frucht mittelgroß, wohlschmeckend<br />
Druck- und platzempfindlich<br />
Verwendung:<br />
Frischverzehr<br />
Kuriosität<br />
<strong>Ausbildung</strong> "Botschafter der Mittelrheinkirsche" <strong>Block</strong> 1: Mittelrheinkirschen und Sortenkunde<br />
Dr. Annette Braun-Lüllemann
Ergebnisse<br />
152 Bäume verifiziert<br />
Ergebnisse der Erfassungen - Sauerkirschen<br />
10 Sorten<br />
9 alte pomologisch beschriebene Sorten<br />
1 moderne Sorte<br />
Potential:<br />
Vorstudie 13 pom. Sortennamen (incl. 2 neue Sorten)<br />
Davon 6 Sorten aufgefunden<br />
4 pomol. Sorte zusätzlich aufgefunden<br />
Gefährdung:<br />
60 % der Sorten sind gefährdet<br />
2 Sorten stark gefährdet<br />
0%<br />
20%<br />
40% 1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
40%<br />
Gefährdungsgrad<br />
<strong>Ausbildung</strong> "Botschafter der Mittelrheinkirsche" <strong>Block</strong> 1: Mittelrheinkirschen und Sortenkunde<br />
Dr. Annette Braun-Lüllemann<br />
Ergebnisse der Erfassungen - Sauerkirschen<br />
Die aufgefundenen Sorten<br />
1. Amarellen (hellfrüchtige Sauerkirschen)<br />
Diemitzer Amarelle/Ludwigs Frühe<br />
Im Mittelrheintal noch stark verbreitet<br />
Gesund und robust, nicht anfällig für Monilia<br />
Klein-mittelgroße, helle Frucht<br />
Extrem lange Reifeperiode, 3.-8. Kw<br />
Sehr gute Verarbeitungsfrucht mit eigenem Aroma<br />
2. Weichseln (dunkelfrüchtige Sauerkirschen)<br />
Minister von Podbielski<br />
Verbesserter Typ der Ostheimer Weichsel<br />
Nur 1 Baum im Mittelrheintal aufgefunden,<br />
deutschlandweit selten vorkommend<br />
Wuchs mittelstark<br />
weniger anfällig für Monilia als Schattenm.<br />
Reife mittelfrüh<br />
Große Früchte mit hervorragendem Aroma,<br />
leichter Bittermandelton<br />
Im Ertrag etwas schwankend<br />
<strong>Ausbildung</strong> "Botschafter der Mittelrheinkirsche" <strong>Block</strong> 1: Mittelrheinkirschen und Sortenkunde<br />
Dr. Annette Braun-Lüllemann
Ergebnisse der Erfassungen - Bastardkirschen<br />
Geschmackvolle Raritäten <br />
Stehen in ihren Eigenschaften zwischen Süß- und Sauerkirschen:<br />
Baumwuchs meist stark, süßkirschartig<br />
Triebe und Blätter sauerkirschartig<br />
Fruchtfleisch sauerkirschartig weich, mit ausgewogenem Verhältnis<br />
von kräftiger Säure bei viel Süße<br />
Galten früher als die Königinnen der Kirschen<br />
Heute fast vollständig verschwunden, wegen<br />
Transportempfindlichkeit nicht mehr im Anbau<br />
<strong>Ausbildung</strong> "Botschafter der Mittelrheinkirsche" <strong>Block</strong> 1: Mittelrheinkirschen und Sortenkunde<br />
Dr. Annette Braun-Lüllemann<br />
Ergebnisse<br />
Ergebnisse der Erfassungen - Bastardkirschen<br />
Geschmackvolle Raritäten <br />
7 Bäume verifiziert<br />
4 Sorten<br />
2 alte pomologisch beschriebene Sorten<br />
2 bisher nicht zuordenbare Sorte<br />
(Arbeitstitel)<br />
Potential:<br />
Vorstudie 5 Sortennamen<br />
Davon 2 Sorten aufgefunden<br />
Gefährdung<br />
alle Sorten vom Aussterben bedroht!<br />
<strong>Ausbildung</strong> "Botschafter der Mittelrheinkirsche" <strong>Block</strong> 1: Mittelrheinkirschen und Sortenkunde<br />
Dr. Annette Braun-Lüllemann
Ergebnisse der Erfassungen - Bastardkirschen<br />
Die aufgefundenen Sorten<br />
Schöne von Chatenay<br />
Früher im Mittelrheintal viel angebaut<br />
Bisher nur drei Baumruinen in Filsen aufgefunden<br />
Extrem späte Reife, letzte Kirschsorte, sehr folgernd<br />
Sehr gutes Aroma<br />
Spanische Glaskirsche<br />
Nur ein Baum in Reitzenhain bekannt<br />
Mittelfrühe Reife<br />
Relativ große Frucht, wohlschmeckend<br />
Filsener <br />
Nur ein Baum in Filsen aufgefunden<br />
Sehr frühreifend (ab 2. Kw.)<br />
Sehr ertragreich, wohlschmeckend<br />
<br />
Nur ein uralter Baum in Lahnstein bekannt<br />
Mittelfrüh reifend<br />
Sehr ertragreich, wohlschmeckend<br />
<strong>Ausbildung</strong> "Botschafter der Mittelrheinkirsche" <strong>Block</strong> 1: Mittelrheinkirschen und Sortenkunde<br />
Dr. Annette Braun-Lüllemann<br />
Ergebnisse der Erfassungen - Pflaumen<br />
Ergebnisse<br />
280 Bäume verifiziert<br />
40 Sorten<br />
24 alte pomologisch beschriebene Sorten<br />
4 moderne Sorten<br />
9 bisher nicht zuordenbare Sorte<br />
(Arbeitstitel)<br />
3 Unterlagen/Sämlinge<br />
Potential:<br />
Vorstudie 38 Sortennamen (alte Sorten)<br />
<br />
<br />
Davon 19 Sorten aufgefunden<br />
Zusätzl. 5 bisher für das Mittelrheintal nicht<br />
aufgeführte pomol. Sorten aufgefunden<br />
Gefährdung:<br />
9 Sorten v. Aussterben bedroht<br />
4 Sorten stark gefährdet<br />
6 Sorten gefährdet<br />
51%<br />
23%<br />
16%<br />
10%<br />
Gefährdungsgrad<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
<strong>Ausbildung</strong> "Botschafter der Mittelrheinkirsche" <strong>Block</strong> 1: Mittelrheinkirschen und Sortenkunde<br />
Dr. Annette Braun-Lüllemann
Ergebnisse der Erfassungen - Pflaumen<br />
Beispiele bedeutsamer Sorten für die Region<br />
1. Pomologische Sorte<br />
Fischers Frühe<br />
Von der Baumschule Fischer, Mühlheim-Kärlich verbr.<br />
Bisher nur im Sortengarten Osterspai aufgefunden<br />
Frühsorte, ähnlich Ersinger Frühzwetschge<br />
mittelgroße, blaue Frucht<br />
2. Landsorte<br />
Wagenstedter<br />
Vermutlich als Unterlage eingeführt, wurzelecht<br />
Starkwachsend, robust, auch für Hecken<br />
Mittelfrüh reifend<br />
Kleine, mirabellenartige Frucht<br />
Etwas mehlig, eventuell zum Brennen geeignet<br />
<strong>Ausbildung</strong> "Botschafter der Mittelrheinkirsche" <strong>Block</strong> 1: Mittelrheinkirschen und Sortenkunde<br />
Dr. Annette Braun-Lüllemann<br />
Ergebnisse der Erfassungen - Aprikosen<br />
Ergebnisse<br />
50 Bäume verifiziert (6 außerhalb Welterbe)<br />
12 Sorten (2 außerhalb Welterbe)<br />
5 alte pomologisch beschriebene Sorten<br />
2 moderne Sorten<br />
5 bisher nicht zuordenbare Sorte<br />
(Arbeitstitel)<br />
Potential:<br />
Vorstudie 17 Sortennamen /15 Sorten<br />
<br />
<br />
Davon 4-5 Sorten aufgefunden<br />
Zusätzl. 2 bisher für das Mittelrheintal nicht<br />
aufgeführte pomol. Sorten aufgefunden<br />
<strong>Ausbildung</strong> "Botschafter der Mittelrheinkirsche" <strong>Block</strong> 1: Mittelrheinkirschen und Sortenkunde<br />
Gefährdung:<br />
6 Sorten v. Aussterben bedroht<br />
25%<br />
1 Sorten stark gefährdet<br />
2 Sorten gefährdet<br />
17%<br />
8%<br />
Dr. Annette Braun-Lüllemann<br />
50%<br />
Gefährdungsgrad<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4
Kesterter Schafsnase (Ambrosia)<br />
Ergebnisse der Erfassungen - Aprikosen<br />
Beispiele bedeutsamer Sorten für die Region<br />
Regionaltypische Sorten<br />
Überregional vorkommend<br />
Traditionell am Mittelrhein bevorzugte Sorte<br />
Verlangt warme, trockene Lagen (anfällig für Schorf)<br />
reift mittelfrüh (Mitte Ende Juli)<br />
Geschmacklich gut, reift etwas ungleichhälftig<br />
-<br />
Traditionelle Mittelrheinsorte<br />
Identisch mit Kamper Späte?<br />
Verlangt warme, trockene Lagen (anfällig für Schorf)<br />
Spät reifend (Ende Juli bis Mitte August)<br />
Kleine, sehr aromatische Frucht<br />
Vermutlich für alle Verarbeitungen geeignet<br />
<strong>Ausbildung</strong> "Botschafter der Mittelrheinkirsche" <strong>Block</strong> 1: Mittelrheinkirschen und Sortenkunde<br />
Dr. Annette Braun-Lüllemann<br />
Ergebnisse der Erfassungen - Pfirsiche<br />
Ergebnisse<br />
Ca. 150 Bäume verifiziert<br />
19 Sorten (1 außerhalb Welterbe)<br />
7 alte pomologisch beschriebene Sorten<br />
2 moderne Sorten<br />
10 bisher nicht zuordenbare Sorte<br />
(Arbeitstitel)<br />
Potential:<br />
Vorstudie 27 Sorten<br />
<br />
<br />
Davon 4 Sorten aufgefunden<br />
Zusätzl. 3 bisher für das Mittelrheintal nicht<br />
aufgeführte pomol. Sorten aufgefunden<br />
Gefährdung:<br />
11 Sorten v. Aussterben bedroht<br />
1 Sorten gefährdet<br />
Gefährdungsgrad<br />
37%<br />
1<br />
5%<br />
58%<br />
2<br />
3<br />
4<br />
<strong>Ausbildung</strong> "Botschafter der Mittelrheinkirsche" <strong>Block</strong> 1: Mittelrheinkirschen und Sortenkunde<br />
Dr. Annette Braun-Lüllemann
Ergebnisse der Erfassungen - Pfirsiche<br />
Beispiele bedeutsamer Sorten für die Region<br />
1. Regionaltypische Sorten<br />
Roter Weinbergspfirsich<br />
Zunehmende Verbreitung, in Plantagen angebaut<br />
Robust, wenig beeinträchtigt d. Kräuselkrankh.<br />
Traditionelle Sorte auch am Mittelrhein<br />
Aktuell zwei Sorten angebaut (früh- und spätreifend)<br />
Frühr. Sorte (M - E August), Spätr. Sorte (bis E September)<br />
Kleine, rotfleischige, aromatische, leicht herbe Frucht<br />
Vermutlich für alle Verarbeitungen geeignet<br />
2. Seltene pomologische Sorten<br />
Früher Roter Ingelheimer<br />
Rheinhessischen Ursprungs<br />
Robuste Sorte, benötigt ausreichend Nährstoffe<br />
Frühreifend (Anfang Juli)<br />
Sehr ertragreich, weißfleischig, wenig steinlöslich<br />
Zur Verwertung geeignet<br />
<strong>Ausbildung</strong> "Botschafter der Mittelrheinkirsche" <strong>Block</strong> 1: Mittelrheinkirschen und Sortenkunde<br />
Dr. Annette Braun-Lüllemann<br />
Bewertung des Steinobstpotentials im Oberen Mittelrheintal<br />
1. Große Vielfalt hinsichtlich<br />
des Artenspektrums (auch wärmeliebende Arten Aprikosen und Pfirsiche)<br />
<br />
der Sortenanzahl bei allen Arten<br />
2. Besondere Wertigkeit bezüglich der großen Zahl von Lokal- /Regionalsorten<br />
an die klimatischen und standörtlichen Verhältnisse besonders angepasst, i.d.R. robust<br />
<br />
<br />
<br />
durch beschränkte Verbreitung besonders gefährdet<br />
einzigartiges Kulturgut, besondere Verantwortung der Region für die Sorten<br />
meist sehr gute Geschmacksqualitäten<br />
3. Ein wertvolles Potential<br />
für zukünftige Nutzungen (Früchte, Fruchtprodukte<br />
sowie landschaftspflegerischer Einsatz)<br />
<br />
Genpool für neue Züchtungen<br />
<strong>Ausbildung</strong> "Botschafter der Mittelrheinkirsche" <strong>Block</strong> 1: Mittelrheinkirschen und Sortenkunde<br />
Dr. Annette Braun-Lüllemann
Sortensicherung<br />
Entwicklung eines Anzuchtmanagements<br />
Sicherung der Sortenechtheit hat höchste Priorität!<br />
Lückenlose Kennzeichnung der Sorte<br />
vom Edelreis bis zum fertigen Baum<br />
Auswahl von auf die Anzucht von alten<br />
Sorten spezialisierten Baumschulen<br />
Sortensicherung durch<br />
Anlage von Sicherungsgärten<br />
Anlage von zwei Erlebnispfaden (Filsen, Braubach)<br />
Integration in Neupflanzungen (Ausgleichsmaßn.<br />
<br />
Einführung ausgewählter Sorten in Baumschulen<br />
Weitergabe von 14 Mittelrheinsorten a. d. RMG Bonn<br />
<strong>Ausbildung</strong> "Botschafter der Mittelrheinkirsche" <strong>Block</strong> 1: Mittelrheinkirschen und Sortenkunde<br />
Dr. Annette Braun-Lüllemann
<strong>Ausbildung</strong> "Botschafter der Mittelrheinkirsche"<br />
<strong>Block</strong> 1: Mittelrheinkirschen und Sortenkunde<br />
Einführung in die pomologische Bestimmung von Kirschsorten<br />
Sortenkundliche Merkmale: Übersicht<br />
Frucht, Reifezeit<br />
Fruchtstein<br />
Baum<br />
Blüte, Blütenzeitpunkt<br />
Blätter (in Einzelfällen)<br />
Veredlungswulst (in Einzelfällen)<br />
<strong>Ausbildung</strong> "Botschafter der Mittelrheinkirsche" <strong>Block</strong> 1: Mittelrheinkirschen und Sortenkunde<br />
Dr. Annette Braun-Lüllemann
Sortenkundliche Merkmale: Reifezeit<br />
Was sind "Kirschwochen"?<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Angabe in Kirschwochen, die die relative Reifezeit der Sorten untereinander<br />
bezeichnen (Süßkirschen reifen in ca. 6 - 8 Kirschwochen)<br />
Kirschwoche beginnt bei Reife der Sorte "Früheste der Mark"<br />
Genauer Zeitpunkt der 1. Kirschwoche anhängig von der jeweiligen Witterung und<br />
der geographischen Lage (am Mittelrhein Beginn der 1. Kw i. d. R. vom 8.15. Mai)<br />
Eine Kirschwoche dauert i.d.R. eine Kalenderwoche, kann aber bei heißer<br />
Witterung auch kürzer, bei kalter länger andauern<br />
Sortenkundliche Merkmale: Reifezeit<br />
Reifezeiten der Mittelrhein-Süßkirschen in Kirschwochen (Kw.)<br />
Süßkirschen<br />
Bernhard Nette<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kw.<br />
Bopparder Krächer<br />
Dönissens Gelbe Knorpel<br />
"Filsener Frühkirsche"-AT R<br />
Filsener Goldperle R<br />
Früheste der Mark<br />
Geisepitter<br />
Geldlose R<br />
Hängige<br />
Heidelberger R<br />
Höppches R<br />
Jaboulay<br />
Kaiserkirsche<br />
Kassins Frühe<br />
Kaiserkirsche<br />
Kesterter Schwarze R<br />
Lahnsteiner (syn. Cob. Maiherz Typ S.-K.)<br />
Landele<br />
Lorenzkirsche R<br />
Maibigarreau<br />
Perle von Filsen R<br />
"Porzellankirsche"-AT R<br />
Rivers Frühe<br />
Rote Leberkirsche R<br />
Rotters Braune Riesen R<br />
Simonis<br />
Souvenir de Charmes<br />
Spanische<br />
Tilgeners Rote Herzkirsche R<br />
Wils Frühe R<br />
Zenglers R<br />
<strong>Ausbildung</strong> "Botschafter der Mittelrheinkirsche" <strong>Block</strong> 1: Mittelrheinkirschen und Sortenkunde<br />
Dr. Annette Braun-Lüllemann
Sortenkundliche Merkmale: Reifezeit<br />
Reifezeiten der Mittelrhein-Sauerkirschen in Kirschwochen (Kw.)<br />
Sauerkirschen<br />
Diemitzer Amarelle (syn. Ludwigs Frühe)<br />
"Filsener Sauerkirsche"<br />
Königliche Amarelle<br />
Koröser Weichsel<br />
Minister von Podbielski R<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kw.<br />
Bastardkirschen<br />
"Filsener Glaskirsche" R<br />
"Lahnsteiner Süßweichsel" R<br />
Spanische Glaskirsche R<br />
Schöne von Chatenay R<br />
Legende:<br />
Schrift: Grün: Regionalsorte, R: Rarität<br />
Fruchtfarben:<br />
Süßkirschen<br />
Sauerkirschen/Bastardkirschen<br />
gelb rotgelb dunkel Amarelle/Glaskirsche Weichsel/Süßweichsel<br />
<strong>Ausbildung</strong> "Botschafter der Mittelrheinkirsche" <strong>Block</strong> 1: Mittelrheinkirschen und Sortenkunde<br />
Dr. Annette Braun-Lüllemann<br />
Sortenkundliche Merkmale: Frucht<br />
Fruchtmerkmale:<br />
Differenzierung nach Größe, Farbe, Form, Relief, Stiel, Fleischbeschaffenheit<br />
<strong>Ausbildung</strong> "Botschafter der Mittelrheinkirsche" <strong>Block</strong> 1: Mittelrheinkirschen und Sortenkunde<br />
Dr. Annette Braun-Lüllemann
Sortenkundliche Merkmale: Frucht<br />
Definition Fruchtansichten:<br />
Vorderansicht<br />
Seitenansicht<br />
Länge<br />
Länge<br />
Breite<br />
Tiefe<br />
<strong>Ausbildung</strong> "Botschafter der Mittelrheinkirsche" <strong>Block</strong> 1: Mittelrheinkirschen und Sortenkunde<br />
Dr. Annette Braun-Lüllemann<br />
Sortenkundliche Merkmale: Frucht<br />
Fruchtgröße:<br />
Geldlose / "Valentinsche"<br />
Schneiders Späte Knorpel<br />
<strong>Ausbildung</strong> "Botschafter der Mittelrheinkirsche" <strong>Block</strong> 1: Mittelrheinkirschen und Sortenkunde<br />
Dr. Annette Braun-Lüllemann
Rotbunte Färbung<br />
Sortenkundliche Merkmale: Frucht<br />
Färbung:<br />
Kunzes Maibigarreau Große Prinzessin Große Prinzessin<br />
gestrichelt marmoriert umhöfte Punkte Farbübergang<br />
Dunkle Färbung<br />
Lapins "Rainbow Stripes" "Späte Harte"-AT Rotterts Braune Riesen Souvenir de Charmes<br />
gestreift dunkelrot braunrot schwarz<br />
<strong>Ausbildung</strong> "Botschafter der Mittelrheinkirsche" <strong>Block</strong> 1: Mittelrheinkirschen und Sortenkunde<br />
Dr. Annette Braun-Lüllemann<br />
Sortenkundliche Merkmale: : Frucht<br />
Fruchtform - Vorderansicht<br />
Knauffs Schwarze Hedelfinger Merton Premier Elton<br />
rund oval konisch länglich zugespitzt<br />
Große Prinzessin Tilgeners Rote Herz Grolls Schwarze Van<br />
stumpf-herzförmig spitz-herzfömig breitrund nierenförmig<br />
<strong>Ausbildung</strong> "Botschafter der Mittelrheinkirsche" <strong>Block</strong> 1: Mittelrheinkirschen und Sortenkunde<br />
Dr. Annette Braun-Lüllemann
Sortenkundliche Merkmale: Frucht<br />
Fruchtform - Seitenansicht<br />
.<br />
Große Prinzessin<br />
schmal<br />
Büttners Rote Knorpel<br />
Merton Premier<br />
Kronprinz von Hannover<br />
"Porzellankirsche"-AT<br />
"Früheste der Mark-Ähnliche"-AT<br />
breit<br />
konisch-stielbauchig<br />
mittelbauchig<br />
Stielseite zur<br />
Bauchseite abfallend<br />
Stielseite zur<br />
Rückenseite abfallend<br />
<strong>Ausbildung</strong> "Botschafter der Mittelrheinkirsche" <strong>Block</strong> 1: Mittelrheinkirschen und Sortenkunde<br />
Dr. Annette Braun-Lüllemann<br />
Sortenkundliche Merkmale: Frucht<br />
Fruchtrelief<br />
.<br />
Werdersche Braune<br />
Große Schwarze Knorpel<br />
beulig<br />
ebenmäßig<br />
<strong>Ausbildung</strong> "Botschafter der Mittelrheinkirsche" <strong>Block</strong> 1: Mittelrheinkirschen und Sortenkunde<br />
Dr. Annette Braun-Lüllemann
Sortenkundliche Merkmale: Frucht<br />
Form Stielseite<br />
Kassins Frühe Knauffs Schw. Schmahlfels Schw. Annabella<br />
Vorderansicht:<br />
.<br />
hochgezogene<br />
Schultern<br />
flache<br />
Schultern<br />
eingekerbt<br />
Nasenansatz<br />
Grolls Schw.<br />
Knauffs Schw.<br />
Stielansicht:<br />
Stielgrube<br />
weit und tief<br />
eng und flach<br />
<strong>Ausbildung</strong> "Botschafter der Mittelrheinkirsche" <strong>Block</strong> 1: Mittelrheinkirschen und Sortenkunde<br />
Dr. Annette Braun-Lüllemann<br />
Sortenkundliche Merkmale: Frucht<br />
Relief Bauchseite<br />
Landele Schneiders Werdersche Br. Kronprinz v. Hann.<br />
Furche flaches Band Nahtwulst Spiegel<br />
<strong>Ausbildung</strong> "Botschafter der Mittelrheinkirsche" <strong>Block</strong> 1: Mittelrheinkirschen und Sortenkunde<br />
Dr. Annette Braun-Lüllemann
Sortenkundliche Merkmale: Frucht<br />
Ausprägungen Stempelseite<br />
Kronprinz v. Hann. Große Prinzessin Annabella Burlat<br />
Vorderansicht:<br />
mit Spitzchen abgerundet abgeplattet eingezogen<br />
Große Schw. Kn.<br />
Schneiders<br />
Stempelansicht:<br />
Stempelpunkt: groß klein<br />
<strong>Ausbildung</strong> "Botschafter der Mittelrheinkirsche" <strong>Block</strong> 1: Mittelrheinkirschen und Sortenkunde<br />
Dr. Annette Braun-Lüllemann<br />
Sortenkundliche Merkmale: Frucht<br />
Fruchtstiel<br />
<br />
Länge<br />
<br />
Dicke<br />
<br />
Farbe<br />
<br />
Größe und Farbe fruchtseitiger Stielansatz<br />
"Breyer Läng."<br />
<br />
Fruchtansatzwinkel<br />
Große Braune<br />
Grolls Schwarze<br />
"Breyer Längliche"-AT<br />
Kassins Frühe<br />
Coburger Maiherz Typ Sahlis-Kohren<br />
Fruchtseitiger Stielansatz:<br />
klein/rot groß/grün<br />
Länge/Farbe:<br />
kurz/grün mittellang/rot lang/grün<br />
Frucht<br />
hängt schief<br />
<strong>Ausbildung</strong> "Botschafter der Mittelrheinkirsche" <strong>Block</strong> 1: Mittelrheinkirschen und Sortenkunde<br />
Dr. Annette Braun-Lüllemann
Sortenkundliche Merkmale: Frucht<br />
Fruchtfleisch<br />
Fleischtextur:<br />
weich Herzkirschen hart (knorpelig) Knorpelkirschen<br />
Fleischfarbe:<br />
Saftfarbe:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
gelblich<br />
rosa<br />
dunkelrot/schwarz<br />
nicht färbend<br />
färbend<br />
Geschmack:<br />
säuerlich süß<br />
fade aromatisch<br />
besonderes Gewürz<br />
Bitterton<br />
abhängig von Reifezustand, Witterung, Standort/Region<br />
Haut: dünn dick (zäh)<br />
Platzfestigkeit: platzanfällig platzfest<br />
<strong>Ausbildung</strong> "Botschafter der Mittelrheinkirsche" <strong>Block</strong> 1: Mittelrheinkirschen und Sortenkunde<br />
Dr. Annette Braun-Lüllemann<br />
Sortenkundliche Merkmale: Fruchtstein<br />
Definitionen der Begrifflichkeiten<br />
Seitenansicht<br />
Vorderansicht<br />
Häkchen<br />
Seitenfalte<br />
Mittelkamm<br />
Länge<br />
Mittelkamm<br />
Bauchwulst<br />
Tiefe<br />
Breite<br />
<strong>Ausbildung</strong> "Botschafter der Mittelrheinkirsche" <strong>Block</strong> 1: Mittelrheinkirschen und Sortenkunde<br />
Dr. Annette Braun-Lüllemann
Sortenkundliche Merkmale: Fruchtstein<br />
Fruchtstein-Variationen<br />
Variationen bei zwei<br />
verschiedenen Sorten:<br />
Hedelfinger<br />
Grolls Schwarze<br />
Variationen innerhalb<br />
einer Sorte (Badeborner)<br />
in zwei verschiedenen<br />
Jahren:<br />
2008 2005 2008 2005<br />
<strong>Ausbildung</strong> "Botschafter der Mittelrheinkirsche" <strong>Block</strong> 1: Mittelrheinkirschen und Sortenkunde<br />
Dr. Annette Braun-Lüllemann<br />
Sortenkundliche Merkmale: Fruchtstein<br />
Vergleich Fruchtsteine bei Verwechslersorten<br />
Elton<br />
Elton-Verwechsler: "Porzellankirsche"-AT<br />
<strong>Ausbildung</strong> "Botschafter der Mittelrheinkirsche" <strong>Block</strong> 1: Mittelrheinkirschen und Sortenkunde<br />
Dr. Annette Braun-Lüllemann
Sortenkundliche Merkmale: Fruchtstein<br />
Fruchtstein: Vorderansicht und Bauchwulst<br />
Verschiedenene<br />
Steinformen in<br />
der Vorderansicht<br />
Coburger Maiherz Steinknorpel Landele Büttners<br />
oval rund stielbauchig mittelbauchig<br />
Verschiedene<br />
Ausprägungen<br />
Bauchwulst<br />
Schubacks Büttners Coburger Maiherz "Porzellankirsche" Dönissens Grolls Schwarze<br />
parallel-linig oval sackförmig parallel-linig oval sackförmig<br />
Relief flach<br />
Relief scharfkantig<br />
<strong>Ausbildung</strong> "Botschafter der Mittelrheinkirsche" <strong>Block</strong> 1: Mittelrheinkirschen und Sortenkunde<br />
Dr. Annette Braun-Lüllemann<br />
Sortenkundliche Merkmale: Fruchtstein<br />
Fruchtstein: Seitenansicht<br />
oval<br />
(mit ausgeprägtem Häkchen)<br />
Große Schwarze Knorpel<br />
rund<br />
Garrns Bunte<br />
länglich<br />
"Porzellankirsche"-AT<br />
umgekehrt eiförmig<br />
(stempelseitig zugespitzt)<br />
Badeborner Schwarze Knorpel<br />
oval mit abfallendem Rücken<br />
Burlat<br />
zur Bauchseite schief verzogen<br />
Rives Frühe<br />
<strong>Ausbildung</strong> "Botschafter der Mittelrheinkirsche" <strong>Block</strong> 1: Mittelrheinkirschen und Sortenkunde<br />
Dr. Annette Braun-Lüllemann
Sortenkundliche Merkmale: Baum<br />
Kronenform<br />
kugelig ('Büttners Rote Knorpel') hochkugelig ('Schneiders Späte Kn.) trichterförmig ('Kassins Frühe')<br />
Kronenform<br />
Verzweigungswinkel Leitäste:<br />
schirmartig ('Coburger Maiherz Typ S.-K.')<br />
V-förmig<br />
('Schubacks Frühe Schwarze' )<br />
Steile Leitäste, waager.<br />
Seitenholz ('Teickners')<br />
Sortenkundliche Merkmale: Baum<br />
Verzweigung Fruchtholz<br />
steil aufrecht Weiße Spanische<br />
Besondere Wuchsformen<br />
hängend Spanische-Mittelrhein<br />
Leitastquirl Büttners Rote Knorpel<br />
Astfahnen Große Schwarze Knorpel
Sortenkundliche Merkmale: Baum<br />
Selten, aber auch<br />
möglich: verschiedene<br />
Wuchsformen bei einer<br />
Sorte<br />
Knauffs Schwarze<br />
Knauffs Schwarze<br />
Radikale<br />
Schnittmaßnahmen:<br />
keine Beurteilung<br />
des Baumwuchses<br />
möglich<br />
Typische<br />
Wuchs schon<br />
beim<br />
Jungbaum:<br />
hier Astfahnen<br />
Von Bremens Saure<br />
Große Schwarze Knorpel<br />
<strong>Ausbildung</strong> "Botschafter der Mittelrheinkirsche" <strong>Block</strong> 1: Mittelrheinkirschen und Sortenkunde<br />
Dr. Annette Braun-Lüllemann<br />
Sortenkundliche Merkmale: Laub<br />
Nur bei wenigen Sorten sortentypisches Laub:<br />
länglich-pfirsichartig rote Blattstiele u. Mittelnerv dachziegelartig übereinander<br />
Lucien Elton Kunzes<br />
<strong>Ausbildung</strong> Veredlungsstelle: Sortentypisch, aber auch von Unterlage abhängig<br />
Büttners Rote Knorpel Souvenir d. Charmes Burlat auf P. avium Burlat auf P. mahaleb<br />
<strong>Ausbildung</strong> "Botschafter der Mittelrheinkirsche" <strong>Block</strong> 1: Mittelrheinkirschen und Sortenkunde<br />
Dr. Annette Braun-Lüllemann
Sortenkundliche Merkmale: Blüte<br />
Blütezeitpunkt:<br />
<br />
wichtiges Merkmal, oft<br />
hilfreich bei der<br />
Differenzierung<br />
ansonsten schwer zu<br />
unterscheidender Sorten<br />
Knauffs Schwarze Schubacks F. Schw. Knauffs Teickners<br />
Blütenmerkmale:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Größe<br />
Menge u. Farbe d. Blattaustriebes<br />
bei beginnenderBlüte<br />
Relief der Blütenblätter<br />
Abständigkeit der<br />
Blütenblätter<br />
Blütenblätter: Rundlich - sich berührend oval - leicht abständig länglich - abständig<br />
Fromms Herzk. Sahliser Marmorkirsche Haumüller Mitteldicke<br />
<strong>Ausbildung</strong> "Botschafter der Mittelrheinkirsche" <strong>Block</strong> 1: Mittelrheinkirschen und Sortenkunde<br />
Dr. Annette Braun-Lüllemann<br />
Sortenkundliche Merkmale: Blüte<br />
Jaboulay<br />
Blüte groß, Blütenblätter glatt<br />
Lucien<br />
Blüte klein, Blütenblätter wellig<br />
Schubacks Frühe Schwarze<br />
Blüte mit viel (rötl.) Blattaustrieb<br />
Teickners Schwarze Herz<br />
Blüte mit wenige Blattaustrieb<br />
<strong>Ausbildung</strong> "Botschafter der Mittelrheinkirsche" <strong>Block</strong> 1: Mittelrheinkirschen und Sortenkunde<br />
Dr. Annette Braun-Lüllemann
Referenzmaterial<br />
Fruchtproben von Referenzstandorten (Sortenpflanzungen)<br />
Fruchtsteinproben aus historischen Fruchtsteinsammlungen<br />
(Bundessortenamt Marquardt, Obstinstitute Geisenheim, Hohenheim,<br />
Privatsammlung Gartenbauinspektor D. Dähne)<br />
Historische Literatur<br />
<strong>Ausbildung</strong> "Botschafter der Mittelrheinkirsche" <strong>Block</strong> 1: Mittelrheinkirschen und Sortenkunde<br />
Dr. Annette Braun-Lüllemann<br />
Mittelrheinsorten Übersicht in den Empfehlungslisten<br />
<strong>Ausbildung</strong> "Botschafter der Mittelrheinkirsche" <strong>Block</strong> 1: Mittelrheinkirschen und Sortenkunde<br />
Dr. Annette Braun-Lüllemann
Sortenempfehlung Mittelrheinkirschen<br />
Süßkirschen<br />
39 von 82 Sorten<br />
Stand 2012<br />
Bernard Nette<br />
Bopparder Krächer<br />
Dönissens<br />
Gelbe Knorpel<br />
"Filsener<br />
Früh-<br />
kirsche"-AT<br />
Früheste der Mark<br />
Filsener Goldperle<br />
Geisepitter<br />
Geldlose<br />
Hängige<br />
Heidelberger<br />
Höppches<br />
Jaboulay Kaiserkirsche Kassins Frühe Kesterter Schwarze<br />
Lahnsteiner Landele Lorenzkirsche Maibigarreau Perle von Filsen<br />
„Porzellankirsche“ AT Rivers Frühe Rote Leberkirsche Rotters Braune Riesen Simonis<br />
Souvenir<br />
de Charmes<br />
Spanische<br />
Tilgeners Rote<br />
Herzkirsche Wils Frühe Zenglers<br />
Sauerkirschen<br />
Diemitzer Amarelle<br />
„Filsener<br />
Sauerkirsche“<br />
Königliche Amarelle Koröser Weichsel<br />
Minister<br />
von Podbielski<br />
Bastardkirschen<br />
Regionalsorte<br />
Rarität<br />
„Filsener<br />
Glaskirsche“<br />
„Lahnsteiner<br />
Süssweichsel“<br />
Spanische<br />
Glaskirsche<br />
Schöne von<br />
Chatenay
Sortenempfehlungen aus den Ergebnissen des Projektes Mittelrheinkirschen<br />
für die Region des Oberen Mittelrheintales Stand Frühjahr 2011<br />
Süßkirschen<br />
Sortenname Herkunft/Verbreitung Baumeigenschaften<br />
Bernhard Nette<br />
2.-3. Kw.<br />
Bopparder<br />
Krächer<br />
(Helle Knorpel)<br />
5.-6. Kw.<br />
Regionalsorte<br />
Anfang des 20. Jahrhunderts<br />
im Saalkreis<br />
aufgefundene Sorte, am<br />
Mittelrhein nur vereinzelt<br />
vorkommend; zu ihrer<br />
Reifezeit eine der<br />
festfleischigsten Sorten<br />
Traditionelle Sorte des<br />
Mittelrheintals,<br />
insbesondere um<br />
Boppard, aber auch auf<br />
der rechten Rheinseite<br />
verbreitet<br />
Mittelstark bis<br />
starkwachsend,<br />
bildet kugelige bis<br />
hochkugelige<br />
Kronen<br />
Mittelstark bis<br />
starkwachsend,<br />
bildet kugelige bis<br />
hochkugelige<br />
Kronen<br />
Fruchteigenschaften Verwendung/<br />
Anbaueignung<br />
Große, dunkelrote Frucht<br />
mit etwas unregelmäßiger<br />
Oberfläche; Fruchtfleisch<br />
sehr aromatisch und für<br />
eine Frühsorte recht<br />
festfleischig<br />
Rotbunte, mittelgroße bis<br />
große und spätreifende<br />
Knorpelkirsche mit<br />
aromatischem, knackigem<br />
Fruchtfleisch<br />
Vorwiegend für den<br />
Frischgenuss<br />
Zum Frischgenuss<br />
wie zum Einkochen<br />
geeignet<br />
Dönissens<br />
Gelbe Knorpel<br />
6. Kw.<br />
Die bekannteste unter<br />
den rein gelben Kirschsorten,<br />
im Mittelrheintal<br />
nur vereinzelt anzutreffen;<br />
wird weniger von<br />
Vögeln gefressen als die<br />
roten und dunklen Sorten<br />
Wuchs stark, im<br />
Außenbereich der<br />
Krone leicht<br />
hängend, bildet<br />
rundkugelige<br />
Krone, gute<br />
Baumgesundheit<br />
Früchte rein gelb, reif leicht<br />
bernsteinfarbig, mittelgroß,<br />
mit knackigem<br />
Fruchtfleisch; muss vollreif<br />
geerntet werden,<br />
Geschmack dann<br />
honigsüss und aromatisch<br />
Für Frischgenuss<br />
und zur<br />
Konservierung<br />
geeignet<br />
"Filsener Frühkirsche"-AT<br />
Rarität<br />
1 (-2.). Kw.<br />
Regionalsorte<br />
Diese Sorte, wurde nur in<br />
Filsen gefunden und<br />
konnte bisher nicht<br />
identifiziert werden. Es<br />
handelt sich ev. um eine<br />
der bisher verschollenen<br />
Regionalsorten.<br />
Mittelstarker<br />
Wuchs, eher kleine<br />
Bäume bildend,<br />
rundliche,<br />
ausgeglichene<br />
Krone<br />
Schwarze, klein bis<br />
mittelgroße, weichfleischige<br />
Frucht, ähnlich der<br />
Frühesten der Mark, recht<br />
guter Geschmack, sehr<br />
ertragreich<br />
Früheste der<br />
Mark<br />
1. (-2.) Kw.<br />
Berühmte Frühsorte, die<br />
seit langer Zeit im<br />
Mittelrheintal angebaut<br />
wird und deren Reife den<br />
Beginn der Kirschzeit<br />
einläutet<br />
Wuchs mittelstark,<br />
etwas empfindlich<br />
gegen<br />
Spitzendürre, nicht<br />
für kalte Lagen<br />
Früchte dunkel, klein bis<br />
mittelgroß und<br />
weichfleischig, Geschmack<br />
erst nach längeren Reifen<br />
am Baum wirklich gut<br />
Vorwiegend für den<br />
Frischgenuss<br />
FS LS VS MT LB<br />
X X<br />
X X<br />
X X X<br />
X X X<br />
X X X<br />
1
Sortenempfehlungen aus den Ergebnissen des Projektes Mittelrheinkirschen<br />
für die Region des Oberen Mittelrheintales Stand Frühjahr 2011<br />
Süßkirschen<br />
Sortenname Herkunft/Verbreitung Baumeigenschaften<br />
Filsener<br />
Goldperle<br />
Rarität<br />
7.-8. Kw.<br />
Geisepitter<br />
(Bornhofener,<br />
Kamper Rote)<br />
1.-2. Kw.<br />
Regionalsorte<br />
Neu entstandene Sorte<br />
aus Filsen mit rein gelber<br />
Farbe und sehr später<br />
Reifezeit<br />
Alte Frühsorte aus Kamp-<br />
Bornhofen, benannt nach<br />
ihrem Entdecker Peter<br />
Geis, im Mittelrheintal<br />
einst stark verbreitet<br />
Wuchs stark,<br />
hochstrebend,<br />
vermutlich gute<br />
Baumgesundheit<br />
Wuchs meist nur<br />
mittelstark,<br />
pyramidale Krone,<br />
gute<br />
Baumgesundheit<br />
Fruchteigenschaften Verwendung/<br />
Anbaueignung<br />
Hellgelbe, festfleischige,<br />
kleine bis mittelgroße<br />
Früchte mit gutem Aroma,<br />
sehr ertragreiche Sorte,<br />
eine der am spätesten<br />
reifenden Kirschen am<br />
Mittelrhein<br />
Rotbunte, mittelgroße,<br />
frühreifende Sorte mit<br />
weichem Fruchtfleisch und<br />
säuerlichem Aroma, sehr<br />
ertragreich<br />
Für Frischgenuss,<br />
Eignung zur<br />
Verarbeitung muss<br />
geprüft werden<br />
Traditionelle<br />
Einkochkirsche,<br />
auch für<br />
Frischgenuss<br />
Geldlose<br />
Rarität<br />
1. (-2.) Kw.<br />
Alte Sorte mit regionalem<br />
Namen, bisher nur ein<br />
Baum im Streuobst auf<br />
der linken Rheinseite<br />
aufgefunden<br />
Wuchs stark, bildet<br />
hochkugelige<br />
Krone<br />
Braunrote, kleine<br />
Frühkirsche mit weichem<br />
Fruchtfleisch, Geschmack<br />
für Frühkirsche gut<br />
Vorwiegend für den<br />
Frischgenuss<br />
Hängige<br />
(Hängische)<br />
4.-5. Kw.<br />
Regionalsorte<br />
Im gesamten Oberen<br />
Mittelrheintal verbreitete<br />
Spätkirsche,<br />
regelmäßiger<br />
Massenträger<br />
Starkwachsende<br />
Bäume, mit stark<br />
hängendem<br />
Wuchs, gut als<br />
<br />
geeignet<br />
Dunkelbraune, mittelgroße<br />
bis große Knorpelkirsche<br />
mit aromatischen,<br />
knackigem Fruchtfleisch,<br />
ertragreiche Sorte<br />
Für Frischgenuss<br />
und zur<br />
Konservierung<br />
geeignet<br />
Heidelberger<br />
Rarität<br />
3.-4. Kw.<br />
Regionalsorte<br />
Ebenfalls alte Sorte der<br />
linken Rheinseite, die<br />
vermutlich auch in der<br />
Anbauregion nördlich von<br />
Koblenz einen Verbreitungsschwerpunkt<br />
hatte.<br />
Breitkroniger Baum<br />
mit sparrigem<br />
Wuchs<br />
Rotbunte, mittelgroße<br />
Frucht mit weichem,<br />
aromatischem Fruchtfleisch<br />
und langen Stielen<br />
Für Frischgenuss<br />
und zur<br />
Konservierung<br />
geeignet<br />
FS LS VS MT LB<br />
X X<br />
X X X<br />
X X X<br />
X X<br />
X<br />
2
Sortenempfehlungen aus den Ergebnissen des Projektes Mittelrheinkirschen<br />
für die Region des Oberen Mittelrheintales Stand Frühjahr 2011<br />
Süßkirschen<br />
Sortenname Herkunft/Verbreitung Baumeigenschaften<br />
Fruchteigenschaften Verwendung/<br />
Anbaueignung<br />
Höppches<br />
Rarität<br />
3.-4. Kw.<br />
Regionalsorte<br />
Alte Sorte der linken<br />
Rheinseite, vermutlich<br />
aus dem 19. Jahrhundert<br />
stammend. Bisher nur auf<br />
wenigen Bäumen wieder<br />
aufgefunden<br />
Starker, in die<br />
Breite strebender<br />
Wuchs, Baum<br />
wenig<br />
anspruchsvoll<br />
Rotbunte, mittelgroße<br />
Frucht mit weichem<br />
Fruchtfleisch, süß und sehr<br />
ertragreich<br />
Für Frischgenuss<br />
und zur<br />
Konservierung<br />
geeignet<br />
Jaboulay<br />
2.-3. Kw.<br />
Sorte französischen<br />
Ursprungs, die sich<br />
vermutlich von<br />
Rheinhessen ins<br />
Mittelrheintal verbreitet<br />
hat<br />
Starker, breit<br />
ausladender<br />
Wuchs, Fruchtholz<br />
fein und stark<br />
hängend<br />
Dunkle, mittelgroße bis<br />
große, weichfleischige<br />
Früchte, platzanfällig<br />
Vorwiegend zum<br />
Frischgenuss<br />
Kaiserkirsche<br />
3.-4. Kw.<br />
Regionalsorte<br />
Alte Regionalsorte der<br />
linken Rheinseite. Nicht<br />
zu verwechseln mit der<br />
Großen Prinzessin mit<br />
rotbunten Früchten, welche<br />
z. T. auch als Kaiserkirsche<br />
bezeichnet wird<br />
Stark wachsend,<br />
bildet kugelige bis<br />
hochkugelige<br />
Kronen mit feinem,<br />
hängendem<br />
Fruchtholz<br />
Schwarze, mittelgroße<br />
Früchte mit weichem<br />
Fleisch und würzigem<br />
Aroma, ertragreich<br />
Zum Frischgenuss<br />
wie zur Verwertung<br />
gleichermaßen gut<br />
geeignet, Eignung<br />
zu Brennzwecken<br />
zu vermuten<br />
Kassins Frühe<br />
(1.) -2. Kw.<br />
Regionalsorte<br />
In ganz Deutschland<br />
verbreitete alte und<br />
bewährte Sorte, die auch<br />
am Mittelrhein noch<br />
relativ häufig anzutreffen<br />
ist<br />
Sehr stark<br />
wachsend, bildet<br />
große und<br />
breitkronige,<br />
gesunde<br />
Landschaftsbäume<br />
Dunkelrote, mittelgroße<br />
Früchte mit weichem<br />
Fleisch und leicht<br />
fruchtigem Aroma,<br />
regelmäßiger Ertrag<br />
Vorwiegend für den<br />
Frischgenuss<br />
Kesterter<br />
Schwarze<br />
Rarität<br />
3. Kw.<br />
Regionalsorte<br />
Alte, sehr aromatische<br />
Lokalsorte aus Kestert.<br />
Die Sorte wurde aufgrund<br />
ihres hohen Zuckergaltes<br />
früher zum Süßen<br />
verwendet<br />
Sehr stark<br />
wachsend, bildet<br />
große, langlebige<br />
Landschaftsbäume<br />
etwas anfällig für<br />
Schrotschuss,<br />
sonst robust<br />
Schwarze, kleine bis<br />
mittelgroße Früchte mit<br />
mittelfestem Fleisch und<br />
hervorragendem Aroma<br />
Zum Frischgenuss<br />
wie zur Verwertung<br />
gleichermaßen gut<br />
geeignet, Eignung<br />
zu Brennzwecken<br />
zu vermuten<br />
FS LS VS MT LB<br />
X<br />
X X<br />
X X<br />
X X<br />
X X X<br />
3
Sortenempfehlungen aus den Ergebnissen des Projektes Mittelrheinkirschen<br />
für die Region des Oberen Mittelrheintales Stand Frühjahr 2011<br />
Süßkirschen<br />
Sortenname Herkunft/Verbreitung Baumeigenschaften<br />
Fruchteigenschaften Verwendung/<br />
Anbaueignung<br />
Lahnsteiner<br />
Coburger Maiherz<br />
Typ Sahlis-Koren<br />
2. Kw.<br />
Unter dem Namen<br />
Lahnsteiner im<br />
Mittelrheintal verbreitete<br />
robuste Frühsorte, die<br />
auch für rauere Lagen<br />
geeignet ist<br />
Starkwachsend,<br />
bildet lockere,<br />
etwas schirmartige<br />
Kronen. Gesunder<br />
Baumwuchs<br />
Rotbraune, längliche und<br />
mittelgroße Frucht mit<br />
weichem Fruchtfleisch,<br />
bestes Aroma erst nach<br />
längerem Reifen am Baum;<br />
frühreifender Massenträger<br />
Vorwiegend für den<br />
Frischgenuss<br />
Landele<br />
(Schwarz-,<br />
Mohrenkirsche)<br />
3.-4. Kw.<br />
Lorenzkirsche<br />
Rarität<br />
3. Kw.<br />
Regionalsorte<br />
Alte, überregional<br />
verbreitete Sorte, die<br />
auch im Mittelrheintal<br />
vorkommt, hier aber nicht<br />
häufig ist<br />
Lokalsorte aus<br />
Niederwerth, nur noch<br />
wenige Altbäume<br />
vorhanden, in anderen<br />
Orten vermutlich nicht<br />
verbreitet<br />
Starker,<br />
aufstrebender<br />
Wuchs, bildet<br />
große,<br />
hochkugelige<br />
Kronen<br />
Mittelstarker,<br />
Wuchs, bildet<br />
mittelgroße,<br />
rundliche Kronen<br />
Schwarze, mittelgroße<br />
Früchte mit festem<br />
Fruchtfleisch und<br />
hervorragendem Aroma<br />
Dunkle, mittelgroße<br />
Früchte mit weichem<br />
Fruchtfleisch und gutem<br />
Aroma, sehr ertragreich<br />
Zum Frischgenuss<br />
wie zur Verwertung<br />
gleichermaßen gut<br />
geeignet, Eignung<br />
zum Trocknen u.<br />
Brennzwecken zu<br />
vermuten<br />
Zum Frischgenuss<br />
wie zur Verwertung<br />
gleichermaßen gut<br />
geeignet<br />
Maibigarreau<br />
3. Kw.<br />
In vielen Regionen<br />
Deutschlands verbreitete<br />
gelbrote Frühkirsche,<br />
wegen ihres süßen<br />
Geschmacks auch<br />
"Zuckerkirsche" genannt<br />
Starkwachsend,<br />
bildet kugelige bis<br />
hochkugelige<br />
Kronen, gesunder<br />
Baumwuchs<br />
Rotbunte, mittelgroße und<br />
weichfleischige Sorte mit<br />
gutem Aroma<br />
Zum Frischgenuss<br />
und zur<br />
Verarbeitung<br />
geeignet<br />
Perle von<br />
Filsen<br />
Rarität<br />
3.-4. Kw.<br />
Regionalsorte<br />
Lokalsorte des Filsener<br />
Anbaugebietes mit sehr<br />
großen,<br />
wohlschmeckenden<br />
Früchten<br />
Starkwachsend,<br />
bildet kugelige<br />
Kronen, etwas<br />
anfällig für<br />
Spitzendürre<br />
Dunkelbraune, große und<br />
weichfleischige Sorte mit<br />
gutem Aroma, sehr<br />
ertragreich, leider<br />
platzanfällig<br />
Zum Frischgenuss<br />
und zur<br />
Verarbeitung<br />
geeignet<br />
FS LS VS MT LB<br />
X X X<br />
X X<br />
X X<br />
X X X<br />
X X<br />
4
Sortenempfehlungen aus den Ergebnissen des Projektes Mittelrheinkirschen<br />
für die Region des Oberen Mittelrheintales Stand Frühjahr 2011<br />
Süßkirschen<br />
Sortenname Herkunft/Verbreitung Baumeigenschaften<br />
"Porzellankirsche"-AT<br />
Rarität<br />
3.-4. Kw.<br />
Der richtige Name dieser<br />
Rarität ist bisher<br />
unbekannt, sie wird seit<br />
100 Jahren mit der Sorte<br />
'Elton' verwechselt und<br />
als solche beschrieben;<br />
bei Lahnstein gefunden.<br />
Stark wachsend,<br />
bildet große, breite<br />
und sparrige<br />
Kronen, gesunder<br />
Baum<br />
Fruchteigenschaften Verwendung/<br />
Anbaueignung<br />
Gelbrote, weichfleischige<br />
Herzkirsche mit porzellanblasser<br />
Grundfarbe und<br />
leuchtendroter Deckfarbe;<br />
geschmacklich eine der<br />
besten Sorten<br />
Zum Frischgenuss,<br />
vermutlich auch zur<br />
Verarbeitung<br />
geeignet<br />
FS LS VS MT LB<br />
X<br />
Rivers Frühe<br />
2. Kw.<br />
Ursprünglich aus England<br />
stammend, war die Sorte<br />
einst in ganz Deutschland<br />
verbreitet, im Mittelrheingebiet<br />
überwiegend auf<br />
der linken Rheinseite<br />
vorkommend<br />
Stark wachsend,<br />
bildet große, leicht<br />
hängende Kronen;<br />
gute<br />
Baumgesundheit<br />
Dunkle, breite und<br />
weichfleischge Früchte mit<br />
leicht fruchtigem<br />
Geschmack, ertragreich<br />
Zum Frischgenuss X X<br />
Rote<br />
Leberkirsche<br />
Rarität<br />
5.-6. Kw.<br />
Vermutlich<br />
rheinhessischen<br />
Ursprungs, ist die Sorte<br />
auch im Oberen<br />
Mittelrheintal verbreitet<br />
Mittelstark bis stark<br />
wachsend, bildet<br />
rundkugelige<br />
Krone<br />
Rotbunte, mittelgroße bis<br />
große Knorpelkirsche mit<br />
mittelfestem, saftigem und<br />
wohlschmeckendem<br />
Fruchtfleisch<br />
Zum Frischgenuss<br />
und zur<br />
Verarbeitung<br />
geeignet<br />
X X<br />
Rotters Braune<br />
Riesen<br />
Rarität<br />
3.-4. Kw.<br />
Vermutl. mitteldeutschen<br />
Ursprungs, benannt nach<br />
dem Gutsgärtner Rottert<br />
in Beesenstedt b. Halle/<br />
S., am Mittelrhein nur bei<br />
Weiler u. Trechtingshausen<br />
gefunden<br />
Mittelstark bis stark<br />
wachsend, bildet<br />
rundkugelige,<br />
ausgeglichene<br />
Kronen<br />
Braune, mittelgroße bis<br />
große Herzkirsche mit<br />
weichem, saftigem und<br />
wohlschmeckendem<br />
Fruchtfleisch<br />
Zum Frischgenuss<br />
und zur<br />
Verarbeitung<br />
geeignet<br />
X X<br />
Simonis<br />
3.-4. Kw.<br />
Regionalsorte<br />
Wertvolle Sorte der<br />
linksrheinischen Region<br />
um Brey und Spay, doch<br />
auch rechtsrheinisch hin<br />
und wieder vorkommend<br />
Sehr starkwachsende<br />
Bäume mit<br />
hochkugeligen<br />
Kronen, anspruchsvoll<br />
an die<br />
Nährstoffversorgung<br />
Braunrote, mittelgroße bis<br />
große Herzkirsche mit<br />
weichem Fruchtfleisch,<br />
sehr guter Geschmack<br />
Zum Frischgenuss<br />
und zur<br />
Verarbeitung<br />
geeignet<br />
X X<br />
5
Sortenempfehlungen aus den Ergebnissen des Projektes Mittelrheinkirschen<br />
für die Region des Oberen Mittelrheintales Stand Frühjahr 2011<br />
Süßkirschen<br />
Sortenname Herkunft/Verbreitung Baumeigenschaften<br />
Fruchteigenschaften Verwendung/<br />
Anbaueignung<br />
Souvenir de<br />
Charmes<br />
1.-2. Kw.<br />
Wertvolle Sorte<br />
französischen Ursprungs,<br />
die heute im<br />
Erwerbsobstbau durch<br />
die Sorte Burlat ersetzt<br />
wird<br />
Wuchs stark und<br />
sparrig, breit<br />
ausladend, braucht<br />
ausreichend Platz,<br />
wärmebedürftig,<br />
anspruchsvoll<br />
Fast schwarze, sehr große<br />
Früchte; eine der wenigen<br />
Frühsorten mit festem<br />
Fruchtfleisch, sehr<br />
aromatisch und<br />
wohlschmeckend<br />
Sowohl zum<br />
Frischgenuss wie<br />
vermutlich auch zur<br />
Verarbeitung<br />
geeignet<br />
Spanische<br />
4.-5. Kw.<br />
Regionalsorte<br />
Sehr alte Sorte, die im<br />
Mittelrheintal heute selten<br />
geworden ist<br />
Wuchs stark,<br />
Bäume mit<br />
hängendem<br />
Wuchs, gesunder<br />
Baumwuchs<br />
Braunrote, mittelgroße<br />
Früchte mit festem,<br />
wohlschmeckendem<br />
Fruchtfleisch<br />
Sowohl zum<br />
Frischgenuss wie<br />
zur Verarbeitung<br />
geeignet<br />
Tilgeners Rote<br />
Herzkirsche<br />
Rarität<br />
3.-4. Kw.<br />
Sehr alte, einst<br />
überregional verbreitete<br />
Sorte, die heute sehr<br />
selten geworden ist<br />
Starker Wuchs,<br />
Krone mit<br />
hängendem<br />
Fruchtholz, sehr<br />
gesund und robust<br />
Gelbrote bis leuchtend rote,<br />
sehr hübsche, spitz<br />
herzförmige Frucht mit<br />
hervorragendem, süßem<br />
Geschmack<br />
Sowohl zum<br />
Frischgenuss wie<br />
zur Verarbeitung<br />
geeignet<br />
Wils Frühe<br />
Rarität<br />
1.-2. Kw.<br />
Alte, seltene,<br />
überregional verbreitete<br />
Frühsorte, die am<br />
Mittelrhein in der Region<br />
von Weiler gefunden<br />
wurde<br />
Schwacher Wuchs,<br />
runde, gleichmäßig<br />
aufgebaute Krone<br />
Braunrote, mittelgroße bis<br />
große Frucht mit weichem<br />
Fruchtfleisch und für eine<br />
Frühkirsche gutem<br />
Geschmack<br />
Zum Frischgenuss,<br />
vermutlich auch zur<br />
Verarbeitung<br />
geeignet<br />
Zenglers<br />
Rarität<br />
1.-2. Kw.<br />
Regionalsorte<br />
Lokalsorte aus<br />
Niederwerth, bisher nur<br />
von einem Baum dort<br />
bekannt. Bisher die einzig<br />
bekannte, sehr frühreifende<br />
gelbrote Kirsche<br />
mit festem Fruchtfleisch<br />
Starker Wuchs,<br />
runde, gleichmäßig<br />
aufgebaute Krone<br />
Gelbrote, rundliche Frucht<br />
mit festem Fruchtfleisch<br />
und hervorragendem,<br />
süßem Geschmack<br />
Sowohl zum<br />
Frischgenuss wie<br />
zur Verarbeitung<br />
geeignet<br />
FS LS VS MT LB<br />
X X X<br />
X X X<br />
X<br />
X X<br />
X X<br />
6
Zur Verarbeitung<br />
wie zum<br />
Frischgenuss gut<br />
geeignet<br />
Zur Verarbeitung<br />
wie zum<br />
Frischgenuss gut<br />
geeignet<br />
Zur Verarbeitung<br />
wie zum<br />
Frischgenuss gut<br />
geeignet<br />
X X<br />
X X X X<br />
Kw: Kirschwoche. Die Reifezeit wird bei Kirschen in sogenannten Kirschwochen angegeben, die die relative Reife der Sorten untereinander bezeichnen und deren Zeitpunkt von der<br />
jeweiligen Witterung und der geographischen Lage abhängig ist. Die erste Kirschwoche beginnt mit der Reife der Sorte Früheste der Mark. Je nach Witterung kann diese am<br />
Mittelrhein bereits in der 2. Maiwoche, aber auch deutlich später beginnen. Eine Sorte der 3. Kirschwoche reift also ca. zwei Wochen, eine Sorte der 6. Kirschwoche 5 Wochen nach<br />
der Frühesten der Mark.<br />
X X<br />
X X<br />
1<br />
Sortenempfehlungen aus den Ergebnissen des Projektes Mittelrheinkirschen<br />
für die Region des Oberen Mittelrheintales – Stand Frühjahr 2011<br />
Bastardkirschen<br />
Sortenname Herkunft/Verbreitung Baumeigenschaften<br />
"Filsener<br />
Glaskirsche"<br />
Rarität<br />
3.-4. Kw.<br />
Sehr seltene<br />
Bastardkirsche, die bisher<br />
nur auf einem Baum in<br />
Filsen aufgefunden wurde..<br />
Ihr pomologischer Name<br />
ist bisher nicht bekannt.<br />
Starker Wuchs,<br />
steil aufrecht, bildet<br />
hochkugelige,<br />
süßkirschartige<br />
Krone<br />
Fruchteigenschaften Verwendung/<br />
Anbaueignung<br />
Kleine bis mittelgroße,<br />
leuchtend rote Frucht mit<br />
angenehmen, süßsaurem<br />
Geschmack, sortentypische<br />
Bauchfurche<br />
Zur Verarbeitung<br />
wie zum<br />
Frischgenuss gut<br />
geeignet<br />
FS LS VS MT LB<br />
"Lahnsteiner<br />
Süßweichsel"<br />
Rarität<br />
6.-7. Kw.<br />
Rarität, die auf einem fast<br />
100-jährigem Baum bei<br />
Lahnstein entdeckt<br />
wurde, war früher dort<br />
stärker verbreitet. Ihr<br />
pomologischer Name ist<br />
bisher nicht bekannt.<br />
Starkwachsend,<br />
bildet große,<br />
hochkugelige<br />
Kronen, gesunder<br />
Baumwuchs<br />
Kleine bis mittelgroße,<br />
dunkelrote Frucht mit langen<br />
Stielen. Ausgewogen<br />
süßsauer Geschmack, sehr<br />
ertragreich<br />
Spanische<br />
Glaskirsche<br />
Rarität<br />
4. Kw.<br />
Schöne von<br />
Chatenay<br />
Rarität<br />
7.-10. Kw.<br />
Ebenfalls eine der<br />
seltenen „süßsauren“<br />
Sorten, die heute gänzlich<br />
aus dem Anbau<br />
verschwunden ist, aber<br />
qualitativ sehr hochwertige<br />
Früchte besitzt<br />
Diese früher sehr<br />
geschätzte „süßsaure“<br />
Sorte ist heute in ganz<br />
Deutschland sehr selten.<br />
Ihre späte, stark folgende<br />
Reife weit nach allen<br />
anderen Sorten macht sie<br />
besonders wertvoll<br />
Starker Wuchs,<br />
bildet große,<br />
süßkirschartige<br />
Bäume mit<br />
kugeliger Krone<br />
Starker Wuchs,<br />
bildet große,<br />
süßkirschartige,<br />
gesunde Baume<br />
mit flachkugeliger<br />
Krone<br />
Mittelgroße bis große<br />
dunkelrote Früchte mit<br />
angenehmem Zucker-Säure-<br />
Verhältnis und sehr gutem<br />
Aroma, weniger ertragreich<br />
als die ähnlichen Amarellen<br />
Mittelgroße, leuchtendrote<br />
Früchte mit sehr gutem<br />
Geschmack, in der Reife<br />
sehr folgernd, so dass sie<br />
über eine lange Zeit geerntet<br />
werden können
Sortenempfehlungen aus den Ergebnissen des Projektes Mittelrheinkirschen<br />
für die Region des Oberen Mittelrheintales Stand Frühjahr 2011<br />
Sauerkirschen<br />
Sortenname Herkunft/Verbreitung Baumeigenschaften<br />
Diemitzer<br />
Amarelle<br />
(Ludwigs Frühe)<br />
3.-6. Kw.<br />
Helle, im Mittelrheintal<br />
noch immer recht<br />
verbreitete Sauerkirsche,<br />
die über einen langen<br />
Zeitraum beerntet werden<br />
kann<br />
Mittelstarker<br />
Wuchs, gesunder<br />
und robuster<br />
Baum, nicht<br />
anfällig für<br />
Spitzendürre<br />
Fruchteigenschaften Verwendung/<br />
Anbaueignung<br />
Kleine bis mittelgroße,<br />
leuchtend rote Frucht mit<br />
mildsaurem Fruchtfleisch<br />
und sortentypischen Aroma,<br />
sehr ertragreich<br />
Zur Verarbeitung<br />
wie zum<br />
Frischgenuss gut<br />
geeignet,<br />
Konfitüre mit<br />
sortentypischem<br />
Aroma<br />
"Filsener<br />
Sauerkirsche"<br />
6. Kw.<br />
Der einzige bisher<br />
gefundene Baum konnte<br />
noch keiner<br />
pomologischen Sorte<br />
zugeordnet werden,<br />
vermutlich überregional<br />
verbreitet<br />
Mittelstarker<br />
Wuchs, bildet<br />
kleine Bäume mit<br />
kugeliger Krone,<br />
gut geeignet für<br />
kleine Gärten<br />
Mittelgroße, dunkelrote<br />
Frucht mit gutem<br />
Geschmack, sehr ertragreich<br />
Zur Verarbeitung<br />
wie zum<br />
Frischgenuss gut<br />
geeignet<br />
Königliche<br />
Amarelle<br />
3.-6. Kw.<br />
Koröser<br />
Weichsel<br />
6.-7. Kw.<br />
Minister von<br />
Podbielski<br />
Rarität<br />
4.-5. Kw.<br />
Die Königliche Amarelle<br />
ist ihren<br />
Fruchteigenschaften der<br />
Diemitzer Amarelle sehr<br />
ähnlich, bildet aber im<br />
Alter größere Bäume<br />
Große, dunkle<br />
Sauerkirsche, die in der<br />
mittelrheinischen Region<br />
heute nur vereinzelt<br />
vorkommt<br />
Dieser Typ der Ostheimer<br />
Weichsel ist heutzutage<br />
nur noch selten<br />
anzutreffen, dabei zählt die<br />
Sorte zu den qualitativ<br />
besten Sauerkirschen<br />
Starker Wuchs,<br />
bildet große,<br />
gesunde Baume<br />
mit hochkugeliger<br />
Krone, nicht<br />
anfällig für<br />
Spitzendürre<br />
Starkwachsend,<br />
bildet große,<br />
hochkugelige<br />
Kronen, weniger<br />
anfällig gegen<br />
Spitzendürre als<br />
die<br />
Schattenmorelle<br />
Mittelstarker<br />
Wuchs mit<br />
kugeliger Krone,<br />
Baum weniger<br />
anfällig gegen<br />
Spitzendürre als d.<br />
Schattenmorelle<br />
Kleine bis mittelgroße<br />
leuchtend rote Frucht mit<br />
sehr gutem Geschmack,<br />
mildsaurem Fruchtfleisch<br />
und sortentypischen Aroma<br />
Große, dunkelviolette, sehr<br />
wohlschmeckende Früchte<br />
mit ausgeglichenem Zucker-<br />
Säure-Verhältnis, im Ertrag<br />
etwas schwankend<br />
Große dunkle und<br />
außerordentlich aromatische<br />
Früchte, mit leichtem Bittermandelaroma,<br />
im<br />
Ertragsverhalten etwas<br />
kapriziös<br />
Zur Verarbeitung<br />
wie zum<br />
Frischgenuss gut<br />
geeignet<br />
Zur Verarbeitung<br />
wie zum<br />
Frischgenuss gut<br />
geeignet<br />
Zur Verarbeitung<br />
wie zum<br />
Frischgenuss gut<br />
geeignet<br />
FS LS VS MT LB<br />
X X X<br />
X X X<br />
X X<br />
X X<br />
X X<br />
1
Sortenempfehlungen aus den Ergebnissen des Projektes Mittelrheinkirschen<br />
für die Region des Oberen Mittelrheintales Stand Frühjahr 2011<br />
Sauerkirschen<br />
Kw: Kirschwoche. Die Reifezeit wird bei Kirschen in sogenannten Kirschwochen angegeben, die die relative Reife der Sorten untereinander bezeichnen und deren Zeitpunkt von der<br />
jeweiligen Witterung und der geographischen Lage abhängig ist. Die erste Kirschwoche beginnt mit der Reife der Sorte Früheste der Mark. Je nach Witterung kann diese am<br />
Mittelrhein bereits in der 2. Maiwoche, aber auch deutlich später beginnen. Eine Sorte der 3. Kirschwoche reift also ca. zwei Wochen, eine Sorte der 6. Kirschwoche 5 Wochen nach<br />
der Frühesten der Mark.<br />
FS: Frühsorte, wird i.d.R. noch nicht von der Kirschfruchtfliege befallen.<br />
LS: Liebhabersorte mit besonderen Eigenschaften (z. B. sehr guter Geschmack, frühe Reife), kann etwas empfindlich sein<br />
VS: Verarbeitungssorte, für Verarbeitungszwecke zu prüfen (z. B. Brennen, Einkochen)<br />
MT: Massenträger<br />
LB: Landschaftsbaum, starkwachsende, robuste Sorte für auch für etwas rauere Lagen<br />
Die Angaben resultieren aus zwei Erfassungsjahren und sind als erste Einschätzung zu verstehen. Insbesondere die Angaben zur Verwendung und Anbaueignung müssen durch Versuche überprüft<br />
werden.<br />
2
Sortenempfehlungen aus den Ergebnissen des Projektes Mittelrheinkirschen<br />
für die Region des Oberen Mittelrheintales Stand Frühjahr 2011<br />
Aprikosen<br />
Sortenname Herkunft/Verbreitung Baumeigenschaften<br />
Kesterter<br />
Schafsnase<br />
(Ambrosia)<br />
M-E7<br />
Regionalsorte<br />
Traditionell am<br />
Mittelrhein,<br />
insbesondere in Kestert<br />
sehr geschätzte Sorte,<br />
die hier den Lokalnamen<br />
Kesterter Schafsnase<br />
trägt<br />
Mittelstark wachsende<br />
Sorte, die<br />
zur <strong>Ausbildung</strong><br />
ihrer Fruchtqualität<br />
warme,<br />
trockene Lagen<br />
benötigt<br />
Fruchteigenschaften Verwendung/<br />
Anbaueignung<br />
Mittelgroße orangefarbige<br />
und flache Frucht mit<br />
gutem Aroma, die etwas<br />
ungleichhälfig reift und<br />
schorfanfällig ist<br />
Für Frischgenuss,<br />
zur<br />
Konservierung<br />
wie auch zum<br />
Brennen<br />
geeignet<br />
Heidesheimer<br />
Frühe<br />
Rarität<br />
M7<br />
Sorte rheinhessischen<br />
Ursprungs, die nur noch<br />
sehr vereinzelt im<br />
Mittelrheintal vorkommt<br />
Starkwachsende<br />
Sorte, die<br />
ausladende<br />
Bäume bilden<br />
kann<br />
Mittelgroße, orangefarbige<br />
Früchte, sonnenseitig rot<br />
gesprenkelt mit gutem<br />
Aroma, ertragreiche Sorte<br />
Für<br />
Frischgenuss<br />
und zur<br />
Verarbeitung<br />
geeignet<br />
Ungarische<br />
Beste<br />
M7<br />
-<br />
<br />
Rarität<br />
E7-A8<br />
Regionalsorte<br />
Mandelaprikose<br />
Rarität<br />
M8<br />
Am Mittelrhein<br />
verbreitete Sorte, die<br />
auch jenseits des<br />
direkten Rheinbereichs<br />
gute Fruchtqualitäten<br />
bringt<br />
Diese am Mittelrhein als<br />
<br />
Aprikose ist eine<br />
qualitativ hochwertige<br />
Spätsorte für<br />
entsprechende<br />
Standorte<br />
Die in Rheinhessen<br />
aufgefundene Sorte<br />
besitzt eine<br />
hervorragende Fruchtqualität.<br />
Der offizielle<br />
Name der Sorte ist<br />
bisher noch unbekannt<br />
Starkwachsende,<br />
robuste Sorte,<br />
frostwiderstandsfähig<br />
in Holz und<br />
Blüte. noch für<br />
Aprikosen-Grenzlagen<br />
geeignet<br />
Mittelstark wachsende<br />
Sorte, die<br />
zur <strong>Ausbildung</strong><br />
ihrer Fruchtqualität<br />
warme,<br />
möglich trockene<br />
Lagen benötigt<br />
Schwachw. Sorte,<br />
verlangt vermutlich<br />
guten Boden<br />
u. warme Lagen,<br />
regelmäßiger<br />
Verjüngungsschnitt<br />
erforderl.<br />
Große, orangefarbige<br />
Früchte mit rot<br />
gesprenkelter Sonnenseite<br />
und sehr süßem,<br />
aromatischem<br />
Fruchtfleisch<br />
Klein bis mittelgroße,<br />
runde, orangefarbige<br />
Früchte mit sehr gutem<br />
Aroma und Ertrag, etwas<br />
schorfanfällig<br />
Kleine, leuchtend<br />
orangegefärbte Früchte<br />
mit außerordentlich<br />
süßem, aromatischem<br />
Fruchtfleisch, geschmackl.<br />
eine der besten Sorten,<br />
sehr ertragreich<br />
Für Frischgenuss<br />
und zur<br />
Verarbeitung<br />
gleichermaßen<br />
sehr gut<br />
geeignet<br />
Für<br />
Frischgenuss<br />
und zur<br />
Verarbeitung<br />
geeignet<br />
Für Frischgenuss,<br />
zur<br />
Konservierung<br />
wie auch zum<br />
Brennen sehr<br />
gut geeignet<br />
FS LS VS MT LB<br />
X X<br />
X X X<br />
X<br />
X X X<br />
X X X<br />
1
Sortenempfehlungen aus den Ergebnissen des Projektes Mittelrheinkirschen<br />
für die Region des Oberen Mittelrheintales Stand Frühjahr 2011<br />
Pfirsiche<br />
Sortenname Herkunft/Verbreitung Baumeigenschaften<br />
Fruchteigenschaften Verwendung/<br />
Anbaueignung<br />
Früher Roter<br />
Ingelheimer<br />
A7<br />
Regionalsorte<br />
Frühsorte mit Ursprung<br />
im benachbarten<br />
Rheinhessen, die auch<br />
am Mittelrhein einst<br />
verbreitet war<br />
Mittelstark wachs.<br />
Sorte, benötigt<br />
gute Nährstoffversor-gung,<br />
wenig anfällig für<br />
Kräuselkrankheit<br />
Mittelgroße Frucht mit<br />
rötlicher Fruchthaut,<br />
weißen Fleisch und gutem<br />
Aroma, wenig steinlöslich,<br />
sehr ertragreich<br />
Für<br />
Frischgenuss<br />
Kernechter<br />
vom<br />
Vorgebirge<br />
E8-M9<br />
Regionalsorte<br />
Rekord von<br />
Alfter<br />
Rarität<br />
E8-A9<br />
Traditionell wurden im<br />
Mittelrheintal spätreifende,<br />
weißfleischige<br />
Pfirsiche aus Steinen<br />
nachgezogen, deshalb<br />
in ihren Eigenschaften<br />
etwas variabel<br />
Pfirsich rheinländischen<br />
Ursprungs, die auch im<br />
Mittelrheintal verbreitet<br />
war; schöne robuste<br />
Sorte mit guter<br />
Fruchtqualität<br />
Starkwachsende,<br />
robuste Bäume,<br />
frohwüchsig,<br />
wenig durch die<br />
Kräuselkrankheit<br />
beeinträchtigt<br />
Starkwachsende,<br />
gesunde Sorte,<br />
die eher flache<br />
Kronen bildet;<br />
wenig durch die<br />
Kräuselkrankheit<br />
beeinträchtigt<br />
Mittelgroße bis große<br />
Früchte mit weißem<br />
Fleisch und sehr gutem,<br />
leicht herbem Aroma;,<br />
reicher und regelmäßiger<br />
Ertrag<br />
Große, rot gefärbte<br />
Früchte mit weißem<br />
Fleisch und sehr gutem<br />
Aroma, gut steinlöslich,<br />
ertragreich<br />
Zum<br />
Frischgenuss<br />
und zur<br />
Verarbeitung<br />
geeignet<br />
Zum<br />
Frischgenuss<br />
und zur<br />
Verarbeitung<br />
geeignet<br />
Mme Rogniat<br />
Rarität<br />
A-M8<br />
Traditionell am<br />
Mittelrhein verbreitete<br />
Sorte, die heute nur<br />
noch selten zu finden ist;<br />
für Frischgenuss und zur<br />
Verarbeitung geeignet<br />
Mittelstark<br />
wachsende gesunde<br />
Sorte, rel.<br />
widerstandsfähig<br />
gegen die<br />
Kräuselkrankheit<br />
Großer, rotgefärbter<br />
Pfirsich mit weißem<br />
Fleisch und sehr gutem<br />
Aroma, ertragreich<br />
Für<br />
Frischgenuss<br />
und zur<br />
Verarbeitung<br />
geeignet<br />
Pfirsich,<br />
gelbfleischig<br />
E8<br />
Der Sortenname dieses<br />
in Filsen aufgefundenen<br />
gelbfleischigen<br />
Spätpfirsichs ist bisher<br />
unbekannt<br />
Mittelstark bis<br />
stark wachsende<br />
Sorte, wie fast<br />
alle gelbfleischigen<br />
Sorten etwas<br />
anfällig für die<br />
Kräuselkrankheit<br />
Große, schön gelbrot<br />
gefärbte Früchte mit sehr<br />
gutem Pfirsicharoma,<br />
ertragreich<br />
Für<br />
Frischgenuss<br />
und zur<br />
Verarbeitung<br />
geeignet<br />
FS LS VS MT LB<br />
X X<br />
X X<br />
X X<br />
X<br />
X X<br />
1
Sortenempfehlungen aus den Ergebnissen des Projektes Mittelrheinkirschen<br />
für die Region des Oberen Mittelrheintales Stand Frühjahr 2011<br />
Pflaumen<br />
Sortenname Herkunft/Verbreitung Baumeigenschaften<br />
Erntepflaume<br />
M7-A8<br />
Flotows<br />
Mirabelle<br />
M7-A8<br />
Mirakosa<br />
Rarität<br />
M8-E8<br />
Fischers<br />
Frühe<br />
Rarität<br />
M7-E7<br />
Regionalsorte<br />
Diese alte Landsorte ist<br />
im Mittelrheintal noch<br />
gelegentlich in Hecken<br />
und Gebüschen<br />
wurzelecht zu finden<br />
Diese alte und sehr<br />
wohlschmeckende<br />
Mirabellensorte ist heute<br />
im Mittelrheintal fast<br />
vollständig<br />
verschwunden<br />
Diese im Mittelrheintal<br />
vor einigen Jahrzehnten<br />
viel propagierte Sorte ist<br />
heute aufgrund der<br />
Bevorzugung blauer<br />
Sorten nur noch wenig<br />
anzutreffen<br />
Von der Baumschule<br />
Fischer, Mühlheim-<br />
Kärlich, in den Handel<br />
gebracht<br />
Mittelstarker<br />
Wuchs, robuste<br />
Sorte, wurzelecht<br />
auch für kältere<br />
Lagen geeignet,<br />
auch f. Wildobsthecken<br />
geeignet<br />
Starkwachsend,<br />
bildet große,<br />
robuste Bäume<br />
mit breitkugeliger<br />
Krone, auch für<br />
kühlere Lagen<br />
geeignet<br />
Schwach bis<br />
mittelstark<br />
wachsende Sorte,<br />
bildet kleine<br />
Bäume<br />
Mittelstark<br />
wachsende Sorte<br />
mit kugeligen bis<br />
hochkugeligen<br />
Kronen<br />
Fruchteigenschaften Verwendung/<br />
Anbaueignung<br />
Kleine, blaue Früchte mit<br />
süßaromatischem<br />
Geschmack und pikant<br />
herber Note, ertragreich<br />
Gelb-rötliche Früchte in<br />
der Größe der bekannten<br />
Nancy-Mirabelle, sehr<br />
saftig mit besonderem,<br />
leicht aprikosenartigem<br />
Aroma<br />
Mittelgroße bis große,<br />
grüngelbliche, längliche<br />
Früchte, die zur<br />
<strong>Ausbildung</strong> ihres vollen<br />
Geschmacks ein warmes<br />
Klima; benötigen; Reife<br />
folgernd, ertragreich<br />
In Frucht und Reifezeit der<br />
Ersinger Frühzw. ähnliche<br />
Sorte, mittelgroße bis<br />
große, mittelblaue Früchte<br />
mit leichtem Aroma und<br />
früher Reifezeit<br />
Als kleine frühe<br />
Naschfrucht für<br />
Kinder wie<br />
Erwachsene<br />
attraktiv<br />
Sowohl zum<br />
Frischgenuss<br />
als auch zum<br />
Einkochen und<br />
Brennen sehr<br />
gut geeignet<br />
Für<br />
Frischgenuss,<br />
Verarbeitungsei<br />
genschaften<br />
wären zu prüfen<br />
Für<br />
Frischgenuss,<br />
Verarbeitungsei<br />
genschaften<br />
wären zu prüfen<br />
Schöne von<br />
Löwen<br />
E7-M8<br />
Die Schöne von Löwen<br />
ist eine überregional<br />
verbreitete Sorte, die<br />
ursprünglich aus Belgien<br />
stammt<br />
Starkwachsende,<br />
aufstrebende<br />
Bäume mit<br />
hochkugeligen<br />
Kronen<br />
Sehr große, violettblaue,<br />
mäßig aromatische<br />
Früchte, ertragreicher<br />
Massenträger<br />
Für<br />
Frischgenuss<br />
FS LS VS MT LB<br />
X X<br />
X X X X X<br />
X<br />
X X<br />
1
Sortenempfehlungen aus den Ergebnissen des Projektes Mittelrheinkirschen<br />
für die Region des Oberen Mittelrheintales Stand Frühjahr 2011<br />
Pflaumen<br />
Sortenname Herkunft/Verbreitung Baumeigenschaften<br />
Sultan<br />
Rarität<br />
E8-M9<br />
Wagenstädter<br />
Pflaume<br />
A8-M8<br />
Sultan ist eine in<br />
Deutschland seltene<br />
Sorte, die bisher im<br />
Streuobst nur im<br />
Mittelrheintal auf einem<br />
Baum aufgefunden<br />
wurde<br />
Auch wenn z. T. das<br />
Thüringer Wagenstedt<br />
als Ursprung dieser<br />
Sorte angegeben wird,<br />
scheint sie tatsächlich<br />
doch aus Wagenstädt i.<br />
Breisgau zu stammen<br />
Starkwachsende,<br />
aufstrebende<br />
Bäume mit<br />
hochkugeligen<br />
Kronen<br />
Mittelstark wachsende<br />
Sorte, die<br />
auch als Unterlage<br />
verwendet<br />
wurde, wurzelecht<br />
für Wildobsthecken<br />
geeignet<br />
Fruchteigenschaften Verwendung/<br />
Anbaueignung<br />
Sehr große, sehr<br />
spätreifende Sorte mit<br />
dunkelblauen Früchte und<br />
vergleichsweise wenig<br />
Aroma, ertragreicher<br />
Massenträger<br />
Kleine, mirabellenähnliche<br />
Früchte mit leicht<br />
mehligem Geschmack, ,<br />
ertragreicher<br />
Massenträger<br />
Für<br />
Frischgenuss,<br />
Verarbeitungsei<br />
genschaften<br />
wären zu prüfen<br />
Gut geeignet zu<br />
Brennzwecken,<br />
andere<br />
Verarbeitungsei<br />
genschaften<br />
wären zu prüfen<br />
FS LS VS MT LB<br />
X<br />
X X X<br />
FS: Frühsorte<br />
LS: Liebhabersorte mit besonderen Eigenschaften (z. B. sehr guter Geschmack, frühe Reife), kann etwas empfindlich sein<br />
VS: Verarbeitungssorte, für Verarbeitungszwecke zu prüfen (z. B. Brennen, Einkochen)<br />
MT: Massenträger<br />
LB: Landschaftsbaum, starkwachsende, robuste Sorte für auch für etwas rauere Lagen<br />
Die Angaben resultieren aus zwei Erfassungsjahren und sind als erste Einschätzung zu verstehen. Insbesondere die Angaben zur Verwendung und Anbaueignung müssen durch Versuche überprüft<br />
werden.<br />
2
Historischer Kirschanbau Oberes Mittelrheintal<br />
1. HISTORISCHE AUFARBEITUNG<br />
1.1 RÄUMLICHE VERTEILUNG DER STEINOBSTARTEN<br />
Bei der kartographische Darstellung der räumlichen Verteilung der Steinobstarten (s.<br />
Übersichtskarte) ist zu beachten, dass keine Quellen mit flächengenauer Abgrenzung der<br />
Verbreitung zur Verfügung gestanden haben. Die Karten konnte daher nur anhand von eher<br />
allgemein gehaltenen Literaturangaben sowie der bei einer aktuellen Bereisung<br />
beobachteten noch vorhandenen Bestände abgeschätzt werden und können daher mit<br />
entsprechenden Ungenauigkeiten behaftet sein. Für Pfirsiche und Pflaumen lagen für eine<br />
kartographische Darstellung zu wenige Angaben vor, die Verbreitung der Aprikosen konnte<br />
nur für die Nachkriegszeit dargestellt werden.<br />
Um 1880 war der Süßkirschenanbau in Wesentlichen um die Ortschaften lokalisiert,<br />
während die Steilhanglagen vom Weinbau eingenommen wurden (s. Abb.1). Dies änderte<br />
sich mit dem Niedergang des Weinbaus Ende des 19. Jahrhunderts (Details s. Kap. 2.2).<br />
Zunehmend wurde der Kirschanbau auf den Steilhanglagen als Nachfolgekultur des<br />
Weinbaus etabliert, wie dies für den Kamper Hang zwischen Filsen und Kamp dargestellt ist.<br />
Während des großen Obstbaubooms in den Nachkriegsjahren wurden dann auch die<br />
Hochflächen bepflanzt, die vorher Ackerbau und Grünlandnutzung gedient hatten. Dabei<br />
waren die eingezeichneten Gebiete nicht immer flächendeckend mit Kirschplantagen<br />
bestanden, wie dies z. B. in der Hinteren Dick bei Buchenau der Fall war. Teilweise wurden<br />
auch nur lineare Pflanzungen an Weg- und Flurgrenzen vorgenommen und die dazwischen<br />
liegenden Flächen weiterhin ackerbaulich oder als Grünland genutzt.<br />
Aprikosen wurden aus kleinklimatischen Gründen nur in flussnahen Bereich angebaut. In<br />
welchem Umfang der Aprikosenanbau schon im 19. Jahrhundert existiert hat, war aus den<br />
ausgewerteten Quellen nicht ersichtlich. Eine wirtschaftliche Bedeutung erhielt der Anbau<br />
erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts, welche Mitte des 20. Jahrhunderts noch deutlich<br />
ausgeweitet wurde, wobei die Anbauflächen auf den ufernahen Bereich beschränkt blieben.
Historischer Kirschanbau Oberes Mittelrheintal<br />
Abb. 1: Lage und Höhenverteilung des Kirsch- und Aprikosenanbaus im Welterbe seit 1880
Historischer Kirschanbau Oberes Mittelrheintal<br />
1.2 GESELLSCHAFTLICHE UND WIRTSCHAFTLICHE BEDEUTUNG DES<br />
STEINOBSTANBAUS SEIT DEM MITTELALTER<br />
1.2.1 ANFÄNGE DES OBSTBAUS IM MITTELALTER<br />
Nach dem immer wieder gerne zitierten PLINIUS d. Ä. soll es bereits um 60 n. Chr., also kurz<br />
nachdem Lucullus der Legende nach die Kirschen vom Schwarzen Meer nach Italien gebracht<br />
hat, Kirschen am Rhein gegeben haben.<br />
Erste Belege für einen Obstbau im Oberen Mittelrheintal finden sich seit dem Mittelalter<br />
(VOLK 1998). Im 13. und frühen 14. Jahrhundert gründen sie sich überwiegend auf die<br />
Erwähnung markanter Einzelbäume, die zur Lokalisierung von Liegenschaften in der<br />
Landschaft dienten. Vor 1320 konzentrieren sich die Erwähnungen auf die Talorte auf beiden<br />
Rheinseiten zwischen Boppard und Oberlahnstein im Norden (incl. Rhens, Dinkholdertal und<br />
Osterspai) sowie Oberwesel und Trechtlingshausen im Süden. Es gab aber zu dieser Zeit auch<br />
schon einzelne Baumgärten, wie das 1275 in Oberwesel erwähnte Pomerium sowie<br />
Obstbaumpflanzungen der Eberbacher Mönche im Dinkholdertal (bei Osterspai). Diese<br />
Obstgärten waren nach VOLK (1998) aber eher Ausnahmen und dienten vorwiegend dem<br />
Eigenbedarf.<br />
Im Verlauf des 14. Jahrhundert weitete sich der Obstbau aus und scheint auch eine stärkere<br />
wirtschaftliche Bedeutung bekommen zu haben. Neben Orts- und Ortsrandlagen wurden<br />
Obstgärten verstärkt auf bisher weinbaulich genutzten Flächen angelegt. Belegt sind<br />
Baumgärten (Bungerte) u. a. in Rhens (1335), Lorch (um 1337), Oberwesel (1339), im<br />
Dinkholder (1348) sowie in Niederspay (1350). VOLK (1998) vermutet, dass für diese<br />
Entwicklung wirtschaftliche Krisenzeiten mit Hungerjahren und Pestwellen verantwortlich<br />
waren, die zu Bevölkerungs- und damit Arbeitskräfteverlusten führten. Brachgefallene<br />
Rebflächen konnten so durch die weniger arbeitsintensiven Obstkulturen genutzt werden. Es<br />
gibt auch Belege, dass die Anlage von Obstgärten durch die Grundherren in gewissen Fällen<br />
zur Pflicht gemacht wurde. Insgesamt ist festzustellen, dass im 14. Jahrhundert die<br />
Obstgärten überwiegend in den stark vom Weinbau geprägten Talorten angelegt wurden,<br />
während aus den Ackerbaudörfern auf den Hochflächen keine Belege für<br />
spätmittelalterlichen Obstbau zu finden sind. Die Anbauformen waren unterschiedlich,<br />
einzelne Bäume und kleinere Gruppen oder Reihen wurden an Parzellengrenzen,<br />
Wegrändern oder auf sonstigen ungenutzten Flächen gepflanzt. Die Unternutzung größerer<br />
Baumgärten war oft Grasland, das zu Weidezwecken oder zur Mahd genutzt wurde. Auch<br />
wurden Bäume in Weingärten gepflanzt, was aber wegen des Nährstoffentzuges und der<br />
Schattenwirkung problematisch war.<br />
Über den Anbau von Steinobstarten im Mittelalter finden sich insgesamt nur wenige<br />
Angaben, die sich nur auf Kirschen beziehen. Kirschbäume scheinen besonders im südlichen<br />
Teil des Oberen Mittelrheintales angebaut worden zu sein. Frühe Belege für den Kirschanbau<br />
sind 1279 ein Wingert iuxta cerasum bei Diebach sowie ein von Kirschbäumen gesäumter
Historischer Kirschanbau Oberes Mittelrheintal<br />
Garten bei der Burg Reichenberg. Reine Kirschgärten scheint es vereinzelt seit dem 15.<br />
Jahrhundert gegeben zu haben, so in Bacharach und Kaub. 1445 wird in Güls bei Koblenz<br />
eine Flurbezeichnung „Uffm Kirssenberg“ erwähnt (DÄHNE 1960b), was auf eine gewisse<br />
Verbreitung der Kirschen hindeutet. Die Auffassung IRSINGLERS (o. Jg.), dass es um diese Zeit<br />
regelrechte Kirschwälder bei St. Goar und Bad Salzig gegeben hätte, die frühe Sorten für den<br />
Kölner Markt produzierten, scheint allerdings ungesichert (VOLK 1998).<br />
Das Obst wurde überwiegend zum Eigenverbrauch, als Frischobst und verarbeitet als<br />
Trockenobst sowie als Obstwein verwendet. Ein gewisser Anteil wurde auch vermarktet,<br />
neben den regionalen Märkten teilweise auch rheinabwärts bis Köln. Da für die Einfuhr von<br />
Obst unterhalb von Lahnstein Zoll zu bezahlen war, ist zu vermuten, dass der Anteil des<br />
eingeführten Obstes aus dem Oberen Mittelrheintal gegenüber den zollfreien Einfuhren des<br />
Unteren Mittelrheintals sowie des Neuwieder Beckens eher gering war. Rheinabwärts war<br />
eine Vermarktung aufgrund des mangelnden Anschlusses des Engtals an die südliche<br />
Rheinschifffahrt nicht möglich.<br />
1.2.2 ENTWICKLUNGEN DES STEINOBSTANBAUS IM 19. JAHRHUNDERT<br />
Keimzelle Salzig<br />
An dem Ausmaß und der Nutzung des Obstbaus vorwiegend zum Eigenverbrauch änderte<br />
sich in den folgenden Jahrhunderten wenig. Erst in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts begann<br />
ein Ausbau des Steinobstbaus, der von Salzig ausging. Der Obstbau fokussierte sich hier auf<br />
die Kirschen, die bereits erwerbsmäßig vermarktet wurden. Steinobst, insbesondere<br />
Kirschen, verlangen eine schnelle Verarbeitung direkt nach der Ernte, hohe Steinobstanteile<br />
(im Vergleich zum Kernobst) deuteten daher im Allgemeinen auf einen Erwerbsanbau hin.<br />
Bereits um 1800 wurden in Salzig schon in wirtschaftlich bedeutendem Umfang Kirschen<br />
verkauft (VANRECUM 1800).<br />
Während der linksrheinischen französischen Herrschaft 1798-1814 wurde der Obstbau durch<br />
die französische Verwaltung stark gefördert. Neben Apfelanbau wurde hier vor allem der als<br />
Erwerbsobstbau praktizierte Kirschanbau stark ausgebaut. Allein in den Jahren 1806-1809<br />
wurden im Bezirk Koblenz<br />
164.000 Obstbäume gepflanzt,<br />
davon über 25.000 Kirschen.<br />
Die nachfolgende preußische<br />
Verwaltung war ebenfalls<br />
bestrebt, den Obstanbau zu<br />
stärken. Es wurden<br />
Volksschullehrer mit der<br />
Vermittlung<br />
von<br />
Obstbauwissen betraut,<br />
Obstbau-Wanderlehrer<br />
Abb. 2: Kirschenmarkt in Salzig
Historischer Kirschanbau Oberes Mittelrheintal<br />
eingestellt und Winterschulen eingerichtet.<br />
Ab 1830 wurden in Salzig regelmäßig Kirschmärkte abgehalten (s. Abb. 2) und die<br />
Vermarktung genossenschaftlich organisiert. Die Kirschen wurden in Körben auf Kähnen<br />
nach Bonn und Köln, auf Dampfschiffen bis nach Holland und England exportiert. Aufgrund<br />
der langen Transportzeiten wurden die Kirschen hierzu kaum halbreif geerntet (DEGE 1973).<br />
In der 1860er Jahren waren die Kirschen in Salzig bereits ein bedeutender Wirtschaftsfaktor,<br />
der jährlich 6.000 bis 10.000 Taler einbrachte (LAHR o. Jg.). Auf der rechten Rheinseite wurde<br />
der Obstbau durch die 1879 gegründete Königliche Lehranstalt für Wein- und Obstbau in<br />
Geisenheim ebenfalls befördert. Auf nicht-staatlicher Seite waren verschiedene Obst- und<br />
Gartenbauvereine um Unterstützung und Stärkung des Obstbaus bemüht.<br />
Entstehung des linksrheinischen Kirschanbaugebietes Ende des 19. Jahrhunderts<br />
Um 1880 waren die bedeutendsten Kirschanbauzentren des 20. Jahrhunderts bereits im<br />
Aufbau, so linksrheinisch neben dem Zentrum Salzig die Gemeinden des Amtes Boppard<br />
(Brey, Niederspay, Oberspay, Boppard, Salzig und Weiler) und rechtsrheinisch neben dem<br />
Zentrum Kamp die Gemeinden Osterspai, Filsen und Kestert. Weiter südlich sind erste<br />
Kirschanbaugebiete nördlich von Bacharach, in St. Goarshausen und bei Lorch lokalisiert.<br />
Pflaumenanbau war zu dieser Zeit linksrheinisch in der Region um St. Goar bis Bacharach,<br />
rechtsrheinisch in der Region Lahnstein/Braubach, in geringen Anteilen auch südlich Lorch<br />
verbreitet. Die anderen Steinobstarten scheinen zu dieser Zeit nur geringe Bedeutung<br />
gehabt zu haben.<br />
Da die Märkte in Holland und England durch die italienische Konkurrenz verloren gingen,<br />
wurden das Steinobst in die sich entwickelnden Ballungszentren an Rhein und Ruhr geliefert,<br />
wobei sich der Transport zunehmend von der Rheinschiffart auf die neu entstandenen<br />
Eisenbahnlinien verlagerte. Aufgrund der kürzeren Transportzeiten wurde auch die<br />
Vermarktungsqualität der Früchte deutlich verbessert, da sie reif geerntet werden konnten<br />
und trotzdem frisch beim Verbraucher angelangten. Die Erträge aus dem Kirschanbau<br />
stiegen durch die bessere Vermarktung rapide, in Bad Salzig konnten sich die Einnahmen aus<br />
dem Kirschverkauf von 1881 bis 1887 verdreifachen. Trotz der aufstrebenden Entwicklung<br />
blieb jedoch die wirtschaftliche Bedeutung des Obstanbaus in dieser Zeit immer noch<br />
deutlich hinter der des Weinbaus zurück.<br />
Kirschanbau als Nachfolgekultur des Weinbaus<br />
Dies änderte sich jedoch in der Zeit nach der Jahrhundertwende durch die sich<br />
verschlechternde Lage des Weinbaus. Das Auftreten der Rebschädlinge und -krankheiten aus<br />
Nordamerika und Frankreich sowie eine Häufung von Jahren mit ungünstigen<br />
Witterungsperioden führten zu einer Aufeinanderfolge von Missernten, welche den<br />
Niedergang des gesamten Weinanbaus zur Folge hatte. Der Ende der 19. / Anfang des<br />
20. Jahrhunderts aufkommende Preisverfall durch Einfuhr preiswerter ausländischer Weine,<br />
erhöhten Bierkonsum sowie kartellartigen Preisabsprechen der örtlichen Weinhändler
Historischer Kirschanbau Oberes Mittelrheintal<br />
beschleunigte diese Entwicklung. Während anfänglich die Kirschbäume nur zwischen die<br />
Weinstöcke gesetzt wurden, wurden bald in zunehmendem Maße die gesamten Weinberge<br />
gerodet (insbesondere in den Rotweingebieten) und an ihrer Stelle Kirschpflanzungen, an<br />
klimatisch begünstigen Orten auch Aprikosen und Pfirsiche angebaut. Diese Entwicklung<br />
wurde durch die guten Preise forciert, die für Frischobst gezahlt wurden. Im Zuge dieser<br />
Entwicklung wurde 1904 die Baumschule Lehnert in Kamp gegründet, die 100 Jahre lang<br />
Baumschulware für die Region produzierte. Schwerpunkt des aufstrebenden Erwerbs-<br />
Süßkirschanbaus waren Anfang des 20. Jahrhunderts die Region von Brey bis Hirzenach bzw.<br />
Niederlahnstein bis Wellmich. Der Kirschanbau hatte um diese Zeit bereits eine so große<br />
wirtschaftliche Bedeutung, dass Missernten Notlagen der Bevölkerung in den<br />
Kirschgemeinden nach sich zogen (CARSTENSEN 1914). In den südlicheren Regionen des<br />
Oberen Mittelrheintals wurde der Obstbau dagegen überwiegend als auf Selbstversorgung<br />
ausgerichteter Streuobstanbau weiter betrieben, hier war bis zum 2. Weltkrieg der Weinbau<br />
dominierend.<br />
Der Schwerpunkt des Anbaus lag damals auf frühreifenden Sorten (LEHNERT 1913), als<br />
Hauptsorten werden ‘Geisepitter‘ und ‘Kesterter Schwarze‘ genannt (LORCH 1906). Besonders<br />
gut organisiert war der Kirschenmarkt in Salzig, wo während der Kirschenzeit zweimal täglich<br />
ein Kirschenmarkt abgehalten wurde. Bereits in der Nacht wurde mit dem Pflücken der<br />
Kirschen begonnen, die dann von 9.00 bis 10.00 Uhr auf dem Markt verkauft wurden. Die<br />
über Tag gepflückten Früchte wurden nochmals abends zwischen 19.00 und 20.00 Uhr<br />
verkauft. Zentraler Ort des Marktes war die Waage, die von der Gemeinde jedes Jahr<br />
verpachtet wurde. Den Pächtern war für das Wiegen eine Gebühr zu entrichten und die<br />
Einnahmen der Waage scheinen z. T. beachtlich gewesen zu sein.<br />
1.2.3 DAS AUF UND AB DER ENTWICKLUNG DES STEINOBSTANBAUS IM 20.JAHRHUNDERT<br />
Aufschwung ab Ende der 1920er Jahre<br />
Ende der 1920er bis Mitte der 1930er Jahre erlebte das Obere Mittelrheintal einen<br />
boomartigen Aufschwung des Obst- und insbesondere des Süßkirschanbaus, der sich auch<br />
auf Sauerkirschen ausweitete. Der Schwerpunkt des Anbaus verlagerte sich nun auf die<br />
rechtsrheinische Seite, so dass z. B. der ursprünglich ganz mit Reben bepflanzte Kamper<br />
Hang zu einer fast geschlossenen Kirschbaumpflanzung umgewandelt wurde (s. Abb. 3). Es<br />
wurde eine Vielzahl oft nur lokal begrenzt vorkommender Sorten angebaut.<br />
Rückläufige Phase ab Mitte der 1930er Jahre<br />
Ab Mitte der 1930er Jahre erfolgte eine rückläufige Phase, Ursache waren vermutlich u. a.<br />
die Frostschäden der Winter 1930/40, 1941/42 und 1946/47 sowie die Kriegswirren. Von<br />
1937 bis 1951 war landesweit ein Rückgang von 10% beim Steinobstanbau zu verzeichnen<br />
(STAT. LANDESAMT RHEINL.-PFALZ 1952). Insbesondere auf der rechten Rheinseite kam es in<br />
diesem Zeitraum zu einer zunehmenden Verlagerung vom Süß- zum Sauerkirschanbau. Als<br />
Unterkulturen wurden neben der Grünlandnutzung auf ebenen Flächen auch Ackernutzung<br />
sowie Sonderkulturen wie Beerenobst und Heilkräuter betrieben. Zu dieser Zeit (1936)<br />
wurde auch rechtsrheinisch die Vermarktung in absatzgenossenschaftlicher Form
Historischer Kirschanbau Oberes Mittelrheintal<br />
aufgenommen (Obstverwertungsgenossenschaft für den Kreis St. Goarshausen eGmbH), wie<br />
sie damals in Bad Salzig schon seit 100 Jahren praktiziert wurde. Hierzu wurden in einzelnen<br />
Gemeinden Obstsammelstellen eingerichtet, die erst den Erzeuger-Großmarkt in Koblenz<br />
belieferten (der auch für die linksrheinischen Sammelstellen zuständig war) und später zur<br />
Obst-Absatzgenossenschaft Rhein/Lahn in Niederlahnstein zusammengefasst wurden.<br />
Abb. 3: Kirschbäume oberhalb von Kamp-Bornhofen, um 1930<br />
Während anfänglich die Versteigerung des Obstes an den örtlichen Sammelstellen erfolgte,<br />
wurde später die gesamte Versteigerung zentral in Niederlahnstein bzw. Koblenz<br />
durchgeführt. Hauptabnehmer waren Großhändler, die das Frischobst in die Ballungszentren<br />
an Rhein und Ruhr sowie in norddeutsche Großstädte vermarkteten. Die<br />
genossenschaftliche Vermarktung sicherte den Erzeugern eine sofortige Abnahme ihrer<br />
leicht verderblichen Ware, ersparte langwieriges Verhandeln auf dem freien Markt und<br />
sicherte relativ gleichmäßige Erlöse. Es wurde auch eine Anlieferung von Kleinstmengen<br />
ermöglicht, die den Nebenerwerbsanbau stark förderte. Die Genossenschaften versuchten<br />
auch die Qualität der Ware zu verbessern, indem sie Größenstandards festlegten und auf<br />
eine Sortenvereinheitlichung hinwirkten (LANDWIRTSCHAFTSKAMMER RHEINLAND-NASSAU et al.<br />
o. Jg.). Straßenverkauf war gegenüber den genossenschaftlich vermarkteten Mengen von<br />
untergeordneter Bedeutung.<br />
Obstbauboom nach dem 2. Weltkrieg<br />
Nach der Währungsreform erfolgte Anfang der 1950er Jahren ein zweiter Boom im<br />
Steinobstanbau. Rheinland-Pfalz war zu dieser Zeit ein auch im Bundesvergleich<br />
bedeutender Obstproduzent, bezüglich der Obstbaumdichte lag es nach Baden auf Platz 2<br />
aller Bundesländer (STAT. LANDESAMT RHEINL.-PFALZ 1952). Auch bezüglich der Anzahl der<br />
ertragsfähigen Steinobstbäume in Bezug auf die gesamte landwirtschaftlichen Fläche (ein
Historischer Kirschanbau Oberes Mittelrheintal<br />
Maß für die Bedeutung des Obstbaus innerhalb der landwirtschaftlichen Produktion) steht<br />
Rheinland-Pfalz Anfang der 1950er Jahre ganz vorn: Sieht man von den Stadtstaaten<br />
Hamburg und Bremen mit ihren anders gearteten landwirtschaftlichen<br />
Produktionsverhältnissen ab, nimmt Rheinland-Pfalz Platz 1 der Bundesländer ein, der Anteil<br />
des Steinobstes (4 Millionen Bäume) betrug damals landesweit 46%. Auch bezüglich der<br />
Kirschen wird die herausragende Bedeutung des Oberen Mittelrheintals deutlich, dessen<br />
Baumzahlen landesweit nur noch von den Landkreisen Bingen und Mainz übertroffen<br />
werden. Die Obsternteergebnisse zeigen diesen Trend noch deutlicher: Stadt- und Landkreis<br />
Koblenz liegen mit über 22.000 dz an der Spitze der Süßkirschproduktion des ganzen Landes.<br />
St. Goar liegt auf Platz 2, St. Goarshausen hinter Bingen auf Platz 4.<br />
1958 standen in dem geschlossenen Kirschanbaugebiet des nördlichen Mittelrheintals über<br />
370.000 Kirschbäume (DÄHNE 1960b), der Bestand hatte sich gegenüber 1951 nochmals um<br />
fast 40% erhöht. Einen bedeutenden Anteil machten zu dieser Zeit die Regionalsorten<br />
‘Geisepitter‘ und ‘Helle Knorpel‘ aus (Anteil von jeweils 10% an der Gesamternte), der nur<br />
von einer „Dunklen Knorpel“ (12%) übertroffen wurde. ‘Hedelfinger‘ (6%) ‘Souvenir de<br />
Charmes‘ (5%) und ‘Kassins Frühe‘ (6%) wurden dagegen weniger angebaut (DÄHNE 1960b).<br />
Betrachtet man die durchschnittliche Süßkirschanlieferung der Anbaugemeinden in den<br />
Jahren 1954-1971, war auf der linken Rheinseite Bad Salzig in der Süßkirscherzeugung<br />
führend, gefolgt von Hirzenach, Boppard und Spay; rechtsrheinisch ist Kestert die führende<br />
Kirschanbaugemeinde, gefolgt von Niederlahnstein, Kamp und Filsen (s. Abb. 4, Zahlen nach<br />
DEGE 1973).<br />
Auch die Sauerkirschproduktion stieg nach dem 2. Weltkrieg aufgrund der erhöhten<br />
Nachfrage der Konservenindustrie stark an und lag in einigen Gemeinden höher als die<br />
Süßkirschproduktion. Linksrheinisch nahm Bad Salzig mit Abstand die Führungsposition in<br />
der Produktion ein, rechtsrheinisch lag Filsen an der Spitze.
Historischer Kirschanbau Oberes Mittelrheintal<br />
Abb. 4: Durchschnittliche Obstanlieferungen an den Sammelstellen der Obstabsatzgenossenschaften<br />
am Oberen Mittelrhein 1954-1971<br />
Den enormen Zuwachs des Kirschanbaus macht Abb. 5 für den rechtsrheinischen Bereich<br />
deutlich. Gegenüber dem Ende des 19. Jahrhunderts haben sich die produzierten<br />
Gesamtmengen fast verzehnfacht. Während Ende des 19. Jahrhunderts Kamp mit Abstand<br />
der größte Produzent war und diese Stellung auch noch bis 1938 halten konnte, setzte sich<br />
nach dem 2. Weltkrieg Kestert als Spitzenreiter durch.<br />
Abb. 5: Die durchschnittliche Kirschernte (Süß- und Sauerkirschen) in Zentnern im Vergleich Ende des 19.<br />
Jahrhunderts und Mitte des 20. Jahrhunderts (Zahlen 1938 nur mit Einschränkung zu betrachten)
Historischer Kirschanbau Oberes Mittelrheintal<br />
Der Anbau von anderem Steinobst scheint bis in der 1960er Jahre von geringerer Bedeutung<br />
gewesen zu sein. Im Landesdurchschnitt ist aber der Aprikosen- und Pfirsichanbau durchaus<br />
beachtlich, auch wenn er mengenmäßig stark hinter dem Süßkirschanbau zurücktritt.<br />
So liegt die Produktion der Kreise Koblenz und St. Goarshausen Anfang der 1950er Jahre im<br />
oberen Drittel der Landkreise (STAT. LANDESAMT RHEINL.-PFALZ 1952). Die Obstbaumzahlen des<br />
Loreleykreises von 1951 (s. Abb. 6) zeigen einen Schwerpunkt des Aprikosenanbaus in Kamp,<br />
Kestert und Niederlahnstein sowie einen verstärkten Pfirsichanbau in Niederlahnstein,<br />
Braubach und Oberlahnstein. Beide Obstarten sind auf klimatisch begünstigte Lagen<br />
angewiesen, die Aprikosen wurden aufgrund der Spätfrostgefahr bevorzugt in den Tallagen<br />
direkt am Rhein angepflanzt.<br />
Über den Pflaumenanbau gibt es nur wenige Angaben, vermutlich, weil er gegenüber dem<br />
Süßkirschanbau eine sehr viel geringere Bedeutung hatte. Anfang der 1950er Jahre lag er<br />
unter dem Landesdurchschnitt (STAT. LANDESAMT RHEINL.-PFALZ 1952). Gewisse Anteile an<br />
Pflaumenbäumen hat es bei Lahnstein, Rhens sowie im südlicheren Teil des Oberen<br />
Mittelrheintals gegeben. Es ist zu vermuten, dass es sich hierbei um überwiegend zur<br />
Selbstversorgung angebaute Streuobstbestände handelte, die bevorzugt auf den<br />
Hochterrassen lokalisiert waren.<br />
Das Steinobst wurde in der Region auch verarbeitet, es gab Keltereien und Brennereien<br />
Abb. 6: Anzahl der Steinobstbäume im Loreleykreis 1951<br />
darunter eine Abfindungsbrennerei in Kamp (Salzig-Brennerei), kurzfristig eine Marmeladenfabrik<br />
in Filsen sowie eine Konserven- und Marmeladenfabrik in Kamp-Bornhofen (Herzog<br />
Hofen Brennerei) (W. Spitz, Bad Salzig, P. Lehnert, Kamp, mündl. Mitt. 2009).<br />
Rückgang des Steinobstanbaus seit den 1960er Jahren
Historischer Kirschanbau Oberes Mittelrheintal<br />
Seit Mitte der 1960er Jahre ist ein kontinuierlicher Rückgang des Steinobstanbaus,<br />
insbesondere des Kirschanbaus zu verzeichnen. Neben Anbauproblemen wie der<br />
Ausbreitung von Krankheiten und eines um sich greifenden Kirschbaumsterbens infolge<br />
Überalterung und Bodenmüdigkeit waren dafür auch strukturelle Ursachen verantwortlich<br />
(DÄHNE 1964b). Der Handel verlangte nach größeren Partien von Ware einheitlicher Qualität,<br />
die zu erzielenden Absatzpreise konnten die steigenden Lohnkosten nicht kompensieren. Es<br />
wurde daher die Neuanlage rationeller beerntbarer Erwerbsplantagen in niedrigen<br />
Baumformen sowie eine Reduzierung und Umstellung der bisher zahlreichen, größtenteils<br />
lokalen bzw. regionalen Kirschsorten propagiert (DÄHNE 1962, 1964b). In Richtlinien zur<br />
Sortenvereinfachung, die vom Großmarktes Koblenz, der Obst-Absatzgenossenschaft Rhein-<br />
Lahn in Niederlahnstein sowie der Landwirtschaftskammer Rheinland-Nassau in Koblenz<br />
erstellt wurden, sind in den 1960er Jahren nur noch zehn Süßkirschsorten und zwei<br />
Sauerkirschsorten enthalten (LANDWIRTSCHAFTSKAMMER RHEINLAND-NASSAU et al. o. Jg.). Obwohl<br />
noch vier Regionalsorten empfohlen wurden, zeigt sich hier schon der Trend zu<br />
überregionalen und spätreifenden Sorten, wie es Dähne bereits ab 1960 propagiert (DÄHNE<br />
1960a). Die Konkurrenz von Einfuhren aus Südeuropa führte dazu, dass die<br />
standortklimatischen Vorteile des Rheintales nicht mehr so ins Gewicht fielen. Neben dem<br />
Anbau später reifender Sorten war so auch die Möglichkeit gegeben, mit dem Kirschanbau<br />
auf die großzügiger parzellierten Hochterrassen auszuweichen und so Schwierigkeiten durch<br />
Bodenmüdigkeit zu vermeiden sowie eine intensivere, stärker mechanisierte Bearbeitung zu<br />
ermöglichen. Die Strukturumstellung zu intensiv bewirtschafteten Obstplantagen wurde fast<br />
nur von Haupterwerbsbetrieben vorgenommen, der Nebenerwerbsanbau kam in den letzten<br />
Jahrzehnten fast völlig zum Erliegen.<br />
Aufgrund des Rückgangs des Obstanbaus ist seit den 1960er Jahren ist ein zunehmendes<br />
Brachfallen der ehemaligen Obstanbauflächen zu beobachten. Diese Entwicklung nahm<br />
ihren Beginn auf den schwer zu bewirtschaftenden Steilhanglagen, weitete sich aber<br />
zunehmend auch auf die ebenen Flächen der Mittel- und Niederterrassen aus. Auch die<br />
Förderung von Obstanlagen mit öffentlichen Mitteln konnte diese Entwicklung nicht<br />
beeinflussen. Es wurden hier von Mitte der 1950er bis zum Ende der 1960er Jahre<br />
vorwiegend Sauerkirschanlagen gefördert (DEGE 1973), für Süßkirschen scheint es um diese<br />
Zeit wirtschaftlich schon kaum noch eine Perspektive gegeben zu haben. In geringem<br />
Umfang wurden auch Pfirsichanlagen gefördert, während das Interesse an Pflaumen (incl.<br />
Zwetschgen und Mirabellen) zu dieser Zeit in der Region äußerst gering gewesen zu sein<br />
scheint.<br />
Im Zuge des allgemeinen Abschwungs des Obstbaus wurden Mitte der 1970er Jahre die<br />
beiden Großmärkte in Niederlahnstein und Koblenz zusammengelegt. 1983 wurde auch der<br />
Koblenzer Großmarkt geschlossen, das Obst muss seitdem in das 80 km entfernte Troisdorf<br />
gebracht werden (A. Weber, Koblenz, mündl. Mitt. 2009). Auch die früher in fast allen Orten<br />
existierenden Obstsammelstellen wurden nach und nach geschlossen. Aktuell existiert im<br />
gesamten Oberen Mittelrheintal nur noch die Sammelstelle in Mühlheim-Kärlich, die von<br />
wenigen Direktvermarktern beliefert wird.
Historischer Kirschanbau Oberes Mittelrheintal<br />
Die heute noch bewirtschafteten Erwerbsanlagen bestehen aus niedrigen Baumformen auf<br />
schwachwüchsigen Unterlagen (s. Abb. 7). Der anhaltende Trend zu dunklen, großfrüchtigen,<br />
festfleischigen und spätreifenden Kirschsorten führte dazu, dass nur noch ein enges<br />
Sortiment neuer Sorten kultiviert wird, das die vom Handel geforderten Fruchtgrößen<br />
entwickelt und in dieser Hinsicht den alten Sorten meist stark überlegen ist.<br />
Abb. 7: Erwerbsanlagen mit niedrigen Baumformen, Witzenhausen<br />
1.2.4 BEZIEHUNGEN ZWISCHEN DEM STEINOBSTANBAU UND DEN GESELLSCHAFTLICHEN ENTWICKLUNGEN AM<br />
BEISPIEL VON FILSEN<br />
Filsen liegt auf rechtsrheinischer Seite im Bereich des Rheinbogens südlich von Koblenz. Im<br />
Unterschied zu den meisten anderen Talorten verfügt es aufgrund der topographischen<br />
Verhältnisse über relativ ausgedehnte ebene landwirtschaftliche Flächen. Die wirtschaftliche<br />
Entwicklung dieser Region wurde seit dem Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert überwiegend<br />
vom Weinbau geprägt. Zwar wurden bereits Anfang des 14. Jahrhunderts erste Obstgärten<br />
in Osterspai erwähnt (VOLK 1998), diese dürften jedoch überwiegend dem Eigenverbrauch<br />
gedient haben. Die Entwicklung des Weinbaus in Filsen ist wie die des gesamten<br />
Mittelrheingebietes durch Aufschwünge und Niedergänge geprägt. Nach einer Blütezeit bis<br />
ca. 1600 kam es im 17. Jahrhundert durch Nachwirkungen des 30-jährigen Krieges zum<br />
Verfall des Weinbaus. Hierfür waren neben Bevölkerungsverlusten und Verwüstungen der<br />
Anbauflächen auch die eingeführten hohen Zölle und die damit erschwerte Vermarkung des<br />
Weins verantwortlich. Erst seit Beginn des 19. Jahrhundert kam es wieder zu einer gewissen<br />
Gesundung des Weinbaus, die sich vor allem auf eine Umstellung zu Qualitätsweinen<br />
gründete. Ein regelrechter Aufschwung mit Ausweitung der Rebflächen war aufgrund<br />
mehrerer Jahre mit guten Weinerträgen ab Ende der 1850er Jahre zu verzeichnen.
Historischer Kirschanbau Oberes Mittelrheintal<br />
Doch bereits wenige Jahrzehnte später geriet der Weinbau erneut in eine Krise, deren<br />
Ursachen bereits oben beschrieben sind. Die aufkommende Industrialisierung, insbesondere<br />
im Bereich der Lahnmündung führte daher ab den 1880er Jahren zur vermehrten<br />
Abwanderung der Bevölkerung in industrielle Berufe. Aufgrund der ungünstigen Entwicklung<br />
im Weinbau erfolgte, insbesondere bei den jetzt im Nebenerwerb wirtschaftenden<br />
Betrieben, sukzessiv eine Umstellung vom Wein- zum Obstbau. Diese Entwicklung wurde<br />
durch die Tatsache forciert, dass der Obstbau arbeitsextensiver als der Weinbau und daher<br />
besser als Nebenerwerbstätigkeit geeignet ist.<br />
Da für ein auskömmliches Einkommen aus dem Obstbau größere Flächen als beim Weinbau<br />
benötigt werden, konnten nur größere Betriebe diese Umstellung haupterwerblich<br />
vornehmen. Kleinere Betriebe, die nicht haupterwerblich einer anderen Einnahmequelle<br />
nachgingen, erprobten zur Existenzsicherung Kombinationen des Obstbaus mit anderen<br />
Sonderkulturen. So wurden vor dem 1. Weltkrieg als Unternutzung der Kirschkulturen auch<br />
Heil- und Gewürzkräuter (Tannnessel, Salbei und Wermut) für pharmazeutische Zwecke<br />
angebaut, um den Ertrag der Flächen zu steigern. Ab den 1920er Jahren wurde auch der<br />
Erdbeeranbau eingeführt, der sich vom Ablauf der Pflegearbeiten gut mit dem Süß- und<br />
wegen der späteren Erntearbeiten insbesondere mit dem Sauerkirschanbau kombinieren<br />
ließ. Ab Ende der 1920er Jahre wurden daher zusätzlich vermehrt Sauerkirschen zu<br />
Verarbeitungszwecken angebaut, was auch in der Abnahme der Erträge der Süßkirschen<br />
infolge mangelnder Düngung und Pflege begründet war. Die Intensivierung des Obstbaus<br />
scheint in Filsen derart erfolgreich gewesen zu sein, dass für einige Jahrzehnte des<br />
beginnenden 20. Jahrhunderts die Abwanderung in die Industrie stagnierte. Die Rebflächen<br />
der Mittelterrasse und die Steillagen, ab den 1930er Jahren infolge des allgemeinen<br />
Aufschwungs im Obstanbau aber auch die der Niederterrasse (die vorher noch dem Anbau<br />
von Feldfrüchten vorbehalten war) wurden vorwiegend mit Kirschbäumen bepflanzt, so dass<br />
der Weinbau zur Bedeutungslosigkeit absank.<br />
Ab Mitte der 1930er Jahre wandten sich jedoch insbesondere Nebenerwerbslandwirte<br />
wieder verstärkt der Industriearbeit zu und Ende der 30er Jahre entwickelte sich der<br />
Obstanbau daher wieder rückläufig. Erst in den Jahren nach dem 2. Weltkrieg kam es durch<br />
die erhöhte Nachfrage im Zuge des allgemeinen wirtschaftlichen Aufschwungs wieder zum<br />
Ausbau des Obstanbaus. Die Zahl der ertragsfähigen Süßkirschbäume nahm in der<br />
Gemarkung Filsen von 1951 bis 1965 um ca. 70%, die der Sauerkirschbäume sogar um 120%<br />
zu. Der Nieder- und Mittelterrassenhalbmond zwischen Filsen und Osterspai entwickelt sich<br />
in diesem Zeitraum zu einer fast geschlossenen Obstbaumflur. Diese Entwicklung war vor<br />
allem durch Nebenerwerbslandwirte getragen, die den Obstanbau aufgrund der hohen<br />
Erträge intensivierten.<br />
Ab Mitte der 1960er Jahre sank die Bedeutung des Obstanbaus durch sich verschlechternde<br />
Vermarktungsmöglichkeiten (sinkende Preise aufgrund ausländischer Einfuhren). Auch trat<br />
angesichts steigendem Haupterwerbseinkommen die Bedeutung des Einkommens durch<br />
nebenerwerblichen Obstanbaus zunehmend in den Hintergrund. Auch viele
Historischer Kirschanbau Oberes Mittelrheintal<br />
Haupterwerbsobstbauer wanderten in andere Berufszweige ab (bevorzugt in die<br />
Ballungszentren Koblenz sowie Rhein/Main) und führten, wenn überhaupt, den Obstanbau<br />
nur noch im Nebenerwerb weiter. Die Aufgabe des im Nebenerwerb praktizierten Obstbaus<br />
erfolgte i.d.R. spätestens beim Wechsel der für das Einkommen verantwortlichen<br />
Generation.<br />
Abb. 8:<br />
Nutzungskarte Filsen 1965/66 (hellgraue Flächen genutzte, dunkelgraue Flächen<br />
brachgefallen Obstanlagen), Quelle DEGE 1973<br />
Aufgrund der sich wandelnden Vorstellungen zur Lebens- und Freizeitgestaltung wie auch<br />
der sinkenden Obsterlöse waren die nachfolgenden Generationen nicht mehr bereit, ihren<br />
Urlaub und die sonstige Freizeit in einen wenig rentablen Nebenerwerb zu investieren.<br />
Seit den 1960er Jahren hat daher ein zunehmendes Brachfallen der einstigen<br />
Obstanbauflächen eingesetzt. Diese Entwicklung setzte zuerst in der Gemarkung Osterspai<br />
sowie an den Steilhängen des Kamper Hangs ein. Schon Mitte der 1960er Jahre war auf der<br />
Mittel- und Niederterrasse ein Mosaik aus bewirtschafteten und brachgefallenen Flächen<br />
vorhanden (Abb. 8, DEGE 1973).<br />
Heute sind die Brachestadien der Steilhangflächen schon soweit fortgeschritten, dass die<br />
ehemaligen Parzellengrenzen kaum noch erkennbar sind, auf den Terrassenflächen sind Teile<br />
der Obstbestände gerodet worden.