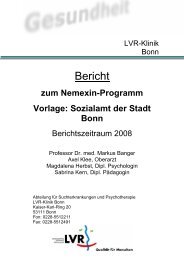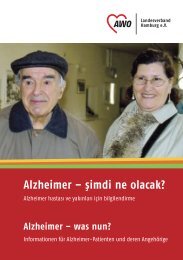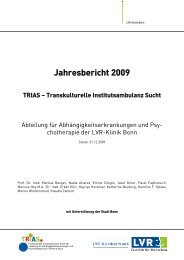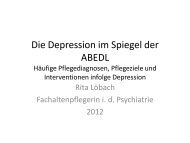Jahresbericht 2008 - LVR-Klinik Bonn
Jahresbericht 2008 - LVR-Klinik Bonn
Jahresbericht 2008 - LVR-Klinik Bonn
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>LVR</strong>-<strong>Klinik</strong> <strong>Bonn</strong><br />
TRIAS_Transkulturelle Institutsambulanz<br />
für Suchterkrankungen und<br />
Psychotherapie<br />
<strong>Jahresbericht</strong> <strong>2008</strong><br />
Transkulturelle Institutsambulanz<br />
für Suchterkrankungen und Psychotherapie<br />
der <strong>LVR</strong> <strong>Klinik</strong> <strong>Bonn</strong> (TRIAS)<br />
Stand: Februar 2009<br />
Professor Dr. med. Markus Banger<br />
Josef Driter<br />
Marissa Hey M.A.<br />
Dr. med. Erkan Kilic<br />
Katharina Neuburg<br />
Yüksel Özcan<br />
Katharina Pries<br />
Karoline F. Spiske<br />
Marion Winterscheid<br />
Klaudia Zantner<br />
mit Unterstützung der Stadt <strong>Bonn</strong>
Inhalt<br />
1 Migration und Gesundheit Seite 03<br />
2 Transkulturelle Ambulanz: Zusammenführung der Migrationsprojekte Seite 04<br />
3 Herausforderungen und Besonderheiten der transkulturellen Behandlung<br />
Seite 05<br />
4 Bericht der Transkulturellen Ambulanz im Allgemeinen Seite 07<br />
4.1 Regelmäßige Veranstaltungen Seite 07<br />
4.2 Vernetzung Seite 07<br />
4.3 Öffentlichkeitswirksamkeit Seite 08<br />
4.4 Personalveränderung Seite 08<br />
4.5 Kultursensibilität in der Gesamtabteilung Seite 08<br />
5 Zielformulierungen aus dem Bericht 2007 Seite 09<br />
6 Bericht „Programm für russischsprachige Migranten“ Seite 10<br />
6.1 Multiprofessioneller und psychoedukativer Ansatz Seite 10<br />
6.2 Qualitätssicherung und Standardisierung Seite 10<br />
6.3 Offene Gesprächsgruppe für alkoholerkrankte russischsprachige<br />
Migranten Seite 10<br />
6.4 Weitere Entwicklungen Seite 11<br />
7 Bericht „Programm für Migranten aus dem türkischsprachigen Kulturraum“<br />
Seite 11<br />
7.1 Patienten Seite 11<br />
7.2 Spielsucht Seite 12<br />
7.3 Statistische Erhebungen und Qualitätssicherung Seite 12<br />
7.4 Weitere Aktivitäten Seite 12<br />
8 Bericht „Angebot für polnischsprachige Migranten“ Seite 13<br />
8.1 Methode Seite 13<br />
8.2 Teilnehmer Seite 14<br />
8.3 Weitere Aktivitäten Seite 14<br />
9 Zukünftige Weiterentwicklung, weiterführende Ziele, Ausblick Seite 15<br />
Literatur Seite 15<br />
II
1 Migration und Gesundheit<br />
Migration, verstanden als dauerhafte oder vorübergehende, aber über längere Zeit bestehende<br />
Verlegung des Wohnsitzes (vgl. Hausotter / Schouler-Ocak 2007), ist in Deutschland<br />
weit verbreitet. Die Gründe von Migration sind dabei vielfältig, Migranten sind „grob umrissen<br />
a) Hochqualifizierte zum Zwecke der Arbeitsaufnahme, b) Studenten, c) politische Flüchtlinge,<br />
d) Spätaussiedler sowie e) Ehepartner und Kinder von hier lebenden Zuwanderern und<br />
Deutschen“ (Finkelstein 2006:13). In der Transkulturellen Ambulanz werden vor allem Patienten<br />
der Gruppen c) bis e) behandelt.<br />
Die Ausländerzahlen können dieses Phänomen in seiner Gesamtheit nicht repräsentieren,<br />
da sie „1. Geburten von Ausländern in Deutschland (die sog. zweite und dritte Migrantengeneration,<br />
die selbst nie migrierte), 2. Todesfälle von Ausländern in Deutschland sowie 3. Einbürgerungen“<br />
(BAMF <strong>2008</strong>: 1) nicht berücksichtigen. Dennoch tragen die 7,3 Millionen<br />
Ausländer (8,9% Bevölkerungsanteil), die zum 31.12.2007 in Deutschland lebten und deren<br />
Zahl seit 2004 weitgehend konstant ist (BAMF <strong>2008</strong>: 2; 4), zu dem Bild Deutschlands als<br />
Einwanderungsland bei, sowie ihre verschiedenen Nationalitäten die Diversität der Bevölkerung,<br />
die in Deutschland lebt, widerspiegeln. Im Land Nordrhein-Westfalen liegt der Ausländeranteil<br />
zum 31.12.2007 über dem bundesdeutschen Durchschnitt bei 10,6% (Statistisches<br />
Bundesamt <strong>2008</strong>), in der Stadt <strong>Bonn</strong> sogar bei 16,1%, im Rhein-Sieg-Kreis dahingegen nur<br />
bei 8,4% (LDS NRW <strong>2008</strong>).<br />
Dabei sind die Migranten keinesfalls als homogene Gruppe zu bezeichnen, sondern unterscheiden<br />
sich hinsichtlich ihrer Lebenswelten beträchtlich, wobei Herkunftsland und Religionszugehörigkeit,<br />
die als die klassischen Differenzierungsmerkmale in Bezug auf Fremdsein<br />
gelten, zum Teil weniger bedeutsam sind als soziale Schichtzugehörigkeit, politische und berufliche<br />
Stellung, Alter, Geschlecht, etc. (vgl. Sinus Sociovision 2009). Der russische Arzt ist<br />
dem deutschen Arzt vielleicht näher als der deutsche Produktionshelfer dem deutschen Arzt.<br />
Das Robert Koch-Institut widmet dem Thema Migration und Gesundheit <strong>2008</strong> eine Sonderberichterstattung,<br />
die zusammenfasst, dass mit einem Migrationshintergrund spezifische<br />
Gesundheitsrisiken verbunden seien, Migration jedoch nicht per se krank oder kränker mache<br />
(vgl. RK-I <strong>2008</strong>: 129). Es wird deutlich, dass Bedarf an einer Versorgung, die auf die<br />
besonderen Bedürfnisse von Migranten zugeschnitten ist, besteht. Zur Versorgung suchtkranker<br />
Migranten liefert dieser Bericht keine eindeutigen Zahlen. Verschiedene Statistiken,<br />
die aber keine Repräsentativität für die Gesamtgesellschaft besitzen, deuten darauf hin, dass<br />
über Häufigkeitsverteilungen und Vergleiche zwischen suchtkranken Migranten und „Nicht-<br />
Migranten“ nur spekuliert werden kann und dass Bedarf an genauerem Datenmaterial besteht<br />
(Robert Koch-Institut <strong>2008</strong>: 59). Dennoch wird die Hypothese erstellt, dass spezifische<br />
3
Zusammenhänge zwischen Migrationsgeschichte und Suchterkrankung bestehen könnten<br />
(vgl. Robert Koch-Institut <strong>2008</strong>: 57).<br />
Migration gehört nach Czycholl 1 (2002) zu den „Krisenzeiten“ menschlicher Entwicklung, von<br />
der jedoch im Gegensatz zu den Prozessen Geburt, Tod, Erwachsen-Werden nicht alle<br />
Menschen betroffen sind. Migration ist mit Risiken und auch mit Chancen verbunden, bedeutet<br />
aber stets „ein Lebensereignis […], das Belastungen mit sich bringt“ (Czycholl 2002: 5;<br />
vgl. auch: Hausotter / Schouler-Ocak 2007), bedeutet Identitätsverlust, Neuorientierung,<br />
Wandern, das Verlassen vertrauter Denk- und Handlungsmuster, Verunsicherung, möglicherweise<br />
Statusverlust, Ängste, Isolation, Ghettoisierung, Trennung. Damit sind Migranten<br />
einer großen Anzahl an Faktoren ausgesetzt, die Abhängigkeitserkrankungen begünstigen,<br />
stellen bei hoch einzuschätzender Dunkelziffer einen vergleichsweise großen Anteil unter<br />
den Suchtkranken dar und fordern bisherige Suchthilfekonzepte vorwiegend aufgrund kultureller<br />
Diversität, anderer Verständnisse im Umgang mit Suchtmitteln und Psychotherapie, mit<br />
Institutionen und Suchthilfe heraus (vgl. Czycholl 2002).<br />
2 Transkulturelle Ambulanz: Zusammenführung der Migrationsprojekte 2<br />
Zu Beginn des Jahres <strong>2008</strong> wurden die einzelnen Migrationsprojekte respektive die migrantenspezifischen<br />
Angebote der Suchtambulanz zur Transkulturellen Ambulanz zusammengeführt.<br />
Damit wird auf die eingangs dargestellte Bedeutung von Migration als omnipräsentem<br />
Phänomen der Gegenwartsgesellschaft reagiert. Die Zusammenführung verfolgt das Ziel, die<br />
Beschäftigung mit den Herausforderungen einer Einwanderungsgesellschaft nicht auf<br />
einzelne nationale und sprachliche Gruppen zu beschränken, sondern sich zusätzlich grundsätzlich<br />
der Frage zu stellen, welche Zusammenhänge es zwischen Migrations- und Suchtgeschichte<br />
der Patienten gibt, welche Bedürfnisse Migranten im <strong>Klinik</strong>- und Ambulanzalltag<br />
haben und wie die Abteilung diesen gerecht werden kann. Als übergeordnetes Ziel wird dabei<br />
Qualitätsverbesserung und Effizienz der Behandlung verfolgt. Mit der Suche nach neuen<br />
Behandlungsansätzen können einerseits Zeitaufwand – und damit Kosten – reduziert werden,<br />
andererseits die Zufriedenheit von <strong>Klinik</strong>personal und Patienten erhöht werden, denn für<br />
diese sind die kulturellen und sprachlichen (Verständigungs-)Probleme nicht selten mit hoher<br />
Frustration verbunden. Des Weiteren dient die Beschäftigung mit kultursensibler Behandlung<br />
und der Erreichbarkeit der Patienten dazu, dem Versorgungsauftrag der <strong>Klinik</strong> gerecht zu<br />
werden und einen Beitrag zur öffentlichen Gesundheitsversorgung aller Einwohner des Versorgungsgebietes<br />
zu leisten.<br />
1 Czycholl beschränkt sich in seiner Analyse auf Migranten aus den ehemaligen GUS, das heißt vorrangig<br />
auf Spätaussiedler. Diese Ergebnisse werden hier in Bezug auf Migranten im Allgemeinen angewendet.<br />
2 vgl. hierzu vor allem die <strong>Jahresbericht</strong>e des Migrationsprojektes aus dem Jahr 2006 (Banger et al.<br />
2006) und der Interkulturellen Ambulanz aus dem Jahre 2007 (Banger et al. 2007).<br />
4
Das Wort „transkulturell“ im Namen der Ambulanz betont die Vielschichtigkeit sowie die innere<br />
Verwobenheit von Kulturen, das gegenseitige Beeinflussen und Durchdringen und zielt<br />
dabei auf eine kulturallgemeine und kulturüberschreitende Betrachtungsweise (vgl. Hepp,<br />
2006: 67; Hinnekamp 1994; Matoba/Scheible 2007; Welsch 1995).<br />
„Die Transkulturelle Psychiatrie ist ein Zweig der Psychiatrie, die sich mit den kulturellen<br />
Aspekten der Ätiologie, der Häufigkeit und Art geistiger Erkrankungen sowie mit<br />
der Behandlung und Nachbehandlung der Krankheiten innerhalb einer gegebenen<br />
Einheit befaßt. Der Begriff Transkulturelle Psychiatrie, die eine Erweiterung der Kulturellen<br />
Psychiatrie ist, bedeutet, dass der wissenschaftliche Beobachter über den<br />
Bereich einer kulturellen Einheit hinausblickend andere Kulturbereiche einbezieht.“<br />
(Wittkower 1972, in Machleidt o.J.: 1)<br />
Die drei Hauptzweige der Transkulturellen Ambulanz sind die bereits länger bestehenden<br />
Angebote und Programme für russisch-, türkisch- und polnischsprachige Migranten mit<br />
Suchterkrankungen.<br />
Bereits 2002 wurde in der Institutsambulanz für Suchterkrankungen und Psychotherapie ein<br />
Migrationsprojekt für russischsprachige Migranten, das psychotherapeutische, fachärztliche<br />
und sozialarbeiterische Behandlung und Begleitung umfasst, eingerichtet. Die Patienten<br />
werden durch Josef Driter, einen Migrationspädagogen, der selbst aus den ehemaligen GUS<br />
stammt, kultursensibel und muttersprachlich begleitet und betreut. Durch die Ärztin Katharina<br />
Pries, die das Projekt auf Honorarbasis unterstützt, ist weitere muttersprachliche Behandlung<br />
möglich. Dieses Projekt wird mit Unterstützung der Stadt <strong>Bonn</strong> realisiert.<br />
Im Jahre 2006 wurde ein Projekt für Migranten aus dem türkischsprachigen Kulturraum etabliert.<br />
Die Patienten werden von Dr. Erkan Kilic (Arzt) und der Yüksel Özcan (Arzthelferin)<br />
behandelt und versorgt. Es erfolgte eine Anschubfinanzierung durch den Landschaftsverband<br />
Rheinland.<br />
2007 wurde mit einer Gruppe für polnischsprachige Migranten ein weiteres Angebot bereitgestellt.<br />
Die Gruppe wird von der Sozialarbeiterin Klaudia Zantner geleitet und ist zur Zeit<br />
noch nicht refinanziert.<br />
3 Herausforderungen und Besonderheiten in der transkulturellen Behandlung<br />
Die Mitarbeiter der Transkulturellen Ambulanz berichten über Herausforderungen und Besonderheiten,<br />
die in Zusammenhang mit der Behandlung und Betreuung von Migranten –<br />
von Menschen mit anderen Muttersprachen und kulturellen Hintergründen – wiederholt auf-<br />
5
treten. Diese Beobachtungen werden im Austausch mit den Mitarbeitern der Ambulanz und<br />
der Abteilung für Suchterkrankungen und Psychiatrie, sowie durch allgemeine Literatur gestützt.<br />
Menschen aus anderen Kulturkreisen begegnen dem deutschen Suchthilfesystem häufig mit<br />
Misstrauen. Dies hat zum einen mit einem generellen Misstrauen gegenüber Institutionen<br />
und psychiatrischen Einrichtungen zu tun, zum anderen mit der Unkenntnis des hiesigen<br />
Verständnisses von Suchthilfe, Behandlung, Beratung und Betreuung. Zusätzliche Sprachprobleme<br />
erschweren es, die Besonderheiten und das Hilfeangebot (statt Strafangebot) verständlich<br />
zu machen. Dies hat zur Folge, dass für Migranten je Kontakt mehr Zeit benötigt<br />
wird und dass eine individuelle und kontinuierliche Betreuung durch den/die Behandler/in<br />
gewährleistet sein sollte. Es scheint daher zielführend zu sein, wenn der/die jeweilige Behandler/in<br />
respektive das Behandlerteam selbst Migrationserfahrung hat und / oder über<br />
besondere interkulturelle Kompetenzen verfügt. Ein auf dieser Basis entstehendes therapeutisches<br />
Vertrauensverhältnis bildet die Basis für eine erfolgversprechende Behandlung und<br />
Betreuung.<br />
Im abteilungsweiten Umgang wird berichtet, dass die Scheu, die Patienten gegenüber den<br />
deutschen Mitarbeitern haben, auch auf der Gegenseite zu finden ist. Auch für Mitarbeiter ist<br />
eine Begegnung mit anderen Weltbildern, mit anderen Selbstverständlichkeiten, mit anderen<br />
Sprachen eine große Herausforderung. Deshalb ist es wichtig, dass die Erfahrungen in der<br />
Arbeit mit Migranten weiter verbreitet werden, dass das Thema „Multikulturalität“ stetig auf<br />
der Agenda aller Mitarbeiter aktualisiert wird und dass das Team sich selbst aus verschiedenen<br />
Kulturen und Herkunftsländern zusammensetzt, so dass die Interkulturalität zur Normalität<br />
werden kann. Letztlich, so könnte man den Gedanken fortführen, bedeutet jeder Kontakt<br />
eine interkulturelle Begegnung, denn immer, wenn zwei Menschen sich begegnen, treffen<br />
zwei Weltsichten, zwei Interpretationsmöglichkeiten, zwei individuelle Lebensläufe und zwei<br />
soziale Netzwerke aufeinander.<br />
Auch Sucht und Krankheit werden kulturell divers verstanden. Was als suchtkrank, abhängig<br />
oder süchtig bezeichnet wird, und an welche Stoffe dies gebunden ist, hängt stark davon ab,<br />
was die Gesellschaft als „normal“ und „üblich“ bezeichnet. Welche Getränke gehören beispielsweise<br />
zum täglichen Konsum aller dazu? Nicht selten sind dabei Unterschiede zum<br />
deutschen Verständnis, aber auch zur deutschen Gesetzgebung gegeben.<br />
Die Differenzierung zwischen somatischen und psychischen Erkrankungen – die „Trennung“<br />
von Körper und Seele –, die in Deutschland geläufig ist, ist ebenso wenig universell. Möglicherweise<br />
werden psychische Erkrankungen als persönliches Versagen gewertet (und nicht<br />
als Krankheit betrachtet), andererseits wiederum Körper und Seele als Einheit betrachtet.<br />
6
So wie sich das Verständnis von Krankheit und Sucht(krankheit) unterscheidet, so unterscheidet<br />
sich auch der Umgang mit Erkrankten – von der familiären Unterstützung, von Isolation,<br />
zentraler Betreuung und sozialem Umfeld bis zur institutionellen Betreuung durch<br />
Krankenhäuser, Gesundheitsbehörden, öffentliche Beratungsstellen, Ärzte, Sozialarbeiter<br />
und Therapeuten.<br />
Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch die Bedeutung der sozial konstruierten Geschlechterrollen<br />
(gender) – ein Thema, das in Zukunft in der Transkulturellen Ambulanz vermehrt<br />
berücksichtigt werden soll.<br />
Diese Herausforderungen bedeuten, dass erprobte Behandlungskonzepte nicht immer angewendet<br />
werden können. Sie fordern eine zeitlich intensivere Betreuung, sowie einen insgesamt<br />
längeren Therapieverlauf, der auch daraus resultiert, dass sich die in Deutschland<br />
lebenden Migranten nicht selten in einer sozialen Situation befinden (soziale Schicht, Aufenthaltsstatus,<br />
Arbeitsituation, Trennung von Familienangehörigen, Sprachschwierigkeiten,<br />
Isolation etc.), die den Therapieverlauf in besonderem Maße erschweren und eine umfassende,<br />
multiprofessionelle Versorgung fordern.<br />
4 Bericht der Transkulturellen Ambulanz im Allgemeinen<br />
4.1 Regelmäßige Veranstaltungen<br />
Die Frequenz der multiprofessionellen Teamsitzungen aller in der Transkulturellen Ambulanz<br />
beschäftigten Mitarbeiter wurde von einem vier- auf einen zweiwöchigen Rhythmus erhöht.<br />
Diese Teamsitzungen verfolgen strategische und konkret handlungsspezifische Ziele. Sie<br />
dienen dem Austausch von Erfahrungen, der gegenseitigen Fortbildung und Bereicherung in<br />
einem multikulturellen und multiprofessionellen Team. Des Weiteren sind die zukünftige Ausrichtung,<br />
die Weiterentwicklung und Sicherung der Finanzierung Aspekte, die kontinuierlich<br />
im Team fortgeschrieben werden. Dabei stellen die stetige Qualitätsverbesserung, Evaluation<br />
und kritische Überprüfung der Projektziele (z.B. die Erreichbarkeit von suchtkranken<br />
Migranten und deren Verweildauer im Programm) wichtige Punkte dar.<br />
Die Teamsitzungen werden von der Oberärztin Karoline Spiske geleitet, die auch die Mitarbeiter<br />
der Transkulturellen Ambulanz individuell supervisorisch betreut.<br />
4.2 Vernetzung<br />
<strong>Klinik</strong>intern ist die Transkulturelle Ambulanz eng mit der Ambulanz für Suchterkrankungen<br />
und Psychotherapie verzahnt, sowie auch mit dem stationären Bereich. Die Mitarbeiter der<br />
Transkulturellen Ambulanz befinden sich im permanenten Austausch mit den jeweils ande-<br />
7
en Therapeuten und Behandlungsteams und vermitteln bei Bedarf weitergehende ambulante<br />
Hilfen.<br />
Es ist angestrebt, auch abteilungsübergreifend die Fragestellung kultursensibler Behandlung<br />
in der <strong>Klinik</strong> weiter vorwärts zu treiben. Dazu gab es bereits erste Kontakte mit den Integrationsbeauftragten<br />
der <strong>Klinik</strong>.<br />
<strong>Klinik</strong>extern wird die Mitarbeit im <strong>Bonn</strong>er Arbeitskreis „Migration und Sucht“, sowie in der<br />
dazugehörigen Arbeitsgruppe fortgesetzt.<br />
Eine weitere Schnittstelle nach außen ist der Dialog mit Kostenträgern und Leistungserbringern,<br />
wobei die Darstellung des besonderen Behandlungsbedarf von Patienten mit Migrationshintergrund<br />
ein wichtiges Feld ist. Dipl. Sozialarbeiterin Marion Winterscheid, die sich<br />
diesen Fragestellungen federführend widmet, trägt auch hier zur Sensibilisierung für kulturspezifische<br />
Besonderheiten in der Behandlung und Betreuung von suchtkranken Migranten<br />
bei.<br />
4.3 Öffentlichkeitswirksamkeit<br />
<strong>2008</strong> erschien der Tagungsband zu den Interkulturellen Psychotherapietagen 2007 mit Beiträgen<br />
von Prof. Dr. Markus Banger (<strong>2008</strong>), Karoline F. Spiske und Dr. Erkan Kilic (<strong>2008</strong>).<br />
Im Rahmen der Umbenennung der <strong>Klinik</strong> in „<strong>LVR</strong>-<strong>Klinik</strong> <strong>Bonn</strong>“ werden im Jahr 2009 neue<br />
Flyer für die Transkulturelle Ambulanz erstellt werden.<br />
Auch im Arbeitskreis „Migration und Sucht“ werden neue Flyer erstellt. Dabei sollen die Angebote<br />
für türkischsprachige und polnischsprachige Migranten, die dort bislang noch nicht<br />
erschienen, zusätzlich aufgenommen werden.<br />
4.4 Personalveränderung<br />
Im Dezember <strong>2008</strong> wurde Marissa Hey (Sozialwirtin (FH), Master of Arts in Kommunikationsund<br />
Kulturwissenschaften) mit einer halben Stelle in der Transkulturellen Ambulanz eingestellt,<br />
um sich jenseits der einzelnen Sprach- und Kulturräume konzeptionell dem Thema der<br />
kultursensiblen Behandlung von suchterkrankten Patienten mit Migrationshintergrund zu<br />
widmen. Nach sechswöchiger Hospitation in der Abteilung für Suchterkrankungen und Psychotherapie<br />
– auf den verschiedenen Stationen, in der Ambulanz und im Casemanagement<br />
– nahm sie Mitte Januar 2009 ihre Tätigkeit in der Transkulturellen Ambulanz auf.<br />
4.5 Kultursensibilität in der Gesamtabteilung<br />
Aktuell wird ein Fortbildungskonzept entwickelt, das abteilungsübergreifend und klinikweit für<br />
alle Mitarbeiter zugänglich sein wird. Es wird intensiv für die Bedeutung des Themas geworben.<br />
Karoline Spiske, Dr. Erkan Kilic und Marissa Hey der Transkulturellen Ambulanz, sowie<br />
8
Dr. Gelas Habasch, die Integrationsbeauftragte der <strong>LVR</strong> <strong>Klinik</strong> <strong>Bonn</strong>, sind an der Konzeption<br />
beteiligt und möchten innerhalb der Fortbildungsveranstaltungen ihre spezifischen Erfahrungen<br />
und Kenntnisse an alle <strong>Klinik</strong>mitarbeiter weitergeben.<br />
5 Zielformulierungen aus dem Bericht 2007<br />
Folgende Ziele wurden im <strong>Jahresbericht</strong> 2007 formuliert und konnten weiter vorangetrieben<br />
werden.<br />
S.10: „Zielsetzungen des integrativen Ansatzes ist die weitere Sensibilisierung<br />
für und Berücksichtigung von migrationsspezifischen Stressfaktoren und kulturspezifischen<br />
Einflüssen in der Behandlung von Suchterkrankungen, die Förderung<br />
der Interkulturalität in der Gesamtabteilung und die Entwicklung neuer<br />
Behandlungsansätze.“<br />
→ In Zusammenarbeit mit den Integrationsbeauftragten der gesamten <strong>LVR</strong>-<br />
<strong>Klinik</strong> ist eine abteilungsübergreifende Fortbildungsveranstaltung zum Thema<br />
„Kultursensibilität“ in der Konzeptionierungsphase.<br />
→ Verstärkte Erhebungen und Analysen migrantenspezifischer Besonderheiten<br />
in der Behandlung werden derzeit geplant beziehungsweise bereits durchgeführt<br />
und evaluiert.<br />
S.20 Synergieprozesse auch auf überregionaler Ebene im Rheinland nutzen,<br />
z.B. bei der Übersetzung von Flyern, dem Aufbau von Internetseiten etc.<br />
→ Weitere Zusammenarbeit im lokalen Arbeitskreis „Migration und Sucht“, derzeit<br />
mit Neuauflage von Flyern beschäftigt.<br />
S.26 fehlende finanzielle Mittel, um für Polnisch sprechende Patienten eine qualifizierte<br />
Behandlung anzubieten<br />
→ Es konnte bereits eine inhaltliche Erweiterung des Gruppenangebotes erreicht<br />
werden. Ziel für 2009 ist die Ausweitung des Angebots in Anlehnung an<br />
das multidimensionale Behandlungsprogramm für russischsprachige Patienten<br />
sowie eine Akquirierung dazu notwendiger Finanzierungsmöglichkeiten.<br />
S. 31: Kultursensible und die Integration fördernde Suchtherapie in der ambulanten<br />
Suchtversorgung muss weiter durch regelhafte migrationsspezifische Aspekte<br />
erweitert werden, konsequenter Abbau von Zugangsbarriere durch<br />
Öffentlichkeitsarbeit<br />
→ Ein neuer Internetauftritt der gesamten Suchtabteilung steht kurz bevor. Dort<br />
wird die Transkulturelle Ambulanz einen eigenen Auftritt haben. Des Weiteren<br />
werden Flyerkonzeption und Öffentlichkeitsarbeit derzeit abteilungsumfassend<br />
überarbeitet.<br />
S.31 „Zur therapeutischen Qualitätssicherung ist es geplant, statistisch validierte<br />
türkischsprachige psychometrische Verfahren (Universitätsklinik Essen (<strong>LVR</strong>)<br />
und Universitätsklinik Ankara) wie das ASI, BDI und SCL 90 und SOGS (Spielsucht)<br />
einzusetzen.“<br />
→ Es konnten <strong>2008</strong> bereits zahlreiche Daten erhoben werden. Um eine ausreichend<br />
große Stichprobe zu erhalten, wird die Erhebung 2009 fortgeführt und<br />
ausgewertet<br />
9
6 Bericht „Programm für russischsprachige Migranten“<br />
Das psychosoziale Betreuungs- und Behandlungsprogramm für russischsprachige Migranten<br />
wurde <strong>2008</strong> in bereits bewährter Form fortgeführt. Die gemeinsame Betreuung und Behandlung<br />
des russischstämmigen Migrationspädagogen Josef Driter, der Sozialarbeiterin Marion<br />
Winterscheid, sowie der russischsprachigen Ärztin Katharina Pries versorgte im Jahr <strong>2008</strong><br />
15 Patienten, von denen zu Jahresbeginn 2009 weiterhin 13 am Behandlungsprogramm teilnehmen.<br />
In der offenen Gruppe, die wöchentlich stattfindet und durch den Migrationspädagogen<br />
und einen Arzt geleitet wird, werden insgesamt ca. 24 Patienten betreut.<br />
6.1 Multiprofessioneller und psychoedukativer Ansatz<br />
Das multiprofessionelle Team erlaubt eine systemische und umfassende Betreuung der Patienten.<br />
Dabei wird ein psychoedukativer Ansatz verfolgt, der darauf zielt, den Patienten zur<br />
Krankheitseinsicht zu verhelfen, ihnen die Behandlungs- und Therapiemöglichkeiten nahe zu<br />
legen und sie langfristig an weitere Suchthilfeangebote anzubinden.<br />
Herr Driter ist dabei als Vertrauensperson für die Patienten ein wichtiger Ansprechpartner<br />
und ermöglicht oft erst die konstruktive Zusammenarbeit von Patienten und Behandlern. Er<br />
stellt darüber hinaus eine Schnittstelle zwischen dem ambulanten und stationären Bereich<br />
der Abteilung für Suchterkrankungen und Psychotherapie dar, da er sowohl die Patienten<br />
aus dem Behandlungsprogramm betreut, wenn diese stationär aufgenommen werden müssen,<br />
als auch bei kulturellen und sprachlichen Verständigungsschwierigkeiten mit russischsprachigen<br />
Patienten auf den Stationen beratend hinzugezogen wird.<br />
6.2 Qualitätssicherung und Standardisierung<br />
Seit <strong>2008</strong> werden für die Patienten im russischsprachigen Programm Hilfepläne erstellt und<br />
regelmäßig (alle sechs Monate) fortgeschrieben. Damit ist eine kontinuierliche Überwachung<br />
und Verfolgung der Zielerreichung möglich.<br />
Da es sich bei den Patienten vorwiegend um „nicht wartezimmerfähige“ Patienten mit zusätzlichen<br />
gravierenden sozialen, wirtschaftlichen und familiären Problemen handelt, werden<br />
diese Ziele in kleinen Schritten verfolgt, wobei bisweilen auch der Erhalt des bisherigen Status<br />
mit großen Herausforderungen verbunden ist. Die Mitarbeiter des Teams stellen hier fest,<br />
dass ein Vergleich mit der Behandlung von deutschen Suchtpatienten nicht möglich ist.<br />
6.3 Offene Gesprächsgruppe für alkoholerkrankte russischsprachige Migranten<br />
An der offenen Gesprächsgruppe nehmen die Patienten des Behandlungsprogramms teil,<br />
aber auch russischsprachige Patienten, die sich stationär (vor allem in Haus 15) aufhalten<br />
und weitere ambulante Patienten. Insgesamt nahmen so im Jahr <strong>2008</strong> etwa 24 Patienten<br />
das Gruppenangebot war, wobei sich eine Stammgruppe von ca. 7-8 Patienten bildete. Mindestens<br />
vier Patienten können aufgrund von Schichtarbeit nicht regelmäßig an der Gruppe<br />
10
teilnehmen, nehmen an diesen Tagen jedoch vormittags Einzelgespräche mit Herrn Driter<br />
war.<br />
In der Gruppe besteht die Möglichkeit, medizinische Fragestellungen zu besprechen, im<br />
Vordergrund stehen jedoch meist Fragen zur familiären Situation, zum Arbeitsplatz und zum<br />
Leben mit der Alkoholerkrankung, sowie zu Themen der Einsamkeit. Für eine Gruppenteilnahme<br />
ist Alkoholintoxikation nicht erlaubt. Die Gruppe ermöglicht Gemeinschaftserlebnisse<br />
„ohne Alkohol“, sowie die Auseinandersetzung auch mit Themen, die nicht mit Alkohol verbunden<br />
sind.<br />
Herr Driter berichtet, dass die Gruppe sehr darauf abziele, zu vermitteln, was es heiße, mit<br />
einer Alkoholerkrankung zu leben und damit umzugehen, wozu eine emotionalere Ebene als<br />
das vielleicht in der „deutschen“ Behandlung üblich wäre, notwendig sei. Insbesondere vor<br />
dem Hintergrund der Verhaftung und Anzeige von Drogenkonsumenten in der ehemaligen<br />
Sowjetunion ist eine vertrauensvollen Beziehung Voraussetzung für eine erfolgreiche Behandlung.<br />
Im Jahr <strong>2008</strong> haben sich einige der Patienten der Gruppe signifikant stabilisiert. In einem Fall<br />
reduzierte sich beispielsweise eine stationäre Aufenthaltszahl von 7-8 Aufenthalten pro Jahr<br />
in den Jahren 2006 und 2007 auf Null, in einem anderen Fall ein täglicher Alkoholkonsum<br />
auf einen einzigen kurzen Rückfall im Jahr <strong>2008</strong>.<br />
6.4 Weitere Entwicklungen<br />
Ende <strong>2008</strong> wurde stationär mit Herrn Pavel Faybisovich ein Arzt aus den ehemaligen GUS<br />
eingestellt, der mit dazu beiträgt, russischsprachige Patienten abteilungsweit zu versorgen<br />
und die Auseinandersetzung mit kulturellen Hintergründen innerhalb der <strong>Klinik</strong>mitarbeiter<br />
anzuregen.<br />
7 Bericht „Programm für Migranten aus dem türkischsprachigen Kulturraum“<br />
Im Angebot für Migranten aus dem türkischsprachigen Kulturraum werden Menschen mit<br />
Abhängigkeitserkrankungen und Komorbiditäten vorwiegend aus dem türkischsprachigen<br />
Raum, aber auch aus einigen nordafrikanischen und arabischen Ländern behandelt. Das<br />
Team aus dem Arzt Dr. Erkan Kilic und der Arzthelfern Yüksel Özcan gewährleistet eine türkischsprachige<br />
und kultursensible Betreuung und Behandlung der Patienten vom ersten Anruf<br />
an.<br />
7.1 Patienten<br />
Von Herrn Dr. Kilic wurden im Jahr <strong>2008</strong> 247 Patienten behandelt, seit Beginn des Programms<br />
insgesamt 352 Patienten.<br />
11
Unter den Patienten spielen vor allem Alkohol und Nikotin eine große Rolle, aber auch Spielsucht,<br />
THC und vereinzelt, vorwiegend bei Frauen, Medikamentenabhängigkeiten sind anzutreffen.<br />
7.2 Spielsucht<br />
Rund 5,7 – 8,6% der Patientengruppe sind von Spielsucht betroffen, wobei die Dunkelziffer<br />
wesentlich höher einzuschätzen ist. Es wird beobachtet, dass – vermutlich in Zusammenhang<br />
mit der individuellen wirtschaftlichen Situation, sowie der globalen Finanzkrise – eine<br />
Suchtverlagerung hin zur Spielsucht stattfindet. Viele der Spielsüchtigen sind arbeitslos und<br />
kompensieren in der Sucht den Verlust von sozialem Status und wirtschaftlichen Möglichkeiten.<br />
Häufig sind exzessive Pokerrunden anzutreffen, sowie auch „der einarmige Bandit“ und<br />
andere Glücksspiele weit verbreitet sind.<br />
Im Februar <strong>2008</strong> wurde ein Gruppenangebot für türkischsprachige Spielsüchtige etabliert.<br />
Nach sechs Monaten wurde dieses wieder aufgelöst, da sich zeigte, dass die Compliance<br />
der Patienten zu gering war, um an einer solchen Gruppe teilzunehmen. Dies hinge zum Teil<br />
mit der kulturell bedingten Scham zusammen, die eine offene Therapierunde weniger effektiv<br />
macht. Die hohe Fluktuation führte letztlich zum Entschluss, das Gruppenangebot aufzulösen<br />
und die Patienten weiterhin in Einzelgesprächen zu betreuen.<br />
7.3 Statistische Erhebungen und Qualitätssicherung<br />
Im Rahmen des Strebens nach Qualitätssicherung und Standardisierung wurden verschiedene<br />
Instrumente, die in türkischer Sprache vorliegen, genutzt. So konnten in einem ersten<br />
Durchlauf bereits zahlreiche Daten mittels folgender Fragebögen erhoben werden: ASI (Eurepean<br />
Addiction Severity Index), SCL 90-R (Symptom-Checkliste von Derogatis), BDI<br />
(Beck-Depressionsinventar) und SOKTT (South Oaks kumar tarama testi [South Oaks<br />
Gambling Screen]). Um eine ausreichend große Anzahl für eine repräsentative Erhebung zu<br />
erhalten, wird die Erhebung aktuell fortgesetzt. Des Weiteren wird ein zweiter Durchlauf zur<br />
Überwachung des Behandlungsverlaufes durchgeführt.<br />
Parallel dazu hat die Auswertung der Daten, die im Laufe des Jahres 2009 abgeschlossen<br />
werden soll, begonnen.<br />
7.4 Weitere Aktivitäten<br />
Am 23.04.<strong>2008</strong> war Herr Dr. Kilic zu einem Vortrag in den Arbeitskreis Erwachsenenpsychiatrie<br />
der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft für den Rhein-Erft-Kreis in Hürth eingeladen.<br />
Er referierte zum Thema „Professionelles Verhalten in der Interkulturellen Psychiatrie“.<br />
Aktuell läuft in der Ambulanz der Abteilungen für Suchterkrankungen und Psychotherapie, zu<br />
der auch die Transkulturelle Ambulanz gehört, ein Auswahlverfahren für eine zweite tür-<br />
12
kischsprachige Arzthelferin, welche die Betreuung der türkischsprachigen Patienten unterstützen<br />
soll.<br />
8 Bericht „Angebot für polnischsprachige Migranten“<br />
Das Angebot für polnischsprachige Suchtkranke besteht seit 2007. Es handelt sich dabei um<br />
eine Gruppe, die von Klaudia Zantner (Dipl. Sozialarbeiterin) angeleitet wird und wöchentlich<br />
stattfindet.<br />
Im Jahre <strong>2008</strong> gab es eine Sommerpause in den Monaten Juni und Juli. Im November und<br />
Dezember fand die Gruppe nicht statt beziehungsweise wurde durch Einzelgespräche ersetzt,<br />
weil ein großer Teil der Kerngruppe sich zu diesem Zeitpunkt in einer Langzeittherapie-<br />
Behandlung befand. Im Januar 2009 wurde die Gruppe wieder aufgenommen und wird nun<br />
nach neuem Konzept durchgeführt.<br />
8.1 Methode<br />
Bislang lehnte sich die Gruppe methodisch an eine Selbsthilfegruppe im Stile der Anonymen<br />
Alkoholiker an, das heißt, es standen vor allem die Themen der Patienten im Vordergrund.<br />
Da dies mitunter vom eigentlichen Zweck der Gruppe abwich, und für Kontinuität, Verbindlichkeit<br />
und Motivation hinderlich war, wurde für 2009 eine Neustrukturierung der Gruppe im<br />
Stil einer Rückfallpräventionsgruppe konzipiert. Diese orientiert sich an dem modularen Aufbau<br />
der Rückfallprävention nach Joachim Körkel und Christine Schindler (2003) und weist<br />
ein strukturiertes Schema in 12 Modulen auf, wobei unter anderem Suchtdruck, der Umgang<br />
mit Rückfällen, emotionale und soziale Situation der Betroffenen berücksichtigt werden. Unabhängig<br />
der Struktur stehen weiterhin die jeweils individuellen Bedürfnisse der Teilnehmer<br />
im Mittelpunkt. Die einzelnen Module bauen nicht aufeinander auf, so dass ein Einstieg jederzeit<br />
möglich ist. Auch ein mehrmaliges Durchlaufen des Modulzyklus’ ist möglich und aufgrund<br />
der jeweiligen Anpassung an die Fragestellungen der Patienten nicht redundant.<br />
Neben der inhaltlichen Arbeit an ihrer Suchterkrankung wird der Neustrukturierung auch ein<br />
Verbindlichkeitstraining hinzugefügt. Dies erwartet von den Teilnehmern zum einen, dass sie<br />
zur Teilnahme an der Gruppe nüchtern sind (Null-Promille-Grenze), was durch Abpusten vor<br />
jedem Gruppentermin kontrolliert wird. Zum anderen bedeutet es, dass die Teilnehmer insgesamt<br />
nicht mehr als viermal pro Modulzyklus fehle dürfen und davon nicht mehr als dreimal<br />
in Folge. Es besteht jedoch die Möglichkeit, nach Ablauf des Zyklus’ wieder neu<br />
einzusteigen.<br />
13
8.2 Teilnehmer<br />
Im Laufe des Jahres <strong>2008</strong> nahmen insgesamt 16 Patienten am Gruppenangebot teil. Dabei<br />
besteht ein konstanter Kern von fünf Patienten, der jeweils von durchschnittlich ca. zwei stationären<br />
Patienten und eventuell unregelmäßig dazu stoßenden externen Patienten erweitert<br />
wird.<br />
Warum die elf Patienten neben der Kerngruppe nicht regelmäßig oder nur während ihrer<br />
stationären Zeit an der Gruppe teilnahmen, kann nicht vollständig beantwortet werden. Drei<br />
dieser Patienten jedoch stammen aus dem Rhein-Sieg-Kreis und können aus finanziellen<br />
Gründen (ARGE-Empfänger) und aus Gründen der unzureichenden Anbindung an den<br />
ÖPNV nicht wöchentlich nach <strong>Bonn</strong> kommen. Ein Patient verstarb. Des Weiteren werden<br />
Gründe wie Rückfall, Saisonarbeit, Schwarzarbeit und Heimreise genannt.<br />
8.3 Weitere Aktivitäten<br />
Frau Zantner übernimmt innerhalb der Abteilung auf allen Stationen Übersetzungs- und Beratungsdienste<br />
in psychosozialen Angelegenheiten. Dazu wird sie durchschnittlich etwa zwei<br />
Mal im Monat angefragt. Bislang war sie dabei meist auf den Akutstationen im Haupthaus,<br />
wobei meist die Klärung der Krankenkassenversicherung und der Finanzierung des <strong>Klinik</strong>aufenthaltes<br />
im Mittelpunkt stehen. Dabei sieht sich die <strong>LVR</strong>-<strong>Klinik</strong> immer wieder dem<br />
Problem von Patienten mit Touristenvisum und/ oder ohne gültige Krankenversicherung gegenübergestellt.<br />
Für diese, oft besonders hilfebedürftigen Patienten kann deshalb nur eine<br />
Notfallversorgung geleistet werden.<br />
Zusätzlich unterstützt Frau Zantner mündlich die Nachsorgeplanung. Wünsche auf Patientenseite<br />
sind dabei oft die konkrete Nachsorgeklärung, insbesondere mit polnischsprachigen<br />
Angeboten, da die deutsche Sprache als Therapiesprache oft ein Hindernis darstellt. Eine<br />
Refinanzierung für diese zusätzlichen Aufgaben ebenso wie für das bereits bestehende<br />
Gruppenangebot ist derzeit noch nicht erfolgt.<br />
Das stationäre Behandlungsteam berichtet oft, dass die Sprachprobleme ein Hindernis für<br />
die Anamnese darstellen. Durch die Übersetzungsarbeit werden so neue anamnetische Befunde<br />
gewonnen. Insbesondere in Bezug auf soziale Fragen seien manche polnischsprachige<br />
Patienten den deutschen Sozialarbeitern und Ärzten nicht so offen gegenüber, weil viele<br />
schwarzarbeiten, und allgemein die Weiterleitung von Daten fürchten. Frau Zantner gegenüber<br />
besteht häufig ein größeres Vertrauen, aber auch sie wird als <strong>Klinik</strong>mitarbeiterin oft<br />
schon parteiisch betrachtet, was ein gewisses Misstrauen zur Folge haben kann.<br />
14
9 Zukünftige Weiterentwicklung, weiterführende Ziele, Ausblick<br />
Ziele und Aufgaben für das neue Jahr sind die zum einen die kontinuierliche Weiterarbeit an<br />
den bestehenden Projekten, die Qualitätsverbesserung und Fortschreibung, wie sie an voran<br />
gegangen Stellen dieses Berichtes bereits dargestellt wurde, sowie die Orientierung an den<br />
Sonnenberger Leitlinien (vgl. <strong>Jahresbericht</strong> 2007; Machleidt o.J.) und die Fokussierung auf<br />
quantifizierbare Wirksamkeitsnachweise. Des Weiteren wird eine Ausweitung des Angebots<br />
für polnischsprachige Patienten im Sinne eines Behandlungsprogramms, sowie dessen Refinanzierung<br />
angestrebt.<br />
Besonderes Augenmerk liegt darauf, die Erfahrungen in der interkulturellen Beratung und<br />
Behandlung innerhalb der Abteilung und innerhalb der <strong>Klinik</strong> weiter zu tragen. Für das Jahr<br />
2009 wird ein transkulturelles Fest geplant.<br />
Für die Transkulturelle Ambulanz selbst ist das wichtigste Ziel jedoch eine konzeptionelle<br />
Neuorientierung, die auf der Zusammenführung der drei Einzelprojekte im Jahr <strong>2008</strong> beruht.<br />
Es wird ein Konzept erarbeitet werden, das jedem Teilprojekt weiterhin individuelle Qualitäten<br />
einräumt und darüber hinaus die Verknüpfung dieser Teilprojekte sowie die breitere<br />
Beschäftigung mit der Thematik „Migration und Sucht“ plant und entwickelt. Dabei spielen<br />
unter anderem auch eine permanente Evaluierung mit standardisierten Instrumenten der<br />
Psychiatrie sowie die Weiterentwicklung von spezifischen und innovativen Behandlungskonzepten<br />
für suchtkranke Migranten eine Rolle.<br />
Wichtig sind dabei die strategischen Planungen im Kontext gesamtgesellschaftlicher, klinikweiter,<br />
medizinischer und allgemeiner Entwicklungen, aber auch die jeweils aktuellen organisatorischen,<br />
finanziellen und personellen Situationen, die die Transkulturelle Ambulanz stetig<br />
vor neue Herausforderungen stellen.<br />
Die Mitarbeiter der Transkulturellen Ambulanz danken der Stadt <strong>Bonn</strong> für die Unterstützung,<br />
für das Vertrauen und die gute, unkomplizierte Zusammenarbeit!<br />
Literatur<br />
BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) (<strong>2008</strong>): Ausländerzahlen 2007.<br />
http://www.bamf.de/cln_092/nn_442496/SharedDocs/Anlagen/DE/DasBAMF/Downlo<br />
ads/Statistik/statistik-anlage-teil-2-auslaendezahlen-auflage14,templateId=raw,proper<br />
ty=publicationFile.pdf/statistik-anlage-teil-2-auslaendezahlen-auflage14.pdf<br />
[06.02.2009].<br />
Banger, Markus (<strong>2008</strong>): Aufbau einer kultursensiblen Behandlung Suchtkranker. In: Junglas,<br />
Jürgen (Hrsg.): Kultur der Therapie der Kulturen. Psychotherapie und Psychiatrie mit<br />
15
Migrationshintergund [Beiträge zur allgemeinen PSYCHOtherapie 6]. <strong>Bonn</strong>: Deutscher<br />
Psychologen Verlag, S.162-167.<br />
Banger, Markus et al. (2006): Zwischenbericht zum Jahr 2006. Migrationsprojekt in den<br />
Rheinischen <strong>Klinik</strong>en <strong>Bonn</strong>.<br />
Banger, Markus et al. (2007): <strong>Jahresbericht</strong> 2007. Interkulturelle Ambulanz in den Rheinischen<br />
<strong>Klinik</strong>en <strong>Bonn</strong>.<br />
Czycholl, Dietmar (2002): Sucht und Migration – ein Zusammenhang. In: Landeszentrale für<br />
Gesundheit in Bayern e.V. (Hrsg.): Sucht und Migration. Suchtprävention und -arbeit<br />
mit Menschen aus der GUS. Drittes Bayerisches Forum Suchtprävention der Landeszentrale<br />
für Gesundheit in Bayern e.V. München, S. 3-13.<br />
Finkelstein, Kerstin F. (2006): Eingewandert. Deutschlands „Parallelgesellschaften“. <strong>Bonn</strong>:<br />
Bundeszentrale für politische Bildung.<br />
Hausotter, Wolfgang / Schouler-Ocak, Meryam (2007): Begutachtung bei Menschen mit<br />
Migrationshintergrund unter medizinischen und psychologischen Aspekten. München,<br />
Jena: Urban&Fischer Verlag.<br />
Hepp, Andreas (2006): Transkulturelle Kommunikation. Konstanz: UVK.<br />
Hinnekamp, Volker (1994): Einleitung: Interkulturelle Kommunikation. http://www.hs-fulda.de/<br />
fileadmin/Fachbereich_SK/Professoren/Hinnenkamp/Einleitung_Interkulturelle_Komm<br />
unikation.pdf [25.01.2009].<br />
Junglas, Jürgen (<strong>2008</strong>): Psychotherapie und Psychiatrie mit Migrationshintergrund: Kultur<br />
der psychoTHERAPIE der Kulturen. In: Junglas, Jürgen (Hrsg.): Kultur der Therapie<br />
der Kulturen. Psychotherapie und Psychiatrie mit Migrationshintergrund. Beiträge zu<br />
allgemeinen PSYCHOtherapie 6. <strong>Bonn</strong>: Deutscher Psychologenverband, S.7-56.<br />
Körkel, Joachim / Schindler, Claudia (2003): Rückfallprävention mit Alkoholabhängigen. Ein<br />
strukturiertes Trainingsprogramm. Berlin, Heidelberg, New York et al.: Springer.<br />
LDS NRW (Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik) (<strong>2008</strong>): Ausländische Bevölkerung<br />
in Nordrhein-Westfalen am 31.Dezember 2007. Düsseldorf.<br />
Machleidt, Wielant (o.J.): Ausgangslage und Leitlinien transkultureller Psychiatrie in Deutschland.<br />
http://www.psychiatrie.de/data/downloads/3b/00/00/Beitrag_Machleidt.pdf<br />
[11.02.2009].<br />
Matoba, Kazuma / Scheible, Daniel (2007): Interkulturelle und Transkulturelle Kommunikation.<br />
Working Paper of International Society for Diversity Management e.V. No. 3<br />
Robert Koch-Institut (in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Bundesamt) (<strong>2008</strong>): Migration<br />
und Gesundheit. Schwerpunktbericht der Gesundheitsberichterstattung des Bundes.<br />
Berlin: Robert Koch-Institut.<br />
Sinus Sociovision (<strong>2008</strong>): Zentrale Ergebnisse der Sinus-Studie über Migranten in Deutschland.<br />
http://www.sinus-sociovision.de/Download/ZentraleErgebnisse0912<strong>2008</strong>.pdf<br />
[06.02.1009].<br />
Spiske, Karoline / Kilic, Erkan (<strong>2008</strong>): Suchterkrankungen bei türkischsprachigen Patienten.<br />
In: Junglas, Jürgen (Hrsg.): Kultur der Therapie der Kulturen. Psychotherapie und<br />
Psychiatrie mit Migrationshintergund [Beiträge zur allgemeinen PSYCHOtherapie 6].<br />
<strong>Bonn</strong>: Deutscher Psychologen Verlag, S.158-161.<br />
Statistisches Bundesamt (<strong>2008</strong>): Ausländische Bevölkerung [zum 31.12.2007].<br />
http://www.statistik-portal.de/Statistik-Portal/de_jb01_jahrtab2.asp [31.12.<strong>2008</strong>].<br />
Welsch, Wolfgang (1995): Transkulturalität. http://www.forum-interkultur.net/uploads/tx_textd<br />
b/27.pdf [22.01.2009].<br />
16